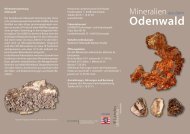Darmstadt - Hessisches Landesmuseum
Darmstadt - Hessisches Landesmuseum
Darmstadt - Hessisches Landesmuseum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Eine Großkopfechse im Hessischen <strong>Landesmuseum</strong><br />
<strong>Darmstadt</strong><br />
»Großkopfechse«, Ornatocephalus metzleri, Detail des Schädels<br />
Das hlmd hat eine der ältesten und weltweit bedeutendsten<br />
Messel-Sammlungen und führt seit 1966 planmäßige<br />
Grabungen im unesco-Weltnaturerbe-Denkmal durch.<br />
Dabei werden auch heute noch bedeutende Funde entdeckt.<br />
So wurde bei der letztjährigen Grabungskampagne eine<br />
hervorragend erhaltene Großkopfechse entdeckt. Diese<br />
Reptilien sind sogar noch seltener als die berühmten<br />
»Urvögel« (Archaeopteryx). Der Neufund hat eine Kopf-<br />
Schwanzlänge von stattlichen 91,39 cm und ist bis auf die<br />
Schwanzspitze und die Finger der rechten Hand vollständig.<br />
Die Erhaltung ist hervorragend, sogar der Hautschatten<br />
und kleinere Reste des »Mageninhalts« sind an<br />
manchen Stellen zu sehen. Neben dem Holotyp dürfte es<br />
sich um das beste Exemplar dieser Art handeln.<br />
Die Großkopfechsen sind bislang nur aus der Grube Messel<br />
bekannt. Der Gattungsname bezieht sich auf das auffällig<br />
skulpturierte Schädeldach, der Artname ehrt einen<br />
Donatoren. Systematisch werden sie zu den Scincoidea<br />
gestellt, eine Überfamilie, zu der neben den echten<br />
Skinken unter anderem auch unsere heimischen Eidechsen<br />
gehören. Unter den heutigen Formen kann man sie noch<br />
am ehesten mit dem Smaragdwaran (Varanus prasinus)<br />
oder dem Schwarzen Baumwaran (Varanus beccarii) vergleichen.<br />
Der lange Greifschwanz in Kombination mit den<br />
stark gekrümmten Krallen an den Vorder- und Hinterextremitäten<br />
sowie das Fehlen von Hautverknöcherungen<br />
am Körper sprechen für eine baumgebundene Lebensweise.<br />
Das stark gepanzerte Schädeldach machte den Kopf<br />
wahrscheinlich relativ unbeweglich, so dass die Tiere<br />
wohl keine flinken und effektiven Jäger waren, sondern<br />
sich eher von Pflanzen und Insekten ernährt haben<br />
dürften. Der hier vorgestellte Fund war am 07.08.2012 von<br />
einem unserer studentischen Grabungspraktikanten entdeckt<br />
worden. Die schwierige Präparation wurde in bewährter<br />
Weise von Eric Milsom übernommen.<br />
Verantwortlich:<br />
Dr. Norbert Micklich<br />
Telefon 0 6151| 16 57 42<br />
E-Mail: norbert.micklich@hlmd.de<br />
15<br />
Museum forscht