Anhang - Ronald Haselsteiner
Anhang - Ronald Haselsteiner
Anhang - Ronald Haselsteiner
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 1<br />
<strong>Anhang</strong><br />
1.1 – Arbeits- und Forschungstätigkeit (Antrag, 28.11.2002) ..............................................4<br />
1.2 – Zusammensetzung des Forschungsbeirates..............................................................5<br />
2.1 – Liste der Wasserwirtschaftsämter in Bayern ..............................................................6<br />
2.2 – Auswahl von 17 Gewässern für weitere Auswertung .................................................6<br />
2.3 – Liste der betroffenen 72 Gewässer.............................................................................6<br />
2.4 – Übersicht der Zustandsanalysetätigkeit......................................................................7<br />
2.5 – Zustandsanalyse von Deichen in Bayern an Gewässern I. Ordnung .........................8<br />
2.6 – Zustandsanalyse der Deiche in Bayern ......................................................................9<br />
2.7 – Deichstrecken an den bayerischen Wasserwirtschaftsämtern .................................13<br />
2.8 – Auswertung „Wasserwirtschaftsämter“ .....................................................................14<br />
2.9 – Deichstrecken an den bayerischen Gewässern 1. Ordnung ....................................15<br />
2.10 – Auswertung „Gewässer“ .........................................................................................16<br />
2.11 – Ertüchtigungsbedarf in Bayern ...............................................................................17<br />
4.1 – Einwirkungen, Schadensursachen und Schäden .....................................................18<br />
5.1 – Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054 (2003).........................................................19<br />
5.2 – Kenngrößen nichtbindiger Böden nach E DIN 1055-2 (2003) ..................................20<br />
5.3 – Kenngrößen bindiger Böden nach E DIN 1055-2 (2003)..........................................21<br />
6.1 – Erhebung von 20 Deichsanierungsarbeiten* in Bayern ............................................22<br />
6.2 – Liste der erhobenen Maßnahmen.............................................................................23<br />
6.3 – Kontaktadressen / Ansprechpartner der Wasserwirtschaftsämter............................24
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 2<br />
6.4 – Histogramme: Einheitspreise für Erdarbeiten – Oberbodenarbeiten ........................26<br />
6.5 – Histogramme: Einheitspreise für Erdarbeiten – Bodenarbeiten................................27<br />
6.6 – Beispiel 01: Aiblinger Au...........................................................................................28<br />
6.7 – Beispiel 02: Vagen....................................................................................................35<br />
6.8 – Beispiel 03: Schweinfurt Süd....................................................................................39<br />
6.9 – Beispiel 04: Thalkirchen (Isar-Plan)..........................................................................48<br />
6.10 – Beispiel 05: Grassau...............................................................................................58<br />
6.11 – Beispiel 06: Tittmoning – Fridolfing.........................................................................63<br />
6.12 – Beispiel 07: Sofortmaßnahmen bei Tittmoning, Fridolfing und Laufen ...................68<br />
6.13 – Beispiel 08: Pähl – Wielenbach ..............................................................................72<br />
6.14 – Beispiel 09: Mariaposching.....................................................................................76<br />
6.15 – Beispiel 10: Sulzbach (Rücklaufdeich) ...................................................................82<br />
6.16 – Beispiel 11: Stoegermühlbach ................................................................................86<br />
6.17 – Beispiel 12: Aicha – Mühlham ................................................................................91<br />
6.18 – Beispiel 13: Vohburg...............................................................................................97<br />
6.19 – Beispiel 14: Wackerstein – Dünzing (Pionierübungsplatz) ...................................102<br />
6.20 – Beispiel 15: Neustädter Brücke / Vohburg............................................................106<br />
6.21 – Beispiel 16: Probierlweg .......................................................................................111<br />
6.22 – Beispiel 17: Mailing...............................................................................................118<br />
6.23 – Beispiel 18: Schlösslwiese – Neuburg an der Donau ...........................................125<br />
6.24 – Beispiel 19: Untermaiselstein – Immenstadt.........................................................132<br />
6.25 – Beispiel 20: Rauhenzell – Immenstadt .................................................................139<br />
7.1 – Freibordberechnung (Tabellen) ..............................................................................145<br />
7.2 – MIP-Verfahren (Fa. Bauer Spezialtiefbau GmbH) ..................................................146
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 3<br />
7.3 – FMI-Verfahren (Fa. Sidla & Schönberger) ..............................................................150<br />
8.1 – Übersicht – Verfahren der Geophysik (Erdoberfläche)...........................................153<br />
8.2 – Übersicht – Verfahren der Geophysik (Bohrloch) ...................................................154<br />
10.1 – Versuchsstand (Detail) .........................................................................................155<br />
10.2 – Durchlässigkeitszelle (Detail)................................................................................155<br />
10.3 – Liste der entnommenen Proben von Grasnarben aus Deichen an der Mangfall<br />
(Versuchsreihe I) .............................................................................................................156<br />
10.4 – Fotos der Standorte der Entnahme von Grasnarbenproben ................................157<br />
10.5 – Fotodok. II: Oberflächen der Grasnarbenproben 1 bis 8 ......................................158<br />
10.6 – Fotodok. II: Oberflächen der Grasnarbenproben 9 bis 16 ....................................159<br />
10.7 – Fotodok. II: Oberflächen der Grasnarbenproben 17 bis 24 ..................................160<br />
10.8 – Ergebnistabelle der Versuchsreihen I und II.........................................................161<br />
11.1 – Liste der Bäume der Gefahrenklasse 1 ................................................................162<br />
11.2 – Liste der Bäume und Sträucher der Gefahrenklasse 2.........................................163<br />
11.3 – Listen der Sträucher und kleinen Bäume der Gefahrenklasse 3 und 4 ................164<br />
11.4 – Übersichtstabelle zu Gehölzen .............................................................................165<br />
11.5 – Hinweise zu Gehölzen auf Deichen......................................................................166<br />
12.1 – Durchstanzberechnungen von Dichtungen bei Wurzelbeanspruchung................168<br />
13.1 – Sättigungsverhältnisse bei den Beregnungsversuchen........................................169<br />
13.2 – Übersichtstabelle der Ergebnisse der Durchsickerungsversuche ........................170<br />
14.1 – Kurzzusammenfassung (Präsentation).................................................................171<br />
14.2 – Hinweise zu Ertüchtigungs- / Sanierungsmaßnahmen von Deichen an<br />
Fließgewässern in Bayern ...............................................................................................172
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 4<br />
1.1 – Arbeits- und Forschungstätigkeit (Antrag, 28.11.2002)<br />
Kennung Arbeitstätigkeit<br />
A 1 Zustandsanalyse von Deichen<br />
A 2 Sammlung bisheriger Schadensfälle<br />
A 3 Studium der Versagensformen<br />
A 4 Sammlung Sanierungsmaßnahmen<br />
A 5 Literaturvergleich<br />
B 1 Bewertung vom Stand der Technik<br />
B 2 Alternative Sanierungsmethoden<br />
C 1 Formulierung von „neuen“ Anforderungen / Sanierungsstandard<br />
C 2 Standardisiertes Vorgehen<br />
D Begleitende Berechnungen<br />
F 1 Hohlräume und Wurzeln im Boden<br />
F 2 Gehölze auf Deichen<br />
F 3 Durchwurzelung von Dichtungselementen<br />
F 4 Durchsickerung von Deichen
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 5<br />
1.2 – Zusammensetzung des Forschungsbeirates<br />
1 Markus<br />
Name Titel Firma Ort Email<br />
Aufleger<br />
2 Anton<br />
Fischer<br />
3 <strong>Ronald</strong><br />
4 Frank<br />
<strong>Haselsteiner</strong><br />
Kleist<br />
5 Reiner<br />
Mößmer<br />
6 Alexander<br />
Neumann<br />
7 Martin<br />
Rau<br />
Privatdozent<br />
Dr.-<br />
Ing. habil.<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau<br />
und Wasserwirtschaft<br />
Technische Universität München<br />
Prof. Dr. Fachgebiet: Geobotanik / Fakultät für<br />
Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement<br />
/ WZW / TU München<br />
Dipl.-Ing. Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau<br />
und Wasserwirtschaft<br />
Technische Universität München<br />
Dr.-Ing. Ingenieurbüro SKI + Partner<br />
Ltd. FD<br />
Dr.<br />
Bayerische Landesanstalt für Wald und<br />
Forstwirtschaft<br />
BOR Bayerisches Staatsministerium für<br />
Landesentwicklung und Umweltfragen<br />
Abteilung 5 – Wasserwirtschaft / Referat<br />
551<br />
Obernach /<br />
Walchensee<br />
m.aufleger@bv.tum.de<br />
Freising A.Fischer@wzw.tum.de<br />
München r.haselsteiner@bv.tum.de<br />
München kleist@ski-ing.de<br />
Freising moe@lwf.uni-muenchen.de<br />
München alexander.neumann@stmlu.bayern.de<br />
Dipl.-Ing. E.ON Wasserkraft GmbH Landshut martin.rau@eon-energie.com<br />
8 Rogowski WWA Deggendorf Deggendorf<br />
9 Manfred<br />
Stocker<br />
10 Franz<br />
Rasp<br />
11 Theodor<br />
Strobl<br />
12 Herbert<br />
Weiß<br />
Dr.-Ing. Bauer Spezialtiefbau GmbH Schroben-<br />
hausen<br />
manfred.stocker@bauer.de<br />
BR Wasserwirtschaftsamt Rosenheim Rosenheim franz.rasp@wwa-ro.bayern.de<br />
Univ.-<br />
Prof. Dr.-<br />
Ing.<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau<br />
und Wasserwirtschaft<br />
Technische Universität München<br />
BD Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft<br />
(LfW)<br />
Abteilung 4 – Referat 42<br />
München t.strobl@bv.tum.de<br />
München herbert.weiss@lfw.bayern.de
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
2.1 – Liste der Wasserwirtschaftsämter<br />
in Bayern<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 6<br />
1 Amberg (AM) 13 Landshut (LA)<br />
2 Ansbach (AN) 14 München (M)<br />
3 Aschaffenburg (AB) 15 Nürnberg (N)<br />
4 Bamberg (BA) 16 Passau (PA)<br />
5 Bayreuth (BT) 17 Pfarrkirchen (PAN)<br />
6 Deggendorf (DEG) 18 Regensburg (R )<br />
7 Donauwörth (DON) 19 Rosenheim (RO)<br />
8 Freising (FS) 20 Schweinfurt (SW)<br />
9 Hof (HO) 21 Traunstein (TS)<br />
10 Ingolstadt (IN) 22 Weiden (WEN)<br />
11 Kempten (KE) 23 Weilheim (WM)<br />
12 Krumbach (KRU) 24 Würzburg (WÜ)<br />
2.3 – Liste der betroffenen 72 Gewässer<br />
2.2 – Auswahl von 17 Gewässern<br />
für weitere Auswertung<br />
1 Ammer 10 Main<br />
2 Amper 11 Mangfall<br />
3 Donau 12 Paar<br />
4 Heng. Ohe 13 Salzach<br />
5 Iller 14 Schmutter<br />
6 Isar 15 TirolerAche<br />
7 Isen 16 Vils<br />
8 Lech 17 Zusam<br />
9 Loisach 18 Sonstige<br />
1 Abens 16 Heng. Ohe 31 Laber 46 Randkanal 61 Stögermühlbach<br />
2 Ainbrach 17 Herzogbach 32 Lech 47 Regnitz 62 Sulzbach<br />
3 Aiterach 18 Hinanger Bach 33 Loisach 48 Rodach 63 TirolerAche<br />
4 Alte Donau 19 Hochrainebach 34 Main 49 Rott 64 Traun<br />
5 Alz 20 Iller 35 Mangfall 50 Saalach 65 Vils<br />
6 Ammer 21 Ilm 36 MD-Kanal 51 Saale 66 W Main<br />
7 Amper 22 Inn 37 Mettenbach 52 Sächsische Saale 67 Waldnaab<br />
8 Angerbach 23 Irlbach 38 Mindel 53 Salzach 68 Waldnaab-Flutkanal<br />
9 Bogenbach 24 Isar 39 Mühlbach 54 Schmutter 69 Wertach<br />
10 Donau 25 Isen 40 Nau 55 Schwaig-Isar 70 Wiesent<br />
11 Egelseebach 26 Itz 41 Neßlbach 56 Sinn 71 Wörnitz<br />
12 Flutmulde 27 Kinsach 42 Osterbach 57 Sinwag 72 Zusam<br />
13 Gr. Laber 28 Kl. Donau 43 Paar 58 Spitzraingraben<br />
14 Günz 29 Kl. Laber 44 Pfellinger Bach 59 Steinach<br />
15 H-Bach 30 Kößnach 45 R Main 60 Stögermühlbach
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 7<br />
2.4 – Übersicht der Zustandsanalysetätigkeit<br />
Übersicht der ausgewerteten Parameter<br />
Zustandserfassung (LfW)<br />
Nr. Parameter<br />
1. Schlüssel<br />
2. Wasserwirtschaftsamt (Auswertungsbasis)<br />
3. Interne Nummerierung<br />
4. Gewässer (Auswertungsbasis)<br />
5. Bauwerk<br />
6. Flussufer<br />
Gesamtbayern<br />
Auswertung<br />
7. Fluss-km Parameter Einheit<br />
8. Länge (Auswertungseinheit) x x x 1 Deichstrecke km<br />
9. Schutzfunktion x x x 2 Schutzfunktion -<br />
10. Baujahr x x x 3 Baujahr z. B. 1976<br />
11. Sanierungsjahr x x x 4 Sanierung<br />
12. Unterhaltspflicht (Unterhalt) x x x 5 Pflicht Unterhalt<br />
13. Unterhaltspflicht (Erneuerung) x x x 6 Pflicht Erneuerung<br />
14. Geringste Deichhöhe x x x 7 minimale Deichhöhe m<br />
15. Größte Deichhöhe x x x 8 maximale Deichhöhe m<br />
16. Jährlichkeit des Bemessungshochwassers (BHW) x x x 9 Jährlichkeit von BHW z. B. 100<br />
17. Kleinstes Freibordmaß x x x 10 Freibord m<br />
18. Deichkronenbreite im Mittel x x x 11 Kronenbreite m<br />
19. Landseitige Deichwege bzw. Kronenweg x x x 12 Lage Deichweg -<br />
20. Böschungsneigung x x x 13/14 Böschungsneigungen 1 : n<br />
21. Dichtungsart x x x 15 Dichtungsart -<br />
22. Deichbaustoff x x x 16 Deichbaustoff -<br />
23. Dichtungsbaustoff x x x 17 Dichtungsbaustoff -<br />
24. Deichentwässerung x x x 18 Entwässerungsart -<br />
25. Sicherung wasserseitige Deichoberfläche<br />
26. Vegetation auf der Wasserseite x x x 19 Vegetation (wassers.) -<br />
27. Landseitige Vegetation x x x 20 Vegetation (lands.) -<br />
28. Bibergefährdung x x x 21 Bibergefährdung -<br />
29. Biberschutz x x x 22 Biberschutzmaßnahmen -<br />
30. Oberste Bodenschicht des Untergrundes x x x 23 Deichuntergrund -<br />
31. Eigentumsverhältnisse x x x 24 Eigentumsverhältnisse -<br />
32. Entspricht das BHW der definierten Schutzfunktion? x x x 25 Bemessung auf richtiges BHW -<br />
33. Standsicherheitsnachweis vorhanden? x x x 26 Standsicherheit gegeben -<br />
34. Entspricht der Freibord den a.a.R.d.T.? x x x 27 Freibord ausreichend -<br />
35. Ist der Deichweg für die Deichverteidigung geeignet? x 28 Deichweg zu DV vorhanden -<br />
36. Jahr der letzten Deichschau x 29 Jahr der Deichschau -<br />
37. Entspricht der Deich den a.a.R.d.T.? x 30 a.a.R.d.T. erfüllt -<br />
38. Besteht Handlungsbedarf? x 31 Handlungsbedarf -<br />
39. Prioritäten von Sanierung/Neubau x 32 Priorität einer Maßnahme -<br />
40. Anzahl der Deichabschnitte<br />
41. Verweise auf Bild- / Videodokumente<br />
42. Verweise auf Verknüpfungen mit anderen Projekten<br />
43. Beendigung der Sanierungs- / Baumaßnahme x 33 Sanierungs- / Baujahr -<br />
44. Beginn Sanierungs- / Baumaßnahme<br />
45. voraussichtlicher Beginn der Sanierungs- / Baumaßnahme<br />
46. Sind hydrologische Untersuchungen notwendig?<br />
47. Sind hydraulische Untersuchungen notwendig?<br />
48. Sind geotechnische Untersuchungen notwendig?<br />
49. Ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich?<br />
50. Eventuell erforderlicher Grunderwerb?<br />
51. Kosten für hydrologische Untersuchungen<br />
52. Kosten für hydraulische Untersuchungen<br />
53. Kosten für geotechnische Untersuchungen<br />
54. Kosten für Standsicherheitsnachweis<br />
55. Kosten für Grunderwerb<br />
x<br />
34 Kosten<br />
€<br />
56. Baukosten<br />
57. Seit 1998 ausgegebene Sanierungskosten<br />
58. Gesamtkosten im Kalenderjahr<br />
59. Gesamtkosten<br />
Wasserwirtschaftsämter<br />
Gewässer<br />
Interne Nr.
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für <strong>Anhang</strong> 8<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft<br />
DEICHSANIERUNG x<br />
Endbericht<br />
2.4 - Übersicht der Analysetätigkeit zum Zustand der Deiche in Bayern (Auswertungsübersicht)<br />
Ausgewertete Daten Deichstrecke [km]<br />
1<br />
1-1<br />
Schutzfunktion<br />
2<br />
2-1<br />
Baujahr<br />
3<br />
Sanierung<br />
4<br />
4-1<br />
4-2<br />
Pflicht Unterhalt<br />
5<br />
Pflicht Erneuerung<br />
6<br />
min. Deichhöhe<br />
7<br />
max. Deichhöhe<br />
8<br />
HQ b<br />
9<br />
Freibord [m]<br />
10<br />
10-1<br />
Kronenbreite [m]<br />
11<br />
Lage vom Deichweg<br />
12<br />
Neigungen (wassers.) [1:n]<br />
13<br />
13-1<br />
Neigungen (lufts.) [1:n]<br />
14<br />
Dichtungsart<br />
15<br />
15-1<br />
A Bayern<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
B Wasserwirtschaftsämter x<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
Amberg (AM)<br />
Ansbach (AN)<br />
Aschaffenburg (AB)<br />
Bamberg (BA)<br />
Bayreuth (BT)<br />
Deggendorf (DEG)<br />
Donauwörth (DON)<br />
Freising (FS)<br />
Hof (HO)<br />
Ingolstadt (IN)<br />
Kempten (KE)<br />
Krumbach (KRU)<br />
Landshut (LA)<br />
München (M)<br />
Nürnberg (N)<br />
Passau (PA)<br />
Pfarrkirchen (PAN)<br />
Regensburg (R )<br />
Rosenheim (RO)<br />
Schweinfurt (SW)<br />
Traunstein (TS)<br />
Weiden (WEN)<br />
Weilheim (WM)<br />
Würzburg (WÜ)<br />
C Gewässer x<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
Ammer<br />
Amper<br />
Donau<br />
Heng. Ohe<br />
Iller<br />
Isar<br />
Isen<br />
Lech<br />
Loisach<br />
Main<br />
Mangfall<br />
Paar<br />
Salzach<br />
Schmutter<br />
TirolerAche<br />
Vils<br />
Zusam<br />
Sonstige (54)<br />
Kategorien<br />
HQ b<br />
Sanierungsjahr<br />
Sanierungs- / Baujahr<br />
Freibord ausreichend<br />
Standsicherheit gegeben<br />
Dichtungsart<br />
15-2 Entwässerungsart<br />
Deichbaustoff<br />
16<br />
Dichtungsart<br />
16-1<br />
16-2 Dichtungsbaustoff<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
Dichtungsbaustoff<br />
17<br />
Entwässerungsart<br />
18<br />
Auswertung vorgenommen<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />
Vegetation (wassers.)<br />
19<br />
Vegetation (lufts.)<br />
20<br />
Bibergefährdung<br />
21<br />
Biberschutzmaßnahmen<br />
21-1<br />
Biberschutzmaßnahmen<br />
22<br />
Deichuntergrund (oberste<br />
Schicht)<br />
23<br />
Dichtungsart<br />
24-1<br />
Eigentumsverhältnisse<br />
24<br />
Ausdruck(e) vorhanden<br />
Bemessung auf ein HQ b<br />
25<br />
HQ b<br />
25-1<br />
Standsicherheit gegeben<br />
26<br />
Freibord ausreichend<br />
27<br />
Deichweg vorhanden<br />
28<br />
Lage vom Deichweg<br />
28-1<br />
Deichschau nach Art. 68<br />
BayWG<br />
29<br />
a.a.R.d.T. erfüllt<br />
30<br />
Handlungsbedarf<br />
30-1<br />
Handlungsbedarf<br />
31<br />
Priorität einer Maßnahme<br />
31-1<br />
Priorität einer Maßnahme<br />
32<br />
Sanierungs- / Baujahr<br />
33<br />
Kosten<br />
34
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 9<br />
2.6 – Zustandsanalyse der Deiche in Bayern<br />
Diagramme für die Auswertung von Gesamtbayern<br />
Diagramm 1:<br />
Schutzfunktion<br />
der Deiche<br />
Diagramm 2:<br />
Baujahr der<br />
Deiche<br />
Diagramm 3:<br />
Sanierungsjahr<br />
der sanierten<br />
Deiche<br />
Anteil der Deichstrecke [%]<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
1850-<br />
1860<br />
Anteil der Deichstrecke [%]<br />
B<br />
77%<br />
1861-<br />
1870<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
k. A.<br />
0%<br />
1871-<br />
1880<br />
1910-<br />
1920<br />
V<br />
2%<br />
1881-<br />
1890<br />
1891-<br />
1900<br />
1921-<br />
1930<br />
LV<br />
0%<br />
1901-<br />
1910<br />
1931-<br />
1940<br />
1911-<br />
1920<br />
1941-<br />
1950<br />
L<br />
17%<br />
1921-<br />
1930<br />
BL<br />
4%<br />
BV<br />
0%<br />
1931-<br />
1940<br />
1951-<br />
1960<br />
1941-<br />
1950<br />
1961-<br />
1970<br />
Legende:<br />
B Bebauung<br />
BL Bebauung/Landwirtschaft<br />
BV Bebauung/Verkehrswege<br />
L Landwirtschaft<br />
LV Landwirtschaft/Verkehrswege<br />
V Verkehrswege<br />
k. A. Keine Angaben<br />
1951-<br />
1960<br />
1971-<br />
1980<br />
1961-<br />
1970<br />
1971-<br />
1980<br />
1981-<br />
1990<br />
1981-<br />
1990<br />
1991-<br />
2000<br />
1991-<br />
2000<br />
2001-<br />
2002<br />
2001-<br />
2003<br />
k.A.<br />
50%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
Zuwachs [%]<br />
20%<br />
18%<br />
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
Zuwachs [%]
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Diagramm 4:<br />
Maximale und<br />
minimale<br />
Deichhöhen<br />
Diagramm 5:<br />
Freibordmaß<br />
bei Bemessungshochwasser<br />
(0 m bedeutet<br />
entweder kein<br />
Freibord<br />
und/oder kein<br />
BHQ)<br />
Diagramm 6:<br />
Lage des<br />
Deichwegs<br />
Anteil der Deichstrecke [%]<br />
Df<br />
10,9%<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 10<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Db<br />
18,7%<br />
Dfb<br />
10,2%<br />
0,00 m bis<br />
1,00 m<br />
1,01 m bis<br />
2,00 m<br />
0 m<br />
32,3%<br />
Dk<br />
23,7%<br />
k. A.<br />
12,6%<br />
2,01 m bis<br />
3,00 m<br />
3,01 m bis<br />
4,00 m<br />
Dkfb<br />
1,8%<br />
Dkb<br />
11,0%<br />
< 1,0 m<br />
32,3%<br />
Dkf<br />
11,2%<br />
4,01 m bis<br />
5,00 m<br />
Max. Höhen (Verteilung)<br />
Min. Höhen (Verteilung)<br />
Max. Höhen (Summenlinie)<br />
Min. Höhen (Summenlinie)<br />
5,01 m bis<br />
6,00 m<br />
> 1,0 m<br />
12,5%<br />
Legende:<br />
> 6,00 m k. A.<br />
1,0 m<br />
23,0%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Verteilung [%]<br />
Db Deichbermenweg<br />
Df Deichfußweg<br />
Dfb Deichbermen und -fußweg<br />
Dk Deichkronenweg<br />
Dkb Deichkronen und -bermenweg<br />
Dkf Deichkronen und -fußweg<br />
Dkfb Deichkronen, -fuß und -bermenwe<br />
k.A. Keine Angaben
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Diagramm 7:<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 11<br />
OoU<br />
20,7%<br />
Dichtungsart<br />
der Deiche<br />
ImU<br />
Legende:<br />
Diagramm 8:<br />
Dichtungsbaustoff<br />
der<br />
Deiche<br />
Diagramm 9:<br />
Deichentwässerung<br />
3,8%<br />
ImS<br />
1,8%<br />
OmS<br />
4,3%<br />
IoU<br />
1,9%<br />
oD<br />
30,7%<br />
Ku<br />
0,0%<br />
Ro<br />
3,1%<br />
Gr<br />
12,5%<br />
Fi<br />
25,3%<br />
OmU<br />
1,6%<br />
St<br />
1,6%<br />
FmR<br />
4,0%<br />
EhD<br />
65,0%<br />
k. A.<br />
3,8%<br />
FmG<br />
0,3%<br />
As<br />
0,6%<br />
Bn<br />
0,9%<br />
FmS<br />
0,3%<br />
k. A.<br />
0,9%<br />
EhD Einheitsdeich<br />
ImS Innenabdichtung mit Sickerwegverlängerung<br />
ImU Innenabdichtung mit Untergrundabdichtung<br />
IoU Innenabdichtung ohne Untergrundabdichtung<br />
OmS Oberflächenabdichtung mit Sickerwegverlängerung<br />
OmU Oberflächenabdichtung mit Untergrundabdichtung<br />
OoU Oberflächendichtung ohne Untergrundabdichtung<br />
k. A. keine Anagbe<br />
bB<br />
58,8%<br />
Bt<br />
3,6%<br />
k. A.<br />
54,5%<br />
Legende:<br />
St Stahl<br />
oD Ohne Dichtungsbaustoff<br />
Ku Kunststoff<br />
bB Bindiger Boden<br />
Bt Bentonit<br />
Bn Beton<br />
As Asphalt<br />
k. A. Keine Angaben<br />
Legende:<br />
Fi Filter<br />
Ro Rohrleitung<br />
Gr Graben<br />
FmR Filter mit Rohrleitung<br />
FmG Filter mit Graben<br />
FmS Filter mit Sickerschlitzen<br />
k. A. Keine Angaben
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Diagramm 10:<br />
Eigentumsverhältnisse<br />
Diagramm 11:<br />
Jahr der letztenDeichschau<br />
Deichstrecke [km]<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 12<br />
E<br />
66,3%<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
k. A.<br />
7,2%<br />
EGD<br />
0,8%<br />
G<br />
10,1%<br />
D<br />
10,3%<br />
EG<br />
0,8%<br />
ED<br />
4,5%<br />
Legende:<br />
E Eigentum Freistaat Bayern<br />
G Grunddienstbarkeit<br />
D Eigentum Dritter<br />
ED Eigentum Freistaat Bayern / Dritter<br />
EG Eigentum Freistaat Bayern mit<br />
EGD Eigentum Freistaat Bayern mit<br />
k. A. keine Angabe<br />
1971 1986 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 k. A.<br />
Kategorien<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Verteilung [%]
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 13<br />
2.7 – Deichstrecken an den bayerischen Wasserwirtschaftsämtern<br />
(sortiert nach Länge)<br />
WWA Länge<br />
Deichstrecke [km]<br />
Prozentual<br />
[%]<br />
1 Deggendorf (DEG) 261,85 22%<br />
2 Freising (FS) 136,24 11%<br />
3 Donauwörth (DON) 111,59 9%<br />
4 Landshut (LA) 111,28 9%<br />
5 Krumbach (KRU) 108,44 9%<br />
6 Weilheim (WM) 84,62 7%<br />
7 Rosenheim (RO) 75,33 6%<br />
8 Traunstein (TS) 65,77 6%<br />
9 Ingolstadt (IN) 65,04 5%<br />
10 Kempten (KE) 45,43 4%<br />
11 Regensburg (R ) 28,66 2%<br />
12 Bamberg (BA) 21,31 2%<br />
13 Passau (PA) 19,47 2%<br />
14 Schweinfurt (SW) 12,95 1%<br />
15 Pfarrkirchen (PAN) 10,09 1%<br />
16 Weiden (WEN) 9,80 1%<br />
17 Hof (HO) 9,51 1%<br />
18 Bayreuth (BT) 7,14 1%<br />
19 München (M) 3,42 0%<br />
20 Würzburg (WÜ) 2,36 0%<br />
21 Amberg (AM) 0,21 0%<br />
22 Aschaffenburg (AB) 0,14 0%<br />
23 Ansbach (AN) 0,00 0%<br />
24 Nürnberg (N) 0,00 0%<br />
Σ: 1190,62 100%
DEICHSANIERUNG<br />
Zwischenbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für <strong>Anhang</strong> 14<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft<br />
2.8 - Auswertung "Wasserwirtschaftsämter"<br />
Nr. Parameter<br />
Bayern (gesamt) Deggendorf Donauwörth Freising Ingolstadt Kempten Krumbach Landshut Rosenheim Traunstein Weilheim<br />
1 Schutz vor Bebauung<br />
77% 95% 54% 80% 100% 66% 77% 74% 90% 80% 76%<br />
2 Baujahr<br />
Beginn: 1850 Beginn: 1850 Beginn: 1880 Beginn: 1900 Beginn: 1850 Beginn: 1900 Beginn: 1890 Beginn: 1890 Beginn: 1900 Beginn: 1880 Beginn: 1920<br />
1880 - 30: 43 % 1910 - 60: 85 % 1880 - 90: 22 % 1900 - 10: 100 % 1850 - 60: 34 % 1900 - 10: 75 % 1890 - 00: 61 % 1940 - 80: 75 % 1900 - 40: 61 % 1900 - 20: 58 % 1920 - 50: 47 %<br />
1930 - 00: 51 % 1990 - 00: 10 % 1960 - 00: 49 %<br />
1910 - 30: 43 %<br />
1950 - 70: 34 %<br />
1960 - 90: 30 %<br />
3 Sanierung<br />
48% 82% 72% 31% 74% 76% 15% 38% 25% 67% 23%<br />
4 Sanierungsjahr<br />
1970 - 00: 82 % 1970 - 00: 90 % 1920 - 30: 26 % 1980 - 02: 95 % 1960 - 80: 76 % 1930 - 40: 47 % 1910 - 30: 54 % 1970 - 00: 90 % 2000 - 02: 66 % 1970 - 02: 88 % 1980 - 02: 86 %<br />
starke Steigerung 1990 - 00: 61 %<br />
1970 - 00: 52 % 1980 - 00: 43 %<br />
5 Unterhaltungspflicht Unterhalt FB 96% 91% 100% 100% 83% 100% 96% 100% 100% 100% 98%<br />
6 Unterhaltungspflicht Erneuerung FB 95% 91% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 98%<br />
7 Min. Deichhöhen<br />
94 % < 3,0 m 92 % < 3,0 m 96 % < 2,0 m 95 % < 3,5 m 99 % < 3,0 m 97% < 2,5 m 96% < 2,0 m 95% < 3,0 m 90 % < 2,0 m 90% < 2,5 m 92% < 2,0 m<br />
8 Max. Deichhöhen<br />
90 % < 4,0 m 92 % < 5,0 m 90 % < 3,0 m 100 % < 3,0 m 100 % < 4,0 m 89 % < 3,0 m 94 % < 3,0 m 84 % < 4,0 m 93 % < 3,0 m 97 % < 5,0 m 90 % < 3,0 m<br />
9 Jährlichkeit BHW > 100<br />
52% 38% 29% 53% 88% 69% 24% 84% 27% 50% 68%<br />
10 Freibordmaß > 1, 00 m<br />
35% 69% 6% 21% 73% 35% 0% 58% 13% 21% 21%<br />
11 Kronenbreite > 3,00 m<br />
43% 57% 11% 12% 56% 54% 13% 81% 39% 55% 53%<br />
12 Lage Deichweg<br />
24 %<br />
64 %<br />
33 %<br />
43 %<br />
42%<br />
56 %<br />
61 %<br />
43 %<br />
71 %<br />
34 %<br />
51 %<br />
Deichkrone Deichberme Deichfuß keine Angaben Deichkrone Deichkrone Deichkrone / - Deichbermen- / - Deichkrone Deichkrone Deichkronen / -<br />
fußweg<br />
fußweg<br />
bermenweg<br />
13 Neigung (wassers.) 1 : 2 und flacher 86% 98% 94% 99% 93% 89% 71% 93% 28% 60% 66%<br />
14 Neigung (lands.) 1 : 3 und flacher 22% 3% 37% 1% 0% 25% 23% 58% 24% 22% 39%<br />
15 Dichtungsart<br />
65 %<br />
68 %<br />
82 %<br />
88 %<br />
70 %<br />
100 %<br />
96 %<br />
90 %<br />
92 %<br />
87 %<br />
86 %<br />
Einheitsdeich Oberflächen- Einheitsdeich Einheitsdeich Oberflächen- Einheitsdeich Einheitsdeich Einheitsdeich Einheitsdeich Einheitsdeich Einheitsdeich<br />
dichtungdichtung<br />
16 Deichbaustoff<br />
72 % Kies 90 % Kies 66 % Schluff 100 % Kies 100 % Kies 100 % Kies 64 % Kies, sandig 70 % Kies 100 % Kies 99 % Kies 56 % Kies<br />
17 Dichtungsbaustoff<br />
59 %<br />
78 %<br />
82 %<br />
100 %<br />
69 %<br />
100 %<br />
78 %<br />
50 %<br />
90 %<br />
89 %<br />
38 %<br />
bindiger Boden bindiger Boden ohne Dichtung bindiger Boden bindiger Boden bindiger Boden bindiger Boden bindiger Boden ohne Dichtung ohne Dichtung ohne Dichtung<br />
18 Deichentwässerung<br />
55 %<br />
85 %<br />
96 %<br />
76 %<br />
97 %<br />
97 %<br />
100 %<br />
81 %<br />
95 %<br />
100 %<br />
86 %<br />
keine Angaben Filter<br />
keine Angaben keine Angaben keine Angaben Filter<br />
keine Angaben Graben<br />
keine Angaben keine Angaben keine Angaben<br />
19 Vegetation (wassers.)<br />
65 % Grasnarbe 95 % Grasnarbe 82 % Grasnarbe 48 % Grasnarbe 50% Grasnarbe 61 %<br />
50 % Grasnarbe 96 %<br />
55 %<br />
65 %<br />
57 % Grasnarbe<br />
mit Bäumen<br />
Bäume<br />
mit Gehölz Grasnarbe Grasnarbe Grasnarbe mit Gehölz<br />
20 Vegetation (lands.)<br />
50 % Grasnarbe mit 72 % Grasnarbe 58 % Grasnarbe 100 % Grasnarbe 52 % Grasnarbe 63 % Grasnarbe 53 % Grasnarbe 91 % Grasnarbe 70 % Grasnarbe 57 % Grasnarbe 58 % Grasnarbe<br />
Bäumen<br />
ohne Gehölz mit Gehölz mit Gehölz ohne Gehölz mit Gehölz ohne Gehölz ohne Gehölz mit Gehölz ohne Gehölz mit Gehölz<br />
21 Bibergefährdung<br />
21% 52% 15% 9% 60% 0 % (98 % keine 5 % (78 % keine 19% 10% 0 % (95 % keine 0 % (100 % keine<br />
Angabe)<br />
Angabe)<br />
Angaben) Angaben)<br />
22 Biberschutzmaßnahmen<br />
13% 47% 0% 0% 42% 0 % (98 % keine 0 % (78 % keine 8% (53 % keine 0% 0 % (95 % keine 0 % (100 % keine<br />
Angabe)<br />
Angabe)<br />
Angabe)<br />
Angaben) Angaben)<br />
23 Oberste Schicht Untergrund 61 % Auelehm, 90 % Auelehm 51 % Kies, 100 % Auelehm 100 % Auelehm 100 % Kies 83 % Auelehm, 59 % Kies, 80 % Kies, 76 % Kies, 100 % keine<br />
31 % Kies<br />
49 % Auelehm<br />
17 % Kies 41 % Auelehm 20 % Auelehm 24 % Auelehm Angaben<br />
24 Eigentum FB<br />
56% 99% 80% 31% 83% 53% 14% 100% 56% 69% 100 % k. A.<br />
25 BHW ausreichend<br />
61% 41% 86% 53% 81% 86% 51% 97% 27% 74% 14%<br />
26 Standsicherheitsnachweis<br />
32% 30% 8% 12% 21% 0% 0% 96% 22% 56% 37%<br />
27 Freibord ausreichend<br />
50% 64% 42% 25% 73% 56% 49% 87% 20% 57% 45%
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 15<br />
2.9 – Deichstrecken an den bayerischen Gewässern 1. Ordnung<br />
(sortiert nach Länge)<br />
Kategorien Länge Deichstrecke<br />
[km]<br />
Prozentual<br />
[%]<br />
1 Donau 266,14 22%<br />
2 Isar 175,64 15%<br />
3 Amper 64,54 5%<br />
4 Iller 56,97 5%<br />
5 Mangfall 46,30 4%<br />
6 Ammer 44,05 4%<br />
7 Vils 40,29 3%<br />
8 Lech 35,87 3%<br />
9 Loisach 35,54 3%<br />
10 TirolerAche 33,89 3%<br />
11 Zusam 31,94 3%<br />
12 Main 30,30 3%<br />
13 Schmutter 22,43 2%<br />
14 Salzach 18,28 2%<br />
15 Heng. Ohe 17,38 1%<br />
16 Paar 15,80 1%<br />
17 Isen 15,15 1%<br />
18 Sonstige 240,11 20%<br />
Σ: 1190,62 100%
DEICHSANIERUNG<br />
Enbericht<br />
2-10 - Auswertung "Gewässer"<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für <strong>Anhang</strong> 16<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft<br />
Nr. Parameter<br />
Bayern (gesamt) Amper Donau Iller Isar Mangfall<br />
1 Schutz vor Bebauung<br />
77% 65% 81% 65% 84% 97%<br />
2 Baujahr<br />
Beginn: 1850 Beginn: 1900<br />
Beginn: 1850 Beginn: 1890 Beginn: 1850<br />
Beginn: 1900<br />
1880 - 30: 43 % 1900 - 10: 97 %<br />
1890 - 00: 28 % 1900 - 10: 78 % 1900 - 10: 40 % 1910 - 40: 91 %<br />
1930 - 00: 51 %<br />
1930 - 60: 37 %<br />
1940 - 60: 21 %<br />
3 Sanierung<br />
48% 39% 61% 72% 35% 27%<br />
4 Sanierungsjahr<br />
1970 - 00: 82 % 1990 - 00: 100 % 1970 - 00: 71 % 1910 - 40: 62 % 1980 - 02: 81 % 1970 - 90: 51 %<br />
1970 - 00: 38 %<br />
2000 - 02: 49 %<br />
5 Unterhaltungspflicht Unterhalt FB 96% 100% 94% 100% 88% 100%<br />
6 Unterhaltungspflicht Erneuerung FB 95% 100% 98% 100% 88% 100%<br />
7 Min. Deichhöhen<br />
94 % < 3,0 m 99 % < 1,5 m 93 % < 3,0 m 92 % < 2,5 m 96 % < 3,5 m 91 % < 1,5 m<br />
8 Max. Deichhöhen<br />
90 % < 4,0 m 92 % < 1,0 m 96 % < 5,0 m 92 % < 3,0 m 92 % < 5,0 m 91 % < 2,0 m<br />
9 Jährlichkeit BHW > 100<br />
52% 4% 32% 72% 97% 15%<br />
10 Freibordmaß > 1, 00 m<br />
35% 1% 52% 24% 68% 2%<br />
11 Kronenbreite > 3,00 m<br />
43% 15% 51% 46% 45% 42%<br />
12 Lage Deichweg<br />
24 %<br />
90 %<br />
41 %<br />
48 %<br />
27 %<br />
93 %<br />
Deichkrone keine Angaben<br />
Deichbermenweg keine Angaben Deichkrone<br />
Deichkrone<br />
13 Neigung (wassers.) 1 : 2 und flacher 86% 100% 84% 97% 94% 39%<br />
14 Neigung (lands.) 1 : 3 und flacher 22% 3% 7% 27% 18% 1%<br />
15 Dichtungsart<br />
65 %<br />
100 %<br />
51 %<br />
100 %<br />
66 %<br />
91 %<br />
Einheitsdeich Einheitsdeich<br />
Oberflächen-dichtung Einheitsdeich Einheitsdeich<br />
Einheitsdeich<br />
16 Deichbaustoff<br />
72 % Kies 100 % Kies 68 % Kies 76 % Kies 99 % Kies 100 % Kies<br />
17 Dichtungsbaustoff<br />
59 %<br />
100 %<br />
78 %<br />
67 %<br />
61 %<br />
90 %<br />
bindiger Boden bindiger Boden<br />
bindiger Boden bindiger Boden bindiger Boden ohne Dichtung<br />
18 Deichentwässerung<br />
55 %<br />
93 % keine Angaben 48 % keine Angaben 66 %<br />
34 %<br />
100 %<br />
keine Angaben<br />
Filter<br />
Graben<br />
keine Angaben<br />
19 Vegetation (wassers.)<br />
65 % Grasnarbe 49 % Grasnarbe 83 % Grasnarbe 41 % Bäume 63 % Grasnarbe 65 % Grasnarbe<br />
20 Vegetation (lands.)<br />
50 % Grasnarbe mit 100 % Grasnarbe mit 74 % Grasnarbe ohne 60 % Grasnarbe mit 51 % Grasnarbe ohne 88 % Grasnarbe mit Gehölz<br />
Bäumen<br />
Gehölz<br />
Gehölz<br />
Gehölz<br />
Gehölz<br />
21 Bibergefährdung<br />
21% 1% 23% 9% 17% 0%<br />
22 Biberschutzmaßnahmen<br />
13% 0% 18% 0% 9% 0%<br />
23 Oberste Schicht Untergrund<br />
61 % Auelehm, 100 % Auelehm 93 % Auelehm 83 % Kies,<br />
54 % Auelehm, 100 % Kies<br />
31 % Kies<br />
17 % Auelehm 44 % Kies<br />
24 Eigentum FB<br />
56% 16% 72% 41% 75% 64%<br />
25 BHW ausreichend<br />
61% 2% 39% 88% 93% 15%<br />
26 Standsicherheitsnachweis<br />
32% 0% 25% 0% 53% 15%<br />
27 Freibord ausreichend<br />
50% 2% 53% 33% 69% 2%
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 17<br />
2.11 – Ertüchtigungsbedarf in Bayern<br />
Aschaffenburg<br />
Aschaffenburg<br />
Würzburg<br />
Würzburg<br />
Schweinfurt<br />
Ansbach<br />
Krumbach<br />
Kempten<br />
Donauwörth<br />
Schweinfurt<br />
Bamberg<br />
Ansbach<br />
Krumbach<br />
Kempten<br />
Nürnberg<br />
Ingolstadt<br />
Weilheim<br />
Bamberg<br />
Bayreuth<br />
Freising<br />
Regensburg<br />
München<br />
Nürnberg<br />
Donauwörth<br />
Hof<br />
Weiden<br />
Ingolstadt<br />
Weilheim<br />
Amberg<br />
Landshut<br />
Rosenheim<br />
Hof<br />
Bayreuth<br />
Freising<br />
München<br />
Weiden<br />
Deggendorf<br />
Pfarrkirchen<br />
Traunstein<br />
Amberg<br />
Regensburg<br />
Landshut<br />
Rosenheim<br />
Stand: Dezember 2002<br />
Traunstein<br />
Passau<br />
Deggendorf<br />
Pfarrkirchen<br />
Passau<br />
> 50.000<br />
10.001 - 50.000<br />
1.001 - 10.000<br />
101 - 1.000<br />
1 - 100<br />
0<br />
Tausend Euro<br />
Stand: Dezember 2002<br />
> 800<br />
601 - 800<br />
401 - 600<br />
201 - 400<br />
1 - 200<br />
0<br />
Euro/lfm
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 18<br />
DEICHSANIERUNG<br />
Zwischenbericht<br />
4.1 – Einwirkungen, Schadensursachen und Schäden<br />
vor / nach Hochwasser während Hochwasser nach HW<br />
keine<br />
weiteren<br />
Schäden<br />
keine<br />
weiteren<br />
Schäden<br />
keine<br />
weiteren<br />
Schäden<br />
Unterhaltung / Beseitigung aller<br />
Schäden / Sofortsicherung /<br />
Ertüchtigung / Sanierung<br />
Neubau / Wiederaufbau<br />
der Deichbruchstelle<br />
Deichbruch<br />
(Überschwemmung des<br />
Deichhinterlandes)<br />
Deichüberwachung /<br />
Deichverteidigung<br />
Folgeschäden<br />
Deichüberwachung /<br />
Deichverteidigung<br />
Einwirkung<br />
(mit Hochwasser)<br />
Unterhaltung / Beseitigung der<br />
Primärschäden /<br />
Ertüchtigung / Sanierung<br />
Primärschäden<br />
Fortlaufende Unterhaltungsmaßnahmen<br />
mit dem Ziel der<br />
Schadensvermeidung und<br />
–beseitigung<br />
Einwirkung<br />
(ohne Hochwasser)<br />
Kein Schaden<br />
(Ausgangszustand)<br />
Deichbauwerk entsprechend<br />
den a.a.R.d.T.<br />
Weitere<br />
Schadensursachen<br />
Einwirkungen<br />
Auswirkungen<br />
Primärschäden<br />
Primäre<br />
Schadens-<br />
ursachen Durchörterung<br />
Einwirkung<br />
Erschwerung von<br />
Deichüberwachung und<br />
Deichverteidigung<br />
Ansatzpunkte für Erosion / Kolk<br />
Erhöhung Sickerlinie<br />
durch Pumpeffekt<br />
Erhöhung Wasserspiegel<br />
durch Verklausung oder<br />
Windwurf auf Deichoberfläche<br />
Bepflanzung mit Bäumen und<br />
Sträuchern ohne<br />
Sicherungskonzept<br />
Hohlräume<br />
Verstärkung der<br />
Durchsickerung<br />
Erhöhung der<br />
Erosionsanfälligkeit<br />
Verminderung der statischen<br />
Widerstandskräfte<br />
Erschwerung<br />
Unterhaltung<br />
Absterben<br />
Wurzeln<br />
Bodenlockerung<br />
Beschattung<br />
Grasnarbe<br />
Veränderung<br />
Bodengefüge<br />
Kraftbelastung<br />
Böschung (Wind,<br />
Eigengewicht)<br />
Durchwurzelung<br />
(Dichtung, Deich,<br />
Drän)<br />
Ausbruch und<br />
Deformation<br />
bei Windwurf<br />
Bepflanzung mit Bäumen und<br />
Sträuchern ohne<br />
Sicherungskonzept<br />
Neubau / Wiederaufbau<br />
der Deichbruchstelle<br />
Folgeschäden<br />
Prozesse<br />
der<br />
Schädigung<br />
Abbrüche / Risse<br />
im Deichkörper<br />
Erosion 1 der<br />
Untergrundschichten<br />
(Kontakterosion)<br />
Rückschreitende<br />
Erosion 1<br />
(Piping)<br />
Erosion 1 an<br />
Bauwerksfugen<br />
(Fugenerosion)<br />
Suffosion / Kolmation<br />
Beeinträchtigung<br />
der Standsicherheit und<br />
Stabilität des Deiches<br />
(Dichtung, Deich,<br />
Grasnarbe)<br />
Wurzelfraß<br />
Verstärkung der<br />
Durchsickerung<br />
Hydrodynamische<br />
Bodendeformation<br />
Unterhaltungsdefizite<br />
Bodenschädigung<br />
durch Frost-<br />
Tau-Wechsel<br />
Austrocknung von<br />
Oberflächendichtungen<br />
Wühltiere Hitze / Kälte<br />
Unterhaltung / Beseitigung<br />
aller Schäden / Sofortsicherung /<br />
Ertüchtigung / Sanierung<br />
Auswirk- Erosion / Suffosion /<br />
ungen Kolmation<br />
Beeinträchtigung / Verlust<br />
der Standsicherheit und<br />
Verminderung / Verlust<br />
der statischen<br />
Stabilität des Deiches<br />
1 Widerstandskräfte<br />
Innere Erosion 2 Oberflächenerosion<br />
Erosion² durch<br />
Überströmen (Krone,<br />
Böschung)<br />
Erosion² durch<br />
Austritt Sickerwasser<br />
(landseitig)<br />
Erosion² durch<br />
Windwellen / Strömung<br />
(wasserseitig)<br />
Hydraulischer<br />
Grundbruch<br />
Unterhaltung / Beseitigung der<br />
Primärschäden /<br />
Ertüchtigung / Sanierung<br />
Schädigung<br />
Vegetationsdecke<br />
Erosion<br />
Deichoberfläche<br />
Starkregen /<br />
Wind / Schnee<br />
Deichbruch<br />
(Überschwemmung des<br />
Deichhinterlandes)<br />
Setzungen, Senkungen,<br />
Zerrungen,<br />
Stauchungen<br />
Grundbruch am<br />
Dammfuß<br />
Spreizen<br />
am Böschungsfuß<br />
Gleiten /<br />
Abschieben Deich<br />
mit Dichtung<br />
Geologische /<br />
geotechnische<br />
Verformungen<br />
Bodenverflüssigung<br />
Sackungen /<br />
Einbrüche<br />
Auftrieb<br />
Böschungsbruch /<br />
Rutschungen<br />
(global + lokal)<br />
Globales oder lokales<br />
geotechnisches Versagen<br />
Hochwasser, Durchsickerung des Deiches und des Untergrundes, Gefahr des Deichbruches, hohes Risiko für materielle und immaterielle Güter im Deichinterland<br />
Unsachgemäßer<br />
Deichaufbau / hohe<br />
Lasteinwirkungen<br />
Wiederherstellung der<br />
Standsicherheit und<br />
Stabilität nach den a.a.R.d.T.<br />
Wiederherstellung der<br />
Standsicherheit und<br />
Stabilität nach den a.a.R.d.T.<br />
Erdbeben<br />
Zerrungen,<br />
Stauchungen<br />
Setzungen<br />
Bergsenkungen<br />
Deichüberwachung /<br />
Deichverteidigung<br />
Unwirksamkeit<br />
Dichtung / Drän<br />
Planung- und<br />
Ausführungs-<br />
Fehler beim Bau<br />
Vandalismus<br />
Schädigung<br />
durch Weidevieh<br />
Unsachgemäße<br />
Bauten / Baumaßnahmen<br />
Mensch<br />
kein Hochwasser, keine mittelbare Deichbruchgefahr und kein Risiko für materielle und immaterielle Güter im Deichhinterland durch Überschwemmung
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 19<br />
5.1 – Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054 (2003)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 20<br />
5.2 – Kenngrößen nichtbindiger Böden nach E DIN 1055-2 (2003)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 21<br />
5.3 – Kenngrößen bindiger Böden nach E DIN 1055-2 (2003)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 22<br />
6.1 – Erhebung von 20 Deichsanierungsarbeiten* in Bayern<br />
Aschaffenburg<br />
15 Pförring<br />
(WWA IN, Donau)<br />
14 Dünzing-Wackerstein<br />
(WWA IN, Donau)<br />
13 Vohburg<br />
(WWA IN, Donau)<br />
17 Mailing<br />
(WWA IN, Donau)<br />
16 Probierlweg<br />
(WWA IN, Donau)<br />
18 Neuburg a. d. D.<br />
(WWA IN, Donau)<br />
19* Untermaiselstein<br />
(WWA KE, Iller)<br />
20 Immenstadt Los 6<br />
(WWA KE, Iller)<br />
Würzburg<br />
Schweinfurt<br />
Ansbach<br />
Krumbach<br />
Iller<br />
Main<br />
Kempten<br />
Übersichtskarte<br />
03 Schweinfurt Süd<br />
(WWA SF, Main)<br />
Donau<br />
Bamberg<br />
Nürnberg<br />
Donauwörth<br />
Bayreuth<br />
Ingolstadt<br />
Weilheim<br />
Ammer<br />
Hof<br />
Freising<br />
Amper<br />
Regensburg<br />
München<br />
Isar<br />
08 Pähl-Wielenbach (WWA WM, Ammer)<br />
Weiden<br />
Amberg<br />
Landshut<br />
Rosenheim<br />
Mangfall<br />
Donau<br />
Tiroler<br />
Achen<br />
Deggendorf<br />
Isar<br />
Pfarrkirchen<br />
Traunstein<br />
Salzach<br />
01 Aiblinger Au (WWA RO, Mangfall)<br />
02 Vagen (WWA RO, Mangfall)<br />
04 Thalkirchen (WWA M, Isar)<br />
* 19 Sanierungsmaßnahmen + 1 Neubau (Untermaiselstein)<br />
09 Mariaposching (WWA DEG, Donau)<br />
10 Sulzbach (WWA DEG, Donau)<br />
11 Stoegermühlbach<br />
(WWA DEG, Donau)<br />
12 Aicha-Mühlham<br />
(WWA DEG, Donau)<br />
Passau<br />
05 Grassau<br />
(WWA TS, Tiroler Achen)<br />
06 Fridolfing / Tittmoning<br />
(WWA TS, Salzach)<br />
07 Fridolfing / Tittmoning /<br />
Laufen (WWA TS, Salzach)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 23<br />
6.2 – Liste der erhobenen Maßnahmen<br />
Nr. Bezeichnung WWA Gewässer Nr. Bezeichnung WWA Gewässer<br />
1 Aiblinger Au Rosenheim Mangfall 11 Stoegermühlbach Deggendorf Stoegermühlbach<br />
2 Vagen Rosenheim Mangfall 12 Aicha-Mühlham Deggendorf Donau<br />
3 Schweinfurt<br />
Süd<br />
Schweinfurt Main 13 Vohburg Ingolstadt Donau<br />
4 Thalkirchen München Isar 14 Dünzing-<br />
Wackerstein<br />
5 Grassau Traunstein Tiroler<br />
Achen<br />
6 Fridolfing<br />
Tittmoning<br />
/<br />
7 Fridolf. / Tittmon.<br />
/ Laufen<br />
8 Pähl / Wielenbach<br />
15 Neustädter Brücke<br />
/ Vohburg<br />
Ingolstadt Donau<br />
Ingolstadt Donau<br />
Traunstein Salzach 16 Probierlweg Ingolstadt Donau<br />
Traunstein Salzach 17 Mailing Ingolstadt Donau<br />
Weilheim Ammer 18 Neuburg<br />
Donau<br />
a. d.<br />
Ingolstadt Donau<br />
9 Mariaposching Deggendorf Donau 19 Untermaiselstein Kempten Iller<br />
10 Sulzbach Deggendorf Sulzbachableiter<br />
20 Immenstadt (Los<br />
6)<br />
Kempten Iller
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 24<br />
6.3 – Kontaktadressen / Ansprechpartner der Wasserwirtschaftsämter<br />
WWA Deggendorf<br />
Detterstraße 20<br />
94469 Deggendorf<br />
Name: Fischer, Josef (Mader; Menacher)<br />
Abteilung: Staatlicher Wasserbau, Gewässerentwicklung<br />
Telefon: 0991 – 2504 174 (143; 144)<br />
Telefax: 0991 – 2504 200<br />
Email: Josef.Fischer@wwa-deg.bayern.de<br />
WWA Ingolstadt<br />
Auf der Schanz 26<br />
85049 Ingolstadt<br />
Name: Plank, Johannes (Zapf)<br />
Abteilung: Wasserbau, Gewässerentwicklung<br />
Telefon: 0841 – 3705 176 (161)<br />
Telefax: 0841 – 3705 298<br />
Email: Johannes.Plank@wwa-in.bayern.de<br />
WWA Kempten<br />
Rottachstrasse 15<br />
87439 Kempten<br />
Name: Schaupp, Armin (Schmidt; Zeiser; Seidl)<br />
Abteilung: Abteilung B – Neubau (HWSOI)<br />
Telefon: 0831 / 5243 308 (107; 215; 214)<br />
Telefax: 0831 / 5243 216<br />
Email: Armin.Schaupp@wwa-ke.bayern.de<br />
WWA München<br />
Praterinsel 2<br />
80538 München<br />
Name: Temeschinko, Alexander<br />
Abteilung: Isar, Gewässerentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Telefon: 089 – 21233 139<br />
Telefax: 089 – 21233 101<br />
Email: Alexander.Temeschinko@wwa-m.bayern.de
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 25<br />
WWA Rosenheim<br />
Königstraße 19<br />
83022 Rosenheim<br />
Name: Rasp, Franz (Obermaier)<br />
Abteilung: Technische Projektleitung, Hochwasserschutz Mangfalltal<br />
Telefon: 08031 – 305 171 (116)<br />
Telefax: 08031 – 305 179<br />
Email: Franz.Rasp@wwa-ro.bayern.de<br />
WWA Schweinfurt<br />
Alte Bahnhofstraße 29<br />
97422 Schweinfurt<br />
Name: Norbert Schneider<br />
Abteilung: Stadt / Landkreis Schweinfurt (Abteilung 1)<br />
Telefon: 09721 – 203 231<br />
Telefax: 09721 – 203 210<br />
Email: Norbert.Schneider@wwa-sw.bayern.de<br />
WWA Traunstein<br />
Rosenheimer Straße 7<br />
83278 Traunstein<br />
Name: Wiedemann, Christoph (Heinz; Semmler)<br />
Abteilung: Wasserbau, Gewässerentwicklung<br />
Telefon: 0861 – 57 331 (338; 325)<br />
Telefax: 0861 – 13 605<br />
Email: Christoph.Wiedemann@wwa-ts.bayern.de<br />
WWA Weilheim<br />
Pütrichstraße 15<br />
82362 Weilheim<br />
Name: Grieblinger, Hans<br />
Abteilung: Wasserbau, Gewässerentwicklung<br />
Telefon: 0881 – 182 129<br />
Telefax: 0881 – 182 162<br />
Email: Hans.Grieblinger@wwa-wm.bayern.de
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 26<br />
6.4 – Histogramme: Einheitspreise für Erdarbeiten – Oberbodenarbeiten<br />
Position Nr. 1.1 Position Nr. 1.4<br />
Häufigkeit<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
0 bis 1<br />
1 bis 2<br />
2 bis 3<br />
3 bis 4<br />
4 bis 5<br />
5 bis 6<br />
6 bis 7<br />
7 bis 8<br />
Einheitspreise [€]<br />
Position Nr. 1.2 Position Nr. 1.5<br />
Häufigkeit<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0 bis 2,5<br />
2,5 bis 5<br />
Position Nr. 1.3<br />
Häufigkeit<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0 bis 1<br />
1 bis 2<br />
2 bis 3<br />
3 bis 4<br />
5 bis 7,5<br />
7,5 bis 10<br />
Einheitspreise [€]<br />
4 bis 5<br />
5 bis 6<br />
6 bis 7<br />
7 bis 8<br />
Einheitspreise [€]<br />
8 bis 9<br />
8 bis 9<br />
10 bis 12,5<br />
9 bis 10<br />
9 bis 10<br />
10 bis 11<br />
10 bis 11<br />
12,5 bis 15<br />
11 bis 12<br />
11 bis 12<br />
Häufigkeit<br />
Häufigkeit<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
0 bis 1<br />
4 bis 5<br />
1 bis 2<br />
5 bis 6<br />
2 bis 3<br />
6 bis 7<br />
3 bis 4<br />
4 bis 5<br />
5 bis 6<br />
6 bis 7<br />
7 bis 8<br />
8 bis 9<br />
Einheitspreise [€]<br />
7 bis 8<br />
8 bis 9<br />
9 bis 10<br />
10 bis 11<br />
Einheitspreise [€]<br />
9 bis 10<br />
11 bis 12<br />
10 bis 11<br />
12 bis 13<br />
11 bis 12<br />
12 bis 13<br />
13 bis 14<br />
13 bis 14<br />
14 bis 15
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 27<br />
6.5 – Histogramme: Einheitspreise für Erdarbeiten – Bodenarbeiten<br />
Position Nr. 2.1 Position Nr. 2.3<br />
Häufigkeit<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0 bis 1<br />
1 bis 2<br />
2 bis 3<br />
3 bis 4<br />
4 bis 5<br />
5 bis 6<br />
6 bis 7<br />
7 bis 8<br />
8 bis 9<br />
Einheitspreise [€]<br />
9 bis 10<br />
Position Nr. 2.2 Position Nr. 2.4<br />
Häufigkeit<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
5 bis 7,5<br />
7,5 bis 10<br />
10 bis 12,5<br />
12,5 bis 15<br />
15 bis 17,5<br />
Einheitspreis [€]<br />
10 bis 11<br />
17,5 bis 20<br />
11 bis 12<br />
12 bis 13<br />
20 bis 22,5<br />
13 bis 14<br />
14 bis 15<br />
22,5 bis 25<br />
Häufigkeit<br />
Häufigkeit<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0<br />
2 bis 3<br />
10 bis 12,5<br />
3 bis 4<br />
4 bis 5<br />
5 bis 6<br />
12,5 bis 15<br />
6 bis 7<br />
7 bis 8<br />
8 bis 9<br />
9 bis 10<br />
10 bis 11<br />
11 bis 12<br />
Einheitspreise [€]<br />
15 bis 17,5<br />
17,5 bis 20<br />
Einheitspreis [€]<br />
12 bis 13<br />
20 bis 22,5<br />
13 bis 14<br />
14 bis 15<br />
15 bis 16<br />
22,5 bis 25<br />
16 bis 17
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 28<br />
6.6 – Beispiel 01: Aiblinger Au<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
An dem Gewässer Mangfall wurde von Flusskilometer 9+100 bis 10+500 der rechtsseitige<br />
Deich größtenteils neu aufgebaut und mit einer Innendichtung versehen (Abb. 1).<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Rosenheim)<br />
Art der Maßnahme: Unterhaltungsmaßnahme<br />
Gewässer: Mangfall / Aiblinger Au (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: 11 Wochen<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 1.264 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit<br />
Deichtrasse<br />
und Flusskilometrierung<br />
Sanierungsjahr: 2002<br />
Gesamtkosten: 558.231 € (inkl. Nachträge)<br />
Sanierungsmethode: - Neuaufbau<br />
Fluss-km 10+500<br />
- Einbau einer Innendichtung (FMI-Wand mit eingestellten<br />
IPE-Trägern)<br />
Mangfall<br />
Fluss-km 9+100
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 29<br />
Da das Vor- und Hinterland sich im Eigentum Dritter befindet, war man bestrebt, den<br />
Deich auf der bestehenden Fläche zu belassen, um keine größeren Kosten durch den<br />
Grunderwerb zu erhalten.<br />
Da aus denselben Gründen auch kein Deichhinterweg vorgesehen wurde, soll die Deichkrone,<br />
die mit einer hydraulisch gebundenen Schottertragschicht versehen wurde, im<br />
Hochwasserfall als Deichverteidigungsweg dienen.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
Die festgestellten Mängel lassen sich auf folgende Punkte konzentrieren:<br />
- zu geringer Freibord<br />
- kein gegliederter Deichquerschnitt (keine Dichtung, kein Drän)<br />
- kein Deichverteidigungsweg<br />
- Gehölze im Vorland und auf dem Deichkörper<br />
Technische Maßnahmen (Regelquerschnitt in Abb. 2)<br />
- Rodung des Baumbestandes und Entfernung der Wurzelstöcke<br />
Von den ca. 8300 im Maßnahmenbereich befindlichen Bäumen wurden ca. 90 % entfernt.<br />
- Verbreiterung der Krone auf 3,0 m durch Anpassung der landseitigen Böschungsneigung<br />
Die landseitige Böschungsneigung wurde bei h:b = 1:1,8 belassen. Um die Kronenbreite<br />
auf 3,0 m zu verbreitern, musste die wasserseitige Böschungsneigung teilweise mit h:b =<br />
1:1,9 steiler angelegt werden.<br />
- Einbau einer Dichtwand<br />
Es ist eine FMI-Wand (d = 40 cm) eingebaut worden. Um die Aufnahme des geforderten<br />
Biegemomentes von 5 kNm/m für den Lastfall „Absacken der wasserseitigen Böschung<br />
um 1,0 m“ gewährleisten zu können, wurden in den bestehenden Schlitz IPE 160 Stahlträger<br />
mit einem Abstand von 2,4 m eingestellt. Die Dichtung bzw. Suspension hat die im<br />
Folgenden aufgezählten Kennwerte:<br />
w/z –Wert: 1,0<br />
Zementgehalt: 230 kg/m 3<br />
Einaxiale Druckfestig- ca. 5,0 MN/m 2<br />
E-Modul: 600 – 800 MN/m 2<br />
Wasserdurchlässigkeit: 10 E –9 bis 10 E –11 m/s
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 30<br />
- teilweise oder vollständiger Abtrag des Deichkörpers<br />
- Aufbau eines Deichkronenwegs mit Schottertragschicht<br />
- Auftragen von Mutterboden mit Ansaatmischung auf der Wasserseite<br />
- Ansaat von Magerrasen im Nassspritzverfahren auf der Landseite<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen und Arbeiten<br />
Im Zuge der Unterhaltungsmaßnahme wurden im Vorfeld die Auswirkungen der geplanten<br />
Gehölzfreistellung und eine ökologisch-naturschutzfachliche Bestandsaufnahme durchgeführt.<br />
Ergebnis war, dass der ökologisch hochwertige Magerrasen die Gehölzfreistellungen<br />
bei Erstellung der Ökobilanz ausgleicht.<br />
Geotechnische und geologische Erkundung<br />
In den oberflächennahen Bereichen stehen im Wesentlichen schwach bis stark sandige<br />
Kiese (Boden 1) an, welche locker bis mitteldicht gelagert sind. Sie sind nicht von dem<br />
bestehenden Deichkörper zu unterscheiden. Teilweise befinden sich in diesen Kiesschichten<br />
Zwischenlagen in Form von weichen bis steifen Schluffen. Unterhalb der Flusskiese<br />
und Auffüllungen sind in einer Tiefe von 5 - 6 m Seetone, die von einer Grundmoräne unterlagert<br />
werden, anzutreffen. Die Seetone bzw. die Grundmoräne bestehen im Wesentlichen<br />
aus Ton-Schluff-Gemischen (Bodenart 2), bei denen man von einer geringen Durchlässigkeit<br />
ausgehen kann.<br />
Im Zuge der Erkundung wurden sowohl 14 Rammkernbohrungen als auch 14 schwere<br />
Rammsondierungen durchgeführt. Mit Hilfe von Laborversuchen wurden die Korngrößenverteilung,<br />
die Zustandsgrenzen, der Wassergehalt, die Dichte und die Scherfestigkeit<br />
durch Rahmenscherversuche ermittelt (Tab. 1).
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 31<br />
Tab. 1: Geotechnische Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Schicht /<br />
Material<br />
Nr. Bodenart<br />
DIN 4022<br />
Lagerung /<br />
Konsistenz<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
ϕ´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
Kiese 1 G, s´-s* locker<br />
mitteldicht<br />
bis 19 10 32,5 0 10 -2 bis 10 -4<br />
Schluffe - U, s, g weich (bis steif) 19 9 22,5 0 – 5 < 10 -8<br />
Auffüllungen<br />
Zwischenlagen<br />
Sande - S, u, g - g* weich bis steif 20 10 25 0 < 10 -7<br />
Tone<br />
Schluffe<br />
/<br />
T/U, s´-s, g' - g steif 19 9 22,5 10 – 15 < 10 -9<br />
Sande S, u´-u*, g' - g* mitteldicht bzw. 20 11 30 0 – 3 < 10 -7<br />
Tone<br />
Schluffe<br />
/ - T/U, s´-s, g' - g halbfest bis fest 20 10 22,5 15 - 25 < 10 -9<br />
Sande - S, u´-u*, g' - g* dicht 21 12 30 3 – 6 < 10 -7<br />
Seetone / Grundmoräne oberhalb verfestigter Zone<br />
2<br />
Seetone / Grundmoräne unterhalb verfestigter Zone<br />
Leistungsverzeichnis, Angebote, Vergabe, Abnahme, Mängel<br />
Es wurden von zwei Firmen Angebote abgegeben. Firma A bot an, eine mit Stahlmatten<br />
bewehrte FMI-Wand auszuführen. Dieses Angebot war preislich deutlich höher als die<br />
Nebenangebote (Tab. 2) der Firma B. Der Angebotsspiegel (Tab. 3) gibt die Summen der<br />
angebotenen Positionen des Leistungsverzeichnis von Firma A und B wider.<br />
Tab 2: Hauptangebot und Nebenangebote der Firma B<br />
Hauptangebot Art: FMI-Dichtwand<br />
Dicke: 100 cm<br />
Bewehrung: unbewehrt<br />
Besonderheiten: -<br />
Nebenangebot 1 Art: FMI-Dichtwand<br />
Dicke: 40 cm<br />
Bewehrung: Betonstahleinlagen<br />
Besonderheiten: Abtragung der Kräfte über Bewehrung<br />
Nebenangebot 2 Art: FMI-Dichtwand<br />
Dicke: 40 cm<br />
Bewehrung: IPE-160 Träger<br />
Besonderheiten: Erdbetonausfachung mit Gewölbetragwirkung,<br />
Abtragung der Kräfte über IPE-Träger<br />
Nebenangebot 3 Art: FMI-Dichtwand<br />
Dicke: 50 cm<br />
Bewehrung: unbewehrt<br />
Besonderheiten: Angesetztes Biegemoment kleiner als gefordert,<br />
deshalb 50 cm Wanddicke ausreichend
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Tab. 3: Angebotsspiegel<br />
Nr. Position<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 32<br />
Firma A<br />
Hauptangebot<br />
Firma B<br />
Hauptangebot<br />
Firma B<br />
Nebenangebot<br />
1<br />
Firma B<br />
Nebenangebot<br />
2<br />
Firma B<br />
Nebenangebot<br />
3<br />
1. Baustelle einrichten 65.532,29 53.856,00<br />
2. Erdbau<br />
2.1 Vorbereitung 7.115,00<br />
2.2 Abtrag und Lagerung,<br />
Deichmaterial<br />
42.956,00<br />
2.3 Verdichtungsversuch<br />
und Qualitätskontrolle<br />
13.620,00<br />
2.4 Deichaufbau 73.843,60<br />
2.5 Spartenproblematik 1.385,00<br />
2.6 Oberboden und Begrünung<br />
31.458,50<br />
Summe Pos. 2 Erdbau: 182.990,37 224.234,10<br />
3. Dichtwandarbeiten 196.051,00 275.500,00 207.500,00 236.500,00 195.740,00<br />
Einzelpreise Dichtwand<br />
38,20 53,70 40,00 45,00 37,80<br />
€/m 2<br />
4. Erkundungsbohrungen Kein Preis 13.201,00<br />
5. Regiearbeiten<br />
vorhanden! 13.491,00<br />
Summe: 560.283,46 610.642,79 531.182,79 560.182,79 518.422,79<br />
Vergabe an Firma B<br />
Der Nachweis der statischen Wirksamkeit für abgerostete Bewehrungskörbe (Nebenangebot<br />
1) konnte nicht geführt werden. Firma B bot an, die FMI-Wand mit eingestellten IPE<br />
160-Trägern im Abstand von 2,4 m auszuführen. Dabei wird das Biegemoment über die<br />
Stahlträger abgetragen. Das zwischen den Trägern befindliche Dichtwandmaterial dient<br />
als Ausfachung. Die Nachweise für das Nebenangebot 3 (unbewehrte FMI-Wand) beruhen<br />
auf der Annahme, dass das tatsächlich auftretende Moment deutlich geringer ist, als<br />
in der Ausschreibung angesetzt wurde. Eine unbewehrte FMI-Wand mit d = 50 cm wurde<br />
unter diesen Annahmen als statisch ausreichend bewertet. Nebenangebot 1 und 3 konnten<br />
aufgrund fehlender Nachweise nicht ausgeführt werden.<br />
Die Auftragserteilung erfolgte nach Beratungen an Firma B mit dem Nebenangebot 2 zum<br />
Preis von Nebenangebot 1.<br />
Folgende technische Mängel wurden bei der Abnahme beanstandet:<br />
- Spurrillen auf Schottertragschicht der Deichkrone<br />
- Entmischungen und Lockerungen im Bereich der Deichkrone<br />
- Ansaat nicht ordnungsgemäß<br />
- Böschungsneigungen teilweise nicht ordnungsgemäß
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 33<br />
- Bindige Rückstände auf der Deichkrone<br />
Pläne / Zeichnungen / Bilder<br />
0 1 2 3 4<br />
3 cm Mutterboden<br />
10 cm Mutterboden mit Magerrasen<br />
HQ100<br />
2<br />
1,70<br />
0,70<br />
1 : 1,9<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt mit Bodenkennwerten<br />
5 m<br />
1<br />
4 %<br />
3,00<br />
Splitt- / Sandgemisch 0/5<br />
1,50<br />
15 cm Schottertragschicht 0/32<br />
0,25 0,25<br />
15 cm Schottertragschicht 0/45<br />
3 % 470,15<br />
3 cm Mutterboden<br />
1<br />
466,15<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
1 : 1,8<br />
Bestand<br />
GOK<br />
FMI-Dichtwand mit eingestellten IPE-Trägern<br />
(d min = 40 cm; z = 300 kg/m³; k F,28,max = 10*E-07 m/s,<br />
βD,28,min = 4,0 MN/m²; IPE 160)<br />
1<br />
462,65<br />
2<br />
1<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
1 G, s, u' 19,0 10,0 32,5 0,0<br />
2<br />
k f<br />
[m/s]<br />
10*E-02<br />
bis -04<br />
γ γ' ϕ' c k f<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
T 19,0 9,0 22,5 10-15 10*E-09
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 34<br />
Bild 1: Zustand des Altdeiches Bild 2: Aufbau des alten Deichkörpers<br />
Bild 3: Abtreppung des Deichkörpers Bild 4: FMI-Fräse im Einsatz<br />
Bild 5: IPE-Träger vor dem Einbau Bild 6: Bohrkern Dichtwand
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
6.7 – Beispiel 02: Vagen<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 35<br />
Am Gewässer Mangfall wurde von Flusskilometer 21+500 bis 22+200 der rechtsseitige<br />
Deich abgetragen und neu aufgebaut.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Rosenheim)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Mangfall / Vagener Au (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: 10 Wochen<br />
Länge Sanierungsabschnitt: ca. 640 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit Deichtrasse<br />
und<br />
Flusskilometrierung<br />
Sanierungsjahr: 2002<br />
Gesamtkosten: 193.419 € (inkl. Nachträge)<br />
Sanierungsmethode: Abtrag und Neuaufbau des Deichkörpers<br />
Fluss-km 22+200<br />
Mangfall<br />
Fluss-km 21+200
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 36<br />
Zur Beibehaltung eines funktionierenden Ökosystems und zum Ausgleich der Ökobilanz<br />
wurde eine Art „Ökologische Bauaufsicht“ eingeführt. Zum Erhalt der Lebensräume und<br />
des Landschaftsbildes wurden teilweise Bäume am Deich belassen. Die Auswahl der<br />
verbleibenden Gehölzgruppen erfolgte unter folgenden Gesichtspunkten:<br />
- naturnahe Artenzusammenstellung<br />
- naturnahe Struktur<br />
- naturschutzfachlicher Wert der Gehölze<br />
- Beschattung des Mangfallufers<br />
- Landschaftsbild<br />
Da die geotechnischen Parameter des vorhandenen Deiches für die Standsicherheit sehr<br />
ungünstig waren, entschloss man sich, den Deich komplett abzutragen und neu zu errichten.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
Die festgestellten Mängel lassen sich auf folgende Punkte konzentrieren:<br />
- Starke Durchsickerung im Hochwasserfall<br />
- Lockere Lagerung des Deichmaterials<br />
- Krone ist zu schmal (< 2,5 m)<br />
Technische Maßnahmen (Regelquerschnitt in Abb. 2)<br />
Um den Deich zu ertüchtigen, wurden folgende Maßnahmen ergriffen:<br />
- Teilweise Rodung des Baumbestandes und Entfernung der Wurzelstöcke<br />
- Vollständiger Abtrag des Deichkörpers<br />
- Vollständiger Wiederaufbau des Deichkörpers<br />
- Anpassung der Böschungsneigungen auf 1:2<br />
- Erstellung eines Deichweges mit Fahrbahn aus Split-Sand-Gemisch mit bituminösem<br />
Fräsgut<br />
- Wiederherstellung des Vorlandes<br />
- Humusauftrag und Begrünung der Deichböschungen<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen<br />
Im Rahmen einer ökologisch-naturschutzfachlichen Bestandsaufnahme wurden die Lebensräume<br />
für Flora und Fauna erfasst und bewertet und darüber hinaus die schutzbedürftigen<br />
Gebiete ausgewiesen. Die zu erhaltenen Gehölzgruppen im Vorland, der Ober-
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 37<br />
bodenauftrag und das Saatgutgemisch wurden festgelegt. Der Einfluss des ertüchtigten<br />
Deiches auf die bestehenden Brunnen wurde ermittelt und beurteilt.<br />
Leistungsverzeichnis, Angebote, Vergabe<br />
Das günstigste Angebote (Firma B) erhielt den Zuschlag.<br />
Tab. 1: Angebotsspiegel<br />
Nr.<br />
Position Firma A Firma B Firma C<br />
01. Baustellengemeinkosten 31.730 38.531 84.688<br />
02.01. Vorarbeiten 27.566 43.648 38.791<br />
02.11. Erdarbeiten 127.108 62.555 54.398<br />
02.21. Straßenbauarbeiten 10.963 8.904 5.179<br />
03. Regiearbeiten 10.765 13.102 7.770<br />
Gesamtsumme: 208.133 166.740 190.827<br />
Gesamtsumme brutto 241.434 193.419 221.359<br />
Schlussrechnung / Nachtrag<br />
Bei der Schlussrechnung stellten sich geringe Abweichungen zu den ausgeschriebenen<br />
Mengen heraus, so dass die Höhe der Schlussrechnung ca. 8,5 % unter der Angebotsendsumme<br />
lag.<br />
Ein Nachtagsangebot wurde gestellt, da nicht vorhergesehenes, bituminöses Fräsgut geliefert<br />
und 10 cm dick auf den bestehenden Wirtschaftsweg aufgebaut wurde.<br />
Pläne / Zeichnungen / Bilder<br />
0 1 2 3 4<br />
5 m<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
0,25 1,25 1,25 0,25<br />
8cm Splitt-Sandgemisch 5 cm Humusbankett<br />
10cm Humus<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt<br />
1 : 2<br />
Urgelände<br />
3,00<br />
3 % OK Planum<br />
Deichschüttung<br />
OK Unterbauplanum<br />
5cm Humus<br />
1 : 2<br />
Deichmaterial bis hierhin abgetragen<br />
Urgelände
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 38<br />
Bild 1: Rodung am Deichkörper<br />
Deichvorland<br />
Bild 2: Lagerung entfernter Wurzelstöcke<br />
Bild 3: Modellieren der Böschung Bild 4: Deich nach Ende der Erdarbeiten<br />
Bild 5: Deichweg mit bituminöser Deckschicht<br />
Bild 6: fertiger Deich
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 39<br />
6.8 – Beispiel 03: Schweinfurt Süd<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Bei einer Zustandserfassung der Maindeiche bei Schweinfurt Süd im Jahr 2001 stellte<br />
sich heraus, dass die Deichböschungen i. d. R. zu steil waren und keine ausreichende<br />
Standsicherheit nachgewiesen werden konnte. Darüber hinaus wurde eine erhöhte Suffosionsgefahr<br />
festgestellt.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Schweinfurt)<br />
Art der Maßnahme: Zustandserfassung (Vorplanung)<br />
Gewässer: Main bei Schweinfurt Süd (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: Maßnahme befindet sich im Planungsstadium<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 2.800 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit Untersuchungsabschnitten<br />
und Mainkilometrierung<br />
Sanierungsjahr: Maßnahme befindet sich im Planungsstadium<br />
Gesamtkosten: 1.358.000 - 2.089.000 € (je nach Sanierungskonzept)<br />
Sanierungsmethode: - Sofortmaßnahme oder Gesamtertüchtigung<br />
- Innendichtung oder Oberflächendichtung<br />
Main-km 329,70<br />
Schweinfurt<br />
Abschnitt 4<br />
Main<br />
Abschnitt 2<br />
Main-km 327,00<br />
Abschnitt 8
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 40<br />
Da die Abschnitte 2, 4 und 8 (Main-km 327,00 bis 329,70) eine erhöhte Ertüchtigungspriorität<br />
aufgrund der anstehenden Bebauung haben, wurde die Machbarkeit sowohl einer<br />
schnell zu realisierenden Sofortmaßnahme oder als auch einer ganzheitlich durchzuführenden<br />
Gesamtmaßnahme, vorzugsweise mittels einer Innendichtung, untersucht.<br />
Aufgrund der landseitig anstehenden Bebauung ist eine Verbreiterung des Deiches nur<br />
wasserseitig in Betracht gezogen worden.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
Die Zustandserfassung gliedert sich in drei Teile:<br />
- Teil I: Deichbegehung / Deichbeschau vom 23.04.01<br />
- Teil II: Standsicherheitsuntersuchungen<br />
- Teil III: Sanierungsvorschläge<br />
Daraus ergab sich folgendes Ergebnis:<br />
- Die Standsicherheit der wasser- bzw. luftseitigen Deichböschungen ist auf über<br />
der Hälfte der Deichstrecke nicht gewährleistet<br />
- Die Sicherheit gegen innere Suffosion ist über die gesamte Länge nicht gegeben<br />
- Der erforderliche Freibord von 1,0 m ist nur in ca. 5 % der untersuchten Deichstrecke<br />
eingehalten (sonst nur 75 bis 80 cm)<br />
- durch teilweise zu geringe Kronenbreite (2,0 bis 3,0 m) und fehlenden Deichhinterweg<br />
ist die Deichverteidigung stark erschwert<br />
Technische Maßnahmen<br />
Für die Abdichtung der Deiche kommen nach dem Variantenstudium grundsätzlich zwei<br />
Möglichkeiten in Frage:<br />
- Aufbringen einer Oberflächenabdichtung aus natürlichem Dichtungsmaterial oder<br />
Einbringen einer Innendichtung<br />
Weiterhin nötig sind:<br />
- eine Verbreiterung des Deiches zur Wasserseite, um langwierigen Grunderwerbsfragen<br />
aus dem Weg zu gehen<br />
- eine Deichaufhöhung um 20 - 25 cm<br />
- eine Verbreiterung der Krone auf 3,5 m<br />
- eine Abflachung der Deichböschungen auf h:b = 1:3<br />
- teilweise die Anordnung eines Deichinterweges, wo Bebauung nicht an Deichfuß<br />
angrenzt
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Variante: Oberflächendichtung<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 41<br />
Nach Abtrag des Oberbodens wird eine Oberflächendichtung aus natürlichem Dichtungsmaterial<br />
vom wasserseitigen Deichfußpunkt mit der Dicke von 100 cm eingebaut.<br />
Um eine ausreichende Verlängerung des Sickerweges zu erzielen, wäre ein wasserseitiger<br />
Dichtungsteppich im ausgebauten Zustand notwendig.<br />
Für den Einbau wäre eine Baustraße am wasserseitigen Böschungsfuß erforderlich, welche<br />
sich aber auf Privatgrund befände.<br />
Variante: Innendichtung<br />
Bei der Wahl der Dichtungsart muss darauf geachtet werden, dass sowohl keine hohe<br />
Lasten auf der Deichkrone (max. 30 to) zulässig sind als auch Erschütterungen (Verflüssigungsgefahr)<br />
vermieden werden (Tab. 1). Deshalb können von der Krone aus nur sehr<br />
wenige Dichtungsverfahren eingesetzt werden. Da eine Festlegung auf ein bestimmtes<br />
Dichtungsverfahren nicht erfolgte, wurden für die weitere Kalkulation 50,- €/m 2 angesetzt.<br />
Tab. 1: Herstellungsverfahren Innendichtung von der Krone aus<br />
Verfahren Problematik<br />
Einphasenschlitzwand mit Tieflöffel keine<br />
FMI- Verfahren Gewicht Einbaugerät: ca. 58 to<br />
MIP- Verfahren Gewicht Einbaugerät: ca. 55 to<br />
Schmalwandverfahren Erschütterungen<br />
Vibrosolverfahren Erschütterungen<br />
Konventionelle Spundwand Erschütterungen<br />
Aufgrund dieser zu erwartenden Schwierigkeiten werden Lösungen gesucht, bei denen<br />
man die Deichkrone mit dem Einbaugerät nicht befahren muss (Tab. 2).<br />
Tab. 2: Herstellungsverfahren Innendichtung vom Deichfuß aus<br />
Verfahren Beschreibung Problematik<br />
Freigleitende<br />
Spundwand<br />
Einphasenschlitzwand<br />
mit<br />
Seilbagger<br />
Einbringen einer Spundwand<br />
mittels eines am<br />
Seil geführten Aufsteckrüttlers,<br />
auf der<br />
Spundwand reitend.<br />
Aushub eines suspensionsgestützen<br />
Schlitzes<br />
mit einem Seilbagger<br />
- Spundwände müssen durch ein (teilweise<br />
auf der Krone aufzustellendes) Gerüst<br />
abgestützt werden.<br />
- Vorgegebene Spundbohlenlänge<br />
- Kostenintensiv (ca. 100.- €/m 2 ); wegen<br />
Sprödbruchgefahr der Schlösser keine<br />
kaltgewalzten Profile möglich<br />
- wegen der verhältnismäßig niedrigen<br />
Leistungsfähigkeit kostenintensiv (ca.<br />
100.- €/m 2 )<br />
Da die Suffosionssicherheit in der tiefer gelegenen Kiesschicht höher ist als direkt unter<br />
der Deichaufstandsfläche, wo sich gleichförmiger Kies befindet, sollte die Dichtwand bis in
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 42<br />
die tiefere Kiesschicht einbinden. Daher ist von einer Einbindetiefe von 7,0 m auszugehen.<br />
Eine wesentliche Verbesserung der Sufffosionssicherheit könnte die Einbindung in den<br />
Keuper bewirken. Jedoch kann der Grundwasserstrom negativ beeinflusst werden. Die<br />
Kosten steigen zudem mit der höheren Einbindetiefe von 10 m an.<br />
Machbarkeit einer Sofortmaßnahme<br />
Nach der Vorwegnahme des Dichtungseinbaus als Sofortmaßnahme muss eine Gesamtertüchtigung<br />
in Form einer Deicherhöhung und Verbreiterung folgen. Die Integrierbarkeit<br />
der Sofortmaßnahme muss gewährleistet sein.<br />
Eine Innendichtung bietet Vorteile, da eine spätere Verschiebung der Deichachse zur<br />
Wasserseite möglich ist. Ein weiterer Vorteil wäre, dass z. B. eine Spundwand schon sofort<br />
nach der Sofortmaßnahme den erforderlichen Freibord durch einen herausstehenden<br />
Spundwandkopf sicherstellen kann.<br />
Aber auch bei einer Oberflächenabdichtung könnte einer Verbreiterung hin zur Wasserseite<br />
durch Kiesüberschüttung vorgenommen werden. Allerdings müsste ein 5 bis 10 m<br />
langer Dichtungsteppich im Vorland angeordnet werden, was einen relativ großen Erwerb<br />
von Grundstücksfläche im Vorland bedürfen würde.<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichkörper<br />
Der Deichkörper besteht überwiegend aus teilweise schluffigen Sanden (Boden 2; Tab. 3)<br />
oder aus enggestuften Tonen und Schluffen mit sandigen Beimengungen (Boden 1; Tab.<br />
3). Beide Böden können nicht von einander abgegrenzt werden.<br />
Untergrund<br />
Es ist keine durchgehende Auelehmschicht vorhanden. Unter der Deichaufstandsfläche<br />
stehen Sande (Boden 2) und Schluffe / Tone (Boden 1) mit einer Mächtigkeit von ca. 3 bis<br />
5 m an, die von einer schwach schluffigen, sandigen Kiesschicht (Boden 3) unterlagert<br />
werden. Die den Deichkörper unterlagernde Schicht hat ca. eine Mächtigkeit von 4,0 m.<br />
Darunter befinden sich Gesteine des Lettenkeupers<br />
Es wurden 192 Bohrungen und 92 schwere Rammsondierungen durchgeführt. Mittels<br />
Laborversuchen wurden die Korngrößenverteilung, die Dichte und die Durchlässigkeit<br />
ermittelt. Rahmenscherversuche wurden ebenfalls durchgeführt.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 43<br />
Tab. 3: Geotechnische Parameter des Untergrundes<br />
Schicht /<br />
Material<br />
Tone /<br />
Schluffe<br />
Nr. Bodenart<br />
DIN 18196<br />
Lagerung /<br />
Konsistenz<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
ϕ´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
1 TM. UM, TA, TL steif bis halbfest 19 -20,5 9- 10,5 25- 30 4 - 7 10 -8 bis 10 -11<br />
Sande 2 SE, SU, (SU*) locker bis<br />
mitteldicht<br />
Kiese 3 GU, GI, GW<br />
(GU*, GT*, SU*,<br />
ST*)<br />
Variantenstudium<br />
Folgende Maßnahmen wurden untersucht:<br />
17,5 -<br />
18,5<br />
9,5 -<br />
10,5<br />
30- 35 0 5*10 -3 bis 10 -<br />
mitteldicht 19- 21 10 - 13 32- 36 0 10 -2 bis 10 -4<br />
- Sofortmaßnahme mittels Oberflächendichtung ohne Gesamtertüchtigung (I)<br />
- Gesamtertüchtigung mittels Oberflächendichtung mit Sofortmaßnahme (II)<br />
- Gesamtertüchtigung mittels Oberflächendichtung ohne Sofortmaßnahme (III)<br />
- Sofortmaßnahme mittels einer Innendichtung ohne Gesamtertüchtigung (IV)<br />
- Gesamtertüchtigung mittels Innendichtung mit Sofortmaßnahme (V)<br />
- Gesamtertüchtigung mittels Innendichtung ohne Sofortmaßnahme (VI)<br />
Gegenüberstellung der Kalkulationskosten<br />
Tab. 3 und 4 zeigen die Kostenzusammensetzung für die einzelnen Sofortmaßnahmen<br />
mittels Oberflächen- (I) und Innendichtung (IV).<br />
Der Einheitspreis für die Lieferung, den Einbau und die Verdichtung der Oberflächendichtung<br />
wurde vom ausführenden Ingenieurbüro mit 35,- € angenommen. Die Ausführung<br />
der Maßnahme wurde entsprechend dem Regelquerschnitt in Abb. 3 angenommen.<br />
Bei nachfolgender Kostenschätzung der Sofortmaßnahme mit Innendichtung in Tab. 4<br />
wurde von einem in Abb. 4 dargestellten Regelquerschnitt ausgegangen. Die Dichtwandtiefe<br />
wurde im Mittel mit 7 m angesetzt. Für die Einheitspreiskalkulation wurde für die<br />
Dichtwand zunächst 50,- € angesetzt.<br />
Die den Sofortmaßnahmen abschließenden Ertüchtigungsarbeiten zur Fertigstellung der<br />
Gesamtmaßnahme belaufen sich bei vorhandener Oberflächendichtung auf 1.174.000 €<br />
(IIa) und bei vorhandener Innendichtung auf 605.000 € (Va). Diese Kostenschätzungen<br />
sind nicht näher aufgeschlüsselt. Die hohen Kosten zur Fertigstellung der Sofortmaßnahme<br />
mit Oberflächendichtung beruhen auf der Notwendigkeit, in diesem Fall einen Dichtungsteppich<br />
anbringen zu müssen.<br />
5
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 44<br />
Tab. 3: Kostenschätzung der Sofortmaßnahme mittels Oberflächenabdichtung (I)<br />
Titel Menge Einheit Einheitspreis<br />
(€)<br />
Preis (€)<br />
Baustelleneinrichtung 1 psch - 57.000<br />
Erstellung einer durchgehenden Baustraße auf der<br />
Wasserseite<br />
5.500 m 3<br />
18 99.000<br />
Oberboden auf Deichkrone und wasserseitiger Böschung<br />
abtragen, seitlich lagern und wieder andecken<br />
2.200 m 3<br />
10 22.000<br />
Sandig- schluffiges Material abtragen und übernehmen<br />
8.000 m 3<br />
10 80.000<br />
Bindiges Material für Oberflächenabdichtung liefern,<br />
einbauen und verdichten<br />
16.000 m 3<br />
35 560.000<br />
Begrünen 20.000 m 2<br />
0,30 6.000<br />
Prüffeld und Eigenüberwachung 1 psch - 50.000<br />
Sonstiges/ Unvorhergesehenes 1 psch - 41.000<br />
Summe: 915.000<br />
Tab. 4: Kostenschätzung der Sofortmaßnahme mittels Innendichtung (IV)<br />
Titel Menge Einheit Einheitspreis<br />
(€)<br />
Preis (€)<br />
Baustelleneinrichtung inkl. Baustraße 1 psch - 93.000<br />
Oberboden auf Deichkrone und Böschungsschultern<br />
abtragen, seitlich lagern und einbauen<br />
900 m 3<br />
10 9.000<br />
Rammkernbohrungen als Vorerkundung<br />
(a = 100 m, t = 9 m)<br />
200 Stk. 75 15.000<br />
Dichtungselement – Spundwand, z.B. Profil PAU<br />
2250 oder Einphasenschlitzwand<br />
8.000 m 2<br />
50 900.000<br />
Deichmaterial abtragen und übernehmen<br />
(drei Spartenquerungen in offener Bauweise)<br />
600 m 3<br />
5 1.200<br />
Bindiges Material liefern und einbauen<br />
(für Spartenquerungen)<br />
600 m 3<br />
18 10.800<br />
Sonstiges/ Unvorhergesehenes 1 psch - 46.000<br />
Summe: 1.075.000<br />
Ohne vorangehende Sofortmaßnahme (separater Einbau einer Oberflächendichtung)<br />
stellt sich die Kostenschätzung der Ertüchtigungsmaßnahme mittels Oberflächendichtung<br />
(III), wie in Tab. 5 dargestellt wird, dar.<br />
Wird die Maßnahme ohne Sofortmaßnahme mit einer Innendichtung (VI) durchgeführt, so<br />
stellt sich die Kostenschätzung, wie in Tab. 6 gezeigt wird, dar.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 45<br />
Tab. 5: Kostenschätzung der Gesamtertüchtigung mittels Oberflächenabdichtung (III)<br />
Titel Menge Einheit Einheitspreis<br />
(€)<br />
Preis (€)<br />
Baustelleneinrichtung inkl. Baustraße 1 psch - 150.000<br />
Oberboden auf Deichkrone und wasserseitiger Böschung<br />
abtragen, seitlich lagern und wieder einbauen<br />
6.500 m 3<br />
10 65.000<br />
Nachverdichten Planum 66.667 m 2<br />
0,15 10.000<br />
Sandig- schluffiges Material im Vorland ausbauen,<br />
seitlich lagern und wieder einbauen<br />
12.000 m 3<br />
11 132.000<br />
Deichschüttmaterial liefern und einbauen 8.000 m 3<br />
14 112.000<br />
Bindiges Material für Oberflächenabdichtung und<br />
Vorlandteppich liefern, einbauen und verdichten (ca.<br />
2.650 m x 11,0 m x 1,0 m)<br />
29.000 m 3<br />
35 1.015.000<br />
Mineralbeton für Deichweg liefern und einbauen 2.500 m 3<br />
25 62.500<br />
Begrünen der Böschungen und des Vorlandteppichs 55.000 m 2<br />
0,30 16.500<br />
Prüffeld und Eigenüberwachung 1 psch - 100.000<br />
Frostschutzkies und Mineralbeton für Deichhinterweg<br />
450 m 3<br />
20 9.000<br />
Deichschüttmaterial abtragen und zwischenlagern<br />
(Deichabtrag entlang Fährhaus)<br />
2.000 m 3<br />
4 8.000<br />
Sonstiges/ Unvorhergesehenes 1 psch - 77.000<br />
Summe: 1.762.000<br />
Tab. 6: Kostenschätzung der Gesamtertüchtigungsmaßnahme mittels Innendichtung (VI)<br />
Titel Menge Einheit Einheitspreis<br />
(€)<br />
Preis (€)<br />
Baustelleneinrichtung inkl. Baustraße 1 psch - 85.000<br />
Oberboden auf Deichkrone und wasserseitiger Böschung<br />
abtragen, seitlich lagern und einbauen<br />
4.000 m 3<br />
10 40.000<br />
Oberboden auf Deichkrone und wasserseitiger Böschung<br />
abtragen und übernehmen<br />
1.000 m 3<br />
5 5.000<br />
Nachverdichten Planum 50.000 m 2<br />
0,15 7.500<br />
Deichschüttmaterial liefern und einbauen 22.000 m 3<br />
14 308.000<br />
Mineralbeton für Deichkronenweg liefern und einbauen<br />
2.500 m 3<br />
25 62.500<br />
Begrünen der Böschungen 40.000 m 2<br />
0,30 12.000<br />
Prüffeld und Eigenüberwachung 1 psch - 50.000<br />
Frostschutzkies und Mineralbeton für Deichhinterweg<br />
450 m 3<br />
20 9.000<br />
Deichschüttmaterial abtragen und zwischenlagern<br />
(Deichabtrag entlang Fährhaus)<br />
2.000 m 3<br />
4 8.000<br />
Rammkernbohrungen als Vorerkundung (a = 100 m,<br />
t = 9 m)<br />
200 Stk. 75 15.000<br />
Dichtungselement – z.B. hydr. Geb. Innendichtung 18.000 m 2<br />
38 684.000<br />
Deichmaterial abtragen und übernehmen (drei Spartenquerungen<br />
in offener Bauweise)<br />
600 m 3<br />
5 1.200<br />
Bindiges Material liefern und einbauen (für Spartenquerungen)<br />
600 m 3<br />
18 10.800<br />
Sonstiges/ Unvorhergesehenes (ca. 5 %) 1 psch - 60.000<br />
Summe: 1.358.000
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 46<br />
Der Kostenvergleich (Tab. 7) ergibt, dass im Hinblick auf den späteren Ausbauzustand<br />
eine Innendichtung als komplett durchzuführende Einzelmaßnahme für eine Gesamtertüchtigung<br />
aus Kostengründen vorzuziehen ist.<br />
Tab. 7: Übersicht der kalkulierten Gesamtkosten der unterschiedlichen Ertüchtigungsvarianten<br />
Sofortmaßnahme mittels Oberflächendichtung<br />
(I)<br />
(ohne Gesamtertüchtigung)<br />
Gesamtertüchtigung mittels Oberflächendichtung<br />
(II)<br />
mit Sofortmaßnahme<br />
Gesamtertüchtigung mittels Oberflächendichtung<br />
(III)<br />
ohne Sofortmaßnahme<br />
Sofortmaßnahme mittels einer Innendichtung<br />
(IV)<br />
(ohne Gesamtertüchtigung)<br />
Gesamtertüchtigung mittels Innendichtung mit<br />
(V)<br />
Sofortmaßnahme<br />
Gesamtertüchtigung mittels Innendichtung ohne<br />
(VI)<br />
Sofortmaßnahme<br />
Kalkulierte Gesamtkosten [€]<br />
915.000 (I)<br />
1.174.000 (IIa) + (I) = 2.089.000 (II)<br />
1.762.000 (III)<br />
1.075.000 (IV)<br />
605.000 (Va) + (IV) = 1.680.000 (V)<br />
1.358.000 (VI)<br />
Die Nachrüstung mittels einer Innendichtung wurde darüber hinaus aus technischen<br />
Gründen favorisiert, da man der Ansicht ist, dadurch die Suffosionsgefahr sowohl im<br />
Deich als auch im Untergrund unter Kontrolle zu bekommen.<br />
Es wurde von Seite des Ingenieurbüros vorgeschlagen, eine Gesamtertüchtigung mit einer<br />
Innendichtung durchzuführen, weil diese über 20 % Kostenersparnis für das System<br />
Innendichtung gegenüber einer Oberflächendichtung und 15 - 20 % Kostenersparnis bei<br />
einer sofortigen Gesamtertüchtigung gegenüber einer Sofortmaßnahme mit anschließender<br />
Ertüchtigung bietet.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
ca. 2,30<br />
Massenanteil mit Körner < d [Gew.- %]<br />
Pläne / Zeichnungen<br />
ca. 2,30<br />
Massenanteil mit Körner < d [Gew.- %]<br />
0 1 2 3 4<br />
HQB = 206,92 m+NN<br />
0,063<br />
Korngröße [mm]<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 47<br />
5 m<br />
endgültige Planung<br />
Ertüchtigung<br />
1 : 3,0<br />
Ton Schluff<br />
Sand<br />
Kies Steine<br />
100<br />
90<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
1<br />
2 3<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0,002<br />
2<br />
63<br />
200<br />
3 %<br />
1 : 2,36<br />
3,50<br />
207,97<br />
1 : 3,17<br />
3,00<br />
nach Oberbodenabtrag<br />
Aufbringen einer<br />
Oberflächenabdichtung<br />
(Sofortmaßnahme)<br />
200,00<br />
1 : 3,0<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
1<br />
1 : 2,62<br />
2<br />
Deichachse (Bestand)<br />
3<br />
Bestand<br />
Straße (Bestand)<br />
γ<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
1 TM,UM19-20,5 9-10,5 25-30 4-7<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
2 SE,SU 17-18,5 9-10,5 30-35 0,0<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-08 -<br />
10*E-11<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-03 -<br />
10*E-04<br />
γ γ' ϕ' c kf<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
3 GU,GI 19-21 11-13 32-36 0,0<br />
10*E-02 -<br />
10*E-04<br />
Abb. 3: Regelquerschnitt der Ertüchtigungsvariante mit Oberflächendichtung<br />
0 1 2 3 4<br />
Ton<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0,002<br />
5 m<br />
endgültige Planung<br />
evtl. erforderliche Aufschüttung<br />
im Rahmen der Ertüchtigung<br />
HQB = 206,92 m+NN<br />
1 : 3,0<br />
1 : 3,17<br />
Schluff<br />
Sand<br />
Kies Steine<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
1<br />
0,063<br />
Korngröße [mm]<br />
2<br />
2<br />
3<br />
63<br />
200<br />
3 %<br />
1 : 2,36<br />
Innendichtung<br />
geplante Lage in Deichachse<br />
für den Endzustand<br />
3,50<br />
207,97<br />
3,00<br />
1 : 3,0<br />
200,00<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
1 : 2,62<br />
Deichachse (Bestand)<br />
Bestand<br />
Abb. 4: Regelquerschnitt der Ertüchtigungsvariante mit Innendichtung<br />
1<br />
3<br />
2<br />
Straße (Bestand)<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
1 TM,UM19-20,5 9-10,5 25-30 4-7<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
2 SE,SU 17-18,5 9-10,5 30-35 0,0<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
3 GU,GI 19-21 11-13 32-36 0,0<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-08 -<br />
10*E-11<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-03 -<br />
10*E-04<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-02 -<br />
10*E-04
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 48<br />
6.9 – Beispiel 04: Thalkirchen (Isar-Plan)<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
An der Isar wurden die Deiche zwischen Marienklausensteg bei Flusskilometer 153+350<br />
und dem Flauchersteg bei Flusskilometer 151+800 linksseitig in sechs Abschnitten und<br />
rechtsseitig in drei Abschnitten aufgehöht, verbreitert und teilweise mit einer Innendichtung<br />
versehen.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA München)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Isar (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: 9 Monate (15.10.2001 bis 14.06.2002)<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 1.600 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit<br />
Deichtrasse,<br />
Sanierungsabschnitten<br />
und Isarkilometrierung<br />
Sanierungsjahr: 2001 - 2002<br />
Gesamtkosten: 1.197.747,28 €<br />
Sanierungsmethode: - Aufhöhung<br />
- Innendichtung (MIP-Wand)<br />
- Teilweise Wand mit Winkelstützmauer<br />
L6<br />
L5<br />
L4<br />
L3<br />
L2<br />
L1<br />
Isar-km 152+400<br />
Isar Isar-km 153+285<br />
R3<br />
R2<br />
R1
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 49<br />
Aus Gründen des Naturschutzes und der Naherholung wurde das bestehende Gehölz<br />
größtenteils nicht gerodet. Die Standsicherheit des Deiches soll beim Lastfall „vollständige<br />
Erosion der wasserseitigen Böschung“ durch die Herstellung einer statisch wirksamen<br />
Dichtwand gewährleistet werden.<br />
Eine Erhöhung der Deiche war abschnittsweise aufgrund bestehender Gehölze auf dem<br />
Deich nur mittels aufgesetzter Wände möglich.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
Die festgestellten Mängel lassen sich auf folgende Punkte konzentrieren:<br />
- zu geringer Freibord (40 – 87 cm)<br />
- kein gegliederter Deichquerschnitt vorhanden und dadurch Gefährdung der Standsicherheit<br />
- geringe Deichkronenbreite (< 2,0 m)<br />
- kein Deichverteidigungsweg vorhanden<br />
- Gehölze im Vorland und auf dem Deichkörper<br />
Technische Maßnahmen<br />
Folgende übergreifende Maßnahmen wurden ergriffen:<br />
- Belassen des bestehender Baumbestandes am und auf dem Deich<br />
- Einbau einer Dichtwand:<br />
Es wurde eine MIP-Wand (d = 40 cm) als aufgelöste Trägerbohlwand mit Erdbetonausfachung<br />
und eingestellten Stahlträgern einer Länge von 6,0 bzw. 8,10 m und einem Abstand<br />
von 3,0 m eingebaut (Abb. 3). Zur Stabilisierung der Dichtwand wurde ein Ortbetonkopfband<br />
darauf betoniert. Die Erdbetonwand reicht mindestens 1,0 m unter den Deichfußpunkt.<br />
Die tiefer reichenden Stahlträger gewährleisten die Standsicherheit der Wand<br />
beim oben genannten Lastfall. Der Erdbetonkörper wird in einer Breite von 40 cm hergestellt,<br />
so dass sich eine Gewölbetragwirkung ausbilden kann (siehe Abb. 2).<br />
Abb. 2: Gewölbetragwirkung in<br />
Erdbetonausfachung<br />
40 cm<br />
Gewölbetragwirkung<br />
Erdbetonausfachung<br />
3,0 m<br />
HE 300 B
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 50<br />
Im ausgewählten Verfahren (Sondervorschlag 1, Tab. 2) werden die Bereiche mit den<br />
längeren Stahlträger im MIP-Verfahren abgeteuft (Abb. 3), so dass ein Vorbohren oder<br />
Einrütteln der Stahlprofile nicht mehr notwendig ist. Es kommt ein Gerät zum Einsatz, das<br />
nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts auf den zweiten übergesetzt wird. Die<br />
Träger werden dann in die tieferen Schlitze eingestellt. Der MIP-Wand-Suspension wird<br />
vor Erhärtung ca. 1-2 Tage weich bis breiartig sein. Die Dichtung bzw. Suspension hat die<br />
im Folgenden aufgezählten Kennwerte:<br />
w/z –Wert: 1,0<br />
Zementgehalt: 230 kg/m 3<br />
Einaxiale Druckfestigkeit: ca. 5,0 MN/m 2<br />
E-Modul: 600 – 800 MN/m 2<br />
Wasserdurchlässigkeit: 10 E –9 bis 10 E –11 m/s<br />
Übersicht der Maßnahmen in den Einzelabschnitten (6 linksseitig, 3 rechtsseitig)<br />
Abschnitt L1 zwischen Fkm 153+340 (Mariaklausensteg) und 153+200<br />
(Regelquerschnitt: Abb. 4)<br />
- Einbau einer MIP-Wand im Deichkern<br />
- Erhöhung des Deiches um 0,13 – 0,60 m für Freibordmaß = 1,0 m<br />
- Landseitige Verbreiterung um bis zu 1,5 m auf 2,5 m Kronenbreite<br />
Abschnitt L2 zwischen Fkm 153+200 und 153+110<br />
(Regelquerschnitt: Abb. 5)<br />
- Einbau einer MIP-Wand im Deichkern<br />
- Anlage von Ausweichbuchten auf der Krone zur Verbesserung der Deichverteidigung<br />
- wasserseitige Verbreiterung<br />
Abschnitt L3 zwischen Fkm 153+110 und 152+770<br />
- Einbau einer MIP-Wand im Deichkern<br />
Abschnitt L4 zwischen Fkm 152+770 und 152+720<br />
- analog Abschnitt L2<br />
Abschnitt L5 zwischen Fkm 152+720 und 152+620<br />
- analog Abschnitt L3<br />
Abschnitt L6 zwischen Fkm. 152+720 und 152+400<br />
- analog Abschnitt L3<br />
Abschnitt R1 zwischen Fkm 153+300 (Mariaklausensteg) und 153+275<br />
- Abbruch der bestehenden Mauer<br />
- Erhöhung des Deiches mittels einer neuen Mauer mit 1,0 m tiefen frostfreien<br />
Gründung
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 51<br />
Abschnitt R2 zwischen Fkm 153+275 und 152+800<br />
(Regelquerschnitt: Abb. 7)<br />
- Abbruch der bestehenden Mauer<br />
- Einbau einer MIP-Wand im Deichkern, wie linksseitig; Mauer wird bis Freibordmaß<br />
hochgezogen, danach angeschüttet<br />
Abschnitt R3 zwischen Fkm 152+800 und 152+530<br />
(Regelquerschnitt: Abb. 7)<br />
- Einbau einer MIP-Wand im Deichkern<br />
- Herstellung einer zusätzlichen Winkelstützmauer aus Stahlbeton, die frostsicher<br />
1,0 m unter GOK beigesteif an die Erdbetonwand angeschlossen wird<br />
Spezielle Lösung für Einzelbäume<br />
(Regelquerschnitt: Abb. 8)<br />
Da sich auf dem Deichkörper teilweise hochwertiger Baumbestand befindet, welcher erhalten<br />
werden sollte, und das ganze Gebiet stark zur Naherholung genutzt wird, hat man<br />
sich dazu entschlossen, vereinzelt den Baumbestand auf dem Deichkörper zu belassen<br />
und ihn mit Blöcken zu sichern. Der neue Deichkörper wird wasserseitig angeschüttet und<br />
mit einer kleinen Steinmauer vom Stamm abgegrenzt. So kann ein ausreichender Freibord<br />
erzielt werden, ohne den Deichkörper landseitig zu verbreitern; zusätzlich ist der<br />
Stamm durch die Blöcke gegen Erosion bei Überströmung des Deiches geschützt.<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen<br />
Im Zuge des landschaftspflegerischen Begleitplans wurden die Umweltauswirkungen, wie<br />
folgt, zusammengefasst:<br />
- positive bis sehr positive Wirkungen durch geplante Maßnahmen auf die Umwelt<br />
und die Schutzgüter<br />
- sehr positive Auswirkungen auf den Menschen aufgrund des verbesserten Hochwasserschutzes<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichkörper<br />
- überwiegend aus kiesigem Material (Boden 1, Tab. 1) mit unterschiedlich hohem<br />
Feinbestandteilen geschüttet (Isar-Kies teilweise mit feinkornreichen Sedimenten<br />
vermischt)<br />
- am linken Deich Abschnitte mit Stützkörper aus sehr feinkörnigem Auelehm<br />
- lockere bis allenfalls mitteldichte Lagerung (wahrscheinlich keine Verdichtung)<br />
- Zonen mit dichter Lagerung meist nur direkt unter der Krone (Nachverdichtung<br />
durch Verkehr)<br />
- Durchlässigkeiten meist hoch bis sehr hoch (siehe Tab. 1)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Untergrund<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 52<br />
- Deiche überwiegend auf gewachsenem Isarschotter (Boden 3, Tab. 1) geschüttet<br />
worden, in Teilbereichen besteht oberste Lage aus Auesanden bzw. Auelehmen<br />
(Boden 2, Tab. 1)<br />
- dichte Lagerung<br />
Die Erkundung umfasste sieben Kernbohrungen, sieben Standard-Penetration-Tests<br />
(SPT), 16 leichte Rammsondierung, 28 Rammkernsondierungen im Vorland und zehn<br />
Versickerungsversuche. Im Labor wurden die Korngrößenverteilung, die Zustandsgrenzen,<br />
der Wassergehalt und die Dichte der angetroffenen Bodenarten bestimmt. Zusätzlich<br />
wurden Rahmenscherversuche durchgeführt.<br />
Tab. 1: Geotechnische Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Schicht /<br />
Material<br />
Nr. Bodenart<br />
DIN 4022<br />
Lagerung /<br />
Konsistenz<br />
Kiese 1 G,s´,u´ locker bis<br />
mitteldicht<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
ϕ´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
20 11 32,5 0 5*10 -3 bis 10 -4<br />
Schluffiger Sand<br />
/ Auelehm<br />
2 U,s*,g weich 20 11 30 2 10 -6 bis 10 -7<br />
Flusskies 3 G,s´ dicht 21 12 37,5 0 5*10 -3 bis 10 -4<br />
Angebote, Vergabe<br />
Ausgeschrieben war eine Erdbetonwand (d = 40 cm). Neben einem Hauptangebot<br />
wurden vom Bieter, der den Zuschlag erhielt, auch zwei Sondervorschläge angeboten.<br />
Sondervorschlag 1 erhielt den Zuschlag (Tab. 3). Der Zuschlag erging somit<br />
nicht an das niedrigste Angebot, sondern an die technisch empfehlenswerteste<br />
Lösung. Die Variante mit Einrütteln der Träger war aufgrund vermuteter Beeinflussung<br />
der Dichtwand beim Einrütteln nicht zum Zuge gekommen.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 53<br />
Tab. 2: Hauptangebot und zwei Sondervorschläge eines Bieters<br />
Hauptangebot Art: MIP-Dichtwand<br />
Sondervorschlag 1<br />
(Vergabelösung)<br />
Dicke: 40 cm<br />
Annahmen: - Gewölbetragwirkung bildet sich<br />
zwischen den Trägern aus<br />
- Träger in Untergrund eingespannt<br />
Besonderheiten:<br />
Besonderheiten:<br />
Sondervorschlag 2 Besonderheiten:<br />
Tab. 3: Angebotsspiegel<br />
- Träger werden in gebohrte Löcher<br />
eingestellt<br />
- Verzahnte Lösung, Dichtwand<br />
wird bei Träger bis UK Träger<br />
geführt<br />
- Größere Dichtwandfläche, aber<br />
dafür entfallen die Bohrungen<br />
- Träger werden nicht in gebohrte<br />
Löcher eingestellt, sondern eingerüttelt,<br />
dadurch entfallen die<br />
Bohrungen<br />
Nr.<br />
Position Hauptangebot Sondervorschlag 1 Sondervorschlag 2<br />
1.1 Baustelle einrichten 206.363,15<br />
1.2 Erdarbeiten 230.350,00<br />
1.3 Bohr- und Sicherungsarbeiten<br />
1.4 Beton und Stahlbetonarbeiten<br />
1.251.065,00<br />
(Erdbetonwand:<br />
315.675)<br />
1.134.612,50<br />
(Dichtwand tiefer,<br />
Bohren entfällt)<br />
430.095,38<br />
1.5 Stundenlöhne 18.053,25<br />
Angebotssumme:<br />
(inkl. 16% MwSt)<br />
1.104.954,20<br />
(Träger eingerüttelt,<br />
Bohren entfällt)<br />
Summe: 2.135.926,78 2.019.474,28 1.989.815,98<br />
2.477.675,06 2.342.590,16 2.308.186,54
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Besonderheiten / Schäden / Mängel<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 54<br />
Im Falle der Überflutung der Überfahrt durch das Isarbett bzw. bei Frost mussten die Arbeiten<br />
unterbrochen werden. Bei den Bauarbeiten kam zu einigen Beschädigung von Kabeln<br />
der Telekom und der Stadtwerke.<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
Abb. 3: Längsschnitt<br />
Dichtwand (Sonderlösung<br />
1)<br />
0 1 2 3 4<br />
10 cm Auffüllung mit anstehendem<br />
feinkörnigen und nährstoffarmen<br />
Material<br />
Deichanschüttung mit<br />
anstehendem Kies<br />
2<br />
0 1 2 3 4<br />
Ordbetonkopfband<br />
8,10<br />
0,40<br />
3,50<br />
4,20<br />
5 m<br />
0,30 1,20<br />
3,00<br />
5 m<br />
3,50 - 4,00 m<br />
min 2,50 m<br />
2,0%<br />
0.10<br />
MIP Erdbetonwand,<br />
d=0,4 m, bis 1 m unter<br />
Vorlandniveau<br />
Abb. 4: Regelquerschnitt des Abschnitts L1<br />
3<br />
1<br />
1:2<br />
1,50<br />
1,50<br />
524,75<br />
521,47<br />
0,20<br />
0,60<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
geplante Deichkrone<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
1:2<br />
HEB 300, l=6 m<br />
Abstand 3,0 m<br />
520,00<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Freibordhöhe 527,71 müNN<br />
1 G,s´,u´<br />
2<br />
3 G,s´<br />
γ<br />
HHW 526,71 müNN<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
γ<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
γ<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
OK Erdbeton<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
20 11 32,5 0<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
U, s 20 11 30 2<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
21 12 37,5 0<br />
k f<br />
[m/s]<br />
5*10 E -3<br />
bis 1*10 E-5<br />
k f<br />
[m/s]<br />
1*10 E -6<br />
bis 1*10 E-7<br />
k f<br />
[m/s]<br />
5*10 E -3<br />
bis 1*10 E-4
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Werkkanal<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 55<br />
0 1 2 3 4<br />
5 m<br />
2,0%<br />
Ausweichbucht<br />
7,00<br />
Deichanschüttung (Mischung aus anstehendem Kies und<br />
anstehenden feinkönigen Böden)<br />
Abb. 5: Regelquerschnitt des Abschnitts L2<br />
0 1 2 3 4<br />
30 cm Mineralstoffgemisch<br />
(mit max. 3% Zementzumischung)<br />
1<br />
3<br />
HWS-Mauer Bestand<br />
wird rückgebaut<br />
Freibordhöhe 527,45 müNN<br />
HHW 526,45 müNN<br />
2<br />
5 m<br />
60 cm Ortbetonkopfband<br />
MIP Erdbetonwand, d=0,4 m<br />
bis 1 m unter Vorlandniveau<br />
1:1,5<br />
Böschungspflater<br />
2,25<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
2,0%<br />
1<br />
3<br />
520,00 müNN<br />
Abtrag zur Herrstellung einer<br />
befahrbaren Deichkrone<br />
30 cm Mineralstoffgemisch<br />
(mit max. 3% Zementzumischung)<br />
Entfernen der vorhandenen Wurzelstöcke<br />
und Pflasterung<br />
γ<br />
γ<br />
Freibordhöhe 524,55 müNN<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
HHW 523,55<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
3 G,s´ 21 12 37,5 0<br />
γ'<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
1 G,s´,u´ 20 11 32,5 0<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
1,50 1,50<br />
523,35<br />
HEB 360 l=8,1 m<br />
Abstand 2,5 m<br />
518,88<br />
Bäume auf der Böschung zwischen Schlichtweg und Deichkrone können teilweise erhalten bleiben<br />
Abb. 6: Regelquerschnitt des Abschnitts R2<br />
1<br />
3<br />
2<br />
1:1,5<br />
3<br />
1<br />
1 G,s´,u´<br />
2<br />
3 G,s´<br />
Schlichtweg<br />
γ<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
γ<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
γ<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
kf<br />
[m/s]<br />
5*10 E -3<br />
bis 1*10 E-5<br />
kf<br />
[m/s]<br />
5*10 E -3<br />
bis 1*10 E-4<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
20 11 32,5 0<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
U, s 20 11 30 2<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
21 12 37,5 0<br />
k f<br />
[m/s]<br />
5*10 E -3<br />
bis 1*10 E-5<br />
k f<br />
[m/s]<br />
1*10 E -6<br />
bis 1*10 E-7<br />
k f<br />
[m/s]<br />
5*10 E -3<br />
bis 1*10 E-4
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
1<br />
0 1 2 3 4<br />
5,5<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 56<br />
Abb. 7: Regelquerschnitt des Abschnitts R3<br />
Abb. 8: SonderlösungBaumbestand<br />
2<br />
Freibord<br />
HHW 525,15 müNN<br />
1<br />
3<br />
1<br />
5 m<br />
1,00<br />
2,5<br />
1<br />
2<br />
3<br />
0,20<br />
0,30<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
0 1 2 3 4<br />
1,50<br />
523,08<br />
5 m<br />
min. 2.5 m<br />
1,00<br />
4,00<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
0,60<br />
525,64<br />
2,0<br />
MIP Erdbetonwand, d=0,4 m<br />
bis 1 m unter Vorlandniveau<br />
(βR=1,2 MN/m 2)<br />
HEB 600, l=6 m<br />
Abstand 3,0 m<br />
519,39<br />
1<br />
30 cm gebundene Kiestragschicht<br />
Gehölzbestand entfernen<br />
20 cm Auffüllung mit anstehendem feinkornreichen<br />
und nährstoffarmen Material<br />
30 cm Bodenverbesserung mit Zement<br />
Freibordhöhe 531,61 müNN<br />
1 : 2,2<br />
10 cm Mineralstoffgemisch (mit max. 3 %<br />
Zementzumischung)<br />
0,30<br />
1,70<br />
Weg<br />
1,00<br />
30 cm Bodenverbesserung mit Zement<br />
1<br />
2<br />
G,s´,u´<br />
3 G,s´<br />
1 : 1<br />
HHW 530,61 müNN<br />
Böschungsfußsicherung bestehend aus:<br />
Grobsteine bzw. Abbruchmaterial, 25- 45 cm<br />
mit feinkornreichen Material gemischt, verdichtet eingebaut<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
1,50<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
20 11 32,5 0<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
U, s 20 11 30 2<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
21 12 37,5 0<br />
kf<br />
[m/s]<br />
5*10 E -3<br />
bis 1*10 E-5<br />
kf<br />
[m/s]<br />
1*10 E -6<br />
bis 1*10 E-7<br />
kf<br />
[m/s]<br />
5*10 E -3<br />
bis 1*10 E-4
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 57<br />
Bild 1: Herstellen der MIP-Wand Bild 2: Bohrgerät (Dreifachschnecke)<br />
Bild 3: HE 300 B-Träger (eingestellt) Bild 4: Betonieren des Ortbetonkopfbandes<br />
Bild 5: Baumsicherung durch Stein Bild 5: Verbleibende Gehölze auf dem<br />
Deich und im Vorland
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
6.10 – Beispiel 05: Grassau<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 58<br />
Die Deichsanierungsmaßnahmen umfassen zwei Teilabschnitte. Teilabschnitt 1 (Fkm<br />
9+570 bis 9+760) sieht auf einer Länge von 190 m den Bau einer Hochwasserschutzmauer<br />
aus Stahlbeton (Regelquerschnitt 1) vor. Teilabschnitt 2 (Fkm 9+740 bis 10+630)<br />
besteht aus einem reinen Erdkörper mit Deichbinnenberme gemäß Regelquerschnitt 2.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Traunstein)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Tiroler Achen / Grassau (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: keine Angaben<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 1037 m<br />
Sanierungsjahr: keine Angaben<br />
Gesamtkosten: 231.842 €<br />
Sanierungsmethode: - Errichtung einer Hochwasserschutzmauer mit Anschluss<br />
an eine bestehende Mauer (Abschnitt 1)<br />
Abb. 1: Lageplan mit Sanierungsabschnitten<br />
und<br />
Flusskilometrierung<br />
- Abtrag und Neuschüttung eines homogenen Deiches<br />
(Abschnitt 2)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 59<br />
Da eine Neuschüttung des Deiches im Siedlungsgebiet aufgrund der beengten Platzverhältnisse<br />
und dem mit einer Verbreiterung verbundenen Grunderwerb nicht oder nur sehr<br />
schwer durchführbar ist, wurde eine Hochwasserschutzmauer errichtet (Abschnitt 1).<br />
Die Tiroler Achen haben ein alpines Einzugsgebiet, wodurch der Wasserstand bei starken<br />
Niederschlägen sehr schnell ansteigt. Die Einstaudauer ist aber relativ kurz ist. Eine vollständige<br />
Durchsickerung des Deiches ist deshalb unwahrscheinlich, weshalb auf den Einbau<br />
eines Dichtungselementes verzichtet wurde (Abschnitt 2)<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
Die festgestellten Mängel lassen sich auf folgende Punkte konzentrieren:<br />
- Schüttmaterial besteht aus unsortiertem, unverdichtetem Kies aus den Tiroler Achen<br />
- Setzungen durch mangelnde Verdichtung<br />
- Kronenbreite zum Teil nur 1,50 m<br />
- Steile Böschungen (1: 1,75)<br />
- kein Deichverteidigungsweg<br />
- kein Freibord bzw. kein HQ100-Schutz<br />
Technische Maßnahmen<br />
Um den Deich zu sanieren, wurden folgende Maßnahmen im Abschnitt 1 ergriffen<br />
(Abb. 3):<br />
- Einbau einer Hochwasserschutzwand<br />
Diese besteht aus einem Stahlbetonkopf, welcher auf einer Stahlspundwand (Larssen<br />
600k, S 240 GB) gegründet ist (siehe Abb. 2 und 3). Die Mauer wurde landseitig angeböscht<br />
und bepflanzt, dadurch konnte das sichtbare Wandstück von max. 1,80 m Höhe<br />
reduziert werden.<br />
Um den Deich zu sanieren, wurden folgende Maßnahmen im Abschnitt 2 ergriffen<br />
(Abb. 4):<br />
- Abtragung des gesamten Deichkörpers<br />
- Neuaufbau des Deiches aus Material mit höherem Sandanteil<br />
- Erhöhung des Deiches (Neuer Freibord zwischen 79 und 85 cm)<br />
- Verbreiterung der Krone auf 3,0 m<br />
- Abflachung der Böschungen auf 1:2,5<br />
- Anordnung einer landseitigen Deichberme mit der Breite von 3,0 m
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 60<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Im Bett der Tiroler Achen steht bis weit in den Untergrund Kies (Boden 1, Tab. 1) mit unterschiedlichen<br />
Anteilen von Sand oder selten auch Sand (Boden 2, Tab. 1) an. Deichkörper<br />
und Untergrund bestehen aus dem gleichen Material.<br />
Der Erkundungsumfang war mit drei Rammkernbohrungen begrenzt. Im Labor wurden<br />
Korngrößenverteilung, Dichte und Durchlässigkeit bestimmt. Rahmenscherversuche wurden<br />
ebenfalls durchgeführt.<br />
Tab. 1: Geotechnischen Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Schicht /<br />
Material<br />
Nr. Bodenart<br />
DIN 4022<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
ϕ´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
Untergrundkies 1 G,s 19 11 35 0 10 -3 bis 10 -4<br />
Sand 2 S,u*,g 21 11,5 30 5 10 -6<br />
Deichkies 3 G,s,u´ 18 10 32 0 10 -4<br />
Leistungsverzeichnis, Angebote, Vergabe<br />
Es wurden von neun Firmen Angebote abgegeben. Die sieben kostengünstigsten Angebote<br />
sind in Tab. 2 dargestellt. Die Abweichungen bei den Positionen Stahlspundwand<br />
und Beton- und Stahlbetonarbeiten sind bei allen Anbietern etwa gleich. Ausschlaggebend<br />
für das Angebot der Firma A, die als kostengünstigste auch den Zuschlag erhielt,<br />
waren die Positionen Erdbau und Baustelleneinrichtung.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 61<br />
Tab. 2: Angebotsspiegel mit Preisangaben in €<br />
Nr. Position Firma A Firma B Firma C Firma D Firma E Firma F<br />
1. BE 14.765 33.092 23.425 20.869 16.316 25.524<br />
2. Erdarbeiten 17.424 24.168 23.384 31.567 32.546 25.849<br />
3. Abbrucharbeiten 2.250 3.275 1.968 3.036 3.270 2.270<br />
4. Stahl-Spundwand 104.099 97.199 100.782 107.604 112.167 102.433<br />
5. Beton- und Stahlbetonarbeiten<br />
45.863 44.285 58.594 51.482 56.053 63.296<br />
6. Stahlarbeiten 14.019 14.681 16.525 14.764 15.070 17.864<br />
7. Landschaftsbauarbeiten<br />
255 135 133 303 430 190<br />
8. Stundenlöhne 1.187 1.196 1.080 1.317 1.374 1.282<br />
Nettosumme 199.864 218.054 225.293 230.944 237.227 238.927<br />
Bruttosumme<br />
(inkl. MWSt)<br />
Pläne / Zeichnungen<br />
0 1 2 3 4<br />
Massenanteil mit Körner < d [Gew.- %]<br />
Ton Schluff<br />
Sand<br />
Kies Steine<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
60<br />
50<br />
40<br />
2<br />
3 1<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Bebauung<br />
0,002<br />
0,063<br />
Korngröße [mm]<br />
5 m<br />
Grenze<br />
bleibt<br />
231.842 252.943 261.341 267.895 275.183 276.670<br />
3<br />
536,00 m+NN<br />
2<br />
4,00<br />
Bestand<br />
1 : 5<br />
gepl.<br />
HW-Mauer<br />
63<br />
200<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
HQ100 = 539.60<br />
ca. 1 : 6<br />
1 2<br />
1<br />
538.02<br />
Larssen 600 K (S240GP)<br />
Länge: 6,80 m bzw. 5,80 m<br />
0,80<br />
γ<br />
γ'<br />
ϕ'<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
G, s 19,0 11,0 35,0 0<br />
c<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-03 -<br />
10*E-04<br />
γ γ' ϕ' c kf<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
2 S,u*,g 21,0 11,5 30,0 5 10*E-06<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
540.40<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
3 G, s, u' 18,0 10,0 32,0 0 10*E-04<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt von Ertüchtigung mit Hochwasserwand (Abschnitt 1)<br />
6,80 bzw. 5,80<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
kf<br />
[m/s]
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 62<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
neues Gelände<br />
1,30- 1,35<br />
ca. 0.20<br />
0,09 0,40 0,09<br />
Abb. 3: Detail des Anschlusses Ortbetonkopf-Spundwand<br />
0 1 2 3 4<br />
536,00 m+N.N<br />
Massenanteil mit Körner < d [Gew.-%]<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Ton<br />
0,002<br />
1.7<br />
3,50<br />
539,12<br />
5 m<br />
1 : 2,5<br />
4,25<br />
Schluff<br />
Sand<br />
Kies Steine<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
0,063<br />
2<br />
Korngröße [mm]<br />
3 1<br />
2<br />
63<br />
200<br />
1,20<br />
0.80- 0.83<br />
neues Gelände<br />
Larssen 600 K (S240GP)<br />
Länge: 6,80 m bzw. 5,80 m<br />
HQ 100<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
3,00<br />
1,50<br />
0,25 0,25<br />
3%<br />
Bestand<br />
1<br />
540.82<br />
0,81<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
G, s 19,0 11,0 35,0 0<br />
HQ100 = 540,01<br />
1 : 2,0<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-03 -<br />
10*E-04<br />
γ γ' ϕ' c kf<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
2 S,u*,g 21,0 11,5 30,0 5 10*E-06<br />
γ<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
3 G, s, u' 18,0 10,0 32,0 0 10*E-04<br />
Abb. 4: Regelquerschnitt der Deichertüchtigung mit reinem Erdbau (Abschnitt 2)<br />
1 2<br />
3<br />
ϕ'<br />
c<br />
kf
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 63<br />
6.11 – Beispiel 06: Tittmoning – Fridolfing<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Die Salzachdeiche, die in den Jahren 1912- 1920 aus dem anstehenden Salzachkies hergestellt<br />
worden sind, wurden im Wesentlichen durch das Errichten einer Deichbinnenberme<br />
mit Deichhinterweg und Deichentwässerung ertüchtigt.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Traunstein)<br />
Art der Maßnahme: Unterhaltungsmaßnahme<br />
Gewässer: Salzach (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: keine Angaben<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 1.000 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit<br />
Deichtrasse<br />
und Flusskilometrierung<br />
Sanierungsjahr: 2002<br />
Gesamtkosten: 763.978 € inkl. Nachträge<br />
Sanierungsmethode: - Errichten einer Deichbinnenberme mit Deichhinterweg<br />
- Sicherstellung der Deichentwässerung<br />
- Einbau von Geotextilien
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 64<br />
Da das einzubauende Material, ein sandiger bis stark sandiger Kies, im verdichteten Zustand<br />
und aufgrund des höheren Anteils an Mittelsand eine geringere Durchlässigkeit<br />
aufweist als das bestehende Deichmaterial, muss nach dem Abschieben des Mutterbodens<br />
zunächst eine gröbere Lage (schlufffreier Kies auf Geotextil) angebracht werden.<br />
Bei dieser reinen Erdbaumaßnahme war vor allem die Position im LV „Kies liefern, einbauen<br />
und verdichten“ für die Kostenbildung ausschlaggebend. Die damit verbundenen<br />
Transportkosten wurden in der Kalkulation sehr unterschiedlich berücksichtigt (Tab. 2).<br />
Zwischen Planung und Ausführung der Maßnahme lagen fünf Jahre. Teilweise aufgrund<br />
geänderte Rahmenbedingungen (Auflagen des Naturschutzes) und der seit 1997 eingetretenen<br />
Preissteigerung kam es zu einer erheblichen Erhöhung der ehemals kalkulierten<br />
Kosten.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
Die festgestellten Mängel lassen sich auf folgende Punkte konzentrieren:<br />
- kein gegliederter Deichquerschnitt<br />
- steile Böschungen 1:1,5<br />
- kein Deichverteidigungsweg<br />
- Deichkronebreite mit 2,30 m zu schmal<br />
Technische Maßnahmen (Regelquerschnitt in Abb. 2)<br />
Um den Deich zu ertüchtigen, wurden folgende Maßnahmen ergriffen:<br />
- landseitige Rodung bzw. Lichtung des Auwaldes zur Herstellung einer Berme<br />
- wasserseitige Rodung bzw. Lichtung des Auwaldes zur Herstellung eines Sicherheitsabstandes<br />
- Errichten einer Deichbinnenberme mit Deichhinterweg zur Deichverteidigung<br />
- Flächenhafte Deichdränung aus Kies mit Sandanteil < 15%<br />
- Einbau eines Geotextils als Filterlage zwischen Untergrund und Berme<br />
- Einbau eines Sickerrohrs DN 300 zur Deichentwässerung, welches im Hochwasserfall<br />
zu einem Revisionsschacht DN 1000 führt
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 65<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologischen Untersuchungen<br />
Der erstellte landschaftspflegerische Begleitplan summierte die Auswirkungen der Maßnahme<br />
auf<br />
- Verlust von Auwald und anderer Waldstrukturen<br />
- Verlust von Tümpeln, Flutmulden mit Gewässervegetation<br />
- Veränderung des Kleinklimas<br />
- Erhöhung des Versiegelungsgrades<br />
und formulierte die notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen:<br />
- Schaffung von Auwald durch Anpflanzung<br />
- Schaffung von Tümpeln<br />
- Anlegen von Flutmulden<br />
- Schaffung von Lebensraum für den Biber<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichkörper<br />
Der Deich besteht durchgehend aus sandigem Kies. Der Schluffanteil ist mit im Mittel 5%<br />
vernachlässigbar gering<br />
Untergrund<br />
Es wurden zwei Geotechnische Berichte angefertigt, der erste entstand im November<br />
1996 und beurteilte nur den Deichabschnitt bei Tittmoning. Der zweite Bericht vom September<br />
1997 wurde dann für den gesamten Bereich zwischen Fridolfing und Tittmoning<br />
erstellt.<br />
Die Sondierungen umfassten je 49 Rammsondierungen mit der mittelschweren Rammsonde<br />
auf Krone und am landseitigen Deichfuß. Darüber hinaus wurden 11 Schürfe auf<br />
der Krone (Tiefe 1,60 – 1,80 m) und 14 Schürfe am Deichfuß (Tiefe 2,0 m) angelegt.<br />
Da außer der Bestimmung der Kornverteilung keine weiteren bodenmechanischen Versuche<br />
durchgeführt worden sind, wurden alle anderen Parameter der Böden aus der Kornverteilung<br />
abgeschätzt oder aus den Erfahrungen früherer Ergebnisse geschlossen (Tab.<br />
1).
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 66<br />
Tab. 1: Geotechnischen Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Schicht / Material Nr. Bodenart<br />
DIN 4022<br />
ϕ´<br />
[°]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
Kies (Schüttung) 1 G, s´ 35 10 -3 – 10 -5<br />
Untergrundkies 2 G, s´ 37 -<br />
Auesande 3 S 30 -<br />
Leistungsverzeichnis, Angebote, Vergabe<br />
Die großen Unterschiede in den Angebotssummen (Tab. 2) resultieren größtenteils aus<br />
der Erdbaukalkulation. Dabei sind vor allem die beiden großen Massenpositionen ausschlaggebend:<br />
Filterkies und Grubenkies. Die Einzelpreise variieren erheblich, was mit<br />
den Transportwegen zusammenhängt. Firma A, welche auch den Zuschlag bekam, hatte<br />
sich Schürfrechte in Kiesgruben gesichert, welche unmittelbar in der Nähe der Baustelle<br />
lagen, wodurch sie insgesamt preislich am günstigsten anbieten konnten.<br />
Tab. 2: Angebotsspiegel<br />
Nr. Position A B C D E F G<br />
1. BE 90.200 60.419 377.460 58.610 142.000 94.080 180.700<br />
2. Rodungsarbeiten 14.850 30.373 38.804 24.890 12.575 27.424 17.350<br />
3. Erdarbeiten 727.660 831.320 1.186.150 1.073.040 956.150 1.261.720 1.122.590<br />
4. Binnenentwässerung<br />
141.020 155.131 191.598 183.026 224.000 170.280 209.832<br />
5. Geotextil 32.700 37.050 47.100 39.000 52.500 31.800 74.250<br />
6. Nachweisarbeiten 26.153 16.960 27.679 21.505 25.304 22.660 26.651<br />
Summe: 1.032.583 1.131.252 1.868.791 1.400.071 1.412.529 1.607.964 1.631.372<br />
Umsatzsteuer (16%): 165.213 181.000 299.007 224.011 226.005 257.274 261.020<br />
Angebotssumme: 1.197.796 1.312.253 2.167.797 1.624.082 1.638.534 1.865.238 1.892.392<br />
Nachträge / Mehrkosten<br />
Im Zuge der Ausführungsarbeiten hat sich gezeigt, dass die landseitig angesetzten Massen<br />
zur Schüttung der Deichbinnenberme mit Deichhinterweg nicht ausreichen. Darüber<br />
hinaus sorgten die schlechten Bodenverhältnisse im Bereich des landseitigen Deichlagers<br />
und die Auflagen der Unteren Naturschutzbehörden dafür, dass der Oberboden im Bereich<br />
des landseitigen Auflagers bis in eine größere Tiefe abgetragen werden musste. Der<br />
Mehrbedarf an Grubenkies betrug 8184 m 3 in diesem Querschnitt.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 67<br />
Auch aufgrund der volkswirtschaftlichen Preissteigerung seit 1997 – die Maßnahme wurde<br />
2002 ausgeführt – ergab sich eine effektive Kostenerhöhung von insgesamt rd.<br />
150.000.- Euro, was die Gesamtkosten von ehemals 612.423,- € auf 763.978,- € steigerte.<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
Oberbodenabtrag wieder<br />
einbauen<br />
2,00 1.60<br />
1 : 3<br />
0 1 2 3 4<br />
flächenhafte Deichdrainungaus Kies<br />
mit Sandanteil < 15 %<br />
Sammler DN 500<br />
Sickerrohr DN 300 J = 1 : 100<br />
Massenanteil mit Körner < d [Gew.- %]<br />
5 m<br />
12.00 24.00<br />
5.00<br />
3,00<br />
3.00 2,50<br />
0,25<br />
3%<br />
0,25<br />
Wassergebundene Decke<br />
3%<br />
1,00<br />
Geotextil<br />
Humusierung mit<br />
Rasenansaat<br />
Ton Schluff<br />
Sand<br />
Kies Steine<br />
100<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
3<br />
2<br />
50<br />
40<br />
1<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0,002<br />
0,063<br />
Korngröße [mm]<br />
2<br />
1 : 5<br />
1.50<br />
1.20<br />
Bestand neue Kiesschüttung in lagen verdichten<br />
63<br />
200<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
1<br />
5,10<br />
1 : 3<br />
2 3<br />
γ γ' ϕ' c kf<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
1 G, s` --- --- 35 0,0<br />
10*E-03<br />
bis -05<br />
γ γ' ϕ' c kf<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
2 G, s´ --- --- 37 0 ---<br />
γ γ' ϕ' c kf<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
3 S --- --- 30 5 ---<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt mit landseitiger Deichberme (HW-Stand im Bild rechts)<br />
Bild 1: Einbau des Geotextils als Filter Bild 2: Drainageschacht<br />
Bild 3: Einbau Binnenberme Bild 4: Fertiger Deich mit Deichhinterweg
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 68<br />
6.12 – Beispiel 07: Sofortmaßnahmen bei Tittmoning, Fridolfing<br />
und Laufen<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Einige Schäden nach dem Pfingsthochwasser 1999 wurden 2002 zwischen Tittmoning<br />
und Laufen in drei Abschnitten als Sofortmaßnahme beseitigt.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Traunstein)<br />
Art der Maßnahme: Unterhaltungsmaßnahme<br />
Gewässer: Salzach (Gew. I. Ordnung)<br />
Lage: Laufen Fridolfing Tittmoning<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 400 m 170 m 500 m<br />
Fkm.: 47+500 – 900 31+800 – 970 28+100 – 600<br />
Sanierungsjahr: 2000<br />
Kosten: 163.918 € 223.491 € 85.238 €<br />
Gesamtkosten (inkl. MWSt.): 536.653,78 €<br />
Sanierungsmethode: - Sicherung<br />
des Deichfußes<br />
Abb. 1: Übersicht der Sanierungsabschnitte<br />
- Sicherung des<br />
Deichfußes<br />
Abschnitt<br />
Tittmoning<br />
- Bau eines<br />
Deichhinterweges<br />
Abschnitt<br />
Fridolfing<br />
Abschnitt<br />
Laufen
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 69<br />
Die Maßnahmen sind Sofortmaßnahmen, die unmittelbar zur Beseitigung von Hochwasserschäden<br />
und zur unmittelbaren Sicherstellung der Hochwassersicherheit dienen. Die<br />
Arbeiten wurden aufgrund der Dringlichkeit nicht öffentlich ausgeschrieben.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand Laufen<br />
- rapide Tiefenerosion (Kolkbildung)<br />
- Längsverbau am Deichfuß um ca. 2 m unterspült, dadurch Standsicherheit nicht<br />
mehr gewährleistet<br />
Technische Maßnahmen Laufen (Regelquerschnitt siehe Abb. 2)<br />
- Abbruch von vorhandenem, beschädigten Deichsteinfuß<br />
- Sicherung des Deichfußes mit Wasserbausteinen<br />
Ober- und unterstrom des Deiches gelegene Abschnitte waren auch von der Eintiefung<br />
betroffen, deshalb wurde der Längsverbau auch in den Übergangsbereichen instand gesetzt.<br />
Ausgangszustand Fridolfing<br />
- Deichvorfuß wurde um ca. 1 m unterspült<br />
Technische Maßnahmen Fridolfing (Regelquerschnitt siehe Abb. 3)<br />
- Bestehende Böschung wurde freigelegt<br />
- Aufsetzen einer Steinmauer im Abstand von 5 m vor dem Böschungsfuß<br />
- Auffüllung mit weit gestuftem Grubenkies<br />
- Errichtung eines wasserseitigen Deichweges<br />
Ausgangszustand Tittmoning<br />
- Deichkrone sehr schmal (ca. 2,30 m)<br />
- Böschungen sind steil (1:1,25 bis 1:1,5)<br />
- kein Deichhinterweg<br />
- Deichmaterial teilweise inhomogen und sehr durchlässig<br />
Technische Maßnahmen Tittmoning (Regelquerschnitt siehe Abb. 4)<br />
- Bau eines Deichhinterweges<br />
- Abflachen der Böschungen auf 1:3 und flacher<br />
- Errichtung einer landseitigen Deichberme mit Deichverteidigungsweg<br />
- Verbreiterung der Krone auf 3,0 m<br />
- Sicherung des landseitigen Bereiches gegen Unterströmung durch Enkamat- Matten
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
bestehender Deich<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 70<br />
Berme Deichvorfuss Salzach<br />
Kolkbildung<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt Laufen<br />
0 1 2 3 4<br />
5 m<br />
Sicherung Vorfuss<br />
3,00 5,00<br />
Deichkrone<br />
3 %<br />
1 : 1,5<br />
weitgestufter Grubenkies<br />
(teiweise aus Deichrutschung)<br />
Abb. 3: Regelquerschnitt Fridolfing<br />
Wsp<br />
Sohle<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
Steinmauer<br />
(gesetzt)<br />
Wsp
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
0,40<br />
0 1 2 3 4<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 71<br />
5 m<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
6,70 3,00 3,70 3,00<br />
1 : 5<br />
bestehende Drainage DN 100<br />
Abb. 5: Regelquerschnitt Tittmoning<br />
1 : 3<br />
> 3 %<br />
Bodenaustausch<br />
Wsp<br />
Enkamat Typ A 7220/5<br />
Bild 1: Steinmauer bei Fridolfing Bild 2: Erdbau bei Tittmoning
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 72<br />
6.13 – Beispiel 08: Pähl – Wielenbach<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Um den bestehenden Deich zu verstärken und eine Deichüberwachung und Deichverteidigung<br />
zu gewährleisten, wird der Deichkörper in drei Abschnitten (Bauabschnitt VII, VIII,<br />
IX) verstärkt und mit einem Deichkronenweg versehen. Der doch recht starke Bewuchs,<br />
der sich auf den Böschungen befindet, wird ausgelichtet oder ganz entfernt.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Weilheim)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Ammer bei Pähl und Wielenbach (Gew. I. Ordnung)<br />
Länge Sanierungsabschnitt: ca. 4.200 m<br />
Sanierungsjahr: 1986<br />
Gesamtkosten: 1.469.964 € (2.875.000 DM)<br />
Sanierungsmethode: - landseitige Verbreiterung mit Abflachen der Böschungen<br />
- Bau eines Deichkronenweges<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit Bauabschnitten<br />
und Flusskilo-metrierung<br />
BA VII<br />
BA IX<br />
BA VIII<br />
Fluss-km 121+240<br />
Fluss-km 125+482
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 73<br />
Nach dem Hochwasser 1979 sind an der Ammer linksseitig zahlreiche Deichabschnitte<br />
auch mittels Deicherhöhungen ertüchtigt worden. Die rechtsseitigen Deiche werden dem<br />
Standard der bereits ertüchtigten linkseitigen Deiche angepasst.<br />
Da diese Maßnahme bereits 1986 durchgeführt wurde, unterlag das Bewuchskonzept für<br />
Deiche an der Ammer einem Gewässerpflegeplan, der nicht den heutigen a.a.R.d.T. entspricht.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
Die festgestellten Mängel lassen sich auf folgende Punkte konzentrieren:<br />
- vorhandener Uferbewuchs<br />
- Deichsetzungen<br />
- Böschungen steiler als 1:2,0<br />
- Deichbaumaterial ungeeignet<br />
- Kronenbreite teilweise nur 1,5 m<br />
- kein Deichverteidigungsweg<br />
Technische Maßnahmen (Regelquerschnitt in Abb. 2)<br />
Folgende Maßnahmen wurden ergriffen:<br />
- Auslichtung oder Entfernen der Weiden- und Erlengebüsche<br />
- landseitige Verbreiterung<br />
- Abflachen der landseitigen Böschungen auf h:b =1:2 bis 1:3<br />
- Verbreiterung der Krone auf 4,0 m<br />
- Erstellung eines 3,0 m breiten Deichkronenweges mit 30 cm starker Frostschutzkiesschicht<br />
und 8 cm starker wassergebundener Kiesdecke<br />
- Sicherung der wasserseitigen Böschung durch Faschinenlagen und Wippen<br />
Um die steile wasserseitige Böschung (Neigung steiler als 1:2,0) gegen Erosion zu sichern,<br />
kam eine Kombination aus Faschinenlagen und Wippen zur Anwendung. Nachdem<br />
das Schüttmaterial abgetragen war, wurden 10 cm Faschinenlagen längs der Böschung<br />
aufgebracht, auf welche senkrecht dazu Wippen (Ø 12 cm) aufgelegt und mit 80 cm langen<br />
Pfählen (Ø 8 cm) gesichert wurden (siehe Abb. 2).<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen<br />
Es wurde ein Gewässerpflegeplan erstellt, der den Erwerb von Uferstreifen, die Pflegearbeiten<br />
und den Ausbau des Gewässers besonders im Anbetracht des Bewuchses regelt.<br />
Geologische und geotechnische Erkundung
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 74<br />
Der anstehende Boden weist aufgrund des sich in früheren Jahrhunderten ständig wechselnden<br />
und verlegten Gewässerbettes der Ammer keine einheitliche Struktur auf und ist<br />
sehr unterschiedlich, d.h. die Bodenarten reichen von Grobkies bis Schluff und Ton.<br />
Kostenermittlung / Leistungsverzeichnis (alle Preise in DM)<br />
Wie in Tab. 1 zu sehen ist, waren die umfangreichen Erdarbeiten die größte Kostenstelle.<br />
Die umfangreichen Arbeiten zur Umsetzung des Gewässerpflegeplans wurden in einer<br />
eigenen Position „Bepflanzung“ berücksichtigt.<br />
Tab. 1: Kostenrechnung nach Leistungsverzeichnis<br />
Nr. Position Bauabschnitt VII Bauabschnitt VIII Bauabschnitt IX<br />
1. Baustelle einrichten 5.000 5.000 5.000<br />
2. Baustelle freimachen<br />
(Rodungsarbeiten)<br />
34.800 78.950 25.100<br />
3. Erdarbeiten 663.419 806.424 422.170<br />
4. Bepflanzen 48.560 26.640 38.160<br />
5. Sonstiges 9.500 63.500 27.000<br />
6. Wasserhaltung 2.500 --- ---<br />
7. Unvorhergesehenes 25.194 26.248 16.020<br />
Nettosumme: 900.000 1.150.000 621.540<br />
Gesamtsumme: 2.671.540<br />
Grunderwerb: 174.000<br />
Entschädigungen: 24.460<br />
Gebühren: 5.000<br />
Gesamtkosten: 2.875.000 DM (1.469.964 €)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
0 1 2 3 4<br />
Weiden- und Erlengebüsch auslichten<br />
2 cm starke Feinsandplanie auf 10 cm<br />
starke gebundene Kiesdecke (gewalzt)<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 75<br />
5 m<br />
(560,72 mü.NNns) = Hochwasser am 18.05.1979, Q =290 m3/s<br />
Wippen,<br />
Durchmesser 12 cm<br />
10 cm Faschinenlage, gesichert mit<br />
Pfählen Durchmesser 8 cm, mind 80 cm lang<br />
4,00<br />
0,50 3,00 0,50<br />
Rasen- und Humusabtrag<br />
min 20 -30 cm<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
Bestehende Deichkronenbreite =1,5 - 2 m<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt des rechtsseitigen Deiches<br />
Gelände variabel<br />
Weiden- und Erlengebüsch auslichten und,<br />
soweit durch Deichverstärkung erforderlich, ganz entfernen<br />
1 : 2- 3<br />
30 cm frostsichere Kiesschicht<br />
mit ausreichender Verdichtung<br />
min 25 cm Humusschicht mit Rasensaat<br />
Bild 1: Ammerdeich vor 1979 Bild 2: Ammerdeich vor 1979<br />
soweit möglich<br />
Böschungsfuß ausrunden
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 76<br />
6.14 – Beispiel 09: Mariaposching<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Der Donaudeich bei Mariaposching wurde durchgehend erhöht und verbreitert. Zusätzlich<br />
wurde eine Spundwand als Innendichtung eingebaut. Im Ortsteil, wo wegen Platzmangels<br />
keine landseitige Anschüttung möglich ist, wird die Spundwand mit einem Stahlbetonholm<br />
und einer landseitigen Verkleidung versehen (Abb. 2). Insgesamt kommen fünf verschiedene<br />
Regelquerschnitte zu Einsatz.<br />
Projektinformationen:<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (Deggendorf)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Donau (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: Keine Angaben<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 950 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit Sanierungsabschnitten<br />
und<br />
Lage der einzelnenRegelquerschnitten<br />
Sanierungsjahr: keine Angaben<br />
Gesamtkosten: 1.588.194 €<br />
Sanierungsmethode: - Aufhöhung mit Innendichtung (Spundwand)<br />
- Spundwand mit Stahlbetonholm und Verkleidung<br />
RQ III<br />
RQ IV<br />
Abschnitt 1<br />
RQ II<br />
RQ III<br />
RQ Ib<br />
RQ Ia<br />
Abschnitt 2
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 77<br />
Die Maßnahme wurde in zwei Abschnitte unterteilt (Abb. 1). Mit Einbezug der Bevölkerung<br />
wurde ein Variantenstudium mit Betrachtung von erdbaulichen und kombinierten<br />
Ertüchtigungskonzepten getrennt für diese Abschnitte durchgeführt.<br />
Aufgrund der an der Donau vorkommenden Biberpopulation müssen entsprechende<br />
Maßnahmen zum Schutz der Deiche getroffen werden, da sich bei einem vorangegangenen<br />
Hochwasserereignis gezeigt hat, dass der Deichkörper durch die Biber stark aufgelockert<br />
und mit Gängen durchzogen war.<br />
Sickerschlitze sind in der wasserseitigen Böschung vorzusehen, damit im Lastfall 2 „fallender<br />
Wasserspiegel“ ein schadloses Abführen des Sickerwassers durch die vorhandene,<br />
teilweise unwirksame Oberflächendichtung hindurch gewährleistet werden kann.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
- wasserseitige Dichtungsschicht<br />
- Kronenbreite abschnittsweise zu schmal<br />
- Böschungsneigungen wasserseitig 1:2,2<br />
- Böschungsneigungen landseitig 1:2,5 bis flacher 1:3,0<br />
- 5,0 m breiter Deichhinterweg mit bituminös befestigter Tragschicht entlang des<br />
gesamten Abschnitts<br />
- landseitige Binnenentwässerung<br />
Die festgestellten Mängel lassen sich auf folgende Punkte konzentrieren:<br />
- kein HQ100- Schutz (bestehender Schutz ist auf ein HQ30 ausgelegt)<br />
- kein Freibord<br />
- Oberflächendichtung teilweise zerstört und unwirksam<br />
- Hohlräume durch starken Biberbefall<br />
Technische Maßnahmen Abschnitt 1 (Regelquerschnitt Abb. 2)<br />
- Erhaltung des Deichhinterweges<br />
- Einbau einer Spundwand mit Stahlbetonholm<br />
- Übergangsbereich Spundwand-Erdkörper: Einbau grobes Schüttmaterial als Korrosionsschutz<br />
- Sickerschlitze in wasserseitiger Böschung für Entwässerung<br />
- Einbau eines landseitigen Fußfilters (5/56 mm) mit Entwässerung<br />
- Herstellen eines mindestens 2,5 m breiten Kronenweges<br />
Seitens der Gemeinde wurde die Lösung Spundwand mit aufgesetzter Mauer im Bereich<br />
zwischen Bau-km 0+000 bis 0+280 abgelehnt. Man einigte sich darauf den Ausbau nach
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 78<br />
RQ 1a (Abb. 2) auf den Bereich zu reduzieren, wo eine Verbreiterung im Erdbau wegen<br />
der ökologisch wertvollen Flächen nicht vertretbar war (Bau-km 0+000 bis 0+218). Im<br />
verbleibenden Teil des Abschnittes 1 kam eine erdbauliche Lösung mit Spundwand als<br />
Innendichtung an der wasserseitigen Böschungsschulter zur Ausführung (Bau-km 0+218<br />
bis 0+280).<br />
Technische Maßnahmen Abschnitt 2 (Regelquerschnitt Abb. 3)<br />
- Einbau einer Spundwand<br />
- Einbau eines landseitigen Fußfilters mit Entwässerungsleitung<br />
Der Regelquerschnitt des Deiches in Abschnitt 2 entsprach in etwa dem Regelquerschnitt<br />
1b in Abb. 3.<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen<br />
Es wurde eine Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt. Der dort enthaltene<br />
landschaftspflegerische Begleitplan beurteilte die Auswirkungen der geplanten<br />
Maßnahme<br />
- Beeinträchtigung des Ortsbildes durch Spundwand<br />
- Beseitigung blütenreicher Magerrasen auf der Nordseite (rote Liste)<br />
- Wasserqualität wird nicht beeinflusst<br />
- Verkleinerung des Hochwasserretentionsraumes um 6.800 m 3<br />
- Verlust von Wuchssorten und gepflanzten Hecken<br />
und legte die Ausgleichsmaßnahmen fest:<br />
- Bereitstellung von zusätzlichem, neuem Retentionsraum<br />
- Bepflanzungen mit Magerrasen<br />
- Neuschaffung von Auwald<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Der Ort Mariaposching liegt auf dem Alluvium und jüngsten Alluvium des Donautales.<br />
Diese feinkörnigen Böden (Auelehm, jüngerer Schwemmlöß) bilden in der Regel die Geländeoberkante<br />
und weisen Mächtigkeiten zwischen ca. 0,5 und 1,5 m auf. Im Polder<br />
Sulzbach finden sich zudem Talsand- und Flugsandablagerungen. Im Bereich Mariaposching<br />
werden jüngere Schwemmlößschichten angetroffen, deren Mächtigkeiten mehrere<br />
Meter betragen können. Unter den alluvialen Anlagerungen befindet sich Niederterrassenschotter,<br />
der aus sandigen bis schwach sandigen feinkiesigen Mittel- und Grobkiesen<br />
mit einer geringen Schlufffraktion besteht. Diese liegen wiederum auf dem Tertiär, in dem<br />
überwiegend tonige Schluffe und schluffige Tone, sowie Ton- und Schluffstein und Feinsanden<br />
angetroffen werden.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 79<br />
Das Deichschüttmaterial besteht aus einem sandigen Kies mit geringer Schlufffraktion,<br />
welcher überwiegend mitteldicht gelagert ist. Im einem der Schürfe wurde eine wasserseitige,<br />
ca. 0,8 m mächtige Dichtungsschicht mit darunter liegenden Wasserbausteinen angetroffen.<br />
Die Dichtungsschicht besteht aus feinsandigem Schluff.<br />
Von Bau-km 0+000 bis 0+280 wurden Auelehme bei den Bohrungen nur in geringem Maße<br />
angetroffen, es wurde aber trotz ihrer geringen Mächtigkeit davon ausgegangen, dass<br />
zumindest bei normalem Wasserstand eine Trennung der Grundwasserstockwerke stattfindet.<br />
Die Kiese und Sande stehen in mindestens mitteldichter bis dichter Lagerung an, ihre<br />
Mächtigkeit beträgt mindestens 4,0 bis 5,0 m.<br />
Auf der Deichkrone wurden fünf 10 m tief reichende Rammkernsondierungen durchgeführt.<br />
In Laborversuchen wurden u. A. die Korngrößenverteilung und die Zustandsgrenzen<br />
bestimmt.<br />
Tab. 1: Geotechnischen Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Bau km<br />
0+000 bis<br />
0+280<br />
Bau-km<br />
0+280 bis<br />
Ende<br />
Schicht /<br />
Material<br />
Nr. Bodenart<br />
DIN 4022<br />
Lagerung /<br />
Konsistenz<br />
Deichkörper 1 G,s,u´ mitteldicht<br />
bis dicht<br />
Kiessande 3 G,s-s*,(u´) mitteldicht<br />
bis dicht<br />
Deichkörper 1 G,s,u´ mitteldicht<br />
bis dicht<br />
Deckschicht 2<br />
S,t´,s´-s*, u´-u*,<br />
g´-g<br />
mitteldicht<br />
bis dicht<br />
U,fs`-fs*,t´ steif<br />
halbfest<br />
bis<br />
Kiessande 3 G,s-s*,(u´) mitteldicht<br />
bis dicht<br />
Kostenberechnung (Tab. 2)<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
ϕ´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
20 12 35 0 10 -3 bis 5*10 -<br />
22 14 35 0 10 -3 bis 5*10 -<br />
20 12 35 0 10-5<br />
20,5 10,5 22,5 5 10 -5 bis 5*10 -<br />
20,5 10,5 22,5 5 10-8<br />
22 14 35 0 10 -3 bis 5*10 -<br />
Da die Deichzuwegungen vorhanden waren, mussten keine zusätzlichen Erschließungsmaßnahmen<br />
durchgeführt werden. Hauptpositionen bilden der Erdbau und die Dichtwandarbeiten.<br />
4<br />
4<br />
4<br />
4
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 80<br />
Tab. 2: Kostenpositionen mit Preisen in €<br />
Nr. Position Gesamtpreis<br />
1. Baugrundstücke 77.476<br />
2. Erschließung 0<br />
3. Bauwerke 1.186.243<br />
3.1 Herrichten des Baugeländes 2.100<br />
3.2 Baustelleneinrichtung 73.750<br />
3.3 Betonarbeiten 51.640<br />
3.4 Erdarbeiten 599.123<br />
3.5 Dichtwandarbeiten 484.400<br />
3.6 Straßenarbeiten 5.231<br />
4. Nebenanlagen 8.100<br />
5. Landschaftspflegerische Maßnahmen 78.000<br />
6. Zusätzliche Maßnahmen 5.000<br />
7. Baunebenkosten 25.000<br />
Gesamtsumme: 1.379.819<br />
Gesamtkosten (inkl. MWSt.): 1.588.194<br />
Pläne / Zeichnungen<br />
0 1 2 3 4<br />
5 m<br />
10 cm Oberbodenabtrag<br />
10 cm Oberbodenauftrag<br />
Filtermaterial 5/56<br />
vorhandener Deichhinterweg<br />
(bituminös befestigt)<br />
Entwässerungsrohr DN 150<br />
0,80<br />
1 : 2,6<br />
1 : 1<br />
bestehender Deichkörper<br />
3<br />
min. 2,50 m<br />
317,60<br />
best. Deichkrone<br />
2 %<br />
Deichkrone Planung<br />
2<br />
1<br />
0,145 0,31 0,145<br />
310,50<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
0,40<br />
Spundwand<br />
Stahlbetonholm und landseitige Verkleidung<br />
316,15 (Aushubgrenze) Sickerschlitz alle 25 m<br />
Dramschotter 5/56, 5 cm Oberbodenauftrag<br />
bestehende Pflastersteine (Kantenlänge 30 cm)<br />
ca. 1 : 2,0<br />
HQ100 = 316,80<br />
bestehender Oberboden<br />
d > 20 cm<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt I a – Spundwand mit aufgesetztem Betonholm<br />
bestehende Dichtung<br />
(Schluff, feinsandig)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 81<br />
Abb. 3: Regelquerschnitt I b – kombinierte Lösung Spundwand und Erdbau
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 82<br />
6.15 – Beispiel 10: Sulzbach (Rücklaufdeich)<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Bei dem Hochwasser im August 2002 hat sich gezeigt, dass u. A. die Deichentwässerung<br />
des linksseitigen Rücklaufdeiches am Sulzbachableiter zwischen Mündung (Fluss-km<br />
0+000) und der Brücke nach Moosmühle (Fluss-km 1+600) nicht mehr funktionstüchtig<br />
war.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Deggendorf)<br />
Art der Maßnahme: Unterhaltungsmaßnahme<br />
Gewässer: Sulzbachableiter bei Mariaposching an der Donau<br />
Dauer der Sanierung: keine Angaben<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 1.600 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit Gewässerkilometrierung<br />
Sanierungsjahr: 2003<br />
Gesamtkosten: 280.000 €<br />
Sanierungsmethode: - Landseitige Anschüttung mit Stützkörperkies<br />
- Einbau von Querrigolen (Entwässerung) in der landseitigen<br />
Berme (Deichhinterweg)<br />
Mariaposching<br />
Maßnahme<br />
Fluss-km 1+600<br />
Fluss-km 0+000<br />
Donau
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 83<br />
Im Hochwasserfall war die bestehende und weitgehend zu erhaltene landseitige Deichberme<br />
mit darauf befindlichem Deichverteidigungsweg von Sickerwasser so aufgeweicht,<br />
dass der darauf befindliche Deichhinterweg nicht mehr befahren werden konnte. Die<br />
Deichverteidigung wurde erheblich erschwert. Deshalb wurden zur zusätzlichen Entwässerung<br />
Sickerschlitze (Querrigolen) im Abstand von 10 bis 15 m aus Rollkies (16/32 mm)<br />
eingebaut.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
- Kronenbreite ca. 2,5 m<br />
- aufgetretene Setzungen<br />
- kein HQ100-Schutz<br />
- Deichkörper bei Hochwasser stark durchsickert<br />
Technische Maßnahmen (Regelquerschnitt siehe Abb. 2)<br />
- Verbreiterung der Deichkrone auf 3,0 m landseitig mit Stützkörperkies<br />
- Ausgleich von Setzungen<br />
- Erhaltung der bestehenden landseitigen Deichberme<br />
- Einbau eines Fußfilters am landseitigen Schnittpunkt der Deichböschung zum Hinterweg<br />
aus Rollkies<br />
- Verbesserung der Durchlässigkeit des Deichhinterweges (Bermenfilter) durch Einbau<br />
von Querrigolen aus Rollkies mit Abstand 10 – 15 m (Abb. 3)<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Vor allem der Einbau des Stützkörpers verursachte einen Großteil der Gesamtkosten.<br />
Die Geräte wurden gleich in die Einheitspreise eingerechnet. Grundstücke<br />
waren, da der Deich nicht verbreitert wurde, keine zu erwerben.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Tab. 1: Kostenberechnung<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 84<br />
Nr. Kostenpositionen Preis (DM)<br />
1. Baugrundstücke 0<br />
2. Erschließung 0<br />
3. Bauwerke<br />
3.1. Baustelleneinrichtung 5.000<br />
3.2 Hochwasserdeich<br />
3.2.1. Oberboden abtragen, seitlich lagern 5.800<br />
3.2.2. Wurzelstöcke entfernen (rd. 80 Stck.) 6.000<br />
3.2.3. Bindiges Material abtragen und auf Dep. abtransportieren 30.000<br />
3.2.4. Aushub Filterschutzkies und auf Dep. abtransportieren 14.400<br />
3.2.5. Fußfiltermaterial liefern und einbauen 38.400<br />
3.2.6. Stützkörpermaterial liefern und einbauen 100.800<br />
3.2.7. Aushub Querrigolen und Abtransport auf Deponie 3.900<br />
3.2.8. Rigolenmaterial liefern und einbauen 10.400<br />
3.2.9. Oberboden wieder andecken 8.700<br />
3.2.10 Decke Deichhinterweg wieder in Stand setzen 5.000<br />
4. Kosten Geräte 0<br />
5. Landschaftspflegerische Maßnahmen 8.800<br />
6. Zusätzliche Maßnahmen 0<br />
7. Baunebenkosten 4.179<br />
Gesamtkosten (netto): 241.379<br />
Gesamtkosten (inkl.16 % MwSt): 280.000
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
Ausgleich Deichsetzungen<br />
Deichhinterweg<br />
(Bestand)<br />
Sickerrigolen b > 60 cm; a = 10- 15 m<br />
(Rollkies 16/32mm)<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 85<br />
0 1 2 3 4<br />
Verstärkung mit<br />
Stützkörperkies<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt<br />
Abb. 3: Detail Querrigolen<br />
Bestand<br />
> 60 cm<br />
5 m<br />
Fußfilter<br />
(Rollkies 16/32mm)<br />
3,00<br />
> 316,40 m+NN<br />
1,00<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
Abtrag bis anstehenden Stützkörperkies<br />
Bild 1: Einbau des Fußfilters Bild 2: Einbau des Stützkörperkieses<br />
HQ100
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 86<br />
6.16 – Beispiel 11: Stoegermühlbach<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Im Rahmen des Zwischenausbaus gemäß Deichbauprogramm 1988 und Hochwasserschutzkonzept<br />
1996 wurde zur Sicherstellung des notwendigen Hochwasserschutzes des<br />
Polders Thundorf-Aicha eine Ertüchtigung des rechtsseitigen Deiches am Stoegermühlbach<br />
von Deich- km 0+425 bis 1+300 in drei Abschnitten durchgeführt.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Deggendorf)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Stoegermühlbach bei Deggendorf an der Donau<br />
Dauer der Sanierung: 8 - 9 Monate<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 1.400 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit Lage der Regelquerschnitte<br />
und Deichkilometrierung<br />
Sanierungsjahr: 1999 - 2000<br />
Gesamtkosten: 1.013.417 € (1.982.072 DM)<br />
Sanierungsmethode: - Oberflächendichtung mit Grabenwand am wasserseitigen<br />
Deichfuß<br />
RQ III<br />
Deich-km 1+850<br />
- teilweise Rückverlegung um 15 m<br />
RQ II<br />
Deich-km 0+425<br />
RQ I
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 87<br />
Da der Mündungsbereich der Isar in die Donau vom Biber bewohnten Gebieten in Bayern<br />
gehört, wurden die Deiche mit Wühltiersicherungsmaßnahmen versehen. Weil die hier<br />
eingebaute natürliche Oberflächendichtung besonders anfällig für Wühltiertätigkeit ist,<br />
wurde als konstruktive Maßnahme ein Biberschutzgitter angeordnet.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
- Hohe Durchlässigkeit des Deichkörpers<br />
- Höhendefizite durch Setzungen<br />
- Freibord nur 25 cm<br />
- vorhandene Dichtung teilweise unwirksam<br />
- Deichkrone unbefestigt ca. 2,0 m breit<br />
- landseitig Wurzelstöcke im Deichkörper<br />
- befestigter Deichhinterweg mit 3,0 m Breite vorhanden (Breite 4,5 m von Deich-km<br />
0+450 bis 1+540)<br />
Technische Maßnahmen im Abschnitt 1 (Abb. 2)<br />
- Entfernung der vorhandenen Wurzelstöcke zwischen Deich-km 0+450 und 0+730<br />
- Verbreiterung der Deichkrone auf 3,0 m<br />
- Einbau einer mineralischen Oberflächenabdichtung aus mittelplastischem tonigem<br />
Schluff (Gehängelehm) mit k < 10 -7 m/s in 80 cm Stärke<br />
- Einbau eines vertikalen, 2,5 bis 3,0 tief reichenden Untergrundabdichtung (Grabenwand,<br />
d = 40 cm) zur Verlängerung des Sickerweges und Reduzierung der Sickerwassermengen<br />
- Einbau eines Biberschutzgitters aus verzinktem Maschendrahtgeflecht mit Maschenweite<br />
40/40 mm direkt auf die Oberflächendichtung unter dem Oberboden<br />
Technische Maßnahmen im Abschnitt 2<br />
- Einbau einer mineralischen Oberflächendichtung wie in Abschnitt 1<br />
- Einbau einer vertikalen Untergrundabdichtung wie in Abschnitt 1<br />
- Einbau eines Biberschutzgitters wie in Abschnitt 1<br />
Technische Maßnahmen im Abschnitt 3 (Abb. 3)<br />
- Rückverlegung des Deiches um 15 m im Bereich der Brücke (siehe Abb. ) auf einer<br />
Länge von 15 m<br />
- Abtrag von landseitigem Deichbereich<br />
- Neuprofilierung des Deiches mit Kiesmaterial<br />
- Verbreiterung der Deichkrone auf 3,0 m<br />
- Einbau einer Oberflächendichtung wie in Abschnitt 1 und 2<br />
- Einbau einer vertikalen Untergrundabdichtung wie in Abschnitt 1 und 2
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 88<br />
- Einbau eines Biberschutzgitters wie in Abschnitt 1 und 2<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen / Maßnahmen<br />
Im landschaftspflegerischen Begleitplan wurde den geplanten Eingriffen jeweils eine Ausgleichsmaßnahme<br />
gegenübergestellt (Tab. 1).<br />
Tab. 1: Eingriffe und Maßnahmen aus dem landschaftspflegerischen Begleitplan<br />
Eingriff Umfang zugeordnete Maßnahme Umfang<br />
Rodung naturnaher Auwälder<br />
Abtrag von Deichböschungen<br />
mit Magerrasen<br />
Verlust bedeutender Pflanzenvorkommen<br />
teilweiser Verlust einer<br />
feuchten, ökologisch bedeutsamen<br />
Rinne<br />
0,76 ha Umwandlung Pappelbestände 1,0 ha<br />
0,26 ha Entwicklung geeigneter Standorte für Magerrasen<br />
auf der gesamten Deichlänge, Auftrag von<br />
samenhaltigem Mähgut<br />
mehrere<br />
Fundpunkte<br />
> 0,3 ha<br />
Verpflanzung der größten Vorkommen ca. 270 m 2<br />
Anordnung einer neuen Rinne im Anschluss an<br />
die bestehende Rinne<br />
Auswirkungen Baubetrieb Minimierung durch ökologische Bauleitung<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichkörper<br />
Der Deichkörpers ist überwiegend aus Flusskies aufgebaut. Auf der Wasserseite ist eine<br />
mineralische Oberflächendichtung unterschiedlicher Güte und Stärke angeordnet, welche<br />
aber durch Erosion stark beschädigt und vom Gehölzbestand durchwurzelt ist.<br />
Untergrund<br />
Im Untergrund stehen Flusskiese an, die durch eine zum Teil sehr dünne Auelehmschicht<br />
überdeckt werden.<br />
Leistungsverzeichnis, Angebote, Vergabe<br />
Aufgrund bestehender Deichzuwegungen entstanden keine Kosten für die Erschließung.<br />
Hauptkostenstelle waren die Erdarbeiten. Die Herstellung der Grabenwand (100 DM/m²),<br />
der komplette Einbau der Oberflächendichtung (30 DM/m³) und die Anordnung des Bibergitters<br />
(10 DM/m²) waren in der Position Erdarbeiten enthalten.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Tab. 2: Leistungsverzeichnis<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 89<br />
Nr. Kostenposition Preis in DM<br />
1. Baugrundstücke 147.525<br />
2. Erschließung 0<br />
3.1. Herrichten des Baugeländes 23.550<br />
3.2. Baustelleneinrichtung 107.500<br />
3.3. Erdarbeiten 1.320956<br />
3.4. Beton- und Stahlbetonarbeiten 10.000<br />
4. Nebenanlagen 0<br />
5. Außenanlagen 21.500<br />
6. Zusätzliche Maßnahmen 70.000<br />
7. Baunebenkosten 28.000<br />
Gesamtkosten (netto): 1.729.031<br />
Gesamtkosten (inkl.16 % MwSt): 1.982.072<br />
Pläne / Zeichnungen<br />
0 1 2 3 4<br />
Biberschutzgitter aus verzinktem<br />
Maschendraht 3,8 mm<br />
Maschenweite 40/40 mm<br />
20 cm Mutterboden<br />
2,50 - 3,00<br />
311,50<br />
0,60<br />
Bestand<br />
0,40 0,40 0,40<br />
1,20<br />
5 m<br />
0,20 0,80<br />
OK Grabenwand<br />
(Trockenschlitzwand, Erdbaton)<br />
je nach Höhe des Vorlandes<br />
308,00<br />
1 : 2,2<br />
3,00<br />
314,00<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
2 %<br />
1 : 2,5<br />
bestehende Dichtung<br />
vorhandene Wurzelstöcke<br />
entfernen<br />
km 0+450 bis 0+730<br />
Oberflächenabdichtung aus mittelplastischem<br />
tonigem Schluff k < 10*E-7<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt im Bereich von Abschnitt 1<br />
10 cm Mutterboden<br />
Deichhinterweg<br />
4,50
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Einbindetiefe Biberschutzgitter 1,00<br />
0 1 2 3 4<br />
2,50 - 3,00<br />
0,60<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 90<br />
0,40 0,40 0,40<br />
1,20<br />
5 m<br />
Oberflächenabdichtung aus mittelplastischem<br />
tonigem Schluff k < 10*E-7<br />
Biberschutzgitter aus verzinktem<br />
Maschendraht 3,8 mm<br />
Maschenweite 40/40 mm<br />
20 cm Mutterboden<br />
1 : 2,2<br />
0,20 0,80<br />
3,00<br />
OK Grabenwand<br />
(Trockenschlitzwand, Erdbeton)<br />
je nach Höhe des Vorlandes<br />
308,00<br />
314,00<br />
2 %<br />
bestehende Dichtung<br />
Abb. 3: Regelquerschnitt im Bereich von Abschnitt 3<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
0,10<br />
1 : 2,5<br />
0,50<br />
10 cm Mutterboden<br />
Deichhinterweg<br />
4,50<br />
Neuaufbau mit kiesigem Material<br />
Abtragsgrenze je nach örtlichen Verhältnissen
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 91<br />
6.17 – Beispiel 12: Aicha – Mühlham<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Zwischen dem Schöpfwerk Aicha (Donau- km 2270,5) und dem Hochrand bei Mühlham<br />
(Donau- km 2271,3) wurde eine Verstärkung der rechtseitigen Donaudeiche im Rahmen<br />
der durchgeführten Sofortmaßnahmen nach dem Pfingsthochwasser 1999 durchgeführt.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Deggendorf)<br />
Art der Maßnahme: Unterhaltungsmaßnahme<br />
Gewässer: Donau bei Aicha (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: 8 - 9 Monate<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 950 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit<br />
Lage der<br />
Regelquerschnitte<br />
und Donaukilometrierung<br />
Sanierungsjahr: 2000<br />
Gesamtkosten: 386.690 € (756.300 DM)<br />
Sanierungsmethode: - Einbau einer wasserseitigen Oberflächenlehmdichtung<br />
- Kronenverbreiterung<br />
RQ I<br />
RQ II<br />
Donau-km 2270,5<br />
Donau-km 2271,3
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 92<br />
Da der Deich durch die wasserseitige Verbreiterung direkt am Ufer der Donau liegt<br />
(Schardeich), wird der Böschungsfuß mit einem Steinsatz aus Wasserbausteinen gesichert.<br />
Aufgrund einer vorhandener Kreisstraße und landseitiger Bebauung war keine landseitige<br />
Verbreiterung des Deichlagers möglich.<br />
Da bereichsweise eine 40 cm starke, undurchlässige Oberbodenschicht auf der landseitigen<br />
Böschung vorhanden ist, wurden dort Entwässerungsschlitze aus Schotter im Abstand<br />
von 25 m eingebaut, um eine Erhöhung der Sickerlinie bei Hochwasser zu vermeiden.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
- Kronenbreite von 2,2 bis 2,5 m<br />
- durch Setzungen keine ausreichende Höhe und kein HQ100-Schutz<br />
- steile Böschungsneigungen von ca. h:b = 1:2<br />
- unterschiedlich starke Oberflächendichtung aus schluffigem bis feinsandigem Material<br />
- Teilweise Vorhandensein einer landseitigen, undurchlässigen, 40 cm dicken Oberbodenschicht<br />
- starke Durchwurzelung der Dichtungsschicht<br />
Technische Maßnahmen Bau-km 0+000 bis 0+650 (Regelquerschnitt I, Abb. 2)<br />
- Rodung der Gehölze auf den Deich im wasserseitigern Vorland<br />
- Abtrag des Deiches bis auf Höhe der Kreisstraße<br />
- Verbreiterung des Deiches und der Deichkrone auf 3,0 m (wasserseitig)<br />
- geringe Aufhöhung für Ausgleich von Setzungen<br />
- Befestigter Deichkronenweg (15 cm Mineralbeton 0/32 mm)<br />
- Einbau einer Oberflächenabdichtung aus bindigem Material (d = 80 cm) mit 2,0 m<br />
Einbindung in den Untergrund<br />
- Einbau eines landseitigen Dräns aus kornabgestuftem Schottergemisch (5/56 mm)<br />
- Einbau einer Sickerrohrleitung (DN 200) längs des landseitigen Deichfußes<br />
- Sicherung des Deichfußes mit Steinsatz aus Wasserbausteinen<br />
- Einbau eines Biberschutzgitters aus verzinktem Maschendrahtgeflecht<br />
Technische Maßnahmen von Bau-km 0+650 bis 0+947 (Regelquerschnitt II)<br />
- Rodung der Gehölze auf den Deich im wasserseitigern Vorland<br />
- Verbreiterung des Deiches und der Deichkrone auf 4,5 m (wasserseitig)<br />
- geringe Aufhöhung für Ausgleich von Setzungen
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 93<br />
- Befestigter Deichkronenweg auf einer Breite von 3,5 m (30 cm Mineralbeton 0/32<br />
mm)<br />
- Einbau einer Oberflächenabdichtung aus bindigem Material (d = 120 cm) mit 2,0 m<br />
Einbindung in den Untergrund<br />
- Einbau von Schotterschlitzen im Abstand von 25 m für Entwässerung im Bereich<br />
der undurchlässigen Oberbodenschicht<br />
- Einbau eines Biberschutzgitters aus verzinktem Maschendrahtgeflecht<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen / Maßnahmen<br />
Es wurde ein vegetationskundliches, floristisches Gutachten angefertigt. Folgende landschaftspflegerischen<br />
Maßnahmen wurden durchgeführt:<br />
- Verpflanzung der artenreichen Trespen-Glatthafer-Rasen auf die neue landseitige<br />
Böschung (ca. 1.000 m 2 , Sohlendicke 25 cm)<br />
- Übertragung von Oberboden (Abtragsdicke 20 cm) aus den artenärmeren<br />
Trespen-Glatthafer-Rasen zur Erhaltung des im Boden enthaltenen Samenmaterials<br />
- Ansaat der neuen wasserseitigen Deichböschung mit einer speziellen Samenmischung<br />
- Schaffung von Magerstandorten auf der neuen landseitigen Böschung durch geringen<br />
Oberbodenauftrag (10 - 15 cm)<br />
- Neubegründung von Auwald bzw. Anlage eines Feldgehölzes (ca. 2.000 m 2 ) als<br />
Ausgleich für Rodungen<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichkörper<br />
Der Deich besteht aus einem Kieskern, der im Kronenbereich von einer 40 cm dicken<br />
Oberbodenschicht überdeckt wird.<br />
Leistungsverzeichnis, Angebote, Vergabe<br />
Da die Deichzuwegungen vorhanden sind, waren keine Kosten für Erschließungsmaßnahmen<br />
entstanden. Die Gerätekosten wurden in die Einheitspreise einbezogen.<br />
Hauptkostenstelle war die Erstellung des Deichbauwerkes. Dazu zählten u. A. der Einbau<br />
der Oberflächendichtung (15,50 DM/m³) und des Schottergemisches (31,50 DM/m³). Der<br />
Biberschutz wurde als Maschendrahtzaun (8,20 DM/m²) ausgeführt.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Tab. 1: Kostenberechnung<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 94<br />
Nr. Kostenposition Preis in DM<br />
1. Baugrundstücke 7.000<br />
2. Erschließung 0<br />
3. Deichbauarbeiten 585.600<br />
4. Kosten der Geräte 0<br />
5. Landschaftspflegerische Maßnahmen 55.250<br />
6. Zusätzliche Maßnahmen 0<br />
7. Baunebenkosten 5.000<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
310, 96 HW 99<br />
309, 40 MHQ<br />
0 1 2 3 4<br />
HQ100 Donau<br />
Bibergitter<br />
Deichfuß durch<br />
Wasserbausteine sichern<br />
5 m<br />
2 cm Mineralbeton 0/11<br />
20 cm Oberbodenauftrag<br />
1,50 - 2,00<br />
0,60<br />
Gesamtkosten (netto): 652.990<br />
Gesamtkosten (inkl.16 % MwSt): 756.326<br />
1 : 2<br />
Sohle Dichtungsgraben: Stat. 0+000 bis 0+600: 308,00<br />
Stat. 0+600 bis 0+650: 307,00<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt I<br />
0,80<br />
80 cm Lehmdichtung<br />
3,00<br />
0,25 2,50 0,25<br />
311,50 - 311,69 2 %<br />
Kiesauftrag<br />
5 %<br />
Kies vorhanden<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
1 : 1<br />
15 cm Mineralbeton 0/32<br />
1 : 2 - 1 : 2,5<br />
Riesel 4/8<br />
Kies<br />
Bestand<br />
Sickerrohrleitung DN 200<br />
(FF- Strabusil TS aus PE-HD)<br />
Schottergemisch 5/56<br />
10 cm Oberbodenauftrag<br />
75°<br />
Kreisstr. DEG 21<br />
Straßenmulde ca. 25 cm tief
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
0 1 2 3 4<br />
311, 14 HW99<br />
309, 50 MHQ<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 95<br />
HQ100 Donau<br />
5 m<br />
2 cm Mineralbeton 0/11<br />
30 cm Oberbodenauftrag<br />
Bibergitter<br />
Vorlandbreite<br />
ca. 2,00 bis 30,00<br />
1,50 - 2,00<br />
Abb. 3: Regelquerschnitt II<br />
0,60<br />
1 : 2<br />
Sohle Dichtungsgraben: Stat. 0+650 bis 0+947: 307,00<br />
Steinwurf ca. 0,5 m stark (2,5m 3/m)<br />
von Stat. 0+650 bis Stat. 0+947<br />
120 cm Lehmdichtung<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
4,50<br />
0,50 3,50 0,50<br />
311,69 - 311,74 2,5 %<br />
Kiesauftrag<br />
Kies vorhanden<br />
Schotterschlitze bis zum Kies,<br />
5 m breit, Abstand 25 m<br />
aus Schottergemisch 5/56<br />
30 cm Mineralbeton 0/11<br />
10 cm Oberbodenauftrag<br />
Grundstücksgrenze
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 96<br />
Bild 1: gerodetes Vorland Bild 2: Aushubarbeiten<br />
Bild 3: Einbau der Oberflächendichtung Bild 4: Verlegung des Bibergitters<br />
Bild 5: Bodeneinbau Bild 6: Fertiger Deich mit Fahrbahn
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
6.18 – Beispiel 13: Vohburg<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 97<br />
Entsprechend dem Landesentwicklungsprogramm wird der rechtsseitige Donaudeich am<br />
östlichen Ende des Ortsgebietes der Stadt Vohburg zwischen der Donaubrücke Vohburg<br />
(Donau- km 2441,800) und der Einmündung der Kleinen Donau in die Donau (Donau- km<br />
2437,200) durch eine Aufhöhung und den Einbau einer Spundwand in zwei Abschnitten<br />
(Los 1 und 2) ertüchtigt.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Ingolstadt)<br />
Art der Maßnahme: Ausbau<br />
Gewässer: Donau / Ingolstadt (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: 3 Monate<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 5.187 m<br />
Abb. 1: Übersichtslageplan<br />
mit Baulosen<br />
und Deichkilometrierung<br />
Sanierungsjahr: 2001<br />
Gesamtkosten: 2.941.708,46 € (5.753.481,65 DM)<br />
Sanierungsmethode: - Aufhöhung<br />
- landseitige Anschüttung<br />
- Einbringen einer Spundwand vom Typ Larrsen<br />
703-05 als Innendichtung<br />
Station<br />
5+187<br />
Los 2<br />
Station<br />
2+350<br />
Los 1<br />
Station<br />
0+000
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 98<br />
Aufgrund der erhöhten Gefahr von Wühltierschäden insbesondere durch Aktivitäten des<br />
Bibers ist die eingebaute Dichtung (Spundwand) gleichzeitig Wühltierschutz und reicht<br />
deshalb bis unterhalb des Niedrigwasserspiegels.<br />
Der Deich wird im Hochwasserfall von beiden Seiten, von der Kleinen Donau und der Donau,<br />
eingestaut. Aufgrund der beidseitigen, unterschiedlichen Belastung wurde an die<br />
Dichtung besondere Anforderungen bzgl. der statischen Funktion und der Durchlässigkeit<br />
gestellt, was letztendlich zum Einbau einer mittig liegenden Spundwand führte.<br />
Die Deiche wurden seit ihrem Bau 1820 bis 1850 immer wieder erhöht und verbreitert,<br />
was dazu geführt hat, dass sie einen sehr inhomogenen Aufbau haben.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
- Starker Bewuchs auf den Deichen<br />
- Freibord nicht ausreichend (im Mittel nur 60 cm, an kritischen Stellen nur ca.<br />
30 cm)<br />
- Kein gegliederter Querschnitt (keine Dichtung, kein Drän)<br />
- Steile Böschungsneigungen mit h:b = 1:2 bis 2,5)<br />
- Bestehende Bibergitter entlang der Ufer der Kleinen Donau<br />
Durchgeführte Sofortmaßnahmen 1999:<br />
- Befestigung der Deichkrone mit Kiestragschicht zur Verbesserung der Befahrbarkeit<br />
im Deichverteidigungsfall<br />
Technische Maßnahmen (Regelquerschnitt: Abb. 2)<br />
- Entfernung der Gehölze auf dem Deichkörper und innerhalb des Schutzstreifens<br />
von 5,0 m in den Vorländern<br />
- Erhöhung des Freibordes um durchschnittlich 50 cm auf mindestens 1,0 m<br />
- Überhöhung von 10 cm zum Ausgleich von Setzungen<br />
- Einbau einer Spundwand Typ Larrsen 703-05 als Innendichtung<br />
- Wasserseitige Verbreiterung des Deiches<br />
- Errichtung eines 4,0 m breiten befestigten Deichkronenweges mit Ausweichstellen<br />
(ca. 8,0 – 9,0 m breit) und einem Wendeplatz am Beginn des Deichabschnittes<br />
- Errichtung von sieben Deichrampen im Abstand von ca. 800 m<br />
- Belassen der Böschungsneigung auf der Seite der „Kleinen Donau“<br />
- Abflachen der Böschungsneigungen an der Donau im Wechsel mit bestehenden<br />
flachen Böschungsabschnitten zur Landschaftseinbindung<br />
- Abschnittsweise (Bau-km 1+200 bis 1+175) Neuerrichtung des bestehenden Wirtschaftweg<br />
mit einer Breite von 3,0 m
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 99<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen und Maßnahmen<br />
Im landschaftspflegerischen Begleitplan wurde festgestellt, dass trotz der Rodung schmaler<br />
Waldstreifen (1,0 – 4,0 m breit) parallel zum Deichverlauf keine großflächigen negativen<br />
Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu erwarten sind.<br />
Als Ausgleichsmaßnahmen wurden festgelegt:<br />
- Ersatz von intensiv gepflegten Rasendecken durch Magerrasen<br />
- Entwicklung von artenreichen Pflanzengesellschaften<br />
- Erhaltung von flachen Böschungen im Bereich von Deichkronen breiter als 4,0 m<br />
zur besseren Einbindung in die Landschaft<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichkörper<br />
Zum größten Teil besteht der Deichkörper aus eng intermittierenden und weit gestuften<br />
durchlässigen und frostunempfindlichen Kiessanden. Darüber hinaus sind Einlagerungen<br />
von Tonen und Sanden vorhanden, die witterungs-, erosions- und frostempfindlich sind.<br />
Untergrund<br />
Der Deichkörper wird von Auelehmen oder Auesanden unterschiedlichen Stärke unterlagert.<br />
Die aus schluffigen bis stark schluffigen Feinsanden bestehende Deckschicht weist<br />
große Scherfestigkeiten und geringe Durchlässigkeiten auf.<br />
Der Untergrund besteht wie der Deichkörper zum Großteil aus Kiesen.<br />
Im Bereich der Endteufen, etwa zwischen 10,0 und 13,0 m, wurden tertiäre Böden erbohrt,<br />
welche aus ausgeprägt plastischen Tone und stark tonigen Sanden bestehen.<br />
Im Rahmen der Erkundung wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:<br />
- 12 Bohrungen (B)<br />
- 19 Bohrsondierungen (BS)<br />
- 23 schwere Rammsondierungen (DPH)<br />
- 8 leichte Rammsondierungen (DPL)<br />
- 32 Grundwassermessstellen
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 100<br />
Tab. 1: Geotechnische Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Schicht /<br />
Material<br />
Nr. Bodengruppe<br />
DIN 18196<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
f´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
Kiessande 1 GE, GW, GI, 18 - 20 10 - 12 30 - 34 0 10 -2 bis 10 -6<br />
Sande 2 SU 19 - 21 11 - 13 27 - 32 4 - 8 10 -3 bis 10 -8<br />
Ton / Schluff 3 TM, TL, UL 20 - 21 10 - 11 25 - 30 5 - 10 10 -6 bis 10 -10<br />
Tertiär 4 TA, ST* 20 - 21 10 - 11 25 25 - 40 10 -6 bis 10 -10<br />
Leistungsverzeichnis / Angebote / Vergabe<br />
Das Leistungsverzeichnis war grob in vier Hautpositionen unterteilt:<br />
- Baustelleneinrichtung<br />
- Erdarbeiten<br />
- Spundwandarbeiten<br />
- Stundenlohnarbeiten / Gerät / Material<br />
Die Spundwandarbeiten wurden separat ausgeschrieben. Das Wasserwirtschaftsamt formulierte<br />
im Ausschreibungstext einen „Amtsvorschlag“ (Spundwandlösung). Bei Vergabe<br />
von beiden Losen an einen Anbieter wurden teilweise vom Anbieter Nachlässe gewährt.<br />
Lösungen, die z. B. ein Verfahren der Bodenvermörtelung beinhalteten, wurden ausgeschlossen.<br />
Einen Auszug aus den abgegebenen Angeboten enthalt Tab. 2.<br />
Tab. 2: Auszug der Angebotspreise für Spundwandarbeiten (Los 1 + 2)<br />
Bieter Beschreibung Einheitspreis<br />
[DM/m 2 Angebotspreis<br />
] (brutto) [DM]<br />
A Profil Arbed DWZ 245/800 118 6.438.307<br />
B Profil Arbed DWZ 245/900 130,28 6.831.905<br />
C Amtsvorschlag Larssen 703 - 7.801.492<br />
D Profil Arbed DWZ 245/800 104,05 6.050.980<br />
E FMI-Wand, Sondervorschlag 2, mit Zugabe Acrylfasern Ausschluss! 4.914.907<br />
F Profil Arbed DWZ 245/800 119,4 6.506.093<br />
G Larrsen 703 - 6.867.484<br />
H Profil Arbed DWZ 245/900 121,76 6.860.177<br />
Profil Arbed DWZ 245/750 103,67 6.003.095<br />
I Amtsvorschlag - 5.883.755<br />
Profil Arbed DWZ 245/800 - 5.539.931<br />
Larssen 703-05 - 5.852.086<br />
J MIP-Wand mit eingestellten IPE-Trägern Ausschluss! 5.696.273<br />
K Arbed PU6 110 6.442.054<br />
Vergabe<br />
Der Auftrag für beide Lose wurde an Bieter I mit dem Angebot Spundwand Typ Larssen<br />
703-05 zu einem Preis von 5.753.481,65 DM (2.941.708,46 €) vergeben.
Massenanteil mit Körner < d [Gew.-%]<br />
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
0 1 2 3 4<br />
Donau<br />
HQ100<br />
bestehender Wirtschaftsweg<br />
1,00<br />
Korngröße [mm]<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 101<br />
5 m<br />
Bestand wird um<br />
ca. 50 cm erhöht<br />
15 cm Oberbodenabtrag<br />
Neigung Bestand > 1 : 2,5<br />
1<br />
Ton Schluff<br />
Sand<br />
Kies Steine<br />
100<br />
90<br />
80<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
Dichtwand aus<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
2<br />
1<br />
Spundwandprofilen<br />
Länge: t = 7.5m<br />
0<br />
0,002<br />
0,063<br />
2<br />
63 200<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt<br />
1 2<br />
3<br />
0,50<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
Lage SPW bezogen auf<br />
Kronenkante kl.Donau<br />
3%<br />
Ausgangspunkt<br />
bestehender Deich<br />
uneinheitlicher Aufbau aus wechselnd<br />
schluffigen, sandig/kiesigen Schichten<br />
quartäre Kiese<br />
Ok Rammplanum<br />
ca.0.3-0.4m unter OK SPW<br />
Neigung Bestand ca.1 : 2 bis 1 : 2,5<br />
Keine durchgehende Talauelehm/-sandschicht vorhanden<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
1 GE,GW 18-20 10-12 30-34 0<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
2 SU 19-21 11-13 27-32 4-8<br />
Zwischenlagerung des abgetragenen Materials<br />
auf Donauseitiger Böschung<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-02 -<br />
10*E-06<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-03 -<br />
10*E-08<br />
15 cm Oberbodenabtrag<br />
γ<br />
HQ100<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
Kleine Donau<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
3 TM,TL 20-21 10-11 25-30 5-10<br />
Bild 1: Deich vor der Ertüchtigung Bild 2: Spundbohle Larrsen 703-05<br />
Bild 3: Einrammen der Spundwand Bild 4: Fertig gestellter Deich<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-06 -<br />
10*E-10
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 102<br />
6.19 – Beispiel 14: Wackerstein – Dünzing (Pionierübungsplatz)<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Der Deich wurde nach dem Pfingsthochwasser 1999 in drei Abschnitten ertüchtigt. Die<br />
Lösung mit Dichtwand und aufgesetztem Betonholm aus Abschnitt II wird näher betrachtet.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Ingolstadt)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Donau bei Wackerstein (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: 5 Monate<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 600 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit<br />
Bauabschnitten<br />
und Donaukilometrierung<br />
Sanierungsjahr: 2001<br />
Gesamtkosten: 806.329,86€ (1.577.044,14 DM)<br />
Sanierungsmethode: - Stahlspundwand als Innendichtung mit<br />
aufgesetztem Betonholm<br />
Donau-km 2441,25<br />
Abschnitt II:<br />
Spundwand mit<br />
Betonholm<br />
Abschnitt III:<br />
Deichvorschüttung und<br />
Deichdichtung<br />
Donau-km 2438,0<br />
Abschnitt I:<br />
Deichvorschüttung und<br />
Deichdichtung<br />
+Mauererhöhung in<br />
Teilbereichen
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 103<br />
Auf dem Deich befindet sich eine Staatsstraße, so dass eine erdbautechnische Erhöhung<br />
des Deiches nur durch wasserseitige Maßnahmen durchzuführen gewesen wäre. Man<br />
entschied sich, die Erhöhung mit einer aufgesetzten Wand zu bewerkstelligen, die auf<br />
einer statisch wirksamen Dichtung gegründet werden sollte.<br />
Das Vorhandensein der Staatsstraße hatte auch Auswirkungen auf die in Betracht zu ziehenden<br />
Lastfälle. Es mussten Scherlasttransporte ebenso berücksichtigt werden wie Aufpralllasten<br />
von Fahrzeugen.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
Die festgestellten Schäden und Mängel lassen sich auf folgende Punkte konzentrieren:<br />
- teilweise unwirksame Oberflächenabdichtung<br />
- Schäden am Deich durch Erosion und Suffosion<br />
- zu geringer Freibord<br />
Technische Maßnahmen (Regelquerschnitt siehe Abb. 2)<br />
- Einbau einer Dichtung in Form einer Spundwand<br />
- Einbau von Querleitungen durch die Spundwand zur Entwässerung der Staatsstraße<br />
in den Vorfluter<br />
- Schaffung eines Freibordes von 1,00 m durch aufgesetzte Mauer (Betonholm)<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichkörper<br />
Die Deiche sind überwiegend aus sandig- kiesigem Material mit lockerer bis sehr lockerer<br />
Lagerung aufgebaut.<br />
Untergrund<br />
Die Deiche befinden sich auf einer Auelehm- bzw. Auesandschicht, deren Schichtmächtigkeit<br />
zum Teil sehr gering ist. Im Bereich von Altarmen der Donau sind diese Auelehmschichten<br />
komplett unterbrochen und es ist grobes, durchlässiges Material vorhanden. In<br />
Tiefen zwischen 6 und 9 m befinden sich dicht gelagerte Bereiche, die ein Vorbohren<br />
beim Einbringen der Spundbohlen erforderlich machen.<br />
Die Erkundung umfasste sowohl zahlreiche Aufschlussbohrungen als auch zahlreiche<br />
Rammsondierungen. Es wurden in Laborversuchen die Korngrößenverteilung, die Durchlässigkeit<br />
und die Dichte bestimmt.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 104<br />
Tab. 1: Geotechnische Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Schicht / Material Nr. Bodenart<br />
DIN 4022<br />
Lagerung /<br />
Konsistenz<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
f´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
Kiese (oberste Lage) 1 G,s mitteldicht 20 11 37,5 0 5*10 -3 bis 10 -4<br />
Kiese 2 G,s locker 18 9 33 0 10 -3<br />
Tone / Schluffe 3<br />
Angebote / Vergabe<br />
T/U - 19 9 22,5 5 -<br />
T/U halbfest/ fest 20 10 25 10 - 25 -<br />
Maßgebende Kostenstelle waren die Spundwandarbeiten. Zwischen dem günstigsten<br />
Anbieter mit 1.577.042 DM bis zum teuersten Anbieter mit 2.357.154 DM lag eine Spanne<br />
von 33 % (Tab. 1). Einige Baufirmen gewährten auch Nachlässe zwischen 2% und 5 %.<br />
Den Zuschlag erhielt das Angebot A mit dem niedrigsten Angebot.<br />
Tab. 2: Angebotsspiegel mit Teilleistungen des Leistungsverzeichnisses<br />
Nr. Position A B C D E<br />
Angebote<br />
F G H I J I<br />
1. Allgemeines 129.439 84.210 90.931 75.250 104.778 85.371 149.379 134.585 117.710 126.350 123.099<br />
2. Stundenlohnarbeiten 3.810 30.171 1.605 38.883 29.790 25.156 44.147 39.227 37.820 33.950 40.560<br />
3. Rodungs- und<br />
Abbrucharbeiten<br />
23.118 14.460 14.580 10.685 8.205 19.902 24.228 17.640 20.580 14.172 16.513<br />
4. Erdarbeiten 13.827 17.425 15.724 24.592 19.059 29.414 36.920 36.920 24.020 37.910 26.561<br />
5. Betonarbeiten 370.979 389.370 351.330 394.917 446.455 460.866 550.020 384.904 491.545 513.713 553.795<br />
6. Spundwände und<br />
Stahlarbeiten<br />
600.781 644.202 721.893 773.044 804.932 807.859 523.111 863.784 812.944 803.327 969.844<br />
7. Sonstige Arbeiten 217.565 220.929 205.642 246.472 177.091 243.837 290.535 237.924 264.465 261.740 301.657<br />
1.359.519 1.400.767 1.401.705 1.526.184 1.590.310 1.672.405 1.618.340 1.617.347 1.769.084 1.791.162 2.032.029<br />
Gesamtsumme (netto):<br />
Nachlässe:<br />
5% 2%<br />
-80.325 -33.007<br />
Angebotsendsumme: 1.577.042 1.624.890 1.625.978 1.690.048 1.844.760 1.939.990 1.844.267 1.876.123 2.052.137 2.077.748 2.357.154<br />
(mit 16% MwSt)<br />
Differenz zu A [DM]: 0 47.848 48.936 113.006 267.717 362.948 267.225 299.080 475.095 500.706 780.112<br />
Abweichung von A [%]:<br />
0% 3% 3% 7% 15% 19% 14% 16% 23% 24% 33%
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
Massenanteil mit Körner < d [Gew.-%]<br />
Ton<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 105<br />
0 1 2 3 4<br />
0,002<br />
5 m<br />
Staatastraße 2232; b = 16,10<br />
Auelehmschicht teilweise nicht durchgängig<br />
(Schnittpunkte mit früherren Altarmen der Donau<br />
mit grobem Schüttmaterial verfüllt)<br />
Schluff<br />
Sand<br />
Kies Steine<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
0,063<br />
Korngröße [mm]<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt<br />
Bild 1: Eingebauter Betonholm<br />
2<br />
1 2<br />
63<br />
1 2<br />
2<br />
200<br />
353,00<br />
3<br />
2<br />
~349,3<br />
0,60<br />
356,79<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
Geländer<br />
1,70<br />
> 1,00<br />
Stahlspundwand<br />
Z.B Larssen 603 k L=7.50<br />
HQ = HW 5/99<br />
356,61<br />
Wasserbausteine Klasse 1<br />
verklammert,ca.70L/m2<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Donau<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
G, s 20,0 11,0 37,5 0,0<br />
kf<br />
[m/s]<br />
5*10*E-03<br />
bis 10*E -04<br />
γ γ' ϕ' c kf<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
G, s 18,0 9,0 33,0 0,0 10*E-03<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
T/U 19,0 9,0 22,5 5,0<br />
kf<br />
[m/s]
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 106<br />
6.20 – Beispiel 15: Neustädter Brücke / Vohburg<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Nach dem Pfingsthochwasser 1999 wurde der rechtsseitige Donaudeich im Bereich von<br />
der Neustädter Brücke bis Vohburg mit einer Innendichtung versehen. Von Deich-km<br />
0+090 bis Deich-km 1+550 wurde eine Spundwand und von Deich-km 1+550 bis Deichkm<br />
9+680 Mixed-in-Place-Wand (MIP-Wand) eingebaut.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Ingolstadt)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Donau (Gew. I. Ordnung) / Kleine Donau<br />
Dauer der Sanierung: keine Angaben<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 9.740 m<br />
Sanierungsjahr: keine Angaben<br />
Gesamtkosten: 880.403,51 € Netto (nur Spundwandeinbau)<br />
Sanierungsmethode: - Einbau von Spundwänden / MIP-Wänden<br />
- Deicherhöhung , anpassen der Böschungen,<br />
Deichwegebau<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit<br />
Trasse des<br />
Deiches Bereich 1<br />
Vohburg<br />
a.d. Donau<br />
Bereiche 2-6<br />
(MIP-Wand)<br />
(Spundwand)<br />
Neustadt<br />
a.d. Donau
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 107<br />
Der gesamte Deich wurde aufgrund seines bodenmechanischen Aufbaus und der örtlichen<br />
Randbedingungen in sechs Bereiche unterteilt.<br />
Als Vorwegmaßnahme wurde aufgrund der engen Platzverhältnisse im Bereich 1 (Deichkm<br />
0-090 bis 1+550) eine Spundwand eingebaut. In den übrigen Bereichen 2 - 6 (Deichkm<br />
1+585 bis 9+680) kam stattdessen eine Dichtwand im Mixed-in-Place-Verfahren (MIP-<br />
Wand) zum Einsatz.<br />
Zur Sicherstellung der Entwässerung des Deichkörpers bei fallendem Wasserspiegel<br />
wurden aufgrund des möglichen Aufstaus durch die bestehende, teilweise unwirksame<br />
Oberflächendichtung wasserseitig Sickerschlitze eingebaut.<br />
Um im Bereich 1 (Deich-km 0+090 bis 1+550) die Deicherhöhung ohne Einengung des<br />
bestehenden Abflussquerschnittes durchführen zu können, wurden die luftseitigen Böschungen<br />
mit einer Neigung von 1:1,8 ausgeführt. Um die Standsicherheit zu gewährleisten<br />
wurde die Böschung des Deichhinterweges zusätzlich mit Wasserbausteinen gesichert.<br />
Eine Anhebung des Deichhinterweges um ca. 1,0 m war erforderlich, da dessen Befahrbarkeit<br />
auch bei einem HQ100 der Ilm gewährleistet sein sollte.<br />
Wo der erforderliche Platz in den Bereichen 2 bis 6 (Deich-km 1+550 bis 9+680) aufgrund<br />
von bestehenden Grundstücksverhältnissen oder Straßenverläufen nicht vorhanden war,<br />
mussten Böschungen mit einer Neigung von 1:1,8 angelegt werden.<br />
Die Innendichtung wirkte sich zum einen positiv auf die Standsicherheit der bereichsweise<br />
steilen Böschungen aus und zum anderen stellt sie eine Sicherungsmaßnahme gegen<br />
den erwarteten starken Wühltierbefall dar.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
- Deichhöhe nicht ausreichend, zu geringer Freibord<br />
- wasserseitige Neigung 1:1,9 bis 1:5,4<br />
- luftseitige Neigung 1:1,7 bis 1:4,9<br />
- vorhandene mineralische Oberflächenabdichtung (teilweise unwirksam)<br />
- teilweise keine oder unzureichende Deichhinterwege<br />
- zu schmale Deichkronenwege<br />
- unzulässiger Bewuchs auf den Deichen<br />
Technische Maßnahmen im Bereich 1 (Regelquerschnitt Abb. 1)<br />
- Einbau einer Spundwand bis in 9,0 m Tiefe im Zuge der Vorwegmaßnahme
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 108<br />
- Herstellen eines 3m breiten Schutzstreifens durch Rodung der Gehölze<br />
- Erhöhung des Deichkörpers um bis zu 0,42 m zur Herstellung des Freibords von<br />
1,0 m<br />
- Verbreiterung und Erhöhung der Deichhinterwege (HQ100 der Ilm)<br />
- Verbreiterung der Deichkronenwege<br />
- Sicherung der landseitigen Böschung mit Wasserbausteinen<br />
Technische Maßnahmen in den Bereichen 2 - 6 (Regelquerschnitt Abb. 2)<br />
- Einbau einer MIP-Wand bis 5,70 m Tiefe<br />
- Herstellen eines 3,0 m breiten Schutzstreifens durch Rodung der Gehölze<br />
- Erhöhung des Deichkörpers um bis zu 0,70 m zur Herstellung des Freibords von<br />
1,0 m<br />
- Verbreiterung und Erhöhung der Deichhinterwege<br />
- Verbreiterung der Deichkronenwege<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen und Arbeiten<br />
Um umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen zu vermeiden, wurden keine Eingriffe wasserseitig<br />
der Deiche vorgenommen. Daher haben die durchgeführten Maßnahmen keinen<br />
Einfluss auf:<br />
- Retentionsraum<br />
- Wasserbeschaffenheit<br />
- Gewässerbett<br />
- Uferstreifen<br />
- Fischerei<br />
Die Auswirkungen auf Natur und Landschaft beschränken sich auf vereinzelte Rodungen<br />
im Bereich der Deichböschungen und der Schutzstreifen.<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichaufbau<br />
Die vorhandenen Deiche bestehen aus einem Stützkörper aus sandig-kiesigem Material<br />
mit Schluffeinlagerungen. Eine 2,0 m mächtige Oberflächendichtung aus sandigschluffigem<br />
Material ist bereichsweise vorhanden.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Untergrund<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 109<br />
Unter den Deichen befinden sich sandige Lehme oder lehmige Sande (Talauelehm) unterschiedlicher<br />
Mächtigkeit. Darunter stehen quartäre Donaukiese an, die ab einer Tiefe<br />
von 10 m von einer undurchlässigen Süßwassermolasse unterlagert werden.<br />
Die Erkundungsmaßnahmen umfassten insgesamt 16 Aufschlussbohrungen (Ø 178mm),<br />
zwei Rammkernbohrungen (Ø 100mm), 81 Bohrsondierungen, 32 schwere Rammkernsondierungen<br />
und sechs leichte Rammsondierungen. Die ermittelten geotechnischen Parameter<br />
der Böden sind in Tab. 1 gegeben.<br />
Tab. 1: Geotechnische Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Schicht / Material<br />
Material für<br />
Deichaufbau<br />
Bestehender<br />
Stützkörper<br />
Untergrund<br />
Nr. Bodengruppe<br />
DIN 18196<br />
Bodenklasse<br />
DIN 18300<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
ϕ´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
Dichtwand 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Pläne / Zeichnungen<br />
GOK<br />
1<br />
0 1 2 3 4<br />
HW Donau<br />
352,89<br />
2,3-2,9<br />
Bestehender Deichstützkörper,<br />
überwiegend (fein-)sandiger Schluff<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 110<br />
Freibord<br />
1,0m<br />
5 m<br />
0,25 3,00 0,25<br />
3%<br />
Spundwand<br />
L=9,0m<br />
Abb. 2: Regelprofil in Abschnitt 1<br />
GOK<br />
1<br />
0 1 2 3 4<br />
2,0<br />
HW Donau<br />
353,33<br />
Sickerschlitz aus Frostschutzkies<br />
4%<br />
Freibord<br />
1,0m<br />
5 m<br />
Bestehender Deichstützkörper,<br />
überwiegend (fein-)sandiger Schluff<br />
353,89<br />
3%<br />
1<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
Bestehender Deichstützkörper,<br />
überwiegend sandiger Kies<br />
2 Auelehm<br />
Donaukies<br />
3<br />
(Quartär)<br />
344,34<br />
0,25 3,00 0,25<br />
348,61<br />
354,33<br />
15cm Schottertragschicht<br />
≥1,9<br />
10cm Humus mit Magerrasen<br />
Aufzubauender Stützkörper aus<br />
1<br />
sandigem Kies, horizontal verdichtet<br />
Weg<br />
0,25 3,00 0,25<br />
353,89 3%<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
1 G,s´,u´ 19 11 33 0-2<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
kf<br />
[m/s]<br />
kf<br />
[m/s]<br />
1*10 E -7<br />
2 U, s 20,5 10,5 29 2-10 bis 1*10 E-10<br />
3 G,s´<br />
Bestehender Deichstützkörper,<br />
überwiegend sandiger Kies<br />
2 Auelehm<br />
Donaukies<br />
(Quartär)<br />
1*10 E -2<br />
bis 1*10 E-9<br />
kf<br />
[m/s]<br />
1*10 E -9<br />
19,5 9,5 18,5 10-25 bis 1*10 E-11<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
MIP-Wand<br />
d=0,4m<br />
Abb. 3: Regelprofil in den Abschnitten 2 bis 6<br />
1<br />
3<br />
15cm Schottertragschicht<br />
2,5<br />
10cm Humus mit Magerrasen<br />
1<br />
0,7<br />
1<br />
Aufzubauender Stützkörper aus<br />
sandigem Kies, horizontal verdichtet<br />
γ γ' ϕ' c kf<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
1 G,s´,u´ 19 11 33 0-2<br />
1*1 0 E -2<br />
bis 1*10 E-9<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
3 G,s´ 19,5 9,5 18,5 10-25<br />
15cm Schottertragschicht<br />
45cm Frostschutzschicht<br />
Wasserbausteine<br />
MW Ilm<br />
0,25 3,50 0,25<br />
3%<br />
15cm Schottertragschicht<br />
Unterbau Deichhinterweg (Mineralbeton 0/56)<br />
2,7<br />
1<br />
0,50m<br />
kf<br />
[m/s]<br />
1*10 E -7<br />
2 U, s 20,5 10,5 29 2-10 bis 1*10 E-10<br />
kf<br />
[m/s]<br />
1*1 0 E -9<br />
bis 1*10 E-11
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 111<br />
6.21 – Beispiel 16: Probierlweg<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Im Bereich des Stadtgebietes von Ingolstadt von Donau-km 2458,3 bis 2460,0 wurde der<br />
Deich abgetragen, rückverlegt und neu aufgebaut.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Ingolstadt)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Donau / Ingolstadt (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: 11 Monate (47 Wochen)<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 1.400 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit Deichtrasse<br />
und<br />
Deichkilometrierung<br />
Sanierungsjahr: keine Angaben<br />
Gesamtkosten: 1.426.515 € (Kostenschätzung) (2.787.240 DM)<br />
Sanierungsmethode: - Neuaufbau mit Deichrückverlegung<br />
km 1+420<br />
Donau<br />
km 0+000
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 112<br />
Aufgrund der erheblichen, negativen, ökologischen Auswirkungen (Rodung von 3.750 m²<br />
Auwald) mussten in größerem Umfang Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt<br />
werden. Die Aufforstung von 6.100 m² Fläche (Faktor: 1,5) und die Neuanlage von Biotoben<br />
trugen u. A. zum Ausgleich der Ökobilanz bei.<br />
In manchen Bereichen des Deiches waren nach dem Pfingsthochwasser Sofortmaßnahmen<br />
durch die Aufbringung eines Auflastfilters und einer natürlichen Oberflächendichtung<br />
ergriffen worden, die durch den Abtrag und den Neuaufbau der Deiche nicht in den neuen<br />
Deich integriert werden konnten.<br />
Aufgrund unterschiedlicher Randbedingungen musste der Ertüchtigungsbereich in sechs<br />
Abschnitten unterteilt werden (siehe unten).<br />
Im Abschnitt 1 und 2 wurde aufgrund der geringen Deichhöhe und der beengten Platzverhältnisse<br />
auf Anlage eines Deichhinterweges verzichtet. Die Deichkrone wurde hier für ein<br />
Befahren mit schwerem Gerät ausgebildet.<br />
In Abschnitt 4 reichten die Grundstücksgrenzen bis zur Deichkrone. Die Deiche wurden in<br />
diesem Abschnitt zur Wasserseite hin verlegt, dass die Deichaufstandsfläche außerhalb<br />
der Grundstücksgrenzen zum Liegen kam.<br />
In Abschnitt 6 konnten die Verluste des Retentionsraumes der Verlegungen hin zur Wasserseite<br />
von Deich km 0+000 bis km 1+000 durch eine Verlegung zur Landseite ausgeglichen<br />
werden.<br />
Reichten die vorhandenen Materialien aus dem Abbruch des alten Deichkörpers nicht aus<br />
so wurde zum Einbau der Dichtung der vorhandene Auelehm und zum Einbau des Stützkörpers<br />
der vorhandene Donaukies verwendet.<br />
Bei ungefähr der Hälfte des bindigen Materials aus dem alten Deich musste Weißfeinkalk<br />
zugegeben werden, um den natürlichen Wassergehalt zu reduzieren.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
- Längsrisse im Bereich der Deichkrone<br />
- durchlässiger Deichkörper und dadurch massive Sickerwasseraustritte im Hochwasserfall<br />
- Ausspülungen von Bodenmaterial im Hochwasserfall<br />
- kein Deichhinterweg<br />
- Gehölze auf der ganzen Länge des Deiches<br />
Durchgeführte Sofortmaßnahmen 1999<br />
- Auflastfilter auf der Luftseite geschüttet (Deich- km 0+250 bis 0+500)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 113<br />
- Aufbringen einer wasserseitigen Oberflächendichtung<br />
Übergeordnete technische Maßnahmen für alle Abschnitte<br />
- Rodung des vorhandenen Gehölzbestandes<br />
- Abtragung der vorhandenen Deiche<br />
- Neuaufbau der Deiche<br />
Abschnittseinteilung<br />
Aufgrund ständig ändernder Randbedingungen musste die Ertüchtigungsstrecke in sechs<br />
Teilabschnitte unterteilt werden (Tab. 1).<br />
Tab. 1: Übersicht über die Abschnitte der Ertüchtigungsmaßnahme<br />
Abschnitt Bezeichnung / Bereich Lage Deich km<br />
1 Westliche Ringstraße bis Sielbauwerk 0+000 bis 0+200<br />
2 Sielbauwerk 0+200 bis 0+250<br />
3 Bebauungsgebiet 0+250 bis 0+560<br />
4 Grundstücksgrenzen auf der Deichkrone 0+560 bis 0+780<br />
5 Biotop 0+780 bis 1+000<br />
6 Grüngürtel 1+000 bis 1+420<br />
Technische Maßnahmen von Deich km 0+000 bis 0+200 (Abschnitt 1, Abb. 2)<br />
- Verbreiterung der Deichkrone auf 4,0 m<br />
- Anordnung eines befestigten Deichweges zur Deichverteidigung<br />
- Ausbildung der Böschungsneigungen beidseitig h:b = 1:2,5<br />
- Anordnung einer wasserseitigen Oberflächendichtung aus Lehm mit Einbindung in<br />
die vorhandene Auelehmschicht<br />
- Anordnung eines landseitigen Fußdräns geschützt mit Geotextilien<br />
Technische Maßnahmen von Deich km 0+200 bis 0+250 (Abschnitt 2, Abb. 3)<br />
- Bau eines Siels zur Entwässerung<br />
- Sicherung der wasserseitigen steilen Böschung (h:b = 1:1,14) mit gebrochenem<br />
Fels (dmin = 20 cm)<br />
- Anordnung eines befestigten Deichweges zur Deichverteidigung<br />
- Abdichtung der wasserseitigen Böschung mit TDB unter Felsschüttung<br />
- Anschluss der TDB an die Flügelmauer des Ausleitungsbauwerkes mit Lehmschlag<br />
Technische Maßnahmen von Deich km 0+250 bis 0+560 (Abschnitt 3, Abb. 4)<br />
- Böschungsneigungen beidseitig h:b = 1:2,5<br />
- Anordnung einer wasserseitigen Oberflächendichtung aus Lehm mit Einbindung in<br />
die vorhandene Auelehmschicht<br />
- Errichtung eines Deichhinterweges auf Drainagekies<br />
- Anschluss des Dränkörpers an Flusskies durch die Auelehmschicht hindurch
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 114<br />
- Verlegung einer Dränleitung mit Kontrollschächten alle 100 m<br />
Technische Maßnahmen von Deich km 0+560 bis 0+780 (Abschnitt 4)<br />
- Verlegung des Deiches mit Berücksichtigung der Grundstücksgrenzen<br />
- Sonst wie bei Abschnitt 3<br />
Technische Maßnahmen von Deich km 0+780 bis 1+000 (Abschnitt 5)<br />
- Auffüllung eines vorhandenen Biotops<br />
- Sonst wie bei Abschnitt 3<br />
Technische Maßnahmen von Deich km 1+000 bis 1+420 (Abschnitt 6)<br />
- Verlegung des Deiches zur Landseite<br />
- Anordnung einer wasserseitigen Oberflächendichtung aus Lehm mit Einbindung in<br />
die vorhandene Auelehmschicht<br />
- Abflachen der wasserseitigen Böschungsneigung auf h:b = 1:3<br />
- Abflachen der landseitigen Böschungsneigung auf h:b = 1:4 bis 1:5<br />
- vereinzelte halbinselförmige Verbreiterungen der Deichkrone<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen und Arbeiten<br />
Die Umweltverträglichkeitsstudie kam zu der Erkenntnis, dass die Auswirkungen der<br />
Maßnahme auf die Umwelt durch die radikale Entfernung des vorhandenen Gehölzes und<br />
die Eingriffe in vorhandene Biotope erheblich sind. Die Auswirkungen wurden als „nachhaltig“<br />
eingestuft und mussten mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden.<br />
Detaillierte Hinweise wurden im landschaftspflegerischen Begleitplan gegeben (siehe<br />
auch unter Rahmenbedingungen).<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
In dem betroffenen Gebiet ist mit älteren Auenablagerungen in Form von Schluffen und<br />
Feinsanden mit Mächtigkeiten über 3 m zu rechnen. Darunter ist Flussschotter zu erwarten.<br />
Die Erkundung umfasste 14 Rammkernbohrungen, 11 Bohrsondierungen, 12 Schürfgruben<br />
und 9 schwere Rammsondierungen (12,0 m). Darüber hinaus wurden im Labor folgende<br />
Versuche durchgeführt:<br />
- 12 x Wassergehaltes<br />
- 5 x Konsistenzgrenze<br />
- 14 x der Korngrößenverteilung<br />
- 5 x der Proctordichte<br />
- 7 x des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes<br />
- 3 x Scherfestigkeit
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Deichkörper<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 115<br />
Der Deich besteht überwiegend aus gemischtkörnigen Böden, zusammengesetzt aus<br />
schluffigen bis stark schluffigen, sandigen Kiesen und schluffigen bis stark schluffigen,<br />
kiesigen Sanden.<br />
Untergrund<br />
Unter den gemischtkörnigen Böden stehen in der Regel feinkörnige Böden in Form von<br />
Tonen, Schluffen und schluffigen bis stark schluffigen Feinsanden an. Bei den bindigen<br />
Böden handelt es sich überwiegend um leicht- bis mittelplastische Tone steifer bis halbfester<br />
Konsistenz.<br />
Baustoff: Auelehm für Dichtung<br />
Der teilweise zum Dichtungseinbau verwendete Auelehm wurde in 30 cm Lagen, mit einer<br />
Proctordichte von mindestens 93 % und einer Durchlässigkeit kf < 10 -8 m/s eingebaut. Es<br />
waren keine organischen Bestandteile vorhanden. Die Verdichtbarkeit des Bodens erwies<br />
sich als gut.<br />
Baustoff: Donaukies für Stützkörper<br />
Der teilweise für den Stützkörper verwendete Donaukies wurde in 30 cm Lagen, mit einer<br />
Proctordichte von mindestens 93 % und einer Durchlässigkeit von kf = 10 -4 m/s eingebaut.<br />
Der Reibungswinkel ist über 32°, die Sieblinie dieses Donaukieses ist weit gestuft. Die<br />
Verdichtbarkeit des Bodens erwies sich als gut.<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
1,0 bis 1,20 m<br />
Massenanteil mit Körner < d [Gew.- %]<br />
Ton<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0 1 2 3 4<br />
Filter, Geotextil<br />
(Alternativ: Mineralfilter)<br />
0,002<br />
10 cm Humus<br />
mit Magerrasen<br />
5 m<br />
1 : 2,5<br />
Schluff<br />
Sand<br />
Kies Steine<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
3<br />
2<br />
0,063<br />
4<br />
Korngröße [mm]<br />
2<br />
2<br />
200<br />
3<br />
2 %<br />
4,00<br />
Oberflächendichtung k1,0 m<br />
Auelehm aus dem Vorland<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt Deich-km 0+000 bis 0+200<br />
1<br />
63<br />
4<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
1<br />
5 cm Humus<br />
mit Magerrasen<br />
1 : 2,5<br />
Auelehm<br />
Auffüllung aus Sand, stark kiesig<br />
Donaukies (Quartär)<br />
Ton, undurchlässig (Tertiär)<br />
Drainage, k>10E-03 m/s
1,0 bis 1,20 m<br />
Massenanteil mit Körner < d [Gew.- %]<br />
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
1,20 m<br />
Massenanteil mit Körner < d [Gew.- %]<br />
0 1 2 3 4<br />
0,063<br />
Korngröße [mm]<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 116<br />
10 cm Humus<br />
mit Magerrasen<br />
5 m<br />
1 : 1,4<br />
Ton Schluff<br />
Sand<br />
Kies Steine<br />
100<br />
90<br />
80<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
3<br />
70<br />
60<br />
50<br />
4<br />
1<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
368,13 m+NN<br />
gebrochener Fels, gesetzt, d = 20 cm<br />
366,1 m+NN<br />
0,002<br />
2<br />
63<br />
200<br />
4<br />
3<br />
2 %<br />
Bentofix<br />
Abb. 3: Regelquerschnitt Deich-km 0+250<br />
0 1 2 3 4<br />
Filter, Geotextil<br />
(Alternativ: Mineralfilter)<br />
10 cm Humus<br />
mit Magerrasen<br />
5 m<br />
1 : 2,5<br />
Ton Schluff<br />
Sand<br />
Kies Steine<br />
100<br />
90<br />
80<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
3<br />
70<br />
60<br />
50<br />
4<br />
1<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0,002<br />
2<br />
0,063<br />
Korngröße [mm]<br />
2<br />
63<br />
2<br />
200<br />
3<br />
3,50<br />
2 %<br />
4,00<br />
Oberflächendichtung k1,0 m<br />
Auelehm aus dem Vorland<br />
369,33 m+NN<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
1<br />
1 : 2,5<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
1<br />
evtl. Filterschicht<br />
5 cm Humus<br />
mit Magerrasen<br />
Abb. 4: Regelquerschnitt Deich-km 0+250 bis 1+000<br />
4<br />
1 : 2,5<br />
Auelehm<br />
Donaukies (Quartär)<br />
Ton, undurchlässig (Tertiär)<br />
Auelehm<br />
Drainage, k>10E-03 m/s<br />
10 cm Mineralbeton<br />
45 cm Splitt und Schottergemisch als Unterbau<br />
Donaukies (Quartär)<br />
10 cm Humus<br />
mit Magerrasen<br />
Ton, undurchlässig (Tertiär)<br />
4,00<br />
3 %<br />
1 : 3,0
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 117<br />
Bild 1: Schacht in Entwässerungskörper Bild 2: Neu angelegtes Biotop<br />
Bild 3: Schüttbetrieb für Neuaufbau des Bild 4: Fertiggestellter Deich<br />
Deiches
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
6.22 – Beispiel 17: Mailing<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 118<br />
Der linksseitige Donaudeich bei Mailing zwischen dem Auslaufbauwerk Großmehring<br />
(Donau-km 2451+530) und der Donaubrücke der Bundesautobahn A9 (Donau-km<br />
2455+050) wurde mittels Einbau einer Oberflächendichtung einer teilweisen Verlegung<br />
der Trasse ertüchtigt. Der betroffene Deichabschnitt wurde in drei Teilabschnitte aufgeteilt.<br />
Hier werden die Bereiche 1 und 2 erläutert.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Ingolstadt)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Donau bei Mailing (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: keine Angaben<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 3.575 m<br />
Sanierungsjahr: 2002<br />
Gesamtkosten (Bereich 1 und 2): 3.231.434 €<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit Baubereichen<br />
und<br />
Deichkilometrierung<br />
Sanierungsmethode: - Neuaufbau mit Oberflächendichtung und Bau<br />
eines Deichhinterweges<br />
- teilweise Deichtrassenverlegung (Bereich 2)<br />
Deich-km<br />
3+575<br />
Bereich 3<br />
Ingolstadt<br />
Deich-km<br />
2+650<br />
Bereich 2b<br />
Deich-km<br />
1+400<br />
Bereich 2a<br />
Deich-km<br />
0+545<br />
Bereich 1<br />
Deich-km<br />
0+080
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 119<br />
Es wurden im Bereich 1 am wasserseitigen Deichfuß mehrere Schwächezonen aus sandigem,<br />
sehr locker bis locker gelagertem Kies erkundet. Der Gefahr der Beschädigung der<br />
Oberflächendichtung durch Setzung wurde mit der Ausführung einer Rütteldruckverdichtung<br />
am Deichfuß längs zur Deichachse (Abstand 2,0 m, Tiefe 8,0 m) begegnet. Die bis<br />
zu 3 m starke Auelehmschicht wurde zuvor ausgebaut, zwischengelagert und nach dem<br />
Verdichten wieder eingebaut. Da das wasserseitige Vorland mit schwerem Gerät nicht<br />
befahrbar war, musste die Verdichtung von der Deichkrone aus durchgeführt werden. Die<br />
Kosten für die Rütteldruckverdichtung beliefen sich auf 100 €/lfm.<br />
Im Bereich 1 befand sich am luftseitigen Böschungsfuß ein 2 m tiefer Entwässerungsgraben.<br />
Der Graben wurde im Zuge des Einbaues eines Deichhinterwegs verfüllt und die<br />
Entwässerung durch den Einbau eines mit Geotextil ummanteltes Filterrohr (DN 1800)<br />
sichergestellt, welches bis zur halben Rohrhöhe mit Drainagekies (8/32 mm) angeschüttet<br />
wurde. Die Grabenböschungen wurden mit einem Geotextil ausgekleidet, welches als<br />
Filterschicht zwischen dem anstehenden sandigen Kies und dem Drainagekies wirkt. Darüber<br />
wurde eine Filterschicht aus Kies in einer Dicke von 1,5 m in Lagen von 30 cm eingebaut<br />
und verdichtet. Der oberste Grabenbereich wurde mit Stützkörpermaterial verfüllt<br />
und verdichtet, so dass die Überdeckung 1,0 m beträgt.<br />
Durch die nachhaltigen Auswirkungen der Maßnahme auf den Naturhaushalt mussten<br />
umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden (siehe unten).<br />
Aufgrund der Ausweitung der Bauwerksgrenzen musste eine Fläche von 51.500 m² zu<br />
einem Preis von 10 €/m² gekauft werden.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
- Freibord ist über die gesamte Länge ausreichend<br />
- Schäden durch Ausspülungen und Böschungsrutschungen<br />
- kein Deichhinterweg<br />
- Deichkronenweg nicht befestigt<br />
- beidseitig des Deiches sind Gehölze vorhanden<br />
Technische Maßnahmen von Deich- km 0+080 bis 0+550 (Bereich 1, Abb. 2)<br />
- Verrohrung von Gräben mit gelochtem Betonrohr (DN 1800)<br />
- Verfüllung der Gräben mit Drainagekies (8/32 mm) bis zur halben Rohrhöhe, weitere<br />
Verfüllung mit Filterschicht (Sandiger Kies: Dicke = 1,5 m)<br />
- Abtrag von Oberboden im Bereich der Rütteldruckverdichtung<br />
- Abtrag der ca. 50 cm dicken Schluffschicht im oberen Bereich des Deiches, da<br />
diese organische Bestandteile enthält.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 120<br />
- Rütteldruckverdichtung von der Deichkrone aus (Tiefe 8,0 m bis Tertiär, geforderte<br />
Lagerungsdichte D = 0,55)<br />
- teilweise Abtrag des bestehenden Deichkörpers und Verdichten der Deichaufstandfläche<br />
mit schwerer Vibrationswalze<br />
- Aushub eines Dichtungssporns<br />
- Einbau einer Oberflächendichtung<br />
- Abflachung der Böschungsneigungen h:b = 1:2,5 (wasserseitig) und luftseitig h:b<br />
1:2,7 (luftseitig)<br />
- Herstellen eines Freibordes von 1,25 m<br />
- Errichten eines Deichhinterweges mit Schottertragschicht auf einer Berme 1,5 m<br />
unterhalb der Krone<br />
- Aufbau des Kronenweges mit Schottertragschicht<br />
- Ansaat von Magerrasen<br />
Technische Maßnahmen von Deich- km 0+550 bis 2+650 (Bereich 2)<br />
- Verlegung der Deichachse in das Vorland<br />
- Abtrag der ca. 30- 40 cm dicken, teilweise organischen Schluffschicht im oberen<br />
Bereich des Deiches<br />
- Sonst wie in Bereich 1 außer der Verrohrung der Gräben und der Rüttelverdichtung<br />
Technische Maßnahmen von Deich- km 2+650 bis 3+575 (Bereich 3)<br />
- wie im Bereich 2<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen und Arbeiten<br />
Im landschaftspflegerischen Begleitplan wurden die negativen Auswirkungen der Baumaßnahme<br />
wie folgt beschrieben:<br />
- direkter und dauerhafter Verlust von Auwaldflächen<br />
- direkter und dauerhafter Verlust von Gehölzpflanzungen, Heckenstrukturen und<br />
Gebüschen entlang des bestehenden Deiches<br />
- Retentionsraumverlust<br />
- vorübergehende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch das Fällen von<br />
Bäumen<br />
Für die betroffenen Flächen wurden Ausgleichsmaßnahmen festgelegt, die sich aus dem<br />
Produkt der betroffenen Fläche und ein eines Faktors ergeben, der die Schwere des Eingriffs<br />
berücksichtigt (Tab. 1).<br />
Es wurde unter anderem als Ausgleichsmaßnahme auf den Deichböschungen angesät.<br />
Je nach Böschungslage wurden verschiedene Saatmischungen verwendet. Ein Beispiel<br />
einer Ansaatmischung für südexponierte Böschungen aus mageren Wiesen- bzw. Mager-
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 121<br />
rasengesellschaften mit geringer Aussaatmenge von 7 g/m 2, bei einem Kräuteranteil von<br />
etwa 1 g/m² ist Tab. 2 zu angegeben.<br />
Die Kosten für Ausgleichsmaßnahmen belaufen sich auf 22.047,50 €.<br />
Tab. 1: Ausgleichsbedarf<br />
betroffene Ausgleichs-<br />
Biotoptypen Faktor Fläche (m²) bedarf (m²)<br />
Hartholzaue 3,0 533 1599<br />
Weichholzaue<br />
Artenärmere<br />
3,0 239 717<br />
Gehölzpflanzungen 1,0 520 520<br />
Feuchtgehölze 1,5 249 373,5<br />
Weidengebüsche<br />
Artenreiche<br />
1,0 1672 1672<br />
Gehölzpflanzungen<br />
Ausgleichsfläche für<br />
1,5 2414 3311,5<br />
Staustufe Vohburg 1,0 157 157<br />
Retentionsraum 1,0 9000 9000<br />
Tab. 2: Beispiel einer Ansaatmischung für exponierte Südböschungen<br />
Gräser<br />
Kräuter:<br />
Name (lat.) Name<br />
Ansaatmenge<br />
[g/m²]<br />
Bromus erectus Aufrechte Trespe 0,5<br />
Festuca ovina Schafschwingel 2<br />
Festuca rubra<br />
Horst<br />
commutata<br />
Brachypodium<br />
Rostschwingel 2<br />
pinnatum Fleder-Zwinke 0,5<br />
Poa compressa Platthalmrispe 1<br />
Lotus cornicalatus Hornklee 0,25<br />
Achillea millefolium Schafgarbe 0,25<br />
Anthyllis vulneraria Wundklee 0,25<br />
Salvia pratensis Wiesensalbei 0,25<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichkörper<br />
Der Deichkörper besteht überwiegend aus schwach sandigem bis sandigem, stellenweise<br />
schwach schluffigem Kies. Im Deichkörper sind örtlich schwach organische Schluffschichten<br />
bzw. schwach schluffige, schwach kiesige Sandschichten eingelagert. Bei Deich-km<br />
3+300 besteht der Deich durchwegs aus schwach schluffigen bis schluffigen Sand. Der<br />
Stützkörper ist bis in eine Tiefe von 0,6 bis 1,1 m überwiegend mitteldicht, stellenweise<br />
dicht gelagert, darunter ist er locker bis sehr locker gelagert. Zwischen Deich-km 2+500<br />
bis 2+900 wurden Feinsande als Stützköpermaterial angetroffen.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Untergrund<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 122<br />
Unterhalb des Deiches befinden sich fast durchgängig Auelehmschichten aus schwach<br />
feinsandigen bis feinsandigen, stellenweise schwach tonigen Schluff bis schluffigen bzw.<br />
stark schluffigen Feinsanden, vereinzelt mit kiesigen Beimengungen. Unter dem Auelehm<br />
schließt bis zur Endtiefe (2,4 bis 4,6 m) sandiger Kies an.<br />
Die Erkundung umfasst sowohl 12 Rammkernbohrungen als auch 12 leichte Rammsondierungen<br />
in einem Abstand von 400 m. In Laborversuchen wurden die Korngrößenverteilung,<br />
die Zustandsgrenzen, der Wassergehalt und die Dichte bestimmt. Darüber hinaus<br />
wurden Dreiaxialversuche durchgeführt.<br />
Tab. 3: Geotechnische Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Schicht / Material Nr. Bodenart<br />
DIN 18196<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
ϕ´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
sandiger Kiese 1 GU, GT, SU*, ST* 21 12 32,5 0 10 -2 bis 5*10 -3<br />
Oberflächendichtung 2 TM, TA,UA 16,5 - 20 7 - 10 17,5 > 5 10 -8 bis 10 -10<br />
Auelehm 3 U,t´ / S,u* 16 - 20 7 - 10 20 5 10 -6 bis 10 -10<br />
Donaukies 4 G 22 13 35 0 10 -2 bis 10 -3<br />
Kostenschätzung<br />
Die Ausschreibung von Bereich 1 und 2 wurden von Bereich 3 getrennt durchgeführt, da<br />
die Maßnahmen im Bereich drei im Rahmen des Unterhalts durchgeführt werden konnten.<br />
Tab. 4: Kostenschätzung<br />
Position geschätzte<br />
Kosten [€]<br />
1 Bereich 1 844.315<br />
2 Bereich 2 1.020.626<br />
3 Bereich 3 405.778<br />
4 Grunderwerb 515.000<br />
Nettokosten: 2.785.719<br />
16 % MwSt: 445.715<br />
Gesamtkosten: 3.231.434
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
10 cm Mutterboden<br />
mit Magerrasen<br />
HQ100 = 363,30 [m+NN]<br />
1.00<br />
0 1 2 3 4<br />
Oberflächendichtung<br />
45°<br />
1,00<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 123<br />
60°<br />
5 m<br />
0,30<br />
1 : 2,5<br />
1,00<br />
Rütteldruckverdichtung<br />
2 3<br />
1 4<br />
3,50<br />
364,55 m+NN<br />
OK bestehender Deich<br />
1 : 2,7<br />
60 cm Frostschutzschicht<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt für Bereich 1<br />
Massenanteil mit Körner < d [Gew.-%]<br />
4,00<br />
363,02 m+NN<br />
Filterschicht<br />
2<br />
3<br />
4<br />
15 cm Schottertragschicht<br />
Geotextil<br />
Secutex R 504<br />
Drainagekies 8/32<br />
Ton Schluff<br />
Sand Kies Steine<br />
100<br />
90<br />
80<br />
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
4<br />
0<br />
0,002<br />
0,063<br />
Korngröße [mm]<br />
2<br />
63 200<br />
1<br />
30°<br />
1 cm Splitt/Brechsand 0/5<br />
5 cm Schottertragschicht 0/16<br />
25 cm Schottertragschicht 0/32<br />
10 cm Mutterboden<br />
mit Magerrasen<br />
4,00<br />
354,30 m+NN<br />
363,02 m+NN<br />
Stützkörpermaterial<br />
1,00<br />
2,60<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
Filterschicht<br />
361,22 m+NN<br />
Geotextil<br />
15 cm Schottertragschicht<br />
Drainagekies 8/32<br />
30°<br />
γ<br />
361,22 m+NN<br />
1,00<br />
2,60<br />
γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
DN 1800<br />
mit Geotextil ummantelt<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
1 GU, GT 21 12 32,5 0<br />
30°<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
2 TM,TA 16,5-20 7- 10 17,5 > 5<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
3 TA, TM 16- 20 7- 10 20 5<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
4 GU, GT 22 13 35 0<br />
0 1 2 3 4<br />
DN 1800<br />
mit Geotextil ummantelt<br />
30°<br />
γ γ'<br />
[kN/m³] [kN/m³]<br />
4 GU, GT 22 13 35 0<br />
5 m<br />
Kies-Sand-Auflager<br />
aus sandigem Feinkies<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-02 -<br />
5*E-03<br />
kf<br />
[m/s]<br />
1*E-08 -<br />
1*E-10<br />
kf<br />
[m/s]<br />
1*E-06 -<br />
1*E-10<br />
kf<br />
[m/s]<br />
1*E-02 -<br />
1*E-03<br />
Kies-Sand-Auflager<br />
aus sandigem Feinkies<br />
Abb. 2: Detail Grabenentwässerung aus dem Regelquerschnitt im Bereich 1<br />
4<br />
ϕ'<br />
[°]<br />
c<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
1*E-02 -<br />
1*E-03
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 124<br />
Bild 1: Deich vor Ertüchtigungsmaßnahme Bild 2: Deich vor Ertüchtigungsmaßnahme<br />
Bild 3: Erdarbeiten am Deich Bild 4: Abziehen von verfülltem Graben
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 125<br />
6.23 – Beispiel 18: Schlösslwiese – Neuburg an der Donau<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Die durch das Pfingsthochwasser aufgezeigten Mängel an den Donaudeichen im Bereich<br />
von Neustadt a. d. Donau waren Anlass u. A. den linkseitigen Donaudeich an der<br />
Schlösslwiese (Abb. 1), der gegenüber von Englischen Garten liegt, u. A. mit einer Dichtung<br />
zu ertüchtigen.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Ingolstadt)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Donau (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: keine Angaben<br />
Länge Sanierungsabschnitt: 625 m<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit Trasse des<br />
Deiches<br />
Sanierungsjahr: keine Angaben<br />
Gesamtkosten: 492.767 €<br />
Sanierungsmethode: - Einbau einer geosynthetischen Tondichtungsbahn<br />
- Deicherhöhung, teilweise mittels mobiler Hochwasserschutzelemente<br />
Schlösselwiese
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 126<br />
Die Ertüchtigungsmaßnahme wurde in drei Abschnitte unterteilt. Während im ersten Abschnitt<br />
eine Lösung mit Verbreiterung des Deichkörpers zur Anwendung kam, mussten in<br />
Abschnitten 2 und 3 aufgrund anderer Randbedingungen andere Lösungsvarianten entwickelt<br />
werden.<br />
In Abschnitt 2 befindet sich landseitig Bebauung, so dass eine Verbreiterung in diese<br />
Richtung nicht vorgenommen werden konnte. Dort erweiterte man den Deich zur Wasserseite<br />
hin. Den damit einhergehenden Retentionsraumverlust glich man an anderer Stelle<br />
wieder aus. Auf einen Deichhinterweg wurde aus denselben Gründen verzichtet. Die<br />
Deichverteidigung soll ggf. von den Grundstücken der Anwohner aus erfolgen.<br />
In Abschnitt 3 befand sich eine Hochwasserschutzmauer mit 90 cm Höhe, die um 90 cm<br />
auf 1,80 m aufgehöht wurde. Sowohl aufgrund ästhetischer und landschaftsgestalterischer<br />
Gründe als auch zur Sicherstellung des Donauausblicks für die Anwohner wurde<br />
eine Kombinationslösung aus erdbaulichen Maßnahmen und mobilen Elementen entwickelt.<br />
Da nicht ausreichend geeignetes Material für die Herstellung einer natürlichen Oberflächendichtung<br />
in der Nähe des Baustellenbereiches gewonnen werden konnte, entschloss<br />
man sich, eine geosynthetische Tondichtungsbahn (TDB) zu verwenden. Aufgrund der<br />
Gefahr von Wühltiertätigkeit wurde als Schutzmaßnahme eine flexible Kunststoffdichtungsbahn<br />
(KDB) aus Polyethylen mit einer Stärke von 1 mm eingebaut.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
- Deichhöhe nicht ausreichend, kein Freibord<br />
- beidseitige Neigung von 1:2,5<br />
- Vorhandene mineralische Oberflächenabdichtung nicht wirksam<br />
- kein Deichhinterweg<br />
Technische Maßnahmen in Abschnitt 1 (Regelquerschnitt Abb. 2)<br />
- Herstellen eines 5 m breiten Sicherheitsstreifens durch Rodung der Gehölze<br />
- Auffüllen von Fehlstellen im Untergrund mit Quellton<br />
- Erhöhung des Deichkörpers um 1,0 m zur Herstellung des Freibords<br />
- Sicherstellung der beidseitigen Böschungsneigungen von h:b = 1:2,5<br />
- Einbau einer wasserseitigen Oberflächendichtung mittels einer geosynthetischen<br />
Tondichtungsbahn (TDB)<br />
- Hochziehen der Dichtung mit 50 cm bindigem Aufsatz<br />
- Einbau einer Wurzelschutzfolie (KDB, d = 1,0 mm) am landseitigen Böschungsfuß<br />
mit Einbindung in die Deckschicht (50 cm) und Überlappung (50 cm)<br />
- Errichten eines Deichhinterweges am landseitigen Böschungsfuß
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 127<br />
Technische Maßnahmen in Abschnitt 2<br />
- Wie in Abschnitt 1 nur kein Deichhinterweg<br />
Technische Maßnahmen in Abschnitt 3<br />
- Aufhöhung des Geländes durch Anschüttung an bestehende Böschung (40 cm)<br />
- Aufhöhung durch mobile Elemente aus Aluminium (50 cm) bei einem Stützenabstand<br />
von 2,50 m und 5 cm dicken und 30 cm hohen Dammbalkenelementen (22<br />
kg)<br />
- Einbau einer Deichscharte mit mobilen Aluminium Dammbalken an Wegkreuzung<br />
bei Deich-km 0+577<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen und Arbeiten<br />
Die Umweltverträglichkeitsstudie mit dem landschaftspflegerischen Begleitplan konzentrierte<br />
die negativen Auswirkungen der Maßnahme auf die Sichtbeeinträchtigung der Anwohner<br />
insbesondere in Abschnitt 3 und auf den Verlust des Retentionsraumes von ca.<br />
800 m³. Es wurden folgende Ausgleichsmaßnahmen angeführt:<br />
- Begrünung der Deichböschungen mit artenreichen Ansaatmischungen<br />
- Strauchpflanzungen<br />
- Natursteinverkleidung der Hochwasserschutzmauern<br />
- Schaffung von neuem Retentionsraum (ca. 46.000 m3)<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichaufbau<br />
Die Deiche sind überwiegend aus schluffig-sandigen Kiesen (Donaukies) aufgebaut. Die<br />
wasserseitig vorhandenen Dichtungen bestehen weitgehend aus Schluffen und stark<br />
schluffigen Sanden mit wechselhaften Tonanteilen.<br />
Hinter den bestehenden Hochwasserschutzmauern lagern anthropogene Auffüllungen<br />
unterschiedlicher Zusammensetzung überwiegend aus Kiesen.<br />
Untergrund<br />
Unter den Deichen befinden sich überwiegend Schluffe und Feinsande unterschiedlicher<br />
Mächtigkeit (Hochflutsedimente). Unter diesen Ablagerungen stehen Donauschotter an,<br />
die überwiegend aus gut gerundeten schluffig-sandigen Kiesen bestehen. Darunter folgen<br />
Ablagerungen aus Tonen / Schluffen und Sanden. Unterlagert wird der Gesamtaufbau mit<br />
Kalken des Tertiärs.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 128<br />
Geosynthetische Tondichtungsbahn (TDB)<br />
Die verwendete „Bentonitmatte“ hatte die in Tab. 1 angeführten technischen Daten.<br />
Tab. 1: Technische Daten der Tondichtungsbahn („Bentonitmatte“)<br />
Trägerschicht: PP-Verbundstoff > 350 g/m 2<br />
Bentoniteinlage: Natriumbetonit in Granulatform<br />
Wasserdurchlässigkeitwert kf: < 5*10 -11 m/s<br />
Bentonitanteil (w =12 %): > 5000g/m 2<br />
Deckvlies: PP mit zusätzlicher thermischer Behandlung<br />
Zugfestigkeit: > 15 KN/m<br />
Scherfestigkeit ϕ: > 35°<br />
Die Erkundungsmaßnahmen umfassten drei Aufschlussbohrungen (Tiefe 13,5 m), drei<br />
Rammkernsondierungen (Tiefe 13,5 m), vier Schürfe und einige schwere Rammkernsondierungen<br />
aus dem gesamten Hochwasserschutzprogramm. Im Labor wurde zudem die<br />
Korngrößenverteilung der angetroffenen Bodenarten ermittelt.<br />
Tab. 2: Geotechnische Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Schicht /<br />
Material<br />
SchüttmaterialOberflächendichtungHochflutsedimente<br />
Quartäre<br />
Kiese<br />
Nr. Bodenart<br />
DIN 18196<br />
Angebote / Vergabe<br />
Lagerung /<br />
Konsistenz<br />
γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
ϕ´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
1 GU, GE, SU,<br />
GW<br />
mitteldicht 20 - 21 12 30 - 35 0 10 -3 bis 5*10 -4<br />
2 U, SU - 18 - 20 7 - 10 25 - 30 0 - 5 5*10 -7 bis 10 -8<br />
2 U, UL, UM, steife<br />
SU, TL/TM Konsistenz<br />
3 GU, SU mitteldicht<br />
bis dicht<br />
18 - 20 7 - 10 25 - 30 0 - 5 5*10 -7 bis 10 -8<br />
21 - 22 12 32,5 - 35 0 10 -3 bis 7*10 -4<br />
Hauptkostenstelle war der Deich- und Wegebau. Der günstigste Anbieter war ca.<br />
20 % billiger als der nächst günstige Anbieter.<br />
Tab. 3: Angebotsspiegel (alle Preise in €)<br />
Rang- Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Bieter A B C D E F G H<br />
Baustelleneinrichtung 80.255 73.627 48.936 108.085 82.604 39.387 91.491 46.995<br />
Deich- und Wegebau 249.667 306.987 340.176 366.427 408.594 430.954 409.699 491.495<br />
Bauwerke 204 2.360 2.422 1.736 2.578 2.553 1.921 1.406<br />
Sonstige 91.868 118.552 140.471 95.953 85.819 108.983 91.435 80.606<br />
Stundenlohn 2.804 3.747 7.527 7.717 6.008 6.430 8.689 5.350<br />
Angebotssumme<br />
(inkl. MwSt. und Nachlässen)<br />
Abweichung von<br />
Angebot A [%]:<br />
492.767 568.118 625.857 672.705 679.300 682.436 699.751 725.988<br />
100% 119% 127% 136% 138% 138% 142% 147%
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
neue<br />
Grundstücks-<br />
grenze<br />
0 1 2 3 4<br />
bestehende<br />
Grundstücks-<br />
grenze<br />
3,50<br />
5,00<br />
Betriebsweg<br />
Bodenaustausch<br />
2<br />
5 m<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 129<br />
7,45<br />
Deichneigung 1 : 2,5 (neu)<br />
1 3<br />
Abb. 2: Regelprofil in Abschnitt 1<br />
383,60 = Deichkrone<br />
1<br />
2<br />
3<br />
3,50<br />
383,34<br />
Deicherhöhung<br />
um 0,80 m<br />
Dichtung: Betonitmatte<br />
378,00<br />
Alle Längenangaben in Meter [cm].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />
[m+NN].<br />
Spannsystem<br />
Deichneigung<br />
1 : 2,5 (neu)<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
Freibord 1,00 m<br />
HQ B<br />
Einbindung bis 377,64 m NN<br />
(0, 50 m i n undurc hl äs sige n Fe insand)<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
1 GU, GE 20- 21 11- 12 30- 35 0,0<br />
2<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
U, UL 18-20 9- 11 25- 30 0- 5<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
3 GU, SU 21- 22 12- 13 32- 35 0,0<br />
Dammbalken<br />
(mobiles Hochwasserschutzsystem)<br />
Bodendichtung aus Spezialschaum,<br />
ohne Bodenschiene<br />
Abb. 3: Detail Deichscharte (Mobiler Hochwasserschutz)<br />
5,00<br />
Wurzelschutzfolie<br />
Auffüllung mit<br />
bindigem Material<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E-03<br />
bis -04<br />
kf<br />
[m/s]<br />
5*E- 07<br />
bis -08<br />
kf<br />
[m/s]<br />
10*E- 03 bis<br />
7*E- 04<br />
Stauhöhe = 80 cm<br />
neue<br />
Grundstücks-<br />
grenze<br />
Systemhöhe = 85 cm
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 130<br />
Freibord 1,00 m<br />
HQ B<br />
Einbindung bis 377,64 m NN<br />
(0,50 m in undurchlässigen Feinsand)<br />
Dichtung: Betonitmatte<br />
Abb. 4: Detail Wurzel- und Wühltierschutz<br />
neue<br />
Grundstücks-<br />
grenze<br />
5,00<br />
Wurzelschutzfolie<br />
Auffüllung mit<br />
bindigem Material
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 131<br />
Bild 1: Abrollen der TDB auf Böschung Bild 2: Einbinden der TDB in Untergrund<br />
Bild 3: Eingebaute TDB mit Deckschicht Bild 4: Erdbauarbeiten<br />
Bild 5: Fertig gestelltes Planum für Deichweg Bild 6: Fertig gestellter Deich
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 132<br />
6.24 – Beispiel 19: Untermaiselstein – Immenstadt<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
Im Zuge des Vorhabens „Hochwasserschutz Obere Iller“ (HWSOI) wurden im Bereich<br />
zwischen Untermaiselstein und Thanners umfangreiche Maßnahmen geplant. Als Vorwegmaßnahme<br />
dazu wurde im Bereich Untermaiselstein ein Deich mit einer Scharte zur<br />
Durchleitung eines Nebengewässers und zur Hochwasserausleitung errichtet (Abb. 1).<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Kempten)<br />
Art der Maßnahme: Neubaumaßnahme<br />
Gewässer: Iller bei Immenstadt (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: April bis August 2001 (4,5 Monate)<br />
Länge Sanierungsabschnitt: ca. 500 m (Fkm 126,35 – 126,85)<br />
Abb. 1: Lageplan<br />
mit Deichtrasse<br />
und<br />
Bauabschnitten<br />
Sanierungsjahr: 2001<br />
Gesamtkosten: 1.592.443 DM Netto (reine Baukosten)<br />
Sanierungsmethode: - Deichneubau mit Innendichtung (FMI-Wand und<br />
Spundwand)<br />
- Einbau einer Deichscharte<br />
Iller<br />
Iller-km 126,35<br />
Iller-km 126,85<br />
ohne<br />
FMI-Wand<br />
FMI-Wand<br />
ohne<br />
Spundwand
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 133<br />
Da das HWSOI zusammen mit der Planung der Baumaßnahmen der Bundesstraße 19<br />
durchgeführt wurde, war im Vorfeld eine Abstimmung der Maßnahmen notwendig. Die<br />
Trasse des Deiches bei Untermaiselstein wurde unter Berücksichtigung der geplanten<br />
Trasse B19 geplant, die sich landseitig befinden wird.<br />
Gleichzeitig mussten die bereits genehmigten und im Bau befindlichen Maßnahmen zur<br />
Illeraufweitung berücksichtigen werden.<br />
Aufgrund sich ändernder Randbedingungen wurde die Maßnahme in fünf Abschnitte eingeteilt<br />
(Abb. 1). Auf der Gesamtstrecke soll Gehölz auf und am Deich zugelassen werden.<br />
Deshalb wurden in den Bereichen 2, 3 und 4 statisch wirksame Innendichtungen eingebaut,<br />
die bei einem durch Gehölz verschuldeten Versagen der Deichböschung die Standsicherheit<br />
des Gesamtdeiches sicherstellen sollen.<br />
Die Spundwand wurde auskragend (1,3 m) eingebaut, da in Folge des Baues der B19<br />
eine landseitige Auffüllung erfolgen sollte.<br />
Am Bauanfang und Bauende (Abschnitt 1 und 5) wurde auf eine Erosionssperre verzichtet<br />
um den Grundwasserstrom in diesen Bereichen nicht aufzustauen.<br />
Aufgrund der vorhandenen Aueablagerungen musste mit Setzungen gerechnet werden.<br />
Durch den Austausch der Aueablagerungen mit Deichmaterial konnten diese auf ca. 6 cm<br />
verringert werden.<br />
Technische Maßnahmen<br />
Technische Maßnahmen in Abschnitt 2 und 4<br />
- Errichtung eines Deiches der Höhe 5,0 m unter Berücksichtigung eines HQ300<br />
und einer Freibordhöhe von 45 cm<br />
- Ausbildung der Kronenbreite mit b = 4,0 m<br />
- Ausbildung der Böschungsneigungen mit h:b = 1:2,0<br />
- Überhöhung des Deiches um die erwarteten Setzungen (ca. 10 cm + 1 bis 3 %<br />
Eigensetzung)<br />
- Einbau einer Innendichtung mit dem FMI-Verfahren (Einbindungstiefe 5,5 bis 7,5<br />
m)<br />
- Sicherstellung der statischen Wirksamkeit durch Einstellen von Stahlträgern IPE<br />
300 und IPE 360 im Abstand von 3,0 und 3,5 m<br />
Technische Maßnahmen im Abschnitt 3<br />
- Einbau einer Spundwand als Innendichtung (Einbindetiefe: 14,0 m)<br />
- Deichbau ansonsten wie in Abschnitt 2 und 4<br />
Technische Maßnahmen in Abschnitt 1 und 5<br />
- Verzicht auf den Einbau einer Dichtung
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 134<br />
- Einbau einer Deichscharte im nördlichen Abschnitt 1 zur Durchleitung eines Nebengewässers<br />
(Rückbau der Deichscharte im Zuge der Gesamtmaßnahme<br />
HWSOI)<br />
- Einbau von Geogittern im Bereich der Deichscharte zur Bodenstabilisierung<br />
- Sicherung der Böschungen im Bereich der Deichscharte mittels Wasserbausteinen<br />
(d > 1,0 m)<br />
- Vergrößerung des Fußdräns im Vergleich zu Abschnitt 2 und 4<br />
- Ansonsten wie in Abschnitt 2 und 4<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Untersuchungen und Arbeiten<br />
Die Umweltverträglichkeitsstudie für die Deichbau- und Deichertüchtigungsmaßnahmen<br />
wurden für das Projekt HWSOI und den Bau der Bundestrasse B19 zusammen durchgeführt.<br />
Da die Studie bereits in einem sehr frühen Planungsstadium durchgeführt wurde,<br />
berücksichtigte sie 14 verschiedene Ausführungsvarianten und diente gleichzeitig als Entscheidungshilfe<br />
für die spätere Bauausführung.<br />
Der naturnahe Illerabschnitt im Bereich der Felsenge Thanners war als Landschaftsschutzgebiet<br />
ausgewiesen. Das Werdensteiner Moos im Norden und die im Osten angrenzenden<br />
Rottachberge sind Schutzgebiete nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.<br />
Die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen beeinträchtigen die vorhandenen Schutzgüter<br />
durch:<br />
- Verlegung eines landwirtschaftlichen Anwesens und einer Bitumenmischanlage<br />
- Überbauung naturnaher Auwaldbereiche und sonstiger Biotopflächen<br />
- Verlegung und Begradigung der Iller<br />
- Beeinträchtigung naturnaher Auwaldbereiche durch Änderung der Überflutungsart<br />
und –häufigkeit<br />
- Reduzierung der Einmündungsbereiche von Nebenflüssen/-bächen in die Iller<br />
- Überbauung (in geringem Maß Versiegelung) von Böden<br />
- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Bauwerke<br />
Der Bau der Bundesstraße B19 führt zu folgenden zusätzlichen Beeinträchtigungen der<br />
Schutzgüter:<br />
- Versiegelung von Flächen<br />
- Beeinträchtigung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen<br />
- Erhebliche Lärmemissionen mit Beeinträchtigungen für Anwohner und Tiere<br />
- Sonstige Schadstoffemissionen (Spritzwasser, Abgase, etc.)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 135<br />
- Zerschneidung der Landschaft und damit eine Trennung von zusammenhängenden<br />
faunistischen Lebensräumen<br />
Die Auswirkungen auf Anwohner, Oberflächengewässer, Retentionsfunktion, Tiere und<br />
Pflanzen wurde besondere Bedeutung beigemessen.<br />
Nach der Umweltverträglichkeitsstudie wurde empfohlen, die wasserwirtschaftliche Variante<br />
A mit Verlegung der Iller in Teilbereichen in Verbindung mit der Straßentrasse<br />
„Dammlinie A“ zu realisieren. Bei dieser ökologisch am günstigsten bewerteten Variante<br />
verläuft die Bundesstraße auf einem Dammbauwerk unmittelbar rechtsseitig der Iller.<br />
Um die Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten, wurden<br />
folgende Minimierungsmaßnahmen vorgeschlagen:<br />
- Gezielte Flutung von Auwaldbereichen, deren natürliche Überschwemmung<br />
durch die Maßnahme zukünftig verhindert wird<br />
- Errichtung von beidseitigen Immissionsschutzeinrichtungen entlang der neu errichteten<br />
Bundesstraße B19<br />
- Naturnahe Gestaltung der Iller ohne Verbauung der Ufer<br />
- Entwicklung von bestehenden Gehölzen zu Auwäldern zwischen den Deichen<br />
- Entwicklung von bestehenden Wiesenflächen zu Feucht- und Magerwiesen<br />
Des Weiteren wurden als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgeschlagen:<br />
- Schaffung neuer Auwälder, Feuchtstandorte, extensiv genutzte Feucht-, Nassund<br />
Magerwiesen<br />
- Renaturierung der Seitengewässer<br />
- Schaffung von Ersatzgewässern und –biotopen<br />
- Verbesserung der Anbindung der Seitenbäche an die Iller auch außerhalb des<br />
Untersuchungsgebietes<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichkörper (einzubauendes Schüttmaterial)<br />
Die Gewinnung des Deichkörpermaterials erfolgte aus den Flussbettaufweitungen an der<br />
Iller die zeitgleich stattfanden. Im Einzelnen waren dies Flusskiese und Aueablagerungen.<br />
Da der Einbau von Erosionssperren vorgesehen war, waren keine besonderen Qualitätsanforderungen<br />
notwendig.<br />
Untergrund<br />
Unter der Deichaufstandsfläche sind bis in Tiefen von 3,0 m künstliche Auffüllungen vorhanden,<br />
die vom südlichen Ende beginnend auf ca. 250 m der Deichstrecke anstehen.<br />
Darunter, bzw. unter dem Mutterboden befinden sich Aueablagerungen mit einer Mächtigkeit<br />
von 0,6 m im Norden bis 2,2 m im Süden des Bauabschnitts. Sie werden von Flusskies<br />
unterlagert, der bis in Tiefen von 5,5 m bis 7,0 m reicht. Es treten dabei Schichtdi-
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 136<br />
cken von 2,6 m bis 5,7 m auf. Laut den durchgeführten Aufschlüssen endeten die Beckenablagerungen<br />
in einer Tiefe von 12,0 m.<br />
Das Grundwasser steht im Süden in einer Tiefe von 4,4 m und im Norden in einer Tiefe<br />
von 2,0 m an. War der Austausch von Aueablagerungen durch günstigere Böden geplant<br />
musste eine Grundwasserabsenkung oder Wasserhaltung vorgesehen werden.<br />
FMI-Dichtwand<br />
Für die Zementsuspension wurde CEM I 42,5R verwendet. Der w/z-Wert variierte zwischen<br />
0,9 und 1,2. Die Druckfestigkeiten von Proben erreichten bis über 7,0 N/mm². Die<br />
geforderte Druckfestigkeit von 2,0 N/mm² wurde nur an einer Stelle unterschritten. Die<br />
erreichten Durchlässigkeiten kf waren durchweg kleiner als die geforderten 10 -8 m/s.<br />
Im Zuge der Erkundung wurden 9 leichte Rammsondierungen und vier Kernbohrungen<br />
durchgeführt.<br />
Die geotechnischen Parameter der Böden sind in Tab. 1 angegeben.<br />
Tab. 1: Geotechnische Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
Schicht / Material Nr. Bodenart<br />
DIN 18196<br />
Lagerung / Konsistenz γ<br />
[kN/m³]<br />
γ'<br />
[kN/m³]<br />
ϕ´<br />
[°]<br />
c´<br />
[kN/m²]<br />
k f<br />
[m/s]<br />
Deichkörper 1 - - 20 10 30 1 1*10 -5<br />
Kiesauffüllungen 2 GU, GU* mitteldicht bis dicht 20 - 21 10 - 11 30 0 -<br />
Tone und Sande der 3 OU, TL, TM, locker bis mitteldicht / 19 - 20 9 - 10 22,5 - 25 0 - 5 -<br />
Aueablagerungen SU, SU*<br />
steif<br />
Flusskiese 4 GW, GU,<br />
GU*, X<br />
mitteldicht bis dicht 21 - 22 11 - 12 30-35 0 7*10 -3<br />
Schluff aus - UL, TL, TM, breiig bis steif 19 9 20 0 -<br />
Beckenablagerungen<br />
SU*<br />
Ausschreibung / Vergabe / Mängel<br />
Die Ausschreibung erfolgte zweigeteilt in Los 1 „Erdbau und Deichscharte“ und Los 2 „Erosionssperren<br />
und Deichweg“. In der Ausschreibung waren für die gesamte Strecke<br />
Spundwände vorgesehen. Den Zuschlag erhielt ein Nebenangebot mit einer gleichwertigen<br />
Lösung mittels FMI-Verfahren und eingestellten Stahlträgern. Der Zuschlag war mit<br />
den Forderungen verbunden, dass umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt<br />
werden müssen.<br />
Die beanstandeten Mängel lassen sich auf folgende drei Punkte reduzieren:<br />
- Die ausführende Firma der Spundwandarbeiten baute im Bereich der auskragenden,<br />
14,0 m tief reichenden Spundwand Einzelbohlen ohne Schlossverpressung<br />
ein. Nachträgliche Berechnungen zeigten, dass die Standsicherheit auch
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 137<br />
mit verminderter Schlossreibung ausreichend war. Ursprünglich waren im<br />
Schloss verpresste Doppelbohlen vorgesehen.<br />
- Stellenweise wurden geringe bindige und organische Einschlüsse in der FMI-<br />
Wand festgestellt.<br />
- Die Einbaulage der IPE-Träger wurde bereichsweise nicht in Wandmitte ausgeführt,<br />
was eine Reduzierung der Mindestüberdeckung zur Folge hatte. Die damit<br />
verbundene erhöhte Korrosionsgefahr wurde wegen der statischen Unbedenklichkeit<br />
akzeptiert.<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
0 1 2 3 4<br />
Böschungssicherung mit Flechtwerk<br />
HQ300<br />
Böschungssicherung durch<br />
Wasserbausteine; l=60cm<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Künstliche Auffüllungen<br />
Aueablagerungen<br />
Flusskies<br />
1 : 2,0<br />
5 m<br />
Humusabtrag<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt in Abschnitt 2 und 4<br />
0,55<br />
1<br />
2,00<br />
4,00<br />
3,60<br />
716,42<br />
710,92<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
Splitt- / Sandgemisch 0/5<br />
40 cm Schottertragschicht 0/32<br />
Mutterboden<br />
1 : 2,0<br />
Fußfilter 2/56mm<br />
FMI-Dichtwand mit eingestellten IPE-Trägern<br />
(dmin = 50 cm; kF,28,min = 10*E-08 m/s,<br />
βD,28,min = 2,0 MN/m²; IPE 300 / IPE360)<br />
WSP im Polder bei<br />
HQ300 714,26<br />
γ γ' ϕ' c kf<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
1 G, s, u' 20,0 10,0 30,0 1 1*10*E-05<br />
2 GU,GU* 20,0 10,0 30,0 0<br />
3 OU,TL,TM,SU,SU* 19,0 9,0 22,5 0-5<br />
4 GW,GU,GU*,X 21,0 11,0 30,0 0 7*10*E-03
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 138<br />
Bild 1: Fertig gestellter Deichscharte Bild 2: Einbringen der Spundwand<br />
Bild 3: FMI-Gerät im Einsatz Bild 4: FMI-Gerät im Einsatz (Frontansicht)<br />
Bild 5: Mischvorgang Bild 6: Einbringen der Stahlträger
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 139<br />
6.25 – Beispiel 20: Rauhenzell – Immenstadt<br />
Projektübersicht<br />
Allgemeines<br />
In Rauhenzell (Immenstadt) wurden Deiche erhöht, verbreitert und eine Innendichtung<br />
eingebaut. Im Folgenden wird das Los 6, der Einbau der Innendichtung in Form einer<br />
MIP-Wand, betrachtet.<br />
Projektinformationen<br />
Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Kempten)<br />
Art der Maßnahme: Genehmigungspflichtige Ausbaumaßnahme<br />
Gewässer: Iller bei Immenstadt (Gew. I. Ordnung)<br />
Dauer der Sanierung: Mai bis September 2003 (4,5 Monate)<br />
Länge Sanierungsabschnitt: Ca. 2.500 m (Fkm 128,00 – 130,50)<br />
Sanierungsjahr: 2003<br />
Gesamtkosten: 980.892 € Netto (reine Baukosten Erosionssperre und<br />
Deichwegebau ohne Rodungsarbeiten und Rekultivierungsmaßnahmen)<br />
Sanierungsmethode: - Einbau einer Innendichtung (MIP-Wand) als Erosionssperre<br />
Abb. 1 Lageplan mit Deichtrassen<br />
Iller-km 128,20<br />
Immenstadt<br />
i. Allgäu<br />
Iller<br />
Iller-km<br />
128,70<br />
Iller-km<br />
130,15<br />
Iller-km<br />
130,50
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Randbedingungen<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 140<br />
Das Grundwasser steht selten bei ca. 3,0 m i. d. R. bei 4,0 bis 5,0 m unter der Geländeoberkante<br />
an. Als Grundwasserleiter dient der Flusskies. Je nach Tiefenlage der Unterkante<br />
der Aueablagerungen ergibt sich ein Wechsel zwischen freien, halbgespannten und<br />
gespannten Grundwasserverhältnissen. Um ein Zufließen des Grundwassers zur Iller<br />
nicht zu beeinträchtigen wurde die Einbindetiefe der Erosionssperre entsprechend gestaffelt.<br />
Aufgrund der geplanten Gehölzbestände am und auf dem Deich wurde eine statisch wirksame<br />
Dichtwand eingebaut, um die Beeinträchtigung der Standsicherheit durch den<br />
Baumbewuchs auszugleichen.<br />
Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />
Ausgangszustand<br />
- Zu geringe Deichhöhe + Freibord<br />
- Zu geringe Deichkronenbreite<br />
- Kein gegliederter Querschnitt (keine Dichtung, kein Drän)<br />
Technische Maßnahmen am beidseitig eingestauten rechtseitigen Deich (Abb. 2)<br />
- Rodung von Waldflächen<br />
- Erhöhung des Deiches durch Anschüttung der Illerseite mit kiesigem Material auf<br />
abgetreppten Altdeich auf 1,0 m Freibord bei maximalem Polderwasserstand<br />
- Überhöhung des Deiches um die erwarteten Setzungen (ca. 1 bis 10 cm + 1 %<br />
Eigensetzung)<br />
- Verbreiterung des Deiches<br />
- Verbreiterung der Krone auf 4,7 m (4,0 m Deichkronenweg)<br />
- Ausbildung der Böschungsneigungen mit h:b = 1:2,0<br />
- Andecken der Böschungen mit Oberboden mit Wurzelbrut (50 cm) zur Gewährleistung<br />
des späteren Gehölzbewuchses<br />
- Einbau einer Innendichtung mit dem MIP-Verfahren (dmin = 50 cm; Einbindungstiefe<br />
4,5 bis 6,0 m)<br />
- Sicherstellung der statischen Wirksamkeit durch Einstellen von Stahlträgern IPE<br />
300<br />
Technische Maßnahmen am einseitig eingestauten linkseitigen Deich (Abb. 3)<br />
- Erhöhung des Deiches auf 0,85 m Freibord bei BHW300<br />
- Überhöhung des Deiches um die erwarteten Setzungen (mehr als 10 cm + 1 bis<br />
3 % Eigensetzung)<br />
- Einbau eines mit Geotextil ummantelten Fußdräns<br />
- Ansonsten wie linkseitiger Deich
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 141<br />
Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />
Ökologische Arbeiten<br />
Die wesentlichen Punkte der Umweltverträglichkeitsstudie sind in Beispiel 19 enthalten,<br />
da die Bewertung der ökologischen Auswirkungen und die Formulierung der daraus abgeleiteten<br />
Minimierungs-, Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für das Gesamtprojekt<br />
HWSOI und den Bau der Bundesstraße B19 vorab durchgeführt wurden.<br />
Im Bereich der Gemarkung Rauhenzell erfolgten Waldrodungen mit einer Gesamtfläche<br />
von 3,05 ha. Als Ausgleichsmaßnahme wurden in diesem Abschnitt 2,02 ha Fläche zur<br />
Waldneubegründung zur Verfügung gestellt.<br />
Geologische und geotechnische Erkundung<br />
Deichkörper<br />
Die Deichkörper bestehen i. d. R. aus durchlässigen Kiesen (GU).<br />
Untergrund links der Iller<br />
Unter der Deichaufstandsfläche sind künstliche Auffüllungen mit Mächtigkeiten zwischen<br />
1,0 m und 3,6 m erschlossen worden. Darunter folgen Aueablagerungen aus Auelehmen<br />
und Auesanden mit Mächtigkeiten von 0,9 m im Norden bis 2,4 m im Süden. Darunter<br />
befinden sich Flusskiese, deren Schichtunterkante mit den bis 8,0 m tief geführten Bohrungen<br />
nicht erreicht wurde. Dabei wurden auch Steine und Blöcke angetroffen. Unter den<br />
Flusskiesen sind erfahrungsgemäß Beckenablagerungen und Geschiebemergel zu erwarten.<br />
Untergrund rechts der Iller<br />
Im Gegensatz zur linkseitigen Fläche sind keine Auffüllungen vorahnden. Die hier befindlichen<br />
Aueablagerungen aus Auesanden haben hier stark schwankende Mächtigkeiten<br />
zwischen 0,0 m und 2,0 m. Die durchschnittliche Dicke liegt bei ca. 1,0 m. Darunter befindet<br />
sich Flusskies. Aus Bohrkernen aus der näheren Umgebung kann die Schichtuntergrenze<br />
in einer Tiefe von ca. 6,0 m angenommen werden. Darunter sind Beckenablagerungen<br />
zu erwarten.<br />
Linkseitig der Iller wurden 13 leichte Rammsondierungen und 10 verrohrte Rammkernbohrungen<br />
durchgeführt. Am rechtsseitigen Deich wurden 32 Nutsondierungen im Abstand<br />
von 15,0 m durchgeführt.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 142<br />
Tab. 1: Geotechnische Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />
rechtsseitiglinksseitig<br />
Deichkiese 1 1 GU 19 - 20 9 - 10 27,5 - 30 0 - 1 1*10 -8<br />
Kiese der Auffüllungen - 2 GW, GE, GU, GU*, Weich bis steif / locker 19 9 22,5 - 30 0 -<br />
UM, TM, X+Y bis mitteldicht<br />
Schluffe, Tone, Sande der 2 3 TL, TM, OU, UM, Weich bis steif / locker 19 - 20 9 - 10 20 - 30 0 - 5 -<br />
Aueablagerungen<br />
SU, SU*, GU* bis mitteldicht<br />
Flusskies 3 4 GW, GU, X Mitteldicht bis dicht 21 - 23 11 - 13 30 - 35 0 3,5*10 -3<br />
Schicht / Material Nr. Bodenart Lagerung / Konsistenz γ γ' ϕ´ c´ kf DIN 18196<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [m/s]<br />
Schluff der<br />
Beckenablagerungen<br />
4 5 TL, TM, SU, SU* weich 19 - 21 9 - 11 22,5 - 27,5 0 -<br />
Ausschreibung / Schäden<br />
Es wurde der Einbau von im Mittelschloss verpresste Doppelspundbohlen Larssen 602<br />
oder gleichwertig ausgeschrieben. Die Länge der Spundwände staffelte sich zu 4,5 m, 4,7<br />
m, 4,9 m und 5,5 m. Den Zuschlag erhielt ein Sondervorschlag in Form einer MIP-Wand<br />
mit eingestellten Stahlträgern IPE 300. Durch den Einbau einer hydraulisch gebundenen<br />
Dichtwand wurden zusätzliche Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Bauüberwachung<br />
notwendig wie z. B. die Prüfung der Frostsicherheit, die Bestimmung der einaxialen<br />
Druckfestigkeit, der Wasserdurchlässigkeit sowie die Betonüberdeckung der Stahlträger.<br />
Im Mai 2003 wurde eine unter dem Arbeitsplanum liegende Erdgasleitung beschädigt.<br />
Dabei entstand erheblicher Sachschaden.<br />
Pläne / Zeichnungen / Fotos<br />
0 1 2 3 4<br />
Wurzelbrutandeckung d=30cm<br />
Mutterboden, d=30cm<br />
2<br />
3<br />
1 : 2,0<br />
4%<br />
5 m<br />
Bankettanschüttung mit Wurzelbrut<br />
Aueablagerungen<br />
Flusskies<br />
1:1<br />
ca.50<br />
ca.1,80<br />
Abtreppung<br />
(Verzahnung mit vorhandenem Deich)<br />
0,35 4,00 0,35<br />
1<br />
3% 3%<br />
Abb. 2: Regelquerschnitt Fkm 129,55 rechtsseitig<br />
714,76<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
1:1<br />
5cm Sand-Splitt-Schicht<br />
30cm Kiestragschicht 0/64<br />
Oberboden, d=10cm<br />
1 : 2,0<br />
MIP-Dichtwand mit eingestellten IPE-Trägern<br />
(dmin = 50 cm; kF,28,min = 10*E-08 m/s, IPE300, l=6,00m)<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
1 GU 20,0 10,0 30,0 1<br />
2 OU,TL,TM,SU,GU* 19,0 9,0 25,0 0-5<br />
721,00 (Schutzziel)<br />
720,00 (Stauziel Polder)<br />
Mutterboden, d=30cm<br />
kf<br />
[m/s]<br />
3 GW,GU,X 22,0 12,0 32,5 0 3,5*10*E-03
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Wurzelbrutandeckung d=50cm<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 143<br />
0 1 2 3 4<br />
Drainageprisma aus Kies (GU) mit<br />
Geotextil (300g/m²)<br />
Mutterboden, d=30cm<br />
1 : 2,0<br />
4%<br />
5 m<br />
Bankettanschüttung mit Wurzelbrut<br />
1:1<br />
1 : 3,0<br />
Bindiger Boden d=0,25m<br />
50<br />
1,45<br />
1 : 2,0<br />
60<br />
Abtreppung<br />
(Verzahnung mit vorhandenem Deich)<br />
1<br />
0,35 4,00 0,35<br />
Abb. 3: Regelquerschnitt Fkm 128,78 linksseitig<br />
714,38<br />
Alle Längenangaben in Meter [m].<br />
Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel [m+NN].<br />
5cm Sand-Splitt-Schicht<br />
30cm Kiestragschicht 0/64<br />
3% 3% 719,12 (Schutzziel)<br />
0,85m<br />
Freibord<br />
1 : 2,0<br />
MIP-Dichtwand mit eingestellten IPE-Trägern<br />
(dmin = 50 cm; kF,28,min = 10*E-08 m/s, IPE300, l=4,50m)<br />
HQ300 = 718,37<br />
Mutterboden, d=30cm<br />
γ γ' ϕ' c<br />
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²]<br />
1 GU 20,0 10,0 30,0 1<br />
2 TM,UM,GU, X+Y 19,0 9,0 25,0 0-5<br />
3 OU,TL,TM,SU,GU* 19,0 9,0 25,0 0-5<br />
3<br />
4<br />
Aueablagerungen<br />
Flusskies<br />
kf<br />
[m/s]<br />
4 GW,GU,X 22,0 12,0 32,5 0 3,5*10*E-03<br />
2<br />
Künstliche Auffüllungen<br />
Bild 1: Rodungen an der Landseite Bild 2: Sicherung eines Strommastes
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 144<br />
Bild 3: Ausrichtung des MIP-Gerätes Bild 4: MIP-Gerät im Einsatz<br />
Bild 5: Detail der Dreifachschnecke Bild 6: Probeentnahme aus Wand
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 145<br />
7.1 – Freibordberechnung (Tabellen)<br />
Querschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />
Fl-km 2456 2455,5 2455 2454,5 2454 2453,5 2441,5 2441 2440,5 2440 2439,5 2436 2435,5 2435 2434,5 2434 2433,5 2433 2432,5 2432<br />
Bereich<br />
Ingolstadt Vohburg<br />
Pförring<br />
Streichlänge: S [m] 222 308 339 477 484 466 502 724 491 680 494 379 374 391 487 334 412 334 530 529<br />
Mittlere Fließtiefe: hm [m] 3,58 3,27 3,97 2,22 2,68 3,27 3,41 3,57 4,28 3,79 4,37 4,00 3,81 3,86 3,38 3,74 3,22 3,65 3,39 3,68<br />
Mittlere Fließgeschwindigkeit: vm [m/s] 2,63 2,30 2,10 2,07 1,74 1,52 1,40 1,18 1,24 0,91 1,11 1,58 1,77 1,69 1,41 1,66 1,50 1,20 1,26 1,25<br />
Froudzahl: Fr [-] 0,44 0,41 0,34 0,44 0,34 0,27 0,24 0,20 0,19 0,15 0,17 0,25 0,29 0,27 0,24 0,27 0,27 0,20 0,22 0,21<br />
Faktor: S/hm [-] 62 94 86 214 181 142 147 203 115 179 113 95 98 101 144 89 128 91 156 143<br />
Abfluss: Q [m³/s] 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290<br />
Abflussfläche: A [m²] 869,5 994,1 1089,9 1106,8 1315,7 1507,9 1640,0 1938,9 1841,5 2506,6 2058,1 1451,5 1292,8 1356,9 1624,7 1381,5 1529,3 1904,8 1813,6 1831,9<br />
Windstauhöhe: hWi [m] 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />
Wellenauflaufhöhe: hAuf [m] 0,45 0,53 0,57 0,62 0,65 0,66 0,68 0,81 0,69 0,80 0,69 0,60 0,59 0,61 0,67 0,56 0,62 0,56 0,70 0,71<br />
Summe Zuschläge: hZu [m] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
windinduzierter Freibord: fWind [m] 0,50 0,59 0,62 0,69 0,71 0,72 0,74 0,88 0,75 0,86 0,75 0,66 0,65 0,67 0,73 0,62 0,68 0,62 0,76 0,77<br />
Strömungswellenfaktor: a [-] 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08<br />
strömungsinduzierter Freibord: fStr [m] 0,43 0,39 0,43 0,29 0,31 0,33 0,33 0,32 0,37 0,31 0,36 0,39 0,39 0,39 0,33 0,38 0,33 0,33 0,32 0,34<br />
Mindestfreibord: fmin [m] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
Bemessungsfreibord: f [m] 0,50 0,59 0,62 0,69 0,71 0,72 0,74 0,88 0,75 0,86 0,75 0,66 0,65 0,67 0,73 0,62 0,68 0,62 0,76 0,77<br />
Abschnittsweiser Freibord: f* [m]<br />
0,72<br />
0,88<br />
0,77<br />
Inn<br />
Mangfall*<br />
Querschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Fl-km 198 197,4 196,8 196,2 195,6 195 194,4 186,8 186,2 185,6 185 184,4 183,8 183,2 10 9,8 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8<br />
Bereich<br />
Rosenheim Feldkirchen<br />
Aiblinger Au<br />
Streichlänge: S [m] 177 152 238 226 242 221 188 109 119 149 182 292 453 487 61,49 61,52 58 56,88 66,96 58,69 62,61 90,25 71,46 65,33 61,74<br />
Mittlere Fließtiefe: hm [m] 5,36 6,33 4,28 4,77 4,21 5,27 5,70 7,71 6,85 5,89 4,99 3,73 2,92 2,78 2,88 2,13 2,27 2,07 1,79 2,55 1,82 2,12 2,11 1,96 2,11<br />
Mittlere Fließgeschwindigkeit: vm [m/s] 2,63 2,80 2,36 2,49 2,43 2,10 2,47 2,89 2,91 2,91 2,53 2,30 1,91 1,87 1,92 2,60 2,58 2,89 2,84 2,27 2,99 1,78 2,26 2,66 2,61<br />
Froudzahl: Fr [-] 0,36 0,36 0,36 0,36 0,38 0,29 0,33 0,33 0,36 0,38 0,36 0,38 0,36 0,36 0,33 0,41 0,46 0,50 0,50 0,40 0,55 0,33 0,39 0,46 0,45<br />
Faktor: S/hm [-] 33 24 56 47 57 42 33 14 17 25 36 78 155 175 21 29 26 28 37 23 34 43 34 33 29<br />
Abfluss: Q [m³/s] 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2570 2570 2570 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340<br />
Abflussfläche: A [m²] 893,6 838,1 997,5 944,0 966,0 1121,4 953,0 813,4 807,2 807,4 928,7 1115,4 1342,2 1372,0 177,08 130,769 131,78 117,647 119,72 149,8 113,71 191,01 150,44 127,82 130,268<br />
Windstauhöhe: hWi [m] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 0,0028 0,0027 0,00241<br />
Wellenauflaufhöhe: hAuf [m] 0,65 0,64 0,52 0,47 0,47 0,46 0,45 0,41 0,40 0,40 0,37 0,36 0,32 0,30 0,22 0,22 0,21 0,21 0,23 0,22 0,22 0,2736 0,2407 0,2289 0,22201<br />
Summe Zuschläge: hZu [m] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
windinduzierter Freibord: fWind [m] 0,71 0,69 0,58 0,53 0,52 0,51 0,50 0,46 0,46 0,45 0,42 0,42 0,38 0,37 0,27 0,27 0,27 0,26 0,28 0,27 0,28 0,33 0,29 0,28 0,27<br />
Strömungswellenfaktor: a [-] 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,14<br />
strömungsinduzierter Freibord: fStr [m] 0,58 0,67 0,47 0,52 0,47 0,52 0,59 0,78 0,72 0,64 0,54 0,42 0,33 0,32 0,37 0,46 0,48 0,43 0,38 0,40 0,42 0,39 0,39 0,42 0,43<br />
Mindestfreibord: fmin [m] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
Bemessungsfreibord: f [m] 0,71 0,69 0,58 0,53 0,52 0,52 0,59 0,78 0,72 0,64 0,54 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
Abschnittsweiser Freibord: f* [m]<br />
0,71 0,78<br />
0,50<br />
Allgemeine Randbedingungen und Annahmen:<br />
Donau<br />
Windgeschwindigkeit: v Wi = 20 [m/s] Windangriffswinkel: βWi = 90 [°] * Daten der Strömungsberechnung mit Vorland<br />
Böschungsneigung: β = 1:3 Böschungsrauheit: kD*kR = 0,8 [-] ** Ermittlung nur unter Berücksichtigung des Abflusses im Hauptgerinne<br />
Überschreitungswahrscheinlichkeit: kX = 2,4 [-]
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 146<br />
7.2 – MIP-Verfahren (Fa. Bauer Spezialtiefbau GmbH)<br />
Literatur<br />
Das Verfahren und die Anwendung des Verfahrens sind in erster Linie aus den Firmenbroschüren<br />
und Referenzlisten der Firma Bauer Spezialtiefbau GmbH wie z. B. Bauer AG<br />
(2003) und Bauer Spezialtiefbau GmbH (2004 a + b) zu entnehmen. Weiterhin sind in<br />
DWA (2005), Stocker (2003 a + b), Weiß (2003 b) und Wildner et al. (1999) Hinweise und<br />
Anwendungen aus der Praxis enthalten.<br />
Allgemeines<br />
Unter dem Begriff "Mixed-in-Place" versteht man eine Vermischung von Bindemitteln und<br />
Boden an Ort und Stelle. Die vorhandenen Porenräume im Bodengerüst werden dabei mit<br />
der Bindemittelsuspension verfüllt. Das Ergebnis ist ein aufgrund der Schneckengeometrie<br />
definierter verfestigter Bodenkörper.<br />
Bild 1: MIP-Dreifachschnecke<br />
an BG 7 / GT 9 mit Anbaurahmen<br />
zum Arbeiten zwischen<br />
den Ketten parallel zur Fahrtrichtung<br />
aus Bauer Spezialtiefbau<br />
GmbH (2004 a)<br />
Anforderungen / Eigenschaften<br />
Die Suspension für eine MIP-Wand kann beispielsweise aus 50 kg/m³ Bentonit, 300 kg/m³<br />
Zement, 300 kg/m³ Kalksteinmehl und 780 kg/m³ Wasser bestehen (Wildner et al. (1999)).<br />
Die Durchlässigkeit liegt i. d. R. bei k < 10 -8 m/s.<br />
Je nach Verfahren können Wände bis 25 m Tiefe hergestellt werden (siehe auch Bild 2).<br />
Die Dicke der hergestellten Wand variiert je nach Bohrschnecke von 0,35 bis ca. 0,88 m.<br />
Die erreichbaren Druckfestigkeiten liegen i. d. R. unter 1,0 MN/m². In Abstimmung an die<br />
Anforderungen an die Plastizität können auch höhere Druckfestigkeiten durch Erhöhung<br />
des Bindemittelanteils erreicht werden.<br />
Arbeitsablauf / Einbau<br />
Zur Herstellung des MIP-Schlitzes wird eine Dreifachschnecke verwendet. Während des<br />
Abbohrens und Ziehens wird der anstehende Boden aufgemischt und durch das hohe
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 147<br />
Seelenrohr der Schnecke die Bindemittelsuspension eingebaut. Zur weiteren Homogenisierung<br />
kann die Drehrichtung der einzelnen Schnecken variiert werden.<br />
Bild 2: Trägergeräte und Bohrschnecken aus Bauer Spezialtiefbau GmbH (2004 a)<br />
Die Herstellung wird laut Bauer Spezialtiefbau GmbH (2004 a) grob in fünf Phasen unterteilt<br />
(Bild 3). Der Einrichtung des Bohrgeräts am Ansatzpunkt (1) folgen das Abbohren mit<br />
Suspensionszugabe (2), das Mischen und Homogenisieren des Bodens durch Variieren<br />
der Schneckendrehrichtung (3 + 4) und das Ziehen der Bohrschnecke (5).<br />
Bild 3: Herstellungsphasen des MIP-Verfahrens aus Bauer Spezialtiefbau GmbH (2004 a)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 148<br />
Die Herstellung erfolgt im Pilgerschrittverfahren (Bild 4). Die Primärlamelle (1) und die<br />
Sekundärlamelle (2) wird mit einer dazwischen liegenden Tertiärlamelle (3) verbunden,<br />
was eine zusammenhängendes Wandelement ergibt (4). Das Pilgerschrittverfahren kann<br />
zur Erzielung einer niedrigeren Durchlässigkeit und einer besonders homogenen Wand<br />
mit zusätzlichen Lamellenstichen ergänzt werden wie z. B. bei der Erhöhung des Sylvensteinspeichers<br />
(Wildner et al. (1999)).<br />
Bild 4: Herstellung der MIP-Wand im<br />
Pilgerschrittverfahren aus Bauer Spezialtiefbau<br />
GmbH (2004 a)<br />
Bild 4 zeigt das Verfahren beim Einsatz auf einem Hochwasserschutzdeich an einem<br />
Hochwasserschutzdeich an der „Kleines Donau“. Das geringe Ausmaß der Bodenförderung<br />
ist gut an den kleinen Erdwällen links und rechts des Suspensionsschlitzes sowie an<br />
der Detailaufnahme in Bild 4 zu erkennen<br />
Vorteile / Nachteile<br />
Die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens sind in nachstehender Tab. 1 aufgelistet. Bei<br />
günstigen Bodenverhältnissen und ausreichend tief reichenden Wandabmessungen können<br />
mit dem MIP-Verfahren trotz der aufwendigen Baustelleneinrichtung sehr günstige<br />
Einheitspreise erzielt werden. Bei geringen Wandtiefen, sprich häufigem Umsetzen des<br />
Gerätes im Verhältnis zur Bohrdauer, verschlechtert sich die Wirtschaftlichkeit dieses Verfahrens.<br />
Tab. 1: Vor- und Nachteile des MIP-Verfahrens<br />
Vorteile Nachteile<br />
- Einsetzbar in nahezu allen Bodenarten,<br />
auch in bindigen, kohäsiven<br />
Schichten<br />
- Einstellen von Stahlträgern möglich<br />
- Geringe Förderung von Boden<br />
- Erschütterungsarm<br />
- Hoher Widerstand gegen chemischen<br />
Angriff und Erosion<br />
- Organische Bodenbestandteile<br />
beeinträchtigen<br />
und Festigkeit<br />
Abbindeprozess<br />
- Nicht einsetzbar bei steinigen und<br />
mit Findlingen durchsetzten Böden<br />
- Herstellung nur von der Deichkrone<br />
aus
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 149<br />
Bild 4: MIP-Gerät im Einsatz an einem Deich an<br />
der „Kleinen Donau“ (Quelle: WWA Ingolstadt)<br />
Bild 4: Nahaufnahme der Bohrschnecke<br />
aus Stocker (2003 b)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 150<br />
7.3 – FMI-Verfahren (Fa. Sidla & Schönberger)<br />
Literatur<br />
Das Verfahren und die Anwendung des Verfahrens sind in erster Linie aus den Firmenbroschüren<br />
und Referenzlisten der Firma Sidla & Schönberger Spezialtiefbau GmbH wie<br />
z. B. Sidla & Schönberger Spezialtiefbau GmbH (2003) zu entnehmen. Weiterhin sind in<br />
DWA (2005) und Weiß (2003 b) Hinweise und Anwendungen aus der Praxis enthalten.<br />
Allgemeines<br />
Mittels einer Grabenfräse (Bild 1) wird die vorhandene Bodenstruktur vermischt und<br />
gleichzeitig Suspension beigemengt.<br />
Bild 1: Grabenfräse im<br />
Einsatz auf einem Donaudeich<br />
bei Niederaltaich<br />
(Quelle: TUM)<br />
Anforderungen / Eigenschaften<br />
Die Suspension besteht aus einem Wasser-Bindemittelgemisch ggf. mit einem Anteil an<br />
Bentonit und/oder Füllern.<br />
Die Durchlässigkeit liegt i. d. R. bei k < 10 -8 m/s.<br />
Je nach Verfahren können Wände bis 9,5 m Tiefe hergestellt werden.<br />
Die Dicke der hergestellten Wand variiert je nach Fräsbaum von 0,35 bis ca. 1,00 m.<br />
Arbeitsablauf / Einbau<br />
Auf der Deichkrone wird der Fräsbaum bis Solltiefe abgesenkt, wobei sich das Raupenfahrzeug<br />
gleichzeitig rückwärts bewegt und eine fugenlose Dichtwand herstellt. Die Suspension<br />
wird am Fräskopf über eine Leitung entlang des Fräsbaumes zugegeben (Bild 2).
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Bild 2: Detailaufnahme vom Fräskopf<br />
mit Düse zur Bindemittelzugabe<br />
(Quelle: TUM)<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 151<br />
Für das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf erstellte die Baustoffprüfanstalt für Asphalt<br />
und Erdbau GmbH (B-A-E) ein Gutachten, das insbesondere die Durchlässigkeit und die<br />
Festigkeit einer in einen Hochwasserschutzdeich an der Donau eingebauten FMI-Wand<br />
untersuchte. Die Ergebnisse zeigten, dass die Anforderungen sowohl an die Dichtheit als<br />
auch an die Festigkeit bei den verwendeten Rezepturen und den anstehenden Böden<br />
erfüllt werden konnten (B-A-E (2000)).<br />
Im Zuge der Ertüchtigung des Mangfalldeiches aus (Beispiel 01 aus Kapitel 06) wurde die<br />
eingebrachte FMI-Wand an einer Stelle aufgegraben und Proben gezogen. Sowohl die<br />
Festigkeit als auch die Durchlässigkeit waren zufrieden stellend (Bild 3 und 4).<br />
Bild 3: Ausgegrabene FMI-Wand an einem<br />
Mangfalldeich (Quelle: WWA Rosenheim)<br />
Bild 4: Bohrkerne einer erhärteten FMI-<br />
Wand aus einem Mangfalldeich (Quelle:<br />
WWA Rosenheim)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 152<br />
Vorteile / Nachteile<br />
Die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens sind in nachstehender Tab. 1 aufgelistet. Bei<br />
günstigen Bodenverhältnissen und ausreichend tief reichenden Wandabmessungen können<br />
trotz der aufwendigen Baustelleneinrichtung wie auch beim MIP-Verfahren sehr günstige<br />
Einheitspreise erzielt werden.<br />
Tab. 1: Vor- und Nachteile des FMI-Verfahrens<br />
Vorteile Nachteile<br />
- Einsetzbar in nahezu allen Bodenarten,<br />
auch in bindigen, kohäsiven<br />
Schichten<br />
- Einstellen von Stahlträgern möglich<br />
- Geringe Förderung von Boden<br />
- Erschütterungsarm<br />
- Hoher Widerstand gegen chemischen<br />
und biologischen Angriff<br />
und Erosion<br />
- Keine Fugen auch bei Arbeitsunterbrechungen<br />
- Organische Bodenbestandteile<br />
beeinträchtigen den Abbindeprozess<br />
und die Festigkeit<br />
- Nicht einsetzbar bei steinigen und<br />
mit Findlingen durchsetzten Böden<br />
(d > 35 cm)<br />
- Herstellung nur von der Deichkrone<br />
aus
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 153<br />
8.1 – Übersicht – Verfahren der Geophysik (Erdoberfläche)<br />
DIN 4020 Beiblatt 1 (2003) – Tabelle 5 (S. 16 – 17)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 154<br />
8.2 – Übersicht – Verfahren der Geophysik (Bohrloch)<br />
DIN 4020 Beiblatt 1 (2003) – Tabelle 6 (S. 18 – 19)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
10.1 – Versuchsstand (Detail)<br />
9<br />
10<br />
20 cm<br />
6<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 155<br />
2<br />
9<br />
15 cm<br />
10.2 – Durchlässigkeitszelle (Detail)<br />
11<br />
10<br />
5<br />
3<br />
2<br />
9<br />
20 cm<br />
6<br />
13<br />
15 cm<br />
6<br />
3<br />
11<br />
5<br />
7<br />
1<br />
8<br />
7<br />
1<br />
4<br />
4<br />
1. Durchlassventile<br />
2. Schlauch: Vorratsbehälter<br />
- Standrohr<br />
3. Standrohr mit Skalierung<br />
(OW)<br />
4. Schlauch: Standrohr –<br />
Zelle<br />
5. Durchlässigkeitszelle mit<br />
Probe<br />
6. 4 Deckelschrauben<br />
7. Entlüftungsschraube<br />
8. Schlauch: Zelle -<br />
Auffangbehälter<br />
9. Klemmleiste (UW)<br />
10. Auffangbehälter<br />
1. Zulauf<br />
2. Zellenboden<br />
3. Dichtungsring<br />
4. Gelochte Scheibe<br />
5. Zylinderflansch (unten)<br />
6. Befestigungsschrauben<br />
7. Bodenprobe<br />
8. Sinterplatte<br />
9. Auffüllkies<br />
10. Zylinderflansch (oben)<br />
11. Zellendeckel<br />
12. Entlüftungsschraube<br />
13. Auslauf<br />
1
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für <strong>Anhang</strong> 156<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft<br />
Datum der Entnahme:<br />
19.11.2003<br />
10.3 - Liste der entnommenen Proben von Grasnarben aus Deichen an der Mangfall<br />
Entnahmepersonal: <strong>Haselsteiner</strong> (Wasserbau / TUM)<br />
Manninger (Wasserbau / TUM)<br />
Obermaier (WWA Rosenheim)<br />
Anzahl entnommener Proben: 24 Anzahl Entnahmestandorte: 6<br />
Proben Sonstige Bemerkungen Proben<br />
Nr. Nr. Deich Gewässer Fkm Neigung Abstand von Kronenbreite Ufer Deichart wass. / Alter der San. / Jahr Sonstiges Zusammensetzung Oberboden Zustand des Deiches, Besondere Nr.<br />
1 : n Krone [m] [m]<br />
luft. Bepflanzung [a] Neubau<br />
(Eigene Einschätzung) [cm] Vorkommnisse bei der Probenentnahme<br />
1 1 Bauabschnitt 04 / Mangfall 3,2 3 1 3 rechtes Homogen w 3 Sanierung 2000 Probe gut erhalten, Kiesschicht erreicht Mischrasen 1 - 3 cm 1<br />
Aisinger Wies<br />
Ufer (undurchlässig)<br />
2 1 Bauabschnitt 04 / Mangfall 3,2 3 1 3 rechtes Homogen w 3 Sanierung 2000 Probe gut erhalten, Kiesschicht erreicht Mischrasen 1 - 3 cm 2<br />
Aisinger Wies<br />
Ufer (undurchlässig)<br />
3 1 Bauabschnitt 04 / Mangfall 3,2 3 2 3 rechtes Homogen w 3 Sanierung 2000 Probe gut erhalten, Kiesschicht erreicht Mischrasen 1 - 3 cm 3<br />
Aisinger Wies<br />
Ufer (undurchlässig)<br />
4 1 Bauabschnitt 04 / Mangfall 3,2 1,5 1 3 rechtes Homogen l 3 Sanierung 2000 Probe mittel bis gut erhalten, Kiesschicht erreicht Rasen mit Stauden, deckend k. A. 4<br />
Aisinger Wies<br />
Ufer (undurchlässig)<br />
5 1 Bauabschnitt 04 / Mangfall 3,2 1,5 1 3 rechtes Homogen l 3 Sanierung 2000 Probe mittel bis gut erhalten, Kiesschicht erreicht Rasen mit Stauden, deckend k. A. 5<br />
Aisinger Wies<br />
Ufer (undurchlässig)<br />
6 1 Bauabschnitt 04 / Mangfall 3,2 1,5 2 3 rechtes Homogen l 3 Sanierung 2000 Probe mittel bis gut erhalten, Kiesschicht erreicht Rasen mit Stauden, deckend k. A. 6<br />
Aisinger Wies<br />
Ufer (undurchlässig)<br />
7 2 Aiblinger Au / Mangfall 9,2 2,5 1 3 rechtes Innendichtung w 1 Sanierung 2002 Probe gut erhalten, Kiesschicht erreicht Rasen 10 cm Wasserseitig: Reigras (schnell wachsend), 7<br />
Deichsanierung<br />
Ufer (FMI)<br />
Luftseitig: Magerrasen (ökologisch sehr wertvoll,<br />
8 2 Aiblinger Au / Mangfall 9,2 2,5 2 3 rechtes Innendichtung w 1 Sanierung 2002 Probe gut erhalten, Kiesschicht erreicht Rasen 10 cm nicht deckend, keine Probe)<br />
8<br />
Deichsanierung<br />
Ufer (FMI)<br />
9 2 Aiblinger Au / Mangfall 9,2 2,5 4 3 rechtes Innendichtung w 1 Sanierung 2002 Probe gut erhalten, Kiesschicht erreicht Rasen 10 cm 9<br />
Deichsanierung<br />
Ufer (FMI)<br />
10 3 Willing / Altdeich Mangfall 11,7 2 0,8 1,5 rechtes Homogen w 80 Neubau 1920 Probe schlecht erhalten, durchwurzelte Oberbodenschicht erkennbar, Gehölz, Stauden k. A. Alter Deich, kurz vor Sanierung, Durchlässigkeiten 10<br />
Ufer (durchlässig)<br />
differenzierbare Kieschicht nicht erkennbar<br />
k des Deichkörpers 10<br />
11 3 Willing / Altdeich Mangfall 11,7 2 0,6 1,5 rechtes Homogen w 80 Neubau 1920 Probe schlecht erhalten, durchwurzelte Oberbodenschicht erkennbar, Gehölz, Stauden k. A. 11<br />
Ufer (durchlässig)<br />
differenzierbare Kieschicht nicht erkennbar<br />
12 3 Willing / Altdeich Mangfall 11,7 2 0,6 1,5 rechtes Homogen w 80 Neubau 1920 Probe schlecht erhalten, durchwurzelte Oberbodenschicht erkennbar, Gehölz, Stauden k. A. 12<br />
Ufer (durchlässig)<br />
differenzierbare Kieschicht nicht erkennbar<br />
13 3 Willing / Altdeich Mangfall 11,7 2 2,5 1,5 rechtes Homogen l 80 Neubau 1920 Probe sehr schlecht erhalten, durchwurzelte Oberbodenschicht fast keine Grasnarbe, waldartiger k. A. 13<br />
Ufer (durchlässig)<br />
nicht erkennbar, waldartiger Bewuchs bis an den Deich<br />
Bewuchs (schattig)<br />
14 3 Willing / Altdeich Mangfall 11,7 2 1,6 1,5 rechtes Homogen l 80 Neubau 1920 Probe sehr schlecht erhalten, durchwurzelte Oberbodenschicht fast keine Grasnarbe, waldartiger k. A. 14<br />
Ufer (durchlässig)<br />
nicht erkennbar, waldartiger Bewuchs bis an den Deich<br />
Bewuchs (schattig)<br />
15 3 Willing / Altdeich Mangfall 11,7 2 2,6 1,5 rechtes Homogen l 80 Neubau 1920 Probe sehr schlecht erhalten, durchwurzelte Oberbodenschicht fast keine Grasnarbe, waldartiger k. A. 15<br />
Ufer (durchlässig)<br />
nicht erkennbar, waldartiger Bewuchs bis an den Deich<br />
Bewuchs (schattig)<br />
16 4 Götting / Mangfall 14,2 3 1,6 3 rechtes Homogen w 18 Sanierung 1985 Probe gut erhalten, deckende Grasnarben verschiedenartiger Gräser krautartiger Bewuchs k. A. 16<br />
Deichsanierung<br />
Ufer (durchlässig)<br />
17 4 Götting / Mangfall 14,2 3 3,2 3 rechtes Homogen w 18 Sanierung 1985 Probe gut erhalten, deckende Grasnarben verschiedenartiger Gräser Gras k. A. 17<br />
Deichsanierung<br />
Ufer (durchlässig)<br />
18 4 Götting / Mangfall 14,2 3 5 3 rechtes Homogen w 18 Sanierung 1985 Probe gut erhalten, deckende Grasnarben verschiedenartiger Gräser krautartiger Bewuchs k. A. 18<br />
Deichsanierung<br />
Ufer (durchlässig)<br />
19 5 Götting / Mangfall 14,8 1,8 1,4 3 rechtes Innendichtung w 1 Sanierung 2002 Probe gut erhalten, Kiesschicht erreicht Rasen 10 cm 19<br />
Deichsanierung<br />
Ufer (FMI)<br />
20 5 Götting / Mangfall 14,8 1,8 2,4 3 rechtes Innendichtung w 1 Sanierung 2002 Probe gut erhalten, Kiesschicht erreicht Rasen 10 cm 20<br />
Deichsanierung<br />
Ufer (FMI)<br />
21 5 Götting / Mangfall 14,8 1,8 2 3 rechtes Innendichtung w 1 Sanierung 2002 Probe gut erhalten, Kiesschicht erreicht Rasen 10 cm 21<br />
Deichsanierung<br />
Ufer (FMI)<br />
22 6 Götting / Altdeich Mangfall 15 2 1,6 1 linkes Homogen w 70 Neubau 1930 Probe gut erhalten, unter durchwurzelter Schicht Humusschicht Verschiedene Gräser und > 10 cm Alter Deich nach Rodung, Wurzelstöcke noch 22<br />
Ufer (durchlässig)<br />
Stauden<br />
vorhanden, Bewuchs nur teilweise deckend,<br />
23 6 Götting / Altdeich Mangfall 15 2 2,2 1 linkes Homogen w 70 Neubau 1930 Probe gut erhalten, unter durchwurzelter Schicht Humusschicht Verschiedene Gräser und > 10 cm luftseitig waldartiger Bewuchs bis an den Deich -- 23<br />
Ufer (durchlässig)<br />
Stauden<br />
> keine Proben wasserseitig<br />
24 6 Götting / Altdeich Mangfall 15 2 1,6 1 linkes Homogen w 70 Neubau 1930 Probe gut erhalten, unter durchwurzelter Schicht Humusschicht Verschiedene Gräser und > 10 cm 24<br />
Ufer (durchlässig)<br />
Stauden<br />
-2 bis 10 -3 Standort<br />
Lage Querschnitt Angaben zur Grasnarbe<br />
Deich mit homogenen Aufbau und<br />
überdimensioniertem Querschnitt, Anreicherung<br />
mit Kalk, Böschungsneigungen variierend der<br />
Landschaft angepasst<br />
m/s,<br />
Probenentnahme sehr schwierig, da gerodetes<br />
Material auf der wasserseitigen Böschung<br />
abgelagert war, luftseitig war starker wald- und<br />
gebüschartiger Bewuchs vorhanden<br />
Wasserseitig deckender Bewuchs mit<br />
Mischgräsern, kein Gehölz auf Böschung<br />
wasserseitig vorhanden, luftseitig buschartiger<br />
Bestand auf Böschung, so dass Probenentnahme<br />
luftseitig nicht möglich war<br />
Sanierter Deich mit schöner,<br />
zusammenhängender Grasnarbe mit ca. 20 cm<br />
dicken Durchwurzelungsschicht, vergleichbar mit<br />
Aiblinger Au, nur Oberboden dicker
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 157<br />
10.4 – Fotos der Standorte der Entnahme von Grasnarbenproben<br />
Standort 1: Aisinger Wies Standort 2: Aiblinger Au<br />
Standort 3: Willing Standort 4: Götting (Sanierung 1985)<br />
Standort 5: Götting (Sanierung 2002) Standort: Götting („Altdeich“)
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 158<br />
10.5 – Fotodok. II: Oberflächen der Grasnarbenproben 1 bis 8<br />
Probe 1<br />
Probe 2<br />
Probe 3<br />
Probe 4<br />
Probe 5<br />
Probe 6<br />
Probe 7<br />
Probe 8
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 159<br />
10.6 – Fotodok. II: Oberflächen der Grasnarbenproben 9 bis 16<br />
Probe 9<br />
Probe 10<br />
Probe 11<br />
Probe 12<br />
Probe 13<br />
Probe 14<br />
Probe 15<br />
Probe 16
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 160<br />
10.7 – Fotodok. II: Oberflächen der Grasnarbenproben 17 bis 24<br />
Probe 17<br />
Probe 18<br />
Probe 19<br />
Probe 20<br />
Probe 21<br />
Probe 22<br />
Probe 23<br />
Probe 24
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 161<br />
10.8 – Ergebnistabelle der Versuchsreihen I und II<br />
Proben-<br />
Böschung Einbauhöhe Einbaudichte<br />
Nr.<br />
[cm] [g/cm 3 Standort<br />
k10 - Wert<br />
] [m/s]<br />
1 1 Aisinger Wies wasserseitig 12,0 1,41 1,55E-03<br />
2 1 Aisinger Wies wasserseitig 13,5 1,52 6,94E-04<br />
3 1 Aisinger Wies wasserseitig 13,5 1,59 4,18E-05<br />
4 1 Aisinger Wies landseitig 14,5 1,31 1,75E-03<br />
5 1 Aisinger Wies landseitig 15,5 1,61 2,62E-04<br />
6 1 Aisinger Wies landseitig 14,5 1,36 8,80E-04<br />
7 2 Aiblinger Au wasserseitig 11,5 1,50 4,15E-04<br />
8 2 Aiblinger Au wasserseitig 7,5 1,63 8,26E-04<br />
9 2 Aiblinger Au wasserseitig 6,5 1,69 1,79E-04<br />
10 3 Willing<br />
-<br />
11 3 Willing wasserseitig 11,5 1,23 2,29E-03<br />
12 3 Willing wasserseitig 9,0 1,27 1,77E-03<br />
13 3 Willing landseitig 11,5 1,20 9,02E-04<br />
14 3 Willing landseitig 7,0 1,44 6,99E-04<br />
15 3 Willing<br />
-<br />
16 4 Götting wasserseitig 12,5 1,23 9,21E-04<br />
17 4 Götting wasserseitig 13,0 1,46 1,37E-04<br />
18 4 Götting wasserseitig 7,5 1,53 5,17E-04<br />
19 5 Götting wasserseitig 16,0 1,55 1,97E-04<br />
20 5 Götting wasserseitig 13,5 1,49 1,21E-04<br />
21 5 Götting wasserseitig 15,5 1,49 5,98E-04<br />
22 6 Götting wasserseitig 11,0 1,62 1,70E-04<br />
23 6 Götting wasserseitig 13,3 1,54 1,76E-04<br />
24 6 Götting<br />
-<br />
25 7* Götting wasserseitig 14,4 1,19 7,59E-04<br />
26 7* Götting wasserseitig 14,7 1,30 1,85E-04<br />
27 7* Götting wasserseitig 14,2 1,38 1,52E-04<br />
28 7* Götting wasserseitig 13,5 1,06 1,47E-04<br />
29 7* Götting wasserseitig 12,2 1,31 5,78E-04<br />
30 7* Götting<br />
-<br />
* Standort 7 entspricht Standort 5
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 162<br />
11.1 – Liste der Bäume der Gefahrenklasse 1<br />
Gefahrenklasse 1<br />
Name lat. Name Baum /<br />
Strauch<br />
H max<br />
[m]<br />
Alle Hybridpappeln Alle Hybridpappeln Baum 30<br />
Bergahorn Acer pseudoplatanus Baum 30<br />
Bergulme Ulmus glabra Baum 30<br />
Esche Fraxinus excelsior Baum 30<br />
Eßkastanie Castanea sativa Baum 30<br />
Fichte Picea abies Baum 50<br />
Flatterulme Ulmus laevis Baum 35<br />
Graupappel Populus canescens Baum 30<br />
Kiefer Pinus silvestris Baum 40<br />
Lärche Larix decidua Baum 50<br />
Robinie Robinia pseudoacacia Baum 25<br />
Schwarzpappel Populus nigra Baum 35<br />
Silberpappel Populus alba Baum 30<br />
Silberweide Salix alba Baum 30<br />
Sommerlinde Tilia platyphylos Baum 30<br />
Stieleiche Quercus robur Baum 30<br />
Traubeneiche Quercus petraea Baum 40<br />
Weißtanne Abies alba Baum 50<br />
Zitterpappel / Aspe Populus tremula Baum 35
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 163<br />
11.2 – Liste der Bäume und Sträucher der Gefahrenklasse 2<br />
Gefahrenklasse 2<br />
Name lat. Name Baum /<br />
Strauch<br />
H max<br />
[m]<br />
Alle Strauchweidenarten Salix incana/S. elaeganos Strauch 12<br />
Bruchweide Salix fragilis Baum 20<br />
Eberesche/Vogelbeere Sorbus aucuparia Baum 15<br />
Elsbeerbaum Sorbus torminalis Baum 22<br />
Feldahorn Acer campestre Baum 10<br />
Feldulme Ulmus minor / carpinifolia Baum 20<br />
Grauerle/Weißerle Alnus incana Baum 15<br />
Hainbuche Carpinus betulus Baum 20<br />
Holzbirne Pirus communis Baum 20<br />
Loorbeerweide Salix pentandra Baum 10<br />
Mehlbeere Sorbus aria Baum 15<br />
Moorbirke Betula pubescens Baum 10<br />
Nordische Eberesche Sorbus intermedia Baum 20<br />
Reifweide Salix daphnoides Strauch 12<br />
Roßkastanie Aesculus hippocastanum Baum 20<br />
Rotbuche Fagus silvatica Baum 15<br />
Roter Holunder/Traubenholunder Sambucus racemosa Baum 10<br />
Rotweide / Weißweide Salix x rubens Baum 25<br />
Sandbirke Betula pendula Baum 20<br />
Schwarzerle Alnus glutinosa Baum 25<br />
Speierling Sobus domestica Baum 20<br />
Spitzahorn Acer platanoides Baum 25<br />
Stechpalme Ilex aquifolium Baum 10<br />
Traubenkirsche Prunus padus Baum 10<br />
Vogelkirsche Prunus avium Baum 20<br />
Wildbirne Pirus pyraster Baum 10<br />
Winterlinde Tilia cordata Baum 25
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 164<br />
11.3 – Listen der Sträucher und kleinen Bäume der Gefahrenklasse<br />
3 und 4<br />
Gefahrenklasse 3<br />
Name lat. Name Baum /<br />
Strauch<br />
Grünerle Alnus viridis Strauch 6<br />
Roter Hartriegel Cornus sanguinea Strauch 6<br />
Hasel Corylus avellana Strauch 8<br />
Weissdorn (eingriffelig) Crataegus monogyna Strauch 7<br />
Weissdorn (zweigriffelig) Crataegus oxyacantha Strauch 8<br />
Spindelstrauch / Pfaffenhütchen Euonymus europaeus Strauch 7<br />
Rainweide/ Liguster Ligustrum vulgare Strauch 5<br />
Grauweide Salix cinerea Strauch 5<br />
Purpurweide Salix purpurea Strauch 6<br />
Schwarzer Holunder Sambucus nigra Strauch 7<br />
Holzapfel/Apfelbaum Malus silvestris Strauch 8<br />
Korbweide Salix viminalis Strauch 8<br />
Mandelweide Salix triandra Strauch 7<br />
Kornelkirsche Cornus mas Strauch 8<br />
Kreuzdorn Rhamnus cathartica Strauch 8<br />
Weichselkirsche Prunus mahaleb Strauch 6<br />
Hundsrose Rosa canina Strauch 5<br />
Wolliger Schneeball Viburnum lantana Strauch 5<br />
Gefahrenklasse 4<br />
Name lat. Name Baum /<br />
Strauch<br />
H max<br />
[m]<br />
Heckenkirsche Lonicera xylosteum Strauch 2<br />
Schlehdorn Prunus spinosa Strauch 3<br />
Wasserschneeball Viburnum opulus Strauch 4<br />
Faulbaum Rhamnus frangula Strauch 4<br />
Schwarzweide Salix nigricans Strauch 4<br />
Kratzbeere Rubus caesius Strauch 3<br />
Ohrweide Salix aurita Strauch 2<br />
Felsenbirne Amelanchier ovalis Strauch 3<br />
Berberitze Berberis vulgaris Strauch 2,5<br />
Besenginster Cytisus scoparius Strauch 2<br />
Alle Wildrosenarten Alle Wildrosenarten Strauch 3<br />
Brombeere Rubus fructicosus Strauch 2<br />
Himbeere Rubus idaeus Strauch 2<br />
Kriechweide Salix repens Strauch 1<br />
H max<br />
[m]
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft<br />
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Bäume aus MSD BAW (1998)<br />
Nr. Name<br />
botan. Name GeK<br />
(B)<br />
11.4 - Übersichtstabelle zu Gehölzen<br />
γ 10<br />
ρ 10<br />
ES 10 ε 10<br />
σBiegung 11<br />
σDruck 11<br />
τScher 11 Höhe/Breite 1<br />
Höhe 2<br />
Breite 2<br />
horiz. 4<br />
vert. 4<br />
[g/cm³] [g/cm³] [kN/cm²] [%] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [-] [m] [m] [m] [m]<br />
1 Alle Hybridpappeln z. B. Populus Robusta Laubbaum - - 605 0,33 11,0 22,0 4,5 - 30÷35 15 - - - - - -<br />
2 19 Bergahorn Acer pseudoplatanus Laubbaum 0,84 0,63<br />
850 0,29 23,0 33,0 9,5 40/15 30 15 breitrund,regelmäßig H*,E* 10 1,0÷1,4 3 Herz-Senkerwurzel, starke Hauptseitenwurzeln und dünne Senkerwurzeln 16<br />
Wurzelsysteme 3<br />
Kronenform<br />
2 (A)<br />
Standort 1<br />
3 19 Bergulme Ulmus glabra Laubbaum 1,00<br />
4 19 Esche Fraxinus excelsior Laubbaum 0,88<br />
5 Eßkastanie (Edelkastanie) Castanea sativa Laubbaum - 0,63<br />
6 Fichte Picea abies Nadelbaum 0,60<br />
7 Flatterulme Ulmus laevis Laubbaum 1,00<br />
8 Graupappel Populus canescens Laubbaum 0,95<br />
9 Kiefer (Waldkiefer) Pinus silvestris Nadelbaum 0,84<br />
10 Lärche Larix decidua Nadelbaum - 0,59<br />
11 Robinie Robinia pseudoacacia Laubbaum 0,95<br />
12 Schwarzpappel Populus nigra Laubbaum 0,95<br />
13 Silberpappel Populus alba Laubbaum 0,95<br />
14 19 Silberweide Salix alba Laubbaum - 0,35<br />
15 Sommerlinde Tilia platyphylos Laubbaum 0,84<br />
16 19 Stieleiche Quercus robur Laubbaum 1,00<br />
17 Traubeneiche Quercus petraea Laubbaum 1,00<br />
18 Weißtanne Abies alba Nadelbaum 0,55<br />
19 Zitterpappel (Aspe, Espe) Populus tremula Laubbaum 0,95<br />
0,68<br />
0,69<br />
0,47<br />
570<br />
625<br />
600<br />
900<br />
0,35<br />
0,42<br />
0,42<br />
0,23<br />
- - - 35/20 30 20 breit,rundlich,hoch angesetzt S*,E* 12 ÷ 15 0,5 ÷ 1,6 Pfahlwurzel, Pfahl-Herzewurzelsystem 16<br />
- - - 40/15 30 15 breit,unregelmäßig,offen H*,S*,E* 5 ÷ 14 0,8 ÷ 1,5 Senkerwurzel, Pahl-Tiefwurzler 10 , auch Herzwurzler 1 , hohe Reichweite 16<br />
- - - - 30 99 - weit, ausladende Krone 99 - - - Tiefwurzler 99<br />
8,0 19,0 2,5 - 50 15 - gleichmäßig spitz, kegelförmig 15 - 4 ÷ 8 13<br />
- - - - - - 30/20 30 20 kugelig,unregelmäßig,locker H*,E* 19 14<br />
- - - 11,0 22,0 4,5 30/10 35 15 - kegelförmig-rundlich,breit W*,H* 17<br />
0,52<br />
0,77<br />
0,45<br />
580<br />
535<br />
705<br />
720<br />
(Nr. 12) 730<br />
0,53<br />
0,69<br />
775<br />
800<br />
690<br />
0,29<br />
0,32<br />
0,28<br />
0,28<br />
0,22<br />
0,21<br />
0,25<br />
0,41<br />
8,0 27,0 4,0 - 40 15 - Im Flachland: abgerundet, grobastig, unregelmäßig 15 - 1÷19 13<br />
< 0,5 3<br />
Flachwurzel 10<br />
1,0÷1,6 3 Pfahlwurzel, Tiefwurzler 1<br />
9 ÷ 30 14 2 Herzwurzel<br />
> 1,5 3 Herz-Pfahlwurzel 10 , Tiefwurzler 15<br />
11,0 30,0 4,0 - 50 15 - anfangs schmal kegelförmig, dann breit abgeflachtem 15 - - 0,5÷1,6 3 Herzwurzel, Tiefwurzler 15<br />
20,0 44,0 8,5 - 25 4<br />
9 4<br />
lockere, abgerundete Krone 15 - 3÷10,5 14 1,5 ÷ 2 Senkerwurzel, Herzwurzel 10 , intensive Wurzelbildung 15<br />
11,0 22,0 4,5 30/10 35 20 hoch,kegelförmig W* 9 ÷ 30 14 2 Flachwurzler 7<br />
11,0 22,0 4,5 30/15 30 20 breit ausladend H* 9 ÷ 30 14 2 Flachwurzler 8 , hohe Vertikalausdehnung 16<br />
9,0 16,0 4,0 30/15 15÷30 5 20 dicht verzweigt W*,S* 11÷ 18 14 0,5 ÷ 2,5 Herzwurzel, oberflächennah intensiv wurzelnd 16<br />
- - - 35/20 40 15 20 kegelförmig, dicht, geschlossen E* 11 14<br />
27,0 28,0 9,0 40/20 30 20 kegelförmig,breit,locker H*,S*,E* 2÷17 13<br />
- - - 27,0 28,0 9,0 (Nr. 16) 40 4<br />
0,45<br />
950<br />
0,16<br />
10 4<br />
breite Krone, geschlossen, regelmäßig 15 - 2÷17 13<br />
flach 1 Herzwurzel 7 , Herzwurzel 99<br />
1,0÷1,6 3 Pfahlwurzel, ab 30 bis 50 Jahre Herzwurzelsystem 1<br />
1,0÷1,6 3 Pfahlwurzel, ab 30 bis 50 Jahre Tiefwurzler 15<br />
11,0 26,0 4,0 40/10 50 15 - anfangs spitz kegelförmig, später säulig nut abgeflachtem Wipfel 15 - - 1,0÷1,6 3 Pfahlwurzel, Tiefwurzler 15<br />
- - - 11,0 22,0 4,5 30/15 35 15 kegelförmig,breit,locker S* 9 ÷ 30 14<br />
0,9÷1,5 3 Senkerwurzel, Tiefwurzler 1<br />
20 Alle Strauchweidenarten (Bsp.) Salix incana / Salix elaeganos Strauch - - - - 9,0 16,0 4,0 - 5÷12 5 - - - - - Intensivwurzel 7<br />
21 19 Bruchweide (Knackweide) Salix fragilis Laubbaum - - - - 9,0 16,0 4,0 15/10 8÷20 8 10 dicht,geschlossen,schief! W*,S* 11÷ 18 14 0,5 ÷ 2,9 Herzwurzel, Flachwurzler 1<br />
22 19 Eberesche (Vogelbeere) [Nord. Eberesche] Sorbus aucuparia [intermedia] Laubbaum - - - - - - - 15/6 15 8 rund,unregelmäßig,offen S* 9,5 14<br />
flach 13 Senkerwurzel, Tiefwurzler 1<br />
23 Elsbeerbaum Sorbus torminalis Laubbaum - - - - - - - - 22 15 - eiförmige Krone 15 - - - Tiefwurzler 15<br />
24 19 Feldahorn Acer campestre Laubbaum - - 600<br />
25 19 Feldulme Ulmus minor / carpinifolia Laubbaum 1,00<br />
26 19 Grauerle (Weißerle) Alnus incana Laubbaum - 0,55<br />
27 19 Hainbuche Carpinus betulus Laubbaum 0,95<br />
28 19 Holzbirne Pirus communis Laubbaum - - 580<br />
0,43<br />
23,0 33,0 9,5 10/6 10 8 kugelig,rund H*,E* 12 14 - Flach-Intensivwurzel 7 , geringe Stärke von Wurzelsträngen 16<br />
- - - - - - 30/15 20 15 schmal,hoch angesetzt H*,S* 19 14 - Tief- / Flachwurzel 8<br />
0,83<br />
800<br />
880<br />
0,25<br />
0,18<br />
0,29<br />
- - - 15/8 15 8 breit,rundlich,locker W*,E* 10 1,5 Herzwurzel, Flachwurzel 17<br />
- - - 20/10 20 15 kegel,breit,unregelmäßig H*,E* max.17 14<br />
0,8÷1,2 3 Herzwurzel, intensiv 17<br />
- - - - 20 15 - sperrig, verzweigter Baum 15 - 8 14 - Pfahl-Tiefwurzler 10<br />
29 Loorbeerweide Salix pentandra Laubbaum - - - - 9,0 16,0 4,0 15/7 10 6 - locker W* 6 - - Herz- bis Falchwurzel 99<br />
30 Mehlbeere Sorbus aria Laubbaum 1,00<br />
- 600<br />
0,27<br />
- - - - 15 15 - eiförmig bis kugelige Krone 15 - 9,5 14 - Flachwurzler 10 , Tiefwurzler 15<br />
31 Moorbirke Betula pubescens Laubbaum 0,80 0,65<br />
705 0,31 14,0 27,0 6,5 - 10 6 - ovale Krone mit spitz abstehenden Ästen 15<br />
W* 6 - - Flachwurzel 15<br />
32 19 Reifweide Salix daphnoides Laubbaum - - - - 9,0 16,0 4,0 10/6 5÷12 5 - locker - - - Herz- bis Falchwurzel 99<br />
33 Roßkastanie Aesculus hippocastanum Laubbaum 0,80 - 525 0,27 - - - - 20 6 - breitkronig 17<br />
H* 6<br />
15 14 - Herzwurlzel, Flachwurzler 10<br />
34 Rotbuche Fagus silvatica Laubbaum 1,00 0,72<br />
850 0,26 26,0 36,0 9,5 - 15 6 - auslandende Krone im freien Gelände H* 6<br />
0,6÷5,7 13 0,6÷1,6 3 Herzwurzel, Intensivwurzler mit teilweise tellerförmigen Ausprägung 16<br />
35 Roter Holunder (Traubenholunder) Sambucus racemosa Laubbaum - - - - - - - 4/3 10 15 - breitkronig 15 - - - Verzweigtes Wurzelsystem 1 , Flachwurzler 15<br />
36 Rotweide (Weißweide) Salix rubens Laubbaum 9,0 16,0 4,0 30/10 25 15 länglich,locker W* - - mittl. Wurzelsyst. 7<br />
37 Sandbirke Betula pendula Laubbaum 0,80<br />
38 Schwarzerle Alnus glutinosa Laubbaum - 0,55<br />
0,65<br />
705<br />
800<br />
0,31<br />
0,25<br />
14,0 27,0 6,5 - 20 4<br />
6 4<br />
ovale Krone mit spitzwinklig ansteigenden Ästen 15 - 8,5 ÷ 9 0,5 ÷ 0,9 Herzwurzel, Tiefwurzler 15 , Herz-Senker-Wurzelsystem 16<br />
- - - 25/8 25 10 breitrund,locker H*,S*,W* 17 - 1,5÷1,8 3 Herzwurzel, Tiefwurzler 1 , keine Hauptseiten- und wenige Starkwurzeln 16<br />
39 Speierling Sobus domestica Laubbaum - - - - - - - - 20 15 - oval bis rundliche Krone 15 - - - Tiefwurzler 15<br />
40 19 Spitzahorn Acer platanoides Laubbaum - - - - 23,0 33,0 9,5 30/10 25 15 rund,regelmäßig,dicht H*,E* 10 1,0÷1,4 3<br />
flache Herzwurzel 17<br />
41 Stechpalme Ilex aquifolium Laubbaum 0,94 - - - - - - - 10 15 - kegelförmig 15 - - - -<br />
42 19 Traubenkirsche Prunus padus Laubbaum - - - - - - - 17/8 10 10 säulen-,kegelförmig H*,S*,E* 7,5 14 - Flachwurzler 15 , Intensivwurzler 16<br />
43 Vogelkirsche Prunus avium Laubbaum - - - - - - - 25/10 20 15 kugelig,locker,hochgesetzt H*,S*,E 7,5 14 - Intensivwurzel 7 , Flachwurzler 15 , Wurzelteller 16<br />
44 Wildbirne Pirus pyraster Laubbaum - - 580<br />
0,29<br />
- - - 10/5 10 5 kegelförmig,breit ausladend H* 8 14 - mittl. Wurzelsyst. 7 , Tiefwurzler 15<br />
45 Winterlinde Tilia cordata Laubbaum 0,84 - 830 0,24 12,0 26,0 - 30/20 25 25 unregelmäßig,dicht verzweigt H*,E* 11 14<br />
0,7÷1,4 13 Herzwurzel, Intensivwurzler 16<br />
46 19 Grauweide (Aschweide) Salix cinerea Strauch - - - - 9,0 16,0 4,0 5/6 5 6 kugeliger,dichter Strauch S*, W* 17 - - Herzwurzel, stark verzweigt 1<br />
47 Grünerle Alnus viridis Strauch - 0,55<br />
Gefahrenklasse 4 Gefahrenklasse 3 Gefahrenklasse 2 Gefahrenklasse 1<br />
Gehölzart<br />
Mechanische Holzdaten<br />
800<br />
0,25<br />
- - - 3/3 3 15 - 8 99 - mehrstämmig - - - Flachwurzler 8<br />
48 19 Hasel ( 19 bezieht sich auf die Haselnuss) Corylus avellana Strauch - - - - - - - 6/4 8 6 hoher,breiter Strauch H*,S*,E*,W* 17 - - Herzwurzel, stocknah tiefgehend 16<br />
49 19 Holzapfel (Apfelbaum, Wildapfel) Malus sylvestris Laubbaum - - - - - - - 8/6 8 6 dicht,stark beastet H* 4 ÷ 8 1 ÷ 1,5 Herzwurzel, flach wurzelnd 15<br />
50 19 Hundsrose Rosa canina Strauch - - - - - - - 4/3 5 99 - breit,aufrecht - - - Tiefwuzel 8<br />
51 Korbweide Salix viminalis Strauch - - - - 9,0 16,0 4,0 8/4 3÷8 5 4 schmal W* - - Flachwurzel 7<br />
52 Kornelkirsche Cornus mas Strauch - - - - - - - - 8 15 - rundkronig 15 - - - Flachwurzel 99<br />
53 19 Kreuzdorn Rhamnus cathartica Strauch - - - - - - - - 8 15 - rundkronig 15 - - - Herzwurzel 10<br />
54 19 Mandelweide Salix triandra Strauch - - - - 9,0 16,0 4,0 4-7/3-5 2÷7 5<br />
5 7 breit ausladend,mehrstämmig W* 17 - flach 1 Herzwurzel, flach ausgebreitet 1<br />
55 19 Purpurweide Salix purpurea Strauch - - - - 9,0 16,0 4,0 5/3 2÷6 5 - dickbuschig W* - - Flachwurzel 7 , Herzwurzel 17 , ohne Staunässe tiefenstrebend 16<br />
56 19 Rainweide (Liguster) Ligustrum vulgare Strauch - - - - - - - 5/3 5 3 breit,buschig,dichter Strauch H* - - Intensivwurzel 7 , oberflächennah 1<br />
57 19 Roter Hartriegel Cornus sanguinea Strauch - - - - - - - 6/4 6 4 hoher Strauch H*,E*, W* 17 - - Flachwurzel 1 , Herzwuzler 10<br />
58 Schwarzer Holunder Sambucus nigra Strauch - - - - - - - 7/5 7 5 breit ausladend,dicht H*,S* - - Flachwurzel 7<br />
59 19 Spindelstrauch (Pfaffenhütchen) Euonymus europaeus Strauch - - - - - - - 7/3 7 3 breit aufrecht, dicht H*,S*,E*,W* 17 - - flache Wurzel 7 , Intensivwurzler mit vielen Feinwurzeln 16<br />
60 Weichselkirsche (Sauerkirsche) Prunus mahaleb Strauch - - - - - - - - 6 99 - kurzstämmig und rundkronig 15 - 7,5 14 - Flachwurzler 15<br />
61 19 Weissdorn (eingriffelig) Crataegus monogyna Strauch 1,00 - - - - - - 7/4,5 7 5 formlos,locker H*,E*,W* 17<br />
8,7 14<br />
tief 1<br />
Intensivwurzel 7 , Tiefe weitverzweigte Wurzeln 16<br />
62 19 Weissdorn (zweigriffelig) Crataegus oxyacantha Strauch 1,00 - - - - - - 8/5 8 5 formlos,locker H*,S*,E* 8,7 14<br />
tief 1<br />
Intensivwurzel 7 , Tiefe weitverzweigte Wurzeln 99<br />
63 Wolliger Schneeball Viburnum lantana Strauch - - - - - - - - 5 99 - reich verzweigter Strauch 99<br />
H* 17 - - -<br />
64 Alle Wildrosenarten - Strauch - - - - - - - - 3 99 - buschig, strauchig 99 - - - -<br />
65 Berberitze Berberis vulgaris Strauch - - - - - - - - 2,5 99 - buschig, strauchig 99 - - - -<br />
66 Besenginster Cytisus scoparius Strauch - - - - - - - - 2 99 - buschig, besenartig 99 - - - -<br />
67 19 Brombeere Rubus fructicosus Strauch - - - - - - - - 2 99 - strauchartig 99 - - - -<br />
68 19 Faulbaum Rhamnus frangula Strauch - - - - - - - 5/3 4 6 - breit,locker H*,S* - - Herzwurzel 10 , Flachwurzel 16<br />
69 Felsenbirne Amelanchier ovalis Strauch - - - - - - - - 3 99 - strauchartig 99 - - - -<br />
70 19 Heckenkirsche Lonicera xylosteum Strauch - - - - - - - 4/3 2 6 - buschig,verzweigt H*,E* - - Flachwurzel 7 ,Herzwurzel 10<br />
Baumdaten<br />
71 Himbeere Rubus idaeus Strauch - - - - - - - - 2 99 - strauchartig 99 - - - -<br />
72 19 Kratzbeere Rubus caesius Strauch - - - - - - - - 3 6 - strauchartig 99<br />
H* 17 - - -<br />
73 Kriechweide Salix repens Strauch - - - - 9,0 16,0 4,0 - 1 99 - strauchartig 99 - - - -<br />
74 19 Ohrweide (Öhrchenweide) Salix aurita Strauch - - - - 9,0 16,0 4,0 3/3 2 99 - breit,verzweigt - - - Flachwurzel 1<br />
75 19 Schlehdorn (Schlehe) Prunus spinosa Strauch - - - - - - - 6/4 3 99 - dicht,mehrstämmig - 7,5 14 - Flachwurzel 16<br />
76 19 Schwarzweide Salix nigricans Strauch - - - - 9,0 16,0 4,0 5/4 3÷4 5 - strauchartig 99 W*,S* - - -<br />
77 19 Wasser-Schneeball (Gemeiner Schwneeball) Viburnum opulus Strauch - - - - - - - 4/3 4 99 - dicht,ausladend H*,E* - - Flach-Intensivwurzel 7<br />
Wurzeldaten
Literaturstellen<br />
weniger empfindlich 14<br />
unempfindlich 99 (Nr. 12) besonders schnellwüchsig 99 1 aus LfU BW (1994)<br />
empfindlich, benötigt Wasserschwankungen 1<br />
unempfindlich 14 nährstoff-/basenreiche, tiefgründige Böden Stockausschlag, schnellwüchsig 6 , bodenfestigend 8 2 aus DVWK 244 (1997)<br />
mäßig empfindlich 14<br />
Adentivwurzelbildung 9 lockere, feuchte, nährstoff-,basenreiche, humose Stein-/Lehmböden Stockausschlag 2 3 aus Köstler et al. (1968)<br />
weniger empfindlich 1 , mäßig empfindlich 14<br />
Adentivwurzelbildung 9 nährstoffreiche, sickerfrische Böden Stockausschlag 2 4 aus LfW BY (1990)<br />
empfindlich 99 - nährstoffarme Böden mit guter Durchlüftung 99<br />
anspruchsvoll und schattenliebend mit Stockausschlag 99 5 aus Hiller (1985a+b)<br />
sehr empfindlich 9<br />
empfindlich 14<br />
frische bis feuchte, lockere Lehmböden 15<br />
Halbschattenbaumart 15 6 aus Tobias (2003)<br />
unempfindlich 1<br />
Adentivwurzelbildung 9 , empfindlich 14 sommerwarme Lehm-/Sandböden Stockausschlag 7<br />
aus Patt (1998)<br />
weniger empfindlich 15<br />
unempfindlich 99<br />
Flussniederungen, standorttolerant 15<br />
Stockausschlag 8 , verursacht starke Schäden 14 , schlank- und schnellwüchsig 17 8 aus DIN 19657 (1973)<br />
sehr empfindlich 9<br />
unempfindlich 18<br />
tiefgründige Lehm-/Steinböden, nährstoff- und basenarme Sande, Moor- oder Rohböden 15<br />
Wurzelbrut, Stockausschlag 2 , verursacht starke Schäden 14 9 aus Sinn (2004)<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 9 - geringe Nährstoffansprüche, gedeiht auf Urgestein und Kalkböden 15<br />
Lichtbaumart 15 10 aus Wessolly und Erb (1998)<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 14 - nährstoffreiche Lehmböden sowie trockene, arme Sandböden 15 , lockere Böden 99<br />
verursacht starke Schäden 14 , Wurzelbrut, Lichtbaumart, schnellwüchsig und bodenfestigend 15 11 aus Mattheck (2002)<br />
weniger empfindlich 9<br />
unempfindlich 99 feuchte, nährstoff- und basenreiche Sand-/Lehmböden Stockausschlag 8 , verursacht starke Schäden 14 12 aus Bruder (1998)<br />
weniger empfindlich 9<br />
unempfindlich 14 offene, lockere, sandige Böden (feuchtefrische Standorte) Stockausschlag 8 , verursacht starke Schäden 14 13 aus Polomski und Kuhn (1998)<br />
unempfindlich 9<br />
unempfindlich 14 wechselfeuchte, kalk- und nährstoffreiche Aueböden; tonige Böden Stockausschlag, verursacht starke Schäden 14 14 aus Balder (1998)<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 14 - frische, basen- und nährstoffreiche Böden - 15<br />
aus Aas und Riedmiller (1987)<br />
unempfindlich 6 , empfindich gegenüber GW-Senkung 16 , weniger empfindlich 14<br />
empfindlich 14 frische-grundfeuchte, nährstoffarme/-reiche Böden Stockausschlag,geringe Wasseransprüche, verursacht Schäden 14 16 aus Winski (2004)<br />
sehr empfindlich 9 - frische, lockere, lehmige Böden 15<br />
Halblichtbaumart 15 17 aus Lange und Lecher (1986)<br />
weniger empfindlich gegenüber Staunässe 99 - auf allen Gesteinen 15<br />
Schattenbaumart 15 18 aus Begemann und Schiechtl (1986)<br />
weniger empfindlich 9<br />
unempfindlich 99 lockere, lichte und nährstoffreiche Standorte Wurzelbrut, Stockausschlag 8 , bodenfestigend 8 19<br />
infrage kommend nach LfW BY (1984)<br />
- unempfindlich 5 - Stockausschlag<br />
weniger empfindlich 1 , unempfindlich 14<br />
unempfindlich 99 sickernasse und feuchte Schwemmböden und basenarme Roh-Aueböden Sturmempfindlich, brüchiges Holz 5 , mehrstämmig 1 , Stockausschlag 2 , bodenfestigend 5 99 Internet<br />
empfindlich 1<br />
empfindlich 14 auf nährstoffärmeren Lehm-/Sand-/Steinböden mehrstämmig 1 , Stockausschlag 2<br />
empfindlich bei Staunässe 99<br />
empfindlich 14<br />
trockene, basenreiche bis schwach saute Böden und Kalk 15<br />
wärmeliebende Halbschattenart 15<br />
empfindlich bei Staunässe 6 - trocken bis frische, nährstoff-/basenreiche Böden Stockausschlag 2 , bodenfestigend 7 , halbschattenveträglich 17 A Standort<br />
unempfindlich 9 - sickerfeuchte, zum Teil überflutete, nährstoff-/basenreiche Lehm-/Tonböden, Aueböden 17<br />
Wurzelbrut, Stockausschlag 2 , verursacht Schäden 14 , halbschattenverträglich 17<br />
weniger empfindlich 1<br />
unempfindlich 18<br />
kiesig-sandige Lockerböden, Kalkschotter 17<br />
Stockausschlag 6 ,Wurzelbrut!, bodenfestigend 8 W*= Weichholzaue [Überflutung an 30-150 Tagen im Jahr]<br />
unempfindlich gegenüber Staunässe 6 - nährstoffarme Böden 17<br />
Stockausschlag 2 , schnittverträglich 2 , halbschattenverträglich 17 H*= Hartholzaue [Überflutung an bis zu 30 Tagen im Jahr]<br />
empfindlich bei Staunässe 99 - nährstoff-, basenreiche, meist kalkhaltige Böden 15<br />
Licht- bis Halbschattenbaumart 15 S*= Wälder in Auen (regelmäßige, kurze Überschwemmungen)<br />
verträgt Staunässe 1<br />
unempfindlich 99<br />
sandig-kiesige, dauernd durchfeuchtete Anschwemmungen des Gewässers, Flachmoore 17<br />
versagt nicht auf stark vernässten Böden 5 E*= Wälder an Fliessgewässern (ohne bzw. sehr kurze Überschwemmungen)<br />
wenig empfindlich 99<br />
empfindlich 14<br />
trockene, kalkreiche bis mäßig saure Lehm- und Steinböden 15 -<br />
unempfindlich gegenüber Staunässe 6 - Saure Sand- und Torfböden 17 , feuchte, staunasse, basen- und nährstoffarme, sauer humose Moorböden 15<br />
Lichbaumart 15 B Baumauswahl<br />
empfindlich bei Staunässe 5 , benötigt Wasserschwankungen 1<br />
unempfindlich 99<br />
feucht-nasse, sandig-tonige und kiesige Anschwemmungen, anspruchslos 99<br />
Stockausschlag 2 , bodenfestigend 1<br />
- empfindlich 14 hohe Bödenansprüche Bruchgefahr der Äste 6 , schnellwüchsig 17<br />
empfindlich 6<br />
unverträglich 14<br />
lockere nährstoff- und kalkhaltige sowie kalkarme, saure Böden 15 , auch auf felsigem Untergrund 16<br />
sturmgefährdet (kleine Wurzel) 13 , verursacht Schäden 14 , Schattenbaumart 15 , Stockausschlag 16<br />
unempfindlich gegenüber Staunässe 99 - humose, nährstoffreiche Böden 15<br />
Halbschattenbaumart 15<br />
unempfindlich 1<br />
unempfindlich 99 basenarme Böden -<br />
unempfindlich 9<br />
unverträglich 14<br />
feuchte oder trockene, nährstoffarme, saure Böden, häufig Sand 15<br />
verursacht starke Schäden 14 , bodenfestigend 8 , anpassungsfähig 16<br />
unempfindlich gegenüber Staunässe, empfindlich gegenüber Überflutungen 1 - sickerfeuchte, nasse und schwachsaure Böden Stockausschlag 2 , schlankwüchsig 6 , bodenfestigend 8<br />
Alle Bäume aus BAW MSD (1998) <strong>Anhang</strong> 5 außer<br />
Waldgeißblatt und Hauspflaume wurden berücksichtigt.<br />
Die Nordische Eberesche wurde zur herkömmlichen<br />
Eberesche gezählt.<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99 - kalkhaltige, nährstoffreiche Böden 15<br />
Halbschattenbaumart 15<br />
empfindlich 1<br />
Adentivwurzelbildung 9<br />
frisch-feuchte, nährstoff-/basenreiche Böden, alle Böden 17<br />
geringe Feuchtigkeitsanprüche, schnellwüchsig 6<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99 - mäßig nährstoff- und basenreichen, kalkarmen Böden 15<br />
Schattenbaumart 15<br />
weniger empfindlich 1 , empfindlich 14<br />
empfindlich 14 tiefgründige, nährstoffreiche, feucht-nasse Böden mehrstämmig 1 , Halbschattenbaumart, Sprossenbildung 15<br />
empfindlich 1<br />
empfindlich 14 nährstoffreiche, tiefgründige, kalkreiche, frische Böden Licht- bis Halbschattenbaumart 15<br />
unempfindlich 1 - nährstoff-, basenreiche, meist kalkhaltige Böden 15<br />
Licht- bis Halbschattenbaumart 15<br />
weniger empfindlich 1 - frische bis mäßig trockene, tiefgründige Böden bodenfestigend 8<br />
weniger empfindlich, verträgt Staunässe 1<br />
empfindlich 1<br />
empfindlich 1<br />
unempfindlich 99 feucht-nasse, kalkfreie Böden (v.a. Quellsümpfe und Moore) sehr schnellwüchsig 6 , Stockausschlag 2<br />
unempfindlich 18 saure, feuchte Böden schattenverträglich 2 , Wurzelbrut, Stockausschlag 8<br />
unempfindlich 18 , Adentivwurzelbildung 99 nährstoff-,kalkhaltige aber auch neutrale Böden Stockausschlag 2 , geringe Wasseransprüche 6 , bodenfestigend 8<br />
weniger empfindlich 1<br />
empfindlich 14<br />
nährstoff- und basenreiche Böden 15 Wurzelbrut, Stockausschlag<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99 - tiefgründige, kalkhaltige, nährstoffreiche, trockene bis feuchte Böden Stockausschlag 8 , bodenfestigend 8 , schattenverträglich 99<br />
weniger empfindlich 1<br />
unempfindlich 99<br />
wechselfeuchte bis nasse, nährstoff-/basenreiche Lehm-/Sandböden (Rohböden); nicht auf sauren Böden 99<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99 - mäßig trockene, meist kalkreiche Lehmböden 15<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99 - feuchte bis sumpfige saure Böden 15 , trockene Sande 99<br />
unempfindlich 1<br />
unempfindlich 18<br />
kalk-,nährstoff- und schlickreiche Aueböden, Iesbänge und Kiesgruben 17<br />
sehr anspruchsvoll, wildverbissgefährdet 5 , Stockausschlag 2<br />
anspruchslos, langsamwüchsig 99<br />
schattenverträglich 99<br />
Stockausschlag, bodenfestigend 8<br />
unempfindlich 1<br />
unempfindlich, Adentivwurzelbildung 99<br />
feucht-nasse Schwemmböden, Sand- und Kiesböden, Kalkböden 17<br />
trockenresistent, größte ökologische Amplitude, anpassungsfähig 5 , Stockausschlag, bodenfestigend 8<br />
empfindlich 1 - mäßig trockene, nahrhafte und kalkhaltige Böden schnittverträglich 6 , Stockausschlag, Wurzelausläufer 16<br />
(un)empfindlich 1 - lockere, mäßig trockene und kalkhaltige Böden Stockausschlag, schnellwüchsig 6 , Wurzelbrut 8 , bodenfestigend 8<br />
unempfindlich gegenüber Staunässe 6 , empfindlich gegenüber Überflutungen 1 - stickstoffreiche Böden Stockausschlag 2 , schnellwüchsig 17<br />
unempfindlich 1 - frisch-feuchte, nährstoff- und kalkhaltige Böden Stockausschlag 6<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99<br />
weniger empfindlich 1<br />
empfindlich 14<br />
nährstoffreiche, kalkhaltige Lehmböden 15<br />
Licht- bis Halbschattenbaumart 15<br />
empfindlich 14 lehmige, kalkhaltige Böden sehr anpassungsfähig, anspruchslos 1 , Stockausschlag 8<br />
empfindlich 1 - lehmige, kalkhaltige Böden sehr anpassungsfähig,anspruchslos 1 , schnittverträglich 2<br />
weniger empfindlich 8 - kalkhaltige, trockene Böden 99<br />
Stockausschlag 17 , schnitt- und schattenverträglich 99<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99 - Kalkmulden der Mittelgebirge, gut belüfteter, lockerer Boden 99 -<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99 - fast alle Böden 99 -<br />
- - stickstoffarme, kalkarme, saure Böden 99<br />
schnittempfindlich 99<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99 - lockerer, humoser, feuchter, sandiger Boden 99<br />
Stockausschlag 8<br />
unempfindlich gegenüber Staunässe 8 - frisch bis feuchte, nährstoffarme, kalkfreie Böden Wurzelbrut 2 , Stockausschlag 6 , schattenverträglich 17<br />
unempfindlich gegenüber Staunässe 8 - keine schwere, aber lockere Böden 99<br />
Lichtstrauchart 99<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99 - kalkhaltige Böden, humose, trockene Böden 99<br />
schnellwüchsig 6 , Halbschatten- bis Schattenbaumart 99<br />
empfindlich gegenüber Staunässe 99<br />
unempfindlich 18 , Adentivwurzelbildung 99<br />
humoser, gut durchlässiger Lehmboden 99 -<br />
unempfindlich 99 - nährstoffreiche Böden 99<br />
ausläuferbildend 6<br />
unempfindlich 99<br />
unempfindlich 8<br />
empfindlich 1<br />
Reaktion bei Überflutung und Staunässe 7<br />
Eigenschaften<br />
Reaktion bei Überschüttung Bevorzugte Böden 7<br />
unempfindlich 99<br />
kalkarme Küstenböden 99 -<br />
unempfindlich 99 naß-feuchte, saure Torf-/Lehmböden; kalkfreie Böden mit wenig Grundwasserbewegung Stockausschlag 2<br />
unempfindlich 18 , empfindlich 14 mäßige trockene bis frische nährstoff- und basenreiche Böden Wurzelbrut, Stockausschlag 8 , bodenfestigend 8<br />
weniger empfindlich, benötigt Wasserschwankungen 1<br />
unempfindlich, Adentivwurzelbildung 99<br />
frische, staunasse, nährstoff- und kalkreiche Sand-, Lehm- und Tonböden, Kiesböden 17<br />
schattenverträglich 1 , Stockausschlag 2<br />
weniger empfindlich 1 - feucht-frische, humus- und kalkahltige Böden Stockausschlag 2 , hohe Wasseransprüche 6<br />
Sonstige Eigenschaften<br />
<strong>Anhang</strong> 165
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 166<br />
11.5 – Hinweise zu Gehölzen auf Deichen<br />
Gehölz 1)<br />
(Pappeln > 30 m)<br />
Gehölze im Vorland dürfen nicht zu einer<br />
unzulässigen Beeinflussung des<br />
Hochwasserabflusses führen.<br />
Wasserstand<br />
(bei Hochwasser)<br />
10 m<br />
5 m<br />
Wasserseitige Böschung<br />
(Rasen)<br />
1<br />
3<br />
Krone<br />
(befahrbar)<br />
3 m<br />
1<br />
3<br />
Landseitige Böschung<br />
(Magerrasen)<br />
Sträucher1) Gehölz1) Sträucher<br />
(Pappeln > 30 m)<br />
1)<br />
Deichschutzstreifen Rasen auf 10 – 25 cm<br />
Deichschutzstreifen Sträucher<br />
(Nutzungs-<br />
Oberboden<br />
(Wurzeln dürfen nicht<br />
(Nutzungseinschränkung)<br />
(intensive Pflege)<br />
in dem erdstatischen<br />
einschränkung)<br />
Querschnitt eindringen.)<br />
1)<br />
Fahrbahn-<br />
Fahrbahn- Kein<br />
aufbau<br />
Aufbau / Gehölz<br />
Kein<br />
Gehölz<br />
Kein<br />
Gehölz<br />
Kein<br />
Gehölz<br />
Kein<br />
Gehölz<br />
Überdimensionierter<br />
Bereich<br />
Berme<br />
(befahrbar)<br />
3 m<br />
Magerrasen<br />
(extensive Pflege)<br />
1) Bepflanzungen sollten nur in Gruppen vorgenommen werden.<br />
Beispiel zur Bewuchsregelung auf einem Deich nach DIN 19712 (1997) (aus <strong>Haselsteiner</strong> und Strobl (2004))<br />
Vorland<br />
Oberer<br />
Betriebswasserstand<br />
Keine Regelung für Gehölz im Vorland 2)<br />
Wasserseitige Böschung<br />
1<br />
3<br />
Keine Regelung 2)<br />
5 m<br />
Zone 1<br />
Röhricht und<br />
Sträucher )<br />
Krone<br />
3 m<br />
< H/3<br />
Landseitige Böschung<br />
β =<br />
1 m<br />
Zone 2 Zone 3<br />
Bäume 2. / 3. Ordnung und<br />
Sträucher<br />
1) Zone<br />
4<br />
< H/3<br />
5 m<br />
Kein<br />
Gehölz<br />
1) Bepflanzungen sollte einzeln oder in Gruppen vorgenommen werden.<br />
2) Bei Dauerstau im Allgemeinen kein Gehölzbewuchs.<br />
3) Auf Dämmen mit Innendichtung oder ohne Dichtung sind Röhricht und einzelne Strauchgruppen zulässig. Bei Oberflächendichtungen ist kein Gehölz<br />
zulässig.<br />
ϕ<br />
2<br />
Gehölz<br />
H < 25 m<br />
Beispiel zur Bewuchsregelung auf einem Damm an einer Bundeswasserstraße nach BAW MSD (2005)<br />
Kein<br />
Gehölz<br />
Hinterland<br />
10 m<br />
10 m<br />
Zone 5 Zone 6<br />
Bäume 2. / 3. Ordnung und<br />
Sträucher<br />
Gehölz<br />
H < 25 m<br />
Gehölz<br />
H > 25 m
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 167<br />
Zulässigkeit von Gehölzen auf<br />
Deichen nach GeK<br />
GeK: GefahrenKlassen 7)8)<br />
(Einteilung von Bäumen und Sträuchern aus BAW MSD (2005) in<br />
Anbetracht von Größe, Wurzelausbreitung und Wachstumsrate)<br />
Sicherungsmaßnahmen<br />
1)8)10)<br />
Keine<br />
(Nur erdstatisch erforderlicher<br />
Deichquerschnitt)<br />
Landseitiges<br />
Überprofil<br />
Landseitiges und<br />
wasserseitiges<br />
Überprofil<br />
Statisch wirksames<br />
Sicherungselement<br />
Deichquerschnitt<br />
2)3)<br />
Wasserstand<br />
(bei Hochwasser)<br />
Zone 9)<br />
W5<br />
GeK<br />
1<br />
GeK<br />
1<br />
GeK<br />
1<br />
GeK<br />
1<br />
Vorland<br />
Zone 9)<br />
W4<br />
GeK<br />
2<br />
GeK<br />
2<br />
GeK<br />
2<br />
GeK<br />
2<br />
30 m<br />
Zone 9)<br />
W3<br />
GeK<br />
3<br />
GeK<br />
3<br />
GeK<br />
3<br />
GeK<br />
2<br />
10 m<br />
Deichschutzstreifen<br />
10)<br />
5 m<br />
Zone 9)<br />
W2<br />
-<br />
-<br />
GeK 4)<br />
4<br />
GeK<br />
3<br />
Wasserseitige Böschung Krone<br />
Zone 9)10)11)<br />
W1<br />
-<br />
-<br />
GeK 6)11)<br />
4<br />
GeK 6)11)<br />
4<br />
Zone 11)<br />
0<br />
-<br />
-<br />
GeK<br />
4<br />
-<br />
> H/3<br />
Zone 10)11)<br />
L1<br />
Landseitige Böschung<br />
< H/3<br />
Deichschutzstreifen<br />
10)<br />
Berme 5 m<br />
Zone 5)10)11)<br />
L2<br />
1) Ein Eindringen der Wurzeln in den statischen Querschnitt ist zu verhindern, außer wenn andere statische Sicherungselemente die Standsicherheit sicherstellen.<br />
2) Deichwege und Fahrbahnen sind von Gehölz freizuhalten. Die Deichkrone und Deichverteidigungswege müssen für den vorgesehen Verkehr auch ein ausreichendes Lichtraumprofil haben..<br />
3) Beim Vorhandensein einer Oberflächendichtung ist ein Eindringen der Wurzeln die dieselbige auszuschließen.<br />
4) Das Eindringen von Wurzeln in den erdstatisch erforderlichen Querschnitt des Deiches oder in einen landseitigen Drän ist ggf. durch eine Wurzelsperre am Deichfuß zu verhindern.<br />
5) Außer in diesen Bereichen sind auf und am Deich standsichere, u. U. bestehende Einzelgehölze im Einzelfall bis zu GK 3 zulässig, sofern genug Platz für eine standsichere Wurzelausbreitung<br />
vorhanden ist, aber gleichzeitig die Wurzeln keine Beeinflussung der Standsicherheit vermuten lassen.<br />
6) Bei Schardeichen, bei erhöhtem Strömungsangriff und/oder erhöhter Erosionsgefahr durch Wellen ist auf der wasserseitigen Böschung kein Gehölz zulässig.<br />
7) Gehölze mit minderer Gefahrenklasse (z. B. GeK 4) sind im Allgemeinen in Zonen höherer Gefahrenklasse (z. B. GeK 1) zulässig.<br />
8) Sind aufgrund der Randbedingungen oder aufgrund besonderer Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen z. B. geringere Höhen und/oder geringere Wurzelausbreitungen der spezifischer Gehölzarten<br />
sicher abschätzbar und/oder sind aufgrund besonderer Sicherungsmaßnahmen eine Beeinträchtigung der Deichsicherheit auszuschließen, können Gehölze einer höheren Gefahrenklasse auch in die<br />
nächst niedrigere gestuft werden.<br />
9) Gehölze auf der Wasserseite müssen einer regelmäßiger u. U. nicht seltener Überflutung standhalten.<br />
10) Sind Gehölzbestände am Deich vorhanden, insbesondere innerhalb der Deichschutzstreifen, müssen Sicherungsmaßnahmen z. B. der Einbau einer Wurzelsperre getroffen werden. Am Deich sollten i.<br />
d. R. maximal Gehölze der GeK 3 und auf dem Deich der GeK 4 zugelassen werden (Ausnahme siehe unter 11) ).<br />
11) In diesen Bereichen können im Einzelfall maximal Gehölze, die der GeK 3 entsprechen, dann zugelassen werden, wenn es sich um Deiche der Klasse III mit niedrigem Schutzgrad und geringem<br />
Schadenspotential handelt, für die im Hochwasserfall keine Deichverteidigung vorgesehen ist und Gehölze bereits vorhanden oder das Wachsen von Gehölzen keine wesentliche Beeinträchtigung der<br />
Standsicherheit erwarten lassen, und/oder sowohl die Standsicherheit, als auch die Deichüberwachung sowie Deichverteidigung durch bauliche und/oder betriebliche Maßnahmen sichergestellt ist.<br />
-<br />
GeK<br />
4<br />
GeK<br />
4<br />
GeK<br />
4<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Zone<br />
L3<br />
-<br />
-<br />
GeK 4)<br />
4<br />
GeK 4)<br />
4<br />
10 m<br />
30 m<br />
Zone<br />
L4<br />
GeK<br />
3<br />
GeK<br />
3<br />
GeK<br />
3<br />
GeK<br />
3<br />
Hinterland<br />
Zone<br />
L5<br />
GeK<br />
2<br />
GeK<br />
2<br />
GeK<br />
2<br />
GeK<br />
2<br />
Zone<br />
L6<br />
GeK<br />
1<br />
GeK<br />
1<br />
GeK<br />
1<br />
GeK<br />
1
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 168<br />
12.1 – Durchstanzberechnungen an Dichtungen in Deichen nach DIN V EN V 1992 (1997)<br />
1. Resultierende Bemessungskraft 3. Widerstand der Schubspannung<br />
ν = ⋅ β u<br />
ν = τ ⋅ ⋅ ( 1,<br />
2 + 40⋅<br />
ρ ) ⋅ d<br />
Sd<br />
V Sd<br />
2. Umfang des kritischen Schnitts 4. Nachweis (Auslastung)<br />
( 0,<br />
5 ⋅ d + 1,<br />
5 ⋅ d ) ⋅ π<br />
Skizze Diagramm<br />
fS gS sG G gG AU 14 AU 20 AU 23 AU 14 7 AU 20 7 AU 23 7<br />
Dicke der Wurzel A<br />
dWurzel [m] 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040<br />
maximaler Wurzeldruck B pmax [MN/m²] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0<br />
Dicke der Dichtwand C<br />
dDW [m] 0,040 0,080 0,120 0,160 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 0,0100 0,0120 0,0145 0,0050 0,0070 0,0095<br />
Resultierende Bemessungskraft VSd [MN/m²] 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003<br />
Korrekturfaktor (Lastausmitten) β [-] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5<br />
Umfang des kritischen Schnitts u [m] 0,503 0,880 1,257 1,634 2,011 2,482 2,953 3,424 3,896 3,896 4,838 5,781 6,723 7,665 8,608 9,550 0,220 0,239 0,262 0,173 0,192 0,215<br />
Einwirkende Querkraft νSd [MN] 0,008 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,017 0,016 0,015 0,022 0,020 0,018<br />
Widerstand der Schubspannung τRd [MN/m²] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4<br />
0,1 0,1 0,1 0,1 4<br />
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5<br />
77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6<br />
k = 1,6 -d > 1 k [m] 1,560 1,520 1,480 1,440 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,200 1,100 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 1,590 1,588 1,586 1,595 1,593 1,591<br />
Bewehrungsgrad C σ 1 [MN/m²] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Widerstand ν Rd [MN] 0,007 0,015 0,021 0,028 0,034 0,041 0,047 0,053 0,058 0,115 0,132 0,144 0,151 0,154 0,151 0,144 1,480 1,773 2,139 0,742 1,038 1,406<br />
Ausnutzungsgrad η [-] 1,01 0,30 0,14 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01<br />
Dicke der Wurzel<br />
fS gS sG G gG AU 14 AU 20 AU 23 AU 14 AU 20 AU 23<br />
A<br />
maximaler Wurzeldruck<br />
dWurzel [m] 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120<br />
A Dicke der Dichtwand<br />
pmax [MN/m²] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0<br />
B<br />
dDW [m] 0,040 0,080 0,120 0,160 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 0,0100 0,0120 0,0145 0,0050 0,0070 0,0095<br />
Resultierende Bemessungskraft VSd [MN/m²] 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023<br />
Korrekturfaktor (Lastausmitten) β [-] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5<br />
Umfang des kritischen Schnitts u [m] 0,754 1,131 1,508 1,885 2,262 2,733 3,204 3,676 4,147 4,147 5,089 6,032 6,974 7,917 8,859 9,802 0,471 0,490 0,514 0,424 0,443 0,467<br />
Einwirkende Querkraft νSd [MN] 0,046 0,030 0,023 0,018 0,015 0,013 0,011 0,009 0,008 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,004 0,004 0,073 0,070 0,067 0,081 0,078 0,074<br />
Widerstand der Schubspannung τRd [MN/m²] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4<br />
0,1 0,1 0,1 0,1 4<br />
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5<br />
77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6<br />
k = 1,6 -d > 1<br />
Bewehrungsgrad<br />
k [m] 1,560 1,520 1,480 1,440 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,200 1,100 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 1,590 1,588 1,586 1,595 1,593 1,591<br />
D σ1 [MN/m²] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Widerstand νRd [MN] 0,007 0,015 0,021 0,028 0,034 0,041 0,047 0,053 0,058 0,115 0,132 0,144 0,151 0,154 0,151 0,144 1,480 1,773 2,139 0,742 1,038 1,406<br />
Ausnutzungsgrad η [-] 6,09 2,08 1,07 0,66 0,45 0,31 0,23 0,18 0,14 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,04 0,03 0,11 0,07 0,05<br />
A<br />
Wurzeldurchmesser aus Diagramm oben rechts<br />
B<br />
Maximalwert aus Marks und Tschantz (2002)<br />
C Übliche Dicken der einzelnen Dichtungen<br />
D Keine Bewehrung<br />
Rd1<br />
Rd<br />
Schmalwand 1<br />
Schmalwand 1<br />
k 1<br />
u = 2 ⋅ Wurzel<br />
DW<br />
η = ν SD / ν Rd<br />
Bodenvermörtelung 2<br />
Bodenvermörtelung 2<br />
Einphasenschlitzwand 2<br />
Einphasenschlitzwand 2<br />
1<br />
Dicken abhängig von Bodenart<br />
2<br />
Dicken abhängig von Einbaugerät<br />
3<br />
Typ Arbed U-Profile AU (S 235) (nach Profilarbed (2004))<br />
4 Schätzwert: τRd = 0,1*q u = 1,0 MN/m² (q u aus Meseck (1987))<br />
5 τRd = 0,20 für C 12/15 (aus Schneider (1996))<br />
6 Schubspannung τRd = 0,33*f y von S 235 nach DIN 18800 Teil 1 (1990)<br />
7 Berücksichtigung von 50jähriger Abrostung (0,01mm/a)<br />
Windschubkraft [kN]<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
0,00<br />
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35<br />
D Wurzel [m]<br />
Spundwand 3<br />
Spundwand 3<br />
F(Wind)<br />
D(Baum)<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
Baumdurchmesser [m]
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 169<br />
13.1 – Sättigungsverhältnisse bei den Beregnungsversuchen<br />
Sättigung [%]<br />
Sättigung [%]<br />
Sättigung [%]<br />
Sättigung [%]<br />
100<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Σ h N = 90 mm/48 h (Versuch 05a)<br />
0<br />
0<br />
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Versuchszeit [h]<br />
Σ h N = 76 mm/3 h (Versuch 05b)<br />
Sgew,05a [%]<br />
hR,05a [mm]<br />
0<br />
0<br />
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54<br />
Versuchszeit [h]<br />
Σ h N = 140 mm/4 h (Versuch 05c)<br />
Sgew,05b [%]<br />
hR,05b [mm]<br />
0<br />
0<br />
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54<br />
Versuchszeit [h]<br />
Σ h N = 140 mm/4 h (Versuch 07)<br />
Sgew,05c [%]<br />
hR,05c [mm]<br />
0<br />
0<br />
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54<br />
Versuchszeit [h]<br />
Sgew,07 [%]<br />
hR,07 [mm]<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
Beregnungshöhe h R [mm]<br />
Beregnungshöhe h R [mm]<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
Beregnungshöhe h R [mm]<br />
Beregnungshöhe h R [mm]
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 170<br />
13.2 – Übersichtstabelle der Ergebnisse der Durchsickerungsversuche<br />
Vgl.-Nr.<br />
Basisversuch Vergleichsversuch<br />
Versuchsbeschreibung<br />
(A)<br />
Nr.<br />
Versuchsbeschreibung<br />
(B)<br />
Durchfluss<br />
q [l/s]<br />
Nr. Untersuchungsparameter q max<br />
Temperatur<br />
t [°C]<br />
dT/dt<br />
(pt3 + pt5)<br />
Deichanteil<br />
Vollsättigung<br />
a sat,max<br />
Mittlere<br />
Deichsättigung<br />
Sm, max<br />
(echo 1 bis 10)<br />
Wertung Bemerkung<br />
1 Normalwelle 00 Stationäre Welle 01 Einstaudauer ++ ++ + O +++++O Langer, hoher Einstau verstärkt die Durchsickerung<br />
2 Normalwelle 00 Schnelle Welle 02 Schnelle Welle - -- -- - ------ Schnelle Welle hat eine geringe Durchsickerung zur Folge<br />
3 Normalwelle 00 Langsame Welle 03 Langsame Welle + ++ ++ O +++++O Langsame Welle hat eine verstärkte Durchsickerung zur Folge<br />
4 Normalwelle 00 Vorwelle + Normalwelle 04 Vorwelle ++ ++ + O +++++O Vorwelle bewirkt eine verstärkte Durchsickerung.<br />
5 Normalwelle 00 Vorregen III + Normalwelle 05c Vorregen III ++ O O O ++OOO<br />
Vorregen erhöht den Abfluss durch Oberflächenabfluss. Ansonsten hat der<br />
Vorregen III keinen Einfluss auf die Durchsickerung.<br />
6 Normalwelle 00 Normalwelle + Grasnarbe 06 Grasnarbe k. A. O - O O-O Grasnarbe hat sehr geringe, bremsende Wirkung.<br />
7 Normalwelle 00<br />
Vorregen III + Normalwelle +<br />
Grasnarbe<br />
07 Grasnarbe + Vorregen k. A. - O O -OO<br />
Mit Vorregen ist die bremsende Wirkung der Grasnarbe aufgehoben.<br />
8 Normalwelle 00<br />
Vorwelle + Normalwelle +<br />
Grasnarbe<br />
08 Grasnarbe + Vorwelle O - O O O-OO<br />
Grasnarbe wirkt sich bei der Vorwelle besonders bremsend aus.<br />
9 Normalwelle 00<br />
Stationäre Welle + Grasnarbe<br />
+ Störstellen<br />
09<br />
Grasnarbe + Störstellen<br />
+ Wellenform<br />
+ O O + +OO+<br />
Bei längerem Einstau von Deich mit Grasnarbe und Störstellen ist eine<br />
leichte Verstärkung der Durchsickerung vorhanden.<br />
10 Stationäre Welle 01<br />
Stationäre Welle + Grasnarbe<br />
+ Störstellen<br />
09<br />
Grasnarbe + Störstellen<br />
+ Wellenform<br />
- - - O ---O<br />
11 Schnelle Welle 02 Schnelle Welle* 02a - - - + O --+O<br />
Stationäre Welle von Versuch 01 hat 2 Stunden geringere Scheiteldauer!<br />
Redundanzversuch zeigt, dass bei den gleichen Versuchen noch mittlere<br />
Abweichungen der Ergebnisse bestehen.<br />
12 Vorwelle + Normalwelle 04 Vorregen III + Normalwelle 05c Vorwelle / Vorregen III k. A. O - O O-O Vorwelle sättigt den Deich mehr als Vorregen III.<br />
13 Vorwelle + Normalwelle 04<br />
Vorwelle + Normalwelle +<br />
Grasnarbe<br />
08 Grasnarbe - -- O O ---OO<br />
Grasnarbe hat bei einer Vorwelle eine leicht bremsende Wirkung.<br />
14 Vorregen I + Normalwelle 05a Vorregen II 05b Vorregen I / II k. A. k. A. k. A. k. A. Keine Vergleich der Durchsickerung möglich.<br />
15 Vorregen I + Normalwelle 05a Vorregen III + Normalwelle 05c Vorregen I / III O + O - O+O- Keine merklichen Unterschiede der Regenereignisse.<br />
16 Vorregen III + Normalwelle 05c<br />
Vorregen III + Normalwelle +<br />
Grasnarbe<br />
07 Grasnarbe k. A. - O O -OO<br />
Die Grasnarbe hat keinen größeren Einfluss auf die Durchsickerung bei<br />
Vorregen III.<br />
17 Normalwelle + Grasnarbe 06<br />
Vorregen III + Normalwelle +<br />
Grasnarbe<br />
07 Vorregen III k. A. O + O O+O<br />
Vorregen II hat keinen größeren Einfluss auf die Durchsickerung auch mit<br />
Grasnarbe.<br />
18 Normalwelle + Grasnarbe 06<br />
Vorwelle + Normalwelle +<br />
Grasnarbe<br />
08 Vorwelle k. A. - + O -+O<br />
Grasnarbe dämpft die Wirkung einer Vorwelle.<br />
19 Normalwelle + Grasnarbe 06<br />
Stationäre Welle + Grasnarbe<br />
+ Störstellen<br />
09<br />
Einstaudauer /<br />
Störstellen<br />
k. A. O + + O++<br />
Die Stationäre Welle mit Störstellen bewirkt eine Zunahme der<br />
Durchsickerung.<br />
20<br />
Vorregen III + Normalwelle<br />
+ Grasnarbe<br />
07<br />
Vorwelle + Normalwelle +<br />
Grasnarbe<br />
08 Vorregen III / Vorwelle k. A. + O O +OO<br />
Vorregen III und Vorwelle haben bei Deich mit Grasnarbe haben keinen<br />
größeren Einfluss auf die Durchsickerung.<br />
21<br />
Vorwelle + Normalwelle +<br />
Grasnarbe<br />
08<br />
Stationäre Welle + Grasnarbe<br />
+ Störstellen<br />
09<br />
Einstaudauer / Vorwelle /<br />
Störstellen<br />
+ ++ O + +++O+<br />
Eine stationäre Welle wirkt sich stärker aus, als eine Vorwelle.<br />
++ große Zunahme > 20% > 50% > 20% > 20%<br />
+ kleine Zunahme > 5% > 25% > 5% > 5%<br />
O keine Zu- / Abnahme 0% 0% 0% 0%<br />
- kleine Abnahme < - 5% < - 25% < - 5% < - 5%<br />
-- große Abnahme < - 20 % < - 50 % < - 20 % < - 20 %<br />
k. A. keine Angabe möglich k. A. k. A. k. A. k. A.
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 171<br />
14.1 – Kurzzusammenfassung (Präsentation)<br />
Präsentation zur 7. Sitzung des Forschungsbeirates des F+E-Vorhabens „Deichsanierung“
DEICHSANIERUNG<br />
Endbericht<br />
Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />
Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 172<br />
14.2 – Hinweise zu Ertüchtigungs- / Sanierungsmaßnahmen von<br />
Deichen an Fließgewässern in Bayern


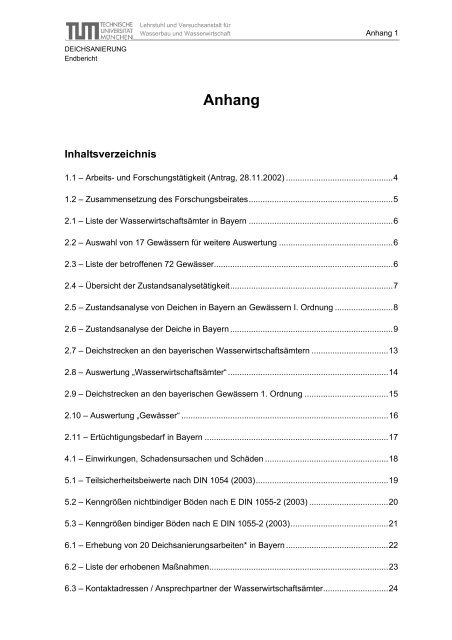












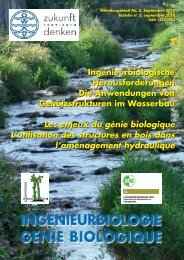

![Ereignis Schäden [Mio. €] - Ronald Haselsteiner](https://img.yumpu.com/5945195/1/190x135/ereignis-schaden-mio-eur-ronald-haselsteiner.jpg?quality=85)