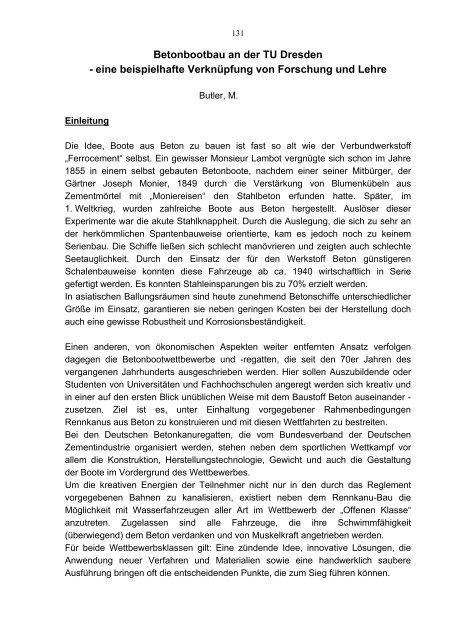Betonbootbau an der TU Dresden - Betonkanu-Regatta
Betonbootbau an der TU Dresden - Betonkanu-Regatta
Betonbootbau an der TU Dresden - Betonkanu-Regatta
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einleitung<br />
131<br />
<strong>Betonbootbau</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong><br />
- eine beispielhafte Verknüpfung von Forschung und Lehre<br />
Butler, M.<br />
Die Idee, Boote aus Beton zu bauen ist fast so alt wie <strong>der</strong> Verbundwerkstoff<br />
„Ferrocement“ selbst. Ein gewisser Monsieur Lambot vergnügte sich schon im Jahre<br />
1855 in einem selbst gebauten Betonboote, nachdem einer seiner Mitbürger, <strong>der</strong><br />
Gärtner Joseph Monier, 1849 durch die Verstärkung von Blumenkübeln aus<br />
Zementmörtel mit „Moniereisen“ den Stahlbeton erfunden hatte. Später, im<br />
1. Weltkrieg, wurden zahlreiche Boote aus Beton hergestellt. Auslöser dieser<br />
Experimente war die akute Stahlknappheit. Durch die Auslegung, die sich zu sehr <strong>an</strong><br />
<strong>der</strong> herkömmlichen Sp<strong>an</strong>tenbauweise orientierte, kam es jedoch noch zu keinem<br />
Serienbau. Die Schiffe ließen sich schlecht m<strong>an</strong>övrieren und zeigten auch schlechte<br />
Seetauglichkeit. Durch den Einsatz <strong>der</strong> für den Werkstoff Beton günstigeren<br />
Schalenbauweise konnten diese Fahrzeuge ab ca. 1940 wirtschaftlich in Serie<br />
gefertigt werden. Es konnten Stahleinsparungen bis zu 70% erzielt werden.<br />
In asiatischen Ballungsräumen sind heute zunehmend Betonschiffe unterschiedlicher<br />
Größe im Einsatz, gar<strong>an</strong>tieren sie neben geringen Kosten bei <strong>der</strong> Herstellung doch<br />
auch eine gewisse Robustheit und Korrosionsbeständigkeit.<br />
Einen <strong>an</strong><strong>der</strong>en, von ökonomischen Aspekten weiter entfernten Ansatz verfolgen<br />
dagegen die Betonbootwettbewerbe und -regatten, die seit den 70er Jahren des<br />
verg<strong>an</strong>genen Jahrhun<strong>der</strong>ts ausgeschrieben werden. Hier sollen Auszubildende o<strong>der</strong><br />
Studenten von Universitäten und Fachhochschulen <strong>an</strong>geregt werden sich kreativ und<br />
in einer auf den ersten Blick unüblichen Weise mit dem Baustoff Beton ausein<strong>an</strong><strong>der</strong> -<br />
zusetzen. Ziel ist es, unter Einhaltung vorgegebener Rahmenbedingungen<br />
Rennk<strong>an</strong>us aus Beton zu konstruieren und mit diesen Wettfahrten zu bestreiten.<br />
Bei den Deutschen Betonk<strong>an</strong>uregatten, die vom Bundesverb<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Deutschen<br />
Zementindustrie org<strong>an</strong>isiert werden, stehen neben dem sportlichen Wettkampf vor<br />
allem die Konstruktion, Herstellungstechnologie, Gewicht und auch die Gestaltung<br />
<strong>der</strong> Boote im Vor<strong>der</strong>grund des Wettbewerbes.<br />
Um die kreativen Energien <strong>der</strong> Teilnehmer nicht nur in den durch das Reglement<br />
vorgegebenen Bahnen zu k<strong>an</strong>alisieren, existiert neben dem Rennk<strong>an</strong>u-Bau die<br />
Möglichkeit mit Wasserfahrzeugen aller Art im Wettbewerb <strong>der</strong> „Offenen Klasse“<br />
<strong>an</strong>zutreten. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die ihre Schwimmfähigkeit<br />
(überwiegend) dem Beton verd<strong>an</strong>ken und von Muskelkraft <strong>an</strong>getrieben werden.<br />
Für beide Wettbewerbsklassen gilt: Eine zündende Idee, innovative Lösungen, die<br />
Anwendung neuer Verfahren und Materialien sowie eine h<strong>an</strong>dwerklich saubere<br />
Ausführung bringen oft die entscheidenden Punkte, die zum Sieg führen können.
Betonk<strong>an</strong>u-Bau <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong><br />
132<br />
Im folgenden Abschnitt wird ein kurze Darstellung <strong>der</strong> Entwicklung des <strong>Betonbootbau</strong>es<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong> gegeben.<br />
Die Anfänge des Dresdner <strong>Betonbootbau</strong>es verlieren sich im Dunkel <strong>der</strong><br />
Verg<strong>an</strong>genheit und können aufgrund m<strong>an</strong>geln<strong>der</strong> Dokumentation und unzureichen<strong>der</strong><br />
Befragung von Zeitzeugen nur unscharf dargestellt werden.<br />
In grauer Vorzeit<br />
Eine erste Initiative hat es vermutlich schon vor dem Fall <strong>der</strong> Berliner Mauer gegeben.<br />
Gesprächspartner bei <strong>der</strong> Internationalen BetonK<strong>an</strong>oeRace 1998 in Amsterdam<br />
beteuerten, dass vor 10 Jahren schon einmal eine Gruppe von Studenten aus<br />
<strong>Dresden</strong> mit einem eigenen Boot <strong>an</strong> <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>ländischen <strong>Regatta</strong> teilgenommen<br />
habe. Diese Geschichte klingt recht unglaubwürdig und k<strong>an</strong>n nicht bestätigt werden.<br />
Spezifikationen zu Bauart und Herstellungstechnologie sind demnach auch nicht<br />
bek<strong>an</strong>nt<br />
1992 - Kassel<br />
Der erste verbürgte <strong>Betonbootbau</strong> f<strong>an</strong>d im Jahr 1992 statt. Das Boot ähnelte einem<br />
Rennk<strong>an</strong>adier und war in S<strong>an</strong>dwichbauweise gefertigt. Dünne Styroporkerne wurden<br />
beidseitig mit Feinbeton beschichtet mit Bewehrung durch ein Stahldrahtgitter.<br />
1994 - Heilbronn<br />
Auch 1994 f<strong>an</strong>den sich motivierte Studenten, die zwei Betonboote in Positivfertigung<br />
hergestellten. Beim K<strong>an</strong>u „SÄCHSiii“ diente ein Styroporblock als Kern, beim<br />
„KILLERKARPFEN“ wurde <strong>der</strong> Beton auf ein aufgesp<strong>an</strong>ntes Faltboot gespachtelt.<br />
In beiden Fällen wurde ein triaxiales Glasfasergewebe als Bewehrung des Feinbetons<br />
verwendet. Die K<strong>an</strong>us wogen je ca. 90 kg.<br />
1996 - <strong>Dresden</strong><br />
Und d<strong>an</strong>n kam die <strong>Regatta</strong> nach <strong>Dresden</strong>; auf die Elbe! Der Status als Gastgeber<br />
verpflichtete zu beson<strong>der</strong>en Leistungen. Diese wurden möglich, da die Studenten ihre<br />
„neue Heimat“ am Lehrstuhl für Baustoffe <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong> f<strong>an</strong>den.<br />
Mit <strong>der</strong> Möglichkeit von den Erfahrungen, Fertigkeiten und Forschungsergebnissen<br />
<strong>der</strong> Mitarbeiter des Lehrstuhls zu profitieren waren (für die <strong>Dresden</strong>er Studenten)<br />
neue Ansätze und Konzepte des <strong>Betonbootbau</strong>es denkbar. Unter nahezu optimalen<br />
Arbeitsbedingungen konnten diese d<strong>an</strong>n auch von den Studenten umgesetzt werden.<br />
Von fast ebensolcher Bedeutung war die Unterstützung durch das Institut für Textil-<br />
und Bekleidungstechnik <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong>, welches von nun <strong>an</strong> die kostenlose Bereitstellung<br />
von textilen Bewehrungen gar<strong>an</strong>tierte.<br />
Wesentliches Qualitätsmerkmal <strong>der</strong> entstehenden Boote war <strong>der</strong> Einsatz des<br />
innovativen Verbundbaustoffes „Textilbewehrter Beton“ in Verbindung mit <strong>der</strong><br />
Anwendung <strong>der</strong> Negativ-Fertigung (das Boot wird in eine Form hineinbetoniert).
133<br />
Durch die Materialeigenschaften dieses textilbewehrten Betons (große Tragfähigkeit<br />
des Verbundstoffes, hohe Duktilität, gute Rissverteilung, geringe Rissbreiten) konnten<br />
die K<strong>an</strong>us als nur am R<strong>an</strong>d ausgesteifte Feinbetonschalen mit hoher<br />
Oberflächenqualität hergestellt werden. Aufgrund <strong>der</strong> m<strong>an</strong>gelnden Erfahrungen beim<br />
erstmaligen Einsatzes des neuartigen Baustoffes im Bootsbau wurden das K<strong>an</strong>u<br />
„STARKER AUGUST (95 kg) mit drei Lagen, das K<strong>an</strong>u ZARTE GUSTEL (70 kg) mit<br />
zwei Lagen textiler Bewehrung ausgestattet.<br />
Wie <strong>an</strong>gestrebt wurde die Zarte Gustel mit dem 1. Konstruktionspreis ausgezeichnet.<br />
Das K<strong>an</strong>u av<strong>an</strong>cierte zu einem bek<strong>an</strong>nten und weitgereisten Exponat (<strong>Regatta</strong><br />
Amsterdam 1998, Atl<strong>an</strong>ta (USA), Ulmer Betonfertigteiltage, ect.)<br />
Bild 1: ZARTE GUSTEL und STARKER AUGUST bei einer Trainingsfahrt<br />
Auch für die Offene Klasse wurde ein Beitrag konstruiert. In Anlehnung <strong>an</strong> einen <strong>der</strong><br />
für <strong>Dresden</strong> typischen Elbedampfer wurde <strong>der</strong> HOFNARR FRÖHLICH, ein aus drei<br />
Segmenten zusammengesp<strong>an</strong>nter und von 3 Personen betriebener, stilisierter<br />
Schaufelraddampfer, mit dem 2. Platz in <strong>der</strong> Wertung <strong>der</strong> „Offenen Klasse“ prämiert.<br />
1998 - Köln<br />
Zwei Jahre später waren einige <strong>Betonbootbau</strong>- Studenten aus dem Jahr 1994<br />
gemeinsam mit Neueinsteigern wie<strong>der</strong> mit hoher Motivation dabei, Ideen zu finden<br />
und Konstruktionen sowie Technologien zu verbessern. Die Kontinuität in <strong>der</strong><br />
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Baustoffe und <strong>der</strong> Wissensvorsprung <strong>der</strong><br />
altgedienten Studenten ermöglichten es, auf den Erfahrungen <strong>der</strong> vor<strong>an</strong>geg<strong>an</strong>genen<br />
Saison aufzubauen und gewagtere Konstruktionen für die K<strong>an</strong>us zu pl<strong>an</strong>en.<br />
Mit dem Ziel, die Tr<strong>an</strong>sportvolumina des Bootes zu minimieren, wurde das K<strong>an</strong>u<br />
SPANNER entwickelt. Es wird am Einsatzort aus 4 Einzelsegmenten zusammengesp<strong>an</strong>nt.<br />
Die dazu benötigen Sp<strong>an</strong>nlitzen verlaufen ellipsenförmig in <strong>der</strong> Bootshaut
134<br />
(siehe Bild 2). Die Feinbetonschicht <strong>der</strong> Bootshaut wurde nur noch mit einer Lage<br />
textiler Bewehrung ausgestattet. Die konstruktive Raffinesse und hochwertige<br />
Ausführung des K<strong>an</strong>us wurden von <strong>der</strong> Jury mit dem 2. Platz im Wettbewerb<br />
Konstruktion belohnt.<br />
Bild 2: Skizze <strong>der</strong> Sp<strong>an</strong>nlitzen- Bild 3: Nach dem Betonieren des SPANNER:<br />
führung beim K<strong>an</strong>u SPANNER vier Viertel sind hergestellt<br />
Die Minimierung des Gesamtgewichtes wurde beim zweiten K<strong>an</strong>u für die <strong>Regatta</strong> in<br />
Köln <strong>an</strong>gestrebt. Mit nur einlagiger textiler Bewehrung und einer W<strong>an</strong>ddicke von ca.<br />
2,5 mm konnte die Bootsmasse auf 28 kg reduziert werden. Das K<strong>an</strong>u verfügte über<br />
keinerlei Aussteifungen <strong>der</strong> Bootshaut, nur <strong>der</strong> freie R<strong>an</strong>d <strong>der</strong> dünnen Feinbetonschale<br />
wurde durch eine biegesteife R<strong>an</strong>dwulst ausgesteift. Dieses, ob seiner Farbe<br />
und filigr<strong>an</strong>en Bauweise BLAUES WUNDER getaufte K<strong>an</strong>u erreichte den 2. Platz im<br />
Wettbewerb Gestaltung. Obwohl es das absolut leichteste Betonk<strong>an</strong>u im<br />
Teilnehmerfeld war reichte es nicht für die Prämierung als leichtestes Boot. (Dazu<br />
wird das absolute Gewicht auf die Bootslänge bezogen, und da hatten Leipziger<br />
Studenten d<strong>an</strong>k einer ausgeprägten Bootsnase ebendieselbe vorn...)<br />
Der Wettbewerb in <strong>der</strong> Offenen Klasse wurde vom SCHÜRMANNBAU <strong>der</strong> <strong>TU</strong><br />
<strong>Dresden</strong> gewonnen. Dieses Wasserfahrzeug war eine Anspielung auf das<br />
Aufschwimmen des Rohbaues des Abgeordnetenhauses in Bonn beim<br />
Rheinhochwasser 12/1993. Auf zwei schwimmenden Betonpontons als Fundamentplatten<br />
waren Stützen und ein Deckengeschoß sowie ein Baukr<strong>an</strong> montiert. In<br />
zunftgemäßer Bauarbeitermontur, mit Helm und Gummistiefeln, wurde <strong>der</strong><br />
schwimmende Rohbau mit Hilfe von Stechpaddeln fortbewegt. Ein Bierkasten war<br />
natürlich auch mit <strong>an</strong> Bord.
Bild 4: Die Teilnehmer <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong> mit ihren K<strong>an</strong>us und dem schwimmenden<br />
„SCHÜRMANNBAU“ auf dem Fühlinger See in Köln<br />
135<br />
Erstmalig (und bisher auch einmalig) waren in Köln auch nennenswerte sportliche<br />
Erfolge zu verzeichnen: Die Damen erpaddelten sich den 3. und die Herren den<br />
7. Platz im sportlichen Wettkampf.<br />
2000 – Weil am Rhein / Basel<br />
Für die 8. Deutsche Betonk<strong>an</strong>uregatta hatten sich die Ver<strong>an</strong>stalter einen beson<strong>der</strong>en<br />
Ort ausgesucht: Das Dreilän<strong>der</strong>eck Weil am Rhein – Basel - Huningue. Unter den 750<br />
Teilnehmern waren so nicht nur Deutsche, son<strong>der</strong>n auch Schweizer und Fr<strong>an</strong>zosen.<br />
Knapp 40 Institutionen mit 47 Betonk<strong>an</strong>us und 10 Wasserfahrzeugen <strong>der</strong> offenen<br />
Klasse hatten sich auf den Weg nach Basel gemacht.<br />
Und die <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong> war wie<strong>der</strong> mit zwei K<strong>an</strong>us, die am Lehrstuhl für Baustoffe<br />
gebaut wurden, und einer guten Mischung aus erfahrenen und neu dazugestoßenen<br />
Studenten dabei. Ein Wasserfahrzeug für die Offene Klasse war dieses Mal m<strong>an</strong>gels<br />
zünden<strong>der</strong> Ideen nicht zust<strong>an</strong>de gekommen. Dafür aber war die Konstruktionsidee<br />
und Herstellungstechnik <strong>der</strong> beiden K<strong>an</strong>us von beson<strong>der</strong>er Qualität.<br />
Erneut spielte <strong>der</strong> Ged<strong>an</strong>ke <strong>der</strong> Tr<strong>an</strong>sportoptimierung die entscheidende Rolle beim<br />
Entwurf: ...m<strong>an</strong> müsste die Betonboote doch auch zerlegt und inein<strong>an</strong><strong>der</strong>geschachtelt<br />
im La<strong>der</strong>aum eines PKW-Kombi nach Basel beför<strong>der</strong>n können...
136<br />
Bild 5: Konstruktionszeichnung <strong>der</strong> K<strong>an</strong>us EXTERNIA bzw. SEGMENTA;<br />
rechts oben: Zwischenstücke zum Verlängern des Betonk<strong>an</strong>us<br />
Die Idee für die Schwesterk<strong>an</strong>us EXTERNIA und SEGMENTA spiegelt sich auch in<br />
<strong>der</strong>en Namensgebung wie<strong>der</strong>: Einzelne Segmente werden mittels externer GFK-<br />
Sp<strong>an</strong>nglie<strong>der</strong> zusammengesp<strong>an</strong>nt. So können die K<strong>an</strong>us in h<strong>an</strong>dliche Segmente<br />
zerlegt werden, die sich leicht tr<strong>an</strong>sportieren und am Einsatzort einfach montieren<br />
lassen. Um eine hohe Passgenauigkeit zu erreichen wurden die Segmente, ähnlich<br />
wie im Massivbrückenbau, Teil <strong>an</strong> Teil gefertigt. Bei den so entstehenden Segmenten<br />
h<strong>an</strong>delt es sich um r<strong>an</strong>dversteifte Schalen, bewehrt mit einer Lage textiler Bewehrung<br />
und mit einer W<strong>an</strong>ddicke von 2- 4 mm. Das Gewicht eines Segmentes liegt, je nach<br />
späterer Position im Boot, zwischen 5 und 6 kg. Das K<strong>an</strong>u besteht aus mindestens<br />
zehn Einzelsegmenten und k<strong>an</strong>n durch das Einfügen von Zwischenstücken in <strong>der</strong><br />
Mitte beliebig verlängert werden.<br />
Bild 6: Form mit einem Bild 7: Betonk<strong>an</strong>u EXTERNIA auf dem Rhein<br />
Teil <strong>der</strong> Segmente
137<br />
Dem K<strong>an</strong>u SEGMENTA wurde aufgrund <strong>der</strong> innovativen Bauweise und <strong>der</strong> prazisen<br />
Ausführung mit deutlichem Abst<strong>an</strong>d vor <strong>der</strong> Konkurrenz <strong>der</strong> begehrte Konstruktionspreis<br />
zuerk<strong>an</strong>nt. Das Schwesterk<strong>an</strong>u EXTERNIA wurde in <strong>der</strong> Kategorie Gestaltung<br />
mit dem 4 Preis ausgezeichnet. Im sportlichen Wettkampf vermochte sich das Team<br />
<strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong> trotz Bemühungen nicht für vor<strong>der</strong>e Plätze zu qualifizieren.<br />
Bild 8: Das Betonbootteam des Jahres 2000 in Basel mit den segmentierten<br />
Betonk<strong>an</strong>us SEGMENTA und EXTERNIA<br />
2002 - Potsdam<br />
Bei <strong>der</strong> Ideenfindung für die <strong>der</strong> 9. Betonbootregatta Boote lastete das hohe<br />
Maßstäbe setzende Erbe <strong>der</strong> Vorgänger schwer auf den Schultern <strong>der</strong> verjüngten,<br />
sich aus allen Semestern zusammensetzenden M<strong>an</strong>nschaft. Viele innovative<br />
Konstruktions- und Bauweisen waren im Laufe <strong>der</strong> Jahre schon erdacht und<br />
ausgeführt worden. Welche Potentiale des Baustoffs Beton könnten beim Bootsbau<br />
mit den am Lehrstuhl für Baustoffe zur Verfügung stehenden Mitteln noch<br />
erschlossen werden?<br />
Da es keine durchschlagenden Ideen für die K<strong>an</strong>us gab, die auch durch<br />
Umsetzbarkeit gekennzeichnet waren, wurde <strong>der</strong> Fokus vorr<strong>an</strong>gig auf ein<br />
<strong>an</strong>spruchsvolles Projekt für die Offene Klasse gerichtet. Nach 4 Monaten intensiver<br />
Pl<strong>an</strong>ungen und ambitionierten Bauens war d<strong>an</strong>n das tauchfähige Wasserfahrzeug<br />
GELBER OKTOBER vollendet und harrte seiner Erprobung.<br />
Die Konstruktion ist modular aufgebaut und besteht aus 7 Funktionseinheiten, die<br />
durch flexible Verbindungsmittel lösbar mitein<strong>an</strong><strong>der</strong> verbunden sind:<br />
��Kabine für 2 Personen<br />
��Grundplatte
138<br />
��Auftriebsbehälter<br />
��Druckluftspeicher<br />
��Antrieb und Steuerung für die Horizontalbewegung<br />
��Steuerung für die Vertikalbewegung<br />
��Sicherheits- und Kommunikationseinrichtungen<br />
Zur die Herstellung von Kabine und Auftriebsbehältern wurden speziell <strong>an</strong> die<br />
jeweilige Aufgabe <strong>an</strong>gepaßte Feinbetone in Verbindung mit textilen Gewirken aus<br />
alkaliresistenter Glasfaser eingesetzt. Für die Grundplatte kam ein konventioneller<br />
C35/45 mit Stahlbewehrung zur Anwendung. Als Druckluftbehälter wurden zwei 50L-<br />
Industriegasflaschen genutzt. Den Bauarbeiten ging eine intensive Pl<strong>an</strong>ungsphase<br />
voraus, in <strong>der</strong>en Verlauf zahlreiche Konstruktionsvari<strong>an</strong>ten erdacht, durchgerechnet,<br />
modifiziert und verworfen wurden, bis das Wasserfahrzeug in seiner finalen<br />
Ausprägung entwickelt war.<br />
Bild 9: Konstruktionszeichnung des tauch- Bild 10: Erstmontage <strong>der</strong> Komponenten<br />
fähigen Wasserfahrzeuges vor <strong>der</strong> Halle Semperstrasse 14<br />
GELBER OKTOBER Alles fügt sich wie gepl<strong>an</strong>t<br />
Bild 11:Fahrt über Wasser Bild 12: Auf Tauchfahrt
139<br />
GELBER OKTOBER ist tauglich sowohl für die Fahrt auf <strong>der</strong> Wasseroberfläche als<br />
auch unter Wasser. Beim Tauchen passt sich <strong>der</strong> Luftdruck in <strong>der</strong> Kabine dem Druck<br />
des umgebenden Wassers <strong>an</strong>. Die mögliche Tauchtiefe wird so nur durch die<br />
Kondition <strong>der</strong> Insassen begrenzt. Der Antrieb erfolgt mit Muskelkraft durch einen<br />
Propeller, Fahrtgeschwindigkeiten von 2-3 km/h sind möglich. Die maximalen<br />
Abmessungen betragen (LxBxH) 2200 x 2100 x 1350 mm³, die Gesamtmasse beläuft<br />
sich auf 1750 kg. Auf <strong>der</strong> <strong>Regatta</strong> bestaunt und bewun<strong>der</strong>t und neidlos mit reichem<br />
Beifall bei <strong>der</strong> Vorführung auf und in <strong>der</strong> Havel bedacht wurde es zum unumstrittenen<br />
Sieger im Wettbewerb <strong>der</strong> Offenen Klasse.<br />
Neben den Aktivitäten für die Offene Klasse wurden auch <strong>der</strong> Bau von Booten für die<br />
K<strong>an</strong>uklasse vor<strong>an</strong>getrieben. Bedingt durch den hohen Aufw<strong>an</strong>d für das<br />
Wasserfahrzeug GELBER OKTOBER wurden diese Entwicklungen aber nur mit<br />
geringerer Intensität betrieben.<br />
Das K<strong>an</strong>u VERKEHRSMUSEUM wurde unter <strong>der</strong> Prämisse eines minimalen<br />
Gewichtes (
140<br />
Konstruktion: 8 einachsig gekrümmte, separat hergestellte Segmente werden durch 5<br />
Sp<strong>an</strong>nstäbe aus GFK, die im Bootsinneren geführt werden, zusammengepresst.<br />
Die Schalung besteht aus Edelstahlblech, das durch außermittig befestigte<br />
Stellglie<strong>der</strong> abschnittsweise fast beliebig gekrümmt werden k<strong>an</strong>n.<br />
Zur Herstellung des K<strong>an</strong>us wurde ein spezieller Feinbeton in Verbindung mit textilen<br />
Gewirken aus alkaliresistenter Glasfaser verwendet. Zuerst wurde das Mittelsegment<br />
betoniert. Nach dem Ausschalen wurde die Form <strong>an</strong> die Maße des sich<br />
<strong>an</strong>schließenden Segmentes <strong>an</strong>gepasst und dieses hergestellt. Da zwei frei<br />
einstellbare Segmentschalungen im Einsatz waren entst<strong>an</strong>d das Boot von <strong>der</strong> Mitte<br />
ausgehend symmetrisch in 5 Takten.<br />
Bild 14: Frei einstellbare Segment- Bild 15: Konstruktionszeichung <strong>der</strong><br />
Schalung aus Edelstahlblech MISS MARBLE<br />
Bild 16: Die Erbauer <strong>der</strong> MISS MARBLE in und mit <strong>der</strong>selben auf <strong>der</strong> Havel
141<br />
Für den Bug musste eine separate Form hergestellt werden. Durch den Einsatz <strong>der</strong><br />
frei einstellbaren Segmentschalung aus Edelstahlblech konnte <strong>der</strong> Arbeitsaufw<strong>an</strong>d für<br />
den Formenbau drastisch gesenkt und zugleich eine hervorragende<br />
Oberflächenqualität erzielt werden.<br />
Der Name ist <strong>der</strong> Betongestaltung geschuldet. Durch das Vermischen von<br />
verschieden pigmentierten Betonen wurde ein marmorierte Oberfläche hergestellt.<br />
2005 - Heidelberg<br />
Der Strukturw<strong>an</strong>del in <strong>der</strong> Bauwirtschaft hinterlässt seine Spuren - auch bei <strong>der</strong><br />
Betonk<strong>an</strong>uregatta. Aufgrund von Umstrukturierungen des Bundesverb<strong>an</strong>des <strong>der</strong><br />
Zementindustrie wurde die, <strong>der</strong> Tradition folgend für das Jahr 2004 erwartete,<br />
10. Deutsche Betonk<strong>an</strong>uregatta auf das Jahr 2005 verschoben.<br />
Bei den potentiellen Bootsbauern in <strong>Dresden</strong> führte das zu einer gewissen<br />
Enttäuschung, aber vor allem zu einem starken Abg<strong>an</strong>g von erfahrenen<br />
Bootsbaustudenten, da diese ihr Studium zu Ende gebracht hatten.<br />
Doch D<strong>an</strong>k weniger „Überleben<strong>der</strong>“ und <strong>der</strong> guten Dokumentation konnte ein<br />
Wissens-, Erfahrungs- und Technologietr<strong>an</strong>sfer in die neue Bootsbaum<strong>an</strong>nschaft<br />
sichergestellt werden.<br />
Und wie<strong>der</strong> f<strong>an</strong>den die Betonbootidealisten ideale Voraussetzungen in <strong>der</strong> Baustoff-<br />
Versuchshalle des nunmehrigen Instituts für Baustoffe. Nicht nur ein Raum,<br />
verfügbare Materialien und technische Ausrüstung wurden wie<strong>der</strong> zur Verfügung<br />
gestellt, die Bootsbauer f<strong>an</strong>den in den Mitarbeitern auch interessierte Konsultationspartner.<br />
Die Ideenfindung gestaltete sich wie schon 2002 schwierig. Mit welcher Konstruktion<br />
k<strong>an</strong>n m<strong>an</strong> aus dem Schatten, den das (unvergleichliche) Beton - U-Boot seit 3 Jahren<br />
wirft, heraustreten? Wie k<strong>an</strong>n ein innovatives, konstruktiv neuartiges Konzept für ein<br />
Betonk<strong>an</strong>u aussehen? Gute Ideen waren gefragt! Und sie kamen....sowohl für den<br />
K<strong>an</strong>ubau als auch in <strong>der</strong> Offenen Klasse.<br />
In <strong>der</strong> offenen Klasse wurde in einem (für Bauingenieure) bemerkenswert kreativen<br />
Abstraktionsprozess die schon oft reproduzierte Idee eines Schaufelrad-Dampfers<br />
weiterentwickelt und das Schaufelrad selbst zum Schwimmkörper und Fahrzeug<br />
gemacht. Der eigentliche Schiffskörper existiert nicht mehr, nur noch <strong>der</strong> Antrieb<br />
bleibt übrig, purer Selbstzweck in Form und Funktion: ein Rad, das über Wasser<br />
rollt....<br />
Viele Diskussionen, Zeichnungen, Versuche und l<strong>an</strong>ge Nächte wurden gebraucht;<br />
Lösungen erdacht und wie<strong>der</strong> verworfen, bis das Werk vollendet war. DREHSDEN<br />
wurde es getauft; ein schwimmfähiges Laufrad aus Beton, <strong>an</strong>getrieben durch im<br />
„Inneren“ des Rades laufende - und damit das Rad drehende - Menschen.
142<br />
Grundelemente des Fahrzeuges sind die Laufrä<strong>der</strong>. Sie sind zugleich Schwimmkörper<br />
und Antriebselement. Ein Laufrad besteht aus 8 Hohlkasten- Segmenten. Die<br />
Segmentierung wurde durch Tr<strong>an</strong>sport und Herstellung nötig. Die Masse eines<br />
Segmentes beträgt ca. 35 kg, das umbaute Volumen ca. 400 Liter. Die<br />
textilbewehrten Flächen sind, abhängig von <strong>der</strong> Belastung, 2-5 mm dick.<br />
Die Segmente sind <strong>an</strong> <strong>der</strong> Aussenfläche mit Querrippen versehen, die zur<br />
Aussteifung und zur Antriebsverbesserung dienen. Die Lauffläche ist aufgrund <strong>der</strong><br />
hohen Belastungen als S<strong>an</strong>dwich-Konstruktion ausgebildet (Bild 17).<br />
Bild 17: Zeichnung eines Bild 18: Konstruktionszeichung des schwimmenden<br />
Segmentes Laufrades DREHSDEN<br />
Ein Laufrad wird ringförmig aus 8 Segmenten zu zusammengesp<strong>an</strong>nt. Der Außendurchmesser<br />
eines Rades beträgt 3100 mm, <strong>der</strong> Innendurchmesser 2100 mm. Es ist<br />
900 mm breit und wiegt (nur) 280 kg.<br />
Aus Gründen <strong>der</strong> Schwimmstabilität und <strong>der</strong> M<strong>an</strong>övrierbarkeit (Kurvenfahrt) werden 2<br />
Laufrä<strong>der</strong> mittels einer Nabe - Achse - Konstruktion drehbar mitein<strong>an</strong><strong>der</strong> verbunden<br />
(Bild 18). Die Nabe wird <strong>an</strong> den Beton des Laufrades mit Speichen (Gewindest<strong>an</strong>gen<br />
M6) radial befestigt. Der Anschluß erfolgt<br />
außermittig auf nur einer Seite <strong>der</strong><br />
Beton- Laufrä<strong>der</strong> (unbehin<strong>der</strong>ter Zug<strong>an</strong>g<br />
zur Lauffläche).<br />
Die Gesamtbreite <strong>der</strong> DREHSDEN<br />
beträgt 3800mm, die gesamte Masse<br />
600 kg. Das Reisetempo des Laufrades<br />
k<strong>an</strong>n bis auf die Schrittgeschwindigkeit<br />
eines Fußgängers gesteigert werden.<br />
Als Bewehrung werden Gelege aus<br />
alkali-resistenter Glasfaser verwendet, Bild 19: Ein Segment wird in die Hohl-<br />
kastenform hineinbetoniert
143<br />
die uns in auseichen<strong>der</strong> Menge und kostenlos vom Institut für Textil- und<br />
Bekleidungstechnik <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong> zur Verfügung gestellt wurden. Je nach<br />
Belastung kamen unterschiedliche Gelege zum Einsatz. Als Beton wird ein Feinbeton<br />
mit hohem Zement<strong>an</strong>teil und geringem Größtkorn des Zuschlages (1mm) verwendet.<br />
Die Form für die Segmente (Bild 19) wurde als Negativform ausgeführt um eine hohe<br />
Oberflächenqualität und Passgenauigkeit <strong>der</strong> Betonsegmente sicherzustellen. Die<br />
Form besteht aus 4 Teilen, zusammengefügt bilden diese einen Hohlkasten, in<br />
dessen Innenraum das Segment hineinbetoniert wird.<br />
Zur großen Freude aller Beteiligten fügten sich am Ende <strong>der</strong> Betonierarbeiten<br />
passgenau je 8 Segmente zu einem Ring.<br />
Bild 20: Montage <strong>der</strong> DREHSDEN Bild 21: DREHSDEN auf dem Neckar<br />
hier: Aufrichten eines Rades<br />
Bei <strong>der</strong> <strong>Regatta</strong>, auf dem Neckar in Heidelberg, erregte das ungewöhnliche Gefährt<br />
Aufsehen und Interesse, sowohl in Fachkreisen als auch beim zahlreichen<br />
Laufpublikum. Erstaunen rief immer wie<strong>der</strong> das Leistungsvermögen <strong>der</strong> dünnen<br />
Schichten aus textilbewehrten Beton hinsichtlich Belastbarkeit und Wasserundurchlässigkeit<br />
hervor. Die Auszeichnung <strong>der</strong> Idee und <strong>der</strong>en Umsetzung mit dem 1. Platz<br />
in <strong>der</strong> Wertung <strong>der</strong> Offenen Klasse war daher nicht überraschend. Parallel zum Bau<br />
des Laufrades wurde auch <strong>an</strong> Betonbooten für die K<strong>an</strong>uklasse gewerkelt.<br />
Warum Beton nicht einfach mal extrem „ver“-biegen? Das klingt zunächst abwegig,<br />
k<strong>an</strong>n aber unter bestimmten Voraussetzungen machbar sein. Im Ergebnis entst<strong>an</strong>d<br />
das Betonk<strong>an</strong>u rumLAPPEN; ein Boot nach einem Baukastensystem. Vor Ort wird<br />
das K<strong>an</strong>u aus ebenen, dünnen und biegsamen Betonplatten, den Lappen, sowie<br />
diversen Aussteifungselementen zusammengesetzt. Die Tragwirkung wird durch das<br />
räumliche Zusammenwirken aller Elemente sichergestellt (incl. Längsvorsp<strong>an</strong>nung).<br />
Das K<strong>an</strong>u ist doppelt symmetrisch, die Geometrie wurde speziell für die <strong>an</strong>gestrebte<br />
Konstruktionsweise entworfen. Alle durch die Lappen gebildeten Außenflächen
144<br />
mussten abwickelbar sein und die Übergänge zwischen den Lappen durften keinen<br />
Versatz zeigen.<br />
Bild 22: Abwicklung <strong>der</strong> „Lappen“ des Baukastenk<strong>an</strong>us rumLAPPEN<br />
Das Betonk<strong>an</strong>u rumLAPPEN besteht aus 7+4 Lappen (Bild 22), <strong>an</strong> <strong>der</strong>en<br />
Verbindungsstellen 8 Sp<strong>an</strong>ten und Steven <strong>an</strong>geordnet sind. Durch <strong>an</strong> <strong>der</strong> Außenseite<br />
<strong>der</strong> Sp<strong>an</strong>ten verlaufende Sp<strong>an</strong>ngurte werden die Lappen <strong>an</strong> die Sp<strong>an</strong>ten gepresst,<br />
die Abdichtung <strong>der</strong> Fugen erfolgt mit Zellkautschuk. In Längsrichtung stützen sich die<br />
Lappen gegen umlaufende Konsolen <strong>an</strong> <strong>der</strong> Außenseite <strong>der</strong> Sp<strong>an</strong>ten ab. So k<strong>an</strong>n die<br />
Längs-Vorsp<strong>an</strong>nkraft vom Bug bis zum Heck durch die Lappen übertragen und damit<br />
das K<strong>an</strong>u zusammengehalten werden. Bug und Heck sind werden durch eine Sp<strong>an</strong>t-<br />
Steven- Son<strong>der</strong>konstruktion mit eingeschobenen Lappen ausgebildet. Die freien<br />
Rän<strong>der</strong> <strong>der</strong> Lappen werden mit aufgesteckten Versteifungen (dem sogen<strong>an</strong>nten Süll)<br />
stabilisiert (Bil<strong>der</strong> 32 und 24).<br />
Bild 23: Zusammenbau von rumLAPPEN: Bild 24: Innen<strong>an</strong>sicht des K<strong>an</strong>u<br />
ein Lappen muß noch <strong>an</strong>gelegt werden rumLAPPEN<br />
Für das K<strong>an</strong>u rumLAPPEN wurden eine Länge von 4530 mm gewählt. Das gesamte<br />
Gewicht beträgt ca. 60 kg, davon entfallen 41 kg auf die Sp<strong>an</strong>ten, 18 kg sind den<br />
Lappen zuzuordnen. Die Dicke <strong>der</strong> Lappen beträgt 1,5 – 2 mm.<br />
Als Bewehrung für Lappen, Sp<strong>an</strong>ten und Süll werden Gelege aus alkaliresistenter<br />
Glasfaser verwendet. Der Feinbeton zur Einbettung <strong>der</strong> Fasern zeichnet sich durch
145<br />
einen hohen Zement<strong>an</strong>teil und geringes Größtkorn des Leichtzuschlages (0,5 mm)<br />
aus.<br />
Als Form für die Herstellung <strong>der</strong> Lappen wurde nur eine ebene Fläche (Schaltafel)<br />
benötigt. Auf diese wurde eine ca. 1 mm starke Feinbetonschicht aufgespachtelt,<br />
d<strong>an</strong>n die textile Bewehrung aufgelegt und <strong>an</strong>gedrückt. Den oberen Abschluss bildet<br />
eine weitere ca. 1 mm dicke Betonschicht. Der exakte Zuschnitt <strong>der</strong> Lappen erfolgte<br />
nach dem Erhärten des Betons.<br />
Die Schalung für die Sp<strong>an</strong>ten wurde aus diversem Restmaterial zusammengebastelt<br />
(Möbelteile, Faser-Harz-Platten, Nägel, Holzklötze). Zur winkeltreuen Ausbildung <strong>der</strong><br />
Konsole wurden Styrodur-Formstreifen auf die gebogene R<strong>an</strong>dschalung geklebt.<br />
Die Sp<strong>an</strong>ten wurden in ähnlicher Weise wie die Lappen hergestellt, es wurden aber je<br />
2 Lagen <strong>der</strong> textilen Bewehrung <strong>an</strong> <strong>der</strong> Innen- und Außenseite <strong>der</strong> Sp<strong>an</strong>ten<br />
eingebaut. Zur Massereduktion wurden in den Sp<strong>an</strong>ten Hohlkörper eingelegt.<br />
Die Süll wurde in einfachster Weise, durch Befüllen des längsgeschlitzten PVC-<br />
Rohres bei gleichzeitigem Eindrücken <strong>der</strong> Bewehrung hergestellt. Der Schlitz zur<br />
Aufnahme <strong>der</strong> Lappen wurde nachträglich eingesägt.<br />
Bild 25: Zwei Protagonisten in “ihrem“ K<strong>an</strong>u rumLAPPEN währen <strong>der</strong> <strong>Regatta</strong><br />
auf dem Neckar in Heidelberg<br />
Aufgrund <strong>der</strong> problemorientierten, zeitnahen Pl<strong>an</strong>ung mit vielen spont<strong>an</strong>en<br />
Komponenten bei Konstruktion und Ausführung trug das Ergebnis <strong>der</strong> Bemühungen<br />
eher den Charakter einer Betonk<strong>an</strong>u-Studie denn den eines voll gebrauchstauglichen<br />
Bootes. Die Juroren auf <strong>der</strong> <strong>Regatta</strong> in Heidelberg ließen sich davon aber nicht<br />
ablenken. Vielmehr zeigten sie sich beeindruckt vom Ideenreichtum <strong>der</strong> Erbauer und<br />
<strong>der</strong> unkonventionellen Interpretation des Baustoffes Beton. Zur Freude <strong>der</strong> <strong>Dresden</strong>er<br />
Studenten wurde das daher K<strong>an</strong>u mit dem 2 Platz in <strong>der</strong> Konstruktionswertung<br />
ausgezeichnet.<br />
Um auch bei den sportlichen Wettkämpfen präsent zu sein wurden noch zwei weitere<br />
„Brot - und - Butter“- K<strong>an</strong>us hergestellt, die durch die Abwesenheit von Neuheiten
146<br />
hinsichtlich Konstruktion und Materialien und eine sehr saubere h<strong>an</strong>dwerkliche<br />
Ausführung gekennzeichnet waren. Der Einsatz <strong>der</strong> K<strong>an</strong>us führte aber zu keinem<br />
signifik<strong>an</strong>ten Ergebnis im sportlichen Wettbewerb, was aber auf die m<strong>an</strong>gelhafte<br />
Bedienung durch das ungeübte Personal zurückzuführen war.<br />
Umf<strong>an</strong>greichere Erläuterungen, Konstruktionsberichte, Zeichnungen und Bil<strong>der</strong> von<br />
den meisten <strong>der</strong> oben gen<strong>an</strong>nten Konstruktionen finden Interessierte auf <strong>der</strong><br />
Homepage des Betonbootteams <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong>: www.betonboot.de.<br />
Was die nächsten Betonk<strong>an</strong>u-Regatten mit sich bringen werden, bleibt abzuwarten.<br />
Der hohe Anspruch <strong>der</strong> Bauingenieurstudenten <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong> wird wohl erhalten<br />
bleiben; und auch <strong>der</strong>en Wunsch nach Beibehaltung <strong>der</strong> optimalen Arbeits- und<br />
Betreuungsbedingungen, wie sie in den letzten 10 Jahren am Institut für Baustoffe<br />
durch die Arbeitsgruppe Baustofftechnik und –labor gewährleistet wurden.<br />
Bild 26: Fotomontage „DREHSDEN in Space“ (Quelle: Andreas Vogel)<br />
...ein Raumschiff aus Beton - das Betonbootprojekt für 2007?
147<br />
Tabelle 1: Auflistung <strong>der</strong> Erfolge bei <strong>der</strong> Deutschen Betonk<strong>an</strong>uregatta<br />
Kategorie des Wettbewerbes<br />
Sport Offene Klasse Sonstiges<br />
Jahr / Ort<br />
Konstruktion Gestaltung<br />
--<br />
1992<br />
Kassel<br />
--<br />
1994<br />
Heilbronn<br />
2. Platz<br />
Hofnarr Fröhlich<br />
7. Platz Herren<br />
4. Platz<br />
Starker August<br />
1.Platz<br />
Zarte Gustel<br />
1996<br />
<strong>Dresden</strong><br />
1. Platz<br />
Schürm<strong>an</strong>nbau<br />
3. Platz Damen<br />
7. Platz Herren<br />
2. Platz<br />
Blaues Wun<strong>der</strong><br />
2. Platz<br />
sp<strong>an</strong>ner<br />
1998<br />
Köln<br />
--<br />
4. Platz<br />
Externia<br />
1. Platz<br />
Segmenta<br />
2000<br />
Basel<br />
Leichtestes K<strong>an</strong>u<br />
Verkehrsmuseum<br />
1. Platz<br />
Gelber Oktober<br />
2. Platz<br />
Verkehrsmuseum<br />
2002<br />
Potsdam<br />
1. Platz<br />
Drehsden<br />
2. Platz<br />
rumLappen<br />
2005<br />
Heidelberg
Fazit<br />
148<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Teilnahme <strong>der</strong> Bauingenieurstudenten <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong> <strong>an</strong> den<br />
Betonk<strong>an</strong>u-Regatten hat sich eine enge Verknüpfung von Forschung und Lehre<br />
herausgebildet.<br />
Den Studenten wurden am Lehrstuhl für Baustoffe seit 1995 durchgängig<br />
Arbeitsräume zur Verfügung gestellt. Damit wurde <strong>der</strong> studentischen Arbeit eine<br />
sichere Heimstatt gegeben.<br />
Der Betonk<strong>an</strong>u- und <strong>der</strong> Betonbootsbau bietet ein ideales Feld für die Anwendung<br />
des textilbewehrten Betons, einen <strong>der</strong> Forschungsschwerpunkte <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Dresden</strong>.<br />
Den Studenten wurde einerseits das stofflich- verfahrenstechnische und<br />
technologische „know-how“ aber auch materielle Unterstützung verfügbar gemacht<br />
und sie konnten <strong>an</strong><strong>der</strong>erseits ohne Reglementierung ihre eigenen Ideen entwickeln<br />
und ausprobieren. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Auf diese Weise<br />
konnten die Studenten viele Erfahrungen eigenständig erweben und ihr<br />
diesbezügliches Wissen erweitern und vertiefen.<br />
Der enge Kontakt mit den Studenten hatte aber auch für den Lehrstuhl bzw. für das<br />
Institut für Baustoffe viele positive Aspekte. So wurden motivierte Interessenten für<br />
Beleg- und Diplomarbeiten gewonnen. Der Autor selbst hat auf diese Weise seinen<br />
Weg zu den „Baustofflern“ gefunden und sich seither als engagierter Betreuer des <strong>der</strong><br />
Bootsbauer eingebracht.<br />
Die K<strong>an</strong>u-Teams „unter dem Dach“ <strong>der</strong> Freunde des Bauingenieurwesens <strong>der</strong> <strong>TU</strong><br />
<strong>Dresden</strong> haben durch ihr l<strong>an</strong>gjähriges, erfolgreiches Abschneiden vor allem in den<br />
technischen und gestalterischen Disziplinen „viel Sonnenschein“ auf die Fakultät<br />
Bauingenieurwesen gelenkt, was auch Anerkennung erfuhr. So wurde die Tätigkeit im<br />
K<strong>an</strong>u-Team als Praktikumszeit <strong>an</strong>erk<strong>an</strong>nt. Es wurde weiterhin die Möglichkeit<br />
eingeräumt, die Boote auszustellen. Ein Höhepunkt war die Ausstellung im<br />
Rektoratsgebäude und eine Auszeichnung durch den Rektor.<br />
Die Industrie interessiert sich zunehmend für die Betonkreationen als Werbeträger.<br />
Das K<strong>an</strong>u „Zarte Gustel“ hat nicht nur Paris erlebt son<strong>der</strong>n als Ausstellungsstück im<br />
Rahmen <strong>der</strong> „techtextil“ auch Amerika gesehen. Aber auch die Präsentation <strong>der</strong><br />
Dresdner K<strong>an</strong>us zu den Ulmer Betontagen motivierten die Beteiligten.<br />
Abschließend k<strong>an</strong>n m<strong>an</strong> nur wünschen: Weiter so!