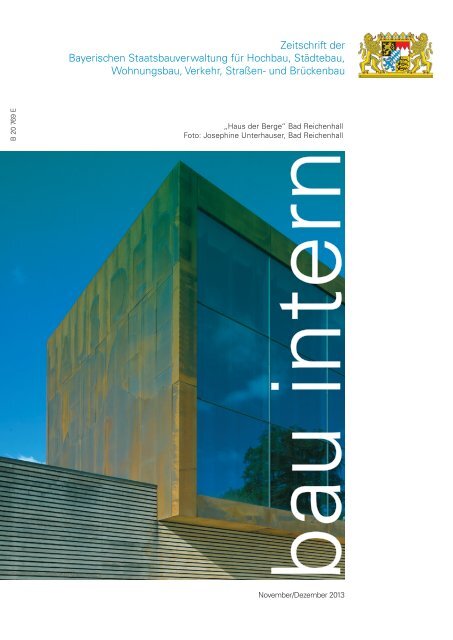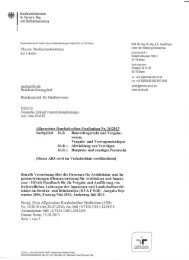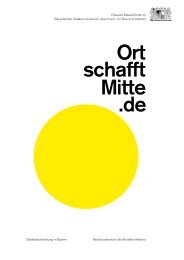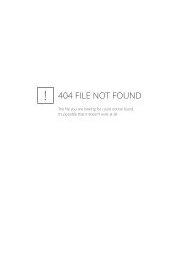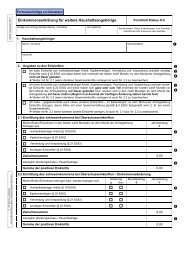Zeitschrift der Bayerischen Staatsbauverwaltung für Hochbau ...
Zeitschrift der Bayerischen Staatsbauverwaltung für Hochbau ...
Zeitschrift der Bayerischen Staatsbauverwaltung für Hochbau ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
November/Dezember 2013bau intern<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Bayerischen</strong> <strong>Staatsbauverwaltung</strong> für <strong>Hochbau</strong>, Städtebau,<br />
Wohnungsbau, Verkehr, Straßen und Brückenbau<br />
B 20 769 E<br />
„Haus <strong>der</strong> Berge“ Bad Reichenhall<br />
Foto: Josephine Unterhauser, Bad Reichenhall
Inhalt<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong> <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />
für <strong>Hochbau</strong>, Wohnungsbau,<br />
Verkehr, Straßen- und Brückenbau<br />
Herausgeber<br />
Oberste Baubehörde im <strong>Bayerischen</strong> Staatsministerium<br />
des Innern, für Bau und Verkehr<br />
Für den redaktionellen Inhalt verantwortlich<br />
Attila Karpati M.A., Oberste Baubehörde im<br />
<strong>Bayerischen</strong> Staatsministerium des Innern,<br />
für Bau und Verkehr<br />
Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München,<br />
Tel. 089 2192 3471, Fax 089 2192 13471<br />
E-Mail: attila.karpati@stmi.bayern.de<br />
Die mit dem Namen des Verfassers gezeichneten<br />
Artikel stellen nicht unbedingt die Meinung<br />
des Herausgebers o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schriftleitung dar.<br />
Verlag<br />
Gebr. Geiselberger GmbH, Druck und Verlag<br />
Martin-Moser-Straße 23, 84503 Altötting,<br />
Telefon: +49 (0) 8671 5065-0,<br />
Telefax: +49 (0) 8671 5065-68<br />
E-Mail: mail@geiselberger.de<br />
Verantwortlich für den Anzeigenteil<br />
Michael Tasche, Tel. +49(0)8671 5065-51<br />
Erscheint 6-mal im Jahr beginnend mit<br />
Jan./Febr. jeweils Ende <strong>der</strong> Monate<br />
Februar, April, Juni, August, Oktober und<br />
Dezember.<br />
Bezugspreis je Heft Euro 4,20,<br />
Jahresabonnement Euro 22,50 zuzüglich<br />
Versandkosten.<br />
Bestellung durch die Buchhandlung o<strong>der</strong> direkt<br />
beim Verlag erbeten.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird<br />
keine Gewähr übernommen. Nachdruck – auch<br />
auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verlages.<br />
Alle Rechte, auch das <strong>der</strong> Übersetzung,<br />
vorbehalten.<br />
Zurzeit ist die Anzeigenpreisliste ab 2006<br />
gültig.<br />
4<br />
5<br />
8<br />
11<br />
15<br />
17<br />
19<br />
21<br />
23<br />
26<br />
28<br />
Staatsminister Joachim Herrmann,<br />
Staatssekretär Gerhard Eck<br />
Grußwort zum Jahreswechsel 2013/2014<br />
Ministerialdirektor Josef Poxleitner<br />
Jahresrückblick<br />
Franz Langlechner, Dr.-Ing. Josef Rott<br />
Auftakt zur neuen EU-För<strong>der</strong>periode 2014-2020 im<br />
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)<br />
Dr. Christina Kühnau, Peter Blum, Hansjörg Haslach,<br />
Prof. Markus Reinke, Dr. Wolfgang Zehlius-Eckert<br />
Kulturlandschaftliche Empfehlungen für Bayern beim<br />
Planen und Bauen<br />
Mathis Gruhn, Bernhard Klingl<br />
Endspurt beim Neubau des größten OP-Zentrums<br />
Europas<br />
Klinikum <strong>der</strong> Ludwig-Maximilian-Universität München<br />
(LMU), Campus Großha<strong>der</strong>n<br />
Cornelia Breitzke, Johann Lechner<br />
Wohnheim für ältere Menschen mit Behin<strong>der</strong>ung in<br />
Mellrichstadt/Unterfranken<br />
Demographie und aktuelle Bedürfnisse<br />
Karin Sandeck, Oliver Seischab<br />
Wohnen in allen Lebensphasen<br />
Umgestaltung des Wohnblocks am Ludwigkai in Würzburg<br />
– Die Mischung macht´s!<br />
Andreas-Michael Buchner, Michael Schätzl<br />
Ortsumgehung Zimmern, Stadt Pappenheim<br />
Hubert Koch<br />
Der neue Winterdienstkoffer<br />
Von <strong>der</strong> Wetterprognose zur Echtzeitdarstellung<br />
Hubertus Wambsganz<br />
Neue Normenreihe DIN 18008 „Glas im Bauwesen –<br />
Bemessungs- und Konstruktionsregeln“<br />
Informationen zu den Normen DIN 18008 Teil 1 bis Teil 5<br />
Personalien<br />
Druck<br />
Gebr. Geiselberger GmbH,<br />
Martin-Moser-Straße 23, 84503 Altötting<br />
bau intern November/Dezember 2013 3
Grußwort zum Jahreswechsel 2013/2014<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
die Oberste Baubehörde geht gestärkt<br />
aus <strong>der</strong> Neuordnung <strong>der</strong> Ministerien<br />
hervor. Alle Zuständigkeiten für<br />
den Verkehr wurden in <strong>der</strong> Obersten<br />
Baubehörde im <strong>Bayerischen</strong> Staatsministerium<br />
des Innern, für Bau und Verkehr<br />
gebündelt. Jetzt sind wir neben<br />
<strong>der</strong> Straße auch für die Verkehrsträger<br />
Schiene, Wasser und Luft verantwortlich.<br />
Der Umsatz <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />
wird sich durch den Aufgabenzuwachs<br />
im Bereich Verkehr um 1,3<br />
Milliarden Euro erhöhen.<br />
Im Mai und Juni dieses Jahres<br />
hat das Hochwasser in vielen Teilen<br />
Bayerns große Schäden auch an <strong>der</strong><br />
Infrastruktur hinterlassen. Die <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />
hat hier sehr schnell<br />
und professionell dafür gesorgt, dass<br />
die Schäden an Verkehrswegen und<br />
staatlichen Gebäuden beseitigt werden,<br />
und auch die För<strong>der</strong>mittel für Bürger<br />
und Kommunen schnell und unbürokratisch<br />
verteilt werden. Ich danke<br />
Ihnen für die geleistete Arbeit, die bei<br />
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
weit über die normale Arbeitszeit<br />
hinausging.<br />
Ministerpräsident Seehofer hat<br />
seine Regierungserklärung unter das<br />
Motto „Bayern. Die Zukunft“ gestellt<br />
und darin die Weichen für die nächsten<br />
Jahre gestellt. Die Zukunft Bayerns<br />
gestalten auch Sie, liebe Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter in <strong>der</strong><br />
<strong>Staatsbauverwaltung</strong> mit. In <strong>der</strong> Regierungserklärung<br />
sind viele Themen<br />
angesprochen, die wir als <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />
gemeinsam mit unseren<br />
Partnern umsetzen werden. Dies sind<br />
unter an<strong>der</strong>em die Erschließung <strong>der</strong><br />
ländlichen Räume und <strong>der</strong> Ballungsräume,<br />
die Sanierung <strong>der</strong> Straßen und<br />
Schienenwege, <strong>der</strong> barrierefreie Ausbau<br />
<strong>der</strong> öffentlichen Räume, <strong>der</strong> soziale<br />
Wohnungsbau und die För<strong>der</strong>ung<br />
von Studentenwohnungen sowie die<br />
energetische Sanierung öffentlicher<br />
Gebäude.<br />
Mit Ihren Ideen, mit Ihrem Engagement<br />
und Ihrer Leistungsbereitschaft<br />
prägen und arbeiten Sie mit<br />
an <strong>der</strong> Zukunft unseres Landes. Dafür<br />
danken wir allen Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern an den Straßen- und<br />
Autobahnmeistereien, Staatlichen<br />
Bauämtern, Autobahndirektionen, an<br />
<strong>der</strong> Landesbaudirektion, den Regierungen<br />
und an <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />
und sprechen Ihnen unsere Anerkennung<br />
aus.<br />
Wir wünschen Ihnen und Ihren<br />
Familien ein frohes und gesegnetes<br />
Weihnachtsfest und für das neue Jahr<br />
alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.<br />
Joachim Herrmann, MdL<br />
Staatsminister<br />
Gerhard Eck, MdL<br />
Staatssekretär<br />
4 bau intern November/Dezember 2013
Jahresrückblick<br />
Ministerialdirektor Josef Poxleitner<br />
Leiter <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />
<strong>der</strong>ung und <strong>der</strong> gesamte Luftverkehr<br />
gehören jetzt ebenfalls zu unserem<br />
Aufgabenspektrum.<br />
Seit die Verkehrsabteilung in <strong>der</strong><br />
Obersten Baubehörde ressortiert,<br />
arbeiten wir schon intensiv an wichtigen<br />
Projekten, wie etwa die Zweite<br />
S-Bahnstammstrecke. Es kommen<br />
viele neue Herausfor<strong>der</strong>ungen auf uns<br />
zu, die wir gemeinsam bewältigen<br />
werden. Ich begrüße die neuen Kolleginnen<br />
und Kollegen sehr herzlich und<br />
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.<br />
Bahnknoten München – 2. Stammstrecke<br />
Die Metropolregion München zählt<br />
zu den großen Wachstumsregionen<br />
in Deutschland mit steigenden Mobilitätsbedürfnissen.<br />
Allein die Münchner<br />
S-Bahn beför<strong>der</strong>t heute schon<br />
über 800.000 Fahrgäste täglich. Der<br />
Erfolg bringt das S-Bahnsystem aber<br />
auch an seine Leistungsgrenzen.<br />
Die Bayerische Staatsregierung hat<br />
daher Anfang 2010 ein Gesamtkonzept<br />
für den Bahnknoten München<br />
beschlossen. Zentrales Element bildet<br />
die 2. Stammstrecke. Im Rahmen<br />
Abteilung Verkehr in <strong>der</strong> Obersten<br />
Baubehörde<br />
Im Zuge <strong>der</strong> Kabinettsneubildung<br />
nach <strong>der</strong> Landtagswahl in Bayern am<br />
15. September 2013 wurden alle Themen<br />
des Verkehrs unter dem Dach<br />
des <strong>Bayerischen</strong> Staatsminsteriums<br />
des Innern, für Bau und Verkehr zusammengefasst.<br />
Die Verkehrsabteilung<br />
des früheren Staatsministeriums<br />
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr<br />
und Technologie ist nun in <strong>der</strong> Obersten<br />
Baubehörde angesiedelt. Dadurch<br />
hat sich <strong>der</strong> Aufgabenzuschnitt<br />
deutlich erweitert. Zusätzlich zu den<br />
zahlreichen Themen des Straßen- und<br />
Brückenbaus sind jetzt auch die Angelegenheiten<br />
des Eisenbahnwesens,<br />
des öffentlichen Personennahverkehrs,<br />
<strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong> Häfen, des<br />
Verkehrswasserbaus und <strong>der</strong> Schifffahrt<br />
in <strong>der</strong> Obersten Baubehörde gebündelt.<br />
Der gewerbliche Straßenpersonen-<br />
und Straßengüterverkehr, das<br />
Seilbahnwesen, die Gefahrgutbeförumfangreicher<br />
Untersuchungen hat<br />
sich <strong>der</strong> 2. S-Bahn-Tunnel als die beste<br />
Lösung herauskristallisiert, um <strong>der</strong><br />
wachsenden Mobilität auf ökologisch<br />
sinnvolle Weise gerecht zu werden.<br />
Mit seiner Realisierung lassen sich<br />
sofort Verbesserungen im S-Bahnnetz<br />
erzielen. Weitere Maßnahmen<br />
des Bahnknoten-Konzeptes, wie die<br />
schnelle Anbindung <strong>der</strong> S-Bahn-Außenäste<br />
und des Flughafens, bauen auf<br />
<strong>der</strong> 2. Stammstrecke auf und können<br />
nur mit ihr die volle verkehrliche Wirkung<br />
entfalten.<br />
Schwerpunkte im Staatlichen<br />
<strong>Hochbau</strong><br />
Mit fast einer Milliarde Euro finanziert<br />
<strong>der</strong> Freistaat Bayern den Strukturwandel<br />
und die Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> bayerischen<br />
Universitätsklinika. Dabei kann<br />
er auf die Kompetenz <strong>der</strong> Staatlichen<br />
<strong>Hochbau</strong>verwaltung bauen. In Großha<strong>der</strong>n<br />
entsteht für 167 Mio. Euro<br />
Europas größtes OP-Zentrum mit 36<br />
Operationssälen. Am Münchner Klinikum<br />
Rechts <strong>der</strong> Isar rollen seit diesem<br />
Jahr ebenfalls die Bagger. Hier<br />
wird für 44 Mio. Euro ein chirurgischer<br />
Funktionstrakt gebaut, <strong>der</strong> die Be<br />
Die S-Bahnlinie S 8 und die Bundesstraße B 301 bei Hallbergmoos.<br />
bau intern November/Dezember 2013 5
triebsabläufe für Ärzte, Personal und<br />
Patienten optimieren soll. Das jüngste<br />
Beispiel, <strong>der</strong> Wettbewerb für den Neubau<br />
Operatives Zentrum am Klinikum<br />
<strong>der</strong> Universität Erlangen, wurde Anfang<br />
des Jahres in <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />
ausgestellt. Zusammen mit<br />
dem im Juli in Betrieb gegangenen<br />
chirurgischen Bettenhaus werden am<br />
Standort Erlangen 228 Mio. Euro investiert.<br />
In Würzburg sind in den letzten<br />
Jahren 16 mo<strong>der</strong>ne Operationssäle<br />
für 125 Mio. Euro errichtet worden.<br />
Mit dem geplanten Neubau <strong>der</strong> Kopfklinik<br />
warten dort 14 weitere OP´s für<br />
125 Mio. Euro auf den offiziellen Startschuss.<br />
Das „Neue Hauner“ (Mutter-<br />
Kind-Zentrum) für 160 Mio. Euro soll<br />
in Kürze die universitäre Kin<strong>der</strong>medizin<br />
in München von Grund auf mo<strong>der</strong>nisieren.<br />
Die Projektverantwortung bei all<br />
diesen Bauvorhaben liegt in den kompetenten<br />
Händen <strong>der</strong> Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter an den Bauämtern, die<br />
diese komplexen Aufgaben im Zusammenspiel<br />
mit freiberuflichen Partnern<br />
abwickeln.<br />
Fachkompetenz auf Bauherrenseite<br />
ist dabei unerlässlich. Für den Erhalt<br />
unserer Fachkompetenz setzen wir<br />
daher wie<strong>der</strong> verstärkt auf Eigenplanungen.<br />
Und das mit Erfolg, denn die<br />
Eigenplanungen <strong>der</strong> Kolleginnen und<br />
Kollegen können sich sehen lassen.<br />
Ein gelungenes Beispiel ist das „Haus<br />
<strong>der</strong> Berge“, ein Informations- und Bildungszentrum<br />
für den Nationalpark<br />
Berchtesgaden, das im Mai dieses<br />
Jahres eröffnet wurde. Es wurde von<br />
den Kollegen des Staatlichen Bauamts<br />
Traunstein geplant.<br />
Investitionen in die Straßeninfrastruktur<br />
Für die Bundesfernstraßen standen<br />
2013 wie im Vorjahr 1,1 Milliarden<br />
Euro zur Verfügung. Der Schwerpunkt<br />
<strong>der</strong> Investitionen lag auf <strong>der</strong><br />
A 3 zwischen Aschaffenburg und<br />
Würzburg sowie auf <strong>der</strong> A 94 zwischen<br />
München und Pocking. Die neu<br />
gebaute Sinntalbrücke <strong>der</strong> A 7 konnte<br />
dem Verkehr übergeben werden. Daneben<br />
wurden wichtige Projekte an<br />
Bundesstraßen fertiggestellt, wie <strong>der</strong><br />
Neubau <strong>der</strong> B 301 zwischen Fischerhäuser<br />
und Hallbergmoos als Zubringer<br />
zum Flughafen München und die<br />
B 15n zwischen Neufahrn und Ergoldsbach<br />
fertiggestellt.<br />
Im Staatsstraßenbau standen 2013<br />
Realisierungswettbewerb Universitätsklinikum Erlangen, Neubau Operatives Zentrum, 1. Preis Architekten gmp<br />
Generalplanungsgesellschaft mbH, Aachen<br />
ZWOPA-Sanierung <strong>der</strong> A 8 nördlich von München<br />
Sechsstreifiger Ausbau <strong>der</strong> A 8 zwischen Ulm und Augsburg im Rahmen des zweiten Betreibermodells auf Autobahnen<br />
in Bayern<br />
6 bau intern November/Dezember 2013
insgesamt 215 Mio. Euro für Investitionen<br />
zur Verfügung. Über das För<strong>der</strong>programm<br />
nach Art.13f FAG zum Bau<br />
von Staatsstraßenumfahrungen in gemeindlicher<br />
Son<strong>der</strong>baulaust, wurden<br />
rund 30 Mio. Euro investiert. Darin enthalten<br />
sind auch Radwege an Staatsstraßen<br />
und <strong>der</strong> Umbau von bestehenden<br />
Kreuzungen an Staatsstraßen.<br />
Baustellenmanagement<br />
Die Erhaltung <strong>der</strong> Straßeninfrastruktur<br />
spielt eine immer wichtigere<br />
Rolle. 2013 wurde sowohl bei den<br />
Staatsstraßen als auch bei den Bundesfernstraßen<br />
erheblich mehr in die<br />
Bestan<strong>der</strong>haltung als in den Ausbau<br />
bzw. Neubau investiert.<br />
Dies schlägt sich in einer Vielzahl<br />
von Baustellen bei laufendem Verkehr<br />
B 301, Verkehrsfreigabe Isarparallele<br />
nie<strong>der</strong>. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen<br />
möglichst gering zu halten,<br />
haben wir das Baustellenmanagement<br />
optimiert und erstmals eine erweiterte<br />
bayernweite Koordination <strong>der</strong> Baustellen<br />
durchgeführt.<br />
Projekte <strong>der</strong> Öffentlich-privaten<br />
Partnerschaft (ÖPP)<br />
Der sechsstreifige Ausbau <strong>der</strong> A 8<br />
zwischen Ulm und Augsburg im Rahmen<br />
des zweiten Betreibermodells<br />
auf Autobahnen in Bayern schreitet<br />
zügig voran. Zwischen Augsburg-<br />
West und Zus marshausen fließt seit<br />
Juli 2013 <strong>der</strong> Verkehr auf <strong>der</strong> neu gebauten<br />
Richtungsfahrbahn. Für das<br />
neue dritte Betreibermodell in Bayern<br />
auf <strong>der</strong> A 94 zwischen Forstinning und<br />
Marktl wurde das europaweite Vergabeverfahren<br />
gestartet. Die Umsetzung<br />
soll als „Verfügbarkeitsmodell“<br />
erfolgen. Die Vergütung erfolgt dabei<br />
in Abhängigkeit von <strong>der</strong> uneingeschränkten<br />
Verfügbarkeit <strong>der</strong> Strecke<br />
und <strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong> Leistungen des<br />
Auftraggebers.<br />
Verkehrssicherheitsprogramm<br />
2020<br />
Am 4. Januar 2013 hat Herr Staatsminister<br />
Joachim Herrmann das bayerische<br />
Verkehrssicherheitsprogramm<br />
2020 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“<br />
vorgestellt. Wichtigstes Ziel ist es, bis<br />
zum Jahr 2020 die Zahl <strong>der</strong> Verkehrstoten<br />
um 30% zu senken.<br />
Das Verkehrssicherheitsprogramm<br />
umfasst die Bereiche:<br />
1. Information, Verkehrssteuerung und<br />
Fahrzeugausstattung<br />
2. Wahrnehmung und Wahrnehmbarkeit<br />
3. Infrastruktur und Verkehrsraumgestaltung<br />
4. Recht und Überwachung.<br />
Für die bauliche und verkehrstechnische<br />
Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms<br />
(Bereiche 2 und<br />
3) sollen bis ins Jahr 2020 440 Mio.<br />
Euro investiert werden.<br />
Hochwasser im Mai und Juni<br />
Das Hochwasser im Mai und Juni dieses<br />
Jahres for<strong>der</strong>te in vielen Regionen<br />
Bayerns in beson<strong>der</strong>em Maße<br />
den Einsatz <strong>der</strong> Kolleginnen und Kollegen<br />
<strong>der</strong> <strong>Staatsbauverwaltung</strong>. So waren<br />
wichtige Verkehrsachsen wie die<br />
A 3 bei Passau und Abschnitte <strong>der</strong> A 8<br />
zwischen Rosenheim und <strong>der</strong> Landesgrenze<br />
überflutet. Beson<strong>der</strong>s hart traf<br />
es das Staatliche Bauamt Passau, wo<br />
das eigene Bauamt und auch viele Gebäude<br />
<strong>der</strong> Universität und <strong>der</strong> Hochschule<br />
schwer betroffen waren. Allen,<br />
die sich am Kampf gegen die Fluten<br />
und ihre Folgen eingesetzt haben, gilt<br />
mein herzlicher Dank und Respekt.<br />
Mit Ihrem außerordentlichen Einsatz<br />
vor Ort haben Sie gezeigt, dass die<br />
<strong>Staatsbauverwaltung</strong> gerade in Krisenzeiten<br />
ein funktionieren<strong>der</strong> und<br />
verlässlicher Partner ist.<br />
Erneuerbare Energien<br />
Der Ausbau <strong>der</strong> erneuerbaren Energien<br />
kommt in Bayern mit deutlichen<br />
Zuwachsraten voran. Im Jahr 2012<br />
wurden ca. 18% des Endenergieverbrauchs<br />
in den Sektoren Strom, Wärme<br />
und Kraftstoffe durch erneuerbare<br />
Energien gedeckt. Ihr Anteil am<br />
Stromverbrauch beläuft sich mittlerweile<br />
auf über 30%. Mehr als die Hälfte<br />
<strong>der</strong> neuen Wohngebäude in Bay ern<br />
wird mit erneuerbaren Energien für<br />
Heizung und Warmwasserbereitstellung<br />
als primären Energieträgern geplant.<br />
Energieeinsparverordnung (EnEV)<br />
Am 18. Juni 2010 wurde die Richtlinie<br />
2010/31/EU des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates über die<br />
Gesamt energieeffizienz von Gebäuden<br />
veröffentlicht. Die Bundesregierung<br />
hat zur Umsetzung <strong>der</strong> Richtlinie<br />
in nationales Recht das Energieeinsparungsgesetz<br />
geän<strong>der</strong>t und am<br />
16. Oktober 2013 <strong>der</strong> Novellierung<br />
<strong>der</strong> Energieeinsparverordnung zugestimmt.<br />
Die Regelungen werden am<br />
1. Mai 2014 in Kraft treten. Die Oberste<br />
Baubehörde hat die Län<strong>der</strong>interessen<br />
während des Gesetzgebungsverfahrens<br />
koordiniert. Bayern hat sich<br />
dabei stets für technisch umsetzbare<br />
Regelungen eingesetzt, die das Gebot<br />
<strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit beachten<br />
und ohne unnötigen bürokratischen<br />
Aufwand vollzogen werden können.<br />
Lei<strong>der</strong> hat <strong>der</strong> Antrag Bayerns, die Anhebung<br />
<strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen an Wohnungsneubauten<br />
auf ein wirtschaftlich<br />
vertretbares Maß von einmalig 12,5%<br />
zu beschränken, im Bundesrat keine<br />
Windpark Büchenbach: Der rechte Turm zeigt den dynamisch<br />
hoch beanspruchten Übergangsbereich zwischen<br />
Stahlturm und Betonringfundament für den ein<br />
ultrahochfester Beton mit Zustimmung im Einzelfall<br />
zum Einsatz kam.<br />
bau intern November/Dezember 2013 7
Mehrheit gefunden. Es ist zu hoffen,<br />
dass die jetzt beschlossenen Standards<br />
den dringend benötigten Neubau<br />
von Wohnungen nicht beeinträchtigen.<br />
Bautechnik<br />
Windkraftanlagen sind hoch beanspruchte<br />
Bauwerke und werden für<br />
eine Nutzungsdauer von ca. 20 Jahren<br />
geplant und errichtet. Sie erreichen<br />
mit innovativen Bauweisen und Baustoffen,<br />
die in <strong>der</strong> Regel einer Zustimmung<br />
im Einzelfall nach Art. 18 und<br />
19 BayBO bedürfen, inzwischen Nabenhöhen<br />
von bis zu 150 m. Der bautechnische<br />
Fortschritt einhergehend<br />
mit <strong>der</strong> zunehmenden Errichtung<br />
von Windkraftanlagen führte daher<br />
zwangsläufig zu einem neuen Aufgabenschwerpunkt<br />
innerhalb <strong>der</strong> Bautechnik<br />
an <strong>der</strong> Obersten Baubehörde.<br />
Zustimmungen im Einzelfall wurden<br />
insbeson<strong>der</strong>e für Son<strong>der</strong>betone, ultrahochfeste<br />
Betone und Spannverfahren<br />
beantragt.<br />
Landesentwicklungsprogramm<br />
Bayern<br />
Die umfassende Reform <strong>der</strong> Landesund<br />
Regionalplanung wurde mit In-<br />
Kraft-Treten des Landesentwicklungsprogramms<br />
Bayern (LEP 2013) am<br />
1. September 2013 abgeschlossen.<br />
Die Regelungsinhalte wurden gestrafft<br />
und auf aktuelle räumliche<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen wie den demographischen<br />
Wandel fokussiert. Das<br />
Anbindungsziel, das <strong>der</strong> Vermeidung<br />
einer Zersiedelung <strong>der</strong> Landschaft<br />
dient, wurde beibehalten. Vor dem<br />
Hintergrund konträrer Interessen und<br />
spezifischer Anfor<strong>der</strong>ungen vor Ort<br />
wurden von politischer Seite mehrere<br />
Ausnahmemöglichkeiten vorgesehen.<br />
Die Gemeinden erhalten somit<br />
mehr Gestaltungsspielraum, zugleich<br />
aber eine höhere Verantwortung. In<br />
Folge des neuen LEP wurde die Zuständigkeit<br />
für die Genehmigung von<br />
Flächennutzungsplänen fast vollständig<br />
auf die Landratsämter übertragen.<br />
Barrierefreiheit<br />
In <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong> Bauordnung sind<br />
die Weichen zum barrierefreien Bauen<br />
seit langem gestellt: Beim Bau von öffentlich<br />
zugänglichen Gebäuden wird<br />
Barrierefreiheit seit 1974, beim Bau<br />
von Wohnungen seit 2003 gefor<strong>der</strong>t.<br />
Um diese grundsätzliche Anfor<strong>der</strong>ung<br />
zu konkretisieren, haben wir die neue<br />
Experimenteller Wohnungsbau: Erstes fertiggestelltes Pilotprojekt aus dem Modellvorhaben „IQ-Innerstädtische<br />
Wohnquartiere“ in Königsbrunn bei Augsburg. Foto: Karin Sandeck<br />
Nach DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“ abzusichern<strong>der</strong><br />
Bereich einer frei im Raum liegenden Treppe<br />
DIN 18040, Planungsnorm für barrierefreie<br />
Gebäude, mit Wirkung zum<br />
1. Juli 2013 als Technische Baubestimmung<br />
bauaufsichtlich eingeführt. Damit<br />
gelten einheitliche, verbindliche<br />
technische Standards, die niemanden<br />
wirtschaftlich überfor<strong>der</strong>n, aber gesamtgesellschaftlich<br />
von großem Nutzen<br />
sind.<br />
Wohnraumför<strong>der</strong>ung<br />
Im März 2013 beschloss <strong>der</strong> Ministerrat<br />
ein Bündel von Maßnahmen<br />
zur Ankurbelung des Wohnungsbaus<br />
sowie zum Erhalt bezahlbaren<br />
Wohnraums. Damit sollen in den Ballungsräumen<br />
Engpässe bei <strong>der</strong> Wohnraumversorgung<br />
beseitigt und <strong>der</strong><br />
ländliche Raum in seiner Funktion als<br />
Wohnstandort gestärkt werden. Über<br />
den Nachtragshaushalt 2014 soll für<br />
die Wohnraumför<strong>der</strong>ung zusätzlich ein<br />
Bewilligungsrahmen von 50 Mio. Euro<br />
sowie für die Studentenwohnraumför<strong>der</strong>ung<br />
von 10 Mio. Euro bereitgestellt<br />
werden. Damit können zusätzlich<br />
rund 500 Mietwohnungen sowie<br />
400 Wohnplätze für Studierende geför<strong>der</strong>t<br />
werden. Gleichzeitig wurden<br />
die För<strong>der</strong>konditionen für die Studentenwohnraumför<strong>der</strong>ung<br />
deutlich verbessert.<br />
Zusammen mit den bisher im Doppelhaushalt<br />
2013/2014 eingestellten<br />
Bewilligungsrahmen in Höhe von 420<br />
Mio. Euro für die Wohnraumför<strong>der</strong>ung<br />
sowie 35 Mio. Euro für die Studentenwohnraumför<strong>der</strong>ung<br />
summiert sich<br />
das Mittelvolumen damit auf über eine<br />
halbe Milliarde Euro.<br />
Experimenteller Wohnungsbau<br />
Bei den im Rahmen des Experimentellen<br />
Wohnungsbaus initiierten<br />
„Wohnmodellen Bayern“ standen<br />
Wohnungsbaumaßnahmen zur Bewältigung<br />
des demographischen Wandels<br />
und des Klimawandels im Blickpunkt.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e haben wir die Pilotprojekte<br />
<strong>der</strong> Modellvorhaben „IQ – Innerstädtische<br />
Wohnquartiere“ und „e%<br />
– Energieeffizienter Wohnungsbau“<br />
fortgeführt. Bei den IQ-Projekten geht<br />
es um den Anschub von beson<strong>der</strong>s familien-<br />
und kindgerechtem Wohnraum<br />
mitten in <strong>der</strong> Stadt; die e%-Maßnahmen<br />
zeigen vielfältige Konzepte zum<br />
energiesparenden, ressourcenschonenden<br />
und gleichzeitig wirtschaftlichen<br />
Wohnungsbau im Neubau und<br />
in <strong>der</strong> Bestandsmo<strong>der</strong>nisierung.<br />
Städtebauför<strong>der</strong>ung<br />
Für die Städtebauför<strong>der</strong>ung konnte<br />
das jährliche För<strong>der</strong>mittelvolumen<br />
in Bayern auf hohem Niveau gehalten<br />
werden. 2013 standen 150 Mio.<br />
Euro För<strong>der</strong>gel<strong>der</strong> zur Verfügung. Davon<br />
stellte <strong>der</strong> Bund 45 Mio. Euro, die<br />
Europäische Union 9 Mio. Euro und<br />
8 bau intern November/Dezember 2013
<strong>der</strong> Freistaat den Löwenanteil von 96<br />
Mio. Euro. Mit Hilfe <strong>der</strong> bayerischen<br />
Städtebauför<strong>der</strong>ungsmittel können<br />
beson<strong>der</strong>s strukturschwache Städte<br />
und Gemeinden unterstützt werden.<br />
Kommunen, die den gefor<strong>der</strong>ten kommunalen<br />
Eigenanteil nur in geringem<br />
Umfang aufbringen können, werden<br />
durch die Möglichkeit, den För<strong>der</strong>satz<br />
auf bis zu 80 % anzuheben, beson<strong>der</strong>s<br />
unterstützt. Der ländliche Raum<br />
profitiert mit einem Anteil von 78 %<br />
<strong>der</strong> För<strong>der</strong>mittel am stärksten von <strong>der</strong><br />
Städtebauför<strong>der</strong>ung. Dies belegt eindrucksvoll<br />
die strukturpolitische Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Städtebauför<strong>der</strong>ung.<br />
2013 wurden rund 700 Städte,<br />
Märkte und Gemeinden in Bayern von<br />
<strong>der</strong> Städtebauför<strong>der</strong>ung unterstützt.<br />
Gemeinsam mit dem kommunalen<br />
Anteil beliefen sich die Investitionen<br />
<strong>der</strong> öffentlichen Hand und <strong>der</strong> dadurch<br />
ausgelösten privaten Investitionen auf<br />
rund 1,2 Mrd. Euro.<br />
Bayerische Kompensationsverordnung<br />
Das neue Bayerische Naturschutzgesetz<br />
hat die Möglichkeit geschaffen,<br />
mit einer Kompensationsverordnung<br />
Einzelheiten <strong>der</strong> Eingriffsregelung näher<br />
zu bestimmen. Die Bayerische<br />
Staatsregierung hat von dieser Möglichkeit<br />
Gebrauch gemacht und am<br />
7. August 2013 nach intensiver Beteiligung<br />
<strong>der</strong> Obersten Baubehörde und<br />
zahlreichen Än<strong>der</strong>ungen eine Bayerische<br />
Kompensationsverordnung<br />
(BayKompV) beschlossen. Sie enthält<br />
umfangreiche Regelungen zur<br />
Bestimmung <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Kompensation<br />
(Ausgleich und Ersatz), zur<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> agrarstrukturellen<br />
Belange sowie zur Sicherung<br />
und Unterhaltung <strong>der</strong> Kompensationsmaßnahmen.<br />
Außerdem wird das<br />
neue Instrument Ökokonto, mit dem<br />
Kompensationsmaßnahmen für eine<br />
spätere Verwendung bevorratet werden<br />
können, etabliert. Dabei konnten<br />
wir erreichen, dass keine überzogenen<br />
naturschutzrechtlichen und<br />
fachlichen Standards eingeführt wurden.<br />
Die BayKompV berührt zentrale<br />
Aufgabenfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Landschaftsplanung<br />
in <strong>der</strong> <strong>Staatsbauverwaltung</strong> und<br />
führt zu zahlreichen und umfassenden<br />
Än<strong>der</strong>ungen bei <strong>der</strong> Bearbeitung <strong>der</strong><br />
Landschaftspflegerischen Begleitplanung.<br />
Mit Schulungen und Arbeitshilfen<br />
unterstützen wir das Fachpersonal<br />
<strong>der</strong> Bauämter als auch bei den Landschaftsplanungsbüros<br />
bei <strong>der</strong> Einarbeitung<br />
in die neuen Verfahren, damit<br />
laufende Planungen nicht verzögert<br />
werden.<br />
10 Jahre Vergabeplattform <strong>der</strong><br />
bayerischen <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />
Seit 2003 führt die Bayerische <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />
alle Vergabeverfahren<br />
elektronisch mit www.vergabe.bayern.de<br />
durch. Die unterschiedlichen<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Vergabestellen<br />
und Bieter haben wir bei <strong>der</strong> Weiterentwicklung<br />
<strong>der</strong> Anwendung berücksichtigt<br />
und umgesetzt. Schnittstellen<br />
zu an<strong>der</strong>en standardisierten Anwendungen<br />
wurden geschaffen.<br />
Das mittelfristige Ziel einer Umstellung<br />
auf die zwingende elektronische<br />
Angebotsabgabe wollen wir Schritt für<br />
Schritt erreichen: Wir versenden die<br />
Vergabeunterlagen seit dem 1. Januar<br />
2010 nur noch über die Vergabeplattform<br />
und nicht mehr in Papierform. Bei<br />
Vergabeverfahren oberhalb <strong>der</strong> EU-<br />
Schwellenwerte und einem geschätzten<br />
Auftragswert größer 100.000 Euro<br />
lassen wir seit 1. Oktober 2013 nur<br />
mehr digitale Angebote zu. Bei nationalen<br />
Verfahren und EU-Verfahren bis<br />
100.000 Euro haben die Bieter noch<br />
ein Wahlrecht zwischen <strong>der</strong> schriftlichen<br />
und elektronischen Angebotsabgabe.<br />
Wir haben mit zahlreichen Informationsveranstaltungen<br />
mit den<br />
Verbänden <strong>der</strong> bayerischen Bauwirtschaft<br />
und Schulungsinitiativen für<br />
Auftragnehmer und Auftraggeber die<br />
Akzeptanz <strong>der</strong> Vergabeplattform vorangetrieben.<br />
Im Januar 2012 wurde<br />
die Vergabeplattform für sonstige öffentliche<br />
Auftraggeber in Bayern geöffnet.<br />
Die Stadt Ingolstadt ist Ende<br />
August 2013 als zehnter sonstiger<br />
Auftraggeber unserer Plattform beigetreten.<br />
Für die ausgezeichnete Arbeit<br />
und den großartigen Einsatz im<br />
vergangenen Jahr bedanke ich<br />
mich bei allen Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern <strong>der</strong> Autobahnund<br />
Straßenmeistereien, <strong>der</strong><br />
Bauämter, <strong>der</strong> Autobahndirektionen,<br />
<strong>der</strong> Landesbaudirektion,<br />
<strong>der</strong> Regierungen und <strong>der</strong> Obersten<br />
Baubehörde.<br />
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien<br />
ein frohes Weihnachtsfest,<br />
erholsame Feiertage und ein<br />
gutes neues Jahr.<br />
Städtebauför<strong>der</strong>ung: Einweihung und Eröffnung des Bürgerhauses und <strong>der</strong> Bücherei in <strong>der</strong> neuen Ortsmitte von<br />
Litzendorf am 23.09.2012 unter an<strong>der</strong>em mit Herrn Staatsminister Herrmann, MdL und Frau Staatssekretärin Melanie<br />
Huml. Foto: Edith Obrusnikohne<br />
bau intern November/Dezember 2013 9
Auftakt zur neuen EU-<br />
För<strong>der</strong>periode 2014-2020<br />
im Europäischen Fonds<br />
für regionale Entwicklung<br />
(EFRE)<br />
Franz Langlechner, Dr.-Ing. Josef<br />
Rott<br />
Auffor<strong>der</strong>ung an Kommunen zur<br />
gemeinsamen Abgabe von Interessensbekundungen<br />
Derzeit sind in Bayern insbeson<strong>der</strong>e<br />
die Kommunen aus den beson<strong>der</strong>s<br />
vom demographischen und<br />
wirtschaftsstrukturellen Wandel betroffenen<br />
Gebieten aufgefor<strong>der</strong>t, sich<br />
mit spezifischen örtlichen Problemanalysen<br />
und interkommunalen Handlungsansätzen<br />
um eine För<strong>der</strong>ung<br />
aus <strong>der</strong> EU-Strukturfondsför<strong>der</strong>ung<br />
2014-2020 zu bewerben. Mit den betroffenen<br />
Räumen sollen nachhaltige,<br />
integrierte Konzepte entwickelt und<br />
umgesetzt werden. Der Aufruf ist Teil<br />
<strong>der</strong> Entwicklung des bayerischen Operationellen<br />
Programms zum EFRE und<br />
zeichnet sich durch eine umfassende<br />
Beteiligung <strong>der</strong> lokalen und regionalen<br />
Ebene aus. Entscheidend ist, dass die<br />
Initiativen aus dem Raum selbst kommen<br />
und so maßgeblich auf dem Freiwilligkeits-<br />
und „Bottom-Up“- Prinzip<br />
basieren.<br />
Der Europäische Überbau – die<br />
EU-Strukturfondsför<strong>der</strong>ung<br />
2014-2020<br />
Die Europäische Union (EU) wird<br />
auch in <strong>der</strong> kommenden Programmplanungsperiode<br />
2014-2020 aus den<br />
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds<br />
(ESI) wie<strong>der</strong> Mittel für Bayern<br />
zur Verfügung stellen. Von den<br />
Struktur- und Investitionsfonds <strong>der</strong><br />
EU können die Kommunen bei ihrer<br />
Orts- und Stadtentwicklung vor allem<br />
aus dem Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung (EFRE) unterstützt<br />
werden. Da dieser Fonds teilweise<br />
von <strong>der</strong> Obersten Baubehörde, Sachgebiet<br />
Städtebauför<strong>der</strong>ung, begleitet<br />
wird (die Fe<strong>der</strong>führung <strong>der</strong> Mittelabwicklung<br />
und <strong>der</strong> Kommunikation<br />
mit den weiteren nationalen und europäischen<br />
Gremien liegt beim <strong>Bayerischen</strong><br />
Wirtschaftsministerium) soll<br />
im vorliegenden Artikel vorwiegend<br />
auf den EFRE eingegangen werden.<br />
Weitere Fonds <strong>der</strong> EU-Strukturfondsför<strong>der</strong>ung<br />
sind <strong>der</strong> Europäische Sozialfonds<br />
(ESF), <strong>der</strong> Kohäsionsfonds (KF),<br />
<strong>der</strong> Europäische Landwirtschaftsfonds<br />
für die Entwicklung des ländlichen<br />
Raums (ELER) und <strong>der</strong> Europäische<br />
Meeres- und Fischereifonds<br />
(EMMF).<br />
Der Europäische Rat hat Schlussfolgerungen<br />
aus den bisherigen För<strong>der</strong>phasen<br />
und den Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />
beteiligten Nationen gezogen und im<br />
Oktober 2010 eine Europa 2020-Strategie<br />
mit dem übergeordneten Ziel<br />
eines intelligenten, nachhaltigen und<br />
integrativen Wachstums vorgestellt.<br />
Dieses Ziel soll durch Investitionen<br />
in Bildung, Forschung und Entwicklung<br />
(intelligentes Wachstum), eine<br />
entschlossene Ausrichtung auf eine<br />
kohlenstoffarme Wirtschaft und eine<br />
wettbewerbsfähige Industrie (nachhaltiges<br />
Wachstum) sowie die vorrangige<br />
Schaffung von Arbeitsplätzen und die<br />
Bekämpfung von Armut (integratives<br />
BIP pro Kopf (EU-27=100)<br />
< 50<br />
50-70<br />
75-90<br />
90-100<br />
100-125<br />
> 125<br />
För<strong>der</strong>katalog (vorläufig)<br />
Drei Kategorien von Regionen<br />
Weniger entwickelte Regionen<br />
Übergangsregionen<br />
Stärker entwickelte Regionen<br />
Wachstum) erreicht werden. Mit <strong>der</strong><br />
allgemeinen strategischen Ausrichtung<br />
gehen fünf EU-Kernziele einher:<br />
1. Beschäftigung auf ein hohes Niveau<br />
bringen und dort halten<br />
2. Forschung und Entwicklung ausbauen<br />
3. Klimawandel entgegenwirken und<br />
Energieaspekte stärken<br />
4. Bildung ausbauen und sichern<br />
5. Armut und soziale Ausgrenzung<br />
vermin<strong>der</strong>n.<br />
Die Umsetzung <strong>der</strong> europäischen<br />
2020-Kernziele ist unter Berücksichtigung,<br />
insbeson<strong>der</strong>e von Län<strong>der</strong>konzepten,<br />
in einem Nationalen Reformprogramm<br />
(NRP) vorzubereiten. Ein<br />
Entwurf zum “Nationalen Reformprogramm<br />
2013” wurde im April 2013<br />
durch die Bundesregierung vorgelegt.<br />
Der Bund bekräftigt darin zur Umset<br />
Entwicklungsstand und vorläufige För<strong>der</strong>kategorien <strong>der</strong> EU-Län<strong>der</strong>, Durchschnitt 2006-2008,<br />
Quelle: Europäische Kommission (2012a)<br />
10 bau intern November/Dezember 2013
Saarland Rheinland-Pfalz<br />
Saarland<br />
Schleswig-Holstein<br />
Schleswig-Holstein<br />
Hamburg<br />
Hamburg<br />
Bremen Lüneburg<br />
Weser-Ems<br />
Bremen<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
Karlsruhe<br />
Baden-Württemberg<br />
Freiburg<br />
Stuttgart<br />
Tübingen<br />
Deutschland<br />
Eligibility simulation 2014-2012, March 2012<br />
GDP/head (PPS), index EU27=100<br />
zung <strong>der</strong> EU-Ziele, an einer wachstumsfreundlichen<br />
Konsolidierung für<br />
Deutschland und Europa festzuhalten,<br />
die Energiewende weiter umzusetzen,<br />
Beschäftigung zu sichern,<br />
Konzepte und Maßnahmen gegen<br />
Fachkräftemangel zu entwickeln, sowie<br />
Bildung und Forschung in erster<br />
Priorität zu halten.<br />
In Ihren Analysen teilt die Europäische<br />
Kommission Regionen in die<br />
Kategorien „weniger entwickelte Regionen“,<br />
„Übergangsregionen“ und<br />
„Stärker entwickelte Regionen“ (siehe<br />
Abb.1) ein. Wobei für Deutschland lediglich<br />
die Kategorien „Übergangsregionen“<br />
und „Stärker entwickelte Regionen“<br />
festgestellt werden (s. Abb.<br />
2). Aber auch in Deutschland gibt es<br />
Schwaben<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Bayern<br />
Oberbayern<br />
Brandenburg<br />
Berlin<br />
Berlin<br />
Hannover<br />
Münster<br />
Brandenburg-Südwest<br />
Detmold<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Braunschweig<br />
Düsseldorf<br />
Leipzig<br />
Arnsberg<br />
Dresden<br />
Sachsen<br />
Kassel<br />
Thüringen<br />
Köln<br />
Thüringen<br />
Chemnitz<br />
Gießen<br />
Hessen<br />
Koblenz<br />
Darmstadt<br />
Trier<br />
Rheinland-Pfalz<br />
< 75 (less developed regions)<br />
60- 90 (transition regions)<br />
>= 90 (more developed regions)<br />
Unterfranken<br />
Mittelfranken<br />
Oberfranken<br />
Oberpfalz<br />
Nie<strong>der</strong>bayern<br />
Regional GDP figures: 2007-08-09<br />
Data available March 2012<br />
REGIOgis<br />
0 140 km<br />
© EuroGeographics Association for the administrative boundaries<br />
Vorläufige Einordnung <strong>der</strong> Regionen Deutschlands in die ESI-Fonds Stand: Juli 2012; Quelle: Europäische Kommission<br />
(2012b)<br />
Problemlagen und Handlungserfor<strong>der</strong>nisse,<br />
die auf Grund seiner Größe,<br />
<strong>der</strong> historisch bedingten Entwicklung<br />
und <strong>der</strong> Vielfalt <strong>der</strong> Regionen in den<br />
Regionen unterschiedlich sind. Strukturelle,<br />
wirtschaftliche, soziale und<br />
demographische Unterschiede und<br />
auch gegenläufige Entwicklungstendenzen<br />
zwischen den zentralen und<br />
peripheren Regionen bedingen differenzierte<br />
Entwicklungsstrategien.<br />
Diese Unterschiede werden in einer<br />
Partnerschaftsvereinbarung zwischen<br />
dem Bund, den Län<strong>der</strong>n und <strong>der</strong> Europäischen<br />
Kommission dargelegt.<br />
Mit <strong>der</strong> Partnerschaftsvereinbarung<br />
sollen die im gemeinsamen Strategischen<br />
Rahmen (ESI) dargelegten<br />
Elemente in den nationalen Kontext<br />
übertragen und feste Verpflichtungen<br />
im Hinblick auf die Verwirklichung <strong>der</strong><br />
Ziele <strong>der</strong> Europäischen Union durch<br />
die Programmplanung <strong>der</strong> ESI-Fonds<br />
eingegangen werden. Die Partnerschaftsvereinbarung<br />
ist gleichzeitig<br />
<strong>der</strong> Bezugsrahmen für die Erarbeitung<br />
<strong>der</strong> Operationellen Programme <strong>der</strong><br />
Län<strong>der</strong> und des Bundes. Gegenüber<br />
den zurückliegenden För<strong>der</strong>perioden<br />
wird in <strong>der</strong> kommenden Phase beson<strong>der</strong>er<br />
Wert auf die konkrete Überprüfbarkeit<br />
<strong>der</strong> erreichten Ziele durch die<br />
vorgeschlagenen und durchgeführten<br />
Maßnahmen gelegt werden.<br />
Das Operationelle Programm<br />
2014-2020 des EFRE in Bayern<br />
Der spezifisch bayerische Handlungsansatz<br />
wird in einem eigenen bayerischen<br />
Operationellen Programm zur<br />
EFRE Strukturfondsför<strong>der</strong>ung 2014-<br />
2020 dargelegt und mit den nationalen<br />
und europäischen Zielen abgestimmt.<br />
Das Operationelle EFRE-Programm<br />
für Bayern hat als übergeordnetes Ziel<br />
„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“<br />
formuliert.<br />
Gemäß <strong>der</strong> Europäischen Verordnung<br />
zur Strukturfondsför<strong>der</strong>ung<br />
können Maßnahmen zur nachhaltigen<br />
Stadtentwicklung in einer eigenen Prioritätsachse<br />
umgesetzt werden. Davon<br />
wird im Operationellen Programm<br />
für den EFRE in Bayern Gebrauch<br />
gemacht. Zum Erreichen des Zieles<br />
„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“<br />
werden folgende Prioritätsachsen<br />
formuliert:<br />
1. Stärkung von Forschung, technologischer<br />
Entwicklung und Innovation<br />
2. Stärkung <strong>der</strong> Wettbewerbsfähigkeit<br />
kleiner und mittlerer Unternehmen<br />
3. Klimaschutz und Anpassung an die<br />
Folgen des Klimawandels<br />
4. Nachhaltige Stadt-Umland-Entwicklung.<br />
Für die im Rahmen des EFRE begleiteten<br />
Aspekte <strong>der</strong> Orts- und<br />
Stadtentwicklung ist vor allem die<br />
Prioritätsachse 4 „Nachhaltige Stadt-<br />
Umland-Entwicklung“ für den Flächenstaat<br />
Bayern von Bedeutung.<br />
Nachhaltige Stadt-Umland-Entwicklung<br />
durch interkommunale<br />
Zusammenarbeit<br />
Um Wechselwirkungen in den betroffenen<br />
Teilräumen zu berücksichtigen,<br />
bau intern November/Dezember 2013 11
ist es unabdingbar, größere funktionale<br />
Räume zu betrachten. Daher soll<br />
sich die Umsetzung <strong>der</strong> Prioritätsachse<br />
4 an interkommunale Kooperationen<br />
richten. In tragfähigen Netzwerken<br />
lassen sich mit räumlich und<br />
fachlich abgestimmten Maßnahmen<br />
lokale und regionale Ressourcen besser<br />
nutzen sowie die notwendigen<br />
Anpassungen verträglich, zielgerichtet<br />
und wirkungsvoll umsetzen. Alle<br />
Maßnahmen sind unter umfassen<strong>der</strong><br />
Beteiligung <strong>der</strong> Bürgerschaft und <strong>der</strong><br />
vielfältigen örtlichen Akteure und Interessensvertreter<br />
vorzubereiten und<br />
durchzuführen.<br />
Absicht des zweiphasigen Auswahlverfahrens<br />
ist es, sogenannte „Integrierte<br />
räumliche Entwicklungsmaßnahmen“<br />
(IRE) zu entwickeln und zu<br />
för<strong>der</strong>n. Die Maßnahmen sind auf die<br />
fünf Dimensionen Wirtschaft, Ökologie,<br />
Klima, Soziales und Demographie<br />
auszurichten. Um die Wirksamkeit <strong>der</strong><br />
Maßnahmen bewerten zu können,<br />
werden zudem Aussagen zum funktionalen<br />
Raum, <strong>der</strong> Organisationsstruktur<br />
in <strong>der</strong> interkommunalen Zusammenarbeit,<br />
die abgestimmte Definition von<br />
Problemen, Bedürfnissen und Potentialen<br />
notwendig sein. Zur Umsetzung<br />
<strong>der</strong> fünf Dimensionen wird es um folgende<br />
Handlungsfel<strong>der</strong> gehen: Aktivierung<br />
von Innenentwicklungspotenzialen,<br />
Unterstützung von Quartieren<br />
mit Integrationsbelastungen, Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Energieeffizienz, Sicherung<br />
und Aufwertung des Kultur- und<br />
Naturerbes, Verbesserung <strong>der</strong> grünen<br />
Infrastruktur, Stärkung <strong>der</strong> wirtschaftsstrukturellen<br />
Entwicklung sowie um<br />
Integration von Forschung in die Stadt-<br />
und Ortsentwicklung. Von den sich bewerbenden<br />
Kooperationen wird erwartet,<br />
dass sie mindestens zwei dieser<br />
Handlungsfel<strong>der</strong> als Schwerpunkte in<br />
ihren Maßnahmen bearbeiten.<br />
Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren<br />
Die Auslobung richtet sich an Kommunen,<br />
darunter mindestens eine Stadt,<br />
die gemeinsam auf ausgewählten<br />
Handlungsfel<strong>der</strong>n in integrierter interkommunaler<br />
Zusammenarbeit tätig<br />
werden wollen (Abb. 3). Eine Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Planungsregion 14<br />
ist lediglich im thematischen Ziel 4<br />
„Verringerung <strong>der</strong> CO 2<br />
-Emissionen in<br />
allen Branchen <strong>der</strong> Wirtschaft" möglich.<br />
Von den Allianzen wird eine Mindestgröße<br />
von mindestens 20.000<br />
Einwohnern erwartet. Die Auswahl<br />
in <strong>der</strong> ersten Bewerbungsstufe dient<br />
dem Ausscheiden gänzlich ungeeigneter<br />
Bewerbungen. Angestrebt wird,<br />
dass alle entwicklungsfähigen Bewerbungen<br />
im Verfahren bleiben und unterstützt<br />
werden können.<br />
An dem Auswahlverfahren werden<br />
auch die am Operationellen Programm<br />
beteiligten <strong>Bayerischen</strong> Staatsministerien<br />
für Wirtschaft und Medien,<br />
Energie und Technologie, für Umwelt<br />
und Verbraucherschutz, das Staatsministerium<br />
des Innern, für Bau und<br />
Verkehr, sowie für Bildung und Kultus,<br />
Wissenschaft und Kunst sowie<br />
die <strong>Bayerischen</strong> Staatsministerien für<br />
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
(bei Berührungspunkten mit dem<br />
ELER) und das Staatsministerium für<br />
Arbeit und Soziales, Familie und Integration<br />
(bei Berührungspunkten mit<br />
dem ESF), sowie Vertreter des <strong>Bayerischen</strong><br />
Städtetages, des <strong>Bayerischen</strong><br />
Gemeindetages und des <strong>Bayerischen</strong><br />
Landkreistages teilnehmen. Für die<br />
erste Phase reichen Interessensbekundungen.<br />
Diese sind einzureichen<br />
bis zum 31. Dezember 2013 an das<br />
sachgebiet-IIC6@stmi.bayern.de.<br />
Weitere Hinweise zu den detaillierten<br />
Bewerbungs- und Auswahlkriterien<br />
sind zu finden unter<br />
http://www.stmi.bayern.de/buw/<br />
staedtebaufoer<strong>der</strong>ung/aktuelles/<br />
EFRE-För<strong>der</strong>ung; Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ 2014-2020;<br />
Kartenentwurf: StMWIVT, Referat Statistik, Analysen, Wirtschafts- und Raumbeobachtung; Stand: August 2013<br />
Autoren<br />
Baudirektor Dipl.-Ing. Franz Langlechner,<br />
Baudirektor Dr.-Ing. Josef Rott,<br />
Oberste Baubehörde<br />
franz.langlechner@stmi.bayern.de<br />
josef.rott@stmi.bayern.de<br />
12 bau intern November/Dezember 2013
Kulturlandschaftliche<br />
Empfehlungen für<br />
Bayern beim Planen<br />
und Bauen<br />
Dr. Christina Kühnau, Peter Blum,<br />
Hansjörg Haslach, Prof. Markus<br />
Reinke, Dr. Wolfgang Zehlius-Eckert<br />
Kulturlandschaft – ein beson<strong>der</strong>er<br />
Wert<br />
Seit Jahrhun<strong>der</strong>ten prägt <strong>der</strong> Mensch<br />
durch Kultivierung die ihn umgebende<br />
Landschaft. Es entstanden „Kulturlandschaften“,<br />
die – je nach ihrer naturräumlichen<br />
Ausstattung und <strong>der</strong> Art<br />
und dem Ausmaß <strong>der</strong> menschlichen<br />
Nutzung – von charakteristischer Eigenart<br />
sind. Dabei reicht das Spektrum<br />
von wenig beeinflussten, wild<br />
Lebensräume entstanden, die heute<br />
Rückzugsorte für zahlreiche seltene<br />
Pflanzen- und Tierarten geworden sind<br />
(z.B. Streuwiesen, Almen, Streuobstwiesen<br />
u.v.a.m.).<br />
Der Gesetzgeber hat diesen beson<strong>der</strong>en<br />
Werten Sorge getragen und<br />
den Schutz <strong>der</strong> Kulturlandschaften in<br />
mehreren Gesetzen verankert, u.a. im<br />
Bundesnaturschutzgesetz (§ 1, Abs.<br />
1 und 4 BNatSchG) o<strong>der</strong> im Raumordnungsgesetz<br />
(§ 2, Abs. 2, Ziffer 5<br />
ROG).<br />
Tatsächlich ist aber fortlaufend ein<br />
schleichen<strong>der</strong>, vielerorts auch rascher<br />
Verlust an kulturlandschaftlichen Werten<br />
zu beobachten. Die Gründe dafür<br />
sind vielfältig: während einerseits die<br />
Landnutzung weiter intensiviert wird,<br />
werden an<strong>der</strong>erseits traditionelle<br />
Wirtschaftsformen aufgegeben, da<br />
Das Projekt „Kulturlandschaftliche<br />
Empfehlungen für Bayern“<br />
Anliegen des Projektes ist die Erhaltung<br />
<strong>der</strong> Vielfalt und Eigenart <strong>der</strong><br />
bay erischen Kulturlandschaften. Dabei<br />
bilden die „Kulturlandschaftlichen<br />
Empfehlungen für Bayern“ den dritten<br />
Baustein eines über mehrere Jahre<br />
laufenden Gesamtprojektes.<br />
Im vorhergehenden Projekt „Entwurf<br />
einer kulturlandschaftlichen Glie<strong>der</strong>ung<br />
Bayerns als Beitrag zur Biodiversität“<br />
(HSWT-ILA & TUM-SMLE,<br />
2011) wurde Bayern flächendeckend<br />
in 61 Kulturlandschaftsräume geglie<strong>der</strong>t.<br />
Je<strong>der</strong> dieser Räume wurde in<br />
Form von Steckbriefen entsprechend<br />
seiner individuellen charakteristischen<br />
Merkmale beschrieben. Dem Entwurf<br />
<strong>der</strong> kulturlandschaftlichen Glie<strong>der</strong>ung<br />
Bayerns liegt dabei ein umfassen<strong>der</strong><br />
Kulturlandschaftsbegriff zugrunde, <strong>der</strong><br />
„jede durch menschliches Handeln<br />
verän<strong>der</strong>te Landschaft unabhängig<br />
von qualitativen Aspekten und normativen<br />
Fragestellungen“ (GAILING &<br />
KEIM 2006: 17) als Kulturlandschaft<br />
definiert. Die kulturlandschaftliche<br />
Glie<strong>der</strong>ung beschäftigt sich daher mit<br />
<strong>der</strong> aktuellen Ausprägung <strong>der</strong> Kulturlandschaft<br />
und verfolgt einen rein<br />
Kreuzberg (LK Freyung-Grafenau): Hecken lassen die radiale Anordnung <strong>der</strong> historischen Waldhufenflur gut in <strong>der</strong> Landschaft erkennen. Foto: Veronika Stegmann, 2009.<br />
anmutenden Naturlandschaften (z.B.<br />
hochalpine Landschaften) über vielfältig<br />
durch traditionelle Nutzungen<br />
geformte Agrarlandschaften bis hin<br />
zu herrschaftlich o<strong>der</strong> religiös überprägten<br />
Landschaften.<br />
Kulturlandschaften sind Zeugnisse<br />
für das Wirken vergangener Generationen.<br />
Indem dieses Wirken auch heute<br />
noch erlebbar ist, können Kulturlandschaften<br />
einen hohen historischen<br />
Wert aufweisen, gleichzeitig haben<br />
sie eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung für die<br />
Vielfalt und Eigenart des Landschaftsbildes<br />
und damit für die Erholungseignung.<br />
Im Laufe <strong>der</strong> Jahrhun<strong>der</strong>te<br />
sind zudem durch spezifische Bewirtschaftungsformen<br />
nutzungsgeprägte<br />
die Nutzung von z.B. Wiesentälern<br />
o<strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>wäl<strong>der</strong>n heute wirtschaftlich<br />
unrentabel ist. Insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong><br />
demografische Wandel und <strong>der</strong> Ausbau<br />
<strong>der</strong> Erneuerbaren Energien stellen<br />
neue Herausfor<strong>der</strong>ungen für den<br />
Schutz <strong>der</strong> Kulturlandschaft dar.<br />
beschreibenden, keinen wertenden<br />
Ansatz.<br />
Im folgenden Projekt „Bedeutsame<br />
Kulturlandschaften in Bayern – Entwurf<br />
einer Raumauswahl“ (HSWT-ILA<br />
& TUM-SMLE, 2012) wurden Kulturlandschaften<br />
beson<strong>der</strong>er Wertigkeit in<br />
Bayern identifiziert. Als „bedeutsame<br />
Kulturlandschaft“ wurden dabei Landschaftsausschnitte<br />
bzw. Teilräume<br />
verstanden, die in ihrer Gestalt maßgeblich<br />
von historischen und traditionellen<br />
Prägungen bestimmt werden.<br />
Beide vorhergehenden Projekte<br />
wurden vom <strong>Bayerischen</strong> Landesamt<br />
für Umwelt initiiert und finanziert.<br />
Im dritten und abschließenden Projektbaustein<br />
„Empfehlungen für die<br />
bau intern November/Dezember 2013 13
Kulturlandschaften in Bayern“ werden,<br />
aufbauend auf den Ergebnissen<br />
<strong>der</strong> vorangegangenen Projekte, Empfehlungen<br />
für die Sicherung und Entwicklung<br />
<strong>der</strong> historisch gewachsenen<br />
Eigenart von Kulturlandschaften formuliert,<br />
die es erlauben, mit möglichst<br />
konkretem Raumbezug Hinweise und<br />
Handlungsempfehlungen für den Erhalt<br />
<strong>der</strong> vielfältigen bayerischen Kulturlandschaften<br />
zu geben und Perspektiven<br />
für <strong>der</strong>en weitere Entwicklung im<br />
Rahmen von Planungen und an<strong>der</strong>en<br />
landschaftsbezogenen Entscheidungsprozessen<br />
aufzuzeigen. Die Empfehlungen<br />
werden flächendeckend für<br />
das ganze Land, entsprechend <strong>der</strong> jeweils<br />
charakteristischen Eigenart <strong>der</strong><br />
einzelnen Teilräume, erarbeitet (siehe<br />
unten).<br />
Das Projekt hat eine Laufzeit von<br />
einem Jahr (10/2012 bis 10/2013) und<br />
wird gemeinsam vom <strong>Bayerischen</strong><br />
Landesamt für Umwelt und <strong>der</strong> Obersten<br />
Baubehörde im <strong>Bayerischen</strong><br />
Staatsministerium des Innern, für Bau<br />
und Verkehr getragen. Eine fachliche<br />
Begleitung erfolgt durch regionale<br />
Experten in einer projektbegleitenden<br />
Arbeitsgruppe.<br />
Die Projektbearbeitung liegt bei <strong>der</strong><br />
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,<br />
Institut für Landschaftsarchitektur, in<br />
Kooperation mit <strong>der</strong> Technischen Universität<br />
München, Lehrstuhl für Strategie<br />
und Management <strong>der</strong> Landschaftsentwicklung.<br />
Vorgehensweise<br />
Die räumliche Bezugsbasis für die<br />
Kulturlandschaftlichen Empfehlungen<br />
bilden die 61 Raumeinheiten <strong>der</strong> ersten<br />
Projektphase (s.o.). Ziel ist eine<br />
möglichst komprimierte Darstellung<br />
von Empfehlungen, individuell für<br />
den jeweiligen Raum in kurzer, knapper<br />
Form („Formblatt“).<br />
In einem tabellarischen Eingangsblock<br />
werden die Lage des Raumes,<br />
seine administrativen Zugehörigkeit<br />
sowie die darin befindlichen bedeutsamen<br />
Kulturlandschaften aufgeführt.<br />
Eine Übersicht zu „wesentlichen<br />
Merkmalen und Gefährdungen <strong>der</strong><br />
landschaftlichen Eigenart“ beinhaltet<br />
eine Zusammenfassung <strong>der</strong> entscheidenden,<br />
umsetzungsrelevanten<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> vorangegangenen Projektphasen,<br />
um die Argumentationslinie<br />
bzw. die Herleitung <strong>der</strong> Empfehlungen<br />
nachvollziehbar zu machen. Es<br />
werden ausschließlich die Merkmale<br />
herausgestellt, die auch in Empfehlungen<br />
münden, insbeson<strong>der</strong>e Angaben<br />
zu wichtigen Gefährdungspotenzialen.<br />
In <strong>der</strong> „Gesamtsituation“ wird<br />
3<br />
7<br />
11 12<br />
13<br />
1<br />
4<br />
4 6<br />
8<br />
10<br />
15<br />
14<br />
23<br />
24<br />
9 16<br />
2<br />
5<br />
18<br />
19<br />
17<br />
21<br />
27<br />
22<br />
25<br />
26<br />
20<br />
30<br />
37<br />
36<br />
28<br />
33<br />
29<br />
40<br />
38<br />
39<br />
41<br />
45<br />
46<br />
48<br />
47<br />
49<br />
51<br />
50<br />
34<br />
35<br />
34 32<br />
31<br />
58<br />
42<br />
43<br />
54<br />
53<br />
56<br />
52<br />
57 59<br />
60<br />
44<br />
61<br />
55<br />
Bearbeitung:<br />
Institut für Landschaftsarchitektur <strong>der</strong><br />
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf<br />
N 1:2.000.000<br />
Lehrstuhl für Strategie und Management <strong>der</strong><br />
Landschaftsentwicklung <strong>der</strong> Technischen Universität München<br />
Entwurf <strong>der</strong> kulturlandschaftlichen Glie<strong>der</strong>ung Bayerns - Übersichtskarte: HSWT-ILA & TUM-SMLE, 2011<br />
14 bau intern November/Dezember 2013
einer gesellschaftlichen Diskussion<br />
erfolgen. Die formulierten Erhaltungsempfehlungen<br />
lassen dennoch Raum<br />
für zahlreiche Entwicklungsalternativen.<br />
Tabellarischer Eingangsblock Kulturlandschaftseinheit „Westallgäu (44)“<br />
eine kurze Einschätzung abgegeben,<br />
wie weit <strong>der</strong> Raum seine landschaftliche<br />
Eigenart erhalten konnte bzw. in<br />
welchem Umfang überformende Entwicklungen<br />
wirksam geworden sind.<br />
Abschließend werden Hinweise auf<br />
weitere Quellen gegeben, die kulturlandschaftlich<br />
relevante Ziel- und Planungsaussagen<br />
enthalten können.<br />
An den tabellarischen Eingangsblock<br />
schließen sich die eigentlichen<br />
Empfehlungen an. Diese werden aufgelistet<br />
und, wenn möglich, zu Themenblöcken<br />
aus Haupt- und Teilzielen<br />
zusammengefasst. Die Reihenfolge<br />
<strong>der</strong> Empfehlungen begründet sich allein<br />
thematisch und spiegelt keine<br />
Schwerpunktsetzung wi<strong>der</strong>. Da die<br />
Empfehlungen für die kulturlandschaftliche<br />
Entwicklung auf den vorangehenden<br />
Projektbausteinen aufbauen,<br />
ist es folgerichtig, dass sich die Empfehlungen<br />
vorrangig auf Erhaltungsaspekte<br />
beziehen. Für Entwicklungsziele<br />
wären zusätzlich Analysedaten<br />
erfor<strong>der</strong>lich gewesen. Zudem kann<br />
eine Erarbeitung von Leitbild-Aussagen<br />
nur zusammen mit den Akteuren<br />
vor Ort, d.h. nur in den Regionen und<br />
auf lokaler Ebene auf <strong>der</strong> Grundlage<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> kulturlandschaftlichen<br />
Empfehlungen in<br />
an<strong>der</strong>en Planungen<br />
Das Projekt ist anwendungsorientiert<br />
und vorrangig auf die Erfor<strong>der</strong>nisse<br />
<strong>der</strong> Raumplanung sowie verschiedener<br />
Fachplanungen auf Landes- und<br />
regionaler Ebene ausgerichtet. Maßstabsbedingt<br />
betreffen die kulturlandschaftlichen<br />
Empfehlungen unmittelbar<br />
die Ebene <strong>der</strong> Landesplanung<br />
(LEP). Hier können sie die Grundlage<br />
für die Formulierung von Zielen und<br />
Grundsätzen nach § 3 ROG (und die<br />
entsprechenden Begründungen) bilden.<br />
Ihre Berücksichtigung ist (mit<br />
konkretisierten Raumbezügen) auch<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Regionalplanung und<br />
auf nachfolgenden Planungsebenen<br />
sowie im Rahmen von Fachplanungen<br />
möglich. Für die regionale und die lokale<br />
Ebene können die vorliegenden<br />
Empfehlungen dabei allenfalls erste<br />
Orientierung und Diskussionsgrundlage<br />
sein. Im Weiteren sind hier die<br />
Erhebung detaillierterer Datengrundlagen<br />
und die Entwicklung konkreter<br />
Leitbil<strong>der</strong> mit den regionalen und örtlichen<br />
Akteuren anzuraten.<br />
Die Empfehlungen bilden einen<br />
aus rein fachlich-sektoraler Perspektive<br />
(„Schutzgut Kulturlandschaft“) entwickelten,<br />
nicht mit Zielvorstellungen<br />
an<strong>der</strong>er Raumansprüche bzw. Fachdisziplinen<br />
abgestimmten Beitrag zur<br />
Landschaftsentwicklung. Erst durch<br />
die Übernahme <strong>der</strong> kulturlandschaftlichen<br />
Empfehlungen in die entsprechenden<br />
o.g. Planwerke können ihre<br />
Aussagen verbindlich werden. Die<br />
Empfehlungen entsprechen dabei<br />
in ihrer Aussageschärfe und ihrem<br />
sprachlichen Duktus landes- bzw. regionalplanerischen<br />
Zielformulierungen.<br />
An<strong>der</strong>s als diese besitzen jedoch<br />
die Empfehlungen für die kulturlandschaftlichen<br />
Entwicklungen einen<br />
unverbindlichen, eben empfehlenden<br />
Charakter. Der Empfehlungscharakter<br />
<strong>der</strong> Aussagen relativiert jedoch nicht<br />
<strong>der</strong>en Dringlichkeit, wenn es darum<br />
geht, die Eigenart und Vielfalt <strong>der</strong> bayerischen<br />
Kulturlandschaften für kommende<br />
Generationen zu erhalten.<br />
In diesem Zusammenhang wurde<br />
<strong>der</strong> Begriff „Empfehlungen“ bewusst<br />
bau intern November/Dezember 2013 15
gewählt, um zu betonen, dass es<br />
sich um einen fachlichen Vorschlag<br />
als Diskussionsgrundlage handelt und<br />
Verwechslungen mit den inhaltlich belegten<br />
planerischen Begrifflichkeiten<br />
raumordnerischer Ziele und Grundsätze<br />
zu vermeiden. Dennoch haben<br />
die Empfehlungen einen Zielcharakter,<br />
indem sie auf die Erhaltung <strong>der</strong><br />
Eigenart und Vielfalt <strong>der</strong> bayerischen<br />
Kulturlandschaften abzielen. Sie sollen<br />
für Planer und Entscheidungsträger<br />
eine zielgerichtete Fach- und Informationsbasis<br />
darstellen und in kompakter<br />
Form Orientierung geben bei Entwicklungsfragen,<br />
die die Belange <strong>der</strong> Kulturlandschaft<br />
betreffen.<br />
Literaturverzeichnis<br />
Augenstein, I., Blum, P., Haslach, H. & J. Reh (2010):<br />
Die Kulturlandschaften Bayerns: Vielfalt – Heimat –<br />
Schutzgut. Auf dem Weg zu einer umfassen<strong>der</strong>en Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> bayerischen Kulturlandschaften in<br />
<strong>der</strong> Planung. Schönere Heimat, 3: 185-187.<br />
BFN & BBSR (2011): Kulturlandschaften gestalten! Zum<br />
zukünftigen Umgang mit Transformationsprozessen in<br />
<strong>der</strong> Raum- und Landschaftsplanung. Saarländische Druckerei<br />
& Verlag GmbH.<br />
BÜTTNER, T. (2004): Die historische Kulturlandschaft in<br />
<strong>der</strong> Region Oberfranken-West. Erläuterungsbericht<br />
zum Pilotprojekt. Augsburg, München 2004.<br />
BÜTTNER, T. (2006): Kulturlandschaft als planerisches<br />
Konzept - Die Einbindung des Schutzgutes „historische<br />
Kulturlandschaft“ in <strong>der</strong> Planungsregion Oberfranken-<br />
West. Dissertation an <strong>der</strong> Fakultät VI <strong>der</strong> Technischen<br />
Universität Berlin.<br />
GAILING, L. & K. D. KEIM (2006): Analyse von informellen<br />
und dezentralen Institutionen und Public Governance<br />
mit kulturlandschaftlichem Hintergrund in <strong>der</strong><br />
Beispielregion Barnim. Materialien Nr. 6 herausgegeben<br />
von <strong>der</strong> Berlin-Brandenburgische Akademie <strong>der</strong><br />
Wissenschaften, Berlin. Online verfügbar unter:<br />
http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/Land/de/bil<strong>der</strong>/arbeitspapier6.pdf<br />
(Stand:<br />
28.09.2011).<br />
GAILING, L. RÖHRING, A. (2008): Kulturlandschaften<br />
als Handlungsräume <strong>der</strong> Regionalentwicklung. Implikationen<br />
des neuen Leitbildes zur Kulturlandschaftsgestaltung.<br />
In: RaumPlanung 136, S. 5 – 10. http://www.<br />
irs-net.de/download/GailingRoehringKulturlandschaft.<br />
pdf.<br />
GESCHÄFTSSTELLE DER MINISTERKONFERENZ<br />
FÜR RAUMORDNUNG IM BUNDESMINISTERIUM<br />
FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG<br />
(BMVBS, HRSG.) (2006): Leitbil<strong>der</strong> und Handlungsstrategien<br />
für die Raumentwicklung in Deutschland. Berlin.<br />
GÜNNEWIG, D., GRAUMANN, U, NAUMANN, J., PE<br />
TERS, J., POHL, R., REICHMUTH, M., WACHTER, T.,<br />
HEMPP, S., UNGER-URBANOWITZ, O. & ZEIDLER, M.<br />
(2006): Flächenbedarfe und kulturlandschaftliche Auswirkungen<br />
regenerativer Energien am Beispiel <strong>der</strong> Region<br />
Uckermark-Barnim. Abschlussbericht eines Forschungsprojektes<br />
im Rahmen des Forschungsprogramms Aufbau<br />
Ost, i. Auftr. des Bundesamtes für Bauwesen und<br />
Raumordnung. Hannover, Eberswalde, Leipzig, Würzburg.<br />
HSWT-ILA & TUM-SMLE [Institut für Landschaftsarchitektur<br />
<strong>der</strong> Hochschule Weihenstephan-Triesdorf &<br />
Lehrstuhl für Strategie und Management <strong>der</strong> Landschaftsentwicklung<br />
<strong>der</strong> Technischen Universität München]<br />
(2011): Entwurf einer kulturlandschaftlichen Glie<strong>der</strong>ung<br />
Bayerns als Beitrag zur Biodiversität,<br />
Online-Veröffentlichung des <strong>Bayerischen</strong> Landesamtes<br />
für Umweltschutz. http://www.lfu.bayern.de/natur/kulturlandschaft/doc/projektbeschreibung.pdf<br />
HSWT-ILA & TUM-SMLE [Institut für Landschaftsarchitektur<br />
<strong>der</strong> Hochschule Weihenstephan-Triesdorf &<br />
Lehrstuhl für Strategie und Management <strong>der</strong> Landschaftsentwicklung<br />
<strong>der</strong> Technischen Universität München<br />
(2012): „Bedeutsame Kulturlandschaften Bayerns<br />
– Entwurf einer Raumauswahl“. Online-Veröffentlichung<br />
des <strong>Bayerischen</strong> Landesamtes für Umweltschutz.<br />
http://www.lfu.bayern.de/natur/kulturlandschaft/doc/<br />
projektbeschreibung_bedeutsam_kula.pdf<br />
HSWT-ILA & TUM-SMLE [Institut für Landschaftsarchitektur<br />
<strong>der</strong> Hochschule Weihenstephan-Triesdorf &<br />
Lehrstuhl für Strategie und Management <strong>der</strong> Landschaftsentwicklung<br />
<strong>der</strong> Technischen Universität München<br />
(2013): Kulturlandschaftliche Leitbil<strong>der</strong> für Bayern.<br />
Zwischenbericht vom 15.02.2013. unveröffentlicht.<br />
SCHMIDT, C., HAGE, G., GALANDI, R., HANKE, R.,<br />
HOPPENSTEDT, A., KOLODZIEJ, J., STRICKER, M.<br />
(2010): Kulturlandschaft gestalten – Grundlagen. Bundesamt<br />
für Naturschutz, Naturschutz und Biologische<br />
Vielfalt, Heft 103. Landwirtschaftsverlag. Bonn- Bad<br />
Godesberg.<br />
Autoren<br />
Dr.-Ing. Christina Kühnau,<br />
Dipl.-Ing. Peter Blum,<br />
Prof. Dr.-Ing. Markus Reinke,<br />
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,<br />
Dipl.-Ing. Hansjörg Haslach,<br />
Dr.-Ing. Wolfgang Zehlius-Eckert,<br />
Technische Universität München<br />
christina.kuehnau@hswt.de<br />
peter.blum@hswt.de<br />
markus.reinke@hswt.de<br />
haslach@wzw.tum.de<br />
zehlius@wzw.tum.de<br />
Ausstellungseröffnung „Wettbewerb Neubau Strafjustizzentrum Nürnberg“<br />
Am 6. November 2013 eröffnete Herr<br />
Ministerialdirigent Friedrich Geiger vor<br />
zahlreichen interessierten Besuchern<br />
im Forum 4 <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />
die Ausstellung „Wettbewerb für<br />
den Neubau des Strafjustizzentrums<br />
Nürnberg“. Die Ausstellung zeigt die<br />
Entwürfe und Modelle von fünf Preisträgern<br />
und vier Ankäufen für die Erweiterung<br />
<strong>der</strong> Justiz auf dem ehem.<br />
VAG-Gelände in Nürnberg.<br />
Wir danken Frau Prof. Weinmiller,<br />
<strong>der</strong> Vorsitzenden des Preisgerichts<br />
und Herrn Pfeifer vom Staatlichen<br />
Bauamt Erlangen-Nürnberg für Ihre<br />
fachkundige und lebendige Einführung<br />
in die Wettbewerbsaufgabe und die<br />
Vorstellung <strong>der</strong> Preisträger.<br />
Die Ausstellung war bis zum 28.<br />
November 2013 im Forum 4 <strong>der</strong> OBB<br />
zu sehen.<br />
1. Preis Architekturbüro ZILA Leipzig<br />
(Sachgebiet IIA1)<br />
16 bau intern November/Dezember 2013
Endspurt beim Neubau<br />
des größten OP-Zentrums<br />
Europas<br />
Klinikum <strong>der</strong> Ludwig-Maximilian-<br />
Universität München (LMU), Campus<br />
Großha<strong>der</strong>n<br />
Mathis Gruhn, Bernhard Klingl<br />
Mit dem Neubau des 167 Mio. Euro<br />
teuren OP-Zentrums in Großha<strong>der</strong>n<br />
wird <strong>der</strong> erste Schritt zu einer umfassenden<br />
Erneuerung und Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
des Universitätsklinikums<br />
Großha<strong>der</strong>n umgesetzt. 40 Jahre<br />
Krankenhausbetrieb und über 30 Jahre<br />
OP-Betrieb mit jährlich rund 18.000<br />
Operationen sind an dem das Stadtbild<br />
prägenden Klinikum in Großha<strong>der</strong>n<br />
nicht spurlos vorüber gegangen.<br />
Die insgesamt mehr als eine<br />
halbe Million Eingriffe machen eine<br />
grundlegende Mo<strong>der</strong>nisierung des<br />
OP-Bereichs dringend erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Medizinische Möglichkeiten, Interdisziplinarität,<br />
technische Infrastruktur<br />
und Hygienestandards haben sich<br />
zudem in den letzten Jahren gewaltig<br />
fortentwickelt. Vor 40 Jahren gab es<br />
we<strong>der</strong> EDV noch Großgeräte (Computertomographen,<br />
Magnetresonanztomographen<br />
u.v.m.) heutiger Vielfalt,<br />
we<strong>der</strong> ambulantes Operieren noch<br />
Holding-Areas, Hybrid-OPs, Laminar-Air-flow-Lüftungsdecken,<br />
multiresistente<br />
Keime, auch keine Energieeinsparverordnung.<br />
Eine Sanierung<br />
des Bestandes wurde abgewogen,<br />
aber hätte bedeutet, im alten OP-<br />
Trakt zeitgleich am Menschen und am<br />
Gebäude zu operieren. Und das über<br />
Jahre hinweg. Das Klinikum befürchtete<br />
zu Recht, Patienten zu verlieren.<br />
Die Lösung hieß: Neu bauen, in <strong>der</strong><br />
Bauphase die alten OPs weiter nutzen<br />
und dann, am Tage X von den alten in<br />
die neuen Säle umziehen. Das Konzept<br />
ging auf. So läuft nun, getrennt<br />
vom Klinikbetrieb, seit 2008 die Baustelle<br />
für das neue Chirurgische Zentrum.<br />
Ab 2014 wird <strong>der</strong> Neubau in adäquaten<br />
Räumen ein zeitgemäßes<br />
OP-Management und optimale betriebliche<br />
Flexibilität ermöglichen. Das<br />
hätte die Sanierung im Altbestand bei<br />
nahezu gleichen Baukosten keinesfalls<br />
zugelassen.<br />
graphieanlangen, sog. „Hybrid-OP´s“.<br />
Daneben beherbergt das fünfgeschossige<br />
Gebäude ein ambulantes Operationszentrum<br />
mit vier OP-Sälen, eine<br />
Intensivebene mit fünf Intensivpflegebzw.<br />
Intermediate-Care-Stationen und<br />
70 Betten, eine interdisziplinäre Notaufnahme<br />
sowie eine mo<strong>der</strong>ne Zentralsterilisation.<br />
Damit werden künftig<br />
das gesamte Klinikum Großha<strong>der</strong>n,<br />
aber auch die ebenfalls zur LMU gehörenden<br />
Innenstadtkliniken mit Sterilgut<br />
versorgt. Die Komplexität dieses<br />
Bauvorhabens wird auch anhand weiterer<br />
beeindrucken<strong>der</strong> Zahlen deutlich:<br />
Insgesamt werden über 1.000 km<br />
Leitungen für EDV, Brandmel<strong>der</strong>, Elektroverkabelung<br />
sowie für Mess-, Steuerungs-<br />
und Regeltechnik verlegt. Für<br />
die Versorgung mit medizinischen Gasen<br />
werden 30 km Rohrleitungen und<br />
2.800 Entnahmestellen installiert. Die<br />
Lüftungsanlage erreicht einen Luftwechsel<br />
von 320.000 m³ pro Stunde<br />
– das fast 1,5-fache Volumen <strong>der</strong><br />
Münchner Frauenkirche.<br />
Der Neubau schließt sich im Norden<br />
an den Behandlungstrakt des Klinikums<br />
an und nimmt die inneren Strukturen<br />
auf. Drei begrünte Innenhöfe<br />
glie<strong>der</strong>n die große Baumasse und führen<br />
zu einer Gebäudestruktur, die fast<br />
überall Tageslichtbezug gewährleistet.<br />
Nach außen präsentiert sich <strong>der</strong> neue<br />
Baukörper mit einer großflächigen textilen<br />
Fassade, die zum einen den nötigen<br />
Sonnenschutz gewährleisten soll<br />
und zum an<strong>der</strong>en Schutz vor Einblick<br />
bietet.<br />
Die Infrastruktur<br />
Parallel wurden verschiedene Infrastrukturmaßnahmen<br />
am Standort Groß-<br />
Blick vom Norden auf neues OP-Zentrum und altes Bettenhaus, Foto: Reinhold Pfeufer<br />
Der Bau<br />
Auf über 14.600 m² Nutzfläche, also<br />
<strong>der</strong> Größe zweier Fußballfel<strong>der</strong>, entstehen<br />
auf zwei Ebenen 32 Operationssäle<br />
- drei OP´s erhalten eine<br />
integrierte BildgebungComputertomographiegeräte<br />
(CT) bzw. Angio<br />
ha<strong>der</strong>n in Angriff genommen. So ging<br />
beispielsweise 2012 Deutschlands<br />
größte zentrale Notstromersatzanlage<br />
in Betrieb, die mit ihren 12,8 MW Leistung<br />
eine Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern<br />
versorgen könnte, die Wärmeversorgung<br />
wurde erneuert und<br />
eine Hackschnitzel-Dampferzeugung<br />
gebaut. Damit ist auch die nötige Versorgung<br />
des Neubaus sichergestellt.<br />
Das Gesamtinvestitionsvolumen am<br />
Standort Großha<strong>der</strong>n beläuft sich <strong>der</strong>zeit<br />
auf über 250 Mio. Euro.<br />
Ausblick<br />
Und es geht weiter: Die Planungen<br />
für das „Neue Hauner“ (Mutter-Kind-<br />
Zentrum) für rund 160 Millionen Euro<br />
laufen an. Damit soll die universitäre<br />
Kin<strong>der</strong>medizin an <strong>der</strong> LMU München<br />
bau intern November/Dezember 2013 17
von Grund auf mo<strong>der</strong>nisiert werden.<br />
Zudem werden in verschiedenen Szenarien<br />
die weitere Entwicklung des<br />
gesamten Standortes Großha<strong>der</strong>n untersucht<br />
und damit die nächsten Maßnahmen<br />
vorbereitet.<br />
Blick auf die Nordwestecke, Foto: Reinhold Pfeufer<br />
Die Medientechnik im OP<br />
Nicht nur <strong>der</strong> Bau an sich, auch die<br />
Medientechnik im neuen OP-Zentrum<br />
in Großha<strong>der</strong>n ist einzigartig<br />
und wegweisend. Alle OPs wurden<br />
mit einer Audio-Video-Konferenzanlage<br />
ausgestattet. Dies ermöglicht die<br />
Zuschaltung weiterer Spezialisten in<br />
den OP (Telemedizin), Übertragungen<br />
in Hörsäle, Kongresse o<strong>der</strong> auch die<br />
Aufzeichnung für Lehrfilme bzw. zu<br />
Dokumentationszwecken. Die Beson<strong>der</strong>heit:<br />
Die Steuerung dieser Anlage<br />
ist in die Medizinische Bilddarstellung<br />
integriert. Hierzu erhält je<strong>der</strong> OP<br />
zwei 42-Zoll Wanddisplays, sowie ein<br />
Display im OP-Feld auf <strong>der</strong> sogenannten<br />
OP-Ampel - einem flexiblem Arm<br />
mit allen notwendigen technischen<br />
Anschlüssen. Die Bedienung erfolgt<br />
über Touchscreen. Zur Bildgebung<br />
tragen neben verschiedenen Medizingeräten,<br />
wie Endoskop, Ultraschall,<br />
Röntgengeräte, CT auch zwei Kameras<br />
bei, die im OP-Licht und im Display<br />
integriert sind. Die Bil<strong>der</strong> werden in<br />
Farbe und in höchster Qualität angezeigt.<br />
Zur Audio-Übertragung dienen<br />
zwei Richtmikrofone an <strong>der</strong> Decke sowie<br />
zwei Flachmembranlautsprecher,<br />
die aus hygienischen Gründen im Deckenhohlraum<br />
versteckt sind. Ein Audio-Rechner<br />
filtert Störgeräusche.<br />
Der Hochleistungsrechner greift<br />
über den OP-Plan auf alle Bild-, Ton-,<br />
und Text-Daten eines Patienten zu.<br />
Er errechnet aus diesen Daten die<br />
Darstellung, welche die Mediziner<br />
über den Touchscreen anfor<strong>der</strong>n.<br />
Dargestellt werden beispielsweise<br />
medizinische Bildüberlagerungen und<br />
Simulationen (z.B. drehbare 3D-Modelle).<br />
Es können gleichzeitig mehrere<br />
medizinische Bil<strong>der</strong> und Bildserien<br />
flexibel angeordnet werden. Außerdem<br />
ist die Bilddarstellung anpassbar<br />
(Zoomen, Rotieren etc.). Weiterhin<br />
gibt es Messfunktionen für Abstand,<br />
Winkel, Kreis und Volumen. Möglich<br />
sind auch 3D-Rekonstruktionen in beliebigen<br />
Ebenen. Kommentare können<br />
mittels Touchscreen direkt in das Bild<br />
eingegeben werden. Beliebige Einstellungen<br />
und Bildserien bzw. Filme können<br />
gespeichert werden. Damit kann<br />
die Operation besser vorbereitet und<br />
<strong>der</strong> Informationsaustausch beschleunigt<br />
werden.<br />
Ausgewählte OP-Säle erhalten zusätzlich<br />
eine Navigationslösung. Durch<br />
die Verwendung von beson<strong>der</strong>em<br />
OP-Besteck kann über Ultraschallsensoren<br />
im OP während <strong>der</strong> Eingriffe<br />
am Display eine Operationskontrolle<br />
durchgeführt werden. Hierzu wird bei<br />
<strong>der</strong> OP-Planung am Medizinischen<br />
Bild die geplante Durchführung eingetragen.<br />
Beson<strong>der</strong>s schützenswerte<br />
Gefäße können gekennzeichnet und<br />
Umgehungsrouten hinterlegt werden.<br />
All dies soll zu einem besseren, sichereren<br />
und schnelleren OP-Ergebnis<br />
führen. Das Softwarekonzept ist modular<br />
aufgebaut, so dass auch künftige<br />
Entwicklungen integriert werden können.<br />
Die Rolle <strong>der</strong> Bauverwaltung<br />
Die Bauverwaltung ist bei dieser<br />
Neubaumaßnahme teils neue Wege<br />
gegangen. So wurden nach <strong>der</strong> Programmplanung<br />
im Zuge eines zweistufigen<br />
Wettbewerbes unter den<br />
damaligen fünf bayerischen Universitätsbauämtern<br />
die baulichen Alternativen<br />
untersucht, die dann in einer in<br />
allen funktionalen Details optimierten<br />
Neubauplanung mündeten. Erst die<br />
Ausführungsplanung wurde an ein Ingenieurbüro<br />
vergeben. So vergingen<br />
nur gut 1,5 Jahre vom Beginn <strong>der</strong> Entwurfsplanungen<br />
bis zur Baudurchführung<br />
bzw. 8 Jahre von <strong>der</strong> ersten Idee<br />
zur Fertigstellung. Dies ist für ein Projekt<br />
dieser Komplexität und Größenordnung<br />
unübertroffen.<br />
Autoren<br />
Dipl.-Ing. Architekt Mathis Gruhn,<br />
Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Klingl,<br />
Staatliches Bauamt München 2.<br />
mathis.gruhn@stbam2.bayern.de<br />
bernhard.klingl@stbam2.bayern.de<br />
Blick in einen Innenhof, Foto: Reinhold Pfeufer<br />
Blick in den OP, Foto: Reinhold Pfeufer<br />
18 bau intern November/Dezember 2013
Wohnheim für ältere<br />
Menschen mit Behin<strong>der</strong>ung<br />
in Mellrichstadt/<br />
Unterfranken<br />
Demographie und aktuelle Bedürfnisse<br />
Cornelia Breitzke, Johann Lechner<br />
Eingang und Terrasse<br />
Die demographische Entwicklung<br />
wirkt sich beson<strong>der</strong>s auf die nördlichen<br />
Landkreise in Unterfranken aus<br />
und umfasst alle hier lebenden Menschen.<br />
Allerdings sind Menschen mit<br />
Behin<strong>der</strong>ung von <strong>der</strong> demographischen<br />
Entwicklung in zweierlei Hinsicht<br />
betroffen, denn <strong>der</strong> Anteil älterer<br />
Menschen steigt auch innerhalb dieser<br />
Gruppe <strong>der</strong> Bevölkerung prozentual<br />
analog an. Gleichzeitig erhöht sich<br />
die Zahl <strong>der</strong> Personen, die bisher in<br />
<strong>der</strong> Familie gewohnt haben und jetzt<br />
von ihren Eltern altersbedingt nicht<br />
mehr betreut werden können. Der aktuelle<br />
Bedarf an Wohnplätzen - gerade<br />
für ältere Menschen mit Behin<strong>der</strong>ung<br />
und Pflegebedarf - ist tendenziell steigend.<br />
In den 50-iger Jahren wurden die<br />
ersten neuen Einrichtungen (Schulen,<br />
Tagesstätten, Wohnheime) für<br />
Menschen mit Behin<strong>der</strong>ung gebaut.<br />
Mittlerweile ist diese Nachkriegsgeneration<br />
auch im Renten alter. Fast die<br />
meisten alten Wohnheime sind nur für<br />
die üblichen „Werkstattgänger“ hinsichtlich<br />
Konzeption und funktionaler<br />
Bauausführung geeignet und entsprechen<br />
nicht den aktuellen Vorgaben zur<br />
Barrierefreiheit und dem Inklusionsgedanken.<br />
Deshalb muss die zusätzliche<br />
Schaffung von altersgerechten betreuten<br />
Wohnmöglichkeiten für unsere<br />
älteren Mitbürger mit Behin<strong>der</strong>ungen,<br />
die keine Werkstatt o<strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>stätte mehr besuchen können,<br />
ermöglicht werden - beson<strong>der</strong>s im<br />
Gesamtblick auf die demographische<br />
Entwicklung einschließlich <strong>der</strong> resultierenden<br />
Abhängigkeiten. Diese<br />
zentrale Aufgabe ist eine <strong>der</strong> vielen<br />
demographischen Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Gegenwart und wird uns sicherlich<br />
auch in den folgenden Jahren<br />
maßgeblich beschäftigen.<br />
Standort - Geschichte<br />
Das Jahr 2006 zählt in <strong>der</strong> Stadtgeschichte<br />
von Mellrichstadt sicherlich<br />
nicht zu den positivsten: Abzug<br />
<strong>der</strong> Bundeswehr verbunden mit <strong>der</strong><br />
Schließung <strong>der</strong> Hainbergkaserne. Am<br />
Ende desselben Jahres gab es dann<br />
auch noch das „Aus“ für das Kreiskrankenhaus.<br />
Wegfall von Arbeitsplätzen, erheblicher<br />
Zentralitäts- und Kaufkraftverlust,<br />
Wohnungsleerstand und Aufbruchstimmung<br />
mit negativer Tendenz<br />
waren nur einige <strong>der</strong> entwicklungsbedingten<br />
Schattenbegleiter. Diese<br />
absehbare Folgeentwicklung führte<br />
bereits im Jahr 2005 dazu Mellrichstadt<br />
in das Städtebauför<strong>der</strong>programm<br />
„Stadtumbau West“ aufzunehmen.<br />
Die damit verbundenen Chancen für<br />
die weitere Stadtentwicklung wurden<br />
im Rückblick richtig genutzt und äußerst<br />
positiv umgesetzt. Nach dem<br />
Abbruch des ehemaligen Kreiskrankenhauses<br />
war die zügige Umnutzung<br />
<strong>der</strong> Krankenhausbrache an einer<br />
städtebaulich dominanten Stelle durch<br />
eine sinnvolle Neubebauung oberstes<br />
För<strong>der</strong>ziel. Aus diesem Grund unterstützten<br />
<strong>der</strong> Landkreis und die Stadt<br />
Mellrichstadt die schnelle Realisierung<br />
durch einen kostenfreien und baureifen<br />
Grundstücksübertrag (in Erbpacht)<br />
an den Nachnutzer.<br />
Die Lebenshilfe Rhön - Grabfeld<br />
e.V. war bereit an dieser Stelle zu investieren,<br />
errichtete ein Wohnheim<br />
mit 24 Wohnplätzen (plus 4 Verhin<strong>der</strong>ungspflegeplätze)<br />
und strukturierter<br />
Tagesbetreuung.<br />
Das sozialpädagogische Konzept<br />
wurde speziell für die Lebenssituation<br />
von älteren Menschen mit Behin<strong>der</strong>ung<br />
entwickelt, so dass ein zukunftsorientiertes<br />
Projekt mit einem hohen<br />
Identifikationswert entstehen konnte.<br />
In dieser Form ist es die erste Einrichtung<br />
in Unterfranken und übernimmt<br />
eine Vorreiterrolle.<br />
Das Gebäude liegt in zentraler<br />
Ortslage von Mellrichstadt, in südwestlicher<br />
Richtung zum Ortskern<br />
(Entfernung ca. 1100 m). In unmittelbarer<br />
Nachbarschaft befinden sich<br />
Wohnbauten entlang <strong>der</strong> Suhlestraße<br />
und das Altenheim <strong>der</strong> Franziska -<br />
Streitelstiftung mit Nutzungsmöglichkeiten<br />
für kooperative Querschnittsdienste.<br />
Insgesamt ist <strong>der</strong> Neubau<br />
durch seine Lage im Wohngebiet<br />
Hainberg städtebaulich gut eingebunden.<br />
Es sind zwei Erweiterungsflächen<br />
für jeweils 12 Plätze vorgesehen.<br />
Aktuell wird ein gemeinsamer<br />
Generationenspielplatz, öffentlich zugänglich<br />
für alle, geplant.<br />
Baukörper und Entwurfsgedanken<br />
Das Gebäude erfüllt insbeson<strong>der</strong>e<br />
hohe Anfor<strong>der</strong>ungen an die barrierefreie<br />
Gestaltung und Bebauung. Dem<br />
kam <strong>der</strong> Umstand zu Gute, dass das<br />
Gelände groß genug war um ein eingeschossiges<br />
Gebäude (teilunterkellert)<br />
zu planen, bei dem alle Räume<br />
ohne Aufzüge erreichbar sind. Die Verkehrsflächen<br />
sind großzügig für Rollstuhlfahrer<br />
ausgelegt, denn viele Bewohner<br />
sind nicht mehr mobil.<br />
Der in Massivbauweise errichtete<br />
Baukörper verfügt insgesamt über<br />
großzügige Belichtungsflächen - be<br />
bau intern November/Dezember 2013 19
son<strong>der</strong>s in den unterschiedlich gestalteten<br />
Aufenthaltszonen, die gemeinschaftlich<br />
genutzt werden können.<br />
Die zentrale Eingangshalle, <strong>der</strong> höhere<br />
Gebäudeteil, wird von den Bewohnern<br />
zum „wohnen und essen“ genutzt.<br />
Gleichzeitig dient sie in 1. Linie als eine<br />
Art „Aktivzone“ und Treffpunkt für alle<br />
Bewohner, die Geselligkeit wünschen.<br />
Wichtig sind maximale Wahlmöglichkeiten<br />
in <strong>der</strong> täglichen Begegnung für<br />
die Bewohner anbieten zu können.<br />
Im angrenzenden linken und rechten<br />
Gebäudeflügel befinden sich die<br />
Bewohnerzimmer und offene Aufenthaltsbereiche,<br />
die geschickt die ohnehin<br />
schon abwechslungsreich gestalteten<br />
Flure, bereichern. Sie bieten<br />
reale Möglichkeiten für angenehme<br />
Kommunikationszonen mit positiver<br />
Aufenthaltsqualität. Ebenfalls sind hier<br />
die erfor<strong>der</strong>lichen Funktions- und Nebenräume<br />
(Wäscheräume, Abstellbereiche<br />
für Gehhilfen/Rollstühle, Fäkalienräume<br />
etc.) angeordnet.<br />
Das Bindeglied zwischen beiden<br />
Flügeln ist <strong>der</strong> Wirtschaftsbereich (notwendige<br />
Hauswirtschafts- und Versorgungsräume)<br />
mit <strong>der</strong> gemeinsamen<br />
Küche, die sogar „Einblicke“ bietet.<br />
Die Anlieferzone ist im rückwärtigen<br />
Bereich, entgegengesetzt vom Haupteingang,<br />
situiert.<br />
Der zentral gelegene Verwaltungstrakt<br />
schließt unmittelbar an die<br />
Eingangshalle. Beson<strong>der</strong>heit ist dort<br />
ein offener Arbeitsplatz und attraktiver<br />
Servicepunkt für alle Bewohner.<br />
Rechts vom Eingang aus gelangt man<br />
in den separaten Tagesstrukturbereich<br />
mit mehreren Therapie- und Beschäftigungsräumen.<br />
Der Wohn- und Beschäftigungsbereich<br />
für die Tagesbetreuung<br />
wurde bewusst getrennt und<br />
als zweiter Lebensraum für die Bewohner<br />
entwickelt.<br />
Gestaltung<br />
Durch die gelungene bauliche Gestaltung<br />
des Baukörpers und die akzentuierte<br />
Farbgebung und Materialienauswahl<br />
konnten die Architekten<br />
Karch-Fuchs eine wohnliche und anregende<br />
Umgebung schaffen. Dazu gehören<br />
die individuellen Wohn-Schlafräume,<br />
die einen privaten Charakter<br />
und Lebensraum vermitteln. In diesem<br />
Haus sind das ausschließlich Einzelzimmer<br />
mit Vorraumzone. Jeweils<br />
zwei Bewohner benutzen gemeinsam<br />
einen Sanitärraum mit Dusche<br />
und WC. Je<strong>der</strong> Bewohner kann von<br />
Zentraler Wohn- und Essraum mit offenem Servicebüro<br />
Flur mit selbst gestaltetem Kunstwerk<br />
seinem Zimmer direkt in einen eigenen<br />
Freibereich gehen o<strong>der</strong> gefahren<br />
werden.<br />
Es wurden bewusst offene Gestaltungsspielräume<br />
für die Bewohner gelassen,<br />
die in Gemeinschaftsräumen,<br />
Räumen für Begegnung und Freizeitgestaltung<br />
bereits aktiv erobert werden.<br />
Die Freiflächengestaltung unterstreicht<br />
dieses individuelle Bestreben<br />
und ergänzt die unterschiedlichen Erlebnismöglichkeiten<br />
<strong>der</strong> Bewohner in<br />
einem fließenden Übergang von innen<br />
und außen. Die Bepflanzungen werden<br />
noch ergänzt.<br />
In einem eigenen Gebäudeflügel<br />
sind ansprechende Räume für eine<br />
strukturierte, abwechslungsreiche Tagesbetreuung<br />
vorgesehen, die auf die<br />
speziellen Bedürfnisse dieser Zielgruppe<br />
ausgerichtet sind.<br />
För<strong>der</strong>ung<br />
Für den Bau des Wohnheims konnten<br />
staatliche Zuschüsse aus dem Ressortbereich<br />
des Sozialministeriums in<br />
Höhe von 1,92 Mio. € (Gesamtbaukosten<br />
3,287 Mio. €) bewilligt werden.<br />
Weitere För<strong>der</strong>geber sind <strong>der</strong> Bezirk<br />
Unterfranken und die Bayerische Landesstiftung.<br />
Die Stadt Mellrichstadt<br />
stellte das Grundstück zur Verfügung.<br />
Durch das Zusammenwirken vieler<br />
Beteiligter konnte am 07. Oktober<br />
2012 das Wohnheim gemeinsam mit<br />
<strong>der</strong> Landtagspräsidentin und Vorsitzenden<br />
des Landesverbandes <strong>der</strong> Lebenshilfe<br />
Bayern e.V. Barbara Stamm<br />
feierlich eingeweiht werden.<br />
Unser beson<strong>der</strong>er Dank gilt generell<br />
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
(Heimleiter/Betreuer/sonstiges<br />
„Einblick“ vom Flur in die Küche<br />
Zum Flur offener Wohnbereich <strong>der</strong> Wohngruppe<br />
Personal/Verantwortliche…) - die sogenannten<br />
„Guten“, die sich um diese<br />
Menschen in positiver Weise bemühen,<br />
sie geduldig betreuen und Ihnen<br />
das Gefühl „etwas wert zu sein“<br />
schenken.<br />
Autoren<br />
Baudirektorin Dipl.-Ing. (Univ.) Architektin<br />
Cornelia Breitzke, Bauoberrat<br />
Dipl.-Ing. (Univ.) Architekt Johann<br />
Lechner,<br />
Regierung von Unterfanken<br />
cornelia.breitzke@reg-ufr.bayern.de<br />
johann.lechner@reg-ufr.bayern.de<br />
Fotos:<br />
Karch-Fuchs Architekten<br />
20 bau intern November/Dezember 2013
Wohnen in allen Lebensphasen<br />
Umgestaltung des Wohnblocks am<br />
Ludwigkai in Würzburg -<br />
Die Mischung macht´s!<br />
Karin Sandeck, Oliver Seischab<br />
Die Wohnanlage am Ludwigkai im<br />
Würzburger Stadtteil San<strong>der</strong>au besteht<br />
aktuell aus einer dreiseitigen<br />
Blockrandbebauung, die einen Innenhof<br />
umschließt. Der Ludwigkai verläuft<br />
zwischen dem östlichen Mainufer<br />
und den Bestandsgebäuden im<br />
Westen <strong>der</strong> Wohnanlage. Die heutige<br />
Bausubstanz stammt, bis auf die<br />
ursprünglichen Kellergeschoße, aus<br />
dem Wie<strong>der</strong>aufbau <strong>der</strong> unmittelbaren<br />
Nachkriegszeit.<br />
Der Startschuss für die grundlegende<br />
Umgestaltung des Wohnblocks<br />
fiel im Jahr 2007 mit <strong>der</strong> Auslobung<br />
eines Architektenwettbewerbs. Der<br />
erste Preis, <strong>der</strong> vom Preisgericht<br />
zur Ausführung vorgeschlagen wurde,<br />
konnte vom ortsansässigen Büro<br />
kuntz + manz Architekten zusammen<br />
mit Lohrer Hochrein Landschaftsarchitekten<br />
aus München gewonnen werden.<br />
Die Stadtbau Würzburg GmbH als<br />
Bauherrin entschied sich, die Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
und Umstrukturierung von<br />
Bestandswohnungen in Verbindung<br />
mit Ersatz- und Ergänzungsbauten in<br />
insgesamt vier Bauabschnitten durchzuführen.<br />
Modellvorhaben <strong>der</strong> Obersten<br />
Baubehörde mit Fokus auf dem<br />
demografischen Wandel<br />
Diese Gesamtbaumaßnahme ist<br />
eines von zwölf ausgewählten Pilotprojekten<br />
des Modellvorhabens "WAL<br />
- Wohnen in allen Lebensphasen", das<br />
vom Experimentellen Wohnungsbau<br />
<strong>der</strong> Obersten Baubehörde im Jahr<br />
2005 initiiert wurde und zum Ziel hat,<br />
innovative Wohnkonzepte umzusetzen,<br />
die dem demographischen und<br />
gesellschaftlichen Wandel beson<strong>der</strong>s<br />
Rechnung tragen.<br />
Die Zahl älterer Menschen steigt signifikant<br />
an. Viele Senioren wünschen<br />
sich möglichst lange in <strong>der</strong> eigenen<br />
Wohnung und in vertrauter Nachbarschaft<br />
leben zu können. Dafür müssen<br />
einerseits die baulichen Voraussetzungen<br />
geschaffen sein - im Gebäude<br />
und auch in den Freibereichen <strong>der</strong><br />
Wohnanlage. An<strong>der</strong>erseits bedarf es<br />
nachbarschaftlicher Hilfe und professioneller<br />
Unterstützung im Alltag und<br />
bei <strong>der</strong> evtl. notwendigen Pflege.<br />
Bei den Pilotprojekten des Modellvorhabens<br />
wurden auf die lokale<br />
Situation beson<strong>der</strong>s zugeschnittene<br />
beispielhafte Wohnkonzepte umgesetzt,<br />
die sowohl geeignet sind für Ansprüche<br />
aus einer aktiven Lebensgestaltung<br />
im Alter, als auch für den Fall<br />
einer notwendigen Betreuungs- o<strong>der</strong><br />
Pflegephase. Dabei ist die barrierefreie<br />
Ausgestaltung von Wohngebäuden<br />
verknüpft mit unterschiedlichen<br />
Konzepten <strong>der</strong> nachbarschaftlichen<br />
Unterstützung und professionellen Betreuung<br />
bei Bedarf.<br />
Die Maßnahmen umfassen Neubauten,<br />
Mo<strong>der</strong>nisierungen und Ergänzungen<br />
von bestehenden Gebäuden<br />
die innerhalb <strong>der</strong> Kostenvorgaben <strong>der</strong><br />
Wohnraumför<strong>der</strong>ung zu realisieren<br />
waren.<br />
Dreiseitig umschließt die Blockrandbebauung den Innenhof,<br />
<strong>der</strong> neu gestaltet wurde und durch zwei Neubauten<br />
im vierten Bauabschnitt nachverdichtet wird<br />
(Lageplan ohne Maßstab).<br />
Überzeugendes Planungs- und<br />
Umsetzungskonzept<br />
An <strong>der</strong> Wohnzeile entlang des Ludwigkai<br />
startete die Gesamtmaßnahme<br />
im ersten Bauabschnitt im Juli<br />
2009 mit einer umfangreichen Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
von 61 Bestandswohnungen.<br />
Das Büro GKP Architekten<br />
GmbH aus Würzburg, im Realisierungswettbewerb<br />
mit dem dritten<br />
Preis prämiert, zeichnet für diesen Bereich<br />
verantwortlich. Augenfällig sind<br />
nach Mo<strong>der</strong>nisierung die an die Wohnungen<br />
zum Ludwigkai angebauten<br />
sogenannten "Mainerker", die für eine<br />
wesentliche Verbesserung <strong>der</strong> Wohnungsbelichtung<br />
sorgen und den Außenbezug<br />
zum Mainufer stärken. Auf<br />
<strong>der</strong> Seite des Innenhofs erhielten die<br />
Wohneinheiten großzügige Balkone.<br />
Doch die Gebäudezeile wurde nicht<br />
nur hinsichtlich Fassadengestaltung<br />
und Freisitzen verbessert. Die Wohnungen<br />
entsprechen nach Grundrissmodifikationen<br />
und vergrößerten<br />
Bä<strong>der</strong>n nun auch den verän<strong>der</strong>ten<br />
Bedürfnissen <strong>der</strong> Bewohner in den<br />
verschiedenen Altersgruppen. Der<br />
energetische Standard nach Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
erfüllt die Anfor<strong>der</strong>ungen des<br />
KfW-Effizienzhauses 70 (EnEV 2009).<br />
Die Sanierung <strong>der</strong> südlichen Gebäudezeile<br />
des Wohnblocks an <strong>der</strong> Rückertstraße<br />
als zweiter Bauabschnitt<br />
erfolgte in einfacherem Standard im<br />
bewohnten Zustand, um die Mieten<br />
gezielt niedrig zu halten. Dieses Gebäude<br />
mit 24 Wohnungen wurde von<br />
2010 bis 2011 energetisch saniert sowie<br />
alle Bä<strong>der</strong> und die Haustechnik<br />
erneuert.<br />
Um das Wohnungsangebot im<br />
Quartier mit rundum barrierefreien<br />
Wohnungen zu ergänzen, entschied<br />
sich die Bauherrin an <strong>der</strong> Sonnenstraße<br />
für einen Abbruch des Gebäudes<br />
bis auf das Kellergeschoß und einen<br />
Ersatzneubau mit 22 Wohnungen. Im<br />
Oktober 2012 war Fertigstellung <strong>der</strong><br />
zwei neuen Gebäudeeinheiten, die<br />
sämtliche Wohnungen barrierefrei<br />
o<strong>der</strong> rollstuhlgerecht anbieten. Mit <strong>der</strong><br />
Planung dieses Bauabschnitts wurde<br />
ebenfalls das Büro GKP Architekten<br />
GmbH beauftragt.<br />
Im Frühjahr 2014 wird <strong>der</strong> letzte<br />
Bauabschnitt in diesem Quartier realisiert.<br />
Das Büro kuntz + manz aus<br />
Würzburg gemeinsam mit Marcus<br />
Rommel aus Stuttgart sind mit dieser<br />
Aufgabe betraut. Der östliche Bereich<br />
des großen Innenhofs wird mit zwei<br />
neuen Wohngebäuden mit jeweils<br />
voraussichtlich 17 barrierefreien und<br />
rollstuhlgerechten Wohneinheiten<br />
nachverdichtet werden. In einem <strong>der</strong><br />
beiden Baukörper steht dann im Erdgeschoss<br />
ein Gemeinschaftsraum für<br />
die Mieter <strong>der</strong> Stadtbau GmbH zur Verfügung.<br />
Raum für nachbarschaftliche Kontakte<br />
bieten die neu gestalteten, barrierefrei<br />
ausgebauten Freibereiche.<br />
WAL-Ziele in Würzburg<br />
Entsprechend <strong>der</strong> Ziele des Modellvorhabens<br />
WAL wird nach Abschluss aller<br />
Bauabschnitte durch die Kombination<br />
aus Mo<strong>der</strong>nisierungen in einfachem<br />
und gehobenerem Standard, Ersatz<br />
bau intern November/Dezember 2013 21
54.000 Euro Zuschuss zum Wettbewerbsverfahren.<br />
Die Gesamtmaßnahme erhielt<br />
im September 2013 einen <strong>der</strong> insgesamt<br />
zehn vergebenen Preise des<br />
Deutschen Bauherrenpreises in <strong>der</strong><br />
Kategorie Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> Aktion<br />
„Hohe Qualität - Tragbare Kosten“ im<br />
Wohnungsbau. Die Jury überzeugte<br />
Neu gestaltete Straßenfassade entlang des Ludwigkai. Foto: Henning Koepke,<br />
München<br />
Der Innenhof wird westlich (links im Bild) von den mo<strong>der</strong>nisierten Bestandsgebäuden<br />
des ersten und nördlich vom Ersatzneubau des dritten Bauabschnitts begrenzt.<br />
Foto: Henning Koepke, München<br />
neubau und Neubauten im Innenhof<br />
ein sehr differenziertes Wohnungsangebot<br />
mit einer großen Bandbreite<br />
von verschiedenen Wohnungsgrößen<br />
für alle Lebenssituationen und unterschiedliche<br />
„Geldbeutel“ zur Verfügung<br />
stehen. Damit ist die Grundlage<br />
für eine gut durchmischte Altersstruktur<br />
und lebendige Nachbarschaft geschaffen.<br />
Dieses breite Angebot ermöglicht<br />
zudem Umzüge innerhalb<br />
des Quartiers z.B., wenn eine rollstuhlgeeignete<br />
Wohnung benötigt<br />
wird. Unterstützt wird diese Differenzierung<br />
durch den Einsatz von zwei<br />
unterschiedlichen Wohnraumför<strong>der</strong>programmen<br />
und des Angebots an<br />
freifinanzierten Wohnungen. Im Zuge<br />
eines Gesamtkonzepts zur Barrierefreiheit<br />
für die Wohnanlage erfolgt<br />
ein Ausgleich mangeln<strong>der</strong> rollstuhlgerechter<br />
Wohnungen im Bestand durch<br />
Neubauten im dritten und vierten Bauabschnitt.<br />
Barrieren in den Bestandsgebäuden<br />
konnten in sinnvollem Umfang<br />
vermin<strong>der</strong>t werden.<br />
Rollstuhlgerechte Wohnungen liegen<br />
in den Neubauten, in denen sie<br />
auch wirtschaftlich geschaffen werden<br />
konnten.<br />
Durch einen Kooperationsvertrag<br />
mit <strong>der</strong> Caritas im unmittelbar benachbarten<br />
St. Thekla Seniorenzentrum<br />
können insbeson<strong>der</strong>e ältere Mieter<br />
ambulante Pflegeleistungen, häus<br />
lichen Notruf und verschiedene weitere<br />
Service-Angebote zu günstigen<br />
Preisen in Anspruch nehmen. Im Pflegefall<br />
können die Bewohner in dieses<br />
Seniorenzentrum umziehen und so<br />
in <strong>der</strong> vertrauten Umgebung bleiben.<br />
Mobile Serviceleistungen wie Essenslieferung<br />
in die Wohnung stehen den<br />
Bewohnern durch die Zusammenarbeit<br />
mit dem Malteser Hilfsdienst e.V.<br />
zur Verfügung. Die Stadtbau GmbH<br />
wird testweise ihren zukünftigen Mietern<br />
für Serviceleistungen ein Gutscheinheft<br />
zu den Mietvertragsunterlagen<br />
übergeben.<br />
Preiswürdiges Engagement zur<br />
Aufwertung des Quartiers<br />
Die Bauherrin investierte mit großem<br />
Einsatz in die Wertbeständigkeit<br />
<strong>der</strong> Anlage und in ein zukunftsfähiges<br />
Gesamt-Wohnkonzept. Zusätzlich ist<br />
die Siedlung auch aus energetischer<br />
Sicht beson<strong>der</strong>s nachhaltig: wegen<br />
<strong>der</strong> hohen energetischen Standards<br />
aller Bauabschnitte wird <strong>der</strong> Heizwärmebedarf<br />
<strong>der</strong> Gesamtmaßnahme auf<br />
51% des Ausgangswertes minimiert<br />
sein, bei insgesamt deutlicher Wohnflächenvergrößerung.<br />
Rund 6,7 Millionen Euro zinsgünstiges<br />
Darlehen für die ersten drei<br />
Bauabschnitte des gesamten Bauvorhabens<br />
wurde vom Freistaat Bayern<br />
zur Verfügung gestellt. Hinzu kamen<br />
beson<strong>der</strong>s die „sensiblen baulichen<br />
Interventionen mit angemessenem<br />
Aufwand in vier Ausbaustandards“.<br />
Dies wurde von <strong>der</strong> Stadtbau GmbH<br />
und den Architekten erzielt in einer<br />
„ausdrucksstarken zeitgenössischen<br />
Architektursprache mit einer nutzerfreundlichen<br />
Innenhofgestaltung“. In<br />
<strong>der</strong> Würdigung <strong>der</strong> Jury wird darüber<br />
hinaus hervorgehoben, dass „Altmieter<br />
großenteils gehalten werden und in<br />
ihre Wohnung zurückziehen“ konnten.<br />
Autoren<br />
Ministerialrätin Dipl.-Ing. Karin Sandeck,<br />
Oberste Baubehörde<br />
karin.sandeck@stmi.bayern.de<br />
Bauoberrat Dipl.-Ing. Oliver Seischab,<br />
Oberste Baubehörde<br />
oliver.seischab@stmi.bayern.de<br />
22 bau intern November/Dezember 2013
Ortsumgehung<br />
Zimmern, Stadt Pappenheim<br />
Andreas-Michael Buchner,<br />
Michael Schätzl<br />
Geographische Lage<br />
Die Ortschaft Zimmern ist im südlichen<br />
Mittelfranken gelegen und gehört<br />
politisch zur Stadt Pappenheim.<br />
Durch Zimmern verläuft die Staatsstraße<br />
2230, die ihren Anfang im<br />
südlichen Mittelfranken südlich von<br />
Gunzenhausen nimmt und über das<br />
nördliche Oberbayern und die Oberpfalz<br />
nach Rohr in Nie<strong>der</strong>bayern führt.<br />
Im Durchschnitt fahren täglich fast<br />
3.900 Fahrzeuge durch den 260 Einwohner<br />
zählenden Ort, davon 336<br />
schwere LKW. Im bayernweiten Vergleich<br />
liegt <strong>der</strong> Schwerverkehrsanteil<br />
von 8,8 % damit deutlich über<br />
dem landesweiten Durchschnitt von<br />
6,2 %. Der hohe Schwerverkehrsanteil<br />
rührt zu einem erheblichen Anteil<br />
aus den Steinbruchbetrieben im fränkischen<br />
Jura zwischen Weißenburg<br />
und Treuchtlingen her. Der Verkehr<br />
stellt in <strong>der</strong> engen Ortsdurchfahrt von<br />
Zimmern eine starke Belastung für die<br />
Ortsbürger dar. An<strong>der</strong>erseits schränkt<br />
die Ortsdurchfahrt die Leichtigkeit des<br />
überörtlichen Staatsstraßenverkehrs<br />
erheblich ein.<br />
Geographisch ist Zimmern an einer<br />
engen Flussschleife im Altmühltal auf<br />
über 410 m ü. NN gelegen. Wahrzeichen<br />
von Zimmern ist <strong>der</strong> Hollerstein,<br />
ein imposanter Fels, <strong>der</strong> nördlich von<br />
Zimmern über den Häusern thront.<br />
Dieser Bereich ist auch in ökologischer<br />
Hinsicht beson<strong>der</strong>s wertvoll, erstreckt<br />
sich über ihn doch ein Fauna-Flora-<br />
Habitat-Gebiet und ein europäisches<br />
Vogelschutzgebiet. Südlich von Zimmern<br />
schmiegt sich die Altmühl in<br />
einer engen Schleife an den Ortsrand<br />
an. Entlang dieser Altmühlschleife<br />
bewegt sich <strong>der</strong> bei Radlern sehr beliebte<br />
Altmühltalradweg, <strong>der</strong> eine Magistrale<br />
im Bayernnetz für Radler darstellt.<br />
Jenseits <strong>der</strong> Altmühl erklimmt<br />
<strong>der</strong> Kirchenberg die Höhen des Jura.<br />
Anfang <strong>der</strong> 2000er Jahre haben sowohl<br />
die Bürger von Zimmern als auch<br />
die Steinbruchindustrie auf die Lösung<br />
des Konflikts zwischen Wohnqualität,<br />
Verkehr, Natur und Landschaftsbild<br />
gedrängt. Die bayerische Straßenbauverwaltung<br />
hat deshalb die Ortsumgehung<br />
von Zimmern für die Aufnahme<br />
in den 6. Ausbauplan angemeldet und<br />
eine Einstufung in die 1. Dringlichkeit<br />
erreicht.<br />
Planung<br />
Bei <strong>der</strong> Planung <strong>der</strong> Ortsumgehung<br />
Zimmern wurden zunächst Linien im<br />
Norden o<strong>der</strong> Süden von Zimmern untersucht.<br />
Eine Nordumgehung von<br />
Zimmern schied aufgrund <strong>der</strong> topographischen<br />
und naturräumlichen<br />
Gegebenheiten – europäisches Vogelschutzgebiet<br />
und Fauna-Flora-Habitat-Gebiet<br />
– sowie <strong>der</strong> vorhandenen<br />
Bebauung jedoch von vorneherein<br />
aus. Südlich von Zimmern wurden<br />
drei mögliche Linienführungen gegenübergestellt:<br />
Eine ortsnahe Umgehung,<br />
eine ortsferne Umgehung<br />
und eine Umgehung in mittlerer Entfernung.<br />
Allen Varianten ist gleich,<br />
dass die Altmühl zweimal zu überqueren<br />
ist. Außerdem muss bei den zwei<br />
ortsferneren Varianten <strong>der</strong> südlich<br />
von Zimmern gelegene Kirchenberg<br />
durchfahren werden. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen<br />
entschieden sich die<br />
Planer für die mittlere, 920 m lange<br />
Variante, weil sich die Länge und Kosten<br />
für das überschüttete Bauwerk<br />
deutlich vermin<strong>der</strong>n ließen.<br />
Für die Ortsumgehung wird im Jahr<br />
2025 eine Verkehrsmenge von 3.088<br />
Kfz/24 h prognostiziert und ein Schwerverkehrs-Anteil<br />
von rund 11 % erwartet.<br />
Zur Aufnahme dieser Verkehrsmenge<br />
wurde <strong>der</strong> Regelquerschnitt<br />
9,5 mit einer befestigten Fahrbahn von<br />
6,50 m Breite festgelegt. Die Baukosten<br />
<strong>der</strong> Maßnahme werden maßgeblich<br />
von den erfor<strong>der</strong>lichen Ingenieurbauwerken<br />
bestimmt und betragen<br />
aktuell rd. 5,2 Mio. €. Sie verteilen sich<br />
zu 1,6 Mio. € auf den Streckenbau, zu<br />
3,4 Mio. € auf die Brückenbauwerke<br />
und zu 200.000 € auf die Ausstattung<br />
und Bepflanzung. Kostenträger des<br />
Projekts ist <strong>der</strong> Freistaat Bayern.<br />
Die Ortsdurchfahrt von Zimmern<br />
wird zukünftig im Westen über eine<br />
Einmündung und im Osten über einen<br />
bestehenden Kreisverkehr an die neue<br />
Ortsumgehung von Zimmern angebunden<br />
und soll zur Gemeindestraße<br />
abgestuft werden.<br />
Brückenbau<br />
Wie eingangs beschrieben, ist für die<br />
Ortsumgehung Zimmern die zweimalige<br />
Überquerung <strong>der</strong> Altmühl, sowie<br />
die Durchörterung des Kirchenbergs<br />
notwendig. Die westliche Altmühlbrücke<br />
ist ein Zweifeldbauwerk mit einer<br />
Gesamtstützweite von 81 m. Direkt<br />
daran schließt das überschüttete Bauwerk<br />
im Bereich des Kirchenbergs,<br />
Blick auf Ortsumgehung mit Ortsanschlüssen, Altmühlschleife mit den drei Bauwerken, im Norden Zimmern,<br />
Mai 2013<br />
mit einer Sohllänge von 43 m, an. Die<br />
östliche Dreifeldbrücke über die Altmühl<br />
hat eine Gesamtstützweite von<br />
91 m. Für die beiden Altmühlbrücken<br />
wurde auf Grund <strong>der</strong> örtlichen Nähe<br />
zueinan<strong>der</strong> und zur Bebauung von<br />
Zimmern auf eine wirtschaftliche und<br />
sich in die Natur einfügende Gestaltung<br />
Wert gelegt. Beide tiefgegründeten<br />
Altmühlbrücken passen sich durch<br />
den zum Pfeiler hin stark angevouteten<br />
Überbau sehr gut in die vorhandene<br />
Ufervegetation ein. Um die Ansichtsflächen<br />
<strong>der</strong> Brücken jedoch nicht<br />
zu massiv erscheinen zu lassen wurden<br />
über den Pfeilern Aussparungen<br />
in den Stegen des Überbaus herge<br />
bau intern November/Dezember 2013 23
stellt und damit den Brücken mehr<br />
Transparenz verliehen.<br />
Durch unterschiedliche Lagerungsarten<br />
kommt <strong>der</strong> Ruhepunkt <strong>der</strong><br />
Brücken jeweils in Brückenmitte zu<br />
liegen, wodurch bei beiden Altmühlbrücken<br />
<strong>der</strong> Einbau von aufwendigen<br />
mehrteiligen Fahrbahnübergängen an<br />
den Wi<strong>der</strong>lagern vermieden werden<br />
konnten. So liegt die Dreifeldbrücke<br />
schwimmend auf Elastomerlagern auf<br />
und die Zweifeldbrücke wird am Pfeiler<br />
in Längsrichtung festgehalten. Das<br />
überschüttete Bauwerk wurde in den<br />
zwischen den beiden Altmühlarmen.<br />
Hierher führt nur eine einspurige Brücke,<br />
die auf 30 t zulässiges Gesamtgewicht<br />
beschränkt ist. Der Sorgfalt <strong>der</strong><br />
Baufirmen ist es zu verdanken, dass<br />
nach Abschluss <strong>der</strong> Hauptbautätigkeit<br />
an <strong>der</strong> Brücke keine Schäden aufgetreten<br />
sind.<br />
Schutz von Landschaft und Natur<br />
An <strong>der</strong> westlichen Altmühlbrücke wird<br />
ein Konflikt zwischen Fle<strong>der</strong>mäusen<br />
und dem Verkehr erwartet. Die hier<br />
angetroffene seltene Fle<strong>der</strong>mausart<br />
Retentionsraum<br />
Das Baufeld für die Ortsumgehung<br />
Zimmern liegt im Bereich des 100-jährigen<br />
Hochwassers <strong>der</strong> Altmühl. Die<br />
neu aufgeschütteten Dämme <strong>der</strong> Altmühlbrücken<br />
greifen in diesen Hochwasserretentionsraum<br />
ein. Durch das<br />
Projekt gingen insgesamt 11.000 m³<br />
Retentionsraum verloren, die wie<strong>der</strong>herzustellen<br />
waren. Es wurden deshalb<br />
innerhalb <strong>der</strong> Altmühlschleife<br />
zwei Flächen soweit abgegraben, dass<br />
dieser Retentionsraumverlust ortsnah<br />
ausgeglichen werden konnte. Die<br />
Untersicht Dreifeldbrücke mit ausgesparten Stegplatten, für zusätzliche Transparenz<br />
Blick auf Zweifeldbrücke über die Altmühl mit Überflughilfe für Fle<strong>der</strong>mäuse und Gewölbebauwerk<br />
während Überschüttung<br />
massiven Kalkstein des Kirchenbergs<br />
flach gegründet. Bei dieser originären<br />
wirtschaftlichen Brückenkonstruktion<br />
werden die Lasten überwiegend als<br />
Druckkräfte in den Untergrund weitergeleitet.<br />
Durch die hohe nahezu halbrunde<br />
Querschnittsform des Portals<br />
kann viel Licht ins Bauwerk gelangen,<br />
was sich positiv auf die Verkehrssicherheit<br />
auswirkt.<br />
Altmühltalradweg<br />
Der Altmühltalradweg im Bayernnetz<br />
für Radler durchquert das komplette<br />
Baufeld. Bis zu 1.000 Radler nutzen<br />
an schönen Tagen diesen touristischen<br />
Radwan<strong>der</strong>weg bei Zimmern.<br />
Der Baubetrieb musste daher Rücksicht<br />
auf den Radtourismus nehmen<br />
und gefahrlos für die Radler abgewickelt<br />
werden. Erreicht wurde dies<br />
durch ein mehrfaches Umlegen des<br />
Radwegs vom Ost- auf das Westufer<br />
<strong>der</strong> Altmühl. Das Ergebnis war ein reibungsloses<br />
Nebeneinan<strong>der</strong> von Baubetrieb<br />
und Radtourismus. Der eine<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Radlerhalt wurde auch für<br />
einen informativen Einblick in die Baustelle<br />
genutzt. Eine weitere Schwierigkeit<br />
bestand in <strong>der</strong> eingeschränkten<br />
Erreichbarkeit des Hauptbaufeldes<br />
des großen Abendseglers fliegt überwiegend<br />
an Leitstrukturen wie Berghängen<br />
o<strong>der</strong> Gewässern entlang. Vom<br />
Pfeiler <strong>der</strong> westlichen Altmühlbrücke<br />
bis zum Portal des überschütteten Gewölbebauwerks<br />
wurden daher Überflughilfen<br />
für Fle<strong>der</strong>mäuse bei<strong>der</strong>seits<br />
<strong>der</strong> Straße mit einer Höhe von 4,0 m<br />
so angeordnet, dass die Fle<strong>der</strong>mäuse<br />
vom fließenden Verkehr nicht erfasst<br />
werden. Die gewählte Drahtgitterkonstruktion<br />
kann von den Fle<strong>der</strong>mäusen<br />
geortet und von Vögeln gesehen werden.<br />
Dabei war diese kostengünstige<br />
Lösung lediglich bei <strong>der</strong> Verankerung<br />
und den Pfosten <strong>der</strong> Leiteinrichtungen<br />
auf die statischen Anfor<strong>der</strong>ungen gegenüber<br />
<strong>der</strong> Gelän<strong>der</strong>konstruktion zu<br />
verstärken. Mit einer zurückhaltenden<br />
Farbgestaltung passt sich diese Konstruktion<br />
in das landschaftlich reizvolle<br />
Altmühltal dezent ein.<br />
Zur Erhaltung <strong>der</strong> Kulturlandschaft<br />
des Altmühltals gehört die Beweidung<br />
<strong>der</strong> Hangwiesen durch Schafe.<br />
Um einen von alters her bestehenden<br />
Schaftrieb aufrechterhalten zu können<br />
und die Einpassung ins Landschaftsbild<br />
zu verbessern, wurde das Bauwerk<br />
am Kirchenberg als überschüttetes<br />
Gewölbe ausgebildet.<br />
Wirksamkeit <strong>der</strong> neu geschaffenen<br />
Retentionsräume war eindrucksvoll<br />
anlässlich <strong>der</strong> Juni-Hochwasser im<br />
Sommer 2013 zu beobachten.<br />
Bauablauf<br />
Am 21.10.2011 fand <strong>der</strong> erste Spatenstich<br />
für die östliche Altmühlbrücke<br />
statt. Vom Mai 2012 bis Oktober 2012<br />
wurden die Straßendämme und Rampen<br />
für die Ingenieurbauwerke geschüttet<br />
sowie <strong>der</strong> Kirchenberg in offener<br />
Bauweise durchörtert. Der Bau<br />
für die westliche Altmühlbrücke sowie<br />
das überschüttete Bauwerk im Bereich<br />
des Kirchenbergs begann im August<br />
2012. Von August bis November 2013<br />
wurden die Arbeiten für den Oberbau<br />
<strong>der</strong> Strecke ausgeführt. Die Verkehrsfreigabe<br />
erfolgt am 2. Dezember 2013.<br />
Autoren<br />
Bauoberrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas-<br />
Michael Buchner, Dipl.-Ing. (Univ.)<br />
Michael Schätzl, Staatliches Bauamt<br />
Ansbach.<br />
andreas.buchner@stbaan.bayern.de<br />
michael.schaetzl@stbaan.bayern.de<br />
24 bau intern November/Dezember 2013
Der neue Winterdienstkoffer<br />
Von <strong>der</strong> Wetterprognose zur Echtzeitdarstellung<br />
Hubert Koch<br />
Entstehung<br />
Die Kurzbezeichnung WDK bedeutet<br />
Winterdienstkoffer und steht für die<br />
Entwicklung eines Informationssystems<br />
zur Koordinierung des Winterdienstes<br />
an Straßen- und Autobahnmeistereien.<br />
Entstanden ist das Projekt aus <strong>der</strong><br />
Idee heraus, die Winterdienstkoordinierung<br />
in eine Hand zu legen und<br />
diesen „Winterdienstkoordinator“ mit<br />
den neuesten elektronischen Hilfsmitteln<br />
auszustatten. So entstand im Jahr<br />
2004 <strong>der</strong> Winterdienstkoffer, bestehend<br />
aus einem Notebook, das stoßfest<br />
in einem Koffer eingebaut wurde<br />
und <strong>der</strong> einen Internetzugang über das<br />
Mobilfunknetz hatte. Die Software, die<br />
zur Visualisierung aller notwendigen<br />
Winterdienstkoffer (WDK)<br />
Informationen auf einer Oberfläche<br />
notwendig war, wurde in enger Zusammenarbeit<br />
mit den Benutzern <strong>der</strong><br />
Straßenmeistereien hausintern entwickelt.<br />
In <strong>der</strong> Winterdienstperiode 2004/<br />
2005 wurde <strong>der</strong> WDK zunächst in <strong>der</strong><br />
Straßenmeisterei Traunstein erprobt.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> guten Anwen<strong>der</strong>resonanz<br />
und dem Umstand, dass es zu<br />
dieser Zeit in ganz Bayern noch kein<br />
vergleichbares System gab, das die<br />
Funktionalitäten des Winterdienstkoffers<br />
erfüllte, wurde er zur Nutzung an<br />
den Straßen- und Autobahnmeistereien<br />
freigegeben. Mittlerweile sind<br />
ca. 60 Meistereien mit dem Winterdienstkoffer<br />
ausgestattet.<br />
Ausgangssituation in den Straßenmeistereien:<br />
In vielen Straßenmeistereien wurde<br />
<strong>der</strong> Winterdiensteinsatz traditionell<br />
von mehreren Personen ausgelöst,<br />
meistens von 3 bis 4 Straßenwärtern<br />
die wie<strong>der</strong>um 3 bis 4 Winterdienstfahrzeuge<br />
koordiniert haben.<br />
Je<strong>der</strong> dieser Winterdiensteinsatzleiter<br />
musste sich selbstständig über<br />
die Wettersituation erkundigen und<br />
eigenständig die ihm zugeordneten<br />
Winterdienstfahrzeuge alarmieren.<br />
Der Nachteil dieser Methode war<br />
<strong>der</strong> hohe Personalaufwand, die jeweils<br />
subjektive Interpretation <strong>der</strong> Straßenverhältnisse,<br />
die Schwierigkeit,<br />
Dispositionen bei Fahrzeugausfällen<br />
ohne Abstimmungen mit den an<strong>der</strong>en<br />
Winterdiensteinsatzleitern vornehmen<br />
zu können und das Fehlen eines Ansprechpartners,<br />
<strong>der</strong> für das gesamte<br />
Straßenmeistereigebiet einen Überblick<br />
über den Winterdienst hatte.<br />
Bei <strong>der</strong> neuen Methode wurde nur<br />
noch ein Winterdienstleiter für das gesamte<br />
Straßenmeistereigebiet eingesetzt.<br />
Mit dem Hilfsmittel WDK hat <strong>der</strong><br />
Winterdienstleiter auf einen Blick die<br />
Übersicht über die Wetter- und Winterdienstsituation<br />
und kann zugleich<br />
alle wichtigen Aktionen gerichtsfest<br />
protokollieren. Das Ergebnis ist eine<br />
effektive Winterdiensteinsatzleitung<br />
mit mehr Qualität und geringeren Kosten.<br />
Erfolgreiches Projekt:<br />
Dr. Marcel Huber zeichnete am 29.<br />
September 2011 in <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong><br />
Staatskanzlei die Jahresson<strong>der</strong>preisträger<br />
des staatlichen Vorschlagswesens<br />
aus. Dabei wurden erstmalig<br />
Jahresson<strong>der</strong>preise für beson<strong>der</strong>s herausragende<br />
Verbesserungsvorschläge<br />
vergeben. Das Staatliche Bauamt<br />
Traunstein erhielt für das Jahr 2007<br />
für den Innovationsvorschlag „Mobiler<br />
Winterdienstkoffer WDK“ eine<br />
Auszeichnung.<br />
In den Jahren 2009 bis 2013 wurden<br />
schwerpunktmäßig in den Straßenmeistereien<br />
Weiden und Viechtach/<br />
Zwiesel sog. „Winterdienst-Managementsystem“<br />
(WDMS) von privaten<br />
Anbietern getestet. Im Hinblick auf die<br />
Darstellung von aktuellen Daten sowie<br />
bei <strong>der</strong> Berücksichtigung von örtlichen<br />
Son<strong>der</strong>einstellungen zeigte sich, dass<br />
eine Weiterentwicklung des WDK die<br />
von den Anwen<strong>der</strong>n gestellten Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
schnell und praxisgerecht erfüllen<br />
kann. Seit 2011 entsteht nun <strong>der</strong><br />
neue WDK auf Grundlage bewährter<br />
Funktionen in <strong>der</strong> bestehenden Software<br />
verknüpft mit neuen innovativen<br />
Funktionalitäten.<br />
Der neue WDK<br />
Das neue System ist - wie schon<br />
<strong>der</strong> alte WDK- für den mobilen Einsatz<br />
geeignet. Genauso ist es aber<br />
auch möglich, die Software auf einem<br />
Festplatzrechner im Intranet zu verwenden.<br />
Als Datenquelle dient eine<br />
lokale SQL-Datenbank, die bei bestehen<strong>der</strong><br />
Intranet- bzw. Internetverbindung<br />
mit einer zentralen SQL-Datenbank<br />
synchronisiert wird. Die Vorteile<br />
liegen in <strong>der</strong> Funktionssicherheit bei<br />
Netzwerkausfällen und <strong>der</strong> besseren<br />
Performance. Pro Meisterei sind mehrere<br />
Arbeitsplätze mit verschiedenen<br />
Benutzerrechten möglich.<br />
Der neue WDK verfügt über folgende<br />
Module:<br />
– Darstellung einer Grundkarte des<br />
Straßennetzes<br />
– Darstellung <strong>der</strong> Räum- und Streupläne<br />
– Darstellung <strong>der</strong> Glatteismeldeanlagen<br />
– Darstellung <strong>der</strong> Wetterinformationen<br />
des Deutschen Wetterdienstes<br />
(DWD)<br />
– Administrationsmodul zur Einsatzauslösung,<br />
Steuerung und Dokumentation<br />
– Darstellung <strong>der</strong> Fahrzeugeinsätze in<br />
Echtzeit.<br />
Die Kartengrundlage für die Streckendarstellung<br />
bilden die Daten <strong>der</strong> Zentralstelle<br />
für Informationssysteme<br />
(ZIS). Die Zentralstelle für den Betriebsdienst<br />
(ZSB) stellt für die Räumund<br />
Streupläne die Daten aus <strong>der</strong> ITunterstützten<br />
Routenoptimierung zur<br />
Verfügung. Zusätzlich besteht die<br />
Möglichkeit, manuelle Streckenkonfigurationen<br />
anzulegen.<br />
Die Daten des Deutschen Wetterdienstes<br />
(DWD) mit den Wetterradarbil<strong>der</strong>n<br />
und den detaillierten Wetterberichten<br />
(siehe Abbildung 2) sowie die<br />
Daten <strong>der</strong> Glatteismeldeanlagen mit<br />
den aktuellen Fahrbahntemperaturen,<br />
<strong>der</strong> Luftfeuchte und den Webcam-<br />
Bil<strong>der</strong>n zur Beurteilung des Straßenzustandes<br />
(siehe Abbildung 3) dienen<br />
als Informationsplattform für die Entscheidungsfindung<br />
zur Auslösung <strong>der</strong><br />
Winterdiensteinsätze. Alle Informatio<br />
bau intern November/Dezember 2013 25
Integriertes Radarbild des Deutschen Wetterdienstes<br />
Fahrzeuge<br />
Winterdienstfahrzeuge mit<br />
Einsatzstatus, Anzahl <strong>der</strong><br />
Tages-Einsätze und aktuell<br />
zugeordnetem Fahrer<br />
Wichtige Partner im<br />
Winterdienst mit<br />
Erreichbarkeit,<br />
Symbol für „heute schon<br />
kontaktiert“<br />
Partner<br />
Einsatzdienste mit<br />
Erreichbarkeiten<br />
zum Aktivieren<br />
Protokollierung von<br />
Ereignissen im<br />
Winterdienst<br />
Ereignisse (10 Tage)<br />
Einsatzdienste<br />
Funktions-Einrichtungen<br />
Automatische Meldungen<br />
Maserer Schneekettenpflicht<br />
Straßensperre Seegaterl<br />
Funktionseinrichtungen<br />
(Straßensperrung,<br />
Schneekettenpflicht)<br />
können aktiviert werden<br />
Aktueller Standort <strong>der</strong><br />
Fahrzeuge mit<br />
Fahrtrichtungspfeil und<br />
Symbol je nach Tätigkeit<br />
Glättemeldeanlagen mit<br />
Alarmsymbol und Hyperlink<br />
zu Detailinformationen und<br />
Bil<strong>der</strong>n<br />
Kartenfenster mit Echtzeitdarstellung <strong>der</strong> Fahrzeuge<br />
nen stehen in <strong>der</strong> Software direkt im<br />
Kartenlayer bzw. als eigener Layer zur<br />
Verfügung. Zusätzlich dokumentiert<br />
das Wettermodul automatisch für jeden<br />
Winterdiensttag die allgemeine<br />
Wettersituation.<br />
Für die Einsatzplanung werden<br />
die täglichen Bereitschaftspläne hinterlegt.<br />
Je nach dem gewählten Arbeitszeitmodell<br />
sind die Zuordnungen<br />
für die Fahrzeuge, Einsatzdienste und<br />
Winterdienstpartner komfortabel einzupflegen.<br />
Je nach Datum und Uhrzeit<br />
steht dann <strong>der</strong> jeweils zuständige Fahrer<br />
bzw. Ansprechpartner im Kommunikationsmodul<br />
(Telefon-, SMS- und E-<br />
Mail-Funktionalität) zur Verfügung.<br />
Auch Schneekettenpflicht, Stra<br />
ßensperren usw. sind Funktionseinrichtungen,<br />
die frei positionierbar sind<br />
und mit verschiedenen Symbolen dargestellt<br />
werden können.<br />
Die Alarmierung des Winterdienstpersonals<br />
erfolgt mit einem Handy<br />
o<strong>der</strong> über das Festnetztelefon. Der<br />
Wählvorgang für die im Bereitschaftsplan<br />
eingetragene Person wird per<br />
26 bau intern November/Dezember 2013
Detailansicht <strong>der</strong> Glatteismeldeanlage<br />
Mausklick vom Notebook bzw. PC<br />
eingeleitet. Somit entfällt die Rufnummerneingabe<br />
per Hand.<br />
Der angefor<strong>der</strong>te Winterdiensteinsatz<br />
wird als „verständigt“ gekennzeichnet<br />
und das Erscheinen des<br />
Fahrzeuges auf <strong>der</strong> Karte (in Echtzeitfunktionalität)<br />
löst den Einsatz aus.<br />
Mit den Positionsdaten <strong>der</strong> Fahrzeuge<br />
werden auch Tätigkeit und Einsatzdaten<br />
wie Streudichte, Streubreite<br />
und Fahrbahntemperatur übertragen.<br />
Je nach Tätigkeit (Räumen, Streuen<br />
o<strong>der</strong> Leerfahrt) erfolgt die Darstellung<br />
des Fahrzeuges mit verschiedenen<br />
Symbolen (siehe Abb. 4).<br />
Einsatzdaten wie Zeitpunkt <strong>der</strong> Verständigung,<br />
Einsatzstart, Einsatzende<br />
sowie <strong>der</strong> GPS-Track mit Bezeichnung<br />
<strong>der</strong> gefahrenen Strecke werden in <strong>der</strong><br />
Datenbank gespeichert. Die Darstellung<br />
<strong>der</strong> Fahrzeugposition und Einsatzdaten<br />
in Echtzeit war bereits in <strong>der</strong><br />
Erprobungsphase eine sehr wichtige<br />
Information für den Winterdiensteinsatzleiter.<br />
Dadurch hatte er immer einen<br />
Überblick über den Standort seiner<br />
Fahrzeuge und konnte so schneller<br />
auf Unvorhergesehenes, wie Unfälle<br />
o<strong>der</strong> Fahrzeugausfälle reagieren. Gegenüber<br />
<strong>der</strong> Polizei und den Medien<br />
konnte <strong>der</strong> Winterdiensteinsatzleiter<br />
sofort Auskunft über die aktuelle Situation<br />
im Winterdienstgebiet geben.<br />
Beson<strong>der</strong>e Ereignisse im Winterdienst<br />
dokumentiert man per Mausklick.<br />
Vorbelegte Texte erleichtern die<br />
Eingabe und mit <strong>der</strong> Zuordnung einer<br />
„Wichtigkeitsstufe“ wird das Ereignis<br />
je nach Wichtigkeit mit einer definierten<br />
Farbe gekennzeichnet.<br />
Die Funktion „Automeldung“ löst -<br />
abhängig von definierten Ereignissen<br />
- verschiedene Aktionen wie das Anzeigen<br />
eines Meldefensters bzw. das<br />
Versenden einer SMS o<strong>der</strong> E-Mail aus.<br />
Je<strong>der</strong> Anruf, jede SMS und jedes<br />
E-Mail wird den jeweiligen Einsätzen,<br />
Ereignissen o<strong>der</strong> Verständigungen zugeordnet<br />
und gespeichert.<br />
Ein umfangreiches Berichtsmodul<br />
mit verschiedenen Filtermöglichkeiten<br />
dient zur Auswertung und Dokumentation<br />
<strong>der</strong> Winterdienstdaten.<br />
Die Fahrzeugpositionen und Einsatzzustände<br />
sowie die Daten <strong>der</strong><br />
Glatteismeldeanlagen sind rückwirkend<br />
grafisch darstellbar. Mit einer<br />
„Zeit-Navigationsleiste“ kann zu dem<br />
gewünschten Zeitpunkt navigiert und<br />
als Film in zwei Minuten-Sprünge abgespielt<br />
werden.<br />
Fazit:<br />
Das Projekt WDK des Staatlichen<br />
Bauamtes Traunstein entstand aus einer<br />
neuen Idee zur praxisorientierten<br />
Optimierung <strong>der</strong> Winterdienstkoordination.<br />
Es hat sich zu einem im<br />
praktischen Einsatz bewährten Standardwerkzeug<br />
für eine effektive und<br />
wirtschaftliche Winterdienstorganisation<br />
entwickelt.<br />
Bewährte Einzelmodule wie Glatteismeldeanlagen<br />
und Wettervorhersagen<br />
sind mit neu entwickelten<br />
Zusatzfunktionen (Einsatzpläne, Einsatzsteuerung,<br />
Echtzeitdarstellung<br />
<strong>der</strong> Fahrzeuge, Meldewesen und<br />
Dokumentation) zu einem ganzheitlichen<br />
Winterdienstmanagementsystem<br />
kombiniert.<br />
Die permanente praxisnahe Weiterentwicklung<br />
des WDK sichert die<br />
Akzeptanz und Zukunftsfähigkeit des<br />
innovativen Projektes WDK.<br />
Damit hat sich <strong>der</strong> WDK von seiner<br />
Grundphilosophie des WD-Koffers<br />
als mobile Einheit weiterentwickelt zu<br />
einem ganzheitlichen Winterdienstsystem,<br />
dem WD-Koordinator.<br />
Autor<br />
Hubert Koch, Staatliches Bauamt<br />
Traunstein<br />
hubert.koch@stbats.bayern.de<br />
bau intern November/Dezember 2013 27
Neue Normenreihe DIN<br />
18008 „Glas im Bauwesen<br />
– Bemessungs- und<br />
Konstruktionsregeln“<br />
Informationen zu den Normen DIN<br />
18008 Teil 1 bis Teil 5<br />
Hubertus Wambsganz<br />
Historie<br />
Früher übernahm Glas i. d. R. nur<br />
„ausfachende“ und damit für die öffentliche<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
weitgehend unbedenkliche Aufgaben<br />
(z.B. als Fenster- und Türverglasungen).<br />
Deswegen bedurften diese<br />
Glaskonstruktionen in bauaufsichtlicher<br />
Hinsicht keiner beson<strong>der</strong>en<br />
Bemessung. Seit ca. 25 - 30 Jahren<br />
finden Glaskonstruktionen nun zunehmend<br />
aber auch als Glasdächer,<br />
Glasfassaden, begehbare Glasböden<br />
o<strong>der</strong> absturzsichernde Verglasungen<br />
und sogar als tragende Glaselemente<br />
(Ganzglastreppe s. Abbildung, Glasstützen,<br />
Glasunterzüge, Glasschwerter,<br />
etc.) Verwendung und sind damit<br />
in Bereichen eingesetzt, in denen<br />
ein Versagen zu einer ernsten Gefährdung<br />
<strong>der</strong> in Art. 3 Abs. 1 Bayerischer<br />
Bauordnung (BayBO) genannten<br />
Schutzziele führen kann. Für<br />
<strong>der</strong>artige (neue) Einsatzgebiete des<br />
Baustoffs Glas sind bestimmte bauaufsichtliche<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen zu erfüllen.<br />
Zu diesem Zweck erarbeiteten<br />
in den vergangenen Jahren Vertreter<br />
<strong>der</strong> deutschen Bauaufsicht in Zusammenarbeit<br />
mit dem Deutschen Institut<br />
für Bautechnik (DIBt) in Berlin für die<br />
Planung, Bemessung und Ausführung<br />
von Glaskonstruktionen die Richtlinien<br />
„Technische Regeln für die Verwendung<br />
von linienförmig gelagerten<br />
Verglasungen (TRLV)“ - Fassungen<br />
August 2006 (Vorgängerfassung September<br />
1998) -, “Technische Regeln<br />
für die Bemessung und die Ausführung<br />
punktförmig gelagerter Verglasungen<br />
(TRPV)“ - Fassung August<br />
2006 - und “Technische Regeln für<br />
die Verwendung von absturzsichernden<br />
Verglasungen (TRAV)“ - Fassung<br />
Januar 2003 -, die alle inzwischen als<br />
Technische Baubestimmung bauaufsichtlich<br />
eingeführt und als solche zu<br />
beachten sind, sowie das Merkblatt<br />
des DIBt „Anfor<strong>der</strong>ungen an begehbare<br />
Verglasungen; Empfehlungen für<br />
das Zustimmungsverfahren“ - Fassung<br />
November 2009 (Vorgängerfas<br />
sung März 2000). Daneben existiert<br />
auch noch die Norm DIN 18516 Teil 4<br />
„Außenwandbekleidungen, hinterlüftet;<br />
Einscheiben-Sicherheitsglas; Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
Bemessung - Prüfung“<br />
- Stand Februar 1990 als Technische<br />
Baubestimmung. Die vorgenannten<br />
Technischen Baubestimmungen waren<br />
bereits Gegenstand eines Fachartikels<br />
im bau intern-Heft Ausgabe<br />
Nov./Dez. 2008 (Seite 22 - 25).<br />
Vorbemerkungen<br />
Allen eingangs genannten Regelwerken<br />
liegt das historisch in Deutschland<br />
übliche globale Sicherheitsbeiwertverfahren<br />
zu Grunde, bei dem<br />
die jeweiligen unter den tatsächlichen<br />
Belastungen im Bauteil auftretenden<br />
Spannungen mit maximal zulässigen<br />
Spannungen zu vergleichen sind, die<br />
sich aus versuchstechnisch ermittelten<br />
Materialkennwerten ergeben, die mit<br />
einem pauschal alle Unwägbarkeiten<br />
abdeckenden globalen Sicherheitsbeiwert<br />
abgemin<strong>der</strong>t werden. In Europa<br />
setzte sich dahingegen das Teilsicherheitsbeiwertverfahren<br />
durch, bei dem<br />
sowohl die auftretenden Belastungen<br />
in Abhängigkeit u. a. von Auftretenswahrscheinlichkeit<br />
und Einwirkungsdauer<br />
als auch die für das Bauteil maximal<br />
zugelassenen Spannungen in<br />
Abhängigkeit u. a. von <strong>der</strong> Materialkennwertermittlung<br />
als auch <strong>der</strong> Sicherheitsrelevanz<br />
des jeweiligen mit<br />
ihnen durchgeführten Standsicherheitsnachweises<br />
durch den Ansatz<br />
Ganzglastreppe im Bürogebäude Nord <strong>der</strong> Fa. Seele<br />
GmbH & Co. KG<br />
mehrerer Teilsicherheitsbeiwerte zu<br />
erhöhen bzw. abzumin<strong>der</strong>n sind. Dies<br />
bedingte eine Überarbeitung <strong>der</strong> o. g.<br />
alten Regelwerke für die Bemessung<br />
von Glaskonstruktionen. Die o. g. verschiedenen<br />
Regelwerke für die Bemessung<br />
von Glaskonstruktionen<br />
sollten zudem anwen<strong>der</strong>freundlich<br />
in einem einzigen Regelwerk zusammengefasst<br />
werden. Selbstverständlich<br />
musste sich das Normungsgremium<br />
dabei auch <strong>der</strong> Aufgabe stellen,<br />
die in vielen Zulassungs- und Zustimmungsverfahren<br />
sowie in Forschungsvorhaben<br />
inzwischen gewonnenen<br />
und abgesicherten Erfahrungen und<br />
Erkenntnisse in die neue Norm einzuarbeiten.<br />
Zu diesem Zweck beantragte<br />
die Fachkommission Bautechnik<br />
<strong>der</strong> Bauministerkonferenz beim Deutschen<br />
Institut für Normung (DIN) in<br />
Berlin ein neues Normungsverfahren,<br />
worauf hin bereits am 30.01.2003 <strong>der</strong><br />
DIN-Arbeitsausschuss NABau - AA<br />
005-09-25 "Bemessungs- und Konstruktionsregeln<br />
für Bauprodukte aus<br />
Glas" mit <strong>der</strong> Erarbeitung <strong>der</strong> neuen<br />
deutschen Norm DIN 18008 „Glas im<br />
Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln“<br />
begann.<br />
Aktueller Stand <strong>der</strong> Normung<br />
DIN 18008<br />
Die nationale Norm DIN 18008 – Glas<br />
im Bauwesen; Bemessungs- und Konstruktionsregeln<br />
– umfasst <strong>der</strong>zeit folgende<br />
Normenteile:<br />
– Teil 1: Begriffe und allgemeine<br />
Grundlagen (Fassung Dezember<br />
2010)<br />
– Teil 2: Linienförmig gelagerte Verglasungen<br />
(Fassung Dezember 2010<br />
mit Berichtigung 1 vom April 2011)<br />
– Teil 3: Punktförmig gelagerte Verglasungen<br />
(Fassung Juli 2013)<br />
– Teil 4: Zusatzanfor<strong>der</strong>ungen an absturzsichernde<br />
Verglasungen (Fassung<br />
Juli 2013)<br />
– Teil 5: Zusatzanfor<strong>der</strong>ungen an begehbare<br />
Verglasungen (Fassung Juli<br />
2013)<br />
– Teil 6: Zu Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten<br />
betretbare Verglasungen<br />
(noch in Erarbeitung)<br />
– Teil 7: Son<strong>der</strong>konstruktionen (noch<br />
in Erarbeitung).<br />
Ein Fachartikel im bau intern-Heft<br />
Ausgabe September/Oktober 2009<br />
(Seite 7 - 9) befasste sich mit den Teilen<br />
1 und 2, weshalb auf ihren Inhalt<br />
hier nicht weiter eingegangen wird.<br />
28 bau intern November/Dezember 2013
Seit Juli 2013 sind nun auch die im Folgenden<br />
vorgestellten Teile 3, 4 und 5<br />
<strong>der</strong> DIN 18008 als endgültige Normen<br />
erschienen.<br />
DIN 18008 Teil 3: Punktförmig<br />
gelagerte Verglasungen<br />
Teil 3 <strong>der</strong> DIN 18008 entspricht inhaltlich<br />
im Wesentlichen <strong>der</strong> zurzeit noch<br />
gültigen TRPV und regelt ausfachende<br />
Verglasungen, bei denen ausschließlich<br />
mechanische Halter die Glasscheiben<br />
in <strong>der</strong>en Gesamtdicke formschlüssig<br />
umfassend punktförmig<br />
halten. Die Punkthalter werden dabei<br />
unterschieden in durch zylindrische<br />
Glasbohrungen (keine konischen Bohrungen)<br />
geführte Tellerhalter und ohne<br />
Bohrungen am Glasscheibenrand angeordnete<br />
Klemmhalter. Eine Kombination<br />
von linien- und punktförmiger<br />
Lagerung ist ebenfalls zulässig. Für<br />
gegen Absturz sichernde, planmäßig<br />
begehbare o<strong>der</strong> befahrbare o<strong>der</strong><br />
zu Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten<br />
betretbare Verglasungen sind<br />
zusätzliche Anfor<strong>der</strong>ungen zu berücksichtigen.<br />
Neu gegenüber den TRPV sind die<br />
Angaben von geeigneten Trennmaterialien<br />
zwischen Glas und Punkthalter-<br />
Stahlbauteilen und zu <strong>der</strong>en Berücksichtigung<br />
beim statischen Nachweis<br />
von punktförmig gelagerten Verglasungen<br />
im Anhang A, das Verifizierungsverfahren<br />
für Finite-Elemente-<br />
Modelle zum statischen Nachweis von<br />
punktförmig gelagerten Verglasungen<br />
im Bohrungsbereich im Anhang B,<br />
das vereinfachte Verfahren für den<br />
Nachweis <strong>der</strong> Tragfähigkeit und <strong>der</strong><br />
Gebrauchstauglichkeit von punktgelagerten<br />
Verglasungen im Anhang C und<br />
die Beschreibung von anerkannten<br />
Nachweisen <strong>der</strong> Verwendbarkeit von<br />
Glashaltern und Zwischenmaterialien<br />
durch Versuche im Anhang D des Teils<br />
3 <strong>der</strong> DIN 18008.<br />
DIN 18008 Teil 4: Zusatzanfor<strong>der</strong>ungen<br />
an absturzsichernde<br />
Verglasungen<br />
Teil 4 <strong>der</strong> DIN 18008 entspricht inhaltlich<br />
im Wesentlichen <strong>der</strong> zurzeit<br />
noch gültigen TRAV. Er gilt für Vertikalverglasungen<br />
und zur Angriffsseite<br />
geneigte Horizontalverglasungen<br />
(durch Verglasung und angriffsseitige<br />
Verkehrsfläche aufgespannter Winkel<br />
< 80°), die Personen auf Verkehrsflächen<br />
gegen Absturz sichern. In den<br />
TRAV waren punktförmig gelagerte<br />
absturzsichernde Verglasungen nur<br />
als in Innenräumen gelegene Gelän<strong>der</strong>ausfachungen<br />
(= Kategorie C1)<br />
geregelt. Teil 4 <strong>der</strong> DIN 18008 enthält<br />
nun unabhängig vom Einbauort<br />
auch Regelungen für punktförmig gelagerte<br />
Verglasungen mit absturzsichern<strong>der</strong><br />
Funktion nach Kategorie A<br />
(= i. d. R. raumhohe Verglasungen),<br />
C2 (= Verglasungen unterhalb eines<br />
Brüstungsriegels in erfor<strong>der</strong>licher<br />
Holmhöhe) und C3 (= Verglasungen<br />
mit in erfor<strong>der</strong>licher Hohe vorgesetztem<br />
lastabtragendem Holm). Waren<br />
gemäß den TRAV absturzsichernden<br />
Verglasungen nach Kategorie B (= unten<br />
eingespannt gehaltene Glasbrüstungen,<br />
<strong>der</strong>en einzelne Glasscheiben<br />
durch einen durchgehenden Handlauf<br />
in erfor<strong>der</strong>licher Höhe mit einan<strong>der</strong><br />
verbunden sind) nur geregelt, wenn<br />
<strong>der</strong> Handlauf auf den Glasscheibenoberkanten<br />
aufgesetzt war, so darf<br />
<strong>der</strong> Handlauf gemäß DIN 18008 Teil 4<br />
nun auch durch Tellerhalter nach Teil 3<br />
<strong>der</strong> DIN 18008 an den Glasscheiben<br />
befestigt sein.<br />
Im Teil 4 <strong>der</strong> DIN 18008 ist gegenüber<br />
den TRAV darüber hinaus noch<br />
Folgendes neu:<br />
– Ergänzung des Nachweises <strong>der</strong><br />
Stoßsicherheit durch Bauteilversuch<br />
mit einer Durchdringungsprüfung,<br />
die beim Bruch von Verbundsicherheitsglasscheiben<br />
bei<br />
<strong>der</strong> Pendelschlagprüfung zusätzlich<br />
durchzuführen ist (Anhang A.2).<br />
– Ausweitung <strong>der</strong> Konstruktionen<br />
mit bereits nachgewiesener Stoßsicherheit:<br />
Die Abmessungen <strong>der</strong><br />
linienförmig gelagerten Verglasungen<br />
mit nachgewiesener Stoßsicherheit<br />
nach Kategorie A, C1,<br />
C2 und C3 des Anhangs B <strong>der</strong> DIN<br />
18008 Teil 4 sind teilweise größer<br />
als in den TRAV und hier sind nun<br />
auch Konstruktionen mit Drei- und<br />
Mehrscheibenisoliergläsern sowie<br />
punktförmig gelagerte Verglasungen<br />
nach Kategorie A, C1, C2<br />
und C3 mit ausreichend erbrachter<br />
Stoßsicherheit zu finden.<br />
– Der in Abschnitt 6.4 <strong>der</strong> TRAV beschriebene<br />
Stoßsicherheitsnachweis<br />
mittels Spannungstabellen ist<br />
in Teil 4 <strong>der</strong> DIN 18008 nicht mehr<br />
enthalten. Stattdessen bietet Anhang<br />
C des Teils 4 <strong>der</strong> DIN 18008<br />
zwei Verfahren zum Nachweis <strong>der</strong><br />
Stoßsicherheit von Glasaufbauten<br />
durch Berechnung an: Ein vereinfachtes<br />
Nachweisverfahren im Anhang<br />
C.2 und die volldynamische<br />
transiente Simulation des Stoßvorgangs<br />
im Anhang C.3.<br />
– Anhang D des Teils 4 <strong>der</strong> DIN 18008<br />
macht Angaben nicht nur zu linienson<strong>der</strong>n<br />
auch zu punktförmigen<br />
Lagerungskonstruktionen, die als<br />
ausreichend tragfähig für die Absturzsicherheit<br />
anzusehen sind.<br />
– DIN 18008 Teil 4 enthält im Anhang<br />
E einen Nachweis eines ausreichend<br />
wirksamen Kantenschutzes<br />
durch Versuche und im Anhang<br />
F die Darstellung eines Musters<br />
eines ausreichend wirksamen Kantenschutzes.<br />
DIN 18008 Teil 5: Zusatzanfor<strong>der</strong>ungen<br />
an begehbare Verglasungen<br />
Teil 5 <strong>der</strong> DIN 18008 regelt begehbare<br />
Verglasungen mit ausschließlich<br />
planmäßigem Personenverkehr bei<br />
üblicher Nutzung und einer lotrechten<br />
Nutzlast von höchstens 5 kN/m 2<br />
(z. B. Treppen, Podeste, Stege und<br />
Lichtschachtabdeckungen). Für befahrbare<br />
Verglasungen, Verglasungen,<br />
die hohen Dauerlasten ausgesetzt<br />
sind o<strong>der</strong> für die aufgrund <strong>der</strong> Nutzungsbedingungen<br />
von einer erhöhten<br />
Stoßgefahr ausgegangen werden<br />
muss, gelten weitergehende Anfor<strong>der</strong>ungen.<br />
Die Norm gilt auch nicht<br />
für nur zu Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten<br />
begehbare Verglasungen.<br />
Diese Verglasungen sind Gegenstand<br />
des noch in Bearbeitung<br />
befindlichen Teils 6 <strong>der</strong> DIN 18008.<br />
Teil 5 <strong>der</strong> DIN 18008 enthält die Vorgaben<br />
des Kapitels 3.4 <strong>der</strong> TRLV und<br />
des DIBt-Merkblatts "Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
an begehbare Verglasungen; Empfehlungen<br />
für das Zustimmungsverfahren"<br />
- Fassung November 2009 -, wobei<br />
die Bemessung <strong>der</strong> begehbaren<br />
Verglasungen nach Teil 5 <strong>der</strong> DIN<br />
18008 auf die Bemessungskonzepte<br />
<strong>der</strong> Teile 1, 2 und 3 <strong>der</strong> DIN 18008 abgestimmt<br />
wurde. Der im DIBt-Merkblatt<br />
beschriebene experimentelle<br />
Nachweis <strong>der</strong> Stoßsicherheit und <strong>der</strong><br />
Resttragfähigkeit ist jetzt im Anhang<br />
A <strong>der</strong> DIN 18008 Teil 5 zu finden. Anhang<br />
B des Teils 5 <strong>der</strong> DIN 18008 beschreibt<br />
Konstruktionen mit bereits<br />
nachgewiesener Stoßsicherheit und<br />
Resttragfähigkeit - wie u. a. die bisher<br />
in <strong>der</strong> Ziffer 3.4.3 <strong>der</strong> TRLV angegebenen.<br />
Bei diesen Konstruktionen<br />
ist ein versuchstechnischer Nachweis<br />
nicht mehr erfor<strong>der</strong>lich.<br />
bau intern November/Dezember 2013 29
Bauaufsichtliche Einführung<br />
Nachdem mit den Teilen 1 - 5 <strong>der</strong> DIN<br />
18008 ein in sich abgeschlossenes<br />
und bei <strong>der</strong> EU-Kommission notifiziertes<br />
Normenpaket zur Bemessung<br />
von Glaskonstruktionen vorliegt, beschäftigen<br />
sich nun die Gremien <strong>der</strong><br />
Bauministerkonferenz mit <strong>der</strong> Aufnahme<br />
des o. g. Normenpakets in die Musterliste<br />
<strong>der</strong> Technischen Baubestimmungen,<br />
wobei wohl frühestens die<br />
Musterliste Februar 2014 <strong>der</strong> Technischen<br />
Baubestimmungen die Teile<br />
1 - 5 <strong>der</strong> DIN 18008 enthalten wird.<br />
Die Musterliste ist dann noch von <strong>der</strong><br />
EU-Kommission zu notifizieren, bevor<br />
die obersten Bauaufsichtsbehörden<br />
<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> wie auch Bayern die<br />
o. g. Normen offiziell bauaufsichtlich<br />
einführen können und die bisherigen<br />
Technischen Baubestimmungen TRLV,<br />
TRPV, TRAV und DIN 18516 Teil 4 aus<br />
<strong>der</strong> Liste <strong>der</strong> Technischen Baubestimmungen<br />
nehmen.<br />
An dieser Stelle muss <strong>der</strong> dringende<br />
Appell an alle Architekten und<br />
Bauingenieure stehen, das Normenpaket<br />
DIN 18008 nach dessen bauaufsichtlicher<br />
Einführung als Technische<br />
Baubestimmung <strong>der</strong> Planung,<br />
Konstruktion und Bemessung von<br />
Glaskonstruktionen von Anfang an zu<br />
Grunde zu legen. Mit einem <strong>der</strong>artigen<br />
Vorgehen können (bautechnisch<br />
nicht notwendige) wesentliche Abweichungen<br />
von dieser Norm und somit<br />
das Erfor<strong>der</strong>nis einer Zustimmung im<br />
Einzelfall nach Art. 18 und 19 BayBO<br />
verhin<strong>der</strong>t werden.<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Mit den nun fertiggestellten Teilen 1 -<br />
5 <strong>der</strong> DIN 18006 steht <strong>der</strong> Praxis ein<br />
in sich abgeschlossenes Normenwerk<br />
zur Bemessung von Glaskonstruktionen<br />
zur Verfügung. Die Erarbeitung<br />
des Teils 6 ist inzwischen weit fortgeschritten,<br />
sodass dieser Normenteil<br />
bald zur allgemeinen Stellungnahme<br />
öffentlich umlaufen wird.<br />
Teil 7 steht noch ziemlich am Anfang<br />
seiner Bearbeitung. Der Umfang<br />
und die Vielfalt <strong>der</strong> durch ihn zu regelnden<br />
Glaskonstruktionen erfor<strong>der</strong>t<br />
wahrscheinlich die Schaffung eines<br />
zusätzlichen Teils 8 <strong>der</strong> DIN 18008.<br />
Autor<br />
Bauoberrat Hubertus Wambsganz,<br />
Oberste Baubehörde<br />
hubertus.wambsganz@stmi.bayern.<br />
de<br />
„För<strong>der</strong>preis Verkehrsbau“ an<br />
Herrn Bauoberrat Dr.-Ing. Jochen<br />
Eid verliehen<br />
Herr Bauoberrat Dr.-Ing. Jochen Eid,<br />
<strong>der</strong>zeit als Projektleiter für das neue<br />
Haushaltsverfahren „HASTA“ an <strong>der</strong><br />
Obersten Baubehörde tätig, erhielt<br />
am 19. September 2013 im Rahmen<br />
<strong>der</strong> diesjährigen Betonstraßentagung<br />
den „För<strong>der</strong>preis Verkehrsbau“ <strong>der</strong><br />
Otto-Graf-Stiftung. Der Preis wurde<br />
von Herrn Dr.-Ing. Walter Fleischer,<br />
stellvertreten<strong>der</strong> Vorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Forschungsgesellschaft für Straßenund<br />
Verkehrswesen, übergeben. Dieser<br />
ist mit einem Geldpreis für eine<br />
fachbezogene Studienreise verbunden<br />
und wird an Vertreter des akademischen<br />
Nachwuchses verliehen, die<br />
durch beson<strong>der</strong>e Arbeiten auf dem<br />
Gebiet des Verkehrsbaues mit Beton<br />
hervorgetreten sind.<br />
Herr Dr.-Ing. Jochen Eid erhielt<br />
den För<strong>der</strong>preis für seine während<br />
seiner Zeit am Lehrstuhl für Verkehrswegebau<br />
<strong>der</strong> TU München erstellte<br />
Doktorarbeit „Theoretische und experimentelle<br />
Untersuchungen dünner<br />
Betondecken auf Asphalt (Whitetopping)“,<br />
in <strong>der</strong>en Rahmen er die praxisnahe<br />
Sanierung von Asphaltflächen<br />
mit Beton erforscht hat.<br />
Wir gratulieren Herrn Dr.-Ing. Eid<br />
sehr herzlich zu dieser Auszeichnung.<br />
Personalien<br />
Unsere Jubilare im November/<br />
Dezember<br />
75. Geburtstag<br />
Ministerialrat a.D. Dr. Otmar Speth,<br />
geb. am 18.11.1938, zuletzt Sachgebietsleiter<br />
bei <strong>der</strong> Abteilung Straßen-<br />
und Brückenbau in <strong>der</strong> Obersten<br />
Baubehörde, seit 01.12.2003 im Ruhestand.<br />
Ltd. Baudirektor a.D. Greger Burkhart,<br />
geb. am 27.12.1938, zuletzt Sachgebietsleiter<br />
bei <strong>der</strong> Regierung <strong>der</strong><br />
Oberpfalz, seit 01.01.2004 im Ruhestand.<br />
70. Geburtstag<br />
Ministerialrat a.D. Dr. Wilfried Zahnmesser,<br />
geb. am 02.10.1943, zuletzt<br />
Sachgebietsleiter bei <strong>der</strong> Abteilung<br />
Zentrale Angelegenheiten in <strong>der</strong><br />
Obersten Baubehörde, seit 01.11.2008<br />
im Ruhestand.<br />
Ltd. Baudirektor a.D. Heinrich Mayer,<br />
geb. am 09.11.1943, zuletzt Behördenleiter<br />
Staatliches Bauamt München 2,<br />
seit 01.12.2008 im Ruhestand.<br />
Ltd. Baudirektor a.D. Stefan Schiefer,<br />
geb. am 01.12.1943, zuletzt Abteilungsleiter<br />
bei <strong>der</strong> Autobahndirektion<br />
Nordbayern, seit 01.12.2008 im Ruhestand.<br />
Wir gratulieren Herrn Dr. Wolfgang<br />
Dölker zu seinem 70. Geburtstag<br />
Am 22. November feierte <strong>der</strong> langjährige<br />
Leiter <strong>der</strong> Abteilung IIB „Recht,<br />
Planung und Bautechnik“ <strong>der</strong> Obersten<br />
Baubehörde im <strong>Bayerischen</strong><br />
Staatsministerium des Innern, für<br />
Bau und Verkehr, Herr Ministerialdirigent<br />
Dr. Wolfgang Dölker, seinen 70.<br />
Geburtstag.<br />
Herr Dr. Dölker wurde 1943 in<br />
Wien geboren. Nach dem Abitur am<br />
Realgymnasium in München studierte<br />
er an <strong>der</strong> Ludwig-Maximilians-Universität<br />
Rechtswissenschaften. Im Jahr<br />
1970 trat er seinen Dienst als Regierungsassessor<br />
bei <strong>der</strong> Regierung von<br />
Oberbayern an. Schon bald wechselte<br />
er an die Oberste Baubehörde und war<br />
30 bau intern November/Dezember 2013
Referent für Bauplanungs- und Bauordnungsrecht<br />
in „seiner“ späteren<br />
Abteilung. Nach sich anschließen<strong>der</strong><br />
zweijähriger Tätigkeit als persönlicher<br />
Referent beim damaligen Leiter <strong>der</strong><br />
Obersten Baubehörde, Herrn Prof.<br />
Koch, wechselte er im Jahr 1976 an<br />
das Landratsamt München und leitete<br />
dort die Bauabteilung. 1978 kehrte er<br />
ins Innenministerium zurück und leitete<br />
dort – unterbrochen von einem<br />
kurzem „Aufenthalt“ in <strong>der</strong> Staatskanzlei<br />
– die Sachgebiete IA5 und IA6.<br />
Nach einer anschließenden Tätigkeit<br />
als Landtagsbeauftragter wurde er im<br />
Jahr 1984 Leiter des Ministerbüros,<br />
zunächst bei Staatsminister Dr. Karl<br />
Hillermeier und dann bei Staatsminister<br />
August Lang. Ab 1988 lenkte<br />
Herr Dr. Dölker als Abteilungsleiter die<br />
Geschicke die Abteilung IIB „Recht,<br />
Planung und Bautechnik“ für fast zwei<br />
Jahrzehnte. Mit seinem Namen dauerhaft<br />
verbunden ist die Reform <strong>der</strong><br />
<strong>Bayerischen</strong> Bauordnung, die eine<br />
deutliche Vereinfachung <strong>der</strong> Baugenehmigungsverfahren<br />
sowie die Verlagerung<br />
von Verantwortung in den<br />
privaten Bereich zum Inhalt hatte.<br />
Neben <strong>der</strong> Fülle seiner dienstlichen<br />
Aufgaben hat sich Dr. Dölker in zahlreichen<br />
Gremien und Ausschüssen<br />
tätig, so z.B. beim Deutschen Institut<br />
für Bautechnik in Berlin, dessen Verwaltungsratsvorsitzen<strong>der</strong><br />
er jahrelang<br />
war.<br />
In all seinen Funktionen und Tätigkeiten<br />
hat sich Herr Dr. Dölker in beson<strong>der</strong>em<br />
Maß engagiert und große<br />
Verdienste erworben. Er wurde hierfür<br />
2009 mit dem Verdienstkreuz erster<br />
Klasse ausgezeichnet.<br />
Wir wünschen Herrn Dr. Dölker alles<br />
Gute, vor allem Gesundheit, damit er<br />
weiterhin seinen sportlichen Aktivitäten,<br />
Bergwan<strong>der</strong>n im Sommer und<br />
Schitouren gehen im Winter, nachgehen<br />
kann. Ganz beson<strong>der</strong>s aber freuen<br />
wir uns, dass Herr Dr. Dölker uns<br />
auch in seinem Ruhestand eng verbunden<br />
geblieben ist und gerne an<br />
den Veranstaltungen <strong>der</strong> OBB und<br />
„seiner“ Abteilung teilnimmt.<br />
Ruhestand<br />
Leiten<strong>der</strong> Baudirektor<br />
Günther<br />
Grafwallner in<br />
Ruhestand<br />
Der Leiter des Staatlichen Bauamtes<br />
Weilheim, Herr Ltd. Baudirektor Günther<br />
Grafwallner, wurde zum 30. November<br />
2013 in den Ruhestand versetzt.<br />
Herr Grafwallner, am 4. September<br />
1948 in München geboren, ist in<br />
Herrsching am Ammersee aufgewachsen.<br />
Nach dem Abitur am Gymnasium<br />
Weilheim und dem Grundwehrdienst<br />
schloss sich sein Studium an <strong>der</strong> TU<br />
München an. Zunächst arbeitete Herr<br />
Grafwallner im Konstruktionsbüro<br />
einer Münchner Baufirma, bevor er<br />
1976 mit seiner Referendarausbildung<br />
begann. Nach <strong>der</strong> Großen Staatsprüfung<br />
führte ihn sein beruflicher Werdegang<br />
zunächst an das Straßenbauamt<br />
Ansbach. Dort war er für rund 600<br />
km Bundes-, Staats- und Kreisstraßen<br />
zuständig. Die Schwerpunkte seiner<br />
Arbeit waren Straßenverlegungen im<br />
Rahmen des Neubaus <strong>der</strong> A 7 sowie<br />
großräumige Straßenprojekte im Bereich<br />
<strong>der</strong> Gruppenflurbereinigung Ansbach<br />
West.<br />
1986 wechselte Herr Grafwallner<br />
zum Straßenbauamt Weilheim. Hier<br />
war er bis 1992 Abteilungsleiter für<br />
den Landkreis Landsberg a. L., aber<br />
auch für die Planung und den Bau <strong>der</strong><br />
Umgehung Schongau und Peiting zuständig.<br />
Auch die Voruntersuchung für<br />
den Neubau <strong>der</strong> B 17neu bei Landsberg<br />
zählte zu seinen Aufgaben.<br />
1992 wurde Herr Grafwallner<br />
Planungsdezernent/-sachgebietsleiter<br />
an <strong>der</strong> Autobahndirektion Südbayern.<br />
Er war zuständig für die Autobahnen<br />
im Raum München und westlich von<br />
München. Schwerpunkt war <strong>der</strong> Neubau<br />
des Autobahnrings München-<br />
West (A 99) vom Tunnel Allach bis zur<br />
Lindauer Autobahn (A 96). Hinzu kamen<br />
die Ausbaumaßnahmen an den<br />
Autobahnen zur Erschließung <strong>der</strong> neuen<br />
Messe Riem und <strong>der</strong>en Anbindung<br />
an den Flughafen. Außerdem war er<br />
mit <strong>der</strong> Planung des 6-streifigen Ausbaus<br />
<strong>der</strong> A 8 zwischen München,<br />
Augs burg und Burgau befasst.<br />
Zum 1. August 2002 wurde Herr<br />
Günther Grafwallner zum Amtsvorstand<br />
des Straßenbauamtes Weilheim<br />
bestellt. Seit <strong>der</strong> Zusammenlegung<br />
mit dem <strong>Hochbau</strong>amt Anfang 2007 leitete<br />
er auch das neue Staatliche Bauamt<br />
Weilheim.<br />
In dieser Funktion konnte Herr<br />
Grafwallner ab 2006 die von ihm begonnene<br />
Planung <strong>der</strong> 16 km langen B<br />
17neu zwischen Klosterlechfeld und<br />
Landsberg verwirklichen. Wichtige<br />
Projekte waren auch die anschließende<br />
Umgehung Landsberg und <strong>der</strong><br />
3-streifige Ausbau <strong>der</strong> B 17 zwischen<br />
Landsberg und Schongau sowie <strong>der</strong><br />
Bau <strong>der</strong> Umgehungstraßen von Peißenberg,<br />
Hohenpeißenberg (B 472)<br />
und von Saulgrub (B 23). Die Umgehung<br />
Garmisch (Kramertunnel) wurde<br />
mit dem Bau des Erkundungsstollens<br />
begonnen. Auch die Planung des Tunnels<br />
Starnberg (B 2) wurde so weiterverfolgt,<br />
dass er nun zum Bau ansteht.<br />
Durch den Bau <strong>der</strong> Umfahrung von<br />
Pähl (St 2056) verbesserte sich die<br />
Anbindung des Ammerseegebietes<br />
an die B 2 im Raum Weilheim. Mit<br />
<strong>der</strong> Umgehungsstraße von Ober-Unterbrunn<br />
(St 2069) und <strong>der</strong> geplanten<br />
Westtangente Starnberg entsteht eine<br />
leistungsfähige Verbindung zwischen<br />
<strong>der</strong> B 2 südlich von Starnberg und <strong>der</strong><br />
A 96 und weiter zum Autobahnring<br />
München.<br />
Zudem war Herr Grafwallner langjähriges<br />
Mitglied im Ausschuss für die<br />
Richtlinien zur Planung von Landstraßen<br />
in <strong>der</strong> Forschungsgesellschaft für<br />
das Straßen- und Verkehrswesen.<br />
Mit Herrn Grafwallner verlässt ein<br />
allseits anerkannter Fachmann und ein<br />
hoch geschätzter Kollege die Bayerische<br />
Straßenbauverwaltung, <strong>der</strong> sich<br />
sowohl im Bereich <strong>der</strong> Autobahnen als<br />
auch <strong>der</strong> Bundes- und Staatsstraßen<br />
große Verdienste erworben hat. Wir<br />
wünschen Herrn Grafwallner für seinen<br />
wohl verdienten Ruhestand alles<br />
Gute.<br />
bau intern November/Dezember 2013 31
Dienstliche Verän<strong>der</strong>ungen<br />
Leiten<strong>der</strong> Baudirektor<br />
Michael<br />
Kordon neuer<br />
Leiter des Staatlichen<br />
Bauamtes<br />
Weilheim<br />
Hirblingen (St 2036) fertiggestellt werden.<br />
Neben seinen unmittelbaren<br />
dienstlichen Aufgaben engagiert sich<br />
Herr Kordon in <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong> Ingenieurekammer-Bau<br />
und wurde 2012 in<br />
den Vorstand <strong>der</strong> Bundesingenieurekammer<br />
gewählt.<br />
1. November 2009 leitete Herr Meyer<br />
die Dienststelle Fürth <strong>der</strong> Autobahndirektion.<br />
Wichtigstes Bauprojekt war<br />
<strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> A 6 zwischen <strong>der</strong> AS<br />
Roth und dem AK Nürnberg-Süd, <strong>der</strong><br />
bundesweit erstmalig als Funktionsbauvertrag<br />
über alle Gewerke erfolgt<br />
ist.<br />
Als Nachfolger von Herrn Ltd. Baudirektor<br />
Günther Grafwallner wurde<br />
Herr Ltd. Baudirektor Michael Kordon<br />
zum 1. Dezember 2013 zum Amtsvorstand<br />
des Staatlichen Bauamtes Weilheim<br />
bestellt.<br />
Herr Kordon (geb. 1962 in Günzburg)<br />
studierte bis 1990 an <strong>der</strong> TU<br />
München Bauingenieurwesen und<br />
war anschließend zwei Jahre als Bauleiter<br />
im <strong>Hochbau</strong> beschäftigt. Dann<br />
absolvierte er das Referendariat bei<br />
<strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong> Straßenbauverwaltung<br />
und legte 1994 die Große Staatsprüfung<br />
als Jahrgangsbester ab. Seine<br />
erste dienstliche Station war die<br />
Autobahndirektion Südbayern, wo<br />
er als Planungsreferent tätig war. Im<br />
Jahr 2000 wurde Herr Kordon an die<br />
Oberste Baubehörde abgeordnet und<br />
war dort zwei Jahre als Referent im<br />
Sachgebiet IID4 „Bundesautobahnen“<br />
eingesetzt. Anschließend wechselte<br />
er an das Straßenbauamt Weilheim<br />
und wirkte dort als Gebietsabteilungsleiter<br />
und Vertreter des Amtsleiters.<br />
2003 verließ Herr Kordon für drei<br />
Jahre die Straßenbauverwaltung, um<br />
bei <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong> Magnetbahnvorbereitungsgesellschaft<br />
mbH als Teilprojektleiter<br />
die Planungen für den<br />
Transrapid München voranzubringen.<br />
Anschließend war er Referent im<br />
Sachgebiet Straßen- und Brückenbau<br />
bei <strong>der</strong> Regierung von Schwaben, bevor<br />
ihm 2007 die Leitung <strong>der</strong> Dienststelle<br />
Kempten <strong>der</strong> Autobahndirektion<br />
Südbayern übertragen wurde. Die<br />
wichtigsten Bauprojekte waren dabei<br />
die Gesamtfertigstellung <strong>der</strong> A 96 auf<br />
bayerischem Gebiet und <strong>der</strong> Lückenschluss<br />
<strong>der</strong> A 7 im Abschnitt Nesselwang<br />
– Füssen.<br />
Seit 1. Dezember 2009 leitete<br />
Herr Kordon den Bereich Straßenbau<br />
am Staatlichen Bauamt Augsburg. In<br />
dieser Zeit konnten u. a. die B 25 bei<br />
Donauwörth 4-streifig und im weiteren<br />
Verlauf bis Harburg 3-streifig ausgebaut<br />
und die Ortsumfahrung von<br />
Baudirektor<br />
Dieter Meyer<br />
neuer Leiter des<br />
Sachgebiets 31<br />
<strong>der</strong> Regierung<br />
von Mittelfranken<br />
In Nachfolge von Herrn Ltd. Baudirektor<br />
Heinrich Schmidt übernahm Herr<br />
Baudirektor Dieter Meyer zum 1. November<br />
2013 die Leitung des Sachgebiets<br />
Straßen- und Brückenbau <strong>der</strong><br />
Regierung von Mittefranken.<br />
Herr Meyer (geb. 1964 in Dettenheim,<br />
Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen)<br />
studierte nach Abitur und Wehrdienst<br />
bis 1989 Bauingenieurwesen an<br />
<strong>der</strong> TU München. Anschließend trat er<br />
als Baureferendar in die <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />
ein und legte 1991 die Große<br />
Staatsprüfung ab. Zunächst war Herr<br />
Meyer als Leiter <strong>der</strong> Planungsabteilung<br />
am Straßenbauamt Ansbach beschäftigt.<br />
Wichtige Planungsaufgaben<br />
in dieser Zeit waren beispielsweise<br />
<strong>der</strong> Neubau <strong>der</strong> B 14-Westtangente in<br />
Ansbach und die Verlegung <strong>der</strong> B 13<br />
bei Muhr a. See. 1998 wechselte er<br />
innerhalb des Amtes in die Gebietsabteilung<br />
„Landkreis Ansbach-Ost“ und<br />
konnte in dieser Funktion unter an<strong>der</strong>em<br />
die Westtangente in Ansbach<br />
sowie verschiedene Ortsumgehungen<br />
baulich umsetzen. Im Jahr 2000 wurde<br />
Herr Meyer an die Oberste Baubehörde<br />
abgeordnet und war als Referent<br />
im Sachgebiet IID7 für die Regierungsbezirke<br />
Mittel- und Unterfranken zuständig.<br />
2002/2003 nahm er am 18.<br />
Lehrgang für Verwaltungsführung <strong>der</strong><br />
<strong>Bayerischen</strong> Staatskanzlei teil.<br />
Anschließend war Herr Meyer als<br />
Sachgebietsleiter in <strong>der</strong> Planungsabteilung<br />
<strong>der</strong> Autobahndirektion Nordbayern<br />
tätig. Arbeitsschwerpunkt war<br />
insbeson<strong>der</strong>e die Schaffung durchgehenden<br />
Baurechts für den 6- streifigen<br />
Ausbau <strong>der</strong> A 3 zwischen Aschaffenburg<br />
und dem AK Biebelried. Seit<br />
Den Kolleginnen und Kollegen, die<br />
mit einer neuen Dienstaufgabe betraut<br />
wurden, wünschen wir alles<br />
Gute und viel Erfolg bei Ihrer neuen<br />
Tätigkeit.<br />
bau intern im Januar/Februar<br />
2014<br />
• Realisierungswettbewerb für<br />
die Rastanlage Lange Berge<br />
an <strong>der</strong> A 73<br />
• Wissenstransfer<br />
• Aktualisierung <strong>der</strong> Fachdatenbank<br />
<strong>Hochbau</strong> FDH<br />
• Neubau Polizeiinspektion Grafenau-Passivhaus<br />
• Beamtenfachhochschule<br />
Herrsching - Neubau Unterkunftstrakt<br />
im Passivhausstandard<br />
• Wettbewerb Denkmal und<br />
Energie<br />
• Abschluss Modellvorhaben<br />
„Ort schafft Mitte“ - Fachtagung<br />
Städtebauför<strong>der</strong>ung<br />
• Die neuen Planungsrichtlinien<br />
für Außerortsstraßen - RAL 12<br />
• Infrastrukturverwaltung in einer<br />
Hand - Die neugeordneten<br />
Aufgaben im Bereich <strong>der</strong><br />
Obersten Baubehörde<br />
32 bau intern November/Dezember 2013
Contracting-Initiative<br />
Bayern (CIB)<br />
Auszeichnung für die Bayerische<br />
<strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />
Beim bundesweiten Wettbewerb „Energieeffizienz<br />
in öffentlichen Einrichtungen<br />
– Gute Beispiele 2013“, wurde<br />
die Bayerische <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />
mit dem Projekt „Energiespar-Contracting<br />
bei <strong>der</strong> Pinakothek <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne“<br />
als Preisträger ausgezeichnet.<br />
Bei <strong>der</strong> feierlichen Preisverleihung<br />
am 26. November 2013 in Berlin nahmen<br />
Herr Ministerialdirigent Friedrich<br />
Geiger - Leiter <strong>der</strong> Abteilung Staatlicher<br />
<strong>Hochbau</strong> <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />
- und Herr Baudirektor Peter Kalmer<br />
- Leiter <strong>der</strong> Leitstelle Contracting an<br />
<strong>der</strong> Regierung von Mittelfranken - den<br />
Preis in Empfang.<br />
Der von <strong>der</strong> Deutschen Energie-<br />
Agentur (dena) regelmäßig ausgerichtete<br />
Wettbewerb wird vom Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und<br />
Technologie (BMWi) geför<strong>der</strong>t und ist<br />
mit Preisgel<strong>der</strong>n in Höhe von insgesamt<br />
25.000 € ausgestattet.<br />
Aus einer Vielzahl von eingereichten<br />
Projekten hat eine unabhängige<br />
Jury mit Vertretern aus Politik, Verwaltung,<br />
Verbänden sowie <strong>der</strong> dena vier<br />
Preisträger ausgewählt. Die Auswahlkriterien<br />
zielten auf innovative und vorbildliche<br />
Projekte, durch die möglichst<br />
viel Energie eingespart wurde. Teilnehmen<br />
konnten Gemeinden, Städte,<br />
Landkreise, Landes- und Bundesbehörden,<br />
aber auch kommunale, landesund<br />
bundeseigene Unternehmen.<br />
Der Vertreter des BMWi, Herr Detlev<br />
Dauke, Abteilungsleiter Energiepolitik,<br />
erläuterte in seiner Rede neben<br />
den politischen Zielen, den Stellenwert<br />
<strong>der</strong> Energieeffizienz aus Sicht des<br />
BMWi und betonte die Bedeutung des<br />
Instrumentes Contracting – insbeson<strong>der</strong>e<br />
auch von guten Beispielen aus<br />
dem Bereich <strong>der</strong> öffentlichen Hand.<br />
Energiespar-Contracting Pinakothek<br />
<strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne<br />
Die reibungslose und effiziente Umsetzung<br />
des Modells Energiespar-<br />
Contracting bei <strong>der</strong> Pinakothek <strong>der</strong><br />
Mo<strong>der</strong>ne in München, einem populären<br />
Museum mit sehr hohen klimatischen<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen, hat Vorbildwirkung<br />
und lässt erhoffen, dass noch<br />
viele weitere Projekte folgen. Alle bei<br />
dem Museum durchgeführten Maßnahmen<br />
wurden im laufenden Betrieb<br />
störungsfrei umgesetzt und vorher<br />
genauestens mit dem Nutzer abgestimmt.<br />
Der Contractor konnte durch<br />
seine Investitionen die jährlichen Energiekosten<br />
von ca. 1,2 Mio. € um<br />
jährlich 460.000 € bzw. 39% senken.<br />
Von den eingesparten Energiekosten<br />
erhält die Pinakothek, ohne eigene Investitionen<br />
o<strong>der</strong> sonstige Nachteile<br />
im täglichen Betrieb, jährlich 63.000 €.<br />
Der Rest steht dem Contractor zur Finanzierung<br />
des Projektes zur Verfügung.<br />
Über die ausgeschriebene Vertragslaufzeit<br />
von 7 Jahren (2012 bis<br />
2019) spart die Pinakothek in Summe<br />
damit 441.000 €. Bei steigenden Energiepreisen<br />
werden die finanziellen<br />
Vorteile noch größer. Nach Ablauf des<br />
Vertrages fließen die Einsparungen in<br />
Höhe von 460.000 €/Jahr dann vollumfänglich<br />
dem Staatshaushalt zu.<br />
Ausblick<br />
Insgesamt wurden in Bayern seit Beginn<br />
<strong>der</strong> Initiative von den Contractoren<br />
bereits 15 Mio. € in energiesparende<br />
Anlagentechnik in staatlichen<br />
Liegenschaften investiert. Dadurch<br />
werden Verbrauchskosten bei Wärme,<br />
Strom und Wasser von etwa 2,7 Mio. €<br />
pro Jahr bzw. durchschnittlich 34%<br />
eingespart und gleichzeitig jährlich<br />
5.200 Tonnen CO 2<br />
weniger emittiert.<br />
In acht weiteren Liegenschaften<br />
des Freistaates, die zusammen ca.<br />
5 Mio. € Gesamtenergiekosten pro<br />
Jahr verursachen, werden <strong>der</strong>zeit<br />
neue ESC-Maßnahmen vorbereitet.<br />
Bei einem ähnlichen Sparpotential<br />
ergäben sich jährliche Kosteneinsparungen<br />
von weiteren 2 Mio. €.<br />
Mit diesen positiven Beispielen<br />
lässt sich die teils noch bestehende<br />
Skepsis bei einigen Nutzern staatlicher<br />
Liegenschaften zum Thema Contracting<br />
sicherlich weiter auflösen. So<br />
haben sich bereits alle Ressorts im<br />
Sommer dieses Jahres in einem entsprechenden<br />
Ministerratsbeschluss<br />
verpflichtet, weitere Liegenschaften<br />
zu benennen, bei denen ein Contracting-Projekt<br />
durchgeführt werden soll.<br />
Der Erfolg in diesem Wettbewerb<br />
bestätigt erneut, dass sich die<br />
Contracting-Initiative Bayern, die in<br />
<strong>der</strong> Obersten Baubehörde im Bereich<br />
Staatlicher <strong>Hochbau</strong>, Sachgebiet IIA8<br />
(Thermische Energieversorgung; maschinentechnische<br />
Anlagen) initiiert<br />
und vorangetrieben wird, auf dem<br />
richtigen und wirtschaftlich sinnvollen<br />
Weg befindet.<br />
Nähere Einzelheiten zum Thema CIB<br />
können online unter www.cib.bayern.<br />
de eingesehen werden.<br />
V. l. n. r.: Herr Detlev Dauke, BMWi, Ministerialdirigent Friedrich Geiger, Baudirektor Peter Kalmer, Frau Annegret<br />
Agricola, dena. Foto: Deutsche Energie-Agentur (dena)<br />
Sachgebiet IIA8<br />
bau intern November/Dezember 2013 33
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong><br />
<strong>Staatsbauverwaltung</strong> für <strong>Hochbau</strong>, Städtebau,<br />
Wohnungsbau, Straßen und Brückenbau<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong><br />
<strong>Staatsbauverwaltung</strong> für <strong>Hochbau</strong>, Städtebau,<br />
Wohnungsbau, Straßen und Brückenbau<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong><br />
<strong>Staatsbauverwaltung</strong> für <strong>Hochbau</strong>, Städtebau,<br />
Wohnungsbau, Straßen und Brückenbau<br />
B 20 769 E<br />
Hochschule Ansbach Hörsaalgebäude, Ansicht von<br />
Osten, Foto: Ebener, Berlin<br />
B 20 769 E<br />
Trauntalbrücke in <strong>der</strong> ersten Bauphase<br />
Foto: Staatliches Bauamt Traunstein<br />
B 20 769 E<br />
Stadteingangssituation Museum „Fluvius“, oberes Stadttor („Törle“)<br />
Foto: Peter Schubert, Stadt Wassertrüdingen<br />
Januar/Februar 2013bau intern<br />
März/April 2013bau intern<br />
Mai /Juni 2013bau intern<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong><br />
<strong>Staatsbauverwaltung</strong> für <strong>Hochbau</strong>, Städtebau,<br />
Wohnungsbau, Straßen und Brückenbau<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Bayerischen</strong> <strong>Staatsbauverwaltung</strong> für <strong>Hochbau</strong>, Städtebau,<br />
Wohnungsbau, Verkehr, Straßen- und Brückenbau<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Bayerischen</strong> <strong>Staatsbauverwaltung</strong> für <strong>Hochbau</strong>, Städtebau,<br />
Wohnungsbau, Verkehr, Straßen und Brückenbau<br />
B 20 769 E<br />
Son<strong>der</strong>programm Militärkonversion Murnau,<br />
Kemmel Kaserne, Kettenhäuser<br />
Juli/August 2013bau intern<br />
B 20 769 E<br />
Sanierung des Wertachtalübergangs<br />
September/Oktober 2013bau intern<br />
B 20 769 E<br />
„Haus <strong>der</strong> Berge“ Bad Reichenhall<br />
Foto: Josephine Unterhauser, Bad Reichenhall<br />
November/Dezember 2013bau intern<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong><br />
<strong>Staatsbauverwaltung</strong> für <strong>Hochbau</strong>, Städtebau,<br />
Wohnungsbau, Straßen- und Brückenbau<br />
B 20 769 E<br />
Son<strong>der</strong>heft Hochschulbau März 2013bau intern<br />
Dieses Jahr haben wir in den sechs Ausgaben von bau intern und in einem<br />
Son<strong>der</strong>heft auf 244 Seiten 77 Beiträge zu einer Vielzahl von Themen, die die<br />
Bauverwaltung in diesem Jahr beschäftigt haben, veröffentlicht. Die Redaktion<br />
dankt allen Autorinnen und Autoren und allen, die an <strong>der</strong> Herausgabe von<br />
bau intern beteiligt waren, sehr herzlich für ihre engagierte Mitarbeit. Wir wünschen<br />
ihnen und unseren Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest,<br />
privat und beruflich alles Gute im neuen Jahr.<br />
Die Redaktion<br />
34 bau intern November/Dezember 2013