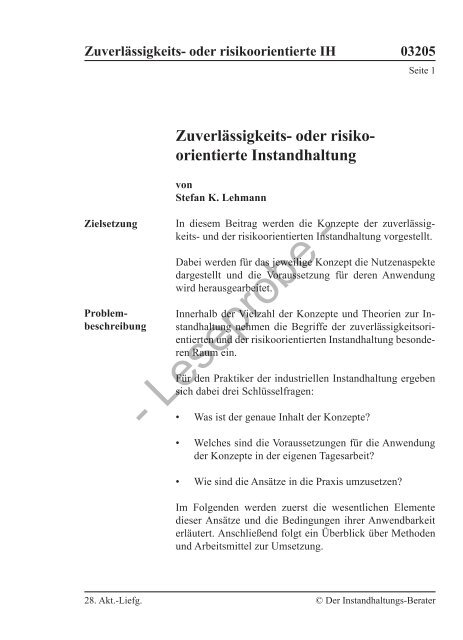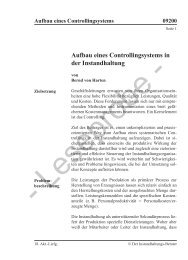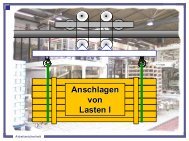Der Instandhaltungs-Berater
Der Instandhaltungs-Berater
Der Instandhaltungs-Berater
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 1<br />
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte<br />
Instandhaltung<br />
Zielsetzung<br />
Problembeschreibung<br />
von<br />
Stefan K. Lehmann<br />
In diesem Beitrag werden die Konzepte der zuverlässigkeits-<br />
und der risikoorientierten Instandhaltung vorgestellt.<br />
Dabei werden für das jeweilige Konzept die Nutzenaspekte<br />
dargestellt und die Voraussetzung für deren Anwendung<br />
wird herausgearbeitet.<br />
Innerhalb der Vielzahl der Konzepte und Theorien zur Instandhaltung<br />
nehmen die Begriffe der zuverlässigkeitsorientierten<br />
und der risikoorientierten Instandhaltung besonderen<br />
Raum ein.<br />
Für den Praktiker der industriellen Instandhaltung ergeben<br />
sich dabei drei Schlüsselfragen:<br />
- Leseprobe -<br />
• Was ist der genaue Inhalt der Konzepte?<br />
• Welches sind die Voraussetzungen für die Anwendung<br />
der Konzepte in der eigenen Tagesarbeit?<br />
• Wie sind die Ansätze in die Praxis umzusetzen?<br />
Im Folgenden werden zuerst die wesentlichen Elemente<br />
dieser Ansätze und die Bedingungen ihrer Anwendbarkeit<br />
erläutert. Anschließend folgt ein Überblick über Methoden<br />
und Arbeitsmittel zur Umsetzung.<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 2<br />
Arbeitsmittel<br />
für die Problemlösung<br />
• EN 13306 – Begriffe der Instandhaltung<br />
• DIN 31051 – Grundlagen der Instandhaltung<br />
Verfahren wie z. B.:<br />
Lösung/<br />
Lösungsweg<br />
Vier fundamentale<br />
IH-Konzepte<br />
<strong>Instandhaltungs</strong>strategie<br />
• Anlagenstrukturierung<br />
• Fehlerbaumanalyse<br />
• Risikoanalyse<br />
• Fehler-Möglichkeiten-Einfluss-Analyse (FMEA)<br />
• Auswahlmatrix zur Risikoanalyse<br />
1 Grundlegende Konzepte der Instandhaltung<br />
Die grundsätzlichen Möglichkeiten der Instandhaltung gemäß<br />
EN 13306 (Begriffe der Instandhaltung) sind in der<br />
Abb. 1 dargestellt.<br />
- Leseprobe -<br />
Während der Inhalt und die wesentlichen Vor- und Nachteile<br />
dieser Konzepte allgemein bekannt sind, stellt sich dem<br />
für die Instandhaltung Verantwortlichen die Frage, wie<br />
diese Konzepte für gegebene Anlagen zu kombinieren sind,<br />
um einen optimalen Erfolg der Instandhaltung zu erreichen.<br />
Die Kombination dieser Konzepte für die Instandhaltung<br />
bestimmter Objekte wird als <strong>Instandhaltungs</strong>strategie bezeichnet.<br />
Die <strong>Instandhaltungs</strong>strategie definiert dabei den Umfang<br />
und die Art, in der die vorbeugende Instandhaltung betrie-<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 3<br />
Instandhaltung<br />
Vorausbestimmende<br />
Instandhaltung<br />
Abb. 1: Grundlegende Möglichkeiten der Instandhaltung gemäß EN 13306<br />
Vorbeugende<br />
IH ist direkt<br />
beeinflussbar- Leseprobe<br />
Vorbeugende<br />
Instandhaltung<br />
Vor einem entdeckten<br />
Fehler<br />
Zustandsorientierte<br />
Instandhaltung<br />
Korrektive<br />
Instandhaltung<br />
Geplante<br />
(aufgeschobene)<br />
Instandhaltung<br />
Sofortige<br />
Instandhaltung<br />
ben wird. Von Umfang und Erfolg der vorbeugenden Instandhaltung<br />
ist es abhängig, in welchem Umfang korrektive<br />
Instandhaltung erforderlich ist.<br />
-<br />
Nach einem entdeckten<br />
Fehler<br />
Die Bedeutung der richtigen <strong>Instandhaltungs</strong>strategie ergibt<br />
sich aus der Erfahrung, dass eine beliebige Erhöhung des<br />
Aufwandes für vorbeugende Instandhaltung weder minimale<br />
<strong>Instandhaltungs</strong>kosten noch eine maximale Verfügbarkeit<br />
oder Zuverlässigkeit der jeweiligen Objekte sicherstellt.<br />
Zwei besonders hervorzuhebende Ansätze zur Entwicklung<br />
einer <strong>Instandhaltungs</strong>strategie werden im Folgenden dargestellt.<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 4<br />
2 Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung<br />
Definition<br />
Den Ausfall<br />
verstehen<br />
Sie beschreibt die Situation, dass die zu Beginn der Lebensdauer<br />
hohe Ausfallwahrscheinlichkeit auf einen niedrigeren<br />
Wert zurückgeht, dieser über einen großen Teil der Lebens-<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit<br />
Grundlage<br />
Statistik<br />
Ausfälle zu<br />
Beginn und zum<br />
Ende<br />
Die Definition der Zuverlässigkeit:<br />
„Zuverlässigkeit ist die Wahrscheinlichkeit, eine Anlage<br />
oder eine Einrichtung während einer (kurzen) Periode intakt<br />
anzutreffen, vorausgesetzt, sie war zu Beginn dieser Periode<br />
intakt.“<br />
macht das grundlegende Konzept der zuverlässigkeitsorientierten<br />
Instandhaltung deutlich: Da das Eintreten eines Ausfalls<br />
in vielen Fällen exakt nicht vorhergesagt werden kann,<br />
wird die exakte deterministische Betrachtung ersetzt durch<br />
eine statistische. In der Anwendung wird anstelle der Zuverlässigkeit<br />
meistens ihr Komplement, die Ausfallwahrscheinlichkeit,<br />
verwendet:<br />
„Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit,<br />
eine Anlage oder eine Einrichtung während einer (kurzen)<br />
Periode nicht intakt anzutreffen, vorausgesetzt, sie war zu<br />
Beginn dieser Periode intakt.“<br />
- Leseprobe -<br />
2.1 Grundkonzept: Die Ausfallkurve<br />
Das primäre Hilfsmittel der zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung<br />
ist die Ausfallkurve. Die Ausfallkurve beschreibt<br />
die Ausfallwahrscheinlichkeit zu jedem Zeitpunkt.<br />
Die am weitesten bekannte Ausfallkurve ist die in der<br />
Abb. 2 dargestellte Badewannenkurve.<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1<br />
0<br />
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 5<br />
Badewannenkurve<br />
Ausfallrate<br />
Abb. 2: Badewannenkurve<br />
Zeit<br />
dauer konstant bleibt, bevor die Ausfallwahrscheinlichkeit<br />
gegen Ende der Lebensdauer wieder ansteigt. Diese Ausfallkurve<br />
beschreibt z. B. das Ausfallverhalten elektronischer<br />
Komponenten. Dabei treten Fehler vor allem in der Anfangsphase<br />
(Frühausfälle z. B. auf Grund von Fabrikationsfehlern)<br />
und gegen Ende der Lebensdauer (aufgrund von<br />
Alterung) auf.<br />
- Leseprobe -<br />
Die Kenntnis der Ausfallkurven der Anlage und ihrer Komponenten<br />
bildet die Grundlage, diese Ausfallkurven durch<br />
zielgerichtete Instandhaltung zu beeinflussen, insbesondere<br />
die vorbeugende Instandhaltung auf Komponenten zu konzentrieren,<br />
deren Zuverlässigkeit die Zuverlässigkeit des<br />
Gesamtsystems (der Anlage) am stärksten beeinflusst.<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 6<br />
2.2 Anwendungsvoraussetzungen<br />
Zwei Voraussetzungen<br />
Bestimmung<br />
von Ausfallkurven<br />
aufwändig<br />
Anwendbar auf<br />
viele vergleichbare<br />
Objekte<br />
Dieses Vorgehen ist an zwei Voraussetzungen gebunden:<br />
• Die Ausfallkurven müssen bekannt sein.<br />
• Die statistischen Aussagen auf der Grundlage der Ausfallkurven<br />
müssen relevant sein.<br />
Die erste Voraussetzung ist grundsätzlich erfüllbar, erfordert<br />
aber aufgrund der oft komplexen Struktur industrieller<br />
Anlagen einen sehr hohen Aufwand, um durch die korrekte<br />
Verknüpfung der Ausfallkurven von Komponenten die Ausfallkurve<br />
der Anlage zu ermitteln. Hierzu eingesetzt werden<br />
Verfahren der Fehlerbaumanalyse oder der Fehler-Möglichkeiten-Einflussanalyse<br />
(FMEA).<br />
Die zweite Voraussetzung ist nach den Gesetzen der Statistik<br />
dann erfüllt, wenn die Aussagen für eine große Anzahl<br />
von Objekten/Fällen gelten.<br />
Daraus ergibt sich, dass die Anwendung der Zuverlässigkeit<br />
als Steuergröße der Instandhaltung sinnvoll ist, wenn z. B.<br />
das Restrisiko beim Einsatz einer Flotte von Verkehrsflugzeugen<br />
abzuschätzen ist oder die notwendigen Rückstellungen<br />
für Garantiereparaturen bei Autos zu kalkulieren sind.<br />
In diesen beiden Fällen interessiert nicht, an welchem Objekt<br />
der Ausfall eintritt, sondern der Umfang von Ausfällen<br />
über alle Objekte. Diese Steuergröße ist weniger geeignet<br />
für die Planung der Instandhaltung für einzelne Objekte.<br />
- Leseprobe -<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 7<br />
2.3 Durchführung der Zuverlässigkeitsorientierten<br />
Instandhaltung<br />
Durchführung<br />
in zwei<br />
Schritten<br />
Kennzeichnende<br />
Eigenschaften<br />
Konzentration<br />
auf relevante<br />
Komponenten- Leseprobe<br />
Die Durchführung der Zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung<br />
erfolgt in den folgenden Schritten:<br />
• Bestimmung der Ausfallkurven (die Alterungsabhängigkeit<br />
der Zuverlässigkeit ist weit weniger bedeutend<br />
als ursprünglich gedacht);<br />
• Klassifizierung der Bedeutung einer Komponente (was<br />
passiert bei einem Ausfall?).<br />
Die so entwickelte <strong>Instandhaltungs</strong>strategie ist gekennzeichnet<br />
durch folgende Eigenschaften:<br />
• Gleiche Komponenten werden nicht unbedingt in gleicher<br />
Weise instand gehalten;<br />
• manche Komponenten werden nicht instand gehalten –<br />
weil es nicht möglich ist oder weil es nicht sinnvoll ist;<br />
-<br />
• eindeutige Identifikation der Ansatzpunkte für Verbesserungen<br />
durch Ermittlung von Komponenten, die die<br />
Zuverlässigkeit der Anlage wesentlich beeinflussen.<br />
Bei korrekter Anwendung und Vorliegen der Anwendungsvoraussetzungen<br />
führt die zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung<br />
dazu, dass <strong>Instandhaltungs</strong>aufwand (einschließlich<br />
Verbesserungen) auf die Komponenten konzentriert<br />
wird, die für die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems<br />
bestimmend sind.<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 8<br />
In der Luftfahrt gelang es vor allem durch diesen Ansatz die<br />
Verlustrate von 60/1 Million Starts auf weniger als 2/1 Million<br />
Starts zu reduzieren.<br />
Beobachtungen<br />
der Praxis<br />
Ausfall auf<br />
Grund von<br />
Verschleiß<br />
vorhersagbar<br />
Verschleißteile/<br />
Schwachstellen<br />
2.4 Praktischer Nutzen – Die realen Ausfallkurven<br />
Das beobachtete Ausfallverhalten von Anlagen lässt sich in<br />
sehr vielen Fällen durch eine der in der Abb. 3 dargestellten<br />
Ausfallkurven beschreiben.<br />
Die Abb. 3 links beschreibt ein Ausfallverhalten, bei dem<br />
der Ausfall ziemlich exakt zu einem bestimmten Zeitpunkt<br />
bzw. bei einer bestimmten Abnutzung eintritt. Dies ist die<br />
Folge von Verschleiß. Die rechte Kurve beschreibt dagegen<br />
die Situation, dass die Ausfälle ohne erkennbare Tendenz<br />
und Systematik erfolgen.<br />
Die Ursachen dieser beiden typischen Ausfallkurven werden<br />
Verschleißteile (links) und Schwachstellen (rechts) genannt.<br />
Während der Ausfall aufgrund von Schwachstellen<br />
der Badewannenkurve im größten Teil der Lebensdauer entspricht,<br />
folgt der Ausfall aufgrund von Verschleiß grundsätzlich<br />
anderen Gesetzen.<br />
- Leseprobe -<br />
Das Verständnis dieser Zusammenhänge ermöglicht es,<br />
Handlungsoptionen<br />
• die Ursachen der Ausfälle auf der Grundlage einer<br />
durchgängigen Schadensregistrierung zu klassifizieren<br />
– ohne die Notwendigkeit, die exakten Ursachen zu<br />
kennen,<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.
•-0.5<br />
•-1.5<br />
•2<br />
•1.5<br />
•1<br />
•0.5<br />
•0<br />
•-1<br />
•-2<br />
•-15 •-10 •-5 •0 •5 •10 •15<br />
•7<br />
•6.8<br />
•6.6<br />
•6.4<br />
•6.2<br />
•6<br />
•5.8<br />
•5.6<br />
•5.4<br />
•5.2<br />
•5<br />
•-15 •-10 •-5 •0 •5 •10 •15<br />
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 9<br />
Die Kenntnis, dass Verschleißteil und Schwachstelle die in<br />
der Praxis häufigsten, aber nicht die einzig möglichen Ausfallkurven<br />
sind, ermöglicht es schließlich, das Auftreten anderer<br />
Ausfallmechanismen (z. B. Alterungsvorgänge) zu erkennen.<br />
Ausfallrate<br />
Ausfallrate<br />
Verschleißteile<br />
Abb. 3: Reale Ausfallkurven<br />
Diagnose gezielt<br />
einsetzen<br />
Zeit<br />
Schwachstellen<br />
• den Ausfall von Verschleißteilen durch die Anwendung<br />
vorbeugender Instandhaltung zu minimieren – insbesondere<br />
durch den Einsatz von Methoden der zustandsorientierten<br />
Instandhaltung –,<br />
• Schwachstellen durch technische Verbesserungen zu<br />
beseitigen oder die Behebung der entsprechenden Ausfälle<br />
zu optimieren.<br />
- Leseprobe -<br />
Die Kenntnis der Ausfallkurven gestattet es daher, den Einsatz<br />
von Diagnosemethoden auf die Objekte zu konzentrieren,<br />
bei denen dieser Einsatz sinnvoll ist.<br />
Zeit<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 10<br />
3 Risikoorientierte Instandhaltung<br />
3.1 Grundkonzept: Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit,<br />
Risiko<br />
Die Sicht des<br />
Anlagennutzers<br />
Weitere Faktoren<br />
Definition<br />
Während Zuverlässigkeit eine Aussage darüber trifft, wie<br />
wahrscheinlich es ist, ein System oder eine Anlage zu einem<br />
Zeitpunkt intakt anzutreffen (die Ausfallkurve stellt das<br />
Komplement der Zuverlässigkeit über der Zeitachse graphisch<br />
dar), berücksichtigt die Verfügbarkeit weitere Faktoren,<br />
die die Einsetzbarkeit einer Anlage für die Produktion<br />
bestimmen:<br />
• Eine Anlage kann, obwohl sie intakt ist, nicht für die<br />
Produktion nutzbar sein, z. B. weil vorbeugende Instandhaltung<br />
ausgeführt wird.<br />
• Eine Anlage ist nach einem Ausfall nicht dauerhaft<br />
nicht nutzbar. Sie wird vielmehr von der Instandhaltung<br />
in einer bestimmten Zeit in den nutzbaren Zustand zurückgeführt.<br />
- Leseprobe -<br />
Um diese Faktoren insgesamt zu erfassen, definiert die<br />
(Technische) Verfügbarkeit den Zeitanteil, zu dem eine Anlage<br />
der Produktion zur Verfügung steht.<br />
Die hier betrachtete Technische Verfügbarkeit berücksichtigt<br />
keine Zeitanteile, in dem die Anlage zwar technisch<br />
nutzbar, aber aus anderen Gründen (keine Rohmaterialien,<br />
kein Lagerplatz für Produkte) nicht genutzt werden kann.<br />
Aus der Definition der Verfügbarkeit ergeben sich drei Faktoren,<br />
um die Verfügbarkeit eines Objektes zu erhöhen:<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 11<br />
Erhöhung der<br />
Verfügbarkeit<br />
• Erhöhung der Zuverlässigkeit,<br />
• Minimierung der Zeit zur Instandsetzung nach einem<br />
Ausfall,<br />
Risiko = Kosten<br />
Ausfall muss<br />
akzeptabel sein<br />
• Minimierung der Zeit, in der das Objekt zur Durchführung<br />
vorbeugender Instandhaltung nicht zur Verfügung<br />
steht.<br />
Die für den Anlagenbetreiber wesentliche Kenngröße sind<br />
die wahrscheinlichen Kosten, die aufgrund der Nichtverfügbarkeit<br />
von Anlagen zu erwarten sind. Diese Kosten, das<br />
Risiko, bilden die wesentliche Steuergröße bei den Verfahren<br />
der risikoorientierten Instandhaltung. Bei der Bestimmung<br />
dieser Kosten geht zusätzlich der Umfang ein, in dem<br />
das Objekt der Produktion zur Verfügung stehen muss.<br />
3.2 Anwendungsvoraussetzungen<br />
Die wesentliche Voraussetzung für die Anwendung der Verfahren<br />
der risikoorientierten Instandhaltung ist die grundsätzliche<br />
Akzeptanz eines Ausfalls.<br />
- Leseprobe -<br />
Diese Voraussetzung ist dann nicht gegeben, wenn<br />
• ein Ausfall zu grundsätzlich nicht akzeptablen Konsequenzen<br />
führt,<br />
• der Ausfall von Einrichtungen zu nicht akzeptablen<br />
Schäden an Anlagen oder hohem Aufwand für An- und<br />
Abfahrvorgänge führt.<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 12<br />
Bei grundsätzlicher Akzeptanz sind die Folgen eines Ausfalls<br />
zu bewerten, um die Auswirkungen verschiedener Ausfälle<br />
vergleichbar zu machen.<br />
Unverzichtbare<br />
Voraussetzung<br />
Strukturierung<br />
in mehreren<br />
Ebenen<br />
3.3 Durchführung der Risikoorientierten Instandhaltung<br />
1. Schritt: Anlagenstrukturierung<br />
Eine prozessorientierte Strukturierung der Objekte der Instandhaltung<br />
nach [2], wie in der Abb. 4 dargestellt, ist<br />
grundsätzlich sinnvoll. Für die Anwendung der Verfahren<br />
der risikoorientierten Instandhaltung ist ein solches Vorgehen<br />
unverzichtbar, um die sich ergebenden Vorgaben systematisch<br />
und transparent den Komponenten der Anlage zuordnen<br />
zu können. Die Verwendung einer Anlagenstruktur<br />
ermöglicht es, auch die Untersuchungen mit einem der Aufgabenstellung<br />
angepassten Detaillierungsgrad durchzuführen.<br />
Dabei wird die Anlage in mehreren Ebenen strukturiert, wobei<br />
jede Ebene die gesamte Anlage beschreibt. Die Anzahl<br />
der Ebenen hängt dabei vom Anwendungsfall ab, wird in<br />
vielen Fällen zwischen drei und fünf liegen. Die Zahl der<br />
Ebenen muss nicht über die gesamte betrachtete Anlage<br />
identisch sein (s. a. Kap. 04410).<br />
- Leseprobe -<br />
2. Schritt: Risikoanalyse<br />
Auf der Grundlage der Anlagenstrukturierung wird das Risiko<br />
bei Ausfall von Komponenten bewertet. Zur Durchführung<br />
der Risikoanalyse wurden zahlreiche Verfahren vorge-<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 13<br />
Prinzip der<br />
Anlagenstrukturierung<br />
Anlagenkomplex<br />
besteht aus<br />
Anlage<br />
besteht aus<br />
besteht aus<br />
besteht aus<br />
Teilanlage<br />
Anlageteil<br />
Teil<br />
Abb. 4: Prinzip der prozessorientierten Anlagenstrukturierung [2]<br />
schlagen. Viele dieser Verfahren arbeiten mit quantitativen<br />
Werten für Ausfallwahrscheinlichkeit und Folgen. Neben<br />
dem mathematischen Aufwand stellt sich dabei die Frage<br />
von Bestimmung und Relevanz der Ausfallwahrscheinlichkeit.<br />
- Leseprobe -<br />
hat<br />
Technische<br />
Einrichtung<br />
Vereinfachtes<br />
qualitatives<br />
Verfahren<br />
Es wurden daher vereinfachte Verfahren entwickelt, wie das<br />
hier dargestellte [1]. Dabei wird die grundsätzlich notwendige<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit nicht aus Ausfallkurven<br />
oder statistischen Betrachtungen, sondern durch qualitative<br />
Abschätzung ermittelt. In gleicher Weise werden die Folgen<br />
eines Ausfalls qualitativ klassifiziert in<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 14<br />
Folgen eines<br />
Ausfalls<br />
• Personenschäden,<br />
• Umweltschäden und<br />
• Sachschäden.<br />
Praxisbewährtes<br />
Vorgehen<br />
Auswahlmatrix<br />
Die Durchführung der Risikoanalyse kann auf jeder Ebene<br />
der Anlagenstruktur erfolgen. In der Praxis hat sich folgendes<br />
Vorgehen bewährt:<br />
• Die Risikoanalyse wird auf der höchsten Ebene der Anlagenstruktur<br />
(auf der Ebene der Teilanlagen bei Nutzung<br />
der Bezeichnungen der Abb. 4) begonnen.<br />
• Die Risikoanalyse wird für die Teilanlage(n) wiederholt,<br />
die wesentlich zum Risiko beitragen.<br />
• Gegebenenfalls wird die Untersuchung auf weitere<br />
Ebenen ausgedehnt.<br />
Hilfsmittel bei der Risikoanalyse ist die in der Abb. 5 dargestellte<br />
Auswahlmatrix. In der Kopfzeile dieser Matrix sind<br />
die zulässigen Werte der Ausfallwahrscheinlichkeit, in der<br />
linken Spalte die Klassifizierungen der Ausfallfolgen dargestellt.<br />
Das Ausfallrisiko jeder Komponente (Teilanlage, Anlagenteil<br />
oder Teil) wird durch ein Feld der Auswahlmatrix<br />
charakterisiert. Dabei sinkt das Risiko von oben nach unten<br />
und von links nach rechts.<br />
- Leseprobe -<br />
Dieses Risiko ist die wesentliche Größe für die Definition<br />
der Anforderungen an die Instandhaltung.<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 15<br />
03205-a.xls<br />
Schadensart.<br />
und -höhe.<br />
Personenschäden<br />
groß<br />
mittel<br />
gering<br />
Umweltschäden<br />
groß<br />
mittel<br />
gering<br />
Sachschäden<br />
groß<br />
mittel<br />
gering<br />
hoch mittel gering<br />
Abb. 5: Auswahlmatrix bei der Risikoanalyse – Anwendung auf Teilanlagen, Anlagenteile<br />
oder Teile [1]<br />
Darstellung der<br />
Anforderung<br />
Wahrscheinlichkeit des Ereigniseintritts<br />
3. Schritt: Bestimmung der Reaktionszeiten<br />
- Leseprobe -<br />
Neben dem Risiko werden die Vorgaben an die Instandhaltung<br />
bestimmt durch die Zeit, innerhalb deren die Instandhaltung<br />
auf einen Ausfall reagieren muss. Es wird daher zusätzlich<br />
die Reaktionszeit vorgegeben. Dazu sind die nachfolgenden<br />
Fragen zu beantworten:<br />
Checkliste<br />
Reaktionszeitbestimmung<br />
• In welcher Zeit nach einem Ausfall treten Folgeschäden<br />
an Anlagen oder Einrichtungen auf?<br />
• Wie ist die Reichweite der Bestände in den Lägern?<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 16<br />
• Wie ist die Reichweite der Puffer im Prozess?<br />
• Sind redundante Einrichtungen vorhanden?<br />
• Wie lange benötigen wir zum Beschaffen der Ersatzteile?<br />
• Wie lange benötigen wir, bis die richtigen Vorrichtungen<br />
verfügbar sind?<br />
• Wie lange benötigen wir, bis die richtigen Mitarbeiter<br />
verfügbar sind?<br />
• Wie lange benötigen wir, bis die richtigen Werkzeuge<br />
verfügbar sind?<br />
Mit Hilfe der aufgeführten Kriterien werden die Reaktionszeiten<br />
nach Ausfall von Komponenten definiert. Dabei wird<br />
neben technischen Faktoren (Vermeidung von Folgeschäden)<br />
auch berücksichtigt, welche Bedeutung die Anlage für<br />
die Lieferfähigkeit hat. Zur Bestimmung der Reaktionszeit<br />
sind daher Produktionsplan, Auslastung und Pufferkapazitäten<br />
heranzuziehen.<br />
- Leseprobe -<br />
Diese Daten werden auch herangezogen, wenn abschließend<br />
die erforderlichen Verfügbarkeiten bestimmt werden.<br />
Resultat: Definition der <strong>Instandhaltungs</strong>strategie<br />
Anwendung der<br />
Vorgaben<br />
Nach der Vorgabe von Risiken und Reaktionszeiten lässt<br />
sich die Strategie der vorbeugenden Instandhaltung aus der<br />
in der Abb. 6 dargestellten Auswahlmatrix ableiten.<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 17<br />
hoch<br />
Risikoklasse<br />
gering<br />
Vorbeugende<br />
Instandhaltung<br />
durchführen<br />
gering<br />
(Zyklen eventuell<br />
verkürzen)<br />
Partieller<br />
Leistungsverzicht<br />
Abb. 6: Auswahlmatrix zur Festlegung der Strategie [1]<br />
IH-Strategie<br />
festlegen<br />
(Zyklen verlängern,<br />
Wartungsverträge<br />
überprüfen, eventuell<br />
kündigen)<br />
Partieller<br />
Leistungsverzicht<br />
im Bereich<br />
Sachschäden<br />
(Zyklen verlängern,<br />
Wartungsverträge<br />
überprüfen)<br />
Leistungsverzicht<br />
(Vollständiger Verzicht auf<br />
vorbeugende<br />
Instandhaltung)<br />
hoch<br />
Reaktionszeit<br />
zur Behebung von<br />
Schäden<br />
Die vorbeugende Instandhaltung wird auf Elemente hoher<br />
Risikoklasse und geringer zulässiger Reaktionszeit konzentriert<br />
(links oben). Bei geringem Risiko und langen Reaktionszeiten<br />
wird auf vorbeugende Instandhaltung vollständig<br />
verzichtet, sofern es gesetzliche und behördliche Vorschriften<br />
zulassen (rechts unten). Bei hohem Risiko, aber<br />
auch langer zulässiger Reaktionszeit kann der Aufwand für<br />
vorbeugende Instandhaltung reduziert werden, sofern Sachschäden<br />
betroffen sind (rechts oben). Eine kritische Überprüfung<br />
des Aufwandes ist auch bei geringem Risiko und<br />
kurzer zulässiger Reaktionszeit sinnvoll. In diesem Fall sind<br />
insbesondere die Folgen einer Überschreitung der zulässigen<br />
Reaktionszeit zu betrachten.<br />
- Leseprobe -<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 18<br />
Örtliche Zuordnung<br />
der IH<br />
Wirksamkeit<br />
ständig<br />
verfolgen<br />
Was ist zu<br />
erfassen/<br />
analysieren?<br />
Die definierten Reaktionszeiten bestimmen darüber hinaus<br />
die Organisation und zweckmäßige örtliche Zuordnung der<br />
Instandhaltung. Je kürzer die zulässigen Reaktionszeiten<br />
sind, desto näher ist die Instandhaltung an der Produktion<br />
anzuordnen.<br />
Umgekehrt besteht bei durchweg langen zulässigen oder<br />
durch andere Bedingungen (z. B. Auskühlen der Anlage)<br />
gegebene Reaktionszeiten keine Notwendigkeit, die Instandhaltung<br />
physisch in der Nähe der Anlagen anzuordnen.<br />
Schadensregistrierung und Schadensanalyse<br />
Die Entwicklung einer <strong>Instandhaltungs</strong>strategie mit den<br />
Methoden der risikoorientierten Instandhaltung beruht in<br />
vielen Fällen auf Abschätzungen und qualitativen Einschätzungen.<br />
Es ist daher unverzichtbar, die resultierende Strategie<br />
ständig auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und gegebenenfalls<br />
anzupassen.<br />
Grundlage dieser Überprüfung sind eine systematische Erfassung<br />
und Analyse aller Schäden. Zu erfassen ist dabei<br />
mindestens:<br />
- Leseprobe -<br />
• Zuordnung des Schadens zur Anlagenstruktur<br />
• Eintrittszeitpunkt und Dauer des Schadens<br />
• Schadensbild und Schadensursache<br />
• Maßnahmen und Aufwand (Zeit, Kosten) zur Beseitigung<br />
des Schadens<br />
• Folgen des Schadens<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 19<br />
Maßnahmen<br />
Verschleiß<br />
Maßnahmen<br />
Schwachstellen<br />
Mit Hilfe dieser Schadensregistrierung lässt sich überprüfen,<br />
• ob die vorgegebenen Verfügbarkeiten erreicht werden<br />
und<br />
• ob die Schäden durch Verschleiß oder durch Schwachstellen<br />
verursacht werden.<br />
Etwa erforderliche Maßnahmen werden entscheidend dadurch<br />
bestimmt, ob sie durch Verschleißteile oder Schwachstellen<br />
verursacht werden. Zur Reduktion der Schäden<br />
durch Verschleißteile können die Zyklen der vorbeugenden<br />
Instandhaltung angepasst und/oder verbesserte Verfahren<br />
zur Diagnose des Verschleißes eingesetzt werden.<br />
Bei Verursachung der Schäden durch Schwachstellen sind<br />
dagegen die Schwachstellen zu ermitteln und durch technische<br />
Verbesserungen zu beseitigen. Ist dies nicht mit<br />
vertretbarem Aufwand möglich, ist die Instandhaltung so<br />
zu organisieren, dass die Zeit zur Beseitigung der so verursachten<br />
Schäden minimal wird (Instandhalter nahe an der<br />
Anlage, Ersatzteile sofort verfügbar, optimale Werkzeuge<br />
und Vorrichtungen, Training). Ob eine Schwachstelle beseitigt<br />
wird oder die Folgen der entsprechenden Ausfälle<br />
minimiert werden, wird durch Vergleich der Kosten entschieden.<br />
- Leseprobe -<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 20<br />
4 Typische Anwendungsgebiete<br />
4.1 Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung<br />
Anwendung,<br />
wenn …<br />
Klassische<br />
Anwendungsgebiete<br />
Entsprechend den Anwendungsvoraussetzungen wird die<br />
zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung zweckmäßig angewandt,<br />
wenn<br />
• die Instandsetzung nach einem Ausfall nicht akzeptabel<br />
ist bzw. die Verfügbarkeit nicht wesentlich erhöht,<br />
• eine Instandsetzung zwar möglich ist, die Instandsetzungszeit<br />
aber nicht oder nur wenig beeinflussbar ist,<br />
• die Zahl der vergleichbaren Objekte die Anwendung<br />
statistischer Verfahren ermöglicht.<br />
Ein Hauptanwendungsgebiet der zuverlässigkeitsorientierten<br />
Instandhaltung ist die Luftfahrtindustrie, in der sie ursprünglich<br />
entwickelt wurde.<br />
Eine vergleichbare Anwendung ist die Instandhaltung einer<br />
Flotte von Speditionsfahrzeugen. Bei festen Orten der<br />
Werkstätten werden die Kosten des Betriebes der Fahrzeuge<br />
wesentlich durch deren Zuverlässigkeit bestimmt.<br />
- Leseprobe -<br />
Das Verfahren der zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung<br />
ist auch dann anzuwenden, wenn eine Anlage zwar<br />
grundsätzlich instand gesetzt werden kann, solche Instandsetzungen<br />
aber – z. B. aufgrund hoher Kosten – wenn irgend<br />
möglich vermieden werden sollen.<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.
Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH 03205<br />
Seite 21<br />
Ein Beispiel für solche Anlagen sind komplexe verfahrenstechnische<br />
Anlagen, deren An- und Abfahren sehr hohe<br />
Kosten verursacht.<br />
Typisch für Anlagen, deren Instandhaltung nach den Methoden<br />
der zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung erfolgt,<br />
ist:<br />
• Ausfälle werden durch anlagentechnische Mittel (Redundanz)<br />
verhindert.<br />
• Die Nähe der Instandhalter zur Anlage ist nicht erforderlich.<br />
4.2 Risikoorientierte Instandhaltung<br />
Grundlegende Voraussetzung für die Anwendung der risikoorientierten<br />
Instandhaltung ist die Akzeptanz von Ausfällen.<br />
Wenn Ausfälle grundsätzlich akzeptabel (bzw. mangels Alternative<br />
zu akzeptieren) sind, spielt die Reaktionszeit der<br />
Instandhaltung eine entscheidende Rolle. In solchen Anlagen<br />
sind die Instandhalter daher möglichst in der Nähe der<br />
Anlagen zu platzieren, wenn nicht sogar in die Produktion<br />
zu integrieren.<br />
- Leseprobe -<br />
Klassische<br />
Anwendungsgebiete<br />
Typisches Anwendungsbeispiel der risikoorientierten Instandhaltung<br />
sind sehr komplizierte Anlagen (Anlagen mit<br />
sehr vielen einzelnen Teilen), bei denen die sichere Vermeidung<br />
aller Ausfälle aus Gründen des Aufwandes nicht sinnvoll<br />
ist. Typische Anlagen dieser Art sind Montagestraßen<br />
und Anlagen der Getränkeabfüllung.<br />
28. Akt.-Liefg. © <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong>
03205 Zuverlässigkeits- oder risikoorientierte IH<br />
Seite 22<br />
Literaturverzeichnis<br />
[1] Geibig, Karl-Friedrich; Risikobetrachtung in der Instandhaltung,<br />
Vortrag auf den Weinheimer Instandhaltertagen,<br />
2002<br />
[2] Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der<br />
Prozessindustrie; NAMUR Empfehlung NE 33: Anforderungen<br />
an Systeme zur Rezeptfahrweise, 1993<br />
- Leseprobe -<br />
© <strong>Der</strong> <strong>Instandhaltungs</strong>-<strong>Berater</strong> 28. Akt.-Liefg.