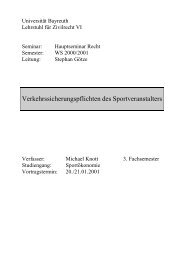Zum Konflikt zwischen Individual - sportrecht.org
Zum Konflikt zwischen Individual - sportrecht.org
Zum Konflikt zwischen Individual - sportrecht.org
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fabien Benjamin Wehner<br />
Am Roten Berg 4<br />
95496 Glashütten<br />
Email: ail: wehner_fabien@msn.com<br />
Matrikel-Nr.: 1150522<br />
5. Fachsemester<br />
<strong>Zum</strong> <strong>Konflikt</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Individual</strong> <strong>Individual</strong>- und Teamsponsoringverträgen ingverträgen am<br />
Beispiel des Musterarbeitsvertrages der DFL<br />
Seminar zum Sportrecht<br />
bei Prof Prof. Dr. Peter W. Heermann, LL.M.<br />
Wintersemester 2010/2011
INHALTSVERZEICHNIS<br />
A. Einleitung ............................................................................................................................. 1<br />
B. Relevante Rechtsverhältnisse im Verhältnis Sponsor-Lizenzspieler-Verein-Sponsor .. 2<br />
I. Der Musterarbeitsvertrag der DFL .................................................................................... 2<br />
II. Der Sportsponsoringvertrag im Überblick ....................................................................... 3<br />
1. Grundlagen des Sponsoringvertrags ........................................................................... 3<br />
a. Typischer Vertragsaufbau .................................................................................... 3<br />
b. Gegenstand des Sponsoringvertrags; der Leistungsaustausch ............................ 3<br />
c. Rechtsnatur des Sponsoringvertrags .................................................................... 4<br />
2. Verfolgte Interessen aus Sicht der Sportsponsoringvetragsparteien .......................... 5<br />
a. Ziele und Motive von Sponsoren ......................................................................... 5<br />
b. Interesse der Gesponserten .................................................................................. 5<br />
c. Die Sponsoringverträge im Fußball ..................................................................... 6<br />
aa. Teamsponsoring durch Ausrüstungs- und individuelle Werbeverträge ........ 6<br />
bb. <strong>Individual</strong>sponsoring durch Ausrüstungs- und individuelle Werbeverträge 6<br />
d. Ausschließlichkeit in Sponsoringverträgen ......................................................... 7<br />
C. Lizenzspieler und ihre von der Vermarktung betroffenen Rechte und Rechtsgüter ... 8<br />
I. Die geschützten Persönlichkeitsrechte der Sportler .......................................................... 8<br />
1. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht .......................................................................... 9<br />
2. Das Recht am eigenen Bilde (§ 22 f. KUG) ............................................................... 9<br />
3. Das Recht am eigenen Namen (§ 12 BGB) .............................................................. 11<br />
4. Sonstige relevante Schutzgüter ................................................................................. 12<br />
II. Zur Übertragbarkeit von Persönlichkeitsrechten .......................................................... 13<br />
D. Beschränkungen durch arbeitsrechtliche Vereinbarungen .......................................... 14<br />
I. Vertragsabschlussfreiheit der Sportler ............................................................................. 14<br />
II. Anwendbarkeit des AGB-Kontrollrecht auf den Musterarbeitsvertrag ..................... 15<br />
III. Tranzparenzkontrolle einzelner Vertragsbestandteile ................................................ 16<br />
1. Verpflichtung zum Tragen bestimmter Kleidung § 2 lit. e) MuAV ....................... 177<br />
2. Nutzung von Gebrauchsgütern § 2 lit. f) MuAV .................................................... 179<br />
II
3. Nutzung und Verwertung der Persönlichkeitsrechte im Arbeitsverhältnis § 3 lit. a)<br />
MuAV ........................................................................................................................... 20<br />
a. Einräumung der Persönlichkeitsrechte nach § 3 lit. a) I MuAV ....................... 20<br />
b. Exklusive Lizenzerteilung ................................................................................. 22<br />
c. Verbot von Nebentätigkeiten ............................................................................. 22<br />
E. Anmerkung zur werberechtlichen Beziehung <strong>zwischen</strong> Spieler und Verband ........... 26<br />
F. Fazit ..................................................................................................................................... 27<br />
G. Anhang ............................................................................................................................... 29<br />
III
LITERATURVERZEICHNIS<br />
Backes, Bettina; Poser, Ulrich Sponsoringvertrag, 4. Auflage, München 2010<br />
(zit.: Poser/Backes, S.)<br />
Batten & Company Studie: Markenbewertung von deutschen Nationalspielern<br />
und Top-Bundesligaspielern, Düsseldorf, August 2010,<br />
(zuletzt 04.12.2010)<br />
Bepler, Klaus Gefahren für die Persönlichkeitsrechte von Sportlern<br />
durch arbeitsrechtliche Regelungen, Manuskript, 2010<br />
(zit.: Bepler, S.)<br />
Bergmann, Bettina Sportsponsoring und Kartellrecht – Was müssen<br />
Sponsoren, Verbände, Vereine beachten?, SpuRt 3/2009<br />
S. 102 ff.<br />
(zit.: Bergmann, SpuRt 3/2009, 102, S.)<br />
Beuthien, Volker; Schmölz, Anton Persönlichkeitsrechtsschutz und<br />
Persönlichkeitsgüterrechte, München 1999<br />
(zit.: Beuthin/Schmölz, S.)<br />
Brandner, Hans E.; Hensen, Hort-<br />
Diether; Ulmer, Peter<br />
Breucker, Marius; Wüterich,<br />
Christoph<br />
AGB-Recht Kommentar, 10. Auflage, Köln 2006<br />
(zit.: Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Gesetz, § Rn.)<br />
Das Arbeitsrecht im Sport, Stuttgart München, 2006<br />
(zit.: Wüterich/Breucker, Rn.)<br />
Brox, Hans Allgemeiner Teil des BGB, 29 Auflage, Köln 2005<br />
(zit.: Brox, BGB AT, Rn.)<br />
Bruhn, Manfrad Sponsoring – Systematische Planung und integrativer<br />
Einsatz, 3. Auflage, Frankfurter Allgemeine Zeitung,<br />
Frankfurt am Main, Wiesbaden 1998<br />
(zit.: Bruhn, S.)<br />
Bruhn, Manfred; Mehlinger, Rudolf Rechtliche Gestaltung des Sponsoring, 2. Auflage, Band I<br />
Allgemeiner Teil Band II Spezieller Teil, München 1999<br />
(zit.: Bruhn/Mehlinger, Band, S.)<br />
Damm, Renate; Rehbock, Klaus Widerruf, Unterlassung und Schadensersatz in den<br />
Medien, 3. Auflage, München 2008<br />
(zit.: Damm/Rehbock, Rn.)<br />
IV
Dauner-Lieb, Barbara; Heidel,<br />
Thomas; Ring, Gerhard<br />
BGB Anwaltskommentar,<br />
Band 1, Allgemeiner Teil mit EGBGB, Bonn 2005<br />
(zit.: BGB-AK, Bearbeiter, § Rn.)<br />
Dreier, Thomas; Schulze, Gernot Urheberrechtsgesetz: UrhG Kommentar, 3. Auflage,<br />
München 2008<br />
(zit.: Dreier/Schulze, Bearbeiter, UrhG § Rn.)<br />
Engel, Philipp Sponsoring im Sport – Vertragliche Aspekte, Zürich<br />
Basel Genf 2009<br />
(zit.: Engel, S.)<br />
Forkel, Hans Lizenzen an Persönlichkeitsrechten durch gebundene<br />
Rechtsübertragung, GRUR 1988, S. 491 ff.<br />
(zit.:Forkel, GRUR 1988, 491, S.)<br />
ders. Zur Zulässigkeit beschränkter Übertragungen des<br />
Namensrechts, NJW 1993, S. 3181 ff.<br />
(zit.:Forkel, NJW 1993, 3181, S.)<br />
Fritzweiler, Jochen; Pfister, Bernd;<br />
Summerer, Thomas<br />
Praxishandbuch Sportrecht, 2. Auflage, München, 2007<br />
(zit.: PHB-SportR, Bearbeiter, Teil, Kapitel, Rn.)<br />
Gauß, Holger Der Mensch als Marke, UFITA Schriftenreihe 230,<br />
Baden-Baden 2005<br />
(zit.: Gauß, S.)<br />
Glöckner, Martin Nebentätigkeitsverbote im <strong>Individual</strong>arbeitsrecht, Baden-<br />
Baden 1993<br />
(zit.: Glöckner, S.)<br />
Götting, Hans Peter Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, Tübingen<br />
1995<br />
(zit.: Götting, S.)<br />
Götze, Stephan; Heermann, Peter W. Zivilrechtliche Haftung im Sport, Juristische<br />
Weiterbildung 11, Baden-Baden 2002<br />
(zit.: Heermann/Götz, S.)<br />
Grunsky, Wolfgang (Hrsg.) Werbetätigkeit und Sportvermarktung, Heidelberg 1985<br />
(zit.: Grunsky, Bearbeiter, S.)<br />
Hamacher, Karl; Robak, Markus Wem gehören die Persönlichkeitsrecht?, Sponsors<br />
10/2009, S. 54 f.<br />
(zit.: Hamacher/Robak, Sponsors 10/2009, 54, S.)<br />
Hamacher, Karl; Weber, Nils Do’s and Don’ts aus Sponsorensicht, Sponsors 01/2008,<br />
S. 42 f.<br />
(zit.: Hamacher/Weber, Sponsors 01/2008, 42, S.)<br />
V
Heermann, Peter W. Ausschließlichkeitsbindungen in Sponsoringverträgen aus<br />
kartellrechtlicher Sicht, causa sport 3/2009 S. 448 ff.<br />
(zit.: Heermann, causa sport 3/2009, 448, S.)<br />
ders. Wem stehen die Verwertungsbefugnisse an<br />
Persönlichkeitsrechten von Lizenzfussballspielern zu?,<br />
causa sport 2/2009, S. 166 ff.<br />
(zit.: Heermann, causa sport 2/2009, 166, S.)<br />
ders. Haftung im Sport, Recht im Sport Band 1, Stuttgart 2008<br />
(zit.: Heermann, S.)<br />
Helle, Jürgen Besondere Persönlichkeitsrecht im Privatrecht, JZ<br />
Schriftenreihe Heft 3, Tübingen 1991<br />
(zit.: Helle, S.)<br />
Hergenröder, Curt Wolfgang;<br />
Loritz, Karl-Ge<strong>org</strong>;<br />
Zöllner,Wolfgang<br />
Arbeitsrecht, 6. Auflage, München 2008<br />
(zit.:Zöllner/Loritz/Hergenröder, S.)<br />
Hunold, Wolf Rechtsprechung zur Nebentätigkeit des Arbeitsnehmers,<br />
NZA-RR 2002, 505 ff.<br />
(zit.: Hunold, NZA-RR 2002, 505, S.)<br />
Ittmann, Erasmus Benjamin Pflichten des Sportler im Arbeitsverhältnis, Arbeits- und<br />
Sozialrecht 87, Baden-Baden 2004<br />
(zit.: Ittmann, S.)<br />
Jarass, Hans D.; Pieroth, Bodo Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland GG<br />
Kommentar, 10. Auflage, München 2009<br />
(zit.: Jarass/Pieroth, Bearbeiter, Art. Rn.)<br />
Jungheim, Stephanie Vertragsbedingungen bei Arbeitsverträgen von<br />
Lizenzfußballspielern, RdA 2008, 222 ff.<br />
(zit.: Jungheim, RdA 2008, 222, S.)<br />
Kindl, Johann; Meller-Hannich,<br />
Caroline; Wolf, Hans-Joachim<br />
Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung, NOMOS<br />
Handkommentar, 1. Auflage, Baden-Baden 2010<br />
(zit.: Kindl/Meller-Hannich/Wolf, § Rn..)<br />
Kitzberger, Ralf Rechtlicher Schutz für Sportler bei der Nutzung ihres<br />
Namens und Bildnisses in der Werbung, SpuRt 6/2009, S.<br />
228 ff.<br />
(zit.: Kitzberger, SpuRt 6/2009, 228, S.)<br />
Koch, Ulrich; Linck, Rüdiger;<br />
Schaub, Günter; Vogelsang, Hinrich<br />
Schaub Arbeitsrechts-Handbuch, 13. Auflage, München<br />
2009<br />
(zit.: Schaub, ArbR-Hdb, § Rn.)<br />
Küpperfahrenberg, Peter Die arbeitsrechtliche Stellung von Spielern und Trainern<br />
im Lizenzfußball, Essen 2004<br />
(zit.: Küpperfahrenberg, S.)<br />
VI
Küttner, Wolf Dieter Personalbuch, 17. Auflage, München 2010<br />
(zit.: Küttner, S.)<br />
Kusulius, Christian; Wichert,<br />
Joachim<br />
Die Vermarktung der Namen von Profisportlern,<br />
Sponsors 04/2007, S. 44 f.<br />
(zit.: Kusulius/Wichert, Sponsors 04/2007, 44, S.)<br />
Magold, Hanns Arno Personenmerchandising, Europäische Hochschulschriften<br />
Band 1632, Frankfurt/M. 1994<br />
(zit.: Magold, S.)<br />
Merkel, Benjamin Der Sport im kollektiven Arbeitsrecht, Aachen 2003<br />
(zit.: Merkel, S.)<br />
Methner, Olaf Vertragsstrafenvereinbarung in Sportverträgen, causa<br />
sport 3/2009 S. 217 ff.<br />
(zit.: Methner, causa sport 3/2009, 217, S.)<br />
Moll, Wilhelm Münchener Anwaltshandbuch Arbeitsrecht, 2. Auflage,<br />
München 2009<br />
(Münchener-AnwHb, Bearbeiter, § Rn.)<br />
Müller-Glöge, Rudi; Preis, Ulrich;<br />
Schmidt, Ingrid<br />
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 11. Auflage<br />
München 2011<br />
(zit.: ErfurtKo, Bearbeiter, GG Art. Rn.)<br />
Nam, Ki-Yeon Persönlichkeitsrechtsschutz in Ungleichgewichtslagen –<br />
am Beispiel des Sports, Europäische Hochschulschriften<br />
Bd. 4457, Frankfurt am Main 2007<br />
(zit.: Nam, S.)<br />
Neumann-Duesberg, Horst Bildberichterstattung über absolute und relative Personen<br />
der Zeitgeschichte, JZ 1960, S. 114 ff.<br />
(zit.: Neumann-Duesberg, JZ 1960, 114, S.)<br />
Nolte, Martin Persönlichkeitsrechte im Sport, Recht und Sport 36,<br />
Stuttgart 2006<br />
(zit.: Nolte, S.)<br />
ders. Deutschland: Relativierung der absoluten Person der<br />
Zeitgeschichte, caus sport 3/2007 S. 390 ff.<br />
(zit.: Nolte, causa sport 3/2007, 390, S.)<br />
Oetker, Hartmut; Seiler, Hans-<br />
Hermann; Wagner, Gerhard<br />
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 5.<br />
Auflage, München 2009<br />
(zit: Münch-Komm, Bearbeiter, § Rn.)<br />
Palandt, Otto (Hrsg.) Beck’sche Kurzkommentare zum BGB, Palandt<br />
Bürgerliches Gesetzbuch, 69. Auflage, 2010<br />
(zit: Palandt, Bearbeiter,§ Rn.)<br />
VII
Pfister, Bernhard Rechtsverhältnisse <strong>zwischen</strong> den Teilnehmern sportlicher<br />
Wettbewerbe, SpuRt 2002 S. 45 ff.<br />
(zit.: Pfister, SpuRt 2002, 45, S.)<br />
Pieroth, Bodo; Schlink, Bernhard Grundrecht Staatsrecht II, 24 Auflage, Heidelberg 2008<br />
(zit.: Pieroth/Schlink, Rn.)<br />
Preis, Bernd Grundfragen der Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht,<br />
Neuwied/Kriflel/Berlin 1993<br />
(zit.: Preis S.)<br />
Preis, Ulrich (Hrsg.) Der Arbeitsvertrag, 3. Auflage, Köln, 2009<br />
(zit.: Preis, Bearbeiter, Teil Rn.)<br />
Rehbinder, Manfred Urheberrecht, 16. Auflage, München 2010<br />
(zit.: Rehbinder, Rn.)<br />
Rixecker, Roland; Säcker, Franz<br />
Jürgen (Hrsg.)<br />
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,<br />
Band 1 Allgemeiner Teil, 5. Auflage, München 2006<br />
(zit.: Münch-Komm, Bearbeiter, § Rn.)<br />
Rybak, Frank Das Rechtsverhältnis <strong>zwischen</strong> dem Lizenzfußballspieler<br />
und seinem Verein, Frankfurt am Main 1999<br />
(zit.: Rybak, S.)<br />
Sachs, Michael Grundgesetz Kommentar, 5. Auflage, München 2009<br />
(zit.: Sachs, Bearbeiter, Art. Rn.)<br />
Schaub, Renate Sponsoring und andere Verträge zur Förderung<br />
überindividueller Zwecke, Tübingen 2008<br />
(zit.: Schaub, S.)<br />
Schmidt, Rolf Grundrechte – sowie Grundzüge der<br />
Verfassungsbeschwerde, 12. Auflage, Grasberg bei<br />
Bremen 2010<br />
(zit.: Schmidt, S.)<br />
Schütz, Markus Persönlichkeitsrecht im Sport, Teil 1, 2010<br />
<br />
(zuletzt 20.10.2010)<br />
Staudinger, Julius von (Hrsg.) Staudinger Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit<br />
Einführungsgesetz und Nebengesetzen,<br />
Band I Allgemeiner Teil,<br />
Band II Recht der Schuldverhältnisse,<br />
Berlin, Teile einzeln neubearbeitet<br />
(zit.: Staudinger, Bearbeiter, § Rn.)<br />
Stoffels, Markus AGB-Recht, 2. Auflage, München 2009<br />
(zit.: Stoffels, Rn.)<br />
VIII
Streudel, Alexander Kahn zieht gegen DFB-Sponsor vor Gericht, WELT<br />
ONLINE am 02.05.2002 (zuletzt 07.12.2010)<br />
Temuulen, Bataa Das Recht am eigenen Bild, Hamburg 2006<br />
(zit.: Temuulen, S.)<br />
Unbekannter Autor Punkten mit der Sport-Prominenz, Sponsors 01/2008 S.<br />
34 f.<br />
(zit.: Sponsors 01/2008, S.)<br />
Unbekannter Autor Maranello statt Rüsselsheim, autobild.de am 03.05.2002<br />
<br />
(zuletzt 20.01.2011)<br />
Unbekannter Autor Geschäftsbericht BVB 2009/2010, <br />
(zuletzt 22.11.2010)<br />
(zit.: Geschäftsbericht BVB 2009/2010, S.)<br />
Wank, Rolf Nebentätigkeiten, Heidelberg 1995<br />
(zit.: Wank, Rn.)<br />
Wegner, Konstantin Der Sponsoringvertrag, Heidelberger Schriften zum<br />
Wirtschaftsrecht und Europarecht 4, Baden-Baden 2002<br />
(zit.: Wegner, S.)<br />
Weiand, Neil Ge<strong>org</strong>e Sponsoringvertrag, 2. Auflage, München 1999<br />
(zit.: Weiand, S.)<br />
Westermann, Harm Peter (Hrsg.) Erman-Bürgerliches Gesetzbuch-Handkommentar, 12.<br />
Auflage, Köln 2008<br />
(zit.: Erman, Bearbeiter, § Rn.)<br />
Württembergischer Fußballverband<br />
e.V. (Hrsg.)<br />
Das Persönlichkeitsrecht des Fußballspielers, Baden-<br />
Baden 2010<br />
(zit.: WFV, Bearbeiter, S.)<br />
IX
A. Einleitung<br />
Derzeit sind in der 1. Fußball-Bundesliga und 2. Fußball-Bundesliga 1021 Lizenzspieler 1 in<br />
den 36 Clubs aktiv. Jeder Einzelne von ihnen verfügt über individuelle Eigenschaften und<br />
Fähigkeiten, die er in die Mannschaft einbringt und mit denen er zum sportlichen Erfolg<br />
beiträgt. Damit sich sportlicher Erfolg einstellt, spielt der wirtschaftliche Erfolg des Clubs<br />
keine unbedeutende Rolle. Einnahmen generieren die heute oft als Kapitalgesellschaften<br />
operierenden Clubs, aus diversen Quellen. Trotz der allgemeinen Wirtschaftskrise, die sich<br />
besonders im Bereich des Sponsorings bemerkbar machte, 2 ist dieser Bereich mit einem<br />
Anteil von 38,6% aller Umsatzerlöse, so bei der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, der<br />
größte Posten aller Umsatzerlöskategorien. 3 Das noch junge, aber stets allgegenwärtige<br />
Kommunikationsinstrument des Sponsorings ist zu einer festen Größe im Sport geworden. Es<br />
wird als ein Rechtsgeschäft, basierend auf einer vertraglichen Vereinbarung, in dem der<br />
Sponsor den Gesponserten fördert und dieser Kommunikationsleistungen für den Sponsor<br />
tätigt, verstanden. Diese Möglichkeit der Unterstützung haben unlängst auch die<br />
Spitzensportler für sich selbst entdeckt. So findet man Lizenzspieler in Tageszeitungen und<br />
TV-Werbespots, in denen sie für diverse Konsumgüter und Dienstleistungen werben. Thomas<br />
Müller lässt sich Produkte von MÜLLER Milch und BIFI schmecken, Michael Ballack fliegt<br />
lieber bei ab-in-den-Urlaub.de in die Sonne. Zusätzlich zu den sportfremden Werbepartnern<br />
besitzen viele Spieler auch Einzelpartnerschaften mit Sportartikelherstellern. Mit Auftritten in<br />
solchen Kampagnen verdienen die Spieler etliche Millionen zu ihren Gehältern hinzu. Sind<br />
dann noch <strong>Individual</strong>partner zugleich auch Sponsoren des Clubs, kann aus dem harmonischen<br />
Verhältnis eine für alle Beteiligten äußerst erfolgreiche Partnerschaft resultieren. Doch stellt<br />
dies nur den Idealfall dar. Aller Harmonie zum Trotz sind Sponsoringverträge oft auch ein<br />
<strong>Konflikt</strong>herd. Aufgrund dieser Form der Kommerzialisierung des Fußballs treten die<br />
Persönlichkeitsrechte der Spieler immer mehr in den Fokus und führen zu gerichtlichen<br />
Auseinandersetzungen. Denn wem steht das Recht zu, mit dem Spieler exklusiv zu werben<br />
und vor allem wie und in welcher Art und Weise? Wann und wie darf sich der Spieler selbst<br />
vermarkten?<br />
In dieser Arbeit wird im Folgenden näher auf den <strong>Konflikt</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Individual</strong>sponsoring-<br />
und Teamsponsoringverträgen eingegangen. Besondere Bedeutung soll hierbei dem<br />
1<br />
Laut § 8 lit 3 Spielordnung DFB ist Lizenzspieler, wer das Fußballspiel aufgrund eines mit einem Lizenzverein<br />
oder einer Kapitalgesellschaft geschlossenen schriftlichen Vertrages betreibt und durch Abschluss eines<br />
schriftlichen Lizenzvertrages mit dem Ligaverband zum Spielbetrieb zugelassen ist;<br />
(zuletzt 11.12.2010).<br />
2<br />
Geschäftsbericht BVB 2009/2010, S. 7.<br />
3<br />
Geschäftsbericht BVB 2009/2010, S. 34; Poser/Backes, S. 1.<br />
1
Musterarbeitsvertrag der DFL zukommen. Als Ausgangspunkt der <strong>Konflikt</strong>situation soll er im<br />
Hinblick auf wirksame Werbebeschränkungen für den Lizenzspieler untersucht werden.<br />
B. Relevante Rechtsverhältnisse im Verhältnis Sponsor-Lizenzspieler-Verein-Sponsor<br />
I. Der Musterarbeitsvertrag der DFL<br />
Das Verhältnis eines Lizenzfußballspielers zu seinem Bundesligaclub ist rein vertraglicher<br />
Natur. Zur Reglung des Verhältnisses trägt der von der Deutschen Fußball Liga GmbH<br />
herausgegebene Musterarbeitsvertrag (MuAV) 4 entscheidend bei. Bei diesem<br />
Musterarbeitsvertrag handelt es sich um einen Formulararbeitsvertrag, 5 der, wie für einen<br />
Arbeitsvertrag üblich, auf den Austausch von Leistung und Vergütung gerichtet ist. 6 Im<br />
Genaueren handelt es sich um ein abstrakt generell vorformuliertes, inhaltlich typisiertes und<br />
standardisiertes Vertragsmuster, das als Grundlage für sämtliche Arbeitsverträge bei<br />
Bundesligaclubs regelmäßig verwendet wird. 7<br />
Zunächst soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass es sich nach nunmehr allgemein<br />
herrschender Ansicht bei Berufsportlern in einem Mannschaftssport um Arbeitnehmer<br />
handelt. 8 Dies ergibt sich nicht automatisch aus ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit vom<br />
Verein, denn diese Abhängigkeit kann aufgrund des starken Einkommensgefälles <strong>zwischen</strong> 1.<br />
bis 3. Fußball-Bundesliga fehlen. Daher soll dieses Kriterium bei der Beurteilung auch nicht<br />
maßgeblich sein. Vielmehr ist entscheidend, dass die Spieler eine Arbeitsleistung erbringen,<br />
für die sie ein vertraglich versprochenes Entgelt bekommen, und so in eine fremdbestimmte<br />
Organisation eingebunden sind, deren Weisungsrecht sie unterworfen sind. 9<br />
Aus dem Musterarbeitsvertrag geht keine deutliche Unterscheidung der Haupt- und<br />
Nebenpflichten des Arbeitnehmers hervor. Es wird vielmehr rahmenmäßig im § 2 MuAV<br />
festgehalten, dass der Spieler etwa dazu verpflichtet ist, seine ganze Kraft und seine sportliche<br />
Leistungsfähigkeit uneingeschränkt für den Club einzusetzen. Im Anschluss daran werden<br />
einzelne Verpflichtungen, unter anderem auch der Umgang mit Ausrüstern und Sponsoren des<br />
Vereins, 10 aneinandergereiht. In dem Musterarbeitsvertrag wird ferner der Umgang mit den<br />
Persönlichkeitsrechten (§ 3 MuAV) festgesetzt, sodass für die individuelle Gestaltung nur<br />
4<br />
Im Anhang abgedruckt.<br />
5<br />
Rybak, S. 70.<br />
6<br />
Staudinger, Richardi, § 611 Rn. 5; BAG, NJW 1984, 1985, 1987.<br />
7<br />
Rybak, S. 70.<br />
8<br />
Merkel, S. 83; BAG, NJW 1980, 470; so im Schreiben des BMF 25.8.1995 IV B 6-S 2331-9/95; im Ergebnis<br />
Küpperfahrenberg, S. 35; zum Streit siehe Küpperfahrenberg S. 23 ff.<br />
9<br />
Methner, causa sport 3/2009 S. 217, 219; Bepler, S. 5.<br />
10 Siehe § 2 e) ff. MuAV.<br />
2
Platz im Rahmen der Vergütung (§ 4 MuAV) und Vertragslaufzeit (§ 10 MuAV) besteht.<br />
Gemäß § 12 MuAV wird den Vertragsparteien allerdings das Recht eingeräumt, sonstige<br />
Vereinbarungen in den Vertrag aufzunehmen. 11<br />
II. Der Sportsponsoringvertrag im Überblick<br />
1. Grundlagen des Sponsoringvertrags<br />
Sportsponsoring ist die Förderung von Einzelsportlern, einer Gruppe von Menschen, von<br />
Sportveranstaltungen oder Organisationen. Der Sponsor fördert diese in der Regel in Form<br />
von Geld-, Sach- und Dienstleistungen, wobei er selbst eine Gegenleistung des Gesponserten<br />
in Form einer wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Unterstützung erwartet. 12<br />
a. Typischer Vertragsaufbau<br />
Grundelemente des Vertrags sind die auch als essentialia negotii des Sponsoringvertrags<br />
bezeichneten Leistungen von Sponsor und Gesponserten. Um ein Sponsoringengagement<br />
möglichst effizient zu gestalten, ist es sinnvoll, den Vertrag durch s<strong>org</strong>fältige und detaillierte<br />
Bestimmungen auszubauen. Aufgrund der Fülle unterschiedlicher Interessen auf beiden<br />
Seiten finden sich häufig auf das jeweilige Engagement bezogene Einzelfallregelungen im<br />
Sponsoringvertrag wieder. Es erweist sich als sinnvoll, dem Vertrag eine Präambel<br />
voranzustellen. Diese entfaltet unmittelbar keine rechtliche Wirkung, kann allerdings in<br />
Einzelfällen bei der Vertragsauslegung nützlich sein. Weitere typische Vereinbarungen im<br />
Rahmen von Sportsponsoringverträgen sind in Regelungen zur Stellung des einzelnen<br />
Sponsors, zur Laufzeit, zu Klauseln zu Leistungsstörung, zur Haftung und Kündigung, aber<br />
auch zu gegenseitiger Loyalität und Wohlverhalten enthalten. Empfehlenswert sind ebenso<br />
Klauseln zur Form des Sponsoringvertrags und eine salvatorische Klausel. 13<br />
b. Gegenstand des Sponsoringvertrags; der Leistungsaustausch<br />
Mit synallagmatisch verknüpften Leistungspflichten stehen sich der Sponsor und der<br />
Gesponserte im Sponsoringvertrag gegenüber. Bei Sportsponsoringverträgen bestehen die<br />
typischen Leistungspflichten des Sponsors darin, durch Zahlung eines bestimmten<br />
Geldbetrages, durch Überlassung von Sachmitteln oder Erbringung von Dienstleistungen die<br />
Tätigkeit des Gesponserten zu fördern. Im Verhältnis „do ut des“ 14 ist eine Typisierung der<br />
Gegenleistung des Gesponserten aufgrund der Mannigfaltigkeit kaum möglich. Stets gemein<br />
11 Nach einer Aussage des Herrn RA S. werden in der Praxis ca. 80 % der Klauseln des MuAV übernommen.<br />
Der Rest, insbesondere der Umgang mit privaten Ausrüstern und Werbepartner, wird erweitert regelt.<br />
12 Poser/Backes, S. 4.<br />
13 Wegner, S. 51 ff, 150; Weiand, S. 43 ff.<br />
14 Lat. für „ich gebe, damit du gibst“.<br />
3
ist diesen Leistungen, dass sie dazu beitragen sollen, die Marketing- und<br />
Kommunikationsziele des Sponsors zu erreichen. Eine Form der Verpflichtung kann darin<br />
bestehen, das Logo oder die Werbung des Sponsors auf der Sportkleidung, z.B. auf dem<br />
Trikot, zu tragen oder bestimmte zur Verwendung überlassene Artikel zu benutzen. Vielfach<br />
ist der Gesponserte dazu verpflichtet, auch selbst kommunikativ tätig zu werden. So kann er<br />
sich dem Sponsor zu Fotoshootings, Werbefilmaufnahmen oder Autogrammstunden<br />
verpflichten oder die überlassenen Gegenstände bzw. dort aufgebrachte Werbung in<br />
Interviews oder sonstigen Foto- oder Fernsehaufnahmen möglichst wirksam platzieren. Die<br />
Gegenleistung ist oft damit verbunden, Eingriffe in seine Persönlichkeitsrechte durch den<br />
Sponsor zu dulden, wenn deren Verwendung dem Sponsor z.B. im Rahmen von<br />
Testimonialwerbung gestattet wird. 15 Grundsätzlich darf alles als Leistung festgehalten<br />
werden, solange es sich innerhalb der gesetzlichen Schranken von §§ 134, 138, 242 BGB<br />
bewegt. 16<br />
c. Rechtsnatur des Sponsoringvertrags<br />
Für den Facettenreichtum des Sponsorings existieren noch keine einheitlichen<br />
spezialgesetzlichen Regelungen. Der Vertrag unterliegt einer ständigen Anpassung an den<br />
Einzelfall und kann weder einem gesetzlich geregelten Vertragstypus noch einem<br />
zusammengesetzten, gemischten oder verkehrstypischen Vertrag zugeordnet werden. 17<br />
Einzelne Elemente der Sponsoringverträge lassen sich allerdings den im Gesetz geregelten<br />
Vertragstypen zuordnen. So können in einem Ausrüstervertrag Elemente des Kauf- und<br />
Tauschrechts enthalten sein. Gerade bei jeglicher Form der Anbringung von Werbung auf<br />
speziellen für Werbemaßnahmen zur Verfügung gestellten Werbeträgern können Normen aus<br />
dem Werkvertragsrecht und dem Miet- oder Pachtrecht einschlägig sein. 18 Mit dem<br />
Sponsoringvertrag nicht vereinbar sind die Normen der Schenkung und des Auftrags, da diese<br />
dem Charakter von Leistung und Gegenleistung eines Sponsoringvertrags widersprechen. 19<br />
Daneben gilt auch für nicht verkehrstypische Verträge das allgemeine Schuldrecht. 20<br />
Bei einem Sponsoringvertrag handelt es sich demnach um einen Innominatvertrag, der sich<br />
keinem kodifizierten Vertragstyp zuordnen lässt. 21 Er lässt sich somit als atypischer,<br />
15<br />
Wegner, S 54 ff.; Wieand, S. 84ff.<br />
16<br />
Bruhn/Mehlinger, Bd. II, S. 39.<br />
17<br />
Nam, S. 91.<br />
18<br />
Bruhn/Mehlinger, Bd. I, S. 63 ff.<br />
19<br />
Nam, S. 92.<br />
20<br />
Palandt, Heinrichs, Überbl. § 311 Rn. 15.<br />
21<br />
Wegner, S. 175.<br />
4
entgeltlicher, gegenseitig-verpflichtender (Austausch-)Vertrag i.S.d. §§ 320 ff. BGB<br />
darstellen. 22<br />
2. Verfolgte Interessen aus Sicht der Sportsponsoringvertragsparteien<br />
Der Fußball zählt zu einer der am stärksten gesponserten Sportarten Deutschlands. Ohne das<br />
Engagement von Sponsoren wäre eine Finanzierung der heute gebotenen Qualität kaum<br />
denkbar. Dabei verfolgen die Sponsoren, meist Wirtschaftsunternehmen, die im direkten<br />
Kontakt mit den Verbrauchern stehen, und die Gesponserten völlig unterschiedliche<br />
Interessen. Bei den Gesponserten muss <strong>zwischen</strong> dem Sponsoring von Teams und<br />
Einzelsportlern unterschieden werden. Zusätzlich bedarf es noch einer Kategorisierung ihrer<br />
Tätigkeit in individuelle Werbeverträge und sogenannte Ausrüstungsverträge.<br />
a. Ziele und Motive von Sponsoren<br />
Für Wirtschaftsunternehmen ist das Sponsoring ein besonderes Kommunikationsinstrument.<br />
Dabei verfolgt es das allgemeine Ziel der Schaffung eines ökonomischen Mehrwerts. 23 Zu<br />
diesem marktstrategischen Ziel gelangt der Sponsor über die Zusammensetzung seines<br />
kommunikativen Interesses aus dem primären Imagetransfer und einer Steigerung des<br />
Bekanntheitsgrades. 24 Der Sport dient für den Sponsor als Trägermedium. Er ist mit positiven<br />
Assoziationen wie Dynamik, Sportlichkeit, Leistungsfähigkeit und Exklusivität verbunden. 25<br />
In der Öffentlichkeit soll der Gesponserte mit einem Produkt oder Unternehmen in<br />
Verbindung gebracht werden. Dadurch erreicht der Sponsor einen Kommunikationseffekt, der<br />
zur Verbesserung des Bekanntheitsgrades führt, wenn vorausgesetzt ist, dass die<br />
kommunizierte Botschaft einen hohen Wiedererkennungswert besitzt und die Marke bereits<br />
auf dem Markt etabliert ist. 26 Des Weiteren wird ein imagestärkender Goodwill erzeugt. Nicht<br />
zu vernachlässigen ist stets als sekundäres Motiv die Förderung des Gesponserten.<br />
b. Interesse der Gesponserten<br />
Ist die Interessenlage eines Sponsors von einer Vielfältigkeit geprägt, so lässt sich das vom<br />
Gesponserten verfolgte Interesse auf zwei Ziele festlegen. Die Hauptmotivation des<br />
Gesponserten, ein Sponsoringengagement einzugehen, liegt freilich darin, dieses als<br />
Finanzierungs- oder Beschaffungsmittel zu nutzen, um sein primäres Ziel, den sportlichen<br />
Erfolg, zu erzielen. Zudem hat der Gesponserte eine weitere Zielsetzung, nämlich den Schutz<br />
22 Heermann/Götze, S. 98.<br />
23 Engel, S. 11.<br />
24 Wegner, S. 39.<br />
25 Engel, S. 11; Wagner, S. 39.<br />
26 Engel, S. 13.<br />
5
des Eigenimages. Durch die geschaffene Assoziation von Gesponserten und Unternehmen<br />
oder Produkt soll es zu keinem für ihn schädigendem Sponsoring kommen. 27<br />
c. Die Sponsoringverträge im Fußball<br />
aa. Teamsponsoring durch Ausrüstungs- und individuelle Werbeverträge<br />
Beim Sponsoring von Mannschaften werden grundsätzlich gesamte Teams unterstützt. So<br />
besitzt der FC Bayern München derzeit 30 in diverse Gruppen gegliederte Sponsoren 28 und<br />
der 1. FC Nürnberg 22 Sponsoren. 29 Bei einem Teamsponsoring ist stets der Verein<br />
Vertragspartner, während die Mannschaftsmitglieder nicht in vertraglicher Beziehung zu dem<br />
Sponsor treten. 30 Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass der Club aufgrund seiner<br />
vertraglichen Verpflichtung Mannschaftsteile oder Einzelsportler durch sein Direktionsrecht<br />
anweist, für den Teamsponsor als Testimonial zu werben. 31 Im Grunde lassen sich zwei<br />
Hauptgruppen von Sponsoren bilden. Hierzu gehört zum einen die Gruppe individueller,<br />
exklusiver Werbepartner, deren Vertrag ein bestimmtes von dem Gesponserten geschnürtes<br />
Paket umfasst. Diese weisen primär keinen Bezug zum Sport auf. Die andere Gruppe bilden<br />
exklusive Ausrüster der Mannschaft. Werbepartnern wird typischerweise das Recht<br />
eingeräumt, das Logo auf der Teambekleidung, Mannschaftsbussen, Autogrammkarten,<br />
Banden etc. zu präsentieren. Von besonderer Bedeutung für Sportartikelhersteller sind<br />
exklusive Ausrüsterverträge. 32 Führende Unternehmen wie adidas, PUMA und NIKE<br />
investieren jährlich Millionen in derartige Verträge, damit sich für diese aufgrund des Fan-<br />
Potentials ein möglichst großer Multiplikatoreffekt zur Zielerreichung einstellt.<br />
bb. <strong>Individual</strong>sponsoring durch Ausrüstungs- und individuelle Werbeverträge<br />
Sportler sind aus der Werbung nicht mehr wegzudenken. Sie besitzen individuelle<br />
Sponsoringverträge und erhalten daraus finanzielle und materielle Zuwendungen. Im<br />
Gegenzug treten sie häufig als Testimonial für den Sponsor auf. 33 Fußballspieler sind zu<br />
Marken geworden. Die Top-Stars der Bundesliga sind derzeit Bastian Schweinsteiger mit<br />
einem Markenwert von 20,7 Mio. € und Arjen Robben mit 17,5 Mio. €. Der Markenwert<br />
beschreibt den Wert eines Spielers aus wirtschaftlicher Sicht und ist daher für die werbliche<br />
27 Nam, S. 89; Engel, S. 15 f.; Wegner, S. 41; Poser/Backes, S. 16.<br />
28 (zuletzt 04.12.2010).<br />
29 (zuletzt 04.12.2010).<br />
30 Poser/Backes, S. 167.<br />
31 Poser/Backes, S. 168.<br />
32 <strong>Zum</strong> Streit über die Ausrüstung der Deutschen Fußballnationalmannschaft <strong>zwischen</strong> NIKE und<br />
adidas. (zuletzt 04.12.2010).<br />
33 Bruhn, S. 71.<br />
6
Verwendung des Spielers durch Unternehmen relevant. 34 Auch bei Sportlersponsoren muss<br />
ebenfalls <strong>zwischen</strong> individuellen Werbeverträgen für Produkte, die primär nichts mit dem<br />
Sport zu tun haben, und Ausrüsterverträgen differenziert werden. Gerade letztgenannte<br />
Alternative ist für Sportartikelhersteller von enormer Bedeutung. Darin verpflichtet sich der<br />
Lizenzspieler, die Produkte des Vertragspartners, im Besonderen im Fußball die Schuhe<br />
während des Spiels und darüberhinaus in der Freizeit Produkte des Herstellers zu tragen. Dies<br />
wird dem Lizenzspieler häufig in Geld- und Prämienzahlung entlohnt. 35 Ausschlaggebend für<br />
ein Individuelles Sponsoring ist nicht nur der Marktwert. Neben der Bekanntheit und der<br />
sportlichen Leistung sind auch die durch den Sportler erzielten Sympathiewerte und ein<br />
vorbildliches Verhalten ein wichtiges Entscheidungsmerkmal. 36<br />
d. Ausschließlichkeit in Sponsoringverträgen<br />
Neben die bereits formulierten Ziele und Interessen der Vertragsparteien tritt ein nicht<br />
weniger essentieller Punkt. In Sponsoringverträgen sind Ausschließlichkeitsklauseln sehr<br />
praxisrelevant. Sie dienen primär zur Absicherung der Werbewirkung des Sponsoringvertrags<br />
für den Sponsor. 37 Denn nur durch ein gewisses Maß an Exklusivität kann gewährleistet<br />
werden, dass der erwünschte kommunikative Erfolg 38 eintritt und eine Verwässerung oder<br />
eine sonstige nachteilige Beeinflussung des kommunikativen Auftritts vermieden wird. 39<br />
Besonders im Sport ist es nicht selten der Fall, dass ein Sponsorenengagement in seiner Größe<br />
variabel gestaltet werden kann, wodurch es zu einer Hierarchie der Sponsoren kommt. Allen<br />
Sponsoren ist es dabei wichtig, eine Branchenexklusivität zu genießen, das heißt bei dem<br />
Gesponserten soll kein Mitbewerber der Branche als Sponsor auftreten. 40 Dieses Verlangen<br />
nach Exklusivität geht bei einem Teamsponsoring so weit, dass es auch zu keiner doppelten<br />
Belegung der Branche durch einen <strong>Individual</strong>sponsor kommen soll. 41<br />
34 Studie von Batten&Company (zuletzt 04.12.2010).<br />
35 Grunsky, Greffenius/Borchert, S. 2.<br />
36 Bruhn, S. 73; Sponsors 01/2008 S. 34.<br />
37 Schaub, S. 448; Heermann, causa sport 3/2009 S. 226, 232.<br />
38 Heermann, causa sport 3/2009 S. 226, 232<br />
39 Poser/Backes, S. 197; Bergmann, SpuRt 3/2009 S. 102, 104.<br />
40 Poser/Backes, S. 196.<br />
41 So etwa Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn, selbst unter Vertrag bei Nestle während der Verband den Sponsor<br />
Ferrero hatte.<br />
7
C. Lizenzspieler und ihre von der Vermarktung betroffenen Rechte und Rechtsgüter<br />
Persönlichkeitsrechte gewinnen immer mehr an Bedeutung im Sport und sind zu einem<br />
umkämpften Gut geworden. Ursächlich hierfür ist die entstandene Symbiose <strong>zwischen</strong><br />
Medien und Sport. Der Sport verdient mit den Medien und die Medien mit dem Sport. 42<br />
I. Die geschützten Persönlichkeitsrechte der Sportler<br />
Ob und inwieweit ein Verein wirtschaftlich erfolgreich ist, hängt nicht allein von seinem<br />
sportlichen Erfolg ab, sondern wird stark durch sein öffentliches Auftreten beeinflusst. Neben<br />
der vereinseigenen Marketing- und Merchandisingabteilung verwenden stets auch die als<br />
Sponsoren des Vereins auftretenden Unternehmen die Spieler als Werbepartner. Das enorme<br />
wirtschaftliche Potenzial der Vermarktung eines Sportlers haben nicht selten die Spieler selbst<br />
entdeckt und lassen ihre Persönlichkeitsrechte professionell vermarkten. 43 Laut § 3 a) MAV 44<br />
räumen die Spieler dem Club die Nutzungs- und Verwertungsbefugnis an unterschiedlichen<br />
Persönlichkeitsmerkmalen ein. Damit berühren die Vermarktungsinteressen an Sportlern<br />
Fragen ihres Persönlichkeitsrechts. Unter diesem versteht man das Recht des Einzelnen auf<br />
Achtung seiner Menschenwürde und auf Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit. 45<br />
Hierfür entwickelte die Rechtsprechung aus den Art. 1 I GG und Art. 2 I GG das<br />
verfassungsmäßig garantierte allgemeine Persönlichkeitsrecht. 46 Dieses ist in ständiger<br />
Rechtsprechung als „sonstiges Recht“ gemäß § 823 I BGB anerkannt. 47 Diesem treten<br />
besondere Persönlichkeitsrechte, also speziellere, eigenständige gesetzliche Regelungen, die<br />
man im BGB, UrhG und KUG findet, gegenüber. 48 Sie sind als subjektive Rechte anerkannt<br />
und stehen einem jedem gegen jedermann zu. Es sind daher absolute Rechte.<br />
Im Folgenden sollen auf die Schutzwirkung der Persönlichkeitsrechte näher eingegangen<br />
werden und die Übertragung dieser dargestellt werden.<br />
42<br />
(zuletzt<br />
20.10.2010).<br />
43<br />
Hamacher/Robak, Sponsors 10/2009, S. 54; Der deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger steht bei der<br />
Münchner Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbh für seine Vermarktung unter Vertrag<br />
(zuletzt 20.10.2010).<br />
44<br />
Siehe § 3 MuAV.<br />
45<br />
Küpperfahrenberg, S. 70; BGHZ 26, 349 ff. (Herrenreiter-Fall).<br />
46<br />
BGHZ 13, 334, 338 (Leserbriefe); BVertGE 34, 269, 271 f. (Soraya-Beschluss).<br />
47<br />
Vgl. dazu BGHZ 15, 249, 257 f.; BGH NJW 1957, S. 1146.<br />
48 Staudinger, Weick, Vor § 1 Rn. 21.<br />
8
1. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht<br />
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 1 I GG und Art. 2 I GG konkretisiert die Würde<br />
des Menschen und gewährleistet dabei die Achtung und Entfaltung der Persönlichkeit. 49 Es<br />
dient insoweit dem Schutze des Einzelnen gegen Persönlichkeitsverletzungen durch<br />
Staats<strong>org</strong>ane, aber entfaltet seinen Schutzbereich auch in mittelbarer Drittwirkung gegen<br />
Beeinträchtigungen durch Private. 50 Sein Schutzbereich umfasst die engere persönliche<br />
Lebenssphäre und die Persönlichkeitsentfaltung. 51 Dadurch wird dem Einzelnen ein Recht auf<br />
Selbstbestimmung zum Schutz der Darstellung seiner Person in der Öffentlichkeit verliehen,<br />
aber auch der Schutz der Ehre gehört hierher. 52 Zu den besonderen rechtlichen Ausprägungen<br />
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gehört das Recht auf Gegendarstellung, das Recht am<br />
eigenen Bild und das Recht am eigenen Wort. 53 Einen weiteren Teilaspekt seiner Ausprägung<br />
findet sich auch in der Beziehung des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber. Dort s<strong>org</strong>t es für eine<br />
allgemeine Fürs<strong>org</strong>epflicht. 54 Einschränkungen dieser Rechte ergeben sich nur aus der<br />
verfassungsrechtlichen Ordnung, also durch verfassungsmäßige Normen unter strikter<br />
Betrachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. 55<br />
2. Das Recht am eigenen Bilde (§ 22 f. KUG)<br />
Bilder von Spitzensportlern eignen sich besonders für Werbezwecke, weshalb dem Recht am<br />
eigenen Bild bei Lizenzspielern eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Eine Vermarktung<br />
der Sportler ohne Bilder ist heute nahezu undenkbar. Angefangen bei der Übertragung von<br />
Sportereignissen über Werbeanzeigen, Poster und ähnliche Druckerzeugnisse bis hin zu den<br />
berühmten Sammelbildern immer ist das Recht am eigenen Bild tangiert. Der § 22 KUG<br />
normiert grundsätzlich, dass Bildnisse nur nach eingeholter Einwilligung des Abgebildeten<br />
verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen. Das allgemeine<br />
Persönlichkeitsrecht dient gegenüber dem Recht am eigenen Bilde als Auffangtatbestand,<br />
sodass ein Rückgriff auf dieses nur nach dem Ausschluss dieses Rechts möglich ist. Unter<br />
einem Bildnis versteht man die Abbildung von Personen, d.h. die Darstellung der Person in<br />
ihrer wirklichen, dem Leben entsprechenden Erscheinung. 56 Das Merkmal wird sehr weit<br />
ausgelegt, sodass alle erdenklichen Darstellungsarten und Darstellungstechniken erfasst<br />
49 BVerfGE 54, 148, 153.<br />
50 Sachs, Murswiek, Art. 2 Rn. 59.<br />
51 Schmidt, Rn. 268; Pieroth/Schlink, Rn. 391.<br />
52 Jarass/Pieroth, Jarass, Art. 2 Rn. 42 f.<br />
53 Sachs, Murswiek, Art. 2 Rn. 71; Jarass/Pieroth, Jarass, Art. 2 Rn. 45b.<br />
54 Schmidt, Rn. 274; BAG NJW 2003, 3436, 3427; Küpperfahrenberg, S. 70.<br />
55 BVerfGE 6, 32 ff.; Nolte, S. 15.<br />
56 Dreier/Schulze, Dreier, § 22 Rn. 1; Münch-Komm, Rixecker, Allg. PersönlR Rn. 42.<br />
9
werden. 57 Es muss dabei stets die Möglichkeit der Identifizierung des Abgebildeten gegeben<br />
sein. Dies geschieht in der Regel anhand von Gesichtszügen. Es soll jedoch bereits genügen,<br />
wenn aufgrund anderer typischer Merkmale, wie einem begleitenden Text 58 oder durch die<br />
Rückenansicht eines Torwarts, 59 auf die Person geschlossen werden kann. Gerade bei<br />
Lizenzspieleren ist die Erkennbarkeit für den Kommunikationserfolg der Werbemaßnahme<br />
entscheidend. Sie werden oft schon aufgrund ihrer Position in der Mannschaft, spätestens aber<br />
durch die Rückennummer und den Namenszug erkannt. Wie viele Betrachter den<br />
Lizenzspieler identifizieren, ist nicht entscheidend. Ebenso bedarf es nicht der Annahme eines<br />
Durchschnittsbetrachters. 60<br />
Ausnahmetatbestände regelt der § 23 I KUG. Dieser gewährt die Verbreitung von Bildnissen<br />
ohne jegliche Einwilligung, wenn diese aus dem Bereich der Zeitgeschichte stammen. Dabei<br />
müssen allerdings die Interessen der Person gemäß § 23 II KUG gewahrt bleiben. Das Gesetz<br />
verfolgt hier die Auffassung ganz allgemein, dass die Person zurückstehen muss, wenn ein<br />
berechtigtes Informationsinteresse der Allgemeinheit besteht. 61 Der Begriff der Zeitgeschichte<br />
besitzt keine einheitliche Definition und ist auslegungs- und ausfüllungsbedürftig. 62 Einigkeit<br />
herrscht allerdings darüber, dass zur Zeitgeschichte alles gehört, woran ein gegenwärtig<br />
allgemeines Interesse besteht. 63 Er könnte damit auch für Sportler von Bedeutung sein. Bis in<br />
jüngster Vergangenheit wurde festgestellt, dass das Schutzbedürfnis des Abgebildeten von<br />
unterschiedlichem Gewicht sei. Es folgte eine Unterscheidung 64 in absolute Personen und<br />
relative Personen der Zeitgeschichte, wobei die Allgemeinheit an absoluten Personen ein<br />
dauerhaftes und umfassendes Interesse besitzt 65 Diese Unterscheidung dürfte mit der<br />
Caroline-Entscheidung 66 des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR), die in<br />
Deutschland für einigen Wirbel s<strong>org</strong>te, da sie die Kriterien der absoluten Person zum<br />
wirksamen Schutz des Privatlebens nicht für ausreichend erachtet, hinfällig sein. 67 Ungeachtet<br />
der Kategorisierung der Person erachtet der Bundesgerichtshof (BGH) die öffentliche<br />
Bekanntheit der Person als nicht ausreichend. Vielmehr muss ein besonderes Ereignis mit<br />
zeitgeschichtlicher Bedeutung vorliegen, um dem Erfordernis der Einwilligung zu<br />
57 Gauß, GRUR Int 2004, 558, 559 mit einer nicht abgeschlossenen Aufzählung.<br />
58 Münch-Komm, Rixecker, Allg. PersönlR Rn. 43.<br />
59 BGH, GRUR 1979, 732, 733 (Fußballtor).<br />
60 Münch-Komm, Rixecker, Allg. PersönlR Rn. 43.<br />
61 Münch-Komm, Rixecker, Allg. PersönlR Rn. 52; Temuulen, S. 108.<br />
62 Temuulen, S. 108.<br />
63 Damm/Rehbock, Rn. 193; RGZ 125, 80, 82 (Tull Harder); BVerfG NJW 2000, 1021, 1025 (Caroline).<br />
64 Neumann-Duesberg, JZ 1960, 114.<br />
65 BVerfG NJW 2000, 1021, 1025 (Caroline); im Fußball: GRUR 1979, 425 (Franz Beckenbauer).<br />
66 EGMR NJW 2004, 2647 ff.<br />
67 Nolte, Causa Sport 3/2007, 390, 390; Damm/Rehbock, Rn. 199 f.<br />
10
entkommen. 68 Der Schutz Prominenter erstreckt sich somit auch auf öffentliche Orte ohne<br />
zeitgeschichtliche Relevanz.<br />
Nach heute herrschender Ansicht handelt es sich bei Spitzensportlern um Personen der<br />
Zeitgeschichte. 69 Da die Bekanntheit der Sportler nicht entscheidend ist, werden auch<br />
Amateursportler durch einmaliges Auftreten im Fernsehen, wie etwa bei Spielen in der 1.<br />
Runde des DFB-Pokals gegen einen Bundesligisten, zur Personen der Zeitgeschichte. 70<br />
Aufgrund der Tatsache, dass die Lizenzspieler in § 3 a) I MuAV ihre ausdrückliche<br />
Einwilligung gemäß § 22 KUG zur Vermarktung ihrer Bildnisse durch den Verein geben und<br />
dies auch regelmäßig in Sponsoringverträgen geschieht, 71 können diese, ohne zusätzliche<br />
Sachinformation zu geben und ohne sich die Einwilligung des Sportler einzuholen, nur durch<br />
sonstige Dritte verletzt werden. 72<br />
3. Das Recht am eigenen Namen (§12 BGB)<br />
Schon seit langem werden Bilder von Sportlern vermarktet, zunehmend geraten aber auch die<br />
Namen von Lizenzspielern in den Blickpunkt. Das Recht am eigenen Namen ist in § 12 BGB<br />
gesetzlich geregelt und stellt eines der besonderen Persönlichkeitsrechte dar. Im Verhältnis zu<br />
ihm steht das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Auffangtatbestand in einem<br />
Subsidiaritätsverhältnis und ist somit erst nach der Verneinung der Verletzung des § 12 BGB<br />
heranzuziehen. 73 Die Norm verleiht positiv jedem das Recht, einen Namen zu führen, und<br />
stellt negativ fest, dass man anderen untersagen kann, diesen Namen für sich zu verwenden.<br />
Für die Beeinträchtigung des Namensrechtes kennt die Norm zwei Alternativen, einerseits die<br />
Namensanmaßung und andererseits die Namensleugnung. 74 Im Zusammenhang mit der<br />
Vermarktung von Prominenten kommt es stets nicht zu einer Namensleugnung, so dass man<br />
sich im Folgenden auf die Namensanmaßung beschränken kann. Diese soll dann vorliegen,<br />
wenn jemand den gleichen Namen eines anderen unbefugt gebraucht und dadurch ein<br />
schutzwürdiges Interesse eines anderen verletzt sowie eine Zuordnungsverwirrung erzeugt. 75<br />
Das Schutzsubjekt der Norm ist der kraft Gesetzes erworbene bürgerliche Zwangsname. Er<br />
68 BGH Urteil vom 1.7.2008 – VI ZR 243/06 (Sabine Christiansen); Mitteilung der Pressestelle BGH Nr.<br />
87/2007 zum Urteil vom 3.7.2007 – VI ZR 164/06 (Oliver Kahn).<br />
69 Kitzberger, SpuRt 6/2009, 228, 229; Münch-Komm, Rixecker, Allg. PersönlR Rn. 53; Dreier/Schulze, Dreier,<br />
KUG § 23 Rn. 6; BGH GRUR 1968, 652 (Ligaspieler).<br />
70 Nam, S. 34.<br />
71 Hamacher/Weber, Sponsors 01/2008, 42, 43; Kitzberger, SpuRt 6/2009, 228, 229.<br />
72 Vgl. LG Düsseldorf Urteil vom 17.6.2009 – 12 O 441/08.<br />
73 Klippel, S. 153; Münch-Komm, Bayreuther, § 12 Rn. 5.<br />
74 Münch-Komm, Bayreuther, § 12 Rn. 150 ff.<br />
75 BGB-AK, Koos § 12 Rn. 192.<br />
11
dient zur Identifikation des Namenträgers und ist Ausdruck seiner <strong>Individual</strong>ität. 76 Des<br />
Weiteren wird auch ein Pseudonym, also ein Deckname oder ein angenommener<br />
Künstlername, geschützt. So ist auch das Pseudonym des ehemaligen Weltfußballers Edson<br />
Arantes do Nascimento, der unter diesem besser als Pelé bekannt ist, geschützt. Ebenso unter<br />
den Schutz des § 12 BGB fallen Spitznamen, wenn <strong>zwischen</strong> dem Spitznamen und der mit<br />
dem Spitznamen bezeichneten Person ein Zuordnungszusammenhang besteht. Dabei muss der<br />
Spieler sich jedoch selbst mit diesem identifizieren. 77 Als erster deutscher Nationalspieler lief<br />
Claudemir Jeronimo Barreto mit seinem Spitznamen Cacau auf dem Trikot auf. 78 So<br />
entschied jüngst das LG München I 79 , dass der durch die Medien und Fans des deutschen<br />
Nationalspielers Bastian Schweinsteiger kreierte Spitzname „Schweini“ ein gesetzlich<br />
geschützter individualisierbarer Name ist und nicht von Dritten in Verbindung mit einem<br />
Produkt verwendet werden darf. Hier entsteht eine Zuordnungsverwirrung aufgrund des<br />
Anscheins, dass der betroffene Spieler das Recht, seinen Namen zu verwenden, dem Dritten<br />
eingeräumt hat. Besteht allerdings ein erhöhtes Interesse des Dritten daran, eine Beziehung<br />
<strong>zwischen</strong> dem Prominenten und dem Produkt herzustellen, um von dessen Image zu<br />
profitieren, soll keine Zuordnungsverwirrung vorliegen, womit das allgemeine<br />
Persönlichkeitsrecht und nicht der Namensschutz anwendbar ist. 80<br />
4. Sonstige relevante Schutzgüter<br />
Um einen möglichst hohen Marktwert zu erreichen, ist nicht ausschließlich der sportliche<br />
Erfolg ausschlaggebend, sondern auch der Umgang des Spitzensportlers mit den Medien in<br />
Interviews direkt nach dem Spiel, während der Analyse im Studio oder in einer der<br />
zahlreichen Pressekonferenzen. Stets lauschen Millionen Zuschauer seinen Worten. Eine<br />
spezielle gesetzliche Regelung erfährt das Recht an der mündlichen und schriftlichen<br />
Äußerung noch nicht. Möglich wäre jedoch ein Schutz der mündlichen Äußerung, wenn das<br />
Gesprochene Werkcharakter besitzt, nach § 2 II UrhG, der persönliche geistige Schöpfungen<br />
als Schutzsubjekt ansieht. 81 Überwiegend handelt es sich bei einem Interview des Sportlers<br />
um keine geistige persönliche Schöpfung, da ihm das nötige künstlerisch-schöpferische<br />
Element fehlt. 82 Einen hinreichend Schutz für das menschliche Wort bietet das allgemeine<br />
76<br />
Münch-Komm, Bayreuther, § 12 Rn. 1, 22; Staudinger, Habermann,§ 12 Rn. 15.<br />
77<br />
BGB-AK, Koos § 12 Rn. 57 ff.<br />
78<br />
(zuletzt 23.11.2010).<br />
79<br />
Urteil vom 08.03.2007, Az. 4 HK O 12806/06 (Schweini-Urteil).<br />
80<br />
Nam, S. 44.<br />
81<br />
Dreier/Schulze, Schulze, UrhG § 2 Rn. 6.<br />
82 Nam, S. 45.<br />
12
Persönlichkeitsrecht. 83 Zur kommerziellen Nutzung der Worte bedarf es daher stets der<br />
Einwilligung des Sportlers.<br />
Gesagtes gilt auch für schriftliche Äußerungen des Sportlers, sollten diese zu Werbezwecken<br />
verwendet werden.<br />
Die Unterschrift, Initialen oder ein Faksimile können aufgrund ihrer Namensfunktion gemäß<br />
§ 12 BGB namensrechtlich geschützt sein und in ihrem Schriftbild sowohl als<br />
urheberrechtliches Werk wie auch als Marke nach §§ 3, 14 MarkenG geschützt sein. 84<br />
II. Zur Übertragbarkeit von Persönlichkeitsrechten<br />
Persönlichkeitsrechte, zu denen besondere Persönlichkeitsrechte oder das allgemeine<br />
Persönlichkeitsrecht zählen, sind vom Grundsatz her nicht auf andere übertragbar. Sie sind<br />
unmittelbar an die Person des Trägers gebunden. 85 Wie allerdings der § 22 I KUG für das<br />
Recht am eigenen Bilde explizit normiert, kann die betroffene Person in die Nutzung der<br />
Rechte einwilligen. Damit kann der Rechteinhaber den Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte<br />
erlauben und sich gleichzeitig dazu verpflichten, bei einem Eingriff des Berechtigten keine<br />
Rechte geltend zu machen („pactum de non petendo“). 86 Diese Wertung kann analog zum<br />
Schutz des Namens herangezogen werden. 87 Eine derartige Einwilligung in Sponsoring- und<br />
Arbeitsverträgen hat lediglich schuldrechtliche Bedeutung, 88 weil durch sie nur die<br />
Rechtwidrigkeit der Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüche entfällt. 89 Wie weit über<br />
Persönlichkeitsrechte rechtsgeschäftlich verfügt werden kann, ist hingegen strittig. 90 Der<br />
Bundesgerichtshofs (BGH) stellte jedoch bereits fest, dass vermögenswerte Bestandteile den<br />
Persönlichkeitsrechten innewohnen, lässt ihre Übertragbarkeit allerdings offen. 91 In der<br />
Literatur werden verschiedene Ansätze 92 diskutiert, die sich für eine Erteilung dinglicher<br />
Lizenzen aussprechen, sich jedoch im Gegenstand der Verfügung differenzieren. 93 In<br />
Übereinstimmung der Auffassungen verbleibt das Stammrecht, aufgrund seines<br />
83<br />
Rehbinder, Rn. 872.<br />
84<br />
Wegner, S 93.<br />
85<br />
BGHZ 50, 133, 137; Staudinger, Weick, Vor § 1 Rn. 29.<br />
86<br />
Helle, S. 108 f; Magold, S. 502f.<br />
87<br />
Kusulius/Wichert, Sponsors 04/2007, 44 f.<br />
88<br />
Helle, S. 109.<br />
89<br />
Wegner, S 95.<br />
90<br />
Ausführlich bei Gauß, S. 88 ff.; Wegner, S. 94 ff.<br />
91<br />
BGH, NJW 1987, 231 ff. (NENA); BGH, NJW 2000, 2195, 2197 ff. (Marlene Dietrich); im Sport OLG<br />
Hamburg, Urteil vom 13.01.2004, 7 U 41/03 (Oliver Kahn).<br />
92<br />
U.a. Forkel, GRUR 1988, 491 ff.; NJW 1993, 3181 f.; der entsprechend dem Urheberrecht eine beschränkte<br />
Übertragung bei Persönlichkeitsrechten sieht, sog. gebundene Rechtsübertragung; oder Andere in Gauß, S. 95<br />
ff., wie Beuthien/Schmölz, S. 26 ff., der eine translative Übertragung von Teilen des Persönlichkeitsrechts mit<br />
dinglicher Wirkung für möglich hält; ablehnend Schaub, S. 383.<br />
93<br />
Gauß, S 97.<br />
13
persönlichkeitsrechtlichen Einschlags unübertragbar beim Rechtsträger. 94 Einen Schutz gegen<br />
die völlige Entäußerung und einen sittenwidrigen Gebrauch bieten dann die §§ 31 IV, 41, 42<br />
UrhG und §§ 134, 138 BGB, wenn sich bereits die Lizenzerteilung nach §§ 29 ff. UrhG<br />
analog richtet. 95 In der jüngsten Entscheidung des LG Frankfurt 96 hat sich das Gericht klar für<br />
eine echte Übertrag- und Lizenzierbarkeit von höchstpersönlichen Rechten ausgesprochen. 97<br />
Dies hat gerade im Rahmen der Vermarktung von Lizenzspielern im Fußball die Position der<br />
Lizenznehmer deutlich gestärkt, sollte es sich bei der Übertragung um eine ausschließliche<br />
Lizenzerteilung durch den Lizenzspieler handeln.<br />
So darf an dieser Stelle kurz angemerkt werden, dass eine Lizenz nach heute herrschender<br />
Ansicht die Befugnis, das Immaterialgut eines anderen zu benutzen, und folglich die<br />
Einräumung eines positiven Benutzungsrechtes für den Lizenznehmer umfasst. 98 Dabei wird<br />
<strong>zwischen</strong> einer ausschließlichen Lizenz, die dem Lizenznehmer die alleinige Befugnis<br />
einräumt das eingeräumte Recht auszuüben, und einer einfachen Lizenz unterschieden, die<br />
dem Lizenznehmer nur Nutzungsrechte gewährt und den Lizenzgeber zur Vergabe weiterer<br />
Lizenzen berechtigt. 99<br />
D. Beschränkungen durch arbeitsrechtliche Vereinbarungen<br />
Dem bereits aufgezeigten Interesse eines jeden erfolgreichen Sportlers, aus seinem<br />
beruflichen Erfolg auch privat Kapital zu schlagen, könnten allerdings durch seinen mit dem<br />
arbeitgebenden Club abgeschlossenem Arbeitsvertrag 100 vertragsimmanente Grenzen gesetzt<br />
sein. Ausgangspunkt der Klärung dieser Frage sind die von den Parteien festgeschriebenen<br />
Vereinbarungen aus dem Musterarbeitsvertrag. 101<br />
I. Vertragsabschlussfreiheit der Sportler<br />
Einem jeden vernünftigen Menschen soll es gestattet sein, in selbstverantwortlicher Weise mit<br />
seinen Freiheiten umzugehen. Erst durch die Möglichkeit, Rechtsverhältnisse einzugehen,<br />
94<br />
Götting, S. 142 ff.; Erman, Ehmnann, Anh § 12 Rn. 261.<br />
95<br />
Gauß, S. 278.<br />
96<br />
LG Frankfurt, Urteil vom 12.12.2008 – AZ 2 06 O 249/06 (nicht rechtskräftig, in<strong>zwischen</strong> haben die Parteien<br />
einen Vergleich geschlossen), Spurt 2009, 207 ff.<br />
97<br />
WFV, Englisch, S. 52, 69.<br />
98<br />
Gauß, S. 24.<br />
99<br />
Gauß, S. 25 f.<br />
100<br />
Näheres zum Musterarbeitsvertrag der DFL siehe unter B. I.<br />
101<br />
Zöllner/Loritz/Hergenröder, S. 160.<br />
14
kann er allein darüber entscheiden, in welcher Form er sich rechtlich zur Regelung seiner<br />
Lebensverhältnisse verpflichten möchte oder eben nicht. 102<br />
Die Vertragsfreiheit ist als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 II GG<br />
geschützt. 103 Sie unterliegt aber wie jedes Freiheitsrecht den Schranken der<br />
verfassungsmäßigen Ordnung. 104 Damit ist die Freiheit nur so weit gewährleistet, wie<br />
Sittengesetze oder Rechte anderer nicht verletzt werden, was dem allgemeinen<br />
Rechtsgrundsatz des neminem laedere 105 entspricht. 106<br />
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) setzt in § 311 I BGB die Vertragsfreiheit voraus und<br />
verankert diese in § 241 BGB zusätzlich. 107 Sie umfasst das Recht der Abschlussfreiheit und<br />
die inhaltliche Gestaltungsfreiheit, ohne an die gesetzlichen Vertragstypen gebunden zu<br />
sein. 108 Demnach ist auch der Sportler frei, sich in jeglicher Form vertraglich zu binden und<br />
über die Inhalts- und Abschlussmodalitäten zu verhandeln.<br />
II. Anwendbarkeit des AGB-Kontrollrecht auf den Musterarbeitsvertrag<br />
Auch für Arbeitsverträge gilt die Maxime der Vertragsfreiheit. Die Parteien können den Inhalt<br />
des Arbeitsvertrages demnach frei gestalten. 109 Allerdings gilt diese Freiheit, wie auch die für<br />
andere Schuldverhältnisse, nicht schrankenlos. Grenzen bilden die §§ 134 und 138 BGB.<br />
Seitdem am 1.1.2002 das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 110 in Kraft getreten ist, herrscht<br />
darüberhinaus Klarheit über eine Rechtsgrundlage der Inhaltskontrolle von<br />
Arbeitsverträgen. 111 Bis dorthin galt, dass Arbeitsverträge nicht in den sachlichen<br />
Anwendungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß des § 23 I ABGB<br />
fielen 112 und daher für vorformulierte arbeitsvertragliche Regelungen eine Inhaltskontrolle auf<br />
der Basis des § 242 BGB stattfand. 113 Nunmehr regelt § 310 IV 2 BGB, dass in Zukunft<br />
Vertragsklauseln im <strong>Individual</strong>recht der Kontrolle nach §§ 305 ff. BGB unterliegen. 114<br />
102<br />
Brox, BGB AT, Rn. 25; Nam, S. 99.<br />
103<br />
ErfurtKo, Schmidt, GG Art. 2 Rn. 2; Sachs, Murswiek, Ar. 2 Rn. 54;; BVerfGE 8, 274, 328.<br />
104<br />
BVerfGE 6, 32 37 ff.; BVerfGE 12, 341, 347.<br />
105<br />
Lat. für „schädige niemanden“.<br />
106<br />
Sachs, Murswiek, Ar. 2 Rn. 89 ff.<br />
107<br />
Staudinger, Olzen, § 241 Rn. 52; Brox, BGB AT, Rn. 25.<br />
108<br />
Brox, BGB AT, Rn. 75 f.<br />
109<br />
Rybak, S. 74.<br />
110<br />
BGBl. I, 3138 v. 26.11.2001.<br />
111<br />
Jungheim, RdA 2008, 222, 224.<br />
112<br />
Staudinger, Richardi, § 611 Rn. 296.<br />
113<br />
Rybak. S 83; ausführlich Preis, S. 275.<br />
114<br />
Münch-Komm, Basedow, § 310 Rn. 87.<br />
15
Gerechtfertigt sei dies durch die Verwendung von einseitig vorformulierten Vertragsklauseln<br />
und den sich daraus ergebenden gestörten Verhandlungsparitäten. 115<br />
Ebenso bleibt festzuhalten, dass Lizenzspieler aufgrund ihrer Arbeitnehmereigenschaft 116<br />
nach Auffassung von Bundesarbeitsgericht (BAG) und Bundesverfassungsgericht (BVerfG)<br />
auch Verbraucher im Sinne des Rechts der Allgemeine Geschäftsbedingungen sind. 117 Somit<br />
sind die Arbeitsverträge zugleich auch Verbraucherverträge, sodass nach § 310 III Nr. 1, 2<br />
BGB der Vertragstext auch dann der Inhaltskontrolle zu unterziehen ist, wäre er auch nur zur<br />
einmaligen Verwendung bestimmt. Ebenfalls müssen bei der Beurteilung einer<br />
unangemessenen Benachteiligung i.S.d. § 307 BGB besondere, den Vertragsschluss<br />
begleitende Umstände berücksichtigt werden. 118<br />
Als Allgemeine Geschäftsbedingungen beschreibt § 305 I BGB in seiner Legaldefinition alle<br />
für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei<br />
(Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags stellt. 119 Eine<br />
Einschränkung der AGB-Kontrolle für das Arbeitsrecht schreibt § 310 IV 2 BGB vor. Dort ist<br />
ausdrücklich normiert, dass die Regelungen des § 305 II, III BGB über die Einbeziehung von<br />
Klauseln, damit diese Vertragsbestandteile werden, keine Anwendung finden. Damit stellt der<br />
Gesetzgeber fest, was bereits der Bundesgerichtshof (BGH) in seiner Entscheidung vom 27.<br />
April 1988 sagte, nämlich, dass der § 305 II BGB auf Formulerarbeitsverträge nicht<br />
anwendbar ist, 120 denn es soll sich die Unterschrift der Vertragsparteien unter den Vertrag auf<br />
den vollständigen Vertragsinhalt beziehen, ohne dass gesondert auf Regelungen hingewiesen<br />
werden muss. 121<br />
III. Tranzparenzkontrolle einzelner Vertragsbestandteile<br />
Im Hinblick auf den hier untersuchten <strong>Konflikt</strong> ist es notwendig, die im Musterarbeitsvertrag<br />
verwendeten und für den <strong>Konflikt</strong> relevanten Klauseln auf ihre Bestimmtheit i.S.d. § 307 I 2<br />
BGB zu überprüfen. Das dort nun normierte und ehemals von der Rechtsprechung<br />
entwickelte Transparenzgebot verlangt, dass sich keine unangemessene Benachteiligung<br />
aufgrund einer nicht ausreichend klar und verständlich formulierten Klausel für den<br />
115<br />
Ittmann, S. 45.<br />
116<br />
Vgl. unter B. I.<br />
117<br />
BAG Urteil vom 25.05.2005 – 5 AZR 572/04; BVerfG Urteil vom 23.11.2006, 1 BvR 1909/06; Stoffels, Rn.<br />
197; Wüterich/Breucker, Rn. 164.<br />
118<br />
Bepler, S. 5.<br />
119<br />
Münch-Komm, Basedow, § 305 Rn. 1.<br />
120<br />
BGHZ 104, 232, 238.<br />
121<br />
Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Gesetz, § 2 Rn. 2.<br />
16
Vertragspartner ergibt. 122 Der Tatbestand des § 307 BGB kommt allein als Prüfungsmaßstab<br />
in Betracht, da keine in § 308 und 309 BGB genannte Vorschrift für<br />
Vermarktungsvorschriften relevant ist. 123<br />
Im Folgenden wird gesondert auf einzelne Punkte des Musterarbeitsvertrags und im<br />
Besonderen auf den § 3 MuAV eingegangen.<br />
1. Verpflichtung zum Tragen bestimmter Kleidung § 2 lit. e) MuAV<br />
Der § 2 lit. e) MuAV regelt den Tatbestand, dass sich der Spieler zum Tragen der ihm zur<br />
Verfügung gestellten Kleidung an den dort beschriebenen Vereinsveranstaltungen<br />
verpflichtet. Dies umfasst sowohl die Spiel- und Trainingskleidung, von Trikot bis zu den<br />
Spielschuhen, aber auch die Reise- und Abendbekleidung des Clubs. Diese Artikel sind meist<br />
so ausgestaltet, d.h. mit Logos und Werbezügen versehen, dass sie für den Markt leicht<br />
wiedererkennbar sind. Dass dadurch die Selbstbestimmung des Spielers über sein äußeres<br />
Erscheinungsbildes tangiert wird, ist zweifellos. 124 Alleine die Weisung eine bestimmte<br />
Kleidung zu tragen, kann sicherlich noch keine rechtswidrige Verletzung der<br />
Persönlichkeitsrechte begründen. Nach allgemeiner Auffassung handelt es sich bei der im<br />
Fußballspiel und im Training getragenen Sportbekleidung um Berufskleidung, die zu tragen<br />
der Arbeitgeber aufgrund seines Direktionsrechts auch verlangen kann. 125 Die für sonstige<br />
beschriebene Anlässe zur Verfügung gestellte Kleidung ist sogenannte Dienstkleidung, 126 die<br />
zur Berufsausübung nicht zwingend erforderlich ist. 127 Fußballspieler sind die Repräsentanten<br />
ihres Clubs. Sie beeinflussen das Image des Clubs nicht unwesentlich. Es ist daher<br />
verständlich, dass es im Interesse des Clubs ist, ein einheitliches repräsentatives Bild in der<br />
Öffentlichkeit darzustellen. Die Rechtsprechung erkennt eine solche Weisung auch an, wenn<br />
dem Arbeitnehmer eine besondere Repräsentationsfunktion zukommt, ohne den Lizenzspieler<br />
unangemessen zu benachteiligen. 128 Die Repräsentationsfunktion des Lizenzspielers für den<br />
Club im Ganzen entfällt jedoch bei Auftritten, zum Beispiel in Sportsendungen oder Galas,<br />
auch wenn der Auftritt im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Lizenzspieler steht. 129<br />
Kritischer hinterfragt werden muss die Tatsache, dass der Lizenzspieler zur Trikotwerbung<br />
122<br />
Münch-Komm, Basedow, § 307 Rn. 48; EuGH NJW 2001, 2244 f.<br />
123<br />
Vgl. BGHZ 128, 93, 102.<br />
124<br />
Ittmann, S. 93; Rybak, S. 109 f.<br />
125<br />
Rybak, S. 110; WFV, Englisch, S. 58.<br />
126<br />
Küttner, Rn. 1 ff.<br />
127<br />
Rybak, S. 111; WFV, Englisch, S. 59.<br />
128<br />
BAG, NZA 1990, 320, 321; BAG, NZA 1993, 711, 711; Ittmann. S. 94; im Ergebnis auch Bepler, S. 14, 16,<br />
wenn die Bekleidungsvorschrift in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Auftreten als Verein steht.<br />
129<br />
WFV, Englisch, S. 59.<br />
17
und sonstiger Werbung mittels vom Verein gestellter Bekleidung und<br />
Ausrüstungsgegenständen verpflichtet wird. Die in § 2 lit. e) MuAV enthaltene Formulierung<br />
„der Club behält sich vor, die von ihm gestellte Sportkleidung mit Werbung zu versehen“<br />
umfasst zwei Verpflichtungen: die Werbung durch und die Werbung mit der gestellten<br />
Ausrüstung. Dass sich für den Lizenzspieler dadurch eine Handlungsverpflichtung zur<br />
Drittwerbung ergibt, ist nunmehr bedenkenlos. 130 Es gehört heutzutage zu jedem Sport,<br />
Sponsoren zu besitzen und sich zur Werbung für diese zu verpflichten. 131 Gerade im Fußball<br />
erstreckt sich dieses Phänomen bis in den Jugendamateurbereich. Es wird damit ein<br />
besonderer Werbewert erzeugt, der im Interesse des Clubs Einnahmen generiert, die zur<br />
Refinanzierung des Clubs beitragen. Dies führt zu einer Verknüpfung von Sportleistung und<br />
Werbeleistung, 132 die besonders im Fall der Trikotwerbung deutlich wird.<br />
Mit diesen Weisungen weicht der Vertrag vom Grundsatz der Privatautonomie ab, indem das<br />
Recht des Spielers auf Abschluss von individuellen Sponsoringverträgen beeinträchtigt<br />
wird. 133 Spitzenlizenzkicker besitzen einen enormen Markenwert und sind gerade in der<br />
Sportartikelindustrie gefragte Werbepartner. Die Klausel könnte sie so möglicherweise<br />
erzielbarer Einkünfte berauben. Zusätzlich hat sie noch den Nebeneffekt, dass sie<br />
Konkurrenten faktisch aussperrt. 134 Hinzu kommt, dass dieses allgemeine Werbeverbot nur<br />
gegenüber dem Vertragspartner gilt, also <strong>zwischen</strong> Club und Spieler. Gleichwohl ist eine<br />
vertragliche Erweiterung an dieser Stelle als wirksam zu erachten. Das Interesse des Clubs,<br />
seine eigenen Sponsorenverträge zu erfüllen, ist schutzwürdiger als das Interesse an<br />
wirtschaftlicher Betätigung durch Werbemaßnahmen für einen <strong>Individual</strong>sponsor des Spielers<br />
während der Arbeitszeit. 135 Ebenso gegen eine sich dadurch ergebende unangemessene<br />
Benachteiligung spricht jedoch, dass stets ein erhebliches Refinanzierungsinteresse des Clubs<br />
entgegensteht und sich dieser wünscht, dass die Spieler seiner Mannschaft auch einheitlich<br />
geschlossen auftreten. 136 Damit verhindert der Verein wirksam, dass Spieler auf eigene<br />
Rechnung Werbung betreiben, so z.B. mit Spielschuhen eines anderen Ausrüsters. 137<br />
130<br />
Grunsky, Seiter, S. 41, 45; Ittmann, S. 94 f.<br />
131<br />
WFV, Englisch, S. 60.<br />
132<br />
PHB-SportR, Fritzweiler, 3. Teil, 1. Kapitel, Rn. 24.<br />
133<br />
Küpperfahrenberg, S. 74.<br />
134<br />
Bepler, S. 16; zu kartellrechtlichen Problemen in ähnlich gelagerten Fällen darf hier auf Heermann,<br />
Sportsponsoring und Kartellrecht, WRP 3/2009, S. 285 ff. verwiesen werden.<br />
135<br />
Ittmann, S. 142.<br />
136 Küpperfahrenberg, S. 74.<br />
137 Rybak. S. 113.<br />
18
Eine im Ergebnis unangemessene Beeinträchtigung des Lizenzspielers durch diese<br />
arbeitsvertragliche Bestimmung liegt nicht vor. 138 In der Praxis haben sich nunmehr nicht<br />
ausschließlich wirtschaftliche Kriterien in den Vordergrund gestellt, sondern auch sportliche.<br />
Um sportlich erfolgreich zu sein, müssen für vakante Mannschaftspostionen neue Spieler<br />
transferiert werden. Hierbei findet sich oft kein gewünschter Spieler aus dem Pool von<br />
Spielern, die denselben individuellen Ausrüster, wie der Club besitzen. Dabei wissen die<br />
Spieler um ihre Verhandlungsposition und können so eine Abbedingung der Klauseln<br />
verlangen. 139 Frank Ribéry oder Mario Gomez wird so vom FC Bayern München gestattet, in<br />
Spielschuhen ihres persönlichen Ausrüsters aufzulaufen.<br />
2. Nutzung von Gebrauchsgütern § 2 lit. f) MuAV<br />
Erweiternd zu der Pflicht aus §2 lit. e) MuAV sagt der § 2 lit. f) MuAV aus, „dass die von<br />
Sponsoren des Clubs zur Verfügung gestellten Gebrauchsgüter (z.B. Kraftfahrzeuge) bei<br />
dienstlichen Anlässen ausnahmslos und bei privaten Unternehmungen regelmäßig zu nutzen“<br />
sind. Gegenüber dem Tatbestand, dass „bei dienstlichen Anlässen ausnahmslos“ die zur<br />
Verfügung gestellten Gebrauchsgüter zu nutzen sind, werden keine Bedenken laut. Fraglich<br />
ist jedoch der Umgang mit der Ergänzung der Verpflichtung in den privaten Bereich hinein.<br />
Es könnten dadurch die Persönlichkeitsrechte des Lizenzspielers verletzt werden, wenn sich<br />
dieser außerhalb seiner Arbeitszeit nicht frei entfalten darf. Sicherlich besitzt der Club ein<br />
berechtigtes Interesse daran, dass die Spieler auch während ihrer Freizeit auf diese<br />
Gebrauchsgüter zurückgreifen, wird über sie ja regelmäßig in den Medien berichtet und der<br />
Werbeeffekt somit verstärkt. Würde der Spieler sofort nach Ende seiner Arbeitszeit die<br />
Produkte wechseln, so würde dies die Glaubwürdigkeit und den Werbeeffekt der Sponsoren<br />
nachhaltig stören. 140 Die Klausel reguliert sich jedoch selbst über den Zusatz, dass dies nur<br />
„regelmäßig“ geschehen soll. Eine flexible, dem Spieler selbst überlassene, Handhabung der<br />
Umsetzung der Klausel ermöglicht es, diese als hinreichend transparent zu beschreiben. 141<br />
138<br />
So auch Rybak, S. 114f; WFV, Englisch, S. 60; Weber, S. 272 f.<br />
139<br />
Küpperfahrenberg, S. 75.<br />
140<br />
In „Maranello statt Rüsselsheim“ <br />
(zuletzt 20.01.2011), spricht sich Herr Hörwick, Pressesprecher des FCB, deutlich gegen<br />
Oliver Kahn aus, der zuvor nicht mit seinem Dienstfahrzeug sondern mit seinem neuen Ferrari F1 zum Training<br />
kam.<br />
141<br />
WFV, Englisch, S. 60 f.<br />
19
3. Nutzung und Verwertung der Persönlichkeitsrechte im Arbeitsverhältnis § 3 lit. a) MuAV<br />
a. Einräumung der Persönlichkeitsrechte nach § 3 lit. a) I MuAV<br />
Zentrale Bedeutung in dem Musterarbeitsvertrag kommt dem § 3 MuAV zu. So wird in § 3<br />
lit. a) I MuAV der Umgang mit den Persönlichkeitsrechten des Spielers geregelt. Dabei<br />
werden die Persönlichkeitsrechte, die für die Vermarktung von besonderer Bedeutung sind,<br />
also das Recht am eigenen Bilde, Namen, gesprochenes Wort und auch besondere<br />
fußballbezogene Persönlichkeitsmerkmale herv<strong>org</strong>ehoben und dem jeweiligen Arbeitgeber<br />
übertragen. 142<br />
Dadurch, dass von Teilen der Literatur 143 angenommen wird, dass die vertraglich vereinbarte<br />
Sportleistung zwangsläufig auch mit einer Werbeleistung verbunden ist, ist eine ausdrücklich<br />
vertragliche Regelung zur Duldung oder Gestattung der Nutzung von Persönlichkeitsrechten<br />
nicht notwendig. Diese Pflicht, die als Ausfluss der Treuepflicht gegenüber dem Club zu<br />
sehen ist, wird jedoch ganz überwiegend 144 abgelehnt, da eine solche Betrachtung den<br />
Rahmen der Treuepflichten überdehne. 145 Der Musterarbeitsvertrag besitzt allerdings eine<br />
ausdrückliche vertragliche Regelung. 146<br />
Der § 3 lit. a), b) MuAV versucht, den durch den § 2 MuAV aufgelisteten Verpflichtungen<br />
eines Lizenzspielers berührten Persönlichkeitsrechten Konturen zu verschaffen. Grundsätzlich<br />
lässt sich nichts gegen eine vertragliche Einräumung zur Nutzung der Persönlichkeitsrechte<br />
des Spielers an den Club anführen. Besonders erforderlich ist die Übertragung zudem, um den<br />
Statuten des Ligaverbands 147 gerecht zu werden, damit dieser wiederum seinen<br />
Verpflichtungen aus der Vermarktung der Fernseh- und Rundfunkvermarktung nachkommen<br />
kann. Aus den so generierten Geldern werden den Bundesligaclubs nach einem<br />
Vergabeschlüssel wieder Mittel zugeteilt, wodurch auch eine mittelbare Entschädigung für<br />
die übertragenen Rechte über den Lohn an den Spieler ausgezahlt wird. Die Spieler einer<br />
Mannschaft sind Identifikationsfiguren für den Club und die Fans. Sie dienen daher als<br />
besonders geeignete Werbefiguren in der vermarktungsfähigen Darstellung für den Club und<br />
seine Werbepartner. Ziel eines jeden ist es, die Wirtschaftlichkeit der Unternehmung zu<br />
steigern. 148 Dass sich der Spieler durch die §§ 3 lit a) und 2 lit. e) MuAV bereiterklärt, mit<br />
ihm im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowohl in Eigen- als auch in Fremdwerbung zu<br />
142<br />
Zur vertraglichen Übertragung von Persönlichkeitsrechten siehe unter C. II.<br />
143<br />
PHB-SportR, Fritzweiler, 3. Teil, 1. Kapitel Rn. 24f.<br />
144<br />
Wüterich/Breucker, Rn. 339; WFV, Englisch, S. 66.<br />
145<br />
WFV, Englisch, S. 66.<br />
146<br />
Vgl. Fn. 141.<br />
147<br />
Die Liga – Fußballverbandes e.V. operative Geschäfte führt die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH aus.<br />
148 Ittmann, S. 140.<br />
20
werben, um dem Repräsentationsinteresse des Vereins gerecht zu werden, kann nichts<br />
entgegengehalten werden. 149 Bei Eigenwerbung handelt es sich um jegliche Werbung für den<br />
Club selbst, unter Fremdwerbung versteht man die Werbung für einen Dritten, der in einer<br />
Vertragsbeziehung zum Club steht. 150 Hier darf auch mit angemerkt werden, dass die in § 3<br />
lit. b) MuAV geregelte Gruppenvermarktung ebenso zu rechtfertigen ist und keine Bedanken<br />
entgegenstehen. 151 Dabei wird Gruppenvermarktung als Vermarktungsmaßnahme definiert.<br />
Diese umfasst die Clubs der 1. Fußball Bundesliga und 2. Fußball Bundesliga in ihrer<br />
Gesamtheit oder in wesentlichen Teilen. 152<br />
Fraglich sind nur etwaige Formulierungen, wie sie in § 3 lit. a) MuAV zu finden sind. Dort ist<br />
die Rede von „fußballbezogenen Persönlichkeitsmerkmalen“, die ebenso voll auf den<br />
Arbeitgeber übertragen werden. Doch was unter diesem hier als besonderes<br />
Persönlichkeitsmerkmal klassifizierten Merkmal zu verstehen ist, scheint offen. Der Wortlaut<br />
besitzt einen derartig großen Auslegungsspielraum, dass es als nahezu unmöglich erscheint,<br />
eine Definition dafür zu finden. Denn ob dieses Merkmal sich nur auf im unmittelbaren<br />
Bezug zu dem ausgeübten Sport stehende Tätigkeiten oder Sachen bezieht oder ob es sich bei<br />
einer der Sportart fremden Handlungen in der Öffentlichkeit eben nicht um das Merkmal<br />
dreht, obwohl der Spieler ja gerade aufgrund seiner Tätigkeit als Fußballer dort auftritt, bleibt<br />
ungelöst. Zieht man die Betrachtung der Gesamtumstände mit in die Entscheidung hinein, so<br />
wird man feststellen, dass sich eine eindeutige Trennung nicht ergeben wird und eine<br />
unscharfe im Ergebnis offene Einzelfallentscheidung bleiben wird. Es wird anscheinend der<br />
Versuch unternommen, dieses Merkmal und ebenso die Verwertung der anderen Rechte<br />
dadurch einzugrenzen, dass man sich nur auf die Tätigkeit als Lizenzfußballer beziehen<br />
möchte. Doch eine begriffliche Enge besitzt auch diese Formulierung nicht. Zwar wird aus<br />
dem § 3 lit. a) III MuAV deutlich, was explizit nicht unter seine Tätigkeit als Lizenzspieler<br />
fällt, u. a. die schriftstellerische Tätigkeit sowie die Testimonial-Werbung für nicht<br />
fußballbezogene Produkte. Doch so ist auch diese Auflistung gemäß § 3 lit. a) IV MuAV nur<br />
beispielhaft und nicht abschließend. Identisch ist auch die Aufzählung der in § 3 lit. a) II<br />
MuAV genannten in Bezug zur Tätigkeit des Lizenzspielers stehenden Verwertungen der<br />
Persönlichkeitsrechte. Bleibt nur zu klären, wo die Tätigkeit als Lizenzspieler beginnt und wo<br />
sie aufhört. Wann beginnt die private Sphäre? Die Lösung gibt zu Teilen der MuAV selbst.<br />
Denn aus den vertraglichen Hauptpflichten ergibt sich nach § 2 MuAV eine mögliche örtliche<br />
149 WFV, Englisch, S. 58.<br />
150 Grunsky, Seiter, S. 41, 45; Küpperfahrenberg, S. 72.<br />
151 Heermann, causa sport 2/2009, 166, 168.<br />
152 WFV, Englisch, S. 68.<br />
21
Abgrenzung. Demnach ist die Tätigkeit des Lizenzspielers zumindest immer dann betroffen,<br />
wenn er sich auf Veranstaltungen des Clubs befindet. Eine sachlich-inhaltliche Abgrenzung<br />
der Tätigkeiten ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit 153 nicht möglich. 154 Denn selbst wenn<br />
der Auftritt für einen Sponsor in jeglicher Form nichts mit dem Fußball zu tun hat, so wird<br />
man eine Inbezugnahme auf den Fußball nicht abstreiten können. 155 Für den Lizenzspieler in<br />
der heutigen Zeit muss klar sein, dass bei der Summe an gezahlten Gehaltern und Prämien<br />
stets das Refinanzierungsinteresse des Clubs derart bedeutend ist, dass er sich allen, auch der<br />
erst zukünftig in Erscheinung tretenden Vermarkungsmöglichkeiten, nicht versperren möchte.<br />
Von einer hinreichenden Transparenz der untersuchten Formulierungen kann somit<br />
gesprochen werden. 156<br />
b. Exklusive Lizenzerteilung<br />
Der Musterarbeitsvertrag drückt in § 3 lit. a) V MuAV die Exklusivität der Einräumung der<br />
Rechte aus § 3 lit. a) I MuAV gegenüber dem Arbeitgeber aus. Dass der Club einen<br />
generellen Anspruch auf eine exklusive Einräumung geltend macht, ist verständlich. Will der<br />
Club sich doch das wirtschaftliche Potenzial der personenbezogenen Rechte sichern. 157 Gegen<br />
eine Exklusivitätsformulierung, die sich im Allgemeinen auf die eingeräumten<br />
Persönlichkeitsrechte, wohl aber im Besonderen auf die, die Tätigkeit als Lizenzspieler<br />
berührenden Persönlichkeitsrechte, bezieht, kann aus dem v<strong>org</strong>ebrachten Grund nichts<br />
eingewendet werden. Eine sichere Position bezüglich der Vermarktung erfolgt daraus aber<br />
nicht, besteht ja noch die Möglichkeit, dass konkurrierende Unternehmen zur Verwertung<br />
berechtigt sind. Nicht selten sind für seine Vermarktung durch den Spieler individuelle Dritte<br />
beauftragt. Je nach Ausgestaltung dieses Verhältnisses bedeutet dies, dass der Spieler auch<br />
diesen all seine Rechte übertragen haben könnte. Daraus resultierend würde es zu einer<br />
erneuten Gewichtung des Merkmals kommen, wann sich die Vermarktung fußballbezogen<br />
abspielt und wann nicht.<br />
c. Verbot von Nebentätigkeiten<br />
Wie bereits aufgezeigt wurde, liegt dem Club viel an einer exklusiven Nutzung der<br />
Werbetätigkeiten des Lizenzspielers. Neben der sich aus § 2 lit. e) MuAV i.V.m. § 3 lit. a) I<br />
MuAV ergebenden Pflicht für den Lizenzspieler, Werbung für den Verein auf der und durch<br />
153 Siehe § 3 lit. a) III MuAV.<br />
154 So auch Ittmann, S. 152.<br />
155 Heermann, causa sport 2/2009 S. 166, 168; Bepler, S. 16.<br />
156 Im Ergebnis auch Ittmann, S. 15; LG Frankfurt, AZ 2-06 O 249/06 vgl. Fn. 96, kritisch Heermann, causa<br />
sport 2/2009 S. 166, 168; a.A. Rybak, S. 120.<br />
157 Ittmann, S. 153.<br />
22
die gestellte Sportkleidung zu betreiben, 158 beinhaltet diese Pflicht gleichzeitig eine Pflicht<br />
zur Unterlassung von Eigenwerbung während der Arbeitszeit. 159 Diese Verpflichtung des<br />
Lizenzspielers schließt als solche jedoch nicht aus, dass der Spieler im privaten Bereich nach<br />
Abschluss von individuellen Werbeverträgen wirbt.<br />
Arbeitsverträge enthalten häufig generelle Nebentätigkeitsverbote. Eine Nebentätigkeit des<br />
Lizenzspielers liegt dann vor, wenn er auf eigene Rechnung wirtschaftlich, etwa durch einen<br />
<strong>Individual</strong>sponsoringvertrag, agiert. So wird in dem Musterarbeitsvertrag der DFL nach § 3<br />
lit. a) V MuAV i.V.m. § 2 lit. g) MuAV festgeschrieben, dass der Spieler im Rahmen seiner<br />
Eigenvermarktung stets erst dann tätig werden darf, wenn eine schriftliche Zustimmung durch<br />
den Club erfolgt ist. Wurde eine Zustimmung erteilt, so der § 3 lit. a) V MuAV i.V.m. § 2 lit.<br />
g) MuAV weiter, kann diese jederzeit widerrufen werden. Folglich ist es dem Spieler<br />
untersagt, jede Form der Nebentätigkeit auf eigene Rechnung zu betreiben, auch wenn ihm<br />
der § 3 lit. a) III MuAV die, zur wirtschaftlichen Verwertung für schriftstellerische<br />
Tätigkeiten und Testimonial-Werbung von nicht fußballbezogenen Produkten, benötigten<br />
Persönlichkeitsrechte zugesteht. Allerdings sind auch diese Rechte einem<br />
Zustimmungserfordernis unterworfen, das immer dann notwendig ist, wenn der Spieler für<br />
andere Partner als die des Clubs wirbt und Persönlichkeitsrechte verwertet werden. Aber doch<br />
gerade bei Testimonial-Werbung der Spieler für Dritte werden diese Persönlichkeitsrechte<br />
verwertet. Es handelt sich somit um ein sog. absolutes Nebentätigkeitsverbot mit<br />
Zustimmungsvorbehalt. 160<br />
Resultierend aus der Präsenz der Privatautonomie steht es den Vertragsparteien frei,<br />
erweiternde Nebentätigkeitsverbote in den Arbeitsvertrag aufzunehmen. 161 Eine<br />
Beschränkung der Nebentätigkeiten des Lizenzspielers in seiner außerdienstlichen Zeit greift<br />
allerdings auch in die, die berufliche Nebentätigkeit schützende Berufsfreiheit, gemäß Art. 12<br />
I GG und für wirtschaftlich motivierte Handlungen in die Handlungsfreiheit gemäß Art. 2 I<br />
GG ein. 162 Aufgrund dieser geschützten Freiheiten bedarf es eines berechtigten Interesses des<br />
Arbeitgebers an einem vertraglichen Nebentätigkeitsverbot, welches vor allem dann besteht,<br />
wenn durch die Nebentätigkeit die Arbeitsleistung für den Arbeitgeber beeinträchtigt wird. 163<br />
Eine Vertragsklausel, die dem Arbeitnehmer jede vom Arbeitgeber nicht genehmigte<br />
158<br />
Siehe unter D. III. 1.<br />
159<br />
Ittmann, S. 141.<br />
160<br />
Münchener-AnwHb Reinfeld, § 31 Rn. 81 f.<br />
161<br />
Küpperfahrenberg, S. 73.<br />
162<br />
Schaub, ArbR-Hdb, § 42 Rn. 3.<br />
163<br />
BAG AP Nr. 6 zu Art. 12 GG; Grunsky, Seiter, S. 54 f; Schaub, ArbR-Hdb, § 42 Rn. 10, auch für<br />
Formuarlverträge im Rahmen der Inhaltskontrolle gemäß § 307 I BGB.<br />
23
Nebentätigkeit verbietet, ist grundsätzlich unvereinbar mit den genannten Freiheiten. Folglich<br />
ist eine solche Klausel nach ganz überwiegender Meinung unwirksam. 164 Handelt es sich<br />
jedoch, wie vorliegend, um ein absolutes Nebentätigkeitsverbot mit Erlaubnisvorbehalt, gehen<br />
die Meinungen auseinander. So sieht die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 165<br />
und der überwiegende Teil der Literatur 166 keine Gesamtunwirksamkeit der entsprechenden<br />
Klausel, sondern legen diese im Hinblick von Art. 2 I GG und Art. 12 I GG teilweise<br />
verfassungskonform einschränkend aus. 167 Demnach steht dem Arbeitnehmer stets ein<br />
Anspruch auf Erteilung der Zustimmung zu, wenn nicht Beeinträchtigungen der Interessen<br />
des Arbeitsgebers zu erwarten sind. 168 Andere wiederum halten auch ein absolutes<br />
Nebentätigkeitsverbot mit Erlaubnisvorbehalt für unwirksam. 169 Für sie handelt es sich dabei<br />
um eine Offenlegungspflicht, auf die der Arbeitgeber keinen Anspruch besitzt. 170 Somit sind<br />
derartige Verbote als unangemessene Benachteiligung für den Arbeitnehmer zu sehen und<br />
unwirksam. 171<br />
Zur Beurteilung, welcher der vertretenen Auffassungen der Vorzug gegeben werden soll,<br />
bedarf es einer genaueren Untersuchung unter Berücksichtigung der dadurch verfolgten<br />
Interessen und Auswirkungen. Es ist verständlich nachvollziehbar, dass ein berechtigtes<br />
Interesse des Clubs daran besteht, seinen Lizenzspieler und im Besonderen seine Gesundheit<br />
durch Einflüsse von außen zu schützen. Eine Mannschaft kann nur sowohl sportlich wie auch<br />
der Verein wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn ihre Leistungsträger ihr absolut höchstes<br />
Leistungsvermögen besitzen. Die Sensibilität vieler Spitzenfußballspieler ist bekannt, sodass<br />
es im Grundsatz berechtigt erscheint, eine außerdienstliche Betätigung in Form von<br />
Werbebelastungen verhindern zu wollen. 172 Trotzdem wird immer im Einzelfall zu<br />
entscheiden sein, wann eine Beeinträchtigung der sportlichen Leistungsfähigkeit vorliegt. Das<br />
ist sicherlich der Fall, wenn etwa die Werbeaktion des Spielers den Trainings- oder<br />
Spielbetrieb behindert. 173 Ebenso einleuchtend ist, dass der Club, durch die Nebentätigkeit des<br />
Lizenzspielers und einer damit verbundene Werbetätigkeit, etwa in Form von Fußballschuhen<br />
164<br />
Rybak, S. 139; Schaub, ArbR-Hdb, § 42 Rn. 10; Glöckner, S. 151; Preis, Rolfs, II N 10 Rn. 28.<br />
165<br />
BAG AP Nr. 60 zu § 626 BGB; BAG AP Nr. 68 zu § 626 BGB; BAG Urteil vom 11.12.2001 – 9 AZR<br />
343/00 – NZA 2002, 965 ff.<br />
166<br />
Preis, Rolfs, II N 10 Rn. 29.<br />
167<br />
Hunold, NZA-RR 2002, 505, Rybak, S. 140; Grunsky, Seiter, S. 54; Schaub, ArbR-Hdb, § 42 Rn. 10; für<br />
WFV, Englisch, S. 5 61 ff. ist jede Konkurrenzwerbung eine Störung der betrieblichen Interessen des Clubs und<br />
ein Zustimmungsvorbehalt damit bedenkenlos.<br />
168<br />
Preis, Rolfs, II N 10 Rn. 29.<br />
169<br />
Glöckner, S. 151 ff.; Bepler, S. 17; Rybak, S. 143; Preis, Rolfs, II N 10 Rn. 31 dann, wenn die Klausel die<br />
Maßstäbe zur Erteilung der Klausel völlig offen lässt.<br />
170<br />
Wank, Rn. 369; BAG Urteil vom 11.12.2001, - 9 AZR 464/00 – NZA 2002, 965, 967; Bepler, S. 17.<br />
171 Bepler, S. 17.<br />
172 So auch Ittmann, S. 118 f.<br />
173 Küpperfahrenberg, S. 75.<br />
24
oder Torwarthandschuhen eines vom Ausrüster des Clubs abweichenden Herstellers, sein<br />
Interesse am eigenen Werbewert erheblich beeinträchtigt sieht. 174 Die Grundrechte sprechen<br />
hingegen für den Spieler, die dem Lizenzspieler eine Ausübung mehrerer Tätigkeiten<br />
zeitgleich gewähren. Das Recht auf zusätzliche Verdienstmöglichkeiten kann ihm per se nicht<br />
einfach durch ein höheres Gehalt abgekauft werden. 175 Eine vertragliche Einschränkung von<br />
Nebentätigkeiten kann sich nicht lediglich durch den Zusatz eines Zustimmungsvorbehalts<br />
positiv auf eine generelle unangemessene Beeinträchtigung des Lizenzspielers auswirken.<br />
Sieht man von einer Gesamtunwirksamkeit oder nur einer verfassungskonformen Auslegung<br />
ab, so bleibt dennoch festzuhalten, dass für sämtliche Tätigkeiten der Lizenzspieler die<br />
Zustimmung durch den Club einholen muss. Dies trifft selbst dann zu, wenn keinerlei<br />
Interessen des Clubs entgegenstehen und er nach der Rechtsprechung einen Anspruch auf<br />
Zustimmung besitzt. 176 Für Ittmann kommt als einzig rechtfertigendes Argument in Betracht,<br />
dass der Spieler die Intensität, Qualität und Wirkung der Nebentätigkeiten nicht abschätzen<br />
kann. Im Zuge dessen wäre eine Beratungs- und Anzeigenpflicht des Vereins als ein milder<br />
eingreifendes Mittel zu verstehen. 177 Aufgrund der gerade aufgezeigten Komplexität der<br />
Materie vertraut der Großteil der Lizenzspieler professionellen Vermarktungsagenturen.<br />
Deren Anliegen ist es, die vor allem wirtschaftlichen Belange der unter Vertrag stehenden<br />
Spieler zu vertreten und, aber auch im eigenen Interesse, zu maximalen Profit zu führen. Es<br />
wird dem Spieler trotz Modifikation des absoluten Nebentätigkeitsverbots zugemutet, im<br />
Ausnahmefall Klage auf Abgabe einer Willenserklärung gemäß § 894 ZPO zu erheben, 178<br />
wovon der Spieler jedoch stets Abstand wegen befürchteter offener oder verdeckter<br />
Sanktionen nehmen wird. Allein durch den Zustimmungsvorbehalt resultiert noch keine<br />
Verbesserung der Stellung des Lizenzspielers gegenüber einem absoluten<br />
Nebentätigkeitsverbot. 179 Erschwert wird die Situation des Lizenzspielers noch erheblich<br />
dadurch, dass eine einmal erteilte Zustimmung jederzeit widerrufen werden kann. Dabei geht<br />
aus der Klausel nicht hervor, ob bestimmte Voraussetzungen an einen Widerruf geknüpft<br />
sind. Der Widerruf kommt einer Generalklausel gleich, die, sei eine Wirksamkeit des<br />
absoluten Nebentätigkeitsverbots mit Zustimmungsvorbehalt angenommen, zwar aufgrund<br />
der bereits an die Zustimmung hoch gestellten Ansprüche kaum Anwendung finden wird,<br />
aber in ihrer Weite zu unbestimmt auftritt.<br />
174 WFV, Englisch, S. 62.<br />
175 Rybak, S. 141; Ittmann, S. 119; a.A. Grunsky, Seiter, S. 54; kritisch Bruhn/Mehlinger, S. 49.<br />
176 Zur Veranschaulichung: Ein Lizenzspieler ist im Vorstand seiner eigenen gemeinnützigen Stiftung aktiv (z.B.<br />
Philipp Lahm als Vorstand der Philipp-Lahm-Stiftung).<br />
177 Ittmann, S. 120; ebenso Grunsky, Seiter, S. 54;<br />
178 Kindl/Meller-Hannich/Wolf, § 894 Rn. 1; Rybak, S. 142; Ittmann, S. 120.<br />
179 Glöckner, S. 152; Ittmann, S. 120.<br />
25
Es sei damit festgestellt, dass die Klausel des § 3 lit. a) V MuAV i.V.m. § 2 lit. g) MuAV den<br />
Arbeitnehmer, sprich den Lizenzspieler in seinen außerdienstlichen Tätigkeiten als absolutes<br />
Nebentätigkeitsverbot mit Zustimmungsvorbehalt unangemessen benachteiligt und somit<br />
unwirksam ist. Sie ist mit dem Grundrechtsschutz aus Art. 2 I GG und Art. 12 I GG<br />
unvereinbar, weil sie die Loyalitätspflicht zu Lasten der freien Entfaltung der Persönlichkeit<br />
zu weit zieht. 180 Die arbeitsvertragliche Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen des<br />
Arbeitsgebers verbietet ihm lediglich, so auch der § 2 lit. g) MuAV, Werbung für<br />
Konkurrenzprodukte der Werbepartner des Clubs zu betreiben. 181 Es sei hier jedoch nochmals<br />
auf die in der Praxis üblichen <strong>Individual</strong>vereinbarungen in den Arbeitsverträgen hingewiesen.<br />
Entscheidend ist wohl auch der Faktor, wann der Spieler <strong>Individual</strong>partnerschaften eingeht<br />
und wie sich dies auf die Vertragsverhandlungen auswirkt. Ob dem Spieler gegenüber seinem<br />
Club auch ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung eine Anzeigepflicht trifft, ist<br />
umstritten. 182 Besteht eine solche Anzeigenpflicht kann der Club neben arbeitsrechtlichen<br />
Sanktionen einen Unterlassungsanspruch geltend machen, solange durch die Nebentätigkeit<br />
das Arbeitsverhältnis tatsächlich betroffen sein. 183<br />
E. Anmerkung zur werberechtlichen Beziehung <strong>zwischen</strong> Spieler und Verband<br />
Nach dem Lizenzspieler und dem Club besitzt auch der Dachverband des deutschen Fußballs,<br />
der Deutsche Fußball Bund (DFB), eigene Sponsoren. Dies s<strong>org</strong>t für zusätzliche Brisanz im<br />
Wettbewerb exklusiver Sponsorentätigkeiten. Der DFB hat als Sponsoren sowohl den<br />
Automobilbauer Mercedes-Benz als auch Ferrero unter Vertrag. Bundesligisten besitzen oft<br />
ebenso einen Sponsorenvertrag mit einem Automobilhersteller. So stellt der deutsche<br />
Rekordmeister FC Bayern München regelmäßig Spieler zur Nationalmannschaft ab, die in<br />
ihrem Verein ein Fahrzeug der Marke Audi bewegen und für den Verband gleichzeitig für<br />
Mercedes-Benz als Testimoials auftreten. Das gleiche Phänomen beschreibt der <strong>Konflikt</strong> mit<br />
dem Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn, der selbst bei Nestlé unter Vertrag stand und für das<br />
Produkt Lion warb, sich aber als Testimonial in Produkten von Ferrero wiederfand. Bislang<br />
galt die Regelung, die Spielerberater sprechen von einer „geduldeten Geschichte“, dass<br />
Werbung der Nationalspieler für die Sponsoren des DFB nur dann erlaubt ist, wenn die<br />
gesamte Mannschaft abgebildet ist; 184 so zu sehen in TV-Spots z.B. von Bitburger oder<br />
Nutella (Ferrero). Die rechtliche Situation stellt sich so dar, dass gemäß § 5 I<br />
180<br />
Rybak, S. 143; im Ergebnis auch Ittmann, S. 120.<br />
181<br />
WFV, Englisch, S. 5 61 ff.; Rybak, S. 137.<br />
182<br />
Für eine solche Anzeigepflicht: Preis, Rolfs, II N 10 Rn. 51; Ittmann, S. 122 nwN.<br />
183<br />
Ittmann, S. 122; Preis, Rolfs, II N 10 Rn. 49.<br />
184<br />
Steudel, WELTonline vom 02.05.2002, (zuletzt 07.12.2010).<br />
26
Grundlagenvertrag (GV) <strong>zwischen</strong> Ligaverband und DFB eine Abstellpflicht von<br />
Lizenzspielern zur Bildung von Auswahlmannschaften besteht. In § 5 I GV heißt es dann<br />
weiter, dass die Nationalspieler dem DFB ihre Persönlichkeitsrechte übertragen, wobei im<br />
Gegenzug eine Finanzzahlung <strong>zwischen</strong> dem DFB und dem Ligaverband erfolgt, die als<br />
Abstellentschädigung an die betroffenen Clubs ausgezahlt wird. Des Weiteren verpflichten<br />
sich die Vereine in § 11 lit. a) und § 2 lit. a) Ligaverbandssatzung, sämtliche Bestimmungen<br />
und Beschlüsse von DFB und DFL zu befolgen, unter anderem den Grundlagenvertrag. Somit<br />
gibt der Verein sein Einverständnis in die Verwertung der Persönlichkeitsrechte der<br />
Lizenzspieler durch den DFB. 185 Durch das Urteil des LG Frankfurt, 186 das eine durchgehende<br />
Erwerbskette der Persönlichkeitsrechte vom Lizenzspieler durch den Musterarbeitsvertrag auf<br />
den Verein und weiter zum Ligaverband 187 feststellt, wird die rechtmäßige Verwertung der<br />
Persönlichkeitsrecht durch den DFB unterstrichen. Folglich ist eine mögliche Spannung<br />
<strong>zwischen</strong> Club und DFB kein <strong>Konflikt</strong>, sondern lediglich ein Kräftemessen verbunden mit<br />
dem Kampf um Sponsoren. Für den Einzelspieler wird wohl auch in Zukunft der obige<br />
Grundsatz fortbestehen.<br />
F. Fazit<br />
Als Resümee der Darstellung bleibt festzuhalten, dass bei jeglicher Form des Sponsorings im<br />
Bereich des Profifußballs gerade bei dem Gesponserten ein erhebliches wirtschaftliches<br />
Interesse besteht. Dieses sich aus der Vermarktung des Teams oder des Einzelnen ergebende<br />
Profitstreben mündet nicht selten in einem <strong>Konflikt</strong> <strong>zwischen</strong> den betroffenen Lizenzspielern<br />
und den Clubs. Grundlage hierfür bildet das unlängst anerkannte Arbeitsverhältnis der<br />
Parteien. Ein derartiges Arbeitsverhältnis bedarf einer klaren und verständlichen<br />
Ausgestaltung aller festgehaltenen Regelungen, damit sich aus diesem die Rechte und<br />
Pflichten der beteiligten Parteien eindeutig ergeben. Voraussetzung ist jedoch, dass diese<br />
Regelungen deutlich und transparent formuliert werden, um im Interesse aller Parteien einer<br />
für sie nachteiligen Auslegung des Vertragswerks vorzubeugen. Besondere Bedeutung besitzt<br />
der Grundsatz der Transparenz bei allen Vertragsteilen, die sich mit den Persönlich-<br />
keitsrechten im Rahmen einer Vermarktung befassen. Damit eine rechtlich-solide, für die<br />
Vertragsparteien zufriedenstellende und konfliktfreie Basis mit dem Arbeitsvertrag geschaffen<br />
wird, ist es höchst sinnvoll, über den Musterarbeitsvertrag hinaus detailliert und allumfassend<br />
bereits bestehende Sponsoringverträge in den Arbeitsvertrag mit aufzunehmen. Es sollte mehr<br />
185 Küpperfahrenberg, S. 77 ff.<br />
186 LG Frankfurt, Urteil vom 12.12.2008 – AZ 2 06 O 249/06 (nicht rechtskräftig) vgl. Fn. 96; ausführlich unter<br />
D. III. 2. a.<br />
187 Heermann, causa sport 2/2009, 166, 169.<br />
27
noch eine Präzisierung der Bereiche stattfinden, in denen der Spieler sich ohne jegliche<br />
Zustimmungspflicht frei vermarkten kann, unter Berücksichtigung aller Loyalitätspflichten<br />
gegenüber dem Arbeitgeber. Nur nach einer derartigen Ergänzung geht aus dem Vertrag klar<br />
und verständlich hervor, welche Formen des <strong>Individual</strong>- und Teamsponsorings konfliktfrei<br />
möglich sind und wie weit die Persönlichkeitsrechte dem Club oder Dritten zur Nutzung<br />
eingeräumt werden. Dabei fungiert das gegenseitige sportliche und wirtschaftliche<br />
Abhängigkeitsverhältnis als Regulativ bei der Vertragsgestaltung. Eine gänzliche Vermeidung<br />
des <strong>Konflikt</strong>potentials scheint jedoch unmöglich zu sein.<br />
28
G. Anhang<br />
Musterarbeitsvertrag der DFL (ab Saison 08-09)<br />
…<br />
§ 2 Pflichten des Spielers<br />
Der Spieler verpflichtet sich, seine ganze Kraft und seine sportliche Leistungsfähigkeit<br />
uneingeschränkt für den Club einzusetzen, alles zu tun, um sie zu erhalten und zu steigern und<br />
alles zu unterlassen, was ihr vor und bei Veranstaltungen des Clubs abträglich sein könnte. Gemäß<br />
diesen Grundsätzen ist der Spieler insbesondere verpflichtet<br />
a) …<br />
e) an allen Darstellungen und Publikationen des Clubs oder der Spieler zum Zwecke der<br />
Öffentlichkeitsarbeit für den Club, insbesondere in Fernsehen, Hörfunk und Presse, sowie bei<br />
öffentlichen Anlässen, Ehrungen, Veranstaltungen, Autogrammstunden etc. teilzunehmen bzw.<br />
mitzuwirken. Bei diesen und bei den unter a) genannten Veranstaltungen ist die vom Club<br />
gestellte Sportkleidung (Clubanzüge, Reisekleidung, Spielkleidung, Trainings- und Spielschuhe<br />
sowie alle sonstigen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände) entsprechend der jeweiligen<br />
Weisung des Clubs zu tragen. Der Club behält sich vor, die von ihm gestellte Sportkleidung mit<br />
Werbung zu versehen;<br />
f) von Sponsoren des Clubs zur Verfügung gestellte Gebrauchsgüter (z.B. Kraftfahrzeuge) bei<br />
dienstlichen Anlässen ausnahmslos und bei privaten Unternehmungen regelmäßig zu nutzen;<br />
g) Werbung für andere Partner als die des Clubs, auch durch oder auf der Bekleidung, nur mit<br />
vorheriger Zustimmung des Clubs zu betreiben. Der Club kann diese Zustimmung insbesondere<br />
dann verweigern, wenn durch Werbemaßnahmen des Spielers berechtigte Interessen des Clubs<br />
beeinträchtigt würden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Spieler beabsichtigt, Werbung für<br />
Unternehmen zu betreiben, die in Konkurrenz zu den Partnern des Clubs stehen. Eine einmal<br />
gegebene Zustimmung kann widerrufen werden, sofern sachliche Gründe hierfür vorliegen;<br />
h) …<br />
§ 3 Nutzung und Verwertung der Persönlichkeitsrechte im Arbeitsverhältnis<br />
a) Der Spieler räumt dem Club, sofern und soweit seine Tätigkeit als Lizenzspieler und nicht<br />
ausschließlich seine Privatsphäre berührt ist, das ausschließliche Recht ein, sein Bildnis, seinen<br />
29
Namen (auch Spitz- und Künstlernamen), das von ihm gesprochene Wort sowie besondere<br />
fußballbezogene Persönlichkeitsmerkmale uneingeschränkt zu nutzen und zu verwerten.<br />
Die hier eingeräumte wirtschaftliche Verwertung der Persönlichkeitsrechte in Bezug zu der<br />
Tätigkeit des Spielers als Lizenzspieler ist etwa gegeben bei einer Verwertung durch Fernsehen,<br />
Internet, mobile Dienste, Computerspiele, Sammelbilder u.Ä.<br />
Zu der ausschließlich der Privatsphäre des Spielers zugeordneten und bei diesem verbleibenden<br />
wirtschaftlichen Verwertung der Persönlichkeitsrechte gehören insbesondere schriftstellerische<br />
Tätigkeiten sowie die Testimonial-Werbung für nicht fußballbezogene Produkte. Die Regelung<br />
des § 2 lit. g) dieses Vertrages bleibt hiervon unberührt.<br />
Die v<strong>org</strong>enannten Aufzählungen sind nur beispielhaft und nicht abschließend.<br />
Falls der Spieler die dem Club zur exklusiven Verwertung eingeräumten Persönlichkeitsrechte<br />
durch Eigenvermarktungsmaßnahmen auch selbst wirtschaftlich verwerten möchte, bedarf es dazu<br />
stets der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den Club. Diese ist zu erteilen, falls dem<br />
nicht ausnahmsweise ein besonderes berechtigtes Interesse des Clubs entgegensteht.<br />
Der Spieler erklärt, die wirtschaftliche Verwertung seiner Persönlichkeitsrechte, sofern und soweit<br />
seine Tätigkeit als Lizenzspieler berührt wird, keinem anderen eingeräumt zu haben.<br />
b) Der Club ist in dem Umfang der Einräumung berechtigt, das Bildnis, seinen Namen (auch<br />
Spitz- und Künstlernamen), das von ihm gesprochene Wort sowie besondere fußballbezogene<br />
Persönlichkeitsmerkmale des Spielers uneingeschränkt zu nutzen und zu verwerten, insbesondere<br />
sie dem DFB, dem Ligaverband oder der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH zur Erfüllung ihrer<br />
vertraglichen Verpflichtungen einzuräumen.<br />
Der Spieler erkennt ausdrücklich an, dass die Verwertung der oben genannten Rechte für<br />
Maßnahmen im Rahmen der Gruppenvermarktung der Bundesliga und/oder der 2. Bundesliga<br />
und/oder weiterer Wettbewerbe des Ligaverbandes nach § 16 der Ordnung für die Verwertung<br />
kommerzieller Rechte (OVR) auch durch den Ligaverband bzw. die DFL Deutsche Fußball Liga<br />
GmbH erfolgen kann. Unter Gruppenvermarktung verstehen die Arbeitsvertragsparteien alle<br />
Vermarktungsmaßnahmen, welche die Vereine bzw. Kapitalgesellschaften der Bundesliga<br />
und/oder der 2. Bundesliga in ihrer Gesamtheit oder in wesentlichen Teilen umfassen.<br />
Der Club kann die ihm von dem Spieler eingeräumten Rechte gegenüber Dritten auch gerichtlich<br />
geltend machen. Er ist berechtigt, bei der Übertragung der hier eingeräumten Rechte auf den<br />
DFB, den Ligaverband oder die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH auch die Befugnis zu<br />
übertragen, die betreffenden Rechte gegenüber Dritten gerichtlich geltend zu machen.<br />
c) Die Einräumung der Nutzungs- und Verwertungsrechte bezieht sich auch auf den Bereich aller<br />
gegenwärtigen und künftigen technischen Medien und Einrichtungen einschließlich Multimedia-<br />
Anwendungen (Internet, Online-Dienste, mobile Dienste etc.) und Softwareprodukte,<br />
insbesondere interaktive Computerspiele. Dies gilt insbesondere für die vom Club veranlasste<br />
oder gestattete Verbreitung von Bildnissen des Spielers als Mannschafts- oder Einzelaufnahmen<br />
in jeder Abbildungsform, auch der virtuellen Darstellung, besonders auch hinsichtlich der<br />
Verbreitung solcher Bildnisse in Form von Spielszenen und/oder ganzer Spiele der<br />
Lizenzligamannschaft, um somit öffentlich- und/oder privatrechtlichen Fernsehanstalten und/oder<br />
anderen audiovisuellen Medien und/oder weiteren Interessenten Nutzungen hieran zu<br />
ermöglichen.<br />
d) Der Spieler stellt dem Club außerdem jederzeit seine Autogrammunterschrift im<br />
Originalschriftzug, als Faksimile oder in gedruckter Form für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit<br />
und/oder zur Wiedergabe auf vom Club beschafften Souvenir- und Verkaufsartikeln - ggf. auch in<br />
Verbindung mit Werbung Dritter - zur Verfügung.<br />
e) Die aus der wirtschaftlichen Verwertung der eingeräumten Rechte erzielten Erlöse stehen<br />
ausschließlich dem Club zu, soweit nicht in diesem Vertrag ausdrücklich Abweichendes geregelt<br />
ist.<br />
30
f) Die Rechteeinräumung ist grundsätzlich begrenzt auf die Laufzeit dieses Arbeitsvertrages.<br />
Diese Begrenzung gilt nicht für die mediale und multimediale Nachverwertung in Form von<br />
Archivbildern. Außerdem gilt für die Vermarktung und den Vertrieb von Produkten eine<br />
Abverkaufsfrist von 5 Jahren. Die Parteien sind sich einig, dass mit der vertraglichen Vergütung<br />
auch die Rechteeinräumung abgegolten ist.<br />
§ 4 Pflichten des Clubs<br />
1) Vergütung und andere geldwerte Leistungen<br />
…<br />
§ 12 Sonstige Vereinbarungen<br />
optional, falls zutreffend bitte ankreuzen:<br />
o siehe Anlagen .................................................................................. .<br />
…<br />
31