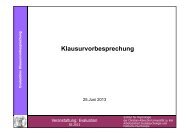AG StGB AT Termin 5_3
AG StGB AT Termin 5_3
AG StGB AT Termin 5_3
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorlesungsbegleitende Arbeitsgemeinschaft im Strafrecht für das 1. Semester (WS 10/11)<br />
Wiss. Mit. Jürgen Telke<br />
Der subjektive Tatbestand<br />
I. Einleitung<br />
Im subjektiven Tatbestand sind der Vorsatz sowie etwaige in Betracht kommende<br />
sonstige subjektive Unrechtsmerkmale zu prüfen. Die sonstigen subjektiven Unrechtsmerkmale<br />
sind deliktsspezifisch und daher je nach Tatbestand äußerst unterschiedlich<br />
(so etwa die Zueignungsabsicht in § 242 oder die subjektiven Mordmerkmale<br />
in § 211, 1. und 3. Gruppe). Demgegenüber stellt der Vorsatz das zentrale E-<br />
lement des subjektiven Tatbestandes dar. Wie es § 15 normiert, ist er, sofern kein<br />
Fahrlässigkeitsdelikt vorliegt, bei jedem Delikt des <strong>StGB</strong> erforderlich und zu prüfen.<br />
Eine genaue Definition des Vorsatzes wird vom Gesetz nicht vorgenommen, im Umkehrschluss<br />
lässt sich diese jedoch aus § 16 entnehmen:<br />
Vorsatz ist der Wille zur Verwirklichung eines Straftatbestandes in Kenntnis<br />
aller seiner objektiven Tatumstände<br />
Oder: Vorsatz ist das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung<br />
Daraus ergibt sich, dass der Vorsatz zwei Elemente voraussetzt: Ein intellektuelles,<br />
kognitives (=Wissen) und ein voluntatives (=Wollen) Element.<br />
II. Allgemeines<br />
1. Bezugspunkt des Vorsatzes<br />
Bereits aus der Definition ergibt sich, dass sich der Vorsatz stets und in vollem Umfang<br />
auf den objektiven Tatbestand zu beziehen hat. Dies bedeutet, dass jedes einzelne<br />
objektive Tatbestandsmerkmal vom Vorsatz des Täters erfasst sein muss, hier<br />
muss volle Kongruenz bestehen. Ist dies nicht der Fall und der Täter weist hinsichtlich<br />
eines objektiven Tatbestandsmerkmals keinen Vorsatz auf, so hat er sich ausweislich<br />
§ 16 nicht wegen einer Vorsatztat strafbar gemacht und es kommt lediglich<br />
eine Strafbarkeit wegen eines Fahrlässigkeitsdelikts in Betracht. Im Grundsatz lässt<br />
sich also festhalten, dass sich objektiver und subjektiver Tatbestand insoweit decken,<br />
als jedem objektiven Tatbestandsmerkmal ein entsprechendes subjektives Tatbestandsmerkmal<br />
gegenübersteht.<br />
Es besteht jedoch nicht immer vollständige Kongruenz zwischen objektivem und subjektivem<br />
Tatbestand. Denn neben dem Vorsatz, der tatsächlich das subjektive Spiegelbild<br />
des objektiven Tatbestandes darstellt, enthält der subjektive Tatbestand mitunter<br />
Elemente, die keine Entsprechung auf der Seite des objektiven Tatbestandes<br />
1
Vorlesungsbegleitende Arbeitsgemeinschaft im Strafrecht für das 1. Semester (WS 10/11)<br />
Wiss. Mit. Jürgen Telke<br />
enthalten. Dies sind die bereits angesprochenen besonderen subjektiven Unrechtsmerkmale<br />
(Bsp.: Die Zueignungsabsicht in § 242. Hier enthält der objektive Tatbestand<br />
des § 242 kein Merkmal der Zueignung, das diesem subjektiven Merkmal entsprechen<br />
würde. Da der Tatbestand des § 242 hier subjektiv mehr aufweist als objektiv,<br />
spricht man von einem Tatbestand mit „überschießender Innentendenz“.). Diese<br />
sonstigen subjektiven Unrechtsmerkmale stehen selbständig neben dem Vorsatz als<br />
Bestandteil des subjektiven Tatbestandes.<br />
a) Besonderheiten der einzelnen objektiven Tatbestandsmerkmale<br />
Der Vorsatz muss sich also auf den objektiven Tatbestand beziehen. Inhalte des<br />
Tatbestandes sind dabei zunächst die objektiven Tatbestandsmerkmale der jeweiligen<br />
Norm. Diese einzelnen objektiven Tatbestandsmerkmale können jedoch von unterschiedlicher<br />
Charakteristik sein, was zu Konsequenzen für die Frage nach der Intensität<br />
des darauf bezogenen Vorsatzes führt:<br />
a) Deskriptive Tatbestandsmerkmale: Bei deskriptiven Tatbestandsmerkmalen handelt<br />
es sich um lediglich beschreibende, natürliche Merkmale, die ohne eine juristische<br />
Wertung ausgefüllt werden können. Hier verwendet das Gesetz Begriffe der<br />
täglichen Umgangssprache. Beispiele sind etwa Sache, Töten, Mensch.<br />
Zur Annahme von Vorsatz seitens des Täters reicht es hier aus, wenn er den natürlichen<br />
Sinngehalt erfasst, also diejenigen Tatumstände kennt, die das abstrakte Tatbestandsmerkmal<br />
ausfüllen. Die Kenntnis aller Definitionsmerkmale ist nicht zu erwarten.<br />
Bsp.: T lässt die Luft aus den Reifen des Autos von O. Dabei glaubt er, mangels Substanzverletzung<br />
handele es sich hierbei nicht um eine Sachbeschädigung.<br />
Ein Vorsatzausschluss gem. § 16 ist hier nicht gegeben, da es genügt, wenn T den natürlichen<br />
Sinngehalt erfasst. Dafür genügt es, wenn er wie hier erkennt, dass er durch das Luftablassen<br />
den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Wagens beeinträchtigt (denn genau dies stellt eben<br />
ein „Beschädigen“ dar).<br />
b) Normative Tatbestandsmerkmale: Normative (=wertende) Tatbestandsmerkmale<br />
sind hingegen solche Merkmale, deren Bedeutung erst aufgrund einer rechtlichen<br />
Wertung klar wird. Beispiele sind etwa fremd, zueignen, Urkunde.<br />
Zur Annahme von Vorsatz seitens des Täters genügt hier die bloße Kenntnis der das<br />
Merkmal ausfüllenden Umstände nicht, vielmehr ist es erforderlich, dass der Täter<br />
den rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt des Tatumstandes laienmäßig erfasst (=<br />
Parallelwertung in der Laiensphäre).<br />
2
Vorlesungsbegleitende Arbeitsgemeinschaft im Strafrecht für das 1. Semester (WS 10/11)<br />
Wiss. Mit. Jürgen Telke<br />
Bsp.: T sitzt regelmäßig abends in einer Kneipe und trinkt dort stets einige Gläser Bier. Jede<br />
neue Bestellung vermerkt die Kellnerin wie üblich mit einem Strich auf T´s Bierdeckel. Eines Tages<br />
hat T nicht genug Geld dabei, will aber dennoch nicht auf sein Bier verzichten. Er reibt daher<br />
einige Striche auf dem Bierdeckel weg.<br />
In Betracht kommt hier eine Strafbarkeit wegen Urkundenfälschung gem. § 267. Dabei muss T<br />
auch Vorsatz hinsichtlich des objektiven Tatbestandsmerkmals „Urkunde“ aufweisen. Natürlich<br />
kann hier nicht verlangt werden, dass T um die Urkundeneigenschaft des Bierdeckels weiß. Es<br />
genügt zur Bejahung des Vorsatzes, dass er um die soziale Bedeutung des Deckels als Beweis<br />
und Grundlage für die spätere Rechnung weiß. Wenn T hier also einwendet, dass er nicht wusste,<br />
dass es sich um eine Urkunde handelt, führt das nicht zum Vorsatzausschluss gem. § 16.<br />
Gegenbsp.: Medizinstudent T kauft von seinem Kommilitonen O ein gebrauchtes Lehrbuch. Den<br />
Kaufpreis entrichtet er gleich nach Vertragsschluss. O weigert sich aber, das Buch sofort herauszugeben,<br />
da er es noch für eine Prüfungsvorbereitung nutzen möchte. Während eines unbeobachteten<br />
Momentes nimmt T das Buch eigenmächtig an sich. Dabei geht er davon aus, bereits<br />
mit Abschluss des Kaufvertrages Eigentümer über das Buch geworden zu sein, dass es<br />
sich bei dem Buch also bereits um sein Buch handele.<br />
In Betracht kommt hier eine Strafbarkeit wegen Diebstahls gem. § 242. Dabei muss T auch Vorsatz<br />
hinsichtlich des objektiven Tatbestandsmerkmals „fremd“ aufweisen. Bei der Parallelwertung<br />
in der Laiensphäre ist jedoch zu beachten, dass einem juristischen Laien die Kenntnis des<br />
Trennungs- und Abstraktionsprinzips regelmäßig nicht bewusst ist. Da auch T diesem Irrtum unterliegt,<br />
liegt hier ein vorsatzausschließender Irrtum gem. § 16 vor.<br />
Weitere Inhalte des Tatbestandes neben den objektiven Tatbestandsmerkmalen<br />
können sein:<br />
- qualifizierende objektive Merkmale (z.B. objektive Mordmerkmale; Merkmale<br />
des § 224)<br />
- privilegierende objektive Merkmale (z.B. das ausdrückliche, ernsthafte Verlangen<br />
des § 216)<br />
- die Rechtswidrigkeit, sofern sie nicht nur einen Hinweis auf das allgemeine<br />
Verbrechensmerkmal der Rechtswidrigkeit darstellt (z.B. in § 242)<br />
- Regelbeispiele (etwa § 243) gehören nicht zum gesetzlichen Tatbestand!<br />
Dennoch muss der Täter auch hier um die Erfüllung der objektiven Umstände<br />
wissen.<br />
b) Intensität des Vorsatzes<br />
Es bedarf hinsichtlich der Intensität des Vorsatzes kein die Tathandlung fortwährend<br />
begleitendes „Daran-Denken“ im Sinne eines voll reflektierten Bewusstseins. Vielmehr<br />
genügt ein aktuelles Bewusstsein der Tatumstände im Sinne eines sachgedanklichen<br />
Mitbewusstseins und eines ständig verfügbaren Begleitwissens.<br />
3
Vorlesungsbegleitende Arbeitsgemeinschaft im Strafrecht für das 1. Semester (WS 10/11)<br />
Wiss. Mit. Jürgen Telke<br />
3. Zeitpunkt des Vorsatzes<br />
Maßgebender Zeitpunkt für das Vorliegen des Tatbestandsvorsatzes ist gem. § 16<br />
„bei Begehung der Tat“. Dieses Koinzidenz- oder Simultanitätsprinzip bedeutet, dass<br />
der Täter bei Vornahme der tatbestandlichen Ausführungshandlung (etwa bei § 212<br />
das Zustechen, bei § 223 das Zuschlagen, bei § 242 das Wegnehmen) den Vorsatz<br />
aufweisen muss.<br />
Der nachträglich gefasste Vorsatz (dolus subsequens) schadet dem im Augenblick<br />
der Vornahme der tatbestandlichen Ausführungshandlung unwissenden Täter nicht.<br />
Ebenso begründet auch der vor der Tat gefasste grundsätzliche Entschluss zur Tatausführung<br />
(dolus antecedens) keine Vorsätzlichkeit, wenn diese nicht im unmittelbaren<br />
Moment der Ausführung vorliegt.<br />
Bsp.: T geht ins MAX und hat vor, an diesem Abend seinen Erzrivalen O mal „richtig zu vermöbeln“.<br />
An der Schlange zur Toilette dreht er sich so ruckartig um, dass er den unbemerkt hinter<br />
ihm stehenden O mit dem Ellbogen ins Gesicht trifft. Anschließend erkennt er den blutend am<br />
Boden liegenden O und freut sich nachträglich über seinen (zufälligen) Erfolg.<br />
Eine vorsätzliche Körperverletzung kommt hier nicht in Betracht, da T im Zeitpunkt<br />
der tatbestandlichen Ausführungshandlung (also des Zuschlagens) keinen Vorsatz<br />
aufwies. Daran ändert weder der vorher gefasst grundsätzliche Entschluss zu einer<br />
solchen Tat (dolus antecedens) noch die nachträgliche Erfassung und Billigung der<br />
Geschehnisse (dolus subsequens) nichts.<br />
Unbeachtlich ist es jedoch auch, wenn der Täter den bei Vornahme der tatbestandlichen<br />
Ausführungshandlung vorhandenen Vorsatz zwischen Abschluss der Tathandlung<br />
und Erfolgseintritt wieder aufgibt.<br />
Bsp.: T schickt O eine Briefbombe, um ihn zu töten, überlegt es sich während der Postlaufzeit<br />
aber noch einmal anders. Es gelingt ihm jedoch nicht mehr, die Zustellung des Briefes zu verhindern.<br />
O stirbt.<br />
Die tatbestandliche Ausführungshandlung war hier das Abschicken der Briefbombe.<br />
Zu diesem Zeitpunkt wies T den notwendigen Vorsatz hinsichtlich einer Tötung auf.<br />
Dass er diesen vor Eintritt des Erfolgs wieder aufgab, ist irrelevant.<br />
III. Arten des Vorsatzes<br />
Es werden drei Vorsatzarten unterschieden: Die Absicht im engeren Sinne (dolus<br />
directus 1. Grades), der direkte Vorsatz (dolus directus 2. Grades) und der Eventualvorsatz<br />
(dolus eventualis oder bedingter Vorsatz).<br />
1. Absicht (dolus directus 1. Grades)<br />
4
Vorlesungsbegleitende Arbeitsgemeinschaft im Strafrecht für das 1. Semester (WS 10/11)<br />
Wiss. Mit. Jürgen Telke<br />
Er liegt vor, wenn es dem Täter gerade darauf ankommt, das entsprechende Tatbestandsmerkmal<br />
zu erfüllen. Dabei ist es irrelevant, ob die Verwirklichung des Tatbestandes<br />
das vom Täter erstrebte Endziel ist, oder nur ein notwendiger Zwischenschritt<br />
auf dem Weg zum Endziel.<br />
Die Absicht ist dadurch charakterisiert, dass sie einerseits ein absolut dominantes<br />
voluntatives Element enthält, der Täter die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals also<br />
als End- oder notwendiges Zwischenziel anstrebt. Andererseits weist die Absicht ein<br />
verkümmertes kognitives Element auf; hier ist es ohne Bedeutung, ob er sich die<br />
Verwirklichung als sicher oder nur als möglich vorgestellt hat. Notwendig ist lediglich,<br />
dass er sich überhaupt eine Einwirkungsmöglichkeit auf das Geschehen zuschreibt.<br />
Die Absicht als Vorsatzform darf nicht verwechselt werden mit den bereits angesprochenen<br />
besonderen Absichten (Zueignungs“absicht“ in § 242). Zwar sind hier die<br />
inhaltlichen Anforderungen identisch, jedoch sind sie eigenständig neben dem eigentlichen<br />
Tatbestandsvorsatz zu prüfen.<br />
Ob ein Tatbestand dolus directus 1. grades fordert, ist regelmäßig durch Auslegung<br />
zu ermitteln. Oftmals benutzt das Gesetz in den einzelnen Normen auch Formulierungen<br />
wie „in der Absicht“, oder „um zu“. Dies ist natürlich ein starkes Indiz für die<br />
Notwendigkeit des dolus directus 1. Grades, jedoch noch keine definitive Aussage.<br />
2. Direkter Vorsatz (dolus directus 2. Grades)<br />
Im Fall des dolus directus 2. Grades ist das Verhältnis zwischen voluntativem und<br />
kognitivem Element genau umgekehrt zu dem bei dolus directus 1. Grades. Hier dominiert<br />
das kognitive Element, der Täter weiß oder setzt es als sicher voraus, dass er<br />
das jeweilige Tatbestandsmerkmal erfüllt. Anforderungen an die voluntative Komponente<br />
sind dem entgegen nicht zu stellen, da von deren Vorliegen ohne weiteres<br />
ausgegangen werden kann. Denn ein Täter, der handelt, obwohl er den Eintritt des<br />
Erfolges als sicher voraussieht, nimmt diesen Erfolg zwangsläufig auch in seinen<br />
Verwirklichungswillen auf, wie unerwünscht er ihm an sich auch sein mag.<br />
Auch hinsichtlich der Frage, wann ein Tatbestand dolus directus 2. Grades fordert, ist<br />
auf die einzelfallbedingte Auslegung zu verweisen. Formulierungen des Gesetzgebers<br />
wie „wissentlich“ oder „wider besseres Wissen“ deuten jeweils ebenfalls auf diese<br />
Vorsatzform hin.<br />
3. Eventualvorsatz (dolus eventualis)<br />
Der Eventualvorsatz stellt die schwächste Form des Vorsatzes dar, da hier weder<br />
das voluntative noch das kognitive Element besonders stark ausgebildet ist. Mindest-<br />
5
Vorlesungsbegleitende Arbeitsgemeinschaft im Strafrecht für das 1. Semester (WS 10/11)<br />
Wiss. Mit. Jürgen Telke<br />
voraussetzung für die Annahme von Eventualvorsatz ist ein kognitives Moment in der<br />
Form, dass der Täter die Verwirklichung des Tatbestandsmerkmals für möglich hält<br />
und trotzdem handelt. Außerhalb dieses kleinsten gemeinsamen Nenners sind die<br />
genauen Voraussetzungen dieser Vorsatzart im Einzelnen höchst umstritten; insbesondere<br />
ist fraglich, ob der Eventualvorsatz ebenfalls ein voluntatives Element enthalten<br />
muss. Dieser Streit liegt begründet in der Notwendigkeit, den Eventualvorsatz<br />
von der bewussten Fahrlässigkeit (sog. luxuria) abzugrenzen. Denn auch bewusste<br />
Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Täter die Verwirklichung des Tatbestandmerkmals<br />
für möglich hält, der Unterschied zum Eventualvorsatz liegt lediglich darin, dass er<br />
dort die Folgen hinnimmt, bei der bewussten Fahrlässigkeit hingegen auf das Ausbleiben<br />
des Erfolges vertraut. Aufgrund der unterschiedlich hohen Strafdrohung von<br />
Vorsatz- und Fahrlässigkeitsdelikten sowie der überhaupt nur fragmentarisch gegebenen<br />
Strafbarkeit von Fahrlässigkeitsdelikten ist diese Abgrenzung von großer Relevanz.<br />
Zum Streitstand im Einzelnen siehe die Darstellung „Der Streit um den<br />
dolus eventualis“.<br />
Wenn sich aus dem Wortlaut des Gesetzes oder aus der einzelfallbedingten Auslegung<br />
nichts gegenteiliges ergibt, genügt zur Bejahung des subjektiven Tatbestandes<br />
stets das Vorliegen des Eventualvorsatzes, das Vorliegen der anderen beiden, stärkeren<br />
Vorsatzarten schadet jedoch natürlich nicht.<br />
4. Sonderformen des Vorsatzes<br />
Außer den soeben dargestellten Vorsatzarten tauchen in der Literatur noch weitere<br />
doli auf, auf deren detaillierte Darstellung hier jedoch verzichtet wird. Zu nennen sind<br />
hier außer den bereits thematisierten Formen des dolus subsequens und dolus antecedens<br />
einerseits der dolus alternativus und der dolus cumulativus 1 , andererseits der<br />
dolus generalis.<br />
1 Zu dolus alternativus und cumulativus siehe Wessels/Beulke <strong>AT</strong>, Rn. 231 ff.<br />
6