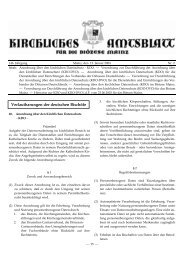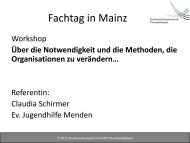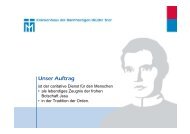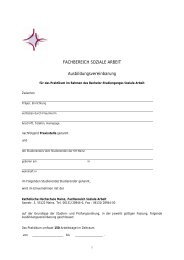forum Aktuell - Katholische Hochschule Mainz
forum Aktuell - Katholische Hochschule Mainz
forum Aktuell - Katholische Hochschule Mainz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 16 Dezember 2011<br />
Symposium „Für eine neue Solidarität!?”<br />
Stichworte aus der Jubiläumsveranstaltung der Hochschulgesellschaft <strong>forum</strong> sociale<br />
„Für eine neue Solidarität!?” war das Thema des Symposiums,<br />
zu dem unsere Hochschulgesellschaft <strong>forum</strong> sociale<br />
<strong>Mainz</strong> e.V. und das <strong>Katholische</strong> Büro <strong>Mainz</strong> aus Anlass des<br />
fünfundzwanzigjährigen Bestehens von <strong>forum</strong> sociale und<br />
des 200. Geburtstags des <strong>Mainz</strong>er Sozialbischofs Wilhelm<br />
Emanuel Freiherr von Ketteler (1811–1877) am 21. Oktober<br />
2011 in die <strong>Katholische</strong> Fachhochschule <strong>Mainz</strong> eingeladen<br />
hatten. Die Schirmherrschaft hatte für die Bischöfe der<br />
rheinland-pfälzischen Diözesen Bischof Dr. Stephan Ackermann<br />
von Trier übernommen.<br />
Das Symposium stieß auf breites Interesse. Der Einladung<br />
waren ca. 120 Personen gefolgt: Mitglieder der im<br />
rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Fraktionen mit<br />
Vizepräsident Heinz-Hermann Schnabel, Vertreter der Landesministerien,<br />
staatlicher Dienststellen und Institutionen,<br />
öffentlicher und kirchlicher Verbände, Lehrende und Studierende<br />
der <strong>Katholische</strong>n Fachhochschule sowie nicht zuletzt<br />
Mitglieder von <strong>forum</strong> sociale.<br />
Die Diskutanten im Podium<br />
Dank der Unterstützung durch den Leiter des <strong>Katholische</strong>n<br />
Büro <strong>Mainz</strong>, Ordinariatsdirektor Bernhard Nacke, waren als<br />
Diskutanten im Podium Persönlichkeiten aus unterschiedlichen<br />
gesellschaftlichen Verantwortungsbereichen und wissenschaftlichen<br />
Disziplinen gewonnen worden:<br />
Marcus Bocklet (MdL, Sprecher der Fraktion Bündnis 90/<br />
Die Grünen im Hessischen Landtag für Armutsbekämpfung,<br />
Arbeitsförderung, Familie, Kinder und Jugend), Lars Martin<br />
Klieve (Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Essen),<br />
Dr. Gerhard Kruip (Professor für christliche Anthropologie<br />
und Sozialethik an der Universität <strong>Mainz</strong>), Dr. Stefan Sell<br />
(Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften<br />
an der Fachhochschule Koblenz), Dr. Norbert<br />
Walter (Professor em. am Institut für Weltwirtschaft<br />
Kiel und langjähriger Chefvolkswirt der Deutschen Bank).<br />
Die Moderation hatte Dr. Ulrich Sarcinelli (Professor für Politikwissenschaft<br />
und Vizepräsident der Universität Koblenz-<br />
Landau) übernommen.<br />
Mit diesem Symposium, so erklärte der Vorsitzende Prof.<br />
Dr. Hans Zeimentz, stelle sich die Hochschulgesellschaft<br />
<strong>forum</strong> sociale ihrem Gründungsauftrag. Danach sollte sie<br />
die <strong>Katholische</strong> Fachhochschule nicht nur im Sinne einer<br />
Sponsorenvereinigung fördern. Vielmehr sollte sie sich<br />
als Forum des offenen Diskurses auch aktiv in den gesellschaftspolitischen<br />
Dialog einschalten und die verschiedenen<br />
Meinungs- und Handlungsträger mit den Mitgliedern und<br />
der Fachhochschule zusammenführen. Mit diesem Symposium<br />
wolle <strong>forum</strong> sociale einen Beitrag zu einer notwendigen<br />
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung leisten.<br />
v. l. L. M. Klieve, S. Sell, N. Walter, U. Sarcinelli, M. Bocklet, G. Kruip<br />
v.l. Landtagsvizepräsident H.-H. Schnabel, B. Nacke, H. Zeimentz, P. Orth<br />
Der Rektor der <strong>Katholische</strong>n Fachhochschule, Professor Peter<br />
Orth, dankte <strong>forum</strong> sociale für die in fünfundzwanzig<br />
Jahren der Fachhochschule geleistete ideelle und materielle<br />
Unterstützung. Mit dem Hinweis auf „die soziale Schieflage”<br />
in unserer Gesellschaft sprach er einen zentralen Tatbestand<br />
für die Forderung nach einer neuen Solidarität an.<br />
Solidariät:<br />
eine drängende gesellschaftliche Herausforderung<br />
Einführend zeichnete Ordinariatsdirektor Bernhard Nacke<br />
ein Tableau der Problemlage. Er wies auf die mit den Stichworten<br />
wie Pflegeentwicklung, Integration, Bildungsfragen<br />
oder europäische Sozialpolitik verbundenen Problemfelder<br />
hin. Er konzentrierte sich aber anhand vielfältiger Belege auf<br />
den Aufweis, dass in den letzten Jahrzehnten in Deutschland<br />
Wohlstand und Armut zunehmend auseinanderklaffen. Das<br />
Risiko, in Armut zu fallen und darin gefangen zu bleiben,<br />
ist stetig größer geworden. Andererseits ist die Zahl der<br />
Einkommensmillionäre von unter 10.000 im Jahre 2004 auf<br />
fast 17.000 im Jahre 2007 gestiegen. Mit kompetenten Zeitkritikern,<br />
die eine Destabilisierung der Gesellschaft konstatieren,<br />
forderte er die Aktivierung umfassender Solidarität<br />
in allen Lebensbereichen. In diesem Sinne plädierte er für<br />
eine grundlegende Überprüfung unserer Sozialsystems auf<br />
Unausgeglichenheiten und Widersprüche.<br />
(Fortsetzung auf Seite 2)
„Für eine neue Solidarität!?" (Fortsetzung von Seite 1)<br />
Zum Verständnis von Solidarität<br />
Der Moderator eröffnete die Diskussion mit der Frage nach<br />
dem Verständnis von Solidarität. Die Antworten der Diskutanten<br />
zeigten unterschiedliche Zugänge: Von ihren<br />
Wirkweisen wurde Solidarität bestimmt als Kitt, der Gesellschaften<br />
auf allen Ebenen zusammenhalte. Sie gelte den<br />
schwächeren Gesellschaftsgliedern, fordere gleichzeitig<br />
aber auch deren Aktivität (Klieve); Solidarität solle Teilhabe<br />
und Entwicklung ermöglichen (Walter); Solidarität<br />
sei das Gegenteil von Egoismus; sie sei nicht naturgeben,<br />
sondern müsse entwickelt, organisiert werden (Bocklet);<br />
Solidarität sei nicht selbstverständlich, sondern jeweils begründungspflichtig<br />
(Sell). Nach der zugrundeliegenden Motivation<br />
unterschied Kruip in Analogie zu den Stufen der<br />
moralischen Entwicklung nach L. Kohlberg drei Formen der<br />
Solidarität: Die in Gemeinschaften erlebte und praktizierte<br />
Solidarität, die aus Eigeninteresse geübte Solidarität und<br />
die aus moralischer Motivation, aus Achtung vor der Würde<br />
des Schwachen und Hilfsbedürftigen, gelebte Solidarität. Er<br />
warnte davor, aus Eigeninteresse geübte Solidarität zu diskreditieren.<br />
Soweit sie sich nicht über die Rechte anderer<br />
hinwegsetzte, in Fairness praktiziert werde, sei sie durchaus<br />
legitim. Im Rahmen sozialer Sicherungssysteme könne<br />
sie sogar hilfreich sein.<br />
Solidarität am Wendepunkt?<br />
Ändern sich die Räume, in denen Solidarität gelebt und vermittelt<br />
werden kann? Führen Individualisierung und Flexibilität<br />
in unserer Gesellschaft zu einer Erosion der Solidarität? Auf<br />
welche Ressourcen kann Solidarität sich stützen? Diese und<br />
ähnliche Fragen bestimmten eine weitere Diskussionsrunde.<br />
In dem Zwiespalt zwischen Freiheit und Sicherheit sei, so<br />
wurde betont, der in der modernen Gesellschaft gegebene<br />
Freiheitsraum als Gewinn zu werten (Kruip; Sell).<br />
Kruip führte Bischof Ketteler als Beispiel dafür an, wie veränderte<br />
gesellschaftliche Situationen neue Formen der Solidarität<br />
bedingen. Ketteler habe zunächst zur Lösung der<br />
sozialen Frage auf Caritas, geübte christliche Nächstenliebe<br />
gesetzt, bis er aufgrund der Analyse der Situation zur Forderung<br />
staatlicher Sozialpolitik gefunden habe.<br />
Sell wies darauf hin, dass Systeme der Solidarität sich<br />
im 19. Jahrhundert kleinräumig entwickelt hätten, diese<br />
aber heute nicht mehr tragfähig seien und durch<br />
großräumige Strukturen abgelöst würden. Dabei zeige<br />
ich, wie er am Beispiel des Pflege-TÜVs verdeutlichte,<br />
dass die erstrebte Sicherheit nur durch solidarisches<br />
Handeln des Nahbereichs gewährleistet werden könne.<br />
Walter vermerkte, dass der Familie in Politik und Gesellschaft<br />
weithin nicht der Rang eingeräumt werde, der ihr<br />
gebührt. Gegen ihre eigene Intention führe Emanzipation<br />
nicht zu mehr Freiheit, sondern zu einer „Welt von Ichlingen”,<br />
zu Vereinzelung und Einsamkeit. Unser Wohnungswesen<br />
schließe weitgehend aus, das drei Generationen<br />
zusammen in einer Familie leben. Damit fehle der heranwachsenden<br />
Generation die erlebte Solidarität der Älteren<br />
und mit den Älteren. Er fragte weiter, wie in der Schule<br />
Solidarität erlernt werden solle, wenn sie nicht in der Familie<br />
– mit mehreren Kindern - erlebt und selbstverständlich<br />
praktiziert werde. Überdies fehle unserer Gesellschaft die<br />
notwendige Dankkultur für diejenigen, die selbstverständlich<br />
ihren Pflichten gegenüber der Gesellschaft nachkommen.<br />
Walter wies nachdrücklich darauf hin, dass heutige<br />
Arbeitsstrukturen es in einem weiter höheren Maße als<br />
vielfach angenommen ermöglichen, Familie und Beruf in<br />
Einklang zu bringen. Hier sei von Arbeitgeber wie Arbeitnehmer<br />
Phantasie gefordert. Dazu aber sei, machte Bocklet<br />
geltend, ein Maß sozialer Sicherheit gefordert, das Leiharbeitsverhältnisse<br />
oder Kurzeitverträge nicht bieten.<br />
Klieve betonte die Wirksamkeit des christlichen Gebots der<br />
Nächstenliebe auch für die Entwicklung von Strukturen der<br />
Solidarität. Doch könne zwischenmenschliche Solidarität<br />
nicht allein durch Strukturen und Organisationen gewährleistet<br />
werde. Es bedürfe überzeugender Vorbilder, die Familie<br />
sei in diesem Kontext auch heute noch ein wichtiger<br />
Ort praktizierter Solidarität.<br />
Kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem<br />
Walter erläuterte die mit dem demografischen Wandel noch<br />
unzureichend bedachten Fragen der Betreuung alter und<br />
kranker Menschen. Hier müsse sich Deutschland mehr als<br />
bisher als ein für Fremde attraktives Land erweisen.<br />
Im Hinblick auf die ungelösten Probleme der Sozial- und<br />
Bildungspolitik machten Bocklet und Sell geltend, es bestehe<br />
hier kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.<br />
Es zeichne sich in unserer Gesellschaft eine<br />
„Exklusion der Reichen und Schönen” ab. Es mangele der<br />
Politik an Entscheidungskraft, die notwendigen finanz- und<br />
steuerpolitischen Fragen anzugehen. Hier bedürfe es eines<br />
breiten gesellschaftlichen Diskurses. Höhere Steuern seien<br />
unumgänglich – und in früheren Jahrzehnten, etwa nach<br />
dem Lastenausgleichgesetz, auch erhoben worden. Aus<br />
der Sicht des Stadtkämmerers sah auch Klieve entsprechenden<br />
Handlungsbedarf, zumal ein weiteres Anwachsen<br />
der öffentlichen Schuldenlast nicht vertretbar sei.<br />
Ausklang bei Gesprächen und Musik<br />
Die Diskussion lieferte hinreichend Anregungen zu anschließenden<br />
Gesprächen in kleinen Runden bei Imbiss und<br />
Wein. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Gruppe<br />
JazzThing unter Leitung von Professor Andreas Büsch.<br />
Dank – und wie geht’s weiter?<br />
Für die – nach allen bisher bekannten Stimmen – anregende<br />
und bereichernde Veranstaltung gebührt allen Beteiligten<br />
aufrichtiger Dank. In diesen Dank sei eingeschlossen<br />
auch die Vorbereitungsgruppe, der unter Leitung von Bernhard<br />
Nacke Dr. Elke Bruck, Clemens Frenzel-Göth, Wilfried<br />
H. Mönch und Prof. Hans Zeimentz angehörten. Für die Organisation<br />
ist Prof. Andreas Büsch mit seinen studentischen<br />
Helferinnen und Helfern und Dr. Elke Bruck, für die bewährte<br />
Kooperation dem Vorstand des SKFH zu danken. Die Veranstaltung<br />
wurde durch Zuwendungen der Wilhelm-Emanuel<br />
von Ketteler-Stiftung <strong>Mainz</strong> und der Pax-Bank-Stiftung Köln<br />
unterstützt. Dafür ein aufrichtiges „Danke”.<br />
Wie geht΄s weiter: Mehrfacher Anregung folgend, hat der<br />
Vorstand die bisherige Arbeitsgruppe gebeten, eine Folgeveranstaltung<br />
möglichst in 2012 zu konzipieren.<br />
Elke Bruck / Hans Zeimentz
KFH <strong>Mainz</strong> unter neuem Namen:<br />
<strong>Katholische</strong> <strong>Hochschule</strong> <strong>Mainz</strong><br />
Mit dem 1. Januar 2012 hat die <strong>Katholische</strong> Fachhochschule<br />
<strong>Mainz</strong> ihren Namen in <strong>Katholische</strong> <strong>Hochschule</strong> <strong>Mainz</strong><br />
(KH <strong>Mainz</strong>) geändert. Im Zuge des Bologna-Prozesses, der<br />
mit einer Annäherung zwischen Fachhochschulen und <strong>Hochschule</strong>n/Universitäten<br />
verbunden ist, haben viele Fachhochschulen,<br />
darunter die meisten kirchlichen Fachhochschulen,<br />
bereits ihren Namen in <strong>Hochschule</strong> geändert. Dazu trägt<br />
auch der Umstand bei, dass im internationalen Kontext die<br />
Bezeichnung „Fachhochschule″ weithin unbekannt ist und<br />
immer wieder erläutert werden muss.<br />
Neue Webseite und E-Mail-Anschrift lauten:<br />
www.kh-mz.de / e-mail@kh-mz.de<br />
Die bisherigen Seiten und Anschriften werden weiter bedient.<br />
* * *<br />
Bundeszentrale Förderung von Medienkompetenz<br />
an der KH <strong>Mainz</strong><br />
Zum 1. Januar 2012 wird die Clearingstelle Medienkompetenz<br />
der Deutschen Bischofskonferenz an der KH <strong>Mainz</strong><br />
unter Leitung von Prof. Andreas Büsch eröffnet. Die Bischofskonferenz<br />
hat sich nach entsprechenden Beratungen<br />
in der Publizistischen Kommission zu diesem auf drei Jahre<br />
angelegten Projekt entschlossen, um die Wahrnehmung katholischer<br />
Aktivitäten im Bereich Medienpädagogik zu bündeln<br />
und stärker als bisher nach außen sichtbar zu machen.<br />
Zugleich wird damit eine Selbstverpflichtung eingelöst aus<br />
der im Juli 2011 veröffentlichten Schrift „Virtualität und<br />
Inszenierung. Unterwegs in der digitalen Mediengesellschaft″<br />
(Die deutschen Bischöfe. Erklärungen der Kommissionen,<br />
Nr. 35).<br />
* * *<br />
Erste Bachelor-Studienabschlüsse<br />
An der KFH <strong>Mainz</strong> haben Studierende im Fachbereich Soziale<br />
Arbeit erstmals zum Ende des Wintersemesters 2010/11,<br />
im Fachbereich Praktische Theologie erstmals zum Ende des<br />
Sommersemesters 2011 ihr Studium mit dem akademischen<br />
Grad Bachelor of Arts (B.A.) abgeschlossen. Im Fachbereich<br />
Gesundheit und Pflege stehen die ersten Bachelor-Abschlüsse<br />
im Jahr 2012 an; hier wird der akademische Grad Bachelor<br />
of Science (B.Sc.) lauten. In allen Fachbereichen sind die<br />
Diplomstudiengänge inzwischen ausgelaufen.<br />
* * *<br />
Master-Studiengang im FB Soziale Arbeit<br />
eröffnet<br />
Im Sommersemester 2011 wurde an der KFH <strong>Mainz</strong> der neue<br />
Masterstudiengang „Soziale Arbeit – Beratung und Steuerung″<br />
(vgl. <strong>forum</strong> <strong>Aktuell</strong> 15. 2010, S. 2) mit 27 Studierenden<br />
eröffnet. Er führt als Präsenz- und Vollzeitstudium in drei<br />
Semestern zum akademischen Grad Master of Arts (M.A.).<br />
Zugangsvoraussetzung ist der Abschluss des Bachelor-Studiengangs<br />
Soziale Arbeit mit einem Notendurchschnitt von<br />
mindestens 2,3. Bewerbungen sind jeweils zum Sommersemester<br />
möglich. Studiengebühren werden nicht erhoben.<br />
Informationen unter<br />
www.kfh-mainz.de/fachbereiche/FB_SA/ma/sa_ma.htm<br />
Über 1.000 Studierende an der KFH<br />
Im Wintersemester 2011/12 zählt die KFH <strong>Mainz</strong> 1.055<br />
Studierende, die sich wie folgt auf die Fachbereiche aufteilen:<br />
Soziale Arbeit B.A. 442 Soziale Arbeit M.A. 27<br />
Praktische Theologie 82 Gesundheit & Pflege 504<br />
* * *<br />
Community <strong>Katholische</strong> Fachhochschule<br />
<strong>Mainz</strong> auf dem Sozialen Netzwerk Xing<br />
Wir berichteten in den letzten Jahren mehrfach über Überlegungen<br />
von <strong>forum</strong> sociale und KFH, im Internetportal der<br />
KFH einen internen Kommunikationsbereich für die Mitglieder<br />
von <strong>forum</strong> sociale einzurichten. Vorbild waren die in<br />
den Internetportalen der meisten deutschen <strong>Hochschule</strong>n<br />
eingerichteten Alumnibereiche, die nur den Mitgliedern zugänglich<br />
sind. Da das Vorhaben sich mit der Software der<br />
KFH nicht verwirklichen lässt, wurde nun – dank der Anregung<br />
und des Engagements unseres Beiratsmitglieds Andreas<br />
Görner – eine andere Kommunikationsmöglichkeit geschaffen:<br />
die Community <strong>Katholische</strong> Fachhochschule <strong>Mainz</strong><br />
auf dem Sozialen Netzwerk Xing. Die Community wurde im<br />
Februar 2011 eingerichtet. Sie zählt heute (Dez. 2011) 75<br />
Mitglieder. Um der Community eine breitere Basis zu geben<br />
und sie allen zu öffnen, die sich durch Studium, Beruf oder<br />
als Förderer mit der KFH verbunden wissen, wurde sie unter<br />
dem eben genannten Namen und nicht, wie zunächst<br />
beabsichtigt, unter dem Namen Community <strong>forum</strong> sociale<br />
eingerichtet. Andreas Görner hat dankenswerterweise die<br />
Aufgabe des Moderators der Community übernommen. Der<br />
Vorstand von <strong>forum</strong> sociale würde es sehr begrüßen, wenn<br />
möglichst viele Mitglieder sich zu einem Beitritt zur Community<br />
entschließen wollten. Auch eine kostenfreie Mitgliedschaft<br />
ist möglich. Nur durch den Beitritt vieler und deren<br />
Bereitschaft, Mitteilungen oder Beiträge einzustellen, kann<br />
eine lebendige Kommunikationsgemeinschaft entstehen.<br />
Der einfachste Weg zu Xing: Geben Sie unter Google Xing<br />
ein. Dann finden Sie verschiedene Links, die Ihnen den Weg<br />
zur Mitgliedschaft anzeigen. Wenn Sie sich zur Mitgliedschaft<br />
entschließen, geben Sie bitte unter den Organisationen, denen<br />
Sie angehören, <strong>forum</strong> sociale an.<br />
* * *<br />
Förderpreis <strong>forum</strong> sociale für<br />
Bachelor-Arbeiten ausgeschrieben<br />
Der mit 2.000 Euro dotierte Förderpreis der Hochschulgesellschaft<br />
<strong>forum</strong> sociale ist zum ersten Mal für Bachelor-Arbeiten<br />
ausgeschrieben, „die sich besonders durch die Qualität<br />
ihres Inhalts und ihrer Darstellung auszeichnen″. Bewerben<br />
können sich Absolventen/innen der <strong>Katholische</strong>n Fachhochschule<br />
<strong>Mainz</strong>, die ihr Studium in der Zeit vom 1. Januar 2011<br />
bis 31. Dezember 2012 mit dem Bachelorabschluss beendet<br />
haben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Dezember 2012.<br />
Die Ordnung für die Vergabe des Preises ist im Rektorat der<br />
KFH erhältlich; sie ist auch im Internet zugänglich unter<br />
www.kfh-mainz.de/wir-ueber-uns/foerderpreis.htm<br />
Die Bewerbungsfrist für die letzte Vergabe des Preises für<br />
Diplomarbeiten ist am 31. Dezember 2011 abgelaufen.<br />
In zukünftigen Verfahren können Absolventen/innen der<br />
Bachelor- wie der Master-Studiengänge sich mit ihren<br />
Arbeiten um den Preis bewerben.
Renate Stemmer / Eva Quack<br />
Fachbereichsübergreifende Demenzforschung<br />
Angesichts der demografischen Entwicklung ist das Thema<br />
‚Versorgung von Menschen mit einer Demenzerkrankung’<br />
auch in den Fachbereichen Gesundheit und Pflege der KH<br />
<strong>Mainz</strong> in Lehre und Forschung sehr präsent. Es werden<br />
mehrere Forschungsprojekte zu dieser Thematik durchgeführt.<br />
Eines dieser Projekte trägt den etwas sperrigen Titel<br />
„Angehörige aktivieren alltagspraktisch und externe Personen<br />
aktivieren kognitiv‟ (ANAA und KO).<br />
Nach aktuellen Studien leben derzeit ca. 60 Prozent der<br />
rund 1,2 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung<br />
zu Hause und werden dort von ihren Angehörigen betreut.<br />
Durch den allmählichen Verlust der alltagspraktischen und<br />
kognitiven Fähigkeiten der demenzerkrankten Person sind<br />
häufig vermehrt die Defizite und nicht die Ressourcen im<br />
Blick der Angehörigen. Diese übernehmen daher immer<br />
mehr alltägliche Aktivitäten für die erkrankte Person. Auch<br />
kognitive Kompetenzen der erkrankten Person werden<br />
häufig nicht mehr ausreichend gefördert. Diese Verhaltensweisen<br />
sind verständlich, tragen aber zum Verlust von<br />
Autonomie und damit zur Minderung von Lebensqualität<br />
bei der erkrankten Person bei. Pflegende Angehörige selbst<br />
fühlen sich oft allein gelassen und erleben die Betreuung<br />
als eine hohe Belastung.<br />
ANAA+KO setzt hier an. Ziel<br />
dieses Forschungsprojektes ist<br />
es, Vorgehensweisen zur Aktivierung<br />
von Menschen mit einer<br />
Demenzerkrankung, die zu<br />
Hause leben, zu erproben und<br />
zugleich die betreuenden Angehörigen zu entlasten. Es gibt<br />
zwar bereits in diesem Kontext eine Vielzahl von Konzepten,<br />
aber diese sind in ihrer Wirksamkeit nur unzureichend<br />
untersucht.<br />
Das Forschungsvorhaben geht von der Annahme aus,<br />
dass eine regelmäßige Aktivierung der alltagspraktischen<br />
und kognitiven Kompetenzen dazu führt, dass an Demenz<br />
erkrankte Personen länger in der Lage sind, zumindest<br />
Teilaspekte ihres Lebens weitgehend eigenständig und<br />
mit mehr Lebensqualität zu gestalten. Das primäre Untersuchungsziel<br />
ist daher der Nachweis der Wirksamkeit einer<br />
alltagspraktischen und kognitiven Aktivierung auf die<br />
Aktivitäten des täglichen Lebens und die kognitiven Fähigkeiten<br />
von Menschen mit Demenz. An sechs Tagen in<br />
der Woche wird die alltagspraktische Aktivierung (jeweils<br />
60 Minuten) durch Angehörige auf der Grundlage eines individuellen<br />
und manualisierten Aktivierungsplanes durchgeführt.<br />
Die kognitive Aktivierung findet an einem Tag<br />
in der Woche (jeweils 30 Minuten) durch eine geschulte<br />
Projektmitarbeiterin statt. Die Angehörigen erhalten zudem<br />
kontinuierliche, begleitende Schulung und kleinteilige<br />
Beratung durch Gesundheits- und Krankenpfleger/innen<br />
bzw. Altenpfleger/innen. So kommt es in diesem Projekt<br />
zu einer gezielten Vernetzung der Kompetenzen der professionell<br />
Pflegenden und der betreuenden Angehörigen.<br />
Zur Sicherung des Effektivitätsnachweises gibt es neben<br />
der Interventionsgruppe auch eine Kontrollgruppe, die<br />
keine spezifische Aktivierung erhält. Der Wirkungsnachweis<br />
erfolgt im Rahmen einer multizentrischen, randomisiert-kontrollierten<br />
Verlaufsuntersuchung. Bei den in<br />
die Studie eingeschlossenen Personen liegt eine leichte<br />
bis mittlere degenerative Demenzerkrankung vor. Diese<br />
Eingrenzung wurde vorgenommen, da das Ansprechen<br />
nichtmedikamentöser Therapieverfahren bei Personen mit<br />
leichter bis mittelschwerer Demenz wahrscheinlicher ist.<br />
Zur Messung der Studienergebnisse werden validierte Messinstrumente<br />
eingesetzt. Die primäre Ergebnismessung erfolgt<br />
bei den an Demenz erkrankten Personen in den Bereichen<br />
Kognition und Funktionsfähigkeit. Die Wirkung der<br />
Maßnahmen wird bei den Angehörigen in den Bereichen<br />
Lebensqualität und Belastung gemessen. Es wird erwartet,<br />
dass alltagspraktische und kognitive Fähigkeiten in der Interventionsgruppe<br />
im Durchschnitt länger konstant bleiben,<br />
während diese in einer nicht spezifisch aktivierten Kontrollgruppe<br />
weiter nachlassen. Weiterhin wird angenommen,<br />
dass sich das Ausmaß an Pflegebedürftigkeit bei den aktivierten<br />
Teilnehmer/innen der Studie günstiger entwickelt.<br />
Wenn sich diese Annahme bestätigt, hat dies konkrete<br />
Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen mit einer<br />
Demenzerkrankung im häuslichen Setting, da sie durch<br />
den Erhalt alltagspraktischer Fähigkeiten ein höheres Maß<br />
an Autonomie im Alltag bewahren können.<br />
Das Projekt ANAA+KO wird in Kooperation mit zahlreichen<br />
Projektpartnern u.a. ambulanten Pflegediensten, Demenzinitiativen<br />
und der Gedächtnisambulanz der Universitätsmedizin<br />
<strong>Mainz</strong> durchgeführt. Es ist im Mai 2009 gestartet und<br />
wird Ende September 2012 beendet sein. Im Rahmen der<br />
Durchführung dieses Projektes haben Studierende Gelegenheit<br />
z.B. im Rahmen von Praktika oder durch studentische<br />
Mitarbeit Erfahrungen in einem Forschungsprojekt zu sammeln<br />
oder Bachelorarbeiten zu Teilfragestellungen zu verfassen.<br />
Die Durchführung dieses Projekts ist ein gelungenes<br />
Beispiel für fachbereichsübergreifende Kooperation. Renate<br />
Stemmer (FB Gesundheit und Pflege) und Martin Schmid<br />
(Fachbereich Soziale Arbeit) haben gemeinsam die Projektleitung<br />
inne. Es ist ebenfalls ein Beispiel für erfolgreiche<br />
Alumniarbeit, denn mit Eva Quack ist eine Absolventin der<br />
KH <strong>Mainz</strong> federführend für die Projektumsetzung zuständig.<br />
Sie wird von Veronika Enders, die ihrerseits in einem weiteren<br />
fachbereichsübergreifende Demenzforschungsprojekt<br />
maßgeblich die Umsetzung gestaltet, unterstützt.<br />
ANAA+KO wird vom BM für Bildung und Forschung mit<br />
einem Drittmittelvolumen von ca. 320.000 Euro gefördert.<br />
Dr. Renate Stemmer ist Professorin für Pflegewissenschaft und Pflegemanagement im FB Gesundheit und Pflege der KFH;<br />
Dipl.-Pflegepädagogin (FH) Eva Quack ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt ANAA+KO.
Petra Tietjen / Theresa Bausch / Wolfgang Feuerhelm<br />
SofiT – Sofort im Team<br />
Ein Projekt zwischen Jugendarrest, Wohngemeinschaft<br />
für Demenzkranke und Fachhochschule ¹<br />
1. Die Idee zu SofiT<br />
Das Projekt „SofiT‟ befasst sich mit der Praxis des Jugendarrestes.<br />
Trotz bereits seit Jahren vorgetragener<br />
Kritik an der bis zu vier Wochen dauernden Einschließung<br />
von verurteilten Jugendlichen und Heranwachsenden²<br />
setzt die Jugendstrafrechtspraxis nahezu konstant<br />
auf diese Sanktion.³ Die Anstöße zur Veränderung des<br />
Vollzugs des Jugendarrests und damit zu SofiT gehen<br />
zurück auf den rheinland-pfälzischen Jugendgerichtstag<br />
2010.<br />
Grundgedanke war hierbei die Suche nach Tätigkeiten<br />
bzw. Erlebnissen, in denen die Arrestanten Wertschätzung<br />
erfahren können. Das Projekt folgt der These, dass<br />
die Insassen bislang häufig Situationen erlebt haben, in<br />
denen ihr Tun als negativ oder auffällig bewertet wurde.<br />
Dem will das Projekt ein – wenn auch kurzes – positives<br />
Erlebnis entgegen setzen. Dieser Ansatz verbindet sich<br />
mit der Hoffnung, dass dem Arrestanten bei seiner Tätigkeit<br />
bewusst wird, dass er Stärken und Ressourcen<br />
besitzt.<br />
2. Kooperationspartner und Ziele<br />
Der Rahmen von SofiT wird von drei Kooperationspartnern<br />
gebildet. Konkret geht es dabei um den Studiengang Soziale<br />
Arbeit der <strong>Katholische</strong>n Fachhochschule <strong>Mainz</strong>, die Jugendarrestanstalt<br />
in Worms und ein Altenwohnheim in Worms.<br />
Grundlegendes Ziel des Praxisprojekts ist die Durchführung<br />
von Besuchskontakten der Arrestanten bei Senioren aus der<br />
Wohngemeinschaft unter Anleitung von Studierenden. Bei<br />
den Arrestanten soll durch den Kontakt mit den Senioren<br />
und mit den Studierenden ein Reflektieren des eigenen Handelns<br />
angeregt werden. Die Interaktion mit den Senioren<br />
erfordert von Seiten der Arrestanten Einfühlungsvermögen<br />
und Perspektivenübernahme. Die Arrestanten erleben, dass<br />
sie eine wertgeschätzte Tätigkeit ausüben.<br />
Für die Senioren bietet das Zusammentreffen mit den Arrestanten<br />
ebenfalls neue Erfahrungen. Sie profitieren durch<br />
die Interaktion, da sie durch die Einsätze der jungen Menschen<br />
Abwechslung und geistige Anregung erfahren. Auch<br />
für die Studierenden sind die Lernchancen vielfältig, z.B. im<br />
Hinblick auf Methoden, die sie in Lehrveranstaltungen erarbeitet<br />
haben.<br />
3. Rahmenbedingungen<br />
Damit alle Kooperationspartner von SofiT profitieren können,<br />
hat sich die Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen<br />
als sinnvoll erwiesen:<br />
In der Jugendarrestanstalt sorgen neben der pädagogischen<br />
Fachkraft, die Vollzugsbeamten und der verantwortliche<br />
Richter für die Auswahl von geeigneten Arrestanten. Voraussetzung<br />
bei deren Auswahl ist, dass der Jugendarrest<br />
mindestens drei Wochen dauert, um mehrfache Besuche zu<br />
ermöglichen. Die Studierenden werden als ehrenamtliche<br />
Vollzugshelfer bestellt. Die Besuche finden in Teams statt,<br />
d.h. jeweils zwei Studierende begleiten zwei Arrestanten.<br />
Regelmäßige Supervisionstermine stellen die Verbindung zur<br />
<strong>Hochschule</strong> her.<br />
4. SofiT in der Praxis<br />
Beim ersten Besuch in der Wohngemeinschaft erfolgt eine<br />
Einweisung durch die Hausleitung. Der Projektname „SofiT‟<br />
steht für „Sofort im Team‟, da die Arrestanten sofort<br />
nach ihrer Ankunft zum Team gehören. Die Aufgaben, die<br />
die Arrestanten übernehmen, sind vielfältig. Hierzu gehören<br />
Spielen, Basteln, Vorlesen oder Singen. Hinzu kommt eine<br />
Unterstützung bei pflegerischen Arbeiten. Diese Tätigkeiten<br />
trauen sich nicht alle Arrestanten bereits zu Beginn der Besuche<br />
zu. Bei späteren Besuchen werden die meisten aber<br />
sicherer im Umgang mit den Senioren und übernehmen anspruchsvollere<br />
Aufgaben.<br />
Für die Studierenden ist vorgesehen, dass sie sich nur dann<br />
motivierend einschalten, wenn sich der Arrestant sehr zögerlich<br />
verhält. Zeigt sich ein Arrestant unfreundlich, ist es<br />
Aufgabe des Studierenden, positiv einzuwirken und Grenzen<br />
aufzuzeigen.<br />
Seit Projektbeginn fanden in der Zeit von Juni bis Dezember<br />
2010 insgesamt 20 Besuche in der Wohngemeinschaft<br />
statt. Die Jugendarrestanten, die am Projekt beteiligt waren,<br />
besuchten die Wohngemeinschaft jeweils zweimal.<br />
Die Grenzen des Projekts liegen vor allem in der Struktur<br />
des Jugendarrests. Die Erlebnisse der Jugendarrestanten<br />
im Umgang mit demenzkranken Menschen und den Studierenden<br />
stellen nur eine punktuelle Erfahrung dar. Zwei<br />
Elemente sind es, die auf die Arrestanten positiv einwirken<br />
können: Einmal die Erkenntnis, dass ihre Tätigkeit in<br />
der Wohngemeinschaft auf einhelliges Lob gestoßen ist und<br />
zum Zweiten ein Einblick in ein möglicherweise unbekanntes<br />
Tätigkeits- und Berufsfeld.<br />
Bei der Durchführung von SofiT wurde nicht verkannt, dass<br />
bei der Durchführung des Projekts auch Gefahren bestehen<br />
können. So kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass<br />
die Jugendarrestanten während der Projektzeit fliehen oder<br />
Straftaten begehen könnten. Hier hat sich aber die Auswahl<br />
von geeigneten Personen durch den Vollzug in vollem Umfang<br />
bewährt. Das Projekt wird ab 2012 fortgesetzt.<br />
¹ Das Projekt wurde gefördert von der Hochschulgesellschaft <strong>forum</strong> sociale<br />
<strong>Mainz</strong> e.V.; hierfür herzlichen Dank.<br />
² Vgl. Laubenthal/Baier: Jugendstrafrecht, Berlin, Heidelberg 2006, Rnr. 665;<br />
Böhm/Feuerhelm: Einführung in das Jugendstrafrecht, München 2004, S. 214 f.<br />
³ Fast konstant lauten etwa 18% aller Verurteilungen zu Jugendstrafrecht auf<br />
Jugendarrest, vgl. Strafverfolgungstatistiken, www.destatis.de<br />
Dipl.-Päd. Petra Tietjen ist Lehrbeauftragte KFH; Dr. jur., Dipl.-Päd. Wolfgang Feuerhelm ist Professor für Sozialrecht<br />
und Strafrecht KFH; Theresa Bausch, BA Soziale Arbeit, ist stud. jur. Universität <strong>Mainz</strong>.
Anne Amann-Kaiser<br />
Rückblick auf 20 Jahre als Psychologische Studierendenberaterin an der KFH <strong>Mainz</strong><br />
In Deutschland gibt es seit<br />
den 1970er Jahren eigene Psychologische<br />
und Psychotherapeutische<br />
Beratungsstellen an<br />
den <strong>Hochschule</strong>n. In der <strong>Katholische</strong>n<br />
Fachhochschule <strong>Mainz</strong><br />
waren bereits in den 1980er<br />
Jahren Psychologinnen auf Honorarbasis<br />
tätig, die Sprechstunden<br />
abhielten und mit<br />
denen Beratungstermine vereinbart<br />
werden konnten. 1991<br />
führte dann eine Initiative des<br />
studentischen Vereins SKFH, die von Hochschulleitung und<br />
Trägergesellschaft aufgegriffen wurde, zur Einrichtung einer<br />
festen 50%-Stelle durch den CV <strong>Mainz</strong>.<br />
Braucht eine <strong>Hochschule</strong> eine Psychologische<br />
Beratungsstelle?<br />
Aus psychologischer Sicht geht die Zeit des Studiums einher<br />
mit wichtigen, über das ganze spätere Leben entscheidenden<br />
Entwicklungsaufgaben und deshalb auch mit einer<br />
erhöhten Krisenanfälligkeit. Im Grunde ist es die Zeit, in<br />
der die jungen Erwachsenen alle Wünsche, Träume und Anforderungen,<br />
die sie seit der Kindheit entwickelt haben, auf<br />
dem Hintergrund dessen, was das Leben ihnen an Ressourcen<br />
gab und gibt, in die Realität bringen müssen.<br />
Eine Vielzahl rechtlicher und sozialer Sachregelungen, die<br />
durchschaut und gehandhabt werden müssen, und/oder<br />
die Notwendigkeit, zusätzlich für ein ausreichendes Einkommen<br />
sorgen zu müssen, erschweren oft die Situation.<br />
Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die einengen, aber<br />
auch Halt gaben, sind anders und weniger vorhanden. Solche<br />
Freiheit ist wenig erprobt, oft verunsichernd, manchmal<br />
ängstigend. Auf Hilfen aus dem Elternhaus ist nicht immer<br />
Verlass, Bewältigungsmuster aus Kindheit und Schulzeit<br />
funktionieren nicht mehr, Ideale und Illusionen sind oft eher<br />
überfordernd.<br />
Natürlich sind all diese Herausforderungen richtig und notwendiger<br />
Teil des Erwachsenwerdens, letztlich reift der<br />
Mensch gerade daran. Aber es geschieht auch, dass lebensgeschichtlich<br />
angelegte Konflikte, noch nicht genügend entwickelte<br />
Bewältigungsstrategien und aktuelle Belastungen<br />
sich unheilvoll miteinander verbinden. Psychologische Beratung<br />
in der <strong>Hochschule</strong> bietet hier einen niederschwelligen,<br />
unbürokratischen Zugang zu Reflexions- und Lösungsfindungsmöglichkeiten,<br />
ein fachliches und persönliches Gegenüber,<br />
Ort und Zeit für Auseinandersetzung und Begleitung<br />
der Prozesse zur Überwindung der Probleme.<br />
Die Eigenart der an der KFH angebotenen Studiengänge erfordert<br />
von allen Studierenden eine oft intensive Auseinandersetzung<br />
mit der eigenen Person und Lebensgeschichte.<br />
Dies kann zu einer Verstärkung bereits angelegter Probleme<br />
führen, durch eine erfolgreiche Auseinandersetzung und<br />
Lösung wird die spätere Professionalität jedoch gestärkt.<br />
Durch das Entstehen einer veränderten und eigenständigen<br />
Erwachsenenidentität wird auch die früher oft selbstverständliche<br />
Orientierung an Kirche, Glauben und Religiosität<br />
in Frage gestellt, muss neu begründet werden.<br />
Ein Miteinander von glaubwürdiger Professionalität und<br />
Konfessionalität hat hier auch Modellfunktion für die Weiterentwicklung<br />
der Studierenden im Hinblick auf diese Fragen<br />
der persönlichen religiösen Ausrichtung.<br />
Entwicklungen in der Beratungsarbeit<br />
War es im Jahr 1991 noch eine relativ geringe Anzahl von<br />
Studierenden, die die Angebote der Stelle annahm, so stieg<br />
diese Zahl in den folgenden Jahren stetig an. Nach dem<br />
Umzug in das neue Gebäude, 1995, stabilisierte sich der<br />
Schwerpunkt Einzelberatung zunehmend. Die Gruppenangebote,<br />
die der Verbesserung der Studienleistung dienen<br />
(Prüfungsvorbereitung, Rhetorik, wissenschaftliches<br />
Schreiben) wurden immer besser angenommen.<br />
Mit der Einführung der Bachelor-Studiengänge ging jedoch<br />
die Nachfrage nach den Gruppen deutlich zurück. Grund<br />
war einerseits, dass Teile des Angebotes in die Module und<br />
in die Angebote der Praxisreferate integriert wurden, teilweise<br />
ist der Rückgang auch darin begründet, dass die Studierenden<br />
durch die Veränderung der Anforderungen des<br />
Studiums deutlich weniger Zeit für freiwillige Angebote aufbringen<br />
wollen.<br />
Der insgesamt steigenden Nachfrage nach Beratung konnte<br />
bis heute dadurch Rechnung getragen werden, dass die<br />
Einzelberatungen in größeren Abständen stattfinden und<br />
die Dauer der Beratungen insgesamt verkürzt wurde. So<br />
kann bis heute eine ständige Erreichbarkeit der Psychologin<br />
für die Studierenden gewährleistet sowie längere Wartezeit<br />
vermieden werden.<br />
Auch die Beratungsanlässe waren im Verlauf der Jahre einem<br />
Wandel unterworfen. Waren es in den ersten Jahren in<br />
erster Linie soziale und persönliche Probleme, die die Liste<br />
der Beratungsanlässe anführten, so nahmen mit den Jahren<br />
die rein studienbezogenen Probleme in der Beratungsarbeit<br />
immer mehr Raum ein. In den Jahren 2003–2008 verstärkte<br />
sich diese Entwicklung, ebenso ergab sich im Bereich<br />
des Übergangs von Studium zu Beruf ein erhöhter Beratungsbedarf<br />
als Antwort auf eine als unsicher empfundene<br />
berufliche Zukunft und den durch die damalige Arbeitsmarktsituation<br />
erschwerten Einstieg in den Beruf.<br />
<strong>Aktuell</strong>e Situation: Psychologische Beratung in einer<br />
veränderten Hochschullandschaft<br />
Im Wintersemester 2006/07 wurde an der KFH <strong>Mainz</strong> der<br />
erste Bachelorstudiengang im FB Soziale Arbeit eröffnet,<br />
die anderen Fachbereiche folgten, Masterstudiengänge<br />
wurden eingerichtet.<br />
Anne Amann-Kaiser ist Diplompsychologin und Psychologische Psychotherapeutin.<br />
Seit 1991 ist sie in der KFH <strong>Mainz</strong> tätig.
Anne Amann-Kaiser, Rückblick auf 20 Jahre als...<br />
(Fortsetzung von Seite 6)<br />
Die Anforderungen dieser Studiengänge, die häufig auf Erwartungen<br />
der Studierenden trafen, die noch von den Erfahrungen<br />
früherer Studierendengenerationen geprägt waren,<br />
führten zunächst häufiger als in den Jahren zuvor zu<br />
Anpassungsproblemen.<br />
Aus Sicht der Studierenden haben in den letzten Jahren<br />
die Leistungsanforderungen stark angezogen und sind<br />
einseitiger auf den Erwerb von Faktenwissen ausgerichtet<br />
(11. Studierendensurvey des BM für Forschung und Bildung,<br />
April 2011). Die relativ eng aufeinander folgenden<br />
Prüfungen erschweren eine intensive Verarbeitung des<br />
Lernstoffes. Ein gutes bis sehr gutes Examen ist für die<br />
Studierenden wichtiger denn je, auch um sich den Weg in<br />
einen der Masterstudiengänge offen zu halten. Durch die<br />
als ungünstig empfundene Situation wird die Erfüllung eigener<br />
Leistungsansprüche erschwert, oft sind bereits im<br />
1. Semester starke Zweifel da, ob das Studium so erfolgreich<br />
wie gewünscht abgeschlossen werden kann. Diese<br />
Veränderungen in Situation und Befindlichkeit der Studierenden<br />
spiegeln sich in den Anfragen an die Beratungsstelle.<br />
Die Nachfrage nach Gruppenangeboten, mit Ausnahme<br />
der Gruppe „Lern- und Arbeitstechniken‟, geht mittlerweile<br />
gegen Null, die studienbezogenen Probleme, die auch mit<br />
anderen psychischen Schwierigkeiten einhergehen können,<br />
nehmen fast 80% der Beratungsarbeit ein, die Zahl<br />
der Einzelberatungen stieg an. Einige wenige Stunden reichen<br />
meist aus, es gibt klare Problemstellungen und Ziele,<br />
oft wird die Beratungsstelle mehrmals während des Studiums<br />
für solch kurze Zeit in Anspruch genommen. Vermehrt<br />
sind Schlafstörungen, körperliche und psychische Erschöpfungszustände,<br />
Überforderungsgefühle, Perfektionismus,<br />
depressive Verstimmungen/Depressionen, Konsum von<br />
Medikamenten Anlass zum Aufsuchen der Stelle. Weiterhin<br />
haben Beratungen per E-Mail deutlich zugenommen.<br />
Im Jahr 2011 sind die Bedingungen der nun nicht mehr so<br />
neuen Studiengänge für die Studierenden zu normalem Alltag<br />
geworden. Die Psychologische Beratungsstelle ist in der<br />
jetzt „<strong>Katholische</strong>n <strong>Hochschule</strong>‟ eine feste, gut integrierte<br />
Institution, die für jährlich ca. 15% der Studierenden Unterstützung<br />
und Hilfen bereitstellt, die gut bis sehr gut angenommen<br />
werden.<br />
* * *<br />
Thorsten Becker<br />
„Mehr Qualität durch Europäisierung?”<br />
<strong>Mainz</strong>er Tagung zum Thema Studium, Ausbildung und Praxis der Sozialen Arbeit<br />
„Es lässt sich wohl nicht<br />
mit Ja oder Nein beantworten‟,<br />
so Werner<br />
Keggenhoff, Präsident<br />
des Landesamtes für<br />
Soziales, Jugend und<br />
Versorgung, in seinen<br />
einführenden Worten in<br />
Replik auf eine umfassende<br />
Frage, die<br />
zugleich als Titel einer Fachtagung fungierte, die am<br />
11. November 2010 vom rheinland-pfälzischen Ministerium<br />
für Arbeit, Soziales, Familie, Gesundheit und Frauen, dem<br />
Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ), der<br />
Bundesarbeitsgemeinschaft der Praxisämter/Praxisreferate,<br />
dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge<br />
und der <strong>Katholische</strong>n Fachhochschule <strong>Mainz</strong> (KFH) in<br />
der Akademie der Wissenschaften und der Literatur <strong>Mainz</strong><br />
veranstaltet wurde: „Mehr Qualität durch Europäisierung?<br />
Studium, Ausbildung und Praxis in der Sozialen Arbeit‟.<br />
Werner Keggenhoff weiter: „Die Umstellung auf Bachelor<br />
und Master ist viel zu frisch.‟ Kinderkrankheiten gelte es<br />
abzustellen, manche Verschlankung des Stoffes sei zu radikal<br />
gewesen und auch über die Richtigkeit der Verzahnung<br />
von Theorie und Praxis ließe sich trefflich streiten.<br />
„Wir sind gleichwohl mit Bachelor und Master auf einem<br />
guten Weg‟, es müsse eben an den Schwächen gearbeitet<br />
werden. So konnte die Fachtagung, die von etwa 100<br />
Aktiven und Gästen begleitet wurde, durchaus im Kontext<br />
einer solchen Arbeit an möglichen Schwächen des Studiums,<br />
der Ausbildung und der Praxis der Sozialen Arbeit im<br />
Rahmen der neuen Studienabschlüsse des Bologna-Prozesses<br />
gedeutet werden.<br />
Agenda<br />
Auf der Agenda der Fachtagung standen diverse Vorträge,<br />
eine Podiumsdiskussion zum Thema „Was braucht die Praxis?”<br />
sowie ein nachmittägliches „World-Café‟. Durch den<br />
Tag führte die Leiterin des SPFZ, Susanne Kros; musikalisch<br />
begleitet wurde die Tagung von der Gruppe „JazzThing‟.<br />
In einem ersten Vortrag verwies der Vorsitzende der BAG<br />
der Praxisämter/Praxisreferate, Heinz Gabler, u.a. darauf,<br />
dass aus seiner Sicht nicht „Bologna‟ das Problem sei,<br />
(Fortsetzung auf Seite 8)<br />
Thorsten Becker, Historiker M.A. und Sozialarbeiter B.A. (KFH <strong>Mainz</strong> 2011),<br />
ist im Stadtjugendamt Koblenz (ASD) tätig.
Thorsten Becker, Mehr Qualität durch Europäisierung?<br />
(Fortsetzung von Seite 7)<br />
sondern die nationale Umsetzung des Bologna-Prozesses:<br />
„Das deutsche Credo scheint zu lauten: mehr Studierende<br />
in kürzerer Zeit mit weniger Ressourcen viel besser zu<br />
qualifizieren‟. Sodann formulierte er Bedenken der Praxis<br />
in Bezug auf die Qualifizierung der Absolventen/innen des<br />
Studiengangs Sozialer Arbeit und leitete daraus indirekt als<br />
mögliche Lösungen möglicher Qualifizierungsmängel eine<br />
bessere Finanzierung der <strong>Hochschule</strong>n und der Praxis sowie<br />
qualifizierte Konzepte der Praxis zur Personalentwicklung<br />
ab.<br />
Vorträge<br />
Nachdem sich Ulrich Bartosch, Professor an der <strong>Katholische</strong>n<br />
Universität Eichstätt-Ingolstadt und Vorsitzender des<br />
Fachbereichstags, im Rahmen des Themas „Soziale Arbeit<br />
und das europäische Ziel vom ‚dynamischsten wissensbasierten<br />
Wirtschaftsraum’ ‟ der bzgl. des Bologna-Prozesses<br />
bildungstheoretischen, ökonomischen und sozialen Metaebene<br />
der Lissabon Strategie der Europäischen Union gewidmet<br />
hatte, ging Peter Buttner, Professor an der <strong>Hochschule</strong><br />
München und Mitglied im Fachausschuss für Soziale<br />
Berufe des Deutschen Vereins, in seinem Vortrag zum Thema<br />
„Sind die Studiengänge Soziale Arbeit für die aktuellen<br />
Herausforderungen gerüstet?‟ dem bereits angedeuteten<br />
Pfad der Ausgestaltung des Studiengangs bzw. der Studiengänge<br />
Sozialer Arbeit weiter nach. Buttner: „Wenn man<br />
jetzt fragt: Sind die Studiengänge für die Herausforderungen<br />
wirklich gerüstet, dann wäre meine Antwort: ja, im<br />
Wesentlichen schon, sonst wäre es schon zum Skandal gekommen‟.<br />
Deutlich machte er allerdings, dass die neuen<br />
Studiengänge relativ verschult seien und eine größere Konzentration<br />
auf Kernkompetenzen, wie Koordination, Information,<br />
Beratung und Ressourcenmobilisierung sowie Soziale<br />
Diagnostik bei gleichzeitiger Beibehaltung inhaltlicher<br />
Orientierung stattfinden müsse. Buttner abschließend. „Die<br />
eigentliche Qualität ist die Professionalität.”<br />
Diskussion<br />
Wie diese Professionalität der Absolventen/innen der Studiengänge<br />
Sozialer Arbeit von der Praxis gesehen wird, darum<br />
ging es u.a. in der anschließenden Podiumsdiskussion.<br />
Beteiligt an dieser waren Carolin Bormann, Studierende<br />
der KFH, Thomas Muth, Jugendamt Koblenz, Peter Weiler,<br />
Stadt <strong>Mainz</strong>, Karl Züfle, Heilpädagogium Schillerhain, sowie<br />
Heinz Gabler. Erwartungsgemäß gestalteten sich die<br />
Antworten auf diesen Zusammenhang so heterogen, wie<br />
es die Soziale Arbeit selbst ist, es kristallisierten sich jedoch<br />
Schwerpunkte bzgl. des Bedarfs der Praxis und damit<br />
verbundener Ansprüche an die (Fach-)<strong>Hochschule</strong>n heraus.<br />
Im Anschluss an die von Buttner formulierten Kernkompetenzen<br />
von Sozialarbeiter/innen machte Karl Züfle auf<br />
die anfänglichen Schwierigkeiten vieler Absolventen/innen<br />
der Studiengänge Sozialer Arbeit aufmerksam, „das theoretische<br />
Wissen in praktisches Handeln umzusetzen‟. Fast<br />
einhelliger Tenor war weiterhin, dass in der Praxis Sozialer<br />
Arbeit Fachkräftemangel zu erwarten ist bzw. in einigen<br />
Tätigkeitsfeldern bereits herrscht und dass darüber hinaus<br />
die Anforderungen an die Fachkräfte höher werden. In diesem<br />
Zusammenhang wurde von einigen Diskutierenden<br />
das sinkende Alter der Absolventen/innen der Studiengänge<br />
Sozialer Arbeit bzw. sinkende Praxiszeiten während des<br />
Studiums als kritisch eingestuft. Thomas Muth: „Es existiert<br />
weniger Zeit für Persönlichkeitsentwicklung während<br />
des Studiums”. Daher wurde von fast allen Diskutierenden<br />
die Vernetzung von Studium und Praxis u.a. über Personalentwicklungsmaßnahmen<br />
seitens der Träger Sozialer<br />
Arbeit als wichtige Weiterentwicklung der Ausbildung gewertet.<br />
Es lässt sich als Fazit der Diskussion festhalten,<br />
dass eine stärkere Vernetzung zwischen <strong>Hochschule</strong>n und<br />
Praxis, die zu einer eingehenderen Kommunikation bzgl.<br />
qualitativer Verbesserungen der Ausbildung führen könnte,<br />
von allen Beteiligten als Wunsch betrachtet werden kann.<br />
World-Café<br />
Eifrig diskutiert wurde auch beim „World-Café‟ am Nachmittag.<br />
Praktiker/innen, Lehrende und Lernende der Sozialen<br />
Arbeit widmeten sich gruppenweise unterschiedlichen<br />
Fragen, die von Susanne Kros im Einklang mit der<br />
leitenden Fragestellung der Tagung formuliert wurden. Die<br />
Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:<br />
Im Kern ging es in vielen unterschiedlichen Formulierungen<br />
um die eine, die Soziale Arbeit bereits seit Jahrzehnten<br />
bewegende Frage, wie sich Professionalität vorantreiben<br />
lässt, d.h. wie sich die Profession Soziale Arbeit (weiter-)<br />
entwickeln könne. Da wurden einerseits Vorschläge gemacht,<br />
Praxis und Ausbildung weiter zu verzahnen, andererseits<br />
wurde die Forderung einer standardisierten Ausbildung<br />
aufgestellt. Dass die Praxis Sozialer Arbeit angesichts<br />
größer werdender sozialer Probleme nicht nur gut ausgebildete<br />
Fachkräfte, sondern auch mehr staatliche Geldtransfers<br />
braucht, was auf Grund der Finanzkrise immer<br />
leerer werdender öffentlicher Kassen zunehmend schwierig<br />
wird, wurde kurioserweise nur von wenigen Gruppen diskutiert,<br />
zumal sich die Verknappung fiskalischer Mittel auch<br />
auf die Ausbildung auswirkt. Möglicherweise bedarf es, wie<br />
ein Diskutant es ausdrückte, einer Repolitisierung der Sozialen<br />
Arbeit, um diese Zusammenhänge formulieren zu<br />
können, und nicht, wie ein anderer es sagte, eines Abrückens<br />
vom auch karitativen Berufsinhalt Sozialer Arbeit,<br />
beispielsweise aus einem finanziellen Aspekt heraus.<br />
Abschließend lässt sich sagen, dass sich die Frage, ob mehr<br />
Qualität durch Europäisierung entstehe, in allen Vorträgen<br />
und Diskussionen naturgemäß nicht definitiv beantwortet<br />
werden konnte, doch gingen alle Teilnehmer/innen mit<br />
dem guten Gefühl nach Hause, dass der Dialog zwischen<br />
Ausbildung und Praxis fruchtbar und weiterführend ist und<br />
dass die Soziale Arbeit insbesondere in ihrer Bachelor-Ausbildung<br />
deutlich besser aufgestellt ist, als der mediale Ruf<br />
des Bachelors suggerieren mag. Eine Fortsetzung des Dialogs<br />
ist dabei durchaus erwünscht.
Martin Klose<br />
Hauptsache gesund!?<br />
Zur aktuellen Kontroverse um die Präimplantationsdiagnostik<br />
Gesundheit – ein absoluter Wert!?<br />
Um die Gesundheit dreht sich vieles, mitunter sogar Alles.<br />
Kein Geburtstag ohne den obligatorischen Glückwunsch<br />
„vor allem Gesundheit”, kein Urlaubskatalog ohne Hinweis<br />
auf zahllose Fitness- und Wellnessangebote, kein Lebensmittel,<br />
das nicht gern mit dem Prädikat „gesundheitsfördernd”<br />
für sich wirbt. Die Sorge um die Gesundheit treibt<br />
den Menschen um, prägt seine Sicht aufs Leben und findet<br />
mannigfachen Niederschlag auch in der Sprache, etwa wenn<br />
heutzutage aus der Krankenschwester offiziell die Gesundheits-<br />
und Krankenpflegerin geworden ist.<br />
Auf den ersten Blick scheint eine solche Denkweise kein<br />
Problem zu sein. Gesundheit ist ein hoher Wert und jeder,<br />
der schon einmal krank oder gar schwer krank gewesen ist,<br />
weiß diesen Wert zu schätzen, weiß, was er an seiner Gesundheit<br />
hat, weiß, welche Bedeutung der Gesundheit im<br />
Leben zukommt. Stimmt also die Auffassung, der man nicht<br />
selten begegnet, dass Gesundheit alles und ohne Gesundheit<br />
alles nichts ist? Hat der Recht, der der Maxime folgt:<br />
Hauptsache gesund?<br />
An dieser Stelle beginnt die ethische Diskussion, denn dass<br />
Gesundheit ein hoher Wert ist, heißt noch nicht, dass sie<br />
auch ein absoluter Wert ist, ein Wert also, dem konkurrenzlos<br />
alles unterzuordnen ist, ein Wert, der im Konfliktfall immer<br />
und unter allen Umständen den Vorzug verdient. Letztlich<br />
ist es diese Frage nach dem Stellenwert der Gesundheit<br />
im Gesamt menschlicher Existenz, die auch den Kern der<br />
ethischen Kontroverse um die Zulässigkeit der Präimplantationsdiagnostik<br />
ausmacht.<br />
Präimplantationsdiagnostik –<br />
ein Verfahren, an dem sich die Geister scheiden<br />
Die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist ein Verfahren, das<br />
künstlich befruchtete Embryonen vor ihrer Übertragung in<br />
die Gebärmutter der Frau einer genetischen Untersuchung<br />
unterzieht. Erstmals vor gut zwanzig Jahren durchgeführt,<br />
galt die PID bisher in der Bundesrepublik Deutschland als<br />
durch das Embryonenschutzgesetz von 1990 verboten, wurde<br />
aber in der Vergangenheit, unbeschadet dieser Tatsache,<br />
in Politik und Gesellschaft immer wieder heftig diskutiert.<br />
Eine neue Qualität bekam diese Auseinandersetzung durch<br />
ein Urteil des Bundesgerichtshofes vom 6. Juli 2010, wonach<br />
die Präimplantationsdiagnostik zur Entdeckung schwerer<br />
genetischer Schäden des Embryos keine Strafbarkeit nach<br />
dem Embryonenschutzgesetz begründet.<br />
Mit dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofes rückte<br />
die Diskussion um das Für und Wider der PID schlagartig<br />
wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und<br />
zeigte einmal mehr, dass sich in dieser Frage die Geister<br />
scheiden. In einem „Memorandum zur Präimplantationsdiagnostik”<br />
spricht sich die Bundesärztekammer etwa für eine<br />
Zulassung der PID für Paare mit einem bekannten hohen<br />
genetischen Risiko aus, die<br />
Deutsche Bischofskonferenz<br />
äußert sich klar im Sinne eines<br />
strikten Verbots der PID, der<br />
Rat der Evangelischen Kirche<br />
Deutschlands (EKD) positioniert<br />
sich in dieser Frage ähnlich, der<br />
Deutsche Ethikrat wiederum ist<br />
in sich gespalten und votiert mit<br />
elf Stimmen für ein Verbot der<br />
PID und mit dreizehn Stimmen<br />
für ihre Durchführung unter bestimmten<br />
Bedingungen. Entsprechend<br />
diesem gesellschaftlichen Dissens kommt es<br />
im Laufe des Frühjahrs 2011 zu drei verschiedenen interfraktionellen<br />
Gesetzentwürfen zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik<br />
in Deutschland. Nur ein Gesetzentwurf<br />
tritt für ein völliges Verbot der PID ein, die beiden anderen<br />
Gesetzentwürfe halten zwar am grundsätzlichen Verbot der<br />
PID fest, lassen aber ihre Durchführung unter bestimmten<br />
Bedingungen zu, wobei die Bedingungen unterschiedlich restriktiv<br />
gefasst sind. Am 7. Juli 2011 entscheidet sich der<br />
Bundestag mehrheitlich für den Gesetzentwurf, der gemeinhin<br />
als der liberalste gilt. Demnach ist eine PID nicht rechtswidrig,<br />
wenn auf Grund „der genetischen Disposition der<br />
Eltern oder eines Elternteiles für deren Nachkommen eine<br />
hohe Wahrscheinlichkeit für eine schwerwiegende Erbkrankheit”<br />
besteht oder die PID „zur Feststellung einer schwerwiegenden<br />
Schädigung des Embryos” vorgenommen wird,<br />
die „mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt<br />
führen wird”. Rückgebunden ist die Erlaubtheit der<br />
PID an eine medizinische und psychosoziale Beratung, an<br />
die schriftliche Einwilligung der Mutter und an das positive<br />
Votum einer interdisziplinär besetzten Ethikkommission.<br />
Ethische Prima-facie-Plausibilitäten<br />
und ihre Fragwürdigkeiten<br />
Mit der nun getroffenen rechtlichen Regelung zur Handhabung<br />
der PID ist die ethische Diskussion nicht beendet. Es<br />
lohnt sich vielmehr, die Frage nach den Gründen zu stellen,<br />
wonach für die einen PID gerechtfertigt werden kann, während<br />
sie für die anderen keine ethisch akzeptable Option<br />
darstellt.<br />
Plausibel scheint zunächst vor allem eine ethische Rechtfertigung<br />
der PID zu sein. Welche Eltern wünschen sich<br />
nicht ein gesundes Kind? Sollen nicht auch genetisch vorbelastete<br />
Eltern die Chance auf ein gesundes Kind haben,<br />
ja fordert das nicht sogar ihre reproduktive Autonomie?<br />
Ist es nicht unbarmherzig, Eltern, die bereits ein schwer<br />
behindertes Kind haben, ein Wiederholungsrisiko zuzumuten?<br />
Ist Gesundheit nicht eine wesentliche Voraussetzung<br />
für ein glückliches Leben? Muss Leid nicht verhindert wer-<br />
(Fortsetzung auf Seite 10)<br />
Dr. Martin Klose ist Professor für Moraltheologie und Christliche Gesellschaftslehre an der KFH.
(Fortsetzung von Seite 9)<br />
Martin Klose<br />
Hauptsache gesund!?<br />
Zur aktuellen Kontroverse um die Präimplantationsdiagnostik<br />
den, wenn man es verhindern kann? Es fällt schwer, solche<br />
Fragen nicht auf Anhieb im Sinne der Befürworter der PID<br />
zu beantworten. Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt,<br />
dass die PID nicht grundsätzlich erlaubt sein soll, sondern<br />
nur ausnahmsweise unter eng umgrenzten Bedingungen,<br />
dass also Embryonen lediglich auf schwerwiegende Erbkrankheiten<br />
untersucht werden sollen und nicht etwa der<br />
Wunsch nach dem Designerbaby bei der PID Pate stehen<br />
darf. Hinzu kommt überdies, dass man für Deutschland pro<br />
Jahr nur mit ca. 200–400 Paaren rechnet, die für eine PID<br />
in Frage kommen, und deshalb meint, das ganze Verfahren<br />
für eine zu vernachlässigende Größe halten zu können.<br />
Schließlich vergleichen nicht wenige die Untersuchung von<br />
Embryonen durch PID und – bei entsprechendem Befund –<br />
ihre Vernichtung mit einem Schwangerschaftsabbruch nach<br />
pränataler Diagnostik. Bei diesem Vergleich erscheint die<br />
PID humaner und damit als das kleinere Übel; auch verweist<br />
man auf einen Wertungswiderspruch in der deutschen<br />
Rechtsordnung, wenn man die PID für unzulässig erklärt,<br />
den Schwangerschaftsabbruch nach pränataler Diagnostik<br />
im Zusammenhang der medizinischen Indikation aber als<br />
nicht rechtswidrig einordnet.<br />
So einleuchtend diese Argumentation zugunsten der PID<br />
prima facie auch sein mag, so sehr wird sie durch ernsthafte<br />
ethische Bedenken in Frage gestellt, ja entkräftet, Bedenken,<br />
die nicht nur, aber vor allem die christliche Ethik<br />
ins Feld führt.<br />
Da ist zunächst die Einordnung der PID als eine Art ethischer<br />
quantité négligeable, weil es ja „nur” um 200–400<br />
betroffene Paare pro Jahr gehen soll. Hier ist zu entgegnen,<br />
dass sich die ethische Relevanz einer Handlung nicht primär<br />
daran entscheidet, wie häufig sie vorkommt, sondern<br />
in erster Linie daran, was qualitativ auf dem Spiel steht.<br />
Darüber hinaus muss die ethische Bedeutung der PID im<br />
Gesamtkontext der Fragen eines verantworteten Umgangs<br />
mit dem menschlichen Leben an seinem Anfang und seinem<br />
Ende gesehen werden – und hier weitet sich der Blick<br />
durchaus auf eine weitaus größere Zahl von Betroffenen.<br />
Auch das Argument, das die PID als eine Art antizipierte<br />
pränatale Diagnostik mit Schwangerschaftsabbruch aufgrund<br />
medizinischer Indikation sieht, will nicht recht überzeugen,<br />
denn hier wird eine Vergleichbarkeit der Situation<br />
behauptet, die so nicht vorliegt, denn es besteht weder<br />
eine Schwangerschaft noch ein Schwangerschaftskonflikt,<br />
weshalb von einem Wertungswiderspruch in der deutschen<br />
Rechtsordnung ebenfalls keine Rede sein kann.<br />
Vor allem aber, und da stehen wir beim eigentlichen Kern<br />
der aktuellen Kontroverse um die PID, ist es fragwürdig,<br />
den ethischen Blick exklusiv auf die Gesundheit zukünftiger<br />
Kinder von Risikopaaren zu konzentrieren und andere<br />
konkurrierende Gesichtspunkte nicht zu berücksichtigen.<br />
Selbstverständlich ist es legitim, wenn sich – gerade auch<br />
genetisch vorbelastete Eltern – ein gesundes Kind wünschen<br />
und selbstverständlich gilt es auch, Leid – wo immer<br />
möglich – zu verhindern. Aber nicht weniger selbstverständlich<br />
ist die Berücksichtigung sämtlicher ethisch relevanter<br />
Gesichtspunkte einer Handlung und ihres Kontextes; und<br />
ebenso selbstverständlich ist eine Verhinderung von Leid<br />
nur dann ethisch akzeptabel, wenn sie nicht größere Übel<br />
als das Leid, das verhindert werden soll, verursacht. Unter<br />
diesen Voraussetzungen zeigt sich die PID in einem wenig<br />
günstigen Licht, sodass aus ethischer Sicht mehr gegen als<br />
für dieses Verfahren spricht. In diesem Zusammenhang sind<br />
es vor allem drei Überlegungen, die nachdenklich machen.<br />
Zum einen steht zu befürchten, dass es nicht bei der PID<br />
unter eng umgrenzten Bedingungen bleibt, sondern die Indikationsliste<br />
beständig erweitert wird. Für eine solche Prognose<br />
muss man kein Prophet sein, sondern nur bei dem<br />
Ausdruck „schwerwiegende Erbkrankheit” ansetzen. Dieser<br />
zentrale Terminus lässt sich kaum objektiv und eindeutig<br />
definieren, ja lädt – wie etwa in Großbritannien bereits geschehen<br />
– dazu ein, das Spektrum potentieller Krankheiten<br />
beständig auszuweiten. Darüber hinaus liegt es in der Natur<br />
der künstlichen Befruchtung selbst, die PID vermehrt einzusetzen,<br />
werden doch schon heute laut Bericht der European<br />
Society for Human Reproduction (ESHR) gut sechzig Prozent<br />
aller Präimplantationsdiagnostiken als qualitatives Embryonenscreening<br />
zur Optimierung der künstlichen Befruchtung<br />
durchgeführt. Zum Zweiten bedeutet PID gezielte Selektion.<br />
Menschliche Embryonen werden künstlich erzeugt, um sie<br />
einer Qualitätskontrolle zu unterwerfen; bestehen sie diese<br />
nicht, werden sie aussortiert und verworfen. Menschen<br />
urteilen hier über Menschen, Menschen nehmen bei ihresgleichen<br />
eine Einteilung in lebenswert und lebensunwert<br />
vor und entscheiden für und über andere, ob es sich zu leben<br />
lohnt oder nicht. Es ist zu befürchten, dass eine solche<br />
präimplantative Praxis Folgewirkungen für die Beurteilung<br />
geborener Menschen hat und zur Diskriminierung von Menschen<br />
mit Behinderung führen wird. Zum Dritten schließlich<br />
ist der PID eine Instrumentalisierung des menschlichen Embryos<br />
immanent. Der einzelne Embryo wird nicht um seiner<br />
selbst willen gewollt und anerkannt; seine Annahme steht<br />
unter dem Vorbehalt, dass die Untersuchung keine Auffälligkeiten<br />
ans Licht bringt, dass er also gesund ist. Seine Erzeugung<br />
ist mithin nicht Selbstzweck, sondern allein Mittel<br />
zu einem seiner Existenz fremden Zweck. Der menschliche<br />
Embryo aber hat schon von der Befruchtung an das Recht,<br />
gegen Verzweckung und Vernutzung geschützt zu sein, weil<br />
die Befruchtung einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess<br />
initiiert und so das willkürärmste Kriterium für den Beginn<br />
eines umfassenden Lebensschutzes ist, der jedem Menschen<br />
aufgrund der ihm eigenen Menschenwürde zusteht.<br />
Hauptsache gesund? „Was für ein Unsinn”, antwortet der<br />
Münchner Philosoph Michael Bordt SJ. Man kann es auch<br />
weniger polemisch sagen: Der Wunsch, gesund zu sein ist<br />
wie der nach einem gesunden Kind verständlich und ehrenwert.<br />
Ein Recht auf Gesundheit oder auf ein gesundes Kind<br />
um jeden Preis lässt sich daraus aber nicht ableiten, übersieht<br />
vielmehr, was auf dem Spiel steht für das Bild vom<br />
Menschen, den Respekt vor seiner Würde, das Verständnis<br />
von Elternschaft, die Humanität der Gesellschaft. Daran erinnert<br />
die christliche Ethik, wenn sie sich gegen die PID ausspricht.
Wir gratulieren unseren Mitgliedern …<br />
Prof. Andreas Büsch zur Berufung zum Leiter der<br />
Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz<br />
(DBK), die zum 1. Januar 2012 an der<br />
KFH für drei Jahre „ad experimentum‟ eingerichtet wird.<br />
Prof. Büsch ist seit 2006 Berater der Publizistischen Kommission<br />
der DBK und in dieser Eigenschaft im Auftrag der<br />
<strong>Katholische</strong>n Kirche Gutachter bei der Freiwilligen Filmselbstkontrolle<br />
(FSK). Er ist Mitverfasser des von der Publizistischen<br />
Kommission 2011 herausgegebenen medienethischen<br />
Impulspapiers „Virtualität und Inszenierung″.<br />
… zur Ernennung zum Geistlichen Rat<br />
Prof. Dr. Martin Klose am 11. November;<br />
… zur Wiederwahl<br />
Rektor Prof. Peter Orth und Prorektorin Prof. Ruth<br />
Remmel-Faßbender für die Amtszeit vom 1. September<br />
2011 bis 31. August 2014;<br />
... zum 60. Jahrestag der Priesterweihe<br />
Anton Kalteyer, Pfarrer i. R., langjähriger Lehrbeauftragter<br />
im FB PT der KFH (15. Juli);<br />
… zum 50. Jahrestag der Priesterweihe<br />
Prälat Dr. Josef Huber, Richter an der Rota Romana,<br />
1978–1992 Lehrbeauftragter an der KFH (25. Februar);<br />
Dr. Helmut Schwalbach, Pfarrer, 1975–2001 Professor<br />
für Pastoraltheologie an der KFH (30. Juli);<br />
… zum 90. Geburtstag<br />
Prof. Emil Wachter, Gründungs- und Ehrenmitglied von<br />
<strong>forum</strong> sociale (29. April);<br />
… zum 85. Geburtstag<br />
Prof. Dr. Irene Willig, die 1972–1989 an der KFH Dogmatik<br />
und Fundamentaltheologie lehrte und 1975–1981 Rektorin<br />
der KFH war (4. November);<br />
… zum 80. Geburtstag<br />
Dompropst em. Hermann Josef Leininger, Ordinariatsdirektor<br />
i. R., der 1972–1996 Personaldezernent des<br />
Bistums Trier war (02. Mai);<br />
Franz Stoffl, Seniorchef der Dombuchhandlung <strong>Mainz</strong><br />
(27. August);<br />
… zum 75. Geburtstag<br />
Prof. Helga Bader, die 1977–1992 Systematik und Methodik<br />
der Sozialen Arbeit an der KFH lehrte (28. Mai);<br />
Prof. Dr. Helmut Schwalbach (16. Juli); ihm gelten auch<br />
für den Ruhestand als Pfarrer, den er im Oktober 2011 antrat,<br />
die besten Wünsche; ;<br />
… zum 70. Geburtstag<br />
Prof. Dr. Helga Maasberg, die 1972–2004 an der KFH<br />
Soziologie lehrte (12. Oktober).<br />
Personelle Veränderungen an der KFH<br />
Am Ende des WS 2010/11 trat Prof. Dr. Christa Olbrich,<br />
Dipl.-Pädagogin und Supervisorin, die am 18. September<br />
2010 ihr 65. Lebensjahr vollendet hatte, in den Ruhestand.<br />
Sie lehrte seit SS 2002 im FB Gesundheit und Pflege die<br />
Fächer Pflegewissenschaft und Pflegepädagogik.<br />
Thomas Roering, Dipl.-Sozialpädagoge (FH), der seit März<br />
1982 für das Praktikantenamt Sozialpädagogik bzw. – nach<br />
Umorganisation der Fachbereiche – für das Praxisreferat Soziale<br />
Arbeit verantwortlich war, trat Ende Januar 2011 in<br />
den Ruhestand. Er war elf Jahre Mitglied des Senats und<br />
neun Jahre aktiv in der Studiengangkommission „Master<br />
Gerontomanagement‟. Zudem engagierte er sich in der Mitarbeitervertretung.<br />
Er ist Gründungsmitglied der BAG der<br />
Praxisämter/-referate an <strong>Hochschule</strong>n für Soziale Arbeit und<br />
war 1992–1997 deren Vorsitzender.<br />
Mit Ende des SS 2011 beendete Prof. Dr. Philipp Müller,<br />
Prof. für Pastoraltheologie, seine Lehrtätigkeit an der KFH.<br />
Er folgte einem Ruf an die Universität <strong>Mainz</strong>.<br />
Als Nachfolgerin von Thomas Roering ist seit 1. April 2011<br />
Dipl.-Sozialpädagogin (FH) Petra Schorr-Medler im Praxisreferat<br />
Soziale Arbeit tätig. Zu ihren Aufgaben zählen<br />
die Organisation und Vorbereitung der Praxismodule, die<br />
Beratung und Begleitung der Studierenden in allen die Praxissemester<br />
betreffenden Fragen und die Kooperation mit<br />
den Praxisstellen. Nach ihrem Studium an der KFH <strong>Mainz</strong><br />
(1982–1986) war sie in der Arbeit mit behinderten Menschen,<br />
in der Allgemeinen Lebensberatung/Schwangerenberatung<br />
und – nach einer Familienphase – in der stadtteilorientierten<br />
Gemeinwesenarbeit tätig.<br />
Am 21. März 2011 wurde Dr. med. Hans-Jürgen Hennes,<br />
MBA, zum Honorarprofessor im Fachbereich Gesundheit und<br />
Pflege der KFH ernannt. Dr. Hennes, der bereits seit 2007<br />
einen Lehrauftrag „Gesundheitswissenschaften‟ wahrnahm,<br />
ist Geschäftsführer des Caritas-Werkes St. Martin/<strong>Katholische</strong>s<br />
Klinikum <strong>Mainz</strong>.<br />
Zum WS 2011/12 ist auf die im FB Gesundheit und Pflege<br />
neu eingerichtete Professur für Hebammenwissenschaft<br />
Dr. phil. Monika Greening berufen worden. Schwerpunkte<br />
ihrer Tätigkeit werden sein „Betreuung der physiologischen<br />
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett durch Hebammen‟<br />
und „Sportliche Aktivitäten während Schwangerschaft<br />
und Wochenbett‟. Dr. Greening hat nach dem Studium der<br />
Pflegewissenschaft berufliche Erfahrungen insbesondere in<br />
den Arbeitsbereichen Belastung und Beanspruchung während<br />
der Berufsausbildung zur Hebamme gemacht. Sie war<br />
zuletzt als Professorin für Pflegewissenschaft an der Ev.<br />
<strong>Hochschule</strong> Nürnberg tätig.<br />
Zum WS 2011/12 wurde auf die von der Ketteler-Stiftung<br />
getragene Professur für Kinder- und Jugendhilfe im FB Soziale<br />
Arbeit (mit 50% Beschäftigungsumfang) Dipl.-Sozialpädagoge,<br />
Dipl.-Pädagoge Dr. Gerald Weidner berufen. Er<br />
hat mit einer Arbeit über Selbstevaluation in Tübingen bei<br />
M. Heiner und H. Thiersch promoviert. Er ist Direktor und pädagogischer<br />
Leiter des St. Josephshauses, einer stationären<br />
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Klein-Zimmern.<br />
Wir gedenken unserer Toten<br />
Am 10. Juni 2011, wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag,<br />
starb Clemens Bendowski. Seit Gründung der<br />
KFH (1972) bis zum Eintritt in den Ruhestand (1992) war er<br />
deren Verwaltungsleiter. Am Auf- und Ausbau der KFH hatte<br />
er maßgeblichen Anteil. Er war Gründungsmitglied unserer<br />
Hochschulgesellschaft<br />
Am 9. November 2011 starb im Alter von 86 Jahren Architekt<br />
Hans Karl Lutz, der unserer Gesellschaft seit deren<br />
Gründung angehörte. R. i. p.
Jens Arnold / Thomas Hermsen / Peter Löcherbach /<br />
Hugo Mennemann / Markus Poguntke-Rauer<br />
Erfolgreiche Hilfesteuerung<br />
im Jugendamt<br />
St. Ottilien: EOS-Verlag 2011<br />
Die Veröffentlichung basiert auf einem Forschungsvorhaben,<br />
das in den Jahren 2005 bis 2008 vom Bundesministerium für<br />
Bildung und Forschung gefördert wurde. In Zusammenarbeit<br />
mit acht Jugendämtern wurde die Effektivität und Effizienz<br />
des Case Managements im Bereich der Hilfen zur Erziehung<br />
untersucht und ein neues Softwareprogramm zur Dokumentation<br />
und Auswertung der Hilfen entwickelt.<br />
Bernhard Nacke (Hg.)<br />
Identität und Relevanz<br />
Glaube und Kirche an der Schnittstelle<br />
zu Staat und Gesellschaft<br />
Erkelenz: Altius Verlag 2011<br />
Dieser vom Leiter des <strong>Katholische</strong>n Büro <strong>Mainz</strong> herausgegebene<br />
Sammelband vereinigt die von den Bischöfen der<br />
in Rheinland-Pfalz gelegenen Diözesen, gelegentlich auch<br />
von Gastrednern beim St. Martin-Jahresempfang des <strong>Katholische</strong>n<br />
Büros <strong>Mainz</strong> gehaltenen Ansprachen aus fast drei<br />
Jahrzehnten. In der Vielfalt der angesprochenen Themen<br />
suchen die Beiträge jeweils nach grundsätzlichen Orientierungen<br />
aus der Option des Glaubens. Das macht die Beiträge<br />
jenseits der aktuellen Problematik auch nach Jahren<br />
lesenswert. Darüber hinaus ist es von eigenem Interesse,<br />
zu sehen, welche Themen den Bischöfen in der jeweiligen<br />
Zeitsituation in den politischen und gesellschaftlichen Dialog<br />
einzubringen wichtig waren.<br />
Bernhard Nacke<br />
Potenziale für Gesellschaftspolitik?<br />
Ein Zwischenruf in zehn Thesen<br />
angesichts der globalen<br />
Finanz- und Wirtschaftskrise<br />
Mit einem Geleitwort von Karl Kardinal Lehmann<br />
Erkelenz: Altius Verlag 2011<br />
Im Blick auf die derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise legt<br />
Verf. eine Reflexion auf die Ziele und Grundforderungen gesellschaftspolitischen<br />
Handelns vor. Denn, so führt er aus<br />
und gibt damit die Zielrichtung seiner Überlegungen an:<br />
„Reflexionen über die politischen Problemlagen im Grundsätzlichen<br />
sind immer dann angebracht, wenn zur Diskussion<br />
eine Orientierungshilfe für das konkrete politische<br />
Handeln beigesteuert werden soll″ (11). Er fordert eine ordnungspolitische<br />
Orientierung „von der Ebene der Gemeinde<br />
bis zur Weltgesellschaft‟ (55), die – wertgebunden – an den<br />
Prinzipien der Subsidiarität, Solidarität und des Gemeinwohls<br />
ausgerichtet ist, und plädiert in diesem Sinne für eine<br />
Reform der Sozialen Marktwirtschaft auf der Grundlage der<br />
sozialen Gerechtigkeit. Dabei werde „das unmittelbar solidarische,<br />
das ehrenamtliche und das bürgerschaftliche Engagement<br />
einen neuen Stellenwert bekommen müssen‟ (54).<br />
Bernd Jochen Hilberath / Johannes Kohl /<br />
Jürgen Nikolay (Hg.)<br />
Grenzgänge sind Entdeckungsreisen<br />
Lebensraumorientierte Seelsorge und<br />
kommunikative Theologie im Dialog:<br />
Projekte und Reflexionen<br />
(Kommunikative Theologie 14)<br />
Ostfildern: Matthias-Grünewald-Verlag 2011<br />
Den Band eröffnen kurze Vorstellungen der Kommunikativen<br />
Theologie (KT) und der Lebensorientierten Seelsorge (LOS).<br />
Herzstück ist der mit „Dialoge″ überschriebene zweite Teil.<br />
Hier werden – in der Dokumentation realer E-Mail-Korrespondenzen<br />
– Projekte aus <strong>Mainz</strong>, St. Gallen, Innsbruck und<br />
Salzburg, die nach dem Konzept LOS durchgeführt wurden,<br />
von Teilnehmern/innen vorgestellt und mit Vertretern/innen<br />
der KT in einem Dialog wechselseitiger Befragung und Reflexion<br />
kommuniziert. Sie zeigen eine beispielhafte Argumentationskultur<br />
und sind allein schon – auch für mit LOS und<br />
KT nicht Vertraute – eine spannende und gewinnbringende<br />
Lektüre. Aber auch die „Perspektiven″ des dritten Teils, die<br />
einzelne Aspekte der „Dialoge″ vertiefen und weiterführen,<br />
rentieren nicht weniger eine aufmerksame Lektüre.<br />
Brigitta Dewald-Koch<br />
Am falschen Ort<br />
Roman<br />
<strong>Mainz</strong>: André Thiele Verlag 2011<br />
Die Verfasserin, Referentin im rheinland-pfälzischen Ministerium<br />
für Integration, Frauen, Kinder und Jugend, legt hier<br />
ihren zweiten Roman vor. Der Titel „Am falschen Ort″ ist<br />
in mehrfacher Hinsicht Metapher für das Romangeschehen:<br />
Eine scheinbar „normale″ Familie bricht auseinander: Senta,<br />
Arnos Ehefrau und Mutter der beiden Töchter Lily und<br />
Paula, verlässt ihre Familie und folgt einem Theaterregisseur,<br />
der sie zu einer gefeierten Schauspielerin „macht″. In eindringlichen<br />
Szenen verfolgt man die Verlassenheit und das<br />
Arrangement der Kinder, schließlich die nach Jahren erfolgte<br />
Begegnung Paulas mit ihrer Mutter, den psychischen Zusammenbruch<br />
Sentas und das erneute Zusammenfinden Arnos<br />
mit seiner in „den weißen Nebeln″ der Demenz versunkenen<br />
Ehefrau. Der Roman zeigt in spannungsvoller Dramatik wie<br />
Menschen, auf der Suche nach sich selbst, nach Erfolg und<br />
Anerkennung, sich um die Erfüllung ihrer Sehnsucht nach<br />
Zuwendung und Liebe bringen. Er zeigt die Wirkungen der<br />
Sprachlosigkeit, Angst und Einsamkeit, aber auch die Nähe<br />
und Begegnung schaffende Wirkung des Gesprächs und die<br />
Tragkraft der Liebe. Die eindringlichen Schilderungen und<br />
tiefgründigen Reflexionen verlangen ein bedachtsames Lesen,<br />
das die Komposition und die „Signale″ der Darstellung<br />
beachtet. Der Roman entlässt einen nachdenklichen Leser.<br />
Herausgeber:<br />
Verantwortlich:<br />
Satz und Druck:<br />
I M P R E S S U M<br />
Hochschulgesellschaft <strong>forum</strong> sociale <strong>Mainz</strong> e.V., Saarstraße 3, 55122 <strong>Mainz</strong><br />
Clemens Frenzel-Göth, Winfried Piel, Ruth Remmel-Faßbender, Hans Zeimentz<br />
Christa Scharnagl, Rüsselsheim, tanamana@gmx.net