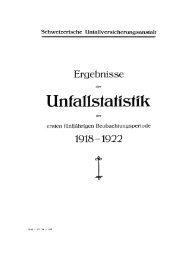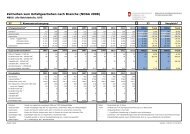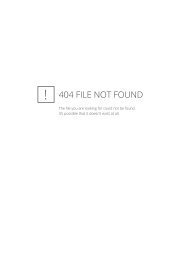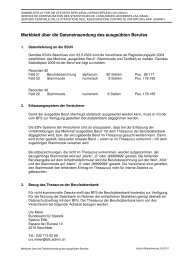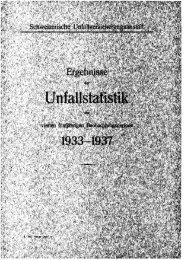herunterladen - Statistik der Unfallversicherung UVG
herunterladen - Statistik der Unfallversicherung UVG
herunterladen - Statistik der Unfallversicherung UVG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SCHWEIZERI SCH E UNFALLVE RS ICH E RUNGSAN STALT<br />
ERGEBEN ISSE<br />
DER<br />
U IV I.ALLSTATI STI K<br />
DER ACHTEN FÜNF JÄHRIGEN<br />
BEOBACHTUNGS PERIODE<br />
1953 — 1957
SCHWEIZERISCH E U NFALLVERS ICH ERU NGSAN STALT<br />
ERGEBNISSE<br />
DER UNFALLSTATISTIK<br />
DER ACHTEN FÜNFJÄHRIGEN<br />
1953 †19<br />
BEOBACHTUNG SPE RIODE
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
Einleitung<br />
Än<strong>der</strong>ungen in Gesetz und Praxis .<br />
Der Versicherungsbestand<br />
Die unterstellten Betriebe.<br />
Die versicherte Lohnsumme.<br />
Die Zahl <strong>der</strong> Versicherten<br />
Die Zahl <strong>der</strong> Unfälle.<br />
Die Unfälle.<br />
Kollektivunfälle .<br />
Die Versicherungsleistungen.<br />
Die Heilkosten<br />
Das Krankengeld<br />
Die Rentenkosten .<br />
Invaliden- und Hinterlassenenrenten .<br />
Die Invalidenrenten .<br />
Die H interlassenenrenten .<br />
Berufskrankheiten .<br />
Zusammenfassung .<br />
A nhang<br />
Abgelehnte Fälle<br />
Die Unfallkosten<br />
Unfall häufigkei und Unfallschwere<br />
Die Unfallhäufigkeit .<br />
Die Unfallschwere .<br />
Unfallursachen<br />
Unfallursachen in den Giessereien .<br />
Unfallursachen in <strong>der</strong> keramischen Industrie<br />
L) ber die Nichtbetriebsunfälle .<br />
Die Bedeutung <strong>der</strong> Berufskrankheiten<br />
Die Silikose.<br />
Massnahmen zur Unfallverhütung .<br />
Die Tätigkeit <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt<br />
Die Tätigkeit von Fachinspektoraten und Beratungsstellen<br />
Das Unfallgeschehen als Zufallsvorgang<br />
Das Prämienwesen<br />
Das Wirken des Zufalls .<br />
Die Darstellung des Zufallsvorgangs<br />
129<br />
129<br />
133<br />
139<br />
145<br />
147<br />
5<br />
5<br />
7<br />
7<br />
8<br />
11<br />
15<br />
15<br />
18<br />
23<br />
25<br />
25<br />
31<br />
32<br />
34<br />
35<br />
35<br />
41<br />
44<br />
44<br />
58<br />
63<br />
64<br />
78<br />
97<br />
101<br />
101<br />
104<br />
124<br />
124<br />
128
Zeichenerklärung<br />
Ein Strich an Stelle einer Zahl bedeutet Null (nichts).<br />
0 o<strong>der</strong> 0,0 Nullen bedeuten Grössen, die kleiner sind als die Hälfte <strong>der</strong> verwendeten Zähleinheit.<br />
Ein Punkt bedeutet, dass eine Zahlenangabe unmöglich ist, weil die begrifflichen Voraussetzungen<br />
dazu fehlen.<br />
Ein Stern bedeutet, dass die Zahlenangabe entwe<strong>der</strong> nicht erhältlich ist o<strong>der</strong> nicht<br />
erhoben wurde.<br />
Abkürzungen<br />
K<strong>UVG</strong><br />
SBB<br />
PTT<br />
Bundesgesetz über die Kranken- und <strong>Unfallversicherung</strong> (vom 13.Juni 1911).<br />
Sctsweizerische Bundesbahnen.<br />
Post-, Telegraphen- und Telephonverwaltung.
Einleitung<br />
Än<strong>der</strong>ungen in Gesetz und Praxis<br />
Der vorliegende Bericht soll über die Ergebnisse <strong>der</strong> Unfallstatistik <strong>der</strong> achten fünfjährigen Beobachtungsperiode<br />
1953 — l 957 Auskunft geben und zudem Vergleiche mit den Ergebnissen früherer Beobachtungsperioden<br />
ermöglichen. Es ist deshalb notwendig, einleitend auf die wichtigeren Än<strong>der</strong>ungen des<br />
Bundesgesetzes über die Kranken- und <strong>Unfallversicherung</strong> (K<strong>UVG</strong>) sowie <strong>der</strong> Praxis bei <strong>der</strong> Zusprechung<br />
von Versicherungsleistungen hinzuweisen.<br />
Der Kreis <strong>der</strong> Betriebe, die <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> zu unterstellen sind, wurde durch<br />
die bundesrätliche Verordnung vom 18. Dezember 1953 betreffend die Ergänzung <strong>der</strong> Verordnung I über<br />
die <strong>Unfallversicherung</strong> erweitert. So unterstehen dem Versicherungsobligatorium nun alle Betriebe, die<br />
überhaupt Motorfahrzeuge — und nicht bloss Automobile — garagieren sowie alle Betriebe, die Kork, Stein<br />
o<strong>der</strong> feste Kunststoffe mechanisch bearbeiten. Diese seit 1. Januar 1954 gültige Än<strong>der</strong>ung gewisser Unterstellungsbestimmungen<br />
war jedoch nicht von weittragen<strong>der</strong> Bedeutung, schloss aber immerhin einige<br />
durch die technische Entwicklung bedingte Lücken in <strong>der</strong> Versicherungspflicht.<br />
Durch die bundesrätliche Verordnung über Berufskrankheiten vom 11. November 1952 wurden ab 1953<br />
neue Stoffgruppen und Einzelstoffe, <strong>der</strong>en Erzeugung o<strong>der</strong> Verwendung sogenannte Berufskrankheiten<br />
verursacht, in das Verzeichnis gemäss Art.68 K<strong>UVG</strong> aufgenommen. Dadurch entstand bei vielen Fällen<br />
ein Rechtsanspruch auf Versicherungsleistungen, bei denen bisher auf Grund eines Verwaltungsratsbeschlusses<br />
vom Oktober 1918 nur freiwillige Leistungen gewährt wurden. Eine weitere Verordnung vom<br />
6. Apri11956 stellte ab 1. Mai 1956 gewisse akute Erkrankungen, die durch die Arbeit ohne die Einwirkung<br />
schädigen<strong>der</strong> Stoffe verursacht werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Berufskrankheiten gleich.<br />
Weil trotz diesen neuen Verordnungen und dem alten Verwaltungsratsbeschluss von 1918 nach wie vor<br />
Lücken in <strong>der</strong> Entschädigungspraxis bestanden, entschloss sich <strong>der</strong> Verwaltungsrat, mit Wirkung ab<br />
1. Mai 1956 eine Generalklausel für die Ausrichtung von Versicherungsleistungen bei sämtlichen eindeutig<br />
beruflichen Schädigungen einzuführen.<br />
Die Versicherungsleistungen sind in <strong>der</strong> Berichtsperiode durch Än<strong>der</strong>ung einiger Gesetzesbestimmungen<br />
verbessert worden. Das fortwährende Ansteigen des Lohnniveaus machte eine Erhöhung des versicherten<br />
Höchstverdienstes (Art.74, 78 und 112 K<strong>UVG</strong>) notwendig, was sich beträchtlich auf die Versicherungsleistungen<br />
(Krankengeld und Renten) und selbstverständlich auch auf die Prämiensumme ausgewirkt<br />
hat. Der von 1945 — 1952 auf 26 Franken im Tag o<strong>der</strong> 7800 Franken im Jahr festgesetzte versicherte<br />
Höchstverdienst wurde mit Wirkung ab 1.Januar 1953 auf 30 Franken beziehungsweise 9000 Franken<br />
heraufgesetzt. Die andauernde Lohnsteigerung erfor<strong>der</strong>te jedoch bald eine weitere Anpassung des versicherten<br />
Höchstverdienstes: seit dem 1. Januar 1957 beträgt er 40 Franken im Tag beziehungsweise 12000<br />
Franken im Jahr. Diese Massnahme drängte sich auf, nachdem Untersuchungen ergeben hatten, dass rund<br />
ein Fünftel aller Versicherten den anrechenbaren Höchstlohn erreicht o<strong>der</strong> überschritten hatte. Auf Beginn<br />
des Jahres 1953 wurde die Bestattungsentschädigung von 40 auf 250 Franken (Art.83 K<strong>UVG</strong>) und<br />
das Schlussalter für den Bezug <strong>der</strong> Waisenrenten vom 16. auf das vollendete 18. beziehungsweise für die in<br />
Ausbildung begriffenen Kin<strong>der</strong> auf das vollendete 20. Altersjahr (Art. 85 K <strong>UVG</strong>) heraufgesetzt. Bei diesen<br />
beiden Gesetzesän<strong>der</strong>ungen standen den Mehrkosten keine Mehreinnahmen gegenüber.<br />
Im Zusammenhange mit diesen Verbesserungen <strong>der</strong> Versicherungsleistungen ist die Erhöhung <strong>der</strong><br />
Teuerungszulagen an die Rentner <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt durch Bundesbeschluss<br />
mit Wirkung ab 1953 zu erwähnen; gleichzeitig wurde <strong>der</strong> Kreis <strong>der</strong> Anspruchsberechtigten ausgedehnt.<br />
Eine weitere Verbesserung <strong>der</strong> Teuerungszulagen trat 1957 in Kraft. Diese Teuerungszulagen, die im Jahre<br />
1957 über 6 Millionen Franken erfor<strong>der</strong>ten, müssen umlagemässig finanziert werden, weil dafür keine<br />
Deckungskapitalien vorhanden sind. Seit 1953 übernimmt <strong>der</strong> Bund die Hälfte <strong>der</strong> Kosten und verzichtet<br />
auch weiterhin auf die ihm gemäss Art. 90 K<strong>UVG</strong> zustehenden Gutschriften.<br />
Eine Verteuerung <strong>der</strong> Unfallkosten bewirkte <strong>der</strong> im Jahre 1953 in Kraft getretene neue Zahnarzttarif<br />
mit mehrheitlich erhöhten Ansätzen. Im gleichen Jahre führten Abmachungen mit dem Verbande Schwei
zerischer Krankenanstalten über eine neue Liste <strong>der</strong> Extraleistungen zu grösseren Kosten bei Spitalbehandlung.<br />
Im letzten Berichtsjahre wurden die Spitaltaxen in gewissen Fällen erhöht und die Teuerungszuschläge<br />
auf den Arzttarifen von 45 Prozent auf 50 Prozent heraufgesetzt.<br />
Auf die Notwendigkeit einer Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> technischen Grundlagen zur Berechnung <strong>der</strong> Deckungskapitalien<br />
für Invalidenrenten wurde schon im Berichte über die Ergebnisse <strong>der</strong> Unfallstatistik <strong>der</strong> Beobachtungsperiode<br />
1948 — 1952 hingewiesen. Eine geringere Wirkung <strong>der</strong> Revisionen <strong>der</strong> Invalidenrenten<br />
und ein Anwachsen <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Kapitalabfindungen bedingte eine Erhöhung <strong>der</strong> Barwerte für die noch<br />
revidierbaren Invalidenrenten (Art. 80 K<strong>UVG</strong>). Diese Massnahme wirkte sich seit 1953 auf die Ergebnisse<br />
aus.<br />
In <strong>der</strong> Berichtsperiode traten einige zwischenstaatliche Abko>nmen über die Sozialversicherung in<br />
Kraft, und zwar mit<br />
<strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich und Holland betreffend<br />
die soziale Sicherheit <strong>der</strong> Rheinschiffer . am 1. Juni 1953<br />
Belgien.<br />
Grossbritannien<br />
Dänemark .<br />
Schweden<br />
am 1. November 1953<br />
am 1. Juni 1954<br />
am 1. März 1955<br />
am 1. September 1955<br />
Diese Vereinbarungen führten insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung zu gewissen Mehrkosten.<br />
Die Prämientarife <strong>der</strong> Betriebs- und <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung wurden mit Wirkung ab<br />
1. Januar 1953 geän<strong>der</strong>t. Bei <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung handelte es sich um eine Anpassung <strong>der</strong> Prämiensätze<br />
an die Risikoentwicklung in den einzelnen Gefahrenklassen und gleichzeitig um eine zweckdienlichere<br />
Glie<strong>der</strong>ung des Prämientarifes für die Zuteilung <strong>der</strong> Betriebe zu Gefahrenklassen und ihre Einreihung<br />
in Gefahrenstufen. Insgesamt hatten diese Massnahmen die Aufhebung von 19 Gefahrenklassen<br />
sowie eine Prämienermässigung von jährlich annähernd 1 Million Franken zur Folge. Eine weitere An<strong>der</strong>ung<br />
des Prämientarifes auf den 1. Januar 1956, in <strong>der</strong>en Zusammenhang 28 Gefahrenklassen aufgehoben<br />
und eine neue geschaffen wurden, brachte wie<strong>der</strong>um eine Prämiensenkung um jährlich rund 2,5 Millionen<br />
Franken. Diese Ermässigungen waren trotz allgemeiner Kostensteigerung deshalb möglich, weil in den<br />
betroffenen Gefahrenklassen die versicherte Lohnsumme und damit <strong>der</strong> Prämieneingang im Verhältnis zu<br />
den Unfallkosten stärker anstieg. Die auf den 1. Januar 1953 beschlossene Erhöhung <strong>der</strong> Prämiensätze in<br />
<strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung bezweckte nicht nur, den Ausgleich <strong>der</strong> Betriebsrechnung wie<strong>der</strong>herzustellen,<br />
son<strong>der</strong>n auch das Darlehen aus dem Reservefonds schrittweise abzutragen.<br />
Schliesslich sind noch einige den Prämienbezug betreffende Massnahmen zu erwähnen. Der Verwaltungsrat<br />
hat mit Wirkung ab 1957 in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung den Prämienabzug, den die Anstalt<br />
zum Ausgleich <strong>der</strong> in <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme eingeschlossenen Entschädigungen für Ferien, Krankheit<br />
und ähnliche Arbeitsunterbrechungen gewährt, den verän<strong>der</strong>ten Gegebenheiten entsprechend von<br />
5 auf 6 Prozent erhöht. Im weitern beschloss die Direktion ein im Jahre 1923 gemachtes Zugeständnis ab<br />
1957 aufzuheben, wonach Gratifikationen prämienfrei waren, sofern sie den Betrag eines Monatslohnes<br />
beziehungsweise einer vierzehntägigen Zahltagsperiode nicht überstiegen. Auf diese Weise konnte eine<br />
Anpassung an den für die Eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung beitragspflichtigen Verdienst<br />
und damit eine Vereinfachung <strong>der</strong> Lohnlistenführung und <strong>der</strong> Lohnerklärung erreicht werden. Die<br />
Aufhebung drängte sich aber auch deshalb auf, weil dieser Verdienstbestandteil im Laufe <strong>der</strong> Zeit zugenommen<br />
hat und es immer schwieriger wurde, die Gratifikation vom Lohn zu unterscheiden. Zudem ist<br />
die Anstalt gemäss einem Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes verpflichtet, die den Versicherten<br />
infolge eines Unfalles entgehenden Gratifikationen bei <strong>der</strong> Berechnung des Krankengeldes und<br />
<strong>der</strong> Renten mitzuberücksichtigen. Im weitern hob <strong>der</strong> Verwaltungsrat seinen Beschluss aus dem Jahre 1915<br />
auf, wonach die Prämien für Lehrlinge, Volontäre und Praktikanten auf Grund von angenommenen<br />
Löhnen zu entrichten waren, die wesentlich höher lagen als die wirklichen Löhne. Er bestimmte, dass ab<br />
1957 <strong>der</strong> Prämienrechnung die wirklichen Löhne zugrunde zu legen sind. Die sich ergebenden Min<strong>der</strong>prämien<br />
erreichen nahezu die durch die vollständige Erfassung <strong>der</strong> Gratifikationen erzielten Mehrprämien.
Der Versicherungsbestand<br />
Für eine zuverlässige Beurteilung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Unfallstatistik ist es erfor<strong>der</strong>lich, den Umfang, die<br />
Zusammensetzung und die Entwicklung des Versicherungsbestandes zu kennen. Zudem dürfte diese<br />
Kenntnis auch in volkswirtschaftlicher und soziologischer Hinsicht von Interesse sein. Zur Beschreibung<br />
des Versicherungsbestandes dient je nach <strong>der</strong> Betrachtungsweise entwe<strong>der</strong> die Zahl <strong>der</strong> unterstellten Betriebe,<br />
die versicherte Lohnsumme o<strong>der</strong> die Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden beziehungsweise die Zahl <strong>der</strong> Versicherten.<br />
Diese vier den Versicherungsbestand kennzeichnenden Grössen sind in <strong>der</strong> Anhangstabelle l<br />
für die Jahre 1918 — 1957 aufgeführt.<br />
Die unterstellten Betriebe<br />
Ende 1957 waren 64241 Betriebe <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> unterstellt gegenüber 59599<br />
Ende 1952, so dass in <strong>der</strong> Berichtsperiode eine Bestandeszunahme um 4642 Betriebe zu verzeichnen ist.<br />
Dabei steht einem Abgang von 11124 Betrieben ein Zuwachs von 15766 Betrieben gegenüber. Diese beträchtliche<br />
Bestandesän<strong>der</strong>ung findet ihre Erklärung in <strong>der</strong> Neugründung o<strong>der</strong> dem Eingehen von Unternehmungen<br />
und in betrieblichen Verän<strong>der</strong>ungen, die das Hinzukommen o<strong>der</strong> den Wegfall bestimmter für<br />
die Unterstellung entscheiden<strong>der</strong> Merkmale zur Folge hatten. An <strong>der</strong> Bestandesverän<strong>der</strong>ung sind hauptsächlich<br />
Kleinbetriebe sowie Bauunternehmungen von befristeter Dauer beteiligt.<br />
Sofern bedeutsame Unterschiede in <strong>der</strong> Unfallgefahr für verschiedene Teile <strong>der</strong> Belegschaft bestehen,<br />
kann ein unterstellter Betrieb in Betriebsteile aufgeteilt werden. Auf die Ende 1957 unterstellten 64241<br />
Betriebe entfallen 86231 Betriebsteile.<br />
Die unterstellten Betriebsteile nach Industrie- und Gewerbezweigen<br />
Gruppen von Gefahrenklassen nach dem Prämientarif 1952<br />
1957<br />
Zunahme<br />
in /<br />
Steine und Erden<br />
Metallindustrie (ohne Uhrenindustrie) .<br />
Uhrenindustrie .<br />
Holzindustrie .<br />
Le<strong>der</strong>, Kork, Kunststoffe; Papier, graphische Gewerbe .<br />
Textilindustrie<br />
Zeughäuser.<br />
Chemische Industrie, Nahrungs- und Genussmittel.<br />
Gewinnung und Verarbeitung von Gestein und Mineralien<br />
B au wesen<br />
Waldwirtschaft .<br />
B ahnen ~ ~<br />
An<strong>der</strong>e Transportunternehmungen, Handelsbetriebe<br />
Licht-, Kraft- und Wasserwerke .<br />
K lnos<br />
Büros, Verwaltungen.<br />
T otal ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
603<br />
10 650<br />
1 213<br />
4 089<br />
1 545<br />
2 314<br />
73<br />
l 662<br />
1 398<br />
26 444<br />
3 637<br />
309<br />
5 219<br />
1 007<br />
361<br />
18 154<br />
78 678<br />
641<br />
12 029<br />
1 531<br />
3 853<br />
1 679<br />
2 453<br />
73<br />
1 758<br />
1 395<br />
28 476<br />
3 594<br />
406<br />
6 023<br />
993<br />
422<br />
20 905<br />
86 231<br />
6<br />
13<br />
26<br />
6<br />
9<br />
6<br />
0<br />
6<br />
0<br />
8<br />
1<br />
31<br />
15<br />
1<br />
17<br />
15<br />
10<br />
Der Vergleich <strong>der</strong> Bestandeszahlen von 1952 und 1957 zeigt, dass die Entwicklung in den einzelnen<br />
Gefahrenklassen sehr unterschiedlich verlief.
Einen überdurchschnittlichen prozentualen Zuwachs weisen in erster Linie die Bahnen auf, und zwar<br />
wegen <strong>der</strong> zahlreichen neuen Luftseil- und Skischleppseilbahnen. Dann folgen die Uhrenindustrie und die<br />
Kinos. Die bedeutende Vermehrung <strong>der</strong> Gruppe Transportunternehmungen und Handelsbetriebe ist zum<br />
Teil eine Folge <strong>der</strong> Ausdehnung <strong>der</strong> Versicherungspflicht auf alle Garagen. Die gute wirtschaftliche Entwicklung<br />
und die damit zusammenhängende Vergrösserung <strong>der</strong> Betriebe bewirkte auch einen ausserordentlichen<br />
Zugang an Büros. Die Zunahme des Bestandes an metallverarbeitenden und Baubetrieben ist<br />
anzahlmässig von beson<strong>der</strong>er Bedeutung. In einem auffallenden Gegensatz zur allgemein feststellbaren<br />
Ausweitung steht die Abnahme <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> versicherungspflichtigen Betriebe in <strong>der</strong> Holzindustrie.<br />
Die versicherte Lohnsumme<br />
Einen noch besseren Hinweis auf die Grösse und die Entwicklung des Versicherungsbestandes gibt die<br />
versicherte o<strong>der</strong>, was dasselbe ist, die prämienpflichtige Lohnsumme. Sie ist in <strong>der</strong> Berichtsperiode um<br />
Durchschnittliche Stundenverdienste verunfallter erwachsener Arbeiter und Arbeiterinnen<br />
Jahre<br />
gelernte<br />
und angelernte<br />
Arbeiter<br />
ungelernte<br />
Arbeiterinnen<br />
Stundenverdienste in Franken<br />
1939<br />
1942<br />
1947<br />
1952<br />
1957<br />
1.40<br />
1.68<br />
2.42<br />
2.76<br />
3.29<br />
1.08<br />
1.37<br />
2 ~ 04<br />
2.34<br />
2.71<br />
0.73<br />
0.92<br />
1.49<br />
1.74<br />
1.96<br />
Index <strong>der</strong> Stundenverdienste: 1939 = 100<br />
1939<br />
1942<br />
1947<br />
1952<br />
1957<br />
100<br />
120<br />
172<br />
196<br />
234<br />
100<br />
127<br />
189<br />
217<br />
251<br />
100<br />
126<br />
204<br />
239<br />
269<br />
Index <strong>der</strong> Stundenverdienste: 1942 = 100<br />
1942<br />
100<br />
100<br />
100<br />
1947<br />
144<br />
149<br />
162<br />
Index <strong>der</strong> Stundenverdienste: 1947 = 100<br />
1947<br />
1952<br />
100<br />
114<br />
100<br />
115<br />
100<br />
117<br />
Index <strong>der</strong> Stundenverdienste: 1952 = 100<br />
1952<br />
1957<br />
100<br />
119<br />
100<br />
116<br />
100<br />
113
und die Hälfte angestiegen, nämlich von 6,243 Milliarden Franken im Jahre 1952 auf 9,248 Milliarden<br />
Franken im Jahre 1957. Dieses Anwachsen kann zur einen Hälfte auf die Zunahme <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden<br />
beziehungsweise <strong>der</strong> Versicherten, worüber im nächsten Abschnitt berichtet wird, und zur an<strong>der</strong>n<br />
Hälfte auf das Ansteigen des Lohnniveaus sowie auf die Erfassung bisher prämienfreier Lohnbestandteile<br />
zurückgeführt werden.<br />
Wie in <strong>der</strong> Einleitung erwähnt wurde, folgte <strong>der</strong> auf den 1. Januar 1953 in Kraft getretenen Erhöhung<br />
des jährlichen versicherten Höchstverdienstes eines Versicherten von 7800 Franken auf 9000 Franken am<br />
1. Januar 1957 eine weitere Erhöhung auf 12000 Franken. Ferner sind seit diesem Zeitpunkt nun sämtliche<br />
Gratifikationen prämienpflichtig. Diese Massnahmen fielen mit einem fortwährenden Ansteigen des Lohnniveaus<br />
zusammen. Die auf Seite 8 zusammengestellten Angaben des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe<br />
und Arbeit veranschaulichen die Entwicklung <strong>der</strong> nominellen Löhne.<br />
Aus den Indexzahlen geht hervor, dass die Frauenlöhne in den Jahren 1942 — 1952 stärker zunahmen<br />
als die Männerlöhne. Dasselbe gilt von den Löhnen <strong>der</strong> ungelernten Arbeiter bezüglich <strong>der</strong> Löhne <strong>der</strong><br />
gelernten und angelernten. Diese Lohnnivellierung ist während <strong>der</strong> Berichtsperiode zum Stillstand gekommen<br />
und hat sich sogar leicht zurückgebildet.<br />
Aus <strong>der</strong> folgenden Zusammenstellung von Angaben des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und<br />
Arbeit ist ersichtlich, dass die Lohnentwicklung in den einzelnen Industrie- und Gewerbezweigen unterschiedlich<br />
verlief.<br />
I ndex <strong>der</strong> durchschnittlichen Stundenverdienste verunfallter erwachsener Arbeiter<br />
und Arbeiterinnen nach Industrie- und Gewerbezweigen 1957<br />
Industrie- und Gewerbezweige<br />
Industrie <strong>der</strong> Steine und Erden .<br />
Metall- und Maschinenindustrie<br />
Uhrenindustrie .<br />
Holzindustrie<br />
Schuhindustrie .<br />
Papier, Le<strong>der</strong>, Kautschuk<br />
Graphische Gewerbe<br />
Textilindustrie .<br />
Chemische Industrie ..<br />
Nahrungs- und Genussmittel .<br />
Gewinnung von M ineralien<br />
Verarbeitung von Steinen<br />
Baugewerbe<br />
Waldwirtschaft .<br />
Lager- und Handelsbetriebe<br />
Erzeugung und Verteilung von<br />
trischem Strom .<br />
Gas- und Wasserversorgung .<br />
Total .<br />
Und<br />
elek<br />
Index <strong>der</strong> Stundenverdienste:<br />
1939 = 100<br />
Arbeiter<br />
gelernte<br />
und ungelernte<br />
angelernte<br />
231<br />
242<br />
251<br />
243<br />
252<br />
242<br />
215<br />
261<br />
247<br />
211<br />
248 , 266<br />
221<br />
216<br />
219<br />
206<br />
250<br />
258<br />
278<br />
264<br />
280<br />
266<br />
260<br />
261<br />
250<br />
215<br />
242<br />
289<br />
223<br />
254<br />
215<br />
234 251<br />
269<br />
282<br />
281<br />
266<br />
277<br />
259<br />
266<br />
292<br />
261<br />
239<br />
269<br />
Index <strong>der</strong> Stundenverdienste;<br />
1952 = 100<br />
gelernte<br />
und<br />
angelernte<br />
119<br />
116<br />
120<br />
123<br />
128<br />
Arbeiter<br />
118 112<br />
Arbeiungelernte<br />
terinnen<br />
119 118 116<br />
127 118 114<br />
116 115 114<br />
120 118 112<br />
118 116 113<br />
128 117 121<br />
118 114 111<br />
126 113 115<br />
118 116 116<br />
117<br />
113<br />
123<br />
114<br />
116<br />
121<br />
119 116<br />
116<br />
113
Die bereits festgestellte Nivellierung <strong>der</strong> Löhne in den Jahren 1942 — 1952 ist, wie die auf 1939 bezogenen<br />
Indexzahlen zeigen, eine durchgehende Erscheinung; die einzige Ausnahme von Bedeutung ist bei <strong>der</strong><br />
Schuhindustrie festzustellen. Der bald darauf einsetzende Abbau <strong>der</strong> Nivellierung kommt in den auf 1952<br />
bezogenen Indexzahlen zum Ausdruck: im allgemeinen nahmen nun die Löhne <strong>der</strong> gelernten und angelernten<br />
Arbeiter prozentual stärker zu als die Löhne <strong>der</strong> ungelernten Arbeiter und diese stärker als die<br />
Löhne <strong>der</strong> Arbeiterinnen.<br />
1953<br />
Einen Überblick über die Zusammensetzung<br />
â€<br />
des Versicherungsbestandes<br />
19<br />
in zeitlicher Entwicklung<br />
gibt die Verteilung <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme auf die Industrie- und Gewerbezweige.<br />
Die versicherte Lohnsumme nach Industrie- und Gewerbezweigen<br />
In Promillen<br />
1938 †19 1943 †19<br />
1948-1952<br />
Gruppen von Gefahrenklassen nach dem Prämientarif<br />
Steine und Erden .<br />
Metallindustrie (ohne Uhrenindustrie) .<br />
Uhrenindustrie .<br />
Holzindustrie<br />
Le<strong>der</strong>, Kork, Kunststoffe; Papier, graphische Gewerbe<br />
Textilindustrie<br />
Zeughäuser<br />
Chemische Industrie, Nahrungs- und Genussmittel<br />
Gewinnung und Verarbeitung von Gestein und Mineralien<br />
Bau wesen<br />
Waldwirtschaft .<br />
Bahnen<br />
An<strong>der</strong>e Transportunternehmungen, Handelsbetriebe<br />
Licht-, Kraft- und Wasserwerke<br />
Kinos ~<br />
Büros, Verwaltun en<br />
T otal . ~ ~<br />
15<br />
189<br />
45<br />
26<br />
59<br />
87<br />
5<br />
67<br />
9<br />
170<br />
14<br />
76<br />
38<br />
21<br />
1<br />
178<br />
17<br />
192<br />
52<br />
29<br />
58<br />
82<br />
8<br />
64<br />
13<br />
173<br />
15<br />
70<br />
38<br />
18<br />
1<br />
170<br />
18<br />
195<br />
54<br />
26<br />
57<br />
83<br />
6<br />
64<br />
l 000 1 000 l 000 1 000<br />
7<br />
180<br />
10<br />
62<br />
38<br />
17<br />
1<br />
182<br />
17<br />
202<br />
53<br />
22<br />
56<br />
72<br />
5<br />
63<br />
7<br />
190<br />
9<br />
56<br />
39<br />
16<br />
l<br />
192<br />
Umwälzende Verän<strong>der</strong>ungen im Anteil <strong>der</strong> einzelnen Industriearten an <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme<br />
sind in den zwanzig letzten Jahren nicht eingetreten. Immerhin sind in <strong>der</strong> Beobachtungsperiode einige<br />
Verschiebungen festzustellen, die zum Teil mit den im vorausgehenden Abschnitt erwähnten Verän<strong>der</strong>ungen<br />
im Bestande <strong>der</strong> unterstellten Betriebsteile übereinstimmen. Die Anteile des Bauwesens sowie <strong>der</strong><br />
Büros und Verwaltungen haben verhältnismässig am stärksten zugenommen. Auch die Metallindustrie,<br />
die anteilmässig nach wie vor an <strong>der</strong> Spitze steht, hat erneut an Bedeutung gewonnen. Demgegenüber ist<br />
ein Rückgang des Lohnsummenanteiles <strong>der</strong> Holzindustrie, <strong>der</strong> Textilindustrie, <strong>der</strong> Waldwirtschaft und<br />
<strong>der</strong> Bahnen zu verzeichnen. Die Ursache dieses Rückganges dürfte weniger in Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Wirtschaftsstruktur<br />
zu suchen sein als vielmehr im überdurchschnittlichen Wachstum <strong>der</strong> drei lohnsummenmässig<br />
grössten Gruppen. Weitere Angaben über die Lohnsummenverteilung nach Gefahrenklassen enthält<br />
die Anhangstabelle 3.<br />
Da die Industrie- und Gewerbedichte in den einzelnen Landesgegenden unterschiedlich ist, mag es<br />
interessieren, wie die versicherte Lohnsumme auf die einzelnen Kantone verteilt ist. Im Bericht über die<br />
Beobachtungsperiode 1948 — 1952 wurde anhand <strong>der</strong> Volkszählungsergebnisse 1950 die Bedeutung <strong>der</strong><br />
obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> in den einzelnen Kantonen aufgezeigt. Dies sei für das Jahr 1957 anhand<br />
<strong>der</strong> auf 5,1 Millionen Einwohner geschätzten Wohnbevölkerung wie<strong>der</strong>holt.<br />
10
Die versicherte Lohnsumme nach Kantonen 1957<br />
Ohne SBB und PTT<br />
Kantone<br />
in Millionen<br />
Franken<br />
Versicherte Lohnsumme<br />
in Promillen<br />
Wohnbevölkerung<br />
in Promillen<br />
Durchschnittlicher<br />
versicherter Lohn<br />
je Einwohner<br />
in Franken<br />
Zürich<br />
Bern<br />
Luzern<br />
Schwyz .<br />
Obwalden .<br />
Nid waiden.<br />
Glarus<br />
Zug .<br />
Freiburg<br />
Solothurn .<br />
Basel-Stadt<br />
Basel-Land<br />
SchaA'hausen.<br />
Appenzell A.-Rh..<br />
Appenzell I.-Rh..<br />
St.Gallen .<br />
Graubünden .<br />
Aargau<br />
Thurgau<br />
Tessin.<br />
Waadt<br />
Wallis<br />
Neuen burg<br />
Genf .<br />
1785<br />
1276<br />
287<br />
43<br />
70<br />
18<br />
19<br />
73<br />
85<br />
119<br />
473<br />
598<br />
242<br />
163<br />
49<br />
5<br />
471<br />
152<br />
670<br />
265<br />
220<br />
525<br />
211<br />
327<br />
413<br />
209<br />
149<br />
33<br />
5<br />
8<br />
2<br />
2<br />
9<br />
10<br />
14<br />
55<br />
70<br />
28<br />
19<br />
6<br />
1<br />
55<br />
18<br />
78<br />
31<br />
26<br />
61<br />
25<br />
38<br />
48<br />
171<br />
167<br />
48<br />
6<br />
15<br />
4<br />
4<br />
8<br />
9<br />
32<br />
37<br />
42<br />
24<br />
12<br />
10<br />
3<br />
64<br />
28<br />
65<br />
31<br />
36<br />
78<br />
33<br />
28<br />
45<br />
2038<br />
1494<br />
1171<br />
1444<br />
928<br />
779<br />
897<br />
1875<br />
1810<br />
726<br />
2509<br />
2753<br />
1948<br />
2609<br />
1009<br />
346<br />
1426<br />
1064<br />
2010<br />
1673<br />
1206<br />
1313<br />
1246<br />
2318<br />
1785<br />
Schweiz . 8559<br />
1000<br />
1000<br />
1673<br />
Die Gegenüberstellung <strong>der</strong> kantonalen Promilleanteile an <strong>der</strong> Gesamtlohnsumme und an <strong>der</strong> Wohnbevölkerung<br />
gestattet, die einzelnen Kantone hinsichtlich Belegung mit versicherungspflichtigen Industrien<br />
und Gewerben zu vergleichen. Bemerkenswert ist, dass die Kantone Wallis und Graubünden dank<br />
Grosskraftwerkbauten die durchschnittliche versicherte Lohnsumme je Einwohner seit 1950 verdoppeln<br />
konnten. Aufschlussreich für die Kenntnis <strong>der</strong> schweizerischen Wirtschaftsstruktur ist auch die in <strong>der</strong><br />
Anhangstabelle 2 gegebene Übersicht über die Verteilung <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme 1957 nach Kantonen<br />
und Industrie- und Gewerbezweigen.<br />
Die Zahl <strong>der</strong> Versicherten<br />
Der Versicherungsbestand würde zweifellos am anschaulichsten durch dieZahl<strong>der</strong> Versichertenwie<strong>der</strong>gegeben.<br />
Diese Grösse wird aber nicht unmittelbar erhoben, weil sie für die Durchführung <strong>der</strong> obligatorischen<br />
<strong>Unfallversicherung</strong> nicht erfor<strong>der</strong>lich ist und erfahrungsgemäss auch nicht ohne weiteres zur Verfügung<br />
steht. Zudem ist es für eingehen<strong>der</strong>e Untersuchungen des Unfallrisikos zweckmässiger, als Risiko<br />
11
einheit anstelle des Versicherten eine Risikodauer zu wählen. Es liegt deshalb nahe, die Zahl <strong>der</strong> Versicherten<br />
auf Grund <strong>der</strong> verhältnismässig einfacher zu erhaltenden Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden zu schätzen.<br />
Obwohl im Interesse einer einwandfreien Risikobeurteilung die genaue Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden<br />
wünschbar wäre und gestützt auf Art.64 K<strong>UVG</strong> von den Betriebsinhabern auch erfahren werden<br />
könnte, unterbleibt eine unmittelbare Erhebung mit Rücksicht auf die damit verbundenen administrativen<br />
Umtriebe. Zur Bestimmung <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden wird die versicherte jährliche Lohnsumme,<br />
wie sie die Betriebe in ihren für die Prämienberechnung einzureichenden Lohnerklärungen ausweisen,<br />
durch den geschätzten mittleren Stundenverdienst <strong>der</strong> entsprechenden Versicherten dividiert.<br />
Die Zuverlässigkeit <strong>der</strong> so ermittelten jährlichen Arbeitsstundenzahl hängt von <strong>der</strong> Güte <strong>der</strong> Schätzung<br />
<strong>der</strong> Durchschnittslöhne <strong>der</strong> Versicherten ab. Die Schätzung besteht in <strong>der</strong> Annahme, <strong>der</strong> zu bestimmende<br />
mittlere Stundenverdienst <strong>der</strong> Versicherten sei gleich gross wie <strong>der</strong> durchschnittliche Stundenverdienst <strong>der</strong><br />
Verunfallten. Dieser ist aus <strong>der</strong> Krankengeldabrechnung erhältlich und um so zuverlässiger bestimmbar,<br />
je zahlreicher die zur Verfügung stehenden Lohnangaben sind. Deshalb wird <strong>der</strong> Durchschnittslohn <strong>der</strong><br />
Verunfallten und damit auch die Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden nicht für einzelne Betriebe, son<strong>der</strong>n nur für die<br />
im Prämientarif <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung vorgesehenen Gefahrenklassen bestimmt, und zwar anhand<br />
<strong>der</strong> sich sowohl für die Betriebs- als auch für die Nichtbetriebsunfälle ergebenden Krankengeldabrechnungen.<br />
Wenn dennoch in manchen Gefahrenklassen die Zahl <strong>der</strong> jährlichen Krankengeldabrechnungen<br />
gering ausfällt, ist es trotzdem möglich, die Zuverlässigkeit des Durchschnittslohnes zu beurteilen,<br />
sei es durch Vergleich mit den früheren Mittellöhnen <strong>der</strong>selben Gefahrenklasse, sei es durch Vergleich mit<br />
<strong>der</strong> Lohnentwicklung in verwandten Gefahrenklassen. Ob die Verunfallten hinsichtlich Entlöhnung eine<br />
einseitige Auslese aus <strong>der</strong> Gesamtheit <strong>der</strong> Versicherten bilden, kann nicht entschieden werden, weil die<br />
Glie<strong>der</strong>ung des Versichertenbestandes nach Alter, Geschlecht, Beruf, Unfallgefährdung und so weiter unbekannt<br />
ist. Immerhin bestätigen vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit durchgeführte Vollerhebungen<br />
in einzelnen Industriezweigen, denen nachträglich bestimmte Gefahrenklassen zugeordnet<br />
werden konnten, dass zwischen den unmittelbar erhobenen Mittellöhnen <strong>der</strong> Versicherten und den aus<br />
den Krankengeldabrechungen bestimmten Mittellöhnen <strong>der</strong> Verunfallten gute Übereinstimmung besteht.<br />
Ebenso einfach wie <strong>der</strong> Schluss von den Mittellöhnen <strong>der</strong> Verunfallten auf die Zahl <strong>der</strong> in den einzelnen<br />
Gefahrenklassen jährlich geleisteten Arbeitsstunden vollzieht sich <strong>der</strong> Übergang von <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden<br />
auf die entsprechende Zahl <strong>der</strong> Versicherten. Als Norm für die jährliche Arbeitszeit eines Versicherten<br />
wurde bisher eine Dauer von<br />
300 Tagen zu 8 Arbeitsstunden = 2400 Arbeitsstunden = 1 Vollarbeiter<br />
angenommen, so dass die geschätzte Zahl <strong>der</strong> Versicherten aus <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> durch 2400 dividierten Arbeitsstunden<br />
hervorgeht. Die Dauer von 2400 Arbeitsstunden entsprach früher im allgemeinen <strong>der</strong> mittleren<br />
Jahresleistung eines Vollbeschäftigten. Wie eine Untersuchung gezeigt hat, gilt dies auch noch für die<br />
Berichtsperiode. Denn die während <strong>der</strong> Berichtsperiode eingetretene Verkürzung <strong>der</strong> ordentlichen Arbeitszeit<br />
wurde weitgehend durch Überstunden ausgeglichen. Deshalb ist die Vergleichbarkeit <strong>der</strong> neuesten Erfahrungen<br />
mit früheren Ergebnissen gewährleistet. Wie lange aber <strong>der</strong> herkömmliche VollarbeiterbegriA<br />
angesichts weiterer Arbeitszeitverkürzungen zur Schätzung <strong>der</strong> Versichertenzahl dienen kann, wird die<br />
Zukunft erweisen. Die Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden, die für sich schon ein Mass für den Umfang des Versichertenbestandes<br />
darstellt, wird jedenfalls die Grundlage für die Schätzung <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Versicherten<br />
bleiben.<br />
Die Zahl <strong>der</strong> in den unterstellten Betrieben geleisteten Arbeitsstunden stieg von 2458 Millionen im<br />
Jahre 1952 auf 2987 Millionen im Jahre 1957. Entsprechend nahm die auf Grund <strong>der</strong> Arbeitsstundenzahl<br />
errechnete Zahl <strong>der</strong> Versicherten innert 5 Jahren um 21 Prozent zu, nämlich von 1,024 Millionen auf 1,244<br />
Millionen. Darin kommt wie<strong>der</strong>um die seit Jahren andauernde günstige Wirtschaftslage zum Ausdruck.<br />
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welcher Anteil <strong>der</strong> Wohnbevölkerung und <strong>der</strong> Berufstätigen<br />
von <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> erfasst wird. Während es im Jahre 1952 auf 1000 Einwohner<br />
213 Versicherte traf, stieg diese Zahl bis 1957 auf 243 Versicherte. Da erst die nächste Volkszählung<br />
Unterlagen zur Beantwortung <strong>der</strong> Frage hinsichtlich <strong>der</strong> Berufstätigen liefert, sei auf die im letzten Bericht<br />
angeführten Zahlen verwiesen. So betrug im Volkszählungsjahr 1950 <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> obligatorisch Versicherten<br />
an <strong>der</strong> Gesamtheit <strong>der</strong> Berufstätigen überhaupt 43 Prozent und an <strong>der</strong> Gesamtheit <strong>der</strong> unselb<br />
12
ständig Berufstätigen 53 Prozent. Beim Anteil <strong>der</strong> weiblichen Versicherten am Versicherungsbestand<br />
traten seit <strong>der</strong> letzten Berichtsperiode keine wesentlichen Verschiebungen ein. Der leichte Rückgang ihres<br />
Anteils an <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme ist eine Folge <strong>der</strong> seit einigen Jahren wie<strong>der</strong> zunehmenden Differenzierung<br />
zwischen Männer- und Frauenlöhnen.<br />
Anteil <strong>der</strong> weiblichen Versicherten am Versicherungsbestand<br />
938 943 Jahre<br />
in "/~~ <strong>der</strong><br />
Versicherten<br />
948 953 †19 231<br />
219<br />
220<br />
220<br />
in "/,<br />
versich<br />
Lohns<br />
14<br />
151<br />
164<br />
163<br />
Abschliessend sei noch eine zusammenfassende Übersicht über die Entwicklung <strong>der</strong> den Versicherungsbestand<br />
kennzeichnenden Grössen gegeben.<br />
Der Versicherungsbestand<br />
Bestandesgrössen<br />
1953<br />
1954<br />
1955 1956<br />
1957<br />
absolute Zahlen<br />
Unterstellte Betriebe.<br />
Unterstellte Betriebsteile .<br />
60 283<br />
80 635<br />
61 307<br />
81 867<br />
62 499<br />
83 495<br />
63 335<br />
84 695<br />
64 241<br />
86 231<br />
Versicherte Lohnsumme in Millionen Franken<br />
Total<br />
Männer<br />
Frauen<br />
Arbeitsstunden in Millionen<br />
Versicherte in Tausend....... Total<br />
Männer<br />
Frauen<br />
6 683<br />
5 599<br />
1 084<br />
2 516<br />
1 049<br />
818<br />
231<br />
6 968<br />
5 835<br />
1 133<br />
2 586<br />
1 078<br />
842<br />
236<br />
7 433<br />
6 221<br />
1 212<br />
2 702<br />
1 126<br />
879<br />
247<br />
8 006<br />
6 679<br />
1 327<br />
2 812 2 987<br />
l 171<br />
911<br />
260<br />
9 248<br />
7 767<br />
1 481<br />
1 244<br />
971<br />
273<br />
Durchschni t tszahlen<br />
Mittlere Zahl <strong>der</strong> Versicherten eines Betriebes ..<br />
Mittlere Zahl <strong>der</strong> Versicherten eines Betriebsteils<br />
17<br />
13<br />
18<br />
13<br />
18<br />
13<br />
18<br />
14<br />
19<br />
14<br />
Mittlere versicherte Lohnsumme eines Betriebes in<br />
Franken.<br />
Mittlere versicherte Lohnsumme eines Betriebsteils<br />
in Franken.<br />
111 000<br />
83 000<br />
114 000 119 000 126 000<br />
85 000 89 000 95 000<br />
144 000<br />
107 000<br />
Mittlere versicherte Lohnsumme in Franken<br />
— einer versicherten Person.<br />
— eines männlichen Versicherten<br />
— einer weiblichen Versicherten .<br />
6 370<br />
6 840<br />
4 690<br />
6 460<br />
6 930<br />
4 800<br />
6 600<br />
7 080<br />
4 910<br />
6 840<br />
7 330<br />
5 100<br />
7 430<br />
8 000<br />
5 420<br />
13
Die unterschiedliche Entwicklung einzelner Bestandesgrössen seit 1952 wird in folgen<strong>der</strong> Darstellung<br />
veranschaulicht.<br />
() '<br />
rO<br />
50<br />
Die prozentuale Zunahme des Versicherungsbestandes seit 1952<br />
Versicherte Lohnsumme<br />
40<br />
30<br />
20<br />
Arbeitsstunden<br />
(Versicherte)<br />
10<br />
Unterstellte Betriebsteile<br />
Unterstellte Betriebe<br />
1953 1954 1955 1956 1957<br />
Um schliesslich die Verän<strong>der</strong>ung des Versicherungsbestandes während <strong>der</strong> Berichtsperiode im Rahmen<br />
<strong>der</strong> Gesamtentwicklung zu überblicken, sei auf die Anhangstabelle 1 verwiesen. Sie enthält die Bestandesgrössen<br />
seit 1918, dem ersten Geschäftsjahr <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt.<br />
Angesichts <strong>der</strong> in dieser Anhangstabelle sichtbaren Verän<strong>der</strong>ungen stellt sich die Frage nach <strong>der</strong>en Einfluss<br />
auf den Finanzhaushalt <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong>. Art.48 K<strong>UVG</strong> schreibt als Finanzsystem<br />
das Kapitaldeckungsverfahren vor. Danach müssen die Unfallkosten eines Jahres durch die Prämien<br />
des betreflenden Jahres gedeckt werden, wobei für die Rentenleistungen ausreichende Deckungskapitalien<br />
bereitzustellen sind. Bei diesem Finanzsystem trägt also jede Generation die auf sie entfallenden<br />
Versicherungslasten, so dass Bestandesverän<strong>der</strong>ungen ohne Einfluss auf die Erfüllbarkeit <strong>der</strong> Rentenverpflichtungen<br />
bleiben. Weiteres zu dieser Frage ist dem Kapitel «Kapitaldeckungs- und Umlageverfahren<br />
in <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong>» im Bericht über die Beobachtungsperiode 1948 — 1952<br />
zu entnehmen.
Die Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Als Unfälle werden die eigentlichen Unfälle, die Berufskrankheiten und die beruflichen Schädigungen<br />
gezählt, sofern die Entschädigungsberechtigung anerkannt wurde und Versicherungsleistungen auszurichten<br />
waren. Nicht als Unfälle erfasst werden also Ereignisse, die keine Versicherungsleistungen zur<br />
Folge hatten o<strong>der</strong> bei denen die Leistungspflicht verneint werden musste.<br />
Die Unfallzahlen allein besitzen selbstverständlich nur eine beschränkte Aussagekraft. Eine richtige<br />
Beurteilung ist erst möglich, wenn sie im Rahmen einer längern zeitlichen Entwicklung betrachtet und auf<br />
den Versicherungsbestand bezogen werden. In diesem Zusammenhang sei auf das Kapitel über Unfallhäufigkeit<br />
und Unfallschwere verwiesen, wo die Unfallzahlen zum Versicherungsbestand in Beziehung<br />
gesetzt werden, sowie auf die Anhangstabelle 3, welche die Unfallzahlen <strong>der</strong> Berichtsperiode nach Gefahrenklassen<br />
enthält.<br />
Im vorliegenden Kapitel wird zunächst die Zahl <strong>der</strong> Unfälle besprochen. Die mit Beispielen belegten<br />
Ausführungen über Kollektivunfälle dürften wie<strong>der</strong>um auf beson<strong>der</strong>es Interesse stossen. Den Abschluss<br />
des Kapitels bilden einige kurze Hinweise auf die abgelehnten Fälle.<br />
Die Unfälle<br />
Zur Vereinfachung <strong>der</strong> Unfallmeldung und <strong>der</strong> Unfallerledigung werden die Unfälle nach Bagatellunfällen<br />
und ordentlichen Unfällen unterschieden. Als Bagatellunfall gilt ein Unfall, <strong>der</strong> keine Arbeitsaussetzung<br />
o<strong>der</strong> eine solche von höchstens drei Tagen einschliesslich Unfalltag zur Folge hatte und <strong>der</strong><br />
nicht mehr als fünf Arztkonsultationen erfor<strong>der</strong>te. Je<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Unfall gilt als ordentlicher Unfall.<br />
Diese Aufteilung wird auch für die Unfallstatistik übernommen. Bei statistischen Untersuchungen<br />
muss jeweils die den beson<strong>der</strong>n Gegebenheiten entsprechende Unfallart zugrunde gelegt werden; so wird<br />
bald auf die Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle allein, bald auf die Gesamtzahl <strong>der</strong> Unfälle abzustellen sein.<br />
Di e Bagatellunfä lle<br />
Mit leichten Verletzungen und Schädigungen ist im Berufs- und Privatleben je<strong>der</strong>zeit zu rechnen.<br />
Wenn sich <strong>der</strong> Versicherte für ärztliche Behandlung entscheidet, sind auch Bagatellen durch den Betriebsinhaber<br />
<strong>der</strong> <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt zu melden. Ob eine Bagatelle zur Anmeldung kommt, liegt also<br />
weitgehend im persönlichen Ermessen des Versicherten und hängt auch vom Ausbau des Sanitätsdienstes<br />
in den Betrieben ab, da die sofortige Versorgung von geringfügigen Verletzungen o<strong>der</strong> Schädigungen oft<br />
eine ärztliche Behandlung erübrigt. Um möglichst einheitliche Voraussetzungen für die Unfallanmeldung<br />
und die Behandlung <strong>der</strong> Verletzten zu erreichen, hat die <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt in ihrer Wegleitung<br />
«Samariterhilfe bei Unfällen» die Befugnisse <strong>der</strong> Betriebssamariter abgegrenzt.<br />
ln beiden Versicherungsabteilungen ist gegenüber <strong>der</strong> vorausgehenden Berichtsperiode eine Zunahme<br />
<strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Bagatellunfälle um rund einen Viertel festzustellen. Aber auch das zahlenmässige Verhältnis<br />
zwischen Bagatellunfällen und ordentlichen Unfällen hat sich beachtenswert verschoben. Die zunehmende<br />
Bedeutung <strong>der</strong> Bagatellunfälle gegenüber den ordentlichen Unfällen, die sich bereits in <strong>der</strong> Vorperiode abzuzeichnen<br />
begann, dürfte zum Teil auf eine Ausdehnung <strong>der</strong> Samariter- und Werkarztdienste zurückzuführen<br />
sein. Denn bei sofortiger und fachgemässer Behandlung <strong>der</strong> Verunfallten kann sehr oft das Heilverfahren<br />
abgekürzt und eine längere Arbeitsaussetzung vermieden werden. Manche Unfälle, die früher<br />
als ordentliche erfasst worden wären, wan<strong>der</strong>n so zu den Bagatellunfällen ab.<br />
15
Die Zahl <strong>der</strong> Bagatellunfälle<br />
Betriebsun fallversicherung<br />
Nichtbetriebsun<br />
fallversicheru n<br />
absolut<br />
auf 1000<br />
ordentliche<br />
Unfälle<br />
absolut<br />
auf 1<br />
ordent<br />
Unf<br />
52<br />
459 026<br />
796<br />
138 140 43<br />
100 678<br />
106 700<br />
113 705<br />
120 646<br />
126 310<br />
872<br />
906<br />
907<br />
927<br />
934<br />
32 353<br />
32 200<br />
34 532<br />
35 954<br />
37 675<br />
47<br />
49<br />
50<br />
50<br />
51<br />
57<br />
568 039 910 172 714<br />
49<br />
Entfielen während <strong>der</strong> Berichtsperiode in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung auf 1000 ordentliche 910<br />
Bagatellunfälle, so betrug die entsprechende Zahl in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung nur 498. Der<br />
deutliche Unterschied ist zur Hauptsache den Augenunfällen zuzuschreiben, die in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung<br />
rund die Hälfte <strong>der</strong> Bagatellunfälle ausmachen, während sie bei den Nichtbetriebsunfällen<br />
nur eine untergeordnete Rolle spielen.<br />
Wie aus <strong>der</strong> anschliessenden Zusammenstellung ersichtlich ist, handelt es sich bei <strong>der</strong> verhältnismässigen<br />
Zunahme <strong>der</strong> Bagatellunfälle in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung um eine allgemeine Erscheinung.<br />
Dass das Zahlenverhältnis zwischen Bagatell- und ordentlichen Unfällen in den einzelnen Industrie- und<br />
Gewerbezweigen sehr unterschiedlich ist, kann nicht überraschen, hängt doch die Art und damit die<br />
Schwere <strong>der</strong> Verletzungen und Schädigungen weitgehend von <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Arbeit und den betrieblichen<br />
Einrichtungen ab.<br />
Anzahl Bagatellunfälle auf 1000 ordentliche Betriebsunfälle<br />
nach Industrie- und Gewerbezweigen<br />
Gruppen von Gefahrenklassen nach dem Prämientarif 1948-1952 1953-1957<br />
Steine und Erden .<br />
Metallindustrie (ohne Uhrenindustrie) .<br />
Uhrenindustrie .<br />
Holzindustrie<br />
Le<strong>der</strong>, Kork, Kunststoffe; Papier, graphische Gewerbe<br />
Textilindustrie<br />
Zeughäuser<br />
Chemische Industrie, Nahrungs- und Genussmittel .<br />
Gewinnung und Verarbeitung von Gestein und Mineralien<br />
Bau wesen<br />
Waldwirtschaft .<br />
Bahnen .<br />
An<strong>der</strong>e Transportunternehmungen, Handelsbetriebe.<br />
Licht-, Kraft- und Wasserwerke<br />
K inos . ~ ~<br />
Büros, Verwaltungen<br />
633<br />
1246<br />
1557<br />
641<br />
738<br />
730<br />
884<br />
650<br />
471<br />
578<br />
186<br />
1022<br />
603<br />
949<br />
796<br />
905<br />
683<br />
1427<br />
1615<br />
737<br />
amtbestand 796 910<br />
821<br />
810<br />
951<br />
745<br />
582<br />
689<br />
237<br />
1151<br />
686<br />
1080<br />
837<br />
1035<br />
16
Der Anhangstabelle 3 kann entnommen werden, dass die einzelnen Gefahrenklassen hinsichtlich <strong>der</strong><br />
Bedeutung <strong>der</strong> Bagatellunfälle noch ausgeprägtere Unterschiede als die Industrie- und Gewerbezweige<br />
zeigen. Die Bauschlosserei (Gefahrenklasse 9e) weist mit 2641 Bagatellunfällen auf 1000 ordentliche Unfälle<br />
den höchsten und das Holzfällen und <strong>der</strong> Holztransport (Gefahrenklasse 42e) mit 104 den niedrigsten<br />
Wert auf.<br />
Die ordentlichen Unfälle<br />
Bei den ordentlichen Unfällen handelt es sich um Unfälle, die eine Arbeitsaussetzung von mehr als<br />
drei Tagen einschliesslich Unfalltag zur Folge hatten o<strong>der</strong> mehr als fünf Arztkonsultationen erfor<strong>der</strong>ten.<br />
In <strong>der</strong> nachstehenden Tabelle sind auch die in <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle enthaltenen Invaliditätsund<br />
Todesfälle angegeben.<br />
Die Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle<br />
Jahre<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
Betriebs unfallversicherung<br />
I nvaliditätsfälle<br />
absolut<br />
davon<br />
Todesfälle<br />
in "/„absolut in "/«<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
Nichtbetrieb<br />
I n val iditä t sfäl le<br />
Todesfälle<br />
absolut in "/„„absolut in '/„„<br />
1948 — 1952 576 481 17 550 30 1 933 3,4 315 707 7 525 24 1 638 5,2<br />
1953<br />
1954<br />
1955<br />
1956<br />
1957<br />
115 413<br />
117 808<br />
125 415<br />
130 211<br />
135 269<br />
3 775<br />
3 868<br />
3 995<br />
4 318<br />
4 413<br />
33<br />
33<br />
32<br />
33<br />
33<br />
392<br />
386<br />
411<br />
435<br />
429<br />
3,4<br />
3,3<br />
3,3<br />
3,3<br />
3,2<br />
1953 — 1957 624 116 20 369 33 2 053 3,3<br />
68 064 1 623<br />
65 683 1 702<br />
69 055 1 750<br />
70 672 1 877<br />
73 023 1 847<br />
24<br />
26<br />
25<br />
27<br />
25<br />
321<br />
388<br />
402<br />
398<br />
450<br />
4,7<br />
5,9<br />
5,8<br />
5,6<br />
6,2<br />
346 497 8 799 25 1 959 5,7<br />
Die Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle aus <strong>der</strong> Berichtsperiode ist grösser als diejenige <strong>der</strong> Jahre 1948 — 1952,<br />
und zwar um 8 Prozent in <strong>der</strong> Betriebsunfall- und um 10 Prozent in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung.<br />
Während die Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Betriebsunfälle Jahr für Jahr fast gleichmässig anstieg, verlief die Entwicklung<br />
in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung unregelmässiger. Erfahrungsgemäss unterliegt die Zahl<br />
<strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle in höherem Masse zufälligen Schwankungen als die Zahl <strong>der</strong> Betriebsunfälle. Bis<br />
zu einem gewissen Grade ist dies eine Folge <strong>der</strong> Wetterabhängigkeit <strong>der</strong> Sport- und Verkehrsunfälle, die<br />
zusammen rund zwei Drittel <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle ausmachen.<br />
Die Zahl <strong>der</strong> Invaliditä tsfälle hat in beiden Abteilungen um je 16 Prozent zugenommen. Die Promilleanteile<br />
sind gegenüber <strong>der</strong> vorangehenden Periode leicht von 30 auf 33 beziehungsweise von 24 auf 25 angestiegen.<br />
Die Zunahme <strong>der</strong> Todesfälle hält sich in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung mit 6 Prozent im Rahmen des<br />
Anstiegs <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle. Beeindruckend ist die Zunahme in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung,<br />
nicht nur, weil die Zahl <strong>der</strong> Todesfälle gegenüber den Jahren 1948 — 1952 um 20 Prozent anstieg, son<strong>der</strong>n<br />
auch, weil diese Zahl diejenige <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung im Jahre 1957 erstmals in <strong>der</strong> Geschichte<br />
<strong>der</strong> <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt erheblich übertroffen hat.<br />
Die Promilleanteile <strong>der</strong> Invaliditäts- und Todesfälle gestatten gewisse Rückschlüsse auf das Unfallgeschehen.<br />
Während die auf Grund <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle ermittelten Promillezahlen in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung<br />
sozusagen unverän<strong>der</strong>t blieben und sich durchwegs im Verhältnis zehn zu eins verhalten,<br />
zeigen sich in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung erwartungsgemäss grössere Schwankungen.<br />
Die festgestellte Abwan<strong>der</strong>ung ordentlicher Unfälle zu den Bagatellunfällen legt es nahe, auch den<br />
Promilleanteil <strong>der</strong> Invaliditäts- und Todesfälle an <strong>der</strong> Gesamtzahl <strong>der</strong> Unfälle zu ermitteln.<br />
17
Zahl <strong>der</strong> Invaliditäts- und Todesfälle in Promillen <strong>der</strong> Unfälle<br />
ahre<br />
Betriebsun fallversicherung<br />
I nvaliditätsfälle<br />
Todesfälle<br />
N ichtbetriebsunfallversicherung<br />
I nvaliditätsfälle<br />
Todesfälle<br />
1948-1952<br />
17<br />
1,9 17 3,6<br />
1953<br />
1954<br />
1955<br />
1956<br />
1957<br />
17<br />
17<br />
17<br />
17<br />
17<br />
1,8<br />
1,7<br />
1,7<br />
1,7<br />
1,6<br />
16<br />
17<br />
17<br />
18<br />
17<br />
3,2<br />
40<br />
3,9<br />
3,7<br />
4,1<br />
1953-1<br />
Die grössere Zufallsabhängigkeit des Anteils <strong>der</strong> Todesfälle in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
kommt wie<strong>der</strong>um zum Ausdruck. Interessant ist die Feststellung, dass während <strong>der</strong> zwei letzten Beobachtungsperioden<br />
in beiden Versicherungsabteilungen rund je<strong>der</strong> 60. Unfall Invaliditätsfolgen nach sich zog.<br />
Diese Übereinstimmung erscheint um so auffälliger, als zwischen den beiden Abteilungen hinsichtlich <strong>der</strong><br />
Unfallsterblichkeit ein wesentlicher Unterschied besteht. Während in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung nur<br />
je<strong>der</strong> 600. Unfall tödlich ausging, traf es in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung bereits auf durchschnittlich<br />
260 Unfälle einen Todesfall. Die beiden Darstellungen auf Seite 19 vermitteln ein anschauliches Bild<br />
<strong>der</strong> genannten Unfallzahlen.<br />
Kollektivunfälle<br />
Kollektivunfälle sind Ereignisse, die gleichzeitig mehrere Opfer for<strong>der</strong>n. Im vorliegenden Bericht werden<br />
aber nur jene Ereignisse berücksichtigt, bei denen 5 o<strong>der</strong> mehr Versicherte einen Unfall erlitten. Diese<br />
Ereignisse können den beiden Versicherungsabteilungen nicht wie üblich zugewiesen werden, da ein und<br />
<strong>der</strong>selbe Kollektivunfall sowohl Betriebs- als auch Nichtbetriebsunfälle verursachen kann.<br />
Zahl <strong>der</strong> Kollektivunfälle<br />
Jahre<br />
1948 †19<br />
74<br />
1953<br />
1954<br />
1955<br />
1956<br />
1957<br />
Zahl<br />
<strong>der</strong> Ereignisse<br />
Kol lektivun fälle<br />
Zahl<br />
<strong>der</strong> Verunfallten<br />
Zahl <strong>der</strong> Betriebsund<br />
Nichtbet<br />
riebsun fälle<br />
666 1 489 354<br />
13<br />
19<br />
17<br />
23<br />
25<br />
110<br />
175<br />
144<br />
161<br />
217<br />
316 508<br />
322 391<br />
342 707<br />
357 483<br />
372 277<br />
1957 97 807 1 711 366
Die Zahl <strong>der</strong> Unfälle 1953 — 1957<br />
Bagatel 1 unfälle<br />
Ordentliche Unfälle ohne Rentenfolgen<br />
Zahl <strong>der</strong><br />
Unfälle<br />
L Invaliditäts- und Todesfälle<br />
1 200000<br />
l 000000<br />
800000<br />
600000<br />
400000<br />
200000<br />
Betriebsun fallversicherung<br />
N ichtbetriebsunfallversicherung
In <strong>der</strong> Berichtsperiode wurden auf insgesamt 1,7 Millionen Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle 97 Kollektivunfälle<br />
beobachtet, bei denen zusammen 807 Versicherte verunfallten. Die Zahl <strong>der</strong> Kollektivunfälle<br />
ist demnach äusserst gering und, was bei diesen seltenen Ereignissen nicht überrascht, grossen zeitlichen<br />
Schwankungen unterworfen. Dies kommt auch in <strong>der</strong> folgenden Aufteilung gut zum Ausdruck, obwohl die<br />
Beobachtungen je aus fünf Jahren zusammengefasst wurden.<br />
Zahl <strong>der</strong> Kollektivunfälle nach <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Ereignisse<br />
davon Kollisionen: Motorfahrzeug — Eisenbahn<br />
Motorfahrzeug — Bergbahn .<br />
Motorfahrzeu — Strassenbahn<br />
Motorfahrzeu — Motorfahrzeu<br />
Motorfahrzeug — Fussgän er<br />
Flugunglücke<br />
Werkverkehrsunglücke (Roll- und Seil bahnen)<br />
B rande<br />
~ ~<br />
Explosionen .<br />
Sprengunglücke<br />
Einstürze von Gebäuden, Gerüsten, Schächten, Stollen<br />
Lawinen, Felsstürze, Erdrutsche<br />
Vergiftungen und berufliche Schädigungen ~<br />
Unglücke beim Sport und bei Sportveranstaltungen .<br />
Raufereien.<br />
T otal .<br />
1<br />
4<br />
7<br />
5<br />
6<br />
13<br />
4<br />
12<br />
74 97<br />
5<br />
13<br />
Rund die Hälfte aller Kollektivunfälle sind Verkehrsunfälle, und an diesen waren vorwiegend Motorfahrzeuge<br />
beteiligt. Eindringlich und nicht bloss durch das Wirken des Zufalls erklärbar ist die sprunghafte<br />
Zunahme <strong>der</strong> Zusammenstösse zwischen Motorfahrzeugen. Die auffällige Häufung <strong>der</strong> Einstürze<br />
dürfte eine Folge <strong>der</strong> überaus regen Bautätigkeit <strong>der</strong> letzten Jahre sein; fünf solche folgenschwere Ereignisse<br />
waren allein bei Grosskraftwerkbauten zu verzeichnen.<br />
Die 97 Kollektivunfälle hatten 572 Betriebs- und 235 Nichtbetriebsunfälle zur Folge, was nur 0,5 Promillen<br />
aller Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle entspricht. Die Unfallkosten dieser 807 Unfälle betrugen<br />
7,2 Millionen Franken o<strong>der</strong> 8 Promille <strong>der</strong> Unfallkosten bei<strong>der</strong> Versicherungsabteilungen. Wenn demnach<br />
8 Promille aller Unfallkosten auf nur 0,5 Promille aller Unfälle entfallen, muss es sich um sehrschwere<br />
Unfälle handeln. In <strong>der</strong> Tat wurden für jeden dieser 807 Unfälle im Mittel 8900 Franken aufgewendet,<br />
gegenüber durchschnittlich 530 Franken für jeden <strong>der</strong> 1,7 Millionen Unfälle des Gesamtbestandes. Dieser<br />
Kostenunterschied hat seinen Grund in <strong>der</strong> ungleichen Rentenhäufigkeit: Während 100 durch Kollektivereignisse<br />
verursachte ordentliche Unfälle zu 25 Invaliditäts- o<strong>der</strong> Todesfällen führten, waren es von 100<br />
ordentlichen Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen nur <strong>der</strong>en 3. Bemerkenswert ist auch die Verdoppelung<br />
<strong>der</strong> durchschnittlichen Aufwendungen für ein Kollektivunfallereignis: sie betrugen 74000 Franken gegenüber<br />
40000 Franken in den Jahren 1948 — 1952. Zu dieser Steigerung, die noch durchaus als zufallsbedingt<br />
betrachtet werden kann, hat das Zusammentreffen dreier ausserordentlicher Kollektivunfälle mit je über<br />
500000 Franken U nfallkosten beigetragen.<br />
Es liegt auf <strong>der</strong> Hand, dass <strong>der</strong>artige Ereignisse den durch die Festsetzung angemessener Prämien angestrebten<br />
zeitlichen Ausgleich <strong>der</strong> Versicherungsergebnisse in den einzelnen Risikobeständen stören<br />
20
können. Diese Gefahr besteht in erhöhtem Masse bei kleinen Gefahrenklassen mit grossem Kollektivunfallrisiko.<br />
ln <strong>der</strong> kleinen Gefahrenklasse 50a (Piloten und Bordpersonal von Flugbetrieben) sind beispielsweise<br />
6 von den insgesamt 98 Unfällen <strong>der</strong> Berichtsperiode bei einem Ereignis eingetreten, das über<br />
40 Prozent <strong>der</strong> Unfallkosten dieser Gefahrenklasse zur Folge hatte. Dass durch Kollektivunfälle auch das<br />
finanzielle Gleichgewicht grösserer Gefahrenklassen gestört werden kann, zeigen wie<strong>der</strong>um die neuesten<br />
Erfahrungen. So geht in <strong>der</strong> Gefahrenklasse 32c (Fabrikation von pharmazeutischen, kosmetischen und<br />
diätetischen Produkten) ein Viertel <strong>der</strong> Unfallkosten aufein einziges Ereignis zurück.<br />
Wenn auch die Versicherten bisher von eigentlichen Katastrophen verschont blieben, muss die <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt<br />
doch gegen die Folgen solcher je<strong>der</strong>zeit möglichen Ereignisse gewappnet sein. Das<br />
K<strong>UVG</strong> schreibt zu diesem Zweck in Art.49 die Äufnung eines Reservefonds vor, <strong>der</strong> bis Ende 1957 auf<br />
40 Millionen Franken angewachsen ist, damit aber erst rund einen Drittel des gesetzlich vorgesehenen Mindestbetrages<br />
erreicht hat. Diese Reserve steht zur Verfügung, wenn die Ausgleichsfonds <strong>der</strong> beiden Versicherungsabteilungen<br />
die durch Katastrophen verursachten Schwankungen in den Betriebsrechnungen<br />
nicht mehr auffangen könnten.<br />
Abschliessend seien einige beson<strong>der</strong>s aufschlussreiche Kollektivunfälle kurz beschrieben:<br />
1. Vergiftungen durch Sprenggase in einem Stollen, März 1953.<br />
5 Tote, 2 Verletzte; 195000 Franken Unfallkosten.<br />
Während Arbeiten am Vortrieb explodierten 3 Kisten Sprengstoff, die in einer 200 m entfernten<br />
Nische aufbewahrt worden waren. Beim Versuch, durch die sich rasch ausbreitenden Explosionsgase<br />
ins Freie zu flüchten, brachen die sieben im Stollen beschäftigten Arbeiter nach etwa 300 m zusammen.<br />
Da keine Atemschutzgeräte zur Verfügung standen, verstrich mehr als eine Stunde, bis die Vergifteten<br />
geborgen werden konnten.<br />
2. Explosion in einer chemischen Fabrik, Mai 1954.<br />
5 Tote, 8 Invalide, 19 Verletzte; 740000 Franken Unfallkosten.<br />
Bei <strong>der</strong> Erhitzung von mehreren tausend Litern Azeton wurde das zur Entnahme von Proben<br />
dienende Guckloch des Destillators versehentlich nicht vollständig verschlossen. Durch diese Öffnung<br />
konnte Azeton entweichen. Aus unbekannten Gründen entzündete es sich und führte zu einer starken<br />
Explosion mit mehreren kleinen Bränden. Zum Glück hatte ein Teil <strong>der</strong> Arbeiter bereits beim Wahrnehmen<br />
des Azeton-Geruches das Arbeitslokal verlassen.<br />
3. Absturz einer Arbeitsbühne im Rheinhafen Birsfelden, Juli 1954.<br />
2 Tote, 3 Invalide; 270000 Franken Unfallkosten.<br />
Für die Montage einer Kranbrücke war ein an Ketten aufgehängter hölzerner Gerüstboden verwendet<br />
worden. Wahrscheinlich infolge unsachgemässer Befestigung an einer zudem nicht einwandfreien<br />
Kette stürzte ein Teil <strong>der</strong> Bühne samt fünf darauf arbeitenden Monteuren 10 m tief ab.<br />
4. Absturz eines Materialsilos beim Bau einer Staumauer, September 1954.<br />
6 Tote, 3 Verletzte; 295000 Franken Unfallkosten.<br />
Während des Auffüllens löste sich plötzlich das im sogenannten Betonturm aufgehängte, in mehrere<br />
Kammern von zusammen 800 m~ Fassungsvermögen unterteilte Materialsilo aus Eisenblech. Das halbgefüllte<br />
Silo durchschlug ein Stockwerk, tötete zwei dort befindliche Arbeiter und blieb auf dem Eisenbetonfundament<br />
des Turmes liegen, wo drei weitere Arbeiter den Tod fanden. Ein Arbeiter, <strong>der</strong> sich<br />
nicht im Sturzbereich des Silos aufhielt, wurde vom ausfliessenden Kiesmaterial verschüttet und konnte<br />
nur noch tot geborgen werden.<br />
5. Sprengunglück in einem Stollen, März 1955.<br />
4 Tote, 1 Verletzter; 260000 Franken Unfallkosten.<br />
Bei einer pyrotechnischen Sprengung ging aus unbekannten Gründen ein Schuss zu früh los, wobei<br />
alle mit dem Zünden beschäftigten Mineure ums Leben kamen; ein Handlanger, <strong>der</strong> sich in einiger<br />
Entfernung von <strong>der</strong> Stollenbrust befand, erlitt Verletzungen.<br />
21
6. Autounglück bei Landquart, April 1955.<br />
4 Tote, 1 Invali<strong>der</strong>; 180000 Franken Unfallkosten.<br />
Nach einer Versammlung fuhren fünf Teilnehmer mit dem Auto nach Hause. Vor <strong>der</strong> Brücke über<br />
die Landquart verfehlte das Auto vermutlich infolge übersetzter Geschwindigkeit — <strong>der</strong> Lenker stand<br />
unter Alkoholeinfluss — die leichte Kurve und raste in eine Brückenmauer.<br />
7. Absturz eines Lastwagens auf <strong>der</strong> Gotthardstrasse, Oktober 1955.<br />
1 Toter, 5 Verletzte; 130000 Franken Unfallkosten.<br />
Ein Lastwagen mit fünf Mitfahrern geriet auf <strong>der</strong> zufolge Strassenarbeiten eingeengten Fahrbahn<br />
über den Strassenrand und stürzte etwa 40 m einen Abhang hinunter.<br />
8. Brand und Explosion in einem Magazin, Oktober 1955.<br />
2 Tote, 22 Verletzte; 150000 Franken Unfallkosten.<br />
In einem Lager mit leicht brennbaren Materialien entstand durch Unvorsichtigkeit eines Arbeiters<br />
ein Brand. Ein explodierendes Benzinfass bespritzte die an den Räumungs- und Löscharbeiten beteiligten<br />
Leute mit brennendem Benzin.<br />
9. Absturz einer Dienstbrücke beim Bau eines Kraftwerkes, Juni 1956.<br />
4 Tote, 1 Verletzter; 300000 Franken Unfallkosten.<br />
Infolge Fehlens einer Abschrankung stürzte ein schwerer Betonkübel aus grosser Höhe auf eine<br />
Dienstbrücke. Durch den Aufprall kippte die Brücke, wobei vier von fünf darauf befindlichen Arbeitern<br />
80 m abstürzten. Ein Arbeiter, <strong>der</strong> sich im letzten Moment an einer Drahtseilschlaufe halten<br />
konnte, wurde mit nur leichten Verletzungen geborgen.<br />
10. Pontonunglück, Juli 1956.<br />
8 Tote, 6 Verletzte; 510000 Franken Unfallkosten.<br />
Ein Pontonierfahrverein unternahm mit 31 Mann eine Talfahrt auf dem damals Hochwasser<br />
führenden Rhein. Infolge falscher Einschätzung <strong>der</strong> Strömungsverhältnisse zerschellte <strong>der</strong> Ponton an<br />
<strong>der</strong> Rheinbrücke bei Trübbach, wobei elf Pontoniere, darunter acht Versicherte, ertranken. Die<br />
wenigen mitgeführten Schwimmwesten wurden als Sitzkissen benützt; einzelne Pontoniere waren des<br />
Schwimmens unkundig.<br />
11. Bergunglück im Rottalsattel, September 1956.<br />
4 Tote, 4 Verletzte; 115000 Franken Unfallkosten.<br />
Beim Abstieg von <strong>der</strong> Jungfrau, wobei wegen <strong>der</strong> ausserordentlich starken Vereisung alle Teilnehmer<br />
zusammen angeseilt waren, glitt im Rottalsattel <strong>der</strong> zweitvor<strong>der</strong>ste Mann einer Neunerpartie<br />
aus. Die ganze Seilschaft stürzte ab, wobei fünf Mann, darunter vier Versicherte, den Tod fanden.<br />
12. Absturz eines Schulflugzeuges, Juni 1957.<br />
9 Tote; 600000 Franken Unfallkosten.<br />
Begleitet von einem Fluglehrer unternahmen fünf angehende Verkehrspiloten zusammen mit zwei<br />
Ingenieuren und einem Techniker einen Schulungsflug. Aus unabgeklärten Gründen stürzte das Flugzeug<br />
aus grosser Höhe in den Bodensee, wobei sämtliche Insassen ums Leben kamen.<br />
13. Sprengunglück beim Bau eines Kraftwerkes, Juni 1957.<br />
9 Verletzte; 55000 Franken Unfallkosten.<br />
22<br />
Neun Arbeiter trafen an <strong>der</strong> Stollenbrust die letzten Vorbereitungen für die elektrische Zündung<br />
von 61 Sprengschüssen, als plötzlich fünf Schüsse detonierten. Glücklicherweise handelte es sich nur<br />
um sogenannte Helfer- o<strong>der</strong> Kranzschüsse, und offensichtlich hielt sich niemand im direkten Streubereich<br />
auf, so dass eine Katastrophe ausblieb.<br />
Der Unfall muss auf einen Blitzeinschlag in das überdeckende Gebirge zurückgeführt werden. Die<br />
entstehende Spannungsdifferenz an <strong>der</strong> Stollenbrust genügte, um die sehr empfindlichen elektrischen<br />
Sprengkapseln zur vorzeitigen Detonation zu bringen.
I<br />
14. Unfall auf einer Standseilbahn beim Bau eines Kraftwerkes, Juli 1957.<br />
9 Verletzte; 30000 Franken Unfallkosten.<br />
Mit <strong>der</strong> Standseilbahn wurden Arbeiter und Material zur Baustelle transportiert. Bei einer Umgruppierung<br />
in einer elektrischen Verteilstation wurden irrtümlich die Phasen verwechselt. Als <strong>der</strong><br />
Seilbahnwagen nun zur Talstation abgelassen werden sollte, setzte er sich in umgekehrter Richtung in<br />
Bewegung, fuhr über das obere Geleiseende hinaus und kippte um.<br />
15. Leuchtgasvergiftungen in einem Wohnhaus, November 1957.<br />
1 Toter, 6 Verletzte; 135000 Franken Unfallkosten.<br />
Weil das betreffende Wohnhaus selbst keinen Gasanschluss besass und da zudem <strong>der</strong> typische Gasgeruch<br />
fehlte, wurden die auftretenden Erkrankungen vorerst als Grippefälle betrachtet. Das Gas war<br />
aus einer geborstenen Hauptleitung entwichen und unter dem Strassenbelag hindurch in dasHaus eingedrungen.<br />
Das durchströmte Material hatte als Filter gewirkt, aber das geruchlose Kohlenoxyd nicht<br />
zurückgehalten. Von zehn betroffenen Personen waren sieben bei <strong>der</strong> Anstalt versichert.<br />
16. Unglück auf einer Standseilbahn beim Bau eines Stollens, Dezember 1957.<br />
1 Toter, 16 Verletzte; 190000 Franken Unfallkosten.<br />
Bei <strong>der</strong> Talfahrt eines mit Arbeitern besetzten Wagens riss etwa 25 m vor <strong>der</strong> Talstation das Zugseil.<br />
Der Wagen prallte mit grosser Wucht auf die Talstation. Die grosse Zahl <strong>der</strong> Verletzten ist darauf<br />
zurückzuführen, dass ein gleichzeitig mitbeför<strong>der</strong>ter Rollwagen in die Arbeitergruppe hineingeschleu<strong>der</strong>t<br />
wurde.<br />
Abgelehnte Fälle<br />
Eine beson<strong>der</strong>e Erhebung ergab, dass im Jahre 1956 in beiden Versicherungsabteilungen (ohne SBB<br />
und PTT) bei 7169 gemeldeten Ereignissen die Leistungspflicht verneint werden musste. Auf 1000 Unfälle<br />
traf es in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung 17 und in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung 31 abgelehnte<br />
Fälle. Die Zahl <strong>der</strong> Ablehnungen ist demnach gering. Wie aus folgen<strong>der</strong> Zusammenstellung hervorgeht,<br />
bestehen in den beiden Versicherungsabteilungen hinsichtlich <strong>der</strong> Art und Zahl <strong>der</strong> Ablehnungsgründe<br />
wesentliche Unterschiede.<br />
Die abgelehnten Fälle nach Ablehnungsgründen 1956<br />
Ohne SBB und PTT<br />
Ablehnungsgrt.lnde nach K<strong>UVG</strong><br />
Betriebsun<br />
fallversicherung<br />
N ich tbet riebsunfall<br />
versicherung<br />
Kein Unfall (Art. 67 und 68) .<br />
Nicht versicherte Person (Art. 60, VO I Art. 24, VO II<br />
Versicherung abgelaufen (Art. 62, VO II Art. 3).<br />
Aussergewöhnliche Gefahr o<strong>der</strong> Wagnis (Art. 67) .<br />
Verspätete Anmeldung (Art. 70)<br />
Militärversicherungsfall (Art. 92)<br />
An<strong>der</strong>e Gründe<br />
T otal . ~ ~ ~<br />
Art. 2)<br />
3791<br />
203<br />
11<br />
3<br />
10<br />
4018<br />
1060<br />
199<br />
464<br />
1316<br />
7<br />
89<br />
16<br />
3151<br />
In <strong>der</strong> Betriebsunfallversieherung entfallen fast 95 Prozent <strong>der</strong> abgelehnten Fälle auf die Gruppe «Kein<br />
Unfall». Diese Gruppe umfasst unter an<strong>der</strong>em nicht unfallmässig entstandene Lumbalgien und Muskelzerrungen<br />
(1176 Fälle), vorbestandene Krankheiten (982 Fälle), Furunkel und Hautkrankheiten (419<br />
23
Fälle), Folgen nicht unfallmässig bedingter Überanstrengungen o<strong>der</strong> Schädigungen bei normalen Körperbewegungen<br />
(399 Fälle) sowie nicht durch Unfall verursachte Hernien (351 Fälle). Von den übrigen Ablehnungsgründen<br />
ist einzig noch die Gruppe «Nicht versicherte Person» von Bedeutung; rund die Hälfte<br />
<strong>der</strong> 203 Fälle bezieht sich auf im Auslande erworbene Silikosen.<br />
In <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung gilt eine an<strong>der</strong>e Rangfolge, weil sich zwei nur in dieser Versicherungsabteilung<br />
mögliche Ablehnungsgründe einschieben. An erster Stelle stehen die Ablehnungen<br />
auf Grund des Ausschlusses aussergewöhnlicher Gefahren und Wagnisse. Während den Wagnissen mit<br />
48 Fällen verhältnismässig geringe Bedeutung zukommt, stellen das Motorradfahren (873 Fälle) und die<br />
Raufereien (305 Fälle) als aussergewöhnliche Gefahren die grössten Anteile. Inwieweit diese Ablehnungsgruppe<br />
durch die am 1. Januar 1960 in Kraft tretende Neuordnung, wonach das Motorradfahren auf dem<br />
Wege zu und von <strong>der</strong> Arbeit in die Nichtbetriebsunfallversicherung eingeschlossen wird, an Bedeutung<br />
einbüsst, wird die Zukunft erweisen. Die nächste Gruppe «Kein Unfall» umfasst unter an<strong>der</strong>em vorbestandene<br />
Krankheiten (250 Fälle), nicht unfallmässig entstandene Lumbalgien und Muskelzerrungen<br />
(173 Fälle), Folgen nicht unfallmässig bedingter Überanstrengungen o<strong>der</strong> Schädigungen bei normalen<br />
Körperbewegungen (148 Fälle) sowie nicht erwiesene Unfallereignisse (140 Fälle). Auch die Selbstschädigungen<br />
und Selbstmorde, die in dieser Versicherungsabteilung mit 38 Fällen bedeutend zahlreicher<br />
sind als in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung mit nur 5 Fällen, sind unter «Kein Unfall» erfasst. Bei <strong>der</strong> Ablehnungsgruppe<br />
«Versicherung abgelaufen» handelt es sich um eine Unfallkategorie, die vom 1.Januar<br />
1960 an zum grössten Teil versichert sein dürfte, erfährt doch die Versicherungsdauer infolge <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung<br />
des Art.62 K<strong>UVG</strong> eine Ausdehnung vom 2. auf den 30. Tag nach Ende des Lohnanspruches. Die letzte<br />
grössere Gruppe «Nicht versicherte Person» umfasst zu zwei Dritteln Unfälle von Versicherten, die<br />
nur gegen Betriebsunfälle versichert waren, und zu einem Drittel Unfälle von überhaupt nicht Versicherten.<br />
24
Die Unfallkosten<br />
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Unfallkosten umfassen nur die Versicherungsleistungen, wobei<br />
die Beträge <strong>der</strong> gesetzlichen Leistungskürzungen und die Regresseinnahmen abgezogen sind; die mit<br />
dem Versicherungsbetrieb verbundenen Unkosten sind weggelassen. Zur Ergänzung <strong>der</strong> in diesem Kapitel<br />
veröffentlichten Zahlen möge die Anhangstabelle 3 dienen, welche die Unfallkosten <strong>der</strong> Jahre 1953 — 1957<br />
nach Gefahrenklassen wie<strong>der</strong>gibt. Wenn diese Angaben auch gewisse Einblicke in das Risikogefüge gestatten,<br />
so erlauben sie angesichts <strong>der</strong> ausserordentlichen Zufallsabhängigkeit <strong>der</strong> Unfallkosten doch nicht<br />
ohne weiteres eine abschliessende Beurteilung <strong>der</strong> Risikoverhältnisse. Es sei in diesem Zusammenhange<br />
auf das Kapitel über das Unfallgeschehen als Zufallsvorgang verwiesen.<br />
Während sich <strong>der</strong> erste Abschnitt dieses Kapitels auf die Versicherungsleistungen im allgemeinen sowie<br />
auf die Kürzungen und Regresse bezieht, wird in den folgenden Abschnitten über die Versicherungsleistungen<br />
im einzelnen berichtet.<br />
Die Versicherungsleistungen<br />
Die Versicherungsleistungen bestehen im wesentlichen in <strong>der</strong> Bezahlung <strong>der</strong> Krankenpflege, des<br />
Krankengeldes sowie in <strong>der</strong> Ausrichtung von Invaliden- und Hinterlassenenrenten. Die Kosten für die<br />
Krankenpflege sind als Heilkosten ausgewiesen. Diese bilden zusammen mit dem Krankengeld die Kosten<br />
des Heilverfahrens. Die Rentenkosten umfassen die Kapitalwerte <strong>der</strong> zugesprochenen Renten.<br />
Die Unfallkosten 1953 — 1957<br />
In Franken<br />
1948 †19<br />
1953<br />
1954<br />
1955<br />
1956<br />
1957<br />
1953 †19<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
kosten<br />
Total<br />
80 806 019 147 176 912 222 990 681 450 973 612<br />
20 580 491<br />
20 867 831<br />
22 311 459<br />
23 529 391<br />
25 924 650<br />
34 294 549<br />
35 258 984<br />
38 562 642<br />
41 113 657<br />
45 770 468<br />
113 213 822 195 000 300<br />
51 980 212<br />
52 830 360<br />
55 303 427<br />
59 038 189<br />
63 857 810<br />
106 855 252<br />
108 957 175<br />
116 177 528<br />
123 681 237<br />
135 552 928<br />
283 009 998 591 224 120<br />
N ichtbetriebsunfallversicherung<br />
1948-1952<br />
43 637 329<br />
77 438 087<br />
107 781 705 228 857 121<br />
1953<br />
1954<br />
1955<br />
1956<br />
1957<br />
1953 †11 332 155<br />
11 217 300<br />
12 064 197<br />
12 716 268<br />
13 947 864<br />
61 277 784<br />
18 856 403<br />
18 685 098<br />
20 257 525<br />
21 372 500<br />
24 183 576<br />
103 355 102<br />
24 093 831<br />
28 013 728<br />
26 445 821<br />
30 173 700<br />
35 988 207<br />
144 715 287<br />
54 282 389<br />
57 916 126<br />
58 767 543<br />
64 262 468<br />
74 119 647<br />
309 34<br />
ln <strong>der</strong> folgenden Darstellung sind die nach den drei Kostenarten aufgeteilten Unfallkosten <strong>der</strong> Jahre<br />
1953 — 1957 grössentreu wie<strong>der</strong>gegeben.<br />
25
Die Unfallkosten nach Kostenarten<br />
Betriebsun fal 1 versicherung<br />
N ich tbetriebsun fal1 versicherung<br />
Während <strong>der</strong> letzten Berichtsperiode trat lediglich eine leichte Gewichtsverschiebung vom Krankengeld<br />
zu den Heilkosten ein, so dass von den Unfallkosten nach wie vor näherungsweise ein Fünftel auf die<br />
Heilkosten, ein Drittel auf das Krankengeld und etwas weniger als die Hälfte auf die Rentenkosten entfallen.<br />
Die Kosten des Heilverfahrens und die Rentenkosten sind demnach ungefähr gleich gross. Wird<br />
berücksichtigt, dass etwa ein Viertel <strong>der</strong> Kosten des Heilverfahrens von Unfällen mit Rentenfolgen<br />
(Invaliditäts- und Todesfälle) herrühren, so zeigt sich, dass in beiden Versicherungsabteilungen rund<br />
2 Prozent <strong>der</strong> Unfälle beinahe zwei Drittel <strong>der</strong> Unfallkosten verursachen.<br />
Die Unfallkosten nach Unfallarten<br />
?.,<br />
Bet riebsun fallversicherung<br />
N ich tbet riebsu n fa I I versicherung<br />
26
Der Vergleich zwischen <strong>der</strong> Vorperiode und <strong>der</strong> Berichtsperiode ergibt bei den Unfallkosten einen<br />
Anstieg um 31 Prozent in <strong>der</strong> Betriebs- und um 35 Prozent in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung. Diese<br />
Zunahmen gehen einerseits auf das Anwachsen <strong>der</strong> Unfallzahl, an<strong>der</strong>seits vorwiegend auf die allgemeine<br />
Teuerung zurück. In beiden Versicherungsabteilungen beträgt die Zunahme <strong>der</strong> Unfallzahl rund 15 Prozent.<br />
Der Einfluss <strong>der</strong> Teuerung ist aus <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> durchschnittlichen Kosten eines Unfalls ersichtlich.<br />
Die durchschnittlichen Kosten eines Unfalls<br />
V nfallarten<br />
Bet riebsu n fal 1 versicherung<br />
N ich tbetriebsun fall versicherung<br />
Zunahme<br />
1948-1952 1953-1957 1948-1952 1953-1957<br />
in /<br />
Zunahme<br />
in /<br />
Unfälle insgesamt<br />
Bagatellunfälle.<br />
Ordentliche Unfälle.<br />
Fr. Fr.<br />
Fr. Fr.<br />
436<br />
19,2<br />
767<br />
496<br />
23,2<br />
926<br />
14<br />
21<br />
21<br />
504<br />
21,4<br />
715<br />
596<br />
26,6<br />
880<br />
18<br />
24<br />
23<br />
Die Nichtbetriebsunfälle haben sich durchwegs stärker verteuert als die Betriebsunfälle. In je<strong>der</strong> Versicherungsabteilung<br />
besteht zwischen <strong>der</strong> Kostenentwicklung <strong>der</strong> Bagatell- und <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle<br />
weitgehende Übereinstimmung. Während die ordentlichen Betriebsunfälle im Mittel höhere Kosten verursachten<br />
als die ordentlichen Nichtbetriebsunfälle, ist es bei den Bagatellunfällen umgekehrt. Aufschluss<br />
über die Beteiligung <strong>der</strong> einzelnen Kostenarten am Kostenanstieg gibt die Aufspaltung <strong>der</strong> durchschnittlichen<br />
Unfallkosten. Für die Kosten <strong>der</strong> Bagatellunfälle braucht sie nicht durchgeführt zu werden, da es<br />
sich hier um reine Heilkosten handelt.<br />
1953<br />
Die durchschnittlichen<br />
†19<br />
Kosten eines ordentlichen Unfalls nach Kostenarten<br />
Bet riebsu n fa1 l versicherung<br />
Nichtbet<br />
Kostenarten<br />
Zunahme<br />
1948-1952 1948-1952<br />
in /<br />
Heilkosten 125 160<br />
Krankengeld.<br />
255 312<br />
Rentenkosten<br />
387 454<br />
Fr.<br />
Fr.<br />
28<br />
22<br />
17<br />
Fr.<br />
129<br />
245<br />
341<br />
Total ~ 767 926<br />
21 715<br />
Die weitaus grösste prozentuale Zunahme ist bei den Heilkosten zu verzeichnen. Der Anstieg geht<br />
einmal zurück auf die Anpassung <strong>der</strong> Arzt- und Spitaltaxen, auf die zum Teil ausserordentliche Verteuerung<br />
<strong>der</strong> Heilmittel sowie auf die Verlängerung <strong>der</strong> Heildauer, wie sie in <strong>der</strong> Zunahme <strong>der</strong> mittleren Krankengeldbezugsdauer<br />
zum Ausdruck kommt. Die Gründe dieser Verlängerung sind vorwiegend medizinischer<br />
Natur. Die Unfallverletzungen sind, wie eine beson<strong>der</strong>e Erhebung ergab, in beiden Versicherungsabteilungen<br />
schwerer geworden. Die damit verbundene Ausdehnung <strong>der</strong> Heildauer wurde noch geför<strong>der</strong>t<br />
durch die Anwendung neuerer Behandlungsmethoden, worüber im Abschnitt Heilkosten näher berichtet<br />
wird. Die Verlängerung <strong>der</strong> Heildauer ist zusammen mit <strong>der</strong> allgemeinen Erhöhung des Lohnniveaus und<br />
<strong>der</strong> zweimaligen Anpassung des versicherten Höchstverdienstes für den ebenfalls beträchtlichen Anstieg<br />
<strong>der</strong> Krankengeldanteile verantwortlich. Die Zunahme beläuft sich in beiden Versicherungsabteilungen<br />
übereinstimmend auf 22 Prozent. Demgegenüber ist die unterschiedliche Entwicklung <strong>der</strong> auch stark<br />
lohnabhängigen Rentenkostenanteile augenfällig.<br />
Diese allgemeine Übersicht über die Versicherungsleistungen wäre unvollständig ohne Hinweis auf<br />
das Verhältnis <strong>der</strong> Unfallkosten zur versicherten Lohnsumme. Dieses in Promillen ausgedrückte Verhältnis<br />
heisst Risikosatz.<br />
27
Die Unfallkosten in Promillen <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme<br />
Betriebsun<br />
fallversicherung<br />
Kostenarten<br />
1948-1952 1953 †19<br />
1948-1952<br />
Nichtbetrie<br />
unfall versiche<br />
195<br />
Heilkosten .<br />
Krankengeld .<br />
Invalidenrenten .<br />
Hinterlassenenrenten<br />
2,9<br />
5,2<br />
5,6<br />
2,3<br />
2,9<br />
5,1<br />
5,3<br />
2,1<br />
1,6<br />
2,8<br />
2,3<br />
1,5<br />
al 16,0 15,4 8,2<br />
In <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung gingen die Promillesätze <strong>der</strong> einzelnen Kostenarten mit einer Ausnahme<br />
zurück; dementsprechend sank <strong>der</strong> Risikosatz gegenüber <strong>der</strong> vorangehenden Berichtsperiode von<br />
16,0 auf 15,4 Promille. In <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung hingegen entwickelten sich die Promille<br />
'/o<br />
100<br />
Prozentuale Verän<strong>der</strong>ung des Risikosatzes, <strong>der</strong> Unfallkosten<br />
und <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme seit 1947<br />
Betriebsun fal1versicherung<br />
."" ~ ~ ~ " ~ Versicherte Lohnsumme<br />
------- Unfallkosten<br />
Risikosatz<br />
N ichtbetriebsunfallversicherung<br />
o/<br />
/Ü<br />
100<br />
90 90<br />
80 80<br />
70 70<br />
60 60<br />
50 50<br />
40 40<br />
30 30<br />
20 20<br />
10 10<br />
— 10 — 10<br />
— 20<br />
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957<br />
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957<br />
— 20<br />
28
sätze <strong>der</strong> Kostenarten uneinheitlich, und <strong>der</strong> Risikosatz hat sich nur unbedeutend verän<strong>der</strong>t. Die in <strong>der</strong><br />
Nachkriegszeit festgestellte Zunahme des Nichtbetriebsunfallrisikos ist also zum Stillstand gekommen.<br />
Aus den Darstellungen auf Seite 28 ist die Entwicklung <strong>der</strong> Risikosätze in den zehn letzten Jahren ersichtlich.<br />
Aufschlussreich sind auch die in <strong>der</strong> Anhangstabelle 3 enthaltenen Risikosätze <strong>der</strong> Gefahrenklassen.<br />
Obwohl diese Risikosätze weitgehend zufallsbedingt sind, zeigen sie doch die erheblichen Risikounterschiede<br />
zwischen den einzelnen Gefahrenklassen.<br />
Abschliessend sei noch die Bedeutung <strong>der</strong> Leistungskürzungen und <strong>der</strong> Regresse dargelegt.<br />
Die Kürzung <strong>der</strong> Versicherungsleistungen<br />
In gewissen Fällen können gemäss K <strong>UVG</strong> die Versicherungsleistungen gekürzt o<strong>der</strong> entzogen werden.<br />
Anzahl- o<strong>der</strong> betragsmässig von Bedeutung sind nur die Kürzungen nach Art. 71, 74, 91 und 98 K<strong>UVG</strong>.<br />
Diese Kürzungen sind nachstehend für ein bestimmtes Jahr ausgewiesen.<br />
Kürzung <strong>der</strong> Versicherungsleistungen nach Kürzungsgründen 1956<br />
Ohne SBB und PTT<br />
Zahl <strong>der</strong> Kürzungen<br />
Kürzungsgründe nach K<strong>UVG</strong> in /<br />
absolut<br />
<strong>der</strong> Unfälle<br />
absolut<br />
Fr.<br />
Kürzungsbeträge<br />
in / <strong>der</strong><br />
ungekürzten<br />
Unfallkosten<br />
in "/~~ <strong>der</strong><br />
versicherten<br />
Lohnsumme<br />
Bet riebsun fallversicherung<br />
Nichtbefolgen von Anordnungen (Art. 71)<br />
Ü berversicherung...... (Art. 74)<br />
Medizinische Gründe..... (Art. 91)<br />
Grobe Fahrlässigkeit..... (Art. 98)<br />
3<br />
351<br />
809<br />
303<br />
0,0<br />
0,3<br />
0,7<br />
0,2<br />
663<br />
31 937<br />
1 877 425<br />
258 632<br />
0,0<br />
0,0<br />
1,6<br />
0,2<br />
0,0<br />
0,0<br />
0,3<br />
0,0<br />
N ich tbet riebsunfallversicherung<br />
Nichtbefolgen von Anordnungen (Art. 71)<br />
Überversicherung...... (Art. 74)<br />
Medizinische Gründe..... (Art. 91)<br />
Grobe Fahrlässigkeit..... (Art. 98)<br />
436<br />
379<br />
2 265<br />
0,6<br />
0,6<br />
3,4<br />
46 826<br />
1 194 096<br />
1 492 233<br />
0,1<br />
1,9<br />
2,3<br />
0,0<br />
0,2<br />
0,2<br />
Nichtbefolgen von Anordnungen zur zweckmässigen Behandlung <strong>der</strong> Verunfallten führte im Jahre 1956<br />
nur zu drei Kürzungen. Zahlreicher, wenn auch betragsmässig immer noch bedeutungslos, sind die Kürzungen<br />
wegen Überversicherung. Wenn nämlich für einen Unfall auch von an<strong>der</strong>n Versicherern Leistungen<br />
ausgerichtet werden, so darf das Krankengeld den von diesen Versicherern ungedeckten Teil des entgehenden<br />
Verdienstes nicht überschreiten. Da bei mindestens 35000 von insgesamt 184000 Unfällen mit<br />
Krankengeldleistung neben den gesetzlichen noch Krankengeldleistungen aus Zusatzversicherungen ausgerichtet<br />
werden, scheint die Zahl von total 787 Kürzungen klein zu sein. Es ist jedoch zu berücksichtigen,<br />
dass es sich bei diesen Zusatzversicherungen vielfach um Krankenkassen und <strong>Unfallversicherung</strong>en handelt,<br />
die im eigenen Interesse keine im Wi<strong>der</strong>spruch zum K<strong>UVG</strong> stehenden Krankengeldbezüge dulden.<br />
Die Kürzungen aus medizinischen Gründen fallen in beiden Versicherungsabteilungen betragsmässig deshalb<br />
ins Gewicht, weil rund ein Viertel dieser Kürzungen Rentenfälle betrifft. Der weitaus häufigste<br />
Kürzungsgrund ist grobe Fahrlässigkeit.<br />
29
Die Kürzungen infolge grober Fahrlässigkeit des Verunfallten<br />
(Art. 98 K<strong>UVG</strong>) nach Gründen 1956<br />
Gründe<br />
Betriebsun<br />
fallversicherung<br />
absolut<br />
in /<br />
Nichtbetrie<br />
unfallversiche<br />
absolut<br />
in /<br />
Verkehrswidriges Verhalten .<br />
Raufereien<br />
Sonstiges Selbstverschulden .<br />
Total.<br />
175<br />
69<br />
59<br />
58<br />
23<br />
19<br />
1 728<br />
16<br />
521<br />
76<br />
1<br />
23<br />
303 100 2 265 100<br />
Die Prozentzahlen decken sich mit jenen früherer Erhebungen. In <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung<br />
gehen rund 60 Prozent, in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung sogar über 75 Prozent aller Kürzungen auf<br />
verkehrswidriges Verhalten zurück. Bei etwas mehr als einem Drittel solcher Fälle spielte <strong>der</strong> Alkohol eine<br />
Rolle. Selbst wenn von den alkoholbedingten Verkehrsunfällen abgesehen wird, bleibt die Zahl <strong>der</strong> übrigen<br />
selbstverschuldeten Verkehrsunfälle immer noch erschreckend hoch. Sie unterstreicht nachdrücklich die<br />
Notwendigkeit unfallverhüten<strong>der</strong> Verkehrserziehung, um so mehr als es sich hier meistens um schwere<br />
Unfälle handelt, die ohne weiteres vermeidbar wären.<br />
Die Regresse<br />
Auch bei Unfällen, für welche Drittpersonen haften, müssen die gesetzlichen Versicherungsleistungen<br />
ausgerichtet werden. Dabei ist aber die Schweizerische <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt nach Art.100 K<strong>UVG</strong><br />
zum Rückgriff gegenüber dem haftbaren Dritten berechtigt, und zwar bis zur Höhe ihrer Leistungen.<br />
Die Regresse 1953 — 1957<br />
Zahl <strong>der</strong> Regresse<br />
Regressbeträge<br />
Versicherungsabtei lungen<br />
absolut<br />
in /<br />
<strong>der</strong> Unfälle<br />
in<br />
Franken<br />
in / <strong>der</strong><br />
unregressierten<br />
U n fal 1 kosten<br />
in ~/„~ <strong>der</strong><br />
versicherten<br />
Lohnsumme<br />
Betriebsunfallversicherung.<br />
Nichtbetriebsunfallversicherung .<br />
6 475<br />
22 849<br />
0,5<br />
4,4<br />
8 346 233<br />
29 038 632<br />
1,4<br />
8,6<br />
0,2<br />
0,8<br />
In <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung spielen die Regresse anzahlmässig eine bescheidene Rolle: im Mittel<br />
führt nur einer von 200 Unfällen zu einem Regress. Die 6475 Regresse betreffen hauptsächlich Verkehrsunfälle<br />
während <strong>der</strong> Arbeitszeit, Streitigkeiten im Betrieb und Unfälle, die sich infolge fehlerhafter<br />
Installationen auf auswärtigen Werkplätzen ereignen. Nur selten richten sich Regresse gegen Betriebsinhaber<br />
in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber.<br />
In <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung gibt je<strong>der</strong> 23. Unfall Anlass zu einem Regress. Ungefähr<br />
85 Prozent dieser Regresse mit 96 Prozent <strong>der</strong> Regressbeträge entfallen auf Verkehrsunfälle. Die Regresseinnahmen<br />
führen hier zu einer spürbaren Entlastung des Prämienzahlers, erreichen sie doch 0,8 Promille<br />
<strong>der</strong> versicherten Lohnsumme. Die geltenden Prämiensätze <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung müssten<br />
bei Wegfall <strong>der</strong> Regresseinnahmen um fast 10 Prozent erhöht werden.<br />
30
Die Heilkosten<br />
Unter Heilkosten sind, wie erwähnt wurde, die Krankenpflegekosten ausgewiesen. Die Krankenpflege<br />
umfasst die ärztliche Behandlung und die Betreuung des Verunfallten, die Abgabe von Medikamenten und<br />
an<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Heilung dienlichen Mitteln sowie den Ersatz von Reise- und Transportauslagen.<br />
Gegenüber dem vorangehenden Jahrfünft verteuerten sich die Heilkosten um über einen Viertel. Die<br />
Gründe seien kurz wie<strong>der</strong>holt: Anpassung <strong>der</strong> Arzt- und <strong>der</strong> Spitaltarife, Verteuerung <strong>der</strong> übrigen Heilkosten<br />
und Verlängerung <strong>der</strong> Heildauer. Verteuernd mag auch die zunehmende Anwendung neuartiger<br />
Behandlungsmethoden gewirkt haben. Hingegen dürften Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Zusammensetzung <strong>der</strong><br />
Heilkosten wenig zur Verteuerung beigetragen haben. Denn die Glie<strong>der</strong>ung nach den wichtigsten Kostenarten<br />
lässt nur geringfügige Verschiebungen erkennen.<br />
Heilkosten <strong>der</strong> Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle nach Kostenarten<br />
In Prozenten<br />
Kostenarten<br />
1948-1952 1953-1957<br />
Arztkosten ' (ohne Spitalarztkosten)<br />
Spitalkosten (mit Spitalarztkosten) .<br />
Apothekerk osten<br />
Zahnarztkosten ~<br />
Verschiedenes .<br />
T otal ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
58<br />
28<br />
3<br />
2<br />
9<br />
100<br />
56<br />
29<br />
3<br />
2<br />
10<br />
100<br />
' Einschliesslich <strong>der</strong> Kosten selbstdispensierter Medikamente.<br />
Die Arztkosten und die darin enthaltenen Kosten für selbstdispensierte Medikamente beanspruchen<br />
nach wie vor fast drei Fünftel <strong>der</strong> Heilkosten. Aufschluss über ihre Zusammensetzung gibt eine im Jahre<br />
1956 durchgeführte Erhebung.<br />
Arztkosten nach Kostenarten 1956<br />
In Prozenten<br />
Kostenarten<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
Nichtbe<br />
unfa<br />
versich<br />
nsultationen und Besuche.<br />
agnostische und therapeutische Leistungen<br />
ohne Röntgen und Durchleuchten).<br />
ntgen und Durchleuchten.<br />
ugnisse und Gutachten .<br />
dikamente und Verbandmaterial.<br />
gentschädigungen .<br />
rschiedenes (Konsilien, ärztliche Assistenz,<br />
Autopsien)<br />
a l.<br />
65<br />
11<br />
7<br />
8<br />
6<br />
1<br />
100<br />
62<br />
10<br />
10<br />
8<br />
6<br />
2<br />
100<br />
31
Zusammen mit den Wegentschädigungen entfallen auf Konsultationen und Besuche zwei Drittel <strong>der</strong><br />
Arztkosten, nämlich im Mittel rund 36 Franken für einen Betriebs- und 42 Franken für einen Nichtbetriebsunfall.<br />
Dieser Unterschied rührt daher, dass die durchschnittliche Zahl <strong>der</strong> Konsultationen und<br />
Besuche bei den Nichtbetriebsunfällen höher ist als bei den Betriebsunfällen. Für den deutlich höheren<br />
Anteil <strong>der</strong> Röntgen- und Durchleuchtungskosten in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung sind die im allgemeinen<br />
schweren Verkehrsunfälle verantwortlich.<br />
Durchschnittliche Zahl <strong>der</strong> Konsultationen und Besuche je Unfall 1956<br />
Art <strong>der</strong> Unfälle<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
Unfälle insgesamt .<br />
Bagatellunfälle<br />
Ordentliche Unfälle .<br />
5,3<br />
2,3<br />
8,1<br />
6,3<br />
2,5<br />
8,3<br />
Die bei <strong>der</strong> Gesamtzahl <strong>der</strong> Unfälle festgestellte Abweichung ist auf die grössere Häufigkeit <strong>der</strong> Bagatellunfälle<br />
in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung zurückzuführen. Im weitern sei erwähnt, dass eine Konsultation<br />
o<strong>der</strong> ein Besuch einschliesslich <strong>der</strong> dabei verabreichten Medikamente im Durchschnitt 7 Franken<br />
kostete.<br />
Die Spitalkosten waren im Jahre 1956 an den Heilkosten mit 29 Prozent beteiligt. Die durchschnittliche<br />
Dauer des Spitalaufenthalts je Hospitalisationsfall betrug während <strong>der</strong> Berichtsperiode 28 Tage. Von<br />
100 Hospitalisationstagen entfielen auf<br />
Spitäler<br />
Tuberkulose-Heilstätten<br />
Bä<strong>der</strong>-Heilstätten .<br />
Irren- und Pflegeanstalten.<br />
Übrige Anstalten<br />
91 Tage<br />
5 Tage<br />
2 Tage<br />
1 Tag<br />
1 Tag<br />
Die Apothekerkosten umfassen nur die direkten Bezüge aus Apotheken. Die Kosten für die von den<br />
Ärzten verabreichten Medikamente sind in den Arztkosten enthalten; <strong>der</strong> Umfang <strong>der</strong> Selbstdispensation<br />
ist aber je nach Landesgegend, ja von Arzt zu Arzt sehr verschieden.<br />
Die Zahnarztkosten sind gemessen an den gesamten Heilkosten verhältnismässig gering, weil die Zahnschäden<br />
nicht häufig sind. Hingegen können die Kosten im Einzelfall einen ansehnlichen Betrag erreichen.<br />
Unter Verschiedenes fallen die Reise- und Transportspesen sowie die Aufwendungen für prophylaktische<br />
Untersuchungen, Massagen, Bä<strong>der</strong>, Krankenutensilien und Prothesen.<br />
Das Krankengeld<br />
Das Krankengeld beträgt 80 Prozent des dem Verunfallten entgehenden versicherten Lohnes. Es wird<br />
vom dritten Tage nach dem Tage des Unfalles an entrichtet; <strong>der</strong> Selbstbehalt zu Lasten des Verunfallten<br />
beträgt demnach anfänglich 100 Prozent und später noch 20 Prozent des versicherten Verdienstes. Nach<br />
oben ist <strong>der</strong> versicherte Lohn gesetzlich begrenzt: in den Jahren 1953 bis 1956 betrug er 9000 Franken im<br />
Jahr beziehungsweise 30 Franken im Tag, seither 12 000 beziehungsweise 40 Franken.<br />
Das auf einen ordentlichen Unfall bezogene Krankengeld nahm während <strong>der</strong> Berichtsperiode in<br />
beiden Versicherungsabteilungen um 22 Prozent zu. Zum Anstieg trugen vor allem die Erhöhung desLohnniveaus<br />
und die zweimalige Anpassung des versicherten Höchstverdienstes bei sowie in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
die Verlängerung <strong>der</strong> mittleren Krankengeldbezugsdauer.<br />
32
1957 1953 †19<br />
Mittlere Krankengeldbezugsdauer eines ordentlichen Unfalls<br />
In Tagen<br />
Versicherungsbestande 1948-1952<br />
1953 1954 1955 1956<br />
Bet riebsun fall versicherung<br />
Männliche Versicherte<br />
Weibliche Versicherte ~<br />
17,8<br />
15,2<br />
19,3<br />
15,4<br />
19,1<br />
15,4<br />
19,2<br />
15,7<br />
18,9<br />
15,3<br />
19,1<br />
15,3<br />
Total. 17,6 19,0 18,8 18,9 18,6 18,8<br />
N ich t be tri ebsu n fa1 1 versicheru n g<br />
Männliche Versicherte 19,0<br />
Weibliche Versicherte.<br />
18,9<br />
20,4<br />
19,9<br />
20,7<br />
20,1<br />
20,6<br />
20,9<br />
20,7<br />
20,6<br />
21,1<br />
21,1<br />
Total. 19,0 20,3 20,6 20,7 20,7 21,1<br />
Während die auf einen ordentlichen Unfall bezogene Zahl <strong>der</strong> Krankengeldtage in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung<br />
seit 1953, dem Jahre mit dem höchsten je beobachteten Wert, praktisch unverän<strong>der</strong>t blieb, ist<br />
sie in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung nach wie vor deutlich im Steigen begriffen. Die in dieser Versicherungsabteilung<br />
für beide Geschlechter übereinstimmende Krankengeldbezugsdauer ist darauf zurückzuführen,<br />
dass die männlichen und weiblichen Versicherten im wesentlichen denselben Unfallgefahren<br />
ausgesetzt sind und demzufolge dieselben Arten von Verletzungen erleiden. In <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung<br />
weisen die Frauen eine bedeutend kürzere Bezugsdauer auf, was mit ihrer geringeren und an<strong>der</strong>sgearteten<br />
beruflichen Unfallgefährdung zusammenhängt. Massgebend für die Dauer des Krankengeldbezuges<br />
sind vor allem die Art <strong>der</strong> Verletzung, <strong>der</strong> Erfolg <strong>der</strong> Behandlung, das ärztliche Urteil über die<br />
Arbeitsfähigkeit des Verunfallten und dessen Arbeitswille. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die<br />
Unfallverletzungen schwerer geworden sind. Darin liegt einer <strong>der</strong> Gründe für die in den letzten Jahren<br />
beobachtete Verlängerung <strong>der</strong> durchschnittlichen Dauer des Krankengeldbezuges. Als weitere Ursachen<br />
sind die mo<strong>der</strong>nen Behandlungsmöglichkeiten zu nennen, dank denen immer mehr Schwerverletzte am<br />
Leben erhalten und früher unvermeidliche Amputationen umgangen werden können. Den mit diesen langwierigen<br />
Behandlungen verbundenen Mehraufwendungen an Krankengeld und Heilkosten stehen ein<br />
besserer Heilerfolg und oft grosse Einsparungen bei den invaliden- und Hinterlassenenrenten gegenüber.<br />
Abschliessend ist noch auf einen beson<strong>der</strong>n, die Krankengeldbezugsdauer beeinflussenden Umstand<br />
hinzuweisen: auf das Bestehen von Zusatzversicherungen. Solche werden bei privaten Versicherern vor<br />
allem zur vollen o<strong>der</strong> teilweisen Deckung des im Selbstbehalt zu tragenden Lohnausfalls abgeschlossen.<br />
Im Jahre 1957 erhielten von 100 Verunfallten, die Krankengeld bezogen, zusätzliche Leistungen durch<br />
Krankenkassen .<br />
Unfallversicher ungen .<br />
Zeitschriftenversicherungen .<br />
Volle Lohnzahlung<br />
N ichtbetriebsunfallversicherung<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
ln diesem Zusammenhang muss <strong>der</strong> volle Lohnbezug in seinen Auswirkungen auf die Dauer des<br />
Krankengeldbezuges den Zusatzversicherungen gleichgestellt werden. Es ist anzunehmen, dass die hier<br />
gegebenen Zahlen zu niedrig sind, weil zusätzliche Bezüge nicht immer zuverlässig angegeben werden.<br />
Jedenfalls entspricht den Unfällen mit Zusatzleistungen im Durchschnitt eine um rund zwei Tage längere<br />
Krankengeldbezugsdauer, was mit früheren Erhebungen übereinstimmt. Es steht demnach fest, dass <strong>der</strong><br />
gesetzlich festgelegte lohnmässige Selbstbehalt, welcher <strong>der</strong> nicht medizinisch bedingten Arbeitsaussetzung<br />
entgegenwirken sollte, mit dem Abschluss von Zusatzversicherungen an Wirksamkeit einbüsst.<br />
10<br />
5<br />
3<br />
1<br />
10<br />
8<br />
4<br />
l<br />
33
Die Rentenkosten<br />
Bei den Rentenkosten handelt es sich um die Kapitalwerte <strong>der</strong> zugesprochenen Invaliden- und Hinterlassenenrenten.<br />
Die Invalidenvente beträgt bei voller Erwerbsunfähigkeit 70 Prozent des versicherten<br />
Jahresverdienstes; ist <strong>der</strong> Invalide <strong>der</strong>art hilflos, dass er beson<strong>der</strong>er Wartung und Pflege bedarf, so kann<br />
die Rente bis auf den vollen versicherten Verdienst erhöht werden. Bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit wird<br />
die Rente entsprechend gekürzt. Wenn erhebliche Än<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Erwerbsunfähigkeit eintreten, kann<br />
die Rente unter bestimmten Voraussetzungen den neuen Verhältnissen angepasst werden. Stirbt <strong>der</strong> Versicherte<br />
an den Unfallfolgen, erhalten die Anspruchsberechtigten eine Hinterlassenenrente, die insgesamt<br />
höchstens 60 Prozent des versicherten Jahresverdienstes beträgt. Über den Verlauf dieser Renten wird im<br />
Kapitel Invaliden- und Hinterlassenenrenten berichtet.<br />
Rund die Hälfte <strong>der</strong> Unfallkosten entfallen auf die Renten. Die Rentenkosten hangen ab von <strong>der</strong><br />
Rentenhäufigkeit und von <strong>der</strong> durchschnittlichen Rentenhöhe. Diese wird bestimmt durch den mittleren<br />
Invaliditätsgrad beziehungsweise durch die Zusammensetzung <strong>der</strong> rentenberechtigten Hinterlassenenschaft<br />
sowie durch das allgemeine Lohnniveau und die Höhe des versicherten Verdienstmaximums. Diese<br />
Bestimmungsgrössen sind fortwährenden Verän<strong>der</strong>ungen unterworfen, woraus sich die unterschiedlichen<br />
Zunahmen <strong>der</strong> durchschnittlichen Rentenkosten eines ordentlichen Unfalls erklären; die Zunahmen von<br />
1948 — 1952 auf die Berichtsperiode betragen 17 Prozent in <strong>der</strong> Betriebs- und 23 Prozent in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung.<br />
Auch die durchschnittlichen Rentenkosten <strong>der</strong> Rentenfälle stiegen verschieden<br />
an, und zwar um rund 10 Prozent bei den Invaliditätsfällen und um 20 Prozent bei den Todesfällen.<br />
1953 â€<br />
Durchschnittliche<br />
19<br />
Rentenkosten eines Rentenfalles<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
Rcntenfälle<br />
Zunahme<br />
1948-1952<br />
1948-1952<br />
in /<br />
N ichtbetriebsunfallversicherung<br />
1953-1957<br />
Zunahme<br />
in /<br />
I nvalid itätsfälle<br />
Todesfälle.<br />
Fr. Fr. Fr. Fr.<br />
9 071<br />
33 003<br />
9 915<br />
39 480<br />
9<br />
20<br />
8 734<br />
25 675<br />
9 586<br />
30 817<br />
10<br />
20<br />
Diese Zahlen weisen einmal mehr auf die grosse Bedeutung hin, die den Rentenfällen im allgemeinen<br />
und bei <strong>der</strong> Risikobeurteilung im beson<strong>der</strong>n zukommt.<br />
34
Unfallhäufigkeit und Unfallschwere<br />
Um das Unfallrisiko zu messen, werden aus den Beobachtungen über das Unfallgeschehen und seine<br />
Kostenfolgen geeignete Masszahlen geschöpft. Unter ihnen steht an erster Stelle das in Promillen ausgedrückte<br />
Verhältnis <strong>der</strong> Unfallkosten zur versicherten Lohnsumme, <strong>der</strong> sogenannte Risikosatz; auf diese<br />
Grösse wurde bereits im Kapitel über die Unfallkosten hingewiesen. Für die eingehen<strong>der</strong>e Untersuchung<br />
des Unfallrisikos ist es erfor<strong>der</strong>lich, noch weitere Unfallmasszahlen zu kennen. Es liegt nahe, dafür die<br />
Unfallhäußgkeit und die Unfallsch~i ere zu ermitteln. Mit Hilfe dieser beiden Masszahlen werden zeitliche<br />
Risikoentwicklungen beurteilt, Unterschiede im Unfallrisiko von Versicherungsbeständen aufgezeigt und<br />
statistische Unterlagen für die Belange <strong>der</strong> Unfallverhütung bereitgestellt.<br />
Selbstverständlich erlauben Unfallmasszahlen nur dann sichere Schlussfolgerungen in bezug auf Verän<strong>der</strong>ungen<br />
und Unterschiede des Risikos, wenn die statistischen Beobachtungen aus so umfangreichen<br />
Versicherungsbeständen stammen, dass Zufälligkeiten nicht mehr ins Gewicht fallen. Da die einzelne<br />
Unfallmasszahl überdies nur ein unvollständiges Bild <strong>der</strong> vielfältigen Risikoverhältnisse vermittelt, sollte<br />
die Deutung statistischer Masszahlen stets mit dem Blick auf das Ganze erfolgen.<br />
In diesen Zusammenhang gehört auch die Frage nach <strong>der</strong> internationalen Vergleichbarkeit von Unfallmasszahlen.<br />
Die Arbeitsunfallstatistiken sind schon wegen <strong>der</strong> Verschiedenheit <strong>der</strong> Unfallbegriffe, die<br />
wesentlich von <strong>der</strong> jeweiligen Gesetzgebung über die Arbeitsunfallversicherung abhängen, international<br />
nicht vergleichbar. Im weitern ergeben die Unterschiede in <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Versicherungsleistungen ungleiche<br />
<strong>Statistik</strong>en. Zudem ist <strong>der</strong> Kreis <strong>der</strong> versicherten Personen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> versicherten Industrie- und Gewerbezweige<br />
meistens nicht <strong>der</strong>selbe. Die Uneinheitlichkeit <strong>der</strong> angestrebten Ziele, die mit den einzelnen <strong>Statistik</strong>en<br />
verfolgt werden und nach denen sich die statistische Erhebung und Auswertung zu richten hat, erschweren<br />
internationale Vergleiche ebenfalls. Wie weit schliesslich an sich vergleichbare Ergebnisse von<br />
Unfallstatistiken, worin aber noch die Unterschiede in den Arbeitsbedingungen, im Stande <strong>der</strong> technischen<br />
Entwicklung und <strong>der</strong> getroffenen Unfallverhütungsmassnahmen, in <strong>der</strong> Zusammensetzung <strong>der</strong> Belegschaften,<br />
in <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> Versicherungsleistungen usw. ihren Nie<strong>der</strong>schlag finden, von Nutzen sein<br />
können, sei hier weiter nicht erörtert. Seit Jahren werden Anstrengungen unternommen, um wenigstens<br />
den Unfallbegriff zu vereinheitlichen. Dabei kann es sich selbstverständlich nicht darum handeln, die<br />
einzelnen Unfallbegriße auf einen Nenner zu bringen. Vielmehr wird zu ihrer Ergänzung nach einem<br />
Unfallbegriff gesucht, <strong>der</strong> als Grundlage einer internationalen Unfallstatistik dienen könnte. Wer sich<br />
allenfalls ernsthaft an einer solchen <strong>Statistik</strong> beteiligt, sofern sie zustande kommt, wird je eine Unfallstatistik<br />
für die eigenen und für die internationalen Belange führen müssen. Es ist schwer zu sagen, ob <strong>der</strong><br />
damit verbundene Aufwand als lohnend erachtet wird. So bleibt es bei aller Wünschbarkeit internationaler<br />
Vergleichsmöglichkeiten doch fragwürdig, ob das gesteckte Ziel je erreicht werden kann. Einen<br />
kleinen Hinweis auf die dabei zu lösenden Probleme geben die im vorliegenden Berichte besprochenen<br />
Gesetzesän<strong>der</strong>ungen und Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> statistischen Erhebung, die schon die zeitliche Vergleichbarkeit<br />
<strong>der</strong> schweizerischen Unfallmasszahlen untereinan<strong>der</strong> erschweren.<br />
Die Unfallhäufigkeit<br />
Die Unfallhäufigkeit setzt die Zahl <strong>der</strong> Unfälle in Beziehung zur Risikodauer, worunter die Summe <strong>der</strong><br />
Zeitspannen zu verstehen ist, während <strong>der</strong>en die einzelnen Versicherten des betrachteten Bestandes <strong>der</strong><br />
Unfallgefahr ausgesetzt waren. Wird diese Risikodauer mit Hilfe <strong>der</strong> durchschnittlichen jährlichen Risikodauer<br />
eines Versicherten gemessen, so ist die Unfallhäufigkeit eine anschauliche Grösse, die angibt, wie<br />
viele Unfälle während eines Jahres im Mittel auf einen Versicherten entfielen.<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Unfallhäufigkeit = Zahl <strong>der</strong> Versicherten<br />
35
Auf den Versicherten bezogene Unfallhäufigkeiten sind aber nicht ohne weiteres miteinan<strong>der</strong> vergleichbar,<br />
wenn sich die durchschnittliche jährliche Risikodauer des Versicherten im Verlaufe <strong>der</strong> Zeit verän<strong>der</strong>t<br />
hat. Um auch in diesem Falle die Risikoentwicklung zuverlässig beurteilen zu können, ist die Risikodauer<br />
in Arbeitsstunden beziehungsweise in arbeitsfreien Stunden auszudrücken.<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Unfallhäufigkeit = Zahl <strong>der</strong> Risikostunden<br />
Im folgenden werden sowohl die auf den Versicherten als auch die auf die Arbeitsstunde beziehungsweise<br />
auf die arbeitsfreie Stunde bezogenen Häufigkeiten <strong>der</strong> Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle bekanntgegeben.<br />
Da die mittlere jährliche Risikodauer eines Versicherten für die ganze Berichtsperiode in <strong>der</strong><br />
Betriebsunfallversicherung zu 2400 Arbeitsstunden und in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung zu 6360<br />
arbeitsfreien Stunden angenommen werden kann, sind die nach den beiden Ansätzen bestimmten Häufigkeiten<br />
ineinan<strong>der</strong> überführbar. Die Erfahrung wird zeigen, ob die auf den Versicherten bezogene Unfallhäufigkeit<br />
weiterhin beibehalten werden kann.<br />
Die Häufigkeit <strong>der</strong> Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle<br />
In den Jahren 1953 — 1957 entfielen auf 100 Versicherte jährlich rund<br />
21 Betriebsunfälle<br />
Und<br />
9 Nichtbetriebsunfälle<br />
.J
im übrigen bemerkenswert, dass die Invaliditäts- und die Todesfallhäufigkeit in beiden Versicherungsabteilungen<br />
sozusagen unverän<strong>der</strong>t geblieben ist.<br />
Die Häufigkeit <strong>der</strong> Betriebsunfälle<br />
Art <strong>der</strong> Unfälle 1948-1952 1953 1954 1955 1956 1957 1953-1957<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle auf 10000 Versicherte<br />
Unfälle insgesamt<br />
Bagatell unfälle<br />
Ordentliche Unfälle<br />
I nvaliditätsfälle<br />
Todesfälle<br />
2 125<br />
942<br />
1 183<br />
36<br />
4,0<br />
2 061<br />
960<br />
1 101<br />
36<br />
3,7<br />
2 083<br />
990<br />
1 093<br />
36<br />
3,6<br />
2 124<br />
1 010<br />
1 114<br />
36<br />
3,7<br />
2 141<br />
1 030<br />
1 111<br />
37<br />
3,7<br />
2 102<br />
l 015<br />
1 087<br />
36<br />
3,4<br />
2 103<br />
l 002<br />
l 101<br />
36<br />
3,6<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle auf 10 Millionen Arbeitsstunden<br />
Unfälle insgesamt<br />
Bagatellunfälle<br />
Ordentliche Unfälle<br />
Invaliditätsfälle<br />
Todesfälle<br />
886<br />
393<br />
493<br />
15<br />
1,7<br />
859<br />
400<br />
459<br />
15<br />
1,6<br />
868<br />
413<br />
455<br />
15<br />
1,5<br />
885<br />
421<br />
464<br />
15<br />
1,5<br />
892<br />
429<br />
463<br />
15<br />
1,5<br />
876<br />
423<br />
453<br />
15<br />
1,4<br />
876<br />
417<br />
459<br />
15<br />
1,5<br />
In <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung hat sich die Unfallhäufigkeit im Vergleich zur vorangehenden Periode<br />
sozusagen nicht geän<strong>der</strong>t. Dem Anstieg <strong>der</strong> Bagatellunfallhäufigkeit um fast 7 Prozent steht eine ebenso<br />
grosse Abnahme bei den ordentlichen Unfällen gegenüber. Während die Häufigkeit <strong>der</strong> Invaliditätsfälle<br />
gleich blieb, ist bei den Todesfällen ein Rückgang um 10 Prozent festzustellen.<br />
Die Häufigkeit <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle<br />
Art <strong>der</strong> Unfälle 1948-1952 1953 1954 1955<br />
1956<br />
1957 195<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle auf 10000 Versicherte<br />
Unfälle insgesamt .<br />
Bagatellunfälle<br />
Ordentliche Unfälle<br />
Invaliditätsfälle<br />
Todesfälle<br />
931<br />
283<br />
648<br />
15<br />
3,4<br />
958<br />
309<br />
649<br />
16<br />
3,1<br />
908<br />
299<br />
609<br />
16<br />
3,6<br />
920<br />
307<br />
613<br />
16<br />
3,6<br />
910<br />
307<br />
603<br />
16<br />
3,4<br />
890<br />
303<br />
587<br />
15<br />
3,6<br />
916<br />
305<br />
611<br />
16<br />
3,5<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle auf 10 Millionen arbeitsfreie Stunden<br />
Unfälle insgesamt .<br />
Bagatellunfälle<br />
Ordentliche Unfälle<br />
I nvaliditätsfälle<br />
Todesfälle<br />
146<br />
44<br />
102<br />
2,4<br />
0,53<br />
151<br />
49<br />
102<br />
2,4<br />
0,48<br />
143<br />
47<br />
96<br />
2,5<br />
0,57<br />
145<br />
48<br />
97<br />
2,4<br />
0,56<br />
143<br />
48<br />
95<br />
2,5<br />
0,53<br />
140<br />
48<br />
92<br />
2,3<br />
0,57<br />
144<br />
48<br />
96<br />
2,4<br />
0,54<br />
Die Nichtbetriebsunfallversicherung zeigt eine Abnahme <strong>der</strong> Unfallhäufigkeit. Der Rückgang ist zum<br />
grössten Teil eine Folge des ausgeprägten, über das ganze Jahrfünft anhaltenden Sinkens <strong>der</strong> Häufigkeit<br />
37
<strong>der</strong> ordentlichen Unfälle. Allerdings lässt sich auf Grund <strong>der</strong> vorliegenden Beobachtungen nicht entscheiden,<br />
ob diese Abnahme nur eine vorübergehende, durch Zufälligkeiten hervorgerufene Erscheinung<br />
ist.<br />
Besser als die angegebenen Zahlen veranschaulicht den zeitlichen Verlauf <strong>der</strong> Unfallhäufigkeiten die<br />
folgende, mehrere Jahre umfassende Darstellung.<br />
Unfallhäufigkeiten 1938 — 1957<br />
Betriebsunfälle<br />
N ichtbetriebsunfälle<br />
Zahl <strong>der</strong><br />
Unfälle auf<br />
10000<br />
Versicherte<br />
2500<br />
Bagatellun fälle<br />
ordentliche Unfälle<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
1938 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1957<br />
Die nach Bagatell- und ordentlichen Unfällen getrennte Darstellung <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Unfallhäufigkeiten<br />
zeigt die zunehmende Verschiebung im Verhältnis <strong>der</strong> Bagatellunfälle zu den ordentlichen<br />
Unfällen sowie auch den in beiden Versicherungsabteilungen mit Kriegsbeginn einsetzenden und bis 1947<br />
anhaltenden Anstieg <strong>der</strong> Unfallhäufigkeiten. Bis zu diesem Zeitpunkte betragen die Zunahmen gegenüber<br />
38
1938 rund 30 Prozent in <strong>der</strong> Betriebs- und 25 Prozent in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung. Während<br />
sich dann in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung eine Abnahme einstellte, die bis in das Jahr 1950 hineinreicht,<br />
setzte sich <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> Unfallhäufigkeit in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung mit dem Wie<strong>der</strong>aufleben<br />
des motorisierten Strassenverkehrs in <strong>der</strong> Nachkriegszeit fort. Die in <strong>der</strong> Berichtsperiode festgestellte<br />
leichte Zunahme <strong>der</strong> Betriebsunfallhäufigkeit erweist sich in diesem zeitlich umfassen<strong>der</strong>en Rahmen<br />
als nicht sehr bedeutend. Ob in <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallhäufigkeit das Jahr 1952 mit<br />
dem grössten beobachteten Wert einen Wendepunkt darstellt, bleibt abzuwarten.<br />
Die Unfallhä ußgkei t in verschiedenen Versi cherungsgesa>nthei ten<br />
Weil die Unfallhäufigkeiten in einzelnen Versicherungsbeständen erhebliche Unterschiede aufweisen,<br />
ist es von Interesse, auch die Betriebsunfallhäufigkeiten in den Industrie- und Gewerbezweigen sowie die<br />
Nichtbetriebsunfallhäufigkeit <strong>der</strong> männlichen und <strong>der</strong> weiblichen Versicherten zu kennen.<br />
Mittlere Zahl <strong>der</strong> Betriebsunfälle auf 10 Millionen Arbeitsstunden<br />
nach Industrie- und Gewerbezweigen 1953 — 1957<br />
davon<br />
Ordentliche<br />
Gruppen von Gefahrenklassen<br />
Unfälle Bagate1 l<br />
nach dem Prämientarif insgesamt unfälle<br />
I n val id i<br />
U n fälle<br />
Todes fä l le<br />
tät sfälle<br />
Steine und Erden.<br />
Metallindustrie (ohne Uhrenindustrie)<br />
Uhrenindustrie.<br />
Holzindustrie<br />
Le<strong>der</strong>, Kork, Kunststoffe; Papier, graphische<br />
Gewerbe 525 237 288 11 04<br />
Textilindustrie .<br />
Zeughäuser<br />
Chemische Industrie, Nahrungs- und Genussmittel<br />
.<br />
358<br />
690<br />
755<br />
160<br />
336<br />
322<br />
198<br />
354<br />
433<br />
5<br />
8<br />
13<br />
0,2<br />
0,7<br />
1,0<br />
Gewinnung und Verarbeitung von Gestein<br />
und Mineralien<br />
Bauwesen .<br />
Waldwirtschaft.<br />
Bahnen .<br />
An<strong>der</strong>e Tran sportunternehmungen, Handelsbetriebe<br />
.<br />
Licht-, Kraft- und Wasserwerke<br />
Kinos<br />
Büros, Verwaltungen .<br />
Total .<br />
1 077<br />
1 204<br />
347<br />
1 140<br />
1 794<br />
1 513<br />
1 432<br />
957<br />
1 093<br />
1 002<br />
205<br />
173<br />
437<br />
708<br />
214<br />
464<br />
660<br />
624<br />
274<br />
512<br />
444<br />
520<br />
93<br />
88<br />
876 417<br />
640<br />
496<br />
133<br />
676<br />
1 134<br />
889<br />
1 158<br />
445<br />
649<br />
482<br />
112<br />
85<br />
459<br />
20<br />
16<br />
4<br />
34<br />
57<br />
31<br />
41<br />
7<br />
20<br />
14<br />
3<br />
2<br />
15<br />
2,5<br />
0,8<br />
0,1<br />
1,0<br />
17,1<br />
3,7<br />
5,2<br />
2,0<br />
2,1<br />
3,6<br />
0,0<br />
0,3<br />
Obwohl es sich um Durchschnitte aus fünfjährigen Beobachtungen handelt, sind die angegebenen<br />
Häufigkeiten nicht frei von Zufallsschwankungen. Dies gilt vor allem von den Invaliditäts- und den Todesfallhäufigkeiten<br />
kleinerer Industrie- und Gewerbezweige. Bei Vergleichen sollte deshalb auch <strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Anhangstabelle<br />
3 zu entnehmende Umfang des betrachteten Versicherungsbestandes berücksichtigt werden.<br />
Die Häufigkeit <strong>der</strong> Unfälle liegt zwischen 173 bei den Büros und Verwaltungen und 1794 bei <strong>der</strong> Gewinnung<br />
und Verarbeitung von Gestein und Mineralien. Diese Gruppe weist auch die weitaus höchste<br />
Invaliditäts- und Todesfallhäufigkeit auf.<br />
39
Die Bagatellunfallhäufigkeiten weichen nicht in dem Masse voneinan<strong>der</strong> ab wie es die Unterschiede<br />
bei den an<strong>der</strong>n Häufigkeiten erwarten liessen. Im allgemeinen übersteigt die Häufigkeit <strong>der</strong> ordentlichen<br />
Unfälle jene <strong>der</strong> Bagatellunfälle. Dies gilt jedoch nicht in <strong>der</strong> Metall- und Uhrenindustrie wegen <strong>der</strong> zahlreichen<br />
leichten Metallsplitterverletzungen sowie bei den Bahnen und den Licht-, Kraft- und Wasserwerken.<br />
Eine nähere Betrachtung bestätigt die Vermutung, dass einem Industrie- o<strong>der</strong> Gewerbezweig mit hoher<br />
Unfallhäufigkeit meistens auch hohe Invaliditäts- und Todesfallhäufigkeiten entsprechen. Ausnahmen<br />
hievon bilden die Metallindustrie, wo einer an sich grossen Unfallhäufigkeit verhältnismässig kleine Invaliditäts-<br />
und Todesfallhäufigkeiten gegenüberstehen, die Holzindustrie, wo den vor allem auf Fingeramputationen<br />
zurückgehenden Invaliditätsfällen überdurchschnittliches Gewicht zukommt, und die<br />
Bahnen, bei denen umgekehrt die Bedeutung <strong>der</strong> Invaliditätsfälle gegenüber den Todesfällen zurücktritt.<br />
M ittlere Betriebsunfallhäufigkeiten 1953 — 1957<br />
Büros, Verwaltungen<br />
Kinos<br />
Uhrenindustrie<br />
Textilindustrie<br />
Le<strong>der</strong>, Kork, Kunststoffe;<br />
Papier, graphische Gewerbe<br />
Zeughäuser<br />
Chemische Industrie,<br />
Nahrungs- und Genussmittel<br />
Bahnen<br />
Licht-, Kraftund<br />
Wasserwerke<br />
Steine und Erden<br />
An<strong>der</strong>e Transportunternehmungen,<br />
Handelsbetriebe<br />
H olzi nd ustrie<br />
Metallindustrie<br />
(ohne Uhrenindustrie)<br />
Waldwirtschaft<br />
Bau wesen<br />
Gewinnung und Verarbeitung<br />
von Gestein<br />
und Mineralien<br />
500 1000<br />
1500 1800<br />
Zahl <strong>der</strong> Betriebsunfälle auf 10 Millionen Arbeitsstunden<br />
40
Die Häufigkeiten des Gesamtbestandes hängen weitgehend von <strong>der</strong> Risikoentwicklung in den beiden<br />
umfangreichsten Industrie- und Gewerbezweigen ab. Die Figur auf Seite 40 veranschaulicht das unterschiedliche<br />
Gewicht <strong>der</strong> einzelnen Gruppen. Da die Länge <strong>der</strong> Rechtecke die Unfallhäufigkeit bedeutet<br />
und die Höhe proportional zur Zahl <strong>der</strong> Versicherten gewählt wurde, entspricht die Rechteckfläche <strong>der</strong><br />
Unfallzahl des betreffenden Bestandes.<br />
In <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung zeigen die beiden Gefahrenklassen hinsichtlich <strong>der</strong> Häufigkeit<br />
<strong>der</strong> Bagatell- und <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle keine grossen Abweichungen. Um so auffallen<strong>der</strong> erscheint <strong>der</strong><br />
beträchtliche Unterschied in <strong>der</strong> Invaliditäts- und beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> Todesfallhäufigkeit, <strong>der</strong> zur Hauptsache<br />
auf die grössere Bedeutung <strong>der</strong> Verkehrs- und Sportunfälle bei den Männern zurückzuführen ist.<br />
Mittlere jährliche Zahl <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle auf 10000 Versicherte 1953 — 1957<br />
Gefah renklassen<br />
U n fälle<br />
insgesamt<br />
Bagate l l<br />
unfälle<br />
Ordentliche<br />
U nfälle<br />
I n val id i tätsfälle<br />
davon<br />
Todesfälle<br />
Männliche Versicherte 932 304 628<br />
Weibliche Versicherte<br />
858 305 553<br />
17<br />
12<br />
4,1<br />
1,1<br />
Total. 916 305 611 16 3,5<br />
Die Unfallschwere<br />
Die Schwere eines Unfalls kann nach verschiedenen Gesichtspunkten beurteilt werden. Auf den ersten<br />
Blick erscheint es naheliegend, die Unfallschwere anhand <strong>der</strong> mittleren Kosten eines Unfalls zu messen.<br />
Obschon diese im Kapitel über die Unfallkosten eingehend besprochene Grösse in mancher Hinsicht von<br />
Interesse ist, eignet sie sich nicht für Vergleiche über längere Zeitspannen hinweg. Wie dargelegt wurde,<br />
nehmen die Unfallkosten ununterbrochen zu. Ohne weiteres ist es jedoch nicht möglich, die zahlreichen<br />
den Kostenanstieg bewirkenden Einflüsse auseinan<strong>der</strong>zuhalten. Deshalb kann zwischen <strong>der</strong> eigentlichen<br />
nominellen Verteuerung <strong>der</strong> Unfallkosten und <strong>der</strong>en Zunahme zum Beispiel wegen Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />
Unfallfolgen nicht unterschieden werden. Die Voraussetzung hiefür bildet ein Unfallschweremass, welches<br />
nicht von nominellen Kostenverän<strong>der</strong>ungen abhängt.<br />
Solche Unfallschweremasse sind die auf einen Unfall bezogene Zahl <strong>der</strong> Tage mit Krankengeldbezug,<br />
die schon im Kapitel über die Unfallkosten zur Sprache kam, sowie die Zahl <strong>der</strong> je Unfall vevlorenen Arbei tsstunden.<br />
Die letztgenannte Grösse berücksichtigt auch den Arbeitsausfall infolge Invalidität und Tod, hat<br />
aber den Nachteil, dass sie von Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Arbeitszeit abhängig ist. Die Zahl <strong>der</strong> verlorenen<br />
Arbeitsstunden müsste schon beim Eintritt blosser Arbeitszeitverkürzungen sinken, weil überhaupt<br />
weniger Arbeitsstunden ausfallen können; wegen des erwähnten Ausgleiches <strong>der</strong> eingetretenen Arbeits<br />
. zeitverkürzungen durch Überstunden fällt dies aber für die Berichtsperiode ausser Betracht. Betriebswirtschaftlich<br />
gesehen scheint es schliesslich zweckmässig, die Unfallschwere am Arbeitsausfall zu messen<br />
und diesen auf einen Versicherten o<strong>der</strong> eine geleistete Arbeitsstunde zu beziehen. Diese Grösse dient auch<br />
mittelbar den Belangen <strong>der</strong> Unfallverhütung, ist sie doch wie kein an<strong>der</strong>es Schweremass geeignet, die wirtschaftliche<br />
Bedeutung <strong>der</strong> Unfälle und damit die Notwendigkeit ihrer Verhütung zum Ausdruck zu<br />
bringen.<br />
41
Mittlere Zahl <strong>der</strong> Tage mit Krankengeldbezug eines ordentlichen Unfalls<br />
Versicherungsabteilungen<br />
1938<br />
bis 1942<br />
1943<br />
bis 1947<br />
1948<br />
bis 1952<br />
1953 1954<br />
1955<br />
1956<br />
1957<br />
1953<br />
bis 1957<br />
Betriebsunfallversicherung.<br />
Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
16,3<br />
16,7<br />
17,2 17,5<br />
17,6<br />
19,0<br />
19,0 18,8<br />
20,3 20,6<br />
18,9 18,6<br />
20,7 20,7<br />
18,8<br />
21,1<br />
Die durchschnittliche Zahl <strong>der</strong> Krankengeldtage erhöhte sich im Verlaufe <strong>der</strong> letzten 20 Jahre in zunehmendem<br />
Mass, und zwar um rund 15 Prozent in <strong>der</strong> Betriebs- und um 20 Prozent in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung.<br />
Der Anstieg kommt nicht überraschend. Er ist die Folge <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>s in den letzten<br />
Jahren fortgeschrittenen Behandlungsmöglichkeiten, dank denen mehr Schwerverunfallte als früher am<br />
Leben erhalten werden. Die Verlängerung <strong>der</strong> Heildauer hängt auch damit zusammen, dass die neuen<br />
Methoden eine glie<strong>der</strong>haltende Therapie auch dort gestatten, wo Amputationen ehemals unvermeidlich<br />
waren. Nicht zu vergessen ist ferner die plastische Chirurgie, die vermehrt zur Anwendung kommt und das<br />
Heilverfahren oft sehr in die Länge zieht.<br />
Während <strong>der</strong> Berichtsperiode ist <strong>der</strong> Anstieg in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung zum Stillstand gekommen;<br />
die höchste je ermittelte Zahl fällt ins Jahr 1953. In <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung hingegen<br />
hält die Zunahme nach wie vor unvermin<strong>der</strong>t an. Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Karenzzeit, die mit<br />
2 Tagen angenommen werden kann — das Krankengeld wird bekanntlich erst vom dritten Tage nach dem<br />
Tag des Unfalls an ausgerichtet — beträgt <strong>der</strong> Arbeitsausfall während <strong>der</strong> Heildauer eines ordentlichen<br />
Unfalls rund 21 Tage in <strong>der</strong> Betriebs- und 23 Tage in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung.<br />
In dieser Grösse wird <strong>der</strong> Ausfall infolge Invalidität und Tod nicht berücksichtigt; denn die für die<br />
Krankengeldbezugsdauer massgebliche Heildauer umfasst nur die Zeit bis zur vollen Arbeitsaufnahme<br />
beziehungsweise bis zur Zusprechung einer Rente. Diesen Ausfall zu ermitteln ist um so angezeigter, als<br />
<strong>der</strong> mittlere anfängliche Invaliditätsgrad und die Todesfallhäufigkeit zeitlichen Verän<strong>der</strong>ungen unterliegen.<br />
Die Zahl <strong>der</strong> pro ordentlichen Unfall verlorenen Arbeitsstunden wird nach <strong>der</strong> Formel<br />
berechnet. Dabei bedeuten<br />
A g 320I y 60000 T<br />
Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle<br />
A = Arbeitsausfall während des Heilverfahrens, ausgedrückt in Arbeitsstunden,<br />
I = Summe <strong>der</strong> Invaliditätsprozente bei <strong>der</strong> erstmaligen Rentenfestsetzung,<br />
T = Zahl <strong>der</strong> Todesfälle.<br />
Die Zahl 320 beruht auf <strong>der</strong> Erfahrung, dass einer einprozentigen anfänglichen Invalidität ein durchschnittlicher<br />
Ausfall von 40 achtstündigen Arbeitstagen o<strong>der</strong> von 320 Arbeitsstunden entspricht. Ein<br />
Todesfall führt im Mittel zum Verlust von 60000 Arbeitsstunden, das heisst von 25 Jahren zu 300 achtstündigen<br />
Arbeitstagen.<br />
1948 †19<br />
Zahl <strong>der</strong> verlorenen Arbeitsstunden je ordentlichen Unfall<br />
1953<br />
Versicherungsabtei 1un gen<br />
1954 1955 1956 1957 1953-1957<br />
Betriebsunfallversicherung.<br />
Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
578<br />
671<br />
597<br />
651<br />
586<br />
730<br />
576<br />
719<br />
574<br />
718<br />
563<br />
740<br />
578<br />
712<br />
In den Jahren 1953 — 1957 gingen also durchschnittlich je ordentlichen Unfall in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung<br />
72 und in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung 89 achtstündige Arbeitstage verloren.<br />
42
Bei <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> je Unfall verlorenen Arbeitsstunden ist vor allem <strong>der</strong> Einfluss <strong>der</strong><br />
Todesfälle zu berücksichtigen, <strong>der</strong>en Zahl starken Zufallsschwankungen unterliegt. In <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung<br />
geht rund ein Drittel, in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung sogar fast die Hälfte aller verlorenen<br />
Arbeitsstunden auf die tödlichen Unfälle zurück. Es überrascht deshalb nicht, dass die Zahl <strong>der</strong><br />
verlorenen Arbeitsstunden im grossen und ganzen <strong>der</strong>selben zeitlichen Entwicklung folgt wie die Todesfallhäufigkeit.<br />
Als Beispiel sei auf die Nichtbetriebsunfallversicherung verwiesen, wo die unterdurchschnittlich<br />
kleine Zahl von Todesfällen des Jahres 1953 ein starkes Sinken <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> verlorenen Arbeitsstunden<br />
bewirkte. Wie <strong>der</strong> Vergleich <strong>der</strong> Durchschnittszahlen aus den beiden aufeinan<strong>der</strong>folgenden<br />
Jahrfünften zeigt, blieben die Verhältnisse in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung unverän<strong>der</strong>t, obwohl sich<br />
innerhalb <strong>der</strong> Berichtsperiode ein leichter Rückgang abzeichnete; in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
dagegen ist ein deutlicher Anstieg festzustellen.<br />
Vom Arbeitsausfall pro Unfall führt nur ein kleiner Schritt zum sogenannten Arbeitsausfallkoeffizienten,<br />
<strong>der</strong> die Zahl <strong>der</strong> verlorenen Arbeitsstunden angibt, welche es infolge ordentlicher Unfälle durchschnittlich<br />
auf einen Versicherten beziehungsweise auf eine geleistete Arbeitsstunde traf. Er kann entwe<strong>der</strong><br />
unmittelbar als Quotient aus <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> im betrachteten Versicherungsbestand verlorenen Arbeitsstunden<br />
und <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Versicherten beziehungsweise <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> geleisteten Arbeitsstunden o<strong>der</strong> als<br />
Produkt aus <strong>der</strong> Unfallhäufigkeit und <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> je ordentlichen Unfall verlorenen Arbeitsstunden berechnet<br />
werden.<br />
1948 †19 1953<br />
Arbeitsausfallkoeffizient<br />
Versicherungsabteilungen 1954 1955 1956 1957 195<br />
Zahl <strong>der</strong> verlorenen Arbeitsstunden auf einen Versicherten<br />
Betriebunfallversicherung .<br />
Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
68<br />
43<br />
66<br />
42<br />
64<br />
44<br />
64<br />
44<br />
64<br />
43<br />
61<br />
43<br />
64<br />
44<br />
Zahl <strong>der</strong> verlorenen Arbeitsstunden auf 10000 geleistete Arbeitsstunden<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
285<br />
181<br />
274<br />
176<br />
267<br />
185<br />
267<br />
184<br />
266<br />
180<br />
255<br />
181<br />
265<br />
182<br />
Im Verlauf <strong>der</strong> Berichtsperiode traten in beiden Versicherungsabteilungen keine grossen Verän<strong>der</strong>ungen<br />
auf: in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung kommt, wenn die Entwicklung <strong>der</strong> letzten zehn Jahre untersucht<br />
wird, eine leicht sinkende Tendenz zum Ausdruck; in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung dagegen<br />
blieben die Verhältnisse unverän<strong>der</strong>t. Dieser Befund steht in Übereinstimmung mit den Entwicklungstendenzen<br />
<strong>der</strong> beiden Grössen, <strong>der</strong>en Produkt den Arbeitsausfallkoeffizienten ergibt. Weil sich in <strong>der</strong><br />
Betriebsunfallversicherung die Häufigkeit <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle nicht wesentlich än<strong>der</strong>te, die Zahl <strong>der</strong><br />
je Unfall verlorenen Arbeitsstunden dagegen leicht zurückging, wird die Abnahme des Arbeitsausfallkoeffizienten<br />
verständlich. In <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung dagegen hielten sich <strong>der</strong> Rückgang <strong>der</strong><br />
Ünfallhäufigkeit und die Zunahme <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> verlorenen Arbeitsstunden die Waage.<br />
Zusammenfassend kann für die Berichtsperiode gesagt werden, dass die Schwere <strong>der</strong> Betriebsunfälle<br />
unter allen hier betrachteten Gesichtspunkten im Abnehmen begriA'en war. Die Schwere <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle<br />
dagegen weist im allgemeinen steigende Tendenz auf; nur <strong>der</strong> Arbeitsausfallkoeffizient<br />
blieb unverän<strong>der</strong>t.<br />
43
Invaliden- und Hinterlassenenrenten<br />
Die Invalidenrenten<br />
Entstehung und Entwicklung des Invalidenrentenbestandes sind in erster Linie von den im K<strong>UVG</strong><br />
festgesetzten Bestimmungen abhängig. Die massgebenden Gesetzesartikel, die seit ihrem Inkrafttreten<br />
unverän<strong>der</strong>t geblieben sind, seien deshalb an den Anfang dieses Abschnittes gestellt:<br />
Art.76: Wenn von <strong>der</strong> Fortsetzung <strong>der</strong> ärztlichen Behandlung eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des<br />
Versicherten nicht erwartet werden kann und <strong>der</strong> Unfall eine voraussichtlich bleibende Erwerbsunfähigkeit hinterlässt,<br />
so hören die bisherigen Leistungen auf, und es erhält <strong>der</strong> Versicherte eine Invalidenrente. Überdies rüstet<br />
ihn die Anstalt noch mit den nötigen Hilfsmitteln aus.<br />
Art.77: Die Rente beträgt bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit siebzig Prozent des Jahresverdienstes des Verischerten. Ist<br />
<strong>der</strong> Versicherte <strong>der</strong>art hilflos, dass er beson<strong>der</strong>er Wartung und Pflege bedarf, so kann für die Dauer dieses Zustandes<br />
die Rente bis auf die Höhe des Jahresverdienstes gebracht werden.<br />
Bei nur teilweiser Erwerbsunfähigkeit wird die Rente entsprechend gekürzt.<br />
Art. 80: Wird die Erwerbsunfähigkeit nach Festsetzung <strong>der</strong> Rente erheblich grösser o<strong>der</strong> geringer, so tritt für die Folgezeit<br />
eine entsprechende Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Rente o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en Aufhebung ein.<br />
Die Rente kann während <strong>der</strong> ersten drei Jahre nach ihrer Festsetzung je<strong>der</strong>zeit, in <strong>der</strong> Folge aber nur noch bei<br />
Ablauf des sechsten und des neunten Jahres revidiert werden.<br />
Wenn die Revision eine ärztliche Untersuchung o<strong>der</strong> Beobachtung erfor<strong>der</strong>t, die für den Versicherten eine Einbusse<br />
an seinem Verdienst bedingt, so treten für die entsprechende Zeit die in Art. 73 bis 75 vorgesehenen Leistungen<br />
an Stelle <strong>der</strong> Rente.<br />
Im folgenden wird eingehend über den Neuzugang an Invalidenrenten, über die Reaktivierung und die<br />
Sterblichkeit <strong>der</strong> Unfallinvaliden sowie über den Bestand <strong>der</strong> laufenden Renten berichtet. Dadurch soll<br />
ein Einblick in die Entwicklung des Rentenbestandes und in die damit zusammenhängenden versicherungstechnischen<br />
Belange vermittelt werden.<br />
Dev Neuzugang an 1nvalideni enten<br />
Im Laufe <strong>der</strong> Zeit hat sich die Entschädigungspraxis gewandelt, indem mehr und mehr einmalige<br />
Kapitalabfindungen an Stelle von kleinen befristeten Renten ausbezahlt wurden. Auch in <strong>der</strong> Berichtsperiode<br />
ist <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Einmalentschädigungen an <strong>der</strong> Gesamtheit <strong>der</strong> zugesprochenen Invalidenrenten<br />
wie<strong>der</strong>um grösser geworden.<br />
Prozentualer Anteil <strong>der</strong> Einmalentschädigungen am Neuzugang<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
1923<br />
Beobachtungsperiode<br />
1928 1933 †19<br />
1943 1948 †1938-1942<br />
1953-1957<br />
Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
3<br />
6<br />
9<br />
15<br />
31<br />
36<br />
40<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
20<br />
24<br />
27<br />
Die neuesten Beobachtungen zeigen, dass in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung zwei Fünftel und in <strong>der</strong><br />
Nichtbetriebsunfallversicherung etwas mehr als ein Viertel aller neu festgesetzten Invalidenrenten in<br />
Form von Kapitalabfindungen ausgerichtet werden. Es ist deshalb von Interesse, den Neuzugang an In<br />
44
validenrenten geson<strong>der</strong>t nach den Einmalentschädigungen und nach den übrigen, den sogenannten<br />
ordentlichen Renten, zu betrachten.<br />
Der Neuzugang an I nvalidenrenten<br />
Zahlungsart<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
N ichtbetriebsunfallversicherung<br />
1948 — 1952 1953 — 1957 Zunahme 1948 — 1952 1953 — 1957 Zunahme<br />
Einmalentschädigungen<br />
Ordentliche Renten.<br />
6 450 8 358<br />
11 379 12 310<br />
30/<br />
8/<br />
17 829 20 668 16 /<br />
1 804 2 395 33/<br />
5 744 6 426 12/<br />
7 548 8 821 17 /<br />
' Diese Zahlen sind grösser als die auf Seite 17 des Berichtes mitgeteilten Werte, weil lnvaliditätsfälle, denen Hinterlassenenrenten<br />
nachfolgen, für versicherungstechnische Zwecke nicht nur als Todesfälle, son<strong>der</strong>n auch als Invaliditätsfälle<br />
behandelt werden müssen; in <strong>der</strong> Unfallstatistik hingegen werden sie nur als Todesfälle gezählt.<br />
Die auch während <strong>der</strong> Beobachtungsperiode 1953 — 1957 andauernde Hochkonjunktur brachte eine<br />
Ausweitung des Versichertenbestandes; die demzufolge erwartungsgemäss eingetretene Zunahme des<br />
Neuzuganges an Invalidenrenten entspricht in beiden Versicherungsabteilungen <strong>der</strong> Vergrösserung <strong>der</strong><br />
Vollarbeiterzahl. Der bedeutende Zuwachs <strong>der</strong> Einmalentschädigungen ist auf die fortschreitende Erhöhung<br />
des Anteils <strong>der</strong> Renten mit niedrigem Invaliditätsgrad zurückzuführen.<br />
Verteilung des Neuzuganges an Invalidenrenten nach Invaliditätsgrad bei Rentenbeginn<br />
Invaliditätsgrad<br />
Bet riebsu n fal I versicheru n g<br />
N ichtbetriebsunfallversicherung<br />
1938 †19 1943 †19 1948-1952 195<br />
bei Rentenbeginn<br />
1938-1942 1943 †19 1948-1952 1953 †19<br />
0 — 19/ .<br />
20 — 69/ .<br />
70/ und mehr .<br />
Total<br />
310<br />
640<br />
50<br />
399<br />
561<br />
40<br />
503<br />
462<br />
35<br />
570<br />
401<br />
29<br />
1 000 1 000 1 000 1 000<br />
283<br />
671<br />
46<br />
357<br />
607<br />
36<br />
418<br />
548<br />
34<br />
1 000 1 000 1 000 1<br />
Mittlerer<br />
Invaliditätsgrad . 27,9 / 25,0 / 22,9 / 20,8 / 28,3 / 25,2 / 24,1 / 22<br />
In den letzten Jahren entfällt mehr als die Hälfte des Neuzuganges auf Renten mit einem anfänglichen<br />
Invaliditätsgrad von weniger als 20 Prozent, während die schweren Fälle glücklicherweise nur noch eine<br />
kleine Min<strong>der</strong>heit von rund 3 Prozent bilden. Diese Entwicklung bewirkte eine deutliche Abnahme des<br />
mittleren Invaliditätsgrades. Dabei ist festzustellen, dass dieser bei den Nichtbetriebsunfällen stets höher<br />
ist als bei den Betriebsunfällen, wo die kleinen Renten als Folge <strong>der</strong> vielen Fingerverletzungen zahlreicher<br />
vertreten sind.<br />
Die Frage nach dem Grund <strong>der</strong> fortwährenden Zunahme des Anteils <strong>der</strong> kleinen Renten kann nicht<br />
eindeutig beantwortet werden. Sicher ist, dass die Renten dank den besseren Heilerfolgen niedriger festgesetzt<br />
werden können als früher; auch ist eine Wandlung in <strong>der</strong> Entschädigungspraxis in dem Sinne erfolgt,<br />
dass die Renten eher spät und mit einem kleineren anfänglichen Invaliditätsgrad zugesprochen werden,<br />
dafür aber auf die einst üblichen vielen Abstufungen während <strong>der</strong> ersten Zeit des Rentenbezuges verzichtet<br />
wird.<br />
45
Durch die dargelegte Wandlung in <strong>der</strong> Entschädigungspraxis - kleinerer Invaliditätsgrad bei Rentenbeginn<br />
und Zunahme <strong>der</strong> Einmalentschädigungen - lässt <strong>der</strong> Bestand <strong>der</strong> ordentlichen Renten weniger<br />
Revisionsmöglichkeiten übrig. Eine Folge davon ist <strong>der</strong> schwächere Rentenabfall im Revisionsbereich,<br />
worüber im zweiten Teil dieses Abschnittes berichtet wird.<br />
Die Verteilung <strong>der</strong> Renten nach dem Invaliditätsgrad für die Einmalentschädigungen und für die<br />
ordentlichen Renten ist aus <strong>der</strong> folgenden Tabelle ersichtlich:<br />
Verteilung <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> 1953-1957 festgesetzten Invalidenrenten<br />
nach dem Invaliditätsgrad<br />
Invaliditäts rad<br />
Betriebsunfall- Nichtbetriebsversicherung<br />
unfallversicherung<br />
entschadı- gungen 1 enten R entschadı- gungen 1 enten R<br />
bei Rentenbšginn Eínmfilb. Ordentliche Einmíilí Ordentliche<br />
0-19°/0. . . . . . 932 333 894 356<br />
20-69°/0. . . . . . 67 619 106 605<br />
70% und mehr _ . 1 48 0 39<br />
Total. . . . . . . 1 000 1 000 1 000 1 000<br />
Mittlerer<br />
Invaliditätsgrad . . 11,3 y, 26,9 °/, 12,0 % 25,8 ° O<br />
1 Ohne Abfindungen nach Art. 82 K<strong>UVG</strong>.<br />
Bei den weitaus meisten Einmalentschädigungen beträgt <strong>der</strong> anfängliche Invaliditätsgrad weniger als<br />
20 Prozent, während rund zwei Drittel <strong>der</strong> ordentlichen Renten für schwerere Fälle ausgerichtet werden.<br />
Erfreulicherweise ist aber <strong>der</strong> Invaliditätsgrad auch bei den neu festgesetzten ordentlichen Renten im<br />
Mittel klein.<br />
Dass es sich bei den Einmalentschädigungen nur um kleine, befristete Renten handelt, geht auch aus<br />
ihrem Kostenanteil hervor. Die 40 Prozent in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung durch Kapitalabfindung<br />
entschädigten Rentenfälle verursachen nur 3 Prozent <strong>der</strong> Rentenkosten, die 27 Prozent in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
nur <strong>der</strong>en 2 Prozent. Bei den ordentlichen Renten entfallen in <strong>der</strong> Betriebsbzw.<br />
Nichtbetriebsunfallversicherung auf die leichten Fälle nur 17 bzw. 22 Prozent, auf die mittleren 68<br />
bzw. 66 Prozent und auf die schweren 15 bzw. 12 Prozent <strong>der</strong> Rentenkosten.<br />
Aufschlussreich ist schliesslich eine Übersicht über das mittlere Alter <strong>der</strong> lnvalidenrentner bei Rentenbeginn.<br />
46<br />
Mittleres Alter <strong>der</strong> lnvalidenrentner bei Rentenbeginn<br />
Betriebsunfallversicherung Nichtbetriebsunfallversicherung<br />
Beobachtungsperiode eEti;rlT§å-i_ Ordentliche Gesamt- eštigcrgâfiíb Ordentliche Gesamtgungen<br />
1 Renten bestand gungen 1 Renten bestand<br />
1938-1942 37,1 40,9 40,4 39,4 42,8 42,5<br />
1943-1947 37,4 42,6 41,1 40,2 45,3 44,3<br />
1948-1952 38,6 43,4 41,7 41,1 46,4 45,2<br />
1953-1957 39,5 43,7 42,0 42,4 47,6 46,2<br />
1 Ohne Abfindungen nach Art.82 K<strong>UVG</strong>.
Einmalentschädigungen werden eher an jüngere und somit anpassungsfähigere Verunfallte ausgerichtet.<br />
Bei allen Gesamtheiten ist ein ständiger Anstieg des mittleren Alters <strong>der</strong> Invaliden bei Rentenbeginn<br />
festzustellen. In <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung ist es stets deutlich höher als in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung.<br />
Der Rentenabfall im Revisionsbeveieh<br />
Als Revisionsbereich wird <strong>der</strong> Zeitraum <strong>der</strong> ersten neun Rentenbezugsjahre bezeichnet, in dem nach<br />
Gesetz eine Invalidenrente durch Herab- o<strong>der</strong> Heraufsetzung des Rentenbetrages den Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />
Erwerbsfähigkeit angepasst werden muss. Die Rentenbetragsän<strong>der</strong>ungen häufen sich beson<strong>der</strong>s in den<br />
drei gesetzlich verankerten Revisionsterminen am Ende des dritten, sechsten und neunten Bezugsjahres.<br />
Es ergeben sich dadurch sprunghafte Abnahmen <strong>der</strong> Rentenbeträge, die in den Rentenabfallsordnungen<br />
als Än<strong>der</strong>ungen dargestellt sind, welche auf die sehr kurzen Zeitspannen 3 bis 3 + L,6 bis 6 + A und<br />
9 bis 9 + L entfallen.<br />
Die Gesamtausschei deoi.dnung<br />
Aus dem seit <strong>der</strong> letzten Berichterstattung gewonnenen Beobachtungsmaterial wurde wie<strong>der</strong>um die<br />
Abfallsordnung <strong>der</strong> Rentensummen ermittelt, die sich durch das Zusammenwirken von Revision und<br />
Sterblichkeit in den ersten neun Bezugsjahren einerseits für den Bestand aller Renten und an<strong>der</strong>seits für<br />
den Bestand <strong>der</strong> ordentlichen Renten allein (ohne Einmalentschädigungen) ergibt. In <strong>der</strong> nachfolgenden<br />
Tabelle sind diese beiden Ordnungen jenen gegenübergestellt, die aus den Erfahrungen <strong>der</strong> Beobachtungsperioden<br />
1938 — 1943, 1944 — 1948 und 1949 — 1953 abgeleitet wurden.<br />
1954 †19<br />
Abfall einer Rentensumme von 10000 Franken im Revisionsbereich<br />
1944 1938 †â€<br />
Seit<br />
19 19<br />
Rentenbetrag im Zeitpunkt t nach den Erfahrungen <strong>der</strong> Beobachtungs<br />
Rentenbeginn<br />
Gesa<br />
verflossene Ordentliche Renten (ohne Einmalentschadigungen) bestand<br />
Zeit in Jahren<br />
1949-1953<br />
E<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
3yZ<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10 000<br />
6 859<br />
5 714<br />
5 017<br />
4 638<br />
4 448<br />
4 244<br />
4 125<br />
3 779<br />
3 673<br />
3 556<br />
3 446<br />
3 275<br />
10 000<br />
7 627<br />
6 546<br />
5 905<br />
5 558<br />
5 290<br />
5 081<br />
4 909<br />
4 556<br />
4 451<br />
4 324<br />
4 215<br />
4 019<br />
10 000<br />
8 240<br />
7 175<br />
6 595<br />
6 388<br />
6 134<br />
5 930<br />
5 773<br />
5 519<br />
5 343<br />
5 180<br />
5 049<br />
4 893<br />
10 000<br />
8 759<br />
7 769<br />
7 270<br />
7 047<br />
6 845<br />
6 630<br />
6 435<br />
6 169<br />
6 001<br />
5 872<br />
5 730<br />
5 645<br />
10 000<br />
7 875<br />
6 609<br />
6 134<br />
5 791<br />
5 596<br />
5 410<br />
5 248<br />
5 023<br />
4 885<br />
4 780<br />
4 664<br />
4 593<br />
Der Rentenabfall des Gesamtbestandes in <strong>der</strong> Beobachtungsperiode 1954 — 1957 ist wegen <strong>der</strong> vielen in<br />
Kapitalform ausbezahlten kleinen, befristeten und rasch abfallenden Renten erheblich grösser als jener<br />
<strong>der</strong> ordentlichen Renten. Der auf die gesamte Jahresrentensumme entfallende Anteil <strong>der</strong> Einmalentschädigungen<br />
hat in diesen vier Jahren von 18,0 Prozent auf 19,5 Prozent zugenommen. Diese Entwicklung ist<br />
einer <strong>der</strong> Gründe, weshalb <strong>der</strong> Abfall <strong>der</strong> ordentlichen Renten erneut schwächer geworden ist; denn je<br />
mehr Renten in Kapitalform ausbezahlt werden, desto kleiner wird die Revisionsmöglichkeit des verbleibenden<br />
Rentenbestandes. Die Vermin<strong>der</strong>ung des Rentenabfalles ist ferner eine Folge <strong>der</strong> geringeren Wir<br />
47
kung <strong>der</strong> Rentenrevision. Da die Renten dank den besseren Heilerfolgen und wegen des Verzichtes auf<br />
viele Rentenabstufungen zu einem niedrigeren Invaliditätsgrad zugesprochen werden können als früher,<br />
hat <strong>der</strong> Rentenabfall beson<strong>der</strong>s in den ersten Bezugsjahren bedeutend abgenommen.<br />
Aus <strong>der</strong> folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass dieser Rückgang auch während <strong>der</strong> neuesten Beobachtungsperiode<br />
angehalten hat; im ersten Rentenbezugsjahr ist <strong>der</strong> Abfall sogar deutlich schwächer als<br />
jener <strong>der</strong> Abfallsordnung, die den gegenwärtig gültigen Rentenbarwerten zugrunde liegt. Wie jedoch die<br />
Werte im Zeitpunkt 9 + D zeigen, ist gesamthaft betrachtet diese Abfallsordnung noch nicht überholt.<br />
Renten<br />
Zeitpunkt<br />
nach den Erfahrungen<br />
<strong>der</strong> Beobachtungsjahre<br />
1954-1955<br />
1956-1957<br />
nach den<br />
gültigen<br />
Rechnungsgrundlagen<br />
0<br />
1<br />
9+K<br />
10 000<br />
8 716<br />
5 607<br />
10 000<br />
8 801<br />
5 686<br />
10 000<br />
8 675<br />
5 971<br />
Die im Jahre 1955 festgelegten Rentenbarwerte vermögen zur Zeit insgesamt noch zu genügen. Bei<br />
einem weiteren Rückgang des Rentenabfalles werden sie jedoch erneut den verän<strong>der</strong>ten Verhältnissen angepasst<br />
werden müssen.<br />
Die Wirkung <strong>der</strong> beiden Abgangsursac lsen Revision und Tod<br />
Beim Rentenabfall im Revisionsbereich handelt es sich um eine zusammengesetzte Ordnung. Die beson<strong>der</strong>e<br />
Bedeutung <strong>der</strong> beiden Abgangsursachen Revision und Tod kann mit unabhängigen Ordnungen<br />
dargelegt werden.<br />
Die graphische Darstellung dieser unabhängigen Abfallsordnungen auf Seite 49 zeigt deutlich, wie<br />
verschieden die beiden Abgangsursachen Revision und Tod auf den Rentenbetrag einwirken. Es ist ohne<br />
weiteres zu erkennen, wie ungleich viel schwerer die Rentenrevisionen gegenüber <strong>der</strong> Sterblichkeit ins<br />
Gewicht fallen. Die Revisionswirkung bestimmt denn auch wesentlich den Gesamtabfall. Aus <strong>der</strong> graphischen<br />
Darstellung sind ferner die Auswirkungen <strong>der</strong> die Rentenrevision ordnenden Gesetzesbestimmungen<br />
leicht abzulesen. Da während <strong>der</strong> ersten drei Bezugsjahre die Renten je<strong>der</strong>zeit revidierbar sind,<br />
ist <strong>der</strong> Einfluss <strong>der</strong> Revision in diesem Bereiche beson<strong>der</strong>s spürbar. Die Unstetigkeitsstellen <strong>der</strong> Revisionskurven<br />
am Ende des dritten, sechsten und neunten Bezugsjahres weisen auf die gesetzlich verankerten Revisionstermine<br />
hin.<br />
Die ständige und erhebliche Abnahme <strong>der</strong> Revisionswirkung wird durch die stets flacher werdenden<br />
Kurven deutlich dargestellt. Während sich vor etwa 15 Jahren eine anfängliche Rentensumme von 10000<br />
Franken im Revisionsbereich durchschnittlich um 60 Prozent auf 4000 Franken vermin<strong>der</strong>te, ist <strong>der</strong><br />
Rentenabfall in neuerer Zeit nur noch halb so gross. Noch stärker ist <strong>der</strong> Rückgang <strong>der</strong> Revisionswirkung<br />
im ersten Rentenbezugsjahre, in dem er fast zwei Drittel betrug, während die Rentensumme vom 6. bis<br />
zum 9.Jahre in <strong>der</strong> neuesten Beobachtungsperiode wegen <strong>der</strong> Heraufsetzungen bei Silikoserenten sogar<br />
anstieg. Auch in den drei Revisionsterminen ist <strong>der</strong> Rentenabfall im allgemeinen etwas schwächer geworden.<br />
Der Einfluss <strong>der</strong> Sterblichkeit während <strong>der</strong> drei ersten Rentenbezugsjahre ist viel geringer als<br />
die Wirkung <strong>der</strong> Revisionen; in den folgenden 6 Jahren wird jedoch die Rentensumme durch Todesfälle<br />
stärker vermin<strong>der</strong>t, und vom zehnten Bezugsjahre an wirkt nur noch <strong>der</strong> Tod als Ausscheideursache. Der<br />
Rentenabfall durch Tod im Revisionsbereich hat sich während <strong>der</strong> letzten Jahre wenig verän<strong>der</strong>t, was mit<br />
dem sonst allgemein beobachteten Rückgang <strong>der</strong> Sterblichkeit nicht übereinzustimmen scheint. Diese<br />
eigentümliche Erscheinung ist auf die hohe Sterblichkeit <strong>der</strong> Silikoseinvaliden zurückzuführen, <strong>der</strong>en<br />
Bestand stets zunimmt.
...... ~.... Beobachtungsperiode 1938 — 1943<br />
----- - - Beobachtungsperiode 1944-1948<br />
Rentensumme<br />
l 0000<br />
Rentenabfall im Revisionsbereich<br />
R: Abfall durch Revision T: Abfall durch Tod<br />
~ — - — - —. — - Beobachtungsperiode 1949 — 1953<br />
Beobachtungsperiode 1954 — 1957<br />
~ % ~ ~ ~<br />
~ y<br />
~ ~ ~ ~<br />
9 000<br />
~ ~ ~<br />
~ ~<br />
~ y~ ~ ~ ~<br />
8 000<br />
L.<br />
7 000<br />
~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~y ~ ~ ~ ~ ~<br />
5 000<br />
~ yg<br />
~ ~ y ~<br />
~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ y~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~<br />
3000<br />
2 000<br />
l 000<br />
0<br />
3<br />
3y i]<br />
~ ~ +<br />
6<br />
Oy~ ~ ~ ~ y~ ~ ~<br />
~
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass <strong>der</strong> Verlauf <strong>der</strong> Silikoserenten von jenem <strong>der</strong><br />
Unfallrenten vollständig verschieden ist. Da es sich bei <strong>der</strong> Silikose um einen fortschreitenden Krankheitsprozess<br />
handelt, werden viele Silikosekranke vollständig invalid. Ihre Renten müssen deshalb auf dem<br />
Revisionswege ständig erhöht werden; in <strong>der</strong> Beobachtungsperiode 1954 — 1957 stieg dadurch die Rentensumme<br />
während des Revisionsbereiches um 67 Prozent an. An<strong>der</strong>seits ist die Sterblichkeit <strong>der</strong> Silikosekranken<br />
viel höher als jene <strong>der</strong> Unfallinvaliden.<br />
Durch die in <strong>der</strong> Nachkriegszeit vermehrt vorgenommenen prophylaktischen ärztlichen Untersuchungen<br />
und durch die Verbesserungen von technischen Einrichtungen wird versucht, das Auftreten<br />
<strong>der</strong> Silikose zu verhüten und die von <strong>der</strong> Silikose befallenen Arbeiter vor einer weiteren Gefährdung zu bewahren.<br />
Die bisherigen Erfahrungen lassen vermuten, dass durch die Verhin<strong>der</strong>ung einer weiteren Quarzstaubgefährdung<br />
das Fortschreiten <strong>der</strong> Krankheit in manchen Fällen verlangsamt werden kann. Jedenfalls<br />
hat sich <strong>der</strong> Rentenverlauf im Mittel bereits erheblich verbessert, indem einerseits <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> Rentensummen<br />
zufolge Revision und an<strong>der</strong>seits <strong>der</strong> Abfall durch Tod im Vergleich mit <strong>der</strong> Beobachtungsperiode<br />
1949 — 1953 kleiner geworden sind. Zu bemerken bleibt noch, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten <strong>der</strong><br />
Tuberkulose im letzten Jahrzehnt spürbar verbessert haben, wodurch auch die an Silikotuberkulose erkrankten<br />
Versicherten länger am Leben bleiben.<br />
Gemessen am gesamten lnvalidenbestande stellen die Silikoserentner nur eine kleine Min<strong>der</strong>heit dar.<br />
Da zudem die hohe Sterblichkeit durch die vielen Rentenerhöhungen weitgehend ausgeglichen wird, vermögen<br />
die Silikoserenten den Abfall aller Renten nur sehr wenig zu beeinflussen. Bei <strong>der</strong> Kapitalisierung<br />
<strong>der</strong> Silikoserenten, denen vielfach noch Hinterlassenenrenten nachfolgen, ist allerdings den Beson<strong>der</strong>heiten<br />
des Rentenverlaufes Rechnung zu tragen. Dies geschieht vorerst durch die Bestellung von Schadenreserven;<br />
die endgültige Ermittlung des Rentendeckungskapitals erfolgt erst nach dem Ableben <strong>der</strong><br />
S iii kosein validen.<br />
Die Abhängigkeit <strong>der</strong> Rentenabfallsordnungen vom Alter<br />
Die nach Alter geglie<strong>der</strong>ten unabhängigen Ausscheideordnungen, ermittelt aus dem Beobachtungsmaterial<br />
<strong>der</strong> Jahre 1954 — 1957, zeigen folgenden Verlauf:<br />
Abhängigkeit <strong>der</strong> Ausscheideordnungen vom Alter<br />
Zeitpunkt<br />
Rentenabfall durch<br />
Revision<br />
Tod<br />
Alter bei Rentenbeginn<br />
Alter bei Rentenbcginn<br />
70 und mehr<br />
20 — 24 45 — 49<br />
20 — 24 4549 70 und mehr<br />
0<br />
3yZ<br />
6+L<br />
9q-L<br />
10 000<br />
6 620<br />
5 983<br />
5 767<br />
10 000<br />
7 310<br />
6 889<br />
6 917<br />
10 000<br />
8 776<br />
8 695<br />
8 682<br />
10 000<br />
9 947<br />
9 886<br />
9 837<br />
10 000<br />
9 727<br />
8 998<br />
8 383<br />
10 000<br />
8 328<br />
6 243<br />
4 125<br />
Die Wirkung <strong>der</strong> Ausscheideursachen Revision und Tod ist je nach dem Alter <strong>der</strong> Invaliden sehr verschieden.<br />
Der Rentenabfall zufolge Revision ist bei den jungen, anpassungsfähigeren Rentnern am grössten<br />
und nimmt mit zunehmendem Alter ab, während <strong>der</strong> Einfluss <strong>der</strong> Sterblichkeit mit dem Alter ansteigt.<br />
Der Rentenabfall im Revisionsbereich wird bei den jüngern Invaliden in erster Linie durch die Revisionen,<br />
bei den älteren durch die Sterblichkeit bestimmt. Der beobachtete Rückgang des Rentenabfalles erstreckt<br />
sich über alle Altersklassen.<br />
50
Der Rentenabfall nach Verletzungsarten<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungen über den Rentenabfall im Revisionsbereich und über die Sterblichkeit<br />
<strong>der</strong> Unfallinvaliden lassen vermuten, dass die Wirkung <strong>der</strong> Rentenrevision wesentlich abhängig ist<br />
von <strong>der</strong> Verletzungsart und dass die Sterblichkeit <strong>der</strong> Invaliden nicht in erster Linie vom Grad, son<strong>der</strong>n<br />
von <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Invalidität beeinflusst wird.<br />
Eine Untersuchung <strong>der</strong> Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit von den Verletzungsarten ist schon deshalb<br />
nicht möglich, weil dem Versicherer in den weitaus meisten Fällen nicht einmal die Todesursachen bei den<br />
Rentnern bekannt sind. Hingegen konnte <strong>der</strong> Rentenverlauf im Revisionsbereiche für verschiedene Verletzungsarten<br />
untersucht werden. Die Untersuchungen erstreckten sich auf die Rentenjahrgänge 1945 und<br />
1952; das Beobachtungsmaterial umfasste rund 3500 beziehungsweise 3600 Betriebsunfall- und 1100 beziehungsweise<br />
1600 Nichtbetriebsunfallrenten, worin auch die Einmalentschädigungen enthalten sind.<br />
Während <strong>der</strong> Verlauf <strong>der</strong> Renten aus dem Jahre 1945 bis zum Ende des Revisionsbereiches beobachtet<br />
werden konnte, war dies bei jenen aus dem Jahre 1952 vorläufig nur bis zum 4. Bezugsjahre möglich. Im<br />
folgenden seien einige Ergebnisse dieser umfangreichen Erhebungen mitgeteilt.<br />
Das Beobachtungsmaterial wurde in 13 Gesamtheiten geglie<strong>der</strong>t, wobei nur die Hauptverletzung beziehungsweise<br />
<strong>der</strong> am schwersten verletzte Körperteil berücksichtigt wurde:<br />
I Finger- und Mittelhandverletzungen aller Art<br />
2 Frakturen, Luxationen und Distorsionen von<br />
21 Schlüsselbein, Schulterblatt, Schultergelenk, Oberarm<br />
22 Speiche, Elle, Handwurzel, Ellenbogen- und Handgelenk<br />
23 Becken, Hüftgelenk, Oberschenkel<br />
24 Kniescheibe, Schienbein, Wadenbein, Fusswurzel, Mittelfuss, Zehen, Kniegelenk (inkl. Meniskus),<br />
Fuss- und Zehengelenke<br />
3 Weichteilverletzungen <strong>der</strong> Extremitäten (ohne Finger und Mittelhand), also Schnitt-, Stich-, Riss-,<br />
Schürf-, Schuss- und Bisswunden, Quetschungen und Insektenstiche<br />
31 — 34 Unterteilung analog 21 — 24<br />
4 Schädel- und Hirnverletzungen<br />
5 Augenverletzungen<br />
6 Wirbelsäuleverletzungen<br />
7 Übrige Verletzungen (im wesentlichen Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Elektrizität,<br />
Hitze und Kälte, Verletzungen von Ober- und Unterkiefer, Nase, Hals, Rücken, Lenden, Rippen und<br />
Innenorganen)<br />
0 Nicht in die Untersuchung einbezogen wurden die Renten für Berufskrankheiten, die Abfindungen nach<br />
Art. 82 und die durch Pauschalentschädigungen erledigten Fälle (z. B. Verlust des Geruchsinnes).<br />
Für alle 13 Gesamtheiten wurde ausser dem Rentenabfall im Revisionsbereich noch die mittlere Heildauer<br />
und <strong>der</strong> mittlere Invaliditätsgrad bei Rentenbeginn festgestellt. Obschon das Beobachtungsmaterial<br />
bei einigen Verletzungsarten ziemlich klein war, vermitteln die Ergebnisse doch einen Überblick über die<br />
Unterschiede zwischen den einzelnen Gesamtheiten und über die Entwicklung von 1945 bis 1952.<br />
Es ist von Interesse, die mittlere Heildauer <strong>der</strong> einzelnen Gesamtheiten miteinan<strong>der</strong> zu vergleichen. Bei<br />
einer Gegenüberstellung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Jahre 1945 und 1952 dürfte wegen <strong>der</strong> unbestrittenen Fortschritte<br />
<strong>der</strong> medizinischen Wissenschaft eine spürbare Verbesserung des Heilerfolges erwartet werden. In<br />
<strong>der</strong> Tat begannen im Jahre 1945 die Ärzte mit <strong>der</strong> Anwendung von Antibiotika; bekannt war damals erst<br />
das noch teure Penicillin, während im Jahre 1952 dessen allseits gute Wirksamkeit vielleicht den Höhepunkt<br />
erreicht hatte, und daneben noch an<strong>der</strong>e Antibiotika zur Verfügung standen. Es sei indessen daran<br />
erinnert, dass sich die Rentenfestsetzungspraxis ebenfalls geän<strong>der</strong>t hat, indem die Verunfallten eher länger<br />
im Heilstadium mit Krankengeldanspruch behalten, dafür aber die Renten tiefer und mit möglichst wenig<br />
Abstufungen festgesetzt werden.<br />
51
Mittlere Heildauer nach Verletzungsarten bei Rentenfällen<br />
Verletzungsart i verletzter Körperteil<br />
1945<br />
Bet riebsun fallversicherung<br />
1952<br />
N ichtbetriebsunfallversicherung<br />
1945<br />
1952<br />
Tage<br />
Tage<br />
Tage<br />
Tage<br />
l Fingerverletzungen<br />
2 Frakturen usw. von<br />
21 Schulter, Oberarm .<br />
22 Vor<strong>der</strong>arm<br />
23 Becken, Oberschenkel<br />
24 Unterschenkel, Fuss<br />
3 Weichteilverletzungen an<br />
31 Schulter, Oberarm .<br />
32 Vor<strong>der</strong>arm<br />
33 Becken, Oberschenkel<br />
34 Unterschenkel, Fuss<br />
4 Schädel- und Hirnverletzungen<br />
5 Augenverletzungen<br />
6 Wirbelsäuleverletzungen .<br />
7 Übrige Verletzungen<br />
100<br />
187<br />
211<br />
313<br />
279<br />
184<br />
176<br />
259<br />
288<br />
342<br />
127<br />
265<br />
314<br />
218<br />
195<br />
348<br />
276<br />
194<br />
190<br />
251<br />
317<br />
311<br />
105<br />
309<br />
309<br />
95<br />
179<br />
153<br />
285<br />
239<br />
162<br />
236<br />
294<br />
268<br />
293<br />
122<br />
244<br />
246<br />
176<br />
174<br />
337<br />
270<br />
162<br />
151<br />
216<br />
345<br />
252<br />
115<br />
301<br />
226<br />
Total 167 168 180 205<br />
Die Unterschiede zwischen den Gesamtheiten entsprechen den Erwartungen. Am kürzesten ist die<br />
mittlere Heildauer bei den Fingerverletzungen; auch bei den Augenverletzungen ist sie bedeutend kleiner<br />
als bei den übrigen Verletzungsarten. Ferner ist die Behandlungsdauer von Frakturen und Weichteilverletzungen<br />
an den Armen im Mittel viel früher abgeschlossen als jene von Beinverletzungen.<br />
Bei den Nichtbetriebsunfällen ist die mittlere Heildauer in <strong>der</strong> Regel kürzer als bei den entsprechenden<br />
Verletzungsarten in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung, wo sie aber insgesamt wegen <strong>der</strong> vielen Fingerverletzungen<br />
kleiner ist.<br />
Von 1945 bis 1952 ist die Behandlungsdauer infolge <strong>der</strong> erwähnten Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Rentenfestsetzungspraxis<br />
im allgemeinen ausgedehnt worden. Mit ein Grund hiefür ist auch die Tatsache, dass die fortschreitende<br />
Mechanisierung und die Zunahme <strong>der</strong> Verkehrsunfälle mehr schwere Verletzungen verursachten.<br />
Der Erfolg <strong>der</strong> Anwendung von Antibiotika wird deshalb nicht augenfällig; immerhin lässt er<br />
sich bei den Finger- und Augenverletzungen gut nachweisen. Sicher ist ferner, dass viele Verletzungen dank<br />
diesen Medikamenten besser ausgeheilt werden konnten, weshalb gar keine Rente mehr zugesprochen<br />
werden musste; endlich ist anzunehmen, dass mancher Schwerverunfallte durch die neue Therapie am<br />
Leben erhalten wurde.<br />
Je grösser <strong>der</strong> Fortschritt <strong>der</strong> medizinischen Wissenschaft und je länger die Behandlungsdauer, desto<br />
grösser wird <strong>der</strong> Heilerfolg und desto kleiner die verbleibende Invalidität. Aus <strong>der</strong> folgenden Tabelle ist<br />
ersichtlich, dass <strong>der</strong> mittlere jnvaliditätsgrad bei Rentenbeginn in beiden Versicherungsabteilungen insgesamt<br />
und bei den meisten Verletzungsarten deutlich kleiner geworden ist.<br />
Da sich wegen <strong>der</strong> vielen Fingerverletzungen in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung verhältnismässig weniger<br />
schwere Unfälle ereignen als in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung, ist in dieser Versicherungsabteilung<br />
<strong>der</strong> mittlere Invaliditätsgrad höher; für die einzelnen Verletzungsarten ist er jedoch bei den<br />
Nichtbetriebsunfällen in <strong>der</strong> Regel kleiner als bei den Betriebsunfällen.<br />
Auch die Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungen über den mittleren Invaliditätsgrad entsprechen den Erwartungen.<br />
Die höchsten Renten müssen im Mittel für die Becken/Oberschenkel-, Schädel/Hirn-, Wirbelsäule-<br />
und für die «Übrigen Verletzungen» zugesprochen werden.<br />
52
Mittlerer lnvaliditätsgrad bei Rentenbeginn<br />
% 36 %<br />
Betriebsunfall- Nichtbetriebsunfall<br />
Verletzungsart / verletzter Körpcrteil Versicherung Versicherung<br />
1945 1952 1945 1952<br />
1 Fingerverletzungen . . . . . . . . 21 16 19 14<br />
2 Frakturen usw. von<br />
21 Schulter, Oberarm . . . 27 25 27 24<br />
22 Vor<strong>der</strong>arm . . . . . . . . . . . 26 23 22 22<br />
23 Becken, Oberschenkel . . . . . . 36 39 4| 40<br />
24 Unterschenkel, Fuss . . . . . 29 24 25 23<br />
3 Weichteilverletzungen an<br />
31 Schulter, Oberarm . . . . . . . . 24 25 23 21<br />
32 Vor<strong>der</strong>arm . . . . . . . . 26 22 27 19<br />
33 Becken, Oberschenkel . 30 36 33 31<br />
34 Unterschenkel, Fuss . . . . . 24 31 23 26<br />
4 Schädel- und Hirnverletzungen . . . 43 36 35 31<br />
5 Augenverletzungen . . . . 20 18 23 21<br />
6 Wirbelsäuleverletzungen . . . 36 31 33 36<br />
7 Übrige Verletzungen . . . . . . . . 42 44 35 37<br />
Total . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 25 24<br />
Für die Darstellung des Rentenabfalles im Revísíonsbereich wurden, um für die einzelnen Gesamtheiten<br />
ein etwas umfangreicheres Beobachtungsmaterial zu erhalten, die Betriebs- und Nichtbetriebsunfallrenten<br />
zusammengefasst.<br />
Rentenabfall nach Verletzungsarten<br />
(Gesamtbestand)<br />
Seit Rentenbeginn verflossene Zeit in Jahren<br />
Verletzungsart / verletzter Körperteil 0 4 9<br />
'gfâslånd 1945 1952 1945 1952 1945<br />
2 Frakturen usw. von «<br />
1 Fingerverletzungen . . . . . . 10 000 6 410 6 772 3 212 1 3 126 2 270<br />
21 Schulter, Oberarm . . . . . 10 000 7 535 7 660 5 058 5 427 4 121<br />
22 Vor<strong>der</strong>arm . . . . . . . . . . . 10 000 6 848 7 289 4 452 4 820 3 522<br />
23 Becken, obefschenkeı . . . . _ . 10 ooo 7 215 s 460 5 830 1 7 231 4 829<br />
24 Unterschenkel, Fuss. 10 000 6 901 7 490 4 764 5 819 3 917<br />
3 Weichteilverletzungen an<br />
31 Schulter, Oberarm 10 000 7 494 7 716 4 973 5 226 4 064<br />
32 Vor<strong>der</strong>arm . . . . . . . . . . . 10 000 7 368 7 563 5 245 5 694 3 579<br />
33 Becken, Oberschenkel . . . . . . 10 000 6 914 7 681 5 375 6 985 5 346<br />
34 Unterschenkel, Fuss. . . . . . . 10 000 7 342 7 897 5 221 1 6 218 4 036<br />
4 Schädel- und Hirnverletzungen. . . . 10 000 8 625 8 846 6 287 1 7 025 4 872<br />
5 Augenverletzungen . . . . . . . 10 000 9 901 9 750 9 068 8 851 8 320<br />
6 Wirbelsäuleverletzungen . . . . . . 10 000 7 413 8 552 5 380 1 6 797 4 270<br />
7 Übrige Verletzungen . . . . . . . . 10 000 8 310 9 124 6 200 i 7 784 5 752<br />
53
Der weitaus kleinste Rentenabfall ist bei den Augenschädigungen festzustellen; bei den «Übrigen<br />
Verletzungen» sowie bei den Becken/Oberschenkel- und Schädelverletzungen ist er ebenfalls deutlich geringer<br />
als bei den an<strong>der</strong>n Verletzungsarten. Die Fingerverletzungen weisen den grössten Abfall auf. Die<br />
zeitliche Entwicklung lässt — ausser bei den Fingerverletzungen und bei den Augenschädigungen — bei<br />
allen Verletzungsarten einen bedeutenden Rückgang des Rentenabfalles im Revisionsbereich erkennen,<br />
<strong>der</strong>en Ursachen bereits mehrmals erwähnt wurden.<br />
Es könnte die Frage aufgeworfen werden, ob die festgestellten Unterschiede im Rentenabfall bei <strong>der</strong><br />
Kapitalisierung <strong>der</strong> Renten zu berücksichtigen seien, indem für die einzelnen Verletzungsarten beson<strong>der</strong>e<br />
Barwerte zu ermitteln wären. Dazu ist vorerst zu bemerken,dass für die Untersuchung des Rentenabfalles<br />
bei den Verletzungsarten zur Vermeidung einer Auslese alle Renten zu berücksichtigen waren, also auch<br />
die kurzfristigen, rasch abfallenden Renten für leichtere Verletzungen, die in Form von Einmalentschädigungen<br />
ausbezahlt werden. Ohne diese Einmalentschädigungen, die in <strong>der</strong> Praxis ohne eine Kapitalisierung<br />
bestimmt werden und deshalb für eine Barwertberechnung ausser Betracht fallen, ergeben sich kleinere<br />
Unterschiede im Rentenabfall, die sich in den Barwerten bei den meisten Verletzungsarten nur wenig auswirken<br />
würden. Im weitern ist darauf hinzuweisen, dass die Beobachtungen über den Rentenverlauf im<br />
gesamten Revisionsbereich erst dann ausgewertet werden können, wenn sie im Hinblick auf die Fortschritte<br />
<strong>der</strong> medizinischen und <strong>der</strong> pharmazeutischen Wissenschaft als veraltet gelten müssen. Jedenfalls<br />
ist zu beachten, dass die für eine Barwertbestimmung in Frage kommenden Rentenbestände <strong>der</strong> einzelnen<br />
Verletzungsarten klein sind und dass — wie bereits erwähnt — die Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit von den<br />
Verletzungsarten aus dem zur Verfügung stehenden Beobachtungsmaterial nicht festgestellt werden kann,<br />
so dass die Ermittlung von geson<strong>der</strong>ten Barwerten nicht mit genügen<strong>der</strong> Zuverlässigkeit möglich beziehungsweise<br />
sinnvoll wäre.<br />
Die Sterblichkeit <strong>der</strong> Invalidenrentner<br />
Bei <strong>der</strong> Würdigung <strong>der</strong> an den Invalidenrentnern vorgenommenen Sterblichkeitsmessungen ist zu beachten,<br />
dass auch Teilinvalidität, vielfach sogar Fälle mit ganz niedrigem Invaliditätsgrad, in Rentenform<br />
zu entschädigen ist. Es handelt sich beim Grossteil <strong>der</strong> Rentner nicht um schwerinvalide o<strong>der</strong> gar hilflose,<br />
pAegebedürftige Menschen, son<strong>der</strong>n um durchaus arbeitsfähige Leute. An<strong>der</strong>seits sterben viele schwer<br />
Verunfallte schon während des Heilverfahrens und erleben somit die Rentenfestsetzung nicht.<br />
Für die Beurteilung <strong>der</strong> Sterblichkeit <strong>der</strong> Invalidenrentner sind von beson<strong>der</strong>em Interesse<br />
— <strong>der</strong> Vergleich mit <strong>der</strong> Sterblichkeit <strong>der</strong> schweizerischen Bevölkerung,<br />
— die Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit von <strong>der</strong> Rentenbezugsdauer und<br />
— die Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit vom Invaliditätsgrad.<br />
Vergleich mit <strong>der</strong> Sterblichkeit <strong>der</strong> schweizerischen Bevölkerung<br />
Werden die eingetretenen Todesfälle mit jenen verglichen, die nach den schweizerischen Volkssterbetafeln<br />
für Männer (SM) aus den Jahren 1939/1944 und 1948/1953 zu erwarten sind, wobei als Beobachtungsperiode<br />
jeweils <strong>der</strong> den Vergleichstafeln entsprechende Zeitabschnitt gewählt wird, so ergibt sich folgendes<br />
Bild:<br />
Vergleich <strong>der</strong> Sterblichkeit <strong>der</strong> Invalidenrentner<br />
mit jener <strong>der</strong> schweizerischen Bevölkerung<br />
Vergleichstafel<br />
eobachtungszeit<br />
Beobachtete<br />
I nval idenjah re<br />
Eingetretene Todesfälle<br />
absolut<br />
in Prozenten <strong>der</strong><br />
erwarteten Fälle<br />
1939/1944<br />
1948/1953<br />
159 878<br />
199 443<br />
3 214<br />
4 648<br />
112<br />
114<br />
54
In Übereinstimmung mit früheren Beobachtungen ist festzustellen, dass die Sterblichkeit <strong>der</strong> Invalidenrentner<br />
etwas über jener <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung liegt. Der Unterschied wird noch kleiner, wenn die Silikosefälle<br />
nicht in die Untersuchung einbezogen werden; die Übersterblichkeit <strong>der</strong> Invalidenrentner<br />
beträgt dann weniger als 10 Prozent.<br />
Wie die Sterblichkeit <strong>der</strong> schweizerischen Bevölkerung, so nimmt auch jene <strong>der</strong> Unfallinvaliden<br />
ständig ab. Gemessen an den Sterbenswahrscheinlichkeiten <strong>der</strong> Tafel SM 1939/1944 ergibt sich folgen<strong>der</strong><br />
Rückgang während <strong>der</strong> letzten zwanzig Jahre:<br />
Sterblichkeitsrückgang bei den Invalidenrentnern<br />
1939 †19<br />
Beobachtungsperiode<br />
1949 1954 †1944-1948<br />
Eingetretene Todesfälle<br />
in Prozenten<br />
<strong>der</strong> erwarteten Fälle<br />
gemäss SM 1939/44<br />
112<br />
105<br />
100<br />
95<br />
Es ist zu erwarten, dass die Sterblichkeit <strong>der</strong> Invalidenrentner weiterhin abnehmen wird. Auch die<br />
neueste Volkssterbetafel SM 1948/1953, nach welcher die Unfallinvaliden in <strong>der</strong> Beobachtungsperiode<br />
1954 — 1958 nur noch eine Ubersterblichkeit von 9 Prozent aufweisen, dürfte deshalb für die Ermittlung von<br />
Invalidenrentenbarwerten nicht geeignet sein. Es ist deshalb verständlich, dass kleinere Sterbenswahrscheinlichkeiten<br />
in Rechnung gestellt werden müssen.<br />
Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit ~'on dei Rentenbezugsdaue]<br />
Bei einer Aufteilung des gesamten Beobachtungsmaterials <strong>der</strong> Zeitspanne 1949 — 1958 nach <strong>der</strong> Rentenbezugsdauer<br />
ergeben sich — gemessen an <strong>der</strong> Tafel SM 1948/1953 — folgende Sterblichkeitsverhältnisse:<br />
Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit von <strong>der</strong> Rentenbezugsdauer<br />
Renten<br />
Beobachtete<br />
nvalidenjahr<br />
Erwartete<br />
Todesfälle<br />
Eingetretene Todesfälle<br />
2.<br />
4<br />
7.<br />
10.<br />
Die Sterb]ichkeit im ersten Rentenbezugsjahre ist bedeutend kleiner als jene während <strong>der</strong> folgenden<br />
Zeit. Diese schon in früheren Untersuchungen festgestellte Tatsache lässt sich nicht vollständig erkia«n,<br />
da unbekannt ist, welche Sterblichkeit die Invaliden aufweisen würden, wenn sie nicht verunfallt wären.<br />
Sicher ist, dass es sich bei diesen Leuten bezüglich Sterblichkeit um eine günstige Auslese <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
handelt, weil die Invalidenrentner aus einer Gesamtheit von lauter Berufstätigen stammen. Hinzu kommt<br />
— wie auf Seite 54 erwähnt — die Selektionswirkung während des Heilverfahrens. Diese tritt noch deutlicher<br />
in Erscheinung, wenn für die Beobachtung <strong>der</strong> Rentnersterblichkeit die auf Folgen eines Unfalls o<strong>der</strong><br />
einer Berufskrankheit zurückzuführenden Todesfälle — 76 Prozent davon entfallen auf Silikosetodesfälle—<br />
nicht berücksichtigt werden:<br />
55
Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit von <strong>der</strong> Rentenbezugsdauer bei Weglassung <strong>der</strong> Todesfälle,<br />
die auf Folgen eines Unfalls o<strong>der</strong> einer Berufskrankheit zurückzuführen sind<br />
10. und folgende 5 778<br />
109<br />
Die Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit <strong>der</strong> lnvalidenrentner von <strong>der</strong> Dauer <strong>der</strong> Invalidität ist somit eindeutig<br />
erwiesen, und zwar nimmt die Sterblichkeit in den ersten Jahren nicht etwa ab, son<strong>der</strong>n zu. Damit<br />
ist ein Ergebnis bestätigt, auf das schon mehrmals hingewiesen wurde.<br />
Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit ~'oin In~'aliditä tsgi ud<br />
Um die Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit vom Invaliditätsgrad zu untersuchen, ist das Beobachtungsmaterial<br />
1949 — 1958 des Revisionsbereiches (l.— 9. Rentenbezugsjahr) in drei Gruppen von Invaliditätsgraden<br />
geglie<strong>der</strong>t worden, wobei <strong>der</strong> bei Rentenbeginn festgestellte lnvaliditätsgrad massgebend war.<br />
Abhängigkeit <strong>der</strong> Sterblichkeit vom Invaliditätsgrad<br />
0 — 15/<br />
16-75 /<br />
76 †1 / .<br />
49 794<br />
162 452<br />
8 453<br />
567,9<br />
2568,7<br />
195,6<br />
559<br />
2 783<br />
387<br />
Alle Renten . 220 699 3332,2 3 729<br />
98 (97')<br />
108 (97')<br />
198 (108')<br />
112 (97')<br />
' Ohne Berücksichtigung <strong>der</strong> Todesfälle, die auf Folgen eines Unfalls o<strong>der</strong> einer Berufskrankheit zurückzuführen sind.<br />
Wie aus <strong>der</strong> Tabelle ersichtlich ist, nimmt die Sterblichkeit mit dem Invaliditätsgrad zu. Beson<strong>der</strong>s<br />
hoch ist sie bei den Schwerinvaliden. Eine Proportionalität zwischen Sterblichkeit und Invaliditätsgrad<br />
besteht jedoch nicht. Zu beachten ist, dass die Unterschiede vor allem auf die Todesfälle zurückzuführen<br />
sind, die sich als Folge eines Unfalls o<strong>der</strong> einer Berufskrankheit ereigneten. Werden diese Fälle nicht in<br />
die Untersuchung einbezogen, so ist zwischen den ersten beiden Invaliditätsgradgruppen kein Sterblichkeitsunterschied<br />
mehr festzustellen, und die Schwerinvaliden weisen nur noch eine um rund 10 Prozent<br />
erhöhte Sterblichkeit auf.<br />
Zusammenfassend ist festzuhalten:<br />
Die lnvalidenrentner <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt weisen insgesamt eine Sterblichkeit<br />
auf, die etwas höher ist als jene <strong>der</strong> schweizerischen Bevölkerung, und <strong>der</strong> allgemein beobachtete<br />
Sterblichkeitsrückgang ist auch bei den Unfallinvaliden festzustellen.<br />
Die Sterblichkeit <strong>der</strong> Invaliden ist abhängig von <strong>der</strong> Rentenbezugsdauer. Im ersten Jahr ist sie klein<br />
und nimmt dann zu.<br />
56
Die Sterblichkeit <strong>der</strong> Invaliden ist nicht erheblich abhängig vom Invaliditätsgrad. Einzig die Schwerinvaliden<br />
weisen eine erhöhte Sterblichkeit auf. Eine proportionale Zunahme <strong>der</strong> Sterblichkeit entsprechend<br />
dem Invaliditätsgrad besteht nicht.<br />
Die Gesanriheil dei iauJemlen In>alidenrenien<br />
I n <strong>der</strong> Berichtsperiode war <strong>der</strong> Neuzugang an ordentlichen Renten wie<strong>der</strong>um bedeutend grösser als <strong>der</strong><br />
Abgang durch Tod und Reaktivierung, weshalb <strong>der</strong> Bestand <strong>der</strong> laufenden Renten zugenommen hat.<br />
Zahl <strong>der</strong> laufenden I nvalidenrenten<br />
St lchtäg<br />
Betriebsun<br />
fallversicherung<br />
N ichtbctricbsu<br />
n fal 1 versicherung<br />
Gcsamtbestand<br />
31. Dezember 1947<br />
31. Dezember 1952<br />
31. Dezember 1957<br />
25 475<br />
29 556<br />
34 350<br />
8 990<br />
11 624<br />
14 580<br />
34 465<br />
41 180<br />
48 930<br />
Die Bestandesvermehrung seit dem letzten Stichtage beträgt 16 Prozent in <strong>der</strong> Betriebsunfallversichcrung<br />
und 25 Prozent in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung und ist prozentual ungefähr gleich gross wie<br />
während des vorletzten Jahrfünfts. Es ist daher ohne weiteres verständlich, dass die Bilanzdeckungskapitalien<br />
durch diese bedeutende Rentenzunahme, durch die höhern Jahresverdienste <strong>der</strong> neu festgesetzten<br />
Renten und durch die während <strong>der</strong> Berichtsperiode erfolgte Barwerterhöhung erheblich angestiegen<br />
sind.<br />
Bis zum 31. Dezember 1957 wurden insgesamt 165000 Invalidenrenten festgesetzt, wovon am Stichtage<br />
noch 30 Prozent in Kraft waren. Von diesen rund 49000 Renten entfallen nur rund 3800 auf weibliche Verunfallte;<br />
<strong>der</strong>en Anteil beträgt bei den Betriebsunfällen lediglich 4 Prozent, bei den Nichtbetriebsunfällen<br />
15 Prozent. Während von den Renten an die männlichen Versicherten 73 Prozent als Folge eines Betriebsunfalles<br />
ausgerichtet werden müssen, sind es bei den weiblichen Versicherten nur 41 Prozent. Die obligatorisch<br />
gegen Unfall versicherten Frauen sind offenbar — im Gegensatz zu den Männern — ausser Betrieb<br />
unfallgefährdeter als während <strong>der</strong> Arbeitszeit.<br />
Es ist von Interesse, nach <strong>der</strong> Bestandesentwicklung noch die Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Renten nach dem lnvaliditätsgrad<br />
und die Verteilung <strong>der</strong> Bezüger nach dem Alter zu betrachten.<br />
Verteilung <strong>der</strong> laufenden Invalidenrenten nach dem I nvaliditätsgrad am 31. Dezember 1957<br />
0-9/ .<br />
10 — 19 /<br />
20 — 29 /<br />
30 — 39 /<br />
40 — 49 /<br />
50 — 66 /<br />
I nvaliditätsgrad<br />
66'/,. / und mehr<br />
Total.<br />
Mittlerer I nvaliditätsgrad .<br />
Mittlerer Betrag <strong>der</strong> Jahresrente .<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
Anzahl<br />
32<br />
418<br />
266<br />
103<br />
50<br />
77<br />
54<br />
1 000<br />
25,3 /<br />
Rentenbeträge<br />
8<br />
212<br />
233<br />
127<br />
78<br />
158<br />
184<br />
1 000<br />
Fr. 854<br />
N ich tbetriebsun fal l<br />
versicherung<br />
Anzahl<br />
19<br />
482<br />
265<br />
94<br />
34<br />
62<br />
44<br />
1 000<br />
23,3 /<br />
Rentenbeträge<br />
5<br />
274<br />
259<br />
124<br />
57<br />
131<br />
150<br />
1 000<br />
57
Im Vergleich mit den Eintrittsbeständen an ordentlichen Renten ist im Gesamtbestande als Folge<strong>der</strong><br />
Revisionswirkung eine Senkung des mittleren Invaliditätsgrades zu beobachten. Ungefähr die Hälfte aller<br />
laufenden Renten wird für kleine Schäden ausgerichtet.<br />
Am 31.Dezember 1957 hatten die Invaliden einen Anspruch auf eine Jahresrentensumme von rund<br />
29,3 Millionen Franken in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung und von rund 11,4 Millionen Franken in <strong>der</strong><br />
Nichtbetriebsunfallversicherung. Wie aus <strong>der</strong> Tabelle ersichtlich ist, entfällt auf die kleinen Renten etwa<br />
ein Viertel <strong>der</strong> Rentensumme; ihr betragsmässiger Anteil ist somit nur halb so gross als ihr zahlenmässiges<br />
Gewicht. An<strong>der</strong>seits Aiesst den relativ wenigen Schwerinvaliden ein namhafter Teil <strong>der</strong> Rentensumme zu.<br />
Die maximale Höhe einer Invalidenrente einschliesslich Hilfslosenrente beträgt 12000 Franken im Jahr;<br />
im Vergleich dazu ist die mittlere Rentenhöhe bescheiden.<br />
Über den Altersaufbau des Rentnerbestandes gibt die nächste Tabelle Aufschluss.<br />
Altersverteilung <strong>der</strong> I n validen<br />
A 1 tersk lasse<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
Stichtag<br />
31. Dezember 1952 31. Dezember 1957<br />
N ich tbetriebsunfallversicherung<br />
Stichtag<br />
31. Dezember 1952 31. Dezember 1957<br />
Bis 29 Jahre<br />
30 — 49 Jahre<br />
50 — 69 Jahre<br />
70 Jahre und mehr<br />
76<br />
375<br />
438<br />
111<br />
71<br />
339<br />
468<br />
122<br />
Total<br />
71<br />
337<br />
464<br />
128<br />
63<br />
299<br />
490<br />
148<br />
1 000 1 000 1 000 l 000<br />
Mittleres Alter 51,3<br />
52,2 52,7<br />
53,<br />
Da <strong>der</strong> Beharrungszustand des Bestandes noch nicht erreicht ist und <strong>der</strong> Neuzugang im Mittel immer<br />
älter wird, ist eine deutliche Zunahme des Anteils <strong>der</strong> über 50jährigen Rentner zu verzeichnen. Das<br />
mittlere Alter ist deshalb wie<strong>der</strong>um angestiegen.<br />
Im Bestande sind noch Renten aus dem Jahre 1918 enthalten; <strong>der</strong> älteste Invalidenrentner hatte am<br />
Stichtage das 94. Altersjahr überschritten.<br />
Die Hinterlassenenrenten<br />
Von den für die Zusprechung von Hinterlassenenrenten massgebenden Gesetzesbestimmungen ist mit<br />
Wirkung ab 1. Januar 1953 Art. 85 K<strong>UVG</strong> abgeän<strong>der</strong>t worden. Danach wurde <strong>der</strong> Anspruch auf eine<br />
Waisenrente vom 16. bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr des Kindes ausgedehnt; für Waisen, die noch<br />
in Ausbildung begriffen sind, besteht nun zudem ein Rentenanspruch bis zum Abschluss <strong>der</strong> Ausbildung,<br />
längstens aber bis zum vollendeten 20. Altersjahr. Diese Gesetzesrevision bewirkte eine Vergrösserung des<br />
Waisenrentenbestandes. Im übrigen wurde die im nachfolgenden ersten Teil dieses Abschnittes dargelegte<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Rentnerbestände vom Gesetzgeber nicht beeinflusst.<br />
Bei den Hinterlassenenrenten entfällt <strong>der</strong> weitaus grösste Teil <strong>der</strong> Leistungen auf Witwen. Die für die<br />
Deckungskapitalberechnung verwendeten Witwenrentenbarwerte werden deshalb fortwährend überprüft,<br />
wozu die Beobachtung <strong>der</strong> Sterblichkeit und <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>verheiratung <strong>der</strong> Witwen notwendig ist. Bei den<br />
übrigen Rentnergruppen fällt für die Ermittlung <strong>der</strong> Barwerte nur die Sterblichkeit in Betracht. Diese ist<br />
58
jedoch in <strong>der</strong> Berichtsperiode nicht überprüft worden, weil einerseits frühere Untersuchungen ergeben<br />
haben, dass die Sterblichkeit <strong>der</strong> Aszendenten von jener <strong>der</strong> schweizerischen Bevölkerung nur unwesentlich<br />
abweicht und an<strong>der</strong>seits nicht zu erwarten ist, dass sich die Sterblichkeit <strong>der</strong> rentenberechtigten<br />
Waisen von <strong>der</strong> gesamten Kin<strong>der</strong>sterblichkeit unterscheidet. Im zweiten und dritten Teil dieses Abschnittes<br />
werden deshalb nur einige Ergebnisse von Untersuchungen über die Sterblichkeit und über die Wie<strong>der</strong>verheiratung<br />
<strong>der</strong> Witwen besprochen.<br />
Die Ente icklung des Bestandes <strong>der</strong> Hinterlassenenrentner<br />
Wie bereits im Kapitel «Die Zahl <strong>der</strong> Unfälle» dargelegt wurde, ist die Zahl <strong>der</strong> tödlich Verunfallten<br />
wie<strong>der</strong>um angestiegen. Die bedeutende Zunahme <strong>der</strong> Todesfälle hatte zwangsläufig auch eine Erhöhung<br />
<strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> rentenberechtigten Hinterlassenen zur Folge.<br />
Der Neuzugang an Hinterlassenenrenten<br />
Rentnergruppe<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
1948 — 1952 1953 — 1957 Zunahme<br />
N ich tbet riebsun fal l<br />
versicherung<br />
1948 — 1952 1953 — 1957 Zunahme<br />
Witwen.<br />
Waisen .<br />
Aszendenten und Ge<br />
1 260 1 326 5/ 859 1 042 21/<br />
1 645 1 789 9/ 904 1 291 43/<br />
schwister '. 979 l 013 3/ 883 998 13 /<br />
Alle Rentner.<br />
3 884 4 128 6/<br />
2 646 3 331 26 /<br />
Anzahl Todesfälle 1 933 2 053 6/ 1 638 1 959<br />
20/<br />
' Anzahl Todesfälle, die zur Ausrichtung von Aszendenten- und Geschwisterrenten führten.<br />
ln <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung entspricht die Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Rentnerbestände <strong>der</strong> Zunahme <strong>der</strong><br />
Todesfälle. Bei den Nichtbetriebsunfällen ist <strong>der</strong> grosse Neuzugang an Waisen am augenfälligsten, <strong>der</strong> in<br />
diesem Masse schon während <strong>der</strong> vorletzten Berichtsperiode beobachtet werden konnte. Die Zunahme<br />
<strong>der</strong> Aszendenten ist in beiden Versicherungsabteilungen etwas kleiner als jene <strong>der</strong> Todesfälle.<br />
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Zusammensetzung des Hinterlassenenbestandes <strong>der</strong><br />
tödlich Verunfallten.<br />
Verteilung <strong>der</strong> Todesfälle 1953 — 1957 nach Hinterlassenen<br />
59
Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Hinterlassenenschaft <strong>der</strong> tödlich Verunfallten hat sich seit <strong>der</strong> letzten Berichtsperiode<br />
kaum verän<strong>der</strong>t. Es besteht nach wie vor eine auffallende Verschiedenheit zwischen den<br />
beiden Versicherungsabteilungen. In <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung müssen in mehr Fällen Witwen- und<br />
Waisenrenten ausgerichtet werden als in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung, weshalb auch die mittlere<br />
Zahl <strong>der</strong> rentenberechtigten Kin<strong>der</strong> höher ist. An<strong>der</strong>seits sind die Fälle, in denen nur Aszendentenrenten<br />
o<strong>der</strong> überhaupt keine Renten zur Auszahlung gelangen, in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung häufiger.<br />
Hieraus darf geschlossen werden, dass sich eher Alleinstehende o<strong>der</strong> Verheiratete ohne Kin<strong>der</strong> den verschiedenen<br />
Nichtbetriebsunfallrisiken aussetzen. Dem entspricht auch das Ergebnis, dass das mittlere<br />
Alter <strong>der</strong> tödlich Verunfallten in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung um 1,3 Jahre kleiner ist als in <strong>der</strong><br />
Betriebsunfallversicherung, wo es 44,6 Jahre beträgt.<br />
Es ist naheliegend, dass die laufenden Renten durch die grosscn Neuzugänge eine beträchtliche Vcrmchrung<br />
erfuhren.<br />
Der Bestand <strong>der</strong> laufenden Hinterlassenenrenten<br />
Rcntncrgruppe<br />
Witwen .<br />
Waisen .<br />
Aszendenten und Geschwister<br />
'.<br />
Betriebsunfallversicherung<br />
Zahl <strong>der</strong> Rentner am<br />
31. Dezember 31. Dezember<br />
1952 1957<br />
4 487<br />
2 547<br />
2 890<br />
5 058<br />
2 872<br />
3 095<br />
13/<br />
13/<br />
Nichtbet<br />
Zahl <strong>der</strong> R<br />
31. Dezember 31. Dezember<br />
1952 1957<br />
2 600<br />
1 214<br />
3 166<br />
1 798<br />
7'/ 2 562 2 846<br />
Alle Rentner. 9 924 11 025<br />
6 376<br />
7 810<br />
22/<br />
48 '/<br />
22/<br />
' Anzahl Todesfälle mit am Stichtage noch laufenden Aszendenten- und Geschwisterrenten.<br />
Die Zunahme <strong>der</strong> Rentnerbestände ist beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung sehr gross und<br />
zur Hauptsache dem motorisierten Strassenverkehr zuzuschreiben. Da in über 2000 Fällen mehrere Aszendenten<br />
und Geschwister rentenberechtigt sind, ist lei<strong>der</strong> festzustellen, dass etwa 22000 Menschen, wovon<br />
rund 13000 Witwen und Waisen, durch die monatliche Rentenauszahlung an den tödlichen Betriebs- o<strong>der</strong><br />
Nichtbetriebsunfall eines nahen Verwandten erinnert werden. Die jüngste Witwe war am Stichtage erst 21,<br />
die älteste 94 Jahre alt; unter den Müttern <strong>der</strong> tödlich Verunfallten ist zur Zeit noch eine Hun<strong>der</strong>tjährige<br />
ren tenberechtigt.<br />
Die Sterblichkeit <strong>der</strong> 8'iti~en<br />
Für die Beurteilung <strong>der</strong> Sterblichkeitsverhältnisse <strong>der</strong> Witwen tödlich Verunfallter ist vorerst ein Vergleich<br />
mit <strong>der</strong> Sterblichkeit <strong>der</strong> weiblichen Gesamtbevölkerung von Interesse. Hiefür wurde die Zahl <strong>der</strong><br />
eingetretenen Todesfälle mit jener verglichen, die nach den schweizerischen Volkssterbetafeln für Frauen<br />
(SF) zu erwarten ist, wobei als Beobachtungsperiode jeweils ein den Vergleichstafeln entsprechen<strong>der</strong><br />
Zeitabschnitt gewählt wurde. Da seit <strong>der</strong> Drucklegung des letzten Berichtes keine neue Volkssterbetafel<br />
erstellt wurde, konnten in <strong>der</strong> vergangenen Fünfjahreperiode keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden.<br />
Die seinerzeit ermittelten Vergleichswerte seien daher erneut wie<strong>der</strong>gegeben.<br />
Vergleich <strong>der</strong> Sterblichkeit <strong>der</strong> Witwen mit jener <strong>der</strong> weiblichen Gesamtbevölkerung<br />
Beobacht ungszei t<br />
Vergleichs tafel<br />
Eingetretene Todesfälle<br />
absolut<br />
in Prozenten <strong>der</strong><br />
erwarteten Fälle<br />
1. 4. 1938 — 31. 3. 1943<br />
1. 4. 1948 — 31. 3. 1953<br />
SF 1939/1944<br />
SF 1948/1953<br />
370<br />
671<br />
101<br />
106<br />
60
Die Ergebnisse zeigen, dass die Sterblichkeit <strong>der</strong> Witwen tödlich Verunfallter von jener <strong>der</strong> weiblichen<br />
Gesamtbevölkerung nicht erheblich abweicht.<br />
Die zeitliche Entwicklung <strong>der</strong> Witwensterblichkeit ist aus <strong>der</strong> folgenden Beobachtungsreihe ersichtlich:<br />
Zeitliche Entwicklung <strong>der</strong> Witwensterblichkeit<br />
Zeitraum<br />
Beobachtete<br />
Witwenjahre<br />
Erwartete<br />
Todesfälle<br />
nach SF<br />
1939/1944<br />
Eingetretene Todesfälle<br />
absolut<br />
in Prozenten<br />
<strong>der</strong> erwarteten<br />
Fälle<br />
1. 4. 1933 — 31. 3. 1938<br />
1. 4. 1938 — 31. 3. 1943<br />
1. 4. 1943 — 31. 3. 1948<br />
1. 4. 1948 — 31. 3. 1953<br />
1. 4. 1953 — 31. 3. 1958<br />
19 050<br />
23 950<br />
28 329<br />
33 514<br />
38 627<br />
241,9<br />
367,6<br />
535,1<br />
748,5<br />
987,6<br />
302<br />
370<br />
526<br />
671<br />
817<br />
125<br />
101<br />
98<br />
90<br />
83<br />
Aus <strong>der</strong> Tabelle ist deutlich ersichtlich, dass sich <strong>der</strong> allgemein beobachtete Sterblichkeitsrückgang<br />
auch bei den Witwen <strong>der</strong> tödlich Verunfallten nachweisen lässt. Wohl ist die rückläufige Entwicklung eher<br />
schwächer geworden, doch muss auch künftig mit einer weiteren Abnahme <strong>der</strong> Sterblichkeit gerechnet<br />
werden. Die neueste Volkssterbetafel SF 1948/1953 ist, was die hier betrachteten Witwen betrifft, bereits<br />
überholt; denn danach sind in <strong>der</strong> Berichtsperiode nur 97 Prozent <strong>der</strong> erwarteten Todesfälle eingetreten.<br />
Es ist deshalb verständlich, dass für die Ermittlung <strong>der</strong> Witwenrentenbarwerte kleinere Sterbenswahrscheinlichkeiten<br />
in Rechnung gestellt werden müssen.<br />
Die Wie<strong>der</strong>verheiratung <strong>der</strong> Witiven<br />
Die Wie<strong>der</strong>verheiratung <strong>der</strong> Witwen tödlich Verunfallter hat sich wie folgt entwickelt:<br />
Die Wie<strong>der</strong>verheiratung <strong>der</strong> Witwen<br />
Zeitraum<br />
Beobachtete<br />
Witwenjahre<br />
Erwartete<br />
Wie<strong>der</strong>verheiratungen<br />
nach SUVA<br />
Grundlagen<br />
1938<br />
Eingetretene<br />
Wie<strong>der</strong>verheiratungen<br />
absolut<br />
in Prozenten<br />
<strong>der</strong> erwarteten<br />
Fälle<br />
1. 4. 1918 — 31. 3. 1933<br />
1. 4. 1933 — 31. 3. 1938<br />
1. 4. 1938-31. 3. 1943<br />
1. 4. 1943-31. 3. 1948<br />
1. 4. 1948 — 31. 3. 1953<br />
1. 4. 1953-31. 3. 1958<br />
24 338<br />
18 990<br />
23 914<br />
28 258<br />
33 348<br />
38 373<br />
402,4<br />
237,9<br />
242,2<br />
223,9<br />
233,2<br />
246,7<br />
465<br />
192<br />
307<br />
350<br />
357<br />
326<br />
116<br />
81<br />
127<br />
156<br />
153<br />
132<br />
1. 4. 1918-31. 3. 1958<br />
167 221<br />
1 586,3<br />
l 997<br />
126<br />
Die Wie<strong>der</strong>verheiratungshäufigkeit <strong>der</strong> rentenberechtigten Witwen konnte während 40 Jahren beobachtet<br />
werden. Dabei fallen vorerst die bedeutenden Schwankungen auf, die zu einem grossen Teil auf<br />
die jeweilige Wirtschaftslage des Landes zurückzuführen sind. Während <strong>der</strong> Krisenperiode gaben die<br />
Witwen ihren festen Rentenanspruch nur ungern preis, und die schlechten Verdienstmöglichkeiten
dämpften auch die Heiratsfreude <strong>der</strong> Männer. Auch zur Zeit des zweiten Weltkrieges war die Wie<strong>der</strong>verheiratungshäufigkeit<br />
viel kleiner als während <strong>der</strong> nach dem Kriege einsetzenden Hochkonjunktur. In <strong>der</strong><br />
Berichtsperiode, die auch in eine Zeit mit anhalten<strong>der</strong> günstiger Wirtschaftslage fällt, ist die Wie<strong>der</strong>verheiratungshäufigkeit<br />
allerdings stark zurückgegangen. Jedenfalls zeigen alle diese Ergebnisse deutlich, dass<br />
zur Ermittlung von Wie<strong>der</strong>verheiratungswahrscheinlichkeiten für die Barwertbestimmung auf eine längere<br />
Beobachtungsperiode abgestellt werden muss.<br />
Die Wie<strong>der</strong>verheiratungshäufigkeit ist ferner abhängig von <strong>der</strong> Bevölkerungsschicht, aus <strong>der</strong> die<br />
Witwen stammen, wobei die Einkommensverhältnisse eine grosse Rolle spielen. Gemessen an den Wahrscheinlichkeiten<br />
SF 1939/1944 weisen beispielsweise die Witwen in <strong>der</strong> Berichtsperiode eine Wie<strong>der</strong>verheiratungshäufigkeit<br />
auf, die nur 63 Prozent <strong>der</strong> erwarteten Fälle erreicht. Hiezu ist zu bemerken, dass in<br />
<strong>der</strong> Zeit von 1939/1944 viele Witwen in <strong>der</strong> Schweiz keine o<strong>der</strong> nur kleine Renten bezogen, weshalb sie<br />
wesentlich heiratsfreudiger waren als die rentenberechtigten Witwen. Es ist daher zu erwarten, dass die zur<br />
Zeit noch nicht vorliegenden Heiratswahrscheinlichkeiten SF 1948/1953 dank <strong>der</strong> Eidgenössischen Altersund<br />
Hinterlassenenversicherung kleiner ausfallen als jene nach SF 1939/1944, wodurch sich eine Angleichung<br />
<strong>der</strong> Heiratswahrscheinlichkeiten ergäbe. Trotzdem ist es angezeigt, bei einer künftigen Barwertbestimmung<br />
das eigene Beobachtungsmaterial für die Ermittlung <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>verheiratungswahrscheinlichkeiten<br />
<strong>der</strong> Witwen auszuwerten.<br />
Es ist leicht einzusehen, dass die Wie<strong>der</strong>verheiratungshäufigkeit ausser vom Alter <strong>der</strong> Witwen auch<br />
von <strong>der</strong> Dauer <strong>der</strong> Witwenschaft abhängig ist. Aus dem gesamten Beobachtungsmaterial lassen sich<br />
folgende Ergebnisse zusammenstellen.<br />
Abhängigkeit <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>verheiratung von <strong>der</strong> Dauer <strong>der</strong> Witwenschaft<br />
Beobachtungen 1918 — 1957<br />
Rentenbezugsjahre<br />
Beobachtete<br />
Witwenjahre<br />
Erwartete<br />
Wie<strong>der</strong>verheiratungen<br />
nach SUVA<br />
G rund lagen<br />
1938<br />
Eingetretene<br />
Wie<strong>der</strong>verheiratun<br />
absolut<br />
in Proz<br />
<strong>der</strong> erw<br />
Fa<br />
2.— 5.<br />
6.— 10.<br />
11.— 15.<br />
16.-20.<br />
21.— 35.<br />
36.— 40.<br />
13 048<br />
43 579<br />
39 180<br />
27 782<br />
19 483<br />
23 442<br />
707<br />
284,8<br />
725,0<br />
366,2<br />
138,9<br />
50,8<br />
20,6<br />
0,0<br />
77<br />
l 223<br />
491<br />
138<br />
50<br />
18<br />
2<br />
16<br />
13<br />
9<br />
9<br />
8<br />
l.— 40. 167 221 1586,3 l 997 12<br />
Aus naheliegenden Gründen (Trauerjahr, gesetzliche Wartefrist gemäss Art. 103 ZGB) ist die Wie<strong>der</strong>verheiratungshäufigkeit<br />
im ersten Witwenjahre sehr klein. Die meisten Wie<strong>der</strong>verheiratungen erfolgen im<br />
zweiten bis fünften Jahre nach dem Tode des Ehemannes: nachher nimmt die Häufigkeit ständig ab.<br />
Diese Ergebnisse lassen erkennen, dass die Witwenrentenbarwerte eigentlich nicht nur nach dem Alter<br />
<strong>der</strong> Witwen, son<strong>der</strong>n auch nach <strong>der</strong> Rentenbezugsdauer abzustufen wären. Es konnte aber nachgewiesen<br />
werden, dass sich die Einführung doppelt abgestufter Witwenrentenbarwerte finanziell nur wenig auswirken<br />
würde. Da zudem das Beobachtungsmaterial <strong>der</strong> Anstalt zu klein ist, um für jedes Alter einwandfreie<br />
doppelt abgestufte Witwenrentenbarwerte zu ermitteln, wurde die Dauer <strong>der</strong> Witwenschaft bei <strong>der</strong><br />
Barwertbestimmung nicht berücksichtigt.<br />
62
Unfallursachen<br />
Unfallereignisse können folgenschwer sein: Menschenleben werden vernichtet, die Arbeitskraft <strong>der</strong><br />
Betroffenen wird gebrochen o<strong>der</strong> beeinträchtigt, und es entstehen Sachschäden. Die Verhütung von Unfällen<br />
muss deshalb mit allen Mitteln geför<strong>der</strong>t werden. Im Kampfe gegen die Unfallgefahren können im<br />
beson<strong>der</strong>n die Erfahrungen wertvoll sein, die sich aus den zahlreichen und mannigfaltigen <strong>der</strong> Schweizerischen<br />
<strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt angezeigten Unfällen schöpfen lassen.<br />
Die genaue Kenntnis <strong>der</strong> Unfallursachen ist Voraussetzung einer wirksamen Unfallverhütung. Um<br />
diese Unfallursachen festzustellen, sind gründliche Untersuchungen erfor<strong>der</strong>lich, die möglichst bald am<br />
Unfallort durchgeführt werden müssen. Die Schweizerische <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt kann nur eine<br />
kleine Zahl beson<strong>der</strong>s aufschlussreicher Unfälle durch eigene Fachleute abklären lassen, und deshalb ist<br />
ihre Mitwirkung an <strong>der</strong> Erforschung <strong>der</strong> Unfallursachen begrenzt. Insbeson<strong>der</strong>e muss deshalb auch die<br />
Abklärung <strong>der</strong> Betriebsunfälle im allgemeinen den Betriebsinhabern und ihren Organen überlassen werden.<br />
Sie sind zur Stelle und kennen die betrieblichen Einrichtungen, die Arbeitsweise und die Belegschaft.<br />
Nach Art.65 K<strong>UVG</strong> ist <strong>der</strong> Betriebsinhaber verpflichtet, zur Verhütung von Krankheit und Unfall alle<br />
Schutzmittel einzuführen, die nach den Erfahrungen notwendig und nach dem Stande <strong>der</strong> Technik und den<br />
gegebenen Verhältnissen anwendbar sind. Die anhand einer systematischen Unfallabklärung möglichen<br />
Erkenntnisse sind für die im Betrieb zu treffenden Unfallverhütungsmassnahmen wegleitend und auch für<br />
die Aufklärung und Schulung <strong>der</strong> Belegschaft wertvoll. Ohne die rasche und gründliche Unfalluntersuchung<br />
ist im übrigen eine vollständige Unfallmeldung nicht möglich.<br />
Zu Unrecht wird angenommen, die Schweizerische <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt sei ohne weiteres in <strong>der</strong><br />
Lage, anhand <strong>der</strong> Unfallmeldungen eine <strong>Statistik</strong> <strong>der</strong> Unfallursachen aufzustellen. Das Führen einer allgemeinen<br />
Unfallursachenstatistik auf Grund <strong>der</strong> Unfallmeldungen ist nicht möglich, weil die Unfallbeschreibungen<br />
in den meisten Fällen dürftig und unvollständig, bisweilen sogar unrichtig o<strong>der</strong> irreführend<br />
sind. Diese bedauerliche Tatsache ist teilweise auf die Furcht von Versicherten und Betriebsinhabern<br />
zurückzuführen, es könnte aus den Meldungen auf ein ihnen zur Last fallendes Verschulden geschlossen<br />
werden. Oft wird zudem die Unfallmeldung auch von nicht sachkundigen Personen erstellt.<br />
Die Erfahrung zeigt auch immer wie<strong>der</strong>, dass eine <strong>Statistik</strong> über die Ursachen <strong>der</strong> Betriebsunfälle, bei<br />
<strong>der</strong> die Merkmale nur allgemein umschrieben o<strong>der</strong> weitgehend zusammengefasst sind, lediglich eine Übersicht<br />
über das Unfallgeschehen geben kann. Eine Unfallursachenstatistik ist daher <strong>der</strong> zu betrachtenden<br />
Betriebsart o<strong>der</strong> Gefahrenklasse anzupassen, indem die Erhebungsfragen im Hinblick auf die Beson<strong>der</strong>heiten<br />
gestellt werden. Der Unterscheidung <strong>der</strong> Unfallmerkmale dienen Fragen nach dem Unfallort, das<br />
heisst <strong>der</strong> Stelle im betrieblichen Arbeitsablauf, nach dem Unfallhergang unter Angabe <strong>der</strong> Tätigkeit des<br />
Verunfallten, <strong>der</strong> beteiligten Einrichtungen und Gegenstände sowie schliesslich nach <strong>der</strong> eigentlichen Unfallursache.<br />
Aus diesen Gründen fallen nur zielgerichtete Erhebungen für ausgewählte Gefahrenklassen<br />
in Betracht.<br />
In <strong>der</strong> Berichtsperiode wurden solche Erhebungen in den Giessereien und <strong>der</strong> keramischen Industrie<br />
durchgeführt. Die betreffenden Berufsverbände und Betriebsinhaber wurden eingehend über den Zweck<br />
<strong>der</strong> <strong>Statistik</strong> aufgeklärt. Durch Rückfrage o<strong>der</strong> Augenschein wurden unvollständige Unfallmeldungen<br />
ergänzt und Unfälle beson<strong>der</strong>er Art weiter abgeklärt. Ausser zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Unfallverhütung dienen<br />
die dadurch erhaltenen Unterlagen zusammen mit den aufgenommenen Betriebsbeschreibungen auch <strong>der</strong><br />
Beschaffung von Prämientarif- und Einreihungsgrundlagen. Die Untersuchung <strong>der</strong> Beziehungen zwischen<br />
Unfallursachen und Unfallkosten ermöglicht eine Beurteilung <strong>der</strong> Bedeutsamkeit vorhandener Risikomer<br />
kmale.<br />
Gleichartige Erhebungen sind für die Bindemittelindustrie, die Gerbereien, die Papierindustrie und die<br />
Steinbrüche in die Wege geleitet und für die Verzinkereien und Metallspritzwerke, die Fabrikation von<br />
Kunststoffgegenständen, die Sand- und Kiesgewinnung sowie für die Altstoffverwertung vorgesehen. Es<br />
ist verständlich, dass nur eine beschränkte Zahl von Gefahrenklassen gleichzeitig in die Unfallursachenstatistik<br />
einbezogen werden kann. Deshalb können statistische Erfahrungen über die Unfallgefahren nur<br />
schrittweise gewonnen werden.<br />
63
Diese auf ganze Gefahrenklassen bezogenen Unfallursachenstatistiken tragen den in den einzelnen<br />
Betrieben vorhandenen Unfallverhütungsproblemen beson<strong>der</strong>er Art zu wenig Rechnung und genügen<br />
deshalb dem an <strong>der</strong> Unfallverhütung beson<strong>der</strong>s interessierten Betriebsinhaber allein nicht, abgesehen davon,<br />
dass sie nur verzögert verfügbar sind. Zur Unterstützung seiner Bestrebungen wird er mit Vorteil die<br />
Ergebnisse seiner Unfalluntersuchungen selbst auswerten, um Massnahmen gegenüber sicherheitswidrigen<br />
Handlungen und Umständen möglichst rasch treffen und so die Wie<strong>der</strong>holung gleicher Unfälle<br />
verhin<strong>der</strong>n zu können. Es sei in diesem Zusammenhange darauf hingewiesen, dass in jedem Betriebe nach<br />
Art. 69 K<strong>UVG</strong> über sämtliche Unfälle <strong>der</strong> versicherten Personen ein fortlaufendes Verzeichnis zu führen<br />
ist. Bei zweckmässigem Aufbau kann dieses gleichzeitig auch als betriebseigene Unfallstatistik dienen.<br />
Bei den Nichtbetriebsunfällen stösst die Ermittlung <strong>der</strong> Unfallursachen auf noch grössere Schwierigkeiten<br />
als bei den Betriebsunfällen, sind doch die verfügbaren Angaben über den Unfallhergang im allgemeinen<br />
noch unvollständiger o<strong>der</strong> dem wirklichen Tatbestand oßensichtlich wi<strong>der</strong>sprechend. Die<br />
Schweizerische <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt hat deshalb seit jeher auf eine eigentliche Unfallursachenstatistik<br />
für die Nichtbetriebsunfälle verzichtet und sich lediglich darauf beschränkt, die Betätigung festzustellen,<br />
bei <strong>der</strong> sich <strong>der</strong> Unfall ereignet hat.<br />
Im folgenden wird das Ergebnis einer in den Giessereien und <strong>der</strong> keramischen Industrie in den Jahren<br />
1956 — l957 durchgeführten Unfallursachenerhebung dargelegt und über die Untersuchung <strong>der</strong> IVi
Die Betriebe unterscheiden sich aber nicht nur nach dem Verfahren, son<strong>der</strong>n auch nach <strong>der</strong> unterschiedlichen<br />
Bedeutung, die den einzelnen Arbeiten zukommt, sei es wegen unterschiedlicher Fabrikationsprogramme<br />
o<strong>der</strong> deshalb, weil gewisse Arbeiten an Dritte abgegeben o<strong>der</strong> von Dritten übernommen<br />
werden. So werden beispielsweise Modelle o<strong>der</strong> Kokillen selbst hergestellt o<strong>der</strong> von auswärts<br />
bezogen, o<strong>der</strong> es wird das Rohmaterial ofenfertig gekauft o<strong>der</strong> Schrott erworben und selbst vorbereitet.<br />
Die Giessereien werden nach <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Erzeugnisse, <strong>der</strong> Formen, des Giessens und des gegossenen<br />
Metalls in Betriebsarten unterteilt; die Unterscheidung erfolgt teils nach diesem und teils nach jenem<br />
Merkmal. Wie sich die 161 zur Zeit <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> unterstellten Betriebe o<strong>der</strong><br />
Betriebsteile, die als Giessereien geson<strong>der</strong>t im Prämientarif eingereiht sind, auf die verschiedenen Betriebsarten<br />
verteilen, geht aus <strong>der</strong> folgenden Zusammenstellung hervor. Dabei sind gemischte Giessereien<br />
jener Betriebsart zugewiesen, auf die ihre Haupttätigkeit entfällt.<br />
Die Giessereien nach Betriebsarten<br />
Formgiessereien<br />
Metallart sandform_<br />
Dauerformgiessereien<br />
schmelz-<br />
Um- B|Ock_<br />
. . Total<br />
gicssereien kokıııclı- pfucıg- werke gmsserme"<br />
gıessereıen gıessereıen<br />
Stahl. . . . . . . . 2 _ _ _ 4 6<br />
Eisen. . . . . . . . 62 -- _ _ - 62<br />
übrige Schwermetalle . 21 6 3 4 -- 34<br />
Leichtmetalle . . . 38 17 3 1 -- 59<br />
T0181. . . . . . . . 123 23 Ö 5 4 lÖl<br />
Am weitesten verbreitet ist das Sandformgiessen, seltener sind das Kokillen- und vor allem das<br />
Druckgiessen. Diese jüngern Verfahren werden im allgemeinen nicht für den Eisen- und Stahlformguss<br />
verwendet; sie gelangen in erster Linie für die Herstellung von Serienerzeugnissen aus an<strong>der</strong>n Metallen<br />
zur Anwendung. Nach <strong>der</strong> Metallart betrachtet, sind die Eisengiessereien am zahlreichsten; ihre überragende<br />
Bedeutung wird noch ofiensichtlicher, wenn die Giessereien nach ihrer Grösse geglie<strong>der</strong>t<br />
werden.<br />
Die Giessereien nach <strong>der</strong> Belegschaftsgrösse 1958<br />
Giessereien nach Art Giessereien nach<br />
des Metalles Herstellungsverfahren<br />
Vo/lxlgfägiltcr Eisen<br />
Sltıarııliil- Giíeišsıeiišıeeien Total Gielıbifgien Total<br />
giessereien<br />
6<br />
bis<br />
- 10<br />
5.<br />
. 1<br />
9<br />
41<br />
18<br />
42<br />
27<br />
25<br />
25<br />
17<br />
2 27<br />
42<br />
26<br />
11 50<br />
25.<br />
. 11<br />
10<br />
14<br />
13<br />
25<br />
23<br />
19<br />
17 6<br />
25<br />
51 75. . . . 10 3 13 12 13<br />
23<br />
101<br />
76 -<br />
-<br />
100<br />
150 1<br />
7<br />
2<br />
1<br />
3<br />
8<br />
2<br />
7 1<br />
.<br />
8<br />
151 _ 250 . . . . s _ 8 7 1 f<br />
3<br />
s<br />
251 und mehr . . 11 1 12 9 3 12<br />
Total. . . . . . 68 93 161 123 38 161<br />
66
Die Eisen- und Stahlgiessereien sind im allgemeinen grösser als die übrigen Giessereien, und die<br />
meisten <strong>der</strong> grössern Giessereien sind Sandformgiessereien. Die Bestände <strong>der</strong> Belegschaften sind sehr<br />
unterschiedlich. Die kleinste Giesserei beschäftigt I Person, die grösste gegen 1500 Personen. Der<br />
durchschnittliche Vollarbeiterbestand beträgt bei den Eisen- und Stahlgiessereien rund 185 und bei den<br />
Nichteisengiessereien rund 25, bei den Sandformgiessereien rund 100 und bei den Nichtsandformgiessereien<br />
rund 60. Von <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme sämtlicher Giessereien entfallen 87 Prozent auf<br />
die Eisen- und Stahlgiessereien und nur 13 Prozent auf die übrigen Giessereien. Bei <strong>der</strong> Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Lohnsumme nach dem Herstellungsverfahren ergibt sich ein Anteil von 86 Prozent für die Sandformgiessereien.<br />
Das Unfallgeschehen wird ausser durch die Art und die Grösse <strong>der</strong> Giessereien auch durch den<br />
Stand <strong>der</strong> betrieblichen Unfallverhütung sowie das Verhalten <strong>der</strong> Belegschaft in bezug auf Arbeitssicherheit<br />
beeinflusst.<br />
Bei dieser Mannigfaltigkeit von Merkmalen ist es schwierig, aus einer Unfallstatistik, die sich im<br />
allgemeinen auf verhältnismässig wenig Beobachtungen stützen muss, mit Hilfe von Masszahlen die<br />
Risikounterschiede und die bedeutsamen Risikomerkmale mit einiger Sicherheit zu bestimmen; denn<br />
<strong>der</strong> Zufall übt auf die Zahl und die Kosten <strong>der</strong> Unfälle, insbeson<strong>der</strong>e bei den seltenen, aber kostspieligen<br />
Rentcnfällen, einen überragenden Einfluss aus. Dies ist bei <strong>der</strong> nun folgenden Beurteilung<br />
des Unfallgeschehcns zu beachten. Die in <strong>der</strong> nachfolgenden Zusammenstellung ausgewiesenen zehnjährigen<br />
Erfahrungen vermögen wohl einen Hinweis auf die Risikoverhältnisse zu geben, können<br />
aber nur teilweise als schlüssig angesehen werden. Im weitern ist zu beachten, dass die angegebenen<br />
Unfalll:osten nur die Aufwendungen an Versicherungsleistungen umfassen und nicht etwa auch die<br />
mit <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> Versicherung verbundenen Unkosten. Die Zahl und die Kosten <strong>der</strong> Silikosefälle<br />
— über die im Kapitel Berufskrankheiten berichtet wird — sind in den Angaben ebenfalls nicht enthalten.<br />
Aus all diesen Gründen können die angegebenen Risikosätze für sich allein nicht als Grundlage<br />
für eine "llfällige Prämienbeurteilung dienen. Wie die folgenden Ausführungen zeigen, lassen sich<br />
dennoch wertvolle Erkenntnisse gewinnen, insbeson<strong>der</strong>e auch für die Unfallverhütung.<br />
Die Unfälle in den Giessereien 1948 — 1957<br />
Betriebsart<br />
l l ehe<br />
unfälle Unfälle<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Total<br />
I nval i- Toauf<br />
davon<br />
absolut in / y ll ditäts- desfä1<br />
le fäl 1e<br />
arbeiter<br />
Unfallkosten<br />
I n /t)t)<br />
<strong>der</strong><br />
verin<br />
Franken in /<br />
sicherten<br />
Lohnsumme<br />
Sandformgiessereien<br />
Eisen- u. Stahlgiessereien<br />
"b<br />
en<br />
15 937 17 743 33 680 82 324 498 23<br />
903 1 149 2 052 5 313 29<br />
895 1 945 2 840<br />
1 073 1 273 2 346<br />
7 399<br />
6 223<br />
99<br />
47<br />
18 808 22 110 40 918 100 320 673 35<br />
12 573 131<br />
719 628<br />
2 265 093<br />
1 051 873<br />
76<br />
4<br />
14<br />
6<br />
19<br />
17<br />
49<br />
16<br />
16 609 725 100 20<br />
' Ohne Kilikosen.<br />
In den Giessereien ereignen sich jährlich im Durchschnitt rund 4100 Unfälle, die Kosten im Betrage<br />
von rund 1,7 Millionen Franken verursachen. Rund 45 Prozent <strong>der</strong> Unfälle sind Bagatellunfälle und<br />
nicht ganz 2 Prozent führen zu Invalidität o<strong>der</strong> Tod. Auf die wenigen Unfälle mit Rentenfolgen entfällt<br />
mehr als die Hälfte <strong>der</strong> Unfallkosten. In einer Giesserei mit einer dem Durchschnittsbestand entsprechenden<br />
Belegschaft von 80 Vollarbeitern ereignen sich im Mittel alle 2 Wochen ein Unfall, alle<br />
2'/~ Jahre ein Invaliditätsfall und alle 45 Jahre ein Todesfall. Sowohl die Unfallhäufigkeit als auch <strong>der</strong><br />
67
Risikosatz sind bei den Giessereien im Mittel beträchtlich höher als bei <strong>der</strong> gesamten Betriebsunfallversicherung.<br />
Dieses Ergebnis für die Gesamtheit <strong>der</strong> Giessereien ist weitgehend durch das Unfallgeschehen in den<br />
Eisen- und Stahlgiessereien bestimmt, auf die dem Versicherungsbestand entsprechend <strong>der</strong> Grossteil <strong>der</strong><br />
Zahl und <strong>der</strong> Kosten <strong>der</strong> Unfälle entfällt. Das Unfallrisiko bei den übrigen Sandformgiessereien weicht<br />
im Mittel nicht viel von jenem <strong>der</strong> Eisen- und Stahlgiessereien ab, was durch die Erfahrungen aus <strong>der</strong><br />
Gesamtversicherungszeit bestätigt wird. Die Blockgiessereien (Stahlwerke) hingegen weisen ein beträchlich<br />
höheres Unfallrisiko auf als alle an<strong>der</strong>n Giessereien. Die Kokillen- und Druckgiessereien sowie die<br />
Umschmelzwerke scheinen nach dieser allgemeinen Übersicht ein unterdurchschnittliches Unfallrisiko<br />
zu haben. Eine eingehen<strong>der</strong>e Prüfung hat jedoch ergeben, dass dies nicht zutrifft, weil die ausgewiesenen<br />
Erfahrungen einerseits wegen ihres geringen Umfanges nicht schlüssig und an<strong>der</strong>seits durch die beson<strong>der</strong>n<br />
Verhältnisse eines grössern Betriebes beeinflusst sind.<br />
Um weitere Erkenntnisse über das Unfallgeschehen in den Giessereien zu erlangen, wurden anhand<br />
<strong>der</strong> Unfallmeldungen <strong>der</strong> Betriebe die ordentlichen Betriebsunfälle aus den Jahren 1956 — 1957 und die<br />
Rentenfälle aus den Jahren 1948 — 1957 nach bestimmten Merkmalen ausgezählt. Damit ergab sich auch<br />
die entsprechende Verteilung <strong>der</strong> Unfallkosten 1948 — 1957, wobei <strong>der</strong> Kostenanteil <strong>der</strong> Unfälle ohne<br />
Rentenfolgen auf Grund <strong>der</strong> Erfahrungen 1956 — 1957 verteilt wurde. In <strong>der</strong> Anhangstabelle 4a ist das<br />
Ergebnis dieser Erhebung nach den Arbeitsorten und den Unfallgegenständen und in <strong>der</strong> Anhangstabelle<br />
4b nach dem Unfallhergang beziehungsweise <strong>der</strong> Verletzungsart und den Gegenständen, welche<br />
die Verunfallten verletzt haben (Verletzungsgegenstände), zusammengestellt. Die Zahl <strong>der</strong> in die <strong>Statistik</strong><br />
einbezogenen Unfälle verteilt sich auf so viele Merkmale, dass ein einzelnes Merkmal mit Vorsicht<br />
beurteilt werden muss. Ferner ist es für die Beurteilung <strong>der</strong> Bedeutsamkeit <strong>der</strong> Merkmale erfor<strong>der</strong>lich,<br />
die Zahl und die Kosten <strong>der</strong> Unfälle auf den Versicherungsbestand zu beziehen. Im folgenden wird<br />
versucht, einige Schlussfolgerungen zu ziehen.<br />
In <strong>der</strong> Übersicht auf <strong>der</strong> folgenden Seite sind die Unfälle und die Unfallkosten nach den Arbeitsorten<br />
aufgeteilt. Die angegebene Verteilung <strong>der</strong> Vollarbeiter stützt sich auf die im Jahre 1959 erhobenen<br />
Betriebsbeschreibungen.<br />
Bei den Sandformgiessereien entfällt auf die Formenherstellung, die mit 40 Prozent den grössten<br />
Anteil an <strong>der</strong> Belegschaft aufweist, rund ein Viertel <strong>der</strong> Unfälle und <strong>der</strong> Unfallkosten. Die Unfallgefahr<br />
ist also hier verhältnismässig klein. Die meisten Unfälle und Unfallkosten stammen aus <strong>der</strong> Gussputzerei.<br />
Hier ist die Unfallhäufigkeit überdurchschnittlich gross. Die Unfallschwere aber bleibt unter<br />
dem Durchschnitt, ist doch <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Unfallkosten kleiner als <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Unfallzahl. Die weitaus<br />
grösste Unfallgefahr besteht beim eigentlichen Giessen, bei dem die Unfallhäufigkeit sehr gross ist und<br />
es auf den Versicherten auch am meisten Unfallkosten trifft. Ein überdurchschnittliches Unfallrisiko<br />
weisen auch die Sandaufbereitung und die Rohmaterialvorbereitung auf.<br />
Bei den Blockgiessereien ereignen sich die meisten Unfälle bei <strong>der</strong> Rohmaterialvorbereitung, für die<br />
rund ein Drittel <strong>der</strong> Belegschaft eingesetzt ist. Diese Unfälle sind im allgemeinen nicht beson<strong>der</strong>s schwerwiegend.<br />
Auf die Schmelzerei und die Giesserei entfällt insgesamt auch etwa ein Drittel <strong>der</strong> Unfälle.<br />
Hier sind die Unfälle verhältnismässig häufig und kostspielig; auf einen Versicherten trifft es deshalb<br />
auch ausserordentlich hohe Unfallkosten. Da <strong>der</strong> Grossteil <strong>der</strong> Belegschaft dort beschäftigt ist, wo eine<br />
grosse Ünfallgefahr besteht, sind bei den Blockgiessereien die Unfallhäufigkeit und <strong>der</strong> Risikosatz hoch<br />
im Vergleich zu den an<strong>der</strong>n Giessereien.<br />
Bei den Kokillen- und Di.uckgiessei.eien sowie den Uinscfimelzii'erken ist eine Aufteilung auf die<br />
einzelnen Arbeitsorte wegen <strong>der</strong> wenigen Erfahrungen nicht gegeben. Immerhin kann festgehalten<br />
werden, dass in den Kokillen- und Druckgiessereien fast drei Viertel <strong>der</strong> Versicherten mit dem Putzen<br />
und Bearbeiten <strong>der</strong> Gußstücke sowie mit dem Herstellen <strong>der</strong> Dauerformen beschäftigt sind, wobei sich<br />
im allgemeinen nicht beson<strong>der</strong>s schwere Unfälle ereignen. Gleich wie bei den an<strong>der</strong>n Betriebsarten besteht<br />
aber auch in diesen Betrieben die grösste Unfallgefahr beim Giessen und Schmelzen.<br />
68
Unfälle ' in den Giessereien nach Arbeitsorten<br />
Ordentliche U nfälle<br />
Arbeitsorte<br />
Vollarbeiter<br />
in /<br />
in /<br />
auf 1000<br />
Vollarbeiter des<br />
betreffenden Ortes<br />
in<br />
Rohmaterialvorbereitung.<br />
Sandaufbereitung .<br />
Formenherstellung<br />
Schmelzerei<br />
Giesserei.<br />
Gussputzerei .<br />
Bearbeitung<br />
Spedition, Betriebsunterhalt<br />
Total 100 190<br />
100<br />
4<br />
5<br />
40<br />
6<br />
4<br />
26<br />
5<br />
10<br />
5<br />
5<br />
27<br />
5<br />
13<br />
36<br />
5<br />
4<br />
Sandformgiessereien<br />
225<br />
184<br />
127<br />
166<br />
611<br />
265<br />
173<br />
86<br />
Blockgiessereien<br />
Rohmaterialvorbereitung.<br />
Sandaufbereitung .<br />
Formenherstellung<br />
Schmelzerei<br />
Giesserei.<br />
Gussputzerei .<br />
Bearbeitung<br />
Spedition, Betriebsunterhalt<br />
35<br />
1<br />
7<br />
16<br />
10<br />
16<br />
5<br />
10<br />
34<br />
0<br />
5<br />
22<br />
14<br />
16<br />
5<br />
4<br />
293<br />
418<br />
421<br />
304<br />
Total 100 100<br />
302<br />
100<br />
49<br />
' Ohne Silikosen.<br />
Die Angaben dieser Tabelle stützen sich auf die ordentlichen Unfälle 1956 — 1957 und auf die Rentenfälle 1948 — 1957.<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass bei sämtlichen Betriebsarten vor allem das Schmelzen und das Giessen<br />
im Unfallgeschehen beson<strong>der</strong>e Bedeutung haben. Bei den Sandformgiessereien treten ferner hervor<br />
die Sandaufbereitung und bei den grössern Eisengiessereien und den Stahlwerken auch die Rohmaterialvorbereitung.<br />
Schliesslich ist noch von Interesse, die mit dem Ünfallgeschehen im Zusammenhang stehenden<br />
Gegenstände und Tätigkeiten zu betrachten. Im folgenden Überblick nach den Arbeitsorten, <strong>der</strong> sich<br />
auf die Anhangstabellen 4 stützt, sind die innerbetrieblichen Transportmittel zusammengefasst behandelt.<br />
69
Der Einsatz von Magnetkranen für den<br />
Schrottumschlag beseitigt zahlreiche Unfallgefahren<br />
<strong>der</strong> Handarbei t.<br />
Bei <strong>der</strong> Rohn>ateiialiorbe>.eitung, die vor allem in den Blockgiessereien, den Umschmelzwerken und<br />
den grössern Eisen- und Stahlgiessereien von Bedeutung ist, ereignen sich hauptsächlich Unfälle beim<br />
Sortieren, Stapeln, Zusammenpressen und Zerkleinern des Schrotts. Zahlreich, aber im allgemeinen nicht<br />
beson<strong>der</strong>s schwer, sind Verletzungen <strong>der</strong> Hände durch die scharfen Kanten <strong>der</strong> Schrottstücke und <strong>der</strong><br />
Masseln, Verletzungen <strong>der</strong> Beine und Füsse durch abrutschendes o<strong>der</strong> fallendes Material und Unfälle<br />
durch wegfliegende Splitter beim Zerschlagen von Gussbruch, Roheisen und Steinen mittels Handschlägel.<br />
Als Quelle schwerer Unfälle ist in erster Linie die Schrottschere zu nennen. Beim Zuführen <strong>der</strong><br />
Schrottstücke von Hand kommt es häufig zu Verletzungen durch das unter <strong>der</strong> Einwirkung des Scherenmessers<br />
schnellende Schrottstück, o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Arbeiter gerät in den ungesicherten Scherbereich. Seltener<br />
sind Unfälle an <strong>der</strong> Schrottpaketierpresse, obschon diese so zahlreich vorhanden ist wie die Schrottschere.<br />
Noch seltener führt <strong>der</strong> in den meisten Eisengiessereien für die Gusszerkleinerung gebräuchliche Fallbär<br />
zu Unfällen, vermutlich weil die mit dieser Einrichtung verbundene Gefahr offensichtlich ist.<br />
70
Viele <strong>der</strong> kostspieligen Unfälle an Sandmischern ereignen sich bei ihrem Entleeren. Das Hineingeraten ins laufende<br />
Mischwerk wird verunmöglicht, wenn das Mischwerk bei geöffneter Entleerungstüre nur durch einen von <strong>der</strong> Maschine entfernt<br />
angebrachten Druckknopf in Gang gehalten werden kann.<br />
Bügel o<strong>der</strong> Kappen an den<br />
Stossgriffen <strong>der</strong> Schubkarren<br />
schützen vor Handverletzungen.<br />
Bei gewissen Mischern lässig<br />
sich die Entleerungsöffnung<br />
durch einen Schutzkorb gegen<br />
Hineinlangen sichern.<br />
Einfache Sicherung <strong>der</strong> gefahrlichen<br />
Auf laufstelle eines För<strong>der</strong>bandes<br />
auf die Umlenktrommel,<br />
welche die Reinigungs-<br />
und Reparaturarbeiten<br />
nicht behin<strong>der</strong>t: ein an den<br />
Lagerböcken befestigter Hartholzstabmitwenig<br />
Spiel gegenüber<br />
Band und Trommel.<br />
Bei <strong>der</strong> Sandaufbereitung fallen mit einem Unfallkostenanteil von zwei Dritteln die schweren Unfälle<br />
an den maschinellen Einrichtungen ins Gewicht. Ohne die Maschinen abzustellen, werden Sandstauungen<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Störungen behoben und Unterhaltsarbeiten ausgeführt, obwohl die für das Arbeiten an<br />
laufenden Maschinen erfor<strong>der</strong>lichen Sicherungen fehlen. Oft kommt es dabei auch vor, dass Dritte die<br />
Maschine irrtümlich in Gang setzen. Sehr schwere Unfälle ereignen sich an den vor allem in grösseren<br />
Betrieben vorhandenen För<strong>der</strong>bän<strong>der</strong>n, weil beim Säubern des laufenden Bandes Hände und Arme<br />
zwischen das Band und die Umlenktrommel hineingezogen werden. Von den Aufbereitungsmaschinen<br />
ist <strong>der</strong> auch in Kleinbetrieben gebräuchliche Kernsandmischer beson<strong>der</strong>s zu erwähnen; daer bei laufendem<br />
Mischwerk entleert werden muss, gerät <strong>der</strong> Sandmacher beim Verteilen des ausgestossenen Sandes<br />
häufig mit <strong>der</strong> Hand zwischen die umlaufende Schaufel und den Rand <strong>der</strong> ungesicherten Entleerungsöffnung.<br />
Schwere Unfälle kommen auch beim Lösen o<strong>der</strong> Nachstossen von Sand im Einwurftrichter<br />
von Sandschleu<strong>der</strong>maschinen vor, indem das dabei verwendete Werkzeug vom rotierenden Schleu<strong>der</strong>rad<br />
zurückgeschlagen wird. Im weitern führt das Bewegen von Handkarren und mobilen Einrichtungen<br />
mangels Grißschutzbügel häufig zu Handverletzungen.<br />
71
Ein Handgriff an <strong>der</strong><br />
schwenkbaren Pressplatte<br />
einer Formmaschine verhütet<br />
schwere Fingerquetschungen.<br />
Formen an handgesteuertem<br />
Slinger, mit Gesichtsschutz.<br />
Die bei <strong>der</strong> Formenheistellung auftretenden Unfälle sind nicht häufig und im allgemeinen auch nicht<br />
sehr schwer: sie stehen meistens im Zusammenhang mit dem Stapeln, dem Transportieren, dem Umsetzen<br />
o<strong>der</strong> dem Zusammenbauen von Formkasten, Modellen und Formen. Da aber ein grosser Teil <strong>der</strong> Belegschaft<br />
in den Sandformgiessereien damit zu tun hat, sind sowohl die Zahl als auch die Kosten dieser<br />
Unfälle beträchtlich. Schwerere Unfälle ereignen sich an den Formereieinrichtungen, insbeson<strong>der</strong>e an<br />
<strong>der</strong> zahlreich vorhandenen Formmaschine. Durch Fehlbetätigung des Steuerhebels werden die Arbeiter<br />
von den Bewegungen <strong>der</strong> Abhebe-, Wende- o<strong>der</strong> Presseinrichtung überrascht und erleiden Quetschungen<br />
o<strong>der</strong> sogar Verluste von Fingern und Händen. Derartige Unfälle kommen auch vor an den Scher- und<br />
Quetschstellen <strong>der</strong> Verschlüsse <strong>der</strong> Formsandsilos. An den Kernschiessmaschinen werden Unfälle durch<br />
Hineinlangen in das laufende Sandrührwerk beim Sandnachstossen o<strong>der</strong> durch Einklemmen zwischen die<br />
pneumatische Spannvorrichtung und die Kernbüchse verursacht. Unfälle im Zusammenhang mit Sand<br />
Slingern scheinen selten zu sein.<br />
72
Kettenvorhang an <strong>der</strong> Beschickungsöffnung eines P<br />
Kupolofens zum Schutze gegen Funkenwurf und<br />
Stichflammen.<br />
Entleeren eines Kupolofens bei ungenügen<strong>der</strong> Ab- P<br />
schirmung gegen Spritzer und Flammen<br />
In <strong>der</strong> Schmelzerei handelt es sich bei<br />
rund einem Fünftel <strong>der</strong> Unfälle um Verbrennungen<br />
durch Metallspritzer, die vorwiegend<br />
beim Beschicken o<strong>der</strong> beim Abstich<br />
<strong>der</strong> Schmelzöfen entstehen. An den in<br />
den Eisengiessereien gebräuchlichen Kupolöfen<br />
kommt es zudem beim Entleeren bei<br />
Betriebsschluss, wenn die Bodenklappe gezogen<br />
wird, zu oft sehr schweren Verbrennungen.<br />
Eine grosse Unfallgefahr bilden<br />
auch die beim Beschicken aus den Öfen herausschlagenden<br />
Stichflammen. Solche Unfälle<br />
sind beson<strong>der</strong>s schwer bei den in den<br />
Stahlwerken verwendeten Lichtbogenöfen.<br />
Zu erwähnen sind auch die Stürze in die<br />
Ofengruben, die zwar nicht häufig, aber<br />
folgenschwer sein können.<br />
Fahrbarer Schutzschild gegen Hitzestrahlung, P<br />
Flammen und Spritzer «m Elektroofen.<br />
73
Dcr Einsatz eines Giesshebczeugcs vermin<strong>der</strong>t<br />
die Zahl <strong>der</strong> Personen im Bereich<br />
des flüssigen Metalls.<br />
Beim automatischen Giessen erübrigt<br />
sich <strong>der</strong> Aufenthalt von Personen im Bereich<br />
des flüssige» Metalls.<br />
Die verschiedenen beim Giessen vorkommenden Un f-11 a e haben sa bei den einzelnen Betriebsarten eine<br />
unterschiedliche Bedeutung. . W-l a end >ren bei e' den Sandformgiessereien die ie Verbrennungen ren durch flüssiges<br />
Metall o<strong>der</strong> flüssige Schlacke vorwiegen, en, fallen a e bei den Blockgiessereien zu dem die Kranunfälle und bei<br />
Unfälle an den Druckgussmaschinen ins Gewicht. s Die . letzteren sind vor allem<br />
auf Fehlbetätigungen <strong>der</strong> Steuerorgane zurückzuführen, und vie e avon erei<br />
o<strong>der</strong> beim Beheben von Störungen.<br />
rsachen rund zwei Drittel <strong>der</strong> auf das Giessen entfallenden a Unfallkosten o<strong>der</strong><br />
samten Unfallkosten <strong>der</strong> Giessereien. Mehr 1 a d s ie H"If ä e d V b 1" 11<br />
ine und etwa ein Fünftel die Augen. Daraus eht ge hervor, welche Bedeutung einem<br />
geeigneten Schuhwer rk und geei~neter Bekleidung sowie dem Augensc utz zu o<br />
r verschüttetes Metall sind au "berfüllte über u te Pfannen und Tiegel, auf schmale, verf<br />
h .S i Df<br />
und auf hastiges Arbeiten zurückzu ü ren. e en<br />
Bruchs von Kesselgehängen, Pfannentraggab,<br />
g cl 1'1<br />
g g<br />
i n ocl cli h cle<br />
ein Tie elzan en un in o ge i<br />
von Kesseln und Pfannen.<br />
74
Der Transport <strong>der</strong> vielgestaltigen Gußstücke ist oft )<br />
schwierig. Freie Wege, zweckmässige Transportmittel<br />
in ausreichen<strong>der</strong> Anzahl und grosse Abstellplätze erleichtern<br />
den sicheren Umgang mit Gußstücken.<br />
Die Gussputzeiei hat hinsichtlich Unfallzahl<br />
und Unfallkosten bei den Sandformgiessereien<br />
eine grosse Bedeutung, eine geringere hingegen<br />
bei den Dauerformgiessereien, weil dort das Gussstück<br />
nur wenig Nacharbeit erfor<strong>der</strong>t. Sehr zahlreich<br />
sind die Unfälle, die sich beim Bewegen und<br />
Lagern <strong>der</strong> Gußstücke ereignen, und zwar vor<br />
allem in den Eisen- und Stahlgiessereien, wo die<br />
Gußstücke im allgemeinen schwer und sperrig<br />
sind und sich nicht behälter- o<strong>der</strong> serienweise<br />
transportieren und lagern lassen.<br />
Unfälle an Schleifmaschinen 1956 — 1957<br />
Unfallursache<br />
Augenverletzungen durch eingedrungene<br />
Fremdkörper .<br />
Hand- und Fingerverletzungen<br />
durch Abgleiten mit Werkstück<br />
Verklemmen, Zurückschlagen des<br />
Werk stückes<br />
Zu grosser Abstand <strong>der</strong> Werkstückauf<br />
lage vom Schleifkörper<br />
Bersten des Schleifkörpers<br />
Hineingeraten von Drittpersonen<br />
Übrige .<br />
Total.<br />
Anzahl Unfall<br />
Unfälle kosten<br />
in % in %<br />
50 25<br />
18 17<br />
4 10<br />
l<br />
6<br />
5<br />
16<br />
4<br />
20<br />
5<br />
19 )<br />
100 100<br />
~ Schutzfenster zwischen den Schmirgler,i vermin<strong>der</strong>t di<br />
gegenseitige Gefährdung.<br />
Ebenfalls ins Gewicht fallend sind die Unfälle<br />
an Maschinen und Geräten, wobei jene an den<br />
Schleifmaschinen im Vor<strong>der</strong>grund stehen. Obschon<br />
die Beobachtungen wenig zahlreich sind,<br />
bestätigen die obenstehenden Angaben über diese<br />
Unfälle doch die Wichtigkeit des Augenschutzes<br />
beim Schmirgeln und beim Aufenthalt im Bereiche<br />
von Schleiffunken sowie die Bedeutung <strong>der</strong><br />
Massnahmen zur Verhütung <strong>der</strong> schweren Unfälle<br />
beim Zerspringen von Schleifkörpern.<br />
Schlecht angepasste und unrichtig eingestellte Schutzverdecke<br />
an Schleifmaschinen verhin<strong>der</strong>n Unfälle nicht.<br />
75
~ Platzmangel vermin<strong>der</strong>t die Ausweichmöglichkeit und<br />
erhöht dadurch die Unfallgefahr beim Umgang mit Kranlasten.<br />
~ Gefährlicher und mühevoller Weg unter fahrbarem Kran<br />
hindurch.<br />
Kettenrechen helfen Hand- und Fingerquetschungen vermeiden,<br />
indem sie das Einfahren des Kranhakens in den<br />
Kettenring erleichtern.<br />
Der Umgang mit Ti.ansporn t»ii tteln führt zu<br />
vielen Unfällen. Die grösste Bedeutung haben die<br />
Unfälle an Kranen und Hebezeugen, vor allem in<br />
den Block-, Eisen- und Stahlgiessereien, wo schwere<br />
Gußstücke o<strong>der</strong> grosse Giesspfannen zu transportieren<br />
sind. Die Kranunfälle sind im allgemeinen<br />
sehr schwer; ihre Kosten betragen mehr als 10%<br />
<strong>der</strong> gesamten Unfallkosten aller Giessereien.<br />
Beim Befestigen <strong>der</strong> Lasten werden sehr oft<br />
Hände und Finger zwischen Kranhaken und Befestigungsmittel<br />
o<strong>der</strong> zwischen diesen und <strong>der</strong> Last<br />
eingeklemmt. Häufig sind auch die Unfälle durch<br />
überraschende Bewegungen <strong>der</strong> Kranlast bei ihrem<br />
Anheben, Abstellen o<strong>der</strong> Begleiten. Im üb>igen<br />
werden die Leute durch herunterfallende o<strong>der</strong> bewegte<br />
Lasten getroffen, o<strong>der</strong> sie stürzen beim Ausweichen.<br />
In diesem Zusammenhange sind auch die<br />
Unfälle durch herunterfallenden Schrott bei Magnetkranen<br />
zu nennen.<br />
~ ~<br />
Ubrige .<br />
Unfälle an Kranen und Hebezeugen<br />
1956-1957<br />
U n f;il lc<br />
Beim Befestigen und Begleiten <strong>der</strong><br />
Last<br />
Durch Versagen des Kranes, Bruch<br />
von Ketten und Haken, Zerreissen<br />
von Seilen<br />
Auf <strong>der</strong> Kranbahn, auf Zugängen<br />
zum Kran, bei <strong>der</strong> Kranwartung<br />
Unfall- Unfallzah<br />
I k pste~<br />
65 57<br />
4 7<br />
7 20<br />
24 16<br />
Total............. 100 100<br />
76
~ ~<br />
~ ~<br />
~ ~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~<br />
O O ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~<br />
O O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ O' ~<br />
~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O O O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
QO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~<br />
~ ~ ~ 4. ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O + ~ ~ O QO ~ ~ ~ ~ ~<br />
Die Bedeutung <strong>der</strong> Gleisfahrzeuge ist nur im Unfallgeschehen <strong>der</strong> Blockgiessereien nsit einem Anteil<br />
von rund 8 Prozent an den gesamten Unfallkosten verhältnismässig gross. Die Unfälle ereignen sich infolge<br />
unerwarteten Kippens <strong>der</strong> Wagenmulde und beim Kuppeln und Verschieben <strong>der</strong> Gleisfahrzeuge,<br />
wobei Arbeiter eingeklemmt o<strong>der</strong> angefahren werden.<br />
Für die innerbetrieblichen Transporte sind etwa halb so viele Motorfahrzeuge als führerbegleitete<br />
Krane eingesetzt; auf jene entfallen jedoch sechsmal weniger Unfallkosten als auf die Krane. Gefährlich<br />
sind <strong>der</strong> AufenthaIt zwischen Motorfahrzeug und Anhänger, das Abspringen während <strong>der</strong> Fahrt, das<br />
unbefugte Ingangsetzen <strong>der</strong> Fahrzeuge sowie die Hubvorrichtungen wegen ihrer Quetsch- und Scherstellen.<br />
Obschon die Aufzüge häufig benützt werden und im allgemeinen einer rauhen Beanspruchung ausgesetzt<br />
sind, insbeson<strong>der</strong>e die Setzbodenaufzüge in den Eisengiessereien, entfällt auf sie nur ein geringer<br />
U n fall koste na n tei l.<br />
77
Dieser Überblick über das Unfallgeschehen in den Giessereien vermag gewisse für die Unfallverhütung<br />
nützliche Hinweise zu geben, indem einige <strong>der</strong> bedeutsamsten Gefahrenquellen hervorgehoben wurden.<br />
Zweifellos lässt sich die Unfallverhütung durch technische und organisatorische Massnahmen noch<br />
för<strong>der</strong>n. Die Sicherheit <strong>der</strong> Werktätigen sollte mittels individueller Schutzmittel verbessert werden. Zudem<br />
ist bei <strong>der</strong> Mechanisierung <strong>der</strong> Arbeitsvorgänge, beispielsweise <strong>der</strong> im Unfallgeschehen <strong>der</strong> Giessereien<br />
bedeutsamen Transporte, darauf zu achten, dass die Gefährdung tatsächlich geringer wird als bei<br />
<strong>der</strong> ersetzten Handarbeit. Es darf auch nicht übersehen werden, dass viele Unfälle sich durch grössere<br />
Aufmerksamkeit des Einzelnen vermeiden liessen. Das aufmerksame und sichere Arbeiten lässt sich<br />
för<strong>der</strong>n durch die Verbesserung <strong>der</strong> Beleuchtung, das Dämpfen des Lärms, die SchaAung mühelos und<br />
sicher begeh- o<strong>der</strong> befahrbarer Wege, die Versorgung mit bekömmlichen Getränken und die Pflege guter<br />
menschlicher Beziehungen. Der Unfallverhütung dürfte zudem ein Erfahrungsaustausch über die in den<br />
verschiedenen Betrieben verwirklichten Lösungen bestimmter Probleme <strong>der</strong> Arbeitssicherheit för<strong>der</strong>lich<br />
sein. Die vorgesehene Behandlung<strong>der</strong> wichtigsten Unfallverhütungsmassnahmen in den«Schweizerischen<br />
Blättern für Arbeitssicherheit» soll diesem Erfahrungsaustausch dienen.<br />
Unfallursachen in <strong>der</strong> keramischen Industrie<br />
Die für die gesamte keramische Industrie kennzeichnende Verarbeitung <strong>der</strong> Tone durch Aufbereiten,<br />
Formen, Trocknen, Brennen und Fertigstellen erfolgt in den einzelnen Industriezweigen auf verschiedene<br />
Weise. Je nachdem die Aufbereitung und die Weiterverarbeitung <strong>der</strong> Rohstoffe einfach o<strong>der</strong> vielgestaltig<br />
und die Erzeugnisse dementsprechend roh o<strong>der</strong> fein sind, wird ein grob- und ein feinkeramischer Industriezweig<br />
unterschieden. Die wichtigsten Erzeugnisse sind die folgenden:<br />
Grobkerainik<br />
Ziegel- und Backsteine<br />
Kanalisationssteinzeug<br />
Chemisch-technisches Steinzeug<br />
Feuerfeste und säurebeständige Steine<br />
Klinker- und Steinzeugbodenplatten<br />
Feinkeramik<br />
Geschirrporzellan, Elektro-Isolatoren, Steatitkörper<br />
Steingutgeschirr<br />
Kunstkeramik, Töpfergeschirr, Blumentöpfe<br />
Stein gutwand platten<br />
Sanitärkeramik<br />
Ofenkachel n<br />
Schleifscheiben<br />
Die Verschiedenartigkeit <strong>der</strong> grob- und feinkeramischen Betriebe zeigt sich in <strong>der</strong> unterschiedlichen<br />
Art und Menge <strong>der</strong> verwendeten Rohstofte und in den zur Herstellung <strong>der</strong> Keramik dienenden Einrichtungen<br />
und Maschinen. Nicht alle für die Erzeugung keramischer Gegenstände erfor<strong>der</strong>lichen Tone und<br />
Mineralien sind in <strong>der</strong> Schweiz zu finden o<strong>der</strong> in abbauwürdigen Lagern vorhanden. Während beispielsweise<br />
<strong>der</strong> Bedarf an Ziegelton und weitgehend auch <strong>der</strong>jenige an Töpferton aus einheimischen Gruben gedeckt<br />
werden kann, fehlt das für die Porzellanherstellung verwendete Kaolin vollständig. Im allgemeinen<br />
verfügen feinkeramische Betriebe im Gegensatz zu grobkeramischen über keine eigene Rohmaterialgewinnung.<br />
Ferner fehlen in <strong>der</strong> feinkeramischen Industrie wegen <strong>der</strong> verhältnismässig kleinen zu<br />
verarbeitenden Rohmaterialmengen meistens die im grobkeramischen Industriezweig üblichen umfangreichen<br />
Transporte sowie gewisse schwere Aufbereitungsmaschinen und Pressen. Die folgenden schematischen<br />
Darstellungen geben Aufschluss über den Herstellungsvorgang bei einigen grob- und feinkeramischen<br />
Erzeugnissen.
Ziegel- und Backsteinfabrikation<br />
esc hicker<br />
Aufbereitung<br />
Koll;-. gang<br />
Walz werk<br />
Sumpfh<br />
Trocknerei<br />
Formerei<br />
Revolverpresse<br />
Brennerei<br />
Die in Ton- und Lehmgruben mechanisch o<strong>der</strong> von Hand abgebauten Rohmaterialien werden zur Aufbereitung in die<br />
Ziegelei geführt. Beschicker bringen die verschiedenen Tonsorten in einem bestimmten Mengenverhältnis in den Kollergang<br />
und ins Walzwerk, wo das Material zerkleinert, zerrieben und schliesslich im Doppelwellenmischer unter Wasserzugabe<br />
innig vermischt wird. Die so aufbereitete Tonmasse wird im sogenannten Sumpfhaus gelagert, nach einigen Wochen<br />
abgebaggert und zur Formgebung <strong>der</strong> Strangpresse zugeführt. Hier wird die plastische Masse zu einem endlosen<br />
Strang ausgepresst, dem ein am Ende <strong>der</strong> Presse eingebautes Mundstück gleichzeitig auch die Querschnittsform gibt.<br />
Ein Abschneideautomat teilt den austretenden Strang in Stücke, die entwe<strong>der</strong> gleich ihre endgültige Form als Backsteine<br />
haben o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Revolverpresse noch zu Dachziegeln weiterverarbeitet werden. Auf Gestellen in Trockenräumen o<strong>der</strong> in<br />
beson<strong>der</strong>en Trockenkammern wird den Formlingen die Feuchtigkeit entzogen. Anschliessend erfolgt <strong>der</strong> Brand bei etwa<br />
1000' C im kontinuierlich arbeitenden Ring- o<strong>der</strong> Zickzackofen. Nach etwa einer Woche verlässt das Brenngut den Ofen,<br />
wird sortiert, gelagert und schliesslich den Baustellen zugeführt.<br />
79
Steinzeugfabrikation<br />
Ro hmateriallager<br />
Walzenbrecher<br />
Aufbereitung<br />
Nassaufbereitung<br />
~IQI<br />
Mauken<br />
Tonschnei<strong>der</strong><br />
Wellenmischer<br />
Trockenaufbereitung<br />
Drehscheibe<br />
Röhren presse<br />
Formerei<br />
Handformen<br />
Trocknerei<br />
Prüfen<br />
Sc hleifen<br />
Fertig stellung<br />
Brennerei<br />
Die vorwiegend aus dem Ausland zugeführten Rohmaterialien werden in Schuppen gelagert und zur Voraufbereitung in<br />
einen Walzenbrecher gebracht. Die vorgebrochene Masse wird dann entwe<strong>der</strong> nass o<strong>der</strong> trocken aufbereitet und durchläuft<br />
bei Nassaufbereitung: Kugelmühle — Rührwerk — Filterpresse — Tonschnei<strong>der</strong>,<br />
bei Trockenaufbereitung: Kollergang — Kugel- o<strong>der</strong> Schlagmühle — Silos, je nach Körnung des Rohmaterials — Doppelwellenmischer,<br />
wo unter Wasserzugabe eine innige Vermengung stattfindet — Tonschnei<strong>der</strong>.<br />
Nach längerer Zwischenlagerung in sogenannten Maukkellern (feuchte Atmosphäre) erfolgt je nach Gestalt <strong>der</strong> Gegenstände<br />
die Formgebung auf Töpferdrehscheiben, an Röhren- und an<strong>der</strong>n Pressen o<strong>der</strong> von Hand. Die Trocknung <strong>der</strong><br />
Formlinge vollzieht sich wie<strong>der</strong>um in Trockenkammern o<strong>der</strong> -räumen und <strong>der</strong> anschliessende Brand in Kammeröfen mit<br />
überschlagen<strong>der</strong> Flamme bei etwa 1350" C. Während des Brennvorganges wird auch das Salz beigegeben, welches die<br />
Formlinge mit einer durchsichtigen Glasurschicht überzieht. Werkstücke, die für die Montage Pass-Sitze erfor<strong>der</strong>n, werden<br />
an den entsprechenden Stellen geschliffen und Steinzeuggefässe, die vorwiegend in <strong>der</strong> chemischen Industrie Verwendung<br />
finden, noch einer Druckwasserprobe unterzogen.<br />
80
Geschir; porzellanfabrikation<br />
Kollergang<br />
Rührwerk<br />
Filterpresse<br />
Aufbereitung<br />
Giessen<br />
Fo rrne re i<br />
Trocknerei<br />
Drehen<br />
Mauken Tonschnei<strong>der</strong><br />
Vorbrand<br />
Glasieren<br />
Sinterbrand<br />
Brennerei<br />
Fertig st g llung<br />
Dekorbrand<br />
Deko<br />
So<br />
Die aus verschiedenen Län<strong>der</strong>n stammenden Rohstoffe werden in Kollergängen vor-, in Kugelmühlen feingemahlen und<br />
im Rührwerk unter Wasser-usatz innig miteinan<strong>der</strong> vermengt. Pumpen beför<strong>der</strong>n die so entstandene Schlickermasse in die<br />
Filter-Pressen, wo das überschüssige Wasser abfliesst, die Tonmasse aber in Form von sogenannten Filterkuchen zurückbleibt.<br />
Nach längerem Zwischenlagern in feuchten Kellern erfolgt die weitere Aufarbeitung <strong>der</strong> Masse entwe<strong>der</strong> zur plastischen<br />
Drehmasse o<strong>der</strong> zur dickflüssigen Giessmasse.<br />
Je nach <strong>der</strong> Gestalt des Gegenstandes geschieht die Formgebung auf <strong>der</strong> Töpferdrehscheibe o<strong>der</strong> im Giessverfahren in<br />
Gipsformen. Nachdem die Formlinge garniert sind (Anbringen von Henkeln, Ausgüssen und so weiter), werden sie in<br />
Trockenkammern o<strong>der</strong> -räumen getrocknet und nachher in Elektrotunnelöfen bei etwa 900' C vorgebrannt. Anschliessend<br />
werden die sogenannten Biscuits im Tauch- o<strong>der</strong> Spritzverfahren glasiert und im nachfolgenden Sinterbrand bei rund<br />
1400" C ein zweites Mal gebrannt, wobei sich die Glasur mit dem Scherben verbindet und die eigentliche Umwandlung des<br />
Scherbens zum Porzellan stattfindet.<br />
Nach sorgfältiger Sortierung ist das Porzellan versandbereit, sofern sich nicht noch das Aufmalen <strong>der</strong> Dekors anschliesst,<br />
die in einem dritten Brand im Muffelofen bei etwa 850' C eingebrannt werden.<br />
81
Von den <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> unterstellten keramischen Betrieben sind ungefähr<br />
drei Viertel industriell organisiert. Die übrigen sind Handwerksbetriebe mit zum Teil kunstgewerblichem<br />
Einschlag. Etwas mehr als die Hälfte aller keramischen Betriebe sind Ziegel- und Backsteinfabriken, und<br />
etwas mehr als ein Viertel sind Töpfereien. Die folgende Übersicht vermittelt einen Einblick in die<br />
Zusammensetzung <strong>der</strong> keramischen Industrie. Bei den wenigen Betrieben, die verschiedenartige Keramik<br />
herstellen, aber nicht in Betriebsteile aufgeteilt sind, war für die Zuweisung zu einer Betriebsart das<br />
Haupterzeugnis massgebend.<br />
Die keramische Industrie 1957<br />
Erzeugnisse<br />
Betriebsteile<br />
Betriebsteile mit ... Vollarbeitern<br />
1-5 6-20 21-40 41-140 140<br />
Vol larbei ter<br />
Versiche<br />
Lohnsum<br />
in Franken<br />
Ziegel- und Backsteine.<br />
Steinzeug<br />
Feuerfeste Steine, Klinker- und<br />
Steinzeugbodenplatten .<br />
Total<br />
75<br />
2<br />
6 15 26 4 647<br />
19<br />
2<br />
198<br />
515<br />
33 279 693<br />
1 340 209<br />
3 482 907<br />
84 6 16 28 24 10 5 360 38 102 809<br />
Grobkeramik<br />
Porzellan.<br />
Steingutgeschirr.<br />
Kunstkeramik, Töpfergeschirr<br />
und Blumentöpfe .<br />
Sanitärkeramik, Wandplatten .<br />
Ofen kacheln<br />
Schleifscheiben .<br />
40<br />
Total 60<br />
3<br />
7<br />
1<br />
20 12<br />
l 3<br />
1 1<br />
Feinkeramik<br />
927<br />
114<br />
599<br />
682<br />
180<br />
238<br />
23 16 8 9 4 2 740<br />
6 413 054<br />
791 144<br />
4 139 727<br />
4 717 309<br />
1 246 104<br />
1 646 936<br />
18 954 274<br />
esamt<br />
144<br />
29 32 36 33 14 8 100 57 057 083<br />
Ein grobkeramischer Betrieb o<strong>der</strong> Betriebsteil weist im Mittel 64 Vollarbeiter auf und ein feinkeramischer<br />
46. Dieser Durchschnitt beträgt für die Töpfereien sogar nur 15. Die <strong>der</strong> obligatorischen Versicherung<br />
unterstellten Risikoeinheiten sind also im allgemeinen klein, wenn auch die Grösse <strong>der</strong> Betriebe<br />
sehr unterschiedlich ist. Der kleinste keramische Betrieb beschäftigt 1 Person und <strong>der</strong> grösste rund 750<br />
Personen.<br />
Ausser <strong>der</strong> Mannigfaltigkeit <strong>der</strong> Betriebe hinsichtlich Art und Grösse wi<strong>der</strong>spiegelt sich im Unfallgeschehen<br />
auch <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> betrieblichen Unfallverhütung sowie das Verhalten <strong>der</strong> Belegschaft in bezug<br />
auf Arbeitssicherheit. Es ist aber schwierig, aus einer Unfallstatistik, die sich wie bei den keramischen<br />
Betrieben auf verhältnismässig wenig Beobachtungen stützen muss, mit Hilfe von Masszahlen die Risikounterschiede<br />
und die bedeutsamen Risikomerkmale mit einiger Sicherheit zu bestimmen; denn <strong>der</strong> Zufall<br />
übt auf die Zahl und die Kosten <strong>der</strong> Unfälle, insbeson<strong>der</strong>e bei den verhältnismässig seltenen, aber kostspieligen<br />
Rentenfällen, einen überragenden Einfluss aus. Dies ist bei <strong>der</strong> nun folgenden Beurteilung des<br />
Unfallgeschehens zu beachten. Die ausgewiesenen zehnjährigen Erfahrungen vermögen wohl einen Hinweis<br />
auf die Risikoverhältnisse zu geben, können aber nur teilweise als schlüssig angesehen werden. Im<br />
weitern ist zu beachten, dass die ausgewiesenen Unfallkosten nur die Aufwendungen an Versicherungsleistungen<br />
umfassen und nicht etwa auch die mit dem Versicherungsbetrieb verbundenen Unkosten. Auch<br />
82
die Zahl und die Kosten <strong>der</strong> Silikosefälle — über die im Kapitel Berufskrankheiten berichtet wird — sind<br />
in den Angaben nicht enthalten. Aus all diesen Gründen können die angegebenen Risikosätze nicht ohne<br />
weiteres als Grundlagen für eine allfällige Prämienbeurteilung dienen.<br />
Die Unfälle in <strong>der</strong> keramischen Industrie 1948 — 1957<br />
Unfallkosten<br />
in "/„, <strong>der</strong><br />
versicherten<br />
Lohn<br />
summe<br />
ranken in /<br />
44 960<br />
10 704<br />
88<br />
12<br />
23<br />
55 664 100 18<br />
7<br />
' Ohne Silikosen.<br />
Aus diesen Angaben ist ersichtlich, dass sich in <strong>der</strong> keramischen Industrie im jährlichen Mittel etwas<br />
mehr als 1600 Unfälle ereignen, die Kosten im Betrage von rund 850000 Franken zur Folge haben. Rund<br />
40 Prozent aller Unfälle sind Bagatellunfälle und 2 Prozent sind Rentenfälle. Die wenigen Rentenfälle verursachen<br />
nahezu zwei Drittel <strong>der</strong> Unfallkosten. Die kostspieligen, aber verhältnismässig seltenen schweren<br />
Unfälle mit Rentenfolgen beherrschen demnach die Unfallkosten. Die Häufigkeit <strong>der</strong> Betriebsunfälle in<br />
<strong>der</strong> keramischen Industrie entspricht ungefähr <strong>der</strong>jenigen in <strong>der</strong> gesamten Betriebsunfallversicherung,<br />
aber die Rentenhäufigkeit ist um rund einen Zehntel und <strong>der</strong> Risikosatz um rund zwei Zehntel grösser.<br />
Den Gegebenheiten entsprechend entfällt <strong>der</strong> Grossteil <strong>der</strong> Zahl und <strong>der</strong> Kosten <strong>der</strong> Unfälle auf die<br />
grobkeramische Industrie. In diesem Industriezweig ist die Unfallhäufigkeit mehr als doppelt und die<br />
Rentenhäufigkeit sogar dreimal so gross als bei den feinkeramischen Betrieben, und auch an Unfallkosten<br />
trifft es auf einen Versicherten mehr als das Dreifache. Innerhalb <strong>der</strong> Industriezweige lassen sich wegen<br />
<strong>der</strong> weitgehend zufallsbedingten Beobachtungen nur mit geringer Sicherheit Risikounterschiede feststellen.<br />
Immerhin scheinen die Ziegel- und Backsteinfabriken ein etwas grösseres Unfallrisiko aufzuweisen<br />
als die übrigen grobkeramischen Betriebe. In <strong>der</strong> feinkeramischen Industrie scheint die Herstellung<br />
von Porzellan und Kunstkeramik weniger gefährlich zu sein als die übrigen Fabrikationen.<br />
Zur eingehen<strong>der</strong>en Untersuchung des Unfallgeschehens in <strong>der</strong> keramischen Industrie wurden anhand<br />
<strong>der</strong> Unfallmeldungen <strong>der</strong> Betriebsinhaber die ordentlichen Betriebsunfälle aus den Jahren 1956 — 1957 und<br />
die Rentenfälle aus den Jahren 1948 — 1957 nach dem Unfallgegenstand beziehungsweise <strong>der</strong> Tätigkeit ausgezählt.<br />
Gestützt darauf ergab sich die entsprechende Verteilung <strong>der</strong> Unfallkosten 1948 — 1957, wobei <strong>der</strong><br />
verhältnismässig kleine Kostenanteil <strong>der</strong> Unfälle ohne Rentenfolgen auf Grund <strong>der</strong> Erfahrungen 1956<br />
bis 1957 verteilt wurde. Das Ergebnis dieser Erhebung ist in <strong>der</strong> Anhangstabelle 5 zusammengestellt, wobei<br />
die Unfallgegenstände und Tätigkeiten nach dem Arbeitsort gruppiert sind. Die Zahl <strong>der</strong> in die <strong>Statistik</strong><br />
einbezogenen Unfälle verteilt sich auf so viele Merkmale, dass ein einzelnes Merkmal mit einer gewissen<br />
Vorsicht beurteilt werden muss. Ferner sind die Zahl und die Kosten <strong>der</strong> Unfälle auf den Versicherungsbestand<br />
zu beziehen, wenn die Bedeutsamkeit <strong>der</strong> Risikomerkmale richtig erkannt werden soll. Es wird<br />
nun im folgenden versucht, einige Schlussfolgerungen zu ziehen.<br />
Werden auch die Unfälle und die Kosten, die in <strong>der</strong> Unfallgegenstandsliste im Anhang unter Transporte<br />
in <strong>der</strong> Fabrik, Bauten, Einrichtungen und Verschiedenes gezählt sind, den eigentlichen Arbeitsorten zugeteilt,<br />
so ergibt sich die folgende Verteilung <strong>der</strong> Unfälle und Unfallkosten nach Arbeitsorten, wobei sich<br />
die in <strong>der</strong> Übersicht ebenfalls angegebene Verteilung <strong>der</strong> Vollarbeiter auf die in den Jahren 1958 — 1959<br />
erhobenen Betriebsbeschreibungen stützt.<br />
83
Unfälle ' in <strong>der</strong> keramischen Industrie nach Arbeitsorten<br />
Arbeitsorte<br />
Vollarbeiter<br />
in /<br />
in /<br />
Ordent liehe U nfälle<br />
auf 1000 Vollarbeiter<br />
des betreffenden<br />
Ortes<br />
in /<br />
U nfallkosten<br />
in /„„<strong>der</strong> versicherten<br />
Lohnsumme des<br />
betreffenden Ortes<br />
Grobkeramik<br />
Rohmaterialgewinnung ..<br />
Zufuhr des Rohmaterials.<br />
Aufbereitung .<br />
Formerei.<br />
Trocknerei, Brennerei<br />
Fertigstellung.<br />
Lager, Versand .<br />
Hilfs- und Nebenbetriebe.<br />
Total<br />
8<br />
5<br />
7<br />
17<br />
34<br />
5<br />
11<br />
13<br />
7<br />
12<br />
7<br />
11<br />
36<br />
1<br />
14<br />
12<br />
143<br />
418<br />
187<br />
115<br />
188<br />
34<br />
212<br />
165<br />
12<br />
14<br />
12<br />
20<br />
20<br />
0<br />
100 100 176 100 23<br />
12<br />
10<br />
34<br />
63<br />
44<br />
27<br />
14<br />
2<br />
25<br />
18<br />
Feinkeramik<br />
Rohmaterialgewinnung.<br />
Zufuhr des Rohmaterials.<br />
Aufbereitung .<br />
Formerei.<br />
Trocknerei, Brennerei<br />
Fertigstellung.<br />
Lager, Versand .<br />
Hilfs- und Nebenbetriebe.<br />
0<br />
I<br />
7<br />
34<br />
15<br />
21<br />
12<br />
10<br />
1<br />
4<br />
14<br />
18<br />
18<br />
21<br />
14<br />
10<br />
168<br />
44<br />
102<br />
83<br />
97<br />
86<br />
0<br />
4<br />
22<br />
15<br />
13<br />
19<br />
10<br />
17<br />
22<br />
3<br />
6<br />
6<br />
6<br />
12<br />
Total<br />
100<br />
100 83 100<br />
' Ohne Silikosen.<br />
Die Angaben dieser Tabelle stützen sich auf die ordentlichen Unfälle 1956 — 1957 und auf die Rentenfälle 1948-1957.<br />
In <strong>der</strong> grobkeramischen Industrie ereignet sich wenig mehr als ein Drittel aller Unfälle in <strong>der</strong> Trocknerei<br />
und <strong>der</strong> Brennerei; dort ist aber auch etwa ein Drittel <strong>der</strong> Versicherten beschäftigt. Die grösste Unfallhäufigkeit<br />
ist bei <strong>der</strong> Zufuhr des Rohmaterials festzustellen, wobei es auch am meisten Unfallkosten auf<br />
einen Versicherten trifft. Die Formerei weist bei verhältnismässig kleiner Belegschaft am meisten Unfallkosten<br />
auf. Es ereignen sich beim Formen offenbar die schwersten Unfälle. Auf das Trocknen und Brennen<br />
entfallen zwar gleich viel Unfallkosten wie auf das Formen, aber die Unfälle sind dort bedeutend leichter.<br />
Ähnlich schwere Unfälle wie beim Formen ereignen sich bei <strong>der</strong> Gewinnung, <strong>der</strong> Zufuhr und <strong>der</strong> Aufbereitung<br />
des Rohmaterials. Diesen vier Arbeitsorten dürfte demnach in erster Linie die Aufmerksamkeit<br />
hinsichtlich Unfallverhütung zu schenken sein. Im weitern ist ersichtlich, dass das allfällige Fehlen einer<br />
Rohmaterialgewinnung ins Gewicht fällt. Der Art <strong>der</strong> grobkeramischen Erzeugnisse entsprechend hat das<br />
Fertigstellen hinsichtlich des Unfallgeschehens eine untergeordnete Bedeutung. Beim Lagern und beim<br />
Versand hingegen besteht auch eine erhebliche Unfallgefahr, ist doch hier die zweitgrösste Unfallhäufigkeit<br />
festzustellen.<br />
Etwas an<strong>der</strong>s sind die Verhältnisse in <strong>der</strong> feinkeramischen Industrie Dabei hat die G.ewinnung und die<br />
Zufuhr des Rohmaterials gesamthaft betrachtet keine beson<strong>der</strong>e Bedeutung, was auch in den geringen<br />
Unfallzahlen zum Ausdruck kommt. Auf das Fertigstellen <strong>der</strong> feinkeramischen Gegenstände entfallen<br />
die meisten Unfälle. Das grösste Unfallrisiko besteht aber beim Aufbereiten <strong>der</strong> Rohstoffe, bei dem sich<br />
auch die schwersten Unfälle ereignen. Die Bedeutung <strong>der</strong> Aufbereitung hinsichtlich Unfallverhütung wird<br />
aber bei industriell und handwerklich organisierten Betrieben unterschiedlich sein.<br />
Von beson<strong>der</strong>em Interesse ist die Frage, welche Bedeutung innerhalb <strong>der</strong> einzelnen Arbeitsorte den<br />
verschiedenen Unfallgegenständen o<strong>der</strong> Tätigkeiten zukommt. Der folgende Überblick stützt sich wie<strong>der</strong>um<br />
auf die Anhangstabelle 5.<br />
84
Grohke] a)nis( he Inilust]ie<br />
I n <strong>der</strong> Roh»~ateiialge»innung werden<br />
rund drei Fünftel aller Unfallkosten durch<br />
Unfälle an den vielfach hohen und steilen<br />
Abbauwänden verursacht. Herunterfallendes<br />
o<strong>der</strong> rutschendes Material und Abstürze<br />
ungesicherter Arbeiter sind häufige<br />
Unfallursachen, die allein in den Jahren<br />
1948-1957 zu sieben Todesfällen führten.<br />
Ein Fünftel <strong>der</strong> Unfallkosten steht im Zusammenhang<br />
mit den Abbau- und Auflademaschinen,<br />
bei denen vor allem <strong>der</strong> Aufenthalt<br />
im Bereich <strong>der</strong> Baggerlöffel o<strong>der</strong><br />
Ladeschaufeln und unvorsichtiges Manövrieren<br />
schwere Unfälle verursachen. Immer<br />
wie<strong>der</strong> treten Verletzungen an nicht rückschlaggesicherten<br />
Anwurfkurbeln von Motoren<br />
auf. Schliesslich spielt in <strong>der</strong> Rohmaterialgewinnung<br />
auch das Ausgleiten<br />
auf nassem o<strong>der</strong> vereistem Boden eine gewisse<br />
Rolle.<br />
l Der stufenweise Abbau vermin<strong>der</strong>t die Absturzgefahr<br />
von Personen und Material.<br />
2 Hydraulischer Ladegreifer. Im Bereich des Greifers halten<br />
sich vorschriftsgemäss keine Personen auf.<br />
3 Hydraulischer Löffelbagger mit uneingeschränkter Sicht<br />
aus dem Führerstand.
Bei <strong>der</strong> Zufuhr des Rohmaterials überwiegen<br />
die Rollbahnen mit einem Unfallkostenanteil<br />
von zwei Dritteln gegenüber<br />
den an<strong>der</strong>n Transportmitteln und dem Ausladen.<br />
Die meisten Unfälle ereignen sich<br />
beim Verschieben <strong>der</strong> Rollwagen, wobei<br />
Arbeiter angefahren, eingeklemmt o<strong>der</strong><br />
überfahren werden. Als nicht ungefährlich<br />
erweist sich das Aufgleisen von. Fahrzeugen.<br />
Infolge Fehlens geeigneter Sicherungen<br />
gibt das ungewollte Kippen <strong>der</strong> Rollwagenmulden<br />
und das Umstürzen <strong>der</strong> Rollwagen<br />
beim Entleer en Anla ss zu manchen U n<br />
fällen. Hängebahnen verursachen des öftern<br />
Unfälle durch entgleisende, abstürzende,<br />
pendelnde o<strong>der</strong> kippende För<strong>der</strong>gefässe.<br />
Bei den Lastwagenunfällen sind Fingerund<br />
Handquetschungen beim Hantieren an<br />
den Seitenwänden <strong>der</strong> Ladebrücken beson<strong>der</strong>s<br />
zahlreich.<br />
1 Wirksame Sicherung gegen Entlaufen:<br />
die fest eingebaute, von<br />
sicherem Standort aus bedienbare<br />
Bremse.<br />
2 Gefährliches Stoppen durch Unterlegen<br />
einer Bauklammer. Ein<br />
Hemmschuh o<strong>der</strong> Vorlagekei1 hät te<br />
das Entlaufen <strong>der</strong> Rollwagen und<br />
damit einen schweren Unfall verhütet.<br />
3 Der fest verankerte, beim Entleeren<br />
über den Chassisrahmen geschobene<br />
Sicherungsbügel verhin<strong>der</strong>t<br />
das Umstürzen.<br />
4 Zufuhr des Rohmaterials mittels<br />
Hängebahn. Gut organisierter<br />
Lagerplatz n>it Eimerkettenbaggern<br />
~ und Schleppseilbahn.<br />
86
Die Unfälle bei Ti.ansporn.ten in <strong>der</strong> Fabrik sind<br />
ebenso mannigfaltig wie die verwendeten Transportmittel.<br />
Bei Aufzügen und Ablässen führen vor<br />
allem fehlende Verriegelungen an den Fahrbahnabschlüssen<br />
o<strong>der</strong> mangelhafte Abschrankungen<br />
<strong>der</strong> Fahrbahn zu meist schweren Unfällen. Ungesicherte<br />
Quetsch-, Scher-, Auf laufstellen und<br />
Stützrollen von Transport- und För<strong>der</strong>bän<strong>der</strong>n<br />
erhöhen die Unfallgefahr beträchtlich: die mit<br />
<strong>der</strong> Überwachung des Materialflusses und mit den<br />
Unterhalts- und Reinigungsarbeiten Betrauten<br />
können hineingeraten und sich Arm- und Handverletzungen<br />
zuziehen. Schaukelför<strong>der</strong>er, Hängebahnen,<br />
För<strong>der</strong>er für den Absetzwagenbetrieb<br />
und Elevatoren sind durch zwei Arten von Unfällen<br />
gekennzeichnet: Arbeiter werden erfasst<br />
und mitgerissen o<strong>der</strong> durch abstürzendes Ladegut<br />
getroffen. Unfälle mit Rollwagen treten oft<br />
deshalb auf, weil diese gezogen statt gestossen<br />
werden. Unzweckmässige Handgriffe an den<br />
Karren sind die Ursache zahlreicher Hand- und<br />
Fingerquetschungen.<br />
1 Durch Seitenbleche gesicherte Aufl<br />
aufstelle eines Stahlför<strong>der</strong>bandes.<br />
Der Abstreifer wird mittels Gegengewichten<br />
angepresst. Das Material<br />
fällt durch die mit einem Gitterrost<br />
geschützte Bodenöffnung.<br />
2 Abgedeckte Quetsch- und Scherstellen<br />
im Handbereich eines Glie<strong>der</strong>för<strong>der</strong>bandes.<br />
3 Geeignete Schutzbügel verhin<strong>der</strong>n<br />
Handverletzungen.<br />
4 Vollautomatisches Sammelgerüst<br />
mit Elektroschiebebühne.<br />
5 Absetzgerüst mit abnahmeseitig<br />
eingebautem Schutzgitter gegen<br />
herabfallendes Transportgut.<br />
87
ln <strong>der</strong> Aufbereitung kommt es<br />
beim Nachstossen von Material o<strong>der</strong><br />
bei Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten<br />
an laufenden Beschickern, Brechern,<br />
Kollergängen, M ühlen, M i<br />
schern, Walzwerken und Tonschnei<strong>der</strong>n<br />
zu auffallend vielen Hand- und<br />
Fingerverletzungen. Eine typische<br />
Situation für Unfälle mit tödlichem<br />
Ausgang liegt vor, wenn Arbeiter<br />
zum Beheben von Störungen in abgestellte,<br />
gegen unbefugtes Anlassen<br />
jedoch nicht gesicherte Kollergänge<br />
und Mischer einsteigen. Im Sumpfhaus<br />
besteht vor allem die Gefahr,<br />
auf dem lehmigen Boden auszugleiten<br />
o<strong>der</strong> durch herunterfallendes<br />
Material verletzt zu werden.<br />
1 Gefährliche offene Haspelwelle<br />
eines Kastenbeschickers.<br />
2 Durch solides Gitter gesicherte<br />
Beschicker-Einfüllöffnung.<br />
3 Gefährliche Reinigungsarbeiten<br />
im Kollergangy<br />
Die Türverriegelung sollte<br />
mit <strong>der</strong> Anlassvorrichtung<br />
<strong>der</strong>Maschine zwangsläufig<br />
gekuppelt sein.<br />
4 Mangelhafte Läuferbah<br />
umwehrung eines Kolle<br />
ganges. Ungenügende<br />
auf das Hand rad d<br />
Riemenrückers wirkend<br />
Kettensicherung gege<br />
irrtümliches o<strong>der</strong> unb<br />
fugtes Ingangsetzen.<br />
5 Kollergang mit guter<br />
Läuferbahnumwehrung.<br />
88
Die Unfallkosten <strong>der</strong> Foi i~igebung<br />
entfallen zum grössten Teil auf die<br />
Ziegelpressen. Insbeson<strong>der</strong>e an den<br />
Revolverpressen werden beim Anschlag<br />
<strong>der</strong> Lehmklösse häufig Finger<br />
o<strong>der</strong> Hände durch den Preßstempel<br />
abgequetscht; eine weitere Gefährdung<br />
besteht darin, dass diese Pressen<br />
während Ü berholungsarbei ten und<br />
beim Formenwechseln irrtümlich in<br />
Gang gesetzt werden. Zahlreich sind<br />
ebenfalls die Verletzungen an den<br />
Drähten des Abschneidautomaten<br />
<strong>der</strong> Strangpressen. Viele Hand- und<br />
Fussverletzungen ereignen sich im<br />
übrigen auch beim Auswechseln <strong>der</strong><br />
schweren Pressformen.<br />
1 Ciegen Nachgreifen an<br />
<strong>der</strong> Revolverziegelpresse<br />
nur ungenügend<br />
Schutz bieten<strong>der</strong><br />
Handabweiser<br />
2 Automatisierung verhin<strong>der</strong>t<br />
charakteristische<br />
Handverletzungen<br />
an Ziegelpressen. Einlaufseite<br />
einer vollautomatischen<br />
Revolverpresse.<br />
3 Abnahmeseite einer<br />
vollautomatischen Revolverpresse.<br />
4+5 Nichto<strong>der</strong>ungenügend<br />
verschalte Antriebsorgane<br />
und Steuermechanismen<br />
an Abschneidautomaten.<br />
89
l<br />
I<br />
Beim Trocknen und Brennen stammt fast ein<br />
Viertel <strong>der</strong> Unfallkosten vom Ein- und Ausgerüsten<br />
des Trockengutes in den Grossraumtrocknereien.<br />
Hier sind Abstürze von Personen<br />
und Trockengut vielfach auf schlecht unterhaltene<br />
Gerüste o<strong>der</strong> ungeeignete Einrichtungen zum<br />
Füllen und Leeren <strong>der</strong> hohen Tiockengestelle<br />
zurückzuführen. Als bedeutsame Gefahrenquellen<br />
haben sich die für die Bedienung <strong>der</strong> Trockenkammern<br />
verwendeten Schiebebühnen und Absetzwagen<br />
erwiesen. Bei den Absetzwagen ins beson<strong>der</strong>n<br />
können die langen Handhebel <strong>der</strong> Hubvorrichtung<br />
beim Zurückschnellen zu schweren<br />
Gesichtsverletzungen führen. Der Umgang mit<br />
Handkarren und herunterfallendesMaterial verursachen<br />
während des Einsetzens und Ausziehens<br />
des Brenngutes je rund einen Sechstel <strong>der</strong> Unfallkosten.<br />
Nicht selten sind schliesslich Verbrennungen<br />
an heisser Ofenasche und überhitzten<br />
Abgasrohren sowie Stürze in nicht o<strong>der</strong> schlecht<br />
abgedeckte Luft- und Rauchgaskanäle.<br />
1 Die Möglichkeit, dass die lange<br />
Handhebel an Absetzwagen zu<br />
rückschnellen, bildet eine nicht zu<br />
unterschätzende Un fallgefahr.<br />
2 Das Handrad an Stelle des langen<br />
Handhebels beseitigt dieses Gefahren<br />
moment.<br />
3 Absturzgefahr: die Randlatten des<br />
hohen Trockengeste)les bieten keine<br />
Standsicherheit.<br />
4 Schmale und niedrige Ofentür~<br />
öffnungen erschweren das Ein<br />
setzen und Ausziehen.<br />
5 Umgebaute, genügend hohe un<br />
breite Ofent üröffnung.<br />
90<br />
1
Die Unfallkosten im Lagei<br />
und Versand sind zur einen Hälfte<br />
dem Sortieren, Stapeln und Verladen,<br />
zur an<strong>der</strong>n Hälfte dem<br />
Transport zuzuschreiben. Dort<br />
handelt es sich hauptsächlich um<br />
Verletzungen d u reh fallendes<br />
Ladegut und Stürze vom Fahrzeug,<br />
hier vor allem um Unfälle<br />
an Lastwagen: Quetschen <strong>der</strong><br />
Finger und Hände beim Öffnen<br />
o<strong>der</strong> Schliessen <strong>der</strong> Brückenladen<br />
und zum Teil schwere Verletzungen<br />
beim An- und Abkuppeln<br />
von Anhängern wegen<br />
Zusammenstössen o<strong>der</strong> ausbrechenden<br />
Deichseln.<br />
Unterstellen eines Bockes verhin<strong>der</strong>t<br />
das Schwanken des Auffahrtbrettes,<br />
besser jedoch sind feste<br />
Verla<strong>der</strong>ampen, niveaugleich mit<br />
<strong>der</strong> Ladefläche <strong>der</strong> Fahrzeuge.<br />
2 Selbst tätige Anhängerkupplungen<br />
mit Einstellvorrichtung für die<br />
Deichsel würden den Aufenthalt<br />
zwischen Fahrzeug und Anhänger<br />
erübrigen.<br />
3 -)-4 Gegen herabfallendes Ladegut<br />
einwandfrei gesicherte Führerstände<br />
von Gabelstaplern.<br />
5 Über dem Führersitz des Hubstaplers<br />
fehlt ein Schutzdach.<br />
91
Feinkeraınische Industrie<br />
Die Zufuhr des Rolınıareriııls spielt unfallmässig<br />
keine grosse Rolle. Die wenigen<br />
vorkommenden Unfälle treten vor allem<br />
beim Entladen <strong>der</strong> Eisenbahn- und Lastwagen<br />
auf.<br />
Bei den Transporten in <strong>der</strong> Fabrik ist rund<br />
ein Drittel <strong>der</strong> Unfallkosten auf ungenügend<br />
gesicherte Waren- und Personenaufzüge<br />
zurückzuführen. Etwas mehr als<br />
die Hälfte <strong>der</strong> Kosten wird jedoch durch<br />
Unfälle bei Transporten mit dcn verschiedenartigen<br />
Handfahrzeugen o<strong>der</strong> von blosser<br />
Hand verursacht. Unübersichtliche und<br />
hin<strong>der</strong>nisreiche Verkehrswege, das Fehlen<br />
von I-landschutzbügeln an den Karrengriffen<br />
sowie unrichtiges Anfassen, Aufheben<br />
und Verschieben <strong>der</strong> Lasten begünstigen<br />
Transportunfällc.<br />
l Mit Paletten lässt sich das aufbereitete<br />
Material bequem und<br />
sicher in den Maukkeller transportieren.<br />
2+3 Vierradhandwagen mit Pneubereifung,<br />
Stirn- und Seitenwänden<br />
sowie gut angeordneten Handgriffen<br />
eignen sich für die zu<br />
transportierenden Lasten.<br />
4 Ungenügende Lichtraumfreiheit<br />
und versperrte Wege erschweren<br />
die Transporte.<br />
92
In <strong>der</strong> Aufbereitung entfallen rund<br />
zwei Drittel <strong>der</strong> Unfallkosten auf die<br />
Kugelmühlen und Kollergänge. Unbefugtes<br />
Ingangsetzen <strong>der</strong> Aufbereitungsmaschinen<br />
während Reinigungsund<br />
Uberholungsarbeiten führt oft<br />
zu schweren Unfällen. Unverschalte<br />
o<strong>der</strong> ungenügend abgeschrankte Bereiche<br />
bewegter Maschinenteile sowie<br />
ungeeignete Werkzeuge vor allem<br />
zum Nachstossen des Materials sind<br />
bedeutende Unfallquellen. Die Unfälle<br />
in den Maukkellern verursachen<br />
etwa einen Fünftel <strong>der</strong> Unfallkosten<br />
und sind hauptsächlich eine Folge<br />
des Ausgleitens auf dem glitschigen<br />
Boden.<br />
1 Durch Vorlegestange abgeschrankter Trommelrotationsbereich einer<br />
Kugelmühle.<br />
2 Gut abgedeckte Stützrollen an einem Eirich-Mischer.<br />
3 Handverletzungen beim Nachstossen von Masse am Tonschnei<strong>der</strong> lassen<br />
sich bei Verwendung von geeigneten Spachteln o<strong>der</strong> Stösseln aus Holz<br />
vermeiden.<br />
4 Über <strong>der</strong> Einfüllöffnung des Knetmischers fehlt ein zwangsläufig auf die<br />
E - d A " k o acht g d Meech~eh<strong>der</strong> gchggßggg.<br />
93
Die Unfallkosten <strong>der</strong> Fon»gebung verteilen<br />
sich zu zwei Dritteln auf die verschiedenartigen<br />
Pressen und zu einem Drittel<br />
auf die Töpferdrehscheiben und übrigen<br />
Formarbeiten. Anlass zu oft schweren Finger-<br />
und Handverletzungen gibt das Einfüllen<br />
<strong>der</strong> Masse sowie das Reinigen <strong>der</strong><br />
Stempel und Formen an den laufenden<br />
Pressen. Verhältnismässig zahlreich sind<br />
die Fingerunfälle an <strong>der</strong> Töpferdrehscheibe,<br />
vor allem beim Aufsetzen <strong>der</strong> Formen und<br />
Einführen <strong>der</strong> Schablonen. Beim Giessen<br />
ereignen sich nicht selten Stürze auf dem<br />
durch Schlickermassen glitschig gewordenen<br />
Boden.<br />
Beim Trocknen und Bi.ennen verunfallen<br />
Arbeiter oft dadurch, dass sie beim Verschieben<br />
<strong>der</strong> Brennwagen angefahren und<br />
eingeklemmt o<strong>der</strong> beim Einsetzen und Ausziehen<br />
von herabfallendem Brenngut getroffen<br />
werden.<br />
1 Zwangsläufig gesteuerte Einwurfvorrichtung<br />
an halbautomatischer<br />
Blumentopfpresse vermin<strong>der</strong>t<br />
die Handverletzungsgefahr.<br />
2 )-3 Durch den automatisch bewegten<br />
Füllschieber einer Presse, <strong>der</strong><br />
beim Vorgehen in die Füllstellung<br />
gleichzeitig das gepresste Stück<br />
ausstösst, erübrigt sich das Hineinlangen<br />
mit den Händen in den<br />
Gefahrenbereich des Stempels.<br />
4 Seitliches Anfassen <strong>der</strong> Gipsmodelle<br />
am obern Rand vermin<strong>der</strong>t<br />
Fingerverletzungen beim<br />
Einsetzen <strong>der</strong> Formen an Töpferdrehscheiben.<br />
5-',-6<br />
Aufbau von Gross-Isolatoren:<br />
früher vom gefährlichen Standort<br />
einer Handhubwagenplattform<br />
aus, Fangvorrichtung und<br />
Umwehrung fehlen; heute durch<br />
den Einbau hydraulischer Absenkbühnen<br />
vom sicheren Boden<br />
aus.<br />
94
Bei <strong>der</strong> Fertigung verursachen<br />
das Schleifen und Polieren drei<br />
Fünftel, die übrigen Fertigungsarbeiten<br />
zwei Fünftel <strong>der</strong> Unfallkosten.<br />
Auffallend zahlreich sind<br />
beim Polieren die Schnittverletzungen<br />
durch berstende Werkstücke<br />
vor allem an Händen und<br />
Fingern. lns Gewicht fallen auch<br />
die zum Teil schweren Unfälle,<br />
die sich beim Hineingeraten in<br />
die laufenden Bearbeitungsmaschinen<br />
ereignen, sei es wegen<br />
Abgleitens <strong>der</strong> Werkstücke o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Hände.<br />
1 Schnittverletzungen infolge Berstens<br />
von Werkstücken werden<br />
durch vollautomatische Poliereinrichtungen<br />
vermieden.<br />
2 Das Bersten <strong>der</strong> Werkstücke beim<br />
Polieren kann zu schweren<br />
Schnittwunden an Fingern und<br />
Händen führen.<br />
3+4 Tischeben eingelassene Schleifscheiben<br />
und mechanische Zuführungsvorrichtungen<br />
verhin<strong>der</strong>n<br />
Verletzungen durch Abgleiten<br />
<strong>der</strong> Werkstücke o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Hände.<br />
95
Im Lager und beim Versand<br />
stehen Hand- und Fingerverletzungen<br />
im Vor<strong>der</strong>grund, die<br />
beson<strong>der</strong>s häufig beim Lagern,<br />
Sortieren und Verladen durch<br />
zerbrechende o<strong>der</strong> schadhafte<br />
Keramik sowie durch hervorstehende<br />
Nägel o<strong>der</strong> Holzspriessen<br />
an Kisten verursacht werden.<br />
I m weitern treten die beim Umgang<br />
mit Lastfahrzeugen üblichen<br />
Unfälle auf.<br />
1 Gute Ordnung im Fertiglager. Durch die Verwendung<br />
standsicherer Leitern sind auch hohe Lagergestelle sicher<br />
erreichbar.<br />
2 Mit geeigneten Transportmitteln können auch schwere<br />
Lasten bequem und sicher verladen werden.<br />
3 Die niveaugleich mit <strong>der</strong> Ladefläche <strong>der</strong> Fahrzeuge angeordneten<br />
Rammten erleichtern das Verladen.<br />
96
Alle diese Angaben über das Unfallgeschehen in <strong>der</strong> keramischen Industrie vermögen gewisse für die<br />
Unfallverhütung nützliche Hinweise zu geben. Das Schwergewicht <strong>der</strong> Unfälle liegt im allgemeinen in <strong>der</strong><br />
grobkeramischen Industrie bei <strong>der</strong> Gewinnung, <strong>der</strong> Zufuhr und <strong>der</strong> Aufbereitung <strong>der</strong> Rohstoffe sowie beim<br />
Formen und in <strong>der</strong> feinkeramischen Industrie bei <strong>der</strong> Aufbereitung und beim Fertigstellen. Insgesamt<br />
fallen die Transport- und Maschinenunfälle mit einem Kostenanteil von rund 70 Prozent ins Gewicht.<br />
Damit ist hauptsächlich darauf hingewiesen, wo das Eindämmen <strong>der</strong> Gefahrenquellen durch technische<br />
und organisatorische Massnahmen eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung hat. Es ist beabsichtigt, die wichtigsten<br />
Unfallverhütungsmassnahmen in den «Schweizerischen Blättern für Arbeitssicherheit» zu behandeln und<br />
damit die Bestrebungen <strong>der</strong> Betriebsinhaber zu unterstützen. Festzustellen bleibt, dass es in vielen Betrieben<br />
im Zusammenhange mit <strong>der</strong> Einführung wirtschaftlicherer Arbeitsmethoden auch gelungen ist,<br />
die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Es darf aber auch nicht verschwiegen werden, dass bei einer grossen Zahl<br />
von Betrieben die Unfallverhütung den möglichen und wünschbaren Stand noch nicht erreicht hat.<br />
Über die Nichtbetriebsunfälle<br />
Wie bereits erwähnt, sind die Ursachen <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle mangels vollständiger und zuverlässiger<br />
Unfallmeldungen vielfach nicht feststellbar, wohl aber die Betätigung, bei <strong>der</strong> sich <strong>der</strong> Unfall ereignete.<br />
Eine <strong>der</strong>art geglie<strong>der</strong>te <strong>Statistik</strong> vermag immerhin gewisse, den Bedürfnissen genügende Auskünfte<br />
über das Unfallgeschehen zu vermitteln. In diesem Sinne können die Nichtbetriebsunfälle unterteilt<br />
werden in<br />
Unfälle auf dem Weg zur und von <strong>der</strong> Arbeit<br />
Unfälle beim Aufenthalt zu Hause<br />
Unfälle bei Nebenbeschäftigungen<br />
Unfälle bei Sport, Reisen und an<strong>der</strong>n Vergnügen.<br />
Über die kostenmässige Bedeutung dieser Unfälle gibt die neueste im Jahre 1955 vorgenommene Erhebung<br />
Aufschluss, <strong>der</strong>en ausführliche Ergebnisse in <strong>der</strong> Anhangstabelle 6 zu finden sind. Dabei ist zu beachten,<br />
dass in den Unfallkosten die mit dem Versicherungsbetrieb verbundenen Unkosten nicht berücksichtigt<br />
sind.<br />
Kosten <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle 1955<br />
Männer<br />
Frauen<br />
U nfällc<br />
dem Weg zur und von <strong>der</strong> Arbeit.<br />
m Aufenthalt zu Hause<br />
Nebenbeschäftigungen.<br />
Sport, Reisen und an<strong>der</strong>n Vergnügen<br />
schied ene<br />
in / in /<br />
19<br />
12<br />
16<br />
50<br />
3<br />
1,6<br />
1,0<br />
1,4<br />
43<br />
0,2<br />
in "/„<strong>der</strong><br />
versicherten<br />
Lohn<br />
summe<br />
in %~ <strong>der</strong><br />
versicherten<br />
Lohnsumme<br />
29 1,9<br />
27 1,7<br />
4 0,3<br />
37 24<br />
3 ' 0,2<br />
100 100 6,5<br />
8,5<br />
Obschon es sich nur um ein Einzeljahr handelt, bestätigt das Ergebnis wie<strong>der</strong>um die bekannten Unterschiede<br />
im Nichtbetriebsunfallrisiko <strong>der</strong> männlichen und weiblichen Versicherten. Auffallend ist <strong>der</strong> verhältnismässig<br />
grosse Kostenanteil <strong>der</strong> Wegunfälle beim weiblichen Geschlecht. Die beiden Geschlechter<br />
unterscheiden sich in bezug auf die Bedeutung <strong>der</strong> Unfälle beim Aufenthalt zu Hause und <strong>der</strong> Unfälle bei<br />
Nebenbeschäftigungen deshalb so deutlich, weil die Männer viel häufiger als die Frauen Nebenbeschäftigungen<br />
ausserhalb des Hauses nachgehen. Am meisten ins Gewicht fallen beson<strong>der</strong>s bei den Männern<br />
die Unfälle, die sich bei Sport, Reisen und an<strong>der</strong>n Vergnügen ereignen.<br />
97
Die folgende Darstellung <strong>der</strong> Kosten <strong>der</strong> Nichtbetrlebsunfälle ]n Pronllllen <strong>der</strong> versicherten Lohn<br />
summe für mehrere Jahre veranschaulicht die verschiedene Bedeutung <strong>der</strong> betrachteten vier Gruppen von<br />
nfällen und innerhalb <strong>der</strong> Gruppen den Unterschied im Risiko <strong>der</strong> männlichen und weiblichen Versicherten.<br />
Darin kommen auch die zeitlichen Schwankungen des Unfallrisikos zum Ausdruck.<br />
Kosten <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle in Promillen <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme<br />
Frauen<br />
20/<br />
Q() /<br />
/uo<br />
Jahre 47 50 51 52 53 54 55<br />
47 50 51 52 53 54 55<br />
47 50 51 52 53 54 55<br />
47 50 51 52 53 54 55<br />
Bei den Unfällen auf dem kVeg zur und ~'on <strong>der</strong> Arbeit zeigt sich, dass das Wegunfallrisiko <strong>der</strong> weiblichen<br />
Versicherten etwas grösser ist als dasjenige <strong>der</strong> männlichen Versicherten; die Wegunfallhäufigkeit<br />
<strong>der</strong> Frauen beträgt sogar das an<strong>der</strong>thalbfache jener <strong>der</strong> Männer. Dieser Risikounterschied ist vor allem<br />
auf die häufigeren Stürze <strong>der</strong> Fussgängerinnen wegen Ausgleitens und Stolperns zurückzuführen.<br />
Unter den Unfällen beim Aufenthalt zu Hause sind die Unfälle, die sich bei eigentlichen Nebenbeschäftigungen<br />
ereignen, nicht berücksichtigt. Hingegen sind die mit den Haushaltarbeiten zusammenhängenden<br />
Unfälle in dieser Gruppe erfasst, was die grosse Bedeutung dieser Unfälle bei den Frauen hinlänglich<br />
erklärt. Im übrigen handelt es sich bei den Unfällen zu Hause vielfach um Stürze.<br />
Wie bereits erwähnt wurde, spielen die Unfälle bei /)/ebenbesc/(äfri(,un(;en für die männlichen Versicherten<br />
eine viel grössere Rolle als für die weiblichen, handelt es sich doch bei Garten-, Land- und Wald<br />
98
arbeiten, beim Holzsägen und -spalten, bei Unterhaltsarbeiten an Haus, Geräten und Fahrzeugen und so<br />
weiter vorwiegend um Männertätigkeiten.<br />
Auf Sport, Reisen und an<strong>der</strong>e Vergnügen ist bei den männlichen Versicherten rund die Hälfte aller<br />
Nichtbetriebsunfälle zurückzuführen. Dabei fallen einerseits die Ski-, Fussball- und Bergunfälle und an<strong>der</strong>seits<br />
die Verkehrsunfälle, beson<strong>der</strong>s jene <strong>der</strong> Radfahrer, ins Gewicht. Bei den weiblichen Versicherten<br />
steht hingegen nur rund ein Drittel sämtlicher Nichtbetriebsunfälle im Zusammenhang mit Sport, Reisen<br />
und an<strong>der</strong>n Vergnügen. Gegenüber den Männern spielen für sie erklärlicherweise die verschiedenen Sportunfälle,<br />
die Skiunfälle ausgenommen, eine viel geringere Rolle. Das Hauptgewicht liegt bei den Verkehrsunfällen<br />
sowie bei den zahlreichen Unfällen beim Ausgehen und Wan<strong>der</strong>n, wobei auch hier wie<strong>der</strong>um wie<br />
bei den Wegunfällen die Feststellung zu machen ist, dass die weiblichen Versicherten durch Stürze mehr<br />
gefährdet sind als die männlichen.<br />
Den Verkehrsunfällen kommt in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung eine grosse Bedeutung zu. Im<br />
Jahre 1955 mussten für rund 20000 Verkehrsunfälle Entschädigungen ausgerichtet werden. Dazu ist zu<br />
bemerken, dass das Motorradfahren als aussergewöhnliche Gefahr von <strong>der</strong> Versicherung ausgeschlossen<br />
war, nicht aber die Benützung eines Fahrrades mit Hilfsmotor. Der Anteil <strong>der</strong> Verkehrsunfälle an den<br />
Kosten <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle belief sich auf 38 Prozent. Er hätte sogar 43 Prozent betragen, wenn nicht<br />
das Rückgriffsrecht gegenüber den Schadenstiftern hätte geltend gemacht werden können. Wie folgende<br />
Angaben zeigen, sind die Verkehrsunfälle beson<strong>der</strong>s schwer.<br />
Prozentualer Anteil <strong>der</strong> Verkehrsunfälle an <strong>der</strong> Zahl und den Kosten<br />
<strong>der</strong> N ichtbetriebsunfälle<br />
Jahr<br />
Ordentliche<br />
U n fälle<br />
I nvaliditatsfälle<br />
Todesfal le<br />
U nfall kosten<br />
1947<br />
1950<br />
1953<br />
1955<br />
27<br />
31<br />
29<br />
30<br />
31<br />
37<br />
39<br />
42<br />
41<br />
55<br />
55<br />
54<br />
32<br />
37<br />
36<br />
38<br />
Jahr für Jahr fallen rund zwei Fünftel aller Invaliditätsfälle und mehr als die Hälfte aller Todesfälle zu<br />
Lasten des Verkehrs. Immerhin kann festgestellt werden, dass <strong>der</strong> in den Nachkriegsjahren angestiegene<br />
Anteil <strong>der</strong> Verkehrsunfälle an <strong>der</strong> Gesamtheit <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle trotz <strong>der</strong> stets zunehmenden Verkehrsdichte<br />
sich nicht mehr erhöht hat.<br />
Wie sich die Verkehrsunfälle auf die von den Verunfallten benützten Fahrzeuge und die Fussgänger<br />
verteilen, geht aus <strong>der</strong> nachfolgenden Übersicht hervor:<br />
Verkehrsunfälle 1955<br />
Ohne SBB und PTT<br />
Benützte Fahrzeuge, Fussganger<br />
Ordentliche Unfälle<br />
absolut<br />
in /<br />
U n fall kosten<br />
in /<br />
Fahrrad .<br />
Fahrrad mit Hilfsmotor .<br />
Motorwagen .<br />
Bahnen, Tram<br />
An<strong>der</strong>e Fahrzeuge.<br />
Angefahrene o<strong>der</strong> überfahrene Fussgänger<br />
T otal ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
14 096<br />
1 399<br />
1 657<br />
779<br />
210<br />
l 238<br />
19 379<br />
73<br />
7<br />
9<br />
4<br />
1<br />
6<br />
100<br />
57<br />
12<br />
15<br />
3<br />
l<br />
12<br />
10<br />
99
und drei Viertel <strong>der</strong> Verkehrsunfälle sind Radfahrerunfälle. Der grössere Teil <strong>der</strong> übrigen Verkehrsunfälle<br />
betrifft 1VIotorwagenfahrer (Lenker und Mitfahrer) und Mopedfahrer, die schwerer verunfallen<br />
als die Radfahrer, was aus den verhältnismässig grösseren Unfallkostenanteilen hervorgeht. Dasselbe gilt<br />
auch für die angefahrenen und überfahrenen Fussgänger. Im weitern hat die Erfahrung gezeigt, dass es sich<br />
bei nur rund einem Drittel <strong>der</strong> Verkehrsunfälle um Zusammenstösse zwischen den Verkehrsteilnehmern<br />
handelt, wobei bei fast <strong>der</strong> Hälfte <strong>der</strong> Fälle das Automobil mitbeteiligt ist.<br />
Obwohl die Zahl <strong>der</strong> versicherten Mopedfahrer nicht bekannt ist, kann doch im Hinblick darauf, dass<br />
beispielsweise im Jahre 1955 rund dreissigmal mehr Fahrrä<strong>der</strong> als Fahrrä<strong>der</strong> mit Hilfsmotor im Verkehr<br />
gestanden sind, aber nur etwa zehnmal mehr versicherte Radfahrer verunfallten, auf eine grössere Unfallhäufigkeit.<br />
für Mopedfahrer geschlossen werden. Die zeitliche Entwicklung von Zahl und Kosten <strong>der</strong><br />
Unfälle, die sich bei <strong>der</strong> Benützung von Fahrrä<strong>der</strong>n mit Hilfsmotor ereignet haben, ist aus folgen<strong>der</strong> Zusammenstellung<br />
ersichtlich.<br />
Unfälle mit Fahrrä<strong>der</strong>n mit Hilfsmotor 1951 — 1957<br />
Jahre<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Inval iditätsfälle<br />
U n fal l kos ten<br />
davon in /<br />
Todesfälle<br />
in Franken<br />
Koste<br />
Nichtbe<br />
unfä<br />
1951<br />
1952<br />
1953<br />
1954<br />
1955<br />
1956<br />
957<br />
431<br />
668<br />
741<br />
969<br />
1 466<br />
1 850<br />
2 400<br />
30<br />
22<br />
39<br />
40<br />
76<br />
103<br />
111<br />
3<br />
17<br />
14<br />
16<br />
26<br />
25<br />
39<br />
579 383<br />
1 133 264<br />
1 465 036<br />
1 531 943<br />
2 552 039<br />
3 082 303<br />
4 786 219<br />
1,<br />
2,<br />
2,<br />
2,<br />
4,<br />
4,<br />
6,<br />
Abschliessend sei noch darauf hingewiesen, dass <strong>der</strong> grössere Teil <strong>der</strong> Verkehrsunfälle, insbeson<strong>der</strong>e<br />
<strong>der</strong> Fahrrad- und Mopedunfälle, sich auf dem Weg zur und von <strong>der</strong> Arbeit ereignet. In den Jahren 1953<br />
bis 1955 hat <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Wegunfälle an den Verkehrsunfällen 55 Prozent betragen, und zwar 52 Prozent<br />
bei den männlichen Verunfallten und 66 Prozent bei den weiblichen. Der Kostenanteil hingegen betrug<br />
lediglich 42 Prozent beziehungsweise 40 Prozent bei den Männern und 60 Prozent bei den Frauen. Die<br />
Verkehrsunfälle, die sich bei Reisen und an<strong>der</strong>n Vergnügen ereignen, sind offenbar schwerer als die Verkehrsunfälle<br />
auf dem Arbeitswege. Diese Verhältnisse werden sich jedoch in Zukunft än<strong>der</strong>n, weil ab<br />
1. Januar 1960 Motorradunfälle auf dem Weg zur und von <strong>der</strong> Arbeit in die Versicherung <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle<br />
eingeschlossen sind.<br />
100
Berufskrankheiten<br />
Die Bedeutung <strong>der</strong> Berufskrankheiten<br />
Berufskrankheiten sind den Unfällen gleichgestellt, wenn sie durch Stoffe o<strong>der</strong> Arbeiten und unter<br />
Bedingungen verursacht werden, die in das gemäss Art. 68 K<strong>UVG</strong> aufgestellte Verzeichnis aufgenommen<br />
sind. Ausserdem werden nach einem Verwaltungsratsbeschluss für an<strong>der</strong>e berufliche Schädigungen freiwillig<br />
Versicherungsleistungen gewährt.<br />
Wie schon einleitend erwähnt wurde, sind in <strong>der</strong> Berichtsperiode verschiedene Bestimmungen über die<br />
Berufskrankheiten geän<strong>der</strong>t worden. Auf den 1.Januar 1953 wurde eine neue Verordnung über Berufskrankheiten<br />
in Kraft gesetzt, welche die früher in Art.47 <strong>der</strong> Verordnung I über die <strong>Unfallversicherung</strong><br />
enthaltene Liste aufhob und durch ein Verzeichnis ersetzte, das zahlreiche Stoffgruppen und Einzelstoffe<br />
neu enthält. Es erwies sich als angezeigt, eine Reihe von chemisch verwandten Stoffen in Gruppen zusammenzufassen<br />
und einige bestehende Stoffgruppen neu zu umschreiben. Im ganzen wurden 21 Stoffgruppen<br />
und 23 Einzelstoffe neu in das Verzeichnis aufgenommen. Von diesen sind Zement, gelöschter<br />
Kalk, radioaktive Substanzen und durch korpuskulare Strahlungen erzeugte Sekundärstrahlungen beson<strong>der</strong>s<br />
erwähnenswert. Im weitern wurde auf den 1. Mai 1956 das Verzeichnis <strong>der</strong> gesundheitsschädigenden<br />
Stoffe durch eine Liste von 11 akuten beruflichen Erkrankungen ergänzt. Von den unter gewissen Voraussetzungen<br />
den Berufskrankheiten gleichgestellten akuten beruflichen Erkrankungen sind die Sehnenscheidenentzündungen<br />
(Paratenonitis crepitans), Hautblasen, -risse, -schrunden, -schürfungen und<br />
-schwielen sowie Hitzschläge von beson<strong>der</strong>er Bedeutung. Durch diese beiden Neuordnungen von 1953<br />
und 1956 tritt an Stelle <strong>der</strong> gemäss Verwaltungsratsbeschluss vom Oktober 1918 für gewisse Berufskrankheiten<br />
vorgesehenen freiwilligen Ausrichtung von Entschädigungen ein Rechtsanspruch auf Versicherungsleistungen.<br />
Weil nach wie vor Lücken in <strong>der</strong> Entschädigungspraxis bestanden, entschloss sich <strong>der</strong><br />
Verwaltungsrat, mit Wirkung ab 1. Mai 1956 eine Generalklausel für die Ausrichtung von Versicherungsleistungen<br />
bei sämtlichen eindeutig beruflichen Schädigungen einzuführen.<br />
In <strong>der</strong> Berichtsperiode wurden beson<strong>der</strong>e Erhebungen über die Berufskrankheiten in den Jahren 1953,<br />
1954 und 1957 durchgeführt. Dabei bleiben aus rein administrativen Gründen die von den SBB und <strong>der</strong><br />
PTT gemeldeten Fälle unberücksichtigt.<br />
Berufskrankheiten<br />
Jahre<br />
Bagatel l<br />
fälle<br />
Hei 1 kosten<br />
und<br />
Krankengeld<br />
ordentliche<br />
Fälle<br />
Zahl <strong>der</strong> Fälle<br />
Total<br />
davon<br />
I nvaliditätsfälle<br />
'<br />
Todesfälle<br />
Kosten in Franken<br />
Ka pi tal wert<br />
<strong>der</strong> Renten<br />
Total<br />
1953<br />
1954<br />
1957<br />
287<br />
326<br />
416<br />
3 490<br />
3 676<br />
4 287<br />
3 777<br />
4 002<br />
4 703<br />
100 (46)<br />
111 (52)<br />
134 (46)<br />
77<br />
72<br />
82<br />
4 879 312 4 697 413 9 576 725<br />
4 669 211 4 706 043 9 375 254<br />
5 677 737 5 483 680 11 161 417<br />
' Vermin<strong>der</strong>t um die in Klammern beigefügte Zahl <strong>der</strong> an einer Berufskrankheit gestorbenen Invalidenrentner.<br />
Die Zahl <strong>der</strong> Berufskrankheiten hat im gleichen Masse wie <strong>der</strong> Versichertenbestand zugenommen. Dies<br />
geht aus <strong>der</strong> folgenden Zusammenstellung hervor, welche die Bedeutung <strong>der</strong> Berufskrankheiten im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung und die zeitliche Entwicklung <strong>der</strong> Risikoverhältnisse aufzeigt.<br />
101
Bedeutung <strong>der</strong> Berufskrankheiten<br />
Zahl <strong>der</strong> ordcntlichcn Falle<br />
Kosten<br />
Jahre<br />
in Prozenten <strong>der</strong><br />
ordentlichen<br />
U n falle<br />
auf 10000<br />
Versicherte<br />
in Prozenten <strong>der</strong><br />
U nfall kosten<br />
in Promillcn <strong>der</strong><br />
versicherten<br />
Lohnsummc<br />
1941<br />
1945<br />
1951<br />
1952<br />
2,7<br />
2,9<br />
3,2<br />
3,0<br />
36<br />
44<br />
37<br />
35<br />
4,8<br />
5,9<br />
8,1<br />
8,1<br />
0,8<br />
1,2<br />
1,4<br />
1,4<br />
1953<br />
1954<br />
1957<br />
3,2<br />
3,3<br />
3,3<br />
35<br />
36<br />
36<br />
9,4<br />
9,0<br />
8,6<br />
1,6<br />
1,5<br />
1,3<br />
Während die Häufigkeit <strong>der</strong> Berufskrankheiten im Laufe <strong>der</strong> Zeit nur unbedeutend geän<strong>der</strong>t hat, haben<br />
die Kosten beachtlich zugenommen. Diese betrugen in <strong>der</strong> Berichtsperiode rund 9 Prozent <strong>der</strong> gesamten<br />
Aufwendungen in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung. Die Berufskrankheiten fallen im Bestande <strong>der</strong> Betriebsunfälle<br />
kostenmässig stärker ins Gewicht als anzahlmässig. Sie sind demnach im Mittel kostspieliger als<br />
die eigentlichen Betriebsunfälle.<br />
Wie sich die hohen Kosten <strong>der</strong> Berufskrankheiten auf die beiden Übernahmearten und die Schädigungsarten<br />
verteilen, ist den folgenden Angaben zu entnehmen:<br />
Berufskrankheiten nach Übernahme- und Schädigungsarten<br />
In Prozenten<br />
Schadigungsarten<br />
Zahl <strong>der</strong> ordentlichen F'ille<br />
Kosten<br />
1952 1953 1957 1952 1953 1957<br />
Gesetzliche Übernahme<br />
1. Chronische Vergiftungen ~<br />
2. Hautkrankheiten.<br />
3. Staublungen.<br />
4. Ü brige Arbei tsschäd igungen<br />
7,0<br />
14,8<br />
7,3<br />
6,9<br />
35,2<br />
7,2<br />
5,0<br />
35,8<br />
6,0<br />
26,1<br />
10,0<br />
5,3<br />
68,5<br />
9,7<br />
12,2<br />
70,2<br />
8,4<br />
15,1<br />
66,3<br />
3,9<br />
Freiwillige Ü bernahme<br />
1. Chronische Vergiftungen<br />
2. Hautkrankheiten.<br />
3. Staublungen.<br />
4. Übrige Arbeitsschädigungen.<br />
29,1 49,3 72,9 83,8 92,1 93,7<br />
2,5<br />
34,8<br />
0,4<br />
33,2<br />
1,8<br />
15,7<br />
0,1<br />
33,1<br />
1,1<br />
18,2<br />
0,1<br />
7,7<br />
1,4<br />
10,6<br />
0,5<br />
3,7<br />
0,6<br />
3,7<br />
0,5<br />
3,1<br />
0,2<br />
3,8<br />
0,2<br />
2,1<br />
70,9 50,7 27,1 16,2 7,9 6,3<br />
Total Berufskrankheiten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Als Folge <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Berichtsperiode in Kraft getretenen Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Bestimmungen über die<br />
Berufskrankheiten hat sich das Verhältnis <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> nach den beiden Übernahmearten anerkannten<br />
Fälle umgekehrt. Die Verlagerung von den freiwillig zu den gesetzlich übernommenen Fällen ist bei den<br />
Hautkrankheiten vor allem auf die Zementekzeme, von denen allein 1001 Fälle im Jahre 1957 übernommen<br />
wurden, und bei den übrigen Arbeitsschädigungen hauptsächlich auf die sehr zahlreichen<br />
Sehnenscheidenentzündungen zurückzuführen. Die Kosten <strong>der</strong> gesetzlich übernommenen Berufskrankheiten<br />
überwiegen dadurch noch mehr. Sie sind im Mittel auch höher als diejenigen <strong>der</strong> freiwillig über<br />
102
nommenen Fälle. Dies ist vor allem den kostenmässig schwer ins Gewicht fallenden Staublungen zuzuschreiben.<br />
Auf die Staublungen, bei denen es sich fast ausschliesslich um Silikosen handelt, entfielen zwei Drittel<br />
<strong>der</strong> Kosten für alle Berufskrankheiten; dies waren im Jahre 1957 rund 7,4 Millionen Franken. Mehr als<br />
5 Prozent <strong>der</strong> Gesamtkosten <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung werden demnach durch diese eine Krankheit<br />
verursacht. Wenn zudem beachtet wird, dass nur in einigen wenigen Industrie- und Gewerbezweigen eine<br />
Silikosegefahr besteht, so erscheint die überragende Bedeutung <strong>der</strong> Silikose noch eindrücklicher. Aus <strong>der</strong><br />
verhältnismässig geringen Zahl <strong>der</strong> Silikosefälle ergibt sich auch, dass die Silikosen zu den schwersten und<br />
kostspieligsten Berufskrankheiten zählen; ihre Durchschnittskosten je Fall sind gegenwärtig rund 30mal<br />
höher als bei den übrigen ordentlichen Unfällen. Im nächsten Abschnitt wird über diese Berufskrankheit<br />
eingehen<strong>der</strong> berichtet und auch dargelegt, welche Bedeutung ihr in einzelnen Gefahrenklassen zukommt.<br />
Ohne die Staublungen würden die Versicherungsleistungen für Berufskrankheiten nur noch rund<br />
3 Prozent <strong>der</strong> Unfallkosten betragen und im Rahmen <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung also nicht beson<strong>der</strong>s<br />
schwerwiegend sein. In einigen Industrie- und Gewerbezweigen häufen sie sich jedoch. Die nachfolgende<br />
Übersicht zeigt, welche Bedeutung den Berufskrankheiten ohne die Staublungen in gewissen Industrieund<br />
Gewerbezweigen zukommt, wobei zu beachten ist, dass es sich um Ergebnisse handelt, die wegen <strong>der</strong><br />
kurzen Beobachtungsdauer zufallsbedingt sein können.<br />
Berufskrankheiten ' ohne die Staublungen in einigen Industrie- und Gewerbezweigen<br />
Gcfahrcngruppcn<br />
gcm;iss PI;imicntarif<br />
Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Frille<br />
in Prozenten <strong>der</strong> ordentlichen Unfallc<br />
chronischc<br />
Vcrgiftungcn<br />
Hautkrankheiten<br />
Hautkrankheiten<br />
chronische<br />
Vergiftungen<br />
Kosten<br />
in Prozenten <strong>der</strong> Unfallkostcn<br />
übrige<br />
Arbcitsschadigungcn<br />
übrige<br />
Arbeitsschädigungen<br />
Grobkeramik .<br />
Feinkeramik<br />
Giessereien .<br />
Elekt rot her m ische Produkte<br />
Fein- und K lein mechan i k<br />
Uhrenindustrie .<br />
Gerberei .<br />
Schuhfabrikation<br />
Graphische Gewerbe.<br />
Chemische Industrie .<br />
Explosi vsto ffe<br />
Gewinnung und Verarbeitung<br />
von Gestein<br />
und Mineralien.<br />
Hochbauunternehmung<br />
en<br />
0,0<br />
1,1<br />
0,4<br />
1,7<br />
0,4<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,1<br />
0,6<br />
1,5<br />
2,6<br />
0,5<br />
0,5<br />
0,5<br />
2,1<br />
3,1<br />
4,9<br />
5,2<br />
3,8<br />
4,3<br />
5,8<br />
4,4<br />
0,1 0,4<br />
0,1 2,5<br />
1,7<br />
1,4<br />
0,7<br />
0,7<br />
1,1<br />
0,7<br />
0,8<br />
3,2<br />
0,9<br />
1,2<br />
0,4<br />
1,6<br />
0,0<br />
1,5<br />
0,5<br />
16,3<br />
2,4<br />
4,1<br />
0,3<br />
0,0<br />
2,5<br />
13,6<br />
5,9<br />
0,0<br />
0,1<br />
0,6<br />
0,7<br />
0,6<br />
1,2<br />
3,6<br />
4,1<br />
3,4<br />
3,0<br />
6,1<br />
4,2<br />
1,6<br />
0,2<br />
0,4<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,3<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
1,9<br />
0,4<br />
0,4<br />
0,0<br />
0,2<br />
3,2 0,6<br />
' Auf Grund von Beobachtungen aus den Jahren 1953, 1954 und 1957.<br />
Die grösste Bedeutung haben die Berufskrankheiten ohne die Staublungen in <strong>der</strong> chemischen Industrie<br />
und <strong>der</strong> elektrothermischen Produktion, wo ihre Kosten rund 18 Prozent <strong>der</strong> Unfallkosten ausmachen.<br />
Als beson<strong>der</strong>s schwer erweisen sich dabei die chronischen Vergiftungen, die in <strong>der</strong> chemischen<br />
Industrie überwiegend durch Schwefelkohlenstoff, aromatische Amine und Säuredämpfe und in <strong>der</strong> elektrothermischen<br />
Produktion durch Quecksilber und seine Verbindungen verursacht werden. Bedeutungsvoll<br />
sind die beruflichen Schädigungen mit rund 9 Prozent <strong>der</strong> Unfallkosten auch im graphischen Gewerbe,<br />
in <strong>der</strong> Uhrenindustrie und bei den Betrieben <strong>der</strong> Fein- und Kleinmechanik. In diesen Industrie- und Gewerbezweigen<br />
spielen die Hautkrankheiten die Hauptrolle; sie werden hauptsächlich durch Lösungs<br />
103
mittel verursacht, im graphischen Gewerbe vor allem durch Terpentin und Terpentinersatz und in den<br />
feinmechanischen Betrieben durch halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe.<br />
Eingehenden Aufschluss darüber, wie sich die Berufskrankheiten und <strong>der</strong>en Kosten aufdie verursachenden<br />
Stoffe aufteilen, vermitteln die Tabellen 7a und 7b im Anhang. Der leichten Vergleichbarkeit und<br />
Übersichtlichkeit wegen wurden dabei die gesundheitsschädigenden Stoffe in einigen Fällen in Gruppen<br />
zusammengefasst. Beim Vergleich <strong>der</strong> Jahresergebnisse miteinan<strong>der</strong> ist ausser den Verschiebungen von<br />
den freiwilligen zu den gesetzlichen Entschädigungen infolge <strong>der</strong> Revisionen <strong>der</strong> Bestimmungen über die<br />
Berufskrankheiten zu berücksichtigen, dass es sich um weitgehend zufallsbedingte Ergebnisse aus Einzeljahren<br />
handelt. Ferner ist bei einem Vergleich mit Aufstellungen aus früheren Jahren zu beachten, dass<br />
vor 1953 in den Berichten über die Ergebnisse <strong>der</strong> Unfallstatistik die Zahl <strong>der</strong> Bagatellfälle nicht veröffentlicht<br />
wurde.<br />
Die Silikose<br />
Die durch das Einatmen von quarzhaltigem Staub entstehende Erkrankung <strong>der</strong> Lunge bildet nicht nur<br />
medizinisch und verhütungstechnisch, son<strong>der</strong>n auch statistisch ein beson<strong>der</strong>es Problem. An dieser Stelle<br />
sollen die Schwierigkeiten auf statistischem Gebiet dargelegt werden, einmal um die Zahl <strong>der</strong> Silikosefälle<br />
richtig deuten zu können, dann aber auch um zu zeigen, dass <strong>der</strong> Versicherer hinsichtlich <strong>der</strong> Silikosekosten<br />
zu beson<strong>der</strong>en Massnahmen gezwungen wird.<br />
Der Silikosefall gelangt oft erst lange Zeit nach dem Beginn <strong>der</strong> schädigenden Einwirkung von Quarzstaub<br />
zur Anmeldung. Oft war <strong>der</strong> Erkrankte zudem in mehreren Betrieben mit unterschiedlicher Silikosegefahr<br />
tätig, die sogar verschiedenen Gefahrenklassen angehören können. Dadurch wird die Zuteilung <strong>der</strong><br />
Silikosefälle zu den Betrieben erschwert. Früher wurde ein Silikosefall demjenigen Betriebe statistisch zugeteilt,<br />
in dem <strong>der</strong> Erkrankte zuletzt silikosegefährdet war. Seit Beginn <strong>der</strong> Berichtsperiode erfolgt die<br />
Zuteilung nicht mehr zum einzelnen Betriebe, son<strong>der</strong>n zu <strong>der</strong>jenigen Gefahrenklasse, welcher <strong>der</strong> Betrieb<br />
mit <strong>der</strong> für den Versicherten überwiegenden Silikosegefährdung angehört. Die Einführung dieser Praxis<br />
war nicht nur im Hinblick auf die bestehenden Zuteilungsschwierigkeiten naheliegend, son<strong>der</strong>n auch, weil<br />
es auf Grund <strong>der</strong> Erfahrungen von vielen Beteiligten als zweckmässig erachtet wurde, die grossen Kosten<br />
<strong>der</strong> Silikosefälle durch Risikogemeinschaften solidarisch tragen zu lassen. Nicht alle Prämienzahler<br />
jedoch teilen diese Auffassung. Zur Zeit wird deshalb eingehend abgeklärt, ob bei jenen Industrien, bei<br />
denen die Möglichkeit einer eindeutigen Zuteilung des Grossteils <strong>der</strong> Silikosefälle zu den Betrieben gegeben<br />
ist, die bestehende Zuteilungspraxis verlassen werden soll.<br />
Der gesetzlichen Verpflichtung zum Kapitaldeckungsverfahren, wonach für die eingetretenen versicherten<br />
Ereignisse die erwartungsmässig anfallenden Ausgaben zu decken sind, kann bei den Silikosefällen<br />
nur durch die Schätzung von Schadenreserven nachgekommen werden, und zwar ist dies auch notwendig<br />
für Fälle, die dem Versicherer noch gar nicht bekannt sind. Die Bestimmung <strong>der</strong> mutmasslichen<br />
Versicherungsleistungen ist daher nicht einfach. Selbst die Schätzung <strong>der</strong> künftigen Kosten <strong>der</strong> angemeldeten<br />
Silikosefälle ist schwierig. Bei <strong>der</strong> Silikose handelt es sich in <strong>der</strong> Regel um einen fortschreitenden<br />
Krankheitsprozess; im Anfangsstadium sind vielfach keine Versicherungsleistungen erfor<strong>der</strong>lich, dann<br />
wechseln während mehrerer Jahre Arbeitsfähigkeit und -unfähigkeit ab, bis später die endgültige Invalidierung<br />
und schliesslich in vielen Fällen <strong>der</strong> Tod als Folge <strong>der</strong> Krankheit eintritt ~ Auch heute noch erlauben<br />
es die Erfahrungen nicht, zuverlässige Durchschnittskostenwerte zu bilden. Der Verlauf <strong>der</strong> Silikoseinvalidenrenten<br />
ist wesentlich an<strong>der</strong>s als <strong>der</strong>jenige <strong>der</strong> Unfallinvalidenrenten, weil einerseits die Reaktivierung<br />
wegfällt und an<strong>der</strong>seits die Sterblichkeit sehr gross ist. Da nach den bisherigen Erfahrungen den<br />
meisten Invalidenrenten eine Hinterlassenenrente nachfolgte, hätte <strong>der</strong> Rentenbarwert auch diesem Umstande<br />
Rechnung zu tragen. Erschwerend ist im weitern die Tatsache, dass von <strong>der</strong> Silikose betroffeneVersicherte<br />
sich vor <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong> prophylaktischen Tauglichkeitsuntersuchungen meistens erst dann<br />
meldeten, als ihre Erwerbsfähigkeit bereits erheblich beeinträchtigt war; heute wird die Krankheit dagegen<br />
in zahlreichen Fällen entdeckt, bevor <strong>der</strong> Versicherte Beschwerden verspürt. Dies hat zur Folge,<br />
dass die Renten von Silikoseinvaliden im allgemeinen bei geringerer Erwerbsunfähigkeit festgesetzt und<br />
104
demzufolge bis zur allfälligen Vollinvalidität bedeutend mehr erhöht werden müssen als früher; auf Grund<br />
<strong>der</strong> bisherigen Erfahrungen darf allerdings vermutet werden, dass bei Wegfall weiterer Staubgefährdung<br />
die Verschlimmerung <strong>der</strong> Krankheit in manchen Fällen langsamer fortschreitet. Der Rentenablauf bei<br />
Silikosefällen wird deshalb merkliche Än<strong>der</strong>ungen erfahren, wodurch die Schätzung <strong>der</strong> Silikosekosten<br />
erheblich erschwert wird.<br />
Fest steht, dass die Aufwendungen für Silikosefälle auch in <strong>der</strong> Berichtsperiode erneut ganz bedeutend<br />
angestiegen sind.<br />
Silikosefälle 1930 — 1957<br />
Jahre<br />
<strong>der</strong><br />
Anerkennung<br />
1930<br />
1933 â€<br />
â€<br />
19<br />
19<br />
1938<br />
1943<br />
â€<br />
â€<br />
19<br />
1948 â€<br />
19<br />
1953 †19<br />
19<br />
1930 †19<br />
Total<br />
26<br />
Zahl <strong>der</strong> Fälle<br />
I nvaliditätsfälle<br />
'<br />
Todesfälle<br />
6<br />
42<br />
in Franken<br />
411 670<br />
1 295 781<br />
4 735 203<br />
11 935 119<br />
23 477 265<br />
35 257 841<br />
Kosten '<br />
in Prozenten<br />
<strong>der</strong><br />
U n fal I kosten<br />
0,2<br />
0,9<br />
2,5<br />
3,5<br />
5,2<br />
6,0<br />
( — )<br />
128 35 (12)<br />
395 116 (49) 129<br />
1 281<br />
1 128<br />
1 284<br />
207 (135)<br />
386 (196)<br />
387 (250)<br />
240<br />
316<br />
365<br />
4 242 1 140 (642) 1 098 77 112 879 4,0<br />
' Vermin<strong>der</strong>t um die Zahl <strong>der</strong> an Silikose gestorbenen Invaliden, die in Klammern angegeben ist.<br />
-' Einschliesslich Übergangsentschädigungen und Kosten <strong>der</strong> prophylaktischen Untersuchungen.<br />
Die Vermehrung <strong>der</strong> Silikosefälle ist einmal den zahlreichen vor und während den Kriegsjahren ausgeführten<br />
Befestigungsbauten zuzuschreiben; ferner sind in starkem Masse mitbeteiligt: die kriegsbedingte<br />
Ausbeutung von Kohlenvorkommen, <strong>der</strong> durch die Hochkonjunktur auch in den Steinbrüchen<br />
und in den Eisen- und Stahlgiessereien gesteigerte Arbeitsanfall und schliesslich <strong>der</strong> in neuerer Zeit stets<br />
grösseren Umfang annehmende Bau von Kraftwerken.<br />
Einen gewissen Auftrieb hat die Zahl <strong>der</strong> registrierten Silikosefälle im weitern dadurch erfahren, dass<br />
durch Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes aus dem Jahre 1945 ' auch jene Silikosefälle<br />
entschädigungspflichtig erklärt wurden, bei denen die Einwirkung des Quarzstaubes vor dem 1. Mai 1938<br />
(Aufnahme des Quarzes in das Verzeichnis gemäss Art.68 K<strong>UVG</strong>) erfolgte und die Krankheit erst nach<br />
diesem Zeitpunkt zum Ausbruch kam. Dazu kommt die Auswirkung des Bundesratsbeschlusses vom<br />
4. Dezember 1944, mit welchem die Tauglichkeitsuntersuchungen für alle Arbeiter, die im Tunnel-,<br />
Stollen- und Bergbau <strong>der</strong> Einwirkung von Quarzstaub ausgesetzt sind, obligatorisch erklärt wurden. Die<br />
Zahl <strong>der</strong> erkannten und gemeldeten Silikosefälle ist im Anschluss an die Einführung dieser Tauglichkeitsuntersuchungen<br />
in den ersten Nachkriegsjahren stark angestiegen. Schliesslich ist am 15. September 1948<br />
die neue Verordnung über Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung <strong>der</strong> Quarzstaublunge in Kraft<br />
getreten, die sich auf die Artikel 65 und 65 " ' des K<strong>UVG</strong> stützt und den auf Vollmachtenrecht beruhenden<br />
Bundesratsbeschluss vom 4. Dezember 1944 ablöst und erweitert. Die neue Verordnung betrifft nicht<br />
mehr allein den Tunnel-, Stollen- und Bergbau, son<strong>der</strong>n erstreckt sich auf alle <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong><br />
unterstellten Betriebe, in denen mit dem Auftreten <strong>der</strong> Silikose gerechnet werden muss; sodann<br />
räumt sie den Versicherten, die lediglich aus prophylaktischen Gründen von <strong>der</strong> sie gefährdenden<br />
Arbeit im Quarzstaub ausgeschlossen werden müssen und keine ordentlichen Versicherungsleistungen<br />
~ ~<br />
gemäss Gesetz erhalten, unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ausrichtung einer Ubergangsentschädigung<br />
ein. Zufolge dieser prophylaktischen Untersuchungen wurde eine bedeutende Zahl von<br />
Silikosen festgestellt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über durchgeführte Tauglichkeitsuntersuchungen<br />
und ihre Befunde.<br />
' Jahresbericht 1945, Seite 16.<br />
- "Neuer Artikel gemäss Gesetzesrevision vom 17. Dezember 1947.<br />
105
Ergebnisse <strong>der</strong> Tauglichkeitsuntersuchungen seit 1948<br />
Befunde<br />
Fcstgcstclltc Silikosen<br />
Jahre<br />
tauglich<br />
u n tau g I ich<br />
Total<br />
in <strong>der</strong><br />
Schv eiz<br />
erworben<br />
im<br />
Ausland<br />
erworben<br />
Total<br />
1948 '<br />
1949<br />
1950<br />
1951<br />
1952<br />
1953<br />
1954<br />
1955<br />
1956<br />
1957 5 131<br />
88<br />
185<br />
1948 †40 243 2 036 42 279 801 1 316<br />
' Ab 15.September 1948.<br />
364<br />
2 019<br />
2 116<br />
3 409<br />
6 034<br />
6 200<br />
5 769<br />
4 819<br />
4 382<br />
40<br />
166<br />
120<br />
208<br />
321<br />
316<br />
199<br />
188<br />
206<br />
272<br />
404<br />
2 185<br />
2 236<br />
3 617<br />
6 355<br />
6 516<br />
5 968<br />
5 007<br />
4 588<br />
5 403<br />
Von den bei Tauglichkeitsuntersuchungen festgestellten und in <strong>der</strong> Schweiz erworbenen 801 Silikosen<br />
sind bis jetzt 268 als Versicherungsfälle registriert worden. Bis Ende 1957 wurden in 86 Fällen Invalidenrenten<br />
und in 17 Fällen Hinterlassenenrenten ausgerichtet, während in 34 Fällen nur Heilkosten und<br />
Krankengeld auszubezahlen waren. Seit dem Inkrafttreten <strong>der</strong> Verordnung am 15. September 1948 haben<br />
l67 Versicherte insgesamt 564268 Franken an Übergangsentschädigungen erhalten. Die Aufwendungen<br />
für die Tauglichkeitsuntersuchungen in den Jahren 1948 — 1957 beliefen sich auf 1864313 Franken.<br />
Aber nur <strong>der</strong> kleinere Teil <strong>der</strong> jährlich registrierten Silikosefälle wird durch die Tauglichkeitsuntersuchungen<br />
entdeckt. Viele <strong>der</strong> an Silikose Erkrankten sind im Zeitpunkt <strong>der</strong> Anmeldung <strong>der</strong> Silikose nicht<br />
mehr in Betrieben mit einer Silikosegefahr tätig und werden daher nicht mehr von <strong>der</strong> Tauglichkeitsuntersuchung<br />
erfasst. Von den im Jahre 1957 neu registrierten Silikosefällen wurde nur ein Viertel durch Tauglichkeitsuntersuchungen<br />
festgestellt.<br />
Aus diesen Darlegungen geht hervor, dass die Silikosekosten künftig auch dann sehr hohe Werte<br />
erreichen werden, wenn dank den technischen und medizinischen Schutzmassnahmen ein Rückgang <strong>der</strong><br />
Neumeldungen eintreten sollte. Diese Feststellung wird durch folgende Angaben bestätigt:<br />
39<br />
86<br />
58<br />
78<br />
118<br />
107<br />
79<br />
66<br />
73<br />
97<br />
29<br />
2<br />
1<br />
59<br />
91<br />
86<br />
46<br />
47<br />
66<br />
515<br />
68<br />
88<br />
59<br />
137<br />
209<br />
193<br />
125<br />
113<br />
139<br />
Jahr<br />
1943<br />
1944<br />
1945<br />
1946<br />
1947<br />
1948<br />
1949<br />
1950<br />
1951<br />
1952<br />
1953<br />
1954<br />
1955<br />
1956<br />
1957<br />
Si I i kose fa I le<br />
142<br />
202<br />
363<br />
307<br />
267<br />
185<br />
221<br />
250<br />
237<br />
235<br />
250<br />
258<br />
234<br />
286<br />
256<br />
Kosten<br />
in M i I I ionen Franken<br />
1,5<br />
1,4<br />
2,7<br />
3,2<br />
3,1<br />
3,9<br />
4,6<br />
4,5<br />
5,2<br />
5,3<br />
6,6<br />
6,5<br />
6,7<br />
8,1<br />
7,4<br />
106
Ein zeitliches Nachhinken <strong>der</strong> Silikosekosten gegenüber <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Zahl neu registrierter<br />
Silikosefälle ist klar ersichtlich. ln welcher Art diese erst nach und nach zu Leistungen führen und wie das<br />
verspätete Nachfolgen <strong>der</strong> Silikosekosten verursacht wird, geht aus <strong>der</strong> folgenden Übersicht hervor.<br />
Silikosefälle nach Anmeldejahren und nach Art <strong>der</strong> Versicherungsleistungen Ende 1957<br />
davon sind<br />
Ja.hrc <strong>der</strong><br />
Anmeldung<br />
Zahl<br />
<strong>der</strong> Fälle<br />
1930 26<br />
1933 1938 1943 1948 1953 †19<br />
1930 †19 4 242<br />
130<br />
454<br />
1 329<br />
1 076<br />
1 227<br />
ohne<br />
Versicherungsleistungen<br />
1<br />
9<br />
61<br />
484<br />
351<br />
526<br />
mit<br />
Heil kosten mit<br />
und I nvaliden<br />
Kranken- renten<br />
geld<br />
l<br />
2<br />
21<br />
108<br />
108<br />
265<br />
2<br />
9<br />
82<br />
315<br />
319<br />
324<br />
mit<br />
Hinter- auslassenen-<br />
geschieden'<br />
renten<br />
22<br />
99<br />
271<br />
373<br />
243<br />
90<br />
11<br />
19<br />
49<br />
55<br />
22<br />
1 432 505 1 051 1 098 156<br />
' Todesfälle, die nicht durch die Silikose verursacht wurden.<br />
Von den bis Ende 1957 gezählten 4242 an Silikose erkrankten Versicherten starben 1098 an <strong>der</strong> Silikose.<br />
In 1782 Fällen mussten Invalidenrenten zugesprochen werden, wobei bis zum Ende <strong>der</strong> Berichtsperiode<br />
642 an <strong>der</strong> Silikose und 89 aus an<strong>der</strong>n Gründen starben, so dass in diesem Zeitpunkt noch 1051 Invalidenrenten<br />
auszurichten waren. Etwas mehr als ein Viertel <strong>der</strong> an Silikose erkrankten Versicherten ist also an<br />
dieser Krankheit gestorben und ein weiterer Viertel bezog Ende 1957 eine Invalidenrente; für einen Achtel<br />
<strong>der</strong> an Quarzstaublunge Erkrankten waren nur Heilkosten und Krankengeld zu zahlen, und für einen<br />
Drittel mussten bis jetzt noch keine Versicherungsleistungen ausgerichtet werden.<br />
Es muss lei<strong>der</strong> damit gerechnet werden, dass bei einem bedeutenden Teil <strong>der</strong> laufenden 1051 Invalidenrenten<br />
und bei einer nicht unerheblichen Zahl <strong>der</strong> übrigen 1937 Silikosefälle früher o<strong>der</strong> später ebenfalls<br />
Hinterlassenenrenten nachfolgen werden. Diese Feststellung wird eindrücklich erhärtet durch die auf<br />
<strong>der</strong> folgenden Seite dargestellte Verteilung <strong>der</strong> Silikosefälle nach den bisherigen Krankheitsfolgen.<br />
Während von den in <strong>der</strong> ersten Beobachtungsperiode registrierten Silikosefällen bereits rund 80 Prozent<br />
zur Zusprechung von Hinterlassenenrenten geführt haben, mussten bei den in den Jahren 1943 — 1947<br />
registrierten Silikosefällen bisher rund 30 Prozent und bei jenen aus neuester Zeit weniger als 10 Prozent<br />
Hinterlassenenrenten festgesetzt werden.<br />
Wenn auch erwartet werden darf, dass die seit <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong> prophylaktischen Massnahmen festgestellten<br />
Silikosen im allgemeinen weniger schwer verlaufen werden als die Fälle aus früheren Perioden,<br />
so sind für die bis Ende 1957 registrierten Fälle in Zukunft doch ohne Zweifel noch grosse Kosten zu erwarten.<br />
Schätzungen haben ergeben, dass <strong>der</strong> künftig erfor<strong>der</strong>liche Aufwand für die bereits registrierten<br />
Fälle sogar grösser sein wird als die bisherigen Gesamtkosten. Eine beson<strong>der</strong>e Untersuchung hat beispielsweise<br />
gezeigt, dass in den Jahren 1953 bis 1957 nahezu die Hälfte <strong>der</strong> Silikosekosten von Fällen stammt, die<br />
in früheren Jahren registriert worden sind. Es ist deshalb angezeigt, dieser Sachlage durch vorsichtiges<br />
Bestellen von Schadenreserven bei <strong>der</strong> Bemessung <strong>der</strong> Rentendeckungskapitalien Rechnung zu tragen und<br />
die Prämien entsprechend den mutmasslichen künftigen Kosten vorsichtig zu bemessen.<br />
Da die Silikose auch vom menschlichen Standpunkte aus betrachtet ein sehr ernstes Problem darstellt,<br />
muss alles getan werden, um das unermessliche Leid, das vielen <strong>der</strong> Betroffenen aus dieser Krankheit<br />
erwächst, abzuwenden. Hoffentlich stellt sich durch die Tauglichkeitsuntersuchungen und durch die technischen<br />
Schutzmassnahmen zur Verhütung <strong>der</strong> Silikose ein Erfolg ein. Gewisse Anzeichen hiefür liegen<br />
107
C<br />
Verteilung <strong>der</strong> Siljkosefälle nach Anmeldejahren und nach Art <strong>der</strong> Versicherungsleistungen Ende 1957<br />
ohne Versicherungsleistungen<br />
Q mit Heilkosten und Krankengeld<br />
mit I nvalidenrenten<br />
O~ lo<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
D<br />
20<br />
1938 †19<br />
0<br />
1930-1937<br />
1943-1947<br />
1948-1952 1953-1957<br />
vor, endgültige Schlüsse lässt die verhältnismässig kurze, seit dem Beginn <strong>der</strong> technischen Prophylaxe<br />
verstrichene Zeitspanne jedoch noch nicht zu. Immerhin darf erwartet werden, dass sich die Erkrankungshäufigkeit<br />
künftig vermin<strong>der</strong>n wird und die Staublunge in weniger schwerer Form und erst in vorgerückterem<br />
Alter auftritt.<br />
Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass sich die Silikosefälle und die daraus anfallenden Kosten<br />
nur auf wenige Gefahrenklassen verteilen.<br />
108
Silikosefälle nach Industrie- und Gewerbezweigen 1953 — 1957<br />
Zahl <strong>der</strong> Fälle<br />
Kosten<br />
Gefahrcnklassen des Prämientarifs<br />
absolut<br />
in<br />
Prozenten<br />
in Franken<br />
in<br />
Prozenten<br />
in Prozenten <strong>der</strong><br />
Unfallkosten des<br />
Industriezweiges<br />
Tunnel- und Stollenbau (Gefahrenklasse<br />
40e)<br />
Steinbrüche (Gefahrenklassen38 a, c, 1, s)<br />
Giessereien (Gefahrenklassen 10c und d)<br />
Bergwerke (Gefahrenklasse 38u) .<br />
Keramische Industrie (Gefahrenklassen<br />
3b, 3e, 4a und 4c) .<br />
~ ~<br />
Ubrige<br />
511<br />
207<br />
238<br />
111<br />
40<br />
16<br />
18<br />
9<br />
]5 716 965<br />
5 158 020<br />
5 291 045<br />
3 224 242<br />
923 056<br />
4 944 513<br />
Total . 1 284 100 35 257 841 100<br />
62<br />
155<br />
5<br />
12<br />
44<br />
15<br />
15<br />
9<br />
3<br />
14<br />
38<br />
38<br />
36<br />
96<br />
17<br />
1<br />
In <strong>der</strong> Berichtsperiode stammen rund zwei Fünftel <strong>der</strong> Silikosefälle und <strong>der</strong> Silikosekosten aus dem<br />
Tunnel- und Stollenbau. Grosse Bedeutung kommt <strong>der</strong> Silikose auch in den verschiedenen Steinbrüchen<br />
sowie in den Eis=n- und Stahlgiessereien zu. Die Kohlenbergwerke, die in den Nachkriegsjahren stillgelegt<br />
wurden, weisen immer noch ansehnliche Silikosekosten auf. Dies ist ein typisches Beispiel für die Verzögerung<br />
des Kostenanfalles gegenüber <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> schädigenden Einwirkung von Quarzstaub. Bei all diesen<br />
Industrie- und Gewerbezweigen und in <strong>der</strong> keramischen Industrie bilden die Silikosekosten einen beträchtlichen<br />
Anteil an den Versicherungsleistungen.<br />
Die Bedeutung und die Entwicklung <strong>der</strong> Silikose im Tunnel- und Stollenbau, in den Giessereien sowie<br />
in <strong>der</strong> keramischen Industrie wird nachfolgend noch näher betrachtet. Über die Verhältnisse in den Steinbrüchen<br />
soll später berichtet werden.<br />
Die Silikose im Tunnel- und Stollenbau<br />
Wie bereits dargelegt wurde, kommt <strong>der</strong> Silikose vor allem im Tunnel- und Stollenbau eine beson<strong>der</strong>e<br />
Bedeutung zu. Ein Drittel aller bisher registrierten Silikosefälle ist auf diese Tätigkeit zurückzuführen. In<br />
<strong>der</strong> Berichtsperiode betrug <strong>der</strong> Anteil zwei Fünftel, während die Kosten sogar rund 45 Prozent sämtlicher<br />
Silikosekosten ausmachten.<br />
Silikosefälle 1933 — 1957<br />
Jahre <strong>der</strong><br />
Anerkennung<br />
1933 †19<br />
1938-1942<br />
1943 †19<br />
1948-1952<br />
1953-1957<br />
1933 †19<br />
Total<br />
6<br />
88<br />
434<br />
414<br />
511<br />
Zahl <strong>der</strong> Fälle<br />
2<br />
27<br />
60<br />
164<br />
154<br />
I nvaliditätsfälle<br />
'<br />
(1)<br />
(4)<br />
(39)<br />
(52)<br />
(95)<br />
Todesfälle<br />
2<br />
20<br />
70<br />
98<br />
152<br />
1 453 407 (191) 342<br />
Heilkosten<br />
und<br />
Kran kengeld<br />
4 286<br />
99 590<br />
535 275<br />
2 343 938<br />
5 891 189<br />
Kosten in Franken '<br />
Kapi tal wert<br />
del<br />
Renten<br />
79 977<br />
819 438<br />
3 079 463<br />
7 704 411<br />
9 825 776<br />
Total<br />
84 263<br />
919 028<br />
3 614 738<br />
10 048 349<br />
15 716 965<br />
8 874 278 21 509 065 30 383 343<br />
' Vermin<strong>der</strong>t um die Zahl <strong>der</strong> an Silikose gestorbenen Invaliden, die in Klammern angegeben ist.<br />
'-' Einschliesslich Übergangsentschädigungen und Kosten <strong>der</strong> prophylaktischen Untersuchungen.<br />
109
Es sei auch an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die Silikose oft erst lange Zeit nach <strong>der</strong><br />
schädigenden Einwirkung des Quarzstaubes zur Anmeldung gelangt und oft erst spät danach Versicherungsleistungen<br />
ausgerichtet werden müssen. So stammen beispielsweise von den Kosten im Betrage von 15,7 M illionen<br />
Franken aus den Jahren 1953 — 1957 nur 9 Millionen Franken o<strong>der</strong> rund 60 Prozent von den in <strong>der</strong><br />
gleichen Beobachtungsperiode erfassten 511 Silikosefällen. Ferner ist festzustellen, dass <strong>der</strong> Anteil von<br />
Heilkosten und Krankengeld im Laufe <strong>der</strong> Zeit immer grösser wurde und in <strong>der</strong> Berichtsperiode fast<br />
40 Prozent erreicht hat. Diese Entwicklung ist zum Teil eine Folge <strong>der</strong> Tauglichkeitsuntersuchungen, durch<br />
welche die Silikosen frühzeitig erkannt werden, weshalb sich einerseits eine längere Behandlungsdauer<br />
ergibt, an<strong>der</strong>seits aber eine Rentenfestsetzung bei kleinerem Invaliditätsgrad ermöglicht wird. Es ist hier<br />
aber auch zu berücksichtigen, dass die mo<strong>der</strong>ne Krankenbehandlung ganz allgemein sehr viel teurer geworden<br />
ist. Insbeson<strong>der</strong>e wirkt sich dieser Umstand bei <strong>der</strong> Behandlung <strong>der</strong> mit Tuberkulose verbundenen<br />
Silikosen aus. Dadurch, dass den Ärzten heute bedeutend wirksamere Medikamente im Kampf gegen die<br />
Tuberkulose zur Verfügung stehen, bleiben die Siliko-Tuberkulösen erheblich viel länger am Leben als<br />
früher. Deshalb sind viel längere Spital- und Sanatoriumsaufenthalte zu bezahlen, nicht selten jahrelange.<br />
Die weitere Entwicklung <strong>der</strong> Silikosekosten ist schwer abzuschätzen. Sicher ist, dass wegen <strong>der</strong> fortschreitenden<br />
Verschlimmerung <strong>der</strong> vorhandenen Silikosen auch bei einer allmählichen Abnahme <strong>der</strong> Zahl<br />
<strong>der</strong> neugemeldeten Silikosefälle noch erhebliche Kosten entstehen werden. Daher ist im Hinblick auf das<br />
mögliche Zusammenschrumpfen <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme nach Beendigung <strong>der</strong> wichtigsten Bauvorhaben<br />
die Prämie zur Deckung <strong>der</strong> Silikosekosten im Tunnel- und Stollenbau vorsichtig zu bemessen.<br />
Im folgenden werden die bisherigen Erfahrungen über den Verlauf <strong>der</strong> Silikosefälle, die einen Hinweis<br />
auf die künftige Entwicklung <strong>der</strong> Silikosekosten zu geben vermögen, eingehen<strong>der</strong> betrachtet.<br />
Silikosefälle nach Anmeldejahren<br />
und nach Art <strong>der</strong> Versicherungsleistungen Ende 1957<br />
davon sind<br />
Jahre <strong>der</strong><br />
A nmeld u ng<br />
1933 1938 1943 1948 1953 †19<br />
1933-1957<br />
Zahl<br />
<strong>der</strong> Fälle<br />
6<br />
124<br />
449<br />
388<br />
486<br />
ohne<br />
Versicherungsleist<br />
u n gen<br />
1<br />
9<br />
175<br />
112<br />
198<br />
mit<br />
Heil kosten<br />
und<br />
Krankengeld<br />
11<br />
42<br />
34<br />
llo<br />
mit<br />
I nvalidenrcnten<br />
27<br />
106<br />
131<br />
131<br />
mit<br />
Hinter- auslassenen-<br />
geschicdcn'<br />
renten<br />
5<br />
76<br />
117<br />
100<br />
44<br />
1 453 495 197 395 342 24<br />
1<br />
9<br />
11<br />
3<br />
110<br />
' Todesfälle, die nicht durch die Silikose verursacht wurden.<br />
Bis Ende 1957 erfor<strong>der</strong>te die Hälfte <strong>der</strong> Silikosen die Zusprechung einer Rente. In 598 Fällen mussten<br />
Invalidenrenten ausgerichtet werden, wobei bis am Ende <strong>der</strong> Berichtsperiode 191 Rentner an <strong>der</strong> Silikose<br />
und 12 aus an<strong>der</strong>n Gründen starben, so dass zu diesem Zeitpunkt neben den Hinterlassenenrenten noch<br />
395 Invalidenrenten auszurichten waren.<br />
In <strong>der</strong> graphischen Darstellung auf <strong>der</strong> nachfolgenden Seite sind für verschiedene Anmeldejahre und<br />
bestimmte Zeitabstände seit <strong>der</strong> Anmeldung die Verteilungen <strong>der</strong> Silikosefälle nach dem jeweiligen Stand<br />
<strong>der</strong> Ansprüche auf Versicherungsleistungen dargestellt. Beim Vergleich <strong>der</strong> Verteilungen mit <strong>der</strong> gleichen<br />
Anzahl Jahre seit <strong>der</strong> Anmeldung ist festzustellen, dass <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Fälle ohne Versicherungsleistungen<br />
im Laufe <strong>der</strong> Zeit grösser wurde. Dies ist auf die prophylaktischen Massnahmen zurückzuführen. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
ist dies bei den in den Jahren 1943 — 1947 angemeldeten Silikosen <strong>der</strong> Fall, weil in dieser Beobachtungsperiode<br />
erstmals Tauglichkeitsuntersuchungen bei den Arbeitern des Tunnel- und Stollenbaues<br />
durchgeführt wurden.
Dic Silikoscfallc nach Art <strong>der</strong> Versicherungsleistungen zu verschiedenen Zeitpunkten<br />
A n mcldejah re<br />
Anzahl Jahre seit <strong>der</strong> Anmeldung<br />
100<br />
10<br />
15<br />
80<br />
1938-1942<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
100<br />
80<br />
1943 †19<br />
60<br />
40<br />
0<br />
100<br />
80<br />
1948 †19<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1953-1957<br />
100<br />
80<br />
60<br />
h V lh gilt g<br />
itHitk t dK k gld<br />
lid t<br />
40 mit Hinterlassenenrenten<br />
20<br />
ausgeschieden (Todesfälle, die nicht<br />
durch die Silikose verursacht wurden)<br />
0
Über die Zeit zwischen dem Einstellen <strong>der</strong> silikosegefährlichen Arbeit und <strong>der</strong> Feststellung <strong>der</strong> Silikose,<br />
die Latenzzeit genannt sei, gibt die folgende Darstellung Auskunft.<br />
Die Latenzzeit <strong>der</strong> Silikosefälle 1953 — 1957<br />
Nur 17 Prozent <strong>der</strong> Silikosekranken waren im Zeitpunkt <strong>der</strong> Feststellung <strong>der</strong> Krankheit noch im<br />
Tunnel- und Stollenbau beschäftigt, während 45 Prozent seit 10 und mehr Jahren eine an<strong>der</strong>e Tätigkeit ausübten.<br />
Die durchschnittliche Latenzzeit betrug 9, die längste 37 Jahre.<br />
Von Interesse ist auch die Dauer, während <strong>der</strong> die Silikosekranken dem Quarzstaub ausgesetzt waren.<br />
Die Bestimmung <strong>der</strong> Expositionszeit ist abei schwierig, weil die Arbeitsanamnesen früher oft unvollständig<br />
und ungenau waren. Erst in <strong>der</strong> Verordnung über Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung <strong>der</strong><br />
Quarzstaublunge vom 3.September 1948 wurde vorgeschrieben, dass je<strong>der</strong> Arbeitnehmer des Baugewerbes,<br />
<strong>der</strong> Steinbrüche, Kiesgruben und Schotterwerke ein persönliches Kontrollbüchlein besitzen<br />
muss, in dem <strong>der</strong> Arbeitgeber jeweils die Art und die Dauer <strong>der</strong> Arbeitsleistungen einzutragen hat.<br />
Die Expositionszeit <strong>der</strong> Silikosefälle 1953 — 1957<br />
Expositionszeit<br />
in Jahren<br />
Prozentualer<br />
Anteil <strong>der</strong><br />
Silikosefälle<br />
Summe<br />
<strong>der</strong> Prozente<br />
bis 2<br />
2 — 4<br />
4 — 6<br />
6 — 8<br />
8 — 10<br />
10 — 12<br />
12-14<br />
14-20<br />
20 und mehr<br />
20<br />
25<br />
20<br />
14<br />
6<br />
7<br />
3<br />
4<br />
1<br />
20<br />
45<br />
65<br />
79<br />
85<br />
92<br />
95<br />
99<br />
100<br />
Die kürzeste Expositionszeit betrug weniger als ein Jahr, die längste 27 Jahre und <strong>der</strong> Durchschnitt<br />
nicht ganz 6 Jahre. Demnach können bei Arbeiten im Quarzstaub je nach <strong>der</strong> körperlichen Konstitution<br />
und <strong>der</strong> Staubkonzentration <strong>der</strong> eingeatmeten Luft schon nach kürzerer Zeit Erkrankungen an Silikose<br />
auftreten.<br />
Trotz intensiver Forschung im Auslande und in <strong>der</strong> Schweiz kann die Silikose zur Zeit noch nicht<br />
geheilt werden. Immerhin ist aber die Gefahr, an Silikose zu erkranken, dank den prophylaktischen Massnahmen<br />
vermin<strong>der</strong>t worden. Durch die Tauglichkeitsuntersuchungen werden die für Arbeiten im Quarzstaub<br />
Ungeeigneten ausgeschieden. Technische Massnahmen ermöglichen an<strong>der</strong>seits, die Staubkonzentration<br />
wesentlich zu vermin<strong>der</strong>n; Nassbohren, Benetzen des Schuttes, Einhalten genügend langer Be<br />
112
triebspausen nach dem Sprengen und gründliche Ventilation sind die Mittel hiezu. Es ist zu erwarten, dass<br />
durch die vorgeschriebene Prophylaxe schliesslich eine Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Zahl und <strong>der</strong> Kosten <strong>der</strong> Silikosefälle<br />
erreicht wird.<br />
Die Silikose in den Giessereien<br />
Die Silikosegefahr in den Giessereien ist auf den quarzhaltigen Feinstaub zurückzuführen, <strong>der</strong> vor<br />
allem beim Umgang mit Form- und Kernsand sowie beim Sandstrahlen entsteht. Nachdem Ende <strong>der</strong><br />
zwanziger Jahre eine Reihe schwerster Sandstrahlersilikosen die Silikosefrage in <strong>der</strong> Schweiz eigentlich<br />
erst aufgeworfen hatte, ist die Zahl <strong>der</strong> aus den Giessereibetrieben stammenden Silikosefälle bis Ende 1957<br />
auf 623 angestiegen. Die folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über das Auftreten und den Verlauf<br />
dieser Silikosefälle.<br />
Silikosefälle nach Anmeldejahren und Art <strong>der</strong> Versicherungsleistungen Ende 1957<br />
davon sind<br />
re <strong>der</strong><br />
meldung<br />
Zahl<br />
<strong>der</strong> Fälle<br />
ohne<br />
Versicherungsleistungen<br />
mit<br />
Heilkosten<br />
und<br />
Krankengeld<br />
mit<br />
I nvalidenrenten<br />
mit<br />
Hinterlassenenrenten<br />
au<br />
gesch<br />
â€<br />
â€<br />
-1932<br />
-1937 19-1947<br />
†19-1957<br />
213<br />
16<br />
21<br />
24<br />
147<br />
181<br />
234<br />
1<br />
1<br />
9<br />
53<br />
65<br />
84<br />
10<br />
23<br />
49<br />
2<br />
3<br />
42<br />
55<br />
82<br />
14<br />
16<br />
10<br />
32<br />
30<br />
623 83 184 116 27<br />
14<br />
' Todesfälle. die nicht durch Silikose verursacht wurden.<br />
In den dreissiger Jahren war die Zahl <strong>der</strong> zur Anmeldung gelangenden Silikosen klein. Es handelte sich<br />
mehrheitlich um Sandstrahlersilikosen schwerer Natur, die oft rasch zum Tode führten. Mit den in den<br />
vierziger Jahren einsetzenden Tauglichkeitsuntersuchungen, die ein frühzeitiges Erkennen dieser Erkrankung<br />
ermöglichen, schwoll <strong>der</strong>en Zahl auf das Mehrfache an, und sie erhöhte sich seither von Jahrfünft<br />
zu Jahrfünft ganz erheblich.<br />
Eine wesentliche Silikosegefahr tritt bei bestimmten, stark Staub entwickelnden Tätigkeiten auf. Deshalb<br />
ist das Silikoserisiko in den Giessereibetrieben verschieden gross, je nachdem ob und in welchem Umfange<br />
die silikosegefährdenden Tätigkeiten vorkommen. In <strong>der</strong> folgenden Zusammenstellung wurden die<br />
bis Ende 1957 erfassten Silikosefälle auf die verschiedenen Betriebsarten und Tätigkeiten aufgeteilt. Dabei<br />
sind die Fälle dort zugewiesen, wo Dauer und Gefahr <strong>der</strong> Tätigkeit am meisten ins Gewicht fielen; in<br />
einigen Fällen war keine eindeutige Zuordnung möglich.<br />
Zunächst fällt auf, dass fast alle bis jetzt gemeldeten Silikosefälle aus den Sandformgiessereien<br />
stammen, wobei die meisten in den Eisengiessereien zu verzeichnen sind. Demgegenüber entfallen auf die<br />
Nichtsandformgiessereien fast keine Silikosefälle. In den Kokillen-, Druck- und Spritzgiessereien sowie<br />
in den Umschmelzwerken ist überhaupt noch nie eine Silikose erworben worden. Die vereinzelt aus Blockgiessereien<br />
stammenden Silikosen betreßen Ofenmaurer und Pfannenmacher, die insbeson<strong>der</strong>e beim Bearbeiten<br />
<strong>der</strong> feuerfesten Steine und beim Abbruch <strong>der</strong> ausgebrannten Öfen infolge des grossen Gehaltes<br />
<strong>der</strong> Steine an Cristobalit und Tridymit dem gesundheitsschädigenden Mineralstaub ausgesetzt sind.<br />
113
Silikosefälle nach Betriebsarten und Tätigkeiten <strong>der</strong> Erkrankten, 1931 — 1957<br />
Tätigkeiten<br />
Betriebsart<br />
Formen,<br />
Auspacken<br />
'<br />
Sandmachen<br />
Gussputzen<br />
Sandstra<br />
hlen<br />
Kernmachen<br />
Herrichten<br />
<strong>der</strong> Öfen zuteilbare<br />
und<br />
Fälle<br />
Pfannen<br />
Total<br />
Kokillen-, Druck- und Spritzgiessereien<br />
Umschmelzwerke .<br />
Blockgiessereien .<br />
Sandformgiessereien<br />
Stahl<br />
Eisen<br />
l<br />
147<br />
7<br />
137<br />
8<br />
103<br />
übrige Schwermetalle<br />
12 l<br />
l<br />
Leichtmetalle.<br />
nicht zuteilbare Fälle . 8<br />
2<br />
27<br />
21<br />
10<br />
2<br />
75<br />
18<br />
520<br />
32 16 66<br />
192 161 117 33 22 13 85 623<br />
16<br />
' Die Tätigkeiten des Formens und Auspackens wurden vereinigt, weil oft die Former die von ihnen gegossenen Stücke<br />
selbst auspacken.<br />
Für eine Beurteilung des Silikoserisikos sollte die Zahl <strong>der</strong> Silikosefälle auf die Zahl <strong>der</strong> Beschäftigten,<br />
die <strong>der</strong> Staubgefährdung ausgesetzt waren, bezogen werden können. Dies ist jedoch schwierig, weil genauere<br />
Unterlagen fehlen. Immerhin können, gestützt auf eine grobe Schätzung des unter Risiko gestandenen<br />
Versichertenkreises, nachstehende Schlussfolgerungen gezogen werden.<br />
Am grössten erweist sich das Silikoserisiko bei den Eisen- und Stahlgiessereien. Etwas niedriger ist es<br />
bei den Schwermetallgiessereien. Einen Son<strong>der</strong>fall unter den Sandformgiessereien bildet <strong>der</strong> junge Zweig<br />
<strong>der</strong> Leichtmetallgiessereien, bei dem bis jetzt noch keine Silikosen aufgetreten sind. Wie aus Staubmessungen<br />
hervorgeht, ist die Silikosegefährdung dort erheblich geringer; dies ist dadurch zu erklären,<br />
dass bei verhältnismässig niedriger Temperatur durchwegs in nasse Formen gegossen wird. Bei den Kokillen-,<br />
Druck- und Spritzgiessereien, in denen kein Sand verwendet wird, gibt es keine Silikosegefährdung,<br />
und bei den Blockgiessereien und Umschmelzwerken fällt sie nicht ins Gewicht.<br />
Von beson<strong>der</strong>em Interesse ist auch die Silikosegefährdung, welche die einzelnen Tätigkeiten aufweisen.<br />
Wohl entfallen anzahlmässig die meisten Silikosefälle auf das Formen und Auspacken, das Gussputzen<br />
und das Sandstrahlen. Bezogen auf die Zahl <strong>der</strong> Beschäftigten, scheint die Silikosegefährdung jedoch am<br />
grössten beim Sandstrahlen, beim Herrichten <strong>der</strong> Öfen und Giesspfannen sowie beim Gussputzen zu sein.<br />
Die aussergewöhnlich hohe Silikosegefährdung beim Sandstrahlen hat vor allem zur Zeit bestanden, als<br />
die Verwendung quarzhaltiger Strahlmittel noch sehr verbreitet war. Heutzutage wird aber kaum mehr<br />
mit Quarzsand gestrahlt, so dass die Silikosegefährdung zweifellos ganz wesentlich geringer ist als früher.<br />
Auch für die Ofenmaurer und Pfannenmacher, die früher hauptsächlich bei <strong>der</strong> Bearbeitung <strong>der</strong> Ofensteine<br />
gefährdet waren, haben sich die Verhältnisse gebessert. Die Staubentwicklung an den Trennschleifmaschinen<br />
wird nun durch wirksame Absaugungen bekämpft, sofern die Bearbeitung <strong>der</strong> Steine<br />
nicht überhaupt dahinfällt, weil bereits hergerichtete Formsteine verwendet werden. Weniger günstig hat<br />
sich das Silikoserisiko bei den Gussputzern und vor allem bei den Formern und Auspackern entwickelt.<br />
Da nach wie vor die Gußstücke in <strong>der</strong> Mehrzahl <strong>der</strong> Betriebe ohne Staubabsaugung ausgepackt und entsandet<br />
werden, ist es verständlich, dass sowohl bei den Gussputzern als auch bei den Formern und Auspackern<br />
in den letzten Jahren <strong>der</strong> Neuzugang an Silikosen angestiegen ist. Erwartungsgemäss sollten bei<br />
den Formern, die mit feuchtem Sand zu tun haben, kaum Silikosen auftreten. Wenn trotzdem Silikosen<br />
erworben werden, so dürfte dies hauptsächlich dadurch zu erklären sein, dass die Former häufig auch auspacken<br />
und im gleichen Raume tätig sind, in welchem staubentwickelnde Arbeiten ausgeführt werden. Dies<br />
trifft übrigens ebenfalls für die Sand- und Kernmacher zu.<br />
114
Der Gesamtaufwand an Silikosekosten beträgt bis Ende ]957 für die Giessereien nahezu 10 Millionen<br />
Franken. Die folgende Zusammenstellung zeigt, wie sie sich auf die einzelnen Versicherungsleistungen<br />
vertei1en.<br />
Kosten <strong>der</strong> Silikosefälle bis Ende 1957<br />
Jahre<br />
Anzahl<br />
S i l i kose fa I le<br />
1931 †19<br />
36<br />
1938-1942 23<br />
1943 †142<br />
1948 †184<br />
1953-1957 238<br />
1931 †623<br />
Heil kosten<br />
und<br />
K rankengeld<br />
64 828<br />
48 628<br />
201 497<br />
678 501<br />
1 562 767<br />
Silikosekosten<br />
Rentenkosten<br />
529 809 594 637<br />
124 098 172 726<br />
788 644 990 141<br />
2 011 272 2 689 773<br />
3 728 278 5 291 045<br />
2 556 221 7 182 101 9 738 322<br />
Total<br />
in / <strong>der</strong><br />
in Franken Unfallkosten<br />
18<br />
5<br />
14<br />
25<br />
36<br />
Die Silikosekosten, <strong>der</strong>en Schwergewicht bei den Rentenkosten liegt, haben in den letzten Jahren sehr<br />
stark zugenommen. Sie betragen gegenwärtig rund einen Drittel <strong>der</strong> gesamten Unfallkosten, wobei <strong>der</strong> Anteil<br />
bei den Metallgiessereien erheblich kleiner ist als bei den Eisen- und Stahlgiessereien. Ein bedeuten<strong>der</strong><br />
Teil <strong>der</strong> in neuerer Zeit entstandenen Silikosekosten rührt von Fällen her, die in früheren Jahren gemeldet<br />
wurden und erst viel später zu Renten führten. Da viele Silikosefälle bis jetzt noch keine o<strong>der</strong> nur geringe<br />
Kosten verursacht haben, muss erfahrungsgemäss in <strong>der</strong> nächsten Zeit mit weiter ansteigenden Silikosekosten<br />
gerechnet werden.<br />
Im folgenden sei an einigen wenigen Beispielen gezeigt, wie sich eine Giessersilikose entwickeln und<br />
auf die Arbeitsfähigkeit auswirken kann:<br />
Silikose eines Formers<br />
Der Versicherte arbeitete seit dem Jahre 1915 in einer Kleinstückgiesserei an <strong>der</strong> Formbank, wo er nur<br />
mit Formsand zu tun hatte. Ab 1940 musste er grosse Stücke formen, giessen und anschliessend mit<br />
an<strong>der</strong>n Arbeitern zusammen diese Stücke auspacken, wobei viel Staub entstand. Im Oktober 1950 wurde<br />
bei einer Schirmbildaktion eine Silikose festgestellt. Die Invalidenrente von anfänglich 20 Prozent musste<br />
ab Ende 1952 auf 30 Prozent erhöht werden.<br />
Silikose eines Gussputzers<br />
Der Versicherte arbeitete seit 1920 als Gussputzer in einer Eisengiesserei, wo er grosse Gussteile mit<br />
dem pneumatischen Meissel von Form- und Kernsandresten zu reinigen hatte. Die vorhandene Staubabsaugung<br />
vermochte nicht zu genügen, so dass wesentliche Mengen Staub in die Atemwege des Versicherten<br />
gelangten und bei ihm 1946 Kurzatmigkeit auslösten. Die durch die Silikose bewirkte Vermin<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Arbeitsfähigkeit wurde auf 35 Prozent festgesetzt. Obwohl <strong>der</strong> Versicherte an einen staubfreien<br />
Arbeitsplatz versetzt wurde, nahmen die Beschwerden zu, so dass die Invalidenrente 1948 auf 50 Prozent,<br />
1954 auf 80 Prozent und 1957 auf 100 Prozent erhöht werden musste. Nach dem bald darauf eingetretenen<br />
Tode war <strong>der</strong> Witwe eine Rente zuzusprechen.<br />
Silikose eines Ofenmaurers<br />
Der Versicherte trat mit 19 Jahren in eine Eisengiesserei ein, wo seine Tätigkeit neben Formarbeiten<br />
vor allem in <strong>der</strong> Bedienung und im Unterhalt <strong>der</strong> Schmelzöfen bestand. Er war dabei dem Staub <strong>der</strong> Schamotte<br />
ausgesetzt, aus <strong>der</strong> die Ofenfütterung besteht. Nach 31jähriger Tätigkeit wurde 1948 beim Versicherten<br />
eine Silikose festgestellt. Die Atembeschwerden bedingten eine Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Arbeitsfähig<br />
115
keit um 25 Prozent. Der Versicherte arbeitete aber noch weiter, bis 1954 eine Lungentuberkulose hinzutrat,<br />
die eine Behandlung im Sanatorium notwendig machte. Nach dem schon ein Jahr später erfolgten<br />
Tode musste seiner Mutter eine Rente zugesprochen werden.<br />
Silikose eines Kernmachers<br />
Nach Abschluss <strong>der</strong> Lehrzeit übte <strong>der</strong> Versicherte ab 1922 während mehr als 30 Jahren in verschiedenen<br />
Abteilungen einer grossen Giesserei den Beruf eines Kernmachers aus. Bei einer ersten Untersuchung im<br />
Jahre 1950 wurde eine Silikose festgestellt, doch war die Arbeitsfähigkeit noch nicht beeinträchtigt.<br />
Sechs Jahre später jedoch war die Krankheit bereits <strong>der</strong>art fortgeschritten, dass eine Invalidenrente von<br />
50 Prozent zugesprochen werden musste.<br />
Aus diesen Ausführungen geht die grosse wirtschaftliche Bedeutung <strong>der</strong> Silikose in den Giessereien<br />
hervor. Zudem bringt sie den Betroßenen viel Leid und Not. Es dürfte deshalb ausser Frage stehen, dass<br />
zu ihrer Bekämpfung alle notwendigen und geeigneten Massnahmen ergriffen werden müssen.<br />
In erster Linie muss versucht werden, alle Möglichkeiten, bei denen sich gesundheitsschädigen<strong>der</strong> Feinstaub<br />
bilden kann, auszuschliessen. Als Massnahmen sind an vor<strong>der</strong>ster Stelle zu nennen:<br />
Ersetzen des quarzhaltigen Sandes durch quarzfreie Mittel<br />
Anfeuchten des Sandes<br />
Nassputzen<br />
Reinhalten <strong>der</strong> Arbeitsräume<br />
Arbeitsweise ohne Staubaufwirblung.<br />
Am gründlichsten wird die Silikosegefahr beseitigt, indem jeglicher Quarzsand durch quarzfreie Mittel<br />
ersetzt wird. In <strong>der</strong> Schweiz sind schon grosse Fortschritte in dieser Richtung festzustellen. Beim Sandstrahlen<br />
und auch beim Einpu<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Formen werden bereits weitgehend quarzfreie Mittel verwendet.<br />
Noch einen Schritt weiter gehen die Versuche, die in Schweden mit synthetischen Formsanden auf <strong>der</strong><br />
Basis völlig unschädlicher Olivinsande durchgeführt werden.<br />
Das Anfeuchten des Sandes, das die Staubentwicklung bekanntlich stark herabsetzt, ist beim Gussauspacken<br />
allgemein üblich. Es ist jedoch darauf zu achten, dass <strong>der</strong> Sand dabei möglichst frühzeitig berieselt<br />
und nachher stets feucht gehalten wird.<br />
Eine sorgfältige Arbeitsweise, beispielsweise beim Umschaufeln von Sand, sowie das Reinhalten <strong>der</strong><br />
Arbeitsräume sollten Selbstverständlichkeiten sein. Staub- und herumliegende Sandablagerungen sind,<br />
da aus ihnen je<strong>der</strong>zeit neuer Feinstaub aufgewirbelt werden kann, laufend zu beseitigen, wofür sich<br />
Industriestaubsauger eignen, jedoch nicht etwa Besen o<strong>der</strong> gar Druckluftgebläse.<br />
Die Ansammlung von herumliegendem Sand kann auch durch geeignete Ausbildung des Arbeitsplatzes<br />
vermieden werden, indem beispielsweise <strong>der</strong> Fussboden rings um die Formmaschine als Rost ausgebildet<br />
wird, durch den <strong>der</strong> überschüssige Sand fällt und abgeführt werden kann. Durch den Rost ist<br />
zudem eine Absaugung nach unten möglich.<br />
Da sich in <strong>der</strong> Regel trotz <strong>der</strong> bereits besprochenen Vorkehren Feinstaub bildet, kommt den Massnahmen,<br />
welche <strong>der</strong> Entfernung von gesundheitsschädigendem Staub dienen, entscheidende Bedeutung<br />
zu. Darunter sind die wichtigsten:<br />
Absaugung auftretenden Staubes an <strong>der</strong> Entstehungsstelle<br />
Verschalung staubbilden<strong>der</strong> Einrichtungen<br />
Allgemeine Entlüftung.<br />
ln den Sandformgiessereien gibt es zahlreiche Stellen, wo eine Absaugvorrichtung erfor<strong>der</strong>lich ist, so<br />
beispielsweise in <strong>der</strong> Sandaufbereitung, an den Auspackorten und in <strong>der</strong> Gussputzerei.<br />
Um eine gute Saugwirkung zu gewährleisten, sind die Saugstutzen möglichst nahe an die Staubquellen<br />
heranzuführen und, um die Saugkraft <strong>der</strong> übrigen Saugstellen zu erhöhen, bei Nichtgebrauch zu schliessen.<br />
Die abgesaugte Luft ist <strong>der</strong>art ins Freie zu leiten, dass sie nicht mehr in die Arbeitsräume gelangt, denn<br />
auch filtrierte Luft kann noch Feinstaub enthalten. Wegen <strong>der</strong> starken Abnützung und Verschmutzung,<br />
denen die Entstaubungsanlagen unterliegen, sind sie auch häufig zu überholen und zu reinigen.<br />
116
Wo an Auspackstellen d urch den Heissluftstrom viel<br />
lungengängiger Quarzstaub nach oben gewirbelt wird, sind<br />
Saugwände zweckmässig. Sie ziehen den Staub aus <strong>der</strong> Atemzone<br />
des Arbeiters weg, lassen jedoch Platz für den Kran.<br />
Für Auspack- und Gussputzarbeiten an grossen Stücken<br />
eignen sich Kojen mit Saugwänden.<br />
Auch an Siloausläufen und beim Abblasen <strong>der</strong> Modelle<br />
und Formen mit Pressluft wird viel Staub erzeugt, so dass dort<br />
Absaugungen angezeigt sind.<br />
Die Wirkung <strong>der</strong> Staubabsaugung kann wesentlich erhöht<br />
werden, wenn die stauberzeugenden Arbeitsprozesse unter<br />
Absaugung in geschlossene Anlagen verlegt werden. Als Beispiel<br />
dafür seien herausgegriffen Strahlputzanlagen (Wheelabrator),<br />
verschalte För<strong>der</strong>bän<strong>der</strong>, fest eingebaute Sandschleu<strong>der</strong>n<br />
und Sandmischer mit Absaugvorrichtungen.<br />
~ Formmaschine mit Gitterrost umgeben<br />
~ Kleine Saugwand ~ Wheelabrator<br />
Koje mit Saugwand<br />
Wichtig ist auch eine wirksame allgemeine Entlüftung <strong>der</strong><br />
Arbeitsräume, da lungengängiger Quarzstaub sehr lange Zeit<br />
in <strong>der</strong> Atmosphäre schwebt. Es muss eine dauernde Umsetzung<br />
<strong>der</strong> Raumluft gewährleistet sein, insbeson<strong>der</strong>e auch<br />
während <strong>der</strong> Nacht und im Winter. Ferner ist dafür zu sorgen,<br />
dass eine möglichst kleine Zahl von Arbeitern dem Staube ausgesetzt<br />
wird. Dies wird angestrebt durch die Verlegung stark<br />
stauberzeugen<strong>der</strong> Arbeiten in die Nachtschicht und durch<br />
geeignete bauliche Gestaltung <strong>der</strong> Arbeitsräume, indem staubgefährdete<br />
Arbeitsplätze von den weniger gefährdeten einwandfrei<br />
abgetrennt werden.<br />
Persönliche Schutzmittel wie Frischlufthelme und Atemschutzmasken<br />
(mit geprüften und zugelassenen Feinstaubfiltern)<br />
behin<strong>der</strong>n die Träger bei <strong>der</strong> schweren Arbeit allzusehr.<br />
Deshalb sind sie nur als Notbehelf zu betrachten und nur bei<br />
kurzfristigen Arbeiten zu gebrauchen.<br />
117
Die Silikose in <strong>der</strong> keramischen Industrie<br />
Alle keramischen Masseri enthalten mehr o<strong>der</strong> weniger Quarz. Die Möglichkeit an Silikose zu erkranken<br />
ist daher für die in <strong>der</strong> keramischen Industrie Beschäftigten gegeben. Bis Ende 1957 mussten<br />
denn auch 206 Silikosefälle aus <strong>der</strong> keramischen Industrie registriert werden. Aus <strong>der</strong> folgenden Zusammenstellung<br />
ist ersichtlich, wie sich diese Fälle auf die verschiedenen Betriebsarten und die Tätigkeiten<br />
<strong>der</strong> Erkrankten verteilen. Vereinzelte Fälle, die nicht eindeutig zugeordnet werden konnten,<br />
wurden dort zugewiesen, wo die Dauer <strong>der</strong> Gefährdung am meisten ins Gewicht fiel.<br />
Silikosefälle nach Betriebsarten und Tätigkeit <strong>der</strong> Erkrankten 1933 — 1957<br />
da von ent fallen auf das<br />
Betriebsarten<br />
Zahl <strong>der</strong><br />
Fälle<br />
Formgeben,<br />
Ver<br />
Brennen<br />
putzen,<br />
Schlei fen<br />
Aufbereiten<br />
Fabrikation von:<br />
Ziegel- und Backsteinen.<br />
Steinzeug .<br />
Feuerfesten Steinen, Klinker- und Steinzeugbodenplatten<br />
Sanitärkeramik, Wandplatten<br />
Ofen kacheln .<br />
Steingutgeschirr<br />
Töpfergeschirr, Blumentöpfen und kunstkeransischen<br />
Gegenständen<br />
Schlei fschei ben .<br />
Geschirr- und Elektroporzellan.<br />
Total .<br />
3<br />
30 17<br />
67<br />
24<br />
8<br />
16<br />
1<br />
44<br />
7<br />
3<br />
2<br />
1<br />
15<br />
17<br />
5<br />
14<br />
57 13<br />
206 87 94 25<br />
Je nach <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> verwendeten Rohstoffe und dem Aufbereitungs- und Herstellungsverfahren ist<br />
bei den verschiedenen Betriebsarten die Silikosegefährdung von unterschiedlicher Bedeutung. Sie ist<br />
dort gering, wo das Rohmaterial nass aufbereitet und die Masse in feuchtem Zustand geformt wird.<br />
Dies ist insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Fall bei <strong>der</strong> Ziegel- und Backsteinfabrikation sowie beim Herstellen von Töpfergeschirr,<br />
Blumentöpfen und kunstkeramischen Gegenständen. Die drei aus Ziegeleien stammenden<br />
Krankheitsfälle zeigen denn auch nicht den für Keramikerstaublungen typischen Verlauf. Es handelt<br />
sich um Staublungen (Pneumokoniosen), <strong>der</strong>en Natur medizinisch noch nicht eindeutig abgeklärt ist.<br />
Auf Grund <strong>der</strong> bis jetzt vorliegenden Befunde kann nicht mit Sicherheit von Silikosen gesprochen<br />
werden. Vermutlich besteht in den Ziegel- und Backsteinfabriken im allgemeinen keine Silikosegefahr.<br />
Bei den übrigen Betriebsarten <strong>der</strong> keramischen Industrie war und ist teilweise heute noch ein erhebliches<br />
Silikoserisiko vorhanden. Fast die Hälfte <strong>der</strong> Silikosefälle stammt aus Betrieben, die Steinzeug,<br />
feuerfeste Steine, Klinker- und Steinzeugbodenplatten herstellen. Im weitern entfällt eine beträchtliche<br />
Zahl von Erkrankungen auf die Herstellung von Sanitärkeramik und Ofenkacheln. In <strong>der</strong> Gruppe<br />
Steingutgeschirr fiel vor allem ein inzwischen eingegangener Betrieb mit 13 Silikosefällen auf. Der<br />
Porzellanfabrikation musste mehr als ein Viertel <strong>der</strong> Silikosefälle zugeteilt werden.<br />
Die Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Silikosefälle nach <strong>der</strong> Tätigkeit <strong>der</strong> Erkrankten zeigt, dass vor allem das Aufbereiten<br />
bei <strong>der</strong> Herstellung von Steinzeug, feuerfesten Steinen, Klinker- und Steinzeugbodenplatten<br />
gefährlich ist. Der Grund hiefür ist das vorwiegend trockene Mahlen und Mischen <strong>der</strong> Rohstoffe und<br />
Zusatzmaterialien, v,as früher meist in offenen Anlagen erfolgte. Ähnliche Verhältnisse liegen teilweise<br />
118
auch bei <strong>der</strong> Fabrikation von Sanitärkeramik, Wandplatten und Ofenkacheln vor. Die Steingut- und<br />
Porzellanfabriken dagegen beziehen ihr Rohmaterial meistens schon vorgemahlen o<strong>der</strong> in Stückform.<br />
Beim Einfüllen des Materials in die Nass-Kugelmühlen ist die Staubentwicklung nur von kurzer Dauer und<br />
die Gefahr entsprechend geringer. Formgeben, Verputzen und Schleifen verursachen beson<strong>der</strong>s bei<br />
<strong>der</strong> Herstellung von Steingut- und Porzellangeschirr Silikosen. Diese Waren werden auf den sogenannten<br />
Putzspindeln in trockenem o<strong>der</strong> vorgebranntem Zustande nachbearbeitet. Dabei fallen, wie auch<br />
beim Drehen und Giessen, stets Abfälle auf den Boden, die eintrocknen und durch das Darauftreten<br />
<strong>der</strong> Arbeiter zermahlen werden. Beides erzeugt viel Feinstaub in den meist dicht belegten Räumen.<br />
Diese Gefährdung besteht in geringerem Masse auch bei an<strong>der</strong>en Betriebsarten. Die Zahl <strong>der</strong> Erkrankungen<br />
beim Brennen ist geringer, weil hier nur in Einzelfällen, z. B. beim Verwenden von Streusand,<br />
eine wesentliche Staubbildung auftritt.<br />
Im weitern ist auch die Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Silikosefälle nach <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Versicherungsleistungen von<br />
I nteresse.<br />
Silikosefälle nach Betriebsarten und nach Art <strong>der</strong> Versicherungsleistungen Ende 1957<br />
Betriebsarten<br />
Zahl <strong>der</strong><br />
Fälle<br />
Fabrikation von:<br />
Zie el- und Backsteinen 3<br />
Steinzeug .<br />
Feuerfesten Stei nen, Klinker- und<br />
Steinzeugboden platten<br />
Sanitärkeramik, Wandplatten<br />
Ofen kacheln<br />
Steingutgeschirr .<br />
Töpfergeschirr, Blumentöpfen und<br />
kunstkeramischen Ge enständen .<br />
Schlei fscheiben<br />
Geschirr- und Elektroporzellan<br />
30<br />
67<br />
24<br />
8<br />
16<br />
1<br />
57<br />
2<br />
15<br />
47<br />
20<br />
3<br />
5<br />
davon<br />
mit<br />
Heilkosten<br />
und<br />
Krankengeld<br />
ohne<br />
Versiche<br />
rungsleistungen<br />
mit<br />
Hinterlassenenrenten<br />
1<br />
20 13<br />
12<br />
Total. 206 18 27<br />
113<br />
33<br />
mit<br />
I nvalidenrenten<br />
ausgeschieden<br />
'<br />
15<br />
' Todesfälle, die nicht durch die Silikose verursacht wurden.<br />
Von den bis Ende 1957 an Silikose Erkrankten sind 48 gestorben, und zwar 33 an Silikose und die<br />
übrigen 15 aus an<strong>der</strong>en Gründen. Die 33 an Silikose Verstorbenen — von denen rund ein Drittel zusätzlich<br />
eine Tuberkulose aufwies — erreichten im Durchschnitt ein Alter von 62 Jahren. Ausländische Erfahrungen<br />
bestätigen auf Grund einer grösseren Zahl von Beobachtungen, dass das mittlere Sterbealter<br />
eines in <strong>der</strong> keramischen Industrie an Silikose Erkrankten etwas mehr als 60 Jahre beträgt. Die durchschnittliche<br />
Lebensdauer eines an Silikose Gestorbenen war demnach nur um einige Jahre kleiner als die<br />
mittlere Lebenserwartung eines zu Beginn des Jahrhun<strong>der</strong>ts vor <strong>der</strong> Berufswahl gestandenen 15jährigen<br />
Jünglings. Dies und auch die Feststellung, wonach eine verhältnismässig grosse Zahl <strong>der</strong> registrierten<br />
Silikosefälle noch nicht zu Versicherungsleistungen geführt hat, darf jedoch nicht zu falschen Schlussfolgerungen<br />
verleiten. Auf Grund einer eingehenden Prüfung muss nämlich angenommen werden, dass<br />
ein grosser Teil dieser und insbeson<strong>der</strong>e solcher Fälle, die bereits Versicherungsleistungen zur Folge<br />
hatten, künftig noch erhebliche Kosten verursachen werden, die kaum kleiner ausfallen dürften als die<br />
gesamten bisherigen Silikosekosten <strong>der</strong> keramischen Industrie.<br />
119
Kosten <strong>der</strong> Silikosefälle nach Betriebsarten 1933 — 1957<br />
1933-1957<br />
1948-195T<br />
Betriebsarten<br />
in<br />
Franken<br />
in %<strong>der</strong><br />
U nfallkosten<br />
in<br />
Franken<br />
in%0 <strong>der</strong><br />
versicherten<br />
Lohn<br />
summe<br />
in %0 <strong>der</strong><br />
versicherten<br />
Lohn<br />
summe<br />
in % <strong>der</strong><br />
Unfallkosten<br />
Fabrikation von:<br />
Ziegel- und Backsteinen<br />
Steinzeug .<br />
Feuerfesten Steinen, Klin ker- und<br />
Steinzeugbodenplatten<br />
Sanitärkeramik, Wand platten<br />
Ofen kacheln<br />
Steingutgeschirr .<br />
Töpfergeschirr, Blumentöpfen und<br />
kunstkeramischen Gegenständen .<br />
Schleifscheiben<br />
Geschirr- und Elektroporzellan<br />
al.<br />
54 461<br />
322 409<br />
413 609<br />
100 088<br />
73 479<br />
235 796<br />
967<br />
662 321<br />
1 863 130<br />
0<br />
18<br />
11<br />
2<br />
4<br />
17<br />
0<br />
10<br />
0<br />
63<br />
42<br />
21<br />
24<br />
64<br />
1<br />
68<br />
53 549<br />
246 508<br />
278 495<br />
99 479<br />
65 431<br />
140 923<br />
967<br />
492 780<br />
1 378 132<br />
0<br />
22<br />
11<br />
3<br />
6<br />
19<br />
1<br />
76<br />
43<br />
30<br />
27<br />
62<br />
0 2<br />
69<br />
Im Jahre 1933 gelangte erstmals ein Silikosefall <strong>der</strong> keramischen Industrie zur Anmeldung. Seither<br />
mussten für Silikosen l 863 130 Franken aufgewendet werden. Die Herstellung von Töpfergeschirr,<br />
Blumentöpfen und kunstkeramischen Gegenständen weist keine Silikosekosten auf, und für die Fabrikation<br />
von Ziegel- und Backsteinen sowie von Schleifscheiben sind sie unbedeutend. Bei den übrigen Betriebsarten<br />
fallen die Silikosekosten jedoch ins Gewicht. In <strong>der</strong> Steinzeug-, Steingut- und Porzellanfabrikation<br />
betragen die Aufwendungen für die Silikose mehr als die Hälfte des Gesamtaufwandes für<br />
die Betriebsunfallversicherung; in diesen Betriebsarten entfallen also mehr Versicherungskosten auf die<br />
Silikose als auf die eigentlichen Unfälle.<br />
Im folgenden sei an einigen Beispielen gezeigt, wie sich in <strong>der</strong> keramischen Industrie die Quarzstaublunge<br />
entwickeln und auf die Arbeitsfähigkeit auswirken kann.<br />
Aus <strong>der</strong> Steinzeugindustrie<br />
Bevor <strong>der</strong> 1892 geborene Versicherte im Jahre 1918 die Arbeit am Trockenkollergang und in <strong>der</strong><br />
Mischerei einer Steinzeugfabrik aufnahm, kam er nie mit Quarzstaub in Berührung. Die damals gebräuchlichen<br />
Aufbereitungsmaschinen waren noch nicht mit Absaugvorrichtungen versehen. Die starke<br />
Staubentwicklung bei einem Quarzgehalt des Rohmaterials von 20 — 30 Prozent verursachte eine Silikose.<br />
Im Jahre 1937 festgestellt, führte sie nach 6 Jahren zu einer Invalidität von einem Drittel, nach einem<br />
weiteren Jahr zu zu einer solchen von zwei Dritteln und 1954 schliesslich zum Tode.<br />
Aus einer Fabrik für Sanitärkeramik<br />
Nachdem ein Verputzer während 30 Jahren in einer Giessabteilung gearbeitet hatte, wo die Staubbildung,<br />
abgesehen von <strong>der</strong>jenigen beim Reinigen des Lokals, gering war, wurde bei ihm eine leichte<br />
Silikose festgestellt. Eine 5 Jahre später durchgeführte Kontrolluntersuchung zeigte keine weitere Verschlimmerung<br />
des Gesundheitszustandes.<br />
Aus einer Fabrik für Steingutgeschirr<br />
Im Jahre 1911 kam <strong>der</strong> Versicherte in die Geschirrdreherei. Die durch schlechte Raumverhältnisse<br />
begünstigte Staubentwicklung, beson<strong>der</strong>s bei <strong>der</strong> Trockenbearbeitung, verursachte eine Silikose,<br />
120
welche erst 1945 erkannt wurde. 1952 musste eine Invalidenrente von 20 Prozent und zwei Jahre<br />
später eine solche von 40 Prozent zugesprochen werden. Nach Eingehen <strong>der</strong> Fabrik fand <strong>der</strong> Versicherte<br />
an<strong>der</strong>swo eine leichtere Beschäftigung, bei welcher er dank dem nur langsamen Fortschreiten<br />
<strong>der</strong> Krankheit noch heute teilweise arbeitsfähig ist.<br />
Aus einer Porzellanfabrik<br />
Seit seinem Schulaustritt war <strong>der</strong> Versicherte während 36 Jahren als Dreher tätig, bis er 1957 in die<br />
Sortiererei versetzt wurde. Die im Jahre 1956 festgestellte und seither unverän<strong>der</strong>t gebliebene Silikose<br />
mittleren Grades ist auf die Einwirkung des Staubes zurückzuführen, <strong>der</strong> sich infolge früherer mangelhafter<br />
Entlüftungsanlagen und beson<strong>der</strong>s beim Reinigen <strong>der</strong> Holzböden schädlich auswirken konnte.<br />
Ein an<strong>der</strong>er, 1888 geborener Versicherter soll vor seinem Eintritt in die Fabrik nie im Staub gearbeitet<br />
haben. Von 1920 bis 1942 war er in <strong>der</strong> seinerzeit staubreichen Materialaufbereitung und anschliessend<br />
drei Jahre im Brennhaus tätig. Bereits im Jahre 1937 traten Anzeichen einer Silikose auf. 1943 musste<br />
dem Versicherten eine Invalidenrente von 15 Prozent und zwei Jahre später eine solche von 80 Prozent<br />
zugesprochen werden. Der 1946 eingetretene Tod war eine Folge <strong>der</strong> Silikose.<br />
Diese Beispiele und die allgemeinen Erfahrungen weisen darauf hin, dass die Keramikersilikose nicht<br />
in jedem Falle eine zunehmende Arbeitsunfähigkeit und schliesslich den Tod zur Folge haben muss,<br />
wenn die Erkrankung dank prophylaktischen Untersuchungen frühzeitig erkannt und <strong>der</strong> Arbeitsplatz<br />
gewechselt o<strong>der</strong> die Staubgefährdung dort vermin<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> beseitigt wird. Es sei in diesem Zusammenhange<br />
erwähnt, dass bei den bis Ende 1957 erfassten Keramikersilikosen die durchschnittliche Dauer<br />
zwischen <strong>der</strong> Arbeitsaufnahme in einem Staubmilieu und <strong>der</strong> Feststellung <strong>der</strong> Silikose 24 Jahre betragen<br />
hat. Auch bei einer Beseitigung <strong>der</strong> Staubgefährdung ist demnach noch lange Zeit mit Anmeldungen<br />
von Silikosen zu rechnen.<br />
Der allgemeine technische Fortschritt und das Bestreben nach einer zweckmässigeren Gestaltung <strong>der</strong><br />
Arbeit brachte <strong>der</strong> keramischen Industrie nicht nur wirtschaftlichere Einrichtungen und Arbeitsmethoden,<br />
son<strong>der</strong>n gleichzeitig auch viele Möglichkeiten zur Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Silikosegefahr durch Verringerung<br />
<strong>der</strong> Belegschaft an den staubigen Betriebsstellen, durch Vermeidung schwerer körperlicher Arbeit und<br />
durch Eindämmen <strong>der</strong> Staubquellen.<br />
Von den zu ergreifenden Massnahmen ist in erster Linie an eineÄn<strong>der</strong>ung sraubbilden<strong>der</strong> Arbeitsver<br />
fahren zu denken. Die sogenannte Fontänentrocknung beispielsweise erlaubt das Mahlen, Trocknen und<br />
Sieben stauben<strong>der</strong> Rohmaterialien in völlig geschlossener, künstlich ventilierter Anlage mit weitgehend<br />
automatischer Steuerung. Auch ist es in vielen Fällen möglich, das trockene Mahlen und Mischen durch<br />
die staubfreie Nassverarbeitung zu ersetzen. Ferner können Kugelmühlen anstatt mit stark staubendem<br />
Quarzmehl mit gekörntem o<strong>der</strong> stückigem Quarz beschickt werden.<br />
Fon tänentrockn ungsanlage<br />
Siloauslauf mit Saugstutzen über Transportband<br />
121
~ Trockenkollergang (vorne) und Vibrationssieb<br />
(hinten)<br />
~ Plattenpresse mit Staubabsaugung an Stempel und Bürstvorrichtung<br />
Kapellen zum Abstauben und G lasieren<br />
von Sanitärkeramik auf Fliessband<br />
mit Staubabsaugung durch die<br />
wasserberieselte Rückwand<br />
Im weitern ist die Einrichtung von Staubabsaugeanlagen von hervorragen<strong>der</strong> Bedeutung. Die obenstehenden<br />
Bil<strong>der</strong> zeigen, wie Saugstutzen an Siloausläufen, Kollergängen und <strong>der</strong>gleichen angebracht und<br />
wie Trockenkollergänge und Siebe verschalt werden können.<br />
Voraussetzung einer guten Wirkung von Staubabsaugeanlagen ist, dass diese lüftungstechnisch richti<br />
gebaut und regelmässig gereinigt werden. Insbeson<strong>der</strong>e sind Saugstutzen möglichst nahe an den Staubquellen<br />
anzubringen und bei Nichtgebrauch — zur Erhöhung <strong>der</strong> Saugkraft <strong>der</strong> übrigen Saugstellen — zu<br />
schliessen.<br />
Auch beim Verputzen, Abstauben, Glasieren, Schleifen und bei ähnlichen Arbeiten an keramischen<br />
Erzeugnissen ist für eine wirksame Staubabsaugung zu sorgen.<br />
122<br />
~ ~<br />
Fur dte Staubbekämpfung sind ferner die Entlü ftung und die bauliche Gestaltung <strong>der</strong> Arbeitsräume von<br />
Bedeutung. Insbeson<strong>der</strong>e sollte die abgesogene Luft entstaubt und <strong>der</strong>art ins Freie geführt werden, dass<br />
ste mcht wie<strong>der</strong> in die Arbeitsräume zurückgelangt; denn auch filtrierte Luft kann noch gefährliche Staubbestandteile<br />
enthalten. Es ist auch zweckdienlich, rauhe Böden aus Holz o<strong>der</strong> Zement durch solche mit<br />
harter und glatter Oberfläche zu ersetzen, wozu zum Beispiel Steinzeug- o<strong>der</strong> Klinkerplatten geeignet sind.<br />
Falls es schliesslich durch all diese Massnahmen nicht o<strong>der</strong> nur ungenügend gelingt, die Staubbildung<br />
zu vermin<strong>der</strong>n, müssen persönliche Atemschutzgeräte wie Frischluft- o<strong>der</strong> Filtermasken zur Arbeit ge
tragen werden. Dies ist jedoch arbeitserschwerend und daher nur ein Behelf bei nicht lange dauernden<br />
Arbeiten im Staub. Nur gut verpasste, mit anerkannten Feinstaubfiltern versehene Masken bieten wirksamen<br />
Schutz; Gummischwämme, Wattefilter usw. sind untauglich und deshalb gefährlich, da sie nur<br />
einen Schutz vortäuschen.<br />
Nicht zuletzt gilt es die Arbeitsdisziplin zu för<strong>der</strong>n. Durch sorgfältiges Arbeiten beim Entleeren von<br />
Säcken o<strong>der</strong> beim Umschaufeln von Materialien können unnötige Staubaufwirbelungen verhin<strong>der</strong>t werden.<br />
Auch sollte die regelmässige Reinigung <strong>der</strong> Arbeitsplätze und -räume mit Staubsauger o<strong>der</strong> das<br />
Bodenkehren unter Verwendung von feuchtem Sägemehl o<strong>der</strong> Lappen zur Selbstverständlichkeit werden.<br />
Diese Reinigungsarbeiten werden mit Vorteil in Abwesenheit <strong>der</strong> Belegschaft durch beson<strong>der</strong>es Personal<br />
vorgenommen.<br />
Es ist zu erwarten, dass durch eine dem jeweiligen Stand <strong>der</strong> Technik angepasste Staubbekämpfung in<br />
den Betrieben sowie durch systematische technische Kontrollen und gesundheitliche Überwachung <strong>der</strong><br />
Versicherten die Gefahr <strong>der</strong> Entstehung neuer Silikosen auf ein Mindestmass herabgesetzt werden kann.<br />
123
Massnahmen zur Unfallverhütung<br />
Die Schweizerische <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt hat den Stand <strong>der</strong> getroffenen Unfallverhütungsmassnahmen<br />
in den <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> unterstellten Betrieben zu prüfen. Zu diesem Zwecke<br />
führt sie Betriebsbesuche durch und gibt, sofern notwendig, gestützt auf Art.65 K<strong>UVG</strong> entsprechende<br />
Weisungen. Auf Grund <strong>der</strong> Erfahrungen werden Richtlinien für allgemeine Massnahmen aufgestellt und<br />
Verordnungen ausgearbeitet. Zudem werden für bestimmte Maschinen Schutzvorrichtungen geschaffen<br />
und den Betrieben zu günstigen Bedingungen abgegeben. Nachdem sich immer mehr die Erkenntnis<br />
durchsetzt, dass die Unfallverhütung schon beim Planen beginnt, müssen vermehrt Anlagen, Maschinen<br />
und Geräte in bezug auf die Arbeitssicherheit beurteilt und ihre Hersteller beraten werden. Die Schweizerische<br />
<strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt befasst sich in beson<strong>der</strong>em Masse auch mit <strong>der</strong> Erziehung zur Sicherheit<br />
durch Aufklärung und Beratung im Schosse von Berufsverbänden und Belegschaften und durch Vorträge<br />
und Vorlesungen an Mittel- und Hochschulen. Schliesslich ist zu erwähnen, dass auf bestimmten Gebieten<br />
Fachinspektorate und Beratungsstellen bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Unfallverhütung mitwirken.<br />
Der folgende Bericht über die Tätigkeit in den Jahren 1953 — 1957 zeigt, dass die Bemühungen für die<br />
technische und die psychologische Unfallverhütung in weiten Kreisen Gehör finden; denn <strong>der</strong> Verkauf<br />
von Schutzmitteln hält an, die Begehren nach einer Begutachtung von Schutzvorrichtungen, Geräten und<br />
Anlagen nehmen zu und das Interesse an Vorführungen, Vorträgen und Veröffentlichungen wächst.<br />
Die Tätigkeit <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt<br />
Betriebsbesuche<br />
Die Betriebsbesuche erfolgen zur Prüfung des Standes <strong>der</strong> getroffenen Unfallverhütungsmassnahmen,<br />
zur Abklärung von Unfallursachen sowie auf Wunsch <strong>der</strong> Betriebsinhaber o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Hersteller von Anlagen,<br />
Maschinen und Geräten zur Besprechung von Sicherheitsfragen. In <strong>der</strong> Berichtsperiode wurden<br />
durch technische Inspektoren 34857 (24548) ' Betriebsbesuche vorgenommen, davon 2663 (2157) zur<br />
Abklärung von Unfallursachen. Durch Maschinisten sind bei 11324 Betriebsbesuchen Instruktionen<br />
über die richtige Verwendung von Schutzvorrichtungen erteilt worden. Zudem fanden Betriebsbesuche<br />
gemeinsam mit eidgenössischen Fabrikinspektoren statt, die bei <strong>der</strong> Unfallverhütung in den Fabriken<br />
mitwirken.<br />
1953 †19<br />
8 eisungen<br />
In <strong>der</strong> Berichtsperiode wurden gestützt auf Art.65 K<strong>UVG</strong> 42095 Weisungen erlassen. Im vorausgehenden<br />
Jahrfünft waren es 43634. Sie verteilen sich wie folgt:<br />
Weisungen nach Art. 65<br />
Weisungen betreffend<br />
Allgemeine Betriebsführung .<br />
Holzbearbeitung.<br />
Betriebsanlagen .<br />
Aufzugs- und an<strong>der</strong>e Transportvorrichtungen .<br />
Transmissionen, Zahnradgetriebe<br />
Metall bearbeitung, Augenschutz<br />
Hoch- und Tiefbau, Materialgewinnung, Seilbahnen<br />
Verschiedenes .<br />
Total<br />
1948-1952<br />
4 986<br />
18 071<br />
4 111<br />
815<br />
2 091<br />
10 557<br />
1 058<br />
l 945<br />
4 524<br />
11 574<br />
3 831<br />
1 113<br />
l 950<br />
14 253<br />
2 886<br />
1 964<br />
43 634 42 095<br />
' Die eingeklammerten Zahlenangaben beziehen sich auf die Jahre 1948 — 1952.<br />
124
Die Zahl <strong>der</strong> Weisungen ist hauptsächlich deshalb zurückgegangen, weil sich nach dem Inkrafttreten<br />
<strong>der</strong> bundesrätlichen Verordnung über die Unfallverhütung an Holzbearbeitungsmaschinen <strong>der</strong> Erlass von<br />
Weisungen weitgehend erübrigte. Im Hoch- und Tiefbau wird die Unfallverhütung grösstenteils durch<br />
Verordnungen geregelt, was die verhältnismässig kleine Zahl von Weisungen erklärlich macht. Dies gilt<br />
insbeson<strong>der</strong>e auch für die Verhütung <strong>der</strong> Silikose. Es sei auf das Kapitel über die Berufskrankheiten verwiesen.<br />
Wegen Zuwi<strong>der</strong>handlung gegen Weisungen mussten in <strong>der</strong> Berichtsperiode gegenüber 391 Betriebsinhabern<br />
Zwangsmassnahmen eigrißen werden. In allen Fällen handelte es sich um eine Prämienerhöhung<br />
gestützt auf Art. 103 Absatz 2 K<strong>UVG</strong>.<br />
Verordnungen und Richtlinien<br />
In den Jahren 1953 — 1957 wurden folgende Verordnungen und Richtlinien erlassen o<strong>der</strong> vorbereitet:<br />
«Verordnung über die Verhütung von Unfällen bei Sprengarbeiten» (24. Dezember 1954).<br />
«Verordnung über die Unfallverhütung an Holzbearbeitungsmaschinen» (16. Dezember 1955).<br />
«Verordnung über Berufskrankheiten» (6. April 1956).<br />
«Verordnung über die Unfallverhütung beim Erstellen und Betrieb von Luft- und Standseilbahnen mit<br />
Personenbeför<strong>der</strong>ung auf Baustellen und in gewerblichen sowie industriellen Betrieben» (15. Februar<br />
1957).<br />
«Entwurf zu einer Verordnung betreffend die Verhütung von Unfällen an Schleifmaschinen.»<br />
«Entwurf zu einer Verordnung über die Aufstellung, den Betrieb und den Unterhalt von Kranen. »<br />
«Richtlinien zur Verhütung von Unfällen bei <strong>der</strong> Verwendung von Seilriesen für den Holztransport. »<br />
«Richtlinien für die Aufstellung und den Betrieb von För<strong>der</strong>einrichtungen mit freihängendem Fahrstuhl,<br />
die gelegentlich für Kontroll- und Instandstellungsarbeiten in Silos benützt werden.»<br />
«Richtlinien für Taucherarbeiten».<br />
«Richtlinien zur Verhütung von Unfällen an bestehenden Sackaufzügen. »<br />
«Richtlinien zur Verhütung von Unfällen in Silos.»<br />
«Richtlinien zur Verhütung von Unfällen beim Arbeiten auf hölzernen Freileitungsstangen.»<br />
«Richtlinien zur Verhütung von Schlagwetterexplosionen. »<br />
«Richtlinien für die Erstellung von Hochbauten mit o<strong>der</strong> ohne Aussengerüst.»<br />
Zudem hat die Schweizerische <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt bei <strong>der</strong> Ausarbeitung von Unfallverhütungsvorschriften<br />
in folgenden Fachausschüssen mitgewirkt:<br />
Fachkommission für die Ausarbeitung von Richtlinien für den Schutz gegen ionisierende Strahlungen in<br />
<strong>der</strong> Medizin, in Laboratorien, gewerblichen und Fabrikationsbetrieben.<br />
Fachkollegium des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins für die Aufstellung von Vorschriften für<br />
explosionssicheres elektrisches Material.<br />
Expertenkommission <strong>der</strong> chemischen Industrie für die Ausarbeitung von allgemeinen Schutzmassnahmen.<br />
Technische Kommissionen für Farbanstriche und Kälteanlagen des Vereins Schweizerischer Maschinenindustrieller.<br />
SIA-Aufzugskommission zur Aufstellung eines Nachtrages und von Erläuterungen über die Normen für<br />
Errichtung, Betrieb und Unterhalt von Aufzugsanlagen.<br />
Unfallverhü tungsartikel<br />
An Betriebsinhaber und Maschinenverkaufer wurden folgende Unfallverhütungsartikel geliefert:<br />
125
Gelieferte Unfallverhütungsartikel<br />
Schutzbrillen.<br />
A rt <strong>der</strong> Sch u tzart i kel<br />
Ersatzgläser für Schutzbrillen<br />
Spaltkeilvorrichtungen<br />
Spaltkeile für Kreissägen<br />
Schutzhauben für Kreissägen<br />
Kehlschutzapparate.<br />
Hobelschutzapparate .<br />
Frässchutzapparate .<br />
Fingerschutzvorrichtungen für<br />
Frischluftgeräte<br />
Schweisserhelme .<br />
Pressen<br />
1948-1952<br />
197 896<br />
668 842<br />
2 113<br />
12 045<br />
4 400<br />
3 311<br />
3 629<br />
433<br />
1 802<br />
25<br />
33<br />
306 320<br />
1 027 615<br />
1 973<br />
11 050<br />
4 425<br />
2 614<br />
2 909<br />
214<br />
1 765<br />
51<br />
]9'<br />
Total ohne Schutzbrillen und Ersatzgläser . 27 791 24 974<br />
Gesamttotal . 894 529 1 358 909<br />
' Verkauf ab 1. 1. 57 eingestellt.<br />
Der Verkaufswert dieser zum grössten Teil durch die schweizerische Privatindustrie hergestellten<br />
Artikel belief sich in <strong>der</strong> Berichtsperiode auf 4594070 (4097934) Franken, wovon 1668274 (1057717)<br />
Franken auf Schutzbrillen und Ersatzteile entfielen.<br />
Der vermehrte Absatz von Schutzbrillen und Ersatzgläsern ist auf die Einführung <strong>der</strong> SU VA-Schutzbrillen<br />
in einigen Grossbetrieben zurückzuführen. Ferner hatte die erhebliche Zunahme <strong>der</strong> Betriebsbesuche<br />
zwangsläufig auch eine grössere Nachfrage nach Schutzbrillen zur Folge.<br />
Durch den vermehrten Absatz hat die Häufigkeit <strong>der</strong> schweren Augenunfälle mit Rentenfolge<br />
1928 1945 1951<br />
in neuerer Zeit abgenommen.<br />
††19 19 19<br />
Häufigkeit <strong>der</strong> Augenunfälle mit bleibendem Schaden<br />
Anzahl Fälle auf 10000 Versicherte<br />
Versicherungsgesamtheit<br />
1956-1957<br />
Metallindustrie. 4,7 2,8<br />
1,6<br />
10,1 5,5<br />
Bauwesen, Materialgewinnung und -verarbeitung<br />
~ ~<br />
Ub brige<br />
Betriebsunfallversicherung insgesamt 4,1 2,3 2,3 2,0<br />
1,6<br />
1,1<br />
2,8<br />
5,6<br />
1,0<br />
5,5<br />
0,9<br />
Von den gelieferten Schutzvorrichtungen — ohne die Brillen und Ersatzgläser — gingen 15221 (16970)<br />
o<strong>der</strong> 61 Prozent an Betriebsinhaber und 9753 (10821) o<strong>der</strong> 39 Prozent an Maschinenverkäufer. Auffallend<br />
ist <strong>der</strong> Rückgang <strong>der</strong> Zahl gelieferter Schutzvorrichtungen. Während <strong>der</strong> Kriegsjahre konnte wegen <strong>der</strong><br />
Schwierigkeiten in <strong>der</strong> Beschaffung von Rohmaterialien und Fertigprodukten <strong>der</strong> Bedarf an Schutzvorrichtungen<br />
nicht gedeckt werden. In <strong>der</strong> Nachkriegszeit zeigte sich dann ein spürbarer Nachholbedarf, <strong>der</strong><br />
in den Jahren 1948 — 1952 die Zahl <strong>der</strong> gelieferten Schutzvorrichtungen über das normale Mass hinaus ansteigen<br />
liess. Dies erklärt den Rückgang <strong>der</strong> Zahl verkaufter Schutzvorrichtungen in neuerer Zeit.<br />
Die Vereinbarung mit dem Verband schweizerischer Holzbearbeitungsmaschinenfabrikanten und dem<br />
Verband schweizerischer Maschinen- und Werkzeughändler, wonach die Verbandsmitglie<strong>der</strong> ihre Maschinen<br />
mit den von <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen<br />
liefern und auf dem Markt anbieten, war weiterhin wirksam.<br />
Die Monteure <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt brachten folgende Schutzvorrichtungen<br />
in den Betrieben an:<br />
126
Anbringen von Schutzvorrichtungen<br />
Spa<br />
Schutzhauben für Kreissägen .<br />
Hobelschutzapparate.<br />
Kehlschutzapparate<br />
Schutzvorrichtungen für Oberfräsen<br />
Fingerschutzvorrichtungen für Pressen und Stanzen<br />
Schutzapparate für Fusspendelpressen<br />
Total<br />
2 757<br />
1 856<br />
292<br />
1 023<br />
2 006<br />
1 656<br />
87<br />
940<br />
66<br />
11 289 9 901<br />
Im weitern sind 2237 (2348) früher montierte Schutzvorrichtungen repariert, revidiert o<strong>der</strong> an neue<br />
Maschinen versetzt worden.<br />
Abklörung technischer Fragen und Entwicklung neuer Schutzmittel<br />
In <strong>der</strong> Berichtsperiode wurden wie<strong>der</strong>um eine Reihe technischer Fragen abgeklärt und neue Schutzmittel<br />
geschaffen.<br />
Zur Verhütung von Unfällen an Pressen und Stanzen ist eine Fingerschutzvonichtung für Fusspendelpressen<br />
und in Anlehnung an die Entwicklung im Pressenbau eine Vorrichtung mit elektrischer Steuerung<br />
geschaffen worden.<br />
Für Handschleifmaschinen konnte ein Schutzverdeck ausgearbeitet werden, das den Erfor<strong>der</strong>nissen<br />
<strong>der</strong> Praxis im allgemeinen Rechnung trägt.<br />
Für Schmirgler und Schweisser wurde eine Schutzbrille entwickelt, die sich ohne weiteres über <strong>der</strong><br />
Korrekturbrille tragen lässt.<br />
Für die Handkreissäge ist ein Schutz ausgearbeitet worden, <strong>der</strong> ein sicheres Arbeiten mit dieser Maschine<br />
gewährleistet.<br />
In Zusammenarbeit mit interessierten Firmen sind eine Verriegelung <strong>der</strong> Zentrifugen, die Sicherung<br />
von kleinen Holzbearbeitungsmaschinen und sichere Fensterreinigungsanlagen entwickelt worden.<br />
Die zunehmende Verwendung von Baukranen hat die Schweizerische <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt veranlasst,<br />
sich mit <strong>der</strong> Sicherheit dieser Hebezeuge zu befassen. Sie liess durch Prof. Dr. Stüssi von <strong>der</strong> ETH<br />
ein Gutachten über die Berechnung von Turmdrehkranen ausarbeiten, das als Grundlage für die Kontrolle<br />
<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Schweiz verwendeten Krane dient.<br />
Auf dem Markt werden verschiedene dünne Schleifscheiben mit versetzter Nabe angeboten, die den<br />
Sicherheitsanfor<strong>der</strong>ungen nicht entsprechen. Zur Feststellung ihrer Zulässigkeit wurde ein Prüfprogramm<br />
aufgestellt.<br />
Durch systematische Kampagnen sind das Tragen von Sicherheitsschuhen und <strong>der</strong> Ersatz des Quarzsandes<br />
durch quarzfreie Strahlmittel bei Strahlarbeiten geför<strong>der</strong>t worden.<br />
Dank <strong>der</strong> Anschaffung eines Explosimeters kann nun die Kontrolle von Lack-, Trocken- und Einbrennöfen<br />
von <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt selbst vorgenommen werden. Ferner<br />
konnte sie sich vermehrt mit <strong>der</strong> Bestimmung von Konzentrationen chemischer Stoße in <strong>der</strong> Luft von<br />
Arbeitsräumen befassen.<br />
Schliesslich wurden auf Wunsch von Herstellern und Verkäufern zahlreiche Maschinen, Apparate,<br />
Einrichtungen, Geräte usw. vom Standpunkt <strong>der</strong> Unfallverhütung aus geprüft.<br />
A ufklä rung<br />
Auch in den letzten fünf Jahren fanden zahlreiche Vorführungen über das richtige Arbeiten mit Schutzvorrichtungen<br />
statt, so im Anstaltsgebäude in Luzern, im Schreinerhaus auf dem Bürgenstock anlässlich<br />
127
von Maschinistenkursen, in <strong>der</strong> Schweizerischen Holzfachschule in Biel und bei Veranstaltungen regionaler<br />
Berufsverbände.<br />
Der im Jahre 1952 ins Leben gerufene Informationsdienst entfaltete eine rege Tätigkeit. In Berufsschulen,<br />
an Anlässen von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Werkmeistern sowie vor Belegschaften<br />
grösserer Betriebe wurden zahlreiche Vorträge gehalten. Diese Veranstaltungen haben ein gutes<br />
Echo gefunden, und ihre jährliche Zahl stieg von 77 im Jahre 1954 auf 193 im Jahre 1957. Zur Belebung <strong>der</strong><br />
Vorträge wurden Unfallverhütungsfilme vorgeführt. Ausserdem beteiligte sich <strong>der</strong> Informationsdienst an<br />
<strong>der</strong> Redaktion <strong>der</strong> von aussenstehen<strong>der</strong> Stelle herausgegebenen «Illustrierten Zeitschrift für Arbeitsschutz»<br />
und am «Unfallverhütungskalen<strong>der</strong>».<br />
Im Jahre 1956 schritt die Schweizerische <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt zur Herausgabe <strong>der</strong> Zeitschrift<br />
«Schweizerische Blätter für Arbeitssicherheit». Diese Verößentlichungen, die vornehmlich praktischen<br />
Fragen gewidmet sind, sollen bei den gefährdeten Arbeitnehmern und den für sie Verantwortlichen den<br />
Sinn für die Sicherheit bei <strong>der</strong> Arbeit wecken und för<strong>der</strong>n.<br />
Erstmals im Jahre 1957 beteiligte sich die Schweizerische <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt an <strong>der</strong> Organisation<br />
und Durchführung eines dreitägigen Sprengkurses. Ebenfalls zum ersten Male veranstaltete sie,<br />
unter Leitung eines Spezialisten <strong>der</strong> Organisation für europäische Wirtschaftszusammenarbeit, zwei<br />
achttägige Instruktionskurse zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Unfallverhütung. Diesen Kursen liegt eine vom amerikanischen<br />
Experten I.ateiner ausgearbeitete Methode zugrunde.<br />
Die Tätigkeit von Fachinspektoraten und Beratungsstellen<br />
Die Mitwirkung <strong>der</strong> Fachinspektorate und Beratungsstellen, die sich im Auftrage <strong>der</strong> Schweizerischen<br />
<strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt mit <strong>der</strong> Unfallverhütung auf bestimmten Gebieten befassen, kommt in den<br />
folgenden Zahlen zum Ausdruck:<br />
Das Starkstrominspektorat des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins in Zürich erstattete in <strong>der</strong><br />
Beobachtungsperiode 1340(1278) Berichte über durchgeführte Untersuchungen, wovon 81 zur Abklärung<br />
<strong>der</strong> Ursache von Todesfällen.<br />
Das Inspektorat des Schweizerischen Vereins von Dampfkesselbesitzern in Zürich nahm in <strong>der</strong> Berichtsperiode<br />
29618 (22821) Inspektionen vor.<br />
Das Azetylen-Inspektorat des Schweizerischen Vereins für Schweisstechnik in Basel besichtigte 9759<br />
(9026) Anlagen in 7172 (5694) Betrieben, wovon 484 im Anschluss an Unfälle. Es erliess 13876 (9754)<br />
Weisungen.<br />
Das Technische Inspektorat schweizerischer Gaswerke in Zürich erteilte nach 512 (501) Betriebskontrollen<br />
395 (555) Weisungen.<br />
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung des Schweizerischen Baumeisterverbandes in Zürich führte<br />
5213 (3880) Kontrollbesuche auf Baustellen aus und berichtete über 293 (134) Untersuchungen schwerer<br />
Unfälle. Der Baumeisterverband veranstaltete wie<strong>der</strong>um eine grosse Zahl von Kursen und Vorträgen, an<br />
denen, unter Mitwirkung <strong>der</strong> Beratungsstelle, rund 10000Teilnehmer mit den Fragen <strong>der</strong> Unfallverhütung<br />
im Baugewerbe vertraut gemacht wurden.<br />
Die Forstwirtschaftliche Zentralstelle <strong>der</strong> Schweiz in Solothurn führte zahlreiche Holzerkurse durch,<br />
um die Arbeitskräfte über rationelle und unfallsichere Holzgewinnung zu belehren, und untersuchte etliche<br />
Holzerunfälle.<br />
Die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung in Bern, die sich mit <strong>der</strong> Bekämpfung <strong>der</strong><br />
ausserbetrieblichen Unfälle befasst, för<strong>der</strong>te beson<strong>der</strong>s die Sicherheit im Strassenverkehr durch Ausarbeitung<br />
von Projekten für bauliche Verbesserungen an gefährlichen Verkehrsstellen, Begutachtungen,<br />
Vorträge, Pressemitteilungen, Radiosendungen und Filmvorführungen. In Zusammenarbeit mit den zuständigen<br />
Behörden, Verkehrsverbänden und an<strong>der</strong>n Institutionen organisierte sie verschiedene wirkungsvolle<br />
Verkehrserziehungsaktionen. Auch in <strong>der</strong> Landwirtschaft und im Sport setzte die Beratungsstelle<br />
ihre Tätigkeit zur Verhütung von Unfällen fort.<br />
128
Das Unfallgeschehen als Zufallsvorgang<br />
Wie aus Unfallstatistiken ohne weiteres ersichtlich ist, übt <strong>der</strong> Zufall einen grossen Einfluss auf das<br />
Unfallgeschehen aus: die Zahl und vor allem die Kosten <strong>der</strong> Unfälle weisen beträchtliche zeitliche<br />
Schwankungen auf. Wohl lassen sich die Unfallursachen erklären, und es bestehen auch Verhütungsmöglichkeiten;<br />
aber in einem Versicherungsbestande ereignen sich die Unfälle unregelmässig, also in zufälliger<br />
Art, und ihre Folgen sind sehr unterschiedlich. Dieser Umstand erschwert die zuverlässige Beurteilung<br />
des Unfallrisikos; denn die Zufallsschwankungen lassen die systematischen Verän<strong>der</strong>ungen des Unfallrisikos<br />
nur bei grossen Versicherungsbeständen hervortreten. Solche Bestände, die noch bedeutend grösser<br />
sein müssten als gewöhnlich angenommen wird, sind aber im allgemeinen nicht vorhanden. Da in <strong>der</strong><br />
Praxis auch das Unfallrisiko kleiner Versicherungsbestände zu beurteilen ist, dürfte allgemein interessieren,<br />
wie <strong>der</strong> Bereich <strong>der</strong> zufälligen Schwankungen des Unfallrisikos abgegrenzt und eine dem Risiko<br />
angepasste Prämie bestimmt werden kann.<br />
Zunächst wird, um das Verständnis für das Folgende zu erleichtern, ein Überblick über das Prämienwesen<br />
in <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> gegeben. Dann sollen Beispiele das Wirken des Zufalls<br />
veranschaulichen. Schliesslich wird das als Zufallsvorgang aufgefasste Unfallgeschehen auf Grund<br />
neuerer mathematisch-statistischer Erkenntnisse beschrieben. Dabei wird eine Methode entwickelt,<br />
welche die Schlüssigkeit von Risikoerfahrungen zu beurteilen gestattet und deshalb auch <strong>der</strong> Prämienbemessung<br />
nutzbar gemacht werden kann.<br />
Das Prämienwesen<br />
A llgeineiiies<br />
Die obligatorische <strong>Unfallversicherung</strong> versichert die Arbeiter und Angestellten <strong>der</strong> ihr gemäss K<strong>UVG</strong><br />
unterstellten Betriebe. Prämienpflichtige Versicherungseinheit ist <strong>der</strong> Betrieb o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Betriebsteil; sofern<br />
itämlich für verschiedene, bestimmt abgegrenzte Teile <strong>der</strong> Belegschaft bedeutsame Unterschiede im Unfallrisiko<br />
bestehen, kann ein unterstellter Betrieb in Betriebsteile aufgeteilt werden. Gegenstand <strong>der</strong> Versicherung<br />
sind die Betriebs- und die Nichtbetriebsunfälle. Als Betriebsunfälle gelten im allgemeinen Unfälle,<br />
die <strong>der</strong> versicherten Person während <strong>der</strong> Arbeit für den Betrieb zustossen; gewisse Berufskrankheiten<br />
und berufliche Schädigungen sind den Betriebsunfällen gleichgestellt. Als Nichtbetriebsunfälle<br />
gelten alle übrigen Unfälle, namentlich auch die Unfälle auf dem Wege zu und von <strong>der</strong> Arbeit. Die Versicherungsleistungen<br />
bestehen im wesentlichen in <strong>der</strong> Bezahlung <strong>der</strong> Krankenpflegekosten und eines<br />
Krankengeldes sowie in <strong>der</strong> Ausrichtung von Invaliden- und Hinterlassenenrenten.<br />
Die Betriebs- und die Nichtbetriebsunfallversicherung werden unabhängig voneinan<strong>der</strong> nach dem<br />
Grundsatz <strong>der</strong> Gegenseitigkeit durchgeführt. In <strong>der</strong> Jahresrechnung stehen den Prämien-, Zins- und Regresseinnahmen<br />
die Ausgaben für die Versicherungsleistungen einschliesslich die Rückstellung für unerledigte<br />
Unfälle und die Unkosten gegenüber. Bei den Versicherungsleistungen ist <strong>der</strong> Barwert aller Ausgaben<br />
einzustellen, welche die im Rechnungsjahr eingetretenen Unfälle erwartungsgemäss noch erfor<strong>der</strong>n<br />
(Kapitaldeckungsverfahren). Um Überschüsse o<strong>der</strong> Fehlbeträge <strong>der</strong> Jahresrechnung aufzufangen, verfügen<br />
beide Versicherungsabteilungen je über einen Ausgleichsfonds. Über diesen Fonds steht <strong>der</strong> beiden<br />
Abteilungen gemeinsame und bis zu einer gesetzlich festgelegten Höhe zu äufnende Reservefonds. Darlehen<br />
daraus sind durch die betreffende Versicherungsabteilung zu verzinsen und zurückzuzahlen.<br />
Die Prämien eines Betriebes o<strong>der</strong> Betriebsteils richten sich nicht nach <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Versicherten,<br />
son<strong>der</strong>n nach <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme. Die Prämien werden berechnet auf Grund <strong>der</strong> in den Tarifen<br />
festgelegten Prämiensätze, welche den Prämienbetrag für je 1000 Franken des versicherten Lohnes angeben.<br />
Die Tarifprämie setzt sich zusammen aus <strong>der</strong> Netto- o<strong>der</strong> Risikoprämie und dem Unkostenzuschlag;<br />
aus <strong>der</strong> Nettoprämie sind die Unfallkosten (Versicherungsleistungen abzüglich Regressein<br />
129
nahmen) und aus dem Unkostenzuschlag die nicht durch Zinsüberschüsse gedeckten Unkosten (Verwaltungskosten<br />
und Unfallverhütungskosten) zu finanzieren. Die Prämien werden für jede Versicherungsabteilung<br />
geson<strong>der</strong>t berechnet und von den Betriebsinhabern erhoben; dabei fallen die Betriebsunfa)1<br />
prämien ganz zu ihren Lasten, während die Nichtbetriebsunfallprämien den Versicherten verrechnet<br />
werden können.<br />
Bevor die Umstände, welche die Prämienbemessung in <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> erschweren,<br />
dargelegt werden, sei im folgenden vorerst <strong>der</strong> Zweck <strong>der</strong> Versicherung näher betrachtet. I m<br />
weitern wird darauf hinzuweisen sein, dass die Prämien abgestuft werden müssen und dass es möglich ist,<br />
die Prämien auf Beginn eines Rechnungsjahres den Erfahrungen anzupassen; ferner kann je<strong>der</strong>zeit eine<br />
Anpassung an verän<strong>der</strong>te Betriebsverhältnisse vorgenommen werden. Im Gegensatz zur Betriebsunfallversicherung<br />
bietet die Nichtbetriebsunfallversicherung hinsichtlich <strong>der</strong> Prämienbemessung keine nennenswerten<br />
Schwierigkeiten; denn es hat sich als ausreichend erwiesen, die Nichtbetriebsunfallprämien<br />
nur nach dem Geschlecht <strong>der</strong> Versicherten abzustufen, wodurch sich zwei sehr umfangreicheVersicherungsbestände<br />
ergeben. Deshalb beziehen sich die folgenden Darlegungen nur noch auf die Betriebsunfallversicherung.<br />
Es sei aber erwähnt, dass sie sinngemäss auch für die Nichtbetriebsunfallversicherung gelten.<br />
Der Z>
Kollektivprämie ist im übrigen auch gegeben bei nur kurzfristig unterstellten Betrieben und ganz allgemein<br />
im Hinblick darauf, dass die Unterstellung eines Betriebes unter das Versicherungsobligatorium<br />
dahinfallen kann. Demnach hat sich <strong>der</strong> Umfang <strong>der</strong> Solidarität nach <strong>der</strong> Grösse des Betriebes beziehungsweise<br />
<strong>der</strong> Schlüssigkeit <strong>der</strong> betrieblichen Erfahrungen zu richten.<br />
Die Abstufung <strong>der</strong> Prätttien<br />
Durch eine Abstufung <strong>der</strong> Prämien soll einerseits die bei den einzelnen Betriebsarten verschiedene<br />
objektive Unfallgefahr und an<strong>der</strong>seits <strong>der</strong> Einfluss unterschiedlicher betrieblicher Umstände auf die Unfallgefahr<br />
berücksichtigt werden. Dies erfolgt durch die Glie<strong>der</strong>ung des Prämientarifs in Gefahrenklassen<br />
und durch ihre Unterteilung in Gefahrenstufen mit unterschiedlichen Prämiensätzen.<br />
Die Betriebe o<strong>der</strong> Betriebsteile sind also nach objektiven Risikomerkmalen zu klassieren. Als solche<br />
fallen in Betracht: Rohmaterialien, Arbeitsverfahren, Maschinen, Einrichtungen, Produkte und so weiter.<br />
Es handelt sich demnach um Merkmale, die mit <strong>der</strong> Ursache und <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Unfälle zusammenhängen<br />
und deshalb die Unfallgefahr kennzeichnen. Die hinsichtlich <strong>der</strong> objektiven Unfallgefahr gleichartigen<br />
Versicherungseinheiten werden in Gefahrenklassen vereinigt. Auf diese Weise ergibt sich praktisch eine<br />
Gefahrenklassenbildung nach Industrie- und Gewerbezweigen.<br />
Die Aufteilung des gesamten Versicherungsbestandes in verschiedene Risikogemeinschaften stellt ein<br />
beson<strong>der</strong>es Problem dar. Die geson<strong>der</strong>te Klassierung <strong>der</strong> Risikoeinheiten ist nur so weit angezeigt, als<br />
zwischen den objektiven Merkmalen nachweisbar risikobedeutende Unterschiede bestehen. Die zuverlässige<br />
Beurteilung von Risikounterschieden erfor<strong>der</strong>t umfangreiche Erfahrungen, also grosse Gefahr enklassen.<br />
Durch die Bildung hinreichend grosser Risikogemeinschaften werden aber vielfach in bezug auf<br />
die objektive Unfallgefahr nicht nur gleichartige, son<strong>der</strong>n auch ähnliche Betriebe zusammengefasst. Es<br />
hätte jedoch keinen Sinn, Unterschiede in den objektiven Risikomerkmalen berücksichtigen zu wollen,<br />
wenn dabei das Risiko nicht mehr zuverlässig gemessen werden könnte. Bei <strong>der</strong> Lösung dieses Problems<br />
ist ein sowohl den Gegebenheiten als auch den Möglichkeiten angepasster Weg zu beschreiten.<br />
Innerhalb einer Gefahrenklasse sind Gefahrenstufen zu bilden, denen je ein bestimmter Prämiensatz<br />
zuzuordnen ist. In diese Gefahrenstufen werden die Betriebe und Betriebsteile in Würdigung ihrer subjektiven<br />
Risikomeikmale eingereiht. Diese Merkmale umfassen die betrieblichen Umstände, die auf die<br />
Unfallgefahr von Einfluss sind. Ihre Beurteilung bei einer Risikoeinheit besteht in <strong>der</strong> Abschätzung des<br />
Gewichtes <strong>der</strong> verschiedenen objektiven Risikomerkmale und in <strong>der</strong> Bewertung <strong>der</strong> im Hinblick auf<br />
bedeutsame objektive Unfallgefahren getroffenen Unfallverhütungsmassnahmen. Im Rahmen einer Gefahrenklasse<br />
kann es also hinsichtlich <strong>der</strong> subjektiven Unfallgefahr Untergruppen geben, bestehend aus<br />
einzelnen o<strong>der</strong> mehreren Betrieben.<br />
Die getrennte Einreihung objektiv gleichartiger Betriebe o<strong>der</strong> Betriebsteile in verschiedene Gefahrenstufen<br />
setzt gesicherte Unterschiede in den subjektiven Unfallgefahren voraus. Versicherungseinheiten,<br />
bei denen alle o<strong>der</strong> einzelne subjektive Risikomerkmale keinen ins Gewicht fallenden Unterschied aufweisen,<br />
bilden hinsichtlich dieser Risikomerkmale innerhalb einer Gefahrenklasse eine Untergruppe und<br />
sind gleich einzureihen. Die Vielfalt <strong>der</strong> bedeutsamen Risikounterschiede innerhalb einer Gefahrenklasse<br />
gibt einen Hinweis auf die erfor<strong>der</strong>liche Zahl <strong>der</strong> Gefahrenstufen. Erstmalig muss ein Betrieb o<strong>der</strong> ein<br />
Betriebsteil in <strong>der</strong> für ihn in Betracht fallenden Gefahrenklasse in jene Gefahrenstufe eingereiht werden,<br />
die dem mittleren Risiko <strong>der</strong> Gefahrenklasse beziehungsweise <strong>der</strong> entsprechenden Untergruppe angemessen<br />
ist. Die Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Betriebsverhältnisse erfor<strong>der</strong>t eine Überprüfung <strong>der</strong> Gefahrenklasseno<strong>der</strong><br />
Gefahrenstufenzuteilung. Die Veranlassung zu einer Zuteilungsän<strong>der</strong>ung kann aber nur eine bedeutsame<br />
Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> subjektiven Risikomerkmale sein, beispielsweise eine ins Gewicht fallende Än<strong>der</strong>ung<br />
des Standes <strong>der</strong> getrolfenen Unfallverhütungsmassnahmen.<br />
Die Prämiensätze <strong>der</strong> Gefahrenstufen innerhalb einer jeden Gefahrenklasse sind so zu bemessen, dass<br />
aus den Prämien die auf sie entfallenden Ausgaben voraussichtlich bestritten werden können. Auf Grund<br />
<strong>der</strong> Erfahrungen ist also <strong>der</strong> mutmassliche, künftige Prämienbedarf für Gefahrenklassen, Untergruppen<br />
und Betriebe o<strong>der</strong> Betriebsteile zu schätzen. Im Hinblick auf den Versicherungszweck handelt es sich dabei<br />
um die Zumessung einer von zufallsartigen Risikoschwankungen unbeeinflussten Durchschnittsprämie.<br />
131
Die risikomässige Verteilung des Gesamtprämienbedarfes auf die Risikogemeinschaften und schliesslich<br />
auf die Prämienzahler erfor<strong>der</strong>t demnach die Kenntnis des Zufallsbereiches <strong>der</strong> verschiedenen Risiken.<br />
Für die fortwährende Überprüfung <strong>der</strong> Prämientarif- und Einreihungsgrundlagen, die wegen <strong>der</strong> zeitlichen<br />
Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Unfallgefahren notwendig ist, wird also eine zeitnahe <strong>Statistik</strong> über die Unfallzahl,<br />
die Unfallkosten und die Unfallursachen bei den verschiedenen in Betracht fallenden Versicherungsbeständen<br />
benötigt. Im weitern müssen zeitgemässe Richtlinien betreffend die zumutbaren Unfallverhütungsmassnahmen<br />
aufgestellt werden. Ferner sind Betriebsbeschreibungen mit den bedeutsamen<br />
Risikomerkmalen sowie mit einer Beurteilung des Standes <strong>der</strong> getroffenen Unfallverhütungsmassnahmen<br />
einzuholen. Schliesslich ist ein mathematisch-statistisches Verfahren zur Prüfung <strong>der</strong><br />
Schlüssigkeit <strong>der</strong> Erfahrungen notwendig.<br />
Die Anpassung <strong>der</strong> Prämien an die Erfahrungen<br />
Die durch den Risikoverlauf notwendig gewordenen Prämienanpassungen können durch eine Än<strong>der</strong>ung<br />
des Prämientarifs o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Einreihung <strong>der</strong> Betriebe erfolgen. Än<strong>der</strong>ungen des Prämientarifs sind<br />
spätestens zwei Monate, solche <strong>der</strong> Einreihung spätestens einen Monat vor dem Beginn eines Rechnungsjahres<br />
vorzunehmen. Diese Möglichkeit <strong>der</strong> verhältnismässig kurzfristigen Prämienanpassungen an ein verän<strong>der</strong>tes<br />
Risiko erübrigt vorsorgliche Prämienzuschläge gegen die Folgen eines nicht voraussehbaren<br />
Risikoverlaufes und dürfte einer <strong>der</strong> Gründe sein, warum <strong>der</strong> Gesetzgeber keine Prämienrückerstattung<br />
vorgesehen hat.<br />
ln dieser Beziehung unterscheidet sich die obligatorische <strong>Unfallversicherung</strong>erheblich von <strong>der</strong> privaten<br />
Versicherung. Es können zum vorneherein minimale Prämien angesetzt werden. Irgendwelche Sicherheitszuschläge,<br />
auch solche, die bei sogenanntem schadenfreiem Verlauf teilweise wie<strong>der</strong> zurückerstattet<br />
würden, sind nicht zu erheben. Lediglich zur Überwindung finanzieller Engpässe infolge ungünstigen<br />
Risikoverlaufs bis zur Auswirkung <strong>der</strong> Prämienanpassungen werden zweckgebundene Sicherheitsreserven<br />
benötigt. Dazu dienen, wie bereits erwähnt, die Ausgleichsfonds <strong>der</strong> Versicherungsabteilungen und <strong>der</strong><br />
gesetzlich vorgeschriebene Reservefonds.<br />
Das <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt zukommende Monopol sowie das Versicherungsobligatorium<br />
sind in ihren Auswirkungen mit versicherungstechnischen Sicherheitsmassnahmen zu vergleichen.<br />
Dadurch wird <strong>der</strong> Risikoausgleich auf breitester Grundlage ermöglicht und die einseitige Zusammensetzung<br />
des Versicherungsbestandes verhin<strong>der</strong>t. Ferner ist in diesem Zusammenhang das als<br />
Finanzierungssystem vorgeschriebene Kapitaldeckungsverfahren zu nennen, das die Leistungsansprüche<br />
<strong>der</strong> Rentner unabhängig von <strong>der</strong> zukünftigen finanziellen Leistungsfähigkeit <strong>der</strong> Prämienzahler sicherstellt.<br />
Die Möglichkeit <strong>der</strong> verhältnismässig raschen Prämienanpassung darf aber nicht dazu führen, je<strong>der</strong><br />
Risikoschwankung folgen zu wollen. Nur bedeutsame Entwicklungen sind zu berücksichtigen. Das zeitweilige<br />
Ausbleiben von Unfällen o<strong>der</strong> geringe Unfallkosten während eines gewissen Zeitraumes sind für<br />
sich allein kein Nachweis einer Risikoän<strong>der</strong>ung. Ebenso weist ein Unterschied zwischen den bezahlten<br />
Prämien und den ausgerichteten Versicherungsleistungen an sich nicht auf eine ungenügende Prämienanpassung<br />
hin. Das Bestehen solcher Unterschiede liegt vielmehr im Wesen <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong><br />
begründet; die Rückschau in irgendeinem Zeitpunkt zeigt immer Abweichungen zwischen<br />
Prämien und Versicherungsleistungen. Es wäre jedoch abwegig, den Ausgleich fortwährend durch<br />
Prämiennachfor<strong>der</strong>ungen o<strong>der</strong> -rückerstattungen herbeiführen zu wollen. Die Abweichungen sind vielmehr,<br />
sofern sie aus irgendwelchen Gründen grösser sind als <strong>der</strong> Zufallsbereich, bei <strong>der</strong> Bemessung <strong>der</strong><br />
künftigen Prämien mitzuberücksichtigen. Dadurch wird das hie und da aufgeworfene Problem <strong>der</strong><br />
Prämienrückerstattung bei günstigem Risikoverlauf am zweckmässigsten gelöst; eine an<strong>der</strong>e Lösung ist<br />
aus guten Gründen vom Gesetzgeber auch nicht vorgesehen worden.<br />
Aus diesen Hinweisen geht hervor, dass sich bei <strong>der</strong> Prämienbemessung hauptsächlich die Frage nach<br />
<strong>der</strong> Bedeutsamkeit beobachteter Risikoschwankungen stellt. Es sind also Untersuchungen anzustellen,<br />
die zu beurteilen erlauben, ob es sich bei den beobachteten Schwankungen um blosse Zufallserscheinungen<br />
o<strong>der</strong> um wirkliche Risikoverän<strong>der</strong>ungen handelt.<br />
132
Das Wirken des Zufalls<br />
Da die zufälligen Schwankungen <strong>der</strong> Unfallzahl und <strong>der</strong> Unfallkosten weitgehend vom Umfang des<br />
Versichertenbestandes abhängen, ist es von Interesse, zuerst die G>össe <strong>der</strong> vorhandenen Risikoeinheiten<br />
zu kennen. Als Mass für die Grösse dient die Zahl <strong>der</strong> Vollarbeiter, die ein Schätzwert für die Zahl<br />
<strong>der</strong> Versicherten ist; ein Vollarbeiter entspricht einer Arbeitszeit von 300 achtstündigen Arbeitstagen, das<br />
heisst 2400 Arbeitsstunden.<br />
Grösse <strong>der</strong> Betriebsteile 1957<br />
Vollarbciter<br />
Betriebsteile<br />
mit... Vollarbeitern<br />
absolut in %<br />
0— 1.<br />
3.<br />
10.<br />
10— 30.<br />
30— 100 .<br />
100— 300 .<br />
mehr als 300<br />
26 591<br />
20 942<br />
21 059<br />
10 711<br />
5 135<br />
1 355<br />
438<br />
30,8<br />
24,3<br />
24,4<br />
12,4<br />
6,0<br />
1,6<br />
0,5<br />
Total. 86 231 100,0<br />
Bei rund 30 Prozent <strong>der</strong> Risikoeinheiten sind nur vorübergehend Versicherte vorhanden und bei vier<br />
Fünfteln besteht <strong>der</strong> Versichertenbestand höchstens aus 10 vollbeschäftigen Personen. Im Durchschnitt<br />
entfallen auf einen Betrieb o<strong>der</strong> Betriebsteil 14 Vollarbeiter. 84 Prozent <strong>der</strong> Risikoeinheiten weisen einen<br />
kleineren o<strong>der</strong> höchstens so grossen Versichertenbestand auf, und nur 16 Prozent sind also grösser als <strong>der</strong><br />
Durchschnittsbetrieb. Der Grossteil <strong>der</strong> Risikoeinheiten ist demnach sehr klein. Der durchschnittliche<br />
Vollarbeiterbestand beträgt sogar nur noch 7, wenn die verhältnismässig wenigen Betriebe mit mehr als<br />
100 Vollarbeitern (2 Prozent), auf welche rund die Hälfte <strong>der</strong> Versicherten entfällt, ausser Betracht gelassen<br />
werden.<br />
Schon diese Feststellungen weisen darauf hin, dass im allgemeinen die Beurteilung des Unfallrisikos<br />
eines einzelnen Betriebes allein auf Grund seiner Risikoerfahrungen unmöglich ist. Dies wird noch oAensichtlicher,<br />
wenn die Zahl <strong>der</strong> von den Risikoeinheiten jährlich gemeldeten Betriebsunfälle betrachtet<br />
wird. 1m Verlaufe eines Jahres bleiben 58 Prozent <strong>der</strong> Betriebsteile überhaupt ohne Betriebsunfälle, und bei<br />
10 Prozent ereignen sich lediglich Bagatellunfälle. Demnach melden 68 Prozent <strong>der</strong> Risikoeinheiten<br />
während eines Jahres keine ordentlichen Betriebsunfälle.<br />
Die Betriebsteile nach <strong>der</strong> jährlichen Unfallzahl<br />
Beobachtungen 1953 und 1958<br />
0<br />
Ordentliche<br />
t riebsunfäl le<br />
2<br />
— 19<br />
und mehr .<br />
al<br />
Bet riebstei le mit... o rde<br />
Betriebsunfällen während e<br />
in Prozenten<br />
68<br />
21<br />
10<br />
1<br />
100<br />
133
Aber auch die Zahl <strong>der</strong> Risikoeinheiten, die in mehreren sich folgenden Jahren keinen ordentlichen<br />
Betriebsunfall aufweisen, ist verhältnismässig gross; so ereignet sich beispielsweise bei <strong>der</strong> Hälfte aller<br />
Betriebe o<strong>der</strong> Betriebsteile in 3 aufeinan<strong>der</strong>folgenden Jahren kein ordentlicher Betriebsunfall.<br />
Betriebsteile ohne ordentliche Betriebsunfälle in mehreren Jahren<br />
Beobachtungen 1956 — 1958<br />
Von beson<strong>der</strong>em Interesse ist auch noch die Häufigkeit <strong>der</strong> seltenen, aber sehr kostspieligen Betriebsunfälle<br />
mit Rentenfolgen. 2 Prozent sämtlicher Betriebsunfälle haben eine Invalidität o<strong>der</strong> den Tod zur<br />
Folge. Auf diese verhältnismässig wenigen Ereignisse entfallen aber nahezu zwei Dr ittel <strong>der</strong> Unfallkosten<br />
<strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung. Eine Untersuchung hat ergeben, dass in einem Jahr nur 4 Prozent aller<br />
Risikoeinheiten Rentenfälle aufweisen; aber nur bei 1 Prozent aller Betriebsteile ereignen sich sowohl in<br />
diesem als auch im folgenden Jahre Rentenfälle. Nur bei grossen Versichertenbeständen häufen sich<br />
zeitlich die schweren Betriebsunfälle, bei kleinen sind sie selten.<br />
Die Betriebsteile nach Rentenfällen<br />
Beobachtungen 1952 und 1953<br />
96 "„Betriebsteile oh»e Rcntenfallc während<br />
eines Jahres<br />
3 "„Betriebsteile»~it Rentenfällen während<br />
dieses Jahres, aber ohne Rentenfalle im folgenden<br />
Jahr<br />
1 "„Betriebsteile»ii( Rentenfällen während<br />
dieses «nd des folgenden Jahres<br />
Die folgenden Angaben vermitteln eine Vorstellung von <strong>der</strong> geringen Zahl <strong>der</strong> Unfälle, die eine Risikoeinheit<br />
durchschnittlich meldet: in einem <strong>der</strong> mittleren Betriebsgrösse entsprechenden Bestand von 14<br />
Versicherten ereignet sich<br />
— ein Betriebsunfall ohne Rentenfolgen alle 4 Monate,<br />
— ein Invaliditätsfall alle 20 Jahre und<br />
— ein Todesfall alle 200 Jahre.<br />
Bei einer <strong>der</strong>artigen Seltenheit <strong>der</strong> kostenmässig entscheidend ins Gewicht fallenden Rentenfälle kann in<br />
angemessener Zeit für den einzelnen Betrieb keine ausreichende Risikoerfahrung gewonnen werden. Demzufolge<br />
ist es im allgemeinen unmöglich, das Unfallrisiko eines einzelnen Betriebes ausschliesslich auf<br />
Grund seiner eigenen Risikoerfahrungen zu beurteilen.<br />
134
~ O<br />
Die folgende Darstellung zeigt die zeitliche Entwicklung <strong>der</strong> Betriebsunfallhäufigkeiten bei verschieden<br />
grossen Versichertenbeständen.<br />
Betriebsun fa1 lc<br />
auf 1000<br />
Vollarbeiter<br />
1200<br />
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />
Betriebsunfallhaufigkei ten<br />
Betriebsun fal 1 versicherung<br />
Gefahrenklasse 13 a (Maschinenbau)<br />
Grosser Betrieb aus 13 a<br />
Mittelgrosser Betrieb aus 13a<br />
Kleinerer Betrieb aus 13a<br />
I 200 000 Vollarbeitcr Ende 1958<br />
60 000<br />
5 2PP<br />
80<br />
30<br />
O<br />
~ ~<br />
~ ~<br />
~ ~<br />
1000<br />
OO<br />
~ O<br />
~ O<br />
~ ~<br />
t ~<br />
~ ~<br />
O<br />
I<br />
600<br />
r<br />
~ ~<br />
~ ~<br />
~ ~<br />
~ ~<br />
~ ~<br />
~ ~<br />
~ ~<br />
~ ~<br />
~ l<br />
OOO OO ~ O ~<br />
400<br />
I<br />
r<br />
L<br />
200 /<br />
O / /<br />
l,<br />
~ O O ~<br />
V<br />
j<br />
~ ~ ~ ~<br />
1<br />
0<br />
1938<br />
1943<br />
1948<br />
1953<br />
1958<br />
135
Die zeitlichen Verän<strong>der</strong>ungen, denen die Betriebsunfallhäufigkeit unterliegt, gehen meistens aul' zufällige<br />
Schwankungen zurück, die mit abnehmendem Versichertenbestand an Bedeutung gewinnen.<br />
Schon bei mittelgrossen Betrieben und erst recht bei den zahlreichen Kleinbetrieben schwankt die Unfallhaufigkeit<br />
von einem Jahr zum an<strong>der</strong>n oft um mehrere hun<strong>der</strong>t Prozent. So können systematische Verän<strong>der</strong>ungen<br />
vollständig überdeckt werden. Diese Erscheinung zeigt sich noch deutlicher bei den jährlichen<br />
Unfallkosten einzelner Betriebsteile.<br />
Im Jahre1957 entfielen im Durchschnitt auf eine Risikoeinheit an Unfallkosten (Versicherungsleistungen<br />
abzüglich Regresseinnahmen, ohne Unkosten) rund 1600 Franken o<strong>der</strong> 15 Promille <strong>der</strong> mittleren<br />
versicherten Lohnsumme von 107 000 Franken. Werden die wenigen Betriebe mit mehr als 100 Vollarbeitern,<br />
auf die nicht ganz die Hälfte <strong>der</strong> Unfallkosten <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung entfallen, ausser<br />
Betracht gelassen, so trifft es auf jeden <strong>der</strong> verbleibenden 84 500 Betriebsteile noch rund 800 Franken.<br />
Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, dass ein einziger Betriebsunfall, für den im Mittel rund 500 Franken<br />
aufgewendet werden müssen, zwischen 0 und mehr als 300000 Franken kosten kann, je nach Verletzungsart,<br />
Heilungsdauer, bleibenden Folgen, Alter des Verunfallten, versichertem Lohn, Familienzusammensetzung<br />
und so weiter. Da Eintreten o<strong>der</strong> das Ausbleiben schwerer Unfälle kann das Bild <strong>der</strong> Unfallkosten<br />
eines Betriebes vollständig än<strong>der</strong>n. Wie sich ein schwerer Unfall in <strong>der</strong> Unfallkostenstatistik eines<br />
kleineren Betriebes auswirkt, zeigt die nebenstehende Illustration eines aus vielen ähnlichen Fällen<br />
herausgegriffenen Beispiels. Jahrelang treten nur geringe o<strong>der</strong> sogar keine Unfallkosten auf. Irgendwann<br />
ereignet sich ein kostspieliger Unfall, <strong>der</strong> das Unfallkostenbild auf Jahrzehnte hinaus beherrschen dürfte.<br />
Ein <strong>der</strong>artiges Ereignis kann zweifellos allein nicht als Beweis für ein erhöhtes Unfallrisiko gelten. Ebensowenig<br />
kann — wie viele Prämienzahler glauben — das zufällige Ausbleiben grosser Unfallkosten ohne<br />
weiteres als Begründung für ein Prämienermässigungsgesuch dienen.<br />
Eine unmittelbare Folge des Auftretens schwerer Unfälle ist <strong>der</strong> grosse Unfallkostenbereich, <strong>der</strong><br />
einige hun<strong>der</strong>ttausend Franken betragen kann. Die allgemeine Form <strong>der</strong> Häufigkeitsverteilung <strong>der</strong> Kosten<br />
eines Unfalls ist durch eine grosse Streuung und eine grosse Schiefe gekennzeichnet. Für die Darstellung<br />
auf S. 138 wurden die Unfälle einer Gefahrenklasse nach ihrer Kostenhöhe geordnet und ausgezählt.<br />
Da es im vorliegenden Rahmen unmöglich ist, die Häufigkeitsverteilung über dem ganzen Unfallkostenbereich<br />
maßstabsgetreu darzustellen (es fehlen die kostspieligen Unfälle), sei auf die folgenden<br />
Angaben verwiesen, welche über die Eigenart <strong>der</strong> Häufigkeitsverteilung weitern Aufschluss geben.<br />
U n fall kosten vertei l u ng<br />
Cil ulldlagc: die 30 491 Betriebsunfälle <strong>der</strong> Gefahrenklasse 13a<br />
(Maschinenbau) 1949 — 1951<br />
nfall kosten<br />
n Franken<br />
30<br />
300<br />
600<br />
2 500<br />
26 000<br />
Zahl <strong>der</strong> Betriebsunfälle<br />
mit je höchstens<br />
... Franken Kosten<br />
in Prozenten<br />
50<br />
86<br />
95<br />
99<br />
99,9<br />
Gesamtkosten <strong>der</strong> Betriebsunfälle<br />
mit je höchstens<br />
... Franken Kosten<br />
in Prozenten<br />
3<br />
20<br />
32<br />
47<br />
80<br />
Rund 50 Prozent aller Unfälle kosteten in <strong>der</strong> Gefahrenklasse 13a weniger als 30 Franken o<strong>der</strong><br />
weniger als ein Zehntel <strong>der</strong> 300 Franken betragenden Durchschnittskosten eines Unfalls und verursachten<br />
zusammen nur 3 Prozent sämtlicher Kosten. 86 Prozent <strong>der</strong> Unfälle kamen auf höchstens<br />
300 Franken zu stehen, hatten aber lediglich 20 Prozent <strong>der</strong> Gesamtkosten zur Folge und 99 Prozent <strong>der</strong><br />
Unfälle sogar nur die Hälfte aller Kosten. Schliesslich sei erwähnt, dass 99,9 Prozent <strong>der</strong> Unfälle bloss<br />
80 Prozent <strong>der</strong> Gesamtkosten verursachten; auf das eine Promille mit den kostspieligsten Unfällen entfiel<br />
also rund ein Fünftel <strong>der</strong> gesamten Unfallkosten.<br />
Die meisten Unfälle sind leichter Art, und die Kosten jedes einzelnen von ihnen liegen unter dem nach<br />
<strong>der</strong> Erfahrung zu erwartenden Durchschnittswert. Diese Unfälle kosten zusammen jedoch nur einen<br />
136
Jährliche Prämien und Unfallkosten eines kleinen Betriebes<br />
Prämien<br />
f'ränken<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
1 000<br />
0<br />
1938 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 5'7 1958
Betriebsunfälle<br />
8000<br />
Häuftgkeitsverteilung <strong>der</strong> Kosten eines Unfalls<br />
Grundlage: die 30 491 Betriebsunfälle <strong>der</strong> Gefahrenklasse 13a<br />
(Maschinenbau) 1949 — 1951<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
50<br />
100<br />
150<br />
200<br />
250<br />
300 350 400<br />
Unfallkosten in Franken<br />
Bruchteil <strong>der</strong> Summe, mit welcher auf Grund <strong>der</strong> erfahrungsmässigen Durchschnittskosten gerechnet<br />
werden muss. Aber ebenso kennzeichnend für das Unfallgeschehen wie die häufigen leichten sind die seltenen<br />
schweren Unfälle. Damit diese Eigenart in <strong>der</strong> Unfallstatistik überhaupt zum Ausdruck kommt<br />
und damit schliesslich das Unfallrisiko anhand <strong>der</strong> <strong>Statistik</strong> zuverlässig beurteilt werden kann, sind umfangreiche<br />
Beobachtungen notwendig. Solche Beobachtungen setzen aber grössere als die gewöhnlich<br />
vorhandenen Versichertenbestände voraus. Darin liegt <strong>der</strong> Grund, weshalb bei <strong>der</strong> Beurteilung des Unfallrisikos<br />
eines Betriebes meistens die Erfahrung <strong>der</strong> in einer Risikogemeinschaft zusammengefassten<br />
gleichartigen Betriebe zu Rate gezogen werden muss.<br />
138
Die Darstellung des Zufallsvorganges<br />
Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass das Unfallgeschehen ein Zufallsvorgang ist: die<br />
Zahl und vor allem die Kosten <strong>der</strong> Unfälle unterliegen grossen zeitlichen Schwankungen. Die Prämienbemessung,<br />
die auf Grund <strong>der</strong> Erfahrungen zu erfolgen hat, wird dadurch erheblich erschwert, und dies<br />
um so mehr, als sich die Schlüssigkeit von Risikoerfahrungen nicht ohne weiteres zuverlässig beurteilen<br />
lässt. Um diese Beurteilung zu ermöglichen, sollte <strong>der</strong> Zufallsbereich dieser Schwankungen abgegrenzt<br />
werden. Eine solche Abgrenzung ist möglich auf Grund <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeitsverteilung <strong>der</strong><br />
Unfallkosten. Für die Herleitung <strong>der</strong> Verteilung kann das als Zufallsvorgang erkannte Unfallgeschehen<br />
wie folgt dargestellt werden.<br />
Für einen Versichertenbestand sei f(x) die Häufigkeitsverteilung <strong>der</strong> Unfallzahl x und u(z) die Häufigkeitsverteilung<br />
<strong>der</strong> Unfallkosten z. Es bedeutet f(x) also die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Verlaufe<br />
einer Beobachtungsperiode genau x Unfälle ereignen, und u(z) die Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten<br />
irgendeines Unfalls gerade z betragen. Sofern die beiden zufälligen Verän<strong>der</strong>lichen x und z voneinan<strong>der</strong><br />
unabhängig sind, ist die Häufigkeitsverteilung <strong>der</strong> Unfallkosten des Versichertenbestandes durch<br />
den Ausdruck<br />
b(z) = ~g(x) ' 'u(z)<br />
x= 0<br />
gegeben. "'u(:) ist die x-fache Faltung <strong>der</strong> Häufigkeitsverteilung u(z) und stellt die Wahrscheinlichkeit<br />
dafür dar, dass die Kosten von x beliebigen Unfällen zusammen z betragen. Das Produkt f(x) ' 'u(z) entspricht<br />
demzufolge <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von x Unfällen mit den Gesamtkosten z und<br />
b(z) — die Summe über alle möglichen Unfallzahlen x — <strong>der</strong> Waht scheinlichkeit, dass sich die Unfallkosten<br />
des Versichertenbestandes während einer Beobachtungsperiode auf den Betrag z belaufen. Falls u(z) so<br />
normiert wurde, dass die durchschnittlichen Kosten eines Unfalls 1 betragen, ist <strong>der</strong> Durchschnitt z von b(z)<br />
gleich gross wie die im Versichertenbestand zu erwartende Unfallzahl x. Im folgenden handelt es sich<br />
immer um normierte Kosten; die wirklich beobachteten Kosten sind gleich dem Produkt aus den normierten<br />
Unfallkosten und den in Franken ausgedrückten durchschnittlichen Kosten eines Unfalls.<br />
Mit <strong>der</strong> Häufigkeitsverteilung b(z) ergibt sich die gesuchte Wahrscheinlichkeitsverteilung <strong>der</strong> Unfallkosten<br />
in <strong>der</strong> Form<br />
Dieser Ausdruck ist gleich <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Unfallkosten z des Versichertenbestandeszwischen<br />
den Beträgen z, und z, liegen. Mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung ist die<br />
einleitend gefor<strong>der</strong>te Abgrenzung des Zufallsbereiches möglich, da sich damit Fragen folgen<strong>der</strong> Art<br />
beantworteten lassen:<br />
— Mit welcher Wahrscheinlichkeit W fallen die Unfallkosten eines Bestandes von V Versicherten, von<br />
denen je<strong>der</strong> die Unfallhäufigkeit /i besitzt, in den um den Erwartungswert z = x = h V vorgegebenen<br />
Zufallsbereich [a, z, a, z] '. Es gilt für die gesuchte Wahrscheinlichkeit<br />
Z Z]<br />
W = B(a,z ~ z ~ a,z).<br />
Wie gross muss <strong>der</strong> um den Erwartungswert - = h V abzugrenzende Bereich [a,z, a,z] sein, damit die<br />
Unfallkosten: eines Versichertenbestandes Vmit vorgegebener Wahrscheinlichkeit Win diesen Bereich<br />
fallen? Die Unbekannten a, und a, sind aus den durch die Beziehung W, + W, = l — W gekoppelten<br />
Gleichungen<br />
B(0 ~z ~az) = W,<br />
B (a, z ~ z ~,~) = W,<br />
bestimmbar; im allgemeinen wird Wy: 8<br />
139<br />
l — W<br />
vorgegeben.
— Wie gross muss ein Versichertenbestand V sein, damit seine Unfallkosten z mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit<br />
%in den um den Erwartungswert h V vorgegebenen Bereich [a,h V, a,h V] fallen'. Hier ist<br />
V aus <strong>der</strong> Beziehung<br />
B(a,hV~ ~a,hV) = W<br />
zu ermitteln. Dabei muss beachtet werden, dass in diesem Falle b(z) und damit auch die Wahrscheinlichkeitsvei<br />
teilung <strong>der</strong> Unfallkosten von <strong>der</strong> verän<strong>der</strong>lichen Grösse V abhängig sind und dass zwischen<br />
den Grössen a, und a., im allgemeinen eine wechselseitige Bindung besteht.<br />
Die Wahrscheinlichkcitsverteilung <strong>der</strong> Unfallkosten eines Versiche)tcnbestandes ist unbekannt und<br />
kann auch nicht unmittelbar aus <strong>der</strong> Erfahrung gewonnen werden, weil viel zu wenig Beobachtungen vorliegen.<br />
Sie lässt sich jedoch mit Hilfe <strong>der</strong> Häufigkeitsverteilung <strong>der</strong> Unfallzahl f(x) und <strong>der</strong> Häufigkeitsverteilung<br />
<strong>der</strong> Unfallkosten u(z) darstellen, sofern gewisse vereinfachende Annahmen sowie Näherungen<br />
bei <strong>der</strong> numerischen Auswertung in Kauf genommen werden.<br />
Es scheint am einfachsten, f(x) aus <strong>der</strong> Reihe <strong>der</strong> beobachteten jährlichen Unfallzahlen zu ermitteln.<br />
Dafür reicht aber die Zahl <strong>der</strong> verfügbaren Beobachtungen nicht aus. Unter <strong>der</strong> Annahme, das Auftreten<br />
<strong>der</strong> Unfälle könne durch einen sogenannten zusammengesetzten Poissonprozess mit einer Pearson-III<br />
Verteilung als Strukturfunktion beschrieben werden, ergibt sich für die Häufigkeitsverteilung <strong>der</strong> Unfallzahl<br />
x die sogenannte negative Binomialverteilung<br />
p /'<br />
p+x<br />
Dabei ist x <strong>der</strong> Durchschnitt von f(x) und p <strong>der</strong> reziproke Wert <strong>der</strong> Streuung <strong>der</strong> Strukturfunktion; eine<br />
Untersuchung hat ergeben, dass für Versichertenbestände, die we<strong>der</strong> extrem klein noch extrem gross sind,<br />
näherungsweise p = [ V gesetzt werden kann, so dass für die Streuung s> <strong>der</strong> Unfallzahl die einfache<br />
Beziehung<br />
gilt. lm Gegensatz zu/(x) lässt sich u(z) in grössern Versichertenbeständen ohne Schwierigkeit empirisch<br />
als numerische Funktion ermitteln, indem die Unfälle nach <strong>der</strong> Höhe ihrer Kosten geordnet und ausgezählt<br />
werden. Auch die statistischen Masszahlen wie Durchschnitt, Streuung und Schiefe von u(z)<br />
können auf Grund <strong>der</strong> Auszählung ohne weiteres ermittelt werden. Für <strong>der</strong>art hohe Unfallzahlen, wie<br />
sie hier in Betracht fallen, ist es dagegen praktisch unmöglich, die Faltung '"'u(z) <strong>der</strong> numerischen Funktion<br />
u(z) durchzuführen.<br />
Wenn demzufolge auch keine Möglichkeit besteht, unmittelbar aus f(x) und u(z) einen geschlossenen<br />
Ausdruck für b(z) herzuleiten, können doch die üblichen statistischen Masszahlen <strong>der</strong> gesuchten Häufigkeitsverteilung<br />
b(z) verhältnismässig einfach bestimmt werden. Wird für f(x) die negative Binomialverteilung<br />
gewählt und zudem p = [ V gesetzt, gilt beispielsweise für die Streuung s„' von b(z) die einfache<br />
Beziehung<br />
2<br />
S~ — Z<br />
Z<br />
1'V<br />
+s,-',+ l<br />
z = h V ist <strong>der</strong> Durchschnitt von b(z) und s,', die Streuung <strong>der</strong> normierten Häufigkeitsverteilung u(z). Die<br />
Kenntnis dieser Masszahlen legt es nahe, die Häufigkeitsverteilung b(z) durch eine passende und <strong>der</strong><br />
tabellarischen Auswertung zugängliche Funktion anzunähern. Als solche eignet sich zum Beispiel die<br />
dreiparametrige logarithmische Normalverteilung. ihre Parameter können so bestimmt werden, dass die<br />
schiefe Verteilung im Nullpunkt beginnt und denselben Durchschnitt z und dieselbe Streuung s~ besitzt<br />
wie die darzustellende Verteilung b(z). Weil die logarithmische Normalverteilung auf die tabellierte ge<br />
140
wöhnliche Normalverteilung zurückgeführt werden kann, lässt sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung<br />
8 (z, ~ z ~ z,) numerisch auf einfache Weise auswerten. Es ist sodann möglich, den Zufallsbereich abzugrenzen<br />
und die vielfältigen, bei <strong>der</strong> Beurteilung von Risikoerfahrungen auftretenden Fragen befriedigend<br />
zu beantworten.<br />
Im beson<strong>der</strong>n stellt sich bei <strong>der</strong> Beurteilung von Risikoer fahrungen die Frage nach <strong>der</strong> Bedeutsamkeit<br />
von Risikounterschieden: Besteht zwischen den beobachteten Unfallkosten z eines Versichertenbestandes<br />
V und dem Erwartungswert z ein bedeutsamer o<strong>der</strong> ein bloss zufälliger Unterschied? Hier liegt dieselbe<br />
Problemstellung vor wie in <strong>der</strong> Frage nach dem um den Erwartungswert abzugrenzenden Zufallsbereich,<br />
in den die Unfallkosten mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit fallen. Nur wenn die Unfallkosten ausserhalb<br />
des nach unten durch a, z und nach oben durch a, z abgegrenzten Zufallsbereiches liegen, wird <strong>der</strong><br />
Unterschied zwischen Beobachtung und Erwartung als bedeutsam betrachtet. Das folgende Zahlenbeispiel<br />
stützt sich auf die logarithmische Normalverteilung und vermittelt eine Vorstellung über die<br />
Grösse des Zufallsbereiches bei Versichertenbeständen von unterschiedlichem Umfang.<br />
Zufallsbereich <strong>der</strong> Unfallkosten<br />
Versichertenbestand<br />
Erwartungswert<br />
<strong>der</strong><br />
normierten<br />
U n fall kosten<br />
Zu fallsbereich<br />
untere Grenze obere Grenze<br />
Abweichung vom Frwartungswert<br />
in ~/~ des Erwartungswertes<br />
nach<br />
unten<br />
oben<br />
100 000<br />
10 000<br />
I 000<br />
100<br />
10<br />
21 000<br />
2 100<br />
210<br />
21<br />
2,1<br />
18 000<br />
1 415<br />
67<br />
1<br />
0<br />
24 300<br />
3 005<br />
505<br />
105<br />
14<br />
14<br />
33<br />
68<br />
95<br />
100<br />
16<br />
44<br />
140<br />
400<br />
580<br />
h 0,21; s --- 57; 8' — 0,95; 8', =- 8'., — — 0,025; b(z): logarithmische Normalverteilung<br />
Wenn beispielsweise ein durch die Unfallhäufigkeit h =- 0,21 und die Unfallkostenstreuung s„= 57<br />
gekennzeichneter Bestand von 100 000 Versicherten die — auf den Durchschnitt 1 normierten — Unfallkosten<br />
- = 26 000 verursacht, so sind diese Kosten als vom Erwartungswert z = h V = 21 000 bedeutsam<br />
abweichend zu betrachten. Denn <strong>der</strong> beobachtete Wert befindet sich ausserhalb des Bereiches [18 000,<br />
24 300], in den die Unfallkosten in 95 von 100 Fällen zu liegen kommen; die untere Grenze dieses Zufallsbereiches<br />
liegt 14 Prozent unter und die obere Grenze 16 Prozent über dem Erwartungswert. Demgegenüber<br />
unterscheiden sich die in den Zufallsbereich fallenden Kosten, zum Beispiel z =- 18 500, bloss zufällig<br />
vom Erwartungswert. Wie aus <strong>der</strong> Tabelle hervorgeht, nimmt <strong>der</strong> in Prozenten des Erwartungswertes<br />
gemessene Zufallsbereich mit abnehmen<strong>der</strong> Versichertenzahl rasch zu. Bemerkenswert in dieser<br />
Hinsicht ist die Feststellung, dass bei 10 Versicherten sogar eine Abweichung vom Erwartungswert um<br />
100 Prozent nach unten, also das völlige Ausbleiben von Unfallkosten, noch durchaus im Rahmen des<br />
Zufälligen liegt. Aus diesem Grunde ist, entgegen <strong>der</strong> Ansicht vieler Prämienzahler, das zufällige Fehlen<br />
von Unfallkosten nicht ohne weiteres eine stichhaltige Begründugg für ein Prämienermässigungsgesuch.<br />
Die kleinen und kleinsten Betriebe bleiben sehr oft ohne Unfallkosten; es sei daran erinnert, dass 58 Prozent<br />
aller Betriebsteile im Verlaufe eines Jahres überhaupt keine Betriebsunfälle melden und dass ein Betriebsteil<br />
— wenn die verhältnismässig wenigen Betriebe (2 Prozent) mit mehr als 100 Vollarbeitern ausser Betracht<br />
gelassen werden — durchschnittlich nur 7 Versicherte zählt. Wenn einerseits das zufällige Ausbleiben<br />
von Unfallkosten nicht ohne weiteres zu einer Prämienermässigung führen kann, muss an<strong>der</strong>seits<br />
dem ebenso zufälligen Auftreten hoher Unfallkosten auch nicht unbedingt eine Prämienerhöhung<br />
folgen. Bei 10 Versicherten können selbst Unfallkosten, die 580 Prozent über dem Erwartungswert liegen,<br />
«ls vom Erwartungswert noch zufällig abweichend betrachtet werden.<br />
141
Je nach dem Risiko des Versichertenbestandes, das heisst je nach <strong>der</strong> Grösse <strong>der</strong> Unfallhäufigkeit h<br />
und <strong>der</strong> Unfallkostenstreuung s„, ergeben sich unterschiedliche Zufallsbereiche. Die nachstehende Tabelle<br />
enthält Angaben über die Zufallsbereiche für ausgewählte Werte von h und s„, wie sie <strong>der</strong> Grössenordnung<br />
nach in den bisher untersuchten Versichertenbeständen auftreten. Nach den bisherigen Erfahrungen<br />
fallen Streuungen s„zwischen 5 und 12 in Betracht, wenn die Häufigkeitsverteilung u(z) nur die<br />
Heilkosten und das Krankengeld berücksichtigt. Bei Einschluss <strong>der</strong> Rentenkosten liegen die Streuungen<br />
zwischen 20 und 80. Die Zufallsbereiche verän<strong>der</strong>n sich ebenfalls mit <strong>der</strong> Grösse <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeit<br />
W. Je strenger die Sicherheitsanfor<strong>der</strong>ungen sind, das heisst, je grösser die Abweichungen zwischen den<br />
beobachteten Unfallkosten und ihrem Erwartungswert sein müssen, um als bedeutsam zu gelten, desto<br />
grösser ist 8'zu wählen und desto breiter werden die Zufallsbereiche. Die gewählte Wahrscheinlichkeit<br />
von 0,95 entspricht den üblichen Anfor<strong>der</strong>ungen und kann auch für das vorliegende Beispiel als genügend<br />
erachtet werden. Deshalb wurde auf die Bekanntgabe <strong>der</strong> Zufallsbereiche für an<strong>der</strong>e Wahrscheinlichkeiten<br />
als 0,95 verzichtet.<br />
Zufallsbereich <strong>der</strong> Unfallkosten<br />
unten<br />
oben<br />
10 20<br />
40 80<br />
Abweichung vom Erwartungswert in "„des Erwartungswertes nach<br />
unten oben unten oben unten oben unten<br />
oben<br />
0,1<br />
100 000<br />
10 000<br />
1 000<br />
100<br />
10<br />
11<br />
22<br />
46<br />
82<br />
98<br />
12<br />
27<br />
71<br />
220<br />
490<br />
12<br />
25<br />
54<br />
88<br />
99<br />
13<br />
31<br />
91<br />
280<br />
540<br />
13<br />
30<br />
64<br />
93<br />
99<br />
15<br />
39<br />
120<br />
360<br />
570<br />
16<br />
37<br />
75<br />
96<br />
100<br />
18<br />
51<br />
170<br />
440<br />
580<br />
19<br />
46<br />
84<br />
98<br />
100<br />
22<br />
71<br />
240<br />
510<br />
580<br />
0,4<br />
100 000<br />
10 000<br />
1 000<br />
100<br />
10<br />
11<br />
19<br />
36<br />
65<br />
92<br />
12<br />
23<br />
49<br />
130<br />
340<br />
11<br />
20<br />
39<br />
72<br />
95<br />
12<br />
24<br />
55<br />
160<br />
410<br />
11<br />
22<br />
45<br />
80<br />
97<br />
12<br />
26<br />
68<br />
210<br />
470<br />
12<br />
25<br />
53<br />
87<br />
99<br />
13<br />
31<br />
88<br />
280<br />
530<br />
13<br />
30<br />
64<br />
93<br />
99<br />
15<br />
38<br />
120<br />
360<br />
570<br />
0,7<br />
1,0<br />
100 000<br />
10 000<br />
1 000<br />
100<br />
10<br />
100 000<br />
10 000<br />
1 000<br />
100<br />
10<br />
11<br />
19<br />
34<br />
59<br />
88<br />
11<br />
19<br />
33<br />
56<br />
85<br />
12<br />
22<br />
45<br />
110<br />
280<br />
12<br />
22<br />
43<br />
98<br />
250<br />
11<br />
19<br />
36<br />
65<br />
92<br />
11<br />
19<br />
34<br />
61<br />
90<br />
12<br />
23<br />
49<br />
130<br />
340<br />
12<br />
22<br />
46<br />
110<br />
310<br />
11<br />
20<br />
40<br />
73<br />
96<br />
12<br />
24<br />
57<br />
160<br />
420<br />
11 i 12<br />
20 23<br />
37 52<br />
68 140<br />
94 380<br />
12<br />
22<br />
46<br />
81<br />
98<br />
11<br />
21<br />
43<br />
77<br />
97<br />
13<br />
27<br />
70<br />
220<br />
490<br />
12<br />
25<br />
62<br />
190<br />
450<br />
12<br />
26<br />
55<br />
89<br />
99<br />
12<br />
24<br />
50<br />
85<br />
98<br />
13<br />
32<br />
93<br />
290<br />
540<br />
13<br />
29<br />
80<br />
250<br />
510<br />
H =- 0,95; fV, =- l4'., =- 0,025; /.(z): logarithmische Normalverteilung<br />
Für die praktisch in Frage kommenden Versichertenbestände werden die in Prozenten des Erwartungswertes<br />
gemessenen Zufallsbereiche kleiner sowohl mit zunehmen<strong>der</strong> Versichertenzahl V als auch<br />
mit wachsen<strong>der</strong> Unfallhäufigkeit h o<strong>der</strong>, in einem Wort, mit zunehmendem Erwartungswert. Je grösser<br />
hingegen die Unfallkostenstreuung s,', ist, desto grösser sind auch die Zufallsbereiche.<br />
142
Auf welche Weise können nun die im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Abgrenzung des Zufallsbereiches <strong>der</strong><br />
Unfallkosten gewonnenen Erkenntnisse für die Prämienbemessung in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung<br />
nutzbar gemacht werden? Der einer bestimmten Gefahrenklasse zugeteilte Betrieb hat eine Prämie zu<br />
entrichten, die sich nach dem in Promillen <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme ausgedrückten Prämiensatz <strong>der</strong>jenigen<br />
Gefahrenstufe bemisst, in die <strong>der</strong> Betrieb eingereiht wurde. Im allgemeinen erfolgt die erstmalige<br />
Einreihung in die dem mittleren Risiko <strong>der</strong> Gefahrenklasse beziehungsweise Untergruppe entsprechende<br />
Gefahrenstufe. Die von Zeit zu Zeit erfor<strong>der</strong>liche Überprüfung <strong>der</strong> Einreihung ist auf Grund <strong>der</strong> Risikoerfahrungen<br />
vorzunehmen, und zwar anhand von Risikosätzen, den in Promillen <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme<br />
ausgedrückten Unfallkosten. Ob und inwieweit ein auf Grund betriebseigener Erfahrungen ermittelter<br />
Risikosatz im Hinblick auf den grossen Zufallsbereich <strong>der</strong> Unfallkosten als zuverlässiger<br />
Schätzwert für den Prämiensatz betrachtet werden kann, hängt vor allem von <strong>der</strong> Grösse des zugrunde<br />
liegenden Versichertenbestandes ab. Damit stellt sich einmal die Frage, wie gross ein Versichertenbestand<br />
sein muss, damit ein daraus stammen<strong>der</strong> Risikosatz noch als schlüssigei Schätzwert für den Prämiensatz<br />
gelten darf, und ferner, wie die Schlüssigkeit eines Risikosatzes beurteilt und gemessen werden kann.<br />
Die Schlüssigkeit eines Risikosatzes kann gestützt auf die Abgrenzung des Zufallsbereiches <strong>der</strong> Unfallkosten<br />
auf einfache Weise umschrieben werden. Eine im Anschluss an die bisherigen Darlegungen naheliegende<br />
Möglichkeit besteht darin, nur solche Risikosätze als vollständig schlüssig zu betrachten, die aus<br />
Versichertenbeständen stammen, <strong>der</strong>en Unfallkosten mit einer grössern als <strong>der</strong> vorgegebenen Wahrscheinlichkeit<br />
%in den vorgegebenen Zufallsbereich [a,*h V, a,*h V]fallen. Die Zahl <strong>der</strong> Versicherten eines<br />
Bestandes, dessen Risikosätze in diesem Sinne gerade noch schlüssig sind, sei mit V* bezeichnet. V* ist<br />
von dem durch h und s„gekennzeichneten Unfallrisiko abhängig und lässt sich mit Hilfe <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeitsverteilung<br />
<strong>der</strong> Unfallkosten aus <strong>der</strong> Beziehung 8(a,*h V* ( z ( a.,*h V~) = %bestimmen.<br />
Als Masszahl für die Schlüssigkeit eines aus dem Versichertenbestande <strong>der</strong> Grösse V stammenden<br />
Risikosatzes kann im wesentlichen die Wahrscheinlichkeit 8(a,*h V ( z ( a.,*h V) dienen, mit <strong>der</strong> die<br />
Unfallkosten dieses Bestandes in den vorgegebenen Zufallsbereich [a,*h V,a.,*h V] zu liegen kommen. Es<br />
ist zweckmässig, diese Wahrscheinlichkeit zu normieren und überdies allen Risikosätzen aus Beständen<br />
V ~ V* die Aussagekraft 1 zuzuordnen. Auf diese Weise kann die Schlüssigkeit von Risikosätzen mit <strong>der</strong><br />
zwischen 0 und 1 liegenden Grösse<br />
8 (a,* h V ( z ( a.,* h V)<br />
8(a,*h V" ( z ( a,*h V*)<br />
für V~ V~<br />
für V~ V~<br />
in ebenso einfacher wie sinnvoller Weise gemessen werden.<br />
Wie aus <strong>der</strong> Tabelle über die Zufallsbereiche <strong>der</strong> Unfallkosten hervorgeht, ist V* von <strong>der</strong> Grössenordnung<br />
100000, wenn die vorgegebene Wahrscheinlichkeit 8' auf 0,95 und <strong>der</strong> vorgegebene Zufallsbereich<br />
auf + 10 Prozent des Erwartungswertes angesetzt werden. Unter diesen Voraussetzungen, die<br />
angemessenen Sicherheitsanfor<strong>der</strong>ungen entsprechen, könnte die Prämie überhaupt nie ausschliesslich<br />
nach betriebseigenen Risikoerfahrungen bemessen werden, da kein Betrieb einen Versichertenbestand<br />
<strong>der</strong> genannten Grösse aufweist. Diese Tatsache bleibt selbst dann noch weitgehend bestehen, wenn, was<br />
zugelassen sei, <strong>der</strong> Risikosatz eines grossen, jedoch nur kurzfristig beobachteten Bestandes hinsichtlich<br />
seiner Aussagekraft dem Risikosatz eines kleinen, aber langfristig beobachteten Bestandes gleichgestellt<br />
wird. ln diesem Sinne kommt dem Risikosatz von 5000 Versicherten, die 20 Jahre unter Beobachtung<br />
standen, dieselbe Aussagekraft zu wie dem Risikosatz eines während 5 Jahren beobachteten Bestandes<br />
von 20 000 Versicherten. Aber auch so sind dei individuellen, nur auf die betriebseigenen Risikoerfahrungen<br />
abstellenden Prämienbemessung sehr enge Grenzen gesetzt. Im Hinblick auf die Möglichkeit <strong>der</strong><br />
kurzfristigen Prämienanpassung erhebt sich immerhin die Frage, ob und wie weit die hier gestellten<br />
Sicherheitsanfor<strong>der</strong>ungen, nach denen sich die Bedingungen für die Schlüssigkeit von Risikosätzen<br />
richten, gelockert werden könnten. Diese bedeutungsvolle Frage bedarf noch eingehen<strong>der</strong> Prüfung, um<br />
so mehr, als sich die Schlüssigkeitsvoraussetzungen auch auf die Wahl <strong>der</strong> Gefahrenstufenbreite und damit<br />
auf den Aufbau des Prämientarifs auswirken.<br />
143
Um den Prämiensatz eines Betriebes auch dann zuverlässig schätzen zu können, wenn — was in <strong>der</strong><br />
Regel <strong>der</strong> Fall sein wird — keine schlüssigen betriebseigenen Risikosätze vorliegen, bleibt nichts an<strong>der</strong>es<br />
übrig, als die Risikoerfahrungen gleichartiger o<strong>der</strong> ähnlicher Betriebe zu Rate zu ziehen. Das heisst mit<br />
an<strong>der</strong>n Worten, es ist im Ausmass de> fehlenden betriebseigenen Erfahrungen auf die schlüssigen Erfahrungen<br />
einer übergeordneten Risikogemeinschaft(Untergruppe o<strong>der</strong> Gefahrenklasse) abzustellen. Bei<br />
<strong>der</strong> Schätzung des Prämiensatzes P kann zum Beispiel <strong>der</strong> betriebseigene Risikosatz R mit dem seiner<br />
Schlüssigkeit entsprechenden Gewicht g und <strong>der</strong> als schlüssig vorausgesetzte Risikosatz R* <strong>der</strong> übergeordneten<br />
Risikogemeinschaft mit dem Gewichte 1 — g angerechnet werden:<br />
P =g R+ (1 — g) R* o<strong>der</strong> P =- R*+g(R — R*).<br />
Der einem Betriebe zuzumessende Prämiensatz P kann also entwe<strong>der</strong> als <strong>der</strong> gewichtete Mittelwert aus<br />
<strong>der</strong> Risikoerfahrung eines Betriebes und <strong>der</strong>jenigen eines übergeordneten Bestandes gedeutet werden o<strong>der</strong><br />
aber als <strong>der</strong> um die betriebliche Erfahrung korrigierte Risikosatz dieses Bestandes. Die vollständige Anrechnung<br />
<strong>der</strong> betriebseigenen Risikoerfahrungen ergibt sich für g = 1; sie kommt <strong>der</strong> individuellen<br />
Prämienbemessung gleich. In den übrigen Fällen kann die betriebseigene Erfahrung um so weniger berücksichtigt<br />
werden, je kleiner g ist.<br />
Unabhängig davon, wie das statistische Gewicht g schliesslich festgelegt wird, lässt sich die dargelegte<br />
Prämienformel weitgehend verallgemeinern. Sie ist einmal auf beliebige einan<strong>der</strong> zugeordnete<br />
Versichertenbestände anwendbar. Von Bedeutung sind dabei die Zuordnungen Betrieb-Untergruppe,<br />
Betrieb-Gefahrenklasse sowie Untergruppe-Gefahrenklasse. Die Formel kann aber auch für die Risikoerfahrungen<br />
eines und desselben Bestandes Verwendung finden. So etwa, wenn R* den schlüssigen, aus<br />
einer längern Beobachtungsperiode stammenden Risikosatz eines Bestandes und R einen zwar nicht ganz<br />
schlüssigen, dafür aber zeitnahen Beobachtungswert dieses Bestandes bedeutet, o<strong>der</strong> wenn R* <strong>der</strong> Erwartungswert<br />
und R <strong>der</strong> entsprechende beobachtete Risikosatz ist. Endlich ist es mit Rücksicht auf die<br />
aussergewöhnliche Zufallsabhängigkeit <strong>der</strong> Rentenkosten möglich, den Prämienbedarf anhand <strong>der</strong><br />
Formel getrennt für die Heilkosten und das Krankengeld einerseits und für die Rentenkosten an<strong>der</strong>seits<br />
zu ermitteln.<br />
Damit ist ein den beson<strong>der</strong>n Gegebenheiten <strong>der</strong> einzelnen Risikobestände weitgehend Rechnung<br />
tragendes Verfahren dargestellt, das gestattet, die Prämien auf Grund <strong>der</strong> Risikoerfahrung zu bemessen.<br />
Die entwickelte Methode, <strong>der</strong>en Kernstück in <strong>der</strong> Abgrenzung des Zufallsbereiches <strong>der</strong> Unfallkosten besteht,<br />
kann selbstverständlich erst dann für die praktische Anwendung in Betracht fallen, we»n die zur<br />
Herleitung <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeitsverteilung <strong>der</strong> Unfallkosten benötigten Masszahlen für die in Frage<br />
kommenden Versichertenbestände vorliegen. Diesbezügliche Erhebungen sowie beson<strong>der</strong>e Untersuchungen<br />
über die theoretischen Grundlagen sind im Gang. Diese Untersuchungen bezwecken vor allem, die<br />
Tragweite und den Geltungsbereich <strong>der</strong> getroffenen Annahmen abzuklären. Weiter ist im Hinblick auf die<br />
Anwendung in <strong>der</strong> Praxis zu prüfen, wie weit die Bestimmung des statistischen Gewichtes g anhand einer<br />
einfachen Faustregel erfolgen kann. Schliesslich sind die Auswirkungen auf das Prämienwesen zu untersuchen,<br />
welche die praktischeAnwendung dieser Methode mit sich bringen würde. Nach den bisherigen<br />
Erfahrungen scheint es jedenfalls möglich zu sein, auf die hier dargelegte Weise das nicht einfachePrämienproblem<br />
in <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> nun auch unter Berücksichtigung neuerer mathematisch-statistischer<br />
Erkenntnisse befriedigend zu lösen.
Zusammenfassung<br />
Der vorliegende Bericht über die Ergebnisse <strong>der</strong> Unfallstatistik <strong>der</strong> achten fünfjährigen Beobachtungsperiode<br />
1953 — 1957 zeigt, dass sowohl <strong>der</strong> Versicherungsbestand als auch die Zahl und die Kosten <strong>der</strong> Unfälle<br />
zugenommen haben. Ende 1957 waren rund 64000 Betriebe mit schätzungsweise l ~/q Millionen Versicherten<br />
<strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> unterstellt. Die versicherte Lohnsumme ist in <strong>der</strong> Berichtsperiode<br />
beträchtlich angestiegen und erreichte im Jahre 1957 einen Betrag von 9 ~/q Milliarden Franken.<br />
Das Anwachsen ist ungefähr je zur Hälfte einerseits auf die Zunahme <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Versicherten<br />
und an<strong>der</strong>seits auf das Ansteigen des Lohnniveaus, die Erhöhung des jährlichen versicherten Höchstverdienstes<br />
und die Erfassung bisher prämienfreier Gratifikationen zurückzuführen. Der im Vergleich<br />
zur vorangehenden Beobachtungsperiode festgestellten Zunahme <strong>der</strong> Unfallzahl von 15 Prozent steht<br />
ein doppelt so grosses Anwachsen <strong>der</strong> Unfallkosten gegenüber, was vorwiegend auf die allgemeine<br />
Teuerung zurückzuführen ist. In Promillen <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme gemessen, haben jedoch die<br />
Unfallkosten in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung etwas abgenommen, was denn auch in den Jahren 1956<br />
und 1959 Anlass gab zu Än<strong>der</strong>ungen des Prämientarifes. In <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung hat sich<br />
<strong>der</strong> Risikosatz nur unbedeutend verän<strong>der</strong>t. Es scheint, dass die in <strong>der</strong> Nachkriegszeit festgestellte Zunahme<br />
des Nichtbetriebsunfallrisikos, die zu Prämienerhöhungen führte, zum Stillstand gekommen ist.<br />
In den Jahren 1953 — 1957 traf es auf 100 Versicherte 21 Betriebs- und 9 Nichtbetriebsunfälle. Während<br />
dieser Zeit ist die Häufigkeit <strong>der</strong> Betriebsunfälle leicht angestiegen; sie hat sich jedoch im Vergleich zur<br />
vorausgegangenen Beobachtungsperiode sozusagen nicht verän<strong>der</strong>t. Die Häufigkeit <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle<br />
dagegen ist etwas gesunken. Im Hinblick auf die sonst auftretenden Schwankungen ist es bemerkenswert,<br />
dass die lnvaliditäts- und die Todesfallhäufigkeit in beiden Versicherungsabteilungen fast unverän<strong>der</strong>t<br />
geblieben sind.<br />
Das Ansteigen <strong>der</strong> mittleren Kosten eines Unfalles wurde durch die Anpassung <strong>der</strong> Arzt- und Spitaltaxen,<br />
die Verteuerung <strong>der</strong> Heilmittel, die Erhöhung des Lohnniveaus, die Änpassungen des versicherten<br />
Höchstverdienstes und zu einem Teil auch durch die Verlängerung <strong>der</strong> Heildauer verursacht. Diese ist<br />
auf langwierigere, aber bessern Heilerfolg aufweisende Behandlungen und insbeson<strong>der</strong>e auf schwerere<br />
Unfallverletzungen zurückzuführen. Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Karenzzeit betrug in <strong>der</strong> Berichtsperiode<br />
<strong>der</strong> Arbeitsausfall während <strong>der</strong> Heildauer je ordentlichen Unfall rund 21 Tage in <strong>der</strong> Betriebs- und 23 Tage<br />
i n <strong>der</strong> N ichtbetriebsunfallversicherung.<br />
Für die Überprüfung <strong>der</strong> Barwerte zur Kapitalisierung <strong>der</strong> Invalidenrenten ist die Beobachtung von<br />
Interesse, dass <strong>der</strong> dank bessern Heilerfolgen kleinere Invaliditätsgrad bei Rentenbeginn, die Zunahme <strong>der</strong><br />
Zahl <strong>der</strong> Einmalentschädigungen und <strong>der</strong> Verzicht auf viele Rentenabstufungen erneut einen Rückgang<br />
des Rentenabfalles im Revisioosbereich zur Folge hatten. Die allgemein beobachtete Sterblichkeitsabnahme<br />
konnte auch bei den Unfallinvaliden festgestellt werden. Sollte diese Entwicklung anhalten, so<br />
müsste eine Anpassung <strong>der</strong> Rentenbarwerte in Betracht gezogen werden.<br />
Bei den Hinterlassenenrenten interessiert vor allem <strong>der</strong> Verlauf <strong>der</strong> kostenmässig am meisten ins Gewicht<br />
fallenden Witwenrenten. Es ist ein weiterer Rückgang <strong>der</strong> Sterblichkeit und <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>verheiratungshäufigkeit<br />
<strong>der</strong> Witwen festzustellen.<br />
In <strong>der</strong> Berichtsperiode wurde für die Giessereien und für die keramische Industrie eine Erhebung über<br />
die Ursachen <strong>der</strong> Betriebsunfälle durchgeführt. Dadurch konnten weitere wertvolle Erkenntnisse zur<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Unfallverhütung und für die Beurteilung <strong>der</strong> Risikomerkmale bei <strong>der</strong> Überprüfung des<br />
Prämientarifs und <strong>der</strong> Einreihungsgrundsätze gewonnen werden.<br />
1n <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung haben sich die bereits bekannten Risikounterschiede zwischen<br />
den männlichen und den weiblichen Versicherten bestätigt. Die Frauen weisen auf dem Arbeitswege und<br />
beim Aufenthalt zu Hause ein etwas grösseres Unfallrisiko auf, während dieses für die Männer bei Nebenbeschäftigungen<br />
und vor allem bei Sport, Reisen und an<strong>der</strong>n Vergnügen grösser ist.<br />
Eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung kommt den Berufskrankheiten in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung zu. Ohne<br />
die Staublungen würden sie allerdings nicht beson<strong>der</strong>s ins Gewicht fallen, wenn sie sich auch in gewissen<br />
Industrie- und Gewerbezweigen häufen und dort schwerwiegend sein können. Auf die Silikose entfielen<br />
10<br />
145
im Jahre 1957 mehr als 5 Prozent <strong>der</strong> Gesamtkosten <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung. Die Silikosekosten<br />
werden künftig auch dann noch gross sein, wenn dank den technischen und medizinischen Schutzmassnahmen<br />
ein Rückgang <strong>der</strong> Neumeldungen eintreten sollte. Dem verspäteten Nachfolgen <strong>der</strong> Silikosekosten<br />
ist durch das Bestellen von Schadenreserven Rechnung zu tragen, und es sind die Prämien entsprechend<br />
den mutmasslichen künftigen Kosten vorsichtig zu bemessen.<br />
Aus den Darlegungen über die Tätigkeit <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt und <strong>der</strong> Fachinspektorate<br />
und Beratungsstellen auf dem Gebiete <strong>der</strong> Unfallverhütung geht hervor, dass die Bemühungen<br />
für die technische und die psychologische Unfallverhütung in weiten Kreisen auf Interesse stossen.<br />
Schliesslich sind im vorliegenden Bericht einige in neuerer Zeit angestellte Betrachtungen über das<br />
Wirken des Zufalls in <strong>der</strong> Unfallstatistik dargelegt. Das Unfallgeschehen lässt sich auf Grund mathematisch-statistischer<br />
Erkenntnisse als Zufallsvorgang beschreiben, und es kann <strong>der</strong> Zufallsbereich abgegrenzt<br />
werden. Dies ist ein Mittel für die Abklärung <strong>der</strong> Schlüssigkeit <strong>der</strong> Beobachtungen und damit für die Beurteilung<br />
des Unfallrisikos.
Anhang<br />
Tabelle l<br />
Seite<br />
Versicherungsbestand seit 1918.......... 148<br />
2 Versicherte Lohnsumme 1957 nach Kantonen und<br />
Gruppen von Gefahrenklassen......... 149<br />
3 Versicherte Lohnsumme, Vollarbeiter, Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
und Unfallkosten 1953 — 1957 in den Gefahrenklassen 150<br />
4a Unfälle in den Giessereien nach Unfallgegenstand .. 164<br />
4b Unfälle in den Giessereien nach Verletzungsgegenstand 166<br />
5 Unfälle in <strong>der</strong> keramischen Industrie........ 168<br />
6 Nichtbetriebsunfälle 1955............. 170<br />
7a Berufskrankheiten 1953<br />
172<br />
7b Berufskrankheiten 1957<br />
173
Tabelle 1<br />
Versicherungsbestand seit 1918<br />
Unterstellte<br />
Betriebe<br />
Versicherte<br />
Lohnsumme '<br />
in 1000 Fr.<br />
Arbeitsstunden<br />
in Millionen<br />
Vollarbeiter<br />
(Versicherte)<br />
1918 '<br />
1919<br />
1920<br />
1921<br />
1922<br />
33 707<br />
33 787<br />
34 383<br />
34 704<br />
35 344<br />
992 895<br />
I 533 760<br />
1 873 421<br />
1 782 338<br />
1 620 364<br />
1 053<br />
1 303<br />
1 451<br />
1 280<br />
1 171<br />
438 634<br />
542 881<br />
604 395<br />
533 268<br />
487 764<br />
1923<br />
1924<br />
1925<br />
1926<br />
1927<br />
36 112<br />
36 645<br />
37 244<br />
37 878<br />
38 699<br />
1 694 474<br />
1 820 987<br />
1 894 494<br />
1 907 502<br />
1 963 591<br />
1 309<br />
1 410<br />
1 465<br />
1 450<br />
1 601<br />
545 485<br />
587 474<br />
610 234<br />
604 125<br />
667 226<br />
1928<br />
1929<br />
1930<br />
1931<br />
1932<br />
39 711<br />
40 658<br />
41 420<br />
42 408<br />
42 994<br />
2 110 193<br />
2 251 486<br />
2 270 645<br />
2 189 625<br />
1 992 723<br />
1 729<br />
1 827<br />
1 792<br />
1 692<br />
1 542<br />
720 463<br />
761 104<br />
746 793<br />
705 170<br />
642 698<br />
1933<br />
1934<br />
1935<br />
1936 '<br />
1937 '<br />
43 596<br />
44 343<br />
44 511<br />
48 772<br />
49 803<br />
1 921 506<br />
1 910 071<br />
1 797 253<br />
1 740 600<br />
1 914 312<br />
1 529<br />
I 544<br />
1 449<br />
1 414<br />
1 603<br />
636 966<br />
643 328<br />
603 729<br />
589 024<br />
667 800<br />
1938<br />
1939<br />
1940<br />
1941<br />
1942<br />
50 538<br />
50 895<br />
50 769<br />
51 326<br />
«2 221<br />
1 960 053<br />
1 927 299<br />
1 993 802<br />
2 352 706<br />
2 670 009<br />
I 604<br />
I 575<br />
1 612<br />
1 789<br />
1 853<br />
668 177<br />
656 285<br />
671 541<br />
745 548<br />
772 184<br />
1943<br />
1944<br />
1945<br />
1946<br />
1947<br />
52 806<br />
52 975<br />
53 862<br />
56 088<br />
57 678<br />
2 865 767<br />
2931 192<br />
3 499 663<br />
4237 564<br />
4 879 133<br />
1 847<br />
1 772<br />
1 974<br />
2 175<br />
2 315<br />
769 612<br />
738 482<br />
822 364<br />
906 104<br />
964 697<br />
1948<br />
1949<br />
1950<br />
1951<br />
1952<br />
58 585<br />
58 133<br />
58 452<br />
59 004<br />
59 599<br />
5 288 774<br />
5 340 752<br />
5 356 690<br />
5 919 845<br />
6 242 879<br />
2 371<br />
2 224<br />
2 218<br />
2 423<br />
2 458<br />
987 931<br />
926 472<br />
924 136<br />
1 009 630<br />
I 024 213<br />
1953<br />
1954<br />
1955<br />
1956<br />
1957<br />
60 283<br />
61 307<br />
62 499<br />
63 335<br />
64 241<br />
6 683 378<br />
6 967 536<br />
7433 353<br />
8 005 645<br />
9 247 756<br />
2 516<br />
2 586<br />
2 702<br />
2 812<br />
2 987<br />
1 048 522<br />
1 077 587<br />
1 125 748<br />
1 171 475<br />
1 244 483<br />
' Der jährliche versicherte Höchstverdienst pro Person betrug<br />
vom 1.4. 1918 bis 31.12. 1920 4000 Franken<br />
vom 1. 1. 1921 bis 28. 2. 1945 6000 Franken<br />
vom 1. 3. 1945 bis 31. 12. 1952 7800 Franken<br />
vom 1. 1. 1953 bis 31. 12. 1956 9000 Franken<br />
ab 1. 1. 1957 12000 Franken<br />
Ab 1949 einschliesslich Entschädigungen bei Ferien, Krankheit und ähnlichen Arbeitsunterbrechungen.<br />
' April bis Dezember 1918.<br />
' Der Vollzug <strong>der</strong> Ergänzung zur Verordnung I vom 25.2.1936 führte in den Jahren 1936 — 1937 zur Unterstellung von rund 4400 Kleinbetrieben<br />
hauptsächlich <strong>der</strong> mechanischen Holz- und Metallbearbeitung.<br />
148
Versicherte Lohnsumme 1957 nach Kantonen und Gruppen von Gefahrenklassen<br />
Tabelle 2<br />
Anteil an <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme in Promillen<br />
Zürich .<br />
Bern.<br />
Luzern.<br />
Uri<br />
Schwyz<br />
Kantone<br />
Obwalden<br />
N id waiden<br />
Glarus.<br />
Zug<br />
Freiburg .<br />
Solothurn<br />
Basel-Stadt .<br />
Basel-Land .<br />
Schaffhausen .<br />
A ppenzel l A.- R h.<br />
Appenzell I.-Rh.<br />
St. Gallen<br />
Graubünden<br />
Aargau<br />
Thurgau .<br />
Tessin .<br />
Waadt .<br />
Wallis .<br />
Neuenburg .<br />
Genf<br />
Kantone.<br />
SBB und PTT.<br />
Schweiz<br />
Versicherte<br />
Lohnsumme<br />
in 1000 Fr.<br />
c<br />
V ~ c a<br />
V) ~ c<br />
V<br />
C<br />
O y<br />
M O<br />
S o c<br />
4<br />
V<br />
'o cc<br />
V<br />
H<br />
c<br />
1 785 341 15 265 1 39<br />
1 275 524 24 206 139 58<br />
286 949 23 230 5 72<br />
43 451 — 216 — 39<br />
69 601 71 129 — 156<br />
17 838 7<br />
18 573 132<br />
73 320 61<br />
84 723 3<br />
118 679 30<br />
473 398<br />
598 434<br />
242 116<br />
162 808<br />
49 330<br />
4 665<br />
470 479<br />
152 122<br />
670 238<br />
265 345<br />
8<br />
3<br />
33<br />
24<br />
14<br />
7<br />
26<br />
14<br />
O<br />
40 — 238<br />
168 — 113<br />
170 — 51<br />
407 — 56<br />
142 8 105<br />
268 186 27<br />
99 0 21<br />
243 66 58<br />
432 12 41<br />
65 — 72<br />
41 — 98<br />
183 0 68<br />
50 — 78<br />
305 2 66<br />
283—<br />
219 506 15 110 50 38<br />
525 139 30 200 42 58<br />
211 294 9 173 1 43<br />
327 119 3 170 411 24<br />
412 876 9 252 80 32<br />
c<br />
g I. V<br />
44 y « W~<br />
c5 D<br />
g>o o .„r~<br />
~~ ü) a.<br />
a5<br />
bß<br />
V<br />
s<br />
'o c<br />
(h<br />
'Q bO.»<br />
c c<br />
(h<br />
r q<br />
< c<br />
(h<br />
rY) g<br />
E „<br />
Q rn c<br />
56 87 11 49<br />
52 39 8 55<br />
58 49 9 109<br />
4 20 21 200<br />
79 118 34 39<br />
4 81 58<br />
37 27 2<br />
52 337 3 14<br />
82 66 4<br />
59 21 9<br />
11<br />
126<br />
166 43<br />
47 44 175<br />
43 50 1 136<br />
45 57 0 57<br />
]70 345 4 6<br />
21 301 3<br />
56 226 4<br />
26 32 4<br />
67 107 2<br />
76 167 2<br />
54 84 5<br />
52 23 3<br />
10 4 6<br />
36 7 l<br />
38 22<br />
33<br />
69<br />
71<br />
70<br />
75<br />
57<br />
47<br />
62<br />
34<br />
66<br />
c<br />
P<br />
C<br />
C o.c<br />
c<br />
C<br />
jS c<br />
a5<br />
5 164 3<br />
6 ]56 ]0<br />
5 ]69 6<br />
23 317 7<br />
]9 179 6<br />
73 300<br />
65 240<br />
7 132<br />
3 ' 146<br />
14 201<br />
6 93<br />
2 165<br />
7 151<br />
1 94<br />
1 151<br />
2 240<br />
13 146<br />
17 414<br />
5 116<br />
3 120<br />
40 340<br />
8 238<br />
29 440<br />
4 120<br />
6 225<br />
44 21<br />
33 48<br />
18 4<br />
10 1<br />
36 24<br />
8 12<br />
0 31<br />
8 3<br />
11 5<br />
4 49<br />
29<br />
8<br />
47<br />
11<br />
5<br />
12 13<br />
18 24<br />
16 26<br />
7 10<br />
I<br />
a. cg<br />
OQ Cr<br />
cn C 'P<br />
Ps pg<br />
cn<br />
V<br />
V C<br />
'O ~ a5<br />
IX<br />
17 56<br />
28 40<br />
13 55<br />
3 24<br />
]0 20<br />
11 47<br />
]0 31<br />
73 34<br />
3 24<br />
4 29<br />
19<br />
I<br />
V<br />
V)<br />
a$<br />
c<br />
25 20<br />
32 ]3<br />
11<br />
27~ 9<br />
37 31<br />
51 24<br />
37 48<br />
24 18<br />
42 18<br />
11 1<br />
16 1<br />
20 1<br />
37,—<br />
31~ 0<br />
34<br />
15 35 1<br />
16 I<br />
10 0<br />
C<br />
00<br />
O ~<br />
:D Y$<br />
Xl W<br />
ed<br />
O<br />
220 1000<br />
162 1000<br />
176 1000<br />
89 1000<br />
]09 1000<br />
140 1000<br />
156 1000<br />
111 1000<br />
]79 1000<br />
137 1000<br />
113 1000<br />
180 1000<br />
95 1000<br />
130 1000<br />
188 1000<br />
8 558 868 18 222 57 51 59 72 6 67 8 174 9 18 43 17 1 178 1000<br />
688 888<br />
506 — — — 494 1000<br />
9 247 756 16 206 53 47 55 67 5 62 7 161 8 54 40 16 1 202<br />
41<br />
11<br />
]2<br />
14,<br />
12,<br />
7<br />
79 1000<br />
89 1000<br />
]24 1000<br />
174 1000<br />
133 1000<br />
135 1000<br />
302 i ]000<br />
155 1000<br />
191 1000<br />
112 1000<br />
149
Tabelle 3<br />
Versicherte Lohnsumme, Vollarbeiter, Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Betriebsunfall<br />
Versicherungsbestand<br />
Gefahrengruppen und Gefahrenklassen des Prämientarifs<br />
Versicherte<br />
Lohnsumme<br />
1000 Fr.<br />
Vollarbei ter<br />
Steine und Erden<br />
1<br />
la<br />
27 625<br />
Fabrikation von Zement, Kalk, Gips, Mörtel.<br />
Fabrikation von Zement, Kalk, Gips, Mörtel<br />
97 345<br />
97 345<br />
14 681<br />
14 681<br />
2 Fabrikation von Kunststein und Zementwaren ohne Bauarbeiten.<br />
2a<br />
2b<br />
Fabrikation von Kunststein, Zementwaren, armiertem Beton ohne Verwendung von mechanischen<br />
Pressen<br />
Fabrikation von Kunststein, Zement- und Asbestzementwaren, armiertem Beton mit Verwendung<br />
von mechanischen Pressen; Brikettfabrikation.<br />
3 Grobkeramik<br />
3b<br />
3e<br />
Fabrikation von Ziegeln, Back- und Verblendsteinen, Tonröhren.<br />
Fabrikation von Chamotte- und Steinzeugwaren.<br />
181 873<br />
77 849 11 356<br />
104 024<br />
174 623<br />
153 851<br />
20 772<br />
16 269<br />
26 749<br />
23 423<br />
3 326<br />
4a<br />
4c<br />
Feinkeramik<br />
Töpferei, Steingut- und Ofenkachelnfabrikation; Schweisselektroden- und Schleifscheibenfabrikation<br />
.<br />
Porzellanfabrikation.<br />
92 160<br />
63 987<br />
28 173<br />
14 425<br />
9 953<br />
4 472<br />
5 Glasfabrikation 104 970 17 028<br />
5c<br />
5cl<br />
5e<br />
Glas- und Glaswarenfabrikation.<br />
Glasschleiferei, Glasverarbeitung<br />
Glühlampenfabrikation<br />
67 632<br />
22 789<br />
14 549<br />
11 135<br />
3 087<br />
2 806<br />
Metall<br />
9b<br />
9e<br />
9f<br />
9h<br />
9i<br />
Handwerks- und fabrikmässige Betriebe <strong>der</strong> Metallbearbeitung mit Installation, Montage o<strong>der</strong> Bauarbeiten;<br />
Autogaragen und Autoreparaturwerkstätten . 1 639 186 256 320<br />
Fabrikation von Kühl-, Heiz- und Wascheinrichtungen, auch mit Installationsarbeiten verbunden;<br />
elektrothermische Apparate, Blechbearbeitung.<br />
Schlosserei; Huf- und Wagenschmieden; Schweissereien<br />
Eisenkonstruktionen (einschliesslich Bauschlosserei); Kesselschmieden<br />
Mechanische Werkstätten mit mechanischer Holzbearbeitung; Schmieden mit mechanischer Wagnerei,<br />
Rolladenfabrikation<br />
Autogaragen; mechanische Konstruktions- und Reparaturwerkstätten.<br />
455 727<br />
200 663<br />
283 751<br />
113 860<br />
585 185<br />
67 444<br />
36 576<br />
42 145<br />
17 200<br />
92 955<br />
10 Giessereien<br />
484 980<br />
10c<br />
10cl<br />
Eisen- und Stahlgiessereien .<br />
Metallgiessereien für Bronze, Messing, Aluminium «sw.; Fabrikation von Bleiakkumulatoren<br />
405 108<br />
79 872<br />
69 956<br />
57 906<br />
12 050<br />
11 Elektrothermische Produkte ohne Gewinnung des Minerals und ohne Metallverarbeitung 105 994 16 241<br />
lla<br />
l 1b<br />
Elektrometallurgische Behandlung von Mineralien und Erzen; Fabrikation von Kalziumkarbid und<br />
künstlichen Schleif- und Düngmitteln<br />
Aluminium-, Magnesium- und Natriumfabrikation.<br />
66 276<br />
39 718<br />
10 452<br />
5 789<br />
12 Fabrikmässige Betriebe <strong>der</strong> mechanischen Metallbearbeitung .<br />
12a<br />
l2b<br />
Warmeisen walzwerke<br />
Hammerwerke, Fassonschmieden mit Krafthämmern für Maschinenteile, Wagenachsen, Pflugbestandteile,<br />
Grobwerkzeuge .<br />
1 523 212<br />
64 779<br />
37 710<br />
236 084<br />
8 865<br />
5 903
und Unfallkosten 1953 — 1957 in den Gefahrenklassen<br />
Versicherung Tabelle 3<br />
Gef.<br />
Gr.<br />
und<br />
Gef.<br />
K l.<br />
Bagatel l<br />
unfälle<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
davon<br />
Total I nvaliditats-<br />
f-ll<br />
fälle<br />
Todes<br />
Unfallkosten<br />
Hei 1 kosten Krankengeld Invaliditätsfälle<br />
Fr.<br />
Kapitalwert <strong>der</strong> Renten<br />
Todesfälle<br />
Fr. Fr. Fr.<br />
absolut<br />
Fr.<br />
Total<br />
in /gp<br />
<strong>der</strong><br />
Lohnsumme<br />
1<br />
la<br />
1 660<br />
1 660<br />
2 648<br />
2 648<br />
4 308 116 20<br />
4 308 116 20<br />
3 139 5 158 8 297 157 20<br />
2a 1 337 2 219, 3 556 55 10<br />
2b 1 802 2 939 4 741 102 10<br />
2 593 4 273 6 866 140 14<br />
3b 2 343 3 910 6 253 123<br />
3e 250 363 613 17<br />
1 087 1 918 32 5<br />
831<br />
541 270<br />
541 270<br />
940 671<br />
940 671<br />
1 300 934<br />
1 300 934<br />
954 649<br />
954 649<br />
3 737 524<br />
3 737 524<br />
38,4<br />
38,4<br />
921 178 1 725 438 1 529 000 588 116 4 763 732 26,2<br />
709 852 361 565 1 861 960 23,9<br />
366 388 424 155<br />
554 790 1 015 586 1 104 845<br />
724 861 1 282 060 1 813 799<br />
635 051<br />
89 810<br />
222 258<br />
1 162 952<br />
119 108<br />
332 825<br />
1 537 656<br />
276 143<br />
436 383<br />
226 551 2 901 772 27,9<br />
490 233 4310 953 24,7<br />
301 626<br />
188 607<br />
3 637 285<br />
673 668<br />
23,6<br />
32,4<br />
106 186 1 097 652 11,9<br />
4a<br />
4c<br />
5c<br />
5d<br />
5e<br />
674<br />
157<br />
2 321<br />
1 487<br />
512<br />
322<br />
820<br />
267<br />
1 494<br />
424<br />
24<br />
2 272 4 593 41 23 2<br />
1 476<br />
633<br />
163<br />
2 963<br />
1 145<br />
485<br />
8<br />
16<br />
2<br />
145 340<br />
76 918<br />
376 642<br />
246 068<br />
99 128<br />
31 446<br />
224 992<br />
107 833<br />
561 090<br />
312 288<br />
219 382<br />
29 420<br />
225 767<br />
210 616<br />
351 946<br />
138 387<br />
201 761<br />
11 798<br />
48 085<br />
58 101<br />
644 184<br />
453 468<br />
10,1<br />
16,1<br />
88 461 1 378 139 13,1<br />
88 461<br />
785 204<br />
520 271<br />
72 664<br />
1 1,6<br />
22,8<br />
5,0<br />
9 80 536 44 110 124 646 1212 76<br />
9b<br />
9e<br />
9f<br />
9h<br />
9i<br />
5 163<br />
23 531<br />
3 024<br />
13 698<br />
10 860<br />
l 666<br />
25 839 277 9<br />
28 149 199 5<br />
25 242 332 34<br />
8 187 86<br />
37 229 318<br />
4<br />
24<br />
10 11 287 12 526 23 813 471 66<br />
10c<br />
20 687 425 61<br />
3 126 46 5<br />
10ci<br />
lla<br />
l 1 b<br />
9 827<br />
1 460<br />
1 264 2 107 3 371 80 10<br />
936<br />
328<br />
1 480<br />
627<br />
2 416<br />
955<br />
50<br />
30<br />
12 33 086 29 729 62 815 1235 41<br />
12a<br />
15 931<br />
20 418<br />
15 493<br />
728<br />
12b 1 693<br />
9 908<br />
7 731<br />
9 749<br />
1 513 2 241 51 2<br />
1 340 3 033 47 3<br />
7 466 560 10 919 860 10 901 137 3 188 128 32 475 685 19,8<br />
1 598 207<br />
1 420 363<br />
1 802 328<br />
474 738<br />
2 170 924<br />
790 172<br />
2 990 417<br />
780 131<br />
2 533 356<br />
85 020<br />
1 087 919<br />
2 130 061<br />
8 782 616<br />
18,7<br />
15,0<br />
2 656 675 4 548 705 5 510 387 1 958 472 14 674 239 30,3<br />
2 355 900<br />
300 775<br />
569 541<br />
406 001<br />
163 540<br />
640 896<br />
331 533<br />
454 105<br />
334 634<br />
1 775 244<br />
183 228<br />
13 273 320<br />
1 400 919<br />
32,8<br />
17,5<br />
292 506 2 623 215 24,7<br />
124 239<br />
168 267<br />
1 625 241<br />
997 974<br />
24,5<br />
25,1<br />
4 959 782 8 052 616 9 701 572 1 564 006 24 277 976 15,9<br />
171 590 1 668 798 25.8<br />
292 842<br />
271 916<br />
2 515 239<br />
1 668 405<br />
2 955 627<br />
4 046 299<br />
502 406<br />
972 429<br />
558 180<br />
397 655<br />
2 074 798<br />
1 984 451<br />
3 528 401<br />
5 095 877<br />
414 510<br />
788 739<br />
646 186<br />
599 497<br />
299 395<br />
190 747<br />
1 525 047<br />
6487 639<br />
5 263 966<br />
9 811 403<br />
14,2<br />
26,2<br />
34,6<br />
127 834 1 396 902 37,0<br />
151
Tabelle 3, Fortsetzung<br />
Versicherte Lohnsumme, Vollarbeiter, Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Betriebsunfall<br />
Versicherungsbestand<br />
Gefahrengruppen und Gefahrenklassen des Pramientarifs<br />
Versicherte<br />
Lohnsumme<br />
Vollarbeiter<br />
1000 Fr.<br />
12d<br />
121<br />
12n<br />
12p<br />
12r<br />
12s<br />
Metallwerke; Kaltwalzwerke, Rohr- und Profilzieherei; Fabrikation von Kabeln und Drahtseilen;<br />
Edel meta 1 1 werke<br />
Fabrikation von gestanzten, gesenkten und tiefgezogenen Eisen- und Metall waren; Ket tenfabrikation<br />
Fabrikation von Armaturen für Dampf-, Gas- und Wasseranlagen .<br />
Fabrikation von kunstgewerblichen Metall- und Blechwaren, Galvanostegie; Leuchter- und Tafelgerätefabrikation<br />
.<br />
Verzinkerei, Verzinnerei, Metallspritzerei, Scheideanstalten für Edelmetalle, Ätzerei.<br />
Fabrikation von Maschinenbestandteilen und Werkzeugen; Fabrikation von Metallmöbeln; Fabrikation<br />
von Drahtwaren; elektromechanische Werkstätten .<br />
319 272<br />
388 918<br />
115 204<br />
105 745<br />
28 818<br />
462 766<br />
47 605<br />
62 771<br />
17 807<br />
16 619<br />
4 185<br />
72 329<br />
13<br />
Grossbetriebe <strong>der</strong> mechanischen Metallbearbeitung<br />
2 401 726<br />
351 148<br />
13a<br />
13e<br />
Maschinenbau, auch verbunden mit Apparatebau<br />
Karosserie- und Wagen bau, Waggon fabrikation; Fl ugzeugbau .<br />
2 097 156<br />
304 570<br />
306 990<br />
44 158<br />
14<br />
Betriebe <strong>der</strong> Fein- und Kleinmechanik.<br />
1 607 719<br />
251 995<br />
14c<br />
14d<br />
Fabrikation und Reparatur von leichten Maschinen, mechanischen, elektrischen und optischen<br />
Apparaten und Instrumenten; Fabrikation von Präzisionswerkzeugen.<br />
Schraubenfabrikation, Fassondreherei .<br />
1 488 727<br />
118 992<br />
232 071<br />
19 924<br />
16 Uhrenindustrie und Bijouterie<br />
2 032 873 302 907<br />
16a<br />
16f<br />
Fabrikation von Uhren und Uhrenbestandteilen; Edelsteinbearbeitung .<br />
Fabrikation, Finissage und Dekoration von Uhrengehäusen; Medaillonprägerei, Galvanostegie,<br />
Bijouterie<br />
1 677 817<br />
355 056<br />
251 694<br />
51 213<br />
Holz<br />
19 Betriebe <strong>der</strong> mechanischen Bearbeitung von Holz, ohne Bauarbeiten 825 372 139 856<br />
]9b Sägereien, auch verbunden mit Nebenbetrieben, die <strong>der</strong> Holzindustrie angehören (wie Schreinerei.<br />
19c<br />
19f<br />
19g<br />
19i<br />
19k<br />
19m<br />
19n<br />
19p<br />
19s<br />
19v<br />
19w<br />
Kisten- und Parkettfabrikation, Fabrikation von Holzwaren), und mit Nebenbetrieben, die nicht <strong>der</strong><br />
Holzindustrie angehören (wie Getreidemühlen, Ölmühlen, Knochenmühlen).<br />
Kisten- und Emballagenfabrikation ohne Sägerei; Holzwollefabrikation<br />
Hobelwerke, Parkettfabrikation .<br />
Imprägnieranstalten, auch mit mechanischer Holzbearbeitung .<br />
Möbelfabrikation .<br />
Modellschreinerei .<br />
Küferwaren- und Fassfabrikation .<br />
Goldleisten-, Rahmen-, Etuis- und Etalagenfabrikation, Mal3stab- und Zeichenutensilienfabrikation<br />
Fabrikation von gedrehten, gehobelten und geschnitzten Holzgegenständen und Bestandteilen;<br />
Herstellung von Rolläden, Särgen, Bürstenwaren und Sperrholzplatten; Bootsbau.<br />
Pianofabrikation, Orgelbau.<br />
Rohrmöbel-, Korbwaren- und Mattenfabrikation<br />
Wagnerei<br />
195 682<br />
21 768<br />
22 464<br />
8 149<br />
293 575<br />
68 333<br />
8 301<br />
15 936<br />
151 055<br />
17 505<br />
11 299<br />
11 305<br />
34 961<br />
3 967<br />
4 088<br />
1 365<br />
47 872<br />
9 960<br />
1 532<br />
2 944<br />
26 011<br />
2 612<br />
2 139<br />
2 405<br />
Le<strong>der</strong>, Kork, Kunststoße; Papier. graphische Gewerbe<br />
20 Gerberei .<br />
53 435 8 500<br />
20a Gerberei, Pelz- und Fellzurichterei.<br />
53 435 8 500<br />
21<br />
21b<br />
Schuhfabrikation<br />
Schuhfabrikation und Schuhreparaturen<br />
334 777<br />
334 777<br />
60 080<br />
60 080
und Unfallkosten 1953 — 1957 in den Gefahrenklassen<br />
Versicherung<br />
Tabelle 3, Fortsetzung<br />
Gef.<br />
Gr.<br />
und<br />
Gef.<br />
K l.<br />
Bagatel l<br />
unfäl le<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
I nvaliditäts<br />
davon<br />
in %@<br />
<strong>der</strong><br />
Lohnsumme<br />
Todesfalle<br />
Heil kosten<br />
Fr.<br />
Krankengeld<br />
Unfall kosten<br />
Kapitalwert <strong>der</strong> Renten<br />
Invaliditätsfälle<br />
Todesfälle absolut<br />
Fr. Fr. Fr.<br />
Fr.<br />
Total<br />
12d<br />
121<br />
12n<br />
3 800<br />
8 366<br />
1 893<br />
5 773<br />
7 846<br />
1 576<br />
9 573 242<br />
16 212 457<br />
3 469 60<br />
944 934<br />
1 291 513<br />
257 484<br />
1 769 197<br />
2075 217<br />
385 857<br />
1 995 266<br />
3 155 068<br />
372 432<br />
360 470<br />
117 242<br />
306 106<br />
5 069 867<br />
6 639 040<br />
1 321 879<br />
]5,9<br />
17,1<br />
1 1,5<br />
12p<br />
12r<br />
12s<br />
13<br />
13a<br />
]3e<br />
2 247<br />
704<br />
2 120<br />
933<br />
4 367<br />
I 637<br />
63<br />
35<br />
13 655 8 628 22 283 280 6<br />
43 586 33 986 77 572 1022 40<br />
36 026 28 887 64 913 909 28<br />
7 560 5 099 12 659 113 ] 2<br />
14 30 971 18 179 49 150 541 8<br />
317 948<br />
223 684<br />
532 554<br />
352 299<br />
547 396<br />
631 434<br />
1 359 461 ] 981 657 1 754 293<br />
234 775<br />
52 191<br />
1 632 673 15,4<br />
1 259 608 ' 43,7<br />
193 798 5 289 209 ]1,4<br />
5 264 906 8 714 494 8 173 906 1 752 737 23 906 043 10,0<br />
1 203 291 20 157 711<br />
549 446 3 748 332<br />
4477 328<br />
787 578<br />
7 434 828<br />
1 279 666<br />
7 042 264<br />
1 131 642<br />
2 871 500 3 823 283 3 508 375<br />
178 100 10 381 258<br />
9,6<br />
12,3<br />
6,5<br />
14c<br />
14ci<br />
28 237<br />
2 734<br />
16 380 44 617 472<br />
I 799 4 533 69<br />
16 15 571 9 641 25 212 326 8<br />
16a 11 266 6 495 17 761 197 4<br />
16f 4 305 3 146 7 451 129 4<br />
2584 ]53<br />
287 347<br />
3 435 762<br />
387 521<br />
3 142 092<br />
366 283<br />
1 659 272 2230 091 1717 097<br />
1 ]65 936 1 521 150 1 261 624<br />
493 336 708 941 455 473<br />
161 261<br />
16 839<br />
9 323 268<br />
1 057 990<br />
410 973 6 017 433<br />
129 691 4 078 401<br />
281 282 ] 939 032<br />
6.3<br />
8,9<br />
3,0<br />
2,4<br />
5,5<br />
19<br />
15 562 22 702 38 264 1127 33<br />
3 652 758 6 233 876 8 798 809 1 119 971 19 805 414 24,0<br />
l9b<br />
19c<br />
19f<br />
19g<br />
19i<br />
191@<br />
19m<br />
19n<br />
19p<br />
19s<br />
]9v<br />
]9w<br />
4 541<br />
453<br />
661<br />
173<br />
4 959<br />
552<br />
207<br />
242<br />
3 138<br />
211<br />
117<br />
308<br />
9 131<br />
701<br />
840<br />
332<br />
5 565<br />
931<br />
334<br />
220<br />
3 833<br />
171<br />
163<br />
481<br />
13 672 485<br />
1 154 41<br />
1 501 53<br />
505 ll 1<br />
10 524 249 7<br />
1 483 58<br />
541 12<br />
462 7<br />
6 971<br />
382<br />
280<br />
789<br />
173 2<br />
6<br />
31 l<br />
1<br />
1 673 990<br />
112 231<br />
124 213<br />
50 654<br />
770 802<br />
149 855<br />
41 366<br />
29 147<br />
588 256<br />
22 533<br />
20 699<br />
69 012<br />
2 922 045<br />
196 937<br />
215 072<br />
100 510<br />
1 276 770<br />
269 178<br />
74 679<br />
47 579<br />
953 424<br />
40 345<br />
27 527<br />
109 810<br />
4 095 131<br />
283 899<br />
476 728<br />
54 741<br />
1 812 004<br />
347 241<br />
73 909<br />
28 866<br />
1 177 457<br />
95 012<br />
460<br />
353 361<br />
628 572<br />
39 842<br />
14 212<br />
340 414<br />
96 931<br />
9 319 738<br />
632 909<br />
816 013<br />
220 117<br />
4 199 990<br />
766 274<br />
189 954<br />
105 592<br />
2 816 068<br />
157 890<br />
48 686<br />
532 183<br />
47,6<br />
29,1<br />
36,3<br />
27,0<br />
14,3<br />
1 1,2<br />
22,9<br />
6,6<br />
18,6<br />
9,0<br />
4,3<br />
47,1<br />
20<br />
20a 571<br />
21<br />
21b<br />
571 1 056 1 627 54 3<br />
1 056 1 627 54 3<br />
2 478 2 696 5 174 72 2<br />
2 478 2 696 5 174 72 2<br />
165 042<br />
165 042<br />
360 303<br />
360 303<br />
299 484<br />
299 484<br />
515 848<br />
515 848<br />
547 191<br />
547 191<br />
368 093<br />
368 093<br />
155 014 1 166 731 21,8<br />
155 014 1 166 731 21,8<br />
76 889 1 321 133<br />
76 889 1 321 133<br />
3,9<br />
3,9<br />
153
Versicherte Lohnsumme, Vollarbeiter, Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Tabelle 3, Fortsetzung<br />
Betriebsunfall<br />
Versichcrungsbestand<br />
Gefahrengruppen und Gefahrenklassen des Pramientarifs<br />
Versicherte<br />
Lohnsumme<br />
l000 Fr.<br />
Vol larbeiter<br />
22 Papierfabrikation<br />
22d Papier- und Kartonfabrikation; Holzstoff-, Lumpenhalbstoff- und Zellulosefabrikation<br />
23 Verarbeitung von Le<strong>der</strong>, Kork und Kunststoffen<br />
23b<br />
23c<br />
Fabrikation von Le<strong>der</strong>waren; Sattlerei, Tapeziererei<br />
Fabrikation von Artikeln aus Kunststoffen; Verarbeitung von Kork<br />
24 Papierverarbeitung.<br />
24a<br />
24c<br />
Buchbin<strong>der</strong>ei, auch verbunden mit Kartonnagefabrikation; Papierwarenfabrikation.<br />
Kartonnagefabrikation, Fabrikation von Wellkarton, Preßspan, Kunstle<strong>der</strong> .<br />
25 Graphisches Gewerbe<br />
25a<br />
25d<br />
Buchdruckerei, Lithographie; Licht-, Kupfer- und Stahldruck .<br />
Photographie- und Lichtpausanstalten, Klischeefabrikation, Chemigraphie, Ateliers für Filmaufnahmen<br />
289 377<br />
289 377<br />
264 177<br />
114 510<br />
149 667<br />
301 884<br />
176 717<br />
125 167<br />
874 757<br />
792 231<br />
82 526<br />
43 240<br />
43 240<br />
46 135<br />
21 012<br />
25 123<br />
57 338<br />
32 236<br />
25 102<br />
129 656<br />
117 482<br />
]2 174<br />
Textilindustrie, Näherei<br />
27<br />
27c<br />
27d<br />
27e<br />
27h<br />
Mechanische Verarbeitung <strong>der</strong> Rohtextilstoffe, Spinnerei.<br />
Woll- und Baumwollreisserei und -wäscherei, Pressfilzfabrikation; Rosshaarspinnerei, Wollkämmelei,<br />
Seidenkämmelei, Fabrikation von Hutstumpen, Kunstwolle, Watte, Putzfäden; Bettfe<strong>der</strong>nreinigung<br />
.<br />
Kammgarn- und Schappespinnerei.<br />
Tuchfabrikation, Webfilzfabrikation .<br />
Baumwollspinnerei, Natur- und Kunstwollspinnerei, Flachs- und Hanfspinnerei; Seilerei; Asbestspinnerei.<br />
538 549 103 511<br />
54 862<br />
97 056<br />
126 406<br />
260 225<br />
10 316<br />
18 481<br />
23 903<br />
50 811<br />
28 Mechanische Verarbeitung von Gespinsten, Zwirnerei, Win<strong>der</strong>ei, Weberei, Betriebe ohne Reiss- und<br />
Schlagmaschinen und ohne die Textilveredlung . 707 647 138 990<br />
28b<br />
28d<br />
28e<br />
28f<br />
28g<br />
Win<strong>der</strong>ei, Zwirnerei, Bobinenspulerei; Fabrikation von Nähseide und Nähfaden .<br />
Seidenstoffweberei, Band fabri kation, El ast iq ueweberei und -wirkerei .<br />
Woll-, Baumwoll- und Leinenweberei<br />
Ramie-, Rosshaar- und Kunstseideflechterei, Posamenteriewarenfabrikation, Umspinnen und Umflechten<br />
von isolierten Drähten und Kabeln, Fabrikation von Klöppelspitzen, Litzen für die Hutfabrikation<br />
.<br />
Weberei von grobem Leinen; Decken-, Sack-, Schlauch- und Gurtenfabrikation; Teppich- und<br />
Mattenfabrikation<br />
81 120<br />
171 918<br />
357 151<br />
67 974<br />
29 484<br />
18 128<br />
34 046<br />
67 794<br />
Bearbeitung von Textilien. 1 096 222 226 014<br />
13 445<br />
5 577<br />
29g<br />
Fabrikation von Bekleidungsstücken; Tüllfabrikation; Anfertigung von künstlichen Kränzen und<br />
Blumen; Schirmfabrikation. 1 096 222 226 014<br />
30 Textilveredlung; Klei<strong>der</strong>färberei, Wäscherei, Glätterei.<br />
423 488 77 047<br />
30b<br />
Bleicherei, Färberei, Druckerei, Ausrüsterei; Klei<strong>der</strong>färberei und chemische Reinigung, Wäscherei,<br />
Glätterei . 423 488 77 047<br />
Zeughä user<br />
31 Zeughäuser. 205 853 24 774<br />
31a Zeughäuser. 205 853 24 774
und Unfallkosten 1953 — 1957 in den Gefahrenklassen<br />
Versicherung<br />
Tabelle 3, Fortsetzung<br />
Gef.<br />
Gr.<br />
und<br />
Gef.—<br />
K l.<br />
Bagatell- Ordentliche<br />
unfälle Unfälle<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
davon<br />
Heilk osten Krankengeld Invaliditätsfälle<br />
Invaliditäts<br />
Todes<br />
fälle fälle<br />
Unfallkosten<br />
22 811 881 1 532 351 2 293 801<br />
811 881 1 532 351 2 293 801<br />
Fr.<br />
Fr.<br />
Kapitalwert <strong>der</strong> Renten<br />
Fr.<br />
Todesfälle<br />
Fr.<br />
absolut<br />
Fr.<br />
Total<br />
in /() p<br />
<strong>der</strong><br />
Lohnsumme<br />
615 318 5 253 351 18,2<br />
615 318 5 253 351<br />
22d 18,2<br />
23 941 797 1 079 974<br />
23b<br />
23G<br />
1 203<br />
2 302<br />
1 250<br />
2 529<br />
2 453<br />
4 831<br />
25<br />
169 812 230 357 111 055<br />
115 4 428 324 711 440 968 919 129 440<br />
24 3 618 4 743 8 361 178 1 972 588 1 219 272<br />
24a<br />
24c<br />
25<br />
25a<br />
2 875 4 649 7 524 218 14<br />
2 875 4 649 7 524 218 14<br />
3 505 3 779 7 284 140 4 598 136<br />
J 873<br />
1 745<br />
2 472<br />
2 271<br />
4 345<br />
4 016<br />
706 089<br />
94<br />
337 611 494 976 482 598<br />
84 368 478 477 612 736 674 78 836<br />
6 545 6 945 13 490 234 8 1 180 944 1 739 879 2 408 690<br />
5 849 6 357 12 206 223 6 1 088 532 1 611 435 2 377 377<br />
129 440 2749 347 10,4<br />
511 224<br />
2 238 123<br />
78 836 2 976 785<br />
1 315 185<br />
1 661 600<br />
315 116 5 644 629<br />
201 942 5 279 286<br />
4,5<br />
15,0<br />
9,9<br />
7,4<br />
13,3<br />
6,5<br />
6,7<br />
1 284 11 2 92 412<br />
25d 696 588 128 444 31 313 113 174<br />
365 343<br />
4,4<br />
27<br />
4 783 7 283 12 066 266 12 1 047 358 1 489 544 2 670 686<br />
419 498 5 627 086 10 4<br />
27G<br />
27d<br />
27e<br />
737<br />
658<br />
1 181<br />
1 057<br />
1 103<br />
1 583<br />
1 794<br />
1 761<br />
2 764<br />
52<br />
36<br />
2 207 3 540 5 747 ]27 4<br />
51<br />
182 632<br />
140 093<br />
236 797<br />
27h 487 836<br />
252 875<br />
224 201<br />
336 420<br />
676 048<br />
699 672<br />
184 300<br />
478 804<br />
1 307 910<br />
63 285<br />
82 931<br />
131 989<br />
1 198 464<br />
631 525<br />
1 184 010<br />
141 293 2 613 087<br />
21,8<br />
6,5<br />
9,4<br />
10,0<br />
28 5 579 7 001 12 580 158 6<br />
28b<br />
28d<br />
28e<br />
668<br />
1 121<br />
2 809<br />
832<br />
1 272<br />
3 841<br />
1 500<br />
2 393<br />
6 650<br />
19<br />
30 1<br />
82 4<br />
990 110 1 363 016<br />
131 378<br />
178 010<br />
509 789<br />
155 273<br />
241 257<br />
735 833<br />
1 002 483 173 596 3 529 205<br />
222 799<br />
130 833<br />
510 522<br />
39 911<br />
108 366<br />
509 450<br />
590 011<br />
1 864 510<br />
5,0<br />
6,3<br />
3,4<br />
5,2<br />
605 1 192 103 443<br />
28f 587 16<br />
138 720 78 653<br />
28g 394<br />
451 845 11<br />
29 6 654 6 561 13 215 95 2<br />
29g<br />
30<br />
30b<br />
6 654 6 561 13 215 95 2<br />
3 868 4 992 8 860 165 7<br />
3 868 4 992 8 860 165 7<br />
67 490 91 933 59 676<br />
926 114 1 043 067<br />
926 114 1 043 067<br />
812 307 1 240 351<br />
465 111<br />
465 111<br />
320 816<br />
25 319 244 418<br />
95 093 2 529 385<br />
95 093 2 529 385<br />
1 412 369 ' 322 358 3 787 385<br />
812 307 1 240 351 1 412 369 322 358 3 787 385<br />
4,7<br />
8,3<br />
23<br />
2,3<br />
8,9<br />
8,9<br />
31<br />
31a<br />
i 998 2 102 4 100 45 4<br />
1 998 2 102 4 100 45 4<br />
369 056<br />
369 056<br />
727 691<br />
727 691<br />
462 546<br />
462 546<br />
259 610 1 818 903<br />
259 610 1 818 903<br />
8,8<br />
8,8<br />
155
Tabelle 3, Fortsetzung<br />
Versicherte Lohnsumme, Vollarbeiter, Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Betriebsunfall<br />
Versicherungsbestand<br />
Gefahrengruppen und Gefahrenklassen des Prömientarifs<br />
Versichertc<br />
Lohnsumme<br />
Vollarbeiter<br />
1000 Fr.<br />
32 Chemische Industrie<br />
32a<br />
32b<br />
32c<br />
32d<br />
32f<br />
32l<br />
32k<br />
321<br />
32m<br />
32q<br />
32r<br />
32$<br />
Chemische Industrie, Nahrungs- und Genussmittel<br />
Chemische Grossindustrie, Fabrikation von anorganischen Produkten, Mineralsäuren, Alkalien,<br />
Salzen, Knochen- und Le<strong>der</strong>leim, Kunstdünger<br />
Fabrikation von Teerfarbstoffen, Fabrikation von organischen Produkten, Farb- und Gerbstoffextraktion,<br />
Stärke- und Dextrinfabrikation<br />
Fabrikation von pharmazeutischen, kosmetischen und diätetischen Produkten und photographischen<br />
Präparaten; Desinfektionsanstalten; Fabrikation von komprimierten Gasen; Kunstharzfabrikation<br />
Fabrikation von Seifen und Parfümerieartikeln; Tinten-, Kitt-, Kreide- und Bleistiftfabrikation;<br />
Fabrikation von Kerzen und Wachswaren<br />
Fabrikation von technischen Fetten, Ölen, Schmier- und Putzmitteln, Wichse<br />
Fabrikation von Dachpappe und an<strong>der</strong>en Teerprodukten, Asphaltfabrikation<br />
Zündholzfabrikation.<br />
Fabrikation von Kunstfasern .<br />
Gummiwerke, Fabrikation und Neugummierung von Pneus; Fabrikation von Zelluloid .<br />
Salinen<br />
Fabrikation künstlicher Edelsteine.<br />
Fabrikation von Lacken, Farben und Druckfarben.<br />
1 118 669<br />
74 779<br />
387 214<br />
205 806<br />
61 465<br />
32 431<br />
27 323<br />
7 338<br />
169 788<br />
96 759<br />
8 311<br />
2 429<br />
45 026<br />
154 533<br />
10 696<br />
45 460<br />
29 263<br />
9 982<br />
4 948<br />
3 656<br />
I 457<br />
26 969<br />
14 100<br />
1 068<br />
403<br />
6 531<br />
33 Explosivstoffe. 95 728 13 063<br />
33G<br />
Munitionsfabrikation ohne Fabrikation <strong>der</strong> H ülsen und Geschosse; Pulvermühlen, Fabrikation von<br />
Sprengstoffen und Feuerwerk .<br />
95 728 13 063<br />
34 Mühlen<br />
34a Mühlen<br />
79 670<br />
79 670<br />
11 939<br />
11 939<br />
35 Nahrungsmittel . 783 906 132 432<br />
35a<br />
35c<br />
35d<br />
35g<br />
35}1<br />
35i<br />
351<br />
35n<br />
Zuckerfabrikation und -verarbeitung.<br />
Schokoladefabrikation .<br />
Bäckerei, Konditorei; Biskuitfabrikation; Confiserie .<br />
Teigwarenfabrikation<br />
Schlachthof betriebe .<br />
Fabrikation von Fleischwaren und Fleischkonserven, Verwertung von Schlachthausabfällen<br />
Fabrikation von Speisefett, Öl, Kunstbutter, Gelatine<br />
Fabrikation von Konserven, Nahrungsmitteln, Milchprodukten, Essig und Gewürzen; Presshefefabrikation;<br />
Kantinen auf Baustellen.<br />
18 448<br />
152 190<br />
125 462<br />
32 304<br />
22 283<br />
101 442<br />
32 695<br />
3 320<br />
27 754<br />
21 969<br />
6 625<br />
2 646<br />
14 112<br />
4 709<br />
299 082 51 297<br />
36 Getränke.<br />
171 704 23 887<br />
36a<br />
Brauerei; Mineralwasserfabrikation, Ausbeutung von Mineralquellen; Brennerei und Liqueurfabrikation<br />
.<br />
171 704 23 887<br />
37 Tabak . 158 163<br />
37b<br />
37c<br />
Zigarren- und Schnit tabakfabrikation, einschl iessl ich <strong>der</strong> Zigaret tenfabrikation.<br />
Zigarettenfabrikation<br />
96 637<br />
61 526<br />
32 016<br />
21 585<br />
10 431<br />
Gewinnung und Verarbeitung von Gestein und Mineralien<br />
38 Gewinnung und Verarbeitung von Gestein und Mineralien<br />
38a<br />
38c<br />
Granit- und Marmorbrüche, einschliesslich Bearbeitung <strong>der</strong> Steine .<br />
Steinbrüche, ohne Granit-, Marmor- und Schieferbrüche, einschliesslich Steinbearbeitung; Schotterund<br />
Steinmehlaufbereitung .<br />
281 772 43 055<br />
41 811 6 385<br />
70 227 10 982
und Unfallkosten 1953 — 1957 in den Gefahrenklassen<br />
Versicherung<br />
Tabelle 3, Fortsetzung<br />
Gef.<br />
Gr.<br />
und<br />
Gef.<br />
Kl.<br />
Bagatell- Ordentliche<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
davon<br />
Heil kosten<br />
in%,<br />
<strong>der</strong><br />
Lohnsumme<br />
unfälle Unfälle<br />
Total Invali<br />
Krankengeld<br />
ditäts<br />
fälle<br />
Todes<br />
fälle<br />
Unfal l kosten<br />
Kapitalwert <strong>der</strong> Renten<br />
Invaliditätsfälle<br />
Todesfälle absolut<br />
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.<br />
Total<br />
32<br />
32a<br />
32b<br />
32G<br />
32d<br />
32f<br />
321<br />
32k<br />
321<br />
32m<br />
32g<br />
32l<br />
32s<br />
13 387 15 466 28 853 452 56 2 930 854 5 034 400 4 420 301, 2 397 689 14 783 244 13,2<br />
1 026 1 233 2 259<br />
5 229 5 238 10 467 121 17<br />
2 247 2 739 4 986 73 12<br />
791<br />
473<br />
499<br />
123<br />
1 222<br />
1 139<br />
100<br />
31<br />
507<br />
924<br />
499<br />
763<br />
170<br />
1 663<br />
1 509<br />
96<br />
27<br />
605<br />
1 715<br />
972<br />
l 262<br />
293<br />
2 885<br />
2 648<br />
196<br />
58<br />
1 112<br />
37 7 270 072 459 671 323 237 269 876 1 322 856 17,7<br />
32 1<br />
19<br />
18 1<br />
1 l<br />
61 ll<br />
66 3<br />
8<br />
15 3<br />
986 030 1 809 758 889 901 498 979 4 184 668 10,8<br />
521 800<br />
167 691<br />
96 331<br />
124 583<br />
23 024<br />
333 502<br />
271 560<br />
23 131<br />
4 545<br />
108 585<br />
840 667<br />
251 876<br />
154 902<br />
262 726<br />
22 341<br />
539 501<br />
468 137<br />
42 697<br />
7 409<br />
174 715<br />
748 767<br />
221 410<br />
112 754<br />
205 017<br />
6 675<br />
640 565<br />
1 033 201<br />
92 463<br />
295<br />
146 016<br />
768 983 2 880 217 14,0<br />
38 481<br />
67 313<br />
24 153<br />
476 710<br />
181 850<br />
71 344<br />
679 458<br />
363 987<br />
659 639<br />
76 193<br />
1 990 278<br />
] 954 748<br />
]58 291<br />
]2 249<br />
500 660<br />
1 1,1<br />
1 1,2<br />
24,1<br />
]0,4<br />
] ],7<br />
20,2<br />
]9,0<br />
5,0<br />
1 1,1<br />
33<br />
572<br />
787 1 359 25 il 189 994 301 189 433 364<br />
683 273 1 607 820 16,8<br />
33G 572<br />
34<br />
34a<br />
35<br />
35a<br />
35c<br />
35d<br />
35g<br />
354<br />
35i<br />
351<br />
35n<br />
36<br />
36a<br />
37<br />
37b<br />
37G<br />
787 1 359 25 11 189 994 301 189 433 364<br />
952 1 398 2 350 63 4 239 103 464 733 702 352<br />
952 1 398 2 350 63 4 239 103 i 464 733 702 352<br />
9 633 15 199 24 832 427 7 2 238 530 3 696 128 3 157 907<br />
305<br />
l 609<br />
1 481<br />
449<br />
279<br />
1 719<br />
300<br />
3 491 5 022 8 513 145 2<br />
2 706 3 673 6 379 96 5<br />
2 706 3 673 6 379 96 5<br />
1 249 1 670 2 919 48 1<br />
509<br />
740<br />
320<br />
2 198<br />
2 159<br />
583<br />
548<br />
3 755<br />
614<br />
800<br />
870<br />
625<br />
3 807<br />
3 640<br />
1 032<br />
827<br />
5 474<br />
914<br />
l 309<br />
l 610<br />
13 l<br />
564 1<br />
26<br />
11<br />
90<br />
22<br />
16<br />
32<br />
57 640<br />
338 080<br />
306 445<br />
87 505<br />
92 860<br />
475 214<br />
103 234<br />
777 552 ] 214 641<br />
566 673 1 082 790<br />
566 673<br />
221 764<br />
97 762<br />
124 002<br />
84 453<br />
510 545<br />
454 993<br />
138 680<br />
176 218<br />
920 598<br />
196 000<br />
1 082 790<br />
52 703<br />
448 999<br />
509 094<br />
192 484<br />
80 392<br />
557 672<br />
224 692<br />
1 091 871<br />
992 620<br />
992 620<br />
683 273<br />
83 438<br />
83 438<br />
1 607 820 16,8<br />
1489 626 i 18~7<br />
1 489 626 ' ]8.7<br />
119 455 9 212 020 11,8<br />
10 617<br />
10 612<br />
31 608<br />
31 691<br />
10 845<br />
205 413<br />
1 308 236<br />
1 302 140<br />
418 669<br />
349 470<br />
1 985 175<br />
534 771<br />
24 082 3 108 146 1o,4<br />
307 432 2 949 515 17,2<br />
307 432 2 949 515<br />
1], I<br />
8,6<br />
]0,4<br />
]3,0<br />
15,7<br />
19,6<br />
16,4<br />
17,2<br />
319 472 ' 219 835 700 761 771 4,8<br />
137 154 92 846<br />
700 328 462 3,4<br />
182 318 126 989<br />
433 309 7,0<br />
38<br />
38a<br />
38c<br />
6 818 11 715 18 533 589 177 3 876 546 5 601 532 7 708 277 6 110 523 23 296 878 82,7<br />
1 288 2 481 3 769 120 23 656 500 1 037 359 ] 385 550 596 455 3 675 864 87,9<br />
1 822 3 900 5 722 182 46 1 252 546 1 689 290 2 605 448 1 586 781 7 134 065 101,6<br />
157
Versicherte Lohnsumme, Vollarbeiter, Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Tabelle 3, Fortsetzung<br />
Betriebsunfall<br />
Versicherungsbestand<br />
Gefahrengruppen und Gefahrenklassen des Prämientarifs<br />
Versicherte<br />
Lohnsumme<br />
Vollarbeiter<br />
1000 Fr.<br />
38h<br />
38k<br />
381<br />
38s<br />
38t<br />
38u<br />
Sand- und Kiesgewinnung, Kiesrüsten, Ton- und Lehmgruben; Baggerei und Transport von Kies<br />
und Sand zu Wasser .<br />
Torfgewinnung .<br />
Schieferbrüche, einsch1iesslich Steinbearbeitung .<br />
Bearbeitung von Gestein, ohne Schotter- und Steinmehlaufbereitung .<br />
Bergwerke ohne Silikosegefahr<br />
Bergwerke mit Silikosegefahr .<br />
103 439<br />
736<br />
2 128<br />
54 311<br />
7 174<br />
1 946<br />
15 940<br />
158<br />
410<br />
7 731<br />
1 141<br />
308<br />
Bauwesen, Waldwirtschaft<br />
40 Tiefbauunternehmungen 1 743 955 249 097<br />
40a<br />
40b<br />
40d<br />
40e<br />
40f<br />
40g<br />
40k<br />
401<br />
40m<br />
40p<br />
Allgemeine Tiefbauunternehmungen ohne Fels- und Sprengarbeiten und ohne Verwendung von<br />
Baumaschinen<br />
Allgemeine Tiefbauunternehmungen mit Fels- und Sprengarbeiten o<strong>der</strong> mit Verwendung von Baumaschinen<br />
.<br />
Bau und Unterhalt von Bahngeleisen.<br />
Tunnel- und Stollenbau<br />
Wasserbau, Fluss-, Bach- und Lawinenverbauungen; Bau von Brücken, Kraftwerken, Brunnenschächten;<br />
Tief bohrungen<br />
Strassenbau und Strassenunterhalt, Erstellen von Strassenbelägen, Asphaltierung, Teerung, Walzung<br />
Pflästereigeschäfte.<br />
Meliorationsarbeiten, Drainage, Aushebung <strong>der</strong> Gräben für Wasser-, Gas- und Kabelleitungen<br />
Strassenwesen von öffentlichen Verwaltungen, Alpunterhaltsarbeiten: Besorgung <strong>der</strong> Friedhof-,<br />
Park- und Gartenanlagen; Bauaufsicht .<br />
Erstellung von elektrischen Frei- und Kabelleitungen, auch verbunden mit Installation von elektrischen<br />
Anlagen<br />
37 444 5 633<br />
301 789<br />
54 484<br />
223 631<br />
191 802<br />
290 208<br />
11 591<br />
25 697<br />
537 840<br />
69 469<br />
44 347<br />
8 466<br />
33 361<br />
27 955<br />
42 212<br />
I 732<br />
3 961<br />
70 451<br />
10 979<br />
41 Hochbauunternehmungen<br />
2 640 753 387 883<br />
41a<br />
41d<br />
Hochbau, auch mit Tiefbauarbeiten<br />
Abbruch von Hochbauten<br />
2 630 504<br />
10 249<br />
386 502<br />
1 381<br />
42<br />
Wald wirtschaft<br />
328 223<br />
58 539<br />
42b<br />
42c<br />
Waldwirtschaft .<br />
Holzfällen, Holztransport<br />
307 959<br />
20 264<br />
54 748<br />
3 791<br />
43 Betriebe <strong>der</strong> mechanischen Holzbearbeitung mit Bauarbeiten<br />
1 118 586 175 788<br />
43a<br />
43c<br />
43d<br />
43e<br />
Bau- und Möbelschreinerei, Innenausbau, Bauglaserei, Fensterfabrikation.<br />
Mechanische Zimmerei, Chaletbau, auch mit Sägerei .<br />
Mechanische Zimmerei, Chaletbau, verbunden mit Bau- und Möbelschreinerei o<strong>der</strong> Parkettfabrikation,<br />
auch mit Sägerei .<br />
Baugeschäfte; Maurer- und Erdarbeiten, verbunden mit mechanischer Bauschreinerei o<strong>der</strong> mechanischer<br />
Zimmerei, Gebäudeunterhalt.<br />
451 177<br />
61 202<br />
359 535<br />
246 672<br />
71 529<br />
9 930<br />
57 137<br />
37 192<br />
44<br />
Baugewerbe.<br />
427 744<br />
56 825<br />
44d<br />
44e<br />
44g<br />
G ipser-, M a ler- und Stukkaturgeschäfte<br />
Dachdeckergeschäfte, auch mit Kaminfegerei verbunden; Flachbedachungen<br />
Kaminfegergeschäfte.<br />
347 826<br />
54 293<br />
25 625<br />
44 994<br />
8 055<br />
3 776<br />
45<br />
Betriebe für Installation, Montage und Bauarbeiten ohne mechanische Holz- o<strong>der</strong> Metallbearbeitung<br />
und ohne mechanische Fabrikation von Baumaterialien<br />
1 359 770<br />
200 846<br />
45a<br />
45b<br />
Bau- und Möbelschreinerei, Bau- und Blankglaserei<br />
Legen von Bretterböden, Parkett, Linoleum, Steinholz .<br />
12 367<br />
53 815<br />
1 801<br />
7 126
und Unfallkosten 1953 — 1957 in den Gefahrenklassen<br />
Versicherung<br />
Tabelle 3, Fortsetzung<br />
Gef.<br />
Gr.<br />
und<br />
Gef.<br />
K1.<br />
Bagatel l<br />
unfälle<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
davon<br />
Invaliditätsfälle<br />
Invaliditätsfälle<br />
fälle<br />
Heilkosten<br />
Krankengeld<br />
Unfallkosten<br />
Kapitalwert <strong>der</strong> Renten<br />
in /pp<br />
<strong>der</strong><br />
Lohnsumme<br />
Todesfä1 le<br />
absolut<br />
Fr. Fr. Fr.<br />
Fr. Fr.<br />
Total<br />
384<br />
38k<br />
381<br />
38s<br />
38t<br />
38u<br />
2 169<br />
18<br />
55<br />
1 250<br />
161<br />
55<br />
3 271<br />
27<br />
176<br />
1 399<br />
259<br />
202<br />
5 440 161 45<br />
45 — 1<br />
231 28 14<br />
2 649 60 9<br />
420 12 2<br />
257 26 37<br />
751 461<br />
6 433<br />
155 462<br />
291 977<br />
51 595<br />
710 572<br />
1 271 885<br />
5 787<br />
129 033<br />
521 435<br />
77 791<br />
868 952<br />
1 991 829 2 174 651<br />
408 041<br />
585 423<br />
99 092<br />
632 894<br />
384 698<br />
168 609<br />
51 112<br />
1 148 217<br />
6 189 826<br />
12 220<br />
1 077 234<br />
1 567 444<br />
279 590<br />
3 360 635<br />
59,8<br />
16,6<br />
506,2<br />
28,9<br />
39,0<br />
1726,9<br />
4Q 38 551 59 375 97 926, 2286 505 15 737 794 26 611 851 30 671 141 19 192 991 92 213 777 52,9<br />
40a<br />
40b<br />
40d<br />
40e<br />
40f<br />
40g<br />
4014<br />
401<br />
639 1 130 1 769<br />
7 122<br />
1 165<br />
9 375<br />
12 377<br />
2 514<br />
15 064<br />
19 499<br />
3 679<br />
24 439<br />
39 3<br />
413 58<br />
62 17<br />
786 266<br />
198 772 379 517<br />
2 399 699<br />
385 640<br />
6968 306<br />
4 681 490<br />
733 684<br />
9 776 454<br />
321 842<br />
4pnq 5 296 8 505 13 8pl, 256 29 1 371 705 2 935 577 2 383 264<br />
40p<br />
I 545 2 079<br />
52 120 952 251<br />
25,4<br />
4 107 464 2 305 750 13 494 403 44,7<br />
683 153 608 716 2 411 193 44,3<br />
14 083 340 10 516 412 41 344 512 184,9<br />
12 102 335 63,1<br />
9 411 552 32,4<br />
374 435 ' 32,3<br />
952 272 37,1<br />
947 407 7 637 953<br />
3 624 86 21 516 098 921 289 1 209 428 886 056 3 532 871<br />
41 59 735 97 753 157 488 2923 273 16 931 471 33 211 004 28 292 910 9 564 536 87 999 921 33,3<br />
16 744 753 32 808 959 27 480 011 9 352 577 86 386 300 32,8<br />
186 718 402 045 812 899 211 959 1 613 621 157,4<br />
41a<br />
41d<br />
42<br />
42b<br />
42c<br />
59 299<br />
436<br />
96 890 156 189 2866 267<br />
863 1 299 57 6<br />
3 856 16 264 20 120 582 73 2 992 372 5 320 864 5 060 661 2 204 792 15 578 689 47,5<br />
3 619 13 987 17 606 475 60 2 515 832 4 579 301 4 044 380 1 867 245 13 006 758<br />
237 2 277 2 514 107 13 476 540 741 563 1 016 281 337 547 2 571 931<br />
43 26 301 34 116 60 417 1745 7Q 5 472 156 10 336 274 16 151 666 2 514 948 34 475 044 30,8<br />
43a<br />
43c<br />
10 304<br />
1 468<br />
11 569<br />
2 567<br />
21 873<br />
4 035<br />
661 8<br />
147 6<br />
1 698 076<br />
455 336<br />
3 141 536<br />
902 173<br />
5 656 974<br />
1 808 251<br />
243 806<br />
294 535<br />
10 740 392<br />
3 460 295<br />
43d 8 976 12 190 21 166 632 34 2 038 966 3 808 839 5 922 089 1 164 640 12 934 534 36,0<br />
43e<br />
44<br />
44d<br />
44e<br />
44g<br />
7 681<br />
5 227<br />
187<br />
314<br />
5 553 7 790 ]3 343 305 22 l 279 778 2 483 726 2 764 352<br />
14,2<br />
50,9<br />
42,2<br />
126,9<br />
23,8<br />
56,5<br />
811 967 7 339 823 29,8<br />
6 206 9 727 15 933 269 35 1 706 537 3 781 173 3 243 934 1 219 803 9 951 447 23,3<br />
4 363<br />
1 512<br />
331<br />
7 401<br />
9 207<br />
299<br />
799<br />
6 999<br />
2 090<br />
638<br />
15 082<br />
14 434<br />
486<br />
l 113<br />
11 362<br />
3 602<br />
969<br />
321 54<br />
284 53<br />
12 3<br />
27 1<br />
161<br />
91<br />
17<br />
20<br />
14<br />
1<br />
1 138 140<br />
459 707<br />
108 690<br />
2 702 669<br />
867 242<br />
211 262<br />
1 821 747<br />
1 150 336<br />
271 851<br />
674 718<br />
516 818<br />
28 267<br />
6 337 274<br />
2 994 103<br />
620 070<br />
45 29 429 27 499 56 928 659 65 4 692 783 8 431 508 7 277 457 2 585 616 22 987 364 16,9<br />
19 3<br />
1 962 429<br />
1 731 341<br />
52 378<br />
151 426<br />
3 468 398<br />
3 301 238<br />
115 509<br />
298 695<br />
4 607 820<br />
2 634 383<br />
162 479<br />
477 968<br />
2063 688<br />
1 744 590<br />
44 069<br />
24 183<br />
45a 281 377 658 15<br />
63 666 115 316 128 493<br />
45b 650 1 096 1 746<br />
164 845 380 165 179 823 58 050<br />
307 475<br />
782 883<br />
18,2<br />
55,1<br />
24.2<br />
24,9<br />
14,5<br />
159
Tabelle 3, Fortsetzung<br />
Versicherte Lohnsumme, Vollarbeiter, Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Betriebsunfall<br />
Versicherungsbestand<br />
Gefahrengruppen und Gefahrenklassen des Prämientarifs<br />
Versicherte<br />
Lohnsumme<br />
Vollarbeiter<br />
1000 Fr.<br />
45d<br />
45g<br />
45h<br />
45i<br />
451<br />
45m<br />
4sp<br />
Zimmerei und Baugeschäfte, Maurer- und Erdarbeiten, verbunden mit Schreinerei o<strong>der</strong> Zimmerei;<br />
Gebäudeunterhalt; Gebäude- und Glasreinigungsunternehmungen<br />
Bauspenglerei, auch mit Installationsarbeiten und Dachdeckerei verbunden.<br />
Installationsgeschäfte für Gas-, Wasser- und sanitäre Anlagen; Zentralheizungen .<br />
Installation von elektrischen Anlagen<br />
Montage von Maschinen, Aufzügen, Hebezeugen, Luftseilbahnen, Eisenkonstruktionen, Installation<br />
von Fabrikeinrichtungen ohne ausgedehnte Werkstattarbeiten; Verlegen von Wasserleitungen<br />
Hafnergeschäfte ohne Schlosserarbeiten; Ausführung von Steinböden und Wandbelägen; Kälteund<br />
Wärmeisolation .<br />
Maler- und Bautapezierergeschäfte; Beizerei, Poliererei; Automalerei; Baudekoration, Möbeltapeziererei.<br />
39 549<br />
222 238<br />
211 418<br />
345 940<br />
15 653<br />
111 758<br />
347 032<br />
6 224<br />
34 325<br />
30 317<br />
54 863<br />
2 009<br />
15 244<br />
48 937<br />
Bahnen<br />
46<br />
46a<br />
46h<br />
Betriebspersonal <strong>der</strong> Bundesbahnen und <strong>der</strong> Speise- und Schlafwagengesellschaften<br />
Bundesbahnen<br />
Speise- und Schlafwagengesellschaften .<br />
1 505 878<br />
1 483 418<br />
22 460<br />
170 747<br />
167 787<br />
2 960<br />
47<br />
47a<br />
47c<br />
47d<br />
47e<br />
47f<br />
Übrige Bahnen 644 019<br />
Adhäsionsbahnen .<br />
Zahnrad- und Drahtseilbahnen .<br />
Städtische Verkehrsbetriebe, elektrische Trambahnen, Trolleybusbetriebe<br />
Luftseilbahnen und Aufzüge<br />
Skischleppseilbahnen und Schlittenseilbahnen.<br />
240 744<br />
56 619<br />
328 601<br />
11 533<br />
6 522<br />
81 614<br />
33 992<br />
8 421<br />
36 209<br />
1 836<br />
1 156<br />
An<strong>der</strong>e Transportunternehmungen, Handelsbetriebe<br />
49<br />
49a<br />
Autotransporte<br />
Autotransport von Personen und Gütern; Autogaragen mit Transportbetrieb.<br />
276 002<br />
276 002<br />
41 834<br />
41 834<br />
50<br />
Soa<br />
Sob<br />
Flugbetriebe 70 845 8 099<br />
Flugbetriebe (Piloten, Bordpersonal) .<br />
Flugbetriebe (Flugplatz- und Werkstättepersonal)<br />
23 297<br />
47 548<br />
2 381<br />
S 718<br />
51 Fuhrhalterei<br />
70 962 11 702<br />
Sla Allgemeine Fuhrhalterei, auch mit Autotransport verbunden<br />
17 561 3 260<br />
51b Camionnage, Personentransport, Abfuhrwesen, auch mit Autotransport verbunden.<br />
53 401 8 442<br />
52 Lager- und Handelsbetriebe .<br />
987 902 146 552<br />
52a<br />
52b<br />
52c<br />
52d<br />
52k<br />
521<br />
52m<br />
52r<br />
Allgemeine Lager- und Handelsbetriebe<br />
Handels- und Lagerbetriebe für Petrol, Benzin, Chemikalien.<br />
Baumaterialien-, Holz- und Metall-Grosshandel .<br />
Altmetall- und Abfallhandel, Abbruch von alten Maschinen und Handel damit.<br />
Landesproduktehandel, landwirtschaftliche Genossenschaften .<br />
Wein- und Getränkehandel; Getränkedepots; Mosterei; Fabrikation von Schaum- und alkoholfreien<br />
Weinen.<br />
Beladen und Entladen von Eisenbahnwagen.<br />
Brennmateria1 ien handel<br />
477 050<br />
55 795<br />
104 939<br />
33 856<br />
81 292<br />
127 173<br />
23 140<br />
84 657<br />
67 851<br />
7 388<br />
15 255<br />
S 708<br />
13 378<br />
20 989<br />
3 437<br />
12 546<br />
53 Schiffahrtsunternehmungen<br />
95 433 13 932<br />
53a<br />
53b<br />
Schiftahrtsunternehmungen; Bootsvermietung.<br />
Hafen betriebe<br />
64 047<br />
31 386<br />
10 500<br />
3 432<br />
160
und Unfallkosten 1953 — 1957 in den Gefahrenklassen<br />
Versicherung<br />
Tabelle 3, Fortsetzung<br />
Gef.<br />
Gr.<br />
und<br />
Gef.<br />
K l.<br />
Bagatell- Ordentliche<br />
unfälle Unfälle<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
davon<br />
Hei1 kosten Krankengeld Invaliditätsfälle<br />
Invaliditä-<br />
Todesälle<br />
fälle<br />
Unfallkosten<br />
Kapitalwert <strong>der</strong> Renten<br />
Todesfälle<br />
Fr. Fr.<br />
Fr. Fr.<br />
absolut<br />
Fr.<br />
Total<br />
ln %o<br />
<strong>der</strong><br />
Lohnsumme<br />
45d<br />
45g<br />
45h<br />
45i<br />
549<br />
7 495<br />
5 870<br />
8 412<br />
45 l 411<br />
45m<br />
1 713<br />
1 246<br />
5 962<br />
4 942<br />
6 334<br />
47 4<br />
120 16<br />
88 6<br />
135 16<br />
794 16 4 83 687<br />
1 795<br />
13 457<br />
10 812<br />
14 746<br />
243 852<br />
1 021 408<br />
783 356<br />
1 050 648<br />
462 634<br />
1 592 794<br />
1 428 396<br />
1 663 965<br />
383 141 787<br />
2 265 3 978 52<br />
363 613<br />
45p 4 048 4 894 8 942 ]67 13<br />
826 152<br />
394 790<br />
1 476 717<br />
955 294<br />
1 536 499<br />
146 521<br />
600 946<br />
226 503<br />
747 738<br />
917 708 1 820 299 1 896 448 409 913<br />
1 247 797<br />
4 691 865<br />
3 393 549<br />
4 998 850<br />
289 420 306 668 821 562 52,5<br />
419 973 89 277 1 699 015 15,2<br />
5 044 368<br />
31,6<br />
21,1<br />
16,1<br />
14,5<br />
14,5<br />
46 23 461<br />
46a<br />
46h<br />
47<br />
47a<br />
47c<br />
47d<br />
47e<br />
47f<br />
23 145<br />
316<br />
19 146 42 607 237 88<br />
18 814 41 959 228 87<br />
332 648 9 1<br />
3 014 719<br />
2 972 837<br />
41 882<br />
6 069 843<br />
5 978 522<br />
91 321<br />
5 192 497<br />
5 090 646<br />
101 851<br />
5 209 908<br />
5 194 862<br />
15 046<br />
19 486 967<br />
]9 236 867<br />
250 100<br />
7 569 7 816 15 385 168 33 1 357 209 2 642 649 2 230 242 1 906 507 8 136 607 12,6<br />
4 410<br />
746<br />
2 095<br />
195<br />
123<br />
3 668<br />
867<br />
2 729<br />
256<br />
296<br />
8 078<br />
I 613<br />
4 824<br />
451<br />
419<br />
67 27<br />
22<br />
48 5<br />
15 1<br />
16<br />
630 417<br />
157 411<br />
432 199<br />
68 732<br />
68 450<br />
1 072 919<br />
278 371<br />
1 045 832<br />
116 557<br />
128 970<br />
914 408<br />
226 152<br />
819 545<br />
147 631<br />
122 506<br />
1 527 732<br />
322 175<br />
56 600<br />
4 145 476<br />
661 934<br />
2 619 751<br />
389 520<br />
319 926<br />
12,9<br />
13,0<br />
1 l,l<br />
17,2<br />
1 1,7<br />
8,0<br />
33,8<br />
49,1<br />
49<br />
49a<br />
50 574<br />
spa<br />
50b<br />
51<br />
5la<br />
5lb<br />
4 708 6 434 ]1 142 210 28 1 184 183 2 247 991 2 270 633 979 250 6 682 057 24,2<br />
4 708 6 434 11 142 210 28 I 184 183 2 247 991 2 270 633 1 979 250 6 682 057 24,2<br />
37<br />
537<br />
649 1 223<br />
61<br />
588<br />
98<br />
1 125<br />
7 13<br />
1 325 2 451 3 776 87 14<br />
335<br />
990<br />
722<br />
1 729<br />
l 057<br />
2 719<br />
33<br />
54<br />
13<br />
117 624 1 016 864 1408 286 19,9<br />
1 016 864<br />
1 115 680<br />
292 606<br />
47,9<br />
6,2<br />
415 532 2747 194 38,7<br />
310 755<br />
104 777<br />
1 151 208<br />
1 595 986<br />
52 15 327 22 471 37 798 666 45 3 703 635 6 965 331 6 039 772 1 791 920 18 500 658 18,7<br />
52a<br />
52b<br />
52c<br />
52d<br />
52k<br />
521<br />
52m<br />
53r<br />
53<br />
53a<br />
53b<br />
6 093<br />
762<br />
2 146<br />
l 114<br />
926<br />
2 248<br />
577<br />
1 461<br />
3 438<br />
1 310<br />
3 075<br />
5 686<br />
1 887<br />
4 536<br />
113<br />
43<br />
117<br />
1 760 2 555 4 315 91 14<br />
991<br />
769<br />
7 714<br />
916<br />
3 087<br />
1 614<br />
l 317<br />
1 272<br />
l 283<br />
]3 807<br />
1 678<br />
5 233<br />
2 728<br />
2 243<br />
2 263<br />
2 052<br />
175<br />
12<br />
80<br />
65<br />
61<br />
47<br />
44<br />
ll<br />
1<br />
7<br />
1<br />
5<br />
10<br />
2<br />
8<br />
11<br />
3<br />
106 500<br />
28 875<br />
77 625<br />
510 936<br />
201 427<br />
309 509<br />
1 198 125<br />
156 279<br />
493 333<br />
265 908<br />
264 024<br />
586 833<br />
249 286<br />
489 847<br />
1 020 336<br />
468 669<br />
1 050 511<br />
435 686 1 121 239<br />
213 860<br />
221 826<br />
167 298<br />
24 204<br />
143 094<br />
832 540<br />
256 941<br />
575 599<br />
2 200 532<br />
296 240<br />
964 958<br />
462 227<br />
501 858<br />
421 364<br />
699 875<br />
45 737<br />
71 887<br />
988 186<br />
382 085<br />
606 101<br />
1 587 795<br />
158 307<br />
655 895<br />
573 999<br />
697 446<br />
l 056 778<br />
422 959<br />
886 593<br />
784 334<br />
340 538<br />
443 796<br />
466 626<br />
29 244<br />
238 150<br />
37 836<br />
225 125<br />
359 651<br />
65 451<br />
369 837<br />
610 575<br />
462 700<br />
147 875<br />
5 453 078<br />
640 070<br />
2 352 336<br />
1 339 970<br />
1 688 453<br />
65,6<br />
29,9<br />
l 1,4<br />
l 1,5<br />
22,4<br />
39,6<br />
20,8<br />
3 023 598 23,8<br />
l 206 365 ', 52 1<br />
2 796 788 ! 33,0<br />
2 951 834 30,9<br />
l 438 462 1' 22.5<br />
i 5i3 372 48,2
Tabelle 3, Schluss<br />
Versicherte Lohnsumme, Vollarbeiter, Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Betriebsunfall<br />
Versicherungsbestand<br />
Gefahrengruppen und Gefahrenklassen des Prämicntarifs<br />
Versicherte<br />
Lohnsumme<br />
Vollarbeiter<br />
1000 Fr.<br />
Licht-, Kraft- und Wasserwerke<br />
55<br />
55a<br />
Erzeugung und Verteilung von elektrischem Strom<br />
416 490 52 899<br />
Stromerzeugung und Stromverteilung, einschl iesslich Freileitungsbau und Hausinstallationen 416 490 52 899<br />
56<br />
Gas- und Wasserversorgung .<br />
178 385<br />
20 174<br />
56a<br />
56b<br />
56c<br />
Wasserversorgung.<br />
Gaswerke<br />
Vereinigte Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung.<br />
25 861<br />
105 119<br />
47 405<br />
2 814<br />
11 605<br />
5 755<br />
Kinos<br />
59<br />
59a<br />
Kinos<br />
Kinos<br />
47 151 7 537<br />
47 151 7 537<br />
Büros, Verwaltungen<br />
60<br />
Kaufmännische und technische Büros .<br />
5 924 843<br />
773 174<br />
60f<br />
Kaufmännische und technische Büros, Verwaltungen; Reisedienst, Verkaufsläden.<br />
5 924 843<br />
773 174<br />
61<br />
61a<br />
Verwaltung <strong>der</strong> Bundesbetriebe<br />
Post-, Telegraphen- und Telephonverwaltung; Bundesbahnen (Büropersonal); Kriegstechnische<br />
Abteilung<br />
1 448 916<br />
159 348<br />
1 448 916 159 348<br />
1 — 61<br />
Total 38 337 668 5 667 815<br />
N ichtbetriebsun fal l<br />
Versicherungsbestand<br />
Gefahrenklassen<br />
Versicherte<br />
Lohnsumme<br />
Vol 1 arbeiter<br />
1000 Fr.<br />
Männliche Versicherte.<br />
Weibliche Versicherte<br />
Männliche und weibliche Versicherte.<br />
Kollektivabreden .<br />
Einzelabreden<br />
31 951 335<br />
6 159 297<br />
4421 545<br />
1 246 270<br />
38 110 632 5 667 815<br />
Total 38 110 632 5 667 815<br />
162
und Unfallkosten 1953-1957 in den Gefahrenklassen<br />
Versicherung<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle Unfankosten<br />
Tabelle 3, Schluss<br />
Gef" Total Kapitalwert <strong>der</strong> Renten Total<br />
Gr.<br />
und Bagatell- Ordentliche . ~ _ _ __ - 0<br />
räııe w“ l LOW*<br />
Glågll- unlälle Unfälle Total TOl-des- Heılkosten Krankengeld Invalllllñgaıy Todesfälle absolut lflde/llıu<br />
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. l Summe<br />
55 5 859 5 514 11 373 184 50 1 202 231 2 169 347 2 604 021 2 777 706 8 753 305 21,0<br />
55a 5 859 5 514 11 373 184 50 1 202 231 2 169 347 2 604 021 2 777 706 8 753 305 21,0<br />
56 3 267 2 940 6 207 66 13 536 169 1 093 029 868 017 711 335 3 208 550 18,0<br />
56a 430 387 817 7 1 67 028 129 883 86 596 69 903 353 410 13,7<br />
56b 1 880 1 854 3 734 42 6 322 481 697 441 600 377 234 422 1 854 721 17,6<br />
56c 957 699 1 656 17 6 146 660 265 705 181 044 407 010 1 000 419 21,1<br />
59 169 202 371 6 _- 70 135 72 762 73 633 _ 10 740 205 790 4,4<br />
59a 169 202 371 6 -~ 70 135 ' 72 762 73 633 _ 10 740 205 790 4,4<br />
60 13 949 12 094 26 043 285 54 2 389 591 3 402 973 2 962 323 2 731 780 11 486 667 1,9<br />
60f 13 949 12 094 26 043 285 54 2 389 591 3 402 973 2 962 323 2 731 780 ll 486 667 1,9<br />
61 5 795 6 977 12 772 73 13 1 051 708 1 819 326 1 031 226 593 626 4 495 886 3,1<br />
61 a 5 795 6 977 12 772 73 13 1 051 708 1 819 326 1 031 226 593 626 4 495 886 3,1<br />
1-61 568 039 624 116 1 192 155 20 369 2 053 113 213 822 195 000 300 201 957 233 81 052 765 591 224 120 15,4<br />
Versicherung<br />
Gcf. K1.<br />
.. ' n<br />
zanı <strong>der</strong> Unfäııe Unfallkosıen<br />
Total Kapitalwert <strong>der</strong> Renten Total<br />
fane d e Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Summe<br />
811133111121- Oüfırllêlillilfehe Total Tloutllltes- Heilkosten Krankengeld Invašıåiiflíetäts- Todesfälle absolut :clilšoo<br />
Männer 134 978 l 272 629 407 607 7 089 1 752 48 440 434 86 220 489 71 791 108 57 389 416 263 841 447 8,3<br />
Frauen 38 144 66 907 105 051 1 395 130 11 384 124 14 576 217 9 665 483 1 507 469 37 133 293 6,0<br />
173 122 339 536 512 658 8 484 1 882 59 824 558 100 796 706 81 456 591 58 896 885 300 974 740 7,9<br />
383 6 744 7 127 306 77 1 412 073 2 482 506 2 834 599 1 472 829 8 202 007<br />
26 217 243 9 _ 41 153 75 890 54 383 _ 171 426<br />
Total 173 531 346 497 520 028 8 799 1 959 61 277 784 103 355 102 84 345 573 60 369 714 309 348 173 8,1<br />
163
Unfälle in den Giessereien nach Unfallgegenstand<br />
Ohne Silikosen<br />
1956<br />
Tabelle 4 a<br />
†19<br />
Sandformgiessereien<br />
Unfallgegenstand<br />
Ordentliche Renten- Unfallkosten Ordentliche<br />
Unfälle fälle, in Franken Unfälle<br />
1956-1957 1948-1957 i 1948-1957<br />
Block giessereien<br />
Renten- Unfall kosten<br />
fälle in Franken<br />
1948-1957 1948-1957<br />
Kokillen- und Druckgiessereien<br />
Umschmelzwerke<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
1956-1957<br />
Renten- Unfall kosten<br />
f~lle in Franken<br />
1948-1957 1948-1957<br />
Vorbereitung des Rohmaterials.<br />
Pressen, Scheren<br />
Masseln, Barren<br />
Schrott<br />
Gleisfahrzeuge .<br />
Krane, Lastbefestigungsmittel<br />
Übrige.<br />
205<br />
5<br />
34<br />
18<br />
18<br />
3<br />
127<br />
37 777 480 165 35 607 822 33<br />
85 882<br />
55 009<br />
92 135<br />
48 670<br />
52 180<br />
13 649<br />
35<br />
4<br />
48<br />
17<br />
7<br />
14 168 254<br />
5 085<br />
144 880<br />
78 190<br />
79 292<br />
31 185<br />
4 707<br />
3 325<br />
24 515 837 54<br />
132 121 27 46 665<br />
Sandauf bereitung<br />
För<strong>der</strong>bän<strong>der</strong>, Becherwerke,<br />
Sandschleu<strong>der</strong>n, M ischer .<br />
Karretten, Sandkarren, mobile<br />
Einrichtungen<br />
Formstifte .<br />
Silos<br />
Übrige<br />
234<br />
77<br />
52 1 028 725 32 464<br />
40<br />
690 047 30 674<br />
32<br />
8<br />
14<br />
103 10<br />
21 125<br />
31 041<br />
18 569<br />
267 943<br />
1 790<br />
Formenherstellung . 1 128 130 2 748 091 25 7 ]66 759 24<br />
84 287<br />
Formmaschinen.<br />
Pressluftstampfer .<br />
Modell- und Kokillenbau<br />
Formkasten, Formen, Kernbüchsen,<br />
Modelle .<br />
Nägel, Formstifte .<br />
Krane, Lastbefestigungsmittel<br />
Übrige.<br />
105<br />
13<br />
39<br />
517<br />
53<br />
103<br />
298<br />
17 319 792<br />
13<br />
17 318<br />
91 193<br />
8 272<br />
51<br />
1<br />
20<br />
28<br />
1 141 930<br />
94 153<br />
546 669<br />
537 036<br />
13 36 808 10<br />
86 121<br />
43 830<br />
I<br />
10<br />
1 ; 17 103<br />
1 516<br />
57 396<br />
Schmelzerei 236 28 856 ]57 ]06 27 619 659 25 ]59 024<br />
Kupolöfen:<br />
Verbrennungen durch flüssiges<br />
Metall.<br />
an<strong>der</strong>e Unfälle .<br />
Elektroöfen:<br />
Verbrennungen durch flüssiges<br />
Metall.<br />
an<strong>der</strong>e Unfälle .<br />
Tiegel- und an<strong>der</strong>e Öfen:<br />
Verbrennungen durch flüssiges<br />
Metall.<br />
an<strong>der</strong>e Unfälle .<br />
Gase und Rauche .<br />
Chargiereinrichtungen, Setzbodenaufzüge.<br />
Schrott, Masseln, Schlacke, Koks<br />
Herrichten und Ausbessern von<br />
Öfen und Pfannen.<br />
Krane, Lastbefestigungsmi t te 1<br />
Übrige.<br />
28<br />
16<br />
3<br />
]3<br />
11<br />
8<br />
5<br />
10<br />
38<br />
33<br />
6<br />
65<br />
3<br />
2<br />
]2<br />
97 713<br />
27 559<br />
3 716<br />
20 888<br />
39 100<br />
8 237<br />
28 573<br />
45 483<br />
83 180<br />
98 955<br />
95 258<br />
307 495<br />
Giesserei 614 48 1 724 493<br />
26 1 061 512<br />
Flüssiges Metall (Verbrennungen)<br />
davon:<br />
— Verschütten beim Tragen von<br />
Pfannen und Tiegeln .<br />
14<br />
11<br />
10<br />
12<br />
44<br />
2<br />
6<br />
11<br />
21 129<br />
4 294 21 496<br />
78 244<br />
105 740<br />
5 382<br />
2 441<br />
4 940<br />
5 681<br />
47 747<br />
5 320<br />
29 156<br />
1 987<br />
7 112 4 855<br />
34 277<br />
163 300<br />
190 813<br />
405 37 106 404<br />
51 143 501 725<br />
2<br />
12<br />
1 237<br />
43 532<br />
73 12 347 109 5] 333 866<br />
9 595<br />
164
Unfälle in den Giessereien nach Unfallgegenstand<br />
Ohne Silikosen<br />
Tabelle 4a<br />
Sand formgiessereien<br />
Blockgiessereien<br />
Kokillen- und Druckgiessereien<br />
Umschmelzwerke<br />
U nfallgegenstand<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
1956-1957<br />
Rentenfälle<br />
1948-1957<br />
Unfallkosten<br />
in Franken<br />
1948-1957<br />
Ordentliche Renten- Unfallkosten<br />
Unfälle fälle in Franken<br />
1956-1957 1948-1957 1948-1957<br />
Ordentliche Renten- Unfallkosten<br />
Unfälle fälle in Franken<br />
1956-1957 1948-1957 1948-1957<br />
— Verschütten beim Krantransport<br />
.<br />
— Verschütten beim Füllen von<br />
Pfannen und Löffeln .<br />
— Spritzer beim Giessen, Überfüllen<br />
<strong>der</strong> Formen .<br />
— Undichte o<strong>der</strong> vorzeitig geöffnete<br />
Formen .<br />
Druckgussmaschinen (einschl<br />
iesslich Verbrennungen)<br />
Motorfahrzeuge, Gleiswagen .<br />
Krane, Lastbefestigungsmit tel<br />
Übrige<br />
14<br />
301 18<br />
30<br />
3<br />
15<br />
12<br />
179<br />
5<br />
1<br />
3<br />
13<br />
32 708<br />
49 293<br />
737 253<br />
98 757<br />
98 410<br />
16 610<br />
78 277<br />
469 684<br />
8 103<br />
72 715<br />
5 660<br />
24 861<br />
3 935<br />
10 262 508<br />
19<br />
l<br />
17 797<br />
7<br />
178 485<br />
28 44 423 27<br />
61 763<br />
Gussputzerei<br />
1 644 149 3 326 455<br />
81 9 195 101<br />
41<br />
51 703<br />
Maschinen und Geräte.<br />
davon:<br />
— Metallsägen.<br />
— Schmirgel- und Trennschleifmaschinen<br />
— Pressluftmeissel .<br />
— weitere Maschinen und Geräte<br />
.<br />
Formen, Formkasten<br />
Gußstücke .<br />
Krane, Lastbefestigungsmit tel<br />
Übrige.<br />
352 38<br />
17<br />
255<br />
33<br />
47<br />
114<br />
566<br />
74<br />
538<br />
24<br />
l<br />
6<br />
8<br />
60<br />
16<br />
27<br />
753 587<br />
131 225<br />
445 904<br />
53 729<br />
122 729<br />
193 287<br />
1 357 249<br />
390 347<br />
631 985<br />
1<br />
6<br />
5<br />
8<br />
57<br />
4 961<br />
3 479<br />
1 160<br />
322<br />
41 158<br />
9 194<br />
6 607<br />
133 181<br />
23<br />
10 561<br />
850<br />
7 776<br />
586<br />
1 349<br />
8 107<br />
33 035<br />
Bearbeitung<br />
Maschinen .<br />
davon:<br />
— Metall fräs-, Bohrmaschinen,<br />
Drehbänke .<br />
— Pressen<br />
— Schmirgelmaschinen .<br />
— weitere Maschinen.<br />
Übrige.<br />
198 35 710 475 22<br />
102 23<br />
39<br />
18<br />
36<br />
96<br />
20<br />
2<br />
1<br />
12<br />
432 149<br />
283 780<br />
16 141<br />
19 475<br />
112 753<br />
278 326<br />
13<br />
34 191<br />
26 140<br />
6 773<br />
2 834<br />
1 663<br />
14 870<br />
8 051<br />
72<br />
57<br />
23<br />
20<br />
8<br />
15<br />
17 228 348<br />
16 212 768<br />
37 951<br />
117 289<br />
34 789<br />
22 739<br />
15 580<br />
Spedition und Betriebsunterhalt<br />
196 33<br />
875 229<br />
22<br />
3 116 257<br />
26<br />
64 203<br />
Betriebsunterhalt .<br />
Handfahrzeuge .<br />
Motorfahrzeuge.<br />
Krane, Lastbefestigungsmit tel<br />
Übrige.<br />
51<br />
10<br />
11<br />
l9<br />
105<br />
11<br />
2<br />
1<br />
9<br />
10<br />
188 237<br />
23 677<br />
20 815<br />
286 383<br />
356 117<br />
4<br />
10<br />
48 604<br />
51 186<br />
16 467<br />
31 246<br />
5 809<br />
1 581<br />
10 457<br />
15 110<br />
Verschiedenes<br />
386<br />
44 1 245 654<br />
28<br />
7 145 731<br />
38<br />
44 560<br />
(Ausgleiten auf Treppen, Glatteis<br />
und in Waschräumen; Streit,<br />
Bewerfen mit Sandstücken usw.)<br />
Total<br />
4 841<br />
556 13 292 759<br />
523<br />
103 2 265 093<br />
310<br />
49 1 051 873
Tabelle 4b<br />
Unfälle in den Giessereien nach Verletzungsgegenstand<br />
Ohne Silikosen<br />
Verletzungsgegenstand<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
1956-1957<br />
Sandformgiessereien<br />
Rentenfälle<br />
1948-1957<br />
Unfall kosten<br />
in Franken<br />
1948-1957<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
1956-1957<br />
Block giessereien<br />
Rentenfälle<br />
1948-1957<br />
Unfallkosten<br />
in Franken<br />
1948-1957<br />
Kokillen- und Druckgiessereien<br />
Umschmelzwerke<br />
Ordentliche Renten- Unfallkosten<br />
Unfälle fälle in Franken<br />
1956-1957 1948-1957 1948-1957<br />
Schlag durch einen Gegenstand.<br />
i 243 147 3 633 074<br />
151<br />
38 750 415<br />
68<br />
5 138 441<br />
Kranhaken, -ketten, -seile<br />
Hämmer.<br />
Formkasten, Formen, Kokillen<br />
Modelle, Kernbüchsen<br />
Masseln und Barren .<br />
Gußstücke .<br />
Übrige.<br />
23<br />
80<br />
179<br />
74<br />
33<br />
317<br />
537<br />
5<br />
4<br />
26<br />
9<br />
5<br />
27<br />
71<br />
80 071<br />
118 094<br />
669 183<br />
187 594<br />
103 078<br />
831 085<br />
1 643 969<br />
10<br />
11<br />
7<br />
6<br />
2<br />
115 25<br />
69 066<br />
33 384<br />
116 318<br />
11 866<br />
1 131<br />
518 650<br />
4<br />
5<br />
49<br />
4 995<br />
13 594<br />
5 214<br />
7 967<br />
106 671<br />
Anschlagen, Anstossen, Stürzen<br />
von Personen .<br />
Boden.<br />
Schächte, Gruben, Silos<br />
Formkasten, Formen, Kokil len<br />
Gußstücke .<br />
Übrige.<br />
59 1 876 916<br />
692 90<br />
307 317 35<br />
186<br />
23<br />
96<br />
64<br />
323<br />
34<br />
4<br />
3<br />
18<br />
873 803<br />
130 748<br />
167 662<br />
96 655<br />
608 048<br />
23<br />
10<br />
1<br />
1<br />
55<br />
63 627<br />
45 477<br />
428<br />
]81<br />
197 604<br />
15<br />
4<br />
16<br />
74 103<br />
25 100<br />
8 874<br />
40 129<br />
116 1 885 563<br />
Einklemmung, Quetschung 618 30<br />
79 339<br />
Form- und Sandmaschinen<br />
Druckgussmaschinen<br />
Metallscheren, Metallsägen .<br />
Pressen<br />
Krane .<br />
Kranhaken, -ketten, -seile<br />
Rollwagen .<br />
Formkasten, Formen, I~ol i'l~;i<br />
Schrott<br />
Gußstücke .<br />
Übrige.<br />
2<br />
4<br />
4<br />
50<br />
39<br />
120<br />
3<br />
88<br />
256<br />
71 27 421 612<br />
52 14 265 314<br />
50 531<br />
1 I 140<br />
3 18 713<br />
2 12 961<br />
4 17 200<br />
2 9 540<br />
61 845<br />
I 62 870<br />
1<br />
14 100 035 4<br />
2 10 327<br />
6 88 896 13 2 57 914<br />
17 420 056 7<br />
1<br />
11 054<br />
2 7 250 7<br />
2 25 675<br />
14 273 296 2<br />
1<br />
3 113<br />
40 631 818 30 13 177 627<br />
2<br />
1<br />
1<br />
1<br />
17<br />
34 919<br />
321<br />
19 661<br />
2 053<br />
2 851<br />
19 534<br />
Hineinlangen, Hineingeraten in<br />
laufende Maschinen<br />
Form- und Sandmaschincn<br />
Metallscheren, Metallsägen.<br />
Metall fräsmasch inen, Drehbänke,<br />
Bohrmaschinen .<br />
Pressen<br />
Schleifmaschinen<br />
Getriebe, Transmissionen<br />
För<strong>der</strong>bän<strong>der</strong>.<br />
Übrige.<br />
204 92 1 350 398<br />
9 102 652 32 20 348 904<br />
41 25 295 915<br />
30 674<br />
16 6 ' 101 731 37 253<br />
49 672<br />
9<br />
1<br />
81<br />
3<br />
10<br />
43<br />
9<br />
3<br />
10<br />
11<br />
8<br />
20<br />
174 122<br />
45 912<br />
110 635<br />
205 256<br />
204 176<br />
212 651<br />
28 725<br />
3 029<br />
10<br />
8<br />
6<br />
31 868<br />
88 343<br />
9 648<br />
1 086<br />
2 971 168 287
Unfälle in den Giessereien nach Verletzungsgegenstand<br />
Ohne Silikosen<br />
Tabelle 4b<br />
Sand formgiessereien<br />
Block giessereien<br />
Kokillen- und Druckgiessereien<br />
Umschmelzwerke<br />
Verletzungsgegenstand<br />
Or den t1 iche<br />
Unfälle<br />
1956-1957<br />
Rentenfälle<br />
1948-1957<br />
Unfa1 1 kosten<br />
in Franken<br />
1948-1957<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
1956-1957<br />
Renten- Unfallkosten<br />
fälle in Franken<br />
1948-1957 1948-1957<br />
Ordentliche<br />
Unfälle<br />
1956-1957<br />
Renten- Unfallkosten<br />
fälle in Franken<br />
1948-1957 1948-1957<br />
Überfahren- o<strong>der</strong> Angefahrenwerden.<br />
62<br />
126 046 65 332<br />
1 814<br />
Krane .<br />
Rollwagen<br />
Übrige.<br />
26<br />
1 775<br />
23 866<br />
46 873<br />
18 459<br />
36 100 405<br />
1 814<br />
Schnitt, Stich, Eindringen von<br />
Fremdkörpern<br />
Formstifte, Nägel, Drähte,<br />
Schrauben .<br />
Schrott<br />
Splitter, Fremdkörper .<br />
Gussnähte, Gräte .<br />
Übrige.<br />
970<br />
112<br />
8<br />
482<br />
43<br />
325<br />
68 1 397 750 63 6 126 950 69 93 385<br />
26<br />
5<br />
30<br />
179 301<br />
5 936<br />
578 073<br />
64 623<br />
569 817<br />
2<br />
18<br />
27<br />
1<br />
15<br />
1 888<br />
19 088<br />
1 49 452<br />
707<br />
55 815<br />
2<br />
2<br />
21<br />
4<br />
40<br />
898<br />
1 098<br />
52 615<br />
2 581<br />
36 193<br />
Verbrennung, Verätzung, Elektrounfall<br />
Flüssiges Metall.<br />
Flammen, Lichtbogen, Hitze<br />
Formsand .<br />
Elektrischer Strom<br />
Übrige.<br />
681 53 2 324 837 96 8 , 371 837 42 8 238 842<br />
529<br />
59<br />
33<br />
4<br />
56<br />
39<br />
1 604 956<br />
161 921<br />
43 852<br />
375 513<br />
138 595<br />
42<br />
21<br />
l<br />
32<br />
145 590<br />
2 147 671<br />
1 080<br />
24 837<br />
52 659<br />
34<br />
l<br />
141 362<br />
679<br />
96 801<br />
Verstauchung, Verrenkung,<br />
Überanstrengung 244<br />
402 363 35 55 469 17<br />
25 124<br />
Gehwege, Bodenbelag .<br />
Formkasten, Formen, Kokillen<br />
Übrige.<br />
35<br />
20<br />
189<br />
49 894<br />
56 906<br />
295 563<br />
8<br />
2<br />
25<br />
14 869<br />
2 138<br />
38 462<br />
3<br />
1<br />
13<br />
3 651<br />
9 302<br />
12 171<br />
Berufskrankheit, berufliche<br />
Schädigung. 76<br />
Chemikalien, Gase, Kunststoffe<br />
Übrige.<br />
19<br />
57<br />
166 904<br />
87 494<br />
79 410<br />
19 817<br />
8 695<br />
11 122<br />
12<br />
50 154<br />
31 928<br />
18 226<br />
Verschiedenes. 51<br />
128 908<br />
43 692<br />
1 767<br />
Total<br />
4 841<br />
556 13 292 759 523<br />
103 2 265 093 310<br />
49 1 051 873<br />
167
Unfälle in <strong>der</strong> keramischen Industrie<br />
Tabelle 5<br />
Ohne Silikosen<br />
Un fal lgegenstand<br />
Tätigkeit beim Unfall<br />
Ordentliche Renten<br />
Unfälle fälle<br />
Grobkeramik<br />
Unfallkosten 1948 — 1957<br />
Ordentliche Renten<br />
Unfälle fälle<br />
Feinkeramik<br />
Unfallkosten 1948 — 1957<br />
1956-1957 1948-1957 in Franken in /() 1956-1957 1948-1957 in Franken<br />
Rohmaterialgewinnung.<br />
Abbauwände (Herabfallen von Material,<br />
Abstürzen von Personen)<br />
Abbau- und Auf lademaschinen<br />
Abbau und Auf lad von Hand<br />
Sprengarbeiten .<br />
Übrige<br />
128 36<br />
21<br />
30<br />
36<br />
4<br />
37<br />
832 987 l 11,2<br />
1 102<br />
22<br />
11<br />
514 253<br />
174 991<br />
76 132<br />
6 901<br />
60 710<br />
6,9<br />
2,4<br />
1,0<br />
0,1<br />
0,8<br />
426<br />
676<br />
0,0<br />
O,l<br />
0,1<br />
Zufuhr des Rohmaterials.<br />
Roll bahnen<br />
Hängebahnen<br />
Lastwagen, Dumper usw.<br />
Ausladen von Hand.<br />
Rohmateriallager, Silos .<br />
Übrige<br />
230 39 893 738 12,0 13<br />
168<br />
8<br />
14<br />
13<br />
10<br />
17<br />
25<br />
3<br />
3<br />
2<br />
2<br />
4<br />
590 043<br />
90 819<br />
56 574<br />
34 917<br />
33 586<br />
87 799<br />
7,9<br />
1,2<br />
0,7<br />
0,5<br />
0,5<br />
1,2<br />
35 859 3,5<br />
28 807<br />
7 052<br />
2,8<br />
0,7<br />
Transporte in <strong>der</strong> Fabrik.<br />
Waren- und Personenaufzüge<br />
Transport- und För<strong>der</strong>bän<strong>der</strong><br />
Schaukelför<strong>der</strong>er, Hängebahnen<br />
För<strong>der</strong>er für Absetzwagen, Elevatoren<br />
Rol 1 bahnen<br />
Elektrowagen, Hubstapler .<br />
Krane, Winden.<br />
Handkarren .<br />
Transporte von Hand .<br />
Übrige<br />
246 31 852 122 11,4 57<br />
18<br />
39<br />
17<br />
25<br />
25<br />
8<br />
6<br />
44<br />
64<br />
205 880<br />
178 656<br />
102 683<br />
59 604<br />
87 052<br />
26 351<br />
51 810<br />
53 860<br />
86 226<br />
2,8<br />
2,4<br />
1,4<br />
0,8<br />
1,2<br />
0,3<br />
0,7<br />
0,7<br />
l,l<br />
2<br />
2<br />
3<br />
17<br />
24<br />
I<br />
86 788<br />
27 838<br />
4 197<br />
955<br />
1 330<br />
3 157<br />
1 966<br />
24 359<br />
22 489<br />
497<br />
8,6<br />
2,8<br />
0,4<br />
O,l<br />
0,1<br />
0,3<br />
0,2<br />
2,4<br />
2,2<br />
0,1<br />
Brecher<br />
Beschicker .<br />
Kollergänge .<br />
Walzwerke<br />
Mischer, Tonschnei<strong>der</strong><br />
Mühlen .<br />
F i 1 terpressen .<br />
Sumpfhaus, Maukkeller.<br />
Übrige<br />
65 30 490 572 6,6 35<br />
2<br />
7<br />
11<br />
4<br />
2<br />
2<br />
I<br />
16<br />
20<br />
4<br />
4<br />
5<br />
4<br />
6<br />
3<br />
30 122<br />
116 327<br />
85 247<br />
67 573<br />
91 877<br />
18 918<br />
898<br />
47 983<br />
31 627<br />
0,4<br />
1,6<br />
1,2<br />
0,9<br />
1,2<br />
0,3<br />
0,0<br />
0,6<br />
0,4<br />
4<br />
6<br />
7<br />
17<br />
170 066 16,8<br />
47 450<br />
8 740<br />
56 667<br />
4 585<br />
30 033<br />
22 591<br />
4,7<br />
0,9<br />
5,6<br />
0,4<br />
3,0<br />
2,2<br />
Formgebung 129 40 1 291 992<br />
10<br />
Ziegel pressen<br />
Strang-, Röhren-, Platten-, Topfpressen<br />
Drehscheiben, Kopiermaschinen, Drehbänke,<br />
Giessen, Handformen.<br />
Übrige<br />
18<br />
62<br />
10<br />
39<br />
17,4 50 108 577 10,7<br />
29 1 012 251 ]3,6<br />
10 211 991 2,9 18 74 034 7,3<br />
10 451 ' 0,1<br />
57 299 0,8<br />
24<br />
8<br />
29 784<br />
4 759<br />
2,9<br />
0,5
Unfälle in <strong>der</strong> keramischen Industrie<br />
Ohne Silikosen Tabelle 5<br />
Vnfal lgegenstand<br />
Tätigkeit beim Unfall<br />
Grobkeramik<br />
Feinkeramik<br />
Orden tliche Rentenfälle<br />
Unfälle fälle<br />
Unfallkosten 1948 — 1957 Ordentliche Renten Unfallkosten 1948-1957<br />
Unfälle<br />
1956-1957 1948-1957 in Franken<br />
1956-1957 1948-1957 in Franken in /()<br />
Trocknen, Brennen<br />
536 28<br />
1 052 874 14,1 48<br />
67 284 6,7<br />
Ein- und Ausgerüsten .<br />
Einsetzen und Ausziehen<br />
Schiebebühnen, Absetz- und Brennwagen .<br />
Trockenkammern, Öfen .<br />
Übrige<br />
146<br />
228<br />
67<br />
48<br />
47<br />
246 535<br />
334 067<br />
237 442<br />
135 675<br />
99 155<br />
3,3<br />
4,5<br />
3,2<br />
1,8<br />
1,3<br />
1<br />
21<br />
9<br />
7<br />
10<br />
448<br />
14 437<br />
30 246<br />
10 662<br />
11 491<br />
0,0<br />
1,5<br />
3,0<br />
1,1<br />
l,l<br />
Fertigstellen<br />
Schleifen, Polieren<br />
Verputzen .<br />
Glasieren, Engobieren, Dekorieren, Ausgiessen<br />
von Isolatorenkappen usw.<br />
Übrige<br />
14 027 68<br />
0,2<br />
4 449<br />
1 636<br />
0,1<br />
0,0<br />
35<br />
11<br />
7 942 0.1 19<br />
3<br />
157 497 15,6<br />
96 346<br />
23 070<br />
31 193<br />
6 888<br />
9,5<br />
2,3<br />
3,1<br />
0,7<br />
Lager, Versand.<br />
Sortieren, Lagern.<br />
Verladen<br />
Lastwagen, Hubstapler<br />
Güterwagen, Industriegleise<br />
Übrige<br />
211 28<br />
37<br />
91<br />
49<br />
7<br />
27<br />
3<br />
7<br />
16<br />
2<br />
783 774 10,5 44<br />
76 339<br />
71 302<br />
198 513<br />
418 122<br />
63 834<br />
32 003<br />
0,9<br />
2,7<br />
5,6<br />
0,9<br />
0,4<br />
12<br />
13<br />
3<br />
7<br />
9<br />
13 060<br />
13 652<br />
32 441<br />
9 699<br />
7 487<br />
7,6<br />
1,3<br />
1,4<br />
3,2<br />
1,0<br />
0,7<br />
Hilfs- und Nebenbetriebe.<br />
Mechanische Werkstatt .<br />
Schreinerei<br />
Bau- und Abbrucharbeiten.<br />
Übrige<br />
186<br />
79<br />
Il<br />
32<br />
64<br />
4<br />
4<br />
]1<br />
3<br />
560 415 108 608, 10,7<br />
113 234<br />
24 700<br />
246 974<br />
175 507<br />
7,5 36<br />
1,5<br />
0,3<br />
3,3<br />
2,4<br />
24<br />
4<br />
3<br />
5<br />
46 285, 4,6<br />
9 647 09<br />
1 359 0,1<br />
51 317 5,1<br />
Bauten, Einrichtungen .<br />
93 21<br />
466 082 6,3 40<br />
121 748 12,1<br />
Böden<br />
Treppen, Stege, Leitern .<br />
Türen, Bodenöffnungen, Schächte.<br />
Elektrische Anlagen.<br />
Heizungs- und Lüftungsanlagen<br />
Transmissionen<br />
20<br />
31<br />
17<br />
3<br />
6<br />
16<br />
70 609<br />
162 130<br />
73 853<br />
53 634<br />
9 311<br />
96 545<br />
1,0<br />
2,2<br />
1,0<br />
0,7<br />
0,1<br />
1,3<br />
11<br />
21<br />
7<br />
16 210<br />
64 211<br />
5 048<br />
32 991<br />
3 288<br />
1,6<br />
6,4<br />
0,5<br />
3,3<br />
0,3<br />
Verschiedenes<br />
81<br />
206 377 2,8<br />
45<br />
76 836<br />
7,6<br />
Streit, Rauferei.<br />
Betreten und Verlassen des Werkareals,<br />
Gar<strong>der</strong>oben, Duschen.<br />
Übrige<br />
14<br />
8<br />
59<br />
36 921 0,5<br />
21 733<br />
147 723<br />
0,3<br />
2,0<br />
4<br />
36<br />
4 614<br />
0,5<br />
26134 26<br />
46 088, 4,5<br />
Total<br />
1 916<br />
284<br />
7 444 960 100,0<br />
438<br />
47<br />
1 010 704 ' 100,0<br />
169
Tabelle 6<br />
Nichtbetriebsunf älle 1955<br />
Ohne SBB und PTT<br />
Männer '<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Unfallkosten<br />
Betätigung beim Unfall<br />
davon<br />
Ordentliche<br />
Unfälle Invaliditätsfälle<br />
Todesfälle<br />
in Franken<br />
in%<br />
Auf dem Wege zur und von <strong>der</strong> Arbeit<br />
Radfahren<br />
Fahren mit Fahrrad mit Hilfsmotor .<br />
Fahren mit Motorwagen<br />
Fahren mit an<strong>der</strong>n Fahrzeugen .<br />
Zu Fuss gehen .<br />
9 927 325<br />
6 432<br />
719<br />
215<br />
263<br />
2 298<br />
208<br />
33<br />
7<br />
3<br />
74<br />
52<br />
32<br />
9<br />
4<br />
9 077 294 18,7<br />
5 487 135<br />
1 087 815<br />
298 402<br />
172 473<br />
2031 469<br />
1 1,3<br />
2,2<br />
0,6<br />
0,4<br />
4,2<br />
Beim Aufenthalt zu Hause<br />
8 376 168<br />
34<br />
5 789 178 12,0<br />
Umhergehen in Haus und Garten .<br />
Haushaltarbeiten .<br />
Übrige (Körperpflege, Unterhaltung, Essen usw.)<br />
4 827<br />
2 202<br />
1 347<br />
114<br />
38<br />
16<br />
17<br />
5<br />
12<br />
3 685 837<br />
1 224 695<br />
878 646<br />
7,7<br />
2,5<br />
1,8<br />
Bei Nebenbeschäftigungen<br />
Landwirtschaftliche Arbeiten, Wein-, Obst- und Gartenbau<br />
Waldarbeiten, Holzaufbereitung zu Hause .<br />
Unterhalt von Fahrzeugen .<br />
Botengänge<br />
Berufsausbildung, Berufsarbeiten .<br />
Übrige<br />
8 323 336<br />
2 934<br />
2 822<br />
671<br />
200<br />
151<br />
1 545<br />
114<br />
113<br />
12<br />
14<br />
12<br />
71<br />
37<br />
16<br />
10<br />
2<br />
2<br />
1<br />
6<br />
7 974 325 16,5<br />
3 143 566<br />
2 200 843<br />
455 483<br />
300 719<br />
307 076<br />
1 566 638<br />
6,5<br />
4,6<br />
0,9<br />
0,6<br />
0,6<br />
3,3<br />
Bei Sport, Reisen und an<strong>der</strong>n Vergnügen<br />
Skifahren .<br />
Übriger Wintersport<br />
Bergsteigen<br />
Fussballspielen .<br />
Übrige Ballspiele .<br />
Turnen, Schwingen, Leichtathletik<br />
Baden und übriger Wassersport<br />
Übrige Sport- und Spielarten<br />
Radfahren<br />
Fahren mit Fahrrad mit Hilfsmotor<br />
Fahren mit Motorwagen<br />
Fahren mit an<strong>der</strong>n Fahrzeugen .<br />
Ausgehen, Wan<strong>der</strong>n<br />
Wirtshausbesuch, Teilnahme an Anlässen<br />
24 297 590 217<br />
3 493 63<br />
368 3<br />
406 5<br />
4 519 24<br />
150 ]3<br />
1 710 13<br />
718 6<br />
551 13<br />
4 406 157<br />
557 34<br />
1 000 52<br />
293 11<br />
4 399 158<br />
727 i 38<br />
468 12<br />
17<br />
30<br />
2<br />
48<br />
15<br />
42<br />
2<br />
53<br />
2<br />
24 298 397 50,1<br />
3 198 829<br />
141 920<br />
1 111 593<br />
2 016 050<br />
489 345<br />
730 411<br />
1 186 804<br />
451 752<br />
5 037 823<br />
I 265 842<br />
2475 237<br />
384 866<br />
4953 695<br />
854 230<br />
Verschiedenes 18 1 294 338 2.7<br />
Total . 51 391 1 431 358 48 433 532 100,0<br />
6,6<br />
0,3<br />
2,3<br />
4,2<br />
1,0<br />
1,5<br />
2,4<br />
0,9<br />
10,4<br />
2,6<br />
5,1<br />
0,8<br />
10,2<br />
1,8<br />
Davon bei Verkehrsunfällen: 15 068 616 193 18 892 384 39,0<br />
Radfahren.<br />
Fahren mit Fahrrad mit Hilfsmotor<br />
Fahren mit Motorwagen.<br />
Fahren mit an<strong>der</strong>n Fahrzeugen.<br />
Zu Fuss gehen .<br />
11 083<br />
1 280<br />
1 232<br />
612<br />
861<br />
371<br />
70<br />
59<br />
17<br />
99<br />
84<br />
24<br />
46<br />
3<br />
36<br />
10 842 899<br />
2 394 461<br />
2 764 256<br />
657 364<br />
2 233 404<br />
22,4<br />
4,9<br />
5,7<br />
1,4<br />
4,6<br />
170<br />
' 823 000 Vollarbeiter und 5709 Millionen Franken versicherte Lohnsumme.
Nichtbetriebsunfälle 1955<br />
Ohne SBB und PTT<br />
Frauen '<br />
Tabelle 6<br />
Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />
Unfall kosten<br />
Betätigung beim Unfall<br />
davon<br />
Ordentliche<br />
Unfälle Invaliditätsfälle<br />
Todesfälle<br />
in Franken<br />
in%<br />
Auf dem Wege zur und von <strong>der</strong> Arbeit 4 402 97<br />
2 147 188 29,1<br />
Radfahren<br />
Fahren mit Fahrrad mit Hilfsmotor<br />
Fahren mit Motorwagen<br />
Fahren mit an<strong>der</strong>n Fahrzeugen .<br />
Zu Fuss gehen .<br />
2 229<br />
89<br />
97<br />
235<br />
1 752<br />
42<br />
4<br />
1<br />
3<br />
47<br />
1 010 360<br />
86 503<br />
37 593<br />
96 766<br />
915 966<br />
13,7<br />
1,2<br />
0,5<br />
1,3<br />
12,4<br />
Beim Aufenthalt zu Hause 4 249 75<br />
1 975 050 26,8<br />
Umhergehen in Haus und Garten .<br />
Haushaltarbeiten .<br />
Übrige (Körperpflege, Unterhaltung, Essen usw.)<br />
2 276<br />
1 528<br />
445<br />
46<br />
27<br />
2<br />
l<br />
4<br />
1 224 484<br />
596 382<br />
154 184<br />
16,6<br />
8,1<br />
2,1<br />
Bei Nebenbeschäftigungen 626 12<br />
272 240 37<br />
Landwirtschaftliche Arbeiten, Wein-, Obst- und Gartenbau<br />
Waldarbeiten, Holzaufbereitung zu Hause .<br />
Unterhalt von Fahrzeugen .<br />
Botengänge<br />
Berufsausbildung, Berufsarbeiten .<br />
Übrige<br />
241<br />
106<br />
56<br />
147<br />
17<br />
59<br />
2<br />
6<br />
95 867<br />
21 802<br />
24 275<br />
97 986<br />
5 063<br />
27 247<br />
1,3<br />
0,3<br />
0,3<br />
1,3<br />
0,1<br />
0,4<br />
Bei Sport, Reisen und an<strong>der</strong>n Vergnügen<br />
Skifahren .<br />
Übriger Wintersport<br />
Bergsteigen<br />
Fussballspielen .<br />
Übrige Ballspiele .<br />
Turnen, Leichtathleti k<br />
Baden und übriger Wassersport<br />
Übrige Sport- und Spielarten<br />
Radfahren<br />
Fahren mit Fahrrad mit Hilfsmotor .<br />
Fahren mit Motorwagen<br />
Fahren mit an<strong>der</strong>n Fahrzeugen .<br />
Ausgehen, Wan<strong>der</strong>n<br />
Wirtshausbesuch, Teilnahme an Anlässen<br />
4 260 89<br />
859<br />
84<br />
67<br />
24<br />
138<br />
134<br />
95<br />
35<br />
757<br />
30<br />
324<br />
133<br />
1 434<br />
146<br />
1<br />
1<br />
11<br />
2<br />
17<br />
2<br />
42<br />
1<br />
13 2 752 654 373<br />
664 477<br />
38 203<br />
30 902<br />
6 629<br />
41 338<br />
37 656<br />
65 066<br />
32 073<br />
304 602<br />
21 491<br />
372 459<br />
45 100<br />
1 033 518<br />
59 140<br />
9,0<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,1<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,9<br />
0,4<br />
4,1<br />
0,3<br />
5,1<br />
0,6<br />
14,0<br />
0,8<br />
Verschiedenes 102<br />
234 757 3,1<br />
Total 13 639 275 28<br />
7 381 889 100,0<br />
Davon bei Verkehrsunfällen: 4 311 107<br />
Radfahren.<br />
Fahren mit Fahrrad mit Hilfsmotor.<br />
Fahren mit Motorwagen.<br />
Fahren mit an<strong>der</strong>n Fahrzeugen .<br />
Zu Fuss gehen .<br />
3 013<br />
119<br />
425<br />
377<br />
377<br />
53<br />
6<br />
18<br />
5<br />
25<br />
17<br />
2 342 147 31,7<br />
1 323 047<br />
107 994<br />
410 643<br />
147 564<br />
352 899<br />
17,9<br />
1,4<br />
5,6<br />
2,0<br />
4,8<br />
' 238 000 Vollarbeiter und 1140 Millionen Franken versicherte Lohnsumme.<br />
171
Tabelle 7a<br />
Art <strong>der</strong> Berufskrankheit<br />
Chronische Vergiftungen<br />
Säuren .<br />
Nitrose Gase<br />
Schwefeldioxyd .<br />
Blei, seine Verbindungen und Legierungen .<br />
Quecksilber, seine Verbindungen und Legierungen<br />
.<br />
Zinkoxyd<br />
An<strong>der</strong>e Metalle und Metall verbindungen<br />
Kohlenoxyd<br />
Schwefelkohlenstoff .<br />
Benzin .<br />
Formaldehyd .<br />
Halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe<br />
Benzol und seine Homologen<br />
Aromatische Nitro- und Chlornitroverbindungen<br />
.<br />
Aromatische Amine<br />
An<strong>der</strong>e Lösungsmittel<br />
Andt;re Stoffe .<br />
Bernfskrankheiten 1953<br />
Ohne SBB und PTT<br />
l. Übernahme nach Art.68 K<strong>UVG</strong><br />
Baga- Ordenttell-<br />
liehe<br />
fälle Fälle<br />
Zahl <strong>der</strong> Fälle<br />
Total<br />
32 242 274<br />
davon<br />
Invaliditäts- Todesfäll<br />
fälle<br />
1 [6] 14<br />
Heilkosten<br />
und<br />
Krankengeld<br />
526 178<br />
Kosten in Fr.<br />
Kapi tal wert<br />
<strong>der</strong> Renten<br />
400 808<br />
9<br />
8<br />
9<br />
10<br />
19 643<br />
15 002<br />
98 750<br />
21 358<br />
2 5<br />
962<br />
28 28 — 1 [2]<br />
45 658 20 082<br />
6<br />
10<br />
36<br />
10<br />
4<br />
5<br />
30<br />
10<br />
7<br />
7<br />
10<br />
45<br />
11<br />
4<br />
5<br />
35<br />
10<br />
7<br />
Total<br />
926 986<br />
118 393<br />
36 360<br />
962<br />
65 740<br />
[1] 85 995 33 155 119 150<br />
3 667<br />
3 667<br />
30 928<br />
41 603<br />
3 150<br />
14 226<br />
57 592<br />
19 372<br />
2 963<br />
62 714<br />
28 318<br />
94 385<br />
46 615<br />
900<br />
41 486<br />
83 129<br />
7 7<br />
23 29<br />
47 52<br />
55 333<br />
30 928<br />
88 218<br />
3 150<br />
14 226<br />
58 492<br />
19 372<br />
44 449<br />
145 843<br />
28 318<br />
149 718<br />
Haut krankheiten.<br />
Alkalien<br />
Zement, Kalk, Mörtel<br />
Säuren .<br />
Chlor und seine Verbindungen<br />
Chrom und seine Verbindungen .<br />
Cyanamid<br />
Benzin .<br />
Petrol<br />
Formaldehyd .<br />
Halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe<br />
Terpentin und Terpentinersatz .<br />
Teer und Teerprodukte .<br />
An<strong>der</strong>e Lösungsmittel<br />
An<strong>der</strong>e Stoffe .<br />
114 1 227 1 341 14<br />
4 15 19<br />
65 652 717<br />
1 23 24<br />
2 8 10<br />
23 24<br />
1 10 11<br />
3 43 46<br />
6 40 46<br />
1 27 28<br />
2 13 15<br />
10 197 207<br />
1 20 21<br />
5 24 29<br />
12 132 144<br />
1 088 237<br />
12 145<br />
625 559<br />
23 357<br />
4 057<br />
12 676<br />
9 159<br />
23 876<br />
26 896<br />
23 673<br />
4 832<br />
206 999<br />
10 510<br />
13 046<br />
91 452<br />
86 758 1 174 995<br />
9 920<br />
16 839<br />
58 199<br />
1 000<br />
800<br />
12 145<br />
635 479<br />
40 196<br />
4 057<br />
12 676<br />
9 159<br />
23 876<br />
26 896<br />
23 673<br />
4 832<br />
265 198<br />
II 510<br />
13 046<br />
92 252<br />
Staublungen.<br />
Quarz .<br />
Silikate, Aluminium, Eisen, Carborundum<br />
253 253<br />
250 250<br />
3 3<br />
81 [40!<br />
80 [40]<br />
I<br />
61 2 565 999 4 154 234 6 720 233<br />
61 2 558 462 4 097 009<br />
7 537 57 225<br />
6 655 471<br />
64 762<br />
Übrige Arbeitsschädigungen<br />
Sehnenscheidenentzündungen (Paratenonitis<br />
crepitans)<br />
Hautblasen, -risse, -schürfungen, -schwielen<br />
Von Tieren auf Menschen übertragbare<br />
Krankheiten<br />
Hitzschläge .<br />
Sonnenstiche .<br />
Verschiedenes .<br />
Total Übernahme nach Art.68 K<strong>UVG</strong> 146 1 722 1 868 96 [461 76 4 180 414 4 641 800 8 822 214<br />
' Vermin<strong>der</strong>t um die in [] b:igefügte Zahl <strong>der</strong> an einer Berufskrankheit gestorbenen Invalidenrentner. Schluß auf Seite 174
Berufskrankheiten 1957<br />
Ohne SBB und PTT<br />
I. Übernahme nach Art.68 K<strong>UVG</strong> Tabelle 7b<br />
Zahl <strong>der</strong> Fälle<br />
Kosten in Fr.<br />
Art <strong>der</strong> Berufskrankheit<br />
Baga- Ordenttel1-<br />
liehe<br />
fälle Fälle<br />
Total<br />
davon<br />
I nvaliditäts- Todesfälle<br />
' fälle<br />
Heilkosten<br />
und<br />
Krankengeld<br />
Kapitalwert<br />
<strong>der</strong> Renten<br />
Total<br />
Chronische Vergiftungen<br />
Säuren .<br />
Nitrose Gase<br />
Schwefeldioxyd<br />
Blei, seine Verbindungen und Legierungen .<br />
Quecksilber, seine Verbindungen und Legierungen.<br />
Zinkoxyd .<br />
An<strong>der</strong>e Metalle und Metallverbindungen<br />
Kohlenoxyd<br />
Schwefelkohlenstoff<br />
Benzin .<br />
Formaldehyd .<br />
Halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe<br />
Benzol und seine Homologen<br />
Aromatische Nitro- und Chlornitroverbindungen.<br />
Aromatische Amine<br />
An<strong>der</strong>e Lösungsmit tel<br />
An<strong>der</strong>e Stoffe .<br />
27 214 241 5 [lf 10 424 992 509 954 934 946<br />
]1<br />
8<br />
11<br />
9<br />
4 32 36<br />
9<br />
16<br />
9<br />
35<br />
6<br />
5<br />
6<br />
32<br />
18<br />
3<br />
2<br />
2<br />
20<br />
11<br />
17<br />
10<br />
41<br />
7<br />
5<br />
6<br />
34<br />
19<br />
5<br />
2<br />
2<br />
26<br />
]6 559<br />
13 563<br />
11 205<br />
50 636<br />
27 044<br />
4 403<br />
13 145<br />
48 941<br />
40 588<br />
2 614<br />
27 891<br />
26 964<br />
65 745<br />
7 173<br />
29 886<br />
674<br />
37 961<br />
16 559<br />
30 639 44 202<br />
29 926<br />
17 073<br />
85 424<br />
85 981<br />
76 829<br />
3 125<br />
7 807<br />
112 179<br />
60 971<br />
1] 205<br />
80 562<br />
44 117<br />
4 403<br />
98 569<br />
]34 922<br />
1] 7 417<br />
2 614<br />
31 016<br />
34 771<br />
177 924<br />
7 173<br />
90 857<br />
674<br />
37 961<br />
Hautkrankheiten. 194 1 535 1 729 28<br />
1 523 014 161 974 1 684 988<br />
Alkalien<br />
Zement, Kalk, Mörtel<br />
Säuren .<br />
Chlor und seine Verbindungen<br />
Chrom und seine Verbindungen .<br />
Cyanamid<br />
Benzin .<br />
Petrol<br />
Formaldehyd .<br />
Halogenierte aliphatische Koh]enwasserstoffe<br />
Terpentin und Terpentinersatz .<br />
Teer und Teerprodukte .<br />
An<strong>der</strong>e Lösungsmit te]<br />
An<strong>der</strong>e Stoffe .<br />
4 34<br />
905<br />
2 36<br />
15<br />
3 53<br />
20<br />
12<br />
5<br />
5<br />
11<br />
6<br />
2<br />
28<br />
9<br />
68<br />
59<br />
26<br />
23<br />
171<br />
10<br />
12<br />
114<br />
38<br />
1001<br />
38<br />
15<br />
56<br />
9<br />
88<br />
71<br />
31<br />
28<br />
182<br />
16<br />
14<br />
142<br />
24<br />
1<br />
22 384<br />
1 001 661<br />
26 156<br />
12 610<br />
68 904<br />
4 375<br />
45 946<br />
42 869<br />
17 779<br />
]3 438<br />
]66 095<br />
7 405<br />
10 350<br />
83 042<br />
98 174<br />
26 091<br />
14 931<br />
1 300<br />
21 478<br />
22 384<br />
] 099 835<br />
52 247<br />
12 610<br />
83 835<br />
4 375<br />
45 946<br />
42 869<br />
17 779<br />
13 438<br />
167 395<br />
7 405<br />
10 350<br />
]04 520<br />
Staublungen . 258 258 95 [45) 68 2 754 815 4 644 989 7 399 804<br />
Quarz<br />
Silikate, Aluminium, Eisen, Carborundum<br />
255<br />
3<br />
255<br />
3<br />
94 [45]<br />
1<br />
68 2 748 577<br />
6 238<br />
4618 768<br />
26 221<br />
7 367 345<br />
32 459<br />
Übrige Arbeitsschädigungen .<br />
Sehnenscheidenentzündungen (Paratenonitis<br />
crepi tans) .<br />
Hautblasen, -risse, -schürfungen, -schwielen<br />
Von Tieren auf Menschen übertragbare<br />
Krankheiten<br />
Hitzsch]äge .<br />
Sonnenstiche<br />
Verschiedenes .<br />
36 1 117 1 153<br />
30 887<br />
4 152<br />
16<br />
10<br />
20<br />
32<br />
917<br />
156<br />
18<br />
10<br />
20<br />
32<br />
350 416 86 597 437 013<br />
236 689<br />
40 532<br />
40 558<br />
3 319<br />
5 516<br />
23 802<br />
86 597<br />
236 689<br />
40 532<br />
40 558<br />
89 9]6<br />
5 516<br />
23 802<br />
Total Übernahme nach Art. 68 K<strong>UVG</strong> . 257 3 124 3 381 128 [46] 82 5 053 237 5 403 514 10 456 751<br />
' Vermin<strong>der</strong>t um die in [] beigefügte Zahl <strong>der</strong> «n einer Berufskrankheit gestorbenen Invalidenrentner.<br />
Schluß auf Seite 175<br />
173
Tabelle 7a, Schluss<br />
Berufskrankheiten 1953<br />
Ohne SBB und PTT<br />
II. Freiwillige Übernahme nach Verwaltungsratsbeschluss<br />
Zahl <strong>der</strong> Fälle<br />
Kosten in Franken<br />
Art <strong>der</strong> Berufskrankheit<br />
Chronische Vergiftungen<br />
Lösungsmit tel .<br />
An<strong>der</strong>e Stoffe .<br />
Hautkrankheiten.<br />
Öle<br />
Farben und Lacke .<br />
Beizen und Polituren<br />
Alkalien<br />
Lösungsmit tel .<br />
Seifen<br />
Leim<br />
Säuren .<br />
Elektrolytische und an<strong>der</strong>e Bä<strong>der</strong> .<br />
Hölzer .<br />
G laswol le<br />
An<strong>der</strong>e Stoffe .<br />
Baga- Ordenttell-<br />
liehe Total<br />
fälle Fälle<br />
4 64 68<br />
13<br />
51<br />
14<br />
54<br />
92 546 638<br />
23 94 117<br />
41 32<br />
436<br />
5<br />
4 4<br />
2 13 15<br />
58 62<br />
4 18 22<br />
2 l 3<br />
l 316419<br />
4 6<br />
46 299 345<br />
davon<br />
Todesfälle<br />
Invaliditätsfälle<br />
Hei1 kosten<br />
und<br />
Krankengeld<br />
47 517<br />
5 845<br />
41 672<br />
347 558<br />
43 442<br />
14 110<br />
3 310<br />
3 672<br />
10 822<br />
61 062<br />
5 626<br />
273<br />
7 353<br />
1 656<br />
1 679<br />
194 553<br />
Kapitalwert<br />
<strong>der</strong> Renten<br />
9 457<br />
9 457<br />
i 500<br />
1 500<br />
Total<br />
56 974<br />
5 845<br />
51 129<br />
349 058<br />
44 942<br />
14 110<br />
3 310<br />
3 672<br />
10 822<br />
61 062<br />
5 626<br />
273<br />
7 353<br />
1 656<br />
1 679<br />
194 553<br />
Staublungen (Mischstaubkoniosen) . 6 548 42 956 49 504<br />
Übrige Arbeitsschädigungen 45 1 155 i 200 297 275 1 700<br />
Sehnenscheidenentzündungen (Tendovaginitis)<br />
.<br />
Hautrisse, entzündete Schwielen .<br />
Überanstrengung, Übermüdung .<br />
Epikondylitis .<br />
Schleimbeutelentzündungen .<br />
Verschiedenes .<br />
31<br />
1<br />
l<br />
4<br />
5<br />
3<br />
859 890<br />
65 66<br />
61 62<br />
60 64<br />
28 33<br />
82 85<br />
198 769<br />
16 714<br />
13 083<br />
31 819<br />
8 384<br />
28 506 1 700<br />
298 975<br />
198 769<br />
16 714<br />
13 083<br />
31 819<br />
8 384<br />
30 206<br />
Total freiwillige Übernahme. 141 1 768 1 909 698 898 55 613 754 511<br />
Total Berufskrankheiten<br />
287 3 490 3 777 100 [46) 77 4 879 312 4 697 413 9 576 725<br />
' Vermin<strong>der</strong>t um die in [] beigefügte Zahl <strong>der</strong> an einer Berufskrankheit gestorbenen Invalidenrentner.<br />
174
Berufskrankheiten 1957<br />
Ohne SBB und PTT<br />
II. Freiwillige Übernahme nach Verwaltungsratsbeschluss<br />
Tabelle 7b, Schluss<br />
Art <strong>der</strong> Berufskrankheit<br />
Chronische Vergiftungen<br />
Lösungsmittel .<br />
An<strong>der</strong>e Stoft'e .<br />
Hautkrankheiten.<br />
Öle<br />
Farben und Lacke .<br />
Beizen und Polituren<br />
Alkalien<br />
Lösungsmit tel .<br />
Seifen<br />
Leim<br />
Säuren .<br />
Elektrolytische und an<strong>der</strong>e Bä<strong>der</strong> .<br />
Hölzer .<br />
Glaswolle<br />
An<strong>der</strong>e Stoffe .<br />
Baga- 0rdentfälle<br />
Fälle<br />
tell- liehe Total<br />
3 46 49<br />
Zahl <strong>der</strong> Fälle<br />
davon<br />
Invaliditäts<br />
Todesfälle<br />
Hei1k osten<br />
und<br />
Krankengeld<br />
Kosten in Franken<br />
Kapitalwert<br />
<strong>der</strong> Renten<br />
25 887 2 000<br />
15 16<br />
7 793<br />
31 33<br />
18 094 2 000<br />
129 780 909<br />
48 153 201<br />
4 37 41<br />
2 16 18<br />
10 57 67<br />
90 96<br />
6 45 51<br />
3 13 16<br />
4 38 42<br />
12 12<br />
2 5 7<br />
44 314 358<br />
421 248<br />
71 633<br />
18 495<br />
9 561<br />
28 104<br />
53 887<br />
17 042<br />
6 554<br />
16 983<br />
6 620<br />
2 442<br />
189 927<br />
1 500<br />
1 500<br />
Total<br />
27 887<br />
7 793<br />
20 094<br />
422 748<br />
71 633<br />
18 495<br />
9 561<br />
28 104<br />
53 887<br />
17 042<br />
6 554<br />
16 983<br />
6 620<br />
2 442<br />
191 427<br />
Staublungen (Mischstaubkoniosen) 19 049 19 049<br />
Übrige Arbeitsschädigungen 27 332 359 158 316 76 666 234 982<br />
Sehnenscheidenentzündungen (Tendovaginitis)<br />
.<br />
Hautrisse, entzündete Schwielen .<br />
Überanstrengung, Übermüdung .<br />
Epikondylitis .<br />
Schleimbeutelentzündungen .<br />
Verschiedenes .<br />
7 8<br />
31 32<br />
102 109<br />
81 86<br />
60 68<br />
51 56<br />
25 411<br />
2 180<br />
28 914<br />
43 103<br />
18 630<br />
40 078<br />
76 666<br />
25 411<br />
2 180<br />
28 914<br />
43 103<br />
18 630<br />
116 744<br />
Total freiwillige Übernahme 159 1 163 1 322 624 500 80 166 704 666<br />
Total Berufskrankheiten 416 4 287 4 703 134 [46] 82 5 677 737 5 483 680 11 161 417<br />
' Vermin<strong>der</strong>t um die in [ ] beigefügte Zahl <strong>der</strong> an einer Berufskrankheit gestorbenen Invalidenrentner.<br />
175