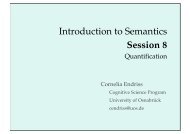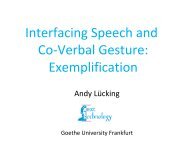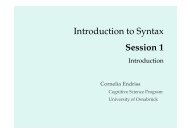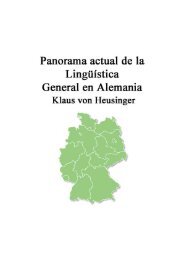Die Bedeutung von Verboten Zur Semantik von NegationsZeichen
Die Bedeutung von Verboten Zur Semantik von NegationsZeichen
Die Bedeutung von Verboten Zur Semantik von NegationsZeichen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Die</strong> <strong>Bedeutung</strong> <strong>von</strong> <strong>Verboten</strong><br />
<strong>Zur</strong> <strong>Semantik</strong> <strong>von</strong> <strong>NegationsZeichen</strong><br />
Antrittsvorlesung an der geisteswissenschaftlichen Sektion<br />
(alias „Philosophische Fakultät“) der Universität Konstanz<br />
1. Einleitung *<br />
Klaus <strong>von</strong> Heusinger, Universität Konstanz<br />
Verbotszeichen oder graphische Verbote werden immer häufiger gebraucht, und<br />
wir sind mit ihnen in unserem alltäglichen Leben permanent konfrontiert, auch<br />
wenn wir es manchmal nicht wahrnehmen. Sie tauchten nicht nur im Straßenverkehr,<br />
auf Müllcontainern und auf Lebensmittelverpackungen auf, sondern<br />
auch auf Gebrauchsanweisungen und Karten. Sie stehen auf öffentlichen Plätzen,<br />
Parks und an Stränden. Schließlich haben sie in Form <strong>von</strong> „Neologismen“<br />
Einzug in Werbung und Parodie gefunden – was ein gutes Indiz für ihre<br />
Produktivität und „Allgegenwärtigkeit“ ist. Aufgrund der sehr unterschiedlichen<br />
Funktionen dieser „Verbotszeichen“ – oft zeigen sie überhaupt kein Verbot mehr<br />
an – werde ich sie im Folgenden etwas allgemeiner und neutraler mit<br />
„<strong>NegationsZeichen</strong>“ benennen. <strong>Die</strong> Binnengroßschreibung <strong>von</strong> Zeichen in<br />
<strong>NegationsZeichen</strong> folgt ebenfalls einem Trend der letzten Jahre, der unter<br />
anderem in dem Wort oder Begriff BahnCard deutlich wurde – doch die Analyse<br />
der zunehmenden Binnengroßschreibung liefert genügend Material für einen<br />
anderen Vortrag.<br />
* <strong>Die</strong>s ist die leicht überarbeitete Version meiner Antrittsvorlesung vom 8. Mai 2000. Für<br />
interessante Anregungen und die sorgfältige Durchsicht des Manuskripts möchte ich Benedikt<br />
Grimmler danken. Ferner möchte ich Victor Linnemann, Andreas Kalkbrenner, Andreas<br />
Meßmer, Thilo Dannenmann, Robert Schmaus, Christian Gassner und Benedikt Grimmler für<br />
die aufwendige Bearbeitung, Katalogisierung und elektronische Präsentation <strong>von</strong> <strong>Verboten</strong> und<br />
anderen <strong>NegationsZeichen</strong> danken.
Der Vortrag möchte nun nicht erklären, wieso diese Verbotsschilder dort sind,<br />
wo sie sind, oder weshalb immer neue solche <strong>NegationsZeichen</strong> eingeführt<br />
werden – dies ist eher eine juristische oder soziologische Frage. Ich will vielmehr<br />
darstellen, wie <strong>NegationsZeichen</strong> in ihrer vielfältigen Verwendung zu ihrer<br />
<strong>Bedeutung</strong> kommen. Um diese Frage beantworten zu können, werde ich einen<br />
kleinen Streifzug durch Semiotik und die moderne <strong>Semantik</strong> machen. Obschon<br />
beide Begriffe auf die gleiche griechische Wurzel sêma, shmeion („Zeichen“,<br />
„Kennzeichen“, „Signal“) zurückgehen, bedeuten sie doch unterschiedliche<br />
Dinge: <strong>Die</strong> Semiotik beschäftigt sich mit dem Zeichen allgemein, mit besonderer<br />
Hinsicht auf dessen Form, während die <strong>Semantik</strong> sich mit der <strong>Bedeutung</strong> <strong>von</strong><br />
Zeichen, und besonders <strong>von</strong> Sprache beschäftigt. Im Laufe des Vortrages werde<br />
ich einige semantischen Entdeckungen und Betrachtungsweisen vorstellen,<br />
aufgrund derer ich einige sehr vorläufige Gedanken über die <strong>Bedeutung</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Verboten</strong> und <strong>von</strong> <strong>NegationsZeichen</strong> im Allgemeinen machen werde.<br />
Gleichzeitig werde ich versuchen, etwas über <strong>Bedeutung</strong>en zu sagen.<br />
<strong>Bedeutung</strong>en sind nicht sichtbar und daher auch nur schwer erfassbar; die<br />
Prinzipien ihrer Organisation sind abstrakt und daher nicht einfach zu vermitteln.<br />
<strong>Die</strong> vielen <strong>NegationsZeichen</strong>, die ich Ihnen heute abend vorstellen werden, sollen<br />
dabei helfen, die abstrakte Struktur der <strong>Bedeutung</strong>en zu veranschaulichen.<br />
Der Vortrag ist folgendermaßen aufgebaut: Im 2. Abschnitt werde ich die<br />
Semiotik oder die Lehre vom Zeichen kurz einführen und an einigen Beispielen<br />
erläutern. Abschnitt 3 behandelt die Negation und die Art und Weise wie<br />
Negation ausgedrückt werden kann. Abschnitt 4 gibt einen kurzen Überblick<br />
über den Aufbau, d.h. die Syntax, <strong>von</strong> Verbotsschildern und <strong>NegationsZeichen</strong>,<br />
während Abschnitt 5 sich mit der <strong>Semantik</strong> dieser Zeichen beschäftigt. Denn<br />
stelle ich die beiden wesentlichen Bereiche der <strong>Semantik</strong> vor: die lexikalische<br />
<strong>Semantik</strong> in Abschnitt 6 und die Satzsemantik oder kompositionelle <strong>Semantik</strong> in<br />
Abschnitt 7. Abschnitt 8 beschäftigt sich dann mit der Nachbardisziplin<br />
Pragmatik und in Abschnitt 9 betrachten wir einige Fällen <strong>von</strong> „doppelter<br />
Negation“. Abschnitt 10 gibt schließlich eine kurze Zusammenfassung.<br />
- 2 -
- 3 -
2. Semiotik oder die Lehre vom Zeichen<br />
2.1 Das semiotische Dreieck<br />
<strong>Die</strong> <strong>Bedeutung</strong>slehre oder <strong>Semantik</strong> ist eine linguistische Teildisziplin; sie wird<br />
jedoch oft auch als Teil der Semiotik („Lehre <strong>von</strong> Zeichen“) verstanden. In der<br />
Semiotik wird ganz allgemein die Beziehung zwischen Zeichen und dem<br />
Bezeichneten untersucht.<br />
Zeichen<br />
- 4 -<br />
Bezeichnetes<br />
Objekt<br />
Referent<br />
<strong>Die</strong> <strong>Semantik</strong> hingegen untersucht die <strong>Bedeutung</strong>en der Zeichen. <strong>Die</strong><br />
<strong>Bedeutung</strong>en sind nicht identisch mit dem Bezeichneten, sondern sind abstrakte<br />
Objekte, manchmal auch „Begriffe“ oder „Konzepte“ genannt. <strong>Die</strong>s kann man<br />
sich am besten am semiotischen Dreieck deutlich machen. <strong>Die</strong>ses dreiteilige<br />
Modell (mit wechselnden Bezeichnungen der Elemente) war schon der Antike<br />
und der mittelalterlichen Scholastik geläufig, wurde aber erst in den 20er Jahren<br />
des 20. Jahrhunderts als „triangle of reference“ oder „the semiotic triangle“<br />
(„Das semiotische Dreieck“) in die neuere Sprachwissenschaft und<br />
Sprachphilosophie eingeführt. Das Zeichen, der Ausdruck oder ein Wort wird mit<br />
einem „Inhalt“, d.h. einer <strong>Bedeutung</strong>, einem Konzept oder einem Begriff<br />
verbunden. <strong>Die</strong>ses Konzept oder der Begriff kann dann mit einem Objekt oder<br />
Referenten assoziiert werden. Damit ist die Relation zwischen Zeichen und<br />
Bezeichneten nicht mehr direkt gegeben, sondern wird über die <strong>Bedeutung</strong> bzw.<br />
den Begriff vermittelt:<br />
Zeichen<br />
Ausdruck<br />
Wort<br />
<strong>Bedeutung</strong><br />
Konzept<br />
Begriff<br />
Bezeichnetes<br />
Objekt<br />
Referent<br />
Während sich die Semiotik vornehmlich mit dem Zeichen als solchen und seiner<br />
Relation zu dem Bezeichneten beschäftigt, untersucht die <strong>Semantik</strong> („<strong>Die</strong> Lehre<br />
<strong>von</strong> der <strong>Bedeutung</strong>“) den Aufbau der <strong>Bedeutung</strong>en aus Teilbedeutungen und die<br />
Beziehungen zwischen unterschiedlichen <strong>Bedeutung</strong>en (siehe Abschnitte 5-7):
Zeichen<br />
Ausdruck<br />
Wort<br />
<strong>Bedeutung</strong><br />
Konzept<br />
Begriff<br />
Untersuchungsbereich der Semiotik<br />
2.2 Welche Arten <strong>von</strong> Zeichen gibt es?<br />
Untersuchungsbereich<br />
der <strong>Semantik</strong><br />
- 5 -<br />
Bezeichnetes<br />
Objekt<br />
Referent<br />
In der Semiotik werden drei Grundarten <strong>von</strong> Zeichen unterschieden, die sich in<br />
der Art, wie sie sich auf das bezeichnete Objekt beziehen, unterscheiden: die<br />
Ikone, der Index und das Symbol.<br />
<strong>Die</strong>se Unterscheidung wurde <strong>von</strong> dem Philosophen Charles Sanders Peirce<br />
(1839-1914) eingeführt. Sie hat primär mit der Relation zwischen Zeichen und<br />
Bezeichnetem zu tun, und nicht mit der <strong>von</strong> Zeichen zu <strong>Bedeutung</strong> oder<br />
<strong>Bedeutung</strong> zu Bezeichnetem. Der Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen<br />
Arten <strong>von</strong> Zeichen wir im folgenden an Warnschildern illustriert.<br />
2.2.1. Ikone<br />
Ikonen (auch: „Ideogramme“ oder „Piktogramme“) haben eine abbildende<br />
Funktion, d.h. sie haben typische Eigenschaften oder Charakteristika der Objekte,<br />
die sie bezeichnen. So bezeichnen die beiden folgenden Warnhinweise eine<br />
Fräswelle und herabfallende Objekte – Entsprechend warnen sie: „Vorsicht<br />
Fräswelle!“ und „Vorsicht herabfallende Objekte!“<br />
2.2.2. Index<br />
Indizes (auch „Anzeichen“) stellen nur eine indirekte Beziehung zu den<br />
Eigenschaften oder Charakteristika der Objekte dar, die sie bezeichnen. Oft<br />
handelt es sich hier um eine kausale Beziehung: „Wenn du das trinkst, dann<br />
stirbst du und wirst so aussehen wie der Totenschädel!“, „<strong>Die</strong>ses Material kann
leicht zu einem Feuer führen!“ oder „Achtung, Magnetismus (sowie er <strong>von</strong><br />
einem einfachen Hufmagneten erzeugt wird)!“ usw. Teilweise haben Indizes auch<br />
die Funktion <strong>von</strong> „Eselsbrücken“, die eine möglichst gute Einprägung des<br />
Zeichens ermöglichen sollen. Der Unterschied zwischen Ikonen und Indizes ist<br />
nicht immer ganz klar zu ziehen – es hängt da<strong>von</strong> ab, welche Eigenschaften als<br />
charakteristisch für das jeweilige Objekt angenommen werden und welche<br />
Eigenschaften „nur“ mit dem Objekt assoziiert werden können.<br />
2.2.3. Symbol<br />
Symbole sind Zeichen, die eine rein zufällige und daher konventionell festgelegte<br />
Beziehung zu dem Bezeichneten haben. Hierzu gehören die meisten Wörter: Sie<br />
bezeichnen ihre Objekte aufgrund einer „Vereinbarung“, die in der Sprachgemeinschaft<br />
stillschweigend akzeptiert wird und <strong>von</strong> neuen Sprachteilnehmern<br />
und -teilnehmerinnen gelernt werden muss. So bedeutet das Ausrufezeichen „!“<br />
ganz allgemein „Achtung“ während das „x“ in dem Warnschild auf eine Gefahr<br />
hinweist. <strong>Die</strong> ineinandergreifenden Halbkreise in dem dritten Warnschild stehen<br />
für „biologische Gefährdungen“:<br />
2.2.4 DIN-Vorschriften<br />
Bei Verkehrszeichen und „offiziellen“ Schildern ist die Konvention schriftlich<br />
verfasst und niedergelegt, nämlich in der Deutschen Industrienorm (DIN):<br />
- 6 -
Bei Wörtern im Deutschen verhält sich dies etwas anders. <strong>Die</strong> meisten deutschen<br />
Grammatiken und Wörterbücher verstehen sich nicht als präskriptiv, sondern als<br />
deskriptiv, d.h. sie folgen dem allgemeinen Sprachgebrauch. So können sie die<br />
Veränderung <strong>von</strong> Form und Inhalt unserer Wörter erfassen. Und das ist auch gut<br />
so; denn eine Sprache ist dynamisch und ändert sich durch den Gebrauch<br />
ständig, was sie wiederum so lebendig und interessant macht. Verbotsschilder und<br />
<strong>NegationsZeichen</strong> im allgemeinen, die nicht den DIN-Normen unterliegen, zeigen<br />
ebenfalls eine gewisse Entwicklung und Variation in ihrer <strong>Bedeutung</strong>. Teilweise<br />
werden sie sogar „falsch“ oder zumindest gegen die ursprünglichen Regeln<br />
gebraucht, wie im Folgenden noch gezeigt werden soll.<br />
2.3 Distinktive Merkmale in den Zeichen<br />
Zeichen können eine Sache nur dann eindeutig bezeichnen, wenn sie selbst<br />
eindeutig zu erkennen sind. Somit stellt sich eine erste Anforderung an die Gestalt<br />
der Zeichen, die nichts mit dem Inhalt, sondern nur mit der Erkennbarkeit oder<br />
Distinktivität der Zeichen zu tun hat.<br />
Klar erkennbar ist ein Zeichen,<br />
wenn es in einem oder mehreren<br />
Merkmalen sich deutlich <strong>von</strong><br />
anderen Zeichen unterscheidet.<br />
<strong>Die</strong>s lässt sich ebenfalls an Verkehrsschildern<br />
deutlich machen.<br />
Es wird hier zwischen Verbots-,<br />
Gebots- und Warnschildern unterschieden<br />
(vgl. Abbildung 1):<br />
- 7 -
<strong>Die</strong> distinktiven („unterscheidbaren“) Merkmale <strong>von</strong> diesen Schildergruppen<br />
lassen sich folgendermaßen beschreiben:<br />
• Verbotsschilder sind immer rund und rot.<br />
• Gebotsschilder sind immer rund und blau.<br />
• Warnschilder sind immer dreieckig und rot oder gelb.<br />
Form und Farbe haben nichts mit den natürlichen Eigenschaften <strong>von</strong> <strong>Verboten</strong>,<br />
Geboten oder Warnungen zu tun, d.h. es sind konventionelle Festlegungen und<br />
damit rein symbolischer Natur. Wir können nun die distinktiven Merkmale in eine<br />
Tabelle eintragen – vgl. auch Abbildung 1:<br />
Form / Farbe rot gelb blau<br />
rund Verbot -- Gebot<br />
dreieckig Warnung Warnung --<br />
Aufgrund dieser Tabelle, die eine Vereinfachung der Abbildung 1 ist, lassen sich<br />
folgende Kontraste ablesen:<br />
• Verbote und Gebote kontrastieren in der Farbe.<br />
• Verbote und Warnungen kontrastieren in Form.<br />
• Gebote und Warnungen kontrastieren in Form und Farbe.<br />
Warnschilder können sowohl als rote Dreiecke wie auch als gelbe Dreiecke<br />
dargestellt werden, d.h. die Farbe (rot vs. gelb) spielt keine Rolle. Man spricht<br />
daher auch da<strong>von</strong>, dass der Kontrast rot vs. gelb neutralisiert ist.<br />
So wie wir hier die Form- oder Ausdrucksseite der Verkehrsschilder nach dem<br />
semiotischen Kriterium der Distinktivität unterschieden haben, können wir auch<br />
die Formseite unserer Wörter durch distinktive Merkmale beschreiben. So<br />
unterscheidet sich rot <strong>von</strong> tot nur in dem r, und tot unterscheidet sich <strong>von</strong> tat nur<br />
in dem a (ich gehe hier nicht weiter in die linguistische Terminologie und<br />
diskutiere auch nicht den Unterschied zwischen den Graphemen, Phonemen und<br />
Phonen):<br />
–o– –a– –u–<br />
t tot tat tut<br />
r rot rat ru(h)t<br />
- 8 -
3. Negation und Negationsträger<br />
3.1 Negation in der Sprache?<br />
Natürliche Sprachen unterscheiden sich <strong>von</strong> anderen Zeichensystemen in einer<br />
Reihe <strong>von</strong> wichtigen Aspekten. Dazu gehört besonders, dass natürliche Sprache<br />
über sich selbst Aussagen machen kann und dass sie zur Negation fähig ist. <strong>Die</strong><br />
Negation scheint gerade eines der universalen Bestandteile einer jeden natürlichen<br />
Sprache zu sein. Andere semiotische Systeme können keine Negation<br />
ausdrücken: So liefert z.B. die DNA die Information, um bestimmte Proteine<br />
aufzubauen, sie enthält aber keine Information, keine Proteine aufzubauen. Bienen<br />
können zwar mitteilen. in welchen Winkel und wieweit eine Futterquelle ist, sie<br />
können aber nicht mitteilen, in welchem Winkel und wieweit keine Futterquelle<br />
ist. Dass es sich bei der Negation um eine komplexe Operation handelt, wird<br />
bereits durch eine einfache Überlegung klar: Wir müssen eine Sache oder einen<br />
Sachverhalt zunächst beschreiben oder nennen, bevor wir ihn verbieten oder<br />
negieren können. Eine solche Operation kann nur in einem rein symbolischen<br />
Zeichensystem vorkommen, wie z.B. in den natürlichen Sprachen. Hier<br />
betrachten wir sprachliche Mittel, Negation auf unterschiedlichen sprachlichen<br />
Ebenen auszudrücken:<br />
auf der Ebene des<br />
Wortes<br />
auf der Ebene des<br />
Satzes<br />
auf der Ebene des<br />
Sprechaktes<br />
ungesüßt, arbeitslos, apolitisch, unsympathisch,<br />
glutenfrei<br />
Es regnet nicht.<br />
Ich habe keine Hunde gesehen.<br />
Ich rauche niemals Havanna Zigarren.<br />
Es ist verboten, zu rauchen.<br />
Es ist nicht der Fall, dass alle Verbotsschilder<br />
ein Verbot ausdrücken.<br />
Verbote gehören wie Aussagen, Fragen und Bitten zu den Sprechakten. Wir<br />
werden aber noch sehen, dass der graphische Träger für das Verbot auch in<br />
anderen Zusammenhängen als Negationsträger vorkommt.<br />
- 9 -
3.2 Unterschiedliche Negationsträger – Distinktive Merkmale<br />
Obschon wir normalerweise Verbotsschilder sofort erkennen, ist es schwierig, ein<br />
eindeutiges Kriterium für den Negationsträger zu finden. Üblicherweise sind<br />
Verbote mit einem roten Kreis und optional mit einer Negationsdiagonale <strong>von</strong><br />
links oben nach rechts unten oder <strong>von</strong> links unten nach rechts oben oder einem<br />
Negationskreuz dargestellt. Verbote können aber auch ohne den Kreis und in<br />
diversen Farben auftauchen. Typisch ist auch die Darstellung in einem Quadrat<br />
mit einem Querstrich. Damit scheint es kein einziges distinktives Merkmal für den<br />
Negationsträger bei <strong>Verboten</strong> zu geben. Verbote sind damit stärker kontextabhängig<br />
als man dies zunächst annehmen möchte. <strong>Die</strong>s zeigt sich z.B. daran,<br />
dass ein blaues Quadrat mit einem Querstrich gerade kein Verbotszeichen,<br />
sondern das Logo der Deutschen Bank darstellt. (siehe Abbildung 2).<br />
3.3 Wie werden Negationen sprachlich realisiert<br />
Es gibt eine Reihe sprachlicher Ausdrücke im Deutschen, um eine Negation<br />
auszudrücken. <strong>Die</strong>se Negation kann auf der Ebene des Sprechakts (Verbot), eines<br />
Satzes oder aber auf der Ebene des Wortes ausgedrückt werden. Im Allgemeinen<br />
wird die Negation mit Wörtern oder Morphemen ausgedrückt. Doch auch<br />
<strong>Bedeutung</strong>sbestandteile <strong>von</strong> Wörtern können eine Negation ausdrücken. So ist in<br />
dem Wort abstellen ein negativer Anteil, nämlich derjenige, der ausdrückt, dass<br />
eine Handlung beendet wird und damit nicht mehr besteht.<br />
Ebene Negationsträger<br />
- 10 -<br />
Negations-<br />
Zeichen<br />
<strong>Bedeutung</strong> oder<br />
„Übersetzung“
auf der Ebene des<br />
Sprechaktes<br />
auf der Ebene des<br />
Satzes<br />
Auf der Ebene eines<br />
Syntagmas<br />
(syntaktische Verbindung<br />
<strong>von</strong> Wörtern)<br />
auf der Ebene des<br />
Wortes<br />
<strong>Bedeutung</strong>steil eines<br />
Wortes<br />
idiosynkratische<br />
Wendungen<br />
träger Zeichen „Übersetzung“<br />
verboten Es ist verboten, zu<br />
rauchen.<br />
Rauchen verboten<br />
kein<br />
nicht<br />
- 11 -<br />
Keine Hunde<br />
erlaubt.<br />
Hunde nicht<br />
erlaubt<br />
Ende Ende der<br />
Spielstraße<br />
ohne<br />
-frei<br />
nuklearfreie Zone<br />
abstellen Motor abstellen<br />
(indirekt: „Bitte<br />
den Schlüssel nicht<br />
benutzen“ ==><br />
„Motor läuft<br />
nicht“)<br />
Schnellspannfutter<br />
(eines Bohrers)<br />
(indirekt: „kein<br />
Werkzeug notwendig“)
4. Syntax <strong>von</strong> <strong>NegationsZeichen</strong><br />
Wir haben zwischen der Form eines Zeichens und seinem Inhalt unterschieden.<br />
Für die Form und die Konstruktion komplexer Formen aus einfachen gelten<br />
syntaktische Regeln, während der Inhalt und die Komposition des Inhalts in der<br />
<strong>Semantik</strong> behandelt wird. Betrachten wir also zunächst die syntaktische Seite <strong>von</strong><br />
<strong>NegationsZeichen</strong>.<br />
4.1 <strong>Die</strong> Formelemente<br />
Woraus besteht ein <strong>NegationsZeichen</strong> und wie werden die einzelnen Elemente<br />
kombiniert? Wir hatten bereits gesehen, dass eine Negation nicht für sich alleine<br />
stehen kann, sondern immer etwas braucht, das sie negiert: die Basis.<br />
Entsprechend kann der Negationsträger nicht allein stehen, sondern muss mit<br />
einem weiteren Zeichen kombiniert werden, dessen Inhalt negiert wird. Bei der<br />
Basis handelt es sich oft um eine Ikone (Ideogramm oder auch Piktogramm); es<br />
kann aber auch mit einem Index (Anzeichen) oder sogar mit Text kombiniert<br />
werden. Somit können wir folgende einfach syntaktische Regel aufstellen (siehe<br />
auch Abbildung 3 für die Farben):<br />
Negationsträger Basis Verbot oder<br />
<strong>NegationsZeichen</strong><br />
+ =<br />
+ =<br />
Ähnliche Bedingungen finden wir auch für die Negationsträger im Deutschen. Es<br />
ist bei den Beispielen jeweils noch ein „ungrammatisches“ Beispiel angegeben,<br />
d.h. ein Beispiel, das nicht nach den Regeln des Deutschen gebildet worden ist<br />
(ungrammatische Ausdrücke werden mit „*“ markiert.):<br />
- 12 -
Negationsträger<br />
Regel Beispiele<br />
verboten kombiniert mit Nebensatz Es ist verboten zu rauchen.<br />
*Zu rauchen ist es verboten.<br />
nicht, nie, Satzadverbial Es regnet nicht.<br />
niemals<br />
*Es nicht regnet.<br />
kein Determinator; kombiniert Keine schwarzen Hunde erlaubt.<br />
mit NP<br />
*Schwarze keine Hunde erlaubt<br />
ohne Präposition; kombiniert mit ohne weißen Zucker<br />
DP<br />
*weißen ohne Zucker<br />
un- Präfix; kombiniert mit unbrauchbar, Unzucht<br />
Adjektiven und Substantiven *unbrauchen, *unziehen<br />
4.2 <strong>Die</strong> Anordnung der Formen – syntaktischer Skopus<br />
Wie wird das <strong>NegationsZeichen</strong> mit dem Zeichen oder den Zeichen kombiniert,<br />
die es negiert?<br />
Bei den meisten graphischen Negationsträger bietet es sich an, dass der<br />
Negationsträger den Bereich überdeckt, den er negiert oder auf den er angewendet<br />
wird. Man sprich hier auch <strong>von</strong> dem Skopus der Negation.<br />
Der Skopus der Negation im Deutschen lässt sich nicht wie in den graphischen<br />
Beispielen mit einer Überdeckung des Bereichs realisieren. Oft wird er jedoch<br />
durch die lineare Abfolge angedeutet, wie in dem Kontrast zwischen (1) und (2).<br />
Hier gehört der Teil rechts vom dem Negationsträger nicht zum Skopus, der<br />
Bereich links jedoch nicht. Doch ist es auch möglich, den Skopus des<br />
Negationsträgers durch die Intonation anzudeuten, wie in (3), wo die betonten<br />
Wörter in Kapitälchen gesetzt sind. Der Skopus lässt sich durch eine Paraphrase<br />
deutlich machen, in der der Negationsträger als der Satz es ist nicht der Fall,<br />
dass und das Adverb zufälligerweise als der Satz Es war Zufall, dass realisiert<br />
werden:<br />
- 13 -
(1) Nicht zufälligerweise stachen Peter viele Mücken.<br />
(1a) Nicht [zufälligerweise stachen Peter viele Mücken].<br />
(1b) Es ist nicht der Fall, [dass es ein Zufall war, dass es viele Mücken<br />
gab, die Peter stachen].<br />
(2) Zufälligerweise stachen Peter nicht [Viele Mücken].<br />
(2a) Zufälligerweise stachen Peter nicht [Viele Mücken].<br />
(2b) Es war ein Zufall war, dass es nicht der Fall war, [dass es viele<br />
Mücken gab, die Peter stachen].<br />
(3) Zufälligerweise stachen Peter Viele Mücken nicht .<br />
(3a) Zufälligerweise stachen Peter [VIELE MÜCKEN] nicht.<br />
(3b) Es war ein Zufall war, dass es nicht der Fall war, [dass es viele<br />
Mücken gab, die Peter stachen].<br />
4.3 Der Fokus der Negation<br />
<strong>Die</strong> Negation besteht aus einem Negationsträger, einem Bereich über den die<br />
Negation ausgesprochen ist und einem Teil, der in besonderer Weise <strong>von</strong> der<br />
Negation betroffen wird: dem Fokus der Negation. In der graphischen<br />
Darstellung unserer Verbotsschilder wird dies manchmal damit deutlich gemacht,<br />
dass der in besonderer Weise negierte Teil extra markiert ist. Der Fokus kann<br />
auch durch den zusätzlichen Einsatz der Farbe Rot dargestellt werden: So ist auf<br />
Überholverboten der (potentielle) Überholer in Rot dargestellt. Der Fokus wird<br />
aber auch durch ein rotes Kreuz auf dem Bereich bezeichnet, der <strong>von</strong> dem<br />
Verbot besonders betroffen ist („an dieser Maschine nur eine Person“). Eine<br />
weitere Möglichkeit ist in dem türkischen Überholverbot angegeben, in dem der<br />
Negationsstrich über dem verbotenen Gegenstand angeordnet ist (Sie auch<br />
Abbildung 4):<br />
Während in den beiden deutschen Überholverboten die Markierung des Fokus<br />
unabhängig <strong>von</strong> dem Negationsträger ist (der durch den runden roten Kreis<br />
- 14 -
dargestellt ist), ist das bei dem Verbot der zweiten Person nicht so klar – hier<br />
kann das rote Kreuz entweder als zusätzliches Fokusmerkmal (wie die roten<br />
Autos in den deutschen Verbotsschildern) aufgefasst werden, oder als Teil des<br />
Verbotsträgers. Der Fall des türkischen Überholverbotes hingegen ist klar – hier<br />
gehört der rote Strich eindeutig zu dem Negationsträger.<br />
<strong>Die</strong> folgenden Beispiele sind ebenfalls interessant, da sie wiederum anderen<br />
Prinzipien folgen: Während das Rauchverbot ähnlich aufgebaut ist wie das Verbot<br />
der zweiten Person, ist das Verbot, eine Granate anzufassen (ein Schild aus den<br />
Schweizer Alpen) allein durch das Negationskreuz über der Hand ausgedrückt.<br />
Ebenso ist das Verbot der „Hundehaufen“ (eigentlich: das Liegenlassen <strong>von</strong><br />
Hundehaufen) durch ein kleines rotes Kreuz über dem verbotenen Produkt<br />
ausgedrückt. Doch ist hier durch die insgesamte Rotfärbung der Basis bereits das<br />
Verbot insgesamt angekündigt. <strong>Die</strong> roteingefärbte Leine (siehe Abbildung 5) in<br />
dem letzten Schild deutet nicht auf ein Verbot hin – das Anleinen <strong>von</strong> Hunden<br />
soll ja nicht verboten werden – sondern auf ein Gebot: „Hunde (bitte) anleinen“.<br />
Hier ist die Leine sicherlich der Fokus („nur mit Leine“), doch das ganze Schild<br />
ist eher ein Gebotsschild.<br />
Sprachlich wird der Fokus meist durch die Intonation markiert, d.h. der Fokus<br />
erhält den Hauptakzent in dem Satz, was hier jeweils mit Kapitälchen markiert<br />
wird. So hat in (4) und (5) die Negation zwar den gleichen Skopus die Mutter<br />
<strong>von</strong> Gert benachrichtigt, d.h. in beiden Sätzen ist der Bereich identisch, auf den<br />
die Negation wirkt. <strong>Die</strong> beiden Sätze unterscheiden sich aber in dem Fokus, d.h.<br />
in dem Bereich der in besonderer Weise <strong>von</strong> der Negation betroffen ist – das lässt<br />
sich meist mit den jeweiligen Alternativen illustrieren: In (4) ist Mutter der Fokus<br />
und wird somit zurückgewiesen, wohin eine entsprechende Alternative zu Mutter,<br />
wie z.B. Vater, durchaus eingesetzt werden könnte. In (5) hingegen ist Gert<br />
fokussiert, d.h. dass hier negiert wird, dass Gerts Mutter benachrichtigt wurde,<br />
wohingegen jedoch die Mutter <strong>von</strong> einer Alternative <strong>von</strong> Gert benachrichtigt<br />
worden ist – z.B. die Mutter <strong>von</strong> Hans. Damit sorgt die Stellung und die<br />
Intonation für die richtige Zuordnung <strong>von</strong> Skopus und Fokus zur Negation.<br />
- 15 -
(4) Peter hat nicht [die MUTTER <strong>von</strong> Gert benachrichtigt.]<br />
(4a) Peter hat nicht [die MUTTER <strong>von</strong> Gert benachrichtigt], sondern den<br />
VATER <strong>von</strong> Gert.<br />
(5) Peter hat nicht [die Mutter <strong>von</strong> GERT benachrichtigt].<br />
(5a) Peter hat nicht [die Mutter <strong>von</strong> GERT benachrichtigt], sondern die<br />
Mutter <strong>von</strong> HANS.<br />
Sowohl syntaktische Anordnung wie auch intonatorische Prominenz sind nicht<br />
immer eindeutig, wie bereits in Beispiel (3) diskutiert. So kann z.B. die Betonung<br />
<strong>von</strong> Gert in (6) zwei unterschiedliche Foki ausdrücken. In (6a) (wie (5a)) wird nur<br />
der Eigenname Gert fokussiert und semantisch zu anderen Eigennamen in<br />
Alternative gesetzt. Doch kann die Betonung <strong>von</strong> Gert auch einen „weiten<br />
Fokus“ auf die Mutter <strong>von</strong> Gert markieren, der dann in Alternative z.B. dem<br />
Vater <strong>von</strong> Hans oder zu Luise steht. Phonologische Regeln bestimmen für solche<br />
längeren Phrasen den Hauptakzent, der in diesem Fall auf das letzte Wort in der<br />
fokussierten Phrase gefallen ist. <strong>Die</strong> Zuordnung eines Fokus zu einem<br />
intonatorisch prominenten Wort ist jedoch nicht trivial und Gegenstand der<br />
Intonationsforschung.<br />
(6) Peter hat nicht [ die Mutter <strong>von</strong> GERT benachrichtigt].<br />
(6a) Peter hat nicht [die Mutter <strong>von</strong> {GERT} benachrichtigt], sondern die<br />
Mutter <strong>von</strong> HANS.<br />
(6b) Peter hat nicht {die Mutter <strong>von</strong> GERT} benachrichtigt, sondern<br />
Luise.<br />
5. <strong>Semantik</strong> (<strong>Bedeutung</strong>slehre)<br />
Bisher haben wir untersucht, wie die Form <strong>von</strong> Zeichen aufgebaut sind und wie<br />
sie syntaktisch kombiniert werden können. Dem entspricht die syntaktische<br />
(manchmal auch „grammatisch“ genannte) Zusammenfügung der Wörter zu<br />
Sätzen. In diesem Abschnitt kommen wir nun zu der <strong>Bedeutung</strong>, die jedes<br />
Zeichen oder Wort besitzt. Dabei unterscheiden wir im allgemeinen zwischen der<br />
lexikalischen oder Wortbedeutung und der kompositionalen oder Satzbedeutung.<br />
In der lexikalischen <strong>Semantik</strong> wird untersucht, was die <strong>Bedeutung</strong> eines einfachen<br />
Ausdrucks ist, während in der kompositionalen oder Satzsemantik die Prinzipien<br />
der Zusammenfügung <strong>von</strong> einzelnen <strong>Bedeutung</strong>en zu größeren Komplexen<br />
beschrieben wird. Bevor wir diese beiden Aspekte der <strong>Semantik</strong> in den nächsten<br />
beiden Abschnitten genauer untersuchen, soll hier eine Bemerkung zur<br />
- 16 -
historischen <strong>Semantik</strong> gemacht werden – d.h. zu dem Bereich, der sich mit der<br />
Veränderung der <strong>Bedeutung</strong> durch die Zeit beschäftigt.<br />
5.1 Historische Entwicklung <strong>von</strong> Negationsträgern<br />
Es gibt eine lange Tradition der Beschreibung der <strong>Bedeutung</strong>sveränderung und<br />
besonders der „<strong>Bedeutung</strong>s-„abschwächung“ <strong>von</strong> Negationselementen in<br />
natürlichen Sprachen. Hier soll nun eine „<strong>Bedeutung</strong>sveränderung“ des<br />
Negationsträgers auf Diskettenhüllen vorgestellt werden. Wir können dabei vier<br />
Stufen unterscheiden:<br />
1. Der Negationsträger, hier der Kreis mit dem diagonalen Negationsstrich,<br />
umfasst die gesamte zu negierende Aktion. In anderen Worten, der Skopus und<br />
der Fokus liegt innerhalb des graphischen Negationsträgers.<br />
2. Der Negationsträger, hier das Negationskreuz, umfasst oder überschreibt<br />
graphisch nur noch einen Teil der gesamten Handlung – man kann an dieser<br />
Stelle noch nicht einmal da<strong>von</strong> sprechen, dass nur der Fokus besonders<br />
gekennzeichnet ist, da der Fokus der Negation hier wohl eher auf den Händen,<br />
die eineDiskette verbiegen können, oder auf dem Magneten liegt.<br />
3. Der Negationsträger umfasst überhaupt nichts mehr <strong>von</strong> der Basis – er steht<br />
vielmehr am Rande der Basis und drückt einfach nur eine Negation der Handlung<br />
- 17 -
aus, die mit der Basis ausgedrückt wird. <strong>Die</strong> graphische Negation steht hier<br />
ähnlich wie die sprachliche Negation vor den negierten Zeichen. Man könnte für<br />
die rechte Darstellung sogar annehmen, dass der Fokus hier auch durch den<br />
großen Stern (für Aufprall) ausgedrückt ist.<br />
4. Der Negationsträger drückt überhaupt keine Negation mehr aus, sondern<br />
entweder eine Art Warnung, oder aber er deutet einfach nur den Skopus für<br />
diese Warnung aus. Hier kann der Negationskreis in Kontrast zu dem<br />
Negationskreis mit der Diagonalen gesehen werden – in diesem Kontrast wird<br />
dann nur die Diagonale als Negationsträger verstanden, wohingegen der Kreis als<br />
Markierung des Skopus aufgefasst werden kann.<br />
An diesen wenigen Beispielen wird bereits deutlich, dass <strong>NegationsZeichen</strong> oft<br />
nicht als klare Verbote aufzufassen sind, sondern vielmehr als Illustrationen für<br />
Anweisungen oder Empfehlungen für die Handhabung <strong>von</strong> Objekten. <strong>Die</strong> unten<br />
aufgeführten Beispiele sind aus dem „Hilfeprogramm“ für ein Computersystem.<br />
Links mit den jeweiligen textuellen Anweisungen oder Empfehlungen, die ich<br />
rechts aus Platzgründen weggeschnitten habe. Sehr komplexe Anweisungen<br />
lassen sich jedoch oft nicht in ein einfaches <strong>NegationsZeichen</strong> übertragen, wie die<br />
- 18 -
eiden unten aufgeführten Anweisungen illustrieren, die keine graphische<br />
Äquivalenz erhalten haben:<br />
- 19 -
6. Lexikalische <strong>Semantik</strong><br />
6.1 Inhaltswörter vs. Formwörter<br />
Wenn wir den Wörtern unserer Sprache ein <strong>Bedeutung</strong> zuordnen wollen, so fällt<br />
sehr schnell auf, dass dies bei einigen Wortklassen wesentlich einfacher geht als<br />
bei anderen. Traditionell wird daher zwischen „Inhaltswörtern“ und<br />
„Formwörtern“ unterschieden. Inhaltswörter haben eine lexikalische <strong>Bedeutung</strong>,<br />
während Formwörter eine strukturelle oder grammatische <strong>Bedeutung</strong> haben. Zu<br />
den Inhaltswörtern gehören die Hauptklassen Substantive, Adjektive, Verben und<br />
Adverbien. Zu den Formwörtern oder grammatischen Wörtern gehören alle<br />
anderen Wörter wie Konjunktionen, Präpositionen, Artikel, Quantoren,<br />
Pronomen, Satzoperatoren etc.<br />
Inhaltswörter Formwörter<br />
Lexikalische <strong>Bedeutung</strong> strukturelle <strong>Bedeutung</strong><br />
Substantive<br />
Artikel (der, die, das, ein)<br />
Adjektive<br />
Konjunktionen (und, oder)<br />
Verben<br />
Präpositionen (über, unter, auf)<br />
Adverbien<br />
Quantoren (alle, jeder, einige)<br />
Satzoperatoren (nicht, immer)<br />
Der Kontrast zwischen Inhaltswörtern und Formwörtern wird auch dadurch<br />
illustriert, dass sich Inhaltswörter eher durch ikonische Zeichen darstellen lassen<br />
als Funktionswörter:<br />
Grammatische Kategorie graphische Darstellung (Beispiel)<br />
Substantive: Gegenstände<br />
(Hunde, Touristen etc.)<br />
Adjektive: Qualitäten<br />
(klein – groß)<br />
- 20 -
Verben: Tätigkeiten<br />
(sprechen, füttern, rodeln)<br />
Adverbien: Modalitäten bisher noch keine guten Beispiele<br />
gefunden<br />
Funktionswörter<br />
meist mit Pfeilen oder mathematischen<br />
Satzverbindungen (und, wenn dann) Symbolen<br />
Lassen sich nun die Inhalte der <strong>Bedeutung</strong>en noch weiter analysieren? Dazu gibt<br />
es unterschiedliche Ansätze. Im Folgenden soll die Merkmalstheorie und die<br />
Prototypentheorie kurz vorgestellt werden.<br />
6.2 Strukturalistische Merkmalstheorien<br />
In den strukturalistischen Merkmalstheorien wird da<strong>von</strong> ausgegangen, dass sich<br />
die <strong>Bedeutung</strong>en unserer Wörter ähnlich wie ihre Formseite mit Merkmalen<br />
beschreiben lassen, die in einem Kontrast zueinander stehen. Jede <strong>Bedeutung</strong><br />
setzt sich aus einer Reihe <strong>von</strong> Merkmalen zusammen, und unterschiedliche<br />
<strong>Bedeutung</strong>en lassen sich oft dadurch beschreiben, dass man angibt, welche<br />
Merkmale sie gemeinsam haben und in welchen Merkmalen sie kontrastieren. So<br />
wird die <strong>Bedeutung</strong> <strong>von</strong> Mann zerlegt in [+männlich, +erwachsen] während die<br />
<strong>Bedeutung</strong> <strong>von</strong> Junge in [+männlich, -erwachsen] zerlegt wird.<br />
<strong>Die</strong>se Theorie ist besonders hilfreich, wenn man sich überlegt, was mit der<br />
Negation negiert wird. Oft werden nämlich nur einzelne Merkmale negiert. So<br />
lassen sich im folgenden die Basen in komplexe Merkmale zerlegen, <strong>von</strong> denen<br />
jeweils nur ein Merkmal negiert wird (hier fett dargestellt):<br />
[+menschlich<br />
+klein]<br />
[+menschlich<br />
+leicht bekleidet]<br />
- 21 -<br />
[+ Kopfbedeckung<br />
+ männlicher Träger]
6.3 Prototypentheorie<br />
<strong>Die</strong> Merkmalstheorie ist in der 60er Jahre auf heftige Kritik gestoßen. Es wurde<br />
argumentiert, dass sich viele <strong>Bedeutung</strong>en nicht in ±Merkmale zerlegen lassen,<br />
sondern das <strong>Bedeutung</strong>en ganz anders aufgebaut seien. So entspricht die<br />
<strong>Bedeutung</strong> <strong>von</strong> Hund nicht der Summe <strong>von</strong> bestimmten Merkmalen, sondern die<br />
<strong>Bedeutung</strong> <strong>von</strong> Hund ist ein prototypischer Hund sowie einer Regel, nach der alle<br />
ähnlichen Objekte ebenfalls Hunde sind. <strong>Die</strong>se Theorie wird als<br />
„Prototypentheorie“ bezeichnet. Im Gegensatz zur sprachlichen Realisierung <strong>von</strong><br />
„Hunde verboten“ oder „Keine Hunde“ wirft die graphische Darstellung gewisse<br />
Probleme auf, da nicht klar ist, ob hier der Prototyp negiert wird oder nur eine<br />
bestimmte Eigenschaft (keine Dackel, keine dunklen Hunde, keine Schäferhunde<br />
etc.). Doch diese Aspekte sind bisher noch überhaupt nicht untersucht worden.<br />
Schließlich kann man sich auch fragen, ob der „prototypische“ Hund am besten<br />
durch einen abstrakten „Archetyp“ bezeichnet werden kann (wie die letzte<br />
stilisierte Darstellung) – doch scheint das nicht sehr wahrscheinlich – denn wenn<br />
man <strong>von</strong> allen typischen Eigenschaften einer Hunderasse abstrahiert, bleibt nicht<br />
viel übrig. Hier sollte man wohl daher eher <strong>von</strong> „Familienähnlichkeit“ sprechen:<br />
Jede Rasse hat etwas mit einer anderen gemeinsam, wenn sie vielleicht auch nicht<br />
alle die gleichen Merkmalen haben:<br />
- 22 -
7. Satzsemantik – wie <strong>Bedeutung</strong>en kombiniert werden<br />
7.1 Kompositionalität<br />
Satzsemantik kann als die Erweiterung der lexikalischen <strong>Semantik</strong> unter<br />
zumindest zwei Aspekten verstanden werden:<br />
1. In der Satzsemantik wird die <strong>Bedeutung</strong> <strong>von</strong> den Funktionswörtern wie nicht,<br />
und, oder, wenn, jeder, alle, einige, keine, er, sie etc. beschrieben. Wir hatten<br />
bereits gesehen, dass diese Wörter keinen oder nur einen sehr geringen<br />
lexikalischen „Inhalt“ haben, sondern vielmehr eine Funktion im Satz ausüben.<br />
2. Der zweite Aspekte, unter dem man die Satzsemantik als die logische<br />
Verlängerung der lexikalischen <strong>Semantik</strong> verstehen kann, ist die Beschreibung<br />
der Kombination <strong>von</strong> <strong>Bedeutung</strong>en zu größeren Komplexen. Analog zu den<br />
syntaktischen Regel der Zusammenfügung <strong>von</strong> einem Negationsträger mit einem<br />
anderem Zeichen, wird eine Negation dadurch realisiert, dass sie als Operation auf<br />
einen Inhalt angewendet wird.<br />
Das entscheidende Prinzip der Satzsemantik ist das Kompositionalitätsprinzip, das<br />
auf Frege zurückgeführt wird. Es ist folgendermaßen formuliert:<br />
<strong>Die</strong> <strong>Bedeutung</strong> eines komplexen Ausdrucks wird aus den <strong>Bedeutung</strong>en seiner<br />
Teile und der Konstruktion zusammengefügt.<br />
Dem Kompositionalitätsprinzip steht das Kontextprinzip gegenüber (ebenfalls bei<br />
Frege), nach dem die <strong>Bedeutung</strong> eines Ausdrucks abhängig <strong>von</strong> dem Kontext ist,<br />
in dem der Ausdruck steht.<br />
7.2 Eigenschaften <strong>von</strong> Formwörtern – logische Äquivalenzen<br />
Formwörtern lässt sich meist nur eine sehr abstrakte <strong>Bedeutung</strong> zuordnen.<br />
Dennoch können die Eigenschaften <strong>von</strong> Formwörtern wie und, oder, nicht sehr<br />
gut beschrieben werden. Sie sind seit der Antike Gegenstand intensiver<br />
Untersuchungen, die insbesondere mit Argumentationsverfahren und<br />
Schlussverfahren in der natürlichen Sprache zu tun haben.<br />
Wir gehen da<strong>von</strong> aus, dass unterschiedliche Objekte innerhalb des Skopus eines<br />
graphischen Negationsträgers mit einem „oder“ verknüpft sind. <strong>Die</strong>se oder-<br />
- 23 -
Verknüpfung lässt sich nun in eine und-Verknüpfung zweier Verbote überführen<br />
(die natürliche Sprache ist in diesem Punkt nicht immer ganz genau – oft werden<br />
die beiden Junktoren und und oder miteinander vertauscht: „Es ist verboten an<br />
Bord zu nehmen: Pistolen und Messer“ – aber nur im Sinne eines Skopus <strong>von</strong><br />
und über verboten. <strong>Die</strong>se Äquivalenz <strong>von</strong> den beiden Sätzen wird auch als<br />
logische Äquivalenz ganz allgemein so formuliert, wobei die Variablen p und q<br />
für Sätze stehen und der Haken „¬“ für die Negation (vgl. Abildung 6 für eine<br />
farbigere Darstellung):<br />
Genau andersherum verhält es sich, wenn wir eine Konjunktion negieren, wie in<br />
dem folgenden Beispiel. Graphisch wird die Konjunktion durch das<br />
Übereinanderlegen der beiden relevanten Bereiche deutlich gemacht (siehe auch<br />
Abbildung 7):<br />
- 24 -
Beide möglichen Kombinationen beruhen auf logischen Gesetzen oder Äquivalenzen,<br />
die als die „De Morganschen Gesetze“ bekannt sind:<br />
(i) ¬(p oder q) ≡ ¬p und ¬q<br />
(ii) ¬(p und q) ≡ ¬p oder ¬q<br />
<strong>Die</strong>ses Gesetz gilt nicht nur für Verbotsschilder, sondern auch für Gebotsschilder,<br />
die meist blau sind.<br />
+ =<br />
Autos verboten Motorräder verboten (Autos oder<br />
Motorräder) verboten<br />
+ =<br />
Nur für Fußgänger Nur für Fahrräder Nur für (Fußgänger<br />
oder Fahrräder)<br />
Eine interessante Beobachtung am Rande ist, dass wir durchaus zwei<br />
Verbotsschilder „Autos verboten“ und „Motorräder verboten“ nebeneinander<br />
finden können, alternativ zu dem kombinierten Schild. Doch dürften wir niemals<br />
die beiden Gebotsschilder „Nur für Fußgänger“ und „Nur für Fahrräder“<br />
nebeneinander finden, da sie sich gegenseitig ausschließen. Für den Fall, dass<br />
beide Gruppen erlaubt sind, ist nur das kombinierte Schild möglich. <strong>Die</strong>s hat mit<br />
der <strong>Bedeutung</strong> der Gebotsschilder zu tun, die mit dem „nur“ alle andere<br />
Gruppen ausschließen. (Das „nur“ schließt eigentlich eine Negation mit ein, da es<br />
sich mit „für niemanden außer ...“ paraphrasieren lässt.)<br />
- 25 -
7.3 Kombination mit anderen Operatoren<br />
Verbotsschilder können auch vielfach kombiniert werden, wie in diesem Beispiel<br />
am Eingang zum Aachener Dom. Während dort einfach diverse Verbote<br />
aneinandergereiht werden, gibt es auch komplexere Verbindungen zwischen<br />
Zeichen, so wie auf dem Schild auf einem Wanderweg in den Schweizer Alpen.<br />
Hier wird das Verbot mit einem Konditional kombiniert: Es heißt nicht: wenn du<br />
die Granatenhülse nicht anfasst wird/kann sie explodieren, sondern vielmehr:<br />
wenn du das Verbot nicht befolgst, dann kann es passieren. Ferner sind noch<br />
nummerierte Anweisungen gegeben:<br />
- 26 -
- 27 -
8. Pragmatik<br />
<strong>Die</strong> linguistische Teildisziplin der Pragmatik ist der <strong>Semantik</strong> benachbart und oft<br />
ist eine klare Grenzziehung nicht einfach. Doch werden zumindest diejenigen<br />
sprachlichen Phänomene in der Pragmatik verhandelt, die mit einem engen<br />
Begriff <strong>von</strong> lexikalischer oder kompositionaler <strong>Bedeutung</strong> nicht abgedeckt<br />
werden können. So lassen sich kontextuelle <strong>Bedeutung</strong>en und implizite<br />
Hintergrundannahmen der Pragmatik zuordnen.<br />
8.1 Kontextprinzip<br />
Viele Wörter bedeuten nur etwas in einem bestimmten Kontext. Auch hier eine<br />
Illustration aus der Welt der Verbote. <strong>Die</strong> folgenden Verbote lassen sich nur<br />
verstehen, wenn man den sprachlichen oder außersprachlichen Kontext kennt. So<br />
ist das erste Zeichen kein Verbot für eine Telefon, sondern vielmehr das Zeichen<br />
für eine Telefonzelle, aber eben nur in Italien. Das zweite Verbotsschild ist kein<br />
Verbot für Schlangen, sondern ein Halteverbot, damit dort ein Arzt (die Schlange<br />
als Zeichen für den medizinischen Archetyp „Äskulap“). Das dritte Verbot ist<br />
bestimmt nicht für Abschleppwagen bestimmt, sondern beinhaltet eine Warnung<br />
für diejenigen, die sich nicht an das Halteverbot halten (vgl. Abbildung 8).<br />
Für die Zuordnung einer <strong>Bedeutung</strong><br />
für das Zeichen unten ist<br />
ebenfalls Kontext notwendig.<br />
Nach allem was wir bisher gelernt<br />
haben, müsste es ein Verbot des<br />
Zugangs sein. Doch in dem rechts<br />
dargestellten Kontext ist das<br />
Zeichen ein positiver Hinweis:<br />
- 28 -
8.2 Hintergrundannahmen: Präsuppositionen<br />
Neben der lexikalischen und kompositionellen <strong>Bedeutung</strong> tragen Wörter und<br />
Sätze immer noch zusätzlich Hintergrundannahmen, die implizit mitgeäußert und<br />
mitverstanden werden. Hintergrundannahmen treten erst dann in den<br />
Vordergrund, wenn es Konflikte mit der explizit ausgedrückten <strong>Bedeutung</strong> gibt,<br />
oder Konflikte zwischen unterschiedlichen Hintergrundannahmen. So bedeutet<br />
das Verbotsschild unten, dass das Beklettern <strong>von</strong> Zügen verboten ist. In der<br />
Kombination mit dem Warnschild wird auch der Grund gleich angedeutet: Es<br />
besteht die Gefahr, <strong>von</strong> dem Starkstrom getroffen (und getötet) zu werden. In<br />
der Kombination mit dem „Betreten...<strong>Verboten</strong>“ Schild entsteht jedoch ein<br />
Konflikt zwischen den Hintergrundannahmen: Das „Klettern verboten“ macht<br />
nur Sinn, wenn man überhaupt bis dahin gehen kann, dies ist jedoch durch das<br />
„Betreten verboten“ bereits untersagt. D.h. wenn ein Schild die Voraussetzung<br />
für ein anderes bereits verletzt, geraten wir in einen Konflikt, den wir durch<br />
„pragmatisches Schließen“ oder Akkommodation („Angleichung der<br />
sprachlichen Verhältnissen an unsere Kenntnis“) beheben müssen. So könnten<br />
wir hier schließen, dass der Schilderaufsteller sein eigenes Schild („Betreten<br />
verboten“) nicht ernst und daher das „Klettern verboten“ aufgestellt hat.<br />
Intendiert war jedoch vermutlich eher eine Verstärkung des Klettern verboten<br />
(die jedoch nach meiner Meinung nicht gelungen ist):<br />
- 29 -
9. Duplex negatio affirmat – <strong>von</strong> den Eigenheiten der Negation<br />
Doppelte Negation kann unterschiedliche Funktionen haben. Einmal kann sie<br />
tatsächlich eine positive Behauptung ausdrücken, auch wenn dabei oft eine<br />
gewisse Abschwächung ausgedrückt wird. Es gibt eine sehr lange Tradition über<br />
den Gebrauch der doppelten Negation als Affirmation oder Verzierung der Rede.<br />
<strong>Die</strong>s ist besonders der Fall, wenn man eine lexikalische Negation (un–) mit einer<br />
Satznegation kombiniert:<br />
Es ist nicht der Fall, das du nicht gelacht hast. = Du hast gelacht.<br />
Du hast nicht die Unwahrheit gesagt. = Du hast die Wahrheit gesagt.<br />
Das ist nicht ungesund: = Das ist gesund.<br />
Oft aber verstärkt eine Negation oder ein negierendes Wort eine bereits<br />
bestehende Negation. <strong>Die</strong>s wird mit „Negative Concord“ („Negative Übereinstimmung“)<br />
bezeichnet. Im folgenden betrachten wir zunächst Fälle <strong>von</strong><br />
„Negative Concord“, die besonders häufig in der Kombination <strong>von</strong> Text und<br />
graphischen <strong>NegationsZeichen</strong> sind. Dann wird ein Fall <strong>von</strong> „falschem“<br />
Gebrauch vorgestellt und schließlich eine wirkliche „doppelte Negation“ im Sinne<br />
<strong>von</strong> Aufhebung einer bereits ausgedrückten Negation<br />
9.1 Negative Concord<br />
- 30 -
Wie bereits erwähnt, treten <strong>NegationsZeichen</strong><br />
oft als Verstärkung<br />
einer bereits ausgedrückten<br />
Negation auf. <strong>Die</strong>se erste oder<br />
primäre Negation ist oft<br />
sprachlich ausgedrückt, so auch in<br />
dem Eigentümerschild rechts,<br />
dem Schild auf der Biotonne und<br />
dem Verbot am Eingang eines<br />
amerikanischen Flughafens (die<br />
Aufnahme ist <strong>von</strong> 1997). Eine<br />
solche Negation soll verstärkend<br />
wirken.<br />
- 31 -
9.2 „Falscher“ Gebrauch des <strong>NegationsZeichen</strong>s<br />
Eine Beobachtung ist, dass im Text<br />
ausgesprochene Verbot (untersagt, Nicht,<br />
prohibited) sich nicht auf das ganze Verbot oder<br />
<strong>NegationsZeichen</strong> bezieht, sondern nur auf die<br />
(positive) Basis. <strong>Die</strong>s trifft auch für das Schild<br />
rechts zu, wo die freundliche (britische!)<br />
Aufforderung, sein Fahrrad an der Hand zu<br />
nehmen sich auf die Basis des <strong>NegationsZeichen</strong>s<br />
bezieht (es ist eigentlich kein Verbotsschild, da<br />
Fahrräder als solche nicht verboten sind).<br />
In diesem Ausschnitt einer Informationstafel in einem Flugzeug wird die Situation<br />
eines Notfalles beschrieben. Während die <strong>NegationsZeichen</strong> rechts für den<br />
Verzicht auf Koffer, hochhackige Schuhe und Zigaretten in dieser Situation noch<br />
verständlich sind, sind die <strong>NegationsZeichen</strong> für (kein) Feuer , (kein) Rauch und<br />
(kein) Wasser tatsächlich missverständlich. Es fällt auch schwer, hier <strong>von</strong> einer<br />
„<strong>Bedeutung</strong>sveränderung“ des Negationsträgers auszugehen, wie wir das oben in<br />
5.1 bei den Diskettenaufschriften vermutet haben. Denn hier wird das gleiche<br />
Zeichen sowohl für das Verbot (oder den Verzicht) wie auch für die Warnung<br />
benutzt. Somit liegt hier vermutlich einfach eine wenig aufmerksame<br />
Umgangsweise mit diesen Zeichen vor.<br />
9.3 Aufhebung der Negation<br />
Schließlich seien noch einige Mittel der Aufhebung der Negation diskutiert: Im<br />
Rahmen der Verbotsschilder wird insbesondere durch graphisches Übermalen<br />
oder farbliches entbleichen, die „Kraft“ des Verbots genommen. Schließlich<br />
- 32 -
erhält bei dem deutschen „Ende des Verbots“-Schild der Negationsstrich auch<br />
noch eine „entblichene“ Darstellung, indem er durchbrochen ist. Bei den<br />
italienischen Schildern (unten) behält jedoch der Negationsstrich seine volle Form<br />
und Farbe (und damit auch seine negierende Kraft).<br />
- 33 -
10. Zusammenfassung und Ausblick<br />
Damit bin ich schon am Ende des Vortrages angekommen. Ich habe mit Ihnen<br />
einen kleinen Ausflug in den Bereich der <strong>Semantik</strong> unternommen. Dabei haben<br />
Sie einige zentrale Begriffe der <strong>Semantik</strong> kennengelernt und einen Einblick in die<br />
abstrakte Struktur der <strong>Bedeutung</strong>en unserer alltäglichen Wörter gewonnen. All<br />
dies habe ich mit unterschiedlichsten <strong>Verboten</strong> und <strong>NegationsZeichen</strong> zu<br />
illustrieren versucht.<br />
<strong>Die</strong> Verbotsschilder, negativen Anweisungen und die <strong>NegationsZeichen</strong> im<br />
Allgemeinen, die ich Ihnen heute abend vorgeführt habe, sind ein kleiner Teil aus<br />
einer Sammlung <strong>von</strong> inzwischen gut 500 unterschiedlichen <strong>NegationsZeichen</strong><br />
(d.h. graphischen Darstellungen, die eine Negation beinhalten). <strong>Die</strong>se habe ich in<br />
den letzten Jahren unsystematisch gesammelt. Ein Teil dieses Materials wurde mit<br />
Hilfe des Fotolabors der Uni Konstanz und mit großem zeitlichen Aufwand <strong>von</strong><br />
Victor Linnemann, Andreas Kalkbrenner, Andreas Meßmer, Thilo Dannenmann,<br />
Robert Schmaus, Christian Gassner und Benedikt Grimmler bearbeitet und in<br />
eine elektronische Datei eingefügt. In dieser Datei wird das jeweilige Verbotsschild<br />
in vier Kontexten erfasst:<br />
• Nur das Verbot<br />
• Das Verbot mit Text<br />
• Das Verbot im Zusammenhang mit anderen <strong>Verboten</strong> oder Zeichen<br />
• Das Verbot in seinem außersprachlichen Zusammenhang<br />
<strong>Die</strong>se Datei bildet das Kernstück für die Untersuchungen im Rahmen des<br />
Projekts „<strong>NegationsZeichen</strong>“. Wie Sie an dem Beispiel auf der folgende Seite<br />
sehen können, werden die jeweiligen <strong>NegationsZeichen</strong> nach einem recht langem<br />
Katalog <strong>von</strong> Stichworten beschrieben. <strong>Die</strong>se Stichworte sollen es erlauben, eine<br />
gute Charakteristik <strong>von</strong> jedem einzelnen Zeichen auf der einen Seite und gute<br />
Verallgemeinerungen <strong>von</strong> Gruppen <strong>von</strong> Zeichen auf der anderen Seite zu<br />
ermöglichen.<br />
Zum Abschluss dieser Veranstaltung möchte ich Sie alle gerne zu einen Sekt und<br />
einem zwanglosen Gespräch hier vor dem Hörsaal einladen und hoffe, dass wir<br />
alle noch einen verbotsfreien und wenig negativen Abend, sowie einen<br />
unglückslosen Heimweg haben.<br />
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit<br />
- 34 -
- 35 -