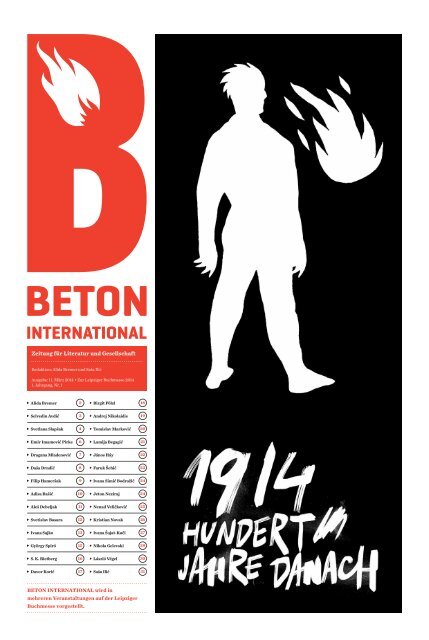1jgbmrt
1jgbmrt
1jgbmrt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zeitung für Literatur und Gesellschaft<br />
Redaktion: Alida Bremer und Saša Ilić<br />
Ausgabe: 11. März 2014 • Zur Leipziger Buchmesse 2014<br />
1. Jahrgang, Nr. 1<br />
Alida Bremer<br />
2<br />
Birgit Pölzl<br />
18<br />
Selvedin Avdić<br />
3<br />
Andrej Nikolaidis<br />
19<br />
Svetlana Slapšak<br />
4<br />
Tomislav Marković<br />
20<br />
Emir Imamović Pirke<br />
6<br />
Lamija Begagić<br />
21<br />
Dragana Mladenović<br />
7<br />
János Háy<br />
22<br />
Daša Drndić<br />
8<br />
Faruk Šehić<br />
23<br />
Filip Hameršak<br />
9<br />
Ivana Simić Bodrožić<br />
24<br />
Adisa Bašić<br />
10<br />
Jeton Neziraj<br />
24<br />
Aleš Debeljak<br />
11<br />
Nenad Veličković<br />
25<br />
Svetislav Basara<br />
12<br />
Kristian Novak<br />
26<br />
Ivana Sajko<br />
13<br />
Ivana Šojat-Kuči<br />
27<br />
György Spiró<br />
15<br />
Nikola Gelevski<br />
29<br />
S. K. Rietberg<br />
16<br />
László Végel<br />
30<br />
Davor Korić<br />
17<br />
Saša Ilić<br />
31<br />
BETON INTERNATIONAL wird in<br />
mehreren Veranstaltungen auf der Leipziger<br />
Buchmesse vorgestellt.
Alida Bremer<br />
Über die erste<br />
Ausgabe von BETON<br />
INTERNATIONAL<br />
Spezialthema: Was bedeutet das Attentat<br />
von Sarajevo für Autorinnen und Autoren<br />
aus Südosteuropa im Jahr 2014<br />
Die Vorgeschichte dieser ersten Ausgabe<br />
von BETON INTERNATIONAL ist einfach:<br />
Entgegen allen ungünstigen realpolitischen,<br />
ideologischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten,<br />
in denen die Länder Südosteuropas<br />
stecken, gibt es unter den SchriftstellerInnen,<br />
PhilosophInnen, SoziologInnen, FeministInnen,<br />
gesellschaftlichen AktivistInnen und vielen<br />
anderen Bürgerinnen und Bürgern unzählige<br />
Initiativen und Projekte, die auf Begegnungen<br />
ausgerichtet sind und die engen nationalen<br />
Rahmen durch ständige Grenzüberschreitungen<br />
unterwandern – in der Hoffnung auf<br />
bessere und gerechtere Gesellschaften. Diese<br />
Durchlässigkeit bezieht sich natürlich nicht nur<br />
auf die Grenzen dieser Länder untereinander,<br />
sondern auch auf die Grenzen zwischen ihnen<br />
und anderen europäischen Ländern. BETON<br />
INTERNATIONAL ist Produkt einer derartigen<br />
Initiative.<br />
In Serbien erscheint seit 2006 eine Beilage<br />
der Tageszeitung „Danas“, die sich unter dem<br />
bewusst an Thomas Bernhard erinnernden<br />
Namen BETON einer Auseinandersetzung mit<br />
den kulturellen Grundlagen des politischen<br />
Geschehens im Land widmet. Am Anfang ein<br />
Produkt des Enthusiasmus von vier kritischen<br />
Geistern, wurde sie zunehmend zu einer wichtigen<br />
Stimme, die weit über die Grenzen Serbiens<br />
hinaus im ganzen Gebiet des ehemaligen<br />
Jugoslawien vernommen wurde.<br />
Ich erfuhr von BETON zum ersten Mal über<br />
Kruno Lokotar, einen kroatischen Verlagslektor,<br />
der bekannt dafür ist, dass er im ganzen<br />
Kulturraum des ehemaligen Jugoslawien zuverlässig<br />
neue literarische Talente aufspürt und<br />
ihnen zu ersten Büchern verhilft. Seitdem verbindet<br />
mich mit Saša Ilić – einer der Gründer<br />
von BETON und meines Erachtens einer der<br />
wichtigsten serbischen Autoren der mittleren<br />
Generation – neben einer Freundschaft auch<br />
eine fruchtbare Zusammenarbeit.<br />
Wir diskutierten über die Notwendigkeit<br />
einer Analyse der öffentlichen Diskurse in unseren<br />
Herkunftsländern und die dringende<br />
Notwendigkeit von Toleranz und Empathie,<br />
die nicht nur bei den Völkern Südosteuropas<br />
an Bedeutung zu verlieren scheinen. Wir waren<br />
uns einig, dass kritische Stimmen aus Südosteuropa<br />
in anderen europäischen Ländern<br />
wenig vernommen werden bzw. dass sie häufig<br />
in bestimmte Muster gepresst werden, wobei<br />
die Autorinnen und Autoren aus diesem unruhigen<br />
Gebiet unserer Meinung nach viel zu sagen<br />
hätten, was auch für andere Europäer von<br />
Interesse sein könnte. Zugleich wird in den<br />
europäischen Diskursen die balkanische Komplexität<br />
überbetont, so als wären die gesellschaftlichen<br />
Prozesse in diesem Gebiet etwas<br />
vollständig Fremdes und Exotisches – und nicht<br />
etwas durch und durch Europäisches, wenn<br />
auch die Entwicklungen nicht immer synchron<br />
mit denen in anderen – vor allem den wohlhabenderen<br />
– Ländern Europas verlaufen. Wir<br />
wollten etwas unternehmen, damit es zu einem<br />
verstärkten Austausch zwischen Autorinnen<br />
und Autoren gesellschaftskritischer Orientierung<br />
kommt – in einem Europa, das zumindest<br />
beim Austausch von Gedanken ein Europa ohne<br />
Grenzen sein sollte.<br />
Mit Hilfe des Netzwerks TRADUKI wurden<br />
daraufhin die Redaktionsmitglieder von BE-<br />
TON zu regelmäßigen Gästen in dem von TRA-<br />
DUKI geförderten Programm „Fokus Südosteuropa“<br />
auf der Leipziger Buchmesse, das ich<br />
seit 2008 kuratiere. Vor vier Jahren unterstützte<br />
das Netzwerk TRADUKI zum ersten Mal<br />
eine deutschsprachige Ausgabe von BETON, in<br />
der zur Leipziger Buchmesse 2010 eine Auswahl<br />
der wichtigsten BETON-Texte seit 2006<br />
veröffentlicht wurde. Im Rahmen des „Fokus<br />
Südosteuropa“ 2010 begegneten sich auch der<br />
kosovo-albanische Autor Jeton Neziraj und<br />
Saša Ilić, und aus dieser Begegnung entstanden<br />
gemeinsame Projekte. Im Jahr 2011 überraschte<br />
BETON – weiterhin mit Hilfe von TRADUKI<br />
– mit einer Nummer, in der sich junge kosovoalbanische<br />
und serbische SchriftstellerInnen<br />
gemeinsam in deutscher Sprache vorstellten.<br />
Im Jahr 2012 widmete sich die deutschsprachige<br />
Ausgabe von BETON dann dem Thema „Krise“<br />
und befragte dazu vor allem slowenische<br />
Autorinnen und Autoren, und im Jahr 2013<br />
hieß die Fragestellung: „Welche Ideen wirken<br />
in Südosteuropa subversiv“, wobei Subversion<br />
gegen engstirnige nationalistische Ideologien<br />
und gegen die Verbreitung von Korruption und<br />
Misswirtschaft in Südosteuropa gemeint war.<br />
In dieser Ausgabe ging es auch um (subversive)<br />
Wege aus der weltweiten Krise, da die wachsenden<br />
Unterschiede zwischen Reich und Arm<br />
nicht nur ein Problem der postsozialistischen<br />
Gesellschaften sind.<br />
Da Saša Ilić und ich bei der Erstellung der<br />
deutschsprachigen Ausgaben von Anfang an<br />
eng zusammenarbeiteten, entschlossen wir uns<br />
Ende Dezember 2013 – nachdem die ursprüngliche<br />
BETON-Redaktion in Belgrad auseinandergegangen<br />
war – BETON INTERNATIONAL<br />
zu gründen. Mit dem neuen Namen sollen unserer<br />
Verbundenheit mit der ursprünglichen<br />
Zeitung und unserer Absicht, international<br />
sichtbarer zu werden, Ausdruck verliehen werden.<br />
Wir waren uns einig, dass die Autorinnen<br />
und Autoren aus Südosteuropa mehr Vernetzung<br />
mit anderen Europäern benötigen, um<br />
nicht in ihrer südlichen geographischen Ecke<br />
isoliert zu bleiben, die dazu mit vielen Vorurteilen<br />
und Stereotypen belegt ist.<br />
Nicht auf der Suche nach einem Konsensus,<br />
sondern auf der Suche nach Mehrstimmigkeit<br />
entschlossen wir uns, die erste Nummer von<br />
BETON INTERNATIONAL einem in Südosteuropa<br />
hochumstrittenen, hochsymbolischen<br />
und hochaktuellen Thema zu widmen: dem Attentat<br />
von Sarajevo.<br />
Ironischerweise entpuppen sich die scheinbar<br />
rückständigen Südosteuropäer bisweilen<br />
als eine Art negativer europäischer Avantgarde.<br />
Das Attentat von Sarajevo aus dem Jahr 1914 war<br />
ein Ausdruck lokal brodelnder machtpolitischer,<br />
militärischer, klerikaler, sozialdemokratischer,<br />
modernistischer, revolutionärer und revolutionär-romantischer,<br />
sozial- und national-emanzipatorischer<br />
und nationalistischer Ideen und<br />
Kräfte sowie des Bestrebens nach einer neuen<br />
geopolitischen Ordnung. Von träumenden Gymnasiasten<br />
und gewaltverherrlichenden Dichtern<br />
über fortschrittliche Denker bis hin zu Reaktionären,<br />
von hungrigen Bauern und Arbeitern bis<br />
hin zu hinterlistigen Geheimpolizisten und dem<br />
gestärkten und siegessicheren Militärapparat –<br />
alles, was man in Südosteuropa vor dem Attentat<br />
auf allen Seiten antreffen konnte, war auch<br />
im restlichen Europa vorhanden. Dass sich am<br />
blutigen Ereignis in Sarajevo der Erste Weltkrieg<br />
entzünden konnte, ist ein Zeichen dafür, dass in<br />
Südosteuropa bestimmte Kräfteverschiebungen<br />
genauso wirksam waren wie in den anderen Teilen<br />
Europas.<br />
Als 1928 im Parlament des Königreichs der<br />
Serben, Kroaten und Slowenen ein serbischmontenegrinischer<br />
Nationalist tödliche Schüsse<br />
auf die kroatischen Delegierten abfeuerte,<br />
gehörten diese zu den ersten Vorzeichen eines<br />
neuen europäischen Unheils, die sich nur noch<br />
verstärkten, als kroatische und mazedonische<br />
Faschisten 1934 im Hafen von Marseille den<br />
serbischen (inzwischen jugoslawischen) König<br />
ermordeten. Der Idee einer homogenen staatstragenden<br />
Nation standen die Ideen der Selbstbestimmung<br />
kleinerer Völker bzw. der Überwindung<br />
jeder Nationalität im Namen der Solidarität<br />
der Klassen gegenüber; dem Erstarken des<br />
Militärs und des Staatsapparats standen Rufe<br />
nach mehr sozialer und individueller Gerechtigkeit<br />
entgegen. Diverse biologistische, aggressivmodernistische,<br />
militaristische und umstürzlerische<br />
Vorstellungen begleiteten diese Ideen.<br />
Auch dieses Wirrwarr aus Mythen, Vorurteilen,<br />
Bestrebungen, Plänen und mehr oder weniger<br />
dringenden Anliegen der politischen und zivilgesellschaftlichen<br />
Akteure aus dem Süden Europas<br />
waren nicht so ungewöhnlich und entsprachen<br />
jenen im restlichen Europa.<br />
Die verächtliche Bezeichnung des Balkans<br />
als ewiges Pulverfass ist deshalb unserer Meinung<br />
nach eine Projektion. Die Balkanregion<br />
ist eigentlich eine durch und durch europäische<br />
Region, mit dem restlichen Europa untrennbar<br />
verbunden. Sogar die Kriege im ehemaligen Jugoslawien<br />
der Neunziger – im Zuge des Zusammenbruchs<br />
des Sozialismus ausgelöst – lagen<br />
nicht derart außerhalb des europäischen geistigen<br />
Horizonts, wie man sie gemeinhin darstellt.<br />
Aufgebaut auf bestimmten – schon wieder allgemein<br />
europäischen – Widersprüchlichkeiten,<br />
war das Land besonders anfällig, als die großen<br />
Blöcke verschwanden und das Korsett der sozialistischen<br />
Staatsordnung entfiel. Auch der<br />
Gedanke, dass vermeintlich „reine“ Nationen<br />
bzw. Staatsgebilde, in denen alle Vertreter eines<br />
Volkes zusammenleben, einzig mögliche Träger<br />
einer stabilen staatlichen Ordnung sein können,<br />
ist ein gefährlicher und anachronistischer,<br />
aber durchaus europäischer Gedanke. Dieser<br />
schien in den Neunzigern im restlichen Europa<br />
zwar tatsächlich überwunden zu sein, doch in<br />
den letzten Jahren stellt man sich zunehmend<br />
die Frage, ob hier nicht der Schein trog. Die Geschehnisse<br />
in den Neunzigern auf dem Balkan<br />
wirken angesichts der aktuellen Stärkung xenophober<br />
Tendenzen in vielen Teilen Europas<br />
nicht mehr so exklusiv.<br />
Doch es gibt auch positive Botschaften aus<br />
dem Süden Europas, und unsere Zeitung ist<br />
nicht die einzige davon. Es ist eine Binsenweisheit,<br />
dass nur Konzerne und Wirtschaftsmonopole<br />
ausdrücklich übernational sind: Auch sie<br />
werden von den mächtigsten Nationen Europas<br />
bestimmt. Die Dominanz dieser globalen wirtschaftlichen<br />
Kräfte hat sich vor allem in den<br />
postsozialistischen Gesellschaften als verheerend<br />
gezeigt, da dort die korrupten Eliten sehr<br />
wenig für den Schutz der heimischen Produktion<br />
unternahmen und ihre Länder sehr schnell<br />
in Kolonien eines neuen Typus umwandelten.<br />
Diese Eliten verschanzten sich hinter dem Nationalismus<br />
und schürten Ängste und Missverständnisse,<br />
während sie sich gleichzeitig maßlos<br />
bereicherten.<br />
Die Unhaltbarkeit eines nationalistischen<br />
Denkens angesichts der sozialen Probleme, die<br />
unter einer derartigen Dominanz entstehen,<br />
wurde in den letzten Wochen ausgerechnet in<br />
Bosnien und Herzegowina wieder deutlich. In<br />
dem Land, in dem vor hundert Jahren Thronfolger<br />
Ferdinand erschossen wurde und das<br />
durch ein ethnisch definiertes Friedensabkommen<br />
seit zwanzig Jahren zwar befriedet, aber<br />
vollständig gelähmt ist, regen sich nun lautstark<br />
Stimmen, die diese unmögliche Situation<br />
ändern wollen. Die Bürgerinnen und Bürger<br />
des vom Krieg schwer traumatisierten Landes<br />
haben den Mut aufgebracht, sich gegen die eigenen<br />
Eliten zu wehren, die sich unter dem Deckmantel<br />
des Interessensschutzes der jeweiligen<br />
Ethnie bereichert haben, ohne irgendetwas für<br />
die wirtschaftliche Perspektive des gesamten<br />
Landes und das Wohl aller Bürger zu tun. Dass<br />
sie nicht darauf warten, dass EU oder UN eine<br />
rettende Entscheidung über ihre Köpfe hinweg<br />
treffen, sondern das Schicksal selbst in die<br />
Hand nehmen, direkte Demokratie in Form von<br />
Plenen umsetzen, sich über soziale Netzwerke<br />
verständigen und in Kategorien jenseits der<br />
veralteten nationalistischen Staatsentwürfe<br />
denken, all das kann einem naiv und zum Scheitern<br />
verurteilt vorkommen.<br />
Aber warum nicht hoffen, dass hundert Jahre<br />
nach dem Attentat von Sarajevo aus dieser<br />
Stadt ein ganz neues Signal kommen kann: dass<br />
eine friedliche Welt möglich ist, dass zwischen<br />
Menschen, die zufällig aus verschiedenen Ethnien<br />
und Religionsgemeinschaften stammen,<br />
eine produktive Zusammenarbeit sowie Toleranz<br />
und gegenseitiger Respekt möglich sind<br />
– und dass die Allianz zwischen einheimischen<br />
und ausländischen Profiteuren entlarvt werden<br />
muss, damit es zu einer gerechteren Verteilung<br />
der Ressourcen, der Arbeit und der Gewinne<br />
kommt Zumindest in unserer Zeitung ist<br />
es möglich, dass der Text des Enkels von Ivan<br />
Kranjčević, einem Mitglied der Verschwörergruppe<br />
aus Sarajevo, die 1914 das Attentat<br />
verübt hat, neben dem eines Verwandten der<br />
ermordeten Sophie Gräfin Chotek von Chotkowa<br />
und Wognin, Herzogin von Hohenberg<br />
veröffentlicht wird. Und dass Texte serbischer,<br />
kroatischer, bosniakischer (bosnisch-muslimischer),<br />
montenegrinischer, slowenischer, mazedonischer<br />
und kosovarischer AutorInnen neben<br />
welchen aus Österreich und Ungarn stehen,<br />
wobei nicht die Herkunft der Autoren, sondern<br />
nur ihre Phantasie und ihre Gedanken zählen.<br />
Alida Bremer<br />
Geboren 1959 in Split / Kroatien. Literarische<br />
Übersetzungen aus dem Kroatischen, Serbischen<br />
und Bosnischen. Freie Mitarbeiterin<br />
der S. Fischer Stiftung (Projekt TRADUKI). In<br />
ihrem Roman Olivas Garten (Eichborn Verlag<br />
2013) beschreibt sie das Leben von fünf Frauengenerationen<br />
ihrer Familie, wobei ein Panorama<br />
der kroatischen Geschichte der letzten<br />
hundert Jahre entsteht.<br />
Beton International März 2014 2
Selvedin Avdić<br />
Die kleine<br />
Taschenbibliothek des<br />
Attentäters<br />
William Morris: Kunde von Nirgendwo<br />
Ein Exemplar mit den Unterschriften von<br />
Princip und Čabrinović ist erhalten. Sie lasen<br />
es 1912 und kennzeichneten Stellen, die ihnen<br />
besonders gefielen.<br />
Princip unterstrich: „weil wir Zentralisierung<br />
vermeiden“, und Čabrinović: „… über das<br />
fehlende Interesse der Arbeiter in der kommunistischen<br />
Gesellschaft“.<br />
Svetozar Marković: Srpske obmane<br />
(Serbische Täuschungen)<br />
Wenn es um Bücher gehe, verstehe er keinen<br />
Spaß, sagte Gavrilo Princip zu seinem Arzt<br />
Dr. Morris Pappenheim, als er in Zimmer 33 der<br />
geschlossenen Abteilung des Krankenhauses in<br />
Theresienstadt lag:<br />
„Ständig in Bibliotheken, allein und einsam<br />
… Bücher sind mein Leben. Deshalb ist es jetzt<br />
ohne Lesen so schwer …“<br />
Nedeljko Čabrinović stellte für seine Kollegen,<br />
andere Druckereilehrlinge, eine Liste mit<br />
Büchern zusammen, die sie lesen müssten, „um<br />
in den Worten der Popen Wahrheit und Lüge<br />
unterscheiden zu können“. Diese Liste umfasst<br />
26 Titel und ist bis heute erhalten, darunter<br />
auch: Prvi maj 1907 (Der erste Mai 1907); Program<br />
i organizacija socijaldemokratske stranke<br />
u Hrvatskoj (Programm und Organisation der<br />
sozialdemokratischen Partei in Kroatien); Das<br />
kommunistische Manifest; Proleterijat i klasna<br />
borba (Proletariat und Klassenkampf ); Kako<br />
buržoazija nova pljačka radnike (Wie die neue<br />
Bourgeoisie die Arbeiter ausbeutet); Ispovijed<br />
pape Aleksandra II Bordžije (Die Bekenntnisse<br />
des Papstes Alexander II. Borgia) …<br />
Danilo Ilić übersetzte buchstäblich bis zum<br />
Tag des Attentats Bücher. In der letzten Nacht<br />
beendete er die Übersetzung eines Buches von<br />
Oscar Wilde. Er übersetzte auch Kierkegaard,<br />
Strindberg, Ibsen, Edgar Allan Poe…<br />
***<br />
Jeder Jungbosnier wollte Dichter werden.<br />
Princip hatte zwar nur wenig Talent, schrieb aber<br />
beharrlich, um besser zu werden. Bei zwei Gelegenheiten<br />
zeigte er Freunden seine Verse, das<br />
ist belegt. Beim ersten Mal las er Dragutin Mras<br />
ein Gedicht vor, das von Rosen handelte, die am<br />
Meeresgrund für das geliebte Mädchen blühen.<br />
Mras gefiel das Gedicht nicht. Beim anderen Mal<br />
erzählte Princip Ivo Andrić von seinen Gedichten.<br />
Er versprach, sie ihm zu zeigen, was er aber<br />
nie tat. Als Andrić ihn danach fragte, antwortete<br />
er, er habe sie vernichtet. Der einzige vollständig<br />
erhaltene lyrische Text Princips stammt aus dem<br />
Jahr 1911 und steht im Gästebuch der Bergsteigerhütte<br />
auf dem Berg Bjelašnica.<br />
1911 war auch das Jahr, das Princip gegenüber<br />
Dr. Pappenheim als kritisches Jahr in seinem<br />
Leben beschrieb. Damals entwickelten sich<br />
seine „Ideale über das Leben“ und er schloss<br />
sich der Organisation „Junges Bosnien“ an. In<br />
diesem Jahr verliebte er sich auch. Seine letzten<br />
Zeilen schrieb er einige Tage vor seinem Tod an<br />
eine Wand, er schrieb über Schatten, vor denen<br />
die feine Gesellschaft bei Hofe sich fürchtete.<br />
Mangel an Mitteilsamkeit hatte den über das<br />
allgemein Menschliche hinausgehenden Eindruck,<br />
den er auf mich machte, noch gesteigert,<br />
und er erschien mir manchmal als einsamer<br />
Fels im Meer, als Verstandesmensch ohne Herz,<br />
ebenso bar menschlicher Sympathie wie hervorragend<br />
durch seine Intelligenz.“<br />
Nikolaj Černiševski:<br />
Was getan werden muss<br />
Nedeljko Čabrinović war 14 Jahre alt, als er<br />
das Buch Was getan werden muss las. Sein Vater<br />
Vaso erwischte ihn bei der Lektüre, gab ihm<br />
eine Ohrfeige und schraubte die Glühbirne aus<br />
der Fassung.<br />
Černiševski hatte den Roman 1862 im Gefängnis<br />
geschrieben, während er auf sein Verfahren<br />
wegen der Anklage auf revolutionäre Umtriebe<br />
wartete. Er schrieb über die Bildung einer<br />
gerechteren Gesellschaft durch Familienbetriebe.<br />
Als er das Manuskript beendet hatte, wurde<br />
er verurteilt und nach Sibirien deportiert.<br />
Guy De Maupassant: Mont-Oriol<br />
Als Major Vasić von der „Narodna odbrana“<br />
(„Volkswehr“) Čabrinović im Park traf und in<br />
dessen Tasche dieses Buch sah, war er sehr<br />
enttäuscht. Er bevorzugte serbische Volksdichtung<br />
und schenkte Čabrinović eine Sammlung<br />
mit Heldenliedern, eine gebundene Ausgabe,<br />
die wie für einen Soldaten gemacht war,<br />
weil sie in der Brusttasche seines Hemdes eine<br />
Kugel abfangen und dem Mann das Leben retten<br />
konnte.<br />
Trifko Grabež und Gavrilo Princip wollten<br />
Čabrinović nicht mitnehmen, als sie Voja<br />
Tankosić, ein Mitglied der „Schwarzen Hand“,<br />
besuchten, weil Nedeljko ständig lächelte („das<br />
ist mein ganz normaler Gesichtsausdruck“, verteidigte<br />
er sich vergeblich). Der arrogante Komita<br />
Tankosić mochte keine lächelnden Menschen.<br />
Er glaubte, dass sie hinter der freundlichen<br />
Miene etwas versteckten. In Gesellschaft<br />
von Fanatikern fühlte er sich wohl. Den Jungbosniern<br />
schenkte er Pistolen und Bomben und<br />
gab ihnen Taschengeld für die Reise.<br />
Jules Payot: Die Erziehung des Willens<br />
Die Erziehung des Willens las Čabrinović<br />
1912 im Gefängnis in Trebinje, wo er drei Tage<br />
verbrachte, weil man ihn verdächtigte, Streiks<br />
der Druckereiarbeiter organisiert, Maschinen<br />
zerstört und Streikbrecher angegriffen zu haben.<br />
Ob nun wegen der Erziehung des Willens<br />
oder weil Čabrinović stärker geworden war, auf<br />
jeden Fall wurde er von da an nie wieder von seinem<br />
Vater geschlagen.<br />
Nedeljko wurde erwachsen und Herr seines<br />
eigenen Lebens. Und seines Todes natürlich,<br />
wie das eben so ist. Im Prozess sagte er:<br />
„Ich will meinem Vater nicht die Schuld geben,<br />
aber wäre die Pädagogik besser gewesen,<br />
würde ich nicht auf dieser Bank hier sitzen.”<br />
Die Jungbosnier teilten Markovićs Haltung,<br />
man könne die Gesellschaft durch das Wirken<br />
moralisch starker Einzelner mit sozialem Bewusstsein<br />
verändern, ihr Beispiel könne dazu<br />
beitragen, einen neuen, besseren Typ Mensch<br />
hervorzubringen.<br />
Vladimir Gaćinović versuchte, in Paris<br />
Trotzki davon zu überzeugen, dass alle Jungbosnier<br />
ein moralisches und bescheidenes<br />
Leben anstrebten, dass sie alle der Reihe nach<br />
revolutionäre Asketen und Puritaner seien. Er<br />
versuchte Trotzki zu überzeugen, in seiner Organisation<br />
herrsche das Prinzip ausnahmsloser<br />
Abstinenz von der Liebe.<br />
Im Fall von Princip stimmte das. Im Gefängnis<br />
gestand er Dr. Pappenheim, das er nie eine<br />
sexuelle Beziehung gehabt hatte. Er trug einen<br />
Gefängniskittel aus grobem Stoff und ohne<br />
Knöpfe. Mit seiner gesunden Hand versuchte<br />
er, ihn vorne zuzuhalten.<br />
Oscar Wilde: Der glückliche Prinz<br />
Einmal traf Princip Čabrinovićs Schwester<br />
Vukosava bei der Lektüre des Schundromans<br />
Die Geheimnisse des Hofes von Konstantinopel<br />
an. Er kritisierte ihren literarischen Geschmack<br />
und brachte ihr Geschichten von Oscar Wilde<br />
mit. Jahre später beschrieb Vukosava Princip<br />
als zurückhaltenden Knaben, manchmal geistreich,<br />
sogar sarkastisch, mit tiefliegenden Augen,<br />
schönen Zähnen und sehr hoher Stirn. Leo<br />
Pfeffer, Richter in Sarajevo, sah ihn kurz nach<br />
der Verhaftung und beschrieb ihn so:<br />
„Der junge Mann war klein, schwächlich,<br />
mit langem, gelblich bleichem Gesicht, man<br />
konnte sich nur schwer vorstellen, wie er, so<br />
klein wie er war, so still und bescheiden, sich<br />
zu einem solchen Attentat hatte entschließen<br />
können.“<br />
Milutin Uskoković: Došljaci<br />
(Die Zugezogenen)<br />
Neben Wilde borgte Princip Vukosava<br />
auch Uskokovićs Roman Došljaci. Warum hätte<br />
Uskoković der jungen Frau gefallen sollen<br />
Wäre ein Gedichtband vielleicht passender gewesen<br />
Milutin Uskoković sprang am 15. Oktober<br />
1915 in den Fluss Toplica und ertrank. Seine<br />
Freunde sahen den Grund im „Untergang des<br />
Vaterlands“.<br />
Oscar Wilde: Kunst als Kritik<br />
Danilo Ilić übersetzte dieses Buch im Jahr<br />
1913, zu einer Zeit, als er intensiv mit den Vorbereitungen<br />
des Attentats beschäftigt war. Kurz<br />
vor der Tat überlegte er es sich anders.<br />
Bis zum letzten Tag versuchte er Princip<br />
und Grabež zu überzeugen, den Plan vom Attentat<br />
aufzugeben. Seine Versuche waren, wie<br />
wir wissen, vergeblich.<br />
***<br />
Die Bücher aus der Taschenbibliothek des<br />
Attentäters fand ich verteilt auf den Seiten des<br />
zweibändigen Buches Sarajevo 1914 (Prosveta,<br />
Beograd, 1978) von Vladimir Dedijer. Soweit<br />
mir bekannt ist, sind diese Bücher bis jetzt nie<br />
an einem Ort zusammengestellt worden.<br />
Ein Buch aus der Bibliothek hallte, auswendig<br />
gelernt, jahrelang im Kopf eines Attentäters<br />
wieder. Es ist immer gefährlich, wenn ein Buch<br />
im Kopf nachhallt. Leider kommt das auch<br />
heutzutage häufig vor.<br />
***<br />
In die Taschenbibliothek des Attentäters<br />
sortierte ich folgende Bücher ein:<br />
Arthur Conan Doyle:<br />
Die Abenteuer des Sherlock Holmes<br />
Sima Pandurović:<br />
Dani i noći (Tage und Nächte)<br />
An Pandurovićs Poesie schätzte Princip<br />
am meisten den Pessimismus. Jovan Skerlić<br />
schrieb, zu der Zeit habe Pessimismus die ganze<br />
serbische Literatur „überflutet“: „Nie wurden<br />
so viele Friedhöfe besungen, nie schien das Nirvana<br />
ein so strahlendes Ideal wie in diesen düsteren,<br />
traurigen Zeiten.“<br />
Henrik Ibsen: Catilina<br />
Henrik Ibsen sah im permanenten Aufstand<br />
das oberste Gesetz des Lebens:<br />
Und ist das Leben nicht steter Kampf<br />
feindlicher Mächte in unserer Seele<br />
Und ist nicht dieser Kampf das einzige Leben<br />
dieser gleichen Seele<br />
Friedrich Schiller: Wilhelm Tell<br />
Gavrilo Princip las gerne Abenteuerromane,<br />
Alexandre Dumas, Walter Scott und besonders<br />
die Abenteuer von Sherlock Holmes.<br />
Bestimmt hat er diese Passage gelesen, in<br />
der Watson seinen Freund beschreibt: „Dieser<br />
Dieses Stück las Bogdan Žerajić wie ein Besessener,<br />
während er das Attentat auf General<br />
Marijan Varešanin vorbereitete. Er gab fünf<br />
Schüsse auf den Gouverneur ab, mit dem sechsten<br />
tötete er sich selbst. In seiner Hosentasche<br />
Beton International März 2014 3
fand die Polizei ein Notizbuch voller Zitate aus<br />
Wilhelm Tell.<br />
Im Gefängnis behauptete Princip, er habe<br />
bereits 1912 an Žerajićs Grab Rache geschworen.<br />
In der Nacht vor dem Attentat klaute er<br />
Blumen von anderen Gräbern und legte sie auf<br />
Žerajićs Grab.<br />
Peter Kropotkin: Die französische<br />
Revolution<br />
Bei Žerajić fand die Polizei neben seinem<br />
Notizbuch eine Anstecknadel, die der Inspektor<br />
in seinem Bericht so beschrieb:<br />
„… sie besteht aus einem roten kreisförmigen<br />
Stück Karton mit einem Durchmesser von 10 cm<br />
und einem ebenfalls roten erhöhten Rand und<br />
zeigt das Porträt eines Mannes mit Haaren und<br />
ohne Bart; sein Gesicht ist schrecklich schief, der<br />
Mund geöffnet und das Haar zerzaust.“<br />
Dem Leichnam Bogdan Žerajićs ließ die<br />
Polizei den Kopf abtrennen und beerdigte den<br />
Rest auf dem Teil des Sarajevoer Friedhofs, der<br />
Selbstmördern und Obdachlosen vorbehalten<br />
war. Sein Kopf wurde im Kriminalmuseum<br />
ausgestellt. Zu der Zeit war die Theorie des Kriminologen<br />
Lombroso populär, nach der Kriminelle<br />
einen speziellen Schädeldefekt aufweisen,<br />
und die Polizei glaubte, Žerajićs Kopf könnte<br />
der Wissenschaft nützen und die Öffentlichkeit<br />
interessieren. Nach dem Fall der Habsburger<br />
Monarchie wurde auch der Kopf in Žerajićs<br />
Grab gelegt.<br />
Sergej Stepnjak: Podzemna Rusija<br />
(Russischer Untergrund)<br />
Kritiker heben an Podzemna Rusija gewöhnlich<br />
die Wärme und Zuneigung hervor,<br />
mit der Stepnjak von seinen Freunden und Mitkämpfern<br />
spricht.<br />
Grabež und Princip waren bis zum letzten<br />
Tag der Meinung, Čabrinović sei nicht dazu fähig,<br />
das Attentat auszuführen. Grabež hielt ihn<br />
für leichtgläubig; er neige dazu, „in jedem Menschen<br />
einen Freund zu sehen“. Gegenüber Dr.<br />
Pappenheim beschrieb Princip ihn als „Wortklauber“<br />
von geringer Intelligenz. Danilo Ilić<br />
sagte einmal, Čabrinović habe die Bombe nur<br />
geworfen, um das Vertrauen seiner Freunde zurückzugewinnen.<br />
In der Nacht vor dem Attentat las Nedeljko<br />
Čabrinović zum wiederholten Mal Podzemna<br />
Rusija. Am Morgen steckte er das Buch neben<br />
den Bomben in seine Tasche und ging zur verabredeten<br />
Stelle an der Miljacka.<br />
Jasija Torunda:<br />
Kada se zemljaci sretnu i druge priče<br />
(Wenn sich Landsleute treffen und andere<br />
Geschichten)<br />
An den Rändern dieses Buches notierte Princip:<br />
„Was dein Feind nicht wissen darf, das verrate<br />
keinem Freund. Wenn ich über das Geheimnis<br />
schweige, wird es zu meinem Sklaven. Wenn ich<br />
es verrate, werde ich zu seinem Sklaven.“<br />
Leonid Andrejev: Priča o sedam obješenih<br />
(Die Geschichte von den sieben Gehängten)<br />
Andrejev schreibt über die Hinrichtung von<br />
zwei Kriminellen und fünf politischen Häftlingen,<br />
wie sie mit dem Tod umgehen, was sie<br />
durchleben und was sie kurz vor der Hinrichtung<br />
empfinden. Bevor Danilo Ilić hingerichtet<br />
wurde, schrieb er drei Briefe an seine Mutter. In<br />
zwei Briefen bat er sie um neue Kleidung, was er<br />
im dritten schrieb, werden wir nie erfahren. Die<br />
Ermittler fanden ihn im Haus von Ilićs Mutter<br />
und zerrissen ihn.<br />
Er wurde zusammen mit Miška Jovanović<br />
und Veljko Čubrilović am 3. Februar 1915 gehängt.<br />
Der Henker Alois Seyfried erzählte später<br />
in Interviews, sie seien an der Hinrichtungsstätte<br />
ungewöhnlich ruhig gewesen. Er wisse<br />
nicht mehr genau, welcher von den dreien zu<br />
ihm gesagt habe:<br />
„Ich bitte Sie nur, mich nicht lange zu quälen.“<br />
Der Henker habe geantwortet:<br />
„Keine Sorge, ich bin sehr erfahren in meinem<br />
Beruf, es wird nicht mal eine Sekunde dauern.“<br />
Petar Kropotkin: Zapisi revolucionara<br />
(Aufzeichnungen eines Revolutionärs)<br />
In der Nacht vor dem Attentat saß Princip<br />
in Gesellschaft bis nachts um elf in der Kneipe.<br />
Aus der Kneipe ging er dann auf den Friedhof an<br />
Žerajićs Grab, streifte danach durch die Stadt<br />
und ging schließlich nach Hause. Weil er nicht<br />
müde war, verbrachte er den Rest der Nacht mit<br />
diesem Buch.<br />
Kropotkin war einer der Lieblingsautoren der<br />
Jungbosnier. In seinem Buch Anarchismus und<br />
Moral schreibt er: „Zum Teufel mit dem ‚blauen<br />
Blut‘, das sich das Recht nimmt, Menschen, die<br />
sich nahe stehen und vertrauen, gegeneinander<br />
auszuspielen! Wir wollen es nicht und werden es<br />
bei jeder Gelegenheit vernichten.“<br />
Milan Rakić: Pjesme (Gedichte)<br />
In schweren Zeiten, und es gab selten andere,<br />
verkaufte Princip seine Bücher, um sich<br />
Lebensmittel kaufen zu können. Rakićs Gedichtband<br />
verkaufte er jedoch nie. Sein Lieblingsgedicht<br />
war „Na Gazimestanu“ (Auf dem<br />
Gazimestan), und darin die Strophe:<br />
Auch heute in der letzten Schlacht<br />
Ohne den verblassten alten Glanz,<br />
Werd ich für dich mein Leben geben, Vaterland,<br />
Im Wissen, was ich gebe und warum ich gebe.<br />
Im Gefängnis von Theresienstadt wurde<br />
Princip von der Tuberkulose aufgefressen. Auf<br />
seiner Brust eiterten Wunden und sein rechtes<br />
Ellbogengelenk war so porös, dass man Oberund<br />
Unterarm mit Silberdraht verbunden hatte.<br />
Er starb am 28. April 1918 um 18.30 Uhr.<br />
Petar Petrović Njegoš: Gorski vijenac<br />
(Der Bergkranz)<br />
Ein Buch, das sie alle beherrschte. Der<br />
Bergkranz ist das wichtigste Buch in dieser Bibliothek.<br />
Es konnte nicht gestohlen, verbrannt<br />
oder zerstört werden. Gavrilo Princip kannte es<br />
auswendig.<br />
Princip wuchs in einem Haus auf, das unterhalb<br />
des Dorfes Crni Potok stand, wo 1875<br />
die Aufständischen ihr größtes Lager hatten.<br />
Später eroberten es die Türken und töteten 150<br />
Aufständische.<br />
Als der dreizehnjährige Princip zum ersten<br />
Mal nach Sarajevo kam, floh er aus einem Gasthaus,<br />
weil ihn die Kleidung, die die Moslems damals<br />
trugen, erschreckte. Er schrie: „Türken!“<br />
und rannte hinaus. Es dauerte lange, bis er seine<br />
Angst abgelegt hatte. Während er sich eingewöhnte,<br />
lernte er den Bergkranz auswendig.<br />
Ja, der Wolf hat auf das Schaf sein Anrecht<br />
So wie der Tyrann auf schwache Menschen;<br />
Doch Tyrannen in den Nacken treten<br />
Sie zu zwingen zu des Rechts Erkenntnis,<br />
Ist des Menschen heiligste Verpflichtung!<br />
Ein natürliches Recht auf Mord.<br />
Tja …<br />
***<br />
Aus der Bibliothek können wir auf ihren Besitzer<br />
schließen. Zu welchem Zweck wurde die<br />
Taschenbibliothek des Attentäters, wie ich sie<br />
nenne, zusammengestellt<br />
In ihr sind, so will Dedijer uns glauben lassen,<br />
die wichtigsten Bücher der Attentäter enthalten.<br />
Bücher, die man in ihren Zimmern fand,<br />
die sie in Gesprächen erwähnten, an die sich<br />
ihre Freunde erinnern, in denen sie ganze Sätze<br />
unterstrichen und an deren Ränder sie Bemerkungen<br />
notierten.<br />
Doch es wäre unseriös, in der kleinen Bibliothek<br />
den Auslöser für Mord und Selbstmord<br />
zu sehen. Sie ist bescheiden, beinhaltet gerade<br />
mal 20 Titel. Sie würde in einen Rucksack passen<br />
und man könnte sie im Laufe eines Sommers<br />
lesen. Die Jungbosnier lasen viel, das wird<br />
vielerorts bezeugt, es können also nicht alle Titel<br />
sein. Wo sind die anderen Bücher<br />
Es scheint als hätten diese Bücher das<br />
Schicksal ihrer Besitzer geteilt. Jeder setzte<br />
sie, wie auch mit ihren Besitzern geschehen,<br />
für seine Zwecke ein, wie es ihm gerade gefiel<br />
– Tankosić, Apis, Pašić, die österreichischen<br />
Ermittler, Generäle und Politiker, Nationalisten,<br />
Romantiker, ein bisschen hier, ein bisschen<br />
dort… Am Ende waren sie verschwunden<br />
oder zu etwas geworden, was sie nie gewesen<br />
sind.<br />
Wie viele solcher Bücher gab es tatsächlich<br />
und wie sähe die Taschenbibliothek des Attentäters<br />
mit ihnen aus Wo sind Princips lyrische<br />
Gedichte über Rosen am Meeresgrund, die er<br />
Ivo Andrić versprochen hatte<br />
Das interessiert mich.<br />
Aus dem Bosnischen von<br />
Blanka Stipetić<br />
Selvedin Avdić<br />
Geboren 1969 in Zenica. Chef-Redakteur des<br />
Online-Magazins „Žurnal“. Er schreibt Erzählungen<br />
und Romane. Über seinen Roman<br />
Sedam strahova (Sieben Ängste; Titel der engl.<br />
Übersetzung Seven Terrors) schrieb unlängst<br />
ein „The Guardian“-Kritiker: “this remarkable<br />
debut illuminating the Bosnian war is like<br />
nothing I’ve ever read before”.<br />
Svetlana Slapšak<br />
Die Revolution<br />
der Frauen<br />
Ein vernachlässigter Aspekt<br />
des Ersten Weltkriegs<br />
Der Erste Weltkrieg hätte lediglich ein weiterer<br />
europäischer Erbfolgekrieg mit zivilen<br />
Kollateralschäden sein können – diese Kriege<br />
hatte es in Europa praktisch seit dem Mittelalter<br />
ohne Unterbrechung gegeben. Doch der<br />
Streit zwischen königlichen Verwandten hob<br />
sich dieses Mal durch ein unbekanntes Element<br />
hervor – Waffen, mittelbare und unmittelbare,<br />
die der brodelnde industrielle Kapitalismus<br />
für die Nationalstaaten produzierte, vor allem<br />
für Deutschland. Die ritterlichen und aufgestachelten<br />
europäischen Männer in Uniform<br />
(eine Minderheit widersetzte sich dem Kriegswahnsinn<br />
allerdings) waren mit Instrumenten<br />
der Massenvernichtung konfrontiert, deren<br />
tatsächliche Wirkung bis dahin nicht erforscht<br />
war: schwere Geschütze, Panzer und gepanzerte<br />
Fahrzeuge, Maschinengewehre, chemische<br />
Kampfstoffe, Flugzeuge, das Radio, die Telegraphie…<br />
Europäische Männerkörper wurden<br />
massenweise zerhackt und verunstaltet, der<br />
Krieg in den Schützengräben hatte keinen strategischen<br />
Nutzen und entwickelte sich zum<br />
Schlachthaus.<br />
Eine Entwicklung ist jedoch bis jetzt historisch<br />
nie analysiert und beschrieben, ja eigentlich<br />
nicht einmal bemerkt worden. Es kam zu<br />
einer revolutionären Veränderung der Stellung<br />
der Frau. Nur ein Aspekt dieser Entwicklung ist,<br />
dass Frauen nach dem Krieg in einigen europäischen<br />
Ländern das Wahlrecht bekamen. Ein<br />
entscheidender revolutionärer Umstand war<br />
die Veränderung des weiblichen Körpers und<br />
ihres Verhaltens. Beides hatte seine Ursache<br />
unmittelbar im Ersten Weltkrieg.<br />
Es war schnell klar, dass der Krieg an der<br />
Front und in den Schützengräben nicht ohne<br />
Frauen auskam – Krankenschwestern, Chauffeurinnen,<br />
Stenotypistinnen, Telefonistinnen,<br />
wie an der Front so auch im Hinterland. Die<br />
Kriegsindustrie verlangte nach Arbeitern, die<br />
aber gerade an der Front starben: Sie wurden<br />
durch Frauen ersetzt. Hunderttausende Frauen<br />
in Europa und auf anderen Kontinenten<br />
mussten ihre Körper und das, worin sich diese<br />
Körper bewegten, völlig neuen Bedingungen<br />
anpassen: Sie kürzten ihre Haare und kürzten<br />
ihre Röcke, zogen Hosen an, entledigten sich<br />
der beengenden Unterwäsche, zogen bequeme<br />
Schuhe an. Dem neuen Körper stellte die Industrie<br />
der Populärkultur den ganzen Schönheitsapparat<br />
aus der neuesten und populärsten<br />
Kunst an die Seite – aus dem Film: starke<br />
Schminke, verführerische Stoffe, Tänze, die den<br />
Körper betonten. So eröffneten sich den Frauen<br />
neue Räume für den Ausdruck ihrer Wünsche,<br />
und so reihten sie sich folgerichtig in die Masse<br />
der Verbraucher ein: Ihnen wurde suggeriert,<br />
dass das Angebot ihre Bedürfnisse befriedige.<br />
Außerdem wurden Frauen schnell und uneinholbar,<br />
Sportlerinnen, Rennfahrerinnen, Pilotinnen:<br />
Sie einzufangen war im wörtlichen<br />
wie auch im übertragenen Sinn nicht mehr so<br />
leicht.<br />
Als der Mann verunstaltet, verkrüppelt und<br />
häufig impotent aus dem Krieg zurückkehrte,<br />
erwartete ihn eine neue Frau, die überlebt<br />
hatte und nicht nur selbständig war, sondern<br />
auch egoistisch, wie sie es von ihrem stärksten<br />
Verbündeten, dem Kapital, gelernt hatte. In<br />
der mitteleuropäischen Literatur, besonders<br />
der serbischen und kroatischen, findet man erschreckende<br />
Zeugnisse traumatisierter Männer<br />
– sie, die „Hündin“, hatte überlebt und weiß Gott<br />
was getrieben, während er an der Front gelitten<br />
hatte. Das einzige, was er tun konnte, war – sie zu<br />
bestrafen. In Serbien war ein Drittel der Männer<br />
im Krieg umgekommen, da kann man vielleicht<br />
Verständnis aufbringen, doch nur als Grundlage<br />
für eine neue bürgerliche Bildung. Wohin ist<br />
die allmächtige expressionistische Göttin verschwunden<br />
Hass und offene Misogynie betreffen<br />
vor allem urbane Frauen.<br />
Das kapitalistische und das kommunistische<br />
System unterschieden sich beim Thema<br />
Frau, was in den Medien und der Kultur am offensichtlichsten<br />
wurde: Die kommunistische<br />
Ideologie durfte nicht riskieren, ihre größte<br />
Unterstützergruppe zu verlieren, die Frauen,<br />
die man durch eine Erweiterung ihrer Rechte<br />
und eine neue gesellschaftliche Anerkennung<br />
gewonnen hatte, und der Kapitalismus konnte<br />
es nicht riskieren, seine neuen Konsumentinnen<br />
zu verlieren. So trafen „weiblich“ und „unweiblich“<br />
in einem verlogenen und berechnenden<br />
Widerstreit und als „Dilemma“ der Frauen<br />
zum ersten Mal aufeinander. Diese unnatürliche<br />
Verbindung verwirrt auch heute noch viele<br />
Beton International März 2014 4
Frauen, denn sie erkennen nicht die Nutznießer<br />
hinter Forderungen, die ihnen die kostbarste<br />
Zeit und Lebensfreude rauben.<br />
Auch ohne Blick auf diese Extreme und Abschweifungen<br />
wurden weiblicher Körper und<br />
weibliches Verhalten nach dem Ersten Weltkrieg<br />
nie wieder wie früher. Versuche, den weiblichen<br />
Körper nach dem Zweiten Weltkrieg wieder<br />
zu disziplinieren – wie zum Beispiel durch<br />
Diors „A-Linie“, durch Korsetts, steife Stoffe<br />
und Reifröcke – hatten nur teilweise und nicht<br />
auf der ganzen Welt Erfolg. Als die patriarchale<br />
Struktur nach dem Zweiten Weltkrieg die<br />
grundlegenden Errungenschaften der Frauenrechte,<br />
auch aus der Zeit vor und während<br />
des Ersten Weltkriegs, offensichtlich zunichte<br />
machte, schrieb Simone de Beauvoir einen verzweifelten<br />
Aufschrei des Feminismus, Das andere<br />
Geschlecht (1949).<br />
Die vielleicht interessanteste „Ikone“ der<br />
populären Kultur ist der Vamp. In ihm spiegeln<br />
sich Ambivalenz und Verwirrung angesichts des<br />
neuen Frauenkörpers und der neuen Stellung<br />
der Frau in der Gesellschaft wider. Gleichzeitig<br />
jedoch enthält diese Ikone Spuren unterschiedlicher<br />
Strategien, ritueller Narrationen und des<br />
Bedürfnisses, eine solche Frau für den Diskurs<br />
zu nutzen: Der Vamp entspringt dem Film, dem<br />
globalen Medium, das bis heute Verhaltensmodelle<br />
formt.<br />
Der Begriff „Vamp“ ist ein Produkt der<br />
Massenkultur des 20. Jahrhunderts, eine Abkürzung<br />
für „Vampir“, im Übrigen eines der<br />
wenigen Wörter serbokroatischen Ursprungs,<br />
das man in französischen, englischen oder<br />
deutschen Sätzen hört. Die Popularität dieser<br />
Art Phantasiefrau steht in Verbindung mit<br />
dem Trauma des Ersten Weltkriegs: Die Frau<br />
blieb hinter der Front und wartete auf den geschwächten,<br />
verkrüppelten und verängstigten<br />
Mann, fordernd und voller neuer Ideen über<br />
ihre Rechte, mehr an sexuellen Erfahrungen<br />
als an einer monogamen Beziehung interessiert.<br />
Die Angst der Männer vor der Untreue<br />
ihrer Frauen und alle Kastrationsphobien konzentrierten<br />
sich im bedrohlichen Bild einer<br />
Frau, die selbst über ihr Vergnügen bestimmt.<br />
Doch Phantasien lassen immer mehrere Deutungen<br />
zu: Das Bild des Vamps diente auch zur<br />
Disziplinierung der Frauen, als Negativbeispiel,<br />
als drohende Strafe für Regelbruch. In<br />
allen Filmen, Romanen, Comics und Feuilletons<br />
ergeht es den Vamps schlecht, unabhängig<br />
davon, wie viele Männer und Frauen sie in<br />
ihren unheilvollen Liebesabenteuern vernichten.<br />
Während des Zweiten Weltkriegs erfand<br />
man für die amerikanischen Soldaten und<br />
Männer eine vereinfachte Form des Vamps<br />
– das Pin-up-Girl, eine Fotofrau, die man an<br />
die Wand hängen kann: Betty Grable und Rita<br />
Hayworth. Zeitweise leidet das Pin-up-Girl an<br />
der eigenen Attraktivität, doch es ist nicht provokativ<br />
wie der Vamp und erwartet auch keine<br />
umfangreichen Liebeserfahrungen. Seine<br />
Weiblichkeit „geschieht“ ihm, es missbraucht<br />
sie nicht wie der Vamp. Anders gesagt, nach<br />
ungefähr zwanzig Jahren hatte die Zensur den<br />
Vamp eingeholt und jegliches Entwicklungspotential<br />
dieser Figur ausgelöscht.<br />
Wenn man sich mit der Emanzipation der<br />
Frau beschäftigt, darf man den Anteil der Massenkultur<br />
an diesem Prozess nicht vernachlässigen,<br />
die Schlüsselfunktion von Bildern,<br />
Symbolen, narrativen Einheiten, Erfolgsgeschichten,<br />
kurz gesagt die Mythologie einer<br />
bestimmten Zeit und eines bestimmten Ortes.<br />
In der westlichen fortschrittlichen Welt<br />
entdecken Historiker erst jetzt, wie sehr die<br />
Emanzipation durch den Ersten Weltkrieg beschleunigt<br />
und durch den Zweiten Weltkrieg<br />
gebremst wurde – ein Prozess, der in den Ländern<br />
Mitteleuropas unterschiedlich verlief,<br />
von den außereuropäischen Ländern gar nicht<br />
zu sprechen.<br />
Doch trotz der offensichtlichen Unterschiede<br />
sind auf der Weltkarte der Vamps einige<br />
Eigenschaften in allen Kulturen gleich:<br />
Der Vamp entspricht dem Bild einer Welt, in<br />
der die Geschlechter einander unversöhnlich<br />
gegenüberstehen und in der der ständige Konflikt<br />
immer wieder von Neuem die Macht des<br />
Mannes sichert. Ohne Herausforderung wäre<br />
diese Macht langweilig, deshalb wird hier ein<br />
Raum der „Ungewissheit“ umrissen, den der<br />
Vamp symbolisiert. Anders gesagt dient die<br />
Vampfrau einer weiteren absehbaren männlichen<br />
Strategie. Eine starke Männerhand ist<br />
auch deshalb erforderlich, weil Frauen ohne<br />
Kontrolle zum Vamp werden könnten und<br />
dann Männern zur Unterhaltung dienen würden.<br />
Die Möglichkeit, dass ein Mann einem<br />
Vamp „verfällt“, ist nicht weniger attraktiv als<br />
andere Verführungstechniken. In den meisten<br />
Geschichten über Vamps kann sich der<br />
Mann „retten“. Seine Sexualität wird dadurch<br />
nur bestätigt und gestärkt, während die der<br />
Frau bei intensivem Einsatz „geschwächt“<br />
wird. Tatsächlich ist es nahezu umgekehrt.<br />
Deshalb kann man die sinkende männliche<br />
Selbstsicherheit an der Veränderung des Bildes<br />
von Phantasiefrauen beobachten. Nach<br />
der Vampfrau, die über emanzipatorische Energie<br />
verfügte, und dem passiven Pin-up-Girl<br />
kam in Filmen und Populärkultur die Variante<br />
der Verführerin der 60er und 70er Jahre, die<br />
„Nymphe“, eine übertrieben junge, aber sexuell<br />
verführerische Kindfrau. Diese Tendenz<br />
zur Infantilisierung weiblicher Sexualität setzt<br />
sich bis heute fort. Daraus entwickelte sich<br />
auch ein interessanter Strang: Im amerikanischen<br />
Film als dem kulturellen Ursprungsraum<br />
des Vamps entstand durch Parodie der<br />
Vamp-Filme die Gestalt einer selbständigen,<br />
klugen und ein wenig übergeschnappten Frau<br />
in den Komödien der dreißiger Jahre (screwball<br />
comedy) - eine moderne Protagonistin, die<br />
in der Zeit der Wirtschaftskrise den erniedrigten<br />
und verunsicherten Mann rettet.<br />
Das hundertjährige Jubiläum des Ersten<br />
Weltkriegs müsste diesen Kanal öffnen und uns<br />
mit allzu lange verborgenen und vernachlässigten<br />
Informationen aus der Geschichte der<br />
Frauen versorgen. Ich fürchte allerdings, dass<br />
viele Hundertjahrfeiern sich darauf beschränken<br />
werden, Orden um Denkmäler, Friedhöfe<br />
und Bilder von schnauzbärtigen Offizieren,<br />
Fahnen, Uniformen, Waffen und Ähnlichem<br />
herum zu tragen. Auf allen Seiten gibt es ausreichend<br />
Daten, Erinnerungen, literarische<br />
und künstlerische Bearbeitungen, um die große<br />
Revolution der Frauen zu rekonstruieren, die<br />
während des Ersten Weltkriegs stattfand. Im<br />
besten Fall wird es eine Erinnerung an die feministische<br />
Bewegung geben, die nach dem Ersten<br />
Weltkrieg überall in Europa neuen Schwung bekam<br />
und neue Formen annahm.<br />
Doch diese neue Frau, die die Universitäten,<br />
die Wissenschaft und Technik eroberte,<br />
die ihre neue Sensibilität im Jazz äußerte, eine<br />
neue Sexualethik, Verhütung und bewusste<br />
Mutterschaft einforderte, unterstützt durch<br />
Psychoanalyse und Reformpädagogik, wurde<br />
zum wichtigsten Erkennungszeichen der neuen<br />
Zeit.<br />
Die Parallele zwischen einer Zeit des Wohlstands<br />
und einer voller sozialer Spannungen,<br />
einer noch nie dagewesenen Entwicklungsgeschwindigkeit<br />
der Medien und der Technik<br />
und gleichzeitig einer Zeit der schmerzlichen<br />
Blindheit gegenüber den Gefahren solcher<br />
Spannungen heute, wie es auch vor dem Ersten<br />
Weltkrieg gewesen ist, ist offensichtlich. An<br />
der Geschichte der Frauen erkennt man, dass<br />
der Erste Weltkrieg nicht „beendet“ ist und<br />
nicht zu Versöhnung und gegenseitigem Verständnis<br />
geführt hat. Was soll man da erst zu<br />
dem noch nicht beendeten Zweiten Weltkrieg<br />
sagen Die sozialen Spannungen und Probleme<br />
im neuen Finanzkapitalismus, begleitet<br />
von der globalen Rückkehr in die Sklavenhaltergesellschaft,<br />
versprechen nichts Gutes: Im<br />
Gegenteil, es ist genau die explosive Mischung,<br />
die bei der harmlosesten Ursache hochgehen<br />
kann, bei irgendeinem Vorfall irgendwo auf<br />
der Welt. Die Rechte der Frauen wurden mit<br />
dem Fall der sozialistischen Staaten zurückgedrängt<br />
und erlebten einen backlash, den<br />
man nun wirklich nicht mit der Einführung<br />
der Demokratie begründen kann. Aber genau<br />
das passiert schon seit zwanzig Jahren in den<br />
postsozialistischen Gesellschaften. Ein globales<br />
weibliches Gebet würde heute darauf gerichtet<br />
sein, dass wir verschont bleiben mögen<br />
davor, dass erst ein neuer Weltkrieg uns Frauen<br />
unsere alten Rechte zurückgibt und neue<br />
hinzufügt.<br />
1913 erschien den Hochgebildeten Europas<br />
ein wahnsinniger Krieg unvorstellbar. Uns<br />
bleibt noch etwas Zeit, das heute Unvorstellbare<br />
zu bedenken.<br />
Aus dem Serbischen von<br />
Blanka Stipetić<br />
Svetlana Slapšak<br />
Geboren 1948 in Belgrad. Zusammen mit der<br />
Gruppe 1000 Frauen für den Frieden wurde sie<br />
2005 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.<br />
Gastdozentin an zahlreichen europäischen<br />
und amerikanischen Universitäten. Professur<br />
für Anthropologie antiker Welten, Gender Studies<br />
und Balkanologie (seit 2003), Dekanin des<br />
ISH (Institutum Studiorum Humanitatis) in<br />
Ljubljana. Sie veröffentlichte über 40 Bücher<br />
und Sammelschriften und über 400 Studien,<br />
über 100 Essays, einen Roman, Übersetzungen<br />
aus dem Alt- und Neugriechischen, Lateinischen,<br />
Französischen, Englischen und Slowenischen.<br />
Beton International März 2014 5
Emir Imamović Pirke<br />
Ergänzungen zur Biographie<br />
Franz Ferdinands<br />
nen, ist, dass niemand aus der Geschichte lernt“,<br />
zitierte Eva am Ende ihres ersten und einzigen<br />
Gesprächs über den Krieg Bismarck.<br />
Also widmete sich Mirza seiner Arbeit und<br />
Eva der ihren. Sie beschlossen, keine Kinder zu<br />
bekommen, und hatten so genügend Zeit, sich<br />
weiterzubilden, und genügend Raum, um beim<br />
Abendessen über das Klonen oder die Geschichte<br />
zu sprechen, insbesondere über die Ursachen<br />
des Ersten Weltkriegs, ein Thema, von dem Eva<br />
fasziniert war.<br />
„Weißt du, mein Schatz“, sagte sie einmal zu<br />
ihm, „es wäre großartig, die Akteure jener Ereignisse<br />
in unserer Gegenwart zu treffen. Aber<br />
ich meine nicht die Könige und die Minister, die<br />
Generäle und so weiter, sondern Menschen wie<br />
Gavrilo Princip.“<br />
„Warum denn, mein Schatz“, fragte Mirza<br />
und nahm einen Schluck vom australischen Wein.<br />
„Weißt du, mein Schatz, Gavrilo Princip war<br />
achtzehn Jahre alt, als er neunzehnhundertvierzehn<br />
Franz Ferdinand tötete. Das heißt,<br />
bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr war er<br />
ein kränklicher Bauer aus irgendeinem Kaff.<br />
Dann verließ er seine Familie, formte seine<br />
politischen Einstellungen und bereitete sich<br />
praktisch auf das Ende seines Lebens vor“, antwortete<br />
Eva.<br />
„Ich verstehe nicht, mein Schatz … Die Welt<br />
war damals noch einfacher“, sagte Mirza.<br />
„Ja, eben, mein Schatz“, fuhr Eva fort.<br />
„Weißt du, Princip war nicht irgendein Idiot.<br />
Dumm war er jedenfalls nicht. Stell dir mal vor,<br />
was jemand täte, der eine so klar ausformulierte<br />
Meinung von seiner damaligen Welt hatte,<br />
wenn er nur knappe achtzig Jahre später mit<br />
der heutigen Welt konfrontiert würde“<br />
„Na ja, mein Schatz, er wäre halt mit dem<br />
Krieg konfrontiert, und dabei setzte er sich<br />
doch, wenn ich mich recht erinnere, für eine<br />
Vereinigung auf dem Balkan ein, Bosnien mit<br />
Serbien, irgend so etwas, und gerade die führen<br />
ja heute Krieg …“, sagte Mirza.<br />
„Dieser Krieg wird doch auch irgendwann<br />
vorbei sein, mein Schatz“, antwortete Eva.<br />
„Denkst du“, fragte Mirza und schaute sie<br />
so an, dass sie spürte, wie ihre Brustwarzen steif<br />
wurden.<br />
In dieser Nacht liebten sie sich auf der<br />
Couch und tranken in den Pausen einen Shiraz<br />
Cabernet Malbec. Es war Freitag, am nächsten<br />
Tag konnten sie ausschlafen. Am Wochenende<br />
ließ Mirza sein Lauftraining ausfallen. Eva ging<br />
sowieso nie laufen.<br />
Über das Ansehen, das Eva unter Historikern<br />
genoss, wusste Fadil Zulfikarpašić nicht alles,<br />
aber jedenfalls genug: Er selbst war ebenfalls<br />
von Geschichte fasziniert. Als Begründer eines<br />
Balkaninstituts hörte er von seinen Freunden,<br />
hochgeschätzten Historikern vom Balkan und<br />
aus Europa, viel über Eva. Doktor Zenić erzählte<br />
ihm eines Abends bei einer Tasse Tee von Mirza<br />
und davon, was über ihn gesprochen wurde. Dies<br />
reichte aus, um den reichen bosnischen Emigranten<br />
von mysteriöser Herkunft zu veranlassen,<br />
seinem jungen Neffen eine Geldsumme zu<br />
überweisen, die es ihm ermöglichen sollte, sich<br />
noch intensiver seiner wissenschaftlichen Arbeit<br />
zu widmen und keine Zeit mehr auf Dinge<br />
zu verschwenden, mit denen er die Erwartungen<br />
seiner Bewunderer nicht erfüllen würde, die<br />
über die Kenntnisse und Talente des jungen Kollegen<br />
mit dem schwer auszusprechenden Nachnamen<br />
staunten.<br />
Das Geld, von dem gemunkelt wurde, es<br />
stamme aus dem Waffenhandel, kam auch Eva<br />
zugute. Es erleichterte ihr, Studienreisen zu<br />
unternehmen, Forschungen zu betreiben und<br />
Von Doktor Z. konnte man zumindest bis<br />
zum Jahr 2001 nicht behaupten, er hätte mehr<br />
Glück als Verstand. Von beidem hatte er nämlich<br />
eigentlich mehr als die meisten. Ab 2001<br />
waren jedoch seine wenigen und nicht allzu<br />
engen Freunde – eher würde man von guten Bekannten<br />
sprechen – steif und fest davon überzeugt,<br />
dass ihn zuerst das Glück und später auch<br />
der Verstand allmählich im Stich ließen. Es war<br />
in diesem Jahr, dass die angesehene Schweizer<br />
Historikerin Eva Zulfikarpašić auf der Rückreise<br />
von einer Fachtagung über das „Junge Bosnien“<br />
in Wien bei einem Verkehrsunfall ums Leben<br />
kam, was das Leben von Doktor Z. vollkommen<br />
veränderte. Nein, der hochgeschätzte Genetiker<br />
bosnisch-herzegowinischer Herkunft<br />
Dr. Mirza Zulfikarpašić gab sich nicht etwa dem<br />
Alkohol hin, er wachte nicht tagelang am Grab<br />
seiner Gattin, er verwandelte ihr gemeinsames<br />
luxuriöses Heim nicht in ein Mausoleum, und<br />
er ließ sich auch nicht gehen. Eigentlich blieb<br />
scheinbar alles beim Alten, außer dass er seine<br />
Arbeitsstelle kündigte: An Werktagen stand er<br />
um sechs Uhr morgens auf, lief fünf Kilometer,<br />
aß ein weichgekochtes Ei zum Frühstück und<br />
trank dazu einen frischgepressten Saft, las Le<br />
Monde, duschte morgens und abends, rasierte<br />
sich einmal täglich, schnitt alle fünf Tage seine<br />
Nägel und ging alle fünfzehn Tage zum Friseur.<br />
Das Haus verließ er immer tadellos gekleidet<br />
und wichtige Theatervorstellungen ließ er nicht<br />
aus. Einen Tag, nachdem er die Todesnachricht<br />
erhalten hatte, warf er alle Aschenbecher, die<br />
seine nunmehr tote Frau mit der Asche selbstgedrehter<br />
Zigaretten der Marke „Drum“ zu füllen<br />
pflegte, kurzerhand in den Müll.<br />
Als Spross zweier angesehener bosnischer<br />
Familien namens Kreševljaković und<br />
Zulfikarpašić war Mirza, damals Kreševljaković<br />
nach seinem Vater, mit Privatlehrern für Geige,<br />
Deutsch und Französisch, einer Gouvernante<br />
und einem Tennistrainer aufgewachsen. Mit sieben<br />
besaß er eine eigene Kinderbibliothek, die<br />
fast hundert Titel umfasste. Zum ersten Schultag<br />
wurde er mit einer Jahreskarte des Volkstheaters<br />
in Sarajevo belohnt. Schon damals wusste<br />
er, dass im Gebäude des Volkstheaters zur Zeit<br />
der österreichisch-ungarischen Monarchie das<br />
Gemeindezentrum untergebracht war. Mit zehn<br />
konnte er problemlos auf Deutsch lesen, mit<br />
zwölf reiste er zum ersten Mal nach Zürich, und<br />
mit vierzehn ließ er alle wissen, dass er nicht vorhabe,<br />
wie sein Vater Wasserkraftwerke im Irak<br />
und Militärstützpunkte in Libyen zu planen<br />
und die Bauarbeiten zu beaufsichtigen, sondern<br />
dass er wie seine Mutter den Arztberuf ergreifen<br />
wolle. Der Cousin seiner Mutter – Fadil<br />
Zulfikarpašić, ein Millionär und Emigrant mit<br />
Schweizer Staatsbürgerschaft – ermöglichte<br />
Mirza eine Ausbildung in seiner neuen Heimat,<br />
und so wurde Mirza gleich nach seinem Abitur<br />
zum Medizinstudenten und erhielt eine Wohnung<br />
und eine beträchtliche Summe Geldes zur<br />
Deckung seiner laufenden Kosten zur Verfügung<br />
gestellt. Allerdings waren zwei Bedingungen<br />
daran geknüpft: Er musste einen hervorragenden<br />
Studienerfolg vorweisen, und er musste<br />
seinen Nachnamen ändern. So wurde aus Mirza<br />
Kreševljaković zunächst Mirza Zulfikarpašić<br />
und einige Jahre später Doktor Z. Den neuen<br />
Nachnamen konnten die Kollegen genauso wenig<br />
aussprechen wie den alten, mit Ausnahme<br />
von Doktor Miha Zenić, der aus Šibenik stammte<br />
und dessen Tochter Eva nach ihrer Hochzeit<br />
am Genfer See am 9. Mai 1993 ebenfalls den<br />
Nachnamen Zulfikarpašić annahm.<br />
Nachdem die Eheleute in ihrer Hochzeitsnacht<br />
mehrere Orgasmen gehabt hatten – Mirza<br />
drei und Eva zwei – , sahen die beiden gemeinsam<br />
auf CNN, wie die Alte Brücke in Mostar zerstört<br />
wurde, und beschlossen daraufhin, keine<br />
Nachrichten aus ihren Heimatländern mehr<br />
zu verfolgen: seine bosnisch-muslimische und<br />
ihre kroatisch-katholische Herkunft hätten ihre<br />
Meinungen über den muslimisch-kroatischen<br />
Konflikt in Bosnien und Herzegowina definieren<br />
und, so dachten sie, ihre Beziehung belasten<br />
können. „Was wir aus der Geschichte lernen könan<br />
diverse Dokumente aus der Zeit vor dem Ersten<br />
Weltkrieg heranzukommen. Indessen veröffentlichte<br />
Mirza seine Arbeiten in wichtigen<br />
Fachzeitschriften, besuchte Kliniken, hielt Vorlesungen<br />
ab und arbeitete mit den allerbesten<br />
Spezialisten der Welt zusammen. Mit einigen<br />
von ihnen präsentierte er schon 1997 der ganzen<br />
Welt Dolly, das erste geklonte Schaf, und<br />
gemeinsam mit anderen plante er für 2001 den<br />
Versuch, einen Menschen zu klonen.<br />
Am Freitag, den 8. März 2001, sollte Eva aus<br />
Wien zurückkehren. Mirza hatte einen Flug für<br />
Sonntag, den zehnten, gebucht. Zum Frauentag<br />
hatte er ihr eine Halskette besorgt und dazu<br />
einen Ratgeber, der ihr dabei helfen sollte, mit<br />
dem Rauchen aufzuhören. Ein Telefonanruf<br />
unterbrach seinen Lesenachmittag: Man informierte<br />
ihn, dass Eva bei einem Verkehrsunfall<br />
ums Leben gekommen war. Sie hatte die Kontrolle<br />
über ihr Auto verloren, weil sie ihr Feuerzeug<br />
gesucht hatte.<br />
Doktor Zenić beschloss, seine Tochter einäschern<br />
zu lassen. Einen Teil von Evas Asche bewahrte<br />
Mirza fortan in der Schachtel auf, in der<br />
sie ihm ihr erstes Geschenk überreicht hatte. Der<br />
Rest wurde zum Grab der Familie Zenić auf dem<br />
Friedhof der Heiligen Anna in Šibenik gebracht.<br />
Mirza kam nicht zur Trauerfeier, was überall auf<br />
Unverständnis stieß. Er saß an diesem Tag am<br />
Esstisch, an dem Platz, wo üblicherweise Eva gesessen<br />
war, und dachte lange über einen Wunsch<br />
nach, den er Eva erfüllen wollte.<br />
Doktor Z. war geradezu besessen von der<br />
Idee eines Gavrilo Princip im einundzwanzigsten<br />
Jahrhundert. Den Verstand hatte er allerdings<br />
nicht verloren. Der hochgeschätzte Genetiker<br />
spielte nicht etwa mit dem Gedanken,<br />
Princip zu klonen. Abgesehen davon, dass er<br />
sich über die Unmöglichkeit eines solchen Un-<br />
Beton International März 2014 6
terfangens im Klaren war, widersetzte er sich<br />
auch jedem Versuch, Menschen zu klonen, mit<br />
aller Kraft. In die USA hatte er nämlich nur reisen<br />
wollen, um sich am Misserfolg jener Kollegen<br />
zu ergötzen, die ihm übertriebene Skepsis<br />
vorgeworfen hatten. Mirzas Plan war ein ganz<br />
anderer. Er beschloss, ein Neugeborenes zu<br />
finden und zu adoptieren oder zu kaufen oder<br />
was auch immer, und dieses Kind unter genau<br />
den gleichen Bedingungen aufzuziehen, unter<br />
denen auch Princip aufgewachsen war. Er wollte<br />
das Kind von der Wirklichkeit abschirmen<br />
und seine Ansichten auf genau jener Grundlage<br />
formen, auf der damals der Sohn eines Postangestellten<br />
zum Mörder des Thronfolgers Franz<br />
Ferdinand und seiner Gattin Sophie geworden<br />
war. Dazu benötigte Doktor Z. Zeit und Raum<br />
– Geld hatte er genug, und sollte er mehr brauchen,<br />
könnte er jederzeit eine Immobilie verkaufen,<br />
die er von seinem reichen Onkel geschenkt<br />
bekommen hatte.<br />
Mirza Zulfikarpašić änderte wieder seinen<br />
Nachnamen: Genau genommen holte er einfach<br />
den väterlichen Nachnamen zurück und schrieb<br />
sich als Kreševljaković für das Geschichtsstudium<br />
ein, das seine verstorbene Frau abgeschlossen<br />
hatte. Er wusste alles über Eva, kannte jeden<br />
wichtigen Augenblick ihres Lebens, von<br />
den ersten Erinnerungen bis zur verfluchten<br />
Nikotinsucht. Nach zwölf Jahren des Studiums,<br />
des Lernens und Forschens in Bibliotheken und<br />
Archiven, als Mirza mühevoll alle wichtigen Informationen<br />
über das „Junge Bosnien“ und seine<br />
Mitglieder zusammengetragen hatte, stand<br />
sein einschlägiges Wissen dem Evas um nichts<br />
nach. Der angesehene Doktor Z. mit seiner brillanten<br />
Karriere als Genetiker, der von den besten<br />
Kliniken und Instituten eingeladen wurde,<br />
der in den besten Fachzeitschriften publizierte<br />
und dessen Zukunftsaussichten in der Kollegenschaft<br />
Neid hervorriefen, hörte für immer<br />
auf zu existieren.<br />
Der Schweizer Staatsbürger Mirza Kreševljaković<br />
passierte problemlos die Passkontrolle<br />
am Flughafen von Sarajevo und nahm ein Taxi<br />
zum Hotel Europa. Das Grab des Vaters und die<br />
Mutter im Altersheim wollte er erst aufsuchen,<br />
nachdem er das, weshalb er gekommen war, erledigt<br />
hatte: ein Baugrundstück erwerben, weit<br />
weg von der Zivilisation und groß genug, um darauf<br />
eine Welt für seinen Gavrilo zu erschaffen. In<br />
seinem Zimmer im fünften Stock blätterte der<br />
einstige Doktor Z. im Telefonbuch und fand darin<br />
drei Familien mit dem Nachnamen Princip. Er<br />
rief die erste Telefonnummer an: Eine metallische<br />
Frauenstimme sagte ihm, dass die gewählte<br />
Telefonnummer nicht existierte. Die andere Telefonnummer<br />
funktionierte. Mirza ließ es lange<br />
läuten. Schließlich meldete sich ein alter Mann<br />
mit einer Piepsstimme. Mirza legte einfach auf.<br />
Die Telefonnummer 033455939 gehörte dem<br />
fünfunddreißigjährigen Braco Princip, von dem<br />
Mirza noch am selben Abend erfahren sollte,<br />
dass es sich bei ihm um einen Bergwerkstechniker<br />
handelte, der derzeit als Chauffeur für das<br />
Türkische Kulturzentrum „Yunus Emre“ tätig<br />
war. Die beiden verabredeten sich genau dort,<br />
wo Gavrilo Princip auf den Thronfolger geschossen<br />
hatte. Braco hatte sich zu dem Treffen bereit<br />
erklärt, weil er eine Aufwandsentschädigung in<br />
Höhe von hundert Euro erhalten sollte.<br />
„Ich bin Mirza“, sagte der ehemalige Doktor<br />
Z. und streckte dem hochgewachsenen,<br />
kahlköpfigen Mann im weißen T-Shirt mit dem<br />
Zeichen der Hypo Alpe Adria Bank und einem<br />
blauen Nilpferd seine Hand hin.<br />
„Braco“, antwortete Princip. Sein Lächeln<br />
war breit genug, um zu offenbaren, dass ihm der<br />
vierte Zahn links oben fehlte.<br />
„Ein ungewöhnlicher Name“, sagte Mirza.<br />
„Kein Name, es ist ein Spitzname“, erklärte<br />
Braco.<br />
„Wie lautet denn dein Name“, fragte Mirza.<br />
Auf die Antwort musste er etwa fünfzehn<br />
Sekunden warten, und dann sprach Braco genau<br />
in dem Augenblick, als eine Straßenbahn<br />
mit einer Werbung des ungarischen Mineralölkonzerns<br />
MOL an ihnen vorbeifuhr. Mirza<br />
musste seinen Gesprächspartner bitten, die<br />
Antwort zu wiederholen.<br />
„Gavrilo“, sagte Braco leise.<br />
„Gavrilo Princip“, fragte Mirza erstaunt.<br />
„Ja“, murmelte Braco.<br />
„Aber das ist doch …“, Mirza konnte seine<br />
Begeisterung kaum verhehlen.<br />
„Das ist furchtbar, Bruder“, entgegnete<br />
Gavrilo Braco Princip.<br />
Hätte Mirza Kreševljaković an diesem<br />
Abend im Restaurant „Dom“ nicht eine Rechnung<br />
von hundertfünfzig bosnischen Mark<br />
oder fünfundsiebzig Euro bezahlt, hätte er einige<br />
hunderttausend Euro verloren – und zwar<br />
im besten Fall. Braco erzählte ihm, dass die jugoslawischen<br />
Polizisten ihm regelmäßig Ohrfeigen<br />
verpasst hätten, wenn er seinen Namen<br />
gesagt habe, ohne seinen Ausweis zu zeigen,<br />
weil sie überzeugt gewesen seien, dass er sie<br />
nur provozieren wolle. Er erzählte aber auch,<br />
nur seinem Nachnamen habe er wenigstens das<br />
bisschen Schulbildung zu verdanken; er habe es<br />
nämlich gehasst, zu lernen. Dann erzählte er,<br />
sie hätten im letzten Krieg wegen seiner Mutter<br />
vor den Serben fliehen müssen, die Moslems<br />
hätten ihn aber wegen seines Namens verach-<br />
tetet. Jetzt kam Mirza nicht mehr mit, also erklärte<br />
ihm Braco, dass seine Mutter Muslimin<br />
sei und dass sie ihretwegen nicht im Stadtteil<br />
Grbavica hätten bleiben können, der von der<br />
serbischen Armee kontrolliert worden sei.<br />
Nachdem es ihnen dank ihres Schmucks und<br />
des guten Ansehens seines Vaters irgendwie<br />
gelungen sei, die Miljacka zu überqueren, sei er<br />
von der bosnisch-herzegowinischen Militärpolizei<br />
verhaftet und zusammengeschlagen worden,<br />
nur weil er so hieß wie der, wie sie sagten,<br />
„Terrorist, der den österreichischen Herrn und<br />
seine feine, schwangere Frau umgebracht hat“.<br />
Er fügte hinzu, dass man ihn sogar an die Front<br />
geschickt hätte, wenn er nicht an Tuberkulose<br />
erkrankt wäre.<br />
„Aber Princip war doch ein Idealist, er<br />
kämpfte gegen die Besatzer“, sagte Mirza.<br />
„Ach geh, er war ein Idiot. Ein richtiger Idiot.<br />
Gestorben mit knapp über zwanzig und nur<br />
vierzig Kilo, für nichts, so wie jeder andere Idiot,<br />
der denkt, er könnte etwas verändern“, antwortete<br />
Braco darauf.<br />
„Er kämpfte für die Freiheit“, wandte Mirza<br />
ein, bereit, sein Wissen zu demonstrieren.<br />
„Na, das ist ihm ja bestens gelungen, alle<br />
Achtung“, sagte Braco, bestellte sich ein Bier<br />
und gab weiter zum Besten, was er von seinem<br />
Namensvetter, der in einem tschechischen Gefängnis<br />
gestorben war, hielt.<br />
Mirza und Braco gingen spät auseinander,<br />
etwa um halb drei Uhr nachts. Braco wollte<br />
die versprochenen hundert Euro nicht annehmen.<br />
Auf einem A4-Blatt mit dem Namen<br />
des Hotels, darüber einer Krone und darunter<br />
der Zahl 130, schrieb Mirza einen Brief an Eva.<br />
Nachdem er mit „für immer Dein Mirza“ unterzeichnet<br />
hatte, machte er das Fenster auf,<br />
faltete einen Papierflieger und ließ ihn aus<br />
dem Hotel Europa segeln, hin zum Minarett<br />
der Begova-Moschee.<br />
„Mein Schatz, ich habe Gavrilo Princip im<br />
einundzwanzigsten Jahrhundert getroffen.<br />
Er ist Angestellter eines türkischen Kulturzentrums,<br />
Kunde einer österreichischen Bank<br />
und Konsument einer ungarischen Tankstelle.<br />
In Belgrad war er nur einmal, in Titos Mausoleum<br />
‚Haus der Blumen‘, im Alter von sieben<br />
Jahren. Ich schreibe Dir aus Sarajevo, aus dem<br />
Zimmer eines Hotels, in dem auch ein Wiener<br />
Kaffeehaus untergebracht ist und das, wie Du<br />
bestimmt weißt, Ende des neunzehnten Jahrhunderts<br />
von Gligorije Jeftanović erbaut wurde,<br />
einem serbischen Politiker aus Bosnien.<br />
Meine Liebste, Du hast mir immer gesagt, dass<br />
Du von Genetik keine Ahnung hast. Ich dagegen<br />
bin nicht sicher, ob irgendjemand in der Lage<br />
ist, die Geschichte dieses Landes zu verstehen.<br />
Hier ist eigentlich auch die Gegenwart nichts<br />
anderes als Geschichte. Mein Schatz, ich habe<br />
sehr lange …“ Das war zu lesen auf dem, was von<br />
Mirzas Brief an Eva übriggeblieben war. Der<br />
Rest des Textes war unleserlich: Der Papierflieger<br />
war nämlich in einer Pfütze gelandet.<br />
Nur ein Teil war unerklärlicherweise trocken<br />
geblieben.<br />
Mirza Kreševljaković ging nicht zum Grab<br />
seines Vaters, und auch seine Mutter im Altersheim<br />
besuchte er nicht. Er kehrte für<br />
kurze Zeit in die Schweiz zurück und tat etwas,<br />
was seinen wenigen und nicht allzu engen<br />
Freunden – eher würde man von guten<br />
Bekannten sprechen – endgültig den Beweis<br />
dafür lieferte, dass er nun für immer den Verstand<br />
verloren hatte. Schon wieder ließ er seinen<br />
Nachnamen ändern, aber diesmal änderte<br />
er noch dazu den Vornamen: Er nannte sich<br />
Franz Ferdinand. Nur Miha Zenić stellte ihm<br />
die Frage: „Warum denn, um Himmels willen“<br />
Fadil Zulfikarpašić war schon tot, und der Rest<br />
von Mirzas Schweizer Familie kämpfte vor Gericht<br />
um das Erbe. „Was wir aus der Geschichte<br />
lernen können, ist, dass niemand aus der Geschichte<br />
lernt, sagte Otto von Bismarck“, antwortete<br />
Mirza Evas Vater und fragte ihn, ob er<br />
möglicherweise jemanden kenne, dem er das<br />
Haus verkaufen könnte.<br />
Mirza Kreševljaković, Mirza Zulfikarpašić,<br />
Mirza Kreševljaković, also Franz Ferdinand, ist<br />
heute der Besitzer des Restaurants „Young Bosnia“<br />
in New York. Noch immer steht er jeden<br />
Morgen um sechs Uhr auf, läuft jeden Tag fünf<br />
Kilometer, isst zum Frühstück ein weichgekochtes<br />
Ei und trinkt dazu einen frischgepressten<br />
Saft, duscht morgens und abends, rasiert<br />
sich einmal täglich, schneidet alle fünf Tage<br />
seine Nägel und geht alle fünfzehn Tage zum<br />
Friseur. Das Haus verlässt er immer tadellos gekleidet.<br />
Er plant, am 28. Juni 2014 nach Sarajevo<br />
zu fahren. Gavrilo Princip hat ihn an diesem<br />
Tag zu seiner Hochzeit eingeladen.<br />
Aus dem Bosnischen von<br />
Mascha Dabić<br />
Emir Imamović Pirke<br />
Geboren 1973 in Tuzla, Bosnien-Herzegowina.<br />
Journalist (Gracija, BBC, ORF, RAI, Radio B92,<br />
Dani) und Drehbuchautor der quotenstärksten<br />
kroatischen TV-Soap. Als Kriegsreporter im<br />
Kosovo, in Mazedonien und Afghanistan. Autor<br />
mehrerer Romane voller schwarzen Humors.<br />
Dragana Mladenović<br />
DAS PRINZIP DER<br />
GEGENSÄTZLICHKEIT<br />
ich bin das prinzip<br />
der gegensätzlichkeit<br />
ein verirrtes flugblatt<br />
ein tödliches geschoss<br />
furchtlos an der ecke<br />
stehe ich alleine<br />
ich zittere<br />
ich bin princip<br />
ich stehe an der ecke des automobils<br />
ich bewege mich<br />
bin neunzehn jahre alt<br />
jung brenne ich alt wie<br />
die zündschnur die miljacka das zyanid<br />
ich schieße nicht ich explodiere<br />
ich schieße<br />
stille<br />
hey ihr slawen<br />
ich bin das prinzip<br />
der gegensätzlichkeit<br />
mit einem bluterguss unter dem auge<br />
mit einem eisigen auge ohne<br />
bluterguss ohne auge<br />
ich verstehe es zu ertragen<br />
ich habe keinen laut von mir gegeben<br />
geschrien habe ich<br />
der schmerz tut keinem gut<br />
der schmerz tut gut<br />
ich bin das prinzip<br />
der gegensätzlichkeit<br />
brutal wie eine amputierte hand<br />
weich wie ein schwarzer handschuh<br />
lang wie eine pelerine<br />
kurz<br />
ein hustenanfall<br />
fieber<br />
ich zittere am ganzen körper<br />
ich bin das prinzip<br />
der gegensätzlichkeit<br />
eine idee, die den körper ignoriert<br />
ein körper, der an tuberkulose zerbricht<br />
es gab eine jelena<br />
ich habe verkehrt<br />
ich habe nicht mit frauen verkehrt<br />
ich habe eine gesunde natur<br />
die sinnlichkeit ist sophies sünde<br />
ist nicht sophies sünde<br />
hey ihr slawen<br />
mein körper ist ein kurzer gewehrlauf<br />
ein trog eine wanne ein grab<br />
ein fluss in den ich nie<br />
gestiegen bin<br />
zweimal<br />
nass<br />
zweimal<br />
trocken<br />
ich bin das prinzip<br />
der gegensätzlichkeit<br />
ich könnte<br />
die ganze stadt in eine<br />
streichholzschachtel stecken und anzünden<br />
mein kuss ist so<br />
fest und feucht<br />
ich bin das prinzip<br />
der gegensätzlichkeit<br />
ich bin tot geboren nein<br />
ich werde niemals sterben<br />
bin unsterblich wie miloš<br />
miloš hat es nie gegeben<br />
es hat ihn gegeben<br />
hey ihr slawen<br />
ich bin ein zahnrad in einem mechanismus<br />
ein mechanismus der sich<br />
mit blut entzündet<br />
keuchend wie eine million<br />
leichen ein golgatha<br />
wie die freiheit das kino<br />
wie das blut<br />
millionen von leichen die repression<br />
das lager die freiheit hej ihr slawen<br />
hört wie es keucht<br />
tausende von betrieben<br />
hunderte von fabriken schulen häusern<br />
blumen<br />
ich bin das prinzip<br />
der gegensätzlichkeit<br />
ein zahnrad in einem mechanismus<br />
ein mechanismus der sich<br />
mit blut entzündet und keucht<br />
wie eine traktorenkolonne eine<br />
kühlwagenkolonne eine panzerkolonne<br />
tausende leichen<br />
ich bin das prinzip der gegensätzlichkeit<br />
der keim einer idee<br />
das geschoss einer idee<br />
ein geschoss<br />
Anmerkungen:<br />
Aus dem Serbischen von<br />
Jelena Dabić<br />
„Princip“ ist im Serbischen /Kroatischen/ Bosnischen<br />
sowohl „das Prinzip“ als auch ein (seltener)<br />
Familienname.<br />
Miljacka: der Fluss, an dem Sarajevo liegt.<br />
Zyanid: Gavrilo Princip und der zweite Attentäter<br />
Čabrinović hatten sich vor dem geplanten<br />
Attentat je eine Zyanidkapsel besorgt und diese<br />
nach dem Schuss auch genommen; das Gift hat<br />
allerdings nicht gewirkt.<br />
Hej Sloveni („hey ihr slawen“): der Beginn der jugoslawischen<br />
Nationalhymne von 1945 bis 2003.<br />
Miloš: Miloš Obilić, serbischer Adeliger und<br />
Nationalheld, fiel 1389 in der Schlacht auf dem<br />
Amselfeld im Kampf gegen die Türken.<br />
häuser / blumen: Anspielung auf das „Haus der<br />
Blumen“, das Mausoleum von Josip Broz Tito<br />
im Belgrader Stadtteil Dedinje.<br />
Dragana Mladenović<br />
Geboren 1977 in Frankenberg, lebt in Pančevo,<br />
Serbien. Seit 2003 sind sieben Gedichtbände<br />
in serbischer Sprache erschienen; in der Übersetzung<br />
von Jelena Dabić ist ihr Gedichtband<br />
Verwandtschaft im Verlag Edition Korrespondenzen<br />
2011 veröffentlicht worden.<br />
Beton International März 2014 7
Daša Drndić<br />
Der Kriegstanz<br />
Galizien, Galizien, pflegte mein Großvater<br />
zu wiederholen. Während er an seinem Malvasier-Wein<br />
aus Eigenanbau nippte, in den er einige<br />
Löffel Honig von seinen Bienen hineingetan<br />
hatte, erzählte er und erzählte, und ich hörte<br />
immer nur Galizien, Galizien. Ich war sieben<br />
Jahre alt. Auch später, wenn wir jeden Sommer<br />
von Belgrad bis ins Herz Istriens fuhren, saß<br />
Galizien so lange, wie Großvater am Leben war,<br />
stets mit uns am Tisch. Mit Galizien frühstückten<br />
mein Bruder und ich, mit Galizien legten<br />
wir uns schlafen.<br />
Galizien kullerte durch die Zimmer wie ein<br />
Geheimnis, wie ein schwarzer flauschiger Ball,<br />
der mal größer, mal kleiner wurde und den man<br />
nicht zu fassen kriegte, und der schließlich davonhüpfte,<br />
in einen Mythos hinein. Galizien<br />
war nicht schön, Galizien war furchteinflößend,<br />
geheimnisvoll und neblig. Niemals restlos verstanden,<br />
niemals restlos zu Ende gehört.<br />
Mein Großvater ist nicht mehr, seit fast vierzig<br />
Jahren, und seit fast vierzig Jahren ist Galizien<br />
nicht mehr bei uns gewesen, vermutlich<br />
ist es mit ihm weggegangen oder er hat es mit<br />
sich gezogen. Hinein in die verdrängte, getrübte<br />
Erinnerung. Während der Zweite Weltkrieg in<br />
meiner Jugend und auch später und sogar bis<br />
heute von überallher seine Geschichte hinausposaunt<br />
hat, seine unterschiedlichen Geschichten,<br />
und damit auch die Rolle meiner Familie,<br />
meines Vaters, meiner Mutter und ebenjenes<br />
Großvaters wie durch ein Megaphon hinausgebrüllt<br />
wurde, hatte der Erste, der Große Krieg,<br />
den Kopf zwischen die Schultern gezogen, uns<br />
allen auf Zehenspitzen den Rücken gekehrt und<br />
sich in eine Höhle des Vergessens verkrochen.<br />
Doch jetzt, da der hundertste Geburtstag näher<br />
rückt, für diesen Krieg und für das unglückselige<br />
Galizien meines Großvaters, kommen sie<br />
wieder, Großvater und Galizien, sie betreten in<br />
ganz anderer Aufmachung meinen Raum, Seite<br />
an Seite mit einer Geschichte, deren Stücke ich<br />
in ein riesiges, im Zerfallen begriffenes Puzzle<br />
einzufügen versuche. Großvater und Galizien<br />
fallen ein in ein abgewetztes und verbrauchtes<br />
Bild, in eine Erzählung ohne Umrisse, ohne<br />
Wände, ohne Rahmen, in einen Nebelschleier,<br />
der von der verbrannten Vergangenheit nur Mikroteilchen<br />
des Fortwährens in die Höhe hebt,<br />
geruchlos, stimmlos.<br />
Galizien und die Erfrierungen an den Füßen<br />
meines Großvaters. Galizien, die ferne Ostfront,<br />
die Karpaten, die Russen, die österreichisch-ungarische<br />
und die deutsche Armee. Hunger und<br />
der Exodus aus Istrien, angeordnete Evakuierungen,<br />
Umsiedlungen, wer weiß, die wievielte<br />
es ist seit Menschengedenken. Wiederholungen.<br />
Traurig und unheilvoll zugleich. Drohgebärde<br />
und Trauergesang unserer Herrin – nicht Gott<br />
ist gemeint, sondern die Geschichte.<br />
Erst jetzt, erst heute, hundert Jahre<br />
später, tritt das Bild aus der Abstraktion heraus<br />
und wächst sich zu einer monströsen Farce des<br />
repetitiven Absurden aus. Im Jahr 1915 wurde<br />
der Londoner Vertrag unterschrieben, durch<br />
den Italiens Eintritt in den Krieg gegen Deutschland<br />
und die österreichisch-ungarische Monarchie<br />
besiegelt wurde. Um Italien auf ihre Seite<br />
zu ziehen, sicherte ihm die Entente große Teile<br />
der Monarchie zu, darunter auch Istrien. Aber<br />
zu diesem Zeitpunkt schlug sich mein Großvater<br />
als „Freiwilliger“ bereits Richtung Karpaten<br />
durch. Seine Füße waren in Lumpen gewickelt.<br />
Um zu überleben, musste er mit seinen Kameraden<br />
das Fleisch gefallener (und getöteter) Pferde<br />
zerstückeln und mit klammen Fingern über<br />
schwacher Flamme drehen, zwischen dem eisigen<br />
Himmel und der frostigen Erde. Es war diese<br />
Schlacht in den Karpaten im Jahr 1915, in der die<br />
österreichische Armee große Verluste an Stellungen<br />
und Menschenleben hinnehmen musste,<br />
es war das „Stalingrad des Ersten Weltkrieges“,<br />
das am wenigsten, am oberflächlichsten und damit<br />
auch am fragwürdigsten beschrieben wurde.<br />
Über diesen unmenschlichen (und sinnlosen)<br />
Feldzug bestehen nach wie vor Zweifel, die in<br />
verlegten Briefen und unvollständigen, halbvergessenen<br />
Geschichten lediglich angedeutet<br />
werden. Eine Million Kämpfer wurden von jeder<br />
Seite in die Kampfhandlungen hineingedrängt:<br />
Die einen mussten die Grenzen der Monarchie<br />
verteidigen, die anderen sollten in die Ungarische<br />
Tiefebene vorstoßen. In einer unwegsamen,<br />
offenen Gebirgslandschaft, die unter einer<br />
dicken Schneedecke lag, bei eisigen Stürmen, im<br />
Nebel, ohne Schutz und ohne Schützengräben<br />
wurde (ein weiterer) sinnloser Krieg geführt,<br />
fast bis zur totalen Ausrottung. Hundertneunzigtausend<br />
(190.000) russische Soldaten fielen<br />
im Kampf, hundertdreißigtausend (130.000)<br />
gefangene, geschwächte und durchfrorene Untertanen<br />
der österreichisch-ungarischen Monarchie<br />
befanden sich in der Festung Przemyśl,<br />
in der auch mein Großvater hockte, während der<br />
Weiße Tod seine Kameraden mit einer lautlosen,<br />
leichten, geradezu mütterlichen Berührung en<br />
gros holte.<br />
Österreich-Ungarn siedelte große Teile der<br />
Bevölkerung um, so auch die Bewohner Istriens.<br />
Der Besitz der Menschen wurde beschlagnahmt,<br />
das Vieh wurde beschlagnahmt, das<br />
Leben wurde aus seiner Einbettung herausgezerrt,<br />
durchschnitten und zerrissen. Intellektuelle<br />
(und andere) kamen ins Lager; wer konnte,<br />
flüchtete in Dörfer im Landesinneren. Die<br />
Waggons standen bereit. Viehwaggons. Im Mai<br />
1915 wurden im Laufe von nur fünf Tagen achttausend<br />
Menschen in Züge hineingepfercht, die<br />
aus je fünfunddreißig Waggons bestanden und<br />
täglich achtmal aus Pula wegfuhren. Auf jedem<br />
Waggon stand mit Kreide geschrieben: sechs<br />
Pferde oder vierzig Personen. Es füllten sich die<br />
Lager in Österreich, in Mähren, in Ungarn. Der<br />
Typhus wütete. Die Cholera wütete. Die meisten<br />
evakuierten Bewohner Istriens wurden ins<br />
Gmünder Lager gepfercht, das ohnehin schon<br />
aus allen Nähten platzte und wo Kinder wie<br />
Fliegen starben. Zwischen November 1915 und<br />
Juli 1916 starben in Gmünd 3000 Menschen.<br />
Da sich für die österreichisch-ungarische Armee<br />
auf dem Schlachtfeld in Galizien bereits<br />
eine vernichtende Niederlage abzeichnete,<br />
wurden in Gmünd Plätze für die Verwundeten<br />
freigehalten. So auch für meinen Großvater. In<br />
welchem Regiment er gekämpft hatte, weiß ich<br />
nicht, aber das ist weder für mich noch für die<br />
Geschichte von Bedeutung.<br />
Meinem Großvater blieb das Lager in<br />
Gmünd erspart. Mit Erfrierungen an den Füßen<br />
und einer beginnenden Gangräne ging oder<br />
kroch er sogar bis Istrien, nunmehr nicht zu<br />
seinem Haus in Pazin, sondern zum Haus seiner<br />
Frau, meiner Großmutter, im kleinen Dorf<br />
Karojba, wo er auch seinen neugeborenen Sohn<br />
vorfand.<br />
Im Laufe des Zweiten Weltkriegs war in<br />
diesem Haus die Zentrale des antifaschistischen<br />
Widerstands in Istrien untergebracht.<br />
In Jugoslawien wurden daran zwei Gedenktafeln<br />
angebracht, die daran erinnern sollten,<br />
dass hier die erste Parteiführung für Istrien<br />
gegründet wurde. In der Unabhängigen Republik<br />
Kroatien unter der Regierung der Kroatischen<br />
Demokratischen Union (Hrvatska demokratska<br />
zajednica, HDZ) und also auch mit<br />
dem Segen des damaligen Vorsitzenden Franjo<br />
Tuđman wurden diese Gedenktafeln mit Vorschlaghammern<br />
zerstört.<br />
Heute haben Schriftsteller die Möglichkeit,<br />
in Gmünd an einem Artist-in-Residence-<br />
Programm teilzunehmen. Manchmal sind auch<br />
Schriftsteller aus Istrien darunter; in Kroatien<br />
wird indessen weiterhin auf Gedenktafeln herumgehämmert.<br />
Ich habe hier nicht genug Platz für Namen,<br />
Einzelschicksale, einzelne umgepflügte Leben.<br />
Dabei sind es gerade sie, die Einzelpersonen,<br />
die das Gewebe einer jeden Erzählung über die<br />
Welt bilden – so auch für die Erzählungen von<br />
Kriegen. Daher ist diese meine Kurzgeschichte<br />
eigentlich gar keine richtige Geschichte, sie ist<br />
klein und unausgegoren.<br />
Im Jahr 1917 herrschte in Istrien eine große<br />
Dürre, die unvorstellbare Hungersnöte nach<br />
sich zog. Der Krieg war noch im Gange, die spanische<br />
Grippe stand vor der Tür, und der italienische<br />
Faschismus kündigte einen längeren Besuch<br />
an. Im Jahr 1920 unterzeichneten das Königreich<br />
der Serben, Kroaten und Slowenen und<br />
das Königreich Italien den Grenzvertrag von<br />
Rapallo, in dem festgehalten wurde, dass neben<br />
anderen Städten und Regionen auch Istrien Italien<br />
zugesprochen wurde. Ein weiterer Exodus<br />
des kroatischen Volkes zeichnete sich ab. Mein<br />
Großvater Edo wurde zu Edoardo, kroatische<br />
Namen wurden sogar auf Grabsteinen italianisiert,<br />
kroatische Kulturzentren wurden in<br />
Brand gesteckt, die kroatische Sprache wurde<br />
aus der Öffentlichkeit verbannt, immer mehr<br />
Menschen wurden verhaftet und gezwungen,<br />
Rizinusöl zu trinken, eine neue große Serie von<br />
Tragödien für Einzelpersonen und Familien<br />
zeichnete sich ab. Mein Großvater zog mit seiner<br />
Frau und zwei Söhnen nach Jugoslawien,<br />
nach Split, und kehrte erst 1941 nach Istrien<br />
zurück, um sich der Volksbefreiungsbewegung<br />
anzuschließen. Die weiteren Ereignisse haben<br />
nur scheinbar nichts mit dem Ersten Weltkrieg<br />
zu tun. Die Geschichte setzte abermals, wie ein<br />
Kreisel, ein lustiges Spielzeug für Kinder, zu<br />
einem Danse Macabre an, und die Melodie war<br />
ganz genau dieselbe. Nach dem Fall des Faschismus<br />
kündigte sich in Istrien ein weiterer Exodus<br />
an, wie ein kleineres, dumpfes Erdbeben.<br />
Diesmal war es der Exodus des italienischen<br />
Volkes, eine stille und scheinbar gewaltlose<br />
Umsiedlung. Und dann wurde 1975 der Vertrag<br />
von Osimo unterzeichnet, Osimo bei Ancona,<br />
was dazu führte, dass im Jahr 1977 schließlich<br />
und endlich – wenn auch nicht unbedingt dauerhaft<br />
– die Grenzen zwischen der Sozialistischen<br />
Föderativen Republik Jugoslawien und<br />
der Republik Italien festgelegt wurden. Dieser<br />
Vertrag resultierte aus dem Wunsch, dass es<br />
nie wieder zu einem Bevölkerungsaustausch<br />
im Namen zweifelhafter politischer Ziele und<br />
territorialer Ansprüche kommen sollte; er sollte<br />
dafür garantieren. Das entpuppte sich keine<br />
dreizehn Jahre später (im Jahr 1990) als Trugbild.<br />
Bei der Unterzeichnung des Vertrags von<br />
Osimo waren die Söhne meines Großvaters<br />
direkt beteiligt, indirekt auch mein Großvater,<br />
der seine durch die Erfrierungen entstellten<br />
Füße und sein durch die vielen Umsiedlungen<br />
zerrupftes Leben nur noch durch eine sinnlose<br />
Hoffnung zu heilen versuchte.<br />
Ich habe keine Briefe von meinem Großvater<br />
aus dem eisigen Galizien. Es existieren keine<br />
Tagebucheinträge, keine Fotografien. Geblieben<br />
ist nur das Echo: Galizien, Galizien. Ein Echo,<br />
das wie ein Klagelied (oder ein Fluch) bis in meine<br />
Zeit hineingetragen wird. In Schneestürmen,<br />
gefangen im Eis, bei Temperaturen von minus<br />
fünfzehn Grad oder sogar noch darunter konnte<br />
kaum jemand Briefe nach Hause schreiben oder<br />
sich fotografieren lassen. Aber nicht alle Kämpfe<br />
in Galizien fanden im Winter statt. Die Jahreszeiten<br />
wechselten sich ab, und so gibt es Geschichten,<br />
die im Gedächtnis bleiben konnten.<br />
Mein Urgroßvater Marko aus einem Ort bei<br />
Gospić wurde in Galizien verwundet. Ein Granatsplitter<br />
schlug ihm ein Auge aus, und nach einer<br />
gewissen Zeit kamen nach und nach Metallstücke<br />
aus seiner Nase. Er hatte ein Glasauge, das er vor<br />
dem Schlafengehen in ein Glas legte, so wie andere<br />
Leute ihre Zahnprothese ablegen. Er wurde mit<br />
einer silbernen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet,<br />
die sich inzwischen in meinem Besitz befindet.<br />
Er erzählte mir, dass der Hunger an der Front<br />
Beton International März 2014 8
so groß war, dass er einmal einem lokalen Bauern<br />
neun Goldstücke für zwei Eier bezahlte.<br />
Ich besitze das Tagebuch meines Großvaters,<br />
der als österreichisch-ungarischer Soldat<br />
nach Serbien versetzt wurde, dort in Gefangenschaft<br />
geriet und später in Russland<br />
kämpfte. Danach kehrte er über Japan und<br />
Australien nach Hause. Es ist mir nicht gelungen,<br />
den gesamten Text des Tagebuchs zu<br />
entziffern, zumal einige Passagen auf Kyrillisch<br />
sind, noch dazu ziemlich unleserlich.<br />
Mein Urgroßvater war in Gefangenschaft in<br />
Russland. Er arbeitete bei einem Gutsherrn,<br />
aber kurz nach der Revolution flüchtete er aus<br />
Russland und kehrte einige Monate später nach<br />
Hause zurück.<br />
Ich weiß noch, dass er Kartoffeln hasste, weil er<br />
sie dort ständig zu essen bekam. Ich habe noch<br />
die Soldatenmarke, die er um den Hals trug.<br />
Darin befand sich ein Zettel mit Namen, Brigade<br />
und Adresse des Vaters.<br />
Damals gab es noch keine Soldatenmarken aus<br />
Metall mit eingravierten Angaben. Das ist alles,<br />
was ich weiß.<br />
Ich habe über einen Russlandgefangenen<br />
gelesen, der erst im Jahr 1929 zurückkehrte,<br />
nachdem er einige Jahre in der Mandschurei<br />
und in China verbracht hatte. Dort hatte er<br />
Kroaten und Serben kennengelernt, die es<br />
niemals schafften, zurückzukehren. Manche<br />
blieben sogar für immer in Russland.<br />
Auch mein Großvater landete in der russischen<br />
Kriegsgefangenschaft, irgendwo im Osten. Er<br />
entkam irgendwie über die Mandschurei. Dann<br />
landete er in Shanghai, von wo aus er einen Brief<br />
nach Hause schrieb und bat, ihm Geld für die<br />
Schiffsreise zu schicken. Von dieser Reise erholte<br />
er sich niemals ganz, er starb früh an einem Herzinfarkt.<br />
Ich habe ihn nicht einmal kennengelernt.<br />
Eure Angehörigen sind alle zurückgekehrt.<br />
Mein Urgroßvater brach in Bjelovar auf, aber<br />
er kehrte niemals zurück. Niemand weiß<br />
heute, wohin er gefahren ist oder wo er möglicherweise<br />
sein Ende gefunden hat. Ein hundertprozentiger<br />
unknown soldier. Zuvor hatte<br />
er als Beamter in der Sparkasse gearbeitet.<br />
Er war verheiratet und hatte ein kleines Kind.<br />
Ich glaube nicht, dass er freiwillig zur Armee<br />
gegangen ist, er war ein ganz gewöhnlicher<br />
Soldat. Man sagt, er sei zu Beginn des Krieges<br />
weggegangen, vermutlich im Jahr 1914, als er<br />
27 Jahre alt war. Das ist alles, was ich weiß.<br />
Mein Urgroßvater mütterlicherseits war ein<br />
Freiwilliger, ein Infanterist. Er meldete sich<br />
1914 freiwillig zum Krieg, ließ seine schwangere<br />
Frau zurück und fiel im Alter von einundzwanzig,<br />
gleich im August, in der ersten Schlacht<br />
des Ersten Weltkriegs, in der Schlacht von Cer<br />
bei Šabac. Von ihm blieben nur dieses Foto und<br />
ein Brief, der ein halbes Jahr nach seinem Tod<br />
ankam. Man weiß nicht, wo er begraben wurde.<br />
Wenn jemand Hinweise darüber hat, wo unsere<br />
gefallenen Soldaten nach der Schlacht von Cer<br />
begraben wurden, wäre ich sehr dankbar ...<br />
Natürlich ist Galizien noch lange nicht das<br />
Ende der Geschichte, denn keine Geschichte<br />
über den Krieg ist jemals zu Ende. Beziehungsweise<br />
über das Leben. Dem Vergessen zum<br />
Trotz, meinem, deinem, unserem, allgemeinem,<br />
erzwungenem oder freiwilligem Vergessen.<br />
Denn all das, unser Verbleib hier, ist nichts<br />
anderes als ein groß angelegter Versuch, die<br />
verstreuten Stücke eines unfertigen Puzzles<br />
zusammenzusetzen, eines Puzzles, das einen<br />
gigantischen Umhang für die gesamte Erde<br />
darstellen sollte. Aber dieser launische, aus<br />
Träumen gewebte Umhang, dessen Teilchen<br />
sich jeglicher Ordnung widersetzen, ist voller<br />
Leerstellen, die sich nicht füllen lassen, er ist<br />
allzu brüchig, zu stark verschlissen, um noch<br />
irgendetwas oder irgendjemanden umhüllen<br />
und beschützen zu können. Uns bleibt nur noch<br />
übrig, weiterhin im Lager seiner Bestandteile<br />
herumzuwühlen, in der Hoffnung, eines Tages<br />
doch noch die richtigen Teilchen zu finden und<br />
das Muster zu vervollständigen.<br />
Aus dem Kroatischen von<br />
Mascha Dabić<br />
Daša Drndić<br />
Geboren 1946 in Zagreb. Sie schrieb zwölf Prosabücher;<br />
ihr Roman Sonnenschein wurde in<br />
zehn Sprachen übertragen. Im Jahr 2013 kam<br />
der Roman Sonnenschein (in der englischen<br />
Übersetzung unter dem Titel Trieste) in die engere<br />
Auswahl für den Preis der Zeitschrift „Independent“<br />
für das beste fremdsprachige Buch.<br />
Filip Hameršak<br />
Die dunkle Seite des Mars<br />
1914–2014: Der Erste Weltkrieg aus<br />
kroatischer Perspektive<br />
Dieser Tage sind einige von uns in Kroatien<br />
mit den Gedenkveranstaltungen zum 100. Jahrestag<br />
des Ersten Weltkriegs befasst, und wenn<br />
wir uns mit Kollegen aus anderen europäischen<br />
Ländern abstimmen, wird uns bewusst, dass<br />
es keine einheitliche Perspektive auf dieses<br />
unglückliche Ereignis gibt. Die Perspektiven<br />
werden nicht nur durch den Verlauf nationaler<br />
Grenzen bestimmt, sondern unterscheiden sich<br />
auch durch ihre Methodik. Historiker, Publizisten,<br />
Literaturwissenschaftler und Politiker<br />
waren in den vergangenen Jahrzehnten uneins<br />
in der Deutung der Ursachen und Folgen des<br />
Krieges: darin, ob man einen Schuldigen ausmachen<br />
kann, aber auch darin, auf welchen<br />
Bereich wir uns konzentrieren sollten – diese<br />
oder jene Kampfarena, Politik, Wirtschaft oder<br />
Kultur, Taktik oder Technik, die Elite oder „gewöhnliche“<br />
Menschen.<br />
Ein Konsens scheint weder möglich noch<br />
erwünscht, würde er doch einen Grad an Homogenität<br />
voraussetzen, der unvereinbar ist<br />
mit der Freiheit der Wissenschaft. So birgt das<br />
Jubiläum 2014 die Gefahr einer Neubelebung<br />
alter Zwistigkeiten in sich, aber auch die Chance,<br />
unterschiedliche Sichtweisen endlich einmal<br />
in Ruhe zu diskutieren, und sei es nur aus<br />
Pietät gegenüber den Opfern auf allen Seiten.<br />
Doch wenn die Rede von nationalen Perspektiven<br />
ist, sollte man auch diese nicht als<br />
homogene Einheiten betrachten. Einer der gemeinsamen<br />
Nenner für kroatische Bürger ist,<br />
dass der Erste Weltkrieg für sie ein vergessener<br />
Krieg ist, wie jüngst der Historiker Višeslav Aralica<br />
lakonisch bemerkte. Der Zweite Weltkrieg,<br />
der auf heutigem kroatischem Staatsgebiet<br />
1941 begann und 1945 endete, wurde nicht als<br />
eine Fortsetzung des Krieges von 1914 bis 1918<br />
gesehen. Noch viel mehr gilt das für den Krieg<br />
um die kroatische Unabhängigkeit in der ersten<br />
Hälfte der 1990er Jahre. Diese beiden letzten<br />
Kriege sind in der kroatischen öffentlichen Erinnerung<br />
ungleich gegenwärtiger als der Erste<br />
Weltkrieg, nicht nur weil Betroffene noch leben<br />
oder weil sie größere Zerstörung hinterlassen<br />
haben, sondern weil mit ihnen Erinnerungsrituale<br />
verbunden sind, die vom Staat unterstützt<br />
werden.<br />
Im Gegensatz dazu wurde hinsichtlich der<br />
kroatischen Beteiligung am Ersten Weltkrieg<br />
weniger der Verlauf des Krieges und seine direkten<br />
Folgen für Soldaten und Zivilisten hervorgehoben,<br />
sondern der Zerfall Österreich-<br />
Ungarns und der Beitritt kroatischer Territorien<br />
zum neuen jugoslawischen Staat, zusammen<br />
mit dem ehemaligen Kriegsgegner, dem Königreich<br />
Serbien.<br />
Die offiziellen Erinnerungsrituale sowohl<br />
des royalen als auch des kommunistischen Jugoslawiens<br />
stützten sich auf die Erfahrungen<br />
der serbischen Armee und taten sich schwer<br />
damit, dass ein großer Teil der Bevölkerung des<br />
nun gemeinsamen Staates vier Jahre lang auf<br />
Seiten des „Aggressors“ gekämpft hatte. Geschichtswissenschaft,<br />
Publizistik und Literatur<br />
der ehemals zu Habsburg gehörenden Teile<br />
Jugoslawiens zeichneten sich dadurch aus,<br />
dass sie Tatsachen verschwiegen oder nur von<br />
einer Seite beleuchteten, wobei der Zwang zur<br />
Waffe und die Auflehnung von Kroaten, Serben,<br />
Slowenen und anderen Südslawen in den österreichisch-ungarischen<br />
Verbänden überbetont<br />
wurden.<br />
Doch auch hier gab es einige Unterschiede.<br />
Da Soldaten aus den Ländern der Habsburger<br />
Monarchie, die ethnisch Slowenen waren, nicht<br />
in serbische Kriegsgebiete geschickt wurden,<br />
sondern vorwiegend in Russland und Italien<br />
kämpften, was Slowenien nach 1947 einen Gebietszuwachs<br />
bescherte (das Isonzo-Tal, das für<br />
zwölf blutige Schlachten berühmt ist), war das<br />
Thema in Slowenien etwas weniger problembehaftet.<br />
Im Gegensatz dazu erinnerten auf dem<br />
Gebiet der ehemaligen jugoslawischen Republiken<br />
Kroatien und Bosnien und Herzegowina<br />
nur noch die infrastrukturellen Einrichtungen<br />
(Kasernen, Befestigungen etc.), die von allen<br />
nach 1918 begründeten Regimen weitergenutzt<br />
wurden, an die Zugehörigkeit zur Habsburger<br />
Monarchie.<br />
Hinzu kam, dass die österreichisch-ungarischen<br />
Soldaten aus den Gebieten des heutigen<br />
Kroatien und Bosnien und Herzegowina im<br />
Gegensatz zu ihren slowenischen Kameraden<br />
gleich 1914 nach Serbien geschickt wurden, wo<br />
sie 1915 zum Teil an der Besetzung des Landes<br />
teilnahmen.<br />
Das Gebiet des alten Kroatiens und Slawoniens<br />
(das sich größtenteils mit den nördlichen<br />
Gebieten des heutigen Kroatien deckt) nahm<br />
außerdem eine staatsrechtliche Sonderstellung<br />
ein, die auch für die dort stationierten ungarischen<br />
Honvéd- und österreichischen Landwehrverbände<br />
galt – das Recht auf kroatische<br />
Amtssprache, eigene Flagge, eigenen Eid und<br />
Ähnliches. Die Verbände dieser „Heimwehr“<br />
waren deshalb einzigartig und sie kennzeichneten<br />
- wenn auch nur symbolisch - innerhalb des<br />
engen Rahmens, den der „Ausgleich“ von 1867<br />
und 1868 vorgab, den Beginn einer modernen<br />
Nationalarmee.<br />
Als 1941 im Rahmen des Achsenbündnisses<br />
der Unabhängige Staat Kroatien gegründet<br />
wurde, vertraute man den Aufbau und die Organisation<br />
der regulären Armee ehemaligen<br />
österreichisch-ungarischen Offizieren an, die<br />
den Traditionen des vorangegangenen Krieges<br />
folgten und sogar die Bezeichnung „Heimwehr“<br />
verwendeten. Die Verbände der kroatischen<br />
Parallelarmee Ustaša, analog zur SS, waren<br />
wegen ihrer Kampfbereitschaft und Brutalität<br />
gegenüber Zivilisten weitaus bekannter. Auf jeden<br />
Fall trug diese persönliche und symbolische<br />
Kontinuität nicht dazu bei, die alte „Heimwehr“<br />
und die österreichisch-ungarischen Kampfverbände<br />
zu einem beliebten Forschungsgegenstand<br />
nach 1945 zu machen.<br />
Und eine Kuriosität hatte vielleicht entscheidenden<br />
Einfluss – bis zu seinem Tod im<br />
Jahr 1980 stand an der Spitze der jugoslawischen<br />
kommunistischen Partei der Kroate<br />
Josip Broz Tito, der 1914 als Offizier der Heimwehrverbände<br />
ebenfalls an den Kämpfen in<br />
Serbien teilgenommen hatte. Doch diese Angabe<br />
wurde in seinen Biographien systematisch<br />
ausgelassen. Grund dafür waren Animositäten<br />
der serbischen Bevölkerung gegenüber der<br />
„Schwabenarmee“, ausgelöst durch die Repressalien<br />
der Besatzungsverwaltung im Ersten<br />
Weltkrieg. Da Tito in Jugoslawien Objekt eines<br />
Personenkults war, ist es nicht ausgeschlossen,<br />
dass die Thematik von Südslawen als mehr oder<br />
weniger loyalen Soldaten in den österreichischungarischen<br />
Streitkräften als Wespennest galt,<br />
in das zu stechen zwar nicht verboten, aber<br />
auch nicht opportun war.<br />
Auf jeden Fall wurden bis 1990 nur wenige<br />
wissenschaftliche Arbeiten publiziert, die sich<br />
mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigten, und<br />
auch bei den übersetzten Werken sah es nicht<br />
besser aus. Abgesehen davon, dass mehr oder<br />
weniger prohabsburgisch orientierte Parteien<br />
und Personen nicht bearbeitet wurden,<br />
wie etwa die Generäle Svetozar Boroević und<br />
Stjepan Sarkotić, die an der Spitze Österreich-<br />
Ungarns standen, wurden auch Standardthemen<br />
gemieden, also solche, die frei waren<br />
von Ideologie, etwa die Rekonstruktion des<br />
allgemeinen Militärsystems, die Analyse der<br />
Kriegsentwicklung einzelner Einheiten oder<br />
die Dokumentation von Soldatenfriedhöfen<br />
und menschlichen und materiellen Verlusten.<br />
Schätzungen zufolge kamen 1914 bis 1918 zwischen<br />
80.000 und 120.000 Menschen aus dem<br />
heutigen kroatischen Staatsgebiet ums Leben,<br />
von denen viele in der heutigen Ukraine begraben<br />
liegen.<br />
Nach 1990 besserte sich die Forschungslage<br />
allmählich. Die Arbeit der Wissenschaftler<br />
konzentrierte sich zunächst auf die Untersuchung<br />
der prohabsburgischen Eliten, nicht zuletzt<br />
deshalb, weil Jugoslawien ebenso wie einst<br />
Österreich-Ungarn zerfiel und sich die Frage<br />
stellte, ob Jugoslawien nicht ein misslungenes<br />
Staatsexperiment war (in diesem Licht neigen<br />
einige Wissenschaftler dazu, die Habsburger<br />
Monarchie mit der Europäischen Union zu<br />
vergleichen, positiv zwar, aber auch besorgt um<br />
deren Zukunft). Erst allmählich, vor allem nach<br />
2000, beschäftigen sich Forscher im Einklang<br />
mit den neuesten methodologischen Trends in<br />
den Sozial- und Kulturwissenschaften auch mit<br />
anderen Aspekten des Krieges.<br />
Doch auch wenn sich Wissenschaftler viele<br />
Jahrzehnte lang nur zögerlich äußerten, war die<br />
literarische Tätigkeit der Veteranen wesentlich<br />
ausgeprägter. Die sichtbarste Spur hinterließen<br />
die Novellen und Dramen des berühmten<br />
Schriftstellers Miroslav Krleža, die auch ins<br />
Deutsche übersetzt wurden und die die Ereignisse<br />
1914 bis 1918 mit einer deutlichen antihabsburgischen<br />
und pazifistischen Botschaft<br />
versahen, dazu mit einer scharfen Kritik an<br />
der institutionalisierten Religion aus der Perspektive<br />
eines zerstreuten Intellektuellen, aber<br />
auch aus der eines ungebildeten, unpolitischen<br />
Bauern. Wegen ihrer künstlerischen Kraft, aber<br />
auch wegen des gesellschaftlichen Kontextes,<br />
wurden die Werke Krležas zum Synonym für<br />
die kroatische Perspektive.<br />
Im Gegensatz dazu blieben an die vierzig<br />
veröffentlichte autobiographische Bücher im<br />
weiter gefassten kroatischen Korpus, deren<br />
Autoren direkt am Krieg teilgenommen hatten<br />
(niedere Dienstgrade, Unteroffiziere, gewöhnliche<br />
Soldaten) bis vor Kurzem nahezu völlig<br />
unerforscht, auch wenn sie eine ausgezeichnete<br />
Basis für eine Herangehensweise „von<br />
unten“ bieten, wie sie beispielsweise bereits<br />
von J. Keegan, E. Leed, R. Holmes, W. Wette,<br />
O. Luthar, L. W. Smith und F. Rousseau angewendet<br />
wurde.<br />
Schaut man sich die Texte dieser 40 Autoren<br />
an, von denen die interessantesten in<br />
den 1930er Jahren veröffentlicht wurden (auf<br />
Deutsch sind nur die Erinnerungen des Berufsoffiziers<br />
Pero Blašković und des Österreichers<br />
Georg von Trapp, der in der dalmatinischen<br />
Stadt Zadar geboren und im Film Meine Lieder<br />
– Meine Träume porträtiert wurde, zugänglich),<br />
kann man feststellen, dass sich diese scheinbar<br />
homogene kroatische Perspektive in Wirklichkeit<br />
in eine Vielzahl persönlicher Standpunkte<br />
verzweigt.<br />
Einige dieser Einblicke bestätigen Krležas<br />
Beobachtungen, andere stehen im Gegensatz<br />
zu ihnen. So waren zwar nur wenige Kriegsteilnehmer<br />
mit der Stellung Kroatiens in der Monarchie<br />
zufrieden, es gab jedoch nur wenige, die<br />
sich eine Abspaltung oder gar eine Vereinigung<br />
mit den Serben wünschten. Die meisten Soldaten<br />
konnten nicht einmal lesen und schreiben<br />
und hatten nur verschwommene Vorstellungen,<br />
wobei die Ergebenheit gegenüber Franz<br />
Joseph dominierte.<br />
Im Verlauf des Krieges wurde bei vielen der<br />
Begriff der Ehre – obwohl sich die Propaganda<br />
verstärkte – vom Begriff Eigeninteresse verdrängt,<br />
sei es auf nationaler (eine unabhängige<br />
kroatische Republik) oder auf persönlicher<br />
Ebene (bedingungslose Rückkehr nach Hause).<br />
Ähnliche Veränderungen kann man in den<br />
Autobiographien auch auf anderen Gebieten<br />
verfolgen – es veränderte sich nicht nur die<br />
Motivation der Soldaten, sondern auch ihr Verhältnis<br />
zu den Kameraden, dem Feind, Stress,<br />
Zivilisten, Sexualität, Religion oder Alkohol.<br />
Aus dem Kroatischen von<br />
Blanka Stipetić<br />
Filip Hameršak<br />
Geboren 1975 in Zagreb / Kroatien. Er studierte<br />
Jura, Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft<br />
in Zagreb. 2013 promovierte er<br />
mit einer Arbeit über kroatische Autobiographien<br />
und den Ersten Weltkrieg, die vor kurzem<br />
unter dem Titel Tamna strana Marsa (Die<br />
dunkle Seite des Mars) erschienen ist.<br />
Beton International März 2014 9
dem Baby und zwei bettlägerigen Greisen im<br />
verlassenen Dorf.<br />
Die Geschichte jagt mir bis heute Schauer<br />
über den Rücken. Ich verstehe Großmutters<br />
Entschlossenheit gut, aber ihr Mut raubt mir<br />
immer wieder aufs Neue die Fassung. Den Ersten<br />
Weltkrieg hatte sie als Baby überlebt, im<br />
Zweiten hat sie ihr Baby gerettet. Großmutters<br />
Durchhaltevermögen verdanke ich mein Leben,<br />
was mir ermöglicht, ihr und dem Augenblick, in<br />
dem sie beschloss, Papa nicht zurückzulassen,<br />
dieses kleine Denkmal zu schreiben.<br />
Überlebt hat sie dank Sekul, einem serbischen<br />
Nachbarn, der ihr half, mit dem Kind<br />
durch die Kontrollen zu kommen und sich zu<br />
Fuß zum nächstgelegenen freien Territorium<br />
durchzuschlagen. Mit dem Dorf wollte sie<br />
nichts mehr zu tun haben. Nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg wurden Flüchtlinge gesetzlich verpflichtet,<br />
dahin zurückzugehen, wo sie vor dem<br />
Krieg gewohnt hatten. Doch Großmutter zog<br />
mit der Familie, so schnell es eben ging, nach<br />
Sarajevo. Jahrzehntelang waren sie dort nicht<br />
gemeldet, damit die übereifrige sozialistische<br />
Regierung sie nicht in ein Dorf zurückschickte,<br />
in dem sie mit knapper Not dem Tod entgangen<br />
waren. Bis zum heutigen Tag hat meine Familie<br />
deswegen Scherereien mit der Bürokratie. Egal<br />
welches Dokument mein Vater benötigt, die Beschaffung<br />
artet zu einer Odyssee aus. Obwohl er<br />
seit beinahe siebzig Jahren in der Stadt wohnt,<br />
fehlen ihm oft die Papiere, um es zu beweisen.<br />
Adisa Bašić<br />
Mama, Papa, der Jahrgang 1914<br />
und ich (um Gavrilo erst gar<br />
nicht zu erwähnen)<br />
1. Abzählreim<br />
„Ich bin noch nicht dran. Hadschi Šefik<br />
kommt vor mir, der ist 1911 geboren. Dann die<br />
Sulejmaniginica, Jahrgang 1912. Frau Lauka<br />
1913, und dann erst ich mit 1914.“ Wir alle wussten,<br />
dass die Großmutter Jahrgang 1914 war, wir<br />
kannten ihre halb scherzhafte Aufzählung, wer<br />
in der Straße älter war als sie bzw. sterben sollte,<br />
bevor sie diese Welt verließ. Das war in einer<br />
Zeit, als wir mit einem, wie wir glaubten, unerschütterlichen<br />
Gefühl für Ordnung und Anstand<br />
lebten, an das man sich selbst bei der Reihenfolge<br />
im Sterben tunlichst zu halten hatte.<br />
Über Omas Geburt ist wenig bekannt. In unserer<br />
Gegend herrscht ein chronischer Mangel<br />
an lebenden Zeitzeugen, die sich zuverlässig zu<br />
Ereignissen äußern könnten, an die man selbst<br />
keine Erinnerung haben kann. 1914 war die<br />
Geburt eines Mädchens wahrscheinlich kein<br />
besonderer Grund zur Freude, aber die Großmutter<br />
war das erste Kind ihrer Eltern, also<br />
stelle ich mir vor, dass ihr Auf-die-Welt-Kommen<br />
doch etwas Besonderes war. Ihr Vater war<br />
einige Jahre beim österreichisch-ungarischen<br />
Heer, die Großmutter wurde bei seinem letzten<br />
Urlaub kurz vor der Entlassung gezeugt. Kaum<br />
zurück zu Hause, kaum dass sein erstes Kind da<br />
war, musste er in den Krieg ziehen, der ihn für<br />
weitere vier Jahre nach Bosnien verschlug.<br />
„Erst Hadschi Šefik, der ist 1911. Dann die<br />
Sulejmaniginica, die ist 1912. Frau Lauka ist<br />
1913. Und dann erst ich, 1914“, sagte die Großmutter<br />
jahrelang, und dann verschwanden die<br />
Nachbarn aus ihrem Abzählreim. Nicht genau<br />
in der Reihenfolge, in der sie sie aufzählte, aber<br />
alle drei vor ihr. Als wir sie damit aufzuziehen<br />
begannen, dass sie jetzt keine Ausrede mehr<br />
hätte, brach der Krieg aus, der dritte in ihrem<br />
Leben. Die Großmutter verlor eine Tochter und<br />
zwei Enkel. Die Geschichte von der Reihenfolge,<br />
in der man sterben sollte, bekam einen bitteren<br />
Beigeschmack; die Großmutter hat sie nicht<br />
mehr wiederholt.<br />
2. Erfundene Geburtstage<br />
Mich interessierte das genaue Geburtsdatum<br />
der Großmutter, also fragte ich ihren Sohn,<br />
meinen Papa: „An welchem Tag hatte Großmutter<br />
eigentlich Geburtstag“ Er ist inzwischen<br />
selbst über siebzig, seine Erinnerung lahmt<br />
manchmal, aber diese Antwort kam wie aus der<br />
Pistole geschossen: „Am 25. Mai, am Tag der Jugend<br />
und Titos Geburtstag!“ Gewohnt, dass er<br />
mit Daten aus der Vergangenheit zögernd und<br />
unsicher herausrückte, verblüffte mich seine<br />
Gewissheit. Er ist im Herbst 1942 geboren, aber<br />
keiner weiß das genaue Datum. Auf dem Land<br />
wurde ein Neugeborenes erst nach einiger Zeit<br />
ins Geburtsregister eingetragen, erst wenn die<br />
Familie dachte, es würde überleben, und wenn<br />
einer sowieso etwas in der nächstgelegenen<br />
Stadt zu tun hatte und den Behördengang nebenbei<br />
miterledigen konnte. Wir feiern Papas<br />
Geburtstag am 21. Oktober, aber dieses Datum<br />
ist Fiktion, genauer eine Rekonstruktion, gewonnen<br />
durch eine einfache Rechnung: Als<br />
die Muslime 1942 aus Papas Heimatdorf flohen,<br />
weil es hieß, die Tschetniks wären im Anmarsch,<br />
war Papa ein rund vierzig Tage altes<br />
Baby. Die Flucht war am Tag vor Neujahr. So<br />
kam es zu dem unzuverlässigen Datum von Papas<br />
Geburtstag.<br />
„Aber woher wissen wir, dass Großmutter<br />
genau am 25. Mai 1914 geboren wurde“, fragte<br />
ich. Papa ließ mich nicht lange raten. „In den<br />
1970ern hat sie sich einen Personalausweis besorgt<br />
und musste ein genaues Datum in das Formular<br />
eintragen, und da habe ich mir das ausgedacht,<br />
ich fand es schön, dass sie im Frühjahr<br />
und am selben Tag wie Tito Geburtstag haben<br />
würde.“ Ob Titos Geburtsdatum glaubwürdig<br />
ist, daran habe ich auch so meine Zweifel, das<br />
verstärkte mein Interesse an Papas Einfall nur<br />
noch. „Und das hast du dem Beamten einfach<br />
so mitgeteilt“ „Aber nein.“ Papa holte zu einer<br />
umfassenden Erklärung aus. „Ich habe das Datum<br />
eigenhändig in die Geburtsurkunde eingetragen,<br />
denn da stand nichts, aber im Gemeindeamt<br />
wollten sie partout eine genaue Angabe.<br />
Ich habe einen Füllfederhalter benutzt, dann<br />
einen Wattebausch mit Ammoniakreiniger beträufelt<br />
und die Schrift damit abgetupft. Die<br />
neue Tinte bleichte aus und sah dann genauso<br />
alt aus wie die anderen Einträge in der Geburtsurkunde.“<br />
Papa als hemmungsloser, gewiefter Fälscher<br />
– das war mir vollkommen neu. Mein<br />
Bruder und ich hörten zu und staunten nicht<br />
schlecht. Eine ganz neue Seite an unserem Vater<br />
kam da zum Vorschein. Innerfamiliär galt er<br />
glasklar als Musterknabe. Trotz Armut, schwieriger<br />
Familienverhältnisse und dem Zwang, von<br />
frühester Jugend an Geld zu verdienen, war er<br />
ein hervorragender Schüler und guter Sportler.<br />
Über Jahrzehnte schmückte ein Foto, das ihn<br />
als Pionierleiter zeigt, die Aula seiner Grundschule.<br />
Generationen unserer nicht weniger<br />
brillanten, fleißigen Schüler mussten sich davor<br />
die Frage gefallen lassen, ob sie sich nicht<br />
vor dem Mann schämten, an dem sie sich ein<br />
Vorbild nehmen sollten. Papa war das Vorbild,<br />
das in der Aula hing, und auf einmal enttarnte<br />
er sich als Fälscher, der mit einem Wattebausch<br />
Tinte auf Omas Geburtsurkunde aufgehellt und<br />
sich der Bürokratie zuliebe ein Geburtsdatum<br />
für sie ausgedacht hatte.<br />
Aber 1914 ist zu lang her, als dass man in<br />
unserer Gegend irgendetwas mit Gewissheit<br />
feststellen könnte. Auch nicht für 1942. Wir haben<br />
es nicht so mit exakten Daten, von unserer<br />
Vergangenheit erfahren wir durch mündliche<br />
Überlieferung. Papa brach das Gesetz für seine<br />
Mama: Erst als ich das begriffen hatte, glaubte<br />
ich es auch. Die beiden hatten schon immer<br />
ein sehr besonderes Verhältnis. Auch darüber<br />
haben wir familieninterne Anekdoten. Die uns<br />
geläufigste ist die Geschichte von der Flucht.<br />
Großmutter wurde 1914 geboren, und ihr<br />
Vater überlebte wie durch ein Wunder den<br />
Krieg, konnte sich nach Hause durchschlagen<br />
und weiterhin für die Familie sorgen. Eine<br />
Zeitlang arbeitete er in einem Sägewerk, um<br />
das herum unter den Habsburgern eine regelrechte<br />
Kleinstadt herangewachsen war. Straße,<br />
Bahnlinie, Sägewerk, Post, das war die Welt,<br />
in der meine Großmutter als junges Mädchen<br />
lebte. Die Ehe verschlug sie dann in eine recht<br />
abgelegene Gebirgsregion, ein Bergdorf, in dem<br />
sie 1942 ihr erstes männliches Kind zur Welt<br />
brachte, meinen Vater. Und damit sind wir wieder<br />
beim Neujahr 1943, als die Muslime aus dem<br />
Dorf flohen. Alle packten in aller Eile und voller<br />
Angst, und dann ereilte die Großmutter die niederschmetternde<br />
Nachricht: Für das Baby war<br />
in der Kolonne kein Platz. Einige Bauern hatten<br />
die Verantwortung übernommen, die Leute auf<br />
geheimen Wegen durch den Wald zu führen.<br />
Ein Baby wäre ein zu hohes Risiko gewesen, es<br />
hätte mit seinem Weinen die ganze Gruppe verraten<br />
können. Die Großmutter selbst und ihre<br />
älteren Töchtern durften mit, aber den neugeborenen<br />
Sohn musste sie im Dorf lassen und<br />
dem sicheren Tod preisgegeben. Der Moment<br />
des Aufbruchs rückte immer näher, und meine<br />
Großmutter hatte sich klar entschieden. Ihre<br />
Töchter, die schon laufen konnten, schickte sie<br />
mit Verwandten auf die Flucht. Sie blieb mit<br />
3. Gavrilos Fusabdruck<br />
Als ich ein kleines Mädchen war, hat mich<br />
Papa oft zu Spaziergängen mitgenommen. Er<br />
hatte Zeit für meine tausend Fragen, antwortete<br />
geduldig und erschöpfend. Gewöhnlich<br />
nahm er mich zu Orten mit, die ihn interessierten,<br />
und mit der Zeit übertrug sich seine<br />
Begeisterung auf mich. Mein Vater ist Handwerker<br />
und liebte Elektrotehne, ein Geschäft<br />
mit Werkzeugen, Schrauben, Rohren und ähnlichen<br />
Dingen. Mit sieben Jahren kannte ich<br />
Worte wie Zollstock, Schraubstock, Rohrzange,<br />
Isolierband...<br />
Am liebsten war es mir aber doch, wenn wir<br />
die Oma besuchten, Papas Mama. Mit der Straßenbahn<br />
fuhren wir bis zur Princip-Brücke.<br />
Ich war noch ganz klein, da wusste ich schon<br />
ganz genau, wo wir aussteigen mussten, um<br />
zur Großmutter zu gehen. Die Brücke hatte ein<br />
grünliches Geländer, dessen Form an alte Radiatoren<br />
erinnerte. Es sah aus, als wäre sie zu<br />
beiden Seiten von einem langen gusseisernen<br />
Heizkörper mit unzähligen Rippen gesäumt.<br />
Papa erklärte mir während der Tramfahrt,<br />
die immer entlang der Miljacka führte, wie die<br />
einzelnen Brücken über den Fluss hießen. „Das<br />
ist die Drvenija, die Hölzerne, siehst du, denn<br />
sie ist ganz aus Holz … Das ist die Ćumurija, die<br />
Holzkohlenbrücke, da haben die Leute Holzkohle<br />
drüber getragen … Das ist die Princip-<br />
Brücke, die ist nach Gavrilo Princip benannt …“<br />
Später lernte ich, wer Gavrilo Princip gewesen<br />
war, damals war es mir gleichgültig. Ich hatte<br />
keine Ahnung, was auf dieser Brücke geschehen<br />
war, aber Papa zeigte mir einen Fußabdruck im<br />
Beton. Jedes Mal, wenn wir die Großmutter<br />
besuchten, gingen wir daran vorbei. Als ich ein<br />
bisschen größer war, fragte ich Papa, wer den<br />
Fußabdruck hinterlassen habe. „Hier stand der<br />
Mann, der den Thronfolger Franz Ferdinand<br />
und dessen Frau getötet hat“, sagte Papa trocken.<br />
Geschichte interessierte ihn nicht sonderlich.<br />
Viel spannender fand er das Geschäft<br />
für Kunsthandwerkerbedarf in der Nähe, dort<br />
blieben wir deutlich länger als bei Gavrilos Fußabdruck.<br />
Ich war voller Zweifel. So viel Zufall wollte<br />
mir nicht in den Kopf: Ausgerechnet die einzige<br />
Stelle, an der der Beton frisch gegossen war, soll<br />
sich dieser Mann ausgesucht haben, um jemanden<br />
umzubringen. Wer hinterlässt denn seinen<br />
Fußabdruck zum Beweis und zur Erinnerung an<br />
eine solche Tat! In meinem kindlichen Verstand<br />
wirkte das spektakulär. So ein Zufall kann nicht<br />
sein, dachte ich und bewunderte es gleichzeitig,<br />
dass wir ein so einmaliges historisches Zeugnis<br />
bekommen hatten. Komisch fand ich es aber<br />
doch, dass Gavrilo so ein Tollpatsch war, nicht<br />
zu schauen, wo er sich hinstellte.<br />
Lange glaubte ich, der Fußabdruck neben<br />
der Princip-Brücke sei vom echten Gavrilo,<br />
aber entmutigt von Vaters fehlendem Interesse<br />
an dem Thema fragte ich nicht groß nach.<br />
Bei einem der unzähligen Male, als wir daran<br />
vorbeigingen, wollte ich seine Meinung über<br />
das Denkmal erfahren. Konkret fragte ich, ob<br />
es 1914 wirklich schon Beton gegeben habe und<br />
warum die Leute damals nur diesen kleinen<br />
Fleck betoniert hätten, in den Gavrilo dann getreten<br />
sei. Papa sah mich erst an, ohne zu verstehen,<br />
was ich meinte, und brach dann in Lachen<br />
aus. Er erklärte, es sei eine Replik von Gavrilos<br />
Beton International März 2014 10
Fußabdruck (das Wort habe ich damals zum ersten<br />
Mal gehört und mir gemerkt). Irgendein<br />
Arbeiter sei mit seinem Schuh in frischen Beton<br />
getreten, um die genaue Stelle zu markieren,<br />
von der aus Gavrilo geschossen hatte. Ich fühlte<br />
mich betrogen. Das Denkmal erschien mir wie<br />
eine Fälschung. Meine Wut richtete sich gegen<br />
Papa; ich glaubte, er hätte mich absichtlich zum<br />
Narren gehalten und den Irrtum nicht aufgeklärt.<br />
In Wirklichkeit war ich wütend, weil ich<br />
vor Papa als Närrin dastand. Er vergaß die Geschichte<br />
zum Glück schnell und erzählte sie keinem<br />
weiter, aber ich schämte mich noch etliche<br />
Jahre für dieses Missverständnis.<br />
Nach der Jahrtausendwende beschäftigte<br />
ich mich noch einmal mit Gavrilo: Als frisch<br />
gebackene Journalistin bekam ich die Aufgabe,<br />
das Schicksal zweier Denkmäler nachzuzeichnen,<br />
die an das Attentat von Sarajevo erinnerten.<br />
Gavrilos Fußabdruck war infolge der neu<br />
ausgerichteten historischen Optik unattraktiv<br />
geworden. Die Handwerker, die mit der Überarbeitung<br />
von Vergangenheit und Gegenwart beauftragt<br />
waren, rissen im Eifer des Gefechts die<br />
Betonplatte aus dem Trottoir. Fünfzehn Jahre<br />
lang verstaubte sie irgendwo und fand dann im<br />
umgestalteten Museum über das Attentat einen<br />
Platz, allerdings nicht als Exponat: Sie steht<br />
kommentarlos in der Ecke bei der Kasse am<br />
Eingang. Mit keinem Wort ist erklärt, wann und<br />
wie die Replik entstand oder wann und warum<br />
sie entfernt wurde. Die Touristen machen im<br />
Wesentlichen einen Bogen um den Betonklotz;<br />
ich verweile etwas länger, schließlich teilen er<br />
und ich gemeinsame Erinnerungen.<br />
Das andere Denkmal, das heute nicht mehr<br />
neben der ehemaligen Princip-Brücke steht, ist<br />
der Obelisk, der zur Erinnerung an die Opfer<br />
des Attentats aufgestellt wurde. Als die Donaumonarchie<br />
von der historischen Bühne abtrat,<br />
wurde er zu einem Riesendorn im Auge der<br />
neuen Herren und deshalb entfernt. Mein Fotograf<br />
und ich hatten einige Mühe, die Überreste<br />
aufzuspüren: In Einzelteile zerschlagen war er<br />
im ehemaligen Aufzugsschacht der Kunstgalerie<br />
deponiert worden. Auch über dieses Denkmal<br />
erfahren weder Touristen noch Besucher<br />
der Galerie etwas. Sie können es nicht einmal<br />
sehen.<br />
Mein Artikel gipfelte in dem Vorschlag, beide<br />
Denkmäler mit je einer Erklärung wieder an<br />
ihrem ursprünglichen Ort aufzustellen. Interessiert<br />
hat das kaum jemanden. Der Redakteur<br />
lobte die Fotos, den Text hat er wahrscheinlich<br />
nicht bis zum Ende gelesen.<br />
Meine Entdeckung nutzte ich dennoch<br />
ein paar Jahre später anlässlich einer wissenschaftlichen<br />
Konferenz zum Thema kulturelles<br />
Gedächtnis. Ein großserbischer Kunsthistoriker<br />
trauerte um das Denkmal für den Attentäter.<br />
Er verteidigte Gavrilos Idee, rechtfertigte<br />
seine Tat, hielt ihn für einen Helden, nicht für<br />
einen Terroristen. Ich war da anderer Meinung,<br />
aber der Kunsthistoriker war ein hübscher Kerl<br />
und ich ließ ihn seine Theorie weitschweifig<br />
erklären. Nach der Sitzung forderte ich ihn<br />
auf, seine Überlegungen im Detail darzulegen.<br />
Andere Konferenzteilnehmer widersprachen<br />
höflich, aber bestimmt, sie argumentierten, einen<br />
Mord zu romantisieren sei nicht angezeigt.<br />
Ich erzählte vom Schicksal der beiden Denkmäler<br />
und stellte die Forderung in den Raum,<br />
sie an ihren alten Ort zurückzustellen, um so<br />
die verschiedenen Sichtweisen auf die Ereignisse<br />
in den letzten hundert Jahren erlebbar<br />
zu machen. Eine ehrgeizige Postdiplomandin<br />
kritisierte den Vorschlag als unausführbar: Wir<br />
müssten gegenüber der Vergangenheit Position<br />
beziehen, behauptete sie, da könne es nicht angehen,<br />
alle im Laufe der Geschichte abgerissenen<br />
Denkmäler wieder hinzustellen. Mein Ehrgeiz<br />
richtete sich gar nicht auf alle Denkmäler<br />
der Welt, sondern auf diese beiden konkreten,<br />
aber sie verallgemeinerte meine Idee, um sie<br />
als kolossale Dummheit herauszustreichen.<br />
Ich hörte mir ihre Argumente an und blieb bei<br />
meinem ursprünglichen Vorschlag. Mir gefiel<br />
die Geschichte von den Denkmälern, ihrer Aufstellung,<br />
ihrer Entfernung, dem Verstecken und<br />
Verschweigen. Von meinem einstigen Missverständnis<br />
mit Gavrilos Fußabdruck habe ich<br />
niemandem erzählt.<br />
Aus dem Bosnischen von<br />
Brigitte Döbert<br />
Adisa Bašić<br />
Geboren 1979 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina.<br />
Sie arbeitet als Journalistin und<br />
Literaturkritikerin für die Wochenzeitschrift<br />
Slobodna Bosna (www.slobodna-bosna.ba). Sie<br />
war DAAD-Stipendiatin. Die Lyrikerin gewann<br />
2012 den Preis „Bank Austria Literaris“ für ihren<br />
Gedichtband Ein Werbespot für meine Heimat<br />
(Wieser Verlag, 2012)<br />
Aleš Debeljak<br />
Grenzen,<br />
Nationalismen und das<br />
gemeinsame Europa<br />
Auf Einladung des Instituts für die Wissenschaften<br />
vom Menschen zog ich in den neunten<br />
Bezirk in Wien. Wie jeder Neuankömmling<br />
begann ich sogleich, mich mit meiner neuen<br />
Umgebung vertraut zu machen: Hier ist das<br />
Geschäft, dort die U-Bahn und die Straßenbahnhaltestelle,<br />
da das Kaffeehaus und der<br />
Frisör, dort die Bank und die Post. Dem Viertel<br />
war nichts anzukreiden. Es hatte alles, was<br />
wir Bewohner zur Befriedigung all unserer<br />
Bedürfnisse benötigten, wenn nicht gar all unserer<br />
Wünsche. Der Bezirk hatte dabei nicht<br />
nur seine Einrichtungen und Institutionen; er<br />
hatte auch seine Grenzen. Seine Geografie war<br />
leicht zu eruieren, da die Gassen, Plätze und<br />
Straßen in der Stadt denselben Zweck haben<br />
wie Flüsse, Bergketten und Meeresküsten in<br />
der Natur.<br />
Die äußeren Grenzen des Alsergrunds, so<br />
heißt der Bezirk nämlich, sind deutlich erkennbar<br />
und unmissverständlich. Im Nordwesten<br />
wird er vom Gürtel und im Osten vom Donaukanal<br />
begrenzt, im Süden dagegen zieht sich die<br />
Grenze an den drei großen Straßen Maria-Theresien-Straße,<br />
Universitätsstraße und Alser<br />
Straße entlang.<br />
Gegenüber dem kleinen Biedermeierhaus,<br />
das ich ganz in der Nähe der Lichtentaler Pfarrkirche<br />
bewohne, in der Franz Schubert getauft<br />
wurde, liegt ein weitläufiger Park. In der Nachmittagssonne<br />
des späten Septembertags klettern<br />
Kinder auf den Spielgeräten herum, die<br />
Kleineren wühlen im Sandkasten, während die<br />
Jugendlichen ein paar Körbe werfen. Die Tischtennisplatten<br />
stehen einsam und verlassen da.<br />
Die Zelluloidbälle würden von dem recht anständigen<br />
Lüftchen ohnehin zu sehr umhergewirbelt.<br />
Unter den Kindern und Erwachsenen,<br />
unter den wachsamen Augen der Eltern und<br />
unter den Dauerspaziergängern gibt es wohl<br />
nicht viele, die die Grenzen des Bezirkes auch<br />
nur im Geringsten interessieren würden.<br />
Deutsche, polnische, türkische und kroatische<br />
Rufe erfüllen die milde Luft und ich würde<br />
wetten, dass viele Parkbesucher, die ich heute<br />
betrachte, einst auf der Suche nach einem besseren<br />
Leben und mehr Sicherheit viel wichtigere<br />
Grenzen passieren mussten. Mehr noch:<br />
Wenn wir unter Europäern Menschen verstehen,<br />
die auf diesem Kontinent mehr als ein<br />
sprachliches und kulturelles Verständnis zur<br />
Verfügung haben, dann sind Europäer im besten<br />
Sinne des Wortes ausgerechnet Migranten.<br />
Ich sitze auf einer grün gestrichenen Bank.<br />
Mein Fahrrad lehnt an dem schmalen Metallmast<br />
eines Schildes, das Hundebesitzer auf eine<br />
unweit gelegene Hundewiese verweist. Ich sitze<br />
da und beobachte, sitze da und gebe mich meinen<br />
Tagträumen hin, vielleicht auch meinen<br />
Bedenken. Wahrlich, nichts hat den Europäern<br />
in der Geschichte ihres Daseins so viel Übel beschert<br />
wie die Grenzfrage. Europäische Grenzen<br />
waren nämlich noch nie deutlich erkennbar<br />
und unmissverständlich.<br />
Von diesem Blickpunkt gesehen ist und<br />
bleibt Europa weiterhin schlechter ausgestattet<br />
als etwa Stadtbezirke wie der Alsergrund. Während<br />
die Natur auf diesem Kontinent mit den<br />
Küsten des Mittelmeers im Süden sowie dem<br />
Atlantik im Westen und Norden für geografische<br />
Abgrenzungen gesorgt hatte, stellte die<br />
weiche Flanke im Osten ein ernstes Problem<br />
dar. Offene Ebenen und weite getreidereiche<br />
Felder bieten leider keinerlei „natürliche“ Stütze<br />
beim Bestimmen der Grenzen und der Kontrolle<br />
eines Landes.<br />
Im Wettlauf um die Kontrolle eines Landes<br />
liegt der ursprüngliche Auslöser aller europäischen<br />
Konflikte und Gefechte. Europa<br />
muss nämlich wie eine Enzyklopädie von Völkerwanderungen<br />
und Eroberungen gelesen<br />
werden, von Vertreibungen und Besatzungen,<br />
von Pogromen und Ausrottung. Es handelt<br />
sich dabei nicht nur um längst vergangene<br />
Schlachten, nicht nur um die alten Griechen<br />
und Perser, um mittelalterliche Christen und<br />
Muslime, sondern um die jüngste Geschichte,<br />
die nicht unwesentlich auf unser leibhaftiges<br />
Jetzt einwirkt.<br />
Unser leibhaftiges Jetzt ist vom Aufstieg<br />
des Nationalismus definiert. Die liberale und<br />
emanzipatorische Ideologie des 19. Jahrhunderts,<br />
die gegen aristokratische und kirchliche<br />
Privilegien ankämpfte, kehrte sich im 20. Jahrhundert<br />
in eine „exklusivistische“ Ideologie<br />
um. Es galt, der Freiheit des Volkes Vorrang zu<br />
geben vor der Freiheit des Einzelnen. Warum<br />
ist Nationalismus anziehend Weil er sich auf<br />
eine einfache Formel verdichten lässt, die die<br />
Welt in „wir“ und „die anderen“ teilt. Der Nationalismus<br />
macht den Menschen mit seinem Aufruf<br />
zur heimatliebenden Wachsamkeit größer,<br />
als er in Wirklichkeit ist. Das Volk wird zu einer<br />
metaphysischen Idee, die unter Verwendung aller<br />
Mittel, auch der moralisch verwerflichsten,<br />
gesichert werden soll.<br />
Kein Opfer ist dafür zu groß. Das wusste<br />
auch der junge serbische Nationalist Gavrilo<br />
Princip nur zu gut, als er am 28. Juni 1914 in Sarajevo<br />
seinen Revolver auf den österreichischen<br />
Erzherzog und Thronfolger Franz Ferdinand<br />
richtete. In der damaligen internationalen Öffentlichkeit<br />
gingen zahlreiche Erklärungen für<br />
dieses Ereignis um. Für manche stellte es ein<br />
revolutionäres Signal für den Beginn des Zerfalls<br />
des österreichisch-ungarischen „Völkerkerkers“<br />
dar, für andere wiederum war es ein<br />
Zeichen nationalistischen Terrors. Die einen<br />
verurteilten die Gewalt des Pöbels, während die<br />
anderen den Volksaufstand als Befreiung vom<br />
kaiserlichen Stiefel bejubelten.<br />
Niemand jedoch erwartete die völlige Umwälzung<br />
der europäischen Landkarte, die vier<br />
Jahre nach dem Schuss in Sarajevo erfolgte.<br />
Die Ideologie des romantischen Nationalismus,<br />
der ohne Rücksicht auf „die anderen“ und „andere“<br />
forderte, dass jede Nation ihre politische<br />
Souveränität zu erhalten habe, siegte. Der Nationalstaat<br />
wurde nach dem Ende des Ersten<br />
Weltkrieges die Grundeinheit internationaler<br />
Beziehungen schlechthin. Es gelang dem Nationalismus,<br />
die vorhergehenden Formen von<br />
Beziehungen und Verbindungen (sei es beruflichen,<br />
status- oder ortsbezogenen) unter<br />
Einzelpersonen und der breiteren Gesellschaft<br />
erfolgreich zu verdrängen, da er sich als das<br />
Nonplusultra des Gemeinschaftssinns auf einem<br />
bestimmten Territorium durchsetzte.<br />
Es ging nämlich immer nur um Territorien.<br />
Das scheint gerade durch den Erfolg des Nationalismus<br />
selbstverständlich. Aber betrachten<br />
wir doch einmal das Schicksal der europäischen<br />
Roma und Sinti, und wir werden alsbald bemerken,<br />
wie verhängnisvoll die Vorstellung von der<br />
Kontrolle über Grenzen sein kann! Die Gedanken-<br />
und Gefühlswelt der europäischen Halbnomaden<br />
ist vollkommen anders als die des Nationalismus,<br />
da sie keine Forderung nach einem<br />
eigenen Gebiet und dessen Selbstverwaltung<br />
stellt. Obwohl sie über ein Drittel der Staaten<br />
auf diesem Kontinent bewohnen, suchen wir<br />
sie vergeblich in den Vorstellungen, die Nationalstaaten<br />
von sich pflegen.<br />
Blut und Boden – das war der laute Schlachtruf<br />
des kriegsführenden Nationalismus im vergangenen<br />
Jahrhundert. Eine führende Rolle<br />
spielte er aber auch beim Zerfall des zweiten<br />
Jugoslawiens. Noch heute gibt es allerdings keinen<br />
europäischen Nationalstaat, der tatsächlich<br />
nur von Angehörigen eines Volkes bevölkert<br />
wäre. Das Zusammenleben ist also unser<br />
Schicksal. Die Frage, in welchem politischen<br />
Rahmen es verläuft, bleibt dagegen immer noch<br />
offen.<br />
Die Europäische Union ist der aktuelle,<br />
nicht aber der erste Versuch, die Grenzen nationaler<br />
Exklusivismen zu überwinden und<br />
sich auf die Suche nach politischem Miteinander<br />
zwischen kulturell verschiedenen Gemeinschaften<br />
zu begeben. Die k. u. k. Monarchie ist<br />
ein schönes Beispiel dafür. Unter anderen Umständen<br />
bestätigte sie jenes (selbe) politische<br />
Ziel, das wir heute unter dem europäischen<br />
Motto „In Vielfalt geeint“ kennen.<br />
Der multilinguale Vielvölkerorganismus,<br />
in dem religiöse Pluralität herrschte und der<br />
in seiner letzten Verkörperung den Namen<br />
„Österreichisch-Ungarische Monarchie“ trug,<br />
überdauerte ununterbrochene sechs Jahrhunderte,<br />
also dreimal so lang wie die Vereinigten<br />
Staaten und zehnmal länger als das europäische<br />
Vereinigungsprojekt. Seine politische Kultur<br />
wirkte unter dem Druck von Reformen und<br />
Kompromissen. Der Kompromiss mit der ungarischen<br />
Elite des Jahres 1867 – und in Galizien<br />
mit Polen – stelle einen handfesten Beweis<br />
der flexiblen habsburgischen Politik dar, so der<br />
amerikanische Historiker Timothy Snyder bei<br />
einer Konferenz mit dem Titel „The Political<br />
Logics of Disintegration: The Habsburg and the<br />
Yugoslav Experiences“, die im Oktober 2012 am<br />
Institut für die Wissenschaften vom Menschen<br />
in neunten Wiener Bezirk stattfand.<br />
Die Suche nach einem Kompromiss, bei der<br />
man die Verantwortlichen an einen Tisch setzt<br />
und ihnen keine Möglichkeit gibt, zu entkommen,<br />
bevor sie eine annehmbare Lösung gefunden<br />
haben, war für die Habsburger gewiss eine<br />
langweilige Angelegenheit, möglicherweise<br />
sogar ein mühseliger diplomatischer Vorgang.<br />
Aber genau diese Verhandlungsmethode wird<br />
heute von der EU angewandt. Im Namen der<br />
Friedenssicherung ist auf lange Sicht die Politik<br />
der kleinen Schritte eben besser geeignet als<br />
eine Politik unüberlegter Sprünge.<br />
Die Habsburger konnten Sicherheit gegen<br />
die Bedrohungen von außen (Frankreich, Russland,<br />
Osmanisches Reich) gewährleisten, nicht<br />
aber hinsichtlich innerer Konflikte. Als während<br />
des „Völkerfrühlings“ die Forderungen nach der<br />
nächsten Stufe zur Selbstständigkeit im gesamten<br />
Kaiserreich widerhallten, wurde auch den<br />
Beton International März 2014 11
größten Naivlingen am Hof klar, dass der Nationalismus<br />
nicht wieder verschwinden würde.<br />
Auf die Herausforderung der nationalen<br />
Bewegungen antworteten die Habsburger mit<br />
drei Maßnahmen. Kaiser Franz Joseph, der im<br />
Jahr 1848 den österreichischen Thron bestiegen<br />
hatte und ihn bis zu seinem Tod 1916 innehielt,<br />
verkörperte das supranationale Symbol<br />
und die Monarchie als solche. Die zentralisierte<br />
öffentliche Verwaltung und das Heer mit der<br />
Offiziersschicht stellten unter Verwendung<br />
derselben Techniken und Stile in unterschiedlichen<br />
Regionen das bedeutende Bindeglied dar.<br />
Das Parlament machte auf seinen Bänken Platz<br />
für die Vertreter aller Völker.<br />
Das Recht des Volkes auf Selbstbestimmung<br />
steht in grundsätzlicher Opposition zu<br />
vielvölkischen politischen Gebilden. Die Habsburger<br />
Monarchie konnte keine wirksame Art<br />
und Weise finden, die Forderungen nach Selbständigkeit<br />
mit dem Bedürfnis nach einem<br />
gemeinsamen Dach zu vereinbaren. Von diesem<br />
Standpunkt aus betrachtet bedeutete der<br />
deutsche Nationalismus für das Kaiserreich<br />
eine größere Bedrohung als die Nationalismen<br />
der kleinen Völker. Zahlreiche deutschsprachige<br />
Österreicher trachteten nämlich – vor<br />
allem nach dem Jahr 1871 und der Gründung<br />
des preußischen Reichs – nach einer Vereinigung<br />
mit dem „Mutterland“. Gegen die habsburgische<br />
Kompromisspolitik traten auch die<br />
Nationalismen der Balkanvölker an, vor allem<br />
der Serben. Die Idee von einem Zusammenschluss<br />
der Südslawen aus den habsburgischen<br />
Ländern mit jenen aus den ehemaligen Osmanischen<br />
Provinzen war ein explosives Gemisch,<br />
das in den Balkankriegen von 1912-1913 hochging.<br />
Der Feuerweg zum Großen Krieg war geebnet.<br />
Der „Europäische Bürgerkrieg“ endete mit<br />
der Zerstörung des Osmanischen und des Habsburger<br />
Reiches, mit der gesellschaftlichen Revolution<br />
in Russland und dem Regimewechsel in<br />
Deutschland. Die Folgen wurden in einer Wirtschaftskrise<br />
sichtbar, die durch Inflation und<br />
Depression zum Zweiten Weltkrieg und zum<br />
Genozid führte. Und aus dieser Brandstätte erwuchs<br />
die Idee, die heute von der Europäischen<br />
Union verkörpert wird.<br />
Die unterschiedlichen Interessensgruppen<br />
und einflussnehmenden Gemeinschaften stellen<br />
sich – jede auf ihre Art – Europa als gemeinsames<br />
Haus vor. Bildhafte Konzepte reichen<br />
vom christlichen Europa bis zum Europa als<br />
Schmelztiegel, vom Europa als Konföderation<br />
bis zu den Vereinigten Staaten von Europa.<br />
All diese Ideen treten indes in einem Rahmen<br />
auf, der das heutige Europa bereits von<br />
anderen Staatsformen unterscheidet. Wenn<br />
wir die Vereinigten Staaten von Amerika zu den<br />
Hegemonial- und Imperialstaaten zählen, die<br />
auf ihrer kompromisslosen Souveränität insistieren,<br />
Iran zu den modernen Staaten, für die<br />
ein autoritärer Nationalismus kennzeichnend<br />
ist, und Somalia zu den prämodernen Staaten<br />
ohne zentralisierte Macht, dann zählt die EU zu<br />
den postmodernen Staaten.<br />
Postmoderne Staaten zeichnen sich durch<br />
eine weiche Form der Souveränität aus, schreibt<br />
der britische Analytiker und Diplomat Robert<br />
Cooper in seinem Buch The Breaking of Nations<br />
(2003). Das bedeutet, dass postmoderne Staaten<br />
in der Verwendung von Streitkräften und bei Gesetzesbeschlüssen<br />
eingeschränkt sind, also nicht<br />
mehr selbständig im traditionellen Sinne. Was<br />
unter einer traditionellen Art staatlicher Souveränität<br />
zu verstehen ist, erschließt sich aus den<br />
Verträgen zum Westfälischen Frieden, der Mitte<br />
des 17. Jahrhunderts geschlossen wurde. Die<br />
postmoderne Art staatlicher Souveränität wurde<br />
von der EU mit dem Vertrag von Maastricht beschlossen,<br />
der Ende des 20. Jahrhunderts unterzeichnet<br />
worden ist. Mit diesem Vertrag wurde<br />
das Eingreifen in die inneren Angelegenheiten<br />
der Mitgliedsstaaten ein Bestandteil der neuen<br />
europäischen Ordnung.<br />
Der Verzicht auf „harte“ Souveränität kam<br />
für die EU-Mitglieder in einem Paket mit der<br />
Solidarität. Von diesem Gesichtspunkt aus hatten<br />
die Grenzen zwischen den europäischen<br />
Staaten ihre einstige Gewichtigkeit verloren.<br />
Damals schien es, als handle es sich um ein annehmbares<br />
„Geben und Nehmen“. Heute stellt<br />
es sich für viele anders dar. Die große wirtschaftliche<br />
und politische Krise, die bereits fünf<br />
Jahre lang andauert, stellt die EU im Allgemeinen<br />
und die Länder der Eurozone im Besonderen<br />
auf eine beispiellose Probe.<br />
Niemand weiß genau, was zu tun oder zu<br />
unternehmen wäre. Fest steht nur, dass unter<br />
den angebotenen Lösungen zur Rettung des<br />
Euros als Währung und der EU als politisches<br />
Projekt diejenige die schlechteste ist, von der<br />
die EU in ein Werkzeug verwandelt würde, das<br />
um jeden Preis die Ideologie des Sparens aufdrängt.<br />
Wenn die EU zu einer Peitsche internationalen<br />
Kapitals auf den Rücken der Armen<br />
würde, also zu dem, was der Internationale<br />
Währungsfonds in den Achtzigern und Neunzigern<br />
in Lateinamerika repräsentierte, würde<br />
sie von ihrem originärsten Merkmal abrücken:<br />
der institutionellen Solidarität. Sollte das<br />
passieren, würde sich die EU in eine Agentur<br />
für Kapitalverwaltung verwandeln und die<br />
Europäer würden durch die Grenze zwischen<br />
Grille und Ameise, zwischen dem „schuftenden<br />
protestantischen Nordwesten“ und dem<br />
„verschwenderischen katholisch-or thodoxen<br />
Südosten“ geteilt.<br />
Aus dem Slowenischen von<br />
Daniela Kocmut<br />
Aleš Debeljak<br />
Geboren 1961 in Ljubljana. Lyriker und sozialkritischer<br />
Essayist; Debeljak unterrichtet an<br />
der Universität Ljubljana Kulturelle Studien.<br />
Svetislav Basara<br />
Doktor<br />
Destouches,<br />
der<br />
unangenehme<br />
Zeuge<br />
Buddha ist ein riesiger, chinesischer<br />
Volkskommissar<br />
mit dem fettem Hintern eines<br />
Erzbischofs.<br />
Céline<br />
Jeder hundertste Geburtstag sollte feierlich<br />
begangen werden. Nun rückt das hundertjährige<br />
Jubiläum des Jahres 1914 näher – und immer<br />
näher! Eine schöne runde Zahl! Wie geschaffen<br />
für ein Jubiläum! Es wird Empfänge und Galadinners<br />
geben, man wird Reden schwingen.<br />
2014 – das Jahr, in dem vermoderte Leichen<br />
durch die frische Luft gezerrt werden, Toten<br />
rituell auf die Schulter geklopft und passender<br />
Blödsinn abgesondert wird. Sie gaben ihr Leben<br />
für die Freiheit! Helden! Das Opfer war nicht<br />
vergebens! Freiheit! Frieden! Europa! Zukunft!<br />
Wohlstand! Die Massenneurose angesichts des<br />
Jubiläums wird langsam zur Massenpsychose.<br />
Die kleinen Siegerstaaten fürchten, dass die<br />
Geschichte umgeschrieben wird! Sie haben<br />
Angst, jemand könnte ihnen den Sieg nehmen!<br />
Das werden sie nicht zulassen! Die großen Siegerstaaten<br />
halten sich besser – deshalb sind<br />
sie wahrscheinlich groß – auch wenn sie nicht<br />
überzeugt sind, dass ihr Sieg so groß war, wie<br />
er hätte sein können und sollen. Die Verliererstaaten<br />
wiederum fühlen sich gedemütigt.<br />
Vielleicht könnte man da etwas tun! Vielleicht<br />
könnte man diese Ungerechtigkeit ausgleichen.<br />
Man kann nie wissen! Es gibt kein umfassendes<br />
Bild! Im Großen Krieg sieht jeder, was er sehen<br />
will, was er sehen soll, weil es ihm aufgetragen<br />
wurde oder er dafür bezahlt wird. Ich gehöre zufälligerweise<br />
zu der letzten Gruppe. Ich wurde<br />
bezahlt – andernfalls hätte ich nicht eine Zeile<br />
geschrieben –, einen Aufsatz zum Thema 1914<br />
zu schreiben, ein Thema, über das ich – trotz<br />
Bezahlung – nicht ein Wort schreiben würde,<br />
weil es kein einziges Wort verdient, hätte mich<br />
die Aufforderung nicht in einer Art militaristischer<br />
Stimmung erreicht, als ich gerade dabei<br />
war, ein Themenheft des „Gradac“ zum zweiten<br />
Mal zu lesen. Es ist Doktor Destouches alias<br />
Louis-Ferdinand Céline gewidmet.<br />
Als ich den „Gradac“ über Céline las, lag es<br />
in der Natur der Sache, dass ich verlockt war,<br />
die Reise ans Ende der Nacht noch einmal zu lesen,<br />
und ein erneutes Lesen der Reise ans Ende<br />
der Nacht führt den Leser unweigerlich ins Jahr<br />
1914 und ins Zentrum des Geschehens, an die<br />
vorderste Frontlinie des Großen Krieges, bei uns<br />
besser bekannt als Erster Weltkrieg. Céline liest<br />
man – Achtung! – auf eigene Gefahr! Am besten<br />
mit kugelsicherer Weste und Gasmaske in der<br />
Hand. Die Kampfgase, die während der Reise<br />
von den Seiten aufsteigen, sind heilsam, aber<br />
auch gefährlich. Wer die eine oder andere kleine<br />
Wahrheit über das Große Schlachten erfahren<br />
will, über seinen Anlass und – vor allem – die<br />
Folgen, der sollte alle historischen Lügen vergessen<br />
und sich in die Reise ans Ende der Nacht<br />
vertiefen. Und nicht nur in die Reise, sondern<br />
auch in Destouches‘ andere Bücher und sogar in<br />
die Interviews. Besonders die Interviews. In den<br />
Interviews ist Doktor Destouches – unbelastet<br />
von einer Erzählform – am tiefsten und am treffendsten.<br />
Hier spinnt er – entblößt bis auf die<br />
Knochen – zynisch und rücksichtslos seine – aus<br />
Sicht eines Philisters – verrückte Anthropologie<br />
und noch verrücktere Philosophie. Der Mensch<br />
– so sieht es Doktor Destouches – ist gerade so<br />
fähig zur Humanität und Kultur, wie ein Huhn<br />
fliegen kann. Wenn man ein Huhn, so erklärt<br />
Doktor Destouches, kräftig in den Hintern tritt,<br />
erhebt es sich drei, vier Meter in die Luft, gackert,<br />
flattert mit den Flügeln, doch gleich nach<br />
der Landung vergisst es das Fliegen und kehrt<br />
zurück zu seinem bescheidenen Lebensinhalt<br />
– dem Scharren im Dreck. Ähnlich der Mensch.<br />
Wenn man ihm in den Hintern tritt oder ihn –<br />
was wesentlich effektiver ist – prügelt, ausbeutet<br />
und demütigt, zeigt der Mensch eine gewisse Befähigung<br />
zur Kultur und in Ausnahmefällen sogar<br />
zur Religion, doch sobald die Prügel – wegen<br />
der Dekadenz oder Nachlässigkeit des Folterknechts<br />
– aufhören, sobald der Mensch sich irgendein<br />
„Menschenrecht“ erkämpft hat, landet<br />
er – nicht auf der Erde, die ist was für Hühner –<br />
auf einem unterirdischem Grund und kratzt hier<br />
an den Geschlechtsorganen seiner Nächsten,<br />
er landet auf Tafeln voller Fleisch und fettem<br />
Essen, trinkt Unmengen von Alkohol, wird fett,<br />
häuft Geld an, langweilt sich und sucht Zerstreuung,<br />
alles Dinge, die ihn zum Kretin machen,<br />
ihn abstumpfen und degenerieren lassen und<br />
nur durch Krieg zu heilen sind. Gäbe es keinen<br />
Krieg, raunt uns Doktor Destouches zu, gäbe es<br />
kein Schlachten, keinen Hunger und keine Epidemien,<br />
ließe man den Menschen ihren Willen,<br />
würde die menschliche Rasse sich selbst zu einer<br />
Lebensform degradieren, die die Natur nicht<br />
ertragen könnte. Wir führen Krieg, um zu überleben!<br />
Das nackte Überleben – das ist der Sinn<br />
des Krieges. Doktor Destouches ist kein Kriegstreiber!<br />
Nein! Gar nicht! Ganz und gar nicht. Destouches<br />
findet Kriegstreiber abstoßend. Abgestoßen<br />
ist er aber auch von denjenigen, die sich<br />
in den Krieg treiben lassen. Er hat sich selbst<br />
dorthin treiben lassen, das gibt er zu, fröhlich<br />
und voll patriotischer Gefühle, sagt er, zog er in<br />
den Krieg. Vielversprechende Helden, Offiziere,<br />
die den Krieg feiern und in ihm einen Lufterfrischer<br />
sehen, ein Mittel zur Desinfektion, Säuberung<br />
und Stärkung einer Nation, hält Destouches<br />
für komplette Idioten, denn er weiß – und<br />
eigentlich wissen wir es alle, wir stellen uns nur<br />
blöd –, dass dies völlig hirnverbrannt ist, denn<br />
es ist eine schreiende Tatsache, dass in Europa<br />
nach jedem bedeutenden Krieg immer weniger<br />
kräftige, mutige und ehrenvolle Männer geboren<br />
werden, dafür immer mehr Kretins, Idioten und<br />
Weicheier. Nein! Destouches rechtfertigt den<br />
Krieg nicht. Aber er rechtfertigt auch den Frieden<br />
nicht. Für Destouches ist Krieg die Fortführung<br />
des Friedens mit anderen Mitteln. Wer die<br />
Zähne zusammenbeißt, versteht, was ich meine.<br />
Wir haben bekommen, was wir verlangt haben,<br />
und dabei sind wir noch gut weggekommen, wir<br />
Lumpenpack, Sesselpupser und Vielfraße – das<br />
ist in Ungefähr der Inhalt des verschlüsselten<br />
Telegramms, das Céline der kulturinteressierten<br />
Öffentlichkeit schon seit Jahrzehnten schickt,<br />
der Gilde der Versüßer – den Herren Politikern,<br />
Schriftstellern, Schmierfinken und Musikanten,<br />
den Zuckerbäckern mit Diplomen von der<br />
Sorbonne und der École normale supérieure,<br />
die unsere menschliche Wirklichkeit – eine aus<br />
geronnenem Blut, Eiter, Sperma, Vaginalsekret<br />
und Scheiße gebackene Torte – mit Saccharin<br />
und Marzipan überziehen. Ah, belle époque!<br />
Emanzipation! Vaginolatrie! Arschkriecherei!<br />
Kackophilie! Durcheinander! Völlerei! Reizüberflutung!<br />
Kollektiver europäischer Nervenzusammenbruch.<br />
Unausstehlichkeit, die – angeblich<br />
weil es so leichter ist – auf jemand anderen übertragen<br />
wird, sagen wir mal auf den Deutschen,<br />
Beton International März 2014 12
dessen germanischer Urin – wie ein angesehener<br />
französischer Akademiker behauptet – hundertmal<br />
mehr stinkt als der eines durchschnittlichen<br />
Franzosen. Das Dumme ist, dass der Deutsche im<br />
Stande ist, wegen der Beleidigung des deutschen<br />
Urins einen Krieg anzufangen. Er kann es kaum<br />
erwarten, dich umzubringen, nicht nur, weil du<br />
die deutsche Pisse beleidigst – wahrscheinlich<br />
eine der besten Pissen der Welt –, sondern, weil<br />
du Franzose bist, syphilitisch, verweichlicht und<br />
degeneriert, der infolge einer Verstopfung seiner<br />
Harnleiter nicht mehr imstande ist zu pissen. Ob<br />
Céline Schopenhauer gelesen hat Kaum vorstellbar,<br />
dass nicht. Ruysbroek hat er gelesen,<br />
das weiß ich, weil er ihn erwähnt! Vielleicht auch<br />
Meister Eckhart. Ob unter dem Einfluss dieser<br />
Männer oder spontan – das weiß ich nicht, dazu<br />
sagt er nichts – erkennt Céline im Schützengraben,<br />
dass sein Feind im Grunde nicht die Deutschen<br />
sind, sondern die ganze Welt. Doch von da<br />
an und bis zu seinem Tod ist die ganze Welt Célines<br />
Feind und er ist der Feind der ganzen Welt,<br />
aller Manifestationen des Willens der Welt und<br />
aller Zirkusvorstellungen der Welt. Monarchisten!<br />
Horror! Dekadenz! Nieder mit dem König!<br />
Mit dem Kommunismus (er lernt ihn vor Ort in<br />
der UdSSR kennen)! Es lebe König Peter I.! Es<br />
lebe Louis XIV., es lebe Franz Joseph! Die Rechte!<br />
Die Vereinigung der königlichen Mobber!<br />
Die Sesselpupser! Zwiebeln und Wasser! Die<br />
Linke! Der Unsinn! Die Geschmacklosigkeit!<br />
Die Stillosigkeit. Éluard, Aragon, Sartre! Weltberühmte<br />
Gymnasiasten! Es gibt kein Wort,<br />
kein Ereignis, keine Philosophie oder Idee,<br />
keinen Politiker, keinen Menschen, kurz keine<br />
Gruppe, vor der sich Doktor Destouches nicht<br />
ekelt und von der er sich nicht voller Abscheu<br />
abwendet – genau wie die christlichen Mystiker.<br />
Aber Céline ist kein christlicher Mystiker,<br />
oder vielleicht doch, wer weiß – Doktor Destouches<br />
balanciert immer am Rande der Religiosität<br />
– einmal verkündete er, er sei ein Mystiker<br />
– in Frankreich geht das gerade noch durch –<br />
aber mitten in Paris öffentlich zu verkünden, er<br />
glaube an Gott, das ist, als würde er in Teheran<br />
den Propheten beschimpfen. So etwas könnte<br />
Doktor Destouches sich nicht erlauben. Dann<br />
würde doch keiner mehr seine Bücher kaufen,<br />
und er will, dass die Leute seine Bücher kaufen,<br />
damit er sie beleidigen und nebenbei vielleicht<br />
noch einen Groschen verdienen kann, denn sobald<br />
er als Schriftsteller von sich reden machte,<br />
war sein Ansehen als Arzt dahin. Dieser kartesianische<br />
Geist ist nicht zu verachten. Den Geist<br />
kann man getrost Scharlatanen überlassen, um<br />
Lunge und Leber kümmert sich besser ein seriöser<br />
Fachmann.<br />
Niemand hasste den kartesianischen Geist<br />
so sehr wie Céline, und niemand machte sich<br />
so ergeben zu seinem Sklaven wie er. Er schlich<br />
um das Christentum herum wie um den heißen<br />
Brei, von dem ihn nur eine Mauer fetter Bischofshintern<br />
trennte.<br />
„Der praktische Nutzen des Christentums“,<br />
schrieb Céline an einer Stelle in einer Art Katechismus,<br />
„liegt darin, dass es die Pille nicht<br />
versüßt. Es beschwichtigt nicht, ist nicht auf<br />
Wählerfang aus, will nicht gefallen und schaukelt<br />
nicht unsere Wiege. Es greift sich den<br />
Menschen, wenn er noch Windeln trägt, kauft<br />
ihm gleich den Schneid ab und sagt es ihm ins<br />
Gesicht: Du hässlicher, stinkender Wurm! Bis<br />
in alle Ewigkeit bleibst du Abschaum… Von Geburt<br />
an ein Stück Dreck… Hörst du mich Genau<br />
so ist es, das ist ein allgemeingültiges Prinzip!<br />
Doch vielleicht … aber nur vielleicht, wenn man<br />
genauer hinschaut, besteht eine kleine Chance<br />
auf ein kleines bisschen Vergebung dafür, dass<br />
du so abscheulich, abschreckend, abstoßend,<br />
widerwärtig bist!“<br />
Doktor Destouches, ein unangenehmer<br />
Zeuge des Krieges, ist ein noch unangenehmerer<br />
Zeuge des Friedens. Es ist kein Wunder,<br />
dass er – wie auch François Rabelais – von Beruf<br />
Arzt war. Im Grunde war er nie etwas anderes<br />
als Arzt. Alles, was er geschrieben hat – und<br />
das ist nicht wenig – ist eigentlich keine Prosa,<br />
sondern eine Anamnese, eine Auflistung von<br />
Diagnosen, eine entsetzliche Geschichte europäischer<br />
Krankheiten …<br />
Für die es kein Heilmittel zu geben scheint.<br />
Aus dem Serbischen von<br />
Blanka Stipetić<br />
Svetislav Basara<br />
Geboren 1953 in Bajina Bašta, Serbien. Er hat<br />
über 20 Romane und Erzählungen veröffentlicht,<br />
die mit renommierten Literaturpreisen<br />
ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt<br />
wurden. Auf Deutsch sind seine Romane<br />
Führer in die innere Mongolei (Antje Kunstmann<br />
Verlag, 2008, Ü.: Patrik Alac) und Die Verschwörung<br />
der Fahrradfahrer(Dittrich Verlag,<br />
2014, Ü.: Mascha Dabić) erschienen.<br />
Ivana Sajko<br />
1914–2014 und<br />
kollaterale Epochen<br />
Die Geschichte ist wohl bekannt. Zu Beginn<br />
des Sommers 1914 kam Franz Ferdinand in Begleitung<br />
seiner Gemahlin Sophie Chotek nach<br />
Sarajevo, um einem militärischen Manöver beizuwohnen.<br />
Im Rahmen seiner Visite sollte auch<br />
ein feierlicher Empfang im Rathaus stattfinden.<br />
Der Weg dorthin führte über die mit Blumen und<br />
Transparenten geschmückte Flusspromenade<br />
der Miljacka. Auf derselben Route hatten vier<br />
Verschwörer Stellung bezogen. Später hieß es,<br />
zwei von ihnen seien an Tuberkulose erkrankt<br />
und ohnehin dem Tod geweiht gewesen, wodurch<br />
sie die allerhöchste Bereitschaft für eine<br />
Aktion gegen den hohen Gast aus Wien an den<br />
Tag legten. Jeder von ihnen war mit einer Bombe,<br />
einer Pistole und ein wenig Zyanid ausgestattet.<br />
Die Motive waren jeweils unterschiedlich:<br />
Kampf gegen die österreichisch-ungarische Vorherrschaft<br />
in slawischen Gebieten, die Befreiung<br />
der unterworfenen serbischen Brüder und die<br />
Schaffung eines Großserbiens, Rache für die bittere<br />
Armut in Bosnien und so weiter. Um zehn<br />
Uhr morgens empfing eine Menge von Schaulustigen<br />
die Automobilkolonne. Das Thronfolgerpaar<br />
fuhr in einem Wagen mit zurückgeklapptem<br />
Stoffverdeck und genoss lediglich Schutz durch<br />
die lokale Polizei. Einer detaillierten Rekonstruktion<br />
der Ereignisse zufolge fuhr der Wagen<br />
so schnell am ersten Verschwörer vorbei,<br />
dass dieser keine Zeit hatte, zu reagieren. So<br />
erhielt erst der nächste Verschwörer, Nedeljko<br />
Čabrinović, die Gelegenheit, eine Bombe zu<br />
werfen. Der Sprengkörper landete unter den Rädern<br />
des falschen Automobils. Die Insassen und<br />
einige umstehende Schaulustige wurden schwer<br />
verletzt. Der erfolglose Attentäter schluckte Gift<br />
und sprang in den Fluss Miljacka, aber bald darauf<br />
stellte sich heraus, dass das Zyanid abgelaufen<br />
war und lediglich Verdauungsprobleme hervorrief,<br />
während der Fluss nur einige Zentimeter<br />
tief war und bloß seine Kleidung nass machte. Im<br />
Film des Regisseurs Veljko Bulajić aus dem Jahr<br />
1975 wird eine etwas andere Version gezeigt. Wir<br />
sehen Franz Ferdinand, der geschickt die Bombe<br />
einfängt und sie nach hinten wirft. Daraufhin<br />
entsteht Unruhe unter den rotgesprenkelten<br />
Statisten auf der Straße, der Wagen des Thronfolgers<br />
rast indessen zum Städtischen Rathaus.<br />
Nedeljko Čabrinović wird von einem Polizisten<br />
mit einem Gewehrkolben auf den Kopf geschlagen,<br />
verliert das Bewusstsein und wird aus dem<br />
Fluss gezerrt. Dies entbehrt nicht einer gewissen<br />
Komik. Der ungeschickte Terrorist. Das unwirksame<br />
Gift. Und die theatralischen Schreie der<br />
Damen. Aber die Geschichte geht weiter. Eine<br />
Stunde vergeht. Der Wagen mit dem Thronfolger<br />
kehrt über dieselbe Route zurück. Der Fahrer<br />
biegt in die falsche Straße ein, an der Ecke steht<br />
Gavrilo Princip. Der schmächtige junge Mann<br />
mit einem Schnurrbart, wie bald darauf ein Polizeifotograf<br />
festhalten wird, verzehrt gerade<br />
ein Brötchen und erwägt, nach dem ersten misslungenen<br />
Attentat den geplanten Angriffsort zu<br />
verlassen. Durch reinen Zufall steht er plötzlich<br />
dicht vor dem Thronfolger und seiner Gemahlin,<br />
Auge in Auge. In Bulajićs Film erblickt die<br />
Gemahlin als erste den Revolver in der Hand des<br />
jungen Mannes. Die Kamera zeigt eine Großaufnahme<br />
vom Gesicht des Thronfolgers, folgt<br />
anschließend dem Finger, der den Abzug betätigt,<br />
und wendet sich dann der Uniform zu, die<br />
mit zahlreichen Orden bedeckt ist und von der<br />
Kugel durchbohrt wird, und dann ist eine Frauenhand<br />
zu sehen, die an den Gürtel des weißen<br />
Kleides greift, über das sich Blut ergießt. Princip<br />
gibt zwei Schüsse ab. Der erste trifft Franz Ferdinand<br />
in den Hals, der zweite, schlecht gezielte,<br />
den Bauch von Sophie Chotek. Der Wagen setzt<br />
seine Fahrt durch die versammelte Menge an<br />
Schaulustigen fort, das Ehepaar liegt reglos auf<br />
den Sitzen, der überdimensionierte Damenhut<br />
verdeckt den Blick auf ihre Gesichter in tödlicher<br />
Agonie. Die Geschichte geht weiter, aber diesmal<br />
bar jeglicher Komik.<br />
Der 28. Juni 1914 stellt für manche den eigentlichen<br />
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts<br />
dar. Der englische Historiker Eric Hobsbawm<br />
rekapituliert in seinem Buch The Age of<br />
Extremes die Visite François Mitterrands in Sarajevo<br />
anlässlich des Jahrestags des Attentats im<br />
Jahr 1992 und postuliert, diese Geste des französischen<br />
Präsidenten sei durch das Prisma des<br />
symbolträchtigen Datums und seiner beunruhigenden<br />
Botschaft zu interpretieren. Wie lautete<br />
die Botschaft Mitterrands In erster Linie<br />
lautet die Botschaft, dass die Geschichte jedem<br />
Versuch, ihr Ende herbeizuführen, geschickt<br />
ausweicht; dass historische Aussöhnungen und<br />
Konsolidierungen immer bloß temporäre Erscheinungen<br />
sind; dass Ereignisse von scheinbar<br />
lokaler Reichweite immer wieder dazu neigen,<br />
ihre dislozierten Grenzen zu überschreiten; und<br />
schließlich, dass wir niemals glauben sollten, alle<br />
Akte des historischen Dramas seien schon zu<br />
Ende gespielt. Wie es bei Baudrillard heißt, das<br />
zwanzigste Jahrhundert stellt uns vor die beunruhigende<br />
Tatsache, dass alles möglich ist. Dieses<br />
kurze Jahrhundert, wie Badiou es in seinem<br />
Essayband Le Siècle nennt, strukturiert seine<br />
Geschichte durch mehrere parallele Narrative.<br />
Eines davon ist ganz konventionell und ließe<br />
sich in zwei Worten zusammenfassen: Krieg<br />
und Revolution. Das Jahrhundert artikuliert<br />
sich durch zwei Weltkriege und durch die Etablierung,<br />
Weiterentwicklung und schlussendlich<br />
den Kollaps des kommunistischen Projekts.<br />
Betrachtet durch das Prisma dieser Parameter,<br />
schreibt Badiou, ist es ein Jahrhundert des Kommunismus,<br />
aber betrachtet durch das Prisma des<br />
kollektiven Gedächtnisses ist es ein Jahrhundert<br />
der Apokalypse, das sich weder denken noch begreifen<br />
lässt, ein Jahrhundert, an das man sich<br />
schlicht und ergreifend erinnern muss. Im Zentrum<br />
dieses unbeschreiblichen Spektakels befindet<br />
sich der Holocaust mit seiner Maschinerie:<br />
Konzentrationslager, Gaskammern, Massaker,<br />
Folter und organisiertes staatliches Verbrechen.<br />
Pathologische Vernichtungstechnologien, die<br />
weder denkbar noch begreifbar sind, sprechen<br />
lediglich in Zahlen zu uns, die anhand von Rechenoperationen<br />
den Versuch machen, das ihnen<br />
innewohnende Irrationale zu rationalisieren.<br />
Millionen von Opfern. Tonnen von Asche.<br />
Aber indem das Jahrhundert seine Parameter<br />
verändert, verändert es auch sein Antlitz und<br />
legt dabei noch andere Resultate frei. Das ökonomische<br />
Narrativ schreibt indessen an einer weiteren<br />
Parallelgeschichte, jener Geschichte über<br />
den Liberalismus, die eine Epoche beschließt<br />
und zugleich in die nächste überschwappt, wie<br />
ein Ausgangspunkt, von dem aus unsere aktuelle<br />
historische Dynamik gesponnen wird. Hier<br />
dreht sich die blutig erkämpfte Demokratie zum<br />
Nutzen des globalen Marktes, des Triumphs des<br />
Kapitals und der Abschaffung sozialer Empathie.<br />
Es ist ein Jahrhundert der Mediokritäten,<br />
des Fernsehens und der Abstumpfung, ein Jahrhundert<br />
des Kredits, der Zwangsräumungen und<br />
der Korruption, ein Jahrhundert, in dem unsere<br />
Gegenwart ein langfristiges Pfand darstellt. Die<br />
Position, aus der heraus ein Jahrhundert, sowohl<br />
das vorige als auch das aktuelle, tatsächlich<br />
etwas über sich selbst aussagen kann, und die<br />
uns einer Position näherbringt, in der wir selbst<br />
ebenfalls etwas zu sagen haben, ist eine ästhetische<br />
Position. Die Kunst dient hier als Zeichen<br />
und Symptom der Zeit, und so werden politische<br />
und zivilisatorische Landschaften gerade durch<br />
Beton International März 2014 13
die Dekonstruktion der Gesten und Bilder der<br />
Kunst wiederhergestellt. Diese von neuem konstruierten<br />
Horizonte gemahnen uns an unsere<br />
eigene Verantwortung gegenüber der Realität,<br />
die sich jederzeit in eine unvorstellbare historische<br />
Fiktion verwandeln kann und deren Jahreszahlen<br />
rückblickend tragisch wirken.<br />
Der harmlose Sommertag im Jahre 1914<br />
könnte ein Anlass für uns sein, andere, ebenso<br />
perfid bedeutungslose Daten zu evozieren.<br />
Eine Gegend, die vor Geschichte nur so strotzt,<br />
nämlich das Gebiet Ex-Jugoslawiens, ist voll von<br />
solchen Daten. Am 23. und 24. September 1987<br />
tagte zum achten Mal das Zentralkomitee des<br />
Bundes der Kommunisten Serbiens. Bei dieser<br />
Sitzung hatte Slobodan Milošević den Vorsitz<br />
inne. Laut Experten hatten die Ergebnisse dieser<br />
Sitzung einen entscheidenden Einfluss auf<br />
die weitere Geschichte der gesamten Region.<br />
Zwei Jahrzehnte nach dem erwähnten Ereignis<br />
drehte der niederländische, in Belgrad geborene<br />
Künstler Bojan Fajfrić den Film Theta Rhythm,<br />
in dem er die betreffenden Septembertage durch<br />
eine ganz und gar antihistorische Perspektive<br />
rekonstruiert, nämlich durch die seines Vaters,<br />
der im Rahmen der live übertragenen Sitzung<br />
dadurch auffiel, dass die Kamera ihn schlafend<br />
auf seinem Stuhl erwischte. „Die Tatsache, dass<br />
mein Vater während der Sitzung eingeschlafen<br />
ist, war keine Schande und sorgte für keinen<br />
Skandal. Ganz im Gegenteil, dieser Akt blieb unbemerkt“,<br />
erinnert sich Fajfrić. „Die unschuldige<br />
Geste meines schlafenden Vaters war eine Metapher<br />
für die Unfähigkeit seiner Generation, die<br />
Gegebenheiten der eigenen Zeit in den Griff zu<br />
bekommen und auf diese Weise auf den weiteren<br />
Verlauf der Geschichte einzuwirken.“<br />
Worauf Fajfrić hinaus will, ist der Umstand,<br />
dass sich kein Augenblick aus der Kontinuität,<br />
zu welcher er gehört, isolieren lässt, und dass<br />
das eigentliche Drama in der Diskrepanz zwischen<br />
der Banalität eines „Jetzt“ und der Tragik<br />
seines „Später“ begründet liegt sowie in unserer<br />
Unfähigkeit, die Folgen unserer Unterlassung<br />
abzusehen – in einer falschen Einschätzung des<br />
Augenblicks, den wir verschlafen und verpasst<br />
haben, der sich jedoch in der Rückschau als<br />
entscheidend herausstellt. Wenn wir schließlich<br />
aufwachen, hat die Geschichte bereits ihren<br />
Lauf genommen und wir versuchen ungeschickt,<br />
die Fäden ihrer Erzählung einzufangen,<br />
die richtige Seite und den richtigen Standpunkt<br />
einzunehmen, den einen zu glauben, den anderen<br />
zu misstrauen und eine passende Wahl zu<br />
treffen, loyal, moralisch und unbefleckt zu bleiben<br />
und so bis zum Ende und darüber hinaus<br />
auszuharren, denn die Geschichtsschreibung<br />
erfolgt auch rückwirkend, ihre Produktion ist<br />
ausgerechnet dann am stärksten, wenn die Geschichte<br />
scheinbar zu Ende ist. Gerade dann<br />
ruft sie uns zur Ordnung und belästigt uns mit<br />
Mathematik, öffnet uns die Augen, die wir fest<br />
zugekniffen hatten, und stellt uns vor Fragen,<br />
auf die wir eine Antwort parat haben müssten:<br />
Wie konnte das passieren<br />
Kehren wir zurück. Auf dem Schwarzweißfoto,<br />
das am Morgen des 28. Juni 1914 um ca. 11<br />
Uhr aufgenommen wurde, sehen wir Franz Ferdinand<br />
und seine Gemahlin, wie sie das Rathaus<br />
in Sarajevo verlassen. Sie sind eingehakt und<br />
begrüßen die protokollarischen Gäste auf der<br />
Treppe des Gebäudes. Sie planen, zum Krankenhaus<br />
zu fahren, in dem der erfolglose Bombenwerfer<br />
liegt, aber wir wissen, dass sie dort<br />
niemals ankommen werden. Das Jahrhundert<br />
stellt sich ihnen in den Weg. Zahlen und Asche.<br />
Dutzende nationaler religiöser Konflikte und<br />
solcher, die mit Erdöl zu tun haben, die Zerstörung<br />
staatlicher Volkswirtschaften, Metastasen<br />
des Kapitals, die Entstehung des Prekariats und<br />
die Agonie des verschuldeten Menschen sowie<br />
die misslungene Verwirklichung großer Utopien,<br />
die ein Ende der Geschichte verhindern.<br />
Diejenigen, die dieses Jahrhundert tatsächlich<br />
erlebt haben, diejenigen, die nach den Worten<br />
von Primo Levi „die Gorgo gesehen“ haben,<br />
werden niemals darüber sprechen. Die integralen<br />
Zeugen, die die Geschichte von innen heraus<br />
erzählen könnten, bleiben außerhalb jeder<br />
nacherzählbaren Geschichte, weil ihre eigene<br />
Geschichte in sich eingestürzt ist und niemand<br />
mehr etwas darüber sagen kann.<br />
Alles, was wir tun können, ist lediglich die<br />
verpassten Gelegenheiten zu thematisieren und<br />
mit Badious Beispiel locker abgesteckte historische<br />
Narrative zu konstruieren, in denen sich<br />
eine gewisse Kohärenz abzeichnet. Einer davon<br />
könnte das konventionelle Narrativ sein. Es<br />
würde mit der Gründung der Jugoslawischen<br />
Föderation beginnen, mit der Idee von Brüderlichkeit,<br />
Einheit und Selbstverwaltung der Arbeiter,<br />
mit der Euphorie des Aufbaus, mit den<br />
Arbeitseinsätzen und Parteitagen in Stadien,<br />
und es würde möglicherweise ausgerechnet mit<br />
Mitterrands Visite in Sarajevo enden, als schon<br />
allen klar war, dass wir uns mitten im ultimativen<br />
Zerfall der Grenzen, Fabriken und Menschen<br />
befanden und dass wir nie wieder die Fotos<br />
unserer Großväter und Großmütter, auf denen<br />
sie Straßen und Eisenbahnen bauen, würden<br />
anschauen können, ohne den aufkeimenden<br />
Verdacht zu spüren, dass sie mit geschlossenen<br />
Augen gegraben hatten, weil die große Idee, die<br />
sie antrieb, von jenen kompromittiert wurde, die<br />
nicht bereit waren, für sie zu arbeiten, sondern<br />
deren Bereitschaft sich im Schießen erschöpfte.<br />
Eine andere mögliche Geschichte könnte Ende<br />
September 1987 beginnen, an dem Tag, als der<br />
Vater des damals vierzehnjährigen Bojan Fajfrić<br />
bei der Sitzung des Zentralkomitees des Bundes<br />
der Kommunisten Serbiens eingeschlafen war<br />
und als weder er noch wir alle anderen in der Begrenztheit<br />
unserer Kurzsichtigkeit die Zahlen<br />
zu sehen vermochten. Diese Geschichte hätte im<br />
Falle Kroatiens zumindest nominell und bürokratisch<br />
durch das Spektakel auf dem Zagreber<br />
Hauptplatz am 1. Juli 2013 zu Ende gehen sollen,<br />
als Kroatien seinen EU-Beitritt feierte. Es hätte<br />
so sein sollen, aber dem war nicht so. Die angebliche<br />
Verwirklichung historischer Bestrebungen<br />
wirkte wie ein Scherz, nicht nur deshalb, weil<br />
bei dem sorgfältig geplanten Bankett am 1. Juli<br />
Frau Merkel nicht aufgetaucht war, um ihren<br />
Segen für das Protokoll zu spenden, und nicht<br />
nur deshalb, weil in diesen Tagen über der großen<br />
Bühne das Logo des Billiganbieters Lidl mit<br />
der ironischen Botschaft prangte: Willkommen<br />
zum Europäischen Festmahl, und auch nicht<br />
nur deshalb, weil zur selben Zeit und zu Ehren<br />
desselben Festmahls tausende von Bürgern<br />
Europas auf die Straße gingen, um den griechischen<br />
und türkischen Demonstranten in ihren<br />
Auseinandersetzungen mit den Schutzschilden<br />
einer mehr oder weniger gleichen autistischen<br />
Macht ihre Unterstützung auszudrücken, sondern<br />
auch deshalb, weil das erwähnte Spektakel<br />
wie eine Parade der touristischen Propaganda<br />
und wenig überzeugenden Wohlstandssymbolik<br />
inszeniert war, im Versuch, ein historisches<br />
Narrativ seinem Happy End zuzuführen, um<br />
die Erzählung über den mühseligen Weg in eine<br />
neue und bessere Epoche zu Ende zu bringen.<br />
Diese Erzählung stemmt sich jedoch durch die<br />
Realität ihres Inhalts mit allen Kräften gegen<br />
ihr eigenes Ende.<br />
Das Palais Khuenburg, in dem Franz Ferdinand<br />
geboren wurde, befindet sich etwa hundert<br />
Meter von dem Haus entfernt, in dem ich im<br />
Moment lebe. An der Ecke des Gebäudes ist eine<br />
Steintafel angebracht, auf der neben dem Todesdatum<br />
Franz Ferdinands auch eingemeißelt ist,<br />
dass der fatale 28. Juni 1914 den unmittelbaren<br />
Anlass für den Ersten Weltkrieg darstellte. Ich<br />
wiederhole, es ist eine bekannte Geschichte, die<br />
Geschichte ist überall, eingepflanzt durch vergleichbare<br />
Gegenstände, die uns an sie erinnern<br />
sollen, Denkmäler und Einkerbungen. Aber das,<br />
was mich interessiert, während ich an der Straßenbahnhaltestelle<br />
gegenüber dem imperialen<br />
Geburtshaus stehe und meinen Sohn im Arm<br />
halte, das, worauf alle diese Jahrestage, die wir<br />
kommemorativ begehen, mich hinzuweisen<br />
scheinen, ist eine ganz intime Perspektive, für<br />
die in historischen Erzählungen üblicherweise<br />
kein Platz ist, weil konkrete Dinge im Leben häufig<br />
den großen gesellschaftlichen Abstraktionen<br />
zum Opfer fallen. Aber meine intime Perspektive,<br />
die ich durch die Attribute einer Mutter,<br />
eines gewöhnlichen Menschen oder auch durch<br />
das Attribut einer Schriftstellerin von mittlerer<br />
Bedeutung kennzeichnen könnte, ist bodenständig<br />
in der radikalen Gegenwart verwurzelt,<br />
in der Kreisbewegung der Spirale hinfälliger<br />
politischer und ökonomischer Konzepte, die<br />
uns keinerlei Zukunftsgarantie liefern, für eine<br />
Zukunft, die durch algorithmische Schuldenkategorien<br />
verkauft ist und durch die unsere Kinder,<br />
ob sie wollen oder nicht, hindurch müssen.<br />
In dieser Perspektive sind die imperialistischen<br />
Bestrebungen Franz Ferdinands oder auch die<br />
reaktionären Pläne Gavrilo Princips Teile derselben<br />
politischen Diktatur, die gesellschaftliche<br />
Dynamiken manipuliert, wenn auch ganz<br />
und gar abgeschnitten von ihren eigentlichen<br />
Schicksalen. Wenn ich sage, gewisse historische<br />
Narrative seien unvollendet, auch hundert Jahre<br />
nach ihrer Kontinuität, dann öffne ich damit<br />
mir selbst, als Mutter, Mensch und Schriftstellerin<br />
einen Raum der Hoffnung, in dem die Geschichte<br />
noch immer zu den Menschen zurückkehren<br />
kann, die sie geduldig erdulden, einen<br />
Raum, in dem sich noch etwas unternehmen<br />
lässt, in dem sich etwas noch zu Ende schreiben<br />
lässt, und dieses Etwas müsste gerade hier,<br />
im Erdgeschoss der Geschichte begründet sein,<br />
unter den realen Schicksalen, wo die größte<br />
Panik herrscht und wo unsere Zukunft, durch<br />
schlechte Prognosen und defizitäre Statistiken<br />
angekündigt, bereits im Voraus abgeschafft ist.<br />
Der Zyklus, der durch das Jubiläum geschlossen<br />
wird, verlangt danach, von uns auf der Plattform<br />
unseres eigenen historischen Augenblicks einer<br />
neuerlichen Überprüfung unterzogen zu werden;<br />
wir müssen die nur scheinbar realisierten<br />
Konzepte revidieren, ebenso die Methoden,<br />
anhand derer diese Konzepte generiert wurden,<br />
wir müssen unsere opportunistischen Gewohnheiten<br />
ändern und auch den jämmerlichen<br />
intellektuellen Sarkasmus, wir müssen uns mit<br />
unseresgleichen solidarisieren, mit Menschen,<br />
die nicht in die Geschichte eingehen werden,<br />
aber die dennoch etwas mehr wollen als das, was<br />
die oben erwähnte Diskontkette Lidl ihnen anbieten<br />
kann. Wir müssen die Augen offen halten.<br />
Im Essay L’autre cap mit der Unterüberschrift<br />
“Mémoires, réponses et responsabilités” spricht<br />
Jacques Derrida von einer Sichtweise Europas<br />
als einer Landspitze, eines westlichen Zusatzes<br />
zum asiatischen Kontinent, dessen geographische<br />
Form schon immer die geistige Kartographie<br />
determinierte, denn eine Landspitze ist<br />
Kopf, Extremität, Ziel und Ende, eine ausgestülpte<br />
Spitze, die die Richtung vorgibt, eine<br />
Spitze ist auch ein Bug auf einem Schiff, das von<br />
einem Kapitän gesteuert wird, der die Macht<br />
hat, das Ziel der Reise zu verändern. Europa<br />
war, schreibt Derrida, immer schon offen gegenüber<br />
einer Geschichte, in der ein Kurswechsel<br />
oder das Verhältnis zu einem anderen Kurs für<br />
möglich erachtet wurden. Auf dieser Landspitze<br />
mit dem Blick zum Horizont zu leben, bedeutet,<br />
eine antizipierende historische Position einzunehmen,<br />
die es mit sich bringt, dass wir für uns,<br />
für andere und den anderen gegenüber Verantwortung<br />
tragen.<br />
Aus dem Kroatischen von<br />
Mascha Dabić<br />
Ivana Sajko<br />
Geboren 1975 in Zagreb. Autorin, Dramatikerin<br />
und Regisseurin. In der Übersetzung von<br />
Alida Bremer sind zwei Theatertrilogien im<br />
Verlag der Autoren erschienen, Archetyp: Medea<br />
/ Bombenfrau / Europa: Trilogie (2008) und<br />
Trilogie des Ungehorsams: Drei Einakter (2012),<br />
und der Roman Rio Bar im Verlag Matthes &<br />
Seitz, 2008.<br />
Beton International März 2014 14
György Spiró<br />
Friedensjagd<br />
(Dramolett)<br />
Personen:<br />
Wilhelm II., Deutscher Kaiser<br />
Nikolaus II., Russischer Zar<br />
Adjutant<br />
Das Gespräch spielt sich am Abend des 28.<br />
Juni 1914 ab.<br />
Adjutant Eure kaiserliche Majestät, Moskau<br />
ist in der Leitung! Darf ich Euch den Zaren<br />
Nikolaus geben<br />
WILHELM Ja. – Votre Majesté, der Zar<br />
NIKOLAUS Votre Majesté, der Kaiser<br />
WILHELM Mein lieber Zarenvetter! Nicki!<br />
NIKOLAUS Mein teurer Kaiservetter! Willi!<br />
WILHELM Wie geht es Ihrer Majestät der Zarin,<br />
meiner Lieblingscousine<br />
NIKOLAUS Der Zarin geht es gut, danke der<br />
Nachfrage, sie lässt dir ihre herzlichsten<br />
und ehrerbietigsten Grüße bestellen! Jede<br />
Woche spricht sie davon, dass ich mich vielleicht<br />
nie getraut hätte, um ihre Hand anzuhalten,<br />
hättest du nicht so hartnäckig auf<br />
mich eingeredet!<br />
WILHELM Es war der achte April vor zwanzig<br />
Jahren … Ich musste dich nicht überreden,<br />
ich habe dir lediglich den Blumenstrauß in<br />
die Hand gedrückt …<br />
NIKOLAUS Das Jahr 1894 war das glücklichste<br />
meines Lebens! Kaum zu glauben, dass bereits<br />
zwanzig Jahre vergangen sind.<br />
WILHELM Wie schön es wäre, wenn ich dich<br />
wieder in Deutschland willkommen heißen<br />
könnte!<br />
NIKOLAUS Und im November werden es vier<br />
Jahre, seit ich zuletzt bei euch jagen war.<br />
WILHELM Es war schon etwas kühl damals.<br />
NIKOLAUS Der Schlamm reichte uns bis zu den<br />
Knien. Aber ich mag den Schlamm. Wie viel<br />
Wild wir erlegt haben! Um die vierzig Hirsche<br />
und mehr als sechzig Rehe … Es war<br />
wunderbar, Willi!<br />
WILHELM Ich hoffe, dich dieses Jahr erneut in<br />
Berlin empfangen zu dürfen.<br />
NIKOLAUS Es wäre mir eine Freude. Bis Mitte<br />
September ist der Krieg bestimmt zu Ende.<br />
WILHELM Wurde dir etwa zugetragen, dass<br />
bald ein Krieg ausbricht<br />
NIKOLAUS Es kann kaum anders kommen, in<br />
Sarajevo wurde heute nämlich der österreichische<br />
Thronfolger Franz Ferdinand<br />
erschossen.<br />
WILHELM Darüber hat man mich noch nicht<br />
verständigt.<br />
NIKOLAUS Ich habe es auch erst vor fünf Minuten<br />
erfahren.<br />
WILHELM Weiß es Franz Joseph schon<br />
NIKOLAUS Er wird es bald wissen. Er wird Serbien<br />
ein Ultimatum stellen, das Serbien zurückweisen<br />
wird; daraufhin werde ich meine<br />
Leute mobilisieren …<br />
WILHELM Ich stelle mich an Franz Josephs<br />
Seite …<br />
NIKOLAUS Es wird zwischen deinen und meinen<br />
Truppen in Ostpreußen zum Kampf<br />
kommen. Als Kriegsschauplatz schlage ich<br />
das Weichselland um Warschau vor, dort<br />
leben sowieso nur Polen, um die ist es nicht<br />
schade. Von meinen Generälen steht Samsonow<br />
schon bereit.<br />
WILHELM Bei mir zieht von Mackensen zu Felde.<br />
Der alte Knabe kann es kaum erwarten,<br />
sich zu messen.<br />
NIKOLAUS In ein paar Wochen, nach einigen<br />
kleineren Siegen meinerseits, schließen wir<br />
auf dem östlichen Kriegsschauplatz Frieden.<br />
Du bist ohnehin nur am französischen<br />
Kriegsschauplatz wirklich interessiert. Ich<br />
werde nichts dagegen haben, wenn du in Paris<br />
einmarschierst.<br />
WILHELM Das ist nett von dir, Nicki.<br />
NIKOLAUS Serbien, Rumänien und der Balkan<br />
gehören weiterhin mir. Polen bleibt nach<br />
wie vor aufgeteilt.<br />
WILHELM Einverstanden.<br />
NIKOLAUS Die Spannung und das Wirrwarr<br />
sind so groß bei uns, und es laufen so viele<br />
Wahnsinnige, Revolutionäre, Gottlose und<br />
erfolgshungrige Generäle herum, dass ich<br />
die Energien irgendwo ableiten muss.<br />
WILHELM Das geht mir genauso. Meine Generäle<br />
quälen mich noch zu Tode, ich kann sie<br />
ja in keinen höheren Rang mehr aufrücken<br />
lassen: von Seeckt, Hindenburg, Ludendorff,<br />
von Falkenhayn, von Moltke … Es ist<br />
mir unmöglich, so viele Militärübungen zu<br />
organisieren, dass sie sich alle beweisen<br />
können … Da kommt ein bisschen Krieg<br />
ganz gelegen, auch wenn ich befürchte, dass<br />
er meine Generäle zu sehr festigt … Sei so<br />
nett und wirke auf Brussilow und deine übrigen<br />
großartigen Generäle ein, dass sie ja<br />
tapfer gegen uns kämpfen!<br />
NIKOLAUS Versprochen. Generäle sind wie Pinscher,<br />
ab und zu man muss sie sich austoben<br />
lassen, damit sie das Halsband nicht ständig<br />
spüren. Es muss schließlich auch der Opposition<br />
etwas geboten werden, soll sie doch<br />
in der Duma schwätzen… Wie geht es eigentlich<br />
den von dir finanzierten russischen<br />
Bolschewiken in der Schweiz<br />
WILHELM Danke der Nachfrage, sie spielen<br />
tagein, tagaus Schach, in Ermangelung einer<br />
sonstigen Aufgabe. Sie sind zu siebenundzwanzigst<br />
und schnauzen sich gegenseitig<br />
in sechs Fraktionen an.<br />
NIKOLAUS Ich begreife einfach nicht, was so<br />
vergnüglich am Schachspielen sein soll.<br />
WILHELM Erzähl doch, wie sich das Attentat<br />
zugetragen hat! Wo ist es gleich passiert<br />
NIKOLAUS In der Innenstadt von Sarajevo.<br />
WILHELM Sarajevo Wo ist das<br />
NIKOLAUS In Serbien. Oder doch nicht, mein<br />
Adjutant schüttelt den Kopf… In Kroatien<br />
Auch nicht Entschuldigung… In Bosnien,<br />
sagt mein Adjutant. Egal. Der erste Attentäter,<br />
ein Muhamed Mehmedbašić, hat sich<br />
nicht getraut zu schießen, obwohl er es zuvor<br />
hoch und heilig gelobt hatte.<br />
WILHELM Ein türkischer Name, nicht wahr<br />
Sind die Attentäter etwa Türken!<br />
NIKOLAUS Ein vertürkter slawischer oder ein<br />
verslawter türkischer Name. Sämtliche Attentäter<br />
sind südslawische Nationalisten,<br />
Mitglieder der Narodna Odbrana. Das bedeutet<br />
so viel wie Volksschutz.<br />
WILHELM Wie viele südslawische Völker gibt<br />
es überhaupt<br />
NIKOLAUS Wie viele südslawische Völker es<br />
gibt – Mein Adjutant sagt, sechs oder sieben…<br />
Die wollen sich alle zu einem kleinen<br />
unabhängigen südslawischen Königreich<br />
zusammenschließen. Ein solcher Staat<br />
steht zwar nicht vollkommen im Interesse<br />
Russlands, aber gegenüber den von Österreich<br />
finanzierten Slawen muss ich die Idee<br />
vorerst unterstützen. Also, dieser Muhamed<br />
hat kalte Füße bekommen und hat<br />
nicht geschossen. Der zweite Attentäter…<br />
Wie heißt er doch gleich Wie bitte Nedeljko<br />
Also Nedeljko hat eine Bombe auf den<br />
Wagen geworfen, aber er hatte sie schlecht<br />
entsichert, sodass sie zehn Sekunden später<br />
explodiert ist und die Insassen des nächsten<br />
Wagens verletzt wurden… Dieser Nedeljko<br />
hat vor Ort Zyankali geschluckt und ist in<br />
den Fluss gesprungen, er wusste ja nicht,<br />
dass der nur zehn Zentimeter tief ist, ein<br />
Wunder, dass er sich nicht das Genick gebrochen<br />
hat… Die Haltbarkeit des Zyankalis<br />
war abgelaufen, also ist ihm überhaupt<br />
nichts passiert... (lacht)<br />
WILHELM Das sind deine zuverlässigsten Agenten<br />
Nicki!<br />
NIKOLAUS Sie sind nicht meine Agenten, ich<br />
finanziere sie nur. Das ist eine billige Sippschaft,<br />
eher verblendet als utilitär. Ich<br />
möchte dich darauf aufmerksam machen,<br />
dass ich noch vor dem ganzen Rest der Welt<br />
von der Verübung des Attentats erfahren<br />
habe.<br />
WILHELM Keine Sorge, ich werde meinen Geheimdienst<br />
deshalb noch heruntermachen.<br />
Eine Schande! Aber erzähl weiter!<br />
NIKOLAUS Die Verletzten wurden ins Krankenhaus<br />
gebracht, und Franz Ferdinand<br />
hat beschlossen, sie zusammen mit Herzogin<br />
Sophie zu besuchen. Eine noble Geste,<br />
wir wurden sofort davon unterrichtet. Der<br />
Chauffeur – einer unserer Männer – hat<br />
sich sozusagen verfahren, ist stehen geblieben<br />
und hat begonnen, zurückzusetzen.<br />
WILHELM Dafür gibt es doch irgendeine offizielle<br />
Bezeichnung...<br />
NIKOLAUS Auf Russisch sagen wir rückwärts.<br />
WILHELM Ja genau!<br />
NIKOLAUS Der Chauffeur hat am Flussufer manövriert,<br />
und man sagt, ihm sei mehrmals<br />
der Motor abgestorben, das hat ein ausgezeichnetes<br />
Ziel geboten. Der nächste Attentäter<br />
hätte schießen sollen, wie ist doch<br />
gleich sein Name – Gavrilo Princip. Danke.<br />
– Er hat auch gezielt, aber es stellte sich<br />
heraus, dass er in der Früh vergessen hatte,<br />
seine Pistole zu laden. Also hat schließlich<br />
einer der Leibwächter im Wagen den<br />
Thronfolger und seine Frau aus einem halben<br />
Meter Entfernung erschossen. Dieser<br />
Kerl namens Gavrilo wurde als Attentäter<br />
festgenommen, der hat ebenfalls Zyankali<br />
geschluckt, aber es in seiner Aufregung<br />
wieder erbrochen, da war wohl auch schon<br />
die Haltbarkeit abgelaufen… Es war noch<br />
ein Landeschef bei ihnen im Wagen… – Wie<br />
bitte Mein Adjutant sagt, sein Name sei Potiorek...<br />
Der blieb unverletzt.<br />
WILHELM Abgelaufenes Zyankali!... (lacht vor<br />
sich hin) Wahrlich unterhaltsam! – Sag, wie<br />
geht es denn dem Thronfolger<br />
NIKOLAUS Seine Bluterkrankheit scheint sich<br />
gebessert zu haben… Er wird durchgehend<br />
von einem genialen Mann mittels Beschwörungsformeln,<br />
Handauflegen und Gebeten<br />
behandelt…<br />
WILHELM Sein Name ist Rasputin, oder Mir<br />
wird ständig über ihn berichtet. Hat er noch<br />
immer so einen großen Einfluss an deinem<br />
Hof<br />
NIKOLAUS Deine Informationen sind exakt.<br />
Meine Frau vergöttert ihn. Er ist in der Tat<br />
ein großer Mann. Das einzige Problem mit<br />
ihm ist, dass er den Krieg ablehnt, er befürchtet,<br />
ein Krieg könnte das Ende des<br />
Hauses Romanow bedeuten, und das verkündet<br />
er auch offen.<br />
WILHELM Ein klares Zeichen von Beschränktheit.<br />
NIKOLAUS Er ist zwar ein genialer Mann, aber<br />
ungebildet. Er versteht meine Situation<br />
nicht. Er versteht nicht, wie viele uns von<br />
wie vielen Seiten angreifen. Nur mit einem<br />
schnellen Krieg kann ich mir etwas Ruhe sichern.<br />
WILHELM Ich kenne die Situation. Wir haben<br />
jetzt Ende Juni. Das Überbringen der<br />
Kriegserklärungen nimmt zwei, drei Wochen<br />
in Anspruch, aber Mitte Juli können<br />
wir schon kämpfen, der August vergeht<br />
noch mit Kriegführen, und im September<br />
können wir dann Frieden schließen.<br />
NIKOLAUS Das entspricht auch meinen Berechnungen.<br />
WILHELM Wie geht es deinem Cousin, König<br />
George Was hast du über seine Intentionen<br />
gehört<br />
NIKOLAUS König George stimmt deiner Erklärung<br />
zu, die du den englischen Blättern gegeben<br />
hast und laut welcher die Engländerfeindlichkeit<br />
in Deutschland wächst. Er für<br />
seinen Teil drängt auf die Deutschenfeindlichkeit<br />
des britischen Volkes und schürt<br />
sie. Er wird an unserer Seite in den Krieg<br />
eintreten, gegen dich.<br />
WILHELM Wir rechnen mit ihm. Er wirbelt<br />
nicht viel Staub auf, England ist weit weg.<br />
Ich plane, gegen die Franzosen Giftgas einzusetzen.<br />
Angeblich kann man damit Hunderttausende<br />
in einer halben Stunde töten,<br />
wir werden sehen, ich habe da so meine<br />
Zweifel. Deine Truppen werde ich mit dem<br />
Gas verschonen. Bitte Nicki, übergib König<br />
George meine herzlichsten Grüße. Ich bin<br />
gespannt, was meine Unterseeboote gegen<br />
seine Flotte ausrichten können.<br />
NIKOLAUS König George hält nicht viel von<br />
Unterseebooten. Er rechnet damit, dass der<br />
Krieg bis Anfang Oktober zu Ende sein wird.<br />
WILHELM Laut meinen Generälen werden wir<br />
seine Flotte um einiges früher zerschlagen.<br />
NIKOLAUS Wie ich höre, kommen bei dir neuartige<br />
Kriegsvehikel zum Einsatz.<br />
WILHELM Ja, die sogenannten Panzer. Sie<br />
walzen alles wahllos nieder. Aber von den<br />
Kampfflugzeugen erwarte ich noch mehr.<br />
Sie werden von oben Granaten auf die Fronten<br />
abwerfen.<br />
NIKOLAUS Ich vertraue auf die Menschen. Die<br />
Tapferkeit und die Zahl des russischen Volkes<br />
sind unerschöpflich.<br />
WILHELM Die Kühnheit der deutschen Soldaten<br />
ist sprichwörtlich. Wir werden die Franzosen<br />
schon auf Zack bringen. – Nun, lieber<br />
Nicki, ich hoffe, ich darf dich zusammen mit<br />
dem britischen Herrscher im September in<br />
Berlin empfangen.<br />
NIKOLAUS Das hoffe ich auch, ich nehme die<br />
Einladung dankend an und leite sie an König<br />
George V. weiter, der sie sicherlich mit<br />
ebenso großer Freude annehmen wird.<br />
WILHELM Übermittle doch bitte Ihrer Majestät<br />
der Zarin meine Ehrerbietung. Königin<br />
Victoria hat immer wieder geäußert, dass<br />
Alix ihr liebstes Enkelkind ist. Und wir übrigen<br />
Enkel haben sie stets beneidet, und<br />
dann auch dich, der du sie geheiratet hast.<br />
NIKOLAUS Sie ist eine wunderbare Frau, bis<br />
heute verbessert sie unermüdlich meine<br />
englische Aussprache. – Ich muss zugeben,<br />
in letzter Zeit ist sie unruhig, die steigende<br />
Deutschenfeindlichkeit in Russland macht<br />
sie nervös, ich versuche vergebens sie davon<br />
zu überzeugen, dass das alles notwendig ist<br />
und nur ein vorübergehender Zustand, der<br />
nach dem Krieg mit einem Schlag zu Ende<br />
sein wird. (lacht) Einen Kopfsprung in zehn<br />
Zentimeter tiefes Wasser machen und am<br />
Leben bleiben! C’est ridicule!<br />
WILHELM (lacht) Abgelaufenes Zyankali! C’est<br />
magnifique! – Alles Gute, mein lieber Nicki,<br />
wir sehen uns als Gegner auf dem Schlachtfeld!<br />
NIKOLAUS Willi, ich wünsche dir und deinen<br />
Truppen viel Glück!<br />
(Klicken)<br />
ADJUTANT Eure kaiserliche Majestät, in der<br />
anderen Leitung möchte Euch General von<br />
Mackensen dringend sprechen.<br />
WILHELM Ja. Gleich. Beginnen Sie unverzüglich,<br />
die Jagd für September zu organisieren.<br />
Es kommen der russische Zar, der britische<br />
Herrscher, Kaiser und König Franz<br />
Joseph, und von mir aus soll auch von den<br />
Franzosen jemand kommen, der noch am<br />
Leben sein wird; es könnte sogar sein, dass<br />
sie nach dem französischen Zusammenbruch<br />
das Königtum wieder einführen.<br />
(lacht) Ich will eine außergewöhnliche,<br />
unvergessliche Friedensjagd! Eine Berliner<br />
Friedensweltausstellung! Aber vorher vergessen<br />
Sie nicht, an alle Betreffenden eine<br />
Kriegserklärung zu übermitteln!<br />
ADJUTANT Jawohl, Eure Majestät!<br />
WILHELM Dass Sie mir ja nicht verwechseln,<br />
wer Freund und wer Feind ist!<br />
ADJUTANT Das wird nicht geschehen, Eure<br />
Majestät!<br />
WILHELM Für die Jagd wünsche ich eine riesige<br />
Menge an Beute. Mindestens achtzig<br />
Hirsche, hundertzwanzig Wildschweine<br />
und dergleichen!<br />
ADJUTANT Jawohl, Eure Majestät!<br />
WILHELM Und Bären! Soll der Zar doch eine<br />
Freude haben! Mindestens zwanzig Eisbären!<br />
ADJUTANT Bei den Russen gibt es keine Eisbären…<br />
WILHELM Eben deshalb! Beschaffen Sie welche<br />
aus Alaska!<br />
ADJUTANT Und wenn auch Amerika in den<br />
Krieg zieht<br />
WILHELM Ich bitte Sie, Amerika ist weit weg<br />
und bleibt neutral!<br />
ADJUTANT Wie Eure Majestät befehlen!<br />
Aus dem Ungarischen von<br />
Sandra Rétháti<br />
György Spiro<br />
Geboren 1946 in Budapest. Er unterrichtete<br />
an der Hochschule für Film und Theater und<br />
an der Universität Budapest. Mehr als zwanzig<br />
Dramen, Komödien und Kabarettstücke. Leider<br />
sind seine berühmten Romane Die X, Der<br />
Ankömmling und Die Gefangenschaft nicht ins<br />
Deutsche übersetzt; im Nischen Verlag sind<br />
sein Roman Der Verruf (2012) und die Novellensammlung<br />
Träume und Spuren (2013) in<br />
deutscher Sprache erschienen.<br />
Beton International März 2014 15
S. K. Rietberg<br />
Das Armband<br />
der Gräfin<br />
1.<br />
Ich war fünfzehn Jahre alt, als mir meine<br />
Großmutter eines Tages ein zartes, zerbrechliches<br />
und etwas altmodisches Armband schenkte.<br />
Mein erster Gedanke war: Wann soll ich<br />
das je tragen Ich blickte verstohlen auf meine<br />
grelle Kunststoffuhr und die ausgeblichenen<br />
Freundschaftsbänder.<br />
„Marguerite, mein Schatz, ich möchte dir<br />
etwas schenken“, sagte meine Großmutter, die<br />
wir Enkel alle ‚Amama‘ nannten. Immer schon<br />
wurden in unserer Familie die Großmütter<br />
‚Amama‘ genannt. Es gab eine Ausnahme, eine<br />
aus Italien stammende Urgroßmutter, die mein<br />
Vater und alle seine Geschwister und Cousins<br />
‚Nonna‘ nannten. Immer wenn Papi von ihr erzählte,<br />
wurde er ganz sanft. Es gab auch einige<br />
‚Omamas‘ auf der österreichischen Seite der<br />
Verwandtschaft. Es war nicht leicht zu durchschauen,<br />
nach welchen Regeln die Verteilung<br />
der Omamas und Amamas jeweils erfolgte.<br />
Amama saß auf dem mit klassischem englischem<br />
Blumenmuster bezogenen Sofa in ihrem<br />
Salon. Sie war eine deutsche Gräfin, vielleicht<br />
sogar Prinzessin. In meiner Generation war es<br />
nicht cool, diese Dinge genau zu wissen.<br />
Meine Großmutter saß aufrecht, ohne sich<br />
anzulehnen, und ihr Gesichtsausdruck hatte etwas<br />
Zeremonielles.<br />
„Setz dich zu mir, Marguerite.“<br />
„Aber ich habe doch nicht Geburtstag oder<br />
Namenstag“, sagte ich.<br />
„Das ist jetzt ganz gleich. Du bist fünfzehn,<br />
eine junge Dame“, sagte meine Großmutter.<br />
Achtung: Erwartungen, dachte ich. Denn<br />
das Wort ‚Dame‘ traf nicht unbedingt auf mich<br />
zu. Amama spürte meine Verkrampfung. Ihre<br />
Stimme wurde weicher.<br />
„Ich war auch fünfzehn, damals. Schau her.“<br />
Neben ihr lag ein kleiner roter Samtbeutel,<br />
mit einem ebenso roten Schnürchen zugebunden.<br />
Sie öffnete den Beutel und ließ das Armband<br />
in ihre linke Hand gleiten. Dann benutzte<br />
sie den Samtbeutel als Unterlage und legte das<br />
Armband darauf.<br />
„Dieses Bracelet“, sagte sie, „hat eine besondere<br />
Geschichte. Es ist ein bissl unpraktisch,<br />
weil es so fragil ist. Vielleicht kann man es<br />
ja irgendwie mit Golddrähten verstärken.“<br />
„Nein, nein“, sagte ich „es ist wunderschön.<br />
Ich werde es natürlich …“, obwohl ich mich fragte,<br />
bei welcher Gelegenheit man solche Armbänder<br />
tragen sollte. „Du warst auch fünfzehn,<br />
als du es bekommen hast“<br />
„Ja“, sagte Amama „und zwar von meiner<br />
Großmutter. Du weißt, sie war eine geborene<br />
Kinsky.“<br />
Ich wusste es nicht. Üblicherweise schaltete<br />
mein Hirn ab, wenn ich das Wort ‚geborene‘<br />
hörte.<br />
„Kinsky, ja, aus Deutschland“, sagte ich.<br />
„Na ja, eigentlich waren die Kinskys Böhmen.<br />
Aber kaisertreue Böhmen, jedenfalls damals.<br />
Und sowieso mit allen in Österreich und<br />
Deutschland verwandt.“<br />
Böhmen war nicht auf meiner Landkarte.<br />
Aber ich wusste, dass es etwas mit Prag zu tun<br />
haben musste.<br />
„O.K.“, sagte ich und Amama lächelte mich<br />
sanft an, denn das Wort ‚O.K.‘ mochte sie nicht<br />
wirklich in einer Konversation.<br />
„Meine Großmutter hat dieses Armband<br />
sehr geliebt. Wir Enkel nannten sie ‚Onana‘.“<br />
Onana, dachte ich. Das war neu … „Hmm.“<br />
„Ja, gell! Nicht ‚Amama‘, das meinst du,<br />
oder Die war eine ‚Onana‘, eine besonders gütige<br />
Großmutter, aber natürlich aus einem anderen<br />
Jahrhundert.“<br />
Aus zwei anderen Jahrhunderten, vermutete<br />
ich.<br />
„Was ist die besondere Geschichte dieses<br />
Brasslö – dieses Armbands, Amama“<br />
„Nun ja“, sagte meine Großmutter, „dieses<br />
Bracelet gehörte der im Jahr 1914 in Sarajevo<br />
ermordeten Herzogin von Hohenberg. Sie war<br />
die Frau des ebenfalls dort ermordeten Thronfolgers<br />
des österreichischen Kaiserreichs, Erzherzog<br />
Franz Ferdinand. Sie sind Seite an Seite<br />
gestorben, im Auto. Der Attentäter war ein serbischer<br />
Revolutionär mit einer Pistole. Und dieses<br />
Attentat hat dann den furchtbaren Ersten<br />
Weltkrieg ausgelöst. Aber keine Angst, Sophie<br />
trug am Tag des Attentats ein anderes Armband.<br />
Dieses war für sie immer zu privat. Eine<br />
Familiensache. Es war zu Hause geblieben.“<br />
„Sie hieß Sophie“, fragte ich. Das gedehnte<br />
„i“ am Ende des Namens gefiel mir.<br />
„Ja, Sophie“, sagte meine Großmutter, „eigentlich<br />
‚Großtante Sophie‘. Sie war die direkte<br />
Cousine meiner Großmutter Kinsky, eine<br />
geborene Gräfin Chotek. Die Choteks waren<br />
auch böhmische Grafen. Ihr Vater war mit einer<br />
Kinsky verheiratet gewesen, die aber sehr früh<br />
verstorben war.“<br />
Das Bracelet der Gräfin Sophie bestand aus<br />
zwei schlichten und parallel laufenden Goldketten<br />
mit kleinen, feinen Kettengliedern. Nur<br />
die Verschlusselemente, auch in Gold, führten<br />
die Goldketten wieder zusammen. Die beiden<br />
Ketten wurden durch acht im Abstand von<br />
etwa einem Zentimeter quer angelötete und<br />
mit jeweils drei kleinen Brillanten besetzte<br />
Elemente verbunden. Fast wie Sprossen einer<br />
Leiter. Zwischen diesen Brillantsprösschen<br />
waren sieben sehr vorsichtig gefasste Steine.<br />
Drei grüne, drei weiße, wovon zwei einen bunten<br />
Schimmer warfen, und ein roter, wie ein<br />
Tropfen Blut.<br />
„Schau“, sagte meine Großmutter, „die grünen<br />
Steine sind Smaragde, sie sehen wie grüne<br />
Augen aus. Findest du nicht auch Die beiden<br />
weißen, die so lustige Regenbogenfarben haben,<br />
nennt man Opale. Der dritte weiße ist<br />
entweder ein Bergkristall oder ein einfacher<br />
Diamant. Und der rote hier, das ist ein Rubin.<br />
Dieses spezielle Rot nennt man ‚pigeon blood‘,<br />
Taubenblut.“<br />
Blut!<br />
„Jeder dieser Steine kam von einer der<br />
Schwestern von Sophie Chotek und von ihren<br />
Cousinen Kinsky. Ich glaube, meine Großmutter<br />
hat sich dieses Geschenk für ihre Lieblingscousine<br />
ausgedacht. Die jungen Frauen gaben<br />
es Sophie an ihrem Hochzeitstag, dem 1. Juli<br />
1900. Es war eigentlich fast ein Affront, bei dieser<br />
Hochzeit gewesen zu sein.“<br />
„Was ist ein Affront“, wollte ich wissen.<br />
„Ein Affront ist eine unmögliche Sache, etwas,<br />
was gegen die Regeln ist, beinahe eine Beleidigung.“<br />
„Warum Beleidigung Warum Affront“,<br />
unterbrach ich meine Großmutter. „Ich denke<br />
mal, die haben sich geliebt“<br />
„Ja“, meine Großmutter nickte, wie um es<br />
zu unterstreichen, „Franz Ferdinand und Sophie<br />
müssen sich wirklich sehr geliebt haben.<br />
Sonst hätten sie all das nie auf sich nehmen<br />
können.“<br />
„Aber was war denn so schwierig, wenn zwei<br />
heiraten“ Meine Stimme ging leicht nach oben.<br />
Und meine Großmutter erzählte mir alles.<br />
Von den tragischen Ereignissen im ‚Erzhaus‘,<br />
wie sie die Familie Habsburg nannte. Vom Tod<br />
oder Selbstmord, Amama ließ es offen, des Kronprinzen<br />
und Erben des Thrones von Österreich-<br />
Ungarn, Erzherzog Rudolph, im Jahr 1889, vom<br />
Attentat auf Kaiserin Elisabeth im Jahr 1898.<br />
Vom alten, seit 1848 regierenden Kaiser Franz<br />
Josef I., seinem Bruder Maximilian, erst Erzherzog<br />
und dann, wieder tragisch, Kaiser von<br />
Mexiko, und von seinem jüngeren Bruder Karl<br />
Ludwig und dessen gesamten Nachkommen,<br />
darunter der Thronfolger Franz Ferdinand und<br />
auch dessen Neffe, der spätere Kaiser Karl. Hunderte<br />
Namen. Am Ende meinte sie:<br />
„Also das alles nur, damit du dich ein bissl<br />
auskennst. Ja “<br />
Meine Großmutter sprang zwischen den<br />
Generationen und innerhalb der Generationen<br />
umher und wusste immer, wo sie gerade war.<br />
So, als hätte sie ein gigantisches Notebook oder<br />
Großmutter-iPad vor sich, von dem sie ablesen<br />
konnte. Das Unterbrechen und Nachfragen<br />
hätte nichts gebracht, denn dann hätte man die<br />
eine oder andere Spur vertiefen können und<br />
wäre am Ende nur noch verwirrter gewesen.<br />
Draußen ging die Sonne unter. Ich dachte mir,<br />
wenn ich jetzt still zuhöre, dann entsteht das<br />
‚big picture‘, wie meine Brüder immer sagten,<br />
irgendwann von selbst. Das Eigentliche würde<br />
schon kommen.<br />
Das Eigentliche war die Liebe.<br />
Und die ganze Zeit schaute ich auf das Armband.<br />
Ich schaute in grüne Augen. Und taubenblutrot<br />
schlug das Herz. Der Tropfen Blut. Neben<br />
dem brautweißen Kleid.<br />
„Amama“, sagte ich, „das ist so gemein!“<br />
„Das war halt so“, sagte meine Großmutter.<br />
„Stell dir vor, es ist Monarchie und du merkst,<br />
der junge Mann, der dir vom ersten Augenblick<br />
an gefallen hat, ist der Thronfolger, und plötzlich<br />
merkst du, dass er sich in dich verliebt hat.“<br />
Es ist doch piepschnurzegal, ob gerade<br />
Monarchie oder sonst etwas ist!, dachte ich und<br />
sagte nur: „Hhmm.“<br />
„Er hat Sophie sicher gleich beim ersten<br />
Ball gefragt, ‚Gehen Gräfin Sophie mit auf die<br />
Terrasse‘ Und sie hat sicher den Atem angehalten,<br />
und wie soll eine junge Frau dann noch das<br />
‚kaiserliche Hoheit‘ herausbringen“<br />
Wie bitte Gräfin Sophie Kaiserliche Hoheit<br />
Was sollte das denn<br />
„Haben die sich denn nicht geduzt, wenn sie<br />
schon zusammen getanzt haben“<br />
„Nein, nein“ antwortete meine Großmutter,<br />
„das kam erst viel später. Es verging eine ganze<br />
Weile, bis Sophie ihre Liebe jemandem anvertrauen<br />
konnte. Ihr war die Lage sicher vollkommen<br />
bewusst. Und die Lage war eben die, dass<br />
Sophie für ein Mitglied des Erzhauses nun einmal<br />
nicht standesgemäß war.“<br />
„Ja, aber, Gräfin und Erzdingsbums sollte<br />
doch in Ordnung sein“, meinte ich. „Sind doch<br />
beide Aristocats und dann passt’s, oder nicht“<br />
„Nein“, sagte Großmutter, „nein, es hat<br />
eben nicht ‚gepasst‘. Von einem Erzherzog,<br />
noch dazu dem Thronfolger – das war Franz<br />
Beton International März 2014 16
Ferdinand de facto schon, als er Sophie Mitte<br />
der 90er Jahre des neunzehnten Jahrhunderts<br />
kennen lernte – wurde erwartet, dass er königlich<br />
heiratet. Das waren die habsburgischen<br />
Hausgesetze. Die waren strenger als alle anderen<br />
in Europa. Und Sophie wusste das. Sie hat<br />
sicher versucht, ihre Gefühle zu bekämpfen,<br />
und lange nicht glauben können, dass Franz<br />
Ferdinand es ernst meint. Aber die Liebe war<br />
stärker. Er hat ihr klar gemacht, dass er nur sie<br />
wollte. Kaiser hin, Kaiser her. Es muss überwältigend<br />
gewesen sein!“<br />
„Mann, war das kompliziert!“<br />
„Lange konnten die beiden es sowieso nicht<br />
geheim halten. Irgendwann wurde allen klar,<br />
warum der begehrteste junge Mann des Kaiserreichs<br />
so oft zu seiner Tante, bei der Sophie<br />
arbeitete, zu Besuch kam. Und dann war es wie<br />
eine Bombe. Wie wenn man in ein Wespennest<br />
hineingreift.“<br />
Beim gemeinsamen Abendessen mit Großeltern,<br />
Eltern, Onkeln, Tanten, Geschwistern<br />
und Cousins verkündete meine Großmutter,<br />
dass sie mir am Nachmittag das Armband von<br />
‚Tante Sophie‘ übergeben hatte. Ich war ganz<br />
still und wurde etwas rot hinter den Ohren.<br />
Meine Cousinen wollten sofort das Armband<br />
sehen. Aber ich sagte, man würde es nur bei<br />
Tageslicht gut sehen können, und verzog mich<br />
bald in mein Zimmer. Ich holte das Armband<br />
aus dem roten Samtbeutelchen und legte es<br />
darauf. So, wie es meine Großmutter am Nachmittag<br />
gemacht hatte.<br />
Nicht standesgemäß! Wenn mir je einer<br />
von diesen Habsburgs begegnet, fahr’ ich ihn<br />
an, noch bevor er weiß, wer ich bin, dachte ich.<br />
Mein Blick versank in den Steinen. Die grünen<br />
Steine, der rote, die unschuldig weißen.<br />
Was hatte das mit mir zu tun 1914 war mindestens<br />
fünfhundert Jahre her! Das Schicksal<br />
von Sophie machte mich traurig und zornig zugleich.<br />
Sophie, dachte ich und blickte in grüne<br />
Augen, was hast du mit mir zu tun Was gehst<br />
du mich an, Sophie<br />
Der Blutstropfen.<br />
Sophie! Sie war da. Mit ihrer Liebe zu ihrem<br />
Mann und ihren Kindern. Mir war, als sähe sie<br />
mich an, als wollte sie mir sagen, dass ich ihr<br />
als neue Trägerin ihres Armbands, ihres Hochzeits-Bracelets,<br />
eine würdige Nachfolgerin werden<br />
sollte.<br />
2.<br />
Ich wollte nicht, dass Sophie stirbt. Und<br />
so entschloss ich mich, die Geschichte neu zu<br />
schreiben. Ich wusste noch nicht, wie ich anfangen<br />
sollte, aber ich hatte meine Großmutter<br />
mit ihren Erinnerungen, meinen Großvater für<br />
genauere Jahreszahlen und – hey, wir lebten im<br />
Zeitalter des Internets! – ich hatte auch Wikipedia<br />
und Google.<br />
„Sophie! Sopherl Wir sollten langsam zum<br />
Diner. Mach ein bissl g’schwinder, bitte!“, sagte<br />
Erzherzog Franz Ferdinand am Abend des 27.<br />
Juni 1914.<br />
Im eleganten Kurort Ilidze in unmittelbarer<br />
Nähe von Sarajevo gaben die örtlichen Oberen<br />
ein Galadiner im besten Hotel des Ortes, zu Ehren<br />
des Thronfolgers und seiner Gemahlin, Ihrer<br />
Hoheit der Herzogin von Hohenberg.<br />
„Komme schon, Franzi!“ erklang es aus dem<br />
Ankleidezimmer der Suite.<br />
***<br />
„Das Armband der Gräfin“ - Zusammenfassung:<br />
Die neunzehnjährige Marguerite erzählt,<br />
dass sie zu ihrem fünfzehnten Geburtstag von<br />
ihrer Großmutter ein Armband geschenkt bekam,<br />
dessen erste Trägerin die 1914 in Sarajevo<br />
erschossene Sophie Herzogin von Hohenberg<br />
war, geborene Gräfin Chotek. Das Armband war<br />
seit 1914 immer in der Familie weitervererbt<br />
worden. Als fünfzehnjähriges Mädchen konnte<br />
Marguerite die tragische Geschichte von Sophie<br />
Hohenberg nicht ertragen. So veränderte<br />
sie in ihrem Tagebuch die Geschichte des Paares<br />
Franz Ferdinand und Sophie und somit die<br />
Geschichte der österreichischen Monarchie,<br />
Europas, der Weltkriege.<br />
S. K. Rietberg<br />
S. K. Rietberg entstammt einer alten Familie<br />
des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation.<br />
Seine Vorfahren lebten und wirkten erfolgreich<br />
in Politik, Militär und Diplomatie in vielen<br />
Ländern. Mit den Nachkommen des in<br />
Sarajevo ermordeten Thronfolgers und seiner<br />
Frau verbindet ihn ein nahes Verhältnis. S. K.<br />
Rietberg lebte in allen deutschsprachigen Ländern<br />
Europas und steht, wie seine Vorfahren,<br />
in besonderen Diensten. Er schreibt hier daher<br />
unter Pseudonym.<br />
Davor Korić<br />
Held oder Terrorist<br />
Erinnerungen an meinen Großvater Ivan Kranjčević,<br />
beteiligt am Attentat von Sarajevo<br />
Es war ein Herbsttag vor 20 Jahren, als ich<br />
voller Angst eine Transportmaschine der UN-<br />
PROFOR bestieg, die mich nach Ancona bringen<br />
sollte. Ich würde keine Schützengräben<br />
ausheben müssen und nicht von einem Heckenschützen<br />
oder einer Granate aus den umliegenden<br />
Bergen getroffen werden. Ich würde<br />
nicht zum Krüppel werden, wovor ich am meisten<br />
Angst hatte, wenn ich wie eine ungeschützte<br />
Tontaube auf der Straße unterwegs war und<br />
über mir ein Pfeifen oder in der Ferne eine<br />
Detonation hörte. Ich würde Dragana und die<br />
Kinder wiedersehen, die schon seit Jahren in<br />
Münster lebten. Die Briefe, die ich ihr geschrieben<br />
hatte, damit sie wusste, dass ich am Leben<br />
war und was in Sarajevo passierte, sollten in<br />
Deutschland veröffentlicht und das Buch dann<br />
auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt werden,<br />
das Buch, das mich aus der Gefangenschaft<br />
im Höllenkessel von Sarajevo befreite. An diesem<br />
Tag flüchtete ich wie in einem Actionfilm in<br />
die Freiheit!<br />
In der Tasche meines Parkas, in dem ich anderthalb<br />
Jahre Belagerung meiner Heimatstadt<br />
verbracht hatte, ertastete ich, nur um mich zu<br />
vergewissern, dass sie da war, neben meinem<br />
Reisepass und der UNPROFOR-Karte die Taschenuhr<br />
meines Großvaters Ivan Kranjčević.<br />
Ich hatte nur wenige Dinge in meinen Koffer<br />
gepackt: ein paar Familienfotos und Videokassetten<br />
mit meinen Sendungen und dem verbotenen<br />
Film „Die Rolle meiner Familie in der<br />
Weltrevolution“, in dem ich als 19-Jähriger die<br />
Hauptrolle – den jungen Schriftsteller Bora<br />
Ćosić – gespielt hatte, dazu Opas Orden der<br />
Einheit und Brüderlichkeit, den ein silberner<br />
Kranz und eine Erinnerungsplakette der Stadt<br />
Sarajevo schmückten, außerdem zwei Ausgaben<br />
seines Buches Uspomene jednog učesnika<br />
u sarajevskom atentatu (Erinnerungen eines Beteiligten<br />
am Attentat von Sarajevo), erschienen<br />
1954 und 1964 mit einer Widmung an mich und<br />
meine Mutter Miroslava, seine einzige Tochter<br />
aus der Ehe mit der früh verstorbenen Christine<br />
Jandl, und dann noch sein Testament, das an<br />
mich gerichtet war, einen Brief des Nobelpreisträgers<br />
Ivo Andrić und einige Dokumente, die<br />
Zeugnisse unseres Lebens sind. Alles andere,<br />
was unsere Existenz hätte bezeugen können,<br />
war in den Wirren des Krieges verschwunden.<br />
In Köln, wo ich heute lebe und arbeite, habe ich<br />
außer diesen wenigen kostbaren Dingen nur<br />
nebelhafte Erinnerungen.<br />
Opa Ivan starb im Schlaf, in seinem Messingbett,<br />
auf dem er nach dem Mittagessen gewöhnlich<br />
ein Nickerchen machte. Ich war erst<br />
17 Jahre alt, ein Alter, das junge Menschen vor<br />
der Erkenntnis schützt, dass wir sterblich sind.<br />
Ich erinnere mich, wie ich ihm ein weißes Hemd<br />
anzog, festliche Hosen und Schuhe, ich war<br />
mir nicht bewusst, dass ich ihn nie wieder sehen<br />
würde, dass ich nie wieder in sein Zimmer<br />
gehen und mit ihm reden könnte. Erst später<br />
spürte ich die Leere und Trauer, weil er nicht<br />
mehr da war, und vermisste seine Fürsorge<br />
und Liebe, die ich beim Erwachsenwerden gebraucht<br />
hätte, weil ich meinen Vater Muhamed<br />
nie kennen gelernt hatte. Wenn er sich über<br />
meine Streiche ärgerte, sagte Opa Ivan immer,<br />
es sei schade, dass er mir nicht seine Erfahrung<br />
vererben könne, weil jeder für sich selbst erfahren<br />
müsse, dass man nicht mit dem Kopf durch<br />
die Wand kann und dass wir uns verbrennen,<br />
wenn wir die Hand ins Feuer halten.<br />
1914, als er wegen seiner Beteiligung am<br />
Attentat auf den österreichischen Thronfolger<br />
Ferdinand und wegen revolutionärer Umtriebe<br />
in der Bewegung „Junges Bosnien“ zu zehn Jahren<br />
Haft verurteilt wurde, da war er gerade mal<br />
zwei Jahre älter als ich an jenem Tag, als sein<br />
Herz aufhörte zu schlagen.<br />
Bald wird der Junitag hundert Jahre her<br />
sein, an dem sein Schulfreund Gavrilo Princip<br />
auf der Uferpromenade bei der Brücke „Latinska<br />
ćuprija“ mit einem Revolver Ferdinand erschoss<br />
und statt des verhassten österreichischungarischen<br />
Gouverneurs Potiorek die Herzogin<br />
Sophie traf. An diesem Tag irrte mein Großvater<br />
durch die Stadt und wartete. Seine Aufgabe<br />
war es, nach dem Attentat die Waffen seiner<br />
Freunde Cvjetko Popović und Vasa Čubrilović<br />
verschwinden zu lassen.<br />
Unmittelbar vor dem Sankt-Veits-Tag war<br />
Princip ihm aus dem Weg gegangen. Später<br />
erklärte er, er habe sich gewünscht, dass mein<br />
Großvater als Kroate auch einer der Attentäter<br />
sei, doch Danilo Ilić, der Organisator des Attentats,<br />
habe bereits heimlich die sechs Bomben<br />
und vier Revolver verteilt gehabt, so dass für<br />
meinen Großvater nichts mehr übriggeblieben<br />
sei. Trifko Grabež und der Moslem Muhamed<br />
Mehmedbašić hätten die Waffen bereits erhalten<br />
gehabt.<br />
Mit Gavrilo hatte sich mein Großvater im<br />
Gymnasium angefreundet, als er einmal bestätigte,<br />
Gavrilo sei krank gewesen und hätte deshalb<br />
die Hausaufgaben nicht machen können.<br />
Darüber hatte Princip sich gefreut, weil er neu<br />
in der Klasse gewesen war und weil ein Kroate<br />
ihm zur Seite gesprungen war und nicht seine<br />
serbischen Freunde, die ihn nur auslachten,<br />
wenn er in Schwierigkeiten geriet. Mit Princip<br />
und Nedeljko Čabrinović, der die erste Bombe<br />
auf den Wagen des Thronfolgers geworfen hatte,<br />
verbrachte mein Großvater ein Jahr seiner<br />
Haft in Theresienstadt, er war angekettet, weshalb<br />
er später sein ganzes Leben lang an Rheuma<br />
litt und sich nur mit Mühe bewegen konnte.<br />
Selbst jetzt, durch den trügerischen Nebel<br />
der Erinnerung, sehe ich ihn in seinem massiven<br />
Holzstuhl sitzen, als wäre er mit imaginären<br />
Ketten aus Theresienstadt daran festgekettet,<br />
an diesen Stuhl mit den breiten Armlehnen,<br />
der bei jeder Bewegung knarrt, er liest oder legt<br />
geduldig Patiencen. Immer überkommt mich<br />
eine Welle der Traurigkeit, wenn ich daran denke,<br />
dass er sich beim Lesen anstrengen musste,<br />
weil er als Kind beim Spielen auf einen Stock<br />
gefallen war und sein linkes Auge verloren hatte.<br />
Aber auch einäugig und noch so jung war er<br />
bereit gewesen, das Attentat zu verüben und<br />
sein Leben zu opfern.<br />
Wenn ich ihn mit kindlicher Neugier löcherte,<br />
erzählte mein Großvater mir oft, die Jugend<br />
damals sei ungeduldig und voller Tatendrang<br />
gewesen. Auch er gehörte dazu und organisierte<br />
mit den anderen Demonstrationen, weshalb<br />
er aus dem Gymnasium geworfen wurde und<br />
dann das Lehrerseminar in Kastav bei Rijeka<br />
besuchte. Ich erinnere mich, dass er behauptete,<br />
die Jugend sei in der ganzen Monarchie in<br />
einer solchen Stimmung gewesen, dass es in jedem<br />
anderen Ort zu dem Attentat hätte kommen<br />
können, zum Beispiel in Split. Inspiriert von den<br />
revolutionären Ideen russischer Schriftsteller,<br />
von Mazzini und Piemont, war die Jugend aufgeheizt,<br />
in einem psychischen Ausnahmezustand.<br />
Ein persönliches Opfer Bogdan Žerajićs, das Attentat<br />
auf den damaligen Gouverneur von Bosnien<br />
und Herzegowina General Varešanin 1910,<br />
erhob das Attentat als effektivstes Mittel politischen<br />
Kampfes zum Kult.<br />
Voller Elan und Naivität wollten die jungen<br />
Leute dem leidgeplagten Volk helfen. Sie glaubten,<br />
wenn sie ihr Leben opferten, könnten sie<br />
sich von der Besatzungsmacht und der Tyrannei<br />
befreien und einen Bund der südslawischen<br />
Völker schmieden. Die Jungbosnier träumten<br />
von einem Staat der Südslawen, mit Rede- und<br />
Gedankenfreiheit und der Trennung von Religion<br />
und Staat. Princip erklärte im Gerichtsprozess,<br />
er fühle sich weder als Serbe noch als<br />
Kroate, sondern als Jugoslawe, so wie die meisten<br />
anderen, denen wegen Hochverrats in Sarajevo<br />
der Prozess gemacht wurde.<br />
„Die Jugend ist sich bewusst, dass Freiheit<br />
Opfer fordert. Nur wer bereit ist, sich zu opfern,<br />
hat Erfolg. Die Jugend träumt nicht vom Sieg,<br />
von persönlichem Glück und einem besseren Leben,<br />
nein, ungeduldig wartet sie auf den richtigen<br />
Moment und die Gelegenheit, sich zu opfern.<br />
Das Opfer ist das Ziel, denn die Schönheit von<br />
Erfolg und Sieg wird nicht derjenige genießen,<br />
der sein Leben auf dem Opfertisch des Vaterlan-<br />
Beton International März 2014 17
des gegeben hat. Wer das versteht, der versteht,<br />
wie und warum es zum Attentat von Sarajevo<br />
gekommen ist.“ Das schreibt Opa Ivan in seinem<br />
Buch. Gavrilo Princip schrieb im Militärgefängnis<br />
in Sarajevo: „Die Zeit, sie schleicht / Es gibt<br />
nichts Neues / Das Heute dem Gestern gleicht /<br />
Morgen nur Gleiches / Doch Recht hatte früher /<br />
Žerajić der graue Falke / Wer leben will, der sterbe<br />
/ Wer sterben will, der lebe.“<br />
Aus der Ferne vergangener Zeiten dringen<br />
die Verse des Gedichts „Meine Maxime“ von<br />
Luka Jukić zu mir, das Vlado Jokanović, Schauspieler<br />
des Nationaltheaters in Sarajevo, am<br />
Grab meines Großvaters rezitierte: „Es tut mir<br />
leid um meine Leute / Um meine Familie / Es<br />
tut mir leid um meine schöne / Heimat / Es tut<br />
mir leid um die Hoffnungen / Der jungen Jahre<br />
/ Es tut mir leid um meine Liebste / Die so weinte<br />
/ Es tut mir leid um mich selbst / Doch was<br />
soll’s / Für Volk und Freiheit / Geb’ ich alles!“<br />
Am 8. Juni 1912 verübte Luka Jukić ein Attentat<br />
auf den kroatischen Ban Cuvaj. Damit<br />
begeisterte er die Jugend und bestätigte sie in<br />
ihrer revolutionären Stimmung. Ivo Andrić, der<br />
1911 als Vorsitzender einer geheimen Vereinigung<br />
serbischer und kroatischer Oberschüler<br />
kurz auf der Szene der Jungbosnier auftauchte,<br />
notierte an diesem Tag: „Heute hat Jukić ein Attentat<br />
auf Cuvaj verübt. Wie schön, dass die unsichtbaren<br />
Fäden von Tat und Auflehnung sich<br />
spannen. Voller Freude sehe ich große Taten<br />
nahen. Mein Leben vergeht ohne Bescheidenheit<br />
und Güte. Aber ich mag die Guten. Leben<br />
sollen die, die auf den Bürgersteigen sterben,<br />
ohnmächtig vor Wut und Pulver, krank von der<br />
gemeinsamen Schande. Die sollen leben, die<br />
zurückgezogen und schweigsam in dunklen<br />
Zimmern den Aufstand vorbereiten und immer<br />
neue Ränke schmieden. Ich bin das nicht. Doch<br />
sie sollen leben.“<br />
In einem Brief an meinen Großvater aus<br />
dem Jahr 1965 bietet Ivo Andrić seinem Namensvetter<br />
finanzielle Unterstützung an, damit<br />
er ans Meer fahren und sich auskurieren kann:<br />
„Lieber Ivo! Ich bin so frei und schicke Dir diese<br />
Kleinigkeit. Soviel kann ich erübrigen, also<br />
erübrige ich es. Und Dich bitte ich, diese kleine<br />
Aufmerksamkeit eines alten Schulfreundes anzunehmen,<br />
wie auch ich es von Dir annehmen<br />
würde. Mit herzlichen Grüßen und allen guten<br />
Wünschen, Dein Ivo.“ Diese Geste freute Opa<br />
Ivan, doch das Geld lehnte er ab. Er konnte<br />
seinen Holzstuhl nicht mehr verlassen. Er war<br />
auch nicht mehr in der Lage, in den Schulferien<br />
mit mir zum Bahnhof zu gehen und nach Brist<br />
ans Meer zu fahren.<br />
Auch wenn Opa Ivan überzeugter Antikleriker<br />
war, war er doch als Katholik auf die Welt<br />
gekommen und konnte deshalb nicht zusammen<br />
mit den anderen Mitgliedern der Bewegung<br />
„Junges Bosnien“ in einem Grab beerdigt<br />
werden, denn die Kapelle der Helden des<br />
Sankt-Veits-Tages, die 1939 erbaut wurde, steht<br />
auf dem alten orthodoxen Friedhof im Stadtteil<br />
Koševo. Zur Zeit des Kommunismus sprach<br />
man davon, ein Grabmal für alle zusammen zu<br />
errichten, im Stadtpark gegenüber dem früheren<br />
Kaufhaus „Sarajka“ in der Nähe des Kult-<br />
cafés „Parkuša“, doch das ist nie geschehen, und<br />
heute befindet sich an dieser Stelle ein Grabmal<br />
für die Märtyrer des letzten Krieges.<br />
Eine kleine Straße im neuen Teil der Stadt<br />
war lange nach ihm benannt. Dann war das<br />
hölzerne atheistische Zeichen auf seinem Grab<br />
zerfallen, und da mir bewusst war, dass er sich<br />
nie zu seinen Freunden, den Jungbosniern, gesellen<br />
würde und dass die jugoslawische Idee<br />
unwiederbringlich verloren war, ließ ich einen<br />
Grabstein aus Marmor anfertigen, damit man<br />
weiß, wo er begraben liegt, dieser Revolutionär,<br />
Abenteurer und Träumer, dieser Mann, der bis<br />
zum Ende seines Lebens ein aufrechter Jugoslawe<br />
gewesen ist.<br />
An jedem Sankt-Veits-Tag zog Opa Ivan sich<br />
festlich an und nahm mich mit, um mit seinen<br />
alten Freunden, Jungbosniern, die überlebt<br />
hatten, Gavrilo, Nedeljko und den anderen<br />
Attentätern die Ehre zu erweisen. Danach saßen<br />
sie auf der anderen Straßenseite im tiefen<br />
Schatten einer Kneipe mit karierten Tischdecken,<br />
unterhielten sich und tranken Bier aus<br />
großen Krügen, während unter den Füßen weiße<br />
Kieselsteine knirschten. Und ich war stolz,<br />
während ich auf dem Schoß meines stattlichen<br />
Großvaters saß, der soviel Autorität in der Stimme<br />
hatte und sich so aufrecht hielt.<br />
Cvjetko Popović, sein bester Freund, ein<br />
immer lächelnder, freundlicher und warmherziger<br />
Mann voller positiver Energie, dessen<br />
runde Brillengläser ich als Junge bewunderte,<br />
kam häufig zu Besuch. Dann saßen sie lange<br />
zusammen, aßen eine Kleinigkeit und nippten<br />
dazu an ihren Schnäpsen. Sie erinnerten sich<br />
an Details aus ihrer Jugend und verfolgten aufmerksam<br />
alles, was über das Attentat von Sarajevo<br />
geschrieben wurde, um alle Ungenauigkeiten<br />
und falschen Zeugnisse richtig zu stellen.<br />
Beide behaupteten, über das Attentat von Sarajevo<br />
sei ein Berg Bücher und ein Meer an Ungenauigkeiten<br />
und falschen Interpretationen<br />
geschrieben worden. Ich sehe sie vor mir, diese<br />
beiden Revolutionäre, wie sie mit jugendlichem<br />
Eifer um jedes Körnchen Wahrheit kämpfen,<br />
während Ivans zweite Frau Oma Fanika, Tochter<br />
des österreichisch-ungarischen Ingenieurs<br />
Nacovski, der vor dem Ersten Weltkrieg die<br />
Eisenbahn in Bosnien und Herzegowina gebaut<br />
hatte, wie in einem Vaudeville ins Zimmer<br />
kommt und Postkarten bringt, die jedes Jahr<br />
am Sankt-Veits-Tag aus Österreich eintrafen,<br />
Postkarten mit Bildern von österreichischen<br />
Soldatenfriedhöfen, auf deren Rückseite neben<br />
dem Namen „Ivan Kranjčević“ und der Adresse<br />
in Großbuchstaben das deutsche Wort „Mörder“<br />
geschrieben stand.<br />
Als ich zu Anfang des neuen Jahrtausends in<br />
der Kölner Uniklinik lag und auf meine tägliche<br />
Dosis Cisplatin und Übelkeit wartete, versank<br />
ich in Gedanken über mein Schicksal als Heimatloser.<br />
Den Fernseher anzumachen, hatte<br />
ich keine Lust. Am Abend wollte ich vielleicht<br />
ein Spiel meiner Lieblingsmannschaft Borussia<br />
Dortmund anschauen, damit mein Zimmernachbar<br />
Herr Krause nicht wieder sagte, ich<br />
hätte ganz umsonst sechs Mark ausgegeben.<br />
Das Telefon klingelte. Dragana war dran, ich<br />
solle sofort den Fernseher anmachen. Den ganzen<br />
Tag sahen Herr Krause und ich die Bilder<br />
des ungeheuerlichen terroristischen Verbrechens,<br />
schauten ungläubig zu, wie sich in New<br />
York die Flugzeuge in die Wolkenkratzer bohrten.<br />
Bevor er am nächsten Tag entlassen wurde,<br />
gab mir Herr Krause als ordentlicher Deutscher<br />
drei Mark, und ich fragte mich, ob die Kriege jemals<br />
aufhören würden, der Terrorismus und das<br />
Morden. Ich fragte mich, wie auch Dostojewski<br />
sich gefragt hatte: Was ist das Verbrechen und<br />
was ist die Strafe Ich fragte mich, ob Opa Ivan<br />
ein Terrorist gewesen war oder ein Held.<br />
Ein Jahrhundert ist das Attentat bald her,<br />
ein Ereignis, das Sarajevo für immer einen Platz<br />
auf der Weltkarte der Geschichte beschert hat<br />
und in dem viele die Ursache der ersten europäischen<br />
Tragödie des vergangenen Jahrhunderts<br />
sehen, eines Jahrhunderts der Attentate,<br />
Kriege, der Lager und des Holocaust. Die einen<br />
werden behaupten, dass die Attentäter von Sarajevo,<br />
damals junge Männer, die gerade mal<br />
etwas Flaum auf der Oberlippe hatten, Helden<br />
waren, die anderen werden sie als serbische<br />
Söldner bezeichnen. Und wenn ich das Grab<br />
meines Großvaters besuche, werde ich mir der<br />
schmerzlichen Tatsache bewusst sein, dass die<br />
jugoslawische Idee, für die er und seine Freunde,<br />
die Jungbosnier, sich geopfert hatten, damit<br />
es folgende Generationen besser haben würden,<br />
am Ende des letzten Jahrhunderts begraben<br />
wurde. Im unglücklichen Land Bosnien und<br />
Herzegowina, in dem ich niemanden mehr habe<br />
außer ein paar alten Freunden und Bekannten,<br />
dem endgültig geteilten Land zwischen Westen<br />
und Osten, kann man manchmal, wenn man in<br />
den Straßen Sarajevos oder Mostars genau hinschaut,<br />
den Schatten der Berliner Mauer sehen.<br />
Aus dem Bosnischen von<br />
Blanka Stipetić<br />
Davor Korić<br />
Geboren 1951 in Sarajevo. Schauspieler, Theaterkritiker,<br />
Dramaturg und Journalist. Hauptrolle<br />
im Film Die Rolle meiner Familie in der<br />
Weltrevolution nach dem Roman von Bora Ćosić<br />
(1970). Seine Briefe aus dem belagerten Sarajevo<br />
sind 1993 unter dem Titel „...und Sarajevo<br />
muß für alles zahlen“ im Fibre Verlag erschienen.<br />
Seit 1995 als Moderator und Redakteur<br />
beim WDR Köln in der Redaktion Radio Forum<br />
des Programms Funkhaus Europa beschäftigt.<br />
Birgit Pölzl<br />
Sorry, Sophie<br />
Der gestreckte Arm Gavrilo Princips ist mit<br />
der Pistole in der Hand auf den Thronfolger<br />
Franz Ferdinand gerichtet, der im Auto neben<br />
seiner tödlich getroffenen Frau Sophie steht, beide<br />
zur Seite und nach hinten gedrückt, Sophie von<br />
der Wucht des Schusses und Franz Ferdinand,<br />
scheint es, in Erwartung des Projektils. Graf<br />
Harrach auf dem vorderen Sitz hebt abwehrend<br />
die Hand Richtung Gavrilo Princip und verdeckt<br />
zur Hälfte das Reserverad, das seitlich an<br />
der Karosserie befestigt ist.<br />
Dieses anonyme Bild des Attentats, das es<br />
mit Tatsachentreue nicht besonders genau<br />
nimmt, hat sich mir eingeprägt (der Augenzeugenbericht<br />
Graf Harrachs als Folie darüber<br />
gelegt: „Da nun rechts nacheinander 2 Schüsse,<br />
aus Seinem Munde ein Blutstrahl auf meine<br />
Backe, Sie ruft: ,Um Gottes Willen, was ist Dir<br />
geschehen‘ u sinkt vom Sitze herab mit dem<br />
Kopfe zwischen seine Oberschenkel und es war<br />
vorbei“, Wladimir von Aichelburg: Erzherzog<br />
Franz Ferdinand von Österreich-Este 1863-1914.<br />
Band 1-3, zitiert nach „profil online“, 14.9.2013).<br />
Das Bild, das sich mir eingeprägt hat, habe ich<br />
als Kind auf einer Karte gesehen, die zwischen<br />
alten Fotos lag. Es war bräunlich gefärbt und<br />
umrankt von Erzählungen und wurde von mir<br />
im Geschmack des Staunens gespeichert: Wie<br />
konnte das Attentat auf den Thronfolger und<br />
seine Frau – es waren bitte zwei Menschen, und<br />
es war tragisch, aber es waren zwei Menschen –,<br />
wie also konnte ein Attentat auf zwei Menschen<br />
Europa in ein derartiges Schlachtfeld verwandeln<br />
Als man mir, älter geworden, die Mechanik,<br />
mit der die Bündnisse schlagend wurden,<br />
und die Kriegsbegeisterung der Intellektuellen<br />
und Künstler vermittelte, sind Kopfschütteln<br />
und Widerstand hinzugekommen: Als sei die<br />
Reaktion auf das Attentat durch ein apokalyptisches<br />
Rauschen im katholischen Himmel<br />
ausgelöst worden, das die feudale Ordnung<br />
hienieden auf ewig zu verankern und Verstöße<br />
dagegen entsprechend zu ahnden befohlen<br />
habe, als sei die Reaktion auf das Attentat die<br />
blutbesiegelte Mega-Affirmation eines himmelschreienden<br />
expressionistischen Pathos und<br />
der blutige Startschuss für die Umsetzung futuristischen<br />
Größenwahns. Zum Kotzen finde<br />
ich auch heute noch Marinettis „Futuristisches<br />
Manifest“, das die feudale Rückständigkeit<br />
hinwegzufegen sich großspurig auf die Fahnen<br />
geheftet hatte und nichts anderes als die Übererfüllung<br />
eines pathologischen Machismo war:<br />
„Wir wollen den Mann besingen, der das Steuer<br />
hält, dessen Idealachse die Erde durchquert, die<br />
selbst auf ihrer Bahn dahinjagt. […] Wir wollen<br />
den Krieg verherrlichen — diese einzige Hygiene<br />
der Welt –, den Militarismus, den Patriotismus,<br />
die Vernichtungstat der Anarchisten, die<br />
schönen Ideen, für die man stirbt, und die Verachtung<br />
des Weibes“. Und klar war die Reaktion<br />
auf das Attentat eine ultimative Möglichkeit,<br />
die Entwicklungen in der Waffentechnik territorial<br />
Raum greifen zu lassen, Militärs gab es ja<br />
viele, die nicht müde wurden, den Herrschern<br />
(vor allem Wilhelm II.) die Vorteile eines Kriegs<br />
einzureden.<br />
Die Kärntner Großmutter sitzt auf der Bank<br />
und erzählt. Die Kärntner Großmutter trägt ein<br />
Schürzenkleid und hochgesteckte Haare. Die mir<br />
liebsten (wichtigsten) Erzählungen der Kärntner<br />
Großmutter, jene, die mein Selbstverständnis<br />
(mit-)begründeten, hingen mit dem 1. Weltkrieg<br />
zusammen.<br />
Ihre Mutter, erzählte die Großmutter, habe<br />
Deserteuren gekochte Erdäpfel in den Wald<br />
gebracht, alle paar Nächte einen Topf voll.<br />
Ihre Mutter habe dabei jedes Mal ihr Leben<br />
riskiert. Ihre Mutter sei mutig gewesen, „Gott,<br />
war meine Mutter mutig“; der Topf, in dem<br />
sie die Erdäpfel trug, war heiß und sollte nicht<br />
an ihre Schenkel schlagen, deshalb ging ihre<br />
Mutter gebeugt, auch weil man sie nicht sehen<br />
sollte; in der Sauküche kochte sie die Erdäpfel,<br />
kleine Erdäpfel, sie hatten Augen und Triebe,<br />
der Frühling stand vor der Tür. Sie kannte die<br />
Männer nicht, denen sie die Erdäpfel brachte,<br />
sie wusste nur, dass sie am Verhungern waren<br />
und dass sie sich strafbar machte. Der Stall hatte<br />
hinten eine Tür. Die stieß sie mit der Schulter<br />
auf, weil sie zum Tragen beide Hände brauchte,<br />
ein großer Holunderstrauch stand neben der<br />
Tür, dann ein Ringlottenbaum, dann der Zaun.<br />
Sie schob den Topf unter dem Zaun durch, dann<br />
kroch sie selber. „Sie hatte Angst. Wir Kinder<br />
durften nichts weitererzählen. Sie hob den Topf<br />
und trug ihn über die Weide. Es waren fünfzig<br />
Schritte zum Wald oder achtundvierzig oder<br />
dreiundfünfzig, je nachdem. Meine Mutter hat<br />
immer gezählt gegen die Angst.“<br />
Ich war sehr stolz auf meine Urgroßmutter,<br />
die Großmutter musste mir die Geschichten sehr<br />
oft erzählen.<br />
Ihre Mutter hat täglich auf die Post gewartet,<br />
obwohl sie sich davor gefürchtet hat. Drei<br />
Söhne waren gefallen, vom vierten hatte sie<br />
schon lange nichts gehört. Die Mutter war vor<br />
Gram weiß geworden. Dann kam ihr Sohn vor<br />
dem Brief, in dem er sich angekündigt hatte,<br />
und alle haben ihn berührt und gedrückt und<br />
geküsst und alle haben geweint und der Bruder<br />
hat erzählt, er wäre im Lager verhungert, wenn<br />
nicht Menschen Erdäpfel über die Mauer geworfen<br />
hätten.<br />
Ich sehe Sophie Gräfin Chotek vor meinem<br />
geistigen Auge, die mit Franz Ferdinand in morganatischer<br />
Ehe lebte, nicht „die künftige Kaiserin-Gemahlin“,<br />
sondern „die Gemahlin des künftigen<br />
Kaisers“ war; „Sopherl! Sopherl! Stirb nicht!<br />
Bleib am Leben für unsere Kinder!“, soll Franz<br />
Ferdinand, über sie gebeugt, gerufen haben, unmittelbar<br />
bevor er starb.<br />
Was bedeutet für mich das Attentat Krieg<br />
und Krieg. 1. Weltkrieg. 2. Weltkrieg. Unermessliches<br />
Leid. Anstoß für meine pazifistische<br />
Gesinnung samt der Skepsis der These<br />
gegenüber, erst durch den 1. Weltkrieg hätten<br />
die Errungenschaften der Moderne sich durchsetzen<br />
können, als seien Transformation und<br />
Evolution keine Möglichkeiten, als sei allein der<br />
Krieg der Vater aller Dinge. Ja, Himmel, warum<br />
denken wir solche Sachen. Warum denken wir<br />
nicht, dass der Krieg der Vater nur eines Dinges<br />
ist, des Krieges nämlich. Warum sehen wir<br />
nicht, dass solchem Denken eine radikale Dichotomisierung<br />
unterliegt, ein Denken, das das<br />
Ich uneinholbar vom Du trennt und das Subjekt<br />
radikal vom Objekt. Warum sehen wir nicht,<br />
dass die Schärfe der Trennung nicht naturgegeben<br />
ist, obwohl sie natürlich erscheint, sondern<br />
Ergebnis eindimensionalen Denkens, warum<br />
sehen wir nicht, dass die radikale Dichotomisierung<br />
fast logisch auf Unterwerfen ausgerichtet<br />
ist, auf Untertan-Machen, auf Instrumentali-<br />
Beton International März 2014 18
sieren und Funktionalisieren, auf Ausbeuten<br />
und Profit-Maximieren. Ich und Grenze und<br />
das und der und die Andere. Die Dichotomisierung<br />
führt nicht nur zu haarsträubenden Interpretationen,<br />
sie perpetuiert den Krieg, der sich<br />
nun vehement gegen die Umwelt richtet und<br />
in neoliberaler Form auf die sozialen Gefüge<br />
weltweit zielt. Ja, grotesk mutet es an, dass angesichts<br />
der verheerenden Kriege, angesichts<br />
der Bedrohtheit der Erde und des vom Neoliberalismus<br />
forcierten Auseinandertreibens von<br />
Arm und Reich (auch eine Form von strukturellem<br />
Krieg) noch immer unsägliche Thesen<br />
breitgetreten werden, Thesen, die auf einem<br />
biologistischen Achselzucken beruhen, nun ja,<br />
die Welt gehört nun mal den besseren im Sinne<br />
von aggressiveren Schimpansen-Männchen,<br />
oder Thesen, die auf einem expansionistischen<br />
und kolonialistischen Blick basieren und die<br />
produktiven Seiten des Krieges als einzig verlässlichen<br />
Garanten für Fortschritt zu beweisen<br />
versuchen, sorry, Krieg ist nun mal notwendig<br />
als Motor des Fortschritts, sonst säßen wir noch<br />
immer in Laubhütten und brüteten dumpf vor<br />
uns hin.<br />
Zugegeben. Lieber wär’s mir, Franz Ferdinand<br />
hätte „Sopherl! Sopherl! Stirb nicht! Bleib am<br />
Leben“ geschrien und seine Frau nicht sterbend<br />
noch ausschließlich über ihre Rolle als Mutter<br />
definiert.<br />
Im gleichen Atemzug räume ich ein, dass<br />
ich dem Fürsorglichen, Pflegenden, Empathischen<br />
hohen Wert beimesse, Werthaltungen<br />
und Denkstrukturen, die im Oikos, der Hausgemeinschaft<br />
(aus-)geübt wurden. Von Frauen<br />
– und leider nur von Frauen – dort (aus-)geübt<br />
wurden, während die Männer Politik betrieben,<br />
philosophierten, sich Scharmützel lieferten und<br />
Kriege führten, Öffentlichkeit also gestalteten,<br />
ohne sich im Fürsorglichen, Pflegenden zu üben:<br />
Vielleicht gab und gibt man deshalb so viel auf<br />
Heraklits These vom Krieg als dem Vater aller<br />
Dinge, nicht nur rückblickend in den Interpretationen,<br />
sondern auch in der Aufbruchsstimmung<br />
zu Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts.<br />
Ja, so sehr ich die Reduktion der Frauen auf die<br />
Tätigkeit des Oikos ablehne, so sehr schätze ich<br />
die Tätigkeiten dieses Bereichs, in dem die Sorge<br />
füreinander denk- und handlungsleitend ist, ja,<br />
so bedeutend sind diese Tätigkeiten für die Entwicklung<br />
von Werthaltungen und Denkstrukturen,<br />
dass ich vorschlage, den Oikos wieder und<br />
wieder auf die Agora zu tragen, nicht als Akt<br />
simpler Macht(ab)gleichung zwischen Männern<br />
und Frauen, sondern als Entwicklungsschub für<br />
global überlebensnotwendige, auf Empathie basierende<br />
Denkstrukturen.<br />
„Weil das Weidenröschen viele Samen hat,<br />
die leicht in Trümmern keimen, heißt es im Volksmund<br />
Trümmerblume.“ „Volksmund“ betont die<br />
Tante besonders, als gebe es pro Volk nur einen<br />
Mund, als könne das, was aus diesem Mund<br />
kommt, Wahrheit für sich beanspruchen; die<br />
Tante sitzt am Tisch und ich neben ihr, das Wort<br />
Volksmund geht ihr leicht über die Lippen. Die<br />
Tante trägt Stützstrümpfe, ein Kleid mit schmaler<br />
Knopfleiste und eine hell gefasste Schmetterlingsbrille.<br />
Der Tisch hat ein Trittholz und gedrechselte<br />
Beine.<br />
Ich verbinde Volksmund mit Nationalismus,<br />
auch wenn es sein kann, dass meine Tante bloß<br />
die im Volk lebendige Überlieferung gemeint<br />
hat, und ich verbinde Nationalismus mit dem<br />
pervertierten Ideal ethnischer Reinheit und der<br />
Bereitschaft, für dieses Ideal zu terrorisieren,<br />
auszugrenzen, Kriege zu führen. Der 1. und der<br />
2. Weltkrieg wurden durch nationalistisch und<br />
faschistisch motivierte Radikalisierung (mit-)<br />
ausgelöst, auch die Jugoslawienkriege.<br />
Im Dorf, in dem die Kärntner Großmutter<br />
lebte, hielt man mit Ressentiments gegenüber<br />
Slowenen, Serben und Russen nicht hinter dem<br />
Berg. Die Serben haben den Thronfolger und seine<br />
Gattin ermordet, die sind schuld am Krieg. Die<br />
Russen sind Vergewaltiger, die Slowenen Verräter.<br />
Auch war die Einzahl beliebt, „der Serbe hat<br />
den Thronfolger ermordet“.<br />
Das für mich überzeugendste Projekt eines<br />
Nationalismus und Faschismus überwindenden<br />
Europas ist die Europäische Union, zuallererst<br />
als Friedensprojekt konzipiert. Das Attentat auf<br />
Sophie und Franz Ferdinand, das als Funke das<br />
so leicht entzündliche Amalgam aus nationalistisch<br />
motivierten Spannungen und Kriegsbefürwortung<br />
und Kriegsbegeisterung zum Brennen<br />
gebracht hat, und die Gründung des Friedensprojektes<br />
EU stehen in einem ursächlichen<br />
Zusammenhang. Diese Union ist weiterzudenken<br />
und weiterzuentwickeln, weil sie das Potential<br />
hat, kulturelle, soziale und wirtschaftliche<br />
Belange so auszutarieren, dass ein friedliches<br />
Miteinander möglich ist. Und klar werden die<br />
Grenzen der Union nicht die Grenzen der Union<br />
bleiben, weil darüber hinaus gedacht werden<br />
muss. Diese Union kann keine Festung sein,<br />
weder im politischen noch im mentalen Sinn,<br />
keine Festung, die Mauern aufzieht und Denken<br />
zementiert, diese Union wird viel Kreativität<br />
und Kraft aufwenden, mental und kulturell<br />
bedingte Grenzen durchlässig zu machen. Wir<br />
werden mit Blick auf die bedrohte Umwelt und<br />
mit Blick auf das Auseinanderbrechen sozialer<br />
Gefüge – oder sagen wir: Wir werden mit der Vision<br />
einer lebenswerten Umwelt und mit Blick<br />
auf soziale Ausgewogenheit, die der alleinige<br />
Garant für eine nachhaltige und friedliche Entwicklung<br />
ist, in diesem vereinten Europa eine<br />
zweite Aufklärung erleben, eine Aufklärung,<br />
die Denken nicht bloß als rationale Operation,<br />
sondern als gleichermaßen empathischen und<br />
vernunftgeleiteten Akt begreift. Wir werden<br />
uns – nicht nur kosmetisch – der wahrscheinlich<br />
größten Herausforderung stellen: der Zähmung<br />
des Finanzkapitals, und eine Wirtschaft<br />
fördern, die stärker auf Nachhaltigkeit als auf<br />
Profitmaximierung ausgerichtet ist. Wir werden<br />
intensiver (und anders) über Glück nachzudenken<br />
beginnen, wie nahe zum Beispiel Glück an<br />
Selbstbestimmtheit, Nichtentfremdung liegt,<br />
wie glücklich einen das Wohlergehen der anderen<br />
macht, wie Gastfreundschaft, Gemeinschaft<br />
glücklich machen, wie Buntheit, Multikulturalität<br />
beglücken, wie Bildung, die auch Herzensbildung<br />
ist, beglückt, wie Hegen glücklich macht:<br />
die Gärten, die man in den Städten pflanzt, das<br />
Denken, das empathisch ist.<br />
Serbien muss sterbien. Als Beispielsatz für<br />
Hetze und Kriegspropaganda, als unsäglicher<br />
Stammtisch-Klassiker und widerlicher Klospruch<br />
ist mir der Satz immer wieder begegnet.<br />
Jede Form von Revanchismus sei angesichts<br />
von Serbiens Schuld legitim, das Legitime,<br />
legt der Satz nahe, reiche übers Legale hinaus,<br />
die niedrigsten Instinkte könnten da mal<br />
zur Sache gehen, der Rahmen sei abgesteckt,<br />
der Möglichkeiten gebe es viele. In den 1990er<br />
Jahren findet sich homöopathisch dosiert und<br />
in impliziter Form die eindimensionale Schuldzuschreibung,<br />
Serbien sei direkt und indirekt<br />
schuld am 1. und 2. Weltkrieg sowie an den Jugoslawienkriegen,<br />
in vielen journalistischen<br />
Texten. Systemisch hat es da fast Logik, dass einer,<br />
der hohes Ansehen gerade seines genauen<br />
Blickes wegen genoss, in der Verteidigung Serbiens<br />
weit übers Ziel hinausschoss. Peter Handkes<br />
Engagement für Serbien (insbesondere für<br />
Milošević) verstörte, verärgerte, sprach jenen,<br />
die litten, Hohn, ja, das war das Schreckliche:<br />
sprach, jenen, die litten, Hohn, und hatte doch<br />
im Ansinnen recht, eine Differenziertheit in der<br />
Berichterstattung, eine größere Sorgfalt in der<br />
Wortwahl einzumahnen (die eine Reflexion der<br />
latenten Schuldzuschreibungen zur Voraussetzung<br />
gehabt hätte). Die neu aufgeflammte<br />
Debatte um die Rolle Serbiens in den Kriegen,<br />
die aktuell in Serbien geführt wird, zeigt, wie virulent<br />
dieses Thema nach wie vor ist. Befreiend<br />
muten dabei die Wortmeldungen und Arbeiten<br />
vieler junger serbischer Intellektueller, Schriftstellerinnen<br />
und Künstlerinnen an, die sich<br />
entschieden gegen eine nationalistische Heroisierung<br />
der Geschichte und der Gegenwart und<br />
gegen eine Turbofolk-Ästhetik richten, die alte<br />
Klischees fortschreibt und instrumentalisiert.<br />
Andrej Nikolaidis<br />
Die Attentate von<br />
Sarajevo<br />
In schwarzen Wassern spiegeln<br />
sich Aussätzige<br />
Georg Trakl<br />
Wir saßen auf einer Café-Terrasse am Ufer<br />
der Miljacka. Den Fluss sahen wir nicht, aber<br />
wir hörten ihn. Das half uns, uns die Szene vorzustellen,<br />
eines jener alltäglichen Bilder, die erst<br />
an Kostbarkeit gewinnen, wenn wir von dieser<br />
Stadt weit entfernt sind, wenn Nostalgie sie vergoldet:<br />
Die dunkle Miljacka wälzt sich durch ihr<br />
Betonflussbett. Sie sieht eigentlich nicht aus wie<br />
ein Fluss, sie erinnert mehr an einen Erdrutsch.<br />
Als flösse nur der Boden durch das Flussbett, auf<br />
dem diese Stadt errichtet worden ist.<br />
Im Frühling war die Miljacka voller Bälle.<br />
An seinen kleinen Stufen hielt der Fluss die<br />
Bälle fest, die beim – so unvorsichtigen! – Spiel<br />
der Kinder ins Wasser gefallen waren. Das letzte<br />
Mal hatte ich dies im Jahr 1999 beobachtet,<br />
nach meiner Flucht vor Miloševićs verrückt<br />
gewordener Armee aus Ulcinj nach Sarajevo,<br />
derselben Armee, derentwegen ich sieben Jahre<br />
zuvor aus Sarajevo geflüchtet war. Auf dem<br />
Vilson-Spazierweg hatte ich eine Gruppe von<br />
Kindern traurig am Ufer stehen und einen Ball<br />
betrachten sehen, den der Fluss nahezu hysterisch<br />
auf der Stelle drehte.<br />
Ja. „Was passiert am Ende eigentlich mit<br />
den Bällen, die in die Miljacka fallen“, dachte<br />
ich, während eine Kolonne gepanzerter Wagen<br />
an uns vorüberfuhr. Zuerst hatten wir ihr Blaulicht<br />
gesehen, als sie auf der Höhe des Theaters<br />
angekommen waren. Als die Limousinen die<br />
Drvenija-Brücke passierten, konnten wir nur<br />
noch ihre Rückseiten sehen, sie trugen die Diplomatenkennzeichen<br />
fort, bevor es uns gelang,<br />
sie zu lesen.<br />
Endlich kam ein Kellner zu uns. „Heiß heute,<br />
was“, sagte er. Ohne eine Antwort abzuwarten,<br />
fuhr er fort: „Der heißeste Juni seit hundert<br />
Jahren. War in den Nachrichten.“ Ich ging mit<br />
keiner passenden Phrase darauf ein – schließlich<br />
waren wir in Bosnien, nicht in England,<br />
über das Wetter unterhielt man sich hier nicht.<br />
Ich hatte keine Zeit, Höflichkeiten auszutauschen,<br />
nicht einmal mit denen, in deren Gesellschaft<br />
ich war – dafür war ich zu sehr in den<br />
Brief vertieft, den ich las. Es war der Brief eines<br />
alten Freundes. Das letzte Mal hatte ich ihn im<br />
April 1992 gesehen. Wir spielten Basketball im<br />
Stadtteil Dobrinja – Kinder, alt genug für die<br />
Armee. Aus dem Stadtteil Kula waren Schüsse<br />
zu hören. Wir drehten uns nach dem schweren<br />
Geräusch des Maschinengewehrs um und sahen<br />
mehrere schwarze Gestalten auf uns zu rennen.<br />
Er sagte: „Hör dir das Maschinengewehr an –<br />
wie ‚Metallica‘“. Ja, der Krieg klang tatsächlich<br />
wie die Bands in „Headbangers Ball“ auf MTV.<br />
Dann schoss pfeifend eine Kugel an meinem<br />
– oder seinem – Kopf vorbei. Beim Lesen des<br />
Briefes erinnerte ich mich, wie der Ball die Straße<br />
hinunter gerollt, mein Freund in den nächsten<br />
Hausflur geflüchtet und ich die Treppe zu<br />
einem Atomschutzkeller hinunter gerannt war,<br />
einem jener Keller, wie sie Vorschrift waren in<br />
den Neubaugebieten des Staates, der sich für<br />
einen Atomkrieg gewappnet hatte und in einem<br />
guten alten blutigen Bürgerkrieg zugrunde gegangen<br />
ist.<br />
Der Brief verriet mir nur wenig über das<br />
Leben meines Freundes. Ich las heraus, dass er<br />
in Amerika lebt. Dass er verheiratet ist. Kinder<br />
scheint er nicht zu haben. Auch keine geregelte<br />
Arbeit. Den Brief habe er an alle Leute aus<br />
Bosnien verschickt, die er kenne, schrieb er.<br />
Ich sah ihn Morgen für Morgen einen Wagen<br />
voller Briefe durch die Straßen einer ruhigen<br />
WASP-Vorstadt zum Briefkasten schieben. Er<br />
fürchte, wir würden ihn nicht ernst nehmen.<br />
Er selbst halte es für ganz natürlich, wenn man<br />
auf prophetische Töne mit Skepsis reagiere.<br />
Doch die historischen Parallelen seien einfach<br />
zu genau, die Analogien zu perfekt, schrieb er.<br />
Er spüre, dass es seine Pflicht sei, uns zu warnen.<br />
Mehr könne er nicht tun. Er wache jeden<br />
Morgen schweißgebadet auf und schalte voller<br />
Angst den Fernseher ein. Er warte: Er lebe nicht<br />
mehr, er warte nur noch. Er wisse, was kommen<br />
würde, und in welcher Form.<br />
„1903 wurde in Belgrad der serbische König<br />
Aleksandar Obrenović ermordet. Hinter dem<br />
Mord stand eine mächtige Militärorganisation.<br />
Bei einem Blick auf die Liste der angeblichen<br />
Fehltritte Aleksandars, mit denen die Attentäter<br />
seine Liquidierung rechtfertigten, sticht<br />
seine verräterische, unzureichend antigermanische<br />
Politik ins Auge“, schrieb er. „2003 wurde<br />
in Belgrad der pro-westliche serbische Premier<br />
Zoran Đinđić ermordet. Hinter dem Mord<br />
standen Strukturen des militärischen Sicherheitsdienstes,<br />
die nach dem Anschlag Vojislav<br />
Koštunica an der Macht installierten. In den<br />
Jahren nach seiner Ermordung wurde Đinđić<br />
als deutsche Marionette bezeichnet, als die er<br />
die Kugel verdient habe.<br />
Dass es die sehr wohl gibt, zeigen Positionen,<br />
wie sie der Historiker Milorad Ekmečić vertritt<br />
(„Der Kampf Serbiens für die Freiheit 1914-<br />
1918 ist das gigantische Ringen eines kleinen<br />
Landes mit einem übermächtigen Feind und<br />
ein Beispiel für das selbstlose Aufopfern für die<br />
Freiheit und die Freiheit seiner Brüder, die sich<br />
später undankbar gezeigt haben“, „europe online<br />
magazine“, 14. 11. 2013).<br />
Wenn ich zum Jubiläumsjahr einen kleinen<br />
Wunsch frei hätte, vielleicht wäre das sogar ein<br />
größerer, dann wünschte ich mir Peter Handke,<br />
Alida Bremer und Sreten Ugričić zu einem Gespräch<br />
an einen Tisch.<br />
Fast gleichzeitig distanziere ich mich von<br />
meinem Ansinnen, weil mir bei genauerer Überlegung<br />
– vor allem mit Blick auf die Geschichte<br />
des europäischen Mittelalters – die Ausweitung<br />
ins Magische doch kontraproduktiv erscheint<br />
und ich zudem so gar nicht versiert in der<br />
Kommunikation mit dieser Art von Wunscherfüllungs-Instanzen<br />
bin, und wende mich meinem<br />
Herzensprojekt zu: der Kultivierung des<br />
Denkens und Wahrnehmens. Das wäre doch ein<br />
richtig großes Ding fürs 21. Jahrhundert.<br />
Birgit Pölzl<br />
Geboren 1959 in Graz. Leiterin des Ressorts Literatur<br />
im Kulturzentrum bei den Minoriten.<br />
Für ihre Erzählungen, Essays und Romane wurde<br />
sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem<br />
Preis der Steiermärkischen Sparkasse für den<br />
Roman Das Weite suchen (2013).<br />
1908: Österreich-Ungarn annektiert Bosnien<br />
und Herzegowina. Belgrad empfindet diesen<br />
Akt als beispiellose Ungerechtigkeit und Beleidigung.<br />
2008: Der Kosovo erklärt seine Unabhängigkeit.<br />
Belgrad ist wütend. 2008: Refrainartig<br />
wiederholen serbische Politiker, die Unabhängigkeit<br />
des Kosovo sei eine Völkerrechtsverletzung.<br />
1908, während der Annexionskrise,<br />
veröffentlicht Jovan Cvijić eine Erörterung, die<br />
sofort ins Englische, Französische und Tschechische<br />
übersetzt wird. Cvijić schreibt: ‚Kein<br />
Ereignis in den vergangenen Jahrzehnten hat<br />
unter den Balkanvölkern und -staaten eine solche<br />
Aufregung hervorgerufen – an erster Stelle<br />
und besonders im serbischen Volk – wie die Annexion<br />
von Bosnien und Herzegowina ... Dieser<br />
Akt zerstört den Glauben an den Wert internationaler<br />
Verträge. Es bahnen sich große Ereignisse<br />
an‘, fügt er hinzu, ‚die sich vielleicht nur<br />
noch für gewisse Zeit aufschieben lassen.‘ Sie<br />
wurden aufgeschoben: Bis zum 28. Juni 1914,<br />
als Franz Ferdinand in Sarajevo ankam. Dort<br />
wartete das ‚Junge Bosnien‘ auf ihn“, schrieb<br />
mein Freund.<br />
Im Februar 2008, in den Tagen vor und nach<br />
der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo, seien<br />
Sprengsätze in einem Objekt der slowenischen<br />
Handelskette Mercator und in Kosovska<br />
Mitrovica, dem Sitz der EU-Mission, detoniert.<br />
Zu den Anschlägen habe sich eine Gruppe bekannt,<br />
die sich „Junges Bosnien“ nenne. Einige<br />
Monate zuvor sei in der Belgrader Wochenzeitschrift<br />
„Vreme“ ein Essay erschienen, in dem<br />
der Autor den Geist Gavrilo Princips wachrufe.<br />
„Ach, wenn ich nur über einen kleinen Teil dieser<br />
Welt, über das kleinste Stückchen Realität,<br />
so mutig und deutlich sagen könnte, was Gavrilo<br />
Princip mit einer Kugel über die europäische<br />
Zivilisation gesagt hat!“, stehe darin, schrieb<br />
mein Freund.<br />
Im März 2008 habe der Kopf der bosnischen<br />
Serben, Milorad Dodik, verkündet, die<br />
Republika Srpska strebe die Unabhängigkeit<br />
an. Er habe dafür die Unterstützung Russlands<br />
gehabt, nicht jedoch die der westlichen Mächte.<br />
Bosnien sei ungeteilt geblieben, doch die Belgrader<br />
nationalistische Elite sehe die Republika<br />
Srpska als ihr von der EU und Amerika annektiertes<br />
Territorium an. Sie glaube, das große<br />
Ereignis, die Abspaltung der Republika Srpska,<br />
lasse sich nur noch für eine gewisse Zeit aufschieben.<br />
„Das will mir nicht aus dem Kopf“, schrieb<br />
er weiter. In einem kleinen Antiquariat in<br />
Charleston habe er das Tagebuch von Johann<br />
V. Schneider gefunden. Der Name sei ihm sofort<br />
bekannt vorgekommen, weshalb die Aufzeichnungen<br />
sein Interesse geweckt hätten. J.<br />
V. Schneider sei derjenige gewesen, der Nedeljko<br />
Čabrinović verhaftet habe, nachdem dieser<br />
einen Anschlag auf den Wagen des Erzherzogs<br />
verübt, Zyankali geschluckt und sich in die Miljacka<br />
gestürzt hatte. Schneider sei einer der vier<br />
Männer gewesen, die Čabrinović hinterher gejagt<br />
seien. Bevor sie ihn gefangen hätten, habe<br />
Čabrinović ein Bündel in die Miljacka geworfen,<br />
habe Schneider geschrieben, schrieb mein<br />
Freund.<br />
Beton International März 2014 19
„Ich vermutete, dass das Bündel Geheimnisse<br />
über den Attentäter und seine Komplizen<br />
enthielt, vielleicht sogar eine Auflistung politischer<br />
Verbindungen, aber ich konnte nicht zurückgehen,<br />
um es zu holen, da sich Čabrinović<br />
heftig wehrte und wir ihn nur mit großer Mühe<br />
in den Wagen zwängen konnten, mit dem wir<br />
ihn aufs Polizeirevier brachten. Vom Ufer aus<br />
beobachtete ich, wie der Fluss das Bündel zur<br />
nächsten kleinen Stufe trug und es dort nahezu<br />
hysterisch auf der Stelle drehte“, habe Schneider<br />
geschrieben.<br />
„Es will mir nicht aus dem Kopf“, schrieb<br />
mein Freund, „ich kann nicht aufhören darüber<br />
nachzudenken, was in Čabrinovićs Bündel verborgen<br />
geblieben ist Warum ist es nicht untergegangen<br />
Hat es jemand, als die Kolonne<br />
mit dem Erzherzog weitergefahren war und die<br />
Menge sich zerstreut hatte, aus der Miljacka gezogen<br />
Und wenn ja, was hat er damit gemacht<br />
Und dann noch dieser Name: Gavrilo“,<br />
schrieb mein alter und verloren geglaubter<br />
Freund, „der Name des Engels, der in eine<br />
Trompete bläst und das Jüngste Gericht ankündigt.<br />
Gavrilo steht am Ufer der Miljacka und<br />
trompetet die biblischen Plagen herbei, von<br />
der Marne bis Gallipoli, er bläst in die Trompete<br />
und bringt das Ende der großen Reiche, das<br />
Ende der Alten Welt.<br />
Was bleibt noch, um den Kreis zu schließen,<br />
was bleibt noch, um ein ganzes Jahrhundert an<br />
einem Punkt wieder zusammenfließen zu lassen,<br />
einem Punkt, der wie ein schwarzes Loch<br />
alles, was von unseren Leben geblieben ist,<br />
aufsaugen wird Nur noch eines, nur noch eine<br />
Kugel. Noch ein Attentat von Sarajevo“, las ich.<br />
Mit schwindligem Kopf ließ ich den Brief<br />
meines Freundes sinken. Aus Richtung der<br />
Lateinerbrücke drangen Detonationen und<br />
Schüsse. Wir hörten Polizei- und Rettungswagensirenen<br />
aufheulen. „Wie eine gesampelte<br />
Version von Public Enemy“, scherzte hinter uns<br />
jemand, der es noch nicht wusste. Aus Richtung<br />
der Lateinerbrücke rannte ein junger Mann<br />
mit blutigem Hemd auf uns zu, die Polizei im<br />
Nacken. „Wie bei Carver in In the Lobby of the<br />
Hotel del Mayo“, dachte ich, bevor der junge<br />
Mann in den Fluss sprang. Wir saßen auf einer<br />
Café-Terrasse am Ufer der Miljacka. Den Fluss<br />
sahen wir nicht. Aber wir konnten uns die Szene<br />
vorstellen: Plötzlich verwandelt sich die Welt in<br />
ein abgenutztes VHS-Band, das beim Drücken<br />
der Pausetaste erzittert. Jeder weiß, was jetzt<br />
kommt, jeder denkt an den eigenen Horror zurück.<br />
Dann beginnt alles wieder von vorn.<br />
Aus dem Bosnischen von<br />
Margit Jugo<br />
Andrej Nikolaidis<br />
Geboren 1974 in Sarajevo, lebt in Ulcinj/Montenegro.<br />
Journalist, Literaturkritiker und Prosa-Autor.<br />
Sein Roman Die Ankunft ist 2014 in<br />
deutscher Sprache im Verlag Voland & Quist<br />
veröffentlicht worden.<br />
Tomislav Marković<br />
Princip oder Von<br />
Grundsätzen<br />
(Die Schwarze Hand schreibt mit dem Herzen)<br />
Wir feiern einen großen Nationalfeiertag<br />
Den Tag, an dem der Drachentöter<br />
Sich einbildete, der Heilige Georg zu sein<br />
Wir begehen den Beginn eines großen<br />
Gemetzels<br />
Das erste Welt-Menschenmassaker<br />
Wir zelebrieren den Tag des<br />
Princip<br />
Die gezackte geistige Vertikale<br />
Nach der wir leben<br />
Nach der andere sterben<br />
Die Zahnradbahn zum Himmelreich<br />
Wir feiern das Jubiläum des Mörders<br />
Die ewge Nacht, in der wir den Grundstein<br />
legten<br />
Für unsere Lebensweise<br />
In die wir Millionen zerstreuter Knochen<br />
Eingemauert haben<br />
Wir verneigen uns vor dem<br />
Menschenassassinen<br />
Jede Idee, die das Messer an die Kehle legt<br />
Die Kugel in den Lauf, den Kopf auf den<br />
Hackklotz<br />
Jede Idee, die<br />
Den Kopf vom Rumpf trennt<br />
Ist unsere Leitidee<br />
Unser Grundsatz lautet: Kugel in die Stirn<br />
Das verspritzte Gehirn zu beweinen, lohnt<br />
nicht<br />
Jede Idee ist gut genug<br />
Um Millionen menschlicher Wesen für sie zu<br />
töten<br />
Serbentum, Jugoslawentum, Aasgeiertum<br />
Die Idee des Messers, des Stacheldrahts, die<br />
Idee der Idee<br />
Wir fragen nicht<br />
Wir graben Massengräber<br />
Die Ideen behalten wir und schreiben die<br />
Menschen<br />
Ins Buch der gänzlich Toten<br />
Menschenleben sind wertlos<br />
Eine schlecht quotierte Ware<br />
Auf dem freien Markt<br />
Der lebendig Toten und toten Seelen<br />
Die Menschen gleichen sich wie ein Ei dem<br />
anderen<br />
Niemand ist unersetzlich<br />
Wie der Stählerne sagte<br />
Man muss die Menschen auf der Ersatzbank<br />
halten<br />
An einem kühlen und dunklen Ort<br />
Damit sie nicht verderben<br />
Keine Idee ist gut genug<br />
Um für sie zu leben<br />
Der Tod ist unser Grund-Princip<br />
Besonders der gewaltsame<br />
Nur Feiglinge sterben im Bett<br />
Auf den Schlachtfeldern blühen<br />
Tausend blutige Blüten<br />
Mit zerpflückten Blättern und Gliedern<br />
Für das Volk, den Glauben, für Gott<br />
Das Jugoslawentum, das Serbentum<br />
Für die Vereinigung, für den Tod<br />
Wider den Nächsten<br />
Für irgendwen<br />
Meist töten wir im Namen der Freiheit<br />
Wie es sich für ein freiheitsliebendes Volk<br />
gehört<br />
Nie im Angriff, immer in der Verteidigung<br />
Wir kicken meistens auswärts<br />
Mit Menschenköpfen<br />
Welch ein perfekter Ball<br />
Hätte er nur keine Ohren<br />
Hätte er nur keine Nase<br />
Wäre der Schnitt am Hals nur etwas gerader<br />
Wer tötet, gewinnt<br />
Militärlieferanten sind der lebende Beweis<br />
dafür<br />
Dass ein großer Krieg einen höheren Sinn hat<br />
Der Himmel ist eine offene Wunde<br />
Die wir mit weißen Wolken verbinden<br />
Die Sonne hat Blut gesaugt wie ein Floh<br />
Sie wird unter unseren Nägeln zerplatzen<br />
Für das Volk, den Glauben, für Gott<br />
Das Jugoslawentum, das Serbentum<br />
Für die Vereinigung, für den Tod<br />
Wider den Nächsten<br />
Für irgendwen<br />
Unsere Prinzipien sind mathematisch genau<br />
Für die Umsetzung sorgt die Einheit<br />
Für Rechenoperationen<br />
Zuerst bilden wir eine Summe<br />
Dann mehren wir uns, um Gott zu ehren<br />
Um die Erde zu füllen<br />
Um uns leichter zu teilen<br />
In diese und jene, in uns und die anderen<br />
Unsere Lieblingsrechenart ist die Subtraktion<br />
Das Nehmen beweglicher und unbeweglicher<br />
Güter<br />
Das Nehmen der Hoffnung<br />
Das Nehmen des Lebens<br />
Dem Rest wird alles genommen<br />
Divisionen fallen Millionen zum Opfer<br />
Die Toten zählen wir nicht<br />
Das ist für uns höhere Mathematik<br />
Geleitet von Apis’ 1 Schwarzer Hand<br />
Führen wir seit hundert Jahren<br />
Eine Alphaapisierungskampagne<br />
Die Konjugation bringt den Gegner zu Fall<br />
Bestimmt haben Artikel und Artillerie<br />
denselben Stamm<br />
Beugung lehren wir in der Gefängniszelle<br />
Mit präzisen Folter-Instrumentalen<br />
Splitter unter Nägel treibend<br />
Beugen wir den Willen<br />
Analphabetischer Gefangener<br />
Wer den Brückenzoll nicht zahlt<br />
Zahlt morgen die Syn-Taxe<br />
Die Leiche ist ein Nomen<br />
Das sich in der Mehrzahl am besten fühlt<br />
Dieses Grab ist mir zu klein<br />
Eng, ungeeignet<br />
Aber groß genug<br />
Um als Ziehstätte zu dienen<br />
Für Millionen kleiner Gräber<br />
Für das Volk, den Glauben, für Gott<br />
Das Jugoslawentum, das Serbentum<br />
Für die Vereinigung, für den Tod<br />
Wider den Nächsten<br />
Für irgendwen<br />
Kaum aus der Nichtigkeit hervorgekrochen<br />
Verlangen wir nach Freiheit<br />
Nach absoluter Harmonie, dem Paradies auf<br />
Erden<br />
Wir bekämpfen den Tyrannen<br />
Um unsere Sklavenseelen<br />
Im Vakuum der Freiheit zu ersticken<br />
Vom Besatzer befreit<br />
Von uns selbst besessen<br />
In der Freiheit trinken wir<br />
Einen Twitterkaffee nach dem anderen<br />
Das Leben ist wie Tausendundeine Schmeichelei<br />
Wir messen es mit goldenen Kaffeelöffeln<br />
Wir reisen in künstliche Paradiese<br />
Im Sommer auf die Malligand-Inseln<br />
Wälzen uns auf Scherben<br />
Berauscht von zwanziggradiger Freiheit<br />
Im Winter nach Narkisch-Partenkirchen<br />
Zum Skifahren ohne Schnee<br />
In der Freiheit fahren wir tolle Schlitten<br />
Mit Schaum auf der Motorhaube<br />
Im Teufelszweierkreis 2<br />
Wir schleifen das Messer für die Rücken der<br />
Nächsten<br />
Deren pure Existenz uns bedroht<br />
Das Loch in unserer Brust<br />
Die Öde, durch die der Wind pfeift<br />
Füllen wir mit Goldmünzen<br />
Mit Titeln und teuren Schuhen<br />
Wir mästen die Leere, bis sie platzt<br />
Wie ein mit Nichtigkeit gefüllter Ballon<br />
Und wenn das in einen roten Teppich gerollte<br />
Herz<br />
Aufhört im Tamtam-Rhythmus zu schlagen<br />
Wenn der faktische Zustand zum rechtlichen<br />
wird<br />
Dann schleichen unsere Geister durch Wien<br />
Und schreiben „Kosovo ist Serbien“ an die<br />
Wände<br />
Für das Volk, den Glauben, für Gott<br />
Das Jugoslawentum, das Serbentum<br />
Für die Vereinigung, für den Tod<br />
Wider den Nächsten<br />
Für irgendwen<br />
Aus dem Serbischen von<br />
Margit Jugo<br />
Tomislav Marković<br />
Geboren 1976 in Belgrad. Mitbegründer und bis<br />
Ende 2013 Redaktionsmitglied von BETON, der<br />
Beilage der Tageszeitung Danas. Mitarbeit bei<br />
zahlreichen Zeitungen, Zeitschriften und Internetportalen.<br />
Er hat zwei Gedichtbände, zwei<br />
Sammlungen von Aphorismen und ein Buch<br />
mit satirischer Poesie und Prosa veröffentlicht.<br />
Stellvertretender Herausgeber des Internetportals<br />
e-novine.<br />
Schlechte Ideen gibt es nicht, nur schlechte<br />
Menschen<br />
Haben oder töten<br />
Im Grunde kein Dilemma<br />
1 Beiname von Dragutin Dimitrijević, einem führenden<br />
Mitglied des serbischen nationalistischen Geheimbunds<br />
„Schwarze Hand“ (Anm. d. Übers.).<br />
2 Die Belgrader Innenstadt wird auch „Zweierkreis“ genannt,<br />
nach der Straßenbahnlinie Nummer 2, die um das<br />
Stadtzentrum kreist (Anm. d. Übers.).<br />
Beton International März 2014 20
Lamija Begagić<br />
Sommer bei den<br />
Winters<br />
Es war nicht schwer, sich auf lange Sommer<br />
bei Manuel einzulassen, nicht bei diesem<br />
riesigen Garten. Es fiel mir nicht schwer, Ende<br />
Mai bei ihm einzuziehen, bis Ende Oktober zu<br />
bleiben und nur wenige Male, wenn physiologische<br />
Notwendigkeit uns dazu zwang, das Innere<br />
seines kleinen Hauses im niederösterreichischen<br />
Berndorf zu betreten. Alle anderen Sommertage<br />
und warmen Nächte verbrachten wir<br />
gerne damit, von der Sonnenliege in die Hollywoodschaukel<br />
zu wechseln, von der Hollywoodschaukel<br />
an den Gartentisch, auf dem das Laptop<br />
sich sonnte, voller halbleerer Dokumente,<br />
die es genauso wenig eilig hatten wie wir.<br />
Manuels Geburtstag feierten wir im Juni,<br />
der dann nahtlos mit dem Juli verschmolz,<br />
so wie auch die langen Tage miteinander verschmolzen,<br />
wie der Himmel und die unendliche<br />
grüne Landschaft der Gärten von Berndorf.<br />
(Was für Gärten dieses Städtchen doch<br />
hatte!)<br />
Dann klopfte der August an, es wurde<br />
schwül und wir verlagerten uns unter die Weiden<br />
in den Ecken, um am Spätnachmittag wieder<br />
an den Gartentisch zurückzukehren. Manuel<br />
brachte Weißwein, Sprudel und Eiswürfel,<br />
legte Block und Stifte dazu und war entschlossen,<br />
es endlich für mich zu zeichnen.<br />
Ich hatte Manuel Winter an einem schwülen<br />
Sommertag in Pula kennen gelernt.<br />
In meinem vorösterreichischen Leben verbrachte<br />
ich die Sommer in Istrien, bei Ivan,<br />
dem Fotografen, Freund aus Studientagen und<br />
erster Arbeitskollege in der Redaktion der Studentenzeitung.<br />
Nur drei Jahre älter, war Ivan dreiunddreißig<br />
Mal mutiger als ich. Während ich mich wie<br />
ein Feigling in meinem muffigen Zimmer in<br />
Sarajevo verkroch, wo der Hopfenmief aus der<br />
nahe gelegenen Brauerei hereinwehte, probierte<br />
er es mit Novi Sad, Zagreb und Rovinj, um,<br />
wie er im Scherz sagte, als Friedhofswächter in<br />
Pula zu enden.<br />
Der Marinefriedhof in Pula, der berühmte<br />
k. u. k. Marinefriedhof, war alles andere als ein<br />
gewöhnlicher Friedhof, genauso wie Ivan alles<br />
andere als ein gewöhnlicher Wächter war.<br />
Er sprach über diese Toten, als hätte er sich<br />
gestern erst an der Kneipentheke von ihnen<br />
verabschiedet, um sie heute wieder zu treffen,<br />
gleich nach seiner Schicht. Dann würden sie<br />
ein kühles Bier trinken, einfach so im Stehen.<br />
Das waren seine Toten, er wusste alles über sie,<br />
selbst die trivialste Kleinigkeit, Österreicher,<br />
Italiener, Dalmatiner, Nachfahren berühmter<br />
Adelsgeschlechter, Offiziere, Kapitäne, Matrosen,<br />
Soldaten.<br />
Der Marinefriedhof in Pula war Teil des<br />
kulturellen Erbes der Stadt, hier ruhten weder<br />
Presley noch Morrison, an deren Gräbern Fans<br />
kitschige Blumensträuße abgelegt oder Kerzen<br />
angezündet hätten, und dennoch brummte er<br />
vor allem im Sommer vor Touristen.<br />
Ivan sprach vier Weltsprachen und erledigte<br />
seinen Job ausgezeichnet. Sein fotografischer<br />
Blick half ihm dabei, sich für diejenigen, die wegen<br />
der Stille des Friedhofs herkamen, knapp<br />
auszudrücken und in Bildern zu sprechen.<br />
Denjenigen, die wegen einer Geschichte herkamen,<br />
gab er auch, was sie suchten, breitete vor<br />
ihnen lebendig die Geschichten der Toten aus.<br />
Für jedes erloschene Leben fand er einen neuen<br />
Schluss, wie in den Geschichten mit mehreren<br />
Enden aus den Zeitschriften meiner Kindheit.<br />
Es gibt immer Aspekte unserer Arbeit, die<br />
wir lieben, egal, was wir tun. Bei mir ist es der<br />
Moment, wenn ich zum Beispiel zehn Tage,<br />
bevor die Zeitung in Druck geht, den Satzspiegel<br />
sehe, diese Bibel aller Zeitungsmacher, den<br />
Plan, ohne den man keine Zeitung machen<br />
kann, und wenn mir all diese Buchstaben, Zahlen<br />
und Farben entgegenleuchten. Alles in diesen<br />
Plänen hat seinen Grund, seine Legende,<br />
man weiß immer, dass Gelb für Text steht, Grün<br />
für Illustrationen, dass Blaues bereits lektoriert<br />
wurde …<br />
All diese Seitenzahlen und Überschriften,<br />
diese grellen Farben verraten, dass wir voller<br />
Tatendrang sind, dass wir mit ganzer Kraft etwas<br />
entwickeln, gestalten, erschaffen!<br />
Was für mich die bunten Pläne sind, sind für<br />
Ivan die Toten von der „Baron Gautsch“.<br />
Die Toten von diesem alten österreichischen<br />
Dampfschiff sind nicht toter als andere,<br />
doch ihre Geschichten gehen Ivan leichter von<br />
den Lippen und klingen in den Ohren seiner<br />
Zuhörer noch lange nach.<br />
In Manuels Ohren klingen sie schon seit<br />
Jahren, seit seiner Kindheit, diese Geschichten,<br />
diese geschminkte Familiengeschichte. Und sie<br />
führten ihn zu Ivan und dann, dem Himmel sei<br />
Dank, zu mir.<br />
Es ist der zehnte August, der Eiswürfel in<br />
der Weinschorle ist bereits nach wenigen Minuten<br />
wieder gewöhnliches Wasser. Trotzdem<br />
sitzt Manuel in der prallen Sonne und zeichnet.<br />
Das, was er zeichnet, ist groß.<br />
Das, was er zeichnet, wird er erst im nächsten<br />
Sommer vor den Augen anderer ausstellen,<br />
sich entblößen, vor die Leute treten (und es<br />
werden Hunderte sein, der Garten der Winters<br />
ist berühmt!) und sagen: „Hier, das bin ich, das<br />
sind wir, so war das oder ein wenig anders, oder<br />
es war gar nicht.“<br />
Das, was er jetzt aufs Papier zeichnet, zeichnet<br />
er in Gedanken schon seit einem Jahrzehnt,<br />
seit er das erste Mal die etwas andere Geschichte<br />
über seinen Uronkel Paul Winter gehört<br />
hat, Kapitän Paul Winter auf der „Baron von<br />
Gautsch“, dem ersten Opfer des Ersten Weltkriegs,<br />
gesunken im fernen August 1914, ganz<br />
zu Anfang des Krieges, dessen Ausmaß unsere<br />
Großonkel nicht einmal ahnten, auch Paul Winter<br />
nicht.<br />
Wir sind wieder im Garten, Manuel und ich.<br />
Wir sind vor Sonnenaufgang aufgestanden und<br />
in Bademänteln nach draußen gegangen. Gegen<br />
fünf Uhr, am dreizehnten August.<br />
„Bis jetzt ist es ruhig. Sie kehren aus Boka<br />
zurück, in sechs Stunden sind sie in Lošinj, im<br />
letzten Hafen. Was sie wohl tun Schlafen oder<br />
trinken<br />
Wer weiß. Vielleicht küssen sie eine Frau,<br />
eine junge, dralle Deckarbeiterin oder die reiche<br />
Gattin eines hohen k. u. k. Beamten, die auf<br />
dem Heimweg vom Strand ist, wütend auf den<br />
Krieg, der die Sommerfrische unterbricht.<br />
Oder küssen sie vielleicht Männer, stattliche<br />
Unteroffiziere<br />
Vielleicht. Es ist Krieg. Es ist die Jahreszeit,<br />
wenn wir uns guten Gewissens sagen: Ach, was<br />
soll’s! Schlagen wir doch einfach mal einen neuen<br />
Kurs ein und lassen uns treiben.<br />
Ja. Einen neuen Kurs“, wiederholt Manuel<br />
lächelnd, zieht meine Liege näher an seine und<br />
legt seinen Kopf in meinen Schoß.<br />
Es ist der 13. August 1914. Die „Baron von<br />
Gautsch“, ein Luxusdampfer für 300 Passagiere,<br />
auf dem saisonabhängig 60 oder 70 Besatzungsmitglieder<br />
arbeiten, steht erst seit drei Wochen<br />
unter dem Kommando der österreichischungarischen<br />
Kriegsmarine. Diese einstmals<br />
luxuriöse Titanic der Adria, die Passagiere von<br />
Triest nach Boka Kotorska beförderte und dabei<br />
alle Städte und Inseln Nordkroatiens und<br />
Istriens anlief, wird jetzt als Truppentransporter<br />
verwendet. Es sind junge Männer, sie fahren<br />
von Triest nach Kotor und sind die Verstärkung<br />
der k. u. k. Truppen in diesem Teil der Adria. Sie<br />
haben ihre neuen, noch makellosen Uniformen<br />
dabei und ihre zügellosen Träume und Ängste.<br />
Wenn sie vor Anker gehen und das Schiff verlassen,<br />
werden sie noch singen und jubeln, es wird<br />
noch Zeit vergehen, bis ihr Lied verstummt.<br />
Dann werden sich Familien auf dem luxuriösen<br />
Schiff einschiffen, größtenteils Frauen und Kinder<br />
von Offizieren und Staatsbeamten, dieses<br />
Schiff bedeutet das Ende vieler Sommerferien<br />
– es ist Krieg, da liegt man nicht in der Sonne!<br />
Wenn sie zu ihren Männern ins Landesinnere<br />
der Monarchie zurückkehren, wird niemand<br />
die leichte Bräune bemerken, Erinnerung an<br />
sonnenbeschienene Inseln, und die weißen<br />
Streifen, die die Badeanzüge auf den Schultern<br />
hinterließen, als Zeichen, dass der Sommer uns<br />
verändert hat.<br />
Wir sind spät. Bis 6 müssen wir Triest erreichen.<br />
Und das werden wir. Ich werde einheizen lassen,<br />
damit wir Höchstgeschwindigkeit erreichen.<br />
Ich denke, es gibt guten Fisch und Wein.<br />
Ja, sind das denn die Leute des Ministers<br />
Ja. Die Rothaarige ist erste Beraterin. Giacchelli,<br />
Höchstgeschwindigkeit!<br />
Erledigt, Kapitän, alle Rösser sind eingespannt!<br />
Luppis, die Baron gehört dir.<br />
Verstanden, Kapitän, seien Sie unbesorgt.<br />
Das Dampfschiff „Baron von Gautsch“ hatte<br />
keine Blackbox, und hätte es eine gehabt, wäre<br />
das der Mitschnitt gewesen. Es wäre nicht darauf<br />
verzeichnet, wie es auch hier nicht verzeichnet<br />
ist, wie und warum der erste Offizier Luppis<br />
gegen 14 Uhr die Kommandobrücke verließ, genau<br />
als das Mittagessen begann, als die Schiffskellner<br />
frischen Fisch und Karaffen voll erstklassigen<br />
Weißweins auf den strahlend weiß<br />
gedeckten Tischen der ersten Klasse verteilten.<br />
Wie und warum gerade auf diesem Streckenabschnitt,<br />
auf den die k. u. k. Marineführung am<br />
Tag vor Beginn der Reise speziell hingewiesen<br />
und für den sie einen exakten Minenplan übergeben<br />
hatte. Der zweite Offizier Tenze hatte sie<br />
ihm persönlich übergeben, und er hatte daraufhin<br />
den Kurs bestimmt, er persönlich, Luppis,<br />
erster Offizier, der jetzt das Bild ihres gelösten<br />
Haars nicht aus dem Kopf bekommt und in dessen<br />
Nase sich Wein und Fisch ausbreiten.<br />
„Der Kriegshafen Pula war am Anfang des<br />
Krieges ein mögliches Ziel der italienischen<br />
Marine“, erklärt Ivan, „sodass im Sommer 1914<br />
der Führungsstab der k. u. k. Kriegsmarine beschloss,<br />
den Hafen zu sichern und vier Minenfelder<br />
mit insgesamt 1300 Minen rund um die<br />
Halbinsel Istrien zu verlegen.“<br />
Es ist heiß und mir ist schwindelig. Einer<br />
der Grabsteine spendet ausreichend Schatten,<br />
dort setze ich mich hin. Er gefällt mir, dieser<br />
Österreicher, dieser Manuel. Ivan sagt, dass<br />
Manuel schon zum dritten Mal hier ist, er ist ein<br />
Nachfahre des Kapitäns, der für das schreckliche<br />
Seeunglück verantwortlich war.<br />
„Du brauchst die Wahrheit nicht“, fährt<br />
Ivan fort, „du kennst sie schon. Wenn einer sie<br />
kennt, Manuel, dann du.<br />
Stell dir die Sonne über dem Meer vor, wie<br />
jeder ihrer Strahlen sich einen eigenen Pfad<br />
über das Wasser sucht. Entlang der Strahlen<br />
sind Minen ausgelegt, der Minenleger ‚Basilisk‘<br />
hatte die Aufgabe, zehn Minenstrahlen auszulegen,<br />
die sich vom Festland wie ein Fächer<br />
aufs Meer hinaus entfalteten, wie eine zweite<br />
verdammte Sonne im Meer, glühend heiß und<br />
tödlich.<br />
Sie verlegten gerade den ersten Strahl, waren<br />
noch nicht einmal bis zur Hälfte gekommen.<br />
Voller Entsetzen erblickten sie das Schiff,<br />
sie schrien, einer hüpfte so hoch er konnte, als<br />
wollte er die Strahlen der Sonne einfangen, der<br />
richtigen am Himmel, ein anderer winkte wie<br />
wild, sie sendeten alle nur erdenklichen Signale,<br />
die offiziellen und inoffizielle, doch die ‚Baron‘<br />
fuhr träge, unbeeindruckt und scheinbar<br />
menschenleer auf den Minenstrahl zu.<br />
Nur fünfzehn Minuten nach der Explosion<br />
war sie weg. In weniger als fünfzehn Minuten<br />
gesunken, gegen drei Uhr am Nachmittag, in<br />
der Nähe von Rovinj.“<br />
Der Tag wird heiß, aber wir werden ausreichend<br />
Getränke und Eis besorgen.<br />
Der Lügenfächer Uronkel Paul und andere<br />
Familienlügen<br />
Manuel sucht noch nach einem Titel für seine<br />
Ausstellung, der größten in seiner Karriere,<br />
er wird sie am hundertsten Jahrestag dieser<br />
burlesken Tragödie eröffnen, in der die Besatzung<br />
Appetit auf Wein, Fisch und das Dekolleté<br />
einer mysteriösen Brünetten hatte und das<br />
Kommando dem jungen zweiten Offizier Tenze<br />
übergab, der das Schiff geradewegs ins Minenfeld<br />
steuerte. Eine Tragikomödie, aus der Manuels<br />
Familie über Jahre hinweg einen ruhmreichen<br />
Kriegsmythos zimmerte.<br />
(Selbst das Gericht hat gesagt, er sei unschuldig,<br />
wie sollten da wir, Blut von seinem<br />
Blut, etwas anderes behaupten.<br />
Und dass er zu Mittag gegessen hat, Kapitäne<br />
müssen schließlich auch essen, oder nicht<br />
Wir heben seine Orden auf, natürlich heben<br />
wir sie auf, sollen wir sie etwa ins Wasser werfen,<br />
draußen auf dem Meer vor diesem Rovinj,<br />
sechs Seemeilen vom Leuchtturm entfernt.)<br />
Manuel Winter wird im Garten des Familienhauses<br />
in Berndorf ein riesiges Bild enthüllen,<br />
ein Bild der Wahrheit über den stolzen Onkel<br />
Paul, Kapitän eines großen Schiffes!<br />
In den Gärten Berndorfs wird man darüber<br />
noch lange sprechen. Oder doch nicht.<br />
Denn auch wenn sie darüber sprechen wollten,<br />
was könnten sie schon sagen<br />
Irgendwann damals, als der Krieg noch grün<br />
war wie in einer lustigen Kindergeschichte, verfing<br />
sich ein Schiff in seinem eigenen Minenfeld,<br />
und jetzt liegt es tot am Meeresgrund, in<br />
der Nähe von Rovinj, und empfängt neugierige<br />
Seeleute, unter deren Tauchermasken sich Bewunderung<br />
verbirgt. Oder Spott.<br />
Der September wird ruhig. Ivan wird seinen<br />
wohlverdienten Urlaub bei uns verbringen. Wir<br />
werden auf die umliegenden grünen Hügel steigen<br />
und uns denken, dass es nicht so schlecht<br />
wäre, sie schneebedeckt zu erleben, vielleicht<br />
wäre auch der Winter ganz schön, ein Winter<br />
bei den Winters.<br />
Aus dem Bosnischen von<br />
Blanka Stipetić<br />
Lamija Begagić<br />
Geboren 1980 in Zenica, lebt in Sarajevo. Redakteurin<br />
in den Zeitschriften für Kinder „Kolibrić“<br />
und „Palčić“ und Mitarbeiterin der Zeitschrift<br />
für eine gerechte Schule „Školegijum“. Bisher<br />
sind von ihr in Bosnien und Herzegowina zwei<br />
Bände mit Erzählungen erschienen.<br />
Beton International März 2014 21
János Háy<br />
AUF DIE<br />
VERGANGENHEIT<br />
NICHT<br />
Die Vergangenheit ist etwas, auf das man<br />
nicht spucken kann, auch dann nicht, wenn<br />
man es gerne tun würde. Denn sie spuckt zurück.<br />
Es hat auch keinen Sinn, sie zu verbergen,<br />
sie drängt sich ohnehin wieder vor, wenn nicht<br />
anders, dann durch einen Psychologen, der sie<br />
im Zuge einer kostspieligen Therapie aus dir<br />
herausholt, zum allerschlechtesten Zeitpunkt,<br />
wenn dein Leben ohnehin in Scherben liegt.<br />
Besser ist es, beizeiten zu beginnen, in<br />
dieser Vergangenheit herumzukramen, die<br />
Geschichte der Mutter, von Großmama und<br />
Großpapa aufzustöbern. Doch wie weit sollen<br />
wir uns zurückwühlen Beispielsweise bis 1914,<br />
damals mochten ja die europäischen Staaten,<br />
unter ihnen Ungarn, die gewohnten Häfen verlassen<br />
haben, mit ihren an Deck gefangenen Bewohnern.<br />
Was ist damals mit uns passiert, mit<br />
denjenigen, deren Andenken ich in mir trage<br />
Ein paar Jahre nach dem Tod des österreichischen<br />
Thronfolgers in einer Stadt, die<br />
Oma nicht kannte, wurde ihr Bruder einberufen,<br />
damit er für diesen Mord Rache nehme.<br />
Die Gesetze ermöglichten das, er war gerade<br />
achtzehn. Leider erwies sich die Rache anderer<br />
Nationen als stärker als die seine, weshalb er in<br />
einer unbedeutenden slowenischen Stadt blieb,<br />
wo man ihn zusammen mit anderen jungen Ungarn<br />
verscharrte. Der Krieg war schon fast vorbei,<br />
nur noch ein paar Wochen wären zu überstehen<br />
gewesen, aber so ist das eben, auch in<br />
den letzten Wochen gibt es Gefallene. Heldentod,<br />
das schrieb man den Eltern, als könnte diese<br />
lächerliche Bezeichnung Schmerzen lindern.<br />
Im Gleichschritt mit der Nachricht vom Friedensschluss<br />
traf, vielleicht aus Spanien, weil es<br />
Spanische Grippe genannt wurde, jenes Virus<br />
ein, das die zwei älteren Schwestern der Großmutter<br />
hinwegraffte, die eine war sechzehn, die<br />
andere fünfzehn, und dann auch noch ihre vom<br />
Pflegen erschöpfte Mutter. Drei blieben übrig,<br />
die jüngeren, und der Vater, um erst später der<br />
Vernichtung anheimzufallen oder um zu überleben.<br />
Mittlerweile waren aus einem Großteil<br />
der Verwandten unbemerkt Ausländer geworden,<br />
denn das Nachbardorf, aus dem auch sie<br />
selbst stammten, war einem anderen Staat zugefallen,<br />
gemeinsam mit anderen ungarischen<br />
Gebieten und ihren so zahlreichen ungarischen<br />
Bewohnern, die von meinen Großeltern fortan<br />
Slowaken und Rumänen genannt wurden, obwohl<br />
sie genau wussten, dass es keine Slowaken<br />
und Rumänen waren, sondern ihre Verwandten.<br />
Zu der Zeit heiratete meine Großmutter<br />
und bekam eine Tochter, ein kleines blondes,<br />
Zöpfe tragendes Mädchen. Lieber nur ein einziges<br />
Kind, sagte sie, doch das bringen wir durch.<br />
Sie schützten und behüteten es, obzwar Großvater<br />
sich daran kaum beteiligen konnte, denn<br />
vom Ende der dreißiger Jahre an wurde er zum<br />
Militär einberufen, zuerst zum Dienst in der<br />
Etappe, weil er ein Kind hatte, doch dann zählte<br />
auch das nicht mehr, er wurde an die Front geworfen,<br />
wo er nach den Kampfhandlungen einiger<br />
Jahre in Gefangenschaft geriet. Er wurde in<br />
einen fernen Winkel Russlands gebracht, in ein<br />
zu diesem Zweck angelegtes Arbeitslager, wo<br />
die einstigen Soldaten unter unmenschlichen<br />
Bedingungen von Woche zu Woche dezimiert<br />
wurden, doch er überlebte. Als Großvater Ende<br />
der vierziger Jahre freigelassen wurde und sich<br />
knochendürr und krank nach Hause trollen<br />
konnte, war aus dem kleinen Mädchen ein großes<br />
geworden. Von wem werde ich entschädigt,<br />
sagte das Mädchen, inzwischen alt geworden,<br />
als der Sozialismus zusammenbrach und der<br />
neue demokratische Staat für jedes verlorene<br />
materielle Gut eine Entschädigung zahlte. Wer<br />
entschädigt mich dafür, sagte sie, dass ich ohne<br />
Vater aufgewachsen bin Das kleine Mädchen<br />
war groß, unser Land ein sozialistischer Großbetrieb<br />
und aus den zwei Brüdern der Großmutter<br />
einer geworden. Während Großvater<br />
fort war, wandelte sich auch die Bevölkerung<br />
des Dorfes, es gab einen Haufen Neuankömmlinge<br />
aus der Slowakei, die Häuser der Juden<br />
hingegen waren verwaist. Einfache Menschen<br />
hatten darin gewohnt, nicht solche, wie sich<br />
die Antisemiten Juden vorstellen. Tief gläubig<br />
und zumeist arm, wie ja alle in dieser Gegend.<br />
Die Häuser blieben unbewohnt; hatte jemand<br />
das hemmungslose Blutvergießen überlebt, so<br />
hatte er keine Lust, an den Ort zurückzukehren,<br />
von wo er, wie er annahm, mit dem stillschweigenden<br />
Einverständnis der Einheimischen<br />
verschleppt worden war. Dabei hatten<br />
diese den staatlich organisierten Völkermord<br />
gar nicht unterstützt, doch das konnte man<br />
sich auf dem Lastwagen unterwegs zum Viehwaggon<br />
nicht vorstellen. Warum tun sie nichts,<br />
das konnte man denken, und sie taten wirklich<br />
nichts, denn in der Welt von damals hatten die<br />
unteren Volksschichten keine Berechtigung zu<br />
handeln. Die Deutschen des Nachbardorfs verschwanden.<br />
Sie hatten im Volksbund auf den<br />
Putz gehauen, waren Faschisten, sagte das neue<br />
Regime, und natürlich kümmerte es sich nicht<br />
darum, wer wirklich einer war und wer nicht,<br />
und wer derjenige war, der den jüdischen Krämer<br />
vor den Augen der Nazis verborgen hatte.<br />
Später kehrten die von der Aussiedlung so<br />
schwer Getroffenen in riesigen Autos mit deutschen<br />
Kennzeichen zurück und protzten vor<br />
den Daheimgebliebenen mit ihrem Wohlstand.<br />
Diese bestaunten die Mercedes und BMWs und<br />
nahmen es dem Schicksal übel, dass nicht sie<br />
selbst ausgesiedelt worden waren, dabei hatten<br />
sie keine Ahnung von jener Art des Entbehrens,<br />
die weder Autos noch sonstige materielle Güter<br />
lindern konnten. Alles hatte sich verändert,<br />
jedoch wussten sie nicht, ob all das tatsächlich<br />
damit zu tun hatte, dass man in einer unbekannten<br />
südslawischen Stadt einen Mann niedergeschossen<br />
hatte, der im Übrigen Thronfolger<br />
war. All das - die vielen Leiden, und später<br />
das Sattwerden. Wie Großmutter es ausdrückte,<br />
die sonst nichts mit dem Kommunismus<br />
am Hut hatte, unter keinen Umständen gehabt<br />
hätte - also die Großmutter sagte, dass wir satt<br />
geworden waren. Jeder war satt geworden. Von<br />
Fleischgerichten. Und sie war traurig, denn sie<br />
musste auch mit ansehen, wie das ganze Wohlleben<br />
zusammenbrach, nach der Wende wurde<br />
das Dorf abermals von der Welt abgeschnitten.<br />
Da half auch der EU-Beitritt nichts, die Dörfer<br />
blieben hinter oder vor den sieben Bergen, jedenfalls<br />
irgendwie sehr weit weg. Zuerst begannen<br />
nur die Ärmsten der Armen zu hungern,<br />
weil sie ihre Arbeit, ihre Habe verloren, dann<br />
wurde allmählich das Elend zum Hauptcharakteristikum<br />
dieses Dorfes, das infolge eines für<br />
seine Einwohnerschaft völlig unverständlichen<br />
Krieges, des Todes eines blöden Thronfolgers<br />
Jahrzehnte hindurch auf ungewissen Pfaden<br />
umhergeirrt war, und vielleicht hätte es diese<br />
Pfade nicht verlassen, wären ihm die Einwohner,<br />
die der Armut leid waren, nicht davongelaufen.<br />
Das konnte Großmutter nicht mehr miterleben,<br />
denn sie hatte an einem Wintertag vor<br />
ein paar Jahren Abschied genommen, von ihren<br />
Verwandten und von jeder möglichen Zukunft,<br />
ob mit gutem oder schlechtem Ausgang.<br />
Erinnerung ist gemeinschaftsstiftend und<br />
ein Teil unserer Identität. In dieser Eigenschaft<br />
kann sie konstruktiv sein, was die Stallwärme<br />
der Zusammengehörigkeit erzeugt, oder<br />
destruktiv, die Gemeinschaft erstickend. Das<br />
Leben produziert Erinnerungen, doch die Erinnerungen<br />
produzieren kein Leben. Wenn das<br />
Verhältnis von Leben und Erinnerung zu Gunsten<br />
der Erinnerung kippt, ist die Gemeinschaft<br />
nicht imstande, etwas aufzubauen, positive und<br />
zukunftsweisende Ziele zu formulieren, die Aktivität<br />
hervorrufen, sie wird zum Erinnerungsverwalter,<br />
zum Wächter der Vergangenheit. Obwohl<br />
es doch ohne Aktivität, einfacher gesagt<br />
ohne Handeln, kein Leben gibt.<br />
In einer besonders schwierigen Situation<br />
befinden wir uns bezüglich der Erinnerung der<br />
verschiedenen ungarischen Gemeinschaften,<br />
denn diese gründen sich fast ohne Ausnahme<br />
auf Traumata. Wenn wir uns entlang von Leidensgeschichten<br />
aneinanderdrängen, wird<br />
die Welt sogleich in zwei Hälften geteilt: wir,<br />
die wir Unrecht erlitten, und sie, die es began-<br />
gen haben. Oft gibt es längst niemanden mehr,<br />
der das Leid miterlebt hat, doch die Nachfahren<br />
hätscheln noch immer die einstige Ungerechtigkeit<br />
und damit die Einteilung der Welt<br />
in Leidende und Verursacher des Leids. Der<br />
eine wird in den Schatten des Schmerzes, der<br />
andere in denjenigen des Verdachts gestellt.<br />
Dieses Bild verfälscht, gibt jedoch Sicherheit.<br />
Oft schrecken wir davor zurück, es abzuschütteln,<br />
wir fürchten, damit das Bindemittel unserer<br />
Persönlichkeit zu verlieren. Dabei ist eine<br />
Identität umso stärker und selbstbewusster, je<br />
mehr sie die Umwertung falschen Bewusstseins<br />
zulässt, je mehr sie wagt, Erinnerungen auf die<br />
Ebene einer realistischeren historischen Einschätzung<br />
zu heben. Wie das Kind, wenn es<br />
erwachsen wird, dazu fähig ist, den Vater nicht<br />
als allmächtige Stütze, sondern als fehlbaren<br />
Sterblichen zu sehen, so ist auch die Erinnerung<br />
einer Nation und kleinerer Gemeinschaften<br />
umso erwachsener und reifer, je mehr sie<br />
wagt, sich selbst kritisch zu betrachten, auf<br />
das Opium der Selbsttäuschung zu verzichten.<br />
Und natürlich wird nur so möglich, für die Ereignisse<br />
der Vergangenheit, die keineswegs nur<br />
makellose Kreuzwege sind, die Verantwortung<br />
zu übernehmen. Damit wir nicht den zahllosen<br />
von Ehemann oder Ehefrau Verlassenen<br />
gleichen, die den Davongelaufenen verlästern<br />
und gar nicht auf die Idee kommen, sie könnten<br />
vielleicht nicht so ganz unschuldig an der Geschichte<br />
sein.<br />
Im Übrigen ist die gemeinschaftliche Erinnerung<br />
im Wesentlichen eine bürgerliche<br />
Erfindung. Tief in ihr lebt der Wunsch, dem<br />
individuellen Schicksal über die eigene Winzigkeit<br />
hinausgehend zu größerer Bedeutung<br />
zu verhelfen. Die Erinnerung ist ein Vorgehen<br />
gegen unsere Endlichkeit. Gemeinsame Erinnerung<br />
verbindet unser eigenes Schicksal mit<br />
dem großen gemeinsamen, das, wie anzunehmen<br />
ist, bis ans Ende aller Zeiten Bestand hat.<br />
Der Erinnerung der Unterschichten fehlt, zumindest<br />
nach meiner persönlichen Erfahrung,<br />
eine solche Erlösungsgeschichte. Meist bleibt<br />
sie im Bereich der eigenen Familie und ist nicht<br />
gemeinschaftsbildend. Meine Großeltern vom<br />
Land erzählten ständig von den Ereignissen der<br />
Vergangenheit, doch wie viel sie auch von Hunger,<br />
Armut und Demütigungen, von Krieg und<br />
Gefangenschaft redeten, es schuf kein Kollektiv.<br />
Mitunter tauchte ein Mitgefangener oder<br />
ein Kriegskamerad auf, ein Schicksalsgefährte<br />
aus dem Luftschutzkeller, doch weiter ging die<br />
Gemeinschaftsbildung nie. Niemals hörte ich<br />
das Gegensatzpaar des „wir“ und „sie“. Sie hatten<br />
keine Feinde und auch kein Bewusstsein<br />
von Feindschaft, nur ein Schicksal, das erduldet<br />
werden musste, wenn etwas zu dulden war,<br />
und über das man sich freuen konnte, wenn die<br />
Familie Grund zur Freude hatte. Wenn jemand<br />
geboren wurde, zum Beispiel ich.<br />
Aus dem Ungarischen von<br />
Heinrich Eisterer<br />
János Háy<br />
Geboren 1960 in Vámosmikola, Ungarn. Studierte<br />
Kunst und Geschichte in Szeged und in Budapest.<br />
Schriftsteller, Dichter und Dramatiker. Bisher<br />
veröffentlichte er 20 Bücher mit Gedichten,<br />
Essays, Erzählungen und Romane.<br />
Beton International März 2014 22
Faruk Šehić<br />
Das Jahr 1992<br />
als unser<br />
persönliches<br />
1914<br />
Im Zuge meiner Vorbereitungen für diesen<br />
Text stieß ich auf die dreibändige Sonderausgabe<br />
der Zeitschrift „Gradac“ aus dem Jahr 2010, die<br />
zur Gänze dem Thema „Junges Bosnien“ gewidmet<br />
war. Einmal abgesehen von der offensichtlichen<br />
Anmaßung, die der Herausgeber Muharem<br />
Bazdulj keineswegs zu verhehlen versuchte, sowie<br />
abgesehen von seiner Angewohnheit, bei jeder<br />
sich bietenden Gelegenheit seinem Missmut<br />
über den Erfolg des Schriftstellers Andrej Nikolaidis<br />
Ausdruck zu verleihen, könnte man sagen,<br />
dass in dieser Ausgabe einiges an interessantem<br />
Material enthalten ist, das dem Leser Informationen<br />
über das Attentat von Sarajevo und die<br />
Person und die Tat des Gavrilo Princip sowie die<br />
politische Situation in Europa vor dem Ausbruch<br />
des Großen Krieges bietet.<br />
Zufällig stieß ich zunächst auf den Text „Sarajevo“<br />
von Rebecca West. Ich bedaure bloß,<br />
dass sie nicht mehr am Leben ist, sonst hätte sie<br />
im Krieg als Beraterin von Radovan Karadžić<br />
fungieren können, und zum jetzigen Zeitpunkt<br />
könnte sie Milorad Dodik ihre Ratschläge ins<br />
Ohr flüstern, einem Mann, der fähig und willens<br />
ist, Bosnien und Herzegowina in einen neuen,<br />
blutigen Konflikt zu führen. Da auf dem Balkan<br />
immer alles möglich ist, darf man die Möglichkeit<br />
eines neuen Krieges in Bosnien und Herzegowina<br />
auch nicht unterschätzen, haben doch<br />
die sezessionistischen Gelüste Milorad Dodiks<br />
und seiner Herrschaften aus Belgrad im Laufe<br />
der Jahre keineswegs nachgelassen, sondern<br />
sind von Jahr zu Jahr progressiv gestiegen.<br />
Der Text von Rebecca West verdient keine<br />
besondere Aufmerksamkeit, abgesehen vielleicht<br />
von einem Umstand: Die Autorin erklärt<br />
in ihrem Text, warum der unbeliebte Erzherzog<br />
Franz Ferdinand getötet werden sollte. Sie begründet<br />
es damit, dass er ein dämonisch-blutrünstiges<br />
Verhältnis zu wilden Tieren pflegte,<br />
darüber hinaus einen bösen Blick hatte, unter<br />
erblicher Tuberkulose litt usw. Der Erzherzog<br />
soll an nur einem einzigen Tag irgendwo<br />
in Tschechien über zweitausendeinhundertfünfzig<br />
kleine Wildtiere erlegt haben – das ist<br />
nur eine von den bizarren Informationen, die<br />
die Autorin anführt. Es war bestimmt nicht<br />
leicht, die unschuldigen, kraftlosen wilden Tiere<br />
abzuzählen, die dem Erzherzog-Terminator<br />
zum Opfer gefallen waren. Die unverhohlene<br />
Botschaft dieses fragwürdigen Texts lautet,<br />
der Erzherzog habe gewiss den Tod verdient,<br />
daran bestünde kein Zweifel. Indem Princip<br />
auf ihn schoss, habe er die Menschheit von einem<br />
erbarmungslosen Mörder erlöst. Der Text<br />
von Rebecca West ist typischer lobbyistischer<br />
Müll, gerammelt voll mit Vorurteilen aller Art.<br />
Deshalb ist es jammerschade, dass die Autorin<br />
schon verstorben ist, weil man große Lust hätte,<br />
sie auf die Größe eines Atoms zu zerlegen.<br />
Ganz anders dagegen der Text „Die ersten<br />
Stunden des Krieges von 1914“ von Stefan<br />
Zweig, der nach all den Jahren noch immer seinen<br />
Glanz bewahrt hat. Zweig setzt sich darin<br />
mit der medialen Hysterie auseinander, die in<br />
Österreich und Deutschland nach dem Attentat<br />
von Sarajevo ausbrach. In erster Linie nimmt<br />
er Schriftsteller, Dichter, Maler, Musiker, Wissenschaftler<br />
und Philosophen unter die Lupe,<br />
Geistesmenschen, die von einer unermesslichen<br />
Paranoia befallen wurden. Rührend-grotesk<br />
mutet das Beispiel des deutsch-jüdischen<br />
Dichters Ernst Lissauer und seines Gedichtes<br />
„Haßgesang gegen England“ an. Zweig schreibt:<br />
„Das Gedicht fiel wie eine Bombe in ein Munitionsdepot.<br />
Nie vielleicht hat ein Gedicht<br />
in Deutschland, selbst die ‚Wacht am Rhein‘<br />
nicht, so rasch die Runde gemacht wie dieser<br />
berüchtigte ‚Haßgesang gegen England‘. Der<br />
Kaiser war begeistert und verlieh Lissauer den<br />
Roten Adlerorden, man druckte das Gedicht in<br />
allen Zeitungen nach, die Lehrer lasen es in den<br />
Schulen den Kindern vor, die Offiziere traten<br />
vor die Front und rezitierten es den Soldaten,<br />
bis jeder die Haßlitanei auswendig konnte.“<br />
Bereits im Jahr 1919 ist Lissauer eine peinliche<br />
Gestalt, für die Medien ist er nicht länger<br />
interessant, seine Freunde haben sich von ihm<br />
abgewandt, und schließlich vertreibt ihn Hitler<br />
aus Deutschland. Er stirbt, von allen vergessen.<br />
Zweig schreibt, auch alle anderen seien<br />
wie Lissauer gewesen, die Denker und die Professoren.<br />
Aus dieser Menge nimmt er lediglich<br />
Rainer Maria Rilke aus. Bis ans Ende meiner<br />
Tage werde ich Zweig dankbar sein, und zwar<br />
wegen der Novelle „Brief einer Unbekannten“,<br />
die ich im Frühsommer des Jahres 1992 las, eines<br />
Jahres, das für meine Generation und mein<br />
Land eine ähnliche Bedeutung haben sollte wie<br />
für viele andere das Jahr 1914. Allerdings mit<br />
dem Unterschied, dass in unserem Fall hier niemand<br />
ein Attentat gegen den Herrscher eines<br />
benachbarten Landes verübt hatte. Niemand<br />
hatte einen Schuss für Heimat, Ruhm, Ehre<br />
oder Freiheit abgegeben, und trotzdem startete<br />
Serbien eine großangelegte Militäraktion mit<br />
dem Ziel, Bosnien und Herzegowina an die damalige<br />
Bundesrepublik Jugoslawien anzugliedern,<br />
weil die Führung der bosnischen Serben<br />
im Falle einer Unabhängigkeitserklärung Bosnien<br />
und Herzegowinas mit Krieg drohte. Es ist<br />
eine lange Geschichte, inzwischen ermüdend<br />
für uns alle, die wir am eigenen Leib den Zauber<br />
des „freiheitsliebenden Geistes“ von Radovan<br />
Karadžić zu spüren bekommen haben, der, wie<br />
es hieß, Gavrilo Princip und seinen Kumpanen<br />
alle Ehre machte. Karadžić und seine Kumpane<br />
wiederum machten sich nur durch ihre Genozidgelüste<br />
einen Namen.<br />
Zweigs Novelle las ich in einem Hangar, in<br />
dem früher eine Viehwirtschaft untergebracht<br />
gewesen war. Zu Beginn „unseres“ Jahres 1914<br />
befand sich dort eine Kaserne. Dort lernten wir,<br />
uns gegen einen bis an die Zähne bewaffneten<br />
Gegner zu verteidigen. Es handelte sich um einen<br />
Aggressor, der seinen militärischen Ruhm<br />
unter anderem auf die Entschlossenheit von<br />
Princips Hand zurückführte, einer Hand, die<br />
am 28.06.1914 einige Patronen auf den Erzherzog<br />
und die Erzherzogin abgefeuert hatte.<br />
Ich erinnere mich an eine Fernsehserie aus<br />
dem ehemaligen Jugoslawien, in der es um das<br />
Phänomen „Junges Bosnien“ und Gavrilo Princip<br />
ging. Es gab eine Szene, in der Princip von der<br />
Brücke sprang, die damals noch nicht nach ihm<br />
benannt war, mitten in die seichte Miljacka. Ich<br />
weiß noch, dass er mir damals leidtat, weil ich<br />
so erzogen worden war, den Kampf der Schwächeren<br />
gegen die Stärkeren zu respektieren. Ich<br />
war vollkommen davon überzeugt, dass man<br />
auf der Seite der Schwächeren stehen müsse,<br />
obwohl die Geschichtsschreibung die Besiegten<br />
links liegen lässt. Ich glaubte daran, dass eine<br />
Idee sich nicht töten lässt. Ich glaubte auch an<br />
die jugoslawische Idee, an die ich seit 1992 nicht<br />
mehr glaube und an die ich nie wieder glauben<br />
werde, obwohl sie Teil meiner Identität ist, wie<br />
eine kulturologische Variable, ein Relikt, das<br />
ich nicht loswerden kann und auch nicht loswerden<br />
will. Die Bitterkeit, die ich angesichts<br />
der Tatsache verspüre, dass meine antifaschistischen<br />
Großväter ein sozialistisches Jugoslawien<br />
aufgebaut und dabei ihre Körperteile<br />
riskiert hatten, jahrelang in Konzentrationslagern<br />
des Unabhängigen Kroatischen Staates interniert<br />
waren – diese Bitterkeit ist unheilbar,<br />
weil es ein unumstößliches Faktum ist, dass wir<br />
in Bosnien und Herzegowina ausgerechnet von<br />
jener Armee überfallen wurden, die meine Vorfahren<br />
gemeinsam mit zehntausenden anderen<br />
Antifaschisten im Laufe des Zweiten Weltkrieges<br />
mit aufgebaut hatten. Einer meiner Großväter,<br />
ein Partisan und Kriegsinvalide, der an der<br />
Sremer Front verwundet worden war, starb als<br />
Flüchtling in Zagreb, während er in einem Auto<br />
saß, das ihn zu einer arabischen humanitären<br />
Organisation fuhr, wo er humanitäre Hilfe bekommen<br />
sollte. Der Mann starb im Auto, an<br />
Elend und Erniedrigung, ohne ein Heim. Das<br />
hatten ihm nämlich in den ersten Tagen des<br />
Krieges die Nachkommen seiner Kriegskameraden<br />
angezündet. Mein Großvater glaubte bis<br />
zum Schluss an die Kommunistische Partei, der<br />
er sich mit Herz und Seele verschrieben hatte.<br />
Der Zusammenbruch Jugoslawiens und der<br />
jugoslawischen Idee tötete indirekt unzählige<br />
naive und unschuldige Menschen und tötet sie<br />
weiterhin.<br />
Aus diesem Grund interessiert mich das<br />
Jahr 1914 nicht so besonders. Mir genügt „mein“<br />
Krieg, über den ich mir bis an mein Lebensende<br />
den Kopf zerbrechen werde, im Bemühen, ihn<br />
zumindest auf irgendeiner Ebene zu begreifen,<br />
wonach ich bislang nach bestem Wissen und<br />
Gewissen auch in meiner literarischen Arbeit<br />
strebe. Mit Gavrilo Princip mögen sich die Historiker<br />
befassen, das ist ihre Aufgabe. Über ihn<br />
könnte ich dasselbe sagen wie das, was Miljenko<br />
Jergović einmal über den Tschetnik-Anführer<br />
Draža Mihailović gesagt hat: „Für mich ist er<br />
weder positiv noch negativ, sondern eine dreidimensionale<br />
Persönlichkeit mit einer tragischen<br />
Biographie, für die ich trotz allem ein Stückchen<br />
Empathie übrig habe. Denn nur ein junger Mann<br />
ohne Lebenserfahrung kann plötzlich zum Revolutionär<br />
und Terrorist werden.“<br />
Senadin Musabegović, ein Dichter und Essayist<br />
aus Sarajevo, schreibt in seinem Buch Der<br />
Krieg – die Konstitution des totalitären Körpers,<br />
dass wir noch immer das Schützengrabentrauma<br />
des Ersten Weltkrieges erleben und dass Europa<br />
sich noch immer nicht von den enormen Verlusten<br />
an Menschenleben aus der damaligen Zeit<br />
erholt hat. Weiter schreibt er, „unser“ Krieg sei<br />
nur eine der vielen Folgen des Großen Krieges<br />
vom Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts.<br />
Fast hätte ich vergessen, wie dieser „unsere“<br />
Krieg begonnen hat, nämlich fast genauso<br />
wie der Erste Weltkrieg. Der Angeklagte in Den<br />
Haag Radovan Karadžić gab die Ermordung eines<br />
serbischen Hochzeitsgastes in der Altstadt<br />
„Baščaršija“ als Hauptgrund für die Bombardierung<br />
und den Granatenbeschuss Sarajevos an.<br />
So begann also „unser“ Krieg, aus der Perspektive<br />
eines gestörten Geistes betrachtet. Dabei<br />
hatte der Krieg noch viel früher begonnen, vorbereitet<br />
durch die Belgrader Medien, und zwar<br />
mit denselben Mechanismen, über die Stefan<br />
Zweig geschrieben hat. Es ist ein Krieg, dessen<br />
Ende noch gar nicht abzusehen ist.<br />
Aus dem Bosnischen von<br />
Mascha Dabić<br />
Faruk Šehić<br />
Geboren 1970 in Bihać / Bosnien und Herzegowina;<br />
lebt in Sarajevo. Er gehörte der Armee<br />
Bosniens und Herzegowinas an (1992-1995).<br />
Einmal wurde er schwer verwundet. Für Das<br />
Buch über die Una erhielt er den Literaturpreis<br />
der Europäischen Union EUPL 2013. Auf<br />
Deutsch ist sein Gedichtband Abzeichen aus<br />
Fleisch erschienen (Edition Korrespondenzen,<br />
2011; Ü.: Hana Stojić).<br />
Beton International März 2014 23
Ivana Simić Bodrožić<br />
Des Krieges gedenken<br />
An einem kühlen Oktobermorgen des Jahres<br />
2013 ging um sechs Uhr vierzig ein anonymer<br />
Telefonanruf bei der Polizeiwache in Vukovar<br />
ein. Die Stimme am anderen Ende der<br />
Leitung behauptete, in der technischen Mittelschule<br />
sei eine Bombe versteckt. Die Polizei<br />
evakuierte das Gelände umgehend, die Schüler<br />
durften nach Hause oder in die umliegenden<br />
Cafés gehen, einige Neugierige harrten in der<br />
Nähe des Schulhofs aus. Auf Sprengstoff trainierte<br />
Spürhunde suchten jeden Winkel ab und<br />
fanden zum Glück nichts. Etliche Journalisten<br />
versuchten unterdessen, brauchbare Informationen<br />
zu erhaschen.<br />
„Wir hatten keine Angst, weder ich noch<br />
meine Klassenkameraden. Wir wollten sofort<br />
wieder in den Unterricht, aber die Polizei hat<br />
es nicht erlaubt“, sagte ein Sechzehnjähriger einige<br />
Stunden nach dem Vorfall in ihre Kameras<br />
und Fotoapparate. Er sprach als Einziger mit<br />
den Journalisten, außer ihm wollte sich keiner<br />
äußern. Der junge Mann bot den Profis sogar<br />
(off the record) Bilder von seinem Handy an,<br />
die Polizisten beim Durchkämmen des Schulgeländes<br />
zeigten – kein Wunder angesichts der<br />
Umstände, in denen die „Bombenkrise“ spielt.<br />
Trotzdem reagierten viele überrascht, als<br />
sich am folgenden Tag herausstellte, dass eben<br />
jener Sechzehnjährige die ganze Aufregung<br />
verursacht und die Polizei auf den Plan gerufen<br />
hatte. Seit Monaten herrschte in Vukovar, der<br />
Grenzstadt eines Vollmitglieds der Europäischen<br />
Union, eine nach Meinung kritischer Beobachter<br />
hausgemachte Krise. Die Stadtverwaltung<br />
brachte an allen öffentlichen Einrichtungen zusätzliche<br />
kyrillische Schilder an (als verbrieftes<br />
Recht der serbischen Minderheit, die heute 33%<br />
der Bevölkerung stellt), aber kroatische Bürger,<br />
Angehörige der nationalen Mehrheit, zerstörten<br />
sie ein ums andere Mal. Vorangegangen waren<br />
fünfzehn Jahre totaler Trennung beider Bevölkerungsgruppen<br />
von frühester Kindheit an, und<br />
davor hatte es einen Krieg gegeben, der über<br />
3500 Menschenleben in dieser Stadt forderte<br />
und dessen Gründe wiederum weit in die Vergangenheit<br />
zurückreichen…<br />
In diesem Milieu wuchs unser junger Held<br />
oder Terrorist mit seinen sechzehn Jahren auf.<br />
Für ihn wurde ein serbischer oder kroatischer<br />
Kindergarten ausgesucht, dann kam er in eine<br />
serbische oder kroatische Klasse, welche, wissen<br />
wir nicht. Er frequentiert entweder serbische<br />
oder kroatische Kneipen und so weiter.<br />
Sofern es sich um einen jungen Serben handelt,<br />
dürfte er sich von der permanenten Zerstörung<br />
der kyrillischen Schilder angegriffen und<br />
stigmatisiert fühlen, ist er hingegen ein junger<br />
Kroate, hat seine Familie aller Wahrscheinlichkeit<br />
nach tragische Dinge erlebt und er besucht,<br />
seit er denken kann, die Gräber enger Verwandter.<br />
Dazu kommt, dass er – egal, welcher Bevölkerungsgruppe<br />
er angehört – nach Abschluss<br />
der Schule in einer Stadt mit Rekordarbeitslosigkeit<br />
kaum Perspektiven hat.<br />
Aus den genannten Gründen versammelte<br />
sich vor der technischen Mittelschule eine<br />
größere Journalistengruppe; sie alle und auch<br />
wir, die wir ihre Berichterstattung verfolgten,<br />
interpretieren die Vorfälle auf ihre Weise. Wäre<br />
tatsächlich eine Bombe gefunden worden, wäre<br />
der junge Mann über den anonymen Telefonanruf<br />
hinausgegangen, hätte es in dieser angespannten<br />
Situation gar Opfer gegeben, wäre<br />
eine beispiellose Lawine losgebrochen. So blieb<br />
es bei einem Psychologen, der an jenem Tag<br />
nachmittags in einer Fernsehsendung zu Gast<br />
war und von den Auswirkungen der Krise, dem<br />
wachsenden Nationalismus und dem enormen<br />
Druck redete, der auf den Jugendlichen laste.<br />
Mich interessierte allerdings vor allem ein Satz,<br />
der eher beiläufig in dem Nachrichtenbeitrag<br />
gesendet wurde: Der junge Mann war nämlich<br />
unter anderem gefragt worden, warum seiner<br />
Meinung nach jemand so was mache. Wahrscheinlich,<br />
so antwortete er, habe jemand eine<br />
Klassenarbeit verhindern wollen. Ja, klar, dachte<br />
ich. Der Junge ist sechzehn. Mit sechzehn<br />
geht man durchaus auch einen Schritt weiter,<br />
und sei es wegen einer dummen Klassenarbeit.<br />
Wäre die Sache dann tatsächlich eskaliert und<br />
jemand dabei umgekommen, wäre er nicht länger<br />
sechzehn. Faktisch natürlich schon, aber<br />
seine Tat wäre in einer Weise interpretiert worden,<br />
wie er es sich weder mit sechzehn noch mit<br />
siebzehn oder achtzehn jemals hätte vorstellen<br />
können oder träumen lassen.<br />
Vor genau hundert Jahren war Gavrilo Princip,<br />
als er auf den Thronfolger und seine Gattin<br />
schoss, gerade mal siebzehn. Ihn allen Ernstes<br />
als Helden zu verehren oder als Terroristen zu<br />
verdammen, ist im Grunde lachhaft. Die Wahrheit<br />
wird nicht gefunden, sondern gemacht, hat<br />
mal jemand gesagt. In seinem Alter steckte der<br />
Attentäter wohl mitten in schmerzlichen Abnabelungsprozessen,<br />
war vielleicht von der Schule<br />
geworfen und aus der Gesellschaft ausgeschlossen<br />
worden, wollte sich aus Bevormundung befreien<br />
oder einfach irgendwo dazugehören und<br />
Aufmerksamkeit erregen, wie alle Teenager, die<br />
historisch von sich reden machten. Wir werden<br />
es nie erfahren. Aber heute, hundert Jahre nach<br />
seiner Tat, überschlägt sich alle Welt wegen<br />
des Jubiläums. Dabei hat dieser Krieg weder<br />
damals angefangen noch vier Jahre später aufgehört.<br />
Er hat lediglich den Ort gewechselt, der<br />
Brandherd hat sich verlagert, die Glut erlischt<br />
hier nur, um anderswo wieder aufzuflammen,<br />
und die Energie, die dabei frei wird, ermöglicht<br />
allen nicht unmittelbar Betroffenen, Nutzen<br />
aus dem Krieg zu ziehen.<br />
Eine ganze Industrie lebt davon, siebzehnjährigen<br />
Kindern Eigenschaften zuzuschreiben,<br />
die sie unmöglich gehabt haben können,<br />
die Industrie braucht eben Material, Historiker,<br />
Schriftsteller, Biografen, Theatermacher, Veranstalter<br />
von Gedenkfeiern, Catering-Anbieter,<br />
Kostümbildner, Redenschreiber, Philharmoniker,<br />
Fotografen im öffentlichen Auftrag, der<br />
diplomatische Chor samt Stellvertretern und<br />
Sekretärinnen, Fahrer sowie Straßenfeger für<br />
den Morgen danach wollen versorgt sein. Die<br />
Profiteure waren zum größten Teil nie selbst<br />
im Krieg, ausgenommen jene, die die letzten<br />
Kriege bei uns erlebt haben. Jedes Detail wird<br />
aufmerksam erörtert, leidenschaftlich über die<br />
Zugehörigkeit des jungen Mannes zu terroristischen<br />
Vereinigungen gestritten, ohne groß<br />
Beweise in der Hand zu haben; alle beteiligen<br />
sich an der Diskussion, Historiker, Nationalisten<br />
und Künstler, und kaum einer merkt, dass<br />
unter ihren Augen eine neue Generation heranwächst,<br />
für die sich eigentlich niemand verantwortlich<br />
fühlt. Viel hat sich verändert und<br />
nichts hat sich geändert, die Leute brauchen<br />
halt Jubiläen, und sei es die Hundertjahrfeier<br />
eines Krieges. Sie brauchen wir vielleicht am<br />
dringendsten, wir huldigen ja dem Irrglauben,<br />
schlauer zu sein als vor hundert Jahren, etwas<br />
aus der Geschichte gelernt zu haben. Doch die<br />
Menschheit dreht sich im geschlossenen Kreis,<br />
und diese bittere Einsicht ist vielleicht das Äußerste,<br />
was uns die Geschichte lehrt. Jedes Erwachen<br />
ist wie ein einziger Tag, wir verpassen<br />
uns selbst, unser eigenes Schicksal, und die<br />
Chancen stehen gut, dass uns eines fernen Tages<br />
im Jahre 2114 dieselbe Aufmerksamkeit zuteil<br />
wird, eine Betrachtung, die nichts mit uns<br />
zu tun hat und genauso naiv wie zu allen Zeiten<br />
die menschliche Dummheit feiert.<br />
Aus dem Kroatischen von<br />
Brigitte Döbert<br />
Ivana Bodrožić<br />
Geboren 1982 in Vukovar, lebt in Zagreb. Der Roman<br />
Hotel Zagorje ist 2010 erschienen (dt. unter<br />
dem Titel Hotel Nirgendwo im Zsolnay Verlag,<br />
2012, Ü.: Marica Bodrožić). Auf Deutsch ist sie in<br />
der Anthologie der kroatischen Poesie Konzert<br />
für das Eis (Verlag Wunderhorn, 2010, interlineare<br />
Übersetzung: Alida Bremer) vertreten.<br />
Jeton Neziraj<br />
Ein Albaner auf dem<br />
Begräbnis von Franz<br />
Ferdinand<br />
Ich kenne die Geschichte gut. Gar kein Problem.<br />
Dann vergesse ich das Gespräch für einige<br />
Monate, bis er mich wieder fragt:<br />
„Jeton, hast du den Text schon fertig“<br />
Erst jetzt nehme ich es ernst. Ich fange an,<br />
nachzudenken. Ich stelle fest, dass ich in Wirklichkeit<br />
sehr wenig weiß. Die ersten verworrenen<br />
Bilder, die mir einfallen, stammen aus<br />
einem Film, den ich irgendwann mal gesehen<br />
habe. Ich "sehe" einen Mann und eine Frau, wie<br />
sie entspannt durch die Straßen von Sarajevo<br />
fahren, und am Rand sehe ich andere Männer<br />
und Frauen, die ihnen Beifall klatschen und<br />
Blumen zuwerfen. Dann tritt aus der Menge<br />
Gavrilo Princip heraus, ein kleiner Kerl, mit einer<br />
Pistole, und schießt „im Namen des Volkes“<br />
auf die beiden. Das Opfer, Franz Ferdinand, fällt<br />
mit aufgerissenen Augen zu Boden. Die Frau,<br />
die Herzogin Sophie, lässt die Blumen fallen<br />
und wirft sich über den Körper ihres sterbenden<br />
Mannes …<br />
„Stirb nicht, stirb nicht …“<br />
Franz Ferdinand stirbt.<br />
Mehr weiß ich nicht. Natürlich weiß ich<br />
noch, dass es danach zu einem großen Schlamassel<br />
kam: dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.<br />
Aber dieses Wissen reicht nicht. Ich<br />
habe ein Problem. Alle diese Dinge sind bekannt<br />
und ich kann keinen Essay schreiben, der<br />
etwas Neues beleuchten würde. Ich kann nicht<br />
einmal eine Erzählung schreiben und noch weniger<br />
eine Theaterszene.<br />
Ich brauche einen Raki.<br />
Ein österreichischer Erzherzog, ein serbischer<br />
Terrorist… Sarajevo… Nichts Außergewöhnliches,<br />
was die Fantasie eines albanischen<br />
Schriftstellers reizen würde. Ich müsste in dieser<br />
Geschichte einen albanischen „Aufhänger“<br />
finden. Es wäre schön, wenn zum Beispiel dieser<br />
Franz Ferdinand albanischer Herkunft wäre<br />
… Hmmm. Scheint nicht glaubwürdig zu sein.<br />
Ich muss weiter nachdenken. Also, der Großvater<br />
von Gavrilo Princip war in Wirklichkeit ein<br />
Albaner… Hmmm… Hmmmm! Oder noch besser:<br />
Gavrilo Princips behandelnder Arzt sagte<br />
ihm eines Tages: „Mein Junge, es steht schlecht<br />
um dich, du hast nicht mehr lange zu leben. Was<br />
möchtest du in den dir noch verbleibenden Jahren<br />
und Monaten machen“ Der traurige Gavrilo<br />
antwortete: „Nichts, weil ich nicht weiß, was<br />
ich machen soll. Ich warte einfach auf den Tod.“<br />
Da fragte ihn sein Arzt: „Warum gehst du nicht<br />
auf die Straßen von Sarajevo und tötest einen<br />
Albaner“ „In Sarajevo Einen Albaner Wie<br />
denn das“, antwortete Gavrilo.<br />
In der folgenden Nacht bekam Gavrilo erhöhte<br />
Temperatur. Schweißausbruch, dann<br />
Fieber, dann Schweißausbruch, dann einen<br />
leichten Husten und… Etwas bewegte sich in<br />
seinem Gehirn, wie ein Ruf, wie eine Botschaft.<br />
Nach dem Gespräch mit dem Arzt über die Aussicht<br />
auf nur noch wenige Monate Leben oder<br />
höchstens einige Jahre war Gavrilo durcheinandergekommen.<br />
In dieser Nacht schwor er Stein und Bein:<br />
Wenn ich keinen Albaner in Sarajevo töte, dann<br />
den Chef der österreichischen Armee! Das Märchen<br />
erzählt weiter, dass…<br />
Während ich mich bei Kerzenlicht am Computer<br />
abmühe, fällt mir die Geschichte eines jungen<br />
Albaners, des Patrioten Avni Rustemi ein,<br />
der am 13. Juni 1920 im Hotel Continental in Paris<br />
den Verräter Esat Pashë Toptani erschossen<br />
hat. Also, Avni nenne ich einen Patrioten, Esat einen<br />
Verräter. Heute. So haben wir es zumindest<br />
aus den Geschichtsbüchern gelernt. Aber die<br />
Dinge können sich in der Zukunft ändern. Die<br />
Rollen können sich ändern, wie es in der Vergangenheit<br />
so oft geschehen ist. Gott, was für eine<br />
Aufregung würde es geben, wenn man Avni Rustemi<br />
des Terrorismus beschuldigte Avni Rustemi<br />
wurde im Unterschied zu Gavrilo Princip<br />
aus dem Hinterhalt ermordet, zwei Monate nach<br />
seinem Attentat in Paris, von einem Agenten des<br />
albanischen Königs Ahmet Zogu. Das soll mal einer<br />
verstehen. Ich denke mir, dass es merkwürdig<br />
ist, dass die albanische Regierung für Ahmet<br />
Zogu, den wir bis zuletzt für einen Verräter gehalten<br />
hatten, letztes Jahr eine Büste errichtet<br />
hat! Sie sollten wissen, dass Avni Rustemi weder<br />
zum Verräter, noch zum Terroristen erklärt wurde.<br />
Er ist der Held. Und König Zogu ist auch nicht<br />
so schlecht dran. Er wurde nicht zum Helden erklärt,<br />
aber er bekam eine Büste.<br />
Deshalb brauchen sich die Serben nicht unwohl<br />
zu fühlen, wenn sie zum Beispiel Gavrilo<br />
Princip als Helden betrachten, während ihn fast<br />
die ganze übrige Welt als Terroristen ansieht.<br />
Das ist etwas Normales. So wie es normal sein<br />
wird, wenn es sich zum Beispiel eines Tages<br />
ändert. Wenn die ganze Welt ihn (Princip) als<br />
Helden betrachtet und die Serben als Verräter.<br />
Oder so ähnlich!<br />
Wer hat gesagt, dass die Verräter von heute<br />
morgen Scheiße sein werden (und übermorgen<br />
Helden) He<br />
Aber natürlich, noch ein Glas Raki!<br />
Aber ich komme noch einmal zurück auf die<br />
Geschichte. Oh, ich wusste nichts von dieser<br />
Geschichte. Das Internet hilft mir nicht richtig.<br />
Wikipedia bietet ein paar trockene Informationen,<br />
die mich nervös machten. Andere Seiten<br />
im Web enthalten ein paar Fotos, Daten, Informationen<br />
über Gavrilo, wo er geboren ist, wo er<br />
gestorben ist und wie sehr er das Vaterland geliebt<br />
hat, mehr nicht.<br />
Ich bin bereit, aufzugeben, und dem Redakteur<br />
zu schreiben: „Nein, mein Freund, ich weiß<br />
es nicht, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht…<br />
Ich bin nicht in der Lage, etwas Brauchbares zu<br />
schreiben. Sollen es die Serben oder die Österreicher<br />
schreiben oder auch die Bosnier.“<br />
Schlaflose Nächte. Gavrilo erscheint mir im<br />
Traum. Mal allein und mal mit dem albanischen<br />
Patrioten Avni Rustemi. Dann träume ich von<br />
Franz Ferdinand, von der Herzogin …<br />
„So this is how you welcome your guests –<br />
with bombs!“, sagte Erzherzog Franz Ferdin-<br />
and zum Bürgermeister Čurčić, der für ihn die<br />
Willkommensrede hielt. Der Erzherzog wird<br />
gestresst gewesen sein. Natürlich. Kurz zuvor<br />
war eine Bombe in seiner Nähe geworfen worden.<br />
Er war entkommen, aber jetzt zitterte er,<br />
vor Angst, vor Traurigkeit, vor Zorn …<br />
„… Eine Bombe… Sie haben mich mit einer<br />
Bombe empfangen…“<br />
Dann flüsterte ihm die Herzogin ins Ohr:<br />
„Lass ihn weiterreden. Du machst dich lächerlich.<br />
Er ist unschuldig.“<br />
Irgendwie so. Oder sie könnte zu ihm gesagt<br />
haben:<br />
„Zeig keine Schwäche. Lass ihn weiterreden<br />
und entbinde ihn dann seines Postens...“<br />
Der einzige Zeuge dieser ins Ohr geflüsterten<br />
Worte, Franz Ferdinand, wurde kurz darauf<br />
ermordet. Ihre Wahrhaftigkeit ist also reine<br />
Spekulation. Es ist eine Re-Konstruktion, wie<br />
in den englischen Dokumentarfilmen, die sich<br />
zum Beispiel bemühen, das Niederbrennen von<br />
Troja oder etwas Ähnliches zu rekonstruieren,<br />
wovon wir nicht so viel wissen.<br />
Aber kommen wir noch einmal zum Flüstern<br />
der Herzogin zurück.<br />
„Unterbrich ihn nicht, damit er schnell fertig<br />
ist. Ich muss Wasser lassen.“<br />
Oder vielleicht:<br />
„Du wolltest nicht auf mich hören, als ich<br />
dir sagte, dass wir nicht in diesen gottvergessenen<br />
Ort fahren sollen. Jetzt musst du die Demütigungen<br />
ertragen.“<br />
Der Erzherzog beruhigte sich wieder, und<br />
der Bürgermeister Čurčić beendete seine Rede.<br />
Schwacher Beifall.<br />
„Albaner, Albaner …“, brülle ich im Traum.<br />
Wo sind die Albaner in dieser Geschichte<br />
Ich gebe auf. Es gibt keine Albaner. Es gibt<br />
keinen Text. Warum sollte ich mich mit etwas<br />
quälen, was zu tun ich anscheinend nicht imstande<br />
bin. Alles ist gesagt worden, und es haben<br />
die Schriftsteller jener Nationen gesagt, die<br />
durch diese Geschichte verbunden sind. Jetzt<br />
haben auch die Albaner einen Teil der Rechnung<br />
für den Schlamassel von Princip bezahlt,<br />
aber es ist nicht das erste Mal, dass wir für den<br />
Schlamassel anderer bezahlen (hu, wie kann ich<br />
nur so etwas denken!).<br />
Warte ein wenig, sage ich mir. Schließe die<br />
Augen für einen Augenblick und denke an den<br />
kritischen Moment. Franz Ferdinand wird von<br />
der Pistole in der grausamen Hand Gavrilo<br />
Princips getroffen. Die Herzogin kauert im Sitz<br />
Beton International März 2014 24
des Phaetons. Franz Ferdinand sinkt in sich zusammen<br />
und droht aus dem Wagen zu fallen.<br />
Der Fahrer hält an. Die Wachen stürzen sich auf<br />
Gavrilo und reißen ihm die Pistole aus der Hand.<br />
Einer Passantin fällt der Hut aufs Pflaster.<br />
„Oh, mein Hut“, schreit die Dame.<br />
Die Herzogin wirft sich auf den sterbenden<br />
Franz Ferdinand, fasst ihn am Kragen und bittet<br />
ihn tränenüberströmt, nicht zu sterben…<br />
„Stirb… nicht… “<br />
Die Wachen ergreifen die Herzogin und ziehen<br />
sie weg. Sie schreit und wehrt sich.<br />
„Noch ein Wort… Ich will ihm noch ein Wort<br />
sagen… Lasst mich los, ihr Bastarde, ihr habt ihn<br />
nicht beschützt.“<br />
Die Frau, der gerade der Hut heruntergefallen<br />
ist, schreit:<br />
„Oh, mein Hut… Oh, mein Hut.“<br />
Ich trinke. Aus Verzweiflung. Aus Trübsinn.<br />
Ein Albaner, ein Albaner… Ein Königreich für<br />
einen Albaner!<br />
Aber dann gebe ich zerschmettert auf. Ich<br />
verzichte auf den Wunsch, die Implikation eines<br />
Albaners in dieser Geschichte zu finden.<br />
Mission impossible.<br />
Ich forsche im Internet, zum letzten Mal.<br />
Das Begräbnis von Franz Ferdinand. Ich hoffe,<br />
dass es wenigstens dort einen Albaner gegeben<br />
haben mag. Das muss doch möglich sein. Ich sage<br />
mir, das muss ein großartiges Begräbnis gewesen<br />
sein. Der Erzherzog hat es verdient. Schluss- und<br />
letztendlich war sein Leben so wertvoll, dass es<br />
den Ersten Weltkrieg verursacht hat. Deshalb<br />
muss auch sein Begräbnis außerordentlich gewesen<br />
sein. Aber das Internet treibt mich in die<br />
Verzweiflung, schon wieder, wer weiß zum wievielten<br />
Mal. Was ich darin lese, ist furchtbar.<br />
Ganz die Geschichte dieser Wiener Bastarde, die<br />
ihm aus persönlichem Trotz kein menschliches<br />
Begräbnis erlaubt haben, wegen einer… wegen<br />
einer Herzogin, die von der grausamen Hand eines<br />
serbischen Analphabeten ermordet wurde.<br />
Ein Albaner… ein Albaner auf dem Begräbnis<br />
von Franz Ferdinand. Es muss einen gegeben haben…<br />
Tut es für mich. Bitte gebt mir einen Albaner<br />
in dieser Geschichte…! Please… Bitte…<br />
Ich sehe verworren. Der Raki hat sein Werk<br />
getan. Basta, sage ich. Das war´s. Es gibt keinen<br />
Text, definitiv. Morgen schreibe ich dem bescheuerten<br />
Redakteur...<br />
Kein Albaner, kein Text.<br />
Ich trinke trotzdem noch ein letztes Glas Raki.<br />
Aus dem Albanischen von<br />
Zuzana Finger<br />
Jeton Neziraj<br />
Geboren 1977 in Kacanik, Kosovo. Er ist Direktor<br />
des Multimedia Centers in Prishtina und war von<br />
2008 bis 2011 künstlerischer Leiter des Nationaltheaters<br />
im Kosovo. Er hat zahlreiche Bücher und<br />
Theaterstücke geschrieben, von denen viele bereits<br />
in mehrere Sprachen übersetzt wurden.<br />
Nenad Veličković<br />
Hasenscharte<br />
Wäre da nicht die Hasenscharte in seinem<br />
nagetierähnlichen Gesicht, könnte ich ihn heute<br />
in der Straßenbahn gar nicht inmitten der<br />
anderen Fahrgäste ausmachen. Ich würde mich<br />
auch nicht mehr an ihn erinnern, wäre da nicht<br />
jene unbändige Wut gewesen, mit der er damals<br />
in der Abenddämmerung ganz durchfroren aus<br />
seinem Hinterhalt zurückgekehrt war und gegen<br />
die Tschetniks und ihre Feigheit gezetert hatte.<br />
Seine Leute kamen manchmal zu unseren<br />
Vorderstellungen, immer nachts und immer<br />
allein, mit Snipergewehren, die sie zärtlich auf<br />
dem Schoß hielten wie Haustiere. Etwa hundert<br />
Schritte über unserem Schützengraben, im Niemandsland,<br />
bezogen sie kurz vor Morgengrauen<br />
Stellung in den Ruinen eines niedergebrannten<br />
gelben Hauses, mit Blick auf die Kaserne und<br />
das Leben darin. Ich bin noch nie dort hinaufgestiegen,<br />
weder nach dem Krieg noch heute, da<br />
die Frist abläuft, in der ich die Geschichte über<br />
das Jahr neunzehnhundertvierzehn zu Ende<br />
schreiben muss.<br />
Die Geschichte sollte von einem Wiener<br />
Paar handeln, nicht zwangsläufig Mann und<br />
Frau, die im Juni des nächsten Jahres nach Sarajevo<br />
kommen, um ihre erlahmte Beziehung<br />
wiederzubeleben, und zwar zu den Feierlichkeiten<br />
anlässlich des Attentats auf Sophie und<br />
Franz Ferdinand. (Ich habe keine klare Vorstellung<br />
davon, wie diese Feierlichkeit aussehen<br />
könnte, genauso wenig wie ich sicher bin, ob<br />
Feierlichkeit überhaupt das richtige Wort ist<br />
für diese Manifestation, bei der es darum geht,<br />
europäische Kulturfonds zu melken. Wie ich<br />
auch nicht sicher bin, ob die oben genannte Geschichte<br />
das ist, was Sie gerade lesen und was<br />
am selben Euter hängt.)<br />
Wie dem auch sei, in der Einleitung würde<br />
die Geschichte die beiden (Männer) auf ihrem<br />
Spaziergang durch die Stadt begleiten und damit<br />
auch die Stadt skizzieren, ganz im Zeichen<br />
des hundertjährigen Jahrestags; vielleicht würde<br />
sie, die Geschichte, mit ihnen gemeinsam in<br />
der Straßenbahn aus dem Wiener Museum fahren,<br />
die eigens aus diesem Anlass zusammen mit<br />
den eingespannten Lipizzanern nach Sarajevo<br />
gekarrt worden ist; oder sie würde mit ihnen<br />
durch den aufgrund der Anwesenheit von Diplomaten<br />
veredelten botanischen Garten des<br />
geschlossenen Landesmuseums schlendern,<br />
mit einem Glas Champagner in der Hand, mit<br />
dem auf die österreichischen Banken angestoßen<br />
wird; oder aber sie würden in orientalisch<br />
anmutenden Schuhen im Walzertakt auf dem<br />
Parkett der Olympiahalle „Zetra“ tänzeln, beim<br />
feierlichen gemeinsamen Konzert der Saraje-<br />
voer und der Wiener Philharmonie; oder im<br />
Hotel Europa mit dem Kopf nicken, im Rahmen<br />
eines wissenschaftlichen Symposiums zum<br />
Thema Vergangenheit und Zukunft. Die Helden<br />
dieser Geschichte würden bei „Željo“ Ćevapčići<br />
essen, sie würden beim Brunnen „Sebilj“ die<br />
Tauben füttern, türkischen Kaffee trinken und<br />
sich den Kaffeegenuss mit Tufahije versüßen,<br />
bis sich ihnen schließlich beim Alten Rathaus<br />
„Vijećnica“ die folgende Kulisse darbieten würde:<br />
ein aufgemaltes Automobil in Echtgröße,<br />
darin der Fahrer und das Thronfolgerpaar mit<br />
Löchern statt Köpfen, sodass die Touristen ihre<br />
Köpfe hindurch stecken und einen Tag lang Unmengen<br />
von „Likes“ auf Facebook ernten können.<br />
Einer von den beiden (es sollen doch zwei<br />
Männer sein, denn in diesem Kontext verfügt<br />
ein solches Stereotyp über eine beträchtliche<br />
literarische Potenz) soll sich von der Szenerie<br />
begeistert zeigen und darauf beharren, sich fotografieren<br />
zu lassen. Der andere findet die Kulisse<br />
widerlich, er denkt nicht einmal im Traum<br />
daran, seinen Kopf unter Sophies Hut zu stecken.<br />
Der Ältere der beiden findet die Leichtigkeit<br />
des Jüngeren zunehmend anstrengend, diese<br />
seine Oberflächlichkeit, die dazu imstande ist,<br />
das eigene Leben in ein Disneyland zu verwandeln,<br />
wodurch der Altersunterschied zu seinem<br />
Schaden immer größer wird, anstatt sich mit<br />
der Zeit zu verringern. Nach der ersten Verliebtheit<br />
hat sich der Nebel wie an einem sonnigen<br />
Morgen gelichtet, und der Ältere entdeckt im<br />
Jüngeren eine schmerzlich hohle Welt, unverbesserlich<br />
banal, ermüdend vorhersehbar; ein<br />
Optimismus, der sich aus dem Unwissen speist,<br />
eingepackt in einen geschmeidigen Wollknäuel,<br />
ein Bissen, der im Hals stecken bleibt wie ein<br />
Stück vom vergifteten Apfel.<br />
Der Jüngere will jedoch keineswegs aufgeben;<br />
für ihn ist es nicht das erste Mal, dass ihm<br />
die bleierne Ernsthaftigkeit auf seine Tanzschuhe<br />
steigt. Indessen liegt der ganze Reiz einer<br />
Beziehung genau darin begründet: der geliebten<br />
Mumie Leben einzuhauchen. Der Mensch –<br />
das ist nicht ein Sarkophag, gemeißelt aus dem<br />
Granit der Ethik, sondern ein Gesicht im Loch<br />
der Kulisse vor dem Alten Rathaus, verzerrt wie<br />
bei einem Karneval, in den Lauf eines Revolvers<br />
starrend wie in den Anus der Geschichtsschreibung.<br />
Die Windstöße der Geschichte durchkämmen<br />
unterdessen die Perücken auf den<br />
Wachspuppen des Thronfolgerpaars.<br />
Für ihn ist es lediglich amüsant und alles<br />
andere als widerlich, auf den Blutflecken zu<br />
stehen wie auf einem roten Teppich. Dort, etwa<br />
hundert Meter weiter, wurden zwei Menschen<br />
umgebracht, was in weiterer Folge Millionen<br />
von Menschen in den Abgrund zog, während er<br />
da steht und wie in einer Coca-Cola-Werbung<br />
lacht. Ihm sind sie alle einerlei, ob Mörder oder<br />
Opfer, es ist alles nur Zufall, jeder von ihnen ist<br />
lediglich eine Funktion im Narrativ, ein fluides<br />
Schicksal, beschmutzt durch die Berührung des<br />
Betrachters, Leerstellen in der Kulisse eines gelernten<br />
Malers. Kurz gesagt, alles eine Frage der<br />
Perspektive, nicht etwa der Tatsachen, der Gaskammern<br />
oder der in Erdlöchern verscharrten<br />
Knochen. Nur von der Perspektive, und nicht<br />
etwa von den Bleikugeln im Bauch der schwangeren<br />
Frau, hängt es ab, ob Gavrilo Princip ein<br />
Mörder ist oder ein Held.<br />
An dieser Stelle der Geschichte kommt gemeinsam<br />
mit Princip auch Hasenscharte ins<br />
Spiel.<br />
Wir schreiben einen der Kriegswinter Anfang<br />
der neunziger Jahre, auf der Linie über<br />
Sarajevo, in einer silberfarbenen Landschaft,<br />
so ruhig wie eine eingefrorene Bildaufnahme.<br />
Hasenscharte hat sich im halbzerstörten gelben<br />
Haus verschanzt, wie eine Raupe im Schlafsack,<br />
und beobachtet durch das optische Visier<br />
aufmerksam das Geschehen. Gestern wurde<br />
ihm gemeldet, dass ein Stück der schützenden<br />
Nylonfolie vom Wind abgerissen worden war.<br />
Damit ist nun der Blick frei auf die Bewegungen<br />
in der Kaserne. In der Tat, gebückte Gestalten<br />
laufen immer wieder durch den ungeschützten<br />
Raum, tauchen auf und verschwinden eine oder<br />
zwei Sekunden später.<br />
Hasenscharte wartet geduldig darauf, dass<br />
die Wintersonne sich durch den morgendlichen<br />
Nebel beißt, die durchgefrorenen Spatzen<br />
aufweckt und die übertriebene Wachsamkeit<br />
einlullt.<br />
Endlich taucht die Zielscheibe auf, eine<br />
Gestalt, die sich geradezu sorglos langsam bewegt,<br />
eine gerade Haltung einnimmt und davon<br />
überzeugt ist, dass der Krieg ganz einfach<br />
aufhört, wenn man beschließt, ihn zu ignorieren.<br />
Mit einem wundersamen und ganz und<br />
gar autodidaktischen chirurgischen Talent gibt<br />
Hasenscharte einen Schuss ab und sieht zu, wie<br />
der Mann zu Boden fällt und sich wie ein Wurm<br />
am Angelhaken um seinen durchschossenen<br />
Bauch windet. Er ist tot, wenn auch noch nicht<br />
ganz, nicht sofort, aber das weiß niemand außer<br />
dem Sniper, der darauf wartet, dass andere<br />
ihm zu Hilfe eilen, sodass er den ersten Toten<br />
unter ihren Leichnamen begraben kann. Sein<br />
Finger am Abzug friert, in den feuchten Wänden<br />
ist es kalt, ihm kommt es so vor, als könnte<br />
er das Jaulen und die Hilferufe des Angeschossenen<br />
hören, immer schwächer und leiser, aber<br />
niemand betritt den Kreis, den das Fadenkreuz<br />
in der verdunkelten Landschaft wie in<br />
einer Kulisse aus Sperrholzplatten in Stücke<br />
geschnitten hat. Er wünscht, er könnte durch<br />
das optische Visier das Auge des Sterbenden<br />
vergrößern und darin die gespiegelten Gesichter<br />
der Feiglinge erkennen, die sich rechts und<br />
links von ihm hinter Barrikaden wie hinter<br />
Bühnenvorhängen verschanzt halten. Die Pupille<br />
betrachten, wie sie sich dehnt, dürstend<br />
nach Licht, es gierig hinunterschlingend, wie<br />
ein schwarzes Loch, in dem Himmel und nack-<br />
te Äste und kalte Schornsteine und zerschlagene<br />
Fenster verschwinden wie im aufgerissenen<br />
Schlund eines Köters.<br />
Trotzdem wartet er vollkommen angespannt.<br />
Er weiß, wenn die anderen auftauchen,<br />
hat er nur einige Sekunden Zeit, um ihren<br />
Schwachpunkt zu orten, die ungeschützte Leistenregion<br />
oder den schmalen Spalt zwischen<br />
Schutzhelm und Panzerkragen. Unter seiner<br />
Fingerkuppe spürt er den Abzug, schmal wie<br />
ein angespannter Seidenfaden im Wasserstrudel.<br />
Es gibt keinen wesentlichen Unterschied<br />
zwischen dem Mann dort unten, der sich auf<br />
dem zerschossenen Asphalt in einer roten Pfütze<br />
zusammenkrümmt, die unter ihm immer<br />
größer wird, und einem streunenden Hund, der<br />
in einem Jagdrevier angeschossen wurde. Auf<br />
dieselbe Weise erlöschen sie, auf dieselbe Weise<br />
zuckt ihr Bein, in immer längeren Abständen,<br />
als würden sie im Schlaf rennen.<br />
Er ist darauf trainiert, stundenlang auf der<br />
Lauer zu liegen, also atmet er langsam. Reglos<br />
liegt er in zwei übereinander gezogenen Schlafsäcken<br />
und spürt keine Kälte. Zwischendurch<br />
kneift er ein Auge zusammen, damit es ruhen<br />
kann, aber nur für kurze Zeit, weil er nicht<br />
glauben kann, dass die dort unten bis zum Einbruch<br />
der Dunkelheit im Versteck bleiben, dass<br />
sie sich nicht getrauen, den Mann, mit dem sie<br />
noch am selben Tag aus einem Kessel gegessen<br />
und aus einer Feldflasche getrunken haben, einfach<br />
so sterben zu lassen. Wie sollen sie einander<br />
in die Augen sehen, wie wollen sie der Witwe<br />
vor die Augen treten, was werden sie ihren<br />
eigenen oder seinen Kindern sagen, sofern er<br />
welche hatte<br />
Er schluckt die Spucke herunter, angewidert<br />
und wütend zugleich: Er ist noch nie im Leben<br />
so erniedrigt und hintergangen worden. Als<br />
der angeschossene Mann schließlich ein letztes<br />
Mal zuckt und anschließend zur Erleichterung<br />
aller ganz still wird, schlussfolgert Hasenscharte,<br />
dass das Spiel vorbei ist. Er verkriecht sich<br />
ganz in die Schlafsäcke, steckt seine durchfrorenen<br />
Finger unter die Achseln und döst bis zur<br />
Abenddämmerung vor sich hin.<br />
Ich treffe ihn ab und zu, in der Straßenbahn,<br />
auf dem Markt, im Krankenhaus, mit Befunden<br />
im blauen Patientenbüchlein oder aber<br />
mit Kartoffeln und Zwiebeln im Plastiksack. Er<br />
wirkt wie ein fürsorglicher Vater und ein guter<br />
Hausmann. Nach ihm sind keine Schulen benannt,<br />
keine Straße trägt seinen Namen, er ist<br />
weder ein Held noch ein Mörder.<br />
Er steht vor dem Alten Rathaus, neben der<br />
Kulisse mit der Szene aus dem Film „Das Attentat<br />
von Sarajevo“, und kassiert das Geld für die<br />
Fotos – in meiner bestellten Geschichte zum<br />
verfehlten Thema neunzehnhundertvierzehn.<br />
Aus dem Bosnischen von<br />
Mascha Dabić<br />
Nenad Veličković<br />
Geboren 1962 in Sarajevo. Er ist Initiator/Redakteur/Mitarbeiter<br />
mehrerer Zeitschriften<br />
und Autor zahlreicher Romane und Erzählungsbände.<br />
Er ist Dozent an der Philosophischen<br />
Fakultät in Sarajevo.<br />
Beton International März 2014 25
Kristian Novak<br />
Schwarzer Fleck,<br />
mappa mundi<br />
Im Mittelalter zeichneten Gelehrte alles in<br />
eine mappa mundi ein, was sie über die bekannten<br />
Teile der Welt wussten und über die unbekannten<br />
dachten, und so konnte es durchaus<br />
passieren, dass neben eingezeichneten Städten,<br />
Meeresgewässern und Erhebungen auch<br />
Drachen, Meeresungeheuer und Menschen mit<br />
Hundeköpfen hervorlugten. Ich gebe zu, für<br />
mich sind gerade jene Orte, die ich aufgesucht<br />
habe, unerforschtes Territorium, und zuweilen<br />
trage ich meine eigene Mythologie in meine<br />
mind map mundi ein. Die genaue Stelle in Sarajevo,<br />
wo Gavrilo Princip mit mehreren Schüssen<br />
Erzherzog Ferdinand und seine Gemahlin<br />
tötete, angeblich bei der Abbiegung vom damaligen<br />
Appel-Kai in die damalige Ulica Franje Josipa,<br />
ist auf meiner persönlichen mappa mundi<br />
leer geblieben, so wie ich mich selbst leer fühlte,<br />
als ich dort keine zehn Sekunden lang verweilte.<br />
In dieser Stadt trieb der Tod sein Unwesen<br />
hinterher in einem solchen Ausmaß, dass mir<br />
allein schon der Gedanke daran, dort irgendetwas<br />
einzuzeichnen, gewissermaßen spießig<br />
erschien. Was wäre jedoch, wenn ich mich<br />
wirklich festlegen müsste, mich entscheiden im<br />
Hinblick auf diese Stelle, von der manche glauben,<br />
sie sei die Brutstätte für das Abschlachten<br />
von Millionen Menschen gewesen Was würde<br />
ich einzeichnen<br />
Die Dinge liegen natürlich nicht so einfach.<br />
Es ist eine Sache, zu behaupten, das Leben eines<br />
Erzherzogs und einer Gräfin sei nicht wichtiger<br />
als das Leben irgendeines anderen Menschen<br />
in dieser Stadt, der mit Gewalt ins Jenseits befördert<br />
wurde. Andererseits gilt der Tod des<br />
Paares, das dem Attentat zum Opfer fiel, als entscheidend,<br />
während der Mörder dieser beiden<br />
der Chronologie der jugoslawischen Einheit auf<br />
unterschiedliche Arten eingeschrieben wurde.<br />
Ich sehe das so: Wäre das Konzept der jugoslawischen<br />
Einheit ein Film, wäre es eine sehr kurze<br />
Szene mit einem riesigen Nachspann. Vielleicht<br />
liege ich vollkommen falsch, aber so ist<br />
nun einmal meine Erfahrung – die Erfahrung<br />
eines Menschen, der im Jahr 1979 geboren wurde.<br />
Ich sehe eine Reihe von Regisseuren und<br />
Mitbeteiligten, eine Vielzahl unterschiedlicher<br />
Konzeptionen. Und jeder einzelne Teilnehmer<br />
müsste unbedingt alle seine Opfer, alle seine<br />
Helden und Ehrenmänner aufzählen. Princip<br />
würde in mehreren Rollen auftreten: als positive<br />
Gestalt, als Antagonist, Regieassistent, best<br />
boy. Ich betrachte seine Fotografie, die dunklen<br />
Augenringe, den spärlichen Oberlippenbart, einen<br />
schwarzen Schlafrock, der möglicherweise<br />
seiner Mutter gehörte. Irgendetwas stimmt da<br />
für mich nicht, ich bringe es einfach nicht fertig,<br />
ihn als bedeutsam zu betrachten. Ich sehe einen<br />
Jungen von etwa zwanzig Jahren, aufgewachsen<br />
unter problematischen Umständen, allem<br />
Anschein nach ein missratenes Kind, und ich<br />
bezweifle, dass er über seine Perspektiven Bescheid<br />
wusste. Auf diese Fotografie bin ich vor<br />
kurzem über Facebook gestoßen. Ein Bekannter<br />
von mir hatte nämlich einen Kommentar<br />
über den Gründer eines wichtigen kroatischen<br />
Informationsportals abgegeben, genau genommen<br />
über seine Statusmeldung.<br />
Dieser relativ junge Mann (wir sind fast<br />
gleich alt) hatte, wie ich sah, als Profilfoto<br />
ebendieses schwarz-weiße Porträtbild von<br />
Gavrilo Princip. Das breite Titelbild seines<br />
Profils war das Foto eines Graffitos: „Macht<br />
euch keine Sorgen, wir erschießen sie alle“ mit<br />
einem roten Stern statt einer Unterschrift. Ich<br />
schaute seine Statusmeldungen durch, um eine<br />
Erklärung dafür zu finden, auf wen er dermaßen<br />
zornig war. Kurz gesagt: Er würde am liebsten<br />
alle kroatischen Politiker aufhängen, linke<br />
wie rechte. Ein legitimer Standpunkt, könnte<br />
man sagen, aber wenn wir den Kontext berücksichtigen,<br />
stellt sich die Frage, ob es auch ein<br />
genuiner Standpunkt ist. Das heißt, ein Mann,<br />
der allem Anschein nach zur Elite zählt und<br />
wunderbar davon leben kann, dass er Informationen<br />
produziert und anbietet, nimmt als<br />
Symbol seiner zornigen Lebensphase das Foto<br />
von jemandem, den er als Tyrannenmörder<br />
sieht, und erhebt ihn damit in den Rang eines<br />
positiven Musterbeispiels. Wenn wir ein Auge<br />
zudrücken bei jeder erdenklichen Perspektive,<br />
unter der man Princips Tat betrachten kann,<br />
sowie bei den zwei, drei weiteren Tyranneien,<br />
die sich nach dem Zusammenbruch des von<br />
Princip so gehassten Reiches etablieren konnten,<br />
wenn wir neue Attentate und neue Imperialismen<br />
außer Acht lassen, so bleibt dennoch<br />
die Frage: Warum eine solche Verbindung Soll<br />
Princips Fotografie vor dem Hintergrund des<br />
Graffitos die jugoslawische Einheit symbolisieren<br />
Oder möglicherweise den Klassenkampf,<br />
den Antifaschismus Ist es möglich, dass der<br />
kränkliche Zwanzigjährige irgendetwas über<br />
den Faschismus wusste, als er seine Pistole<br />
zückte Vom Roten Stern hätte er erst Jahre<br />
nach seinem Attentat etwas hören können.<br />
Oder handelt es sich, unabhängig vom Kontext,<br />
um einen Mann, den zu bewundern wir<br />
angehalten sind, weil er bereit war, für eine<br />
gerechtere Welt etwas zu tun, wozu andere<br />
nicht genug Mut hatten Wenn wir uns schon<br />
in diese Richtung bewegen, können wir uns mit<br />
ein wenig Phantasie ausmalen, was wir wollen,<br />
wir können einen Bezug herstellen zwischen<br />
Gavrilo und den Pyramiden oder den Freimaurern<br />
oder dem lebenden Elvis Presley, weil die<br />
Erinnerung an ihn schlussendlich zu einem Internet-Mem<br />
geworden ist, sie ist eine Einheit<br />
der kulturologischen Information, ein Symbol,<br />
mit dem wir in Ermangelung einer Idee den aktuellen<br />
Standpunkt unseres virtuellen Ich beschreiben<br />
können. Unser lokaler Che Guevara.<br />
Curt Cobain. James Dean. Andreas Baader.<br />
Cristiano Ronaldo. Khal Drogo. Warum mir das<br />
alles so auf die Nerven geht Weil ich die Nase<br />
voll habe von Memen. Obwohl sie halbleer<br />
sind, stellen sie mächtige Indikatoren dar, die<br />
nichtexistente Argumente für jede gegenteilige<br />
Erzählung über unsere angebliche gemeinsame<br />
Geschichte liefern, über die Interessenssphären<br />
und über die niemals verschmerzte<br />
und niemals verwirklichte Brüderlichkeit in<br />
einem gemeinsamen Arkadien, in dem sich alle<br />
gegenseitig respektieren. Solche Geschichten<br />
sind, scheint es, so zahlreich wie die Menschen,<br />
die sie erzählen möchten, aber eines ist ihnen<br />
allen gemeinsam – der tragikomische und potenziell<br />
gefährliche Irrtum, unsere Völker und<br />
aus ihnen stammende Einzelpersonen hätten<br />
in mehreren Anläufen Einfluss auf das Schicksal<br />
der gesamten Welt gehabt.<br />
Im Internet kursiert eine weitere lustige<br />
zeitgenössische mappa mundi. Statt der jeweiligen<br />
Staatsnamen ist eingetragen, was der<br />
durchschnittliche US-Amerikaner angeblich<br />
über diesen Teil der Welt denkt. Bei Brasilien<br />
steht beispielsweise, es sei ein Land ohne<br />
Schamhaare, bei Mexiko steht housekeeping.<br />
Der Indische Ozean ist mit Osama´s grave überschrieben.<br />
Über dem Balkan steht: You don´t<br />
wanna mess with those guys. Nicht schlecht –<br />
mit uns sollte man besser nicht herumspielen,<br />
wir sind bösartige und unantastbare Typen.<br />
Aber mir scheint, auf der globalen Skala funktioniert<br />
es nicht so: Wir sind nicht nur keineswegs<br />
unantastbar, sondern jeder, dem gerade<br />
danach ist, tastet uns an.<br />
Die Streitlust der Menschen auf dem Balkan<br />
wird als ein Teil ihrer Mentalität wahrgenommen,<br />
und so bekam man zu Beginn der<br />
neunziger Jahre in seriösen globalen Medien<br />
Hintergrundanalysen zu hören, nach denen wir<br />
angeblich deshalb gegeneinander kämpften,<br />
weil wir nun einmal sehr stur und halsstarrig<br />
seien. Zu einer solchen Sichtweise passt Princip<br />
als ein angeblicher Initiator historischer<br />
Veränderungen ganz wunderbar. Aber auch<br />
nur dann, wenn man die Tatsache außer Acht<br />
lässt, dass am Vorabend des Ersten Weltkrieges<br />
Kriegshetzerei einen recht legitimen Teil<br />
des öffentlichen Diskurses darstellte, und zwar<br />
nicht nur in Dorfkneipen mit gefährlichen Typen.<br />
Der Krieg war ein Element der kleinbürgerlichen<br />
Folklore, eine erwünschte Strategie<br />
zur Lösung internationaler Streitigkeiten, und<br />
so war irgendwann der Weg frei für eine Reihe<br />
von Wenn-Dann-Zündern, an denen der Krieg<br />
sich schließlich entfachte. Der britische Kriegshistoriker<br />
Michael Howard ist der Meinung,<br />
dass der Krieg an sich in der damaligen Öffentlichkeit<br />
der europäischen Staaten nicht als eine<br />
große Gefahr angesehen wurde. Im kollektiven<br />
Gedächtnis dominierte die Erinnerung an den<br />
Krieg von 1870/71, bei dem es sich um einen relativ<br />
kurzen Konflikt gehandelt hatte. Es hielt<br />
sich das Bild von Soldaten, die ihre schönen<br />
Uniformen anziehen, am Lagerfeuer Soldatenlieder<br />
singen, vormittags ein wenig kämpfen<br />
und nachmittags den Mädchen in der nächstgelegenen<br />
Stadt nachstellen, um sich zwei, drei<br />
Wochen später zu Hause mit entsprechenden<br />
Anekdoten zu brüsten.<br />
Ein solcher Kontext findet seine klare Bestätigung<br />
in den noch vor dem Krieg entstandenen<br />
Texten eines fast vergessenen Zeitgenossen<br />
Gavrilo Princips, des kroatischen<br />
Esperantisten, Lexikographen und Offiziers<br />
in der Armee der österreichisch-ungarischen<br />
Monarchie, Mavro Špicer. Wäre er ganz und<br />
gar in Vergessenheit geraten, wären wir um<br />
einen unbelasteten und dadurch umso erschütternderen<br />
Blick auf den Krieg ärmer, der<br />
Beton International März 2014 26
uns zeigt, dass die Welt geradezu freudig in<br />
den Krieg schlitterte. Es waren nämlich nicht<br />
nur die Staaten, die Aufrüstung im großen Stil<br />
betrieben, sondern auch die Öffentlichkeit<br />
war durchaus in der Lage, den Krieg als etwas<br />
Gutes zu sehen. Wie sonst wäre es möglich,<br />
dass ein so gebildeter Mann wie Špicer in seinen<br />
populärwissenschaftlichen Ausführungen,<br />
zwischen 1906 und 1911 auf Deutsch vorgetragen<br />
und publiziert, die Mobilmachung glorifizierte,<br />
den Pazifismus kritisierte und die<br />
Kriegsführung ästhetisierte, wobei er explizit<br />
betonte, der Krieg sei der Katalysator des allgemeinen<br />
Fortschritts der Menschheit, was<br />
sich dadurch belegen ließe, dass jedes große<br />
Kunstwerk von globaler Bedeutung unter dem<br />
Einfluss kriegerischer Ereignisse entstanden<br />
sei. Es scheint, diese Behauptungen waren keineswegs<br />
kuriose Ergüsse einer extremen Position,<br />
sondern eine verbreitete Meinung im<br />
Mainstream. Aus Špicers Texten spricht eine<br />
Zeit, in der es möglich war, anhand kunsthistorischer<br />
Betrachtungen von großen Werken<br />
und Poetiken der Weltliteratur, der Musik und<br />
der bildnerischen Künste eine These zu verteidigen,<br />
wonach Kunst und Krieg untrennbar<br />
miteinander verbunden seien und produktiv<br />
interagieren würden. Darüber hinaus war es<br />
möglich, Thesen zu unterbreiten, welche die<br />
positiven Auswirkungen einer militärischen<br />
Erziehung unterstrichen, Rekrutierung und<br />
Bewaffnung befürworteten und die Mobilmachung<br />
als attraktiv bezeichneten. Der Militarismus<br />
im Reiche der Poesie (1906), Ästhetik<br />
der Schlacht (1907), Kriegskunst und Tonkunst<br />
(1909) – so lauten einige Titel.<br />
„Schwert und Leier“ sind für Špicer zwei<br />
miteinander verwachsene Symbole; de facto bilden<br />
sie die Schnittstelle zwischen der kunsthistorischen<br />
und der tagespolitischen Ebene seiner<br />
Texte. Byron, Shakespeare, Michelangelo,<br />
die Marseillaise und noch das eine oder andere<br />
liefern Špicer Argumente für seine These, qualitätsvolle<br />
Kunst und der Militarismus seien untrennbar<br />
miteinander verbunden. Gerne greift<br />
er zurück auf die Zitate des preußischen Generals<br />
und Strategen des neunzehnten Jahrhunderts,<br />
Helmuth von Moltke, der in der Manier<br />
des Sozialdarwinismus die Meinung vertrat, die<br />
menschliche Rasse müsse Krieg führen, sofern<br />
sie weiterkommen wolle. „Der ewige Friede ist<br />
ein Traum, und kein schöner.“ Nicht einmal<br />
eine solche Idee wurde von den Zeitgenossen<br />
Špicers als extrem eingestuft. Howard betont,<br />
sie sei am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert<br />
weit verbreitet gewesen. Es ist nicht nötig,<br />
gesondert hervorzuheben, dass diese Idee nach<br />
dem Ersten Weltkrieg aus jeder ernsthaften<br />
Diskussion und aus dem öffentlichen Diskurs<br />
verschwunden war.<br />
Aber bevor die Menschen die möglichen<br />
Konsequenzen absehen konnten, waren sie der<br />
Meinung, dass man sich vor dem Krieg nicht<br />
allzu sehr fürchten sollte. Špicer dachte, die<br />
modernen Kriege seien zwar blutiger, aber dafür<br />
wesentlich kürzer und eigentlich humaner<br />
als früher. Er sah die Zeiten herannahen, da<br />
nur noch Maschinen gegeneinander kämpfen<br />
würden. Außerdem sei der Krieg im 20. Jahrhundert<br />
eine zivilisierte Sache: „Im zwanzigsten<br />
Jahrhundert ist unter zivilisierten Staaten<br />
ein Krieg […], dessen Ziel nur Vernichtung und<br />
Zerstörung ist, ganz undenkbar. Man besiegt<br />
den Feind nicht durch völlige Zerstörung seines<br />
Daseins, sondern durch Vernichtung seiner<br />
Hoffnung auf den Sieg.“<br />
Špicers Sichtweise auf die Kunst mag aus<br />
der heutigen Perspektive schockierend erscheinen.<br />
Aber Emiko Ohnuki-Tierney, die Autorin<br />
von Kamikaze, Cherry Blossoms and Nationalisms<br />
(2002), stellte fest, dass totalitäre Regime<br />
wie die Hitlers, Mussolinis oder Maos die Ästhetisierung<br />
des Krieges und der Armee gezielt<br />
einsetzten. Ohnuki-Tierney führt dies am Beispiel<br />
der japanischen Kamikaze-Piloten und<br />
der Symbolik der Kirschblüten vor und zeigt,<br />
dass die Ästhetisierung sich gut als Instrument<br />
für Manipulation eignet, weil das Bezeichnete<br />
durch die Ästhetisierung eigentlich unbestimmt<br />
wird. Die Kamikaze-Piloten sahen in<br />
den Kirschblüten nämlich kein kriegerisches<br />
Symbol, sondern ein Symbol für schmerzhafte<br />
Schönheit und ungelöste Dilemmata ihres tragisch<br />
kurzen Lebens, ein Symbol der Wiedergeburt<br />
und der Beziehung zwischen Mann und<br />
Frau. In diesem Sinne waren die Soldaten möglicherweise<br />
sogar in der Lage, sich der Ideologie<br />
zu widersetzen, nicht jedoch den Symbolen, die<br />
je nach Bedarf romantisiert oder dämonisiert<br />
wurden. So wie die Memen. Da kannst du alles<br />
so einzeichnen, wie es dir passt.<br />
Was würde ich also in meine eigene mappa<br />
mundi an der Stelle des Attentats von Sarajevo<br />
einzeichnen Ich würde einen guten, aber misshandelten<br />
Menschen einzeichnen, in dessen<br />
Körpergedächtnis zahlreiche Misshandlungen<br />
eingebrannt sind und der sein Leben damit<br />
zubringt, die Wiederholung dieses Traumas zu<br />
suchen. Das ist immer meine erste Assoziation,<br />
wenn ich von einem Ausländer gefragt werde,<br />
was für Menschen in unseren Gegenden leben.<br />
Ich würde auch das kroatische Dreiband einzeichnen,<br />
eine Lilie und einen zweiköpfigen<br />
Adler und die Krone des Hl. Stjepan, den Roten<br />
Stern und das Hakenkreuz, alles übereinander.<br />
Schwarz-gelb würde ich malen und blau und<br />
weiß und rot in einigen möglichen Anordnungen,<br />
und dann würde ich eine Handvoll Grün<br />
hinzufügen. Ich würde den Triglav und den<br />
Ohridsee einzeichnen und jedes andere Symbol,<br />
das mir einfiele. Ich würde so lange alles<br />
übereinander zeichnen, wie es angeblich Autisten<br />
gerne tun, dass zum Schluss nur noch<br />
ein schwarzer, fettiger Fleck übrig bliebe, der<br />
sich allmählich durch das Papier fressen würde.<br />
Noch eine weitere Berührung des Papiers,<br />
und als nächstes würde man über die hölzerne<br />
Tischplatte pflügen. Sodass niemand mehr jemals<br />
noch etwas einzeichnen könnte. Ich weiß<br />
nur nicht, ob man den Fleck daran hindern<br />
kann, sich weiter auszubreiten.<br />
Vielleicht ist das feig. Vielleicht ist es nur<br />
ein temporärer Luxus des Aufatmens, wie es<br />
uns das Vergessen beschert. Jedenfalls ist es gewiss<br />
kein Ausweg, keine Lösung und keine Antwort.<br />
Aber diese Kategorien sind als Ziele ohnehin<br />
unerreichbar für eine Gegend mit einer so<br />
widersprüchlichen Geschichtsschreibung, wie<br />
es der Balkan ist. Wer kann schließlich in dieser<br />
Gegend jemals irgendjemanden von irgendetwas<br />
überzeugen Wann ist so etwas das letzte<br />
Mal wirklich passiert Mir genügt es daher,<br />
zumindest mit einem schwarzen Fleck mein<br />
Gehirn daran zu hindern, sich selbst blutig zu<br />
kratzen.<br />
Was wir nämlich wirklich dringend nötig<br />
haben, ist Aussöhnung. Herausfinden zu wollen,<br />
was wirklich passiert ist, empfiehlt sich<br />
nicht. Vielleicht ist es sogar kontraindiziert.<br />
Aus dem Kroatischen von<br />
Mascha Dabić<br />
Kristian Novak<br />
Geboren 1979 in Baden-Baden. Germanist,<br />
Kroatist und Prosaautor. Er unterrichtet an der<br />
Universität Zagreb und an der Universität Rijeka.<br />
Novak untersucht soziolinguistische Phänomene<br />
im historischen Kontext. In Kroatien<br />
sind von ihm die Romane Die Gehängten und<br />
Schwarze Mutter Erde erschienen.<br />
Ivana Šojat-Kuči<br />
IM PRINZIP…<br />
In einer utopischen Sichtweise könnte die<br />
Geschichtswissenschaft angesichts der Tatsache,<br />
dass sie über konkrete Angaben verfügt, die<br />
uns ausgehend von einem bestimmten Punkt<br />
auf der Zeitachse bis zum heutigen Chaos führen,<br />
und angesichts dessen, dass wir meistens<br />
über Ursachen und Folgen Bescheid wissen,<br />
die zu einer Bombe, einer Invasion, einem<br />
Umsturz, einer Diktatur oder einem Pogrom<br />
geführt haben, ohne weiteres eine exakte Wissenschaft<br />
sein. Die historische Exaktheit wäre<br />
nomenklatorisch fast durchführbar, wären da<br />
nicht ein paar „Kleinigkeiten“.<br />
Die Geschichtsschreibung ließ sich schon<br />
immer sehr leicht manipulieren. Man ist geneigt,<br />
die Geschichte als eine Tatsache anzunehmen, in<br />
Abhängigkeit von dem Staat, in dem man geboren<br />
wurde, und vom Volk, dessen Schoß man sozusagen<br />
entsprungen ist. Die Geschichte nimmt<br />
stets und unweigerlich menschliche Eigenschaften<br />
an, die Eigenschaften eines kleinen menschlichen<br />
Lebewesens, das zu Eitelkeit, Hochmut<br />
und Mythologisierung neigt. Daher ist es nicht<br />
verwunderlich, dass ein und dasselbe Ereignis in<br />
naher oder ferner Vergangenheit mit mehreren<br />
Interpretationen belegt werden kann: Die Tragödie<br />
der einen ist stets der wohlverdiente Triumph<br />
der anderen.<br />
Das gilt auch für das Attentat von Sarajevo,<br />
durchgeführt von Gavrilo Princip mit einer Pistole<br />
in der zitternden Hand, nachdem der bereits<br />
zur Zielscheibe gewordene Thronfolger<br />
von seinem Automobil aus die von Nedeljko<br />
Čabrinović geworfene Bombe abwehren konnte.<br />
Indem Princip den Erzherzog Franz Ferdinand<br />
und seine schwangere Gemahlin Sophie tötete,<br />
wurde Princip mit einem Schlag zum Terroristen<br />
und zum Helden zugleich, zum Schuft<br />
und Freiheitskämpfer.<br />
WAS WÄRE WENN…<br />
„Wenn dieser Dummkopf nicht gewesen<br />
wäre, würden wir hier in Osijek heute in einer<br />
Miniaturversion von Wien leben“, sagte vor<br />
einigen Tagen eine Freundin zu mir. Auf dem<br />
Hauptplatz. Wir hatten uns zufällig getroffen.<br />
Sie war richtig zornig, in Rage. Nachdem ich ihr<br />
gesagt hatte, dass ich über das Attentat von Sarajevo<br />
schreiben würde.<br />
Und sie war nicht die einzige.<br />
„Ach, wir Slawen sind ja geradezu dafür<br />
geschaffen, anderen zu dienen“, winkte ein Bekannter<br />
ab. Nach einigen Bieren. Im Theater-<br />
Kaffeehaus. Ich wollte ihm sagen, dass diese<br />
Schlussfolgerung ironischerweise aus der Etymologie<br />
unserer gemeinsamen Bezeichnung<br />
herrührt: Die Slawen leiten sich vom lateinischen<br />
Begriff für „Sklaven“ ab. Aber ich fiel<br />
ihm nicht ins Wort. Er hatte auch gar nicht zu<br />
mir gesprochen, sondern schüttete mit seinem<br />
alkoholdurchtränkten Redeschwall einen<br />
Freund am Nebentisch zu, dessen Augen glänzten.<br />
Wohl angesichts der Offenbarung. „Es wäre<br />
Beton International März 2014 27
esser gewesen, wenn uns die aus Wien und Budapest<br />
weiterhin beherrscht hätten, anstatt zuzulassen,<br />
dass die von dort drüben fünfzig Jahre<br />
lang auf uns herumtrampeln“, fuhr er fort und<br />
machte eine Kopfbewegung in Richtung Osten,<br />
womit er die Grenze zu Serbien meinte.<br />
Vom Einzelnen zum Ideologischen ist es<br />
kein großer Schritt. So wie der einzelne gerne<br />
alle anderen für seine eigenen Niederlagen beschuldigt,<br />
so begrüßen Ideologien gerne Umstürze,<br />
mit denen sie in Wahrheit gar nichts zu<br />
tun haben. Der Kommunismus (besser gesagt:<br />
Sozialismus), in dem ich aufgewachsen bin,<br />
begrüßte vieles: die Utopie, die er angeblich<br />
auf spektakuläre Weise verkörperte, die Französische<br />
Revolution, mit der die „Verdammten<br />
dieser Erde“ die Sache in die Hand genommen<br />
hätten, die Oktoberrevolution, die angeblich<br />
die Mutter aller weiteren Ereignisse in Jugoslawien<br />
war. Was Gavrilo Princip anbelangt, war<br />
er für die Schüler des sozialistischen Bildungssystems<br />
geradezu ein Partisan, jemand, der<br />
„durchs Gebirge, durch die Steppen“ zog und<br />
gegen alles Böse ankämpfte.<br />
Für die jugoslawischen Schüler war es gar<br />
nicht einfach, gewisse historische Figuren in<br />
ihren zeitlichen Kontext einzubetten, zuweilen<br />
auch in den geographischen. Ein klassisches<br />
Schulbeispiel für diese Verwirrung stellt die<br />
Französische Revolution dar, die laut den Lehrbüchern<br />
einen großartigen Aufstand gegen die<br />
Tyrannei der klerikal-feudalen Kräfte des Bösen<br />
darstellte, einen Ausdruck des Volkswillens<br />
und der Volksmassen, einen Kampf für Gerechtigkeit<br />
und Gleichheit. Deshalb wollte wohl keinem<br />
Kind einleuchten, warum der moralische<br />
Riese Marat in seiner Badewanne von einer<br />
Verrückten umgebracht worden war. Denn in<br />
den Lehrbüchern verschwand die Guillotine<br />
bereits irgendwo bei Marie Antoinette und ihrer<br />
geschmacklosen Aussage: „Dann esst doch<br />
Kuchen.“ Nachdem sie darüber in Kenntnis<br />
gesetzt worden war, dass das Volk kein Brot zu<br />
essen hatte. Die Enthauptung des modisch aufgeklärten,<br />
aber für soziale Probleme ganz und<br />
gar unempfänglichen Königspaars war also gerechtfertigt.<br />
Alles Weitere schien in einen Nebel<br />
gehüllt zu sein, und es war ein Leichtes, den<br />
Terror unter den Teppich zu kehren.<br />
So wurde Robespierre in den Lehrbüchern<br />
stillschweigend der Titel des ersten Partisans<br />
samt der jugoslawischen Staatsbürgerschaft<br />
verliehen. Nach ihm kam eine Lawine von eingebürgerten<br />
Söhnen der jugoslawischen Brüderlichkeit<br />
aus allerlei Völkern und Völkerschaften:<br />
Marx, Engels, Lenin und Stalin, von dem wir<br />
uns jedoch nach Titos „Nein“ mit Ekel lossagten.<br />
Sporadisch fanden sich auch Mao,<br />
Gaddafi, Gandhi, Nasser und Nehru im<br />
Familienalbum ein. Die Wachstumskurve<br />
der sozialistischen Familie<br />
entsprach dem Rhythmus revolutionärer<br />
Strömungen, und die<br />
Familienmitglieder streckten<br />
ihre Arme auch nach weit entfernten<br />
historischen Figuren<br />
aus, etwa nach Matija Gubec<br />
vom Bauernaufstand oder<br />
nach Giordano Bruno. Gavrilo<br />
Princip blieb im Familienporträt<br />
jedenfalls stets in<br />
der Nähe der Elternfiguren.<br />
Groß und wagemutig, ein<br />
Mann, der den Wunsch aller<br />
Unterdrückten und Erniedrigten<br />
erhört und sich mit<br />
einer Pistole in der Hand<br />
gegen die große Doppelmonarchie<br />
erhebt.<br />
ÜBER DIE MILJACKA<br />
In Jugoslawien musste jede<br />
Schulexkursion eine Botschaft<br />
vermitteln. Nichts durfte damals<br />
sinnlos sein. Alle Wege führten<br />
über die Pfade der Revolution und<br />
dienten dem Gedenken an selbige. In<br />
der achten Schulklasse unternahmen<br />
wir eine Reise nach Dubrovnik, mit einem<br />
Zwischenstopp in Sarajevo. Dort machten wir<br />
Halt an der Miljacka, die sich im Vergleich mit<br />
der Donau oder der Drau wie ein Bach ausnahm.<br />
Wir blieben neben den Fußabdrücken Princips<br />
stehen und lasen die in kyrillischer Schrift verfasste<br />
Aufschrift: „Von diesem Platz aus brachte<br />
Gavrilo Princip am 28. Juni 1914 mit seinen<br />
Schüssen den Volksprotest gegen die Tyrannei<br />
und das Jahrhunderte währende Freiheitsstreben<br />
unserer Völker zum Ausdruck.“<br />
Ironischerweise fragte ich mich in diesem<br />
Augenblick bloß, wie der Besagte auch nur im<br />
Traum daran denken konnte, über die Miljacka<br />
zu flüchten. „Zum Glück hat er sich nicht<br />
das Bein gebrochen, als er auf diese Steine da<br />
aufprallte“, entfuhr es mir unwillkürlich. Meine<br />
Frau Klassenvorstand und Französischlehrerin<br />
erblasste daraufhin. Möglicherweise<br />
hatte sie insgeheim dasselbe gedacht wie ich.<br />
Möglicherweise war es so, aber damals presste<br />
sie ganz leise hervor: „Manchmal ist es klüger,<br />
sich auf die Zunge zu beißen.“ Ich aber dachte<br />
nur an die Tschechin, eine ältere Dame, die ich<br />
im Sommer zuvor in Zadar dabei beobachtet<br />
hatte, wie sie im knietiefen Wasser versuchte,<br />
schwimmen zu lernen. Sie hatte geschrien und<br />
immer wieder hatte es so ausgesehen, als ginge<br />
sie unter. Ich stellte mir Gavrilo an ihrer Stelle<br />
vor und schüttelte mich vor Lachen.<br />
Dabei gab es eigentlich gar nichts zu lachen.<br />
DER HEILIGE VID NACH DEM<br />
JULIANISCHEN KALENDER<br />
Mein Urgroßvater Petar Šojat hatte zu seinem<br />
Namenstag am Heiligen Peter und Paul,<br />
dem 29. Juni 1908, ein eiskaltes Bier getrunken<br />
und war einige Tage später an galoppierender<br />
Schwindsucht gestorben. Er war Gendarmeriekommandant<br />
in Bosanski Brod gewesen und<br />
damit ein winziges Rädchen bei der Annexion<br />
Bosniens durch das große Reich Österreich-<br />
Ungarn. Exakt 364 Tage später sollte sich der<br />
famose Vidovdan „ereignen“ und damit der Zusammenbruch<br />
eines Reiches, das noch 364 Tage<br />
zuvor eine neue Expansionsphase eingeläutet<br />
hatte, seinen Lauf nehmen. Der Vidovdan wird<br />
bei den Serben in der Kirche und im Volk als Gedenktag<br />
der Schlacht auf dem Amselfeld begangen.<br />
Dabei wird des Fürsten Lazar Hrebljanović<br />
gedacht und all jener, die für ihren Glauben und<br />
ihr Vaterland fielen. Erzherzog Franz Ferdinand,<br />
dem es nicht beschieden war, Kaiser zu<br />
werden, entschloss sich, ausgerechnet am Vidovdan<br />
nach Bosnien zu fahren, auf das es Serbien<br />
auch schon damals abgesehen hatte. Ziel seiner<br />
Reise war es, Militärmanövern der kaiserlichen<br />
Armee beizuwohnen, die bei den Völkern des<br />
künftigen Königreichs der Serben, Kroaten und<br />
Slowenen sehr verhasst war. Zu seinem Unglück<br />
warten nicht immer alle darauf, dass ihre<br />
Karten aufgehen – manche legen sich das Spiel<br />
von vornherein zurecht, weil nach dem „Zirkus“<br />
ohnehin alles nur eine Sache<br />
der Dialektik und<br />
der Demagogie ist. Das wusste<br />
auch der Offizier Dragutin Dimitrijević Apis,<br />
Chef des serbischen Militärgeheimdienstes<br />
und graue Eminenz hinter der Terrororganisation<br />
„Schwarze Hand“, die offiziell am 10. Juni<br />
1910 gegründet wurde, jedoch auch schon in<br />
den Jahren davor recht aktiv dabei war, politische<br />
Gegner zur Strecke zu bringen, so etwa den<br />
serbischen König Aleksandar Obrenović, der<br />
durch einen Fenstersturz von der politischen<br />
Szene entfernt worden war, was der Dynastie<br />
Karađorđević eine theatralische Wiederkehr<br />
ermöglichte. Dieselbe „Schwarze Hand“ hatte<br />
sich ebenso ritterlich auf die schmächtigen<br />
Schultern der neugegründeten Organisation<br />
„Junges Bosnien“ gelegt, als diese „beschloss“,<br />
die Gelegenheit am Schopf zu ergreifen und die<br />
imperiale Wiener Linie abzuschneiden. Daraufhin<br />
betraten die Glorreichen Sieben die Bühne:<br />
Mehmed Mehmedbašić, Vasa und Nedeljko<br />
Čabrinović (der Bombenwerfer, dessen Bombe<br />
vom Automobil abgewendet werden konnte),<br />
Cvetko Popović, Danilo Ilić, Trifko Grabež und<br />
Gavrilo Princip.<br />
Der vor Gericht zitierte Gavrilo, der sich am<br />
Tatort zunächst mit Zyankali und dann noch<br />
mit einem Kopfschuss das Leben zu nehmen<br />
versucht hatte, brachte geradezu zerknirscht<br />
hervor: „Wir haben unser Volk geliebt.“ Auch<br />
das ist ein historischer Satz, eine dringend nötige<br />
Phrase für die Medien, wie wir heute sagen<br />
würden. Es ist nämlich notwendig, einen letzten<br />
Satz zu haben. Vor dem Tod oder vor dem<br />
Antritt einer Lagerhaft. Wegen der Ideologie<br />
natürlich, wegen all dem, womit die Ideologie<br />
zusätzlich ausgebaut wird. Denn nach einem<br />
solchen Satz, der in alle Ewigkeit erhalten<br />
bleibt, wird das Schicksal desjenigen, der ihn<br />
ausgesprochen hat, unwichtig. Es wird unwichtig,<br />
was er getan hat.<br />
OPFERFORSCHUNG<br />
Gavrilo liebte sein Volk, zusammen mit<br />
sechs seiner Kampfgefährten. Ganz genauso,<br />
wie auch jene vierzig Millionen Opfer des Ersten<br />
Weltkrieges im Zeitraum vom 28. Juli 1914<br />
bis zum 11. November 1918 ihr Volk liebten. Da<br />
Gavrilo für die Todesstrafe zu jung war, wurde<br />
er von der Gerichtsbarkeit des verhassten<br />
Reichs, die seiner verrückten Jugend Nachsicht<br />
zollte, zu zwanzig Jahren Kerkerhaft verurteilt.<br />
Er starb am 28. April 1918 an Tuberkulose in<br />
Theresienstadt, einem Gefängnis, das vermutlich<br />
in Vergessenheit geraten wäre, wenn nicht<br />
zwanzig Jahre später andere,<br />
die ebenfalls ihr Volk<br />
geliebt haben, versucht hätten,<br />
ebendort planmäßig Juden auszurotten.<br />
Drei Vidovdans nach Princips Tod wurde in<br />
dem nach dem Ersten Weltmassaker geschaffenen<br />
Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen<br />
die für die Kroaten und Slowenen schändliche<br />
Vidovdan-Verfassung verabschiedet, mit der<br />
die Dreifachmonarchie zu einer parlamentari-<br />
schen Erbmonarchie mit der Amtssprache Serbo-Kroato-Slowenisch<br />
wurde. Dabei nahmen<br />
die kroatischen Delegierten nicht an der Abstimmung<br />
im Parlament teil, 35 Delegierte stimmten<br />
gegen die Verfassung, während 223 Delegierte<br />
dafür stimmten. Es bleibt ein ungelöstes Rätsel,<br />
ob Gavrilo selbst dieses zweite Wunder von Vidovdan<br />
als einen Sieg der Unterdrückten oder<br />
als eine Schande interpretiert hätte.<br />
Der allmächtige Offizier Dragutin Dimitrijević<br />
war ab 1917 nicht länger erwünscht und<br />
wurde wegen Verbrechen, die nichts mit dem<br />
Attentat von Sarajevo zu tun hatten, vor Gericht<br />
zitiert. Im Laufe des Gerichtsverfahrens gab er<br />
zu, als Hauptkommandant des serbischen Militärgeheimdienstes<br />
das Attentat persönlich<br />
organisiert zu haben. Im selben Jahr wurde er<br />
erschossen, 1953 allerdings nachträglich rehabilitiert.<br />
Inwiefern Herr Apis auf die verspätete<br />
Reinwaschung seiner Ehre Wert legte, mögen<br />
spirituell Begabte abschätzen, für die ein Körper,<br />
geopfert auf dem Altar der Heimat, der<br />
Freiheit oder des Volkes, ohnehin nicht von<br />
Bedeutung ist. Eigentlich, wenn man genauer<br />
darüber nachdenkt, hat eine wiederholte Aufzählung<br />
der Tatsachen im Zusammenhang mit<br />
dem Attentat in einer Stadt, von der manche<br />
bereits vollmundig behaupten, sie sei einfach<br />
verflucht, überhaupt keinen Sinn mehr. Alles<br />
ist schon bekannt. Es wird nur jeweils unterschiedlich<br />
interpretiert. In alle Ewigkeit. Immer<br />
ist es wichtig, ja sogar am allerwichtigsten, den<br />
Scheinwerfer auf bestimmte Details zu richten<br />
und alles andere in die Dunkelheit zu stoßen.<br />
Zum Zwecke der Ideologie, der Demagogie. Die<br />
einen werden immer sagen: „Dieser Verrückte<br />
hat doch einen Mann und eine schwangere Frau<br />
ermordet, auch das Kind in ihrem Bauch!“ Oder:<br />
„Er hat das Schicksal Europas besiegelt und es in<br />
den bis dato blutigsten Krieg gerissen.“ Andere<br />
wiederum werden behaupten: „Princip ist ein<br />
Held, der es gewagt hat, im Namen aller Unterdrückten<br />
das Wort zu ergreifen, im Namen des<br />
Jahrhunderte währenden Strebens der jugoslawischen<br />
Völker nach Vereinigung und Unabhängigkeit.“<br />
Alles ist möglich, in einem gewissen<br />
Kontext ist fast alles akzeptabel. Sogar die Lügen,<br />
die sich als ziemlich langlebig erweisen und<br />
die so lange andauern wie die Ideologien, von<br />
denen sie in die Welt gesetzt wurden. Wie etwa<br />
die Lügen über das Massaker von Katyn.<br />
Im Zusammenhang mit dem Attentat von<br />
Sarajevo ist das, was am meisten zu faszinieren<br />
vermag, die Funktion dieses Ereignisses im<br />
weitverzweigten, an sozialistischer Mythologie<br />
reichen untergegangenen Staat. Gavrilo Princip<br />
spielte etwa fünfzig Jahre lang im Wald der<br />
Halbgötter und Volkshelden die Rolle eines<br />
Neil Armstrong: Er war der erste Mensch,<br />
der einen kleinen, aber zugleich so großen<br />
Schritt auf dem schwerelosen,<br />
von Gleichheit durchdrungenen<br />
Planeten Jugoslawien gemacht<br />
hatte, mit einem Bosnischen Eintopf<br />
vor dem Bauch, direkt vor<br />
seinem Bauchnabel.<br />
Was wäre gewesen, wenn<br />
das Attentat nicht stattgefunden<br />
hätte, wenn es daneben<br />
gegangen wäre, wenn der<br />
Thronfolger aufgrund von<br />
Gastritis seine Visite in Sarajevo<br />
auf einen anderen,<br />
weniger symbolträchtigen<br />
Tag verschoben hätte Wäre<br />
die geopolitische Karte Europas<br />
dem Berliner Abkommen<br />
entsprechend gleich geblieben<br />
Wäre der Begriff „Weltkrieg“<br />
heute unbekannt Die<br />
Dinge bedingen einander, ziehen<br />
einander nach sich, Bestrebungen<br />
flauen nicht ab, Demagogen<br />
finden stets neue Nebelfelder,<br />
entfachen Nationen und nationale<br />
Gefühle, während die armen Leute im<br />
Müll herumstöbern und andere Schuldige<br />
für ihre eigenen Verfehlungen und<br />
Systemkatastrophen identifizieren.<br />
Schlussendlich manifestieren sich Ideologien,<br />
die hochfliegenden Ideen entspringen,<br />
als mangelhafte Geschöpfe – wie eine fordernde<br />
gealterte Geliebte, die fremde Kinder angreift<br />
und dabei ihre eigenen auffrisst.<br />
Aus dem Kroatischen von<br />
Mascha Dabić<br />
Ivana Šojat-Kuči<br />
Geboren 1971 in Osijek, Kroatien. Mehrere Gedicht-<br />
und Essaybände sowie Kurzgeschichten.<br />
Übersetzerin aus dem Englischen und Französischen.<br />
2009 erschien ihr Roman Unterstadt<br />
(Originaltitel), der sich mit dem Schicksal der<br />
Deutschen in Osijek im 20. Jahrhundert befasst.<br />
Beton International März 2014 28
Nikola Gelevski<br />
Grenzen, Scheidungslinien,<br />
Fronten – Mazedonien vor 1914<br />
Drei Szenen mit mazedonischen<br />
revolutionären Terroristen<br />
Ein interessanter amerikanischer Schriftsteller<br />
mazedonischer Herkunft, Stoyan Christowe<br />
(1898-1996) – er schrieb Romane, Erzählungen,<br />
Reportagen und Reisebeschreibungen<br />
in englischer Sprache – war als Vierzehnjähriger<br />
aus der Gegend von Kostur in Agäis-Mazedonien<br />
nach Amerika gekommen. Als Korrespondent<br />
einiger amerikanischer Zeitungen hielt er sich<br />
von 1927 bis 1929 wieder auf dem Balkan auf. In<br />
dieser Zeit führte er Gespräche mit dem berüchtigten<br />
Anführer der IMRO (Innere Mazedonische<br />
Revolutionäre Organisation) Ivan Mihajlov,<br />
mit Vlado Černozemski, der später das Attentat<br />
auf König Alexander verüben sollte, und dem<br />
bulgarischen Zaren Boris. Auch 1952 weilte<br />
Christowe auf dem Balkan und besuchte Skopje.<br />
Er war Mitglied des Vermont State House of Representatives<br />
(1951-1955) und des Vermont State<br />
Senate (1959-1972). Den knapp gehaltenen Lexikonartikeln<br />
über ihn lässt sich entnehmen, dass<br />
Präsident Franklin Roosevelt ein großer Bewunderer<br />
seines autobiografischen Buches This Is<br />
My Country (1938) war.<br />
Im Versuch, das psychologische Profil des<br />
mazedonischen Revolutionärs um die Jahrhundertwende<br />
zu umreißen, habe ich Christowes<br />
Buch Heroes and Assassins (1935) einige pittoreske<br />
Szenen aus der Zeit des mazedonischen<br />
revolutionären Kampfes entnommen. Obwohl<br />
Christowe die mazedonischen „Komitadschi“<br />
stark idealisiert, sind einige Schilderungen aus<br />
seinen historischen Reportagen zwiespältig.<br />
Als Christowe den jungen Goce Delčev beschreibt,<br />
das Schlüsselsymbol des mazedonischen<br />
revolutionären Kampfes, lässt er Delčev<br />
und Dame Gruev (den Ideologen der IMRO und<br />
zweiten Mann der Organisation) einander zum<br />
ersten Mal in Štip begegnen, und zwar unmittelbar<br />
nach Delčevs Rückkehr nach Mazedonien.<br />
Beide waren Lehrer in dieser Stadt. Laut<br />
Christowe sagte Delčev das Folgende zu seinen<br />
Schülern: „Hört mal zu, Jungs. Niemand, der es<br />
am Ende des Halbjahres nicht schafft, über eine<br />
dieser Bänke zu springen, wird versetzt. Jeden,<br />
der nicht zurückschlägt, wenn er geschlagen<br />
wird, verprügele ich persönlich. Und ich werde<br />
jedem die Zunge abschneiden, der seinen Kameraden<br />
hinterherschnüffelt und sie bei mir<br />
verpfeift. Auch ihr selbst sollt jeden bestrafen,<br />
von dem ihr meint, dass er etwas Falsches getan<br />
hat.“ Christowe kommentiert: „Das stand voll<br />
und ganz im Einklang mit seinem Verhalten als<br />
Schüler am bulgarischen Gymnasium in Saloniki.<br />
Dort hatte seine Klasse einmal eine Verschwörung<br />
gegen den Lehrer angezettelt, doch<br />
einer der Schüler verriet das Komplott. Der<br />
dreizehnjährige Goce aus Kukuš wollte lieber<br />
hängen als den Verräter unbestraft davonkommen<br />
zu lassen. Deshalb stieß er ihm ein Messer<br />
in den Rücken.“<br />
Christowe präsentiert uns noch eine interessante<br />
Szenerie, die das Bild des mazedonischen<br />
Revolutionärs zu Beginn des 20.<br />
Jahrhunderts einzufangen vermag: Von der<br />
zehnköpfigen Gruppe der „Saloniker Attentäter“<br />
(die 1903 eine Reihe spektakulärer terroristischer<br />
Aktionen an mehreren Orten in<br />
Saloniki ausübten) überlebten vier die terroristische<br />
Tat: Pavel Šatev, Georgi Bogdanov, Marko<br />
Bošnakov und Milan Arsov. Sie wurden von<br />
einem außerordentlichen Militärgericht zum<br />
Tode verurteilt, doch Sultan Hamid verringerte<br />
ihr Strafmaß zu lebenslanger Haft. Drei Jahre<br />
verbrachten sie in den Verliesen der Festung<br />
der sieben Türme oberhalb von Saloniki. Dann<br />
wurden sie zusammen mit 150 mazedonischen<br />
politischen Gefangenen in Ketten gelegt und<br />
auf das Schiff nach Tripolis gebracht. Von Tripolis<br />
aus schleppten sie sich 1000 Kilometer<br />
durch die Sahara. Nach Wochen voller Qualen<br />
und Agonie erreichten sie das Gefängnis der<br />
Stadt Mursuk in der Provinz Fesan. Bošnakov<br />
und Arsov starben in Mursuk. Kurz nach ihrem<br />
Tod wurde im Jahr 1908 als Folge der jungtürkischen<br />
Revolution eine allgemeine Amnestie<br />
für politische Gefangene verkündet. Šatev und<br />
Bogdanov wurden freigelassen, wollten aber<br />
nicht ohne die Leichname ihrer Kameraden<br />
fortgehen. Die Gesundheitsbehörden erlaubten<br />
ihnen jedoch nicht, sie zu exhumieren. Deshalb<br />
entschlossen sich Šatev und Bogdanov,<br />
die Leichname ihrer Kameraden illegal selbst<br />
auszugraben. Sie planten, die Knochen mitzunehmen,<br />
doch laut Šatev waren die Knochen<br />
noch von verwesendem Fleisch bedeckt. Weil<br />
sie die Knochen also nicht nehmen konnten<br />
und es unmöglich war, die verwesenden Körper<br />
fortzutragen, zogen sie ihre Messer heraus und<br />
schnitten den Leichnamen die Köpfe ab. Am<br />
nächsten Morgen legten sie die Köpfe in Blechkanistern<br />
voller Jodoform ein. So brachten sie<br />
die Köpfe ihrer Kameraden durch die Sahara<br />
zurück und lieferten sie bei deren Eltern in Mazedonien<br />
ab.<br />
Die dritte Szene, die ich ausgewählt habe,<br />
zeigt die beiden umstrittenen IMRO-Anführer<br />
Todor Aleksandrov und Aleksandar Protogerov,<br />
die in eine ganze Kette von politischen Morden<br />
und Gewalttaten verwickelt waren, wie sie auf<br />
dem höchsten Gipfel des Pirin-Gebirges stehen,<br />
dem El-Tepe („Gipfel der Stürme“). Christowe<br />
schreibt: „Der El-Tepe ist immer in Nebel und<br />
Wolken gehüllt. Der ‚Gipfel der Stürme‘ ist nur<br />
fünfzehn Fuß niedriger als der Musala in Bulgarien<br />
und 70 Fuß niedriger als der Olymp, der<br />
höchste Berg auf dem Balkan. Die Mazedonier<br />
häuften Felsbrocken auf dem ‚Gipfel der Stürme‘<br />
auf, und mit jedem neuen Felsbrocken wurde<br />
das Pirin-Gebirge höher. Als Aleksandrov<br />
und Protogerov den Gipfel erreichten, brachten<br />
sie Felsbrocken von tiefer gelegenen Orten mit,<br />
fügten sie zum Haufen hinzu und trugen so zur<br />
Höhe bei. Die beiden standen dort wie Adler in<br />
schwindelnder Höhe.“<br />
Mazedonien und die Balkankriege<br />
Mazedonien ist ein geografisches Gebiet<br />
von rund 67.000 km 2 . Heute gehört dieses Territorium<br />
zu drei Staaten: Republik Griechenland,<br />
Republik Bulgarien und Republik Mazedonien.<br />
Es ist viel Blut vergossen worden, bis diese Staaten<br />
sich untereinander und vom Osmanischen<br />
Reich abgegrenzt hatten, und vielleicht auch,<br />
bis festere zivilisatorische Grenzen zwischen<br />
dem Osten und dem Westen gezogen waren.<br />
Auf eine bestimmte Art ist also Mazedonien die<br />
Grenze.*<br />
Auf dem Territorium Mazedoniens spielte<br />
sich in der Zeitspanne, die vom Ilinden-Aufstand<br />
(1903), der Jungtürkischen Revolution<br />
(1908), den Balkankriegen (1912-1913) und dem<br />
Ersten Weltkrieg (1914-1918) umfasst wird,<br />
praktisch auch ein kontinuierlicher Bürgerkrieg<br />
ab. Zum Beispiel wurden laut den Daten,<br />
die Anfang des 20. Jahrhunderts in der englischen<br />
Presse und im britischen Parlament<br />
vorgestellt wurden, zwischen 1904 und 1908<br />
in Mazedonien etwa 10.000 Menschen getötet.<br />
Bei der Sitzung des Unterhauses des Britischen<br />
Parlaments am 26.10.1906 wurde die Angabe<br />
gemacht, dass in den ersten neun Monaten des<br />
Jahres 1906 im Saloniker Vilayet 577, im Vilayet<br />
Bitola 481 und im Vilayet Skopje 188 Menschen<br />
umgebracht worden waren.<br />
Hauptakteure in den politischen Geschehnissen<br />
in Mazedonien waren die jungen Staaten<br />
Griechenland, Serbien und Bulgarien sowie<br />
das Osmanische Reich, das formell das mazedonische<br />
Territorium kontrollierte. Doch auch<br />
Österreich-Ungarn, Russland, Deutschland,<br />
Italien, Frankreich und England hatten bedeutenden<br />
Einfluss auf die politischen Beziehungen.<br />
Der Gebietshunger der jungen Staaten Griechenland,<br />
Serbien und Bulgarien war groß. Zum<br />
Beispiel wurden – mit einigen Unterbrechungen<br />
– ganze fünfzehn Jahre lang (1897-1912)<br />
Verhandlungen zwischen Bulgarien und Serbien<br />
über die Definition ihrer jeweiligen Interessen<br />
in Mazedonien geführt. Serbien sprach<br />
sich konstant für eine Teilung Mazedoniens<br />
aus, während die Haltung Bulgariens variierte,<br />
je nach seiner Position in den internationalen<br />
Beziehungen. Sie bewegte sich zwischen Forderungen<br />
nach Teilung und nach Autonomie,<br />
wobei sich hinter der nach Autonomie meistens<br />
die Absicht verbarg, ganz Mazedonien einzuheimsen.<br />
Die Balkankriege brachen am 18.Oktober<br />
1912 aus. Sie waren der Auftakt zu einem langen,<br />
sechsjährigen Krieg, der mit kleinen Unterbrechungen<br />
bis 1918 dauerte. Mazedonien war einer<br />
der Haupt-Kriegsschauplätze. Der amerikanische<br />
Schriftsteller Stoyan Christowe schildert<br />
in seinem Buch Heroes and Assassins ein bizarres<br />
Detail zum Beginn der beiden Balkankriege:<br />
Todor Lazarov, ein Mazedonier aus Bulgarien,<br />
der glaubte, dass seine Heimat nach dem Sturz<br />
des Osmanischen Reichs endlich frei sei, erschoss<br />
sich vor Freude selbst. Er wusste nicht,<br />
dass die balkanischen Verbündeten im Jahr 1912,<br />
noch vor ihrer Kriegserklärung an die Türkei,<br />
Mazedonien heimlich untereinander aufgeteilt<br />
hatten. Dieses Geschehnis ist vielleicht eine gute<br />
Illustration der kranken politischen Gemüter<br />
der Mazedonier im Jahr 1912.<br />
Nach mehrhundertjähriger Herrschaft brach<br />
das Osmanische Reich innerhalb von nur anderthalb<br />
Monaten zusammen. In Mazedonien hatte<br />
es 517 Jahre lang geherrscht.<br />
Die Unterzeichnung eines Friedensvertrags<br />
zwischen der Balkan-Allianz und dem Osmanischen<br />
Reich in London (30.5.1913) war nur eine<br />
kurze Verschnaufpause auf dem Weg zu einem<br />
neuen kriegerischen Zusammenstoß, jetzt aber<br />
zwischen Bulgarien und den anderen beiden<br />
Mitgliedern der Allianz. Dieser Krieg begann<br />
am 29. Juni 1913. Das mazedonische Volk befand<br />
sich plötzlich in einem Sandwich. Laut den<br />
Daten der Carnegie-Kommission, die sich nur<br />
auf den ägäischen Teil Mazedoniens beziehen,<br />
wurden rund 170 Dörfer und 16.000 Häuser<br />
von der griechischen Armee zerstört. Die Städte<br />
Voden, Njeguš, Strumica, Kukuš und Dojran<br />
wurden schwer beschädigt. Unter dem Druck,<br />
den der griechische Terror ausübte, verließen<br />
über 100.000 „Slawo-Mazedonier“ das Land.<br />
(Goce Delčev, der wichtigste revolutionäre<br />
Anführer der Mazedonier, stammte aus Kukuš,<br />
einem der Zentren der mazedonischen Wiedergeburt<br />
in unmittelbarer Nähe von Saloniki. Am<br />
4. Juli 1913 steckte die griechische Armee bei<br />
einer Operation ethnischer Säuberungen die<br />
Stadt und noch vierzig Dörfer um sie herum in<br />
Brand. Laut dem angesehenen mazedonischen<br />
Historiker Ivan Katardžiev, dessen Buch Mazedonien<br />
hundert Jahre nach dem Ilinden-Aufstand<br />
ich für die Zwecke dieses Textes herangezogen<br />
habe, wandte die griechische Armee diese Methode<br />
ethnischer Säuberung überall an, wo sie<br />
nur konnte, sogar in den Teilen Mazedoniens,<br />
die unter serbischer Besatzung standen.)<br />
Miroslav Krleža, einer der bedeutendsten<br />
jugoslawischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts,<br />
wirft in einer seiner 99 Variationen einen<br />
interessanten Blick auf die beiden Balkankriege;<br />
den ersten, in dem die Türken vom Balkan<br />
vertrieben wurden, und den zweiten, in dem<br />
Griechenland, Bulgarien und Serbien um das<br />
Territorium Mazedoniens kämpften:<br />
„Das Blut von Kumanovo war noch nicht<br />
getrocknet, als nur acht Monate später die<br />
Schlacht an der Bregalnica wie mit einem Kanonenschlag<br />
alle lyrischen Illusionen zerstörte,<br />
von denen ganze südslawische Generationen<br />
geglaubt hatten, sie seien Teil des Überlebens<br />
unseres Volkes. Im Qualm und im Feuer der<br />
Bregalnica-Schlacht (Juli 1913) lernten wir,<br />
dass der zynische Machiavellismus der kleinen<br />
Balkan-Dynastien Realität war, während Lisinskis<br />
Partitur, die illyrischen Phantasmagorien,<br />
die Džakovaćsche Idylle und die Sehnsucht<br />
nach Prizren nur schnöde Rhetorik waren. Das<br />
Saldokonto der europäischen Banken von Sankt<br />
Petersburg bis Berlin und Paris lombardierte<br />
die Symbole von Kumanovo zu seinen Gunsten,<br />
und uns (Engelsschen) wurde erklärt, dass<br />
nicht die Sopoter Fresken die Welt regieren,<br />
sondern die Banken, die Könige und die Kanonen.<br />
Wir befanden uns vor einem Leninschen<br />
‚merkwürdig abstoßenden‘ Zusammenbruch<br />
der europäischen Zivilisation, am imperialistischen<br />
Magnetpol von Kriegen und Massakern,<br />
die nunmehr seit vierzig Jahren andauern.“<br />
Nach der Niederlage Bulgariens fanden<br />
vom 28. Juli bis zum 10. August 1913 in Bukarest<br />
Friedensverhandlungen statt. Am 10. August<br />
1913 wurde der Bukarester Friedensvertrag unterzeichnet.<br />
Mit diesem Vertrag wurde Mazedonien<br />
dreigeteilt.<br />
Die Periode zwischen den Balkankriegen<br />
und dem Beginn des Ersten Weltkriegs (29. Juli<br />
1914) bis zum Kriegseintritt Bulgariens auf der<br />
Seite Deutschlands und Österreich-Ungarns<br />
unterschied sich in Mazedonien wenig von der<br />
Zeit vor der Unterzeichnung des Bukarester<br />
Vertrags. Wie Katardžiev sagt: Alles, was dem<br />
mazedonischen Volk zukünftig zustoßen sollte,<br />
resultierte aus den Ergebnissen der Balkankriege<br />
– aus der Teilung.<br />
***<br />
* Die Grenze ist fest im Land verwurzelt.<br />
Von ihrer ursprünglichen Herkunft zeugen<br />
zahlreiche Termini in fast allen menschlichen<br />
Sprachen. Sehr oft bedeutet die Grenze eine<br />
Furche, die die Pflugschar im Boden hinterlässt.<br />
Für die Welt zur Zeit der Latiner ist die Spur des<br />
Pflugs die Urfurche, jene ursprüngliche Furche,<br />
die den städtischen Raum begründete und den<br />
städtischen Horizont bezeichnete; sie ist die<br />
Linie, die die Stadt vom Dorf trennt, das Innere<br />
vom Äußeren. Doch noch mehr als das: Mit dem<br />
Pflug die Grenze zu bezeichnen bedeutet, die<br />
Beziehung von Erde und Himmel zu besiegeln.<br />
Diesen Ort haben nicht die Menschen ausgewählt,<br />
sondern die Götter entdeckt, und derjenige,<br />
der die Furche zieht, ist mehr Priester als<br />
Herrscher.<br />
In diesem ersten Einkerben des Bodens gibt<br />
es etwas von einem Opfer, liegt der Keim der archaischen<br />
Gewalt. Rom zum Beispiel entsteht,<br />
als Romulus Remus opfert, der es in seiner<br />
Dreistigkeit gewagt hat, die heilige, gerade erst<br />
gezogene Grenze zu überspringen und so zu<br />
negieren. Das Herumspielen mit Grenzen kann<br />
ausgesprochen gefährlich werden; bei ihnen<br />
sind das Tragische und das Komische eng miteinander<br />
verbunden.<br />
Das italienische Wort für Grenze, frontiera,<br />
so wie auch das spanische frontera, das französische<br />
frontière und das englische frontier – alle<br />
diese Worte beinhalten das Nomen „Front“. Die<br />
Linie, die der Herrscher mit dem Lineal (auf<br />
Lateinisch regula) zieht, bestimmt nicht nur<br />
das räumliche Territorium, sondern stellt auch<br />
eine regula dar, eine Regel, an die wir uns halten<br />
müssen, um aufrecht zu bleiben.<br />
Aus dem Mazedonischen von<br />
Benjamin Langer<br />
Nikola Gelevski<br />
Geboren 1964 in Skopje. Er studierte Komparatistik<br />
und leitet seit 1989 den Verlag Templum.<br />
Als prominentester Kolumnist des Jahres erhielt<br />
er 2007 den Borjan-Tanevski-Preis. Neben<br />
seiner Arbeit als Verlagsleiter, Redakteur,<br />
Übersetzer und Autor gründete er den Verein<br />
Kontrapunkt und ist Mitbegründer dreier weiterer<br />
Vereine (Točka, Ploštad Sloboda, GEM).<br />
Beton International März 2014 29
László Végel<br />
1914: Das Ende<br />
der Utopie Europa<br />
Mein Vater wurde 1914 geboren, in dem<br />
Jahr, in dem der Erste Weltkrieg ausbrach. Wer<br />
hätte damals gedacht, dass man in diesem Jahr<br />
den Grundstein für das Versailler Testament legen<br />
würde. Und ich wurde zu Beginn des Zweiten<br />
Weltkriegs geboren, 1941, in dem Jahr, in<br />
dem auch in meiner Heimat der Krieg ausbrach.<br />
Mein Vater wurde ein Kind von Versailles, ich<br />
ein Kind des Zweiten und gleichzeitig Enkel<br />
des Ersten Weltkriegs. Der eine Krieg nahm<br />
sein Ende mit Versailles, der andere mit Jalta.<br />
In der ersten Hälfte meines Lebens konnte ich<br />
als Enkel nicht an 1914 denken, denn das Europa<br />
von Versailles wurde vom Europa von Jalta<br />
überschattet, das mein Leben bestimmte, und<br />
erst der Fall der Berliner Mauer lenkte meine<br />
Aufmerksamkeit auf den Ersten Weltkrieg. Es<br />
folgten die Jugoslawienkriege, durch die mir<br />
bewusst wurde, dass die Europäische Union,<br />
wie wir sie heute kennen, auf den Grundlagen<br />
gebaut wurde, die man in Versailles gelegt hatte:<br />
dem Bund der Nationalstaaten.<br />
Die Kriege waren im Grunde die logische<br />
Fortsetzung von 1914.<br />
Dieses Paradigma erlebte ich in zwei Parallelwelten.<br />
Die eine war die des Staates, die andere die<br />
der Nation.<br />
Ich wurde in der Vojvodina geboren, die<br />
nach dem Ersten Weltkrieg von der zusammengebrochenen<br />
Österreichisch-Ungarischen<br />
Monarchie abgespalten worden war. Ich bin in<br />
zwei Kulturen aufgewachsen, die bezüglich der<br />
Interpretation dieser Jahreszahl im Konflikt<br />
miteinander standen.<br />
Die eine Kultur wurde durch den jugoslawischen<br />
Staat repräsentiert, der in 1914 das<br />
Heldenepos der Staatsgründung sah. Der Held<br />
dieses Epos war Gavrilo Princip, der Mörder des<br />
österreichischen Thronfolgers. Daraus folgte,<br />
dass die Verfasser des Vertrags von Versailles<br />
als die Verkörperung der historischen Gerechtigkeit<br />
betrachtet wurden. 1914 stand also für<br />
den Beginn der Befreiung der Kroaten, Slowenen,<br />
Vojvodiner Serben und anderen Völker<br />
dieses Gebiets.<br />
Mit der Zeit bekam das Heldenepos jedoch<br />
tragische Risse. Weshalb zerfiel das Land 1941<br />
auf eine so grausame Weise, wenn seine Völker<br />
das Zusammenleben doch so sehr wollten<br />
Die ans Tageslicht gekommenen Dokumente<br />
zeugten davon, dass Serbien 1918 nicht sonderlich<br />
von der Idee Jugoslawiens begeistert<br />
war, sondern eher die Vorstellung von einem<br />
Groß-Serbien pflegte, dass die serbischen Politiker<br />
jedoch nichts anderes tun konnten, als zu<br />
akzeptieren, was Versailles ihnen aufoktroyiert<br />
hatte. Dann wird eben ganz Jugoslawien serbisch,<br />
sagte Nikola Pašić, der einflussreichste<br />
Politiker der damaligen Zeit.<br />
Dieses Unternehmen endete 1941 mit einer<br />
schlimmen Niederlage.<br />
Das Königreich Jugoslawien zerfiel im Zweiten<br />
Weltkrieg völlig. Josip Broz Tito gelang es<br />
jedoch, es wieder zusammenzuschustern, wobei<br />
er nicht mehr auf den Zusammenhalt der<br />
Slawen, sondern die Ideologie des Sozialismus<br />
baute. Über die Einhaltung des Friedensvertrags<br />
von Versailles wachten die jugoslawischen<br />
Kommunisten je nach Bedarf mit Terror, Diktatur<br />
oder einem Sozialismus mit menschlichem<br />
Antlitz. Denn Jugoslawien stellte genauso wie<br />
die Tschechoslowakei eine unlösbare Aufgabe<br />
dar, da das Erbe der einstigen Monarchie, die<br />
Idee des Vielvölkerstaates, bis in die Staatsfundamente<br />
eingesickert war. Der Zusammenbruch<br />
des Sozialismus zerschlug jedoch zwangsläufig<br />
auch Jugoslawien und es kam zum furchtbaren<br />
Balkankonflikt, dessen Ausgang zeigte, dass der<br />
Versailler Plan konsequent umgesetzt werden<br />
musste und man nicht umhinkam, auch in diesem<br />
Teil Europas Nationalstaaten zu gründen.<br />
Zu Recht empörte sich die westliche Welt<br />
beim Anblick des schmutzigsten Krieges, der in<br />
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa<br />
stattfand, dachte jedoch nicht daran, dass<br />
es dabei um die Verwirklichung genau der Ideale<br />
ging, die einst von ihr vorgeschlagen worden<br />
waren, mit denen sie die Erscheinung Mittelosteuropas<br />
nach ihrem eigenen Bild hatte umformen<br />
wollen. Die mit solcher Missbilligung<br />
verfolgten Jugoslawienkriege waren die Reinkarnation<br />
der Ideale, die im Ersten Weltkrieg<br />
geboren worden waren. Die Vielvölkerstaaten<br />
des östlichen Europas zerfielen, und dieser Prozess<br />
war in Jugoslawien blutig und grausam.<br />
Der Plan von Versailles wurde ohne Kompromisse<br />
umgesetzt.<br />
Der andere, diametral entgegengesetzte<br />
Pol, unter dessen Einfluss ich aufwuchs, war<br />
die ungarische Kultur. In ihrer Interpretation<br />
ist 1914 die Jahreszahl, die für die tragischste<br />
Periode in der Geschichte der Nation steht.<br />
Das Land ließ sich in einen Krieg reißen, den<br />
es nicht gewollt hatte. Dem ungerechten Krieg<br />
folgte ein ungerechter Frieden. Die bedeutendsten<br />
Intellektuellen des Landes erhoben 1914<br />
ihre Stimmen gegen den Krieg, und auch sie,<br />
also nicht nur die Nationalisten, sondern auch<br />
die Schriftsteller und Künstler, deren Denken<br />
der europäischen Kultur verpflichtet war, erlebten<br />
den Friedensvertrag von Trianon, der<br />
das Land auf eine Art verstümmelte, wie man es<br />
im 20. Jahrhundert nirgendwo anders gesehen<br />
hatte, als einen Schock.<br />
Ich wuchs zwischen zwei einander widersprechenden<br />
„Wahrheiten“ auf, und in diesem<br />
Vakuum wurde mir klar, dass Europa aus 1914<br />
folgende Lehre gezogen hatte: Man würde in<br />
seinem ethnisch bunten, chaotischen Teil auf<br />
Kosten vieler Millionen verschiedenen ethnischen<br />
Minderheiten angehörenden Menschen<br />
Nationalstaaten errichten.<br />
Das Jahr 1914 stellte Europa die größte Falle<br />
des 20. Jahrhunderts. Danach versuchte es über<br />
hundert Jahre lang, sich wieder aus ihr heraus<br />
zu manövrieren. Gewiss, gegen Ende des Jahrhunderts<br />
gelang es ihm, diese Falle komfortabel<br />
einzurichten, so dass es nun scheint, es werde<br />
nicht zu einem erneuten Krieg kommen. Für<br />
den Frieden bezahlt es jedoch einen hohen<br />
Preis: Die Möglichkeit eines einheitlichen Europas<br />
musste geopfert werden. Denn die Europäische<br />
Union von heute ist eine Antwort<br />
auf 1914, und zur endgültigen Formulierung<br />
dieser Antwort kam es bereits 1918 in Versailles,<br />
als man die neue, in Nationalstaaten definierte<br />
Europakarte festlegte. Davon hatte man<br />
in den Staatskabinetten und Schützengräben<br />
geträumt. Schlimmer als das war nur noch der<br />
tragische Versuch, die Lage zu verändern: der<br />
Zweite Weltkrieg und der Vertrag von Jalta, den<br />
man als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg verstehen<br />
kann.<br />
Allerdings wurde Jalta 1989 von Versailles<br />
besiegt, wodurch dem europäischen Bund der<br />
Nationalstaaten, der Europäischen Union, freie<br />
Bahn geschaffen wurde. Jetzt kämpft man mit<br />
dem Dilemma, ob ein föderales Europa geschaffen<br />
oder die Form des lockeren Bundes von Nationalstaaten<br />
beibehalten werden soll, in dem<br />
die Macht der politischen Eliten nicht maßgeblich<br />
beschränkt wird. In Brüssel versucht man<br />
also, sich die Pergamentpapiere von Versailles<br />
zu erschließen, deren erste Sätze 1914 geschrieben<br />
wurden. Die Nationalstaaten schlagen nun<br />
energisch zurück, wobei der schlimmste Schlag<br />
heute gerade aus dem Osten kommt, aus den<br />
Ländern, die im Namen der Nationalstaatlichkeit<br />
vom Westen legitimiert wurden. Europas<br />
östlicher Teil, vor allem Mittelosteuropa,<br />
nimmt das Europa von Versailles ernst.<br />
Das ist die Falle, in der Europa sitzt. 1914<br />
bedeutet in Wirklichkeit den Anfang des Endes<br />
der Utopie Europa, und die seitdem vergangenen<br />
hundert Jahre handelten von der Sisyphos-<br />
Geschichte des Versuchs, wieder das hervorzuzaubern,<br />
was vor 1914 zum Greifen nah gewesen<br />
war.<br />
In die Falle von 1914 bin ich im Grunde<br />
durch meinen Roman Neoplanta oder das Land<br />
des Versprechens geraten. Mich interessierten<br />
nicht die Helden, die die „Geschichte machten“,<br />
sondern die Durchschnittsmenschen. Lazo<br />
Pavletić, der Protagonist des Romans, wird in<br />
Zagreb zur österreichischen Armee eingezogen.<br />
Der aus einem Dorf in der Gegend von Knin<br />
stammende junge serbische Bauer bestaunt<br />
in Zagreb die Fiakerkutscher, in seinen Augen<br />
sind sie die echten feinen Herren. Als Anhänger<br />
Franz Josephs denkt er warmen Herzens an den<br />
Kaiser und an das österreichische Herrscherhaus,<br />
vor allem an Leopold und Maria Theresia,<br />
die den in den Grenzgebieten lebenden Serben<br />
verschiedene Privilegien zugesichert und Land<br />
an sie verteilt hatten, damit sie das Habsburgische<br />
Reich gegen die Türken verteidigten.<br />
Zu seinem Unglück wird er jedoch an die<br />
serbische Front geschickt, wo er gegen seine<br />
serbischen Landsleute kämpfen muss. Als<br />
ahnte der junge Mann den Plan von Versailles<br />
bereits, also dass in Mittelosteuropa die Zeit<br />
der Nationalstaaten gekommen ist, versucht<br />
er, sich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass<br />
er zum Beispiel gegen die Franzosen gerne an<br />
der Seite des Kaisers kämpfen würde, es gegen<br />
die Serben jedoch nicht könne. Der „Übertritt“<br />
geht mit einer starken inneren Zerrissenheit<br />
einher, denn in seinen Träumen erscheint ihm<br />
Kaiser Franz Joseph, der ihn für das Brechen<br />
seines Eides schilt, dafür, nun mit den serbischen<br />
Truppen gegen die Österreicher, Kroaten<br />
und Ungarn zu kämpfen. Pavletić erleidet die<br />
Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs, kämpft<br />
bis zum Schluss und zieht an der Spitze der siegreichen<br />
serbischen Truppen in Novi Sad ein, wo<br />
er einen herrenlosen Fiaker findet und sich so<br />
erfüllen kann, wovon er 1914 geträumt hat: Er<br />
wird Fiakerkutscher.<br />
Sein Leben steht für die mittelosteuropäische<br />
Geschichte nach 1914. Er wurde gleichzeitig<br />
zum Sieger und zum Opfer von 1914 und ließ<br />
sich in einer ethnisch gemischten Region nieder,<br />
wo Deutsche, Serben, Ungarn, Rumänen,<br />
Slowaken und viele andere zusammenlebten,<br />
die aus einer imperialen Situation in die Falle<br />
der Nationalstaaten geraten waren. In Abhängigkeit<br />
von den gerade aktuellen Verhältnissen<br />
änderten sich in den nächsten Jahrzehnten die<br />
Gesellschaftssysteme, die Namen der Straßen<br />
und Plätze, die Besitzverhältnisse, die Landkarten<br />
und Stadtpläne, die Mörder und Opfer.<br />
Wenn es sein musste, wechselten die Menschen<br />
ihre Identitäten; die Ehefrau gab sich mal als<br />
Slowakin aus, mal als Ungarin, stets, um ihre Familie<br />
zu retten. Es hatte dort in den Menschen<br />
eine grundlegende Solidarität gegeben, die sie<br />
jedoch aufgeben mussten, um ihr eigenes Leben<br />
zu retten, um Überlebende zu bleiben. Das Zeitalter<br />
der Massengräber begann. Man konnte<br />
nicht einmal genau voraussagen, wer von ihnen<br />
Mörder und wer Opfer sein würde.<br />
1914 bedeutete also den Sieg des Nationalismus.<br />
Es hat sich endgültig herausgestellt, dass<br />
die Geschichte den europäischen Menschen<br />
besiegt hat. Der Sieger, die Geschichte, ist zwar<br />
zivilisierbar, heute sind wir ja Zeugen eben dieses<br />
Prozesses, die Niederlage des Menschen ist<br />
jedoch endgültig. Ganz gleich, was für einen Namen<br />
wir dieser Niederlage geben – Wirtschaftskrisen,<br />
Macht des freien Marktes, nationale<br />
Interessen –, gewiss ist, dass die Europäer den<br />
Ersten Weltkrieg 1914 verloren haben. Sie können<br />
sich lediglich glücklich schätzen, den Frieden<br />
erschaffen zu haben, indem sie geschlagen<br />
wurden.<br />
Aus dem Ungarischen von<br />
Timea Tankó<br />
László Végel<br />
Geboren 1941 in Srbobran, damals Königreich<br />
Jugoslawien; er lebt in Novi Sad / Serbien. Er veröffentlichte<br />
mehrere mit Preisen bedachte Romane,<br />
Essaybände sowie Theaterstücke. Zuletzt auf<br />
Deutsch: Exterritoritum. Szenen vom Ende eines<br />
Jahrtausends; Bekenntnisse eines Zuhälters sowie<br />
Sühne (alle im Verlag Matthes & Seitz).<br />
Beton International März 2014 30
Saša Ilić<br />
DER ZUSAMMENBRUCH DER<br />
EUROPÄISCHEN LINKEN<br />
1914 durch die Augen der sozialdemokratischen<br />
Zeitschrift „Borba“ betrachtet<br />
Ich dachte an Dimitrije Tucović, sein Buch<br />
über Albanien und seinen traurigen Tod. Ich<br />
dachte daran, wie das Rad jenes Mechanismus,<br />
gegen den er mutig und tapfer angekämpft<br />
hatte, ihn unter sich begrub wie einen<br />
Fetzen. Seine leuchtende Gestalt bringt uns<br />
Trost, sie zeigt, dass an unseren Horizonten<br />
nicht alle Fahnen hoffnungslos zu Boden<br />
gefallen sind. Der Tod Dimitrije Tucovićs<br />
und die dunkelblaue, stille, melancholische<br />
Agonie von Svetozar Marković sind Ereignisse,<br />
die wie Wegzeichen am Anfang unseres<br />
Weges in die Zivilisation stehen.<br />
Miroslav Krleža<br />
Der Anfang des Jahres 1914 wird in journalistischen<br />
Texten, aber auch in der Literatur als<br />
fröhlich und sorglos beschrieben, als eine Periode,<br />
in der Europa nicht einmal ahnte, dass bald<br />
eine Verwüstung einsetzen würde, in welcher,<br />
wie Slavoj Žižek in seinem Essay über Lenins<br />
Erbe schreibt, eine ganze Welt verschwinden würde.<br />
Dieses Verschwinden der Welt fand nicht auf<br />
einmal statt, sondern hatte eine Vorgeschichte in<br />
der Entwicklung des europäischen Militarismus<br />
und Kapitalismus, die im Jahr 1914 ihren Höhepunkt<br />
erreichte. Für eine genauere Betrachtung<br />
dieser Periode ist es nützlich, einige linksgerichtete<br />
Parteizeitungen aus der damaligen Zeit<br />
durchzublättern, in denen von einer Ausgabe zur<br />
nächsten die Regungen der europäischen Politik<br />
mitverfolgt wurden. Eine solche Parteizeitung<br />
war „Borba“, das Blatt der Serbischen Sozialdemokratischen<br />
Partei, gegründet 1903 und geleitet<br />
von Dimitrije Tucović. Dieses Blatt stellt<br />
heute ebenso wie Tucovićs politisches Erbe die<br />
verdrängten Erinnerungen Europas dar, denn<br />
die Geschichte dieser Partei war ein wichtiger<br />
Teil der Geschichte der europäischen Linken,<br />
die sich damals rund um die Zweite Internationale<br />
organisiert hatte. Zum anderen können uns<br />
die kompromisslosen kritischen Gedanken von<br />
Dimitrije Tucović und sein Aufzeigen akuter<br />
gesellschaftlicher Probleme helfen, zahlreiche<br />
finstere Ereignisse jener Zeit zu verstehen. Darunter<br />
sind gewiss auch Attentate und politische<br />
Gewalt sowie Handlungen, die ein ganzes Jahrhundert<br />
in Serbien markierten, vom Mai-Umsturz<br />
1903 bis hin zum Attentat auf den ersten<br />
demokratischen Premier Serbiens Zoran Đinđić<br />
im März 2003.<br />
neral Živojin Mišić für Waffen so viel ausgeben<br />
konnte, wie er wollte, ohne irgendjemandem<br />
Rechenschaft ablegen zu müssen. Zu dieser Zeit<br />
gab es eine Affäre rund um die Ermordung eines<br />
Soldaten durch einen gewissen Major Vemić.<br />
Die SSDP bestand darauf, die Umstände dieses<br />
Mordes zu klären und den Schuldigen zu bestrafen,<br />
der Mörder wurde aber trotzdem begnadigt.<br />
In „Borba“ wird vermerkt, dass die bourgeoise<br />
Opposition gegenüber der stärksten politischen<br />
Strömung in Serbien, also den Offizieren, eine<br />
servile Haltung an den Tag legte; die Offiziere<br />
hätten zu diesem Zeitpunkt eine viel größere<br />
Macht in ihren Händen gehabt, als es anzunehmen<br />
gewesen sei. Das allgemeine Klima kam<br />
dieser begünstigten Klasse zu Gute, weil so wie<br />
in anderen europäischen Ländern immer größere<br />
Geldsummen in die Armee flossen, sodass die<br />
Armee nicht nur über militärische, sondern auch<br />
über politische Macht verfügte, die im Zusammenspiel<br />
mit dynastischen imperialen Bestrebungen<br />
zu einem unumgänglichen Faktor bei<br />
der Zukunftsplanung wurde. Besondere Formationen<br />
innerhalb der Armee und der Polizei gehen<br />
auf diese Zeit zurück. Im Laufe des zwanzigsten<br />
Jahrhunderts entwickeln sie sich zu diversen<br />
Derivaten innerhalb des militärischen und<br />
staatlichen Sicherheitsdienstes – Ozna, Udba,<br />
Kos, RDB, BIA – und auch zu geheimen und gefährlichen<br />
Sondereinheiten, deren Tätigkeit in<br />
der Geschichte einen finsteren Bogen von der<br />
„Schwarzen Hand“ bis zu den „Roten Baretten“<br />
schlägt.<br />
Tucovićs ökonomischer Rückblick<br />
In „Borba“ erschien Anfang 1914 ein interessanter<br />
Rückblick von Dimitrije Tucović auf<br />
die wirtschaftlichen Verhältnisse im Vorkriegseuropa.<br />
Als wichtigste Tatsache unterstreicht<br />
er die enorme Verteuerung des Geldes, zu der<br />
es gekommen war, weil das Geld aufgrund von<br />
Instabilität und Furcht vor möglichen Krisen<br />
und Kriegen vom Markt abgezogen wurde.<br />
Aus den europäischen Banken sei mehr<br />
als eine Milliarde Kronen abgezogen worden,<br />
schreibt Tucović und führt an, dass die Zinsen<br />
im Laufe des Jahres 1913 das höchste Niveau<br />
in den letzten vierzig Jahren erreicht hätten.<br />
Europa stürzte sich in einen fieberhaften Rüstungswettlauf,<br />
in europäischen Klubs wurden<br />
Schulden aufgenommen (Paris und London).<br />
Der sozialdemokratische Anführer vermerkt,<br />
dass die Balkankriege die Kriegsparteien rund<br />
drei Milliarden Dinar gekostet hätten, wovon<br />
allein Serbien 430 Millionen Dinar ausgegeben<br />
(also an Schulden aufgenommen) habe.<br />
Überraschenderweise überstiegen die neuen<br />
Militärkredite europäischer Großmächte im<br />
Laufe des Jahres 1913 bei weitem die Kosten für<br />
die Kriege auf dem Balkan. Tucović beschreibt<br />
Europa vor dem Krieg folgendermaßen: „Die<br />
Balkankriege riefen auf allen Seiten fieberhafte<br />
Kriegsvorbereitungen hervor: Die Größe der<br />
Armee wird in Friedenszeiten gesteigert, der<br />
Militärdienst wird verlängert, es werden neue<br />
Waffen für mehr Soldaten bestellt, Kriegsschiffe<br />
werden gebaut, Verteidigungsanlagen und<br />
strategische Eisenbahnlinien werden errichtet,<br />
es werden Gewehre und Kanonen bestellt. […]<br />
Das ökonomische Fundament der bourgeoisen<br />
Gesellschaft biegt sich und knackt.“ Die Diskrepanz<br />
zwischen dem Einkommen der Arbeiterklasse<br />
und ihrer Wertschöpfung werde nämlich<br />
immer größer. Um seinen Lesern vor Augen zu<br />
führen, in welche Richtung sich das kapitalisti-<br />
sche Europa bewegte, führte Tucović statistische<br />
Daten an, denen zufolge die europäischen<br />
Großmächte in den letzten fünf Jahren rund 46<br />
Milliarden Dinar für Waffen ausgegeben hatten,<br />
und zwar im Detail folgendermaßen: Österreich<br />
– 4,5 Milliarden, Deutschland – 10, Italien – 3,5,<br />
Russland – 12, Frankreich – 8 und England – 8.<br />
Diese wirtschaftliche Lage hatte zur Folge, dass<br />
die Arbeitslosigkeit außerhalb der Waffenindustrie<br />
stieg. Im Vergleich zu 1912 stieg die Arbeitslosigkeit<br />
im Jahr 1913 in Textilindustrie,<br />
Tischlerei, Bau und Maschinenbau von 15 Prozent<br />
auf 35 Prozent. Das wiederum führte zu<br />
einer zunehmenden Auswanderung aus Österreich-Ungarn.<br />
Allein im Jahr 1913 wanderten<br />
rund 350.000 Erwerbsfähige nach Amerika ab.<br />
Tucović schreibt, die gesamte Last der Krise sei<br />
auf die Schultern des Proletariats und der verarmten<br />
Volksmassen gefallen. Die Kriegsziele<br />
orientierten sich jedoch an einer anderen Logik,<br />
und so galten die hohe Verschuldung und<br />
die Unterdrückung des Proletariats als notwendiges<br />
Mittel zur Realisierung der Staatspläne.<br />
Als im Juni 1912 die serbische Regierung um<br />
einen außerordentlichen Militärkredit in der<br />
Höhe von zwei Millionen ansuchte, bewilligte<br />
die Volksversammlung die unglaubliche Summe<br />
von 21 Millionen. Regierungschef Dr. Milovan<br />
Đ. Milovanović gab dafür die folgende Erklärung<br />
ab: „Entweder vereinigt sich das serbische<br />
Volk, oder der ganze Balkan wird zu einem<br />
einzigen großen Friedhof ...“<br />
Krieg und Frieden<br />
Das politische Programm der Partei von Dimitrije<br />
Tucović beruhte auf den Prinzipien der<br />
deutschen Sozialdemokratie, genau genommen<br />
Offiziere und Radikale<br />
Dušan Popović, einer der Anführer der SSDP,<br />
beschrieb im Januar 1914 die Machtverhältnisse<br />
in Serbien folgendermaßen: „Dieses Regime<br />
ist noch nicht stabilisiert. Hier gibt es ständig<br />
zwei gegenteilige Strömungen – die zivile und<br />
die militärische, die demokratische und die reaktionäre.<br />
Andauernd streiten sich die beiden<br />
Schöpfer des Regimes darum: die Radikalen und<br />
die Offiziere.“ Diese Sichtweise der Innenpolitik<br />
Serbiens ist äußerst interessant, denn hier werden<br />
ganz klar zwei Strömungen markiert, die<br />
die beiden wichtigsten Vektoren der damaligen<br />
Zeit implementierten – den Kapitalismus und<br />
den Militarismus. Popović führt dabei an, dass<br />
die Offiziere Regierungen absetzten, sogenannte<br />
fusionierte und selbständige, beziehungsweise<br />
den Lebensrhythmus und die staatliche Politik<br />
diktierten, ganz genau so, wie sie im Mai 1903<br />
den „Umsturz“ bewerkstelligt hatten, als die militaristische<br />
Organisation „Schwarze Hand“ die<br />
letzten Mitglieder der Familie Obrenović – König<br />
Aleksandar und seine Frau Draga – massakrierte.<br />
Wenn es um Kriege ging (Balkankriege<br />
1912-1913), war das Wort des Generalfeldmarschalls<br />
Putnik ausschlaggebend, während Ge-<br />
Beton International März 2014 31
auf den Prinzipen des Erfurter Programms, das<br />
außer von August Bebel auch vom Philosophen<br />
und Sozialdemokraten Karl Kautsky geschrieben<br />
worden war, dessen Texte in fast jeder Ausgabe<br />
der Belgrader Zeitung „Borba“ erschienen.<br />
Tucović und seine Mitarbeiter orientierten sich<br />
stark an den sozialdemokratischen Ideen aus<br />
Deutschland und gaben sich große Mühe, die<br />
Prinzipien des Erfurter Programms – Kampf<br />
für ein allgemeines Wahlrecht, Achtstundentag<br />
und Schutz der Arbeiterrechte – in ihre eigene<br />
Politik einzubauen. Eine erste Missstimmung<br />
entstand jedoch nach der Annexion von Bosnien<br />
und Herzegowina, worüber Tucović 1910<br />
beim Kongress der Internationale in Kopenhagen<br />
öffentlich sprach. Bei dieser Gelegenheit<br />
sagte er, seine Partei sei angesichts der großen<br />
Kriegsgefahr völlig allein gelassen und von der<br />
österreichisch-ungarischen Sozialdemokratie<br />
wider Erwarten im Stich gelassen worden. Erhofft<br />
hatte er sich „den energischsten Protest<br />
gegen eine koloniale Politik und gegen die Versklavung<br />
des Volkes, wie sie von den Machthabern<br />
Österreich-Ungarns ausgeübt wird.“ Wenn<br />
im Zuge der Annexion von Bosnien und Herzegowina<br />
die Rede davon sei, dass irgendwelche<br />
Rechte verletzt worden seien, betonte Tucović<br />
bei dieser Gelegenheit, dann müsse man sagen,<br />
dass „die Rechte der Türkei verletzt wurden,<br />
und nicht jene Serbiens“. Dabei rief er auf, einen<br />
echten sozialdemokratischen Standpunkt einzunehmen,<br />
der „das Recht eines jeden Volkes auf<br />
Selbstbestimmung und damit auch das entsprechende<br />
Recht der Völker in Bosnien und Herzegowina“<br />
voraussetzen würde. Obwohl Tucović<br />
bei den anwesenden Delegierten auf Wohlwollen<br />
stieß, wurde sein Antrag am Ende der Ansprache<br />
nicht angenommen: Er hatte die „Genossen aus<br />
den großen kapitalistischen Staaten“ dazu aufgerufen,<br />
„zum Zwecke des Zurückdrängens der<br />
kolonialen Politik sich mit den sozialdemokratischen<br />
Bewegungen kleinerer Völker zu verbünden“.<br />
Trotz der offensichtlichen Isolierung der<br />
Sozialdemokratie setzte die Partei Tucovićs ihre<br />
Arbeit im Inland konsequent fort, eingezwängt<br />
zwischen dem starken Einfluss Russlands und<br />
der Kriegspolitik der Karađorđević-Dynastie.<br />
Als die Entscheidung über die Aufnahme von<br />
Kriegskrediten getroffen werden musste, waren<br />
die Delegierten aus den Reihen der SSDP die einzigen,<br />
die dagegen stimmten. Als einzige in ganz<br />
Europa, wie sich dann herausstellte. Slavoj Žižek<br />
schreibt über diesen Moment des Umbruchs, als<br />
die Mehrheit der europäischen sozialdemokratischen<br />
Parteien sich für die patriotische Linie entschied,<br />
Folgendes: „Stellen Sie sich vor, wie viele<br />
angeblich unabhängige Intellektuelle, darunter<br />
auch Freud, zumindest für eine kurze Zeit der<br />
nationalistischen Versuchung erlegen waren. Im<br />
Jahr 1914 verschwand eine ganze Welt und riss<br />
nicht nur den bourgeoisen Fortschrittsglauben<br />
mit sich, sondern auch die begleitende sozialistische<br />
Bewegung.“<br />
Das Ende der Zeitschrift „Borba“<br />
Die letzte Ausgabe von „Borba“ erschien<br />
am 1. Juli 1914. Darin veröffentlichte Dimitrije<br />
Tucović die letzte Fortsetzung eines längeren<br />
Textes unter der Überschrift „Verfassungsund<br />
Parteikämpfe in Serbien“. Neben seinem<br />
Artikel erschien auch ein Text von F. Filipović<br />
über den russischen Imperialismus sowie eine<br />
Studie von Lily Braun über die Entwicklung der<br />
Frauenfrage bis zum 19. Jahrhundert. Alle Texte<br />
wurden noch vor dem Attentat von Sarajevo<br />
verfasst und übersetzt. Am Ende von Tucovićs<br />
Text steht das Datum 25. Juni 1914. Zwischen<br />
der Fertigstellung seines Textes und dem Erscheinen<br />
der letzten Ausgabe von „Borba“ fand<br />
die Explosion Europas statt. Die militaristische<br />
Organisation „Schwarze Hand“ hatte ein Dutzend<br />
der militantesten Mitglieder von „Jungen<br />
Bosnien“ im Umgang mit Handfeuerwaffen und<br />
kalten Waffen unterwiesen. Einigen aktuellen<br />
Medienberichten zufolge ging dieses Training<br />
in Vranje vor sich, in einer Schlucht namens<br />
Kazanđol. An der Ermordung des Thronfolgers<br />
Franz Ferdinand und seiner Frau in Sarajevo<br />
am 28. Juni 1914 ist nichts Romantisches oder<br />
Revolutionäres. Die Rede ist von einem Konflikt<br />
zweier dynastischer bourgeoiser Politiken<br />
auf dem Balkan, der später alle anderen Seiten<br />
mit sich in den Abgrund riss, sodass der Markt<br />
und die Wirtschaft Europas ebenso wie die<br />
billigen Arbeitskräfte im Krieg neu aufgeteilt<br />
werden konnten. Das europäische Proletariat<br />
musste noch warten, bis es sich unter dem Einfluss<br />
der neuen linken Kräfte aus der Sowjetunion<br />
organisieren konnte. Davon sprach und<br />
schrieb Tucović noch Jahre vor dem Ausbruch<br />
des Großen Krieges. Interessanterweise wurden<br />
die Mitglieder von „Jungen Bosnien“ im<br />
Unterschied zu den Sozialdemokraten in Jugoslawien<br />
breit rezipiert und gefeiert, in Serbien<br />
bis heute. Dimitrije Tucović stand mit seinen<br />
linken Ideen schließlich alleine da und kam am<br />
20. November 1914 im Alter von dreiunddreißig<br />
Jahren ums Leben. Die Rezeption seiner Ideen<br />
ist im heutigen Serbien verschwindend gering,<br />
in der europäischen Geschichte ist er so gut wie<br />
unbekannt. Die europäische Linke steckt heute<br />
wieder in einer Krise.<br />
Aus dem Serbischen von<br />
Mascha Dabić<br />
Saša Ilić<br />
Geboren 1972 in Jagodina / Serbien. Er studierte<br />
an der Philosophischen Fakultät in Belgrad.<br />
Bisher veröffentlichte er Erzählbände und die<br />
beiden Romane Berlinsko okno (Berliner Fenster,<br />
2005) und Pad Kolumbije (Der Fall der<br />
Raumfähre Columbia, 2010). Bis Ende 2013 war<br />
er einer der vier Herausgeber der kritischen<br />
serbischen Zeitung BETON. Gemeinsam mit<br />
Alida Bremer gründete er im Dezember 2013<br />
BETON INTERNATIONAL.<br />
Die elektronische Ausgabe von BETON<br />
INTERNATIONAL 2014 (Nr. 1) ist unter<br />
www.traduki.eu zu lesen.<br />
Impressum<br />
V.i.S.d.P.<br />
Dr. Alida Bremer<br />
www.alida-bremer.de<br />
Herausgeber<br />
Verein RK LINKS aus Belgrad / Serbien<br />
Verein KURS aus Split / Kroatien<br />
Lektorat und Korrektur<br />
Benjamin Langer<br />
Layout und Design<br />
Metaklinika, Beograd<br />
Die Herausgabe dieses Werks wurde gefördert durch TRADUKI, ein literarisches Netzwerk,<br />
dem das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik<br />
Österreich, das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, die Schweizer<br />
Kulturstiftung Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, das Goethe-Institut, die Slowenische<br />
Buchagentur JAK, das Ministerium für Kultur der Republik Kroatien, das Ressort Kultur der<br />
Regierung des Fürstentums Liechtenstein, die Kulturstiftung Liechtenstein, das Ministerium<br />
für Kultur der Republik Albanien und die S. Fischer Stiftung angehören.<br />
Illustratoren und Fotografen<br />
Lazar Bodroža – 4, 6, 22, 27, 28<br />
lazarbodroza.com<br />
Igor Hofbauer – 18<br />
Aleksa Jovanović – 28<br />
aleksa-jovanovic.blogspot.com<br />
Ivan Kostić – 2<br />
Metaklinika – 8, 9, 16, 20, 21, 25, 26, 32<br />
metaklinika.com<br />
Sandra Milanović – 5<br />
Danilo Milošev Wostok – 1, 10, 11, 30, 31<br />
facebook.com/DaniloMilosevWostok<br />
Milan Pavlović – 3, 12, 13<br />
milanpavlovic.net<br />
mrstocca.blogspot.com<br />
Turbosutra – 23<br />
Aus dem Familienalbum von Davor Korić – 17<br />
Beton International März 2014 32