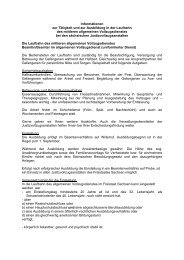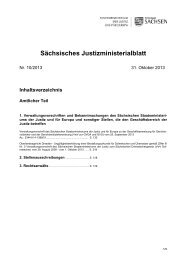Sachsenlandkurier 04/2011 [Download,*.pdf, 4,43 KB
Sachsenlandkurier 04/2011 [Download,*.pdf, 4,43 KB
Sachsenlandkurier 04/2011 [Download,*.pdf, 4,43 KB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sachsenland kurier<br />
Organ des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e. V., 22. Jahrgang, SLK 4 ’11 Ausgabe Juli/August <strong>2011</strong><br />
Themen des Heftes:<br />
Breitbandversorgung<br />
E-Government-Basiskomponenten<br />
4 ’11
Partner der sächsischen Kommunen<br />
� Wirtschaftsprüfung kommunaler Unternehmen (Eigenbetriebe,<br />
Eigengesellschaften)<br />
� Kommunale Steuerberatung (Betriebe gewerblicher Art � BgA)<br />
� Optimierung steuerlicher Gestaltungen<br />
� Unterstützung bei der Doppik-Einführung<br />
� Haushaltssicherungskonzepte<br />
� Gebühren- und Beitragskalkulationen<br />
MENOS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft<br />
Dresdner Straße 17, 01723 Wilsdruff<br />
Tel.: 0352<strong>04</strong> 682 0 Fax: 0352<strong>04</strong> 682 22<br />
www.menos-gmbh.de E-Mail: kanzlei@menos-gmbh.de<br />
�����������������������������������������<br />
������������������������<br />
Sie wollen den Energieverbrauch Ihrer Beleuchtungsanlagen senken und gleichzeitig<br />
die Beleuchtungsqualität verbessern? Nutzen Sie unsere Innovationskraft und schicken<br />
Sie uns auf die Suche nach Ineffi zienzen. Wir begleiten Sie durch den gesamten<br />
Lebenszeitraum Ihrer Beleuchtungsanlage.<br />
Ansprechpartner für Kommunen<br />
Roland Maiwald · Tel.: 0351 468-3<strong>43</strong>4 · E-Mail: Roland.Maiwald@enso.de · www.enso.de<br />
5202_Anz_Beleuchtung_175x125_ok.indd 1 25.03.2009 9:37:28 Uhr<br />
������������������������
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Zeitschrift des Sächsischen Städte- und Gemeindetages<br />
22. Jahrgang · SLK 4/<strong>2011</strong><br />
Ausgabe Juli/August<br />
Spruch des Monats<br />
„Auch der erste Schritt gehört zum Weg.“<br />
(Arthur Schnitzler, 1862–1931,<br />
österreichischer Erzähler und Dramatiker)<br />
Titelfoto: BilderBox-Bildagentur GmbH<br />
Der „<strong>Sachsenlandkurier</strong>“ (SLK) Kommunalzeitschrift<br />
für die Städte und Gemeinden, Organ des Sächsischen<br />
Städte- und Gemeindetages (SSG)<br />
Verantwortlich für den Herausgeber<br />
Geschäftsführer Mischa Woitscheck<br />
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht in<br />
jedem Fall die Meinung des Herausgebers wieder. Für<br />
die inhaltliche Richtigkeit von Fremdbeiträgen ist der<br />
jeweilige Verfasser verantwortlich.<br />
Anschrift<br />
Sächsischer Städte- und Gemeindetag e. V.<br />
Glacisstraße 3, 01099 Dresden<br />
Telefon: (03 51) 81 92 – 0, Telefax: (03 51) 8 19 22 22<br />
E-Mail: post@ssg-sachsen.de<br />
Internet: http://www.ssg-sachsen.de<br />
Gesamtherstellung<br />
SV SAXONIA VERLAG<br />
für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH<br />
Lingnerallee 3, 01069 Dresden<br />
Telefon: (03 51) 48 52 60, Fax: (03 51) 4 85 26 61<br />
Der SACHSENLANDKURIER erscheint 6 mal jährlich.<br />
Abonnenten erhalten den SLK als PDF-Datei auf Anfrage<br />
unter: post@ssg-sachsen.de kostenlos zugesandt.<br />
Bezugspreise<br />
– für Mitgliedsstädte und -gemeinden:<br />
ein Jahresabonnement: gebührenfrei<br />
je weiteres Abonnement: 26,00 �<br />
je Einzelheft: 4,00 �<br />
– für Nichtmitglieder:<br />
je Jahresabonnement: 30,00 �<br />
je Einzelheft: 5,00 �<br />
– für Studenten, Referendare und in Ausbildung<br />
Stehende sowie gewählte Stadt-, Gemeinde- und<br />
Ortschaftsräte und Fraktionen der Gemeinderäte:<br />
je Jahresabonnement: 26,00 �<br />
je Einzelheft: 4,00 �<br />
Alle Abonnementspreise einschließlich Versand- und Zustellgebühren.<br />
Bei Einzelheftbezug zuzüglich Versand- und<br />
Zustellgebühren. In den jeweiligen Bezugsgebühren ist die<br />
gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.<br />
Bestellungen<br />
Schriftlich an die Geschäftsstelle des SSG, Abbestellungen<br />
werden nur zum 30. Juni und zum 31. Dezember<br />
wirksam.<br />
Nachdrucke und Kopien<br />
Außer für Mitglieder nur mit ausdrücklicher Genehmigung<br />
des SSG; Quellenangabe erforderlich.<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Dr. Unger, Agentur für Kommunikation,<br />
Königsberger Str. 12a, 01324 Dresden<br />
Telefon: (03 51) 3 10 93 87, Funk (01 70) 3 12 84 99<br />
Werbeservice Franz<br />
Radeburger Straße 45, 01468 Volkersdorf<br />
Telefon: (03 52 07) 8 13 15<br />
Organ des Sächsischen Städte- und Gemeindetages<br />
Kommunalzeitschrift für die Städte und Gemeinden<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Breitbandversorgung<br />
209 Frank Kupfer<br />
Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum Sachsens<br />
211 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr<br />
Breitbandausbau in Sachsen<br />
213 Bernd Reichmann<br />
Breitbanderschließung des Ortsteils Rothenthal und<br />
des Gewerbegebietes der Stadt Olbernhau<br />
215 Alexander Handschuh, Carsten Hansen<br />
Die Breitbandanbindung ist ein „Muss“ wie Wasser und Straßen<br />
E-Government-Basiskomponenten<br />
218 Dr. Wilfried Bernhardt<br />
E-Government als gemeinsame Aufgabe von Staat und Kommunen<br />
220 Thomas Weber<br />
Umsetzung der Vereinbarung zur Mitnutzung der E-Government-<br />
Plattform des Freistaats Sachsen durch die sächsischen Kommunen<br />
224 Michael Schalla, Dr. Heike Schwerdel-Schmidt<br />
www.amt24.sachsen.de – Sachsens Ratgeberportal in neuem Gewand<br />
227 Jens Keller<br />
Die Basiskomponente „Formularservice“<br />
229 Andreas Klenner, Jörg Taggeselle, Dr. Gunnar Katerbaum, Andreas Hergert<br />
Die Basiskomponente „Geodaten“<br />
232 Uwe Kaiser<br />
Die Basiskomponente „Zahlungsverkehr“<br />
233 Christoph Damm<br />
Die Basiskomponente „Elektronische Signatur und Verschlüsselung“<br />
235 Dr. Hans-Peter Seddig, Tobias Heinrich<br />
E-Government-Plattform 2.0<br />
Allgemeine Beiträge<br />
239 Frank Kupfer<br />
Neues Förderangebot für die Bildungsinfrastruktur<br />
im ländlichen Raum Sachsens<br />
207
Zeitschrift des Sächsischen Städte- und Gemeindetages <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
208<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
240 Friederike Trommer<br />
Die Aufgaben der doppischen Kasse – Einordnung der Kassenaufgaben<br />
in das Neue Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und Erläuterungen<br />
zur neuen Musterdienstanweisung Kasse<br />
247 Dienstanweisung zur Organisation und Aufgabenwahrnehmung<br />
der Kasse im neuen kommunalen Haushalts-, Kassen- und<br />
Rechnungswesen vom …<br />
258 Jan-Hendrik Bahn<br />
Die Organisation des Neuen Kommunalen Haushalts- und<br />
Rechnungswesens<br />
261 Jürgen Meier, Norman Wajand<br />
Trotz düsterer Aussichten –<br />
Naturgefahren bleiben weiterhin versicherbar<br />
267 Dr. Burkhard Nolte<br />
Langzeitspeicherung und elektronische Archivierung<br />
im Freistaat Sachsen<br />
268 Manuela Böttger-Beer, Ralf Pietsch<br />
„Vom Prozessregister zur Prozessplattform“ –<br />
Der Freistaat Sachsen setzt bei der Staatsmodernisierung auf<br />
modernes Prozessmanagement und innovative IT-Unterstützung<br />
270 Janna Lehmann<br />
Delegation aus Dresden auf Arbeitsbesuch in Brüssel<br />
272 Chemnitzer Stadträte stimmen digital ab –<br />
Moderne Technik im 100jährigen Jugendstil-Ambiente<br />
273 Kämmerer als Glücksspieler wider Willen:<br />
Einsatz komplexer Finanzderivate in Kommunen –<br />
Hintergrund und Lösungsmöglichkeiten<br />
277 KindergartenOnline: Service für Kommunalverwaltungen –<br />
Komfort für Eltern<br />
278 Presseschau<br />
280 Aus Büchern und Zeitschriften
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Breitbandversorgung<br />
Förderung der Breitbandversorgung<br />
im ländlichen Raum Sachsens<br />
Frank Kupfer<br />
Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Sachsen macht sich<br />
breit-bandig<br />
Die flächendeckende Versorgung<br />
mit leistungsfähigenBreitbandinternetverbindungen<br />
ist im ländlichen<br />
Raum eine der wichtigsten<br />
Standortvoraussetzungen.<br />
Unternehmen betrachten<br />
sie als Voraussetzung für ihre<br />
Ansiedlung, die Bewohner<br />
als Teil ihrer Lebensqualität.<br />
Dafür ist noch viel zu tun:<br />
Die Breitbandstrategie der<br />
Bundesregierung hatte das<br />
Ziel, bis Ende 2010 für alle<br />
Nutzer in Deutschland einen Breitbandanschluss von mindestens<br />
1 Mbit/s beim Herunterladen bereitzustellen. Wenn auch dieses<br />
Ziel bundesweit um einige Prozentpunkte verfehlt wurde, so<br />
hat die Strategie doch auch im Freistaat Sachsen einen enormen<br />
Schub ausgelöst.<br />
Nach einer aktuellen Umfrage des Bundesinstitutes für Bau-,<br />
Stadt- und Raumforschung vom Mai <strong>2011</strong> zur Lebensqualität<br />
in kleinen Städten und Landgemeinden in Deutschland sehen<br />
(je nach Gemeindetyp) zwischen 31 – 41 % der Befragten hier<br />
noch Verbesserungsbedarf.<br />
Deshalb bietet das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und<br />
Landwirtschaft (SMUL) eine Förderung für die Verbesserung<br />
der Breitbandversorgung in Dörfern und Städten mit bis zu<br />
5.000 Einwohnern an. Basis ist das Breitbanderschließungskonzept<br />
der Sächsischen Staatsregierung vom 05.05.2009.<br />
Das Förderangebot des SMUL<br />
Das SMUL unterstützt den Breitbandausbau im ländlichen<br />
Raum über die Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung<br />
(ILE). Die Förderung umfasst zwei Schritte:<br />
Im ersten Schritt kann eine Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse<br />
gefördert werden. Die Kommune analysiert mit Hilfe eines<br />
externen Planungsbüros den Bedarf von Unternehmen und<br />
Bevölkerung für eine Breitbandausstattung sowie die vorhandene<br />
oder geplante Telekommunikationsinfrastruktur.<br />
Ist als Ergebnis dieser Analyse keine zuverlässige Grundversorgung<br />
(= mindestens 2 Mbit/s beim Herunterladen) gewährleistet oder<br />
geplant und erfolgt kein Ausbau mit der Long-Term-Evolution-<br />
Technologie (LTE) – einer Funktechnologie im Rahmen von<br />
Ausbauverpflichtungen gegenüber dem Bund – kann im zweiten<br />
Schritt die Umsetzung unterstützt werden. Die Kommune hat<br />
dann zwei Möglichkeiten: Bei der ersten wird, ausgehend von<br />
einem marktüblichen Preis, die Wirtschaftlichkeitslücke für einen<br />
Anbieter gefördert. Voraussetzung ist eine Ausschreibung. Die<br />
Technologie (Kabel, Funk oder andere Lösung) darf dabei nicht<br />
vorgeschrieben werden. Die zweite Möglichkeit ist der Bau eines<br />
eigenen Leerrohrnetzes zur Erschließung mit Breitbandinternet.<br />
Neben der alleinigen Initiative der Kommune gibt es eine dritte<br />
Möglichkeit: In Sachsen gibt es die Besonderheit, dass zu DDR-<br />
Zeiten in vielen funktechnisch schwer zu erschließenden Orten<br />
schon Kabelnetze verlegt wurden. Diese Netze können weiterhin<br />
von kleinen Unternehmen betrieben werden. Mit relativ wenig<br />
Aufwand können sie auch für die Breitbandversorgung genutzt<br />
werden. Auch für diese Fälle hat das SMUL ein Förderangebot<br />
auf der Basis der sog. De-minimis-Regelung geschaffen. Kleine<br />
und mittlere Unternehmen und Vereine mit wirtschaftlichem<br />
Zweckbetrieb (KMU) als Netzbetreiber können hier einmalig mit<br />
bis zu 200.000 EUR für Ausbaumaßnahmen unterstützt werden.<br />
Das kann für Kommunen ein Weg sein, eine Unterversorgung<br />
ohne Einsatz von Eigenmitteln zu beseitigen.<br />
Förderverfahren<br />
Innerhalb der Gebietskulisse der Richtlinie des SMUL zur<br />
Integrierten Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen<br />
(RL ILE/2007) werden sowohl Bundesmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe<br />
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes<br />
(GAK) als auch Mittel der Europäischen Union aus<br />
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) eingesetzt. Das<br />
Förderverfahren ist für beide Finanzierungsquellen identisch.<br />
Anträge können Gemeinden oder auch Landkreise stellen. Bewilligungsbehörden<br />
sind die Landkreise. Die Förderung beträgt in<br />
der Regel attraktive 90 %. Wenn im Rahmen des ELER gefördert<br />
wird, ist die Mehrwertsteuer nicht zuwendungsfähig.<br />
Bei den ELER-Mitteln entscheiden die Regionen in eigener<br />
Prioritätensetzung über den Einsatz der Mittel. Breitbandausbau<br />
steht dabei in Konkurrenz zu allen anderen Maßnahmen<br />
der Integrierten Ländlichen Entwicklung. Hier wird sich bei<br />
einsetzender Mittelknappheit zum Ende der Programmperiode<br />
2007 – 2013 zeigen, ob die noch vorhandenen ELER-Mittel<br />
den Bedarf decken können.<br />
Vier Landkreise (Vogtlandkreis, Bautzen, Mittelsachsen, Meißen)<br />
haben sich inzwischen für ein landkreisweites Vergabeverfahren<br />
entschieden und befinden sich in unterschiedlichen Phasen der<br />
Umsetzung. In den übrigen Landkreisen nutzen unterversorgte<br />
Gemeinden die Förderangebote, meist in Form der Ausschreibung<br />
der Wirtschaftlichkeitslücken.<br />
209
Breitbandversorgung <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Gut beraten<br />
In Sachsen steht den Kommunen, Planern, Anbietern und<br />
Bewilligungsbehörden kostenlos die Sächsische Breitbandberatungsstelle<br />
mit Sitz in Limbach-Oberfrohna zur Verfügung.<br />
Die Internetseiten der Breitbandberatungsstelle sind die zentrale<br />
Informationsplattform für die laufenden Förderverfahren. Sie<br />
steht auch für die Beratung vor Ort und die Organisation von<br />
Informationsveranstaltungen zur Verfügung.<br />
Eine erste Bilanz<br />
Mit den bisher bewilligten Förderanträgen (Stand 18.05.<strong>2011</strong>)<br />
wird der Anschluss von 36.123 Haushalten, 5.161 Unternehmen<br />
und 282 öffentlichen Einrichtungen an ein leistungsfähiges<br />
Breitbandinternet ermöglicht.<br />
Unsere Bilanz kann sich sicher sehen lassen:<br />
– 4 Landkreise haben Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalysen<br />
mit Zuschüssen in Höhe von 209.000 EUR durchgeführt,<br />
Übersichtskarte zum Stand der Breitbandförderung im ländlichen Raum Sachsens<br />
Gebundene und beantragte Fördermittel in den Breitbandförderverfahren der RL ILE/2007<br />
210<br />
–<br />
–<br />
–<br />
81 Gemeinden haben für Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalysen<br />
Zuschüsse in Höhe von 581.000 EUR erhalten,<br />
18 Gemeinden und ein Landkreis wurden in der Umsetzung,<br />
meist für die Ausschreibung der Wirtschaftlichkeitslücke,<br />
mit Zuschüssen in Höhe von 3,2 Millionen EUR aus<br />
GAK- bzw. 7,4 Millionen EUR aus ELER-Mitteln unterstützt.<br />
Herausragendes Beispiel ist dabei bisher der Landkreis<br />
Vogtlandkreis, in dem derzeit Breitbandinternet für<br />
177 bisher unterversorgte Ortsteile ausgebaut wird. Beispiele<br />
für einzelne Gemeinden mit ihren Ortsteilen sind<br />
Sornzig-Ablass im Landkreis Nordsachsen und Schönau-<br />
Berzdorf im Landkreis Görlitz.<br />
Im Bereich der KMU-Förderung wurden bisher erst<br />
101.000 EUR bewilligt. Die Zahl dürfte in nächster Zeit<br />
steigen, da mehrere Anträge noch offen sind.<br />
Zusammen mit dem LTE-Ausbau, mit dem seit Ende 2010<br />
begonnen wurde, werden damit viele bisher weiße Flecken<br />
in der Breitbandversorgung im ländlichen Raum Sachsens<br />
verschwinden.<br />
Ausblick<br />
Auch in Zukunft darf der ländliche<br />
Raum bei Breitbandversorgung nicht<br />
benachteiligt werden. Der Ausbau von<br />
Hochgeschwindigkeitsbreitbandinternet<br />
muss auf dem Land mit dem<br />
gleichen Engagement voran getrieben<br />
werden wie in städtischen Ballungsräumen.<br />
Die hierfür benötigten hohen<br />
Investitionen müssen in erster<br />
Linie von den Anbietern, also aus der<br />
Wirtschaft, kommen. Der Staat kann<br />
hier Rahmenbedingungen verbessern<br />
und Synergien im Zusammenhang<br />
mit den öffentlichen Infrastrukturen<br />
erschließen.<br />
Inhaltlich sehe ich zwei wichtige<br />
Strategien, mit denen wir voran<br />
kommen:<br />
Synergien nutzen<br />
Eine ausgedehnte und diskriminierungsfrei<br />
zugängliche Leerrohrinfrastruktur<br />
ist ein wichtiger Baustein für<br />
ein weitverzweigtes und kostengünstiges<br />
Hochgeschwindigkeitsinternet.<br />
Dazu muss man wissen, wo welche<br />
Leerrohre liegen. Die Leerrohre müssen<br />
zu vernünftigen Konditionen für<br />
alle interessierten Anbieter nutzbar<br />
sein. Hier geht die Novelle des Telekommunikationsgesetzes<br />
(TKG) hinsichtlich<br />
der geplanten Verbesserung<br />
bei den Auskunftspflichten in die<br />
richtige Richtung.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Breitbandversorgung<br />
Auch die Mitnutzung bundes- und landeseigener Infrastruktur<br />
muss erleichtert werden. So kann im Bereich der Mitverlegung<br />
viel erreicht werden, wenn bei allen mit Bundesmitteln geförderten<br />
Infrastrukturmaßnahmen die Mitverlegung von Leerrohrinfrastruktur<br />
zuwendungsfähiger Bestandteil der Baumaßnahmen<br />
wäre. Hierzu sollte ein Infrastrukturgesetz, wie es im Rahmen<br />
der laufenden Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG)<br />
angeregt wurde, den Rahmen setzen. Die kommunalen Spitzenverbände<br />
sollten dies unterstützen und dazu ihren Einfluss im<br />
Verfahren geltend machen.<br />
Beim Einsatz von ELER-Mitteln für Gemeindestraßen geht das<br />
SMUL mit gutem Beispiel voran. Jede Gemeinde, die im Zuge<br />
einer geförderten Straßenbaumaßnahme ein Leerrohr mit verlegen<br />
will, kann diese Bauleistung im Rahmen der RL ILE/2007<br />
ohne gesondertes Verfahren gleich mit beantragen.<br />
Hochgeschwindigkeitsinternet auch für den ländlichen<br />
Raum<br />
Die aktuelle Breitbandstrategie des Bundes sieht den Ausbau<br />
von Next-Generation-Netzwerken (NGA-Netze), die Hochgeschwindigkeitsinternet<br />
von mehr als 50 Mbit/s zulassen, vor. Das<br />
kann die Qualität der Breitbandversorgung nachhaltig sichern.<br />
Das Ziel, bis 2014 75 % aller Haushalte damit zu versorgen,<br />
geht allerdings am ländlichen Raum vorbei: Im Wesentlichen<br />
kann diese Quote bereits erreicht werden, wenn der Ausbau auf<br />
Städte und Ballungszentren beschränkt bleibt.<br />
Das kann ich als Minister für den ländlichen Raum nicht akzeptieren.<br />
Wenn nicht bald gehandelt wird, droht der ländliche<br />
Raum von der Entwicklung abgehängt zu werden. Zwar hat das<br />
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) eine beihilferechtliche<br />
Genehmigung für eine etwas einfachere Förderung von Leerrohr-<br />
netzen bei der EU-Kommission erwirkt. Die bisherigen Förderprogramme<br />
des Bundes (über die GAK) reichen aber weder von<br />
ihrer Mittelausstattung noch von ihrer derzeitigen inhaltlichen<br />
Ausgestaltung für einen umfassenden Netzausbau im ländlichen<br />
Raum aus. Bisher hat das BMWi lediglich einen kleinen Wettbewerb<br />
mit einem Umfang von 16 Mio. EUR 2010 ausgelobt. Aus<br />
Sachsen nimmt bisher nur der Verwaltungsverband Wildenstein<br />
im Erzgebirgskreis mit einem Leerrohrkonzept daran teil.<br />
Sachsen wird zwar die neuen Möglichkeiten im Rahmen des ELER<br />
installieren, doch auch hier sind die Finanzierungsmöglichkeiten<br />
bis 2013 stark begrenzt, so dass wohl nur in Einzelfällen von der<br />
Rahmenregelung Gebrauch gemacht werden kann.<br />
Hinreichende Mittel sind aber eine Grundvoraussetzung für<br />
eine effektive Förderung für die benötigten NGA-Netze. Der<br />
tatsächliche Bedarf nur zur Unterstützung der notwendigen Tiefbauarbeiten<br />
dürfte für Sachsen im dreistelligen Millionenbereich<br />
liegen. Hierfür müsste ein Bundesprogramm zur Verfügung<br />
gestellt werden, das z. B. mit Gewinnen aus den Frequenzversteigerungen<br />
finanziert wird.<br />
Frank Kupfer<br />
Sächsischer Staatsminister<br />
für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Breitbandausbau in Sachsen<br />
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr<br />
Verfügbarkeit von Zugängen<br />
Die Verfügbarkeit von Internetzugängen erfordert, digitale<br />
Netze auf- und auszubauen, die für die Informations- und<br />
Kommunikationstechnologien (IKT) geeignet sind. Derartige<br />
Netze können auf sehr verschiedene Arten von Technologie<br />
basieren. Die derzeit wichtigste Technologie ist die festnetzgestützte<br />
Verbindung. Deren bekannteste Variante ist das<br />
DSL (Digital Subscriber Line). Wichtigste DSL-Anbieter sind<br />
Firmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone, Arcor, Freenet,<br />
Versatel und Hansenet, aber auch starke regionale Anbieter<br />
wie NetCologne, EWE und M-net. DSL ist unverändert die<br />
dominierende Technik beim Breitband-Internet. Der dort mit<br />
Abstand größte Anbieter ist weiterhin die Deutsche Telekom<br />
AG mit einem Marktanteil knapp über 50 Prozent. Der Ausbau<br />
der DSL-geeigneten Netze durch die Deutsche Telekom,<br />
Vodafone und die anderen TK-Unternehmen schreitet weiter<br />
voran. Der Ausbau ist durch Verlegung von Erdkabeln aber<br />
zeit- und kostenaufwändig.<br />
Alternative Technologien<br />
Deshalb kommen zunehmend auch andere Technologien zum<br />
Zuge. Eine wichtige Alternative der leitungsgebundenen IKT-<br />
Technologie ist inzwischen das Kabel-Netz der Versorger von<br />
ursprünglich nur TV und Radio, inzwischen aber auch Telefon<br />
und Internet, wie z. B. Kabel Deutschland und regionale Antennengemeinschaften.<br />
Die technischen Möglichkeiten zur Datenübertragung<br />
stehen denen von DSL nicht nach oder übersteigen<br />
die aktuellen Möglichkeiten sogar bei Weitem. Eine wichtige<br />
Alternative für Privathaushalte und kleine und mittelständische<br />
Unternehmen (KMU), einschließlich von Freiberuflern ist der<br />
funkgestützte Breitbandanschluss. Die heutige Technik des<br />
211
Breitbandversorgung <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
HSDPA ist derzeit die wichtigste Technologie. UMTS und<br />
GMS sind die am weitesten verbreiteten Übertragungsstandards<br />
in diesem Bereich der funkgestützten Technologie. Ergänzend<br />
kommen an großen Verkehrsknotenpunkten, aber auch anderen<br />
Orten mit hoher Kundenfrequenz zunehmend Komponenten<br />
wie WiMAX, WLL, WLAN und UT RA-TDD zum Einsatz.<br />
Einzelne Nutzer, die weder mit funkgestützten noch mit<br />
leitungsgebundenen Breitbandanschlüssen versorgt werden<br />
können, haben eine andere leistungsfähige, aber kostenintensivere<br />
Möglichkeit der Versorgung via Satellit. Die bisherige<br />
Lösungsvariante eines Rückkanals über die Telefonleitung wird<br />
zunehmend verdrängt durch die bidirektionale Lösung, also<br />
eines Hin- und Rückkanals. Insgesamt verfügen die Anbieter<br />
von TK-Leistungen über Satellit in Deutschland derzeit über<br />
einen Kundenstamm von gut 30.000 Kunden.<br />
Die Zukunft hat begonnen: NGA<br />
Die Netze der neuen Generation (NGA) werden in der Zukunft<br />
die Leistungsfähigkeit des Internetzugangs vervielfachen.<br />
Und diese Zukunft beginnt bereits im Freistaat Sachsen. Der<br />
Ausbau mit Glasfaser-Kabeln (FTTH) hat bereits begonnen.<br />
Diese übertragen nach bisherigen technologischen Standards<br />
bis zu 100 MBit/s pro Haushalt. Da die Glasfaserkabel aber<br />
neu verlegt werden müssen, ist die Herstellung von Anschlüssen<br />
wiederum sehr zeit- und kostenaufwändig. Diese Technologie<br />
wird daher vor allem in Ballungsräumen zum Einsatz kommen,<br />
in denen mit einer hohen Nachfrage bei gut kalkulierbaren<br />
Kosten zu rechnen ist. Bereits bestehende hybride Netze von<br />
Glasfaser- und Kupferkabeln (FTTC) können aber ebenfalls<br />
mittels VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) bei<br />
den Übertragungsraten mithalten, sind aber dank Nutzungsmöglichkeit<br />
vorhandener Netze durch zügige Umrüstung<br />
schnell nutzbar.<br />
In den Bereichen, in denen leitungsgebundene Technologien<br />
nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung stehen und die<br />
bisherigen funkbasierten Übertragungswege nicht leistungsfähig<br />
genug sind, kommt eine neue Generation von funkbasierter<br />
Übertragungstechnologie zum Einsatz. Diese LTE-Technologie<br />
(Long Term Evolution) wird gerade auch im Freistaat Sachsen<br />
mit großen Schritten vorangebracht. Hier hat die Zukunft ebenfalls<br />
bereits begonnen. Vodafone hat im Beisein des Sächsischen<br />
Staatsministers für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr am 1. Dezember<br />
2010 in Rammenau das erste Netz für den Freistaat Sachsen<br />
und zugleich das Netz für Deutschland in Betrieb genommen.<br />
Bis Mitte des Jahres <strong>2011</strong> wird Vodafone an 82 Standorten<br />
LTE-Netze in Betrieb nehmen. Die Deutsche Telekom plant,<br />
im gleichen Zeitraum ca. 100 LTE-Standorte in Betrieb zu<br />
nehmen. Der Ausbreitungsradius der Funkwellen beträgt 4 bis<br />
10 km und kann von den Übertragungskapazitäten her ca. 1000<br />
Haushalte pro Standort versorgen. Topographie und Bebauung<br />
verändern allerdings bei diesen funkgestützten Technologien<br />
die Reichweite. Der Ausbau des LTE-Netzes kann aber so zügig<br />
erfolgen, weil vorhandene Standorte mit- und umgenutzt<br />
werden. Vor allem die vorhandenen GSM-Antennen-Anlagen<br />
werden dabei aufgerüstet.<br />
Der Ausbau dieses Funknetzes startet zunächst in unterversorgten,<br />
meist dünn besiedelten Regionen. Dies entspricht<br />
212<br />
den Auflagen der Bundesnetzagentur, die den TK-Unternehmen<br />
in Zuge der Versteigerung zusätzlicher Funkfrequenzen vorgegeben<br />
wurden. So ist aber zu erwarten, dass etwa innerhalb eines<br />
Jahres auch in bislang noch unterversorgten Gebieten akzeptable<br />
Bandbreiten, vergleichbar einem DSL-Anschluss verfügbar sein<br />
werden. Es sind dann Bandbreiten bis 50 MBit/s verfügbar.<br />
50 MBit erlauben z. B. das Herunterladen von Filmen, aber<br />
auch das Hochladen von komplexen Bildern, wie z. B. in der<br />
Telemedizin. Für die meisten Anwendungen im Privathaushalt<br />
und bei KMU sowie Freiberuflern sind Netze mit derartigen<br />
Übertragungsraten völlig ausreichend. Derartige Übertragungsraten<br />
setzen bereits Standards für die NGA-Netze der Zukunft.<br />
Sobald sie flächendeckend verfügbar sind, ist der erste Schritt<br />
in die digitale Zukunft getan.<br />
Rat und Tat<br />
Kommunen, Planern, TK-Unternehmen und Bewilligungsbehörden<br />
steht eine Einrichtung zur Beratung zur Verfügung, deren<br />
Finanzierung durch den Freistaat Sachsen zunächst bis 2013<br />
abgesichert ist: die Breitbandberatungsstelle. Die Beratungsstelle<br />
unterhält auch eine Informationsplattform (vergl. Info-Box am<br />
Ende dieses Artikels). SMUL und SMWA fördern Leistungen<br />
der Beratungsstelle projekt- und anlassbezogen. Die Beratung<br />
begleitet gerade auch kommunale Träger bei der Aufbereitung<br />
von Förderverfahren und deren Antragsunterlagen. Bisher<br />
haben sich 81 Gemeinden und 4 Landkreise (Erzgebirgskreis,<br />
Vogtlandkreis, Landkreise Bautzen und Mittelsachsen) an einem<br />
Förderverfahren beteiligt. Dafür wurden Mittel in Höhe von<br />
564 T€ bewilligt. Der Freistaat Sachsen fördert unter anderem<br />
eine verbleibende Wirtschaftlichkeitslücke. Grundlage für den<br />
Nachweis einer Wirtschaftlichkeitslücke ist die Durchführung<br />
eines Ausschreibungsverfahrens, so dass das wirtschaftlichste<br />
Angebot der Förderung zu Grunde gelegt werden kann. Bislang<br />
erhielten 15 Gemeinden hier Fördermittel. Im Bereich<br />
der KMU-Förderung wurden bisher 101 T€ bewilligt. Hier ist<br />
aber mit einem Anstieg der Förderung zu rechnen, da mehrere<br />
Anträge inzwischen gestellt wurden.<br />
Die bisherige Förderung ermöglichte eine breitbandige Versorgung<br />
von 36.123 Haushalten, 5.161 Unternehmen und 282<br />
öffentlichen Einrichtungen, vor allem im ländlichen Raum.<br />
Das Nutzerverhalten<br />
Zum Weltfernmeldetag hat das Statistische Landesamt des Freistaates<br />
Sachsen am 16. Mai <strong>2011</strong> darauf aufmerksam gemacht,<br />
dass die tatsächliche Nutzung des Internetzuganges im Freistaat<br />
Sachsen hinter den Verfügbarkeitswerten deutlich zurückbleibt.<br />
Während 70 Prozent der privaten Haushalte sicher davon ausgehen,<br />
dass sie einen Breitbandanschluss verfügbar haben, nutzen<br />
ihn nur 59 Prozent. Zwischen den technischen Möglichkeiten<br />
und deren Nutzung besteht also in jedem Fall eine größere<br />
Differenz. Zu bedenken ist hierbei, dass die TK-Unternehmen<br />
sogar davon ausgehen, dass Internetzugänge mit einem<br />
Breitbandspektrum von mindestens 1 MBit/s bereits jetzt für<br />
95,6 Prozent der Haushalte und Unternehmen verfügbar sind.<br />
TK-Unternehmen und Gemeinden sind deshalb aufgerufen,<br />
potenzielle Nutzer auch rechtzeitig über die Verfügbarkeit zu<br />
informieren. Dies gilt für alle Formen des Breitband-Anschlusses
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Breitbandversorgung<br />
und es gilt gegenüber privaten Haushalten, Freiberuflern und<br />
anderen Gewerbetreibenden.<br />
Die in den Artikeln des SMUL und SMWA genannten Quellen finden Sie auch im Internet:<br />
1) Breitbandstrategie der Bundesregierung:<br />
http://www.bmwi.de/Dateien/BBA/PDF/breitbandstrategie-der-bundesregierung,property=<strong>pdf</strong>,bereich=bmwi,sprache=de,r<br />
wb=true.<strong>pdf</strong><br />
2) Breitbandinitiative ländlicher Raum<br />
http://www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/1355.htm<br />
3) Richtlinie ILE/2007:<br />
http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=3509213181150<br />
4) Breitbandberatungsstelle Sachsen<br />
Ansprechpartner :<br />
Herr Schwarzenberger<br />
Telefon: 03722 7341- 245<br />
http://www.breitbandberatungsstelle-sachsen.de<br />
Breitbanderschließung des Ortsteils Rothenthal<br />
und des Gewerbegebietes der Stadt Olbernhau<br />
Nach drei Jahren intensiver Arbeit sind wir mit dem Ortsteil<br />
Rothenthal und dem Gewerbegebiet Olbernhau auf der Datenautobahn<br />
angekommen.<br />
An den Ortschaftsrat von Rothenthal wurden seit dem Jahr 2008<br />
mehrfach von Einwohnern und vor allem Gewerbetreibenden<br />
Anfragen mit der Forderung gestellt, dass sich das Gremium<br />
für ein nutzbares Breitbandangebot im Ort einsetzen soll. Aufgrund<br />
dieser mehrfachen Nachfragen hat der Ortschaftsrat von<br />
Rothenthal zwei Informationsveranstaltungen bezüglich der<br />
Breitbandversorgung zur Aufklärung und Sondierung potentieller<br />
Interessenten durchgeführt. Im Ergebnis dessen wurde<br />
eine Umfrage (Postwurfsendung) zur Interessenbekundung als<br />
Vorstufe zur Erstellung einer Bedarfsanalyse an alle Haushalte<br />
gestartet. Das Ergebnis lag uns am 31.08.2008 vor.<br />
Ziel der Aktivitäten zur Breitbanderschließung des Ortsteils Rothenthal<br />
war es, allen in der Umfrage gemeldeten Privatpersonen<br />
und vor allem den Gewerbebetrieben leistungsfähige Breitbandanschlüsse<br />
zur Verfügung zu stellen. Diese Breitbandanschlüsse<br />
sind in Rothenthal um so wichtiger, da hier in der direkten<br />
Tal- und Grenzlage zu Tschechien kein Mobilfunkempfang<br />
möglich ist. Für die Gewerbetreibenden war dies eine unbefriedigende<br />
Situation und ein echter Wettbewerbsnachteil. In den<br />
Informationsveranstaltungen haben wir uns von Fachleuten die<br />
verschiedenen Breitbandübertragungsmöglichkeiten erläutern<br />
lassen. Hierbei wurden von den Einwohnern technische Breitbandlösungen<br />
favorisiert, die zukunftsträchtig und bezahlbar<br />
sind und gleichzeitig die Sprachtelefonie sichern.<br />
Da wir die erste Gemeinde im Erzgebirgskreis waren, die sich<br />
mit der Breitbanderschließung befasste, mussten wir für die<br />
Beantragung der entsprechenden Fördermittel umfangreiche<br />
Bernd Reichmann<br />
Ortsvorsteher des Ortsteils Rothenthal<br />
Nachweise beibringen. Nachweise im Doppelpack, einmal über<br />
das ILE-Förderprogramm für den Ortsteil Rothenthal beim<br />
Landkreis Erzgebirgskreis und einmal für das Gewerbegebiet<br />
Olbernhau über die Richtlinie des SMWA zur Förderung der<br />
wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
(GRW-Infra) bei der Landesdirektion Chemnitz. Die Förderung<br />
in beiden Programmen lag bei 90 % brutto. Die Bearbeitung der<br />
Antragstellungen bei den verschiedenen Stellen nahmen einen<br />
sehr langen Zeitraum in Anspruch. Erst als die Genehmigungen<br />
und Stellungnahmen des Kommunalamtes, des Koordinierungskreises,<br />
der KISA und weiterer Stellen vorlagen, erteilten die<br />
Genehmigungsbehörden die Zuwendungsbescheide, so dass die<br />
ersten Aufträge, wie z. B. die gemeinsame Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse<br />
für den OT Rothenthal und das Gewerbegebiet<br />
Olbernhau, in Auftrag gegeben werden konnten.<br />
Am 11.08.2009 wurde in der von der Firma Tele-Kabel-Ingenieurgesellschaft<br />
mbH (TKI) erstellten Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse<br />
die Unterversorgung des Ortsteiles Rothenthal und<br />
des Gewerbegebietes bestätigt. Gleichzeitig wurde in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung<br />
eine Deckungslücke von 56.000,00 €<br />
für den OT Rothenthal und 164.000,00 € für das Gewerbegebiet<br />
errechnet. Im Rahmen einer technologie- und anbieterneutralen<br />
Ausschreibung im Sächsischen Ausschreibungsblatt sollte nun die<br />
kostengünstigste und effektivste Form der Breitbanderschließung<br />
und ein Anbieter, der diese Erschließung realisieren konnte,<br />
gefunden werden. Dabei mussten die Mindestforderungen von<br />
2.000 kbit/s im downstream und nach Möglichkeit auch im<br />
upstream lt. der ILE Richtlinie 2007 bzw. GRW 2009 garantiert<br />
werden. Unser Ziel war es, einen möglichst großen Kreis von<br />
Breitbandanbietern anzusprechen und die Erschließungskosten<br />
mit evtl. zu erwartenden Deckungslücken so gering wie möglich<br />
213
Breitbandversorgung <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
zu halten. Dazu sollte eine gemeinsame und losweise Ausschreibung<br />
zur Breitbanderschließung mit dem Gewerbegebiet<br />
Olbernhau (Antragstellung über die LD Chemnitz) erfolgen.<br />
Nach den Aussagen der Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse<br />
war davon auszugehen, dass eine Breitbanderschließung des<br />
Ortsteiles Rothenthal und des Gewerbegebietes nur durch die<br />
Förderung der errechneten Deckungslücken möglich ist.<br />
Die Ausschreibung zur Breitbanderschließung des Ortsteiles<br />
Rothenthal und des Gewerbegebietes Olbernhau erfolgte das<br />
erste Mal am 27.11.2009 im Sächsischen Ausschreibungsblatt.<br />
Die Ausschreibung musste aber wegen der noch nicht beantragten<br />
Förderung der Wirtschaftlichkeitslücken am 16.12.2009<br />
aufgehoben werden. Hier wirkte sich hinderlich aus, dass<br />
für jeden Schritt (1. Schritt – Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse,<br />
2. Schritt – Ausschreibung, 3. Schritt – Antrag für<br />
die Deckungslücke) ein Förderantrag gestellt werden musste.<br />
Wiederum wurden Förderanträge für den Ortsteil Rothenthal<br />
gestellt und am 07.01.2010 beim Landratsamt Erzgebirgskreis<br />
eingereicht. Zeitgleich wurde ein erneuter Antrag zur<br />
Förderung der Deckungslücke für das Gewerbegebiet bei der<br />
Landesdirektion Chemnitz eingereicht. Nach dem Vorliegen<br />
des Bescheides zur Förderung der Deckungslücke vom Landratsamt<br />
Erzgebirgskreis für den Ortsteil Rothenthal und der<br />
Genehmigung des vorzeitigen Vorhabensbeginns durch die<br />
Landesdirektion Chemnitz für das Gewerbegebiet wurde die<br />
2. Ausschreibung zur Breitbanderschließung nunmehr EU-weit<br />
erneut vorgenommen.<br />
Die von der TKI Chemnitz vorbereitete Ausschreibung wurde<br />
im Sächsischen Ausschreibungsblatt (19.03.2010) und im Ausschreibungsblatt<br />
der Europäischen Union (17.03.2010) losweise<br />
veröffentlicht. Auf die Ausschreibung hatten sich bis zum festgesetzten<br />
Meldetermin am 24.<strong>04</strong>.2010 nur vier Firmen gemeldet<br />
und ihre Teilnahme bekundet. Eine weitere Firma meldete sich<br />
verspätet am 06.05.2010. Die Öffnung der Angebote erfolgte am<br />
18.05.2010 im Rathaus Olbernhau. Bis zum Submissionstermin<br />
lag nur ein verschlossenes Angebot von der Firma T-Mobile<br />
Deutschland GmbH aus Bonn vor.<br />
Das Submissionsergebnis mit dem vorliegenden Angebot wurde<br />
der Firma Tele-Kabel-Ingenieurgesellschaft Chemnitz am<br />
19.05.2010 zur Prüfung übergeben. Im Rahmen der Prüfung<br />
war ersichtlich, dass die von TKI Chemnitz in der Bedarfs- und<br />
Verfügbarkeitsanalyse ermittelten Werte der Wirtschaftlichkeitslücken<br />
stark von den im Angebot der T-Mobile Deutschland<br />
GmbH abgegebenen Werten abwichen. Diese Abweichung hing<br />
nach Auskunft der TKI Chemnitz mit den technologieneutralen<br />
Bestimmungen der Ausbaustandards der Linienführung und<br />
individueller Besonderheiten des Anbieters zusammen.<br />
Somit ergab sich lt. Angebot für den Ortsteil Rothenthal (Los 1)<br />
eine Kostendeckungslücke von 105.472,00 € bei einer Gesamtinvestition<br />
von 111.118,00 €.<br />
Hierzu musste die auf der Grundlage der Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse<br />
bereits beim Landratsamt Erzgebirgskreis beantragte<br />
Förderung der Wirtschaftlichkeitslücke von 56.000,00 € auf<br />
105.472,00 € erhöht werden.<br />
Für das Gewerbegebiet Olbernhau ergab sich lt. Angebot eine<br />
Kostendeckungslücke von 11. 841,00 € bei einer Gesamtinves-<br />
214<br />
tition von 12. 475,00 €. Hier mussten die auf der Grundlage der<br />
Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse bereits bei der Landesdirektion<br />
Chemnitz beantragten Mittel der Wirtschaftlichkeitslücke<br />
von 164.000,00 € (lt Zuwendungsbescheid vom 03.06.2010)<br />
auf 11.841,00 € minimiert werden (Änderungsbescheid vom<br />
19.07.2010).<br />
Das Auswertungsergebnis wurde der Stadtverwaltung am<br />
01.06.2010 von der Firma TKI Chemnitz übergeben. Am<br />
16.06.2010 fand ein Aufklärungs- und Bietergespräch zwischen<br />
dem Vertreter der T-Mobile Deutschland GmbH und dem<br />
Bürgermeister Dr. Laub unter Teilnahme eines Vertreters der<br />
Firma TKI Chemnitz statt. Im Ergebnis des Bietergespräches<br />
wurde vereinbart, dass die Deutsche Telekom der Stadt Olbernhau<br />
bis Ende Juli 2010 je einen Versorgungsvertrag zur<br />
Breitbandversorgung für den OT Rothenthal (Los 1) und für<br />
das Gewerbegebiet Olbernhau (Los 2) vorlegt. Die von der Stadt<br />
Olbernhau unterzeichneten Kooperationsverträge wurden am<br />
<strong>04</strong>.08.2010 von der Deutschen Telekom gegengezeichnet. Für<br />
die Vorarbeiten, die Antragstellungen, die Genehmigungen bis<br />
hin zur Vertragsunterzeichnung haben wir 2 ½ Jahre benötigt.<br />
Am 09.08.<strong>2011</strong> erfolgte dann die für uns sehr erfreuliche Übergabe<br />
des Fördermittelbescheides zur Umsetzung des Vorhabens<br />
durch den Landrat an den Bürgermeister der Stadt Olbernhau,<br />
Herrn Dr. Laub. Damit konnten die eigentlichen Arbeiten zum<br />
Breitbandausbau beginnen.<br />
Bereits am 15.09.2010 begannen die von der Deutschen Telekom<br />
beauftragen Firmen mit der Breitbanderschließung des Ortsteils<br />
Rothenthal und des Gewerbegebietes Olbernhau. Es wurden in<br />
bereits vorhandene Lehrrohre neue Glasfaserkabel verlegt und<br />
Verteilerkästen errichtet. Auch über den schneereichen Winter<br />
2010/11 wurde im Rahmen des Möglichen bis zur Fertigstellung<br />
weitergearbeitet.<br />
In der Ortschaftsratssitzung am 14.03.<strong>2011</strong> konnte der verantwortliche<br />
Bauleiter der Telekom über die bauseitige Fertigstellung<br />
des Breitbandausbaus berichten. In dieser Sitzung wurden den<br />
Einwohnern gleichzeitig Informationen zum Anschlusszeitpunkt<br />
und zu den Tarifen gegeben. Erfreulich war die Mitteilung, dass<br />
nun jeder Einwohner einen 16-Mbit-Breitbandanschluss nutzen<br />
kann, das ist mehr als wir uns je erhofften.<br />
Am 11.<strong>04</strong>.<strong>2011</strong> erfolgte die Abnahme der neu errichteten<br />
DSL-Kästen durch Vertreter der Firma TKI Chemnitz, der<br />
Stadt Olbernhau und der Deutschen Telekom. Bereits seit dem<br />
01.<strong>04</strong>.<strong>2011</strong> konnten die ersten Rothenthaler Einwohner die<br />
Vorzüge des schnellen Internet nutzen und sind darüber sehr<br />
erfreut.<br />
Fazit<br />
Als Fazit des Ganzen kann man sagen, wir haben 2 ½ Jahre für<br />
die Vorbereitung, Antragstellung und Ausschreibung benötigt.<br />
Nur 6 Monate (einschließlich der Unterbrechung durch den<br />
Winter) wurden für die Anschlussarbeiten durch die Deutsche<br />
Telekom benötigt und sicher werden wir noch 4 Monate für<br />
die zwei Endabrechnungen des Breitbandausbaus beim Landkreis<br />
Erzgebirgskreis und bei der Landesdirektion Chemnitz<br />
benötigen. Wenn wir auch manchmal, z. B. wegen des hohen
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Breitbandversorgung<br />
Verwaltungsaufwandes und der geringen Bieteranzahl, ans<br />
Aufgeben dachten, so sind wir heute froh, dass wir mit langem<br />
Atem ein gutes Ziel – 16000 DSL – für den OT Rothenthal<br />
und das Gewerbegebiet Olbernhau erreicht haben. Wir sind<br />
uns bewusst, dass noch weitere Ortsteile der Stadt Olbernhau<br />
bezüglich Breitband unterversorgt sind, hoffen jedoch, dass bei<br />
erneuter Antragstellung der Verwaltungsaufwand minimiert<br />
und das Genehmigungsverfahren für die Ortslagen Oberneuschönberg<br />
und Hirschberg sowie den Ortsteil Blumenau<br />
zügiger abläuft.<br />
Die Breitbandanbindung ist ein „Muss“<br />
wie Wasser und Straßen<br />
Alexander Handschuh und Carsten Hansen<br />
Der Breitbandausbau in Deutschland und Europa schreitet zügig<br />
voran. Mit mehr als elf Millionen neuen Festnetzanschlüssen in<br />
der EU sind kabelgebundene Internet-Breitbandverbindungen<br />
weiter auf dem Vormarsch. Damit ist die EU der weltweit größte<br />
Breitbandmarkt. Fast ein Viertel der EU-Bürger (24,8 %) verfügt<br />
über einen Festnetz-Breitbandanschluss. Die Übertragungsgeschwindigkeiten<br />
nehmen zu. Rund 80 % der Festnetz-Breitbandanschlüsse<br />
in der EU erlauben über 2 Mbit/s. Allerdings<br />
leisten nur 18 % dieser Anschlüsse mehr als 10 Mbit/s. Für<br />
grundlegende Web-Anwendungen sind diese Geschwindigkeiten<br />
zwar ausreichend, nicht jedoch für fortgeschrittene Anwendungen<br />
wie Fernsehen auf Abruf. Hinsichtlich der eingesetzten<br />
Technik bleiben DSL-Leitungen mit vier Millionen Anschlüssen<br />
weiterhin die am weitesten verbreitete Breitband-Zugangstechnik<br />
in Europa. Durchgehende Glasfaseranschlüsse bis zum Endkunden<br />
(FTTH Fibre To The Home) nahmen zwischen Juli 2008<br />
und Juli 2009 um 40 % zu, machen allerdings nur 1,75 % der<br />
Breitbandanschlüsse in Europa aus.<br />
Die Ausbauziele der EU sind ehrgeizig. Alle Europäer sollen über<br />
einen Breitbandanschluss verfügen, der mindestens 30 Mbit/s<br />
leistet. In Deutschland sollen „nur“ 75% der Haushalte bis 2014<br />
mit 50 MBit/s Anschlüssen versorgt sein. Aus kommunaler<br />
Sicht ist das nicht akzeptabel. Die Entwicklungszahlen zeigen:<br />
Breitband wird in Kürze eine so grundlegende Infrastruktur sein<br />
wie das Straßennetz oder die Wasserversorgung. Wir brauchen<br />
Breitband für alle Haushalte und nicht nur für die Mehrheit!<br />
Breitband schafft Beschäftigung<br />
Breitband hat positive Effekte auf Wachstum und Beschäftigung. So<br />
wird laut einer Studie im Auftrag der Europäischen Kommission mit<br />
mehr als zwei Millionen neuen Arbeitsplätzen bis 2015 gerechnet.<br />
Allein in Deutschland ist damit zu rechnen, dass nur durch die<br />
Aufrüstung der Netze auf Datengeschwindigkeiten von 50 Megabit<br />
pro Sekunde bis 2014 rund 400 000 zusätzliche Arbeitsplätze<br />
geschaffen werden. Der mögliche Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt<br />
(BIP) bis 2014 beträgt rund 60 Milliarden Euro, das heißt<br />
+ 0,6 Prozentpunkte BIP.<br />
Das ifo Institut hat aktuell den Effekt von Breitband über zwölf<br />
Jahre für Deutschland und 24 weitere OECD Staaten untersucht.<br />
In den untersuchten Ländern hat Breitband das Bruttoinlands-<br />
Deutscher Städte- und Gemeindebund<br />
produkt pro Kopf um bis zu 4 % erhöht. Das heißt: Hätte<br />
Deutschland bereits im Jahr 2003 seinen Breitbandausbau mit<br />
Entschlossenheit vorangetrieben, würde das Bruttoinlandsprodukt<br />
pro Kopf heute um rund 6 % höher ausfallen!<br />
Die Bedeutung für die lokale Wirtschaft kann gar nicht hoch<br />
genug eingeschätzt werden. Sie erstreckt sich auf nahezu alle<br />
Bereiche des Arbeitslebens im 21. Jahrhundert. Breitband ist<br />
für den mittelständischen Unternehmer, der seine komplexen<br />
Produktionsmaschinen fernwarten lassen muss ebenso essentiell<br />
wie für den Landwirt, der seine Maschinen mittels spezieller<br />
Programme steuert und seine Produkte über das Internet vertreiben<br />
möchte. Stehen schnelle Leitungen nicht zur Verfügung,<br />
drohen Wettbewerbsnachteile, die nicht zu kompensieren sind.<br />
Dienstleister im Bildungswesen, aber auch Dienstleistungen im<br />
Gesundheitswesen haben ohne leistungsfähiges Breitband nicht<br />
einmal Marktzugang.<br />
Für die kommunale Wirtschaftsförderung ist die Verfügbarkeit<br />
von schnellen Datenleitungen eine Grundvoraussetzung für<br />
Neuansiedlungen und ein starkes Argument für die Pflege der<br />
bestehenden Unternehmen.<br />
Breitband ist der (erwartete) Standard<br />
Leben und Arbeiten ohne schnelle Datenleitungen – was heißt<br />
das eigentlich? Bremst das Fehlen schneller Breitbandverbindungen<br />
„nur“ den digitalen Lifestyle aus oder steht mehr auf<br />
dem Spiel? Ist letztlich gar die kulturelle und demographische<br />
Entwicklung unterversorgter Gebiete gefährdet?<br />
Die Bedeutung der Schlüsselinfrastruktur Breitband erstreckt sich<br />
mittlerweile auf nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens. Das<br />
Internet, seine mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten und<br />
die mit der Verfügbarkeit schneller Datenleitungen verknüpften<br />
Services und Effizienzpotentiale lenken den Blick darauf dass die<br />
unterschiedlichen Lebensbereiche zunehmend verknüpft sind.<br />
Breitbandiges Internet für Freizeitanwendungen verbessert auch<br />
die Qualität von Gesundheits- oder Bildungsangeboten. Beispiel<br />
Schule: Es muss nicht nur der Unterricht an den Schulen selbst<br />
in den Blick genommen werden. Ein Lehrer, der den Unterricht<br />
für seine Schüler häufig auch in den Abendstunden vorbereitet,<br />
braucht Breitband auch Zuhause. Um zu recherchieren oder<br />
215
Breitbandversorgung <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
multimediale Elemente einzubinden und damit die Qualität<br />
des Unterrichts zu verbessern, benötigt er einen Internetzugang<br />
mit einer akzeptablen Bandbreite.<br />
Einer leistungsfähigen Breitband-Infrastruktur kommt eine<br />
elementare Bedeutung besonders für die ländlichen Regionen<br />
zu. Die Verfügbarkeit dieser Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts<br />
ist immens wichtig für die Attraktivität der Gemeinden<br />
geworden. Fehlt Breitband, bedeutet dies einen kaum zu<br />
kompensierenden Nachteil für Städte und Gemeinden in den<br />
ländlich strukturierten Regionen gegenüber den schon heute gut<br />
versorgten Ballungsräumen. Die digitalen Gräben zu reduzieren<br />
ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Die Verfügbarkeit einer adäquaten<br />
Breitbandanbindung auch in den ländlichen Regionen<br />
ist eine Grundbedingung dafür, Chancen ergreifen und nutzen<br />
zu können. Das verstehen wir unter Chancengleichheit der<br />
Lebensbedingungen. Deshalb ist sie für die Zukunft der Bundesrepublik<br />
insgesamt von enormer Wichtigkeit. Fast 50 Millionen<br />
Menschen leben in den ländlich geprägten Regionen während<br />
nur jeder dritte Deutsche in den Ballungsgebieten ansässig ist.<br />
Der überwiegende Teil der rund 3,5 Millionen mittelständischen<br />
Betriebe, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden, haben<br />
ihren Standort außerhalb der Großstädte in den vielfältigen,<br />
teilweise ländlichen Regionen.<br />
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert daher bereits<br />
seit vielen Jahren, bei der Breitbanderschließung die ländlichen<br />
Regionen im Blick zu behalten und eine moderne Telekommunikationsanbindung<br />
sicherzustellen. Es ist nicht zuletzt auf diese<br />
politischen Initiativen zurückzuführen, dass das Thema mittlerweile<br />
weit oben auf der politischen Agenda steht. Mit finanziellen<br />
Förderprogrammen, der Breitbandstrategie der Bundesregierung<br />
und der gezielten Berücksichtigung der Ausbaunotwendigkeit<br />
bei der Versteigerung der zusätzlichen Mobilfunkfrequenzen<br />
durch die Bundesnetzagentur im Mai 2010 sind politische<br />
Weichen gestellt worden, die in die richtige Richtung weisen.<br />
Mobiles Arbeiten oder Telearbeit am privaten Schreibtisch in<br />
den eigenen vier Wänden werden durch die Verfügbarkeit einer<br />
schnellen Internetverbindung möglich. Die Herausforderung,<br />
digitale Chancengleichheit zu schaffen, ist dadurch aber nicht<br />
verschwunden. Sie bleibt nach wie vor eine zentrale Aufgabe<br />
aller beteiligten Akteure.<br />
Die Bedeutung dieser Schlüsselinfrastruktur erstreckt sich<br />
darüber hinaus auch auf die sich wandelnden Bedingungen für<br />
die öffentlichen Verwaltungen. Durch den Einsatz von E-Government<br />
lassen sich Verwaltungsprozesse beschleunigen und<br />
der Bürgerservice steigt. Zunehmend können Verfahren unter<br />
Beteiligung der Betroffenen bearbeitet werden, ohne dass diese<br />
selbst in den Gemeindeverwaltungen präsent sein oder Unterlagen<br />
physisch per Post verschicken müssen. Der Fortschritt<br />
von Verwaltungsprozessen kann dem Zeitbudget der Bürger<br />
angepasst und von diesen mitbestimmt werden. Abgesehen<br />
davon werden auch aufwendige Prozesse der einbeziehenden<br />
Einwohnerbeteiligung einfacher, bei der Bürger in Planungs-<br />
und planungsvorbereitende Prozesse einbezogen werden, bevor<br />
sie formal beteiligt werden.<br />
Des Weiteren gilt, dass auch Kosteneinsparungen und Effizienzrenditen<br />
des Einsatzes moderner Kommunikationstechnik<br />
noch höher sind, wenn Aufgaben von mehreren Kommunen<br />
gemeinsam in interkommunaler Zusammenarbeit erfüllt wer-<br />
216<br />
den. Auch hier ist die leistungsfähige Infrastruktur zwingende<br />
Voraussetzung. Hinzu kommt, dass elektronische Kommunikationsangebote<br />
der Kommunen, wie etwa Online-Portale oder<br />
auf dem Web-2.0-Prinzip basierende Partizipationsangebote an<br />
ihre Bürgerschaft, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ein<br />
„Digitales Stadtgedächtnis“, wie es etwa in Coburg zur Verfügung<br />
steht, kann von den Einwohnern nur dann aktiv mitgestaltet<br />
werden, wenn die multimedialen Angebote auch in angemessenen<br />
<strong>Download</strong>zeiten genutzt werden können.<br />
Breitband ist Lebensqualität<br />
Breitband ist jedoch nicht nur essentiell nützlich im Sinne<br />
der Eröffnung von besseren Bedingungen für Wirtschaft und<br />
Verwaltung, sondern von mindestens ebenso großer Bedeutung<br />
ist die Verfügbarkeit von Breitband für die Lebensqualität der<br />
Bevölkerung. Mehr als zwei Drittel aller Bundesbürger nutzen<br />
regelmäßig das Internet und ständig kommen neue Nutzergruppen<br />
hinzu. Auch Senioren entdecken das Netz für sich. Die<br />
„Silver-Surfer“ nutzen mittlerweile nahezu alle Online-Angebote,<br />
kaufen im Netz ein oder sparen sich durch „Homebanking“ den<br />
aufwändigen Weg zur nächsten Sparkasse. Durch den Wandel<br />
der verfügbaren Kommunikationsangebote hin zu Videoportalen<br />
wie zum Beispiel YouTube sind die Anforderungen an die<br />
Geschwindigkeit der Datenleitungen immens gestiegen.<br />
Online-Nutzer möchten heute Urlaubsfotos hochladen, verpasste<br />
Fernsehsendungen im Netz anschauen oder via Webcam mit<br />
Freunden kommunizieren. Für diese multimedialen Anwendungen<br />
ist ein schneller Internetzugang Voraussetzung. Sein<br />
Fehlen stellt eine nicht zu unterschätzende Beeinträchtigung<br />
der Lebensqualität in einer Stadt oder Gemeinde dar und kann<br />
in letzter Konsequenz dazu führen, dass sich Menschen in einer<br />
anderen Kommune, die über eine bessere Breitbandversorgung<br />
verfügt, ansiedeln.<br />
Die zentrale Bedeutung von schnellen Datenleitungen in den<br />
Bereichen Bildung und Gesundheit wurden schon erwähnt.<br />
Schüler und Studenten erledigen einen großen Teil ihrer Informationsrecherchen<br />
online, Schulen stellen Arbeitsmaterialen und<br />
multimediale Zusatzinformationen im Netz zur Verfügung und<br />
bieten auf speziellen, schulübergreifenden Portalen weiterführende<br />
Informationen an. Auch in der Gesundheitsversorgung<br />
bedeutet eine leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur<br />
die Grundlage für neue Serviceangebote, die Zeit und Geld<br />
sparen und gleichzeitig die Qualität und Sicherheit für Patienten<br />
erhöhen können. So können zum Beispiel grundlegende<br />
Gesundheitsdaten wie Pulsfrequenz, Blutdruck oder Blutzuckerwerte<br />
online an den Hausarzt übermittelt werden, was eine<br />
ständige Kontrolle über den Zustand der Patienten erlaubt und<br />
gegebenenfalls überflüssige Arztbesuche sparen kann. Gerade in<br />
Zeiten der immer geringeren Hausarztdichte in den ländlichen<br />
Regionen kann dies dazu beitragen, die Verfügbarkeit ärztlicher<br />
Betreuung für die Gesamtheit der Einwohner und die konkrete<br />
Qualität der Betreuung zu erhöhen und den Aufwand für Bürgerinnen<br />
und Bürger zu reduzieren.<br />
Die Liste dieser Beispiele und Anwendungsmöglichkeiten<br />
ließe sich beliebig weiter fortsetzen. Nach einer Prognose aus<br />
dem Jahr 2010 wird sich der weltweite Datenverkehr bis zum<br />
Jahr 2014 vervierfachen, für Deutschland wird sogar eine Stei
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Breitbandversorgung<br />
gerung um 500 % vorausgesagt! Dieser rasante Anstieg ist unter<br />
anderem der verstärkten Nutzung von Fernsehangeboten und der<br />
explosionsartigen Ausbreitung von Online-Videos geschuldet.<br />
Den unterversorgten Kommunen stellt sich damit eine doppelte<br />
Herausforderung: Zum einen gilt es, möglichst schnell eine<br />
adäquate Breitbandanbindung mit Geschwindigkeiten von ca.<br />
10 MBit/s zu bekommen, zum anderen darf dabei der Gedanke<br />
der Nachhaltigkeit der verwendeten Technologie nicht aus dem<br />
Blickfeld geraten.<br />
Mobile Lösungen schaffen eine schnelle Verfügbarkeit im<br />
Bereich von zwei bis sechs MBit/s. Die neue Mobilfunktechnologie<br />
LTE (Long Term Evolution) wird noch höhere<br />
Bandbreiten verfügbar machen. In wenigen Jahren werden<br />
Office-Lösungen<br />
EFFIZIENZ EFFIZIENZ<br />
Nutzen Sie die Rahmenvereinbarungen<br />
mit Brother Top-Konditionen!<br />
allerdings auch deutlich höhere Bandbreiten als momentan<br />
gefragt sein; nicht umsonst ist in der Breitbandstrategie der<br />
Bundesregierung von einer <strong>Download</strong>geschwindigkeit von<br />
50 MBit/s die Rede. Für solche oder noch höhere Geschwindigkeiten<br />
gerade auch mit Blick auf das schnelle Hochladen von<br />
Daten sind nach heutigem Kenntnisstand nur kabelgebundene<br />
Lösungen geeignet.<br />
Für die Städte und Gemeinden eröffnen sich durch die Kombination<br />
von schnell verfügbaren Lösungen mit einer langfristigen<br />
Ausbauplanung zeitliche Spielräume. Ohne untätig zu sein, können<br />
sie eine komplette Erschließung mit Glasfaser vorbereiten,<br />
aber in der Zwischenzeit die verfügbare Funktechnologie mit<br />
moderaten Ausbaukosten zur Anwendung bringen.<br />
Brother Office-Lösungen überzeugen<br />
mit Effizienz und intelligenter Funktionalität.<br />
Vom Beschriftungssystem bis zum<br />
High-End Laser-MFC.<br />
Mehr Infos unter www.brother.de<br />
217
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
E-Government als gemeinsame Aufgabe<br />
von Staat und Kommunen<br />
Dr. Wilfried Bernhardt<br />
Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Europa und<br />
Beauftragter für Informationstechnologie (CIO) im Freistaat Sachsen<br />
Auch in der sächsischen<br />
Staats- und Kommunalverwaltung<br />
sehen wir uns heute<br />
stetig wachsenden Herausforderungen<br />
gegenüber.<br />
Demografischer Wandel, die<br />
notwendige Anpassung an<br />
sinkende staatliche Einnahmen,<br />
ein sich ausbreitender<br />
internationaler Wettbewerb<br />
und der immer schneller voranschreitende wissenschaftlichtechnische<br />
Fortschritt verlangen auch von der Verwaltung neue<br />
Antworten. Diesen neuen Rahmenbedingungen wollen wir im<br />
Freistaat Sachsen durch eine umfassende, konsequente Staatsmodernisierung<br />
gerecht werden. Unser Anspruch ist es, vorausschauend<br />
auf künftige Anforderungen an das Verwaltungshandeln zu<br />
blicken und gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren Lösungen<br />
zu erarbeiten. Schon heute entscheidet sich, wie die Verwaltung<br />
des Freistaates in Zukunft aufgestellt sein wird.<br />
Dem verstärkten Einsatz von IT-Lösungen in der Verwaltung<br />
kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Wir sollten die sich<br />
stetig verändernden Nutzungsbedürfnisse der Bürger im Internetzeitalter<br />
unbedingt als Chance begreifen: Hier bietet sich eine<br />
Vielzahl von neuen Kommunikationswegen zwischen Bürgern<br />
und ihrer Verwaltung.<br />
Von der stärkeren Durchdringung der Verwaltungsleistungen<br />
mittels Informationstechnologie und der breiten Einführung<br />
von E-Government erhoffen wir uns im Freistaat aber auch<br />
umfangreiche Effizienzgewinne innerhalb der Verwaltung.<br />
Auch wenn in dünner besiedelten Räumen nicht alle Behördenstandards<br />
auf Dauer erhalten werden können, so<br />
erhält der Bürger über IT einen ganz kurzen Draht zu seiner<br />
Verwaltung.<br />
Um die Aufgaben in diesem Bereich zu bündeln und damit der<br />
wachsenden Bedeutung gerecht werden zu können, wurde ich<br />
mit Beschluss des Kabinetts im Mai 2010 zum Beauftragten für<br />
Informationstechnologie im Freistaat Sachsen berufen. In dieser<br />
Funktion, die sich in vergleichbarer Weise weltweit in Unternehmen<br />
und Verwaltung findet und die auch als Chief Information<br />
Officer (CIO) bezeichnet wird, bin ich sowohl für die grundlegenden<br />
Fragen des E-Government-Angebotes des Freistaates<br />
als auch für die Koordinierung von Planung, Organisation<br />
und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik<br />
zuständig. Der Lenkungsausschuss für IT und E-Government,<br />
dessen Vorsitz ich inne habe, trifft die Grundsatzentscheidungen<br />
für diesen Bereich in der Staatsverwaltung. Auch vertrete ich die<br />
218<br />
Angelegenheiten des Freistaates in dem im letzten Jahr von Bund<br />
und Ländern gegründeten nationalen IT-Planungsrat.<br />
Einige meiner weiteren Aufgaben in dieser Funktion sind:<br />
– Festlegung von Zielen der Informationstechnologie in der<br />
Landesverwaltung unter Beachtung der Nutzerbedürfnisse,<br />
– Beratung der Politik und Verwaltung in allen Fragen zur<br />
Informationstechnologie und zum E-Government. (Dabei<br />
gilt es, auf eine Optimierung der Informationsprozesse<br />
bezüglich Effizienz, Stabilität und Nutzerfreundlichkeit,<br />
hinzuwirken.),<br />
– Initiator von Partnerschaften des Freistaates mit Wirtschaft<br />
und Wissenschaft auf dem Gebiet der Informationstechnologie,<br />
– Ansprechpartner für die Kommunalen Spitzenverbände in<br />
Fragen der Informationstechnologie unter Beachtung der<br />
kommunalen Selbstverwaltung nach Artikel 28 GG, z. B.<br />
bezüglich der Schaffung von Organisationsformen für IT<br />
und E-Government, die gemeinsam von Staat und Kommunen<br />
getragen werden.<br />
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige zentrale Projekte im<br />
Bereich des E-Government vorstellen:<br />
Gemeinsame Nutzungsvereinbarung zur<br />
E-Government-Plattform des Freistaates Sachsen<br />
Mit der landesweit verfügbaren und von allen staatlichen und<br />
kommunalen Verwaltungen nutzbaren E-Government-Infrastruktur<br />
stellt der Freistaat Sachsen eine Basis für die Umsetzung<br />
der gemeinsamen Aufgaben im E-Government bereit. Sie besteht<br />
aus dem Sächsischen Verwaltungsnetz und der E-Government-<br />
Plattform mit ihren Basiskomponenten und wird vom Freistaat<br />
Sachsen betrieben.<br />
Um eine anforderungsgerechte Weiterentwicklung als gemeinsame<br />
Aufgabe und den effizienten Betrieb der E-Government-Infrastruktur<br />
zu gewährleisten, beteiligen sich Land<br />
und Kommunen ab <strong>2011</strong> gemeinsam an der Finanzierung der<br />
E-Government-Plattform.<br />
Im Januar <strong>2011</strong> haben der Freistaat Sachsen, der Sächsische<br />
Städte- und Gemeindetag und der Sächsische Landkreistag eine<br />
Vereinbarung zur Mitnutzung der zentralen E-Government-<br />
Plattform und ihrer Basiskomponenten durch die sächsischen<br />
Kommunalverwaltungen geschlossen. Unterzeichnet wurde diese<br />
von dem Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages,<br />
Herrn Mischa Woitscheck, dem Geschäftsführenden
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 E-Government-Basiskomponenten<br />
Präsidialmitglied des Sächsischen Landkreistag e. V., Herrn André<br />
Jacob, und mir als CIO für den Freistaat Sachsen.<br />
Diese Vereinbarung regelt die organisatorischen, finanziellen<br />
und technischen Rahmenbedingungen für die Nutzung der E-<br />
Government-Plattform und ihrer Basiskomponenten durch die<br />
sächsischen Kommunalverwaltungen sowie die Zusammenarbeit<br />
bei deren Weiterentwicklung. Die Partner der Vereinbarung sind<br />
sich einig, dass die Nutzung der E-Government-Plattform und<br />
ihrer Basiskomponenten zu deutlich erkennbaren Mehrwerten<br />
in den Verwaltungen führen kann. In vertrauensvoller Zusammenarbeit<br />
wollen wir deshalb die vorhandene E-Government-<br />
Plattform und ihre Basiskomponenten entsprechend den Anforderungen<br />
von Bürgern, Wirtschaft und auch den Verwaltungen<br />
weiterentwickeln.<br />
Dabei stellen wir insbesondere folgende Anforderungen an die<br />
Einführung von E-Government:<br />
– Verbesserte Bereitstellung von Informationen zu Verwaltungsverfahren<br />
für die Verwaltungskunden (Bürger und<br />
Unternehmen),<br />
– Umfassende Bereitstellung von elektronischen Zugängen zu<br />
den Verwaltungsverfahren sowie zur Datenerfassung und<br />
zum Datenaustausch zwischen Verwaltungen auf elektronischem<br />
Wege,<br />
– Bereitstellung von Online-Anwendungen, die eine sichere<br />
und datenschutzgerechte elektronische Abwicklung und<br />
Integration von Verwaltungsverfahren unterstützen<br />
Für die Umsetzung der Anforderungen stellt der Freistaat<br />
Sachsen gegenwärtig folgende IT-Systeme (E-Government-Basiskomponenten,<br />
BaK) zentral bereit und entwickelt diese unter<br />
Einbeziehung der kommunalen Seite weiter:<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Amt24/Zuständigkeitsfinder (ZF),<br />
Formularservice (FS),<br />
Zentrales Content Management System (ZCMS),<br />
Geodaten (GD),<br />
Elektronische Signatur/Verschlüsselung (ESV),<br />
Zahlungsverkehr (ZV),<br />
Integrationsframework (IF).<br />
In den weiteren Artikeln dieser Ausgabe des <strong>Sachsenlandkurier</strong>s<br />
werden die einzelnen Basiskomponenten ausführlicher dargestellt<br />
sowie ein Ausblick zu den aktuellen Planungen gegeben.<br />
Ein wichtiger Bestandteil der Vereinbarung sind natürlich die<br />
Leistungen, die der Freistaat Sachsen zur E-Government-Plattform<br />
und den o. g. Basiskomponenten übernimmt.<br />
Dazu gehören:<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
System- und Anwendungsbetrieb,<br />
Softwarepflege und -weiterentwicklung,<br />
Zentrale Anwendungsbetreuung, Nutzeradministration,<br />
Zentraler User Help Desk (1st Level Support) für Verwaltungen<br />
und autorisierte Dienstleister<br />
Störungsbehebung und Problemlösung (2nd und 3rd Level<br />
Support),<br />
Beratung, Hilfestellung, Projektunterstützung,<br />
Marketing.<br />
Diese Leistungen stehen allen Staats- und Kommunalverwaltungen<br />
ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Der zentrale User<br />
Help Desk (UHD), eine telefonisch erreichbare Anwenderhilfe,<br />
ist bei T-Systems angesiedelt, dem Dienstleister, der im Auftrag<br />
der Freistaates Sachsen den System- und Anwendungsbetrieb<br />
übernimmt. Neben dem 1st Level Support kann dieser auch als<br />
Kontaktstelle für Beratungsfragen rund um die E-Government-<br />
Plattform genutzt werden. Die Mitarbeiter des UHD werden<br />
die Anfragen an die Ansprechpartner, die fachliche Fragen zu<br />
den Basiskomponenten beantworten können, weiterleiten und<br />
sind über folgende Kontaktdaten erreichbar:<br />
–<br />
–<br />
Tel.: 0800 2255 742 1500<br />
E-Mail: support@egov.sachsen.de<br />
Ein wichtiger Schritt zur umfassenden Bereitstellung von<br />
elektronischen Zugängen zu Verwaltungsverfahren ist ein<br />
flächendeckendes Angebot an elektronisch ausfüllbaren und<br />
elektronisch einreichbaren Formularen. Wir haben dazu vereinbart,<br />
dass der Freistaat Sachsen es übernimmt, erstmalig<br />
130 kommunale Grundformulare auf dem Formularserver<br />
technisch bereitzustellen, die von allen Kommunen genutzt<br />
werden können. Sollte hierzu bereits Bedarf bestehen, können<br />
sich interessierte Kommunen oder kommunale IT-Dienstleister<br />
an die Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung<br />
(SAKD) wenden.<br />
Die gemeinsame Finanzierung des Betriebs sowie die Weiterentwicklung<br />
der E-Government-Plattform und ihrer Basiskomponenten<br />
ist in der Vereinbarung zunächst bis zum Jahr 2014<br />
geregelt. Die vollständige Vereinbarung inklusive Anlagen kann<br />
über die Internetauftritte der kommunalen Spitzenverbände<br />
heruntergeladen werden.<br />
Gemeinsame Gremien<br />
Zur Klärung und Entscheidung wichtiger operativer Fragen<br />
rund um den Betrieb, den Support und die Weiterentwicklung<br />
der E-Government-Plattform und ihrer Basiskomponenten<br />
soll zukünftig eine gemeinsame Arbeitsgruppe, bestehend aus<br />
Vertretern der Kommunal- und Staatsverwaltungen, eingerichtet<br />
werden.<br />
In der Vereinbarung haben wir uns auch auf die Einrichtung<br />
eines gemeinsamen Gremiums von Staat und Kommunen verständigt,<br />
das in erster Linie strategische Entscheidungen zum<br />
verwaltungsebenenübergreifenden E-Government treffen soll.<br />
Die Aufgaben des neuen Sächsischen IT-Kooperationsrates,<br />
dessen Vorsitz ich übernehmen werde, reichen damit weit über<br />
die Fragen der E-Government-Plattform und der Basiskomponenten<br />
hinaus. Der Sächsische IT-Kooperationsrat wird auch<br />
die sächsischen Positionen für den IT-Planungsrat vorbereiten<br />
und bei der Umsetzung der Entscheidungen des Bund/Länder-<br />
Gremiums mitwirken.<br />
Gemeinsame Projekte<br />
Bereits jetzt pflegen wir zwischen Staats- und Kommunalverwaltungen<br />
eine sehr enge Zusammenarbeit bei der Umsetzung<br />
gemeinsamer E-Government-Projekte. Im März <strong>2011</strong> haben<br />
wir beispielsweise in einer gemeinsamen Kick-off-Veranstaltung<br />
unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände, der SAKD<br />
und ausgewählten Pilotkommunen den Startschuss für das<br />
219
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Projekt „E-Government-Plattform 2.0“ gegeben. Damit wollen<br />
wir die Möglichkeit schaffen, Verwaltungsverfahren vollständig<br />
elektronisch abzuwickeln und somit „E-Government aus einer<br />
Hand“ – in der IT-Welt auch als „One Stop Government“ bezeichnet<br />
– anzubieten. Das Vorhaben soll zunächst pilothaft am<br />
Beispiel der Gewerbeanmeldung umgesetzt werden. Auch dieses<br />
Projekt wird Ihnen im nachfolgenden Artikel zur E-Government-<br />
Plattform 2.0 näher vorgestellt.<br />
Die Bürger im Freistaat, in den Städten und Kommunen können<br />
zu Recht von uns erwarten, dass sich auch die Verwaltung im<br />
Zeitalter von IT und Internet ihrem geänderten Nutzungsverhalten<br />
anpasst. Dabei werden sie weniger zwischen kommunaler<br />
und staatlicher Ebene unterscheiden, sondern vor allem nach den<br />
Ergebnissen fragen. Auch deshalb ist eine gute Zusammenarbeit<br />
zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen so wichtig. Ich<br />
glaube, hier sind wir wieder ein gutes Stück vorangekommen.<br />
Umsetzung der Vereinbarung zur Mitnutzung<br />
der E-Government-Plattform des Freistaats<br />
Sachsen durch die sächsischen Kommunen<br />
Vorbemerkung<br />
Thomas Weber<br />
Direktor der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung – SAKD<br />
Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung hat die sächsische<br />
Landesverwaltung seit 2005 eine Infrastruktur zur IT-Unterstützung<br />
des Verwaltungshandelns aufgebaut. Diese Infrastruktur<br />
besteht aus der E-Government-Plattform mit ihren<br />
Basiskomponenten, dem Sächsischen Verwaltungsnetz – SVN<br />
mit dem darin integrierten Kommunalen Datennetz – KDN<br />
und Übergängen in öffentliche und weitere Verwaltungsnetze<br />
(z. B. TESTA – Trans European Services for Telematics between<br />
Administrations). Für den Betrieb und die Vermarktung des<br />
KDN war von Anbeginn die eigens dafür gegründete KDN<br />
GmbH zuständig. Im Gegensatz dazu wurden die Bedingungen<br />
zur Mitnutzung der E-Governmentplattform durch sächsische<br />
Kommunalverwaltungen 2005 zunächst nicht festgelegt. Im Juli<br />
2006 informierte die Sächsische Staatskanzlei in einer Pressemeldung<br />
über das Angebot einer kostenfreien Mitnutzung bis 2010,<br />
falls dadurch keine Mehrkosten für das Land entstehen.<br />
Für viele sächsische Kommunen stellte sich das Angebot und der<br />
Zeithorizont als zu vage dar, um ihrerseits wesentliche Investitionen<br />
in die Nachnutzung der Basiskomponenten zu tätigen. Immerhin<br />
handelt es sich bei der Einführung von IT-Anwendungen<br />
um strategische Entscheidungen, die zu weiteren Kosten für die<br />
Schulung der Mitarbeiter und die Erstellung, Einarbeitung und<br />
Gestaltung von inhaltlichen Informationen führen.<br />
Um diese eher zögerliche Haltung der Kommunen zu überwinden<br />
und eine klare Perspektive für Kommunen hinsichtlich<br />
ihrer Beteiligung an der Weiterentwicklung der E-Government-<br />
Plattform zu schaffen, bedurfte es klarer und verbindlicher<br />
Regelungen zur gemeinsamen Nutzung sowie zur kooperativen<br />
Weiterentwicklung und Finanzierung der Plattform und ihrer<br />
Basiskomponenten.<br />
Ergebnis hierzu geführter Verhandlungen ist eine im Januar<br />
<strong>2011</strong> zwischen den sächsischen kommunalen Spitzenverbänden<br />
und dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz<br />
und für Europa geschlossene Vereinbarung. Darin bekunden<br />
220<br />
beide Seiten, dass es zum Einen sinnvoll ist, eine gemeinsame<br />
E-Government-Plattform zu betreiben und zum Anderen, diese<br />
in vertrauensvoller Zusammenarbeit inhaltlich und technisch<br />
weiterzuentwickeln.<br />
Der folgende Beitrag betrachtet organisatorische, finanzielle und<br />
technische Aspekte dieser Vereinbarung und informiert über die<br />
aktuellen Maßnahmen der kommunalen Seite zur Umsetzung<br />
der getroffenen Regelungen.<br />
Zielstellung der Weiterentwicklung der<br />
E-Government-Plattform<br />
Die Weiterentwicklung der sächsischen E-Government-Infrastruktur<br />
hat die medienbruchfreie und zügige Verfahrensabwicklung<br />
auf elektronischem Weg zum Ziel. Dies steigert die<br />
Attraktivität Sachsens als Wohn- und Wirtschaftsstandort und<br />
unterstützt den Umbau der Verwaltungsstrukturen im Hinblick<br />
auf die Anpassung an demografische Veränderungen.<br />
Die Infrastruktur muss sowohl den Anforderungen der Bürger<br />
und Unternehmen als auch der Verwaltung gerecht werden.<br />
Verwaltungskunden erhalten – möglichst „auf einen Klick“ – alle<br />
für ihr Anliegen nötigen Informationen zu dessen Erledigung<br />
zur Verfügung gestellt. Auch den Verwaltungsmitarbeiter/-innen<br />
stehen alle elektronischen Werkzeuge zur Erledigung der<br />
Verwaltungsverfahren leicht zugänglich und verständlich zur<br />
Verfügung.<br />
Bei allem muss die datenschutzgerechte Übertragung, Verarbeitung<br />
und Speicherung der Verfahrensdaten gesichert sein.<br />
In die Vereinbarung eingeschlossene<br />
E-Government-Basiskomponenten<br />
Das Amt24 stellt das Zugangsportal zur sächsischen öffentlichen<br />
Verwaltung für Bürger und Unternehmen dar. Es informiert
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 E-Government-Basiskomponenten<br />
über Verwaltungsverfahren und führt den Verwaltungskunden<br />
zur jeweils zuständigen Behörde.<br />
Zur Eröffnung eines Verwaltungsverfahrens stellt der Formularservice<br />
Formulare zur Verfügung und sorgt für die Weiterleitung<br />
der übermittelten Kundendaten. Der Formularservice kann<br />
sowohl in Amt24 als auch direkt in kommunale Homepages<br />
eingebunden werden.<br />
Mittels des zentralen Content Management Systems – zCMS<br />
können Kommunen einen Internetauftritt realisieren, ohne dass<br />
die Verwaltungsmitarbeiter/-innen über Programmierkenntnisse<br />
verfügen müssen. Die Redaktionsverantwortung für die Inhalte<br />
kann in die zuständigen Fachabteilungen delegiert werden.<br />
Die Basiskomponente Geodaten – GD bietet mit den Geobasisdaten,<br />
dem „Sachsenatlas“ interaktive Karten und weitere<br />
Dienste zur Recherche von und Interaktion mit Geodaten an.<br />
Durch die Elektronische Signatur und Verschlüsselung –<br />
ESV wird die datenschutzgerechte und rechtssichere Abbildung<br />
elektronischer Geschäftsprozesse ermöglicht (z. B. Einbindung<br />
neuer Personalausweis, hochsichere Datenübertragung und elektronische<br />
Unterschriften).<br />
Die Bezahlung von Gebühren für Verwaltungsdienstleistungen<br />
kann mit der Komponente Zahlungsverkehr – ZV abgewickelt<br />
werden.<br />
Ein Integrationsframework – IF verbindet Basiskomponenten<br />
und andere Anwendungen, wenn diese über keine direkten<br />
Schnittstellen verfügen.<br />
Abbildung 1: Denkbares Szenario einer umfassenden Nutzung der<br />
E-Government-Basiskomponenten im Verwaltungsvollzug aus Sicht<br />
der SAKD (vereinfachte Darstellung)<br />
Alle eingeschlossenen Basiskomponenten sind in Anlagen<br />
zur Vereinbarung nach folgendem einheitlichen Schema<br />
beschrieben:<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Kurzbeschreibung<br />
Nutzbare Funktionen<br />
– Für Verwaltungen<br />
– Für Verwaltungskunden<br />
Nutzungsvoraussetzungen und Zugang<br />
– Für Verwaltungen<br />
– Für Verwaltungskunden<br />
Schnittstellen<br />
Servicelevel, Serviceklasse<br />
Nutzungskennzahlen<br />
Verfügbare Dokumentationen<br />
Support.<br />
Die Nutzungskennzahlen bilden die Grundlage für die Feststellung<br />
des tatsächlichen Anteils der Kommunen an der Mitfinanzierung<br />
der E-Government-Plattform für den Zeitraum nach<br />
Ablauf der Vereinbarung (ab 2015 ff). Auf sie wird im Weiteren<br />
noch eingegangen.<br />
Leistungen und Finanzierung<br />
Bei der Finanzierung der E-Government-Plattform wird<br />
zwischen nutzungsunabhängigen und nutzungsabhängigen<br />
Kosten des Betriebs und Kosten für die Weiterentwicklung<br />
unterschieden.<br />
Die Kosten des Betriebs enthalten System- und Anwendungsbetrieb,<br />
Softwarepflege, Störungsbehebung, Administration,<br />
Anwenderunterstützung, Hilfe, Beratung, Projektunterstützung<br />
und Marketing.<br />
Als erste Anlaufstelle für Verwaltungen und autorisierte Dienstleister<br />
richtet der Freistaat einen zentralen User Help Desk<br />
ein.<br />
Die kommunale Seite beteiligt sich an den nutzungsabhängigen<br />
Kosten des Betriebes und den Kosten für die<br />
Weiterentwicklung.<br />
Für die Laufzeit der Vereinbarung (<strong>2011</strong> bis 2014) leistet sie<br />
dafür im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Freistaat und<br />
Kommunen eine steigende pauschale Summe.<br />
Um die Anteile der jeweils staatlich und kommunal verursachten<br />
Nutzung zu messen, erarbeiten Freistaat und kommunale<br />
Seite ein Kennzahlensystem, welches für jede Basiskomponente<br />
Aussagen über die Nutzungsanteile liefert.<br />
Aus Sicht der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung<br />
sollten diese Kennzahlen beispielsweise Aussagen<br />
treffen zu<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Anzahl der Mandanten,<br />
Intensität der Technik-Nutzung (Speicherplatz, Datenvolumen,<br />
Anzahl der Aufrufe, Anzahl der Besucher),<br />
Intensität der Support-Nutzung,<br />
Portale/Online-Anwendungen/Komponenten/Dienste, die<br />
die Nutzung verursachen.<br />
Das Kennzahlensystem konkret auszugestalten ist Aufgabe der<br />
Vereinbarungspartner bis zum Jahr 2012.<br />
221
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Die Kosten der Weiterentwicklung der Plattform und einzelner<br />
Komponenten sollen dann ab 2015 „verursachungsgerecht“<br />
zugeordnet und als Grundlage für Verhandlungen über eine Fortführung<br />
der Vereinbarung oder entsprechende Neuregelungen<br />
herangezogen werden können.<br />
Organisation der Zusammenarbeit<br />
Die Umsetzung der vereinbarten Regelungen und der sich hieraus<br />
ergebenden Rechte und Pflichten beider Seiten erfordert die<br />
Einrichtung von teilweise neuen organisatorischen Strukturen.<br />
Zur Klärung wichtiger operativer Fragen des Betriebs, des<br />
Support und der Weiterentwicklung sieht die Vereinbarung die<br />
Einrichtung einer Arbeitsgruppe „E-Government-Basiskomponenten“<br />
vor. Diese setzt sich aus je drei Vertretern des Landes und<br />
der Kommunen zusammen. Notwendige Entscheidungen trifft<br />
das Gremium mehrheitlich. Die kommunale Seite wird durch<br />
den Sächsischen Städte- und Gemeindetag, den Sächsischen<br />
Landkreistag und die SAKD vertreten. Zur fachlichen Unterstützung<br />
bei der Erhebung, Formulierung und Priorisierung der<br />
kommunalen Anforderungen an die Plattform richtet die kommunale<br />
Seite Arbeitsgruppen unter Leitung der SAKD ein.<br />
Können wichtige operative Fragen in der Arbeitsgruppe „E-<br />
Government-Basiskomponenten“ nicht geklärt werden, werden<br />
diese an ein übergeordnetes Gremium, den Sächsischen IT-Kooperationsrat,<br />
eskaliert, dort beraten und entschieden.<br />
Abbildung 2: Organisationsstruktur für Anforderungsmanagement<br />
Um sich in den Prozess der Weiterentwicklung der E-Government-Plattform<br />
einzubringen, sind fundierte Kenntnisse über<br />
derartige Systeme erforderlich. Diese erlangt man in erster Linie<br />
in der intensiven Auseinandersetzung im täglichen praktischen<br />
Umgang. Daraus folgen eigene Überlegungen zur Verbesserung<br />
und Weiterentwicklung der Anwendungen. Diese Überlegungen<br />
sollten durch Kenntnis und Bewertung der Überlegungen anderer<br />
Nutzer in Zusammenhang mit deren Intentionen gebracht werden.<br />
Dieser Aufwand ist für die einzelne Verwaltung aufgrund<br />
einer Fülle von Konzeptpapieren erheblichen Umfangs und deren<br />
mitunter unklarer Status und Verbindlichkeit immens.<br />
Kommunale Anforderungen an die E-Government-Plattform<br />
wurden deshalb bisher in erster Linie bei der SAKD gebündelt<br />
222<br />
und an die jeweiligen Projektleiter auf Landesseite kommuniziert.<br />
Die SAKD wiederum verfügte über Informationen aus den<br />
Kontakten im Rahmen des First-Level-Supports, aus Rückkopplungen<br />
der von ihr durchgeführten Schulungen und Workshops,<br />
aus Projekten und ihren sonstigen Aktivitäten im sächsischen<br />
E-Government. Auch war sie in einschlägige Überlegungen des<br />
Landes eingebunden.<br />
Allerdings existierte kein verbindlicher Prozess, wie (alle) kommunalen<br />
Anforderungen zu erfassen, an die Verantwortlichen<br />
für die Basiskomponenten weiterzuleiten und im weiteren auch<br />
umzusetzen waren.<br />
Die geschlossene Vereinbarung stellt diese Verbindlichkeit her.<br />
Dieser Prozess muss nun aber auch von der kommunalen Seite<br />
„bedient“ werden. Dazu ist eine möglichst breite, transparente<br />
und aktive Einbeziehung möglichst vieler kommunaler Vertreter<br />
erforderlich.<br />
Unser Ansatz besteht in der Einrichtung fachlicher Arbeitsgruppen,<br />
deren Mitglieder sich aus Vertretern aller Größenklassen<br />
von Kommunen rekrutieren. Diese arbeiten auf freiwilliger Basis<br />
aktiv an der Formulierung kommunaler Anforderungen mit und<br />
überprüfen deren Umsetzung.<br />
Arbeitsgruppe „Amt24/Zuständigkeitsfinder“<br />
Für die Basiskomponente Amt24 fragten wir im April <strong>2011</strong> unter<br />
den aktivsten Nutzern die Bereitschaft zur Mitarbeit ab. Die<br />
positive Resonanz erbrachte eine Besetzung mit 10 Mitgliedern,<br />
darunter Vertreter aus 2 Landkreisen und einer Industrie- und<br />
Handelskammer.<br />
Auf einem ersten Workshop am 20.05.<strong>2011</strong> informierten wir<br />
die Teilnehmer über die vom Freistaat anlässlich der CeBIT<br />
<strong>2011</strong> eingegangene Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg.<br />
Im ersten Schritt wird nun eine gemeinsame softwaretechnische<br />
Basis eingeführt. Bereits daraus ergeben sich auch<br />
für Sachsens Kommunen eine Vielzahl neuer Funktionen und<br />
Nutzungsmöglichkeiten.<br />
Für die Arbeitsgruppe besteht jetzt die Aufgabe, nach Freischaltung<br />
des „neuen“ Amt24 dieses auf die Realisierung alter und<br />
neuer Anforderungen zu überprüfen.<br />
In weiteren Schritten wird dann z. B. auch das „Admincenter“<br />
– die Redaktionsoberfläche von Amt24 – überarbeitet, um<br />
die hierzu seit längerem formulierten Anforderungen nach einer<br />
intuitiveren Bedienung des Systems umzusetzen.<br />
In der Diskussion sind auch die weiter gehende Nutzung und<br />
Integration von Geoinformationen – beispielsweise im Bereich<br />
der Zuständigkeitsermittlung – oder Anforderungen, die sich aus<br />
einer zunehmenden Nutzung des Amt24 von mobilen Endgeräten<br />
durch Bürger, aber auch Verwaltungen ergeben.<br />
Arbeitsgruppe „Kommunaler Formulardienst“<br />
Im Rahmen der Erstellung des „Kommunalen Formularpools“<br />
beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe seit 2006 mit der Erstel-
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 E-Government-Basiskomponenten<br />
lung und Pflege von kommunalen Grundformularen für alle<br />
sächsischen Kommunalverwaltungen.<br />
Bestandteil der Vereinbarung ist auch die Finanzierung von<br />
bis zu 130 (weiteren) kommunalen Formularen. Alternativ zur<br />
aufwändigen Eigenerstellung und Pflege der Formulare durch die<br />
kommunale Gemeinschaft selbst sind in diesem Zusammenhang<br />
auch andere Szenarien, z. B. der Bezug fortlaufend qualitätsgesicherter<br />
Pools von Formularen bei entsprechenden Dienstleistern<br />
zu prüfen. Voraussetzung für solche Szenarien ist natürlich, dass<br />
neben der erstmaligen Beschaffung der Formulare auch die Mittel<br />
für die Pflege der Formulare zentral zur Verfügung stehen.<br />
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass kurzfristige Anpassungen<br />
der Formulare an sächsische Gegebenheiten möglich sind. Im<br />
Detail ist auch zu klären, dass die „Rohformulare“ zum Einen auf<br />
der bestehenden Basiskomponente „Formularservice“ eingesetzt<br />
werden können und dass sie zum Anderen den Vorgaben des<br />
kommunalen Styleguides entsprechen.<br />
All diese Aufgaben wird eine Arbeitsgruppe „Kommunaler Formulardienst“<br />
übernehmen, die außerdem inhaltliche Vorgaben<br />
zu den zur Verfügung zu stellenden Formularen machen und<br />
deren Umsetzung überprüfen soll.<br />
Da sich mittlerweile zum derzeit bevorzugten PDF-Format bei<br />
Formularen Alternativen bieten, die eine intuitivere Benutzung<br />
und bessere Integration in andere Anwendungen ermöglichen, ist<br />
hier eine enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Technologie“<br />
(s. u.) bezüglich der uneingeschränkten Nutzbarkeit von<br />
Formularen und der enthaltenen „Nutzdaten“ erforderlich.<br />
Arbeitsgruppe „Geodaten“ – Arbeitskreis Kommunale<br />
Geoinformationen AK KomGeoSAX<br />
Aus der Erkenntnis, dass auch für die kommunale Verwaltungstätigkeit<br />
raumbezogene Daten zunehmend eine entscheidende<br />
Rolle spielen, hat die SAKD im Jahr 2009 den Arbeitskreis<br />
KomGeoSAX eingerichtet. Vornehmliches Ziel des Arbeitskreises<br />
ist es, auf eine möglichst standardisierte Bereitstellung<br />
von (kommunalen) Geodaten hinzuarbeiten (u. a. zur Umsetzung<br />
der INSPIRE-Richtlinie), kommunale Anforderungen an<br />
zentrale Geodienste zu erarbeiten und diese dann in konkreten<br />
Anwendungsszenarien auch im Verwaltungsvollzug einzusetzen<br />
(z. B. die geocodierte Abbildung von Zuständigkeitsbereichen<br />
für das Amt24). Dazu arbeitet der Arbeitskreis bereits heute eng<br />
mit der GDI-Initiative Sachsen zusammen.<br />
An die „Geodienste“ einer Basiskomponente Geodaten, aber auch<br />
an die Basiskomponente Amt24 ergeben sich aus vorgenannten<br />
Anwendungsszenarien zusätzliche kommunale Anforderungen,<br />
die sowohl im AK KomGeoSAX, als auch in der AG Amt24<br />
formuliert, diskutiert und abgestimmt werden müssen.<br />
Arbeitsgruppe „Technologie“<br />
Alle Basiskomponenten bestehen aus technischen Systemen<br />
(„Technologien“) und darauf erstellten bzw. verwalteten „Inhalten“.<br />
„Inhalte“ sind z. B. die Formulare eines Formulardienstes,<br />
redaktionell bearbeitete Texte im Amt24 oder die konkreten Geo-<br />
daten der GeoBaK. Auch administrative Daten zur Verwaltung<br />
der Systeme können als Inhalte gesehen werden.<br />
„Technologien“ dienen dazu, dass Benutzer diese Inhalte möglichst<br />
unkompliziert bearbeiten und nutzen können, dass diese<br />
Inhalte effizient gespeichert werden und die Systeme sich untereinander<br />
austauschen können bzw. sich integrieren lassen.<br />
Aufgabe der Arbeitsgruppe „Technologie“ wird es daher sein,<br />
diese Funktionalitäten für alle Benutzer und Systeme sicher<br />
zu stellen und die technologischen Hürden zum Einsatz der<br />
E-Government-Plattform und der Basiskomponenten niedrig<br />
zu halten. Maßnahmen könnten sein:<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Einhaltung von offenen Standards,<br />
Herstellung möglichst einheitlicher Authentifizierungsmechanismen,<br />
Verständliche und zugängliche Dokumentationen,<br />
Beschreibung von geeigneten Produkten und Lösungsansätzen,<br />
Erarbeitung von Infrastrukturempfehlungen.<br />
Das SMJus arbeitet zur Zeit unter dem Projekttitel „E-Government-Plattform<br />
2.0“ an einer grundlegenden Weiterentwicklung<br />
der sächsischen E-Government-Plattform. Das Vorhaben<br />
umfasst dabei auch die Entwicklung bzw. Bereitstellung neuer<br />
Komponenten.<br />
Hier ist eine noch einzurichtende kommunale AG „Technologie“<br />
in besonderer Weise gefordert, die kommunalen Erwartungen<br />
und Belange für eine zukünftige E-Government-Infrastruktur<br />
zu kommunizieren und durchzusetzen. Da sich diese technologischen<br />
Aspekte quer durch alle Basiskomponenten hindurch<br />
ziehen, wird sich eine enge Abstimmung der AG „Technologie“<br />
mit den anderen – eher an „Inhalten“ orientierten – Arbeitsgruppen<br />
erforderlich machen.<br />
Management der kommunalen Anforderungen<br />
Üblicherweise werden Anforderungen an Softwareanwendungen<br />
in Feinkonzepten oder Pflichtenheften festgehalten. Die Text-<br />
oder Listendokumente folgen einer Struktur, welche naturgemäß<br />
aber nur eindimensional ist. Änderungen an den Dokumenten<br />
und den einzelnen Anforderungen sind nur durch einen aufwändigen<br />
Textvergleich möglich.<br />
Erfahrungsgemäß durchlaufen Anforderungen an die E-Government-Plattform<br />
bis zu ihrer Erledigung mehrere Status, werden<br />
nach verschiedenen Gesichtspunkten kategorisiert, unterliegen<br />
inhaltlichen Konkretisierungen und haben Beziehungen zu<br />
anderen Anforderungen.<br />
Um die Anforderungen entsprechend zu verwalten, sie auch zu<br />
publizieren und damit die Einschränkungen einfacher Textdokumente<br />
zu überwinden, haben wir für das Anforderungsmanagement<br />
eine Internetanwendung eingerichtet.<br />
Zunächst enthält die Anwendung auf der Basis der Open-<br />
Source-Lösung „Mantis“ alle aktuellen Anforderungen an die<br />
Basiskomponente Amt24 als einzelne, nach Typ und Thema<br />
kategorisierte Bausteine. Die Mitglieder der AG Amt24 können<br />
sich die Anforderungen als Liste, gefiltert nach verschiedenen<br />
223
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Kriterien, und im Detail anschauen, ausdrucken oder als Excel-,<br />
Word-, HTML- oder CSV-Dokument abspeichern. Zu jeder<br />
Anforderung können Notizen und Dokumente hinzugefügt<br />
werden. Jede Änderung wird sichtbar protokolliert.<br />
Die Anwendung soll im Weiteren für alle Arbeitsgruppen und<br />
deren Mitglieder geöffnet werden. Jedem Mitglied wird eine<br />
Rolle zugewiesen, nach der der Zugriff auf Inhalte und Funktionen<br />
abgestuft ist.<br />
Es ist beabsichtigt, nach einer Testphase des Systems den Lesezugriff<br />
auf die Inhalte des Systems allen Interessierten aus der<br />
kommunalen Familie zu eröffnen, um ein möglichst breites<br />
Spektrum an Wünschen, Anforderungen und Feedbacks zu<br />
erhalten.<br />
Die Vereinbarung mit Leben erfüllen<br />
Mit der Vereinbarung zur Mitnutzung der E-Government-Plattform<br />
des Freistaates Sachsen durch die sächsischen Kommunen<br />
und der Plattform als solches stehen solide Grundlagen für<br />
sächsisches kommunales E-Government zur Verfügung.<br />
Durch die kommunale Seite werden in den kommenden Jahren<br />
zentral erhebliche finanzielle Mittel bereit gestellt. Die SAKD<br />
www.amt24.sachsen.de –<br />
Sachsens Ratgeberportal in neuem Gewand<br />
Michael Schalla<br />
Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa<br />
www.amt24.sachsen.de – dynamisches und vielgefragtes<br />
Ratgeberportal<br />
Amt24 – das übergreifende Service-Portal der Verwaltungen des<br />
Freistaates Sachsen – bietet seit 2005 Bürgern, Unternehmen<br />
und Institutionen detaillierte Informationen über Verwaltungsdienstleistungen,<br />
Kontaktdaten zuständiger Behörden sowie den<br />
Zugang zu elektronischen Formularen und weiteren Online-<br />
Diensten. Seither hat sich Amt24 zur zentralen Komponente des<br />
sächsischen E-Government entwickelt. Die Inhalte werden unter<br />
Federführung der Sächsischen Staatskanzlei ständig erweitert<br />
und gepflegt, in immer größerem Umfang werden Verwaltungsinformationen<br />
für die Nutzer aufbereitet. Die technische Weiterentwicklung<br />
erfolgt unter der Federführung des Sächsischen<br />
Staatsministeriums der Justiz und für Europa.<br />
Das wird auch an den Nutzerzahlen des Portals deutlich: In den<br />
nachfragestärksten Monaten kann das Portal bis zu 1,25 Millionen<br />
Seitenaufrufe monatlich verzeichnen. Die Ursache für dieses<br />
wiederkehrende hohe Interesse der Bürger ist ein hoher Informa-<br />
224<br />
Dr. Heike Schwerdel-Schmidt<br />
Sächsische Staatskanzlei<br />
und die kommunalen Arbeitsgruppen begleiten mit ihrem fachlichen<br />
Wissen den Betrieb und die Weiterentwicklung.<br />
Mit der Vereinbarung haben sächsische Kommunen nun auch die<br />
Möglichkeit, sich aktiv an der Weiterentwicklung der Plattform<br />
und ihrer Komponenten zu beteiligen. Zögern Sie deshalb nicht,<br />
diese Möglichkeiten auch ganz konkret zu nutzen.<br />
Sie können das tun, indem Sie in einer der vorbeschriebenen<br />
Arbeitsgruppen mitarbeiten, oder sich durch Übermittlung von<br />
Ideen oder Problemen an die SAKD aktiv am Anforderungsmanagement<br />
beteiligen. Nur durch den Beitrag derer, welche sich<br />
praktisch mit der Einführung von E-Government-Prozessen in<br />
die Verwaltungstätigkeit befassen, lassen sich Erfordernisse und<br />
Probleme im Detail erkennen, was wiederum Voraussetzung für<br />
eine passgerechte Anwendungsentwicklung ist.<br />
Für viele Kommunen waren und sind einzelne Basiskomponenten<br />
bis heute Bestandteil ihrer E-Government-Aktivitäten. Alle<br />
anderen sollten unter den heutigen geänderten Bedingungen<br />
einen möglichen Einsatz prüfen.<br />
Nur wenn sich viele Kommunen an der E-Government-Plattform<br />
beteiligen, wird sich die Idee einer gemeinsamen Initiative<br />
von Land und Kommunen zum Nutzen von Bürgern, Wirtschaft<br />
und Verwaltung auch tatsächlich verwirklichen lassen.<br />
tionsbedarf, wie er zum Beispiel durch Gesetzesänderungen beim<br />
Jahreswechsel entsteht. Daher wird ein besonderes Augenmerk<br />
auf die Aktualität und Relevanz der Amt24-Inhalte gelegt. Neue<br />
Informationen werden übersichtlich im Abschnitt „Aktuell: Was<br />
ändert sich <strong>2011</strong>?“ dargestellt, zusätzliche Themen, wie „Zensus<br />
<strong>2011</strong>“, werden aus gegebenem Anlass aufgenommen.<br />
Ein zentrales Portal mit aktuellen Inhalten –<br />
1885 Texte abrufbar<br />
Beim Start von Amt24 waren rund 160 Texte verfügbar. Die<br />
Anzahl der Texte hat sich inzwischen mehr als verzehnfacht. Im<br />
Mai <strong>2011</strong> sind unter www.amt24.sachsen.de online:<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
923 Lebenslagentexte, darunter 41 kommunale Varianten<br />
962 Verfahrensbeschreibungen, darunter 64 kommunale<br />
Varianten<br />
6.742 Behördendatensätze (kommunale und Landesbehörden,<br />
Schulen, Bundesbehörden, Kammern etc.)<br />
7.123 Formulare, darunter 250 Online-Dienste
Dieses Buch unterstützt Personalvertretungen<br />
und Dienststellen bei allen wichtigen Fragestellungen<br />
auf dem Gebiet des Personalvertretungsrechts.<br />
Das neuartige Konzept dabei: Praxisnahe<br />
Erläuterungen zu thematischen Schwerpunkten,<br />
die sich im Kernbereich der Beteiligungsrechte bis<br />
hin zur Kommentierung der wichtigsten Normen<br />
verdichten.<br />
Für die tägliche Praxis sind die Erläuterungen<br />
durch Musterformulierungen von Anträgen und<br />
Beschlüssen sowie durch Praxishinweise ergänzt.<br />
Im Materialteil sind das SächsPersVG und die<br />
SächsPersVWVO in der aktuellen Fassung sowie<br />
Auszüge aus dem BPersVG und den wichtigsten<br />
arbeitsrechtlichen Gesetzen abgedruckt.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.ESV.info/978-3-503-13059-7<br />
erich schmidt verl ag<br />
A u f W i s s e n v e r t r a u e n<br />
Bestellungen bitte an den Buchhandel oder direkt an:<br />
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin<br />
Fax: (030) 25 00 85 - 275 · www.ESV.info · ESV@ESVmedien.de<br />
Setzt Standards<br />
für die Praxis!<br />
Personalvertretungsrecht<br />
in Sachsen<br />
Von Roland Gross, Rechtsanwalt und Fachanwalt für<br />
Arbeitsrecht, Leipzig, unter Mitarbeit von Rechtsreferendarin<br />
Alinde Hamacher<br />
<strong>2011</strong>, 197 Seiten, € (D) 29,80<br />
ISBN 978-3-503-13059-7<br />
Firma / Institution ......................................................<br />
Name / Kd.-Nr. ...........................................................<br />
Funktion ....................................................................<br />
Straße / Postfach ........................................................<br />
PLZ / Ort ....................................................................<br />
Fax ...........................................................................<br />
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken<br />
per Fax über Angebote informieren: ja nein<br />
E-Mail ................................................................<br />
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken<br />
per E-Mail über Angebote informieren: ja nein<br />
Datum / Unterschrift ..................................................<br />
<strong>04</strong>03<br />
Fax (030) 25 00 85-275<br />
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG<br />
Genthiner Straße 30 G<br />
10785 Berlin<br />
Widerrufsrecht: Bestellungen zu Büchern können innerhalb von zwei Wochen<br />
nach Erhalt der Ware bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag<br />
GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Fax 030/25 00 85-275, E-Mail:<br />
Vertrieb@ESVmedien.de schriftlich widerrufen werden (rechtzeitige Absendung<br />
genügt).<br />
Bestellschein<br />
Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten lediglich zur Durchführung des Vertrages,<br />
zur Pfl ege der laufenden Kundenbeziehung und um Sie über unsere Angebote und<br />
Preise zu informieren. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke<br />
jederzeit widersprechen. Bitte senden Sie uns in diesem Fall Ihren Widerspruch<br />
schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail an Service@ESVmedien.de.<br />
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Sitz: Berlin · Persönlich haftende<br />
Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH · Amts gericht: Berlin-Charlottenburg ·<br />
93 HRB 27 197 · Geschäftsführer: Dr. Joa chim Schmidt
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Die ursprünglich dargestellten 8 Themen („Lebenslagen“)<br />
wurden inzwischen auf 49 Lebenslagen erweitert. Der Übersichtlichkeit<br />
halber werden die Lebenslagen nun in Kategorien<br />
„für Bürger“ und „für Unternehmen“ aufgeteilt.<br />
Neue Herausforderungen<br />
Mittlerweile ist Amt24 mit seinen Inhalten Bestandteil des<br />
Verfahrensauskunftssystems zur EU-Dienstleistungsrichtlinie.<br />
Eine neue Sicht auf Verwaltungsverfahren ergibt sich für die<br />
Redaktion Amt24 durch die Verknüpfung des Service-Portals<br />
mit dem Landesprozessregister. Wurden in Amt24 Verwaltungsverfahren<br />
bisher aus Bürgersicht beschrieben, muss nun<br />
auch die Verwaltungssicht berücksichtigt werden. Das Resultat<br />
wird eine weitaus konkretere und detailliertere Beschreibung der<br />
Verfahren und Dienstleistungen in Amt24 sein, die durch die<br />
entsprechenden Registereinträge punktuell ergänzt wird.<br />
Die einheitliche Behördenrufnummer D115 stellte ebenfalls eine<br />
neue Herausforderung für Amt24 dar. Neben der technischen<br />
Anbindung von Amt24 an die bundesweite D115-Wissensdatenbank<br />
war auch eine redaktionelle Überarbeitung der Verwaltungsleistungen<br />
notwendig. Das Ziel ist, dass etwa 80 % der<br />
telefonischen Anfragen schon durch D115-Service-Mitarbeiter<br />
beantwortet werden können! Das kann nur erreicht werden,<br />
wenn alle Leistungen des D115-Katalogs an die Erfordernisse<br />
des D115-Wissensmanagments angepasst sind. Im Gegensatz<br />
zu den Anforderungen durch das Prozessregister muss an dieser<br />
Stelle nun inhaltlich gekürzt werden. Fazit: In Amt24 wird es<br />
künftig eine Kurz- und eine Langfassung der Beschreibungen<br />
von Verfahren und Dienstleistungen geben, die eine speziell für<br />
D115, die andere, konkretere, für das Prozessregister.<br />
Weiterentwicklung in Gemeinschaft<br />
Sachsen betreibt die Weiterentwicklung der Portalsoftware<br />
Zuständigkeitsfinder in einer am 3. März <strong>2011</strong> auf der CeBIT<br />
besiegelten Kooperation mit Baden-Württemberg. Im ersten<br />
Entwicklungsschritt erhalten nun beide Portale die gleiche technische<br />
Basis. Dabei wird im Prinzip das erfolgreiche Vorgehen<br />
226<br />
von 2005 wiederholt: Sachsen erlangt ein erneuertes Portal auf<br />
der Basis der modernisierten Version des Zuständigkeitsfinders<br />
der Firma T-Systems, wie er aktuell in Baden-Württemberg<br />
eingesetzt wird. Gleichzeitig wird auch der kontinuierliche<br />
Ausbau der technischen Basis von Amt24 abgesichert, denn<br />
die gemeinsame Entwicklung spart Kosten und Aufwand und<br />
schont die Landeskassen. In der Kooperation liegt zudem ein<br />
enormes Innovationspotenzial – denn zwei schaffen allemal<br />
mehr als einer!<br />
Obwohl die jetzt anstehende Aktualisierung von Amt24 nur den<br />
Grundstein für die stetige Weiterentwicklung legt, sind bereits<br />
grundlegende Verbesserungen der Nutzeroberfläche und viele<br />
neue Funktionen enthalten. Erfreulicherweise werden damit<br />
auch eine Reihe kommunaler Anforderungen erfüllt, was darauf<br />
hoffen lässt, dass künftig mehr sächsische Kommunen Amt24<br />
in eigene Internetauftritte integrieren.<br />
Unter der Haube<br />
Die Softwarebasis von Amt24 wird gegenwärtig modernisiert;<br />
viele kleine Verbesserungen im Detail sind das Resultat. Mit<br />
den neuen, erweiterten Webservices kann man besser auf den<br />
gesamten Datenbestand von Amt24 zugreifen. Inzwischen<br />
werden auch einzelne schreibende Webservices angeboten, mit<br />
denen man Information in Amt24 übertragen kann. Verschiedene<br />
Dienstleister, wie die Firma denkende portale GmbH und<br />
der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen<br />
(KISA), arbeiten an der Integration dieser neuen Webservices in<br />
ihre Portallösungen. Damit haben Nutzer dieser Produkte künftig<br />
eine komfortable Möglichkeit um lokalisierte Amt24-Inhalte<br />
in ihre Portale einzubinden. Die neuen Webservices werden<br />
dabei helfen, die Nachnutzung von Amt24-Inhalten durch<br />
kommunale und staatliche Behörden voranzutreiben. Im Sommer<br />
<strong>2011</strong> wird die neue Version des sächsischen Service-Portals<br />
Amt24 im neuen Erscheinungsbild und mit zahlreichen neuen<br />
Funktionen online gehen. Dazu gehören erstmalig Schulungen<br />
und Zertifizierungen für Nutzer der Webservices und erneute<br />
Schulungsangebote für Behörden- und Content-Redakteure. Bei<br />
Interesse melden Sie Ihren Schulungsbedarf bitte per E-Mail an<br />
amt24@sk.sachsen.de.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 E-Government-Basiskomponenten<br />
1. Ziele<br />
Die Basiskomponente „Formularservice“<br />
Jens Keller<br />
Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa<br />
Über die Basiskomponente Formularservice werden elektronische<br />
Formulare für Bürger und Unternehmen zentral bereitgestellt<br />
und administriert. Diese elektronischen Formulare<br />
sind sowohl elektronisch ausfüll- und speicherbar, elektronisch<br />
signierbar, elektronisch einreichbar und können elektronisch<br />
an nachgelagerte Systeme weitergeleitet werden (z. B. an EDV-<br />
Fachverfahren oder per Mail). Daneben können alle Formulare<br />
selbstverständlich auch als Leerformular (durch Bürger, Firmen<br />
oder die Verwaltung selbst) ausgedruckt werden.<br />
Zwei Zielsetzungen sind bestimmend: Zum einen soll es den<br />
sächsischen Verwaltungen ermöglicht werden, gemeinsame<br />
Bestände an E-Formularen aufzubauen und Parallelentwicklungen<br />
zu vermeiden. Zum anderen soll die Basiskomponente<br />
eine einheitlich hohe Qualität und Verfügbarkeit der E-Formulare<br />
in Sachsen sichern. Mit einer gemeinsamen technischen<br />
Infrastruktur, einheitlichen Regelwerken und einer zentralen<br />
Koordinierung sind diese Ziele effizient erreichbar.<br />
2. Angebotene Funktionen<br />
Folgende Funktionen der Basiskomponente Formularservice<br />
(BaK FS) stehen den staatlichen und kommunalen Verwaltungen<br />
des Freistaates Sachsen zur Verfügung:<br />
– zentrales, mandantenfähiges Formularmanagementsystem<br />
für Landes- und Kommunalverwaltung<br />
– Verwaltung von Grundformularen, Formularen, Mandanten,<br />
Benutzern<br />
– Revisionssicherheit von (Grund-)Formularen durch Versionierung,<br />
Historisierung<br />
– Mandantenfähigkeit, Nachnutzbarkeit und Vorbefüllung<br />
mit Behördendaten durch Formularinstanziierung<br />
Abbildung 1: Formularservices als Bestandteil des sächsischen E-Governments,<br />
Quelle: Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
ausfüllen, plausibilisieren, zwischenspeichern<br />
einreichen mit/ohne Signatur, Daten elektronisch weiterleiten<br />
Online-Datenentgegennahme, Online-Datenweiterleitung<br />
mit/ohne Transformation (XSLT), Signaturprüfung, Workflows,<br />
Antwortseiten<br />
Statistiken, SQL-Konsole<br />
Formulareditor [e]forms&more für <strong>pdf</strong>- und statische html-<br />
Formulare mit Landeslizenz<br />
Einbetten intelligenter Formularfunktionen wie Berechnungen,<br />
Plausibilitätsprüfungen oder Hilfefunktionen in<br />
die Online-Formulare mittels Formular-Editor<br />
SSL-Verschlüsselung aller Formular-Transaktionen (Formular-Server<br />
und Formular -Gateway).<br />
Verwaltungskunden nutzen die Funktionen der BaK FS indirekt<br />
über die Formulare.<br />
– Aufruf der Online-Formulare in den Web-Auftritten der<br />
Verwaltungen und je nach Funktionalität des einzelnen<br />
Formulars Ausfüllen, Ausdruck und Online-Versand der<br />
eingegebenen Formular-Daten mit und ohne qualifizierter<br />
elektronischer Signatur<br />
– Möglichkeit, die eingegebenen Formular-Daten lokal<br />
zwischenzuspeichern und das Ausfüllen des Formulars zu<br />
einem späteren Zeitpunkt weiterzuführen.<br />
Die Basiskomponente stellt einen Formularserver auf der E-Government-Plattform<br />
bereit, mit dem E-Formulare der sächsischen<br />
Verwaltungen zentral administriert und für E-Government-<br />
Anwendungen zugänglich gemacht werden. Die sächsischen<br />
Landes- und Kommunalverwaltungen administrieren als Mandanten<br />
im Formularservice ihre E-Formulare eigenverantwortlich.<br />
E-Formulare werden dabei versioniert, d. h. jede Änderung kann<br />
nachverfolgt und rückgängig gemacht werden. Der Zugriff auf<br />
die im Formularserver verwalteten E-Formulare kann sowohl aus<br />
Internetauftritten und E-Government-Anwendungen<br />
der einzelnen Verwaltungen als<br />
auch aus Amt24 erfolgen. Dazu ist die Administration<br />
von Amt24 mit dem Formularservice<br />
verbunden; E-Formulare können<br />
so leicht den Verfahrensbeschreibungen und<br />
Behörden in Amt24 zugeordnet werden.<br />
Der Formularserver ermöglicht die gemeinsame<br />
Verwendung von Grundformularen<br />
durch mehrere Verwaltungen. Grundformulare<br />
werden dabei als Basis (Template/<br />
Muster) für den jeweiligen »Mandanten«<br />
(Behörde oder Kommune) verwendet und<br />
bei der Auslieferung instanziiert, d. h. mit<br />
Textangaben und Layoutelementen der<br />
Behörde oder Kommune versehen.<br />
Das Formulargateway der Basiskomponente<br />
ermöglicht es, die eingegebenen Daten<br />
aus E-Formularen entgegen zu nehmen und<br />
227
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
an E-Government-Anwendungen zu übermitteln, um sie dort<br />
automatisiert und medienbruchfrei weiterzuverarbeiten. Dazu<br />
stehen mehrere Schnittstellentechnologien und Dienste zur Verfügung<br />
(siehe unten Technische Schnittstellen). Zusätzlich können<br />
Formulardaten den Verwaltungen auch über elektronische Formular-Postfächer<br />
(Web-Oberfläche) zugänglich gemacht werden.<br />
Alle Formulartransaktionen erfolgen verschlüsselt und können<br />
statistisch ausgewertet werden. Den Formularnutzern bietet das<br />
Formulargateway die Möglichkeit, Formulardaten lokal zwischenzuspeichern<br />
und das Ausfüllen zu einem späteren Zeitpunkt wieder<br />
aufzunehmen. Auch das Online-Einreichen der Formulardaten<br />
sowie das Signieren der Formulardaten mit dem Governikus Web<br />
Signer wird über das Formulargateway realisiert.<br />
Für den Entwurf und die Umsetzung statischer und dynamischer<br />
E-Formulare wird jeweils ein Formulareditor bereitgestellt. In<br />
einer komfortablen Entwicklungsumgebung können in den<br />
Verwaltungen selbst E-Formulare als Acrobat-Datei (für statische<br />
E-Formulare) oder als HTMLDatei (für statische und dynamische<br />
E-Formulare) erzeugt werden. Mit den Editoren wird dabei nicht<br />
nur das Layout der E-Formulare umgesetzt, auch »intelligente«<br />
Formularfunktionen wie Berechnungen, Plausibilitätsprüfungen<br />
oder Hilfefunktionen werden per Formulareditor erzeugt. Mit<br />
der Basiskomponente werden einheitliche Gestaltungsregeln<br />
für E-Formulare der Landes- und Kommunalverwaltungen<br />
bereitgestellt.<br />
3. Nutzer und gegenwärtige Einsatzbereiche<br />
Die BaK FS wird zentral bereitgestellt für alle staatlichen und<br />
kommunalen Behörden. 354 Mandanten (Behörden) arbeiten<br />
aktiv im System mit über 8.000 aktuellen und gültigen Formularen.<br />
Die BaK FS wird sowohl für die Bereitstellung von<br />
verwaltungsexternen (z. B. Bauformulare, Gewerbeformulare,<br />
Wohngeldformulare etc.) wie auch für verwaltungsinterne Formulare<br />
(z. B. RL Bau Formulare, Dienstreiseformulare) genutzt.<br />
Einzelbehörde mit dem größten Formularangebot ist die Sächsische<br />
Aufbaubank (SAB) mit aktuell 606 Formularen.<br />
4. Technische Schnittstellen<br />
a) Webservice zur BaK Amt24 – zur Übernahme der Formulare<br />
in die Behördendaten im Amt24<br />
b) Webservice von der BaK Amt24 – zur Übernahme der<br />
Behördendaten aus Amt24 in die Mandantendaten des<br />
Formularservice<br />
c) Webservice zur BaK ESV – Übergabe von Signaturdaten<br />
an den Governikus Verifier zur Überprüfung von elektronischen<br />
Signaturen, Rückmeldung und Protokollierung<br />
des Prüfergebnisses im Formularservice<br />
d) Schnittstellen bzw. Weiterleitungsregeln zu nachgelagerten<br />
Systemen bzw. Fachanwendungen<br />
– File Weiterleitung des Formulars nach<br />
Eingang im Gateway in eine Datei<br />
(diese liegt auf dem FS-Gateway im<br />
definierten Fileverzeichnis), macht aber<br />
nur Sinn, wenn das File-Verzeichnis im<br />
Nutzer-Zugriff liegt, um von dort die<br />
Daten abzuholen –> also i. d. R. bei<br />
dezentralen Satellitengateways<br />
228<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
FTP Weiterleitung des Formulars nach<br />
Eingang im Gateway zu einem FTP-<br />
Server<br />
Inbox Weiterleitung des Formulars nach Eingang<br />
im Gateway in eine Inbox (auch<br />
auf anderem Gateway)<br />
Mail Weiterleitung des Formulars nach<br />
Eingang im Gateway an eine E-Mail-<br />
Adresse. Es wird nur das SMTP-Protokoll<br />
unterstützt. Das verschickte Mail<br />
kann die XML-Nettodaten und/oder<br />
das PDF-File in Form eines Attachments<br />
enthalten.<br />
Redirect schickt das XML an eine beliebige URL<br />
per https, an der Gegenstelle (URL)<br />
muss scriptgesteuerte Weiterverarbeitung<br />
des XML erfolgen z. B. per PHP,<br />
ASP, JSP (das Häkchenfeld kodieren ist<br />
dazu da, deutsche Umlaute webgerecht<br />
umzuwandeln)<br />
RPC/SOAP bei Weiterverarbeitung über "RPC"<br />
erfolgt die Weiterleitung der (mittels<br />
XSLT transformierten) XML-Daten an<br />
eine RPC/SOAP (Remote Procedure<br />
Call) Schnittstelle. Die Rückmeldung<br />
dieser Schnittstelle wird in das Protokoll<br />
übernommen.<br />
SQL Bei Zuweisung der Weiterverarbeitung<br />
"SQL" erfolgt ein „Insert“ oder<br />
“Update“ in einer Datenbank-Tabelle<br />
mittels JDBC. –> erfordert i. d. R.<br />
dezentrales Satellitengateway<br />
Workflow Bei Zuweisung der Weiterverarbeitung<br />
"Workflow" erfolgt die Weiterleitung<br />
der Formulardaten in eine andere<br />
Inbox. Zusätzlich können dabei die<br />
Werte für OfficeShortcut, FormType,<br />
FormURL, SchemaURL und Format-<br />
String geändert werden.<br />
Diese Schnittstellen bzw. Weiterleitungsregeln können durch<br />
die Nutzer (= Gateway-Behörden-Admin) selbst erstellt und<br />
konfiguriert werden.<br />
5. Weitere Leistungen<br />
Für Mitarbeiter(innen) der Landes- und Kommunalverwaltung<br />
bietet die AVS Meißen Fortbildungsveranstaltungen zur Basiskomponente<br />
Formularservice an.<br />
In einem 2-tägigen Grundlagenlehrgang werden die wesentliche<br />
Funktionsweise des Formularservice, die Basis zur Erstellung von<br />
Formularen und die grundlegende Handhabung des Systems<br />
vermittelt. Die Schulung besteht aus einem Präsentations- und<br />
einem Übungsteil. So können die Schulungsteilnehmer die<br />
Theorie sofort selbst in der Praxis anwenden.<br />
In einem 2-tägigen Aufbaulehrgang werden vertiefende Kenntnisse<br />
zur Funktionsweise des Formularservice, zur Bedienung<br />
des Systems und zur Erstellung von Formularen sowie zu den<br />
Möglichkeiten der Datenweiterleitung an nachgelagerte Syste-
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 E-Government-Basiskomponenten<br />
me vermittelt. Auch hier besteht die<br />
Schulung aus einem Präsentations- und<br />
einem Übungsteil.<br />
6. Nutzungsgrad<br />
Die nebenstehend abgebildete Grafik<br />
zeigt den Nutzungsgrad des Formularservices<br />
zwischen 2007 und 2010<br />
anhand der online aufgerufenen und<br />
online eingereichten Formulare.<br />
Quelle: Leitstelle E-Government im Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste<br />
Die Basiskomponente „Geodaten“<br />
Andreas Klenner, Jörg Taggeselle<br />
Sächsisches Staatsministerium des Innern<br />
Dr. Gunnar Katerbaum, Andreas Hergert<br />
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen<br />
In vielen Beiträgen der Fachliteratur zur modernen Verwaltung<br />
wird immer wieder die Bedeutung von aktuellen digitalen Geodaten<br />
hervorgehoben. Stets wird in diesem Zusammenhang darauf<br />
verwiesen, dass es für nahezu 80 Prozent aller in Verwaltung und<br />
Wirtschaft ablaufenden Geschäftsprozesse unbedingt notwendig<br />
ist, Geodaten zu visualisieren, zu erfassen, zu editieren und zu<br />
verarbeiten. Der Begriff „Geodaten“ bleibt jedoch im Großen<br />
und Ganzen zumeist unscharf und für die tägliche Praxis wenig<br />
greifbar. Dennoch trifft es zu, dass Geodaten – ohne dass es im<br />
Einzelnen tatsächlich bewusst ist – ein ständiger Begleiter des<br />
täglichen Lebens sind. Diese These gilt sowohl für den privaten<br />
Bereich (denken wir hier nur an die bevorstehende Anreise an den<br />
Urlaubsort) als auch für die tägliche Arbeit. Eine große Anzahl an<br />
Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung kam und kommt<br />
nicht ohne Geodaten aus. Die Bedeutung der Basiskomponente<br />
Geodaten als modernes und zeitgemäßes Verwaltungsinstrument<br />
für den schnellen und unkomplizierten Zugang zu den amtlichen<br />
Geodaten im Freistaat Sachsen liegt daher auf der Hand. Bevor<br />
die Basiskomponente Geodaten näher erläutert wird, soll jedoch<br />
zunächst nochmals der Umfang und die Bedeutung des Begriffs<br />
„Geodaten“ konkretisiert werden.<br />
Geodaten können zwar auch in analoger Form vorliegen, in der<br />
heutigen Zeit sind sie jedoch mehrheitlich den digitalen Daten<br />
zuzuordnen. Wichtigste Eigenschaft der digitalen Daten ist ihre<br />
Computerlesbarkeit. Das heißt sie können in einem IT-System<br />
gespeichert, verarbeitet und analysiert werden. In der heutigen<br />
Zeit kommt noch eine weitere wichtige Eigenschaft von digitalen<br />
Daten hinzu: digitale Daten können über das Internet übermittelt<br />
werden. All diese Eigenschaften besitzen digitale Geodaten<br />
auch. Geodaten unterscheiden sich jedoch von anderen Daten,<br />
indem sie gewissermaßen aus zwei Teilen bestehen. Auf der einen<br />
Seite ist die Sachinformation selbst, auf der anderen Seite<br />
– die Beschreibung des Ortes auf der Erdoberfläche, auf den<br />
sich die Sachinformation bezieht und<br />
– die geometrische Form der präsentierten Sachinformation<br />
(Punkt, Linie, Fläche).<br />
Das Charakteristische der Geodaten ist dabei der Ortsbezug, der<br />
beispielsweise durch eine Koordinate hergestellt wird. Allerdings<br />
stellt eine koordinatenbezogene Darstellung von Sachinformationen<br />
tatsächlich nur einen Bruchteil aller Geodaten dar. Zumeist<br />
wird der Ortsbezug indirekt hergestellt. Die bekannteste Form<br />
ist dabei wohl die Postadresse, aber auch die Ortsbeschreibung:<br />
„… um das berühmte Schloss zu finden, verlassen Sie die B 100<br />
ca. fünf Kilometer nach Ortsausgang von …“. Die nachfolgende<br />
Abbildung 1 soll die Bestandteile der Geodaten am Beispiel<br />
„Standort der TU Dresden“ verdeutlichen.<br />
In der Vergangenheit bestand das Problem darin, mit vertretbarem<br />
Aufwand verfügbare Geodaten als Entscheidungsgrundlage<br />
innerhalb der Verwaltung heranzuziehen, da die Präsentations-<br />
229
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Abbildung 1: Geodaten<br />
form der Geodaten höchst heterogen war. Sie reichte von Karten<br />
über die postalische Zuordnung bis zur verbalen Beschreibung.<br />
Eine erste Verbesserung war die Digitalisierung von Geodaten<br />
und der Anfang der neunziger Jahre beginnende Einsatz von<br />
besonderen IT-Systemen in der Verwaltung, die auf die Visualisierung,<br />
Verarbeitung und Analyse von Geodaten spezialisiert<br />
sind. Allerdings sind auch dem Einsatz der als Geografische<br />
Informationssysteme (GIS) bezeichneten Technologie in Bezug<br />
auf die Ansprüche der heutigen Zeit Grenzen gesetzt. Einerseits<br />
werden Verwaltungsprozesse immer schneller und schwieriger,<br />
da immer komplexere Entscheidungen in immer kürzerer Zeit<br />
getroffen werden müssen, so dass bereits die zeitnahe Beschaffung<br />
aktueller Geodaten problematisch ist. Andererseits ist das Angebot<br />
an digitalen Geodaten, die für eine Entscheidung relevant<br />
sind, mittlerweile so groß, dass der Überblick fehlt und eine<br />
komplexe sachgerechte Analyse schwierig ist. An dieser Stelle<br />
setzt die Basiskomponente Geodaten an, da sie die Defizite der<br />
bestehenden GIS-Technologie behebt bzw. deren technischen<br />
Horizont erweitert. Die Basiskomponente Geodaten bedient<br />
sich dabei der oben bereits erwähnten Internettechnologie,<br />
die – wenn man an Ebay oder Amazon denkt – insbesondere<br />
im privaten Bereich bereits etabliert ist. Das Grundprinzip der<br />
Internettechnologie (Abbildung 2) ist verhältnismäßig einfach:<br />
Der Datennutzer greift über seinen Internetbrowser (z. B.<br />
Internetexplorer oder Mozilla Firefox) auf Daten zu, die bei<br />
einem Datenanbieter gespeichert sind. Entscheidend für die<br />
Kommunikation zwischen Nutzer und Anbieter im Internet ist<br />
es, dass beide eine gemeinsame Schnittstelle für den Datenzugriff<br />
verwenden, die allgemein als Dienst (abgeleitet vom englischen<br />
„Webservice“) bezeichnet wird.<br />
Abbildung 2: Grundprinzip der Nutzung von Diensten im Internet<br />
Die Basiskomponente Geodaten bedient sich ebenfalls solcher<br />
Dienste, die im Kontext mit Geodaten allgemein als „Geodatendienste“<br />
bezeichnet werden. Geodatendienste werden in<br />
der Regel im IT-System des Anbieters der Geodaten betrieben<br />
und ermöglichen rund um die Uhr einen schnellen sowie einfachen<br />
Zugang zu den jeweiligen (stets aktuellen) Geodaten.<br />
230<br />
Damit können amtliche Geodaten mit minimalem Aufwand<br />
in Verwaltungsabläufen genutzt werden, ohne dass dafür eigene<br />
technische Systeme zur Speicherung und Verarbeitung der<br />
Geodaten notwendig sind. Da die Bereitstellung der Geodaten<br />
unmittelbar durch die tatsächlich fachlich zuständigen Anbieter<br />
erfolgt, ist eine konstante Qualität und Aktualität stets gewährleistet.<br />
Im Übrigen ist das Grundprinzip der Basiskomponente<br />
Geodaten (Abbildung 3) durchaus vergleichbar mit privaten<br />
Internetangeboten, zu deren bekanntesten sicherlich „google<br />
maps“ gehört. Der entscheidende Unterschied zwischen solchen<br />
privaten Initiativen und der Basiskomponente Geodaten liegt<br />
im Datenangebot. Die Basiskomponente Geodaten ermöglicht<br />
den Zugang zu den Datenressourcen der amtlichen Stellen<br />
des Freistaates Sachsen, also der staatlichen und kommunalen<br />
Verwaltung. Die Themengebiete decken ein breites Verwaltungsspektrum<br />
ab und reichen von Vermessung über Umwelt,<br />
Bildung, Verkehr, Haushalt bis hin zum Tourismus.<br />
Dem Benutzer präsentiert sich die Basiskomponente Geodaten<br />
zunächst durch das Geoportal „Sachsenatlas“, der interaktive<br />
Karten im Internet darstellt und vielfältige Interaktionen in<br />
Geodaten ermöglicht. Als zentrales Geodatenportal für den<br />
Freistaat Sachsen bündelt der „Sachsenatlas“ den Zugang auf<br />
die Geodaten sowohl der staatlichen als auch der kommunalen<br />
Verwaltungen des Freistaats Sachsen. Abbildung 3 zeigt das<br />
Grundprinzip des „Sachsenatlas“. Der „Sachsenatlas“ wird im<br />
Internet über die Adresse http://www.atlas.sachsen.de aufgerufen<br />
und kann danach sofort genutzt, also für den Zugang auf die<br />
amtlichen Geodaten verwendet werden. Darüber hinaus kann<br />
der „Sachsenatlas“ auch in die Internetseiten einer staatlichen<br />
und kommunalen Verwaltung integriert werden. In diesem Fall<br />
würde der „Sachsenatlas“ sich gewissermaßen als „eigene“ Internetanwendung<br />
der jeweiligen Verwaltung präsentieren.<br />
Abbildung 3: Grundprinzip des Sachsenatlas<br />
Neben der Präsentation im Internet bietet die Basiskomponente<br />
Geodaten ihren Nutzern vielfältige Dienste an, um die<br />
amtlichen Geodaten unmittelbar über einen zentralen Zugang<br />
in ihre IT-Systeme, insbesondere GIS, zu integrieren, ohne den<br />
„Sachsenatlas“ selbst zu nutzen. Dies setzt allerdings voraus,<br />
dass die IT-Systeme die Möglichkeit bieten, Geodatendienste<br />
einzusetzen.<br />
Der Erfolg der Basiskomponente Geodaten misst sich am<br />
Datenangebot. Ausdrücklich ist es Ziel, ein immer breiteres<br />
und größeres Angebot an amtlichen Geodaten zu generieren<br />
und über das Internet im Freistaat Sachsen zur Verfügung zu<br />
stellen. Dies setzt jedoch voraus, dass staatliche und kommunale<br />
Verwaltungen den Zugang zu ihren Geodaten ermöglichen und
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 E-Government-Basiskomponenten<br />
diese anderen Verwaltungen, aber auch verwaltungsexternen<br />
Nutzern, wie Bürgern und Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung<br />
zustellen. Im Hinblick auf die eingangs dargestellte<br />
Bedeutung von Geodaten liegt der gesamtwirtschaftliche<br />
Nutzen für die Verwaltung und darüber hinaus für andere<br />
Institutionen auf der Hand. In diesem Kontext lässt sich die<br />
Basiskomponente Geodaten nicht von dem Vorhaben der<br />
Europäischen Kommission trennen, eine gesamteuropäische<br />
Infrastruktur für den Zugang zu amtlichen Geodaten aufzubauen.<br />
Eine solche Infrastruktur wird mit dem etwas sperrigen<br />
Begriff „Geodateninfrastruktur“ beschrieben, der letztlich aber<br />
nichts anderes als das oben beschriebene Grundprinzip für<br />
den Zugang auf verteilt liegende Datenangebote über Dienste<br />
beschreibt. Geodateninfrastrukturen werden derzeit auf allen<br />
Verwaltungsebenen aufgebaut, dementsprechend gibt es eine<br />
Geodateninfrastruktur<br />
– im Freistaat Sachsen, die den Zugang zu sächsischen Geodaten<br />
ermöglicht (GDI Sachsen) und dazu auf die Geodateninfrastrukturen<br />
der staatlichen Behörden und der sächsischen<br />
Kommunen zugreift,<br />
– in der Bundesrepublik Deutschland (GDI-DE), die auf<br />
die Geodateninfrastrukturen des Bundes und der Länder<br />
zugreift sowie<br />
– in der Europäischen Union (INSPIRE), die auf die nationalen<br />
Geodateninfrastrukturen der Mitgliedsstaaten zugreift.<br />
Dabei sind es grundsätzlich immer die originären Geodaten<br />
und Geodatendienste auf die zugegriffen wird, also im Fall des<br />
Freistaates Sachsen, diejenigen der hiesigen Verwaltungen. Die<br />
Europäische Kommission hat den gesamteuropäischen Zugang<br />
zu Geodaten über Geodatendienste gesetzlich in der sog. IN-<br />
SPIRE-Richtlinie 1 geregelt. Diese wurde im Freistaat Sachsen<br />
durch das Sächsische Geodateninfrastrukturgesetz 2 in Landesrecht<br />
umgesetzt. Daneben regeln zahlreiche Verordnungen der<br />
Europäischen Kommission die technischen Anforderungen an<br />
Geodaten und Geodatendienste. Eine Umsetzung aller Anforderungen<br />
in jeder einzelnen von der INSPIRE-Richtlinie<br />
betroffenen staatlichen und kommunalen Verwaltung wäre weder<br />
sachlich noch wirtschaftlich sinnvoll. Aus diesem Grund hat der<br />
Freistaat Sachsen bereits frühzeitig entschieden, die Basiskomponente<br />
Geodaten so weiterzuentwickeln, dass sie allen staatlichen<br />
Verwaltungen und kommunalen Verwaltungen ermöglicht, den<br />
europäischen Verpflichtungen im Rahmen ihrer technischen<br />
und wirtschaftlichen Möglichkeiten nachzukommen. Dementsprechend<br />
wurde ein Geschäftsmodell entwickelt, bei dem die<br />
einzelnen staatlichen und kommunalen Verwaltungen durch<br />
die zentral betriebene Basiskomponente Geodaten unterstützt<br />
werden (Abbildung 4).<br />
Damit die bestehende Basiskomponente Geodaten die Funktion<br />
der oben beschriebenen Anforderungen gewährleisten kann,<br />
muss sie weiterentwickelt und um weitere Funktionen ergänzt<br />
1 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates<br />
vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur<br />
in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) (ABl. EU Nr. L<br />
108 vom 25. April 2007, S. 1)<br />
2 Gesetz über die Geodateninfrastruktur im Freistaat Sachsen<br />
(Sächsisches Geodateninfrastrukturgesetz – SächsGDIG) vom<br />
19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 134)<br />
Abbildung 4: Umsetzung von INSPIRE im Freistaat Sachsen<br />
werden. Dazu gehören insbesondere Funktionen, die die Umsetzung<br />
von INSPIRE bieten:<br />
– Betrieb von Geodatendiensten, um den Zugang zu den Geodaten<br />
der jeweiligen Verwaltung zu gewährleisten,<br />
– Sicherstellung der Leistungsanforderungen (Schnelligkeit,<br />
Menge der Datenzugriffe) gem. INSPIRE-Richtlinie,<br />
– Schutz der Geodatendienste vor einem unberechtigten<br />
Zugriff sowie<br />
– Umwandlung der bestehenden Geodaten in das von<br />
INSPIRE geforderte Datenformat.<br />
Weiterentwickelt werden müssen auch die Angebote an die<br />
Verwaltungen. Dabei ist es besonders wichtig, dass alle wesentlichen<br />
Funktionen „mandantenfähig“ sind. Dies bedeutet, dass<br />
die jeweils benötigte Funktion der künftigen Basiskomponente<br />
Geodaten direkt vom Arbeitsplatz der staatlichen oder kommunalen<br />
Behörde aufgerufen werden kann. In der geplanten Endausbausstufe<br />
der neuen Basiskomponente Geodaten können alle<br />
Funktionen so vom einzelnen Verwaltungsmitarbeiter verwendet<br />
werden, als wäre es ein IT-System der eigenen Verwaltung.<br />
Die künftige Basiskomponente Geodaten soll, beginnend ab<br />
Herbst <strong>2011</strong>, stufenweise bis 2014 aufgebaut werden. Neben<br />
den oben bereits beschriebenen INSPIRE-Funktionen, die natürlich<br />
auch für alle anderen Aufgaben im Zusammenhang mit<br />
der Bereitstellung von Geodaten verwendet werden können, soll<br />
die bestehende Basiskomponente Geodaten insbesondere noch<br />
um folgende Funktionen erweitert werden:<br />
–<br />
–<br />
Lizenzierung von Geodaten und Geodatendiensten sowie<br />
Verkauf von Geodaten und Geodatendiensten.<br />
Nach Abschluss der Weiterentwicklung der Basiskomponente<br />
Geodaten verfügt der Freistaat Sachsen einschließlich seiner<br />
231
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Kommunen über ein modernes und zeitgemäßes IT-System als<br />
Kernbestandteil der GDI Sachsen. Alle Verwaltungen können<br />
damit sowohl ihre europarechtlichen als auch alle anderen Verpflichtungen<br />
auf Basis des Internets erledigen. Perspektivisch<br />
muss der Einsatz der Basiskomponente Geodaten dazu führen,<br />
dass die eingangs erwähnten 80 Prozent aller Verwaltungsentscheidungen<br />
schneller, wirtschaftlicher und effizienter durchgeführt<br />
werden.<br />
Nähere Informationen zur Basiskomponente Geodaten, zu<br />
INSPIRE und zur GDI Sachsen sowie zur geplanten Weiterentwicklung<br />
als Zentrale Komponente der GDI Sachsen erhält<br />
man auf den Internetseiten zur GDI Sachsen unter www.gdi.<br />
sachsen oder beim Staatsbetrieb Geobasisinformation und<br />
Vermessung Sachsen, Referat „Koordinierung GDI Sachsen“<br />
(Koordinierungsstelle.GDI@geosn.sachsen.de).<br />
Die Basiskomponente „Zahlungsverkehr“<br />
Die Basiskomponente Zahlungsverkehr steht den Kommunen<br />
zur medienbruchfreien Abwicklung kostenpflichtiger Verwaltungsdienstleistungen<br />
zur Verfügung<br />
Mit der Basiskomponente Zahlungsverkehr steht allen Verwaltungen<br />
des Freistaats Sachsen und seiner Kommunen eine<br />
einheitliche, standardisierte Dienstleistung für sichere Online-<br />
Zahlungen beispielsweise mit Kreditkarte, Überweisung, Lastschrift<br />
und Giropay zur Verfügung.<br />
Damit schließt der Freistaat Sachsen flächendeckend die Lücke<br />
zur vollständig medienbruchfreien Abwicklung kostenpflichtiger<br />
Verwaltungsdienstleistungen für Bürger, Unternehmen und<br />
öffentliche Verwaltungen.<br />
Die meisten dieser Verwaltungsdienstleistungen beinhalten an<br />
irgendeiner Stelle des Prozesses die Bezahlung von (verauslagten)<br />
Verwaltungsgebühren durch die Bürger oder Unternehmen, die<br />
diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Buchungen müssen<br />
haushaltsordnungskonform vereinnahmt und dem richtigen<br />
Kapitel und Titel zugeschlagen werden. Diese Vorgänge sind organisatorisch<br />
und technisch anspruchsvoll und gehen mit einem<br />
hohen Abstimmungsaufwand aller Beteiligten einher. Viele<br />
Fachverfahren scheuen diesen Implementierungsaufwand und<br />
integrieren keine sofortige, medienbruchfreie Bezahlung der öffentlichen<br />
Dienstleistung. Die Schritte von der Beantragung bis<br />
zum vorausgefüllten Antragsformular sind daher häufig für den<br />
Bürger oder Unternehmen online umsetzbar – bei der Bezahlung<br />
endet der Online-Prozess eines Fachverfahrens jedoch oft.<br />
232<br />
Uwe Kaiser<br />
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste<br />
Bürger und Unternehmen müssen dann zu den Öffnungszeiten<br />
der Kasse die Gebühren „offline“ begleichen oder Informationen<br />
aus einem vorausgefüllten ausgedruckten Überweisungsträger<br />
in ihr Online-Banking per Hand übertragen. Somit ist der<br />
Gesamtprozess der Verwaltungsdienstleistung nicht medienbruchfrei<br />
gestaltet und für die Bürger und Unternehmen<br />
unkomfortabel. Diese Lücke schließt der Freistaat Sachsen mit<br />
der Basiskomponente Zahlungsverkehr, die sich zügig in nahezu<br />
jedes Fachverfahren integrieren lässt.<br />
Nutzt ein Fachverfahren jedoch die Basiskomponente Zahlungsverkehr,<br />
profitiert es sofort von der langjährigen E-Payment-Fachexpertise.<br />
Die Absprachen mit den Haushaltsverantwortlichen<br />
werden professionell bis zu deren Zustimmung zum<br />
Verfahren begleitet.<br />
Die IT-Verantwortlichen des Fachverfahrens werden umfassend<br />
beraten und bei der Umsetzung aktiv unterstützt. Das Fachverfahren<br />
wird aufgrund der Online-Bezahlmöglichkeit mit der<br />
Basiskomponente einfach und nutzerfreundlich und ist trotzdem<br />
haushalts- und datenschutzkonform. Die Online-Zahlung<br />
erledigt die ePayBL Sachsen.<br />
Die Funktionen der Basiskomponente können kostenfrei und<br />
ohne Verpflichtungen getestet werden.<br />
Interessierte Anwender können dazu auch direkten Kontakt zur<br />
Anwendungsbetreuung E-Payment des Freistaates Sachsen unter<br />
zv@sid.sachsen.de aufnehmen.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 E-Government-Basiskomponenten<br />
Die Basiskomponente<br />
„Elektronische Signatur und Verschlüsselung“<br />
Christoph Damm<br />
Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa<br />
Ziele der Basiskomponente „Elektronische Signatur und<br />
Verschlüsselung“ (BAK ESV)<br />
Das Internet verfügt insbesondere als Informations- und Kommunikationsmedium<br />
über eine stetig wachsende Bedeutung.<br />
Bereits heute können jederzeit Wissen abgerufen, Waren ein-<br />
und verkauft sowie elektronische Dienstleistungen umfänglich<br />
in Anspruch genommen werden. Dieser Trend hat in den letzten<br />
Jahren dazu geführt, dass einige Branchen (z. B. der Banken- und<br />
Postsektor) grundlegend revolutioniert wurden. Auch die öffentliche<br />
Verwaltung stellt sich im Rahmen dieser Entwicklungen<br />
(z. B. Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Bereitstellung<br />
elektronischer Kommunikationskanäle, Beschleunigung der<br />
internen und externen Kommunikation) auf eine zunehmende<br />
Digitalisierung des Geschäftsverkehrs ein. Dabei muss – wie auch<br />
bei der papierbasierten Verfahrensabwicklung – die Rechtssicherheit<br />
und der Datenschutz jederzeit gewährleistet sein.<br />
Die Basiskomponente Elektronische Signatur und Verschlüsselung<br />
unterstützt die rechtssichere und datenschutzgerechte<br />
elektronische Kommunikation und bietet damit eine für die<br />
aktuellen Herausforderungen in der sächsischen Verwaltungslandschaft<br />
frei einsetzbare Lösung:<br />
– Identitätsmanagement: Handelt es sich bei meinem Kommunikationspartner<br />
wirklich um die Person, mit der ich<br />
kommunizieren möchte? Kann ich darauf vertrauen, dass<br />
mit ihm elektronisch abgeschlossene Vereinbarungen rechtsgültig<br />
sind?<br />
– Datenschutz: Sind die verarbeiteten (personenbezogenen)<br />
Daten sicher vor unberechtigtem Zugriff geschützt?<br />
– IT-Sicherheit: Sind die informationsverarbeitenden Systeme<br />
in einer Art und Weise konzipiert, dass Vertraulichkeit,<br />
Integrität und Verfügbarkeit sichergestellt sind?<br />
Grundlagen dieser Basiskomponente<br />
Der Freistaat Sachsen orientiert sich im Bereich der Signatur und<br />
Verschlüsselung am Konzept der Virtuellen Poststelle des Bundes.<br />
Auf Basis dieses Konzeptes und der Produkte Governikus (bos<br />
Bremen) und Z1 Secure Mailgateway (zertificon Berlin) wurde<br />
seit 2005 stufenweise die sächsische Basiskomponente Elektronische<br />
Signatur und Verschlüsselung umgesetzt.<br />
Die Produktkette Governikus wird bundesweit von allen Ländern<br />
und dem Bund sowohl flächendeckend eingesetzt als auch<br />
gemeinsam weiterentwickelt. Bei den meisten Ländern – so auch<br />
in Sachsen – ist auch die Einbindung der Kommunen vertraglich<br />
gesichert. Auf EU-Ebene ist die Produktkette Governikus in fast<br />
allen wesentlichen Signatur- und Verschlüsselungsprojekten wie<br />
z. B. PEPPOL oder SPOCS präsent.<br />
Die BAK ESV hat den Anspruch, alle in Sachsen benötigten<br />
Funktionen rund um Signatur und Verschlüsselung zu bündeln<br />
und kostengünstig zentral bereitzustellen. Dieses Angebot richtet<br />
sich an alle Einrichtungen der Landesverwaltung, aber auch an die<br />
Kommunen und Kammern sowie an alle Nutzer, die mit diesen<br />
kommunizieren.<br />
Angebotene Funktionen<br />
Für die sichere elektronische Kommunikation stehen verschiedene<br />
Teilkomponenten mit folgenden Kernfunktionalitäten<br />
zur Verfügung:<br />
– Teilkomponente Secure Mailgateway<br />
– Verschlüsselter und signierter Versand und Empfang<br />
von Nachrichten<br />
– Einbindung in ein E-Mail-Programm oder Nutzung<br />
über eine Weboberfläche<br />
– Teilkomponente Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach<br />
– Hochsichere Kommunikation mittels OSCI-Protokoll<br />
– Durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung<br />
– Qualifizierte elektronische Signatur<br />
Eine weitere Teilkomponente stellt Funktionalitäten rund um<br />
die elektronische Unterschrift von Dokumenten und anderen<br />
Dateien zur Verfügung:<br />
–<br />
Teilkomponente Governikus Signer<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Signatur und Signaturprüfung von Dokumenten<br />
Qualifizierte elektronische Signatur<br />
Zeitstempel und Massensignaturen<br />
Zusätzlich stehen Funktionen wie Langzeitspeicherung, Einbindung<br />
neuer Personalausweis oder Zertifikatsausgabe (elektronische<br />
Identitätsnachweise; PKI) zur Verfügung.<br />
Nutzer und gegenwärtige Einsatzbereiche<br />
Wesentliche, langjährige Einsatzgebiete sind das Elektronische<br />
Meldewesen, der Elektronische Rechtsverkehr und das Gesundheitswesen.<br />
Dazu kommen relativ neue Einsatzgebiete wie der<br />
Einsatz im Pass- und Personalausweiswesen, im Rahmen der<br />
EU-Dienstleistungsrichtlinie oder in der E-Vergabe. Insgesamt<br />
kann gesagt werden, dass praktisch alle Kommunen und Ressorts<br />
des Freistaates Sachsen die Funktionen der BAK ESV in dem<br />
einen oder anderen Teilbereich nutzen.<br />
Wichtige derzeit produktive Einsatzgebiete (nicht vollständig):<br />
– Elektronischer Rechtsverkehr (OSCI und Signatur) in allen<br />
3 sächsischen Registergerichten<br />
233
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Elektronische Kommunikation per<br />
OSCI in allen ca. 300 sächsischen<br />
Pass- und Personalausweisbehörden<br />
im Rahmen Elektronischer<br />
Reisepass und Personalausweis<br />
Elektronischer Versand per OSCI<br />
in allen Grundbuchämtern<br />
E-Vergabe (OSCI und Signatur)<br />
im Staatsbetrieb SIB<br />
Ausgabestelle von Signaturkarten<br />
für das Land Sachsen (u. a. für<br />
Elektronischer Rechtsverkehr, E-<br />
Vergabe und Elektronischer Abfallnachweis)<br />
Ausgabe von SSL-Zertifikaten zur<br />
Absicherung von über 150 Internetangeboten<br />
des Freistaats Sachsen<br />
Elektronisches Meldewesen in allen<br />
ca. 300 sächsischen Meldebehörden<br />
Übertragung von Gesundheitsdaten<br />
per OSCI in allen 13 sächsischen<br />
Gesundheitsämtern<br />
Sichere Kommunikation für alle<br />
ca. 600 beteiligten Stellen der<br />
EU-DLR<br />
Elektronischer Abfallnachweis mit<br />
Beteiligung aller Landkreise, SIB,<br />
SMWA und SMUL<br />
Ausgabe von Maschinenzertifikaten<br />
zur verbesserten Absicherung<br />
des SVN (u. a. für BOS-Digitalfunk)<br />
In Vorbereitung sind u. a. die Einführung<br />
des Elektronischen Rechtsverkehrs<br />
in allen sächsischen Gerichten (bis Ende<br />
2012) sowie die elektronische Kommunikation<br />
im Ausländerwesen.<br />
Quelle: zentrale Anwendungsbetreuung der BAK ESV (Leitstelle E-Government im Staatsbetrieb<br />
Sächsische Informatikdienste)<br />
Quelle: zentrale Anwendungsbetreuung der BAK ESV (Leitstelle E-Government im Staatsbetrieb<br />
Sächsische Informatikdienste)<br />
Aktuelle Aufteilung signierter und verschlüsselter Nachrichten<br />
in Sachsen nach Nutzergruppen<br />
Quelle: zentrale Anwendungsbetreuung der BAK ESV (Leitstelle E-Government im Staatsbetrieb<br />
Sächsische Informatikdienste)<br />
234<br />
Als exemplarisches Beispiel für die sehr<br />
unterschiedlich intensive Nutzung der<br />
BAK-ESV-Dienste in den einzelnen<br />
Projekten kann die Darstellung der<br />
aktuellen Nutzungsanteile der signiert<br />
und verschlüsselt übertragenen OSCI-<br />
Nachrichten dienen. Den bei weitem<br />
höchsten Anteil an der Nachrichtenübermittlung<br />
hat hier das Meldewesen,<br />
gefolgt von Datenübertragungen im<br />
Bereich der Ausgabe von Pässen und<br />
Personalausweisen. Weitere wichtige<br />
Nutzergruppen sind Gesundheitswesen<br />
und Rechtsverkehr, jedoch mit deutlich<br />
geringeren Anteilen.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 E-Government-Basiskomponenten<br />
Derzeitiger Nutzungsgrad der BAK ESV mit Zahlenangaben<br />
Die Nutzung der BAK ESV nimmt ständig stark zu. Dieser<br />
Trend wird sich in den vorhersehbaren Zeiträumen mit hoher<br />
Sicherheit erhalten.<br />
Im Jahr 2010 hat sich so z. B. die Zahl der monatlich verarbeiteten<br />
signierten und verschlüsselten OSCI-Nachrichten von 80.000<br />
auf 120.000 Nachrichten pro Monat gesteigert.<br />
Die Zahl der Nutzer stieg in diesem Zeitraum ebenfalls deutlich<br />
an. So hat sich z. B. die Anzahl der Postfächer für sichere E-Mails<br />
auf dem Secure Mailgateway im Jahr 2010 verdoppelt (von 200<br />
auf 400 Postfächer).<br />
Insgesamt wurden 2010 ca. 1,2 Millionen signierte und verschlüsselte<br />
OSCI-Nachrichten über die BAK ESV vermittelt.<br />
Das Secure Mailgateway wird von ca. 400 Teilnehmern (vor<br />
allem Behörden) aktiv genutzt. Über 150 Internetangebote des<br />
Freistaates Sachsen nutzen SSL-Zertifikate, die über die DFN-<br />
PKI als Teil der BAK ESV angeboten werden.<br />
Mit dem Aufbau einer Registrierungs- und Ausgabestelle für<br />
qualifizierte Signaturkarten Anfang <strong>2011</strong> steht nun auch für<br />
diesen Teilbereich eine Lösung der BAK ESV zur Verfügung.<br />
Seitdem konnten schon knapp 120 Nutzer ihre persönlichen<br />
Signaturkarten entgegennehmen.<br />
Ende Mai <strong>2011</strong> wurde schließlich auch die seit langer Zeit<br />
vorbereitete Landes-PKI des Freistaats Sachsen offiziell in<br />
Betrieb genommen. Durch die Ausgabe von elektronischen<br />
Identitätsnachweisen (Zertifikaten) trägt die Landes-PKI<br />
künftig zu einer höheren Sicherheit im SVN bei.<br />
1. Ausgangslage<br />
Um einen bürgernahen Rund-um-die-Uhr-<br />
Zugang zur Verwaltung zu ermöglichen, sollen<br />
Verwaltungsverfahren künftig ergänzend<br />
zu den bisherigen Möglichkeiten verstärkt<br />
durch eine elektronische Kommunikation<br />
und Verfahrensabwicklung unterstützt<br />
werden. Neben dem Ausbau von Amt24 soll<br />
auch die E-Government-Plattform des Freistaates<br />
auf Basis einer innovativen Zukunftsarchitektur<br />
weiterentwickelt werden. Unter<br />
dem Gesichtspunkt einer Mitfinanzierung<br />
der Plattform durch die Kommunen ab dem<br />
Jahre <strong>2011</strong>, wird auch deren Mehrwert für<br />
die sächsischen Kommunalverwaltungen<br />
schrittweise erhöht.<br />
g<br />
Der Verbreitungsgrad der IT ist<br />
zu erhöhen.<br />
Ausbau Amt24<br />
Der elektronischen Zugang zur<br />
Verwaltung ist rund um die<br />
Uhr zu gewährleisten („24*7“).<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Die BAK ESV hat sich im langjährigen Einsatz als einer der<br />
am stärksten genutzen Bausteine der E-Government-Plattform<br />
bewährt. Inzwischen ist ein technischer Ausbaugrad erreicht,<br />
der praktisch alle wesentlichen Funktionen zur Umsetzung<br />
von Datenschutz und IT-Sicherheit sowie zur Nutzung elektronischer<br />
Identitätsnachweise abdeckt. Neue gesetzliche und<br />
politische Anforderungen wie die Einbindung des neuen Personalausweises<br />
oder des DE-Mail-Projektes bzw. die Umsetzung<br />
von EU-Beschlüssen zu neuen Signaturformaten können durch<br />
den bundesweiten Entwicklungsverbund einfach abgedeckt<br />
und landesweit ohne Zusatzkosten an alle Nutzer der BAK<br />
ESV verteilt werden.<br />
Die Nutzung der Dienste der BAK ESV kann gerade in<br />
kleineren Projekten helfen, den oft schon aus Kostengründen<br />
notwendigen Wechsel von papierbasierten auf elektronische<br />
Verfahren mit vernünftigem Aufwand realisieren zu können –<br />
und das, ohne auf die immer stärker notwendig werdenden und<br />
meist auch gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen gegen<br />
Datendiebstahl und andere Cyberangriffe zu verzichten.<br />
Die zentrale Anwendungsbetreuung der BAK ESV steht für<br />
Anfragen rund um die Nutzung der Dienste der BAK ESV gern<br />
bereit. Weitere Informationen zur BAK ESV können auch der<br />
Webseite www.egovernment.sachsen.de/55.htm entnommen<br />
werden. Dort ist nach einer kurzen Registrierung auch der<br />
direkte und lizenzkostenfreie <strong>Download</strong> von Signatur- und<br />
Verschlüsselungssoftware und der zugehörigen Dokumentation<br />
möglich.<br />
E-Government-Plattform 2.0<br />
Dr. Hans-Peter Seddig, Tobias Heinrich<br />
Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa<br />
E-Government-Plattform 2.0<br />
• Entwicklung einer innovativen<br />
Zukunftsarchitektur<br />
• Konsolidierung der E-<br />
Government-Plattform und<br />
Einführung neuer Komponenten<br />
Die Kosten sind durch<br />
elektronische Abwicklung zu<br />
reduzieren.<br />
Ein Großteil aller Verfahren<br />
soll über einen einheitlichen<br />
Verfahrensmanager<br />
abgewickelt werden.<br />
235
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Das Projekt E-Government-Plattform 2.0<br />
verfolgt das Ziel, die Basiskomponenten<br />
der Plattform so weiterzuentwickeln und<br />
zu vervollständigen, dass ganze Verwaltungsprozesse<br />
komplett elektronisch<br />
über die Plattform abgewickelt werden<br />
können. In einem ersten Schritt soll<br />
auf Basis einer neuen Architektur eine<br />
Gesamtlösung konzipiert werden, in der<br />
wiederverwendbare und konfigurierbare<br />
Prozessschablonen für unterschiedliche,<br />
auch komplexere Antragsprozesse (z. B.<br />
Baugenehmigung) integriert werden<br />
können. Dabei sind insbesondere die Anforderungen<br />
aus Sicht der Antragssteller,<br />
der an den Antragsprozessen beteiligten<br />
Verwaltungen sowie der IT-Fachleute für<br />
die neue Plattform zu berücksichtigen.<br />
Um Doppelentwicklungen zu vermeiden, Abbildung 2<br />
werden in diesem Schritt auch besonders<br />
innovative Lösungen anderer Bundesländer<br />
sowie Erfahrungen aus der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie<br />
mit einbezogen. In einem zweiten Schritt soll auf<br />
Basis eines besonders repräsentativen und mit hohen Fallzahlen<br />
verbundenen Verwaltungsprozesses mit ausgewählten Behörden<br />
eine erste Prozessschablone entwickelt und pilothaft erprobt werden,<br />
die dann für weitere Verwaltungsprozesse nutzbar sind. Im<br />
Weiteren ist dann vorgesehen, auf Grundlage der Erfahrungen<br />
aus der Pilotierung weitere Schablonen für zukünftige Anforderungen<br />
wie beispielsweise „E-Partizipation“ und „Open-Data“<br />
für die Plattform anzufertigen und so statt einzelner technischer<br />
Komponenten, komplette und konfigurierbare Lösungen anzubieten.<br />
Die Abbildung 2 soll den komplexen Lösungsansatz<br />
verdeutlichen:<br />
236<br />
Plattformvision für die Plattform 2.0<br />
Von der Komponentenplattform zur Lösungsplattform<br />
Web<br />
D115<br />
(Telefon)<br />
Bürger<br />
-terminal<br />
E-Mail<br />
Antragsprozesse Open Data ePartizipation<br />
�Gewerbeanmeldung<br />
� Bauantrag<br />
Identitätsmngmt<br />
Signatur<br />
ePayment<br />
� Unfallschwerpunkte<br />
�frei Plätze bei<br />
Kindertagesstätten<br />
Amt24<br />
DMS<br />
eAkte<br />
Pilotverfahren für Antragsprozesse<br />
Workshopteilnehmer priorisieren Gewerbeanzeige<br />
Workshop November 2010<br />
� Kommunale<br />
Spitzenverbände<br />
(SLKT, SSG)<br />
� Städte Dresden und<br />
Chemnitz<br />
� Landkreis Sächsische<br />
Schweiz-Osterzgebirge<br />
� EA (LD Leipzig)<br />
� HWK Dresden<br />
� SAKD<br />
� SMWA<br />
� Abteilung V SMJus<br />
Abbildung 3<br />
Formularservice<br />
�Fortschreibung<br />
des Landesentwicklungsplans<br />
�Dialog-Plattform<br />
Fallmanagement<br />
Serviceportal<br />
Multikanalstrategie<br />
Lösungsschablonen<br />
E-Government-<br />
Anwendungen<br />
Basiskomponenten<br />
Im November 2010 fanden unter Federführung des Sächsischen<br />
Staatsministeriums der Justiz und für Europa mit Beteiligung<br />
der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung<br />
(SAKD), der Handwerkskammer Dresden (HWK Dresden),<br />
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr<br />
(SMWA), des Einheitlichen Ansprechpartners (EA), der Städte<br />
Dresden und Chemnitz, der kommunalen Spitzenverbände<br />
des Sächsische Landkreistag (SLKT) und des Sächsischen<br />
Städte- und Gemeindetages (SSG) sowie des Landkreises Sächsische<br />
Schweiz-Osterzgebirge zwei Innovationsworkshops im<br />
Rahmen des Projektes E-Government-Plattform 2.0 statt. Ziel<br />
der Workshops war es, ein für alle Beteiligten besonders vor-
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 E-Government-Basiskomponenten<br />
teilhaftes Online-Antragsverfahren zu identifizieren und erste<br />
Pilotteilnehmer zu gewinnen. Als Ergebnis der Bewertung der<br />
im Vorfeld eingebrachten Vorschläge, wurde von den Teilnehmern<br />
die Umsetzung eines Onlinedienstes zur Gewerbeanzeige<br />
favorisiert (siehe Abbildung 3). Dabei sollen insbesondere alle<br />
erlaubnisfreien Gewerbeanmeldungen, die erlaubnispflichtigen<br />
Gewerbe Makler oder Gaststätten sowie die zulassungspflichtigen<br />
Handwerke berücksichtigt werden.<br />
Als Pilotteilnehmer wurden die Stadt Dresden und die Stadt<br />
Chemnitz, der Einheitliche Ansprechpartner (EA) und die<br />
HWK Dresden gewonnen. Noch in Klärung sind die Teilnahme<br />
weiterer Städte, Landkreise und Kammern. Allein die Gewerbeanmeldungen<br />
der Städte Dresden, Chemnitz und Leipzig<br />
machten fast 50% der insgesamt 38.680 Gewerbeanmeldungen<br />
des Freistaates Sachsen im Jahre 2009 aus. Das SMWA wird sich<br />
im Rahmen des Vorhabens mit der Klärung rechtlicher Fragestellungen<br />
und der Durchführung deregulativer Maßnahmen<br />
befassen.<br />
2. Nutzen eines Online-Gewerbedienstes für den Freistaat<br />
Erste grobe Schätzungen gehen davon aus, dass bei einer komplett<br />
elektronischen Weiterleitung von den Gewerbeämtern<br />
zu den Weiterleitungsempfängern auf Seite der Gewerbeämter<br />
sehr hohe Einsparungen durch reduzierten zeitlichen Aufwand<br />
und eingespartes Papier erzielt werden können. Darüber hinaus<br />
könnte sich bei Umsetzung folgender Anforderungen weiterer<br />
konkreter Nutzen für die Beteiligten ergeben:<br />
Zentrale Klassifikation der Wirtschaftszweige<br />
Die Gewerbeämter nutzen bei Gewerbeanzeigen nicht durchgängig<br />
die Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen<br />
Bundesamtes („WZ2008“). Eine richtige Zuordnung würde<br />
in den Handwerkskammern die Prüfung eines angemeldeten<br />
Gewerbes auf Eintragung in die Handwerksrolle und die<br />
Nacharbeiten beim Statistischen Landesamt zur Erhöhung der<br />
Datenqualität der Gewerbestatistiken erheblich verkürzen.<br />
Einführung einer landesweiten Gewerbekennung<br />
Die Einführung einer eineindeutigen landesweiten Gewerbenummer,<br />
könnte die zeitaufwendige Zuordnung von Um- und<br />
Abmeldungen zu einer Anzeige für die zuständigen Stellen<br />
erleichtern.<br />
Vorteile für den Gewerbetreibenden bei einer<br />
Online-Antragstellung<br />
Durch die komplette elektronische Umsetzung des Verwaltungsprozesses<br />
würde sich für den Gewerbetreibenden vor allem der<br />
Antragsprozess verkürzen. Die neuen Plattformkomponenten<br />
Antragsassistent sowie ein fallbezogenes Postfach können die<br />
Antragstellung und die Kommunikation mit den Behörden<br />
stark vereinfachen.<br />
Eine integrierte Statusverfolgung würde den Bearbeitungsstand<br />
zum Antrag transparent machen wie in der folgenden<br />
Abbildung gezeigt:<br />
237
E-Government-Basiskomponenten <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
3. Wesentliche Erfolgsfaktoren eines Online-Gewerbedienstes<br />
Die aktuell geringe Verbreitung von elektronischen Signaturen<br />
und die häufige Schriftformerfordernis bei Verwaltungsvorgängen<br />
sind Hindernisse bei der elektronischen Abbildung von<br />
Verwaltungsprozessen. Deshalb sollte die momentan zur<br />
Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen eingesetzte Bund-<br />
Länder-Arbeitsgruppe hier zeitnah entsprechende Vorschläge<br />
unterbreiten. Die Standardisierung bei Formularen, Verwaltungsprozessen<br />
und Datenübertragungsstandards ist eine<br />
wesentliche Voraussetzung zur umfassenden elektronischen<br />
Abbildung von Verwaltungsvorgängen. Im Rahmen der Pilotierung<br />
müssen diese Standards noch in Abstimmung mit<br />
den Beteiligten entwickelt bzw. weiterentwickelt werden, um<br />
anschließend die produktive Nutzung der Piloten und die<br />
Nachnutzung durch weitere Verwaltungen sicherzustellen.<br />
Die verwaltungsübergreifende elektronische Abbildung von<br />
Verwaltungsprozessen erfordert auch die Einführung neuer<br />
238<br />
Komponenten für die E-Goverment-Plattform. Beispielsweise<br />
muss ein sog. Fallmanagement-System eingeführt werden, das<br />
die verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit der Beteiligten<br />
auf Basis einer Fall-ID und die Einbindung der technischen<br />
Komponenten prozessabhängig steuert.<br />
Vertreter von Land, Kommunen und Kammern verständigten<br />
sich zu einer gemeinsamen Vorgehensweise. Um die Projektrisiken<br />
und Kosten minimal zu halten, wird eine stufenweise<br />
Vorgehensweise vorgeschlagen. Zunächst sollen die aufgezeigten<br />
Vorteile für einen Online-Gewerbedienst an einem Prototyp auf<br />
Basis eines fachlichen Grobkonzeptes nachgewiesen werden.<br />
Im Zuge der Erstellung des Grobkonzeptes soll auch eine Prozessanalyse<br />
und eine Prozessoptimierung der Gewerbeprozesse<br />
auf der Fachebene unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
durchgeführt werden. Nach der Realisierung<br />
eines Prototyps, wird die Projektgruppe einen Vorschlag über die<br />
weitere Umsetzung der Pilotierung und des Produktivbetriebes<br />
unterbreiten.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
Investition in die Zukunft<br />
Neues Förderangebot<br />
für die Bildungsinfrastruktur<br />
im ländlichen Raum Sachsens<br />
Frank Kupfer<br />
Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Vielfach werden im ländlichen Raum die Schülerzahlen nicht<br />
mehr erreicht, die erforderlich wären, um Schulen nachhaltig zu<br />
betreiben. Viele Kommunen sehen sich deshalb mit Schulschließungen<br />
konfrontiert und empfinden dies zu Recht als Standortnachteil.<br />
Die Folgen des demografischen Wandels für den<br />
Rückgang an Bildungsinfrastruktur sind absehbar: Der ländliche<br />
Raum verliert an Attraktivität für die Ansiedlung von jungen<br />
Familien mit Kindern, die Distanzen und damit auch Kosten<br />
für den Schülertransport steigen und das Spektrum an Bildungsangeboten<br />
nimmt ab. Dennoch müssen Schulen bestimmten<br />
Qualitätsmaßstäben genügen, und sie müssen bezahlbar bleiben.<br />
Das Schulnetz als Bestandteil der sozialen Grundversorgung<br />
qualitativ hochwertig aufrechtzuerhalten, ist eine Investition in<br />
die Zukunft nachfolgender Generationen.<br />
Vor diesem Hintergrund ist die Sicherung gleichwertiger Bildungschancen<br />
in Stadt und Land ein erklärtes Ziel der Sächsischen<br />
Staatsregierung. Bislang erfolgte die Förderung der Bildungsinfrastruktur<br />
im Freistaat Sachsen im Rahmen der Fachförderung<br />
für den Schulhausbau. Die nunmehr nur noch sehr begrenzt zur<br />
Verfügung stehenden Landesmittel erforderten die Erschließung<br />
neuer Alternativen für die Finanzierung von Projekten des nachhaltigen<br />
Schulhausbaus im ländlichen Raum. Mit Beschluss des<br />
Kabinetts wurde die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums<br />
für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) zur Integrierten Ländlichen<br />
Entwicklung im Freistaat Sachsen (RL ILE/2007) Anfang<br />
Mai <strong>2011</strong> geändert, um das Förderangebot für Träger von Schulen<br />
und Kindertageseinrichtungen in Ergänzung der Fachförderung zu<br />
erweitern. Im Vorfeld wurden hierfür durch das SMUL zusätzlich<br />
134 Mio. für die RL ILE/2007 bereitgestellt.<br />
Neuer Fördergegenstand<br />
Im räumlichen Geltungsbereich der RL ILE/2007 besteht nun<br />
die Möglichkeit, die Modernisierung oder den Neubau von<br />
Schulgebäuden, Schulsporthallen, Schulsportaußenanlagen und<br />
Kindertageseinrichtungen zu unterstützen. Die Förderung des<br />
Neubaus kommt jedoch nur in Betracht, wenn die Sanierung<br />
eines Bestandsgebäudes nachweislich unwirtschaftlich ist oder<br />
bei Schaffung von Bildungszentren.<br />
Energieeffizienz<br />
Zu beachten ist, dass aus Gründen des Klimaschutzes und der<br />
Verbesserung der Gebäudeenergieeffizienz energetische Anforderungen<br />
an die Sanierungsmaßnahmen gestellt werden. Der<br />
dafür erforderliche Investitionsmehraufwand amortisiert sich<br />
in einem Zeitraum von etwa 10 Jahren durch entsprechende<br />
Einsparungen bei den Betriebskosten.<br />
Für alle Schulgebäude und Kindertageseinrichtungen, die dem<br />
Regelungsbereich der Energieeinsparverordnung (EnEV) unterliegen<br />
– mit Ausnahme von Baudenkmalen – gelten demnach<br />
zwingend folgende energetische Anforderungen:<br />
– Modernisierung: Bestehende Gebäude dürfen nach Sanierung,<br />
Modernisierung oder Umbau 70 Prozent der nach<br />
EnEV 2009 einzuhaltenden Höchstwerte (Jahresprimärenergiebedarf<br />
Qp, mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient U)<br />
nicht überschreiten.<br />
– Neubau: Neu zu errichtende Gebäude dürfen 55 Prozent<br />
der nach EnEV 2009 einzuhaltenden Höchstwerte (Jahresprimärenergiebedarf<br />
Qp, mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient<br />
U) nicht überschreiten.<br />
Der jeweilige Nachweis über die Einhaltung dieser Anforderungen<br />
wird wie folgt erbracht:<br />
– für Neubauten: Erklärung zur Einhaltung der Werte durch<br />
Bauvorlageberechtigte nach § 65 SächsBauO<br />
– für bestehende Gebäude: Erklärung zur Einhaltung der<br />
Werte durch Ausstellungsberechtigte nach § 2 SächsEnEV-<br />
DVO<br />
– oder durch eine Erklärung zur Einhaltung des Passivhausstandards<br />
nach Passivhaus-Projektierungs-Paket (PHPP).<br />
Werden ausschließlich Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle<br />
gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 EnEV durchgeführt, erfolgt der Nachweis<br />
(Bauteilnachweis) durch die Unternehmererklärung nach<br />
§ 26a EnEV.<br />
Zuwendungsmodalitäten<br />
Der Kreis der Zuwendungsempfänger umfasst die Gemeinden,<br />
Landkreise, Träger von Schulen in freier Trägerschaft sowie die<br />
Träger der freien Jugendhilfe nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen.<br />
Der Fördersatz beträgt 75 vom Hundert der<br />
zuwendungsfähigen Ausgaben, wobei die Mehrwertsteuer in die<br />
Förderung nicht einbezogen werden kann. Zuwendungen unter<br />
15.000 EUR werden nicht gewährt.<br />
Der neue Fördergegenstand ist vollständig in das Leader- und<br />
ILE-Verfahren integriert. Dies bedeutet, dass es kein eigenes<br />
Finanzbudget für Projekte der Bildungsinfrastruktur gibt,<br />
sodass diese im Wettbewerb mit allen anderen ILE-Vorhaben<br />
stehen. Die Auswahl und Priorität der einzelnen Maßnahmen,<br />
die über die RL ILE/2007 umgesetzt werden sollen, treffen ausschließlich<br />
die Leader- bzw. ILE-Regionen. Die Antragstellung<br />
im ILE-Verfahren ist jederzeit möglich. Vor dem 30.06. eines<br />
239
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
jeden Jahres eingereichte Anträge werden bei einem etwaigen<br />
Bearbeitungsstau dabei vorrangig bearbeitet.<br />
Wesentliche Voraussetzung zur Antragstellung beim zuständigen<br />
Landratsamt ist neben einem positiven Beschluss des Regionalen<br />
Koordinierungskreises die Bestätigung des Sächsischen Staatsministeriums<br />
für Kultus und Sport (SMK) zur Bestandssicherheit<br />
einer Schule. Träger von Kindertageseinrichtungen benötigen eine<br />
Erklärung des Jugendamtes hinsichtlich der Bedarfsplanung.<br />
Nicht förderfähig nach der RL ILE/2007 sind Schulen mit mehr<br />
als 350 Schülern, Gymnasien, Berufsbildende Schulen und deren<br />
Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen. Diese fallen<br />
ebenso in den Zuständigkeitsbereich der Fachförderung des SMK<br />
wie die Förderung der Ausstattung von Schulen.<br />
Neues Förderangebot gezielt nutzen<br />
Das neue Förderangebot für die Bildungsinfrastruktur im<br />
ländlichen Raum über die RL ILE/2007 bietet den Kommunen<br />
und freien Trägern von Schulen und Kindertageseinrichtungen<br />
eine zusätzliche Möglichkeit, dringend notwendige<br />
Investitionen durchzuführen. Attraktive Förderkonditionen<br />
ermöglichen es, qualitativ hochwertige und energieeffiziente<br />
Projekte umzusetzen. Die Haushalte werden dadurch bei den<br />
Betriebskosten nachhaltig entlastet, und die Dörfer behalten<br />
ihr vitales Herz.<br />
Die Projektauswahl über die Koordinierungskreise in den Leader-<br />
und ILE-Gebieten sorgt dafür, dass die aus Sicht der Region<br />
nachhaltigsten und wichtigsten Projekte gefördert werden.<br />
Die Sächsische Staatsregierung hat weiterhin im Ergebnis der<br />
Mai-Steuerschätzung entschieden, dass die für den Investitionsbereich<br />
zur Verfügung gestellten Mittel auch für den Schwerpunkt<br />
„Bildungsinfrastruktur“ verwendet werden. Für die Schulen und<br />
Kindertagesstätten im ländlichen Raum stehen dem SMUL in<br />
<strong>2011</strong> zusätzlich 8 Mio. Euro für den Einsatz in der RL ILE/2007<br />
zur Verfügung. Es gilt nun, dieses Angebot zur finanziellen Entlastung<br />
der regionalen Budgets zügig zu nutzen.<br />
Frank Kupfer<br />
Sächsischer Staatsminister<br />
für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Die Aufgaben der doppischen Kasse – Einordnung<br />
der Kassenaufgaben in das Neue Haushalts-,<br />
Kassen- und Rechnungswesen und Erläuterungen<br />
zur neuen Musterdienstanweisung Kasse<br />
Friederike Trommer<br />
Referentin beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag<br />
Die Einführung des Neuen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens<br />
bei den Kommunen – im Folgenden kurz „Doppik“<br />
genannt – ist eine der umfangreichsten Reformen auf der kommunalen<br />
Ebene. Ausgehend von den Reformzielen der Innenministerkonferenz<br />
im Herbst 2003 ist dieses Ziel nicht schon<br />
dann erreicht, wenn die Vermögenserfassung und -bewertung<br />
abgeschlossen, die Buchführung auf Soll und Haben umgestellt<br />
und alle Aufwendungen und Erträge künftig periodengerecht<br />
erfasst sind. Dennoch sind gerade diese elementar, um eine produktorientierte<br />
Steuerung und den Aufbau einer aussagefähigen<br />
Kosten-Leistungsrechnung überhaupt zu ermöglichen. Hieraus<br />
ergibt sich auch die Notwendigkeit, tradierte Prozesse der Zahlungsabwicklung<br />
innerhalb der Verwaltung zu überprüfen und<br />
an die neuen Anforderungen anzupassen.<br />
Während im kameralen System die Aufgaben der Finanzverwaltung,<br />
der mittelbewirtschaftenden Stellen und der Kasse weitestgehend<br />
klar getrennt waren, sind die Übergänge im doppischen<br />
240<br />
System fließend. Nicht umsonst kennt die Privatwirtschaft den<br />
Begriff „Kasse“ nur als Synonym für die „Barkasse“, nicht jedoch<br />
als Organisationseinheit. Die Privatwirtschaft kennt hierfür<br />
den Begriff der Finanzbuchhaltung oder der Buchhaltung.<br />
Warum dies so ist, wird schnell klar, wenn man die Aufgaben<br />
der doppischen „Kasse“ näher betrachtet. Im Beitrag wird der<br />
Begriff der „Finanzbuchhaltung“ oder „Kasse“ für eine Organisationseinheit<br />
verwendet, während die Begriffe „Finanzbuchführung“<br />
und „Zahlungsverkehr“ die zu erledigenden Aufgaben<br />
wiedergeben.<br />
Der folgende Beitrag soll kurz in die wesentlichen Eckpunkte<br />
und Fragestellung zur künftigen Ausrichtung der doppischen<br />
Kasse einführen. Darüber hinaus hat die Geschäftsstelle in den<br />
zurückliegenden Monaten ein neues Muster für eine „Dienstanweisung<br />
Kasse“ erarbeitet. Die Umsetzung des Musters in<br />
den Kommunen hängt stark von der vor Ort getroffenen Entscheidung<br />
zur Ausrichtung der Kasse ab. Entsprechend soll der
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
Beitrag auch auf die möglichen Organisationsformen eingehen<br />
und wesentliche Regelungen des neuen Musters erläutern. 1<br />
1 Ausrichtung der doppischen Kasse<br />
1.1 Änderungsbedarf<br />
Die (Neu)Ausrichtung der doppischen Kasse sollte im Umstellungsprozess<br />
nicht als „Nebenbei“-Aufgabe angesehen<br />
werden. Mit der Frage der organisatorischen Ausgestaltung<br />
und der Aufgabenzuweisung zur doppischen Kasse stehen<br />
grundlegende Fragen im Zusammenhang, die sich auf den<br />
gesamten Doppik-Prozess nachhaltig auswirken können. So<br />
kann es mit der Einführung der Doppik zu Änderungen beim<br />
Rechnungsdurchlauf kommen. Im kameralen System erfolgte<br />
die Einbuchung einer Rechnung (Sollstellung) überwiegend<br />
erst nach deren Feststellung und Anordnung, gegebenenfalls<br />
erfolgte eine Auftragsvormerkung im System durch das Fachamt.<br />
In einem doppischen Konzept entsteht mit dem Eingang<br />
der Rechnung eine bilanzierungspflichtige Verbindlichkeit. Bei<br />
unterjährigen Vorgängen mag es keinen Unterschied machen,<br />
wann die Einbuchung der Verbindlichkeit erfolgt. Relevanz<br />
erhält die Frage jedoch spätestens dann, wenn eine Rechnung<br />
vor dem Bilanzstichtag (31.12.) eingeht, deren Bezahlung jedoch<br />
erst im Folgejahr erfolgt. Auch für diese Fälle muss die vollständige<br />
und wirklichkeitsgetreue Erfassung aller Vermögens- und<br />
Schuldpositionen zum Bilanzstichtag gewährleistet werden. Der<br />
Vermögenserwerb war buchungsseitig bisher mit der Erstellung<br />
der Auszahlungsanordnung und der Zahlungsanweisung<br />
abgeschlossen. Im doppischen Konzept sind jedoch auch mit<br />
dem Vermögenserwerb zusammenhängende Buchungen in der<br />
Anlagenbuchhaltung und ggf. der Kosten-Leistungsrechnung zu<br />
veranlassen. Dies bedingt eine unterbrechungsfreie und zeitnahe<br />
interne Weiterleitung der dafür notwendigen Informationen an<br />
die zuständigen Mitarbeiter.<br />
Änderungsbedarf ergibt sich auch für die Vielzahl an Verwaltungsvorfällen,<br />
die in der Vergangenheit über das Sachbuch<br />
für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) abgewickelt wurden. Eine<br />
Vielzahl dieser Vorgänge stellt doppisch bilanzierungspflichtige<br />
Sachverhalte dar, da sie zu einer Forderung oder Verbindlichkeit<br />
führen. Darüber hinaus bedingt auch der komplexere Buchungsstoff<br />
organisatorische und personelle Veränderungen der bisherigen<br />
Kasse, besonders hierauf wird im Folgenden eingegangen.<br />
Die Einordnung der Kasse in den Verwaltungsaufbau ist in Folge<br />
seiner Organisationshoheit Aufgabe des Bürgermeisters. Aus § 86<br />
Abs. 2 SächsGemO folgt lediglich, dass die Kasse als eigenständige<br />
Organisationseinheit einzurichten ist. Zweckmäßigerweise erfolgt<br />
die Eingliederung in den Bereich Finanzen und die Unterstellung<br />
beim Fachbediensteten für das Finanzwesen (FfdF).<br />
1 Ergänzend wird auch auf den Beitrag „Organisation des Rechnungs-<br />
und Kassenwesens in der Doppik“ aus dem <strong>Sachsenlandkurier</strong><br />
<strong>04</strong>/2009, S. 237 ff. verwiesen, dessen zentrale Aussagen<br />
auch weiterhin Gültigkeit besitzen.<br />
1.2 Prinzip der Einheitskasse<br />
Ausgangspunkt für die Ausrichtung der Kasse ist der § 86 Sächs-<br />
GemO, der das Prinzip der Einheitskasse verbindlich regelt. Der<br />
Ursprung dieses Prinzips geht weit zurück. Die Einheitskasse<br />
soll einerseits die Transparenz des gesamten Zahlungsverkehrs<br />
gewährleisten, andererseits soll die Einheitskasse aber auch zu<br />
einer wirtschaftlichen Mittelverwaltung führen und insgesamt<br />
die Grundlage für eine einheitliche Liquiditätsplanung bilden.<br />
Daneben gewährleistet die Einheitskasse auch einen effizienten<br />
Einsatz personeller und technischer Ressourcen und erleichtert<br />
die Umsetzung von sicherheitstechnischen Anforderungen gegen<br />
Einbruch, Überfall, Unterschlagung usw. Die Kassengeschäfte<br />
selbst werden dann wiederum beim Kassenverwalter zusammengefasst,<br />
welcher damit eine zentrale Rolle übernimmt (§ 86<br />
Abs. 2 SächsGemO).<br />
Die Kasse hat damit eine „Monopolstellung“, was auch durch<br />
die umfassende Aufgabenzuweisung in § 1 SächsKom<strong>KB</strong>VO<br />
deutlich wird.<br />
Die kamerale Kasse war vorwiegend auf die Abwicklung<br />
des Zahlungsverkehrs und den damit zusammenhängenden<br />
Buchungsvorgängen ausgerichtet. Nichtzahlungswirksame<br />
Vorgänge spielten eine untergeordnete Rolle und waren im<br />
Allgemeinen nur im Zusammenhang mit den Abschlussbuchungen<br />
der Jahresrechnung vorzufinden (u. a. Zuführung<br />
an den Vermögenshaushalt oder in die Rücklage, Ausweis von<br />
internen Verrechnungen, Verbuchung von Abschreibungen bei<br />
kostenrechnenden Einrichtungen). Der kamerale Jahresabschluss<br />
(Jahresrechnung) selbst war nicht auf das kassenmäßige Ergebnis<br />
ausgerichtet. Das Ergebnis ergab sich aus dem Vergleich der Soll-<br />
Stellungen der Einnahmen und Ausgaben. Das kassenmäßige<br />
„Ist“ spielte – ausgewiesen im kassenmäßigen Abschluss – lediglich<br />
eine untergeordnete Rolle.<br />
1.3 Aufgaben der doppischen Kasse<br />
Ausgehend vom doppischen 3-Komponenten-Modell wird der<br />
Buchungsstoff in der Doppik deutlich komplexer. Zahlungswirksame<br />
Vorgänge – also die klassische Kassenaufgabe – sind<br />
nur noch eine Teilaufgabe und finden sich in der Komponente<br />
der Finanzrechnung wieder. Die Ergebnisse der Finanzrechnung,<br />
d. h. der Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen<br />
unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes, finden<br />
sich jedoch unmittelbar in der Vermögensrechnung wieder. Das<br />
„kassenmäßige“ und das „haushaltsmäßige“ Ergebnis können<br />
deshalb nicht mehr voneinander losgelöst betrachtet werden.<br />
Beide verschmelzen in der Vermögensrechnung.<br />
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 SächsKom<strong>KB</strong>VO weist den Kassen jedoch<br />
nicht nur die Aufgaben der Buchführung im Zusammenhang<br />
241
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
mit den zahlungswirksamen Vorgängen zu, sondern die gesamte<br />
Buchführung, soweit nicht ausdrücklich eine andere Stelle damit<br />
beauftragt ist. Die doppische Kasse ist also wesentlich mehr als<br />
der Verwalter der Zahlungsmittel, ihr obliegt dem Grunde nach<br />
auch die Buchführung im Bereich der nichtzahlungswirksamen<br />
Vorgänge, d. h. auch in der Vermögensrechnung (Bilanz) und<br />
der Ergebnisrechnung. Alle Buchungsvorgänge werden in der<br />
Privatwirtschaft in einer Einheit – i. d. R. der Finanzbuchhaltung<br />
– zusammengefasst. In der Finanzbuchhaltung erfolgt die<br />
Erfassung aller Geschäfts- oder Verwaltungsvorfälle innerhalb<br />
eines Haushaltsjahres. Die Aufgabe der Buchführung gehört<br />
damit zum Kernbereich der Kassenaufgaben. 2<br />
Soweit Teile des Buchungsstoffs nicht von der Aufgabenzuweisung<br />
in § 1 Abs. 1 Nr. 4 SächsKom<strong>KB</strong>VO erfasst werden sollen<br />
und einer anderen Stelle zugewiesen werden, bedarf dies einer<br />
ausdrücklichen Regelung.<br />
Bei der Organisationsentscheidung sollte berücksichtigt werden,<br />
dass der zu verarbeitende Buchungsstoff unmittelbar sowohl auf<br />
die Finanzrechnung, die Ergebnisrechnung als auch auf die Vermögensrechnung<br />
und im Weiteren auch in der Kosten-Leistungsrechnung<br />
wirkt. Die Buchführung als solche erfordert damit in<br />
besonderem Maße auch bilanzielles Wissen und Verstehen. Die<br />
Aufteilung des Buchungsstoffes auf verschiedene Ämter oder Organisationseinheiten<br />
kann somit zu Brüchen in der Buchführung<br />
führen. Jede Organisationsentscheidung muss die Einhaltung der<br />
Grundsätze der Buchführung nach § 22 SächsKom<strong>KB</strong>VO, d. h.<br />
einer vollständigen, richtigen, zeitgerechten, geordneten und<br />
nachprüfbaren Buchführung, gewährleisten und darüber hinaus<br />
den Anforderungen des Internen Kontrollsystems genügen.<br />
Dies erscheint in einer dezentralen Struktur ungleich schwieriger.<br />
Insbesondere die einheitliche Beachtung der Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger Buchführung, der Grundsätze der Stetigkeit<br />
und Klarheit sind bei einer dezentralen Struktur zumindest mit<br />
einem höheren Organisationsaufwand verbunden.<br />
1.4 Die „Kasse“ als Organisationsbegriff<br />
Mit dem Vorstehenden wird bereits deutlich, dass die Einführung<br />
der Doppik für die Kassen eine deutliche Aufwertung mit sich<br />
bringen wird. Deshalb sollte bei allen organisatorischen Überlegungen<br />
auch über die Bezeichnung der Organisationseinheit als<br />
„Kasse“ nachgedacht werden. In anderen Bundesländern haben<br />
sich ebenso wie in der privaten Wirtschaft die Bezeichnung als<br />
„Finanzbuchhaltung“ – mit den Teilbereichen oder Sachgebieten<br />
Zahlungsverkehr und Geschäftsbuchführung – zum Teil bereits<br />
durchgesetzt. Das Muster der Dienstanweisung greift auf den<br />
tradierten Begriff der „Kasse“ zurück, wenngleich dieser nahezu<br />
2 Prof. Hansdieter Schmid, Neuregelung des kommunalen Kassenwesen,<br />
KKZ Nr. 11/2005, S. 217 ff.<br />
242<br />
ausnahmslos auch durch den Begriff „Finanzbuchhaltung“ oder<br />
eine andere Organisationsbezeichnung ersetzt werden kann.<br />
1.5 Abgrenzung von Buchführung und Zahlungsverkehr und<br />
dessen organisatorische Umsetzung<br />
In der doppischen Kasse behalten verschiedene Grundprinzipien<br />
des Kassenrechts weiterhin ihre Gültigkeit, dazu gehören<br />
insbesondere:<br />
– Trennung von Anordnung und Vollzug (§ 7 Abs. 3 Sächs-<br />
Kom<strong>KB</strong>VO),<br />
– Trennung von Buchführung und Zahlungsverkehr (§ 5<br />
Abs. 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO) und<br />
– das 4-Augen-Prinzip.<br />
Die Aufgaben der Buchführung (Geschäfts-/Finanzbuchführung)<br />
3 und des Zahlungsverkehrs lassen sich wie folgt voneinander<br />
abgrenzen: 4<br />
Geschäfts-/<br />
Finanzbuchführung<br />
Erfassung von Aufträgen und<br />
Bestellungen<br />
Prüfung und Vorkontierung von<br />
eingehenden und ausgehenden<br />
Rechnungen<br />
Buchung von Forderungen und<br />
Verbindlichkeiten einschließlich<br />
Wertberichtigungen<br />
Buchung der laufenden zahlungswirksamen<br />
und nichtzahlungswirksamen<br />
sowie der ergebniswirksamen<br />
und nicht ergebniswirksamen<br />
Verwaltungsvorfälle<br />
Zahlungsverkehr<br />
Abwicklung des Zahlungsverkehrs<br />
(Leisten von Auszahlungen,<br />
Annahme von<br />
Einzahlungen)<br />
zentrale Liquiditätsplanung<br />
Offene-Posten-Verwaltung und<br />
Mahnung<br />
Abstimmung der Bankkonten,<br />
Führen des Kontogegenbuches<br />
Belegsammlung und -ablage Überwachung und Kontrolle der<br />
liquiden Mittel, Aufklärung von<br />
Differenzen<br />
Erstellung von<br />
Abschlussdokumenten<br />
buchhalterische Umsetzung der<br />
Ergebnisse der Inventur<br />
Bereitstellung von Daten für<br />
Controlling, Berichtswesen,<br />
Finanzstatistik usw.<br />
Die Aufgaben der Geschäftsbuchhaltung können gerade in<br />
größeren Verwaltungen in einer dezentralen Struktur ange-<br />
3 In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird der Begriff der Buchführung<br />
im weiteren Sinn auch für das interne Rechnungswesen<br />
verwendet (Planungsrechnung, Kosten-Leistungsrechnung). Diese<br />
Bereiche sind im hier verwendeten Sprachgebrauch ausdrücklich<br />
nicht erfasst.<br />
4 Vgl. hierzu im Einzelnen KGSt-Bericht B 6/2007 Buchführung<br />
und Zahlungsabwicklung im neuen Haushalts- und Rechnungswesen<br />
– Grundlagen, Prozesse, Reformbedarf.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
siedelt werden (u. a. Vorkontierung 5 und Prüfung von Rechnungen,<br />
Auftragsüberwachung, Erfassung von Forderungen<br />
und Verbindlichkeiten). Dagegen werden die Aufgaben<br />
des Zahlungsverkehrs nach dem Grundsatz der Einheitskasse<br />
auch künftig zweckmäßigerweise zentral durch die<br />
„Kasse“ (Organisationseinheit „Zahlungsverkehr“) erledigt.<br />
Eine generelle Empfehlung für eine Struktur kann den Kommunen<br />
zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.<br />
Wie bereits im <strong>Sachsenlandkurier</strong> Nr. <strong>04</strong>/2009 ausgeführt, ist<br />
sowohl die zentrale als auch die dezentrale Struktur mit Vor- und<br />
Nachteilen verbunden. 6 Wichtiger als ein konkreter Gliederungsvorschlag<br />
erscheint es der Autorin, das Problembewusstsein für<br />
diese Frage zu fördern, um sich im Umstellungsprozess frühzeitig<br />
auch mit der künftigen Organisationsstruktur der Kasse auseinanderzusetzen.<br />
Bleibt diese zentrale Frage ungeklärt, können die<br />
Buchungsqualität aber auch die Aussagefähigkeit der Bücher für<br />
eine zielgerichtete Steuerung in Frage gestellt werden.<br />
Die organisatorische Trennung zwischen der Geschäftsbuchhaltung<br />
und dem Zahlungsverkehr setzt eine gewisse personelle<br />
Mindestausstattung voraus, soweit die in § 1 SächsKom<strong>KB</strong>VO<br />
genannten Aufgaben bei der „Kasse“ als einer Organisationseinheit<br />
zusammengefasst werden sollen. Gerade in kleineren<br />
Kommunen wird es häufig personell erforderlich sein, für einzelne<br />
Aufgaben Mitarbeiter aus anderen Ämtern hinzuzuziehen.<br />
Dagegen greifen größere Kommunen auf eine dezentrale Struktur<br />
der Buchführung zurück, um die Fachkenntnisse im Fachamt<br />
und damit die größere „Problemnähe“ nutzen zu können.<br />
Die Aufteilung der „Kasse“ in die Bereiche oder Sachgebiete<br />
Buchhaltung und Zahlungsverkehr (kamerale Kasse) ist jedoch<br />
in allen Kommunen geboten, um der Anforderung der Trennung<br />
von Buchführung und Zahlungsverkehr gerecht zu werden.<br />
Während die Aufgaben des Zahlungsverkehrs klassischerweise<br />
bei der Kasse zentral verbleiben 7 , muss für die Aufgaben der<br />
Buchhaltung vor Ort eine Entscheidung getroffen werden, welche<br />
Aufgaben bei der doppischen „Kasse“ angesiedelt werden.<br />
Der Entscheidungsspielraum geht dabei von einer ausschließlich<br />
zentral ausgerichteten Struktur aus, bei der alle Buchungsauf-<br />
5 Als Kontierung bezeichnet man dabei die Verknüpfung eines<br />
Geschäftsvorfalles mit dem zugehörigen Produkt und dem Sachkonto<br />
sowie weiteren Merkmalen (z. B. Kostenstelle, Kostenträger,<br />
Budget).<br />
6 Vorteile der dezentralen Organisation: höhere Akzeptanz, Einbeziehung<br />
von Fachwissen der Fachämter, Zusammenhang zwischen<br />
Aufgabe- und Ressourcenverantwortung wird in der Buchhaltung<br />
deutlich, bisherige Organisationsstruktur kann überwiegend<br />
beibehalten werden, keine/weniger personelle Änderungen.<br />
Vorteile der zentralen Organisation: kürzerer Rechnungslauf, Konzentration<br />
von „Buchhalterwissen“, hohe Qualität und Einheitlichkeit<br />
der Buchhaltung, geringerer Schulungsaufwand, weniger<br />
Lizenzen für EDV, zentrale Belegablage und Stammdatenpflege<br />
(� größere Prüfungssicherheit). Vgl. hierzu auch KGSt-Bericht<br />
7/2010 Organisation des kommunalen Finanzmanagements,<br />
Organisation der Finanzbuchführung und Zahlungsabwicklung<br />
als Teil des kommunalen Rechnungswesens.<br />
7 Auch die KGSt kommt zu dem Ergebnis, dass „die Einführung<br />
einer dezentralen Zahlungsabwicklung“ „zu keinen erkennbaren<br />
Vorteilen“ führt. Sie ist überdies „aus rechtlichen Gründen problematisch<br />
zu bewerten“. Vgl. KGSt-Bericht 7/2010 a. a. O.<br />
gaben in der Kasse angesiedelt werden, bis hin zu einer stark<br />
dezentralen Ausrichtung, bei der wesentliche Aufgaben in den<br />
Fachbereichen (Auftragsverwaltung, Erfassung von Forderungen<br />
und Verbindlichkeiten, Vorkontierung, Erfassung im System)<br />
und/oder der Finanzverwaltung (zentrale Anlagenbuchhaltung)<br />
angesiedelt werden. Die Übergänge zwischen einzelnen Organisationsmodellen<br />
sind dabei fließend.<br />
Einen Königsweg gibt es nicht, jedoch sollten Veränderungen<br />
nicht gescheut werden, auch wenn diese noch nicht den angestrebten<br />
Erfolg bringen. Für das Ziel einer produktorientierten<br />
Haushaltssteuerung bedarf es einer modernen, effektiven Kasse,<br />
denn eines sollte nicht außer Acht gelassen werden: das Produkt<br />
„Kasse“ 8 wird in der Doppik selbst zu einem Steuerungsobjekt!<br />
Der Bearbeitungsaufwand für einen Geschäftsvorfall, die Fehlerquote<br />
bei Buchungen, der Zahlungsausfall durch nicht oder nicht<br />
rechtzeitig eingezogene Lastschriften werden sich im Ergebnis<br />
bei den Erträgen und Aufwendungen, den Einzahlungen und<br />
Auszahlungen des Produktes „Kasse“ und den produktbezogenen<br />
Leistungskennzahlen niederschlagen. Und dem Produkt „Kasse“<br />
werden im Ergebnis alle Leistungen zugeordnet, die der Erfüllung<br />
von Kassenaufgaben dienen und zwar unabhängig von der<br />
gewählten Organisation.<br />
2 Erläuterungen zur Musterdienstanweisung<br />
2.1 Vorbemerkung<br />
Das Muster der Dienstanweisung kann zum heutigen Zeitpunkt<br />
nicht abschließend sein. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen<br />
Organisationsformen und dem sich daraus ergebenden<br />
Regelungsbedarf liegen bisher noch sehr wenige Erfahrungen<br />
vor. Darüber hinaus unterliegen auch die Rechtsgrundlagen<br />
noch einem Wandel. Deshalb kann das mit der aktuellen<br />
Ausgabe des <strong>Sachsenlandkurier</strong>s veröffentlichte Muster nur ein<br />
Zwischenstand sein. Da jedoch bereits über 40 kommunale<br />
Körperschaften ihr Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt<br />
haben und in 2012 voraussichtlich eine weitaus größere Anzahl<br />
folgen wird, war es Ziel, den Kommunen möglichst frühzeitig ein<br />
8 Vgl. Kommunaler Produktrahmen, Produkt 111302 „Kassen- und<br />
Rechnungswesen“.<br />
2<strong>43</strong>
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
einheitliches Regelungsinstrument an die Hand zu geben. Zu den<br />
wesentlichen Eckpunkten der Muster-Dienstanweisung erfolgte<br />
deshalb auch eine Auseinandersetzung mit dem Sächsischen<br />
Staatsministerium des Innern, dem Sächsischen Rechnungshof<br />
und kommunalen Praktikern.<br />
Das Muster der Dienstanweisung geht grundsätzlich von einer<br />
zentralen Kasse aus, der die Aufgaben des § 1 SächsKom<strong>KB</strong>VO<br />
vollumfänglich zugewiesen sind. An den entsprechenden Stellen<br />
wird jedoch auf alternative Regelungen hingewiesen, wenn zum<br />
Beispiel die Anlagenbuchhaltung einer anderen Stelle zugeordnet<br />
wird.<br />
2.2 Erläuterungen zu einzelnen Regelungstatbeständen<br />
2.2.1 Allgemeines<br />
Das Muster der Dienstanweisung folgt in seinem Aufbau der<br />
Gliederung der SächsKom<strong>KB</strong>VO sowie der organisatorischen<br />
Trennung von Zahlungsverkehr und Buchführung. Entsprechend<br />
werden in den Teilen 1 und 2 zunächst allgemeine<br />
Grundlagen für die Erledigung der Kassenaufgaben geregelt.<br />
Teil 3 trifft Regelung zu den „klassischen“ Kassengeschäften,<br />
der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Verwahrung<br />
von Gegenständen. Teil 4 umfasst dagegen die notwendigen<br />
Regelungen zur Buchführung.<br />
2.2.2 Rechtsgrundlagen und Kassenaufsicht (Teil 1)<br />
Eine Vielzahl der im Teil 1 getroffenen Regelungen ist gegenüber<br />
der bisherigen Musterdienstanweisung unverändert geblieben.<br />
Die Regelungen wurden lediglich sprachlich überarbeitet und in<br />
den neuen Kontext der Dienstanweisung übernommen. Dabei<br />
wird auch die grundsätzliche Aufteilung der Kassenaufgaben in<br />
den Zahlungsverkehr und die Buchführung berücksichtigt.<br />
Erweitert wurden die Beispiele für die Übertragung von Aufgaben<br />
auf die Kasse gemäß § 1 Abs. 4 SächsKom<strong>KB</strong>VO (vgl.<br />
2.1 [2]).<br />
Der Kasse kann danach die Aufgabe übertragen werden, die<br />
Veranlassung und Bewilligung von Billigkeitsmaßnahmen beim<br />
Fachamt anzuregen. Diese Aufgabe gehört nicht zu den Kernaufgaben<br />
der Kasse. Jedoch können praktische Überlegungen<br />
dafür sprechen. Den Fachämtern fehlen häufig die Kenntnisse<br />
des Standes der Forderung und etwaige Probleme bei der<br />
Beitreibung einer Forderung. Diese Kenntnisse liegen bei der<br />
Kasse vor. Entsprechend kann es sinnvoll sein, dass die Kasse<br />
das Fachamt auf mögliche Billigkeitsmaßnahmen hinweist.<br />
Etwa wenn der Schuldner im Erhebungsverfahren signalisiert<br />
hat, er könne eine Forderung lediglich in Raten begleichen.<br />
Diese Information kann von der Kasse mit dem Hinweis auf<br />
den Abschluss einer Stundungsvereinbarung an das Fachamt<br />
gehen. Die Regelung stellt eine logische Konsequenz aus § 15<br />
Abs. 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO dar.<br />
Die Gemeindekasse selbst darf, außer bei den Fällen nach § 1<br />
Abs. 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO, nur im Ausnahmefall eine Stundung<br />
gewähren (§ 15 Abs. 1 SächsKom<strong>KB</strong>VO). Soweit eine entsprechende<br />
Regelung getroffen werden soll, sollte diese sowohl<br />
betragsmäßig als auch zeitlich (z. B. für eine Stundungsdauer für<br />
maximal 3 Monate) begrenzt werden.<br />
244<br />
Im Hinblick auf die Befugnisse der Kasse im Zusammenhang<br />
mit der Anlage und Auflösung von Geldanlagen erfolgt in der<br />
Dienstanweisung eine Klarstellung. Die Entscheidung über die<br />
Anlage oder Auflösung von Geldanlagen trifft der FfdF (§ 62<br />
Abs. 1 SächsGemO). Eine Übertragung auf den Kassenverwalter<br />
scheitert schon durch die Grundprinzipien der Trennung von<br />
Anordnung und Vollzug und dem 4-Augen-Prinzip.<br />
Neu aufgenommen wurde die Aufgabe „Bewertung von Forderungen<br />
und Verbindlichkeiten für die Vermögensrechnung“.<br />
Diese Aufgabe folgt der Zuständigkeit für die Debitoren- und<br />
Kreditorenbuchhaltung. Soweit diese bei der Kasse verbleibt,<br />
kann nur die Kasse eine sachgerechte und wirklichkeitsgetreue<br />
Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten vornehmen.<br />
Dies geschieht unter Berücksichtigung etwaiger einzelfallbezogener<br />
Kenntnisse (Alter der Forderung, Dauer des Zahlungsausfalles,<br />
Abgabe einer ESV, Stand des Vollstreckungsverfahrens)<br />
zur Ermittlung des Nominalwertes i. S. v. §§ 38 Abs. 4 und 44<br />
Abs. 7 SächsKomHVO-Doppik.<br />
Punkt 2.2 umfasst wesentliche Aussagen zu den Aufgaben des<br />
Kassenverwalters. Auf eine Wiedergabe der einzelnen Aufgaben<br />
wird an dieser Stelle bewusst verzichtet. Zum einen ergeben<br />
sich die Aufgaben des Kassenverwalters im Wesentlichen aus<br />
den Aufgaben der Kasse. Zum anderen kann die Aufteilung der<br />
Kassenaufgaben je nach personeller Ausstattung und der bestehenden<br />
Vertretungsverhältnisse vor Ort sehr unterschiedlich sein.<br />
Die dem Kassenverwalter, dem stellvertretenden Kassenverwalter<br />
und den sonstigen Kassenbediensteten im Einzelfall obliegenden<br />
Aufgaben sollten deshalb im Aufgabengliederungsplan und in<br />
der Stellenbeschreibung wiedergegeben werden.<br />
Unter Punkt 2.2 [5] wird dem Kassenverwalter die Befugnis zur<br />
Errichtung und Aufhebung von Zahlstellen, Handvorschüssen<br />
und Einzahlungskassen eingeräumt. Diese Regelung sollte nur<br />
in großen Kommunen, mit komplexer Aufgaben- und Organisationsstruktur<br />
übernommen werden. Ausgehend von §§ 3 und 4<br />
SächsKom<strong>KB</strong>VO obliegt die Entscheidung dem Bürgermeister.<br />
Dieser delegiert sie zweckmäßigerweise auf den FfdF. Insbesondere<br />
in größeren Kommunen wird es die Aufgabenausstattung<br />
des FfdF nicht zulassen, Einzelheiten des Zahlungsverkehrs-<br />
und der -abwicklung zu überwachen. Hier ist dann auch eine<br />
Delegierung der Befugnis auf den Kassenverwalter sachgerecht.<br />
Entsprechend der getroffenen Entscheidung unter Punkt 2.2 [5]<br />
sind dann im Punkt 3.1 die Abs. [2] und [4] sowie im Punkt 3.2<br />
der Abs. [2] anzupassen.<br />
Bei der Übernahme der Dienstanweisung ins Ortsrecht sollte<br />
insbesondere unter Punkt 2.3 auf die tatsächlichen örtlichen<br />
Verhältnisse geachtet werden. So geht Abs. [1] von einem Geschäftsverteilungsplan<br />
zur Verteilung der Kassenaufgaben auf<br />
die Bediensteten aus. Eine Notwendigkeit hierfür wird nur in<br />
großen Kommunen bestehen. In kleineren Kommunen reicht<br />
es – entsprechend der Alternative zu Abs. [1] – aus, wenn der<br />
Kassenverwalter eine eigenständige, nachprüfbare Anweisung<br />
trifft, welcher Mitarbeiter welche Aufgaben zu erledigen hat.<br />
Gleiches gilt auch für die in Abs. [4] benannten Alternativen.<br />
Punkt 2.4 [6] geht davon aus, dass für den Einsatz der automatisierten<br />
Datenverarbeitung eigenständige Regelungen<br />
(Dienstanweisung ADV) erlassen werden. Da die hier zu treffenden<br />
Regelungen regelmäßig für eine Vielzahl von Ämtern
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
und Softwareverfahren Geltung erlangen, ist eine Aufnahme<br />
der Regelung in die Dienstanweisung Kasse entbehrlich. Die<br />
Dienstanweisung soll den Missbrauch von Daten verhindern, was<br />
im Finanzbereich insbesondere mit Blick auf das Steuergeheimnis<br />
nach § 30 AO von besonderer Bedeutung ist. Die Kommune<br />
soll durch geeignete personelle und technische Vorkehrungen die<br />
Funktion der automatisierten Verfahren gewährleisten.<br />
Punkt 3 umfasst die Kernregelungen zu den Zahlstellen,<br />
Handvorschüssen und Einzahlungskassen. Nach §§ 3 und 4<br />
SächsKom<strong>KB</strong>VO trifft der Bürgermeister die notwendigen<br />
Regelungen für die Zahlstellen, Handvorschüsse und Einzahlungskassen.<br />
Die vorliegende Musterdienstanweisung enthält<br />
nur die wichtigsten, unerlässlichen Regelungen zur Einrichtung,<br />
zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs und zur Abrechnung und<br />
Auflösung von Zahlstellen, Handvorschüssen, Einzahlungskassen<br />
und zu Zahlungen mit Hilfe von Automaten. Je nach Umfang der<br />
Aufgabenerledigung und des Zahlungsanfalls und nach Anzahl<br />
der eingerichteten Zahlstellen, Handvorschüsse und Einzahlungskassen<br />
kann es notwendig sein, konkrete Einzelregelungen<br />
zu Aufgaben, Zuständigkeiten, Aufsicht und Abrechnungsmodalitäten<br />
zu treffen. Diese sollten einer gesonderten Dienstweisung<br />
vorbehalten sein, um die „allgemeine“ Dienstanweisung nicht zu<br />
überfrachten. Entsprechend enthält Punkt 3.2 [9] einen Verweis<br />
auf eine gesonderte Dienstanweisung.<br />
Auf Zahlstellen können im Wesentlichen folgende Aufgaben<br />
übertragen werden:<br />
Annahme bestimmter Einzahlungen9 ,<br />
Leistung bestimmter Auszahlungen10 ,<br />
Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen<br />
einschließlich der Verwaltung der hierfür erforderlichen<br />
baren und unbaren Zahlungsmittel11 ,<br />
die Zeit- und Hauptbuchführung einschließlich der Belegablage<br />
für einen bestimmten, abgegrenzten Aufgabenbereich,<br />
Verwahrung von Wertgegenständen,<br />
die zwangsweise Einziehung von Forderungen nach Maßgabe<br />
des § 1 Abs. 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO,<br />
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von<br />
Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen<br />
und<br />
weitere Aufgaben, welche auf Grundlage von § 1 Abs. 4<br />
SächsKom<strong>KB</strong>VO der Kasse übertragen werden könnten<br />
(z. B. Anlagenbuchhaltung 12 –<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
, Führung und Pflege von Finanzadresse<br />
u. ä., vgl. Punkt 2.1 [2] der Musterdienstanweisung).<br />
9 Soweit nur die Annahme von Zahlungen beabsichtigt ist, sollte<br />
geprüft werden, ob nicht die Einrichtung einer Einzahlungskasse<br />
ausreichend ist.<br />
10 Soweit nur die Leistung von Zahlungen übertragen wird, sollte<br />
vordergründig die Einrichtung eines Handvorschusses geprüft<br />
werden.<br />
11 Eigene Konten sollten den Zahlstellen nur im Ausnahmefall<br />
und bei nachgewiesener Notwendigkeit eingerichtet werden, da<br />
dadurch die Liquiditätsplanung erschwert wird.<br />
12 Von einer Übertragung der Anlagenbuchhaltung auf einzelne<br />
Zahlstellen muss jedoch abgeraten werden. Auf Grund des komplexen<br />
Buchungsstoffes und der weit reichenden Wirkung der<br />
Buchungen sollte diese Aufgabe unbedingt zentral, „aus einer<br />
Hand“ wahrgenommen werden.<br />
Punkt 3.2 [1] und [2] verweisen auf die Abrechnung nach einem<br />
Formblatt bzw. mittels Kassenbuch. Soweit die Abrechnung<br />
nach einem Formblatt erfolgt, sollte dieses Formblatt als Muster<br />
in einer Anlage zur Dienstanweisung verbindlich vorgegeben<br />
werden.<br />
In Abweichung von der bisherigen kameralen Handhabung sind<br />
Vorschüsse, die für eine Zahlstelle, einen Handvorschuss oder<br />
eine Einzahlungskasse (als Wechselgeldvorschüsse) geleistet werden,<br />
nicht mehr als haushaltsfremde Vorgänge zu erfassen. Die<br />
geleisteten Vorschüsse stellen lediglich Bestandsumbuchungen<br />
auf den Zahlungsmittelkonten vor. Entsprechend sind die<br />
Schlussbestände zum Bilanzstichtag in der Vermögensrechnung<br />
auszuweisen. Dies setzt eine rechtzeitige Abrechnung bzw. die<br />
vollständige Erfassung und Dokumentation der Bestände zum<br />
Abschlussstichtag voraus. Ein Ausweis der Vorschüsse unter der<br />
Position „Forderungen“ kommt nicht in Betracht.<br />
In der Musterdienstanweisung wurden in Folge der gesetzlichen<br />
Regelung in § 4 Abs. 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO erstmals auch Bestimmungen<br />
zu Zahlungen mittels Automaten aufgenommen. Je<br />
nach Umfang und Einsatz vor Ort kann hier weiterer Regelungsbedarf<br />
bestehen. Für die Automaten gelten die Vorschriften für<br />
Handvorschüsse grundsätzlich entsprechend. Besondere Sicherheitsanforderungen<br />
ergeben sich für Automaten mit Barzahlung.<br />
Hier sollte gewährleistet sein, dass die Bediensteten nicht mit den<br />
Münzen oder Scheinen in Berührung kommen. Hierzu werden<br />
in den Automaten zunehmend verschlossene Münzsammler oder<br />
Geldkassetten eingesetzt. Die Schlüssel hierfür sind zentral zu<br />
hinterlegen und in der Schlüsselordnung zu erfassen.<br />
2.2.3 Geschäftsgang der Kasse (Teil 2)<br />
In diesem Teil wurden auch die Regelungen zur Erteilung von<br />
Kassenanordnungen getroffen. Punkt 5.1 [1] verweist zur Festlegung<br />
der Anordnungsbefugnis (§ 7 Abs. 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO)<br />
und zur Befugnis der sachlichen und rechnerischen Feststellung<br />
(§ 11 Abs. 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO) auf eine gesonderte Dienstanweisung.<br />
Diese ist nicht zwingend erforderlich. Gerade in kleineren<br />
Kommunen mit wenigen Hierarchieebenen und überschaubaren<br />
Verantwortungsstrukturen können die notwendigen Regelungen<br />
in der Dienstanweisung selbst getroffen werden. Entsprechend<br />
sieht die Dienstanweisung für Abs. [1] einen alternativen Formulierungsvorschlag<br />
vor. Mit Erlass der Dienstanweisung sind<br />
die notwendigen Unterschriftsbefugnisse in der Anlage zur<br />
Dienstanweisung zu regeln.<br />
245
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Neu aufgenommen wurden in dem Punkt 5.2 die Grundlagen<br />
für eine elektronische Anordnung und Feststellung durch Nutzung<br />
der elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz. Im<br />
Zusammenhang mit der Umstellung auf die Doppik werden in<br />
vielen Kommunen Möglichkeiten des papierlosen Verfahrens<br />
geprüft. Was gerade im Hinblick auf den elektronischen Rechnungseingang<br />
auch im Finanzbereich keine uninteressante Frage<br />
ist. Um die sich dabei bietenden Möglichkeiten effektiv nutzen<br />
zu können, bedarf es einer umfassenden elektronischen Vorgangsbearbeitung.<br />
Dabei müssen handschriftliche Unterschriften<br />
durch elektronische Signaturen ersetzt werden.<br />
2.2.4 Zahlungsverkehr und Verwahrungen (Teil 3)<br />
Punkt 7.1 trifft Regelungen zum baren und unbaren Zahlungsverkehr.<br />
Dem unbaren Zahlungsverkehr wird dabei grundsätzlich der<br />
Vorrang eingeräumt. Folglich dürfen Einzahlungen auch mittels<br />
Geldkarten, Debitkarten, Kreditkarten oder Schecks geleistet<br />
werden. Allerdings sind hierfür besondere Sicherheitsstandards<br />
zu beachten (u. a. Punkt 7.1 [5] und 7.2). Soweit eine Kommune<br />
über eine elektronische Kasse verfügt bzw. über deren Einrichtung<br />
nachdenkt, sollten in die Dienstanweisung hinreichende<br />
Regelungen aufgenommen werden. Die elektronische Kasse (u. a.<br />
Basiskomponente Zahlungsverkehr) ermöglicht dem Nutzer neben<br />
einer Leistungsabnahme im Internet (z. B. Beantragung einer<br />
Genehmigung, Erteilung einer kostenpflichtigen Meldeauskunft)<br />
auch die Zahlungsabwicklung im Internet zu veranlassen. Dies<br />
entspricht dem Prinzip der einheitlichen Leistungserbringung wie<br />
es in der EU-Dienstleistungsrichtlinie vorgesehen ist. 13<br />
Unter Punkt 7.1 [2] wird klar gestellt, dass Auszahlungen grundsätzlich<br />
nicht mittels Debit- und Kreditkarten vorgenommen<br />
werden sollen. Auch in Zeiten einer modernen Kasse und der<br />
elektronischen Zahlungsabwicklung sind diese Zahlungsmittel<br />
nicht ohne Weiteres mit den Kassenprinzipien der Trennung von<br />
Anordnung und Vollzug und dem 4-Augen-Prinzip zu vereinbaren.<br />
Der Einsatz einer Debit- oder Kreditkarte sollte deshalb<br />
auf wenige Ausnahmen verbindlich beschränkt sein. Sie sollten<br />
generell nur auf den Kassenverwalter selbst, nicht aber andere<br />
Bedienstete oder den Bürgermeister, ausgestellt werden. Darüber<br />
hinaus sollte durch interne Festlegung konkret bestimmt werden,<br />
in welchen Fällen der Einsatz einer Kreditkarte zulässig ist, wie<br />
Kreditkarten zu verwahren sind und wie das Anordnungsverfahren<br />
und der Zahlungsverkehr abgewickelt werden.<br />
Die Verwaltung der Kassenmittel ist Regelungsgegenstand des<br />
Punktes 7.5. Auch hier wurde der Grundsatz umgesetzt, dass<br />
die Kasse die Liquiditätsbestände zwar überwacht, für die Entscheidung<br />
über eine Geldanlage oder die Auflösung einer solchen<br />
jedoch der FfdF zuständig ist. Abs. [1] sieht eine Regelung für<br />
einen Liquiditätshöchstbetrag sowohl für die Sichteinlagen als<br />
auch die Barkasse vor. Die Regelung für die Sichteinlagen kann<br />
in der örtlichen Dienstanweisung getroffen werden. Sie dient<br />
der wirtschaftlichen Mittelverwaltung. Für die Barkasse sollte<br />
in jedem Fall ein Höchstbetrag festgesetzt werden, da größere<br />
Bargeldbestände in der Regel nicht mehr erforderlich und überdies<br />
unwirtschaftlich sind.<br />
13 Vgl. hierzu auch „Neue Zahlungsverfahren im öffentlichen Bereich<br />
– der elektronische Zahlungsverkehr“, Kommunal-Kassen-<br />
Zeitschrift, <strong>04</strong>/<strong>2011</strong>, S. 73.<br />
246<br />
Grundlage für die Festlegung von Liquiditätsunter- und -höchstgrenzen<br />
ist stets eine transparente Liquiditätsplanung. Mit der<br />
Einführung der Doppik erhalten die Kommunen in Form der<br />
Finanzrechnung ein geeignetes Instrument, um künftig eine<br />
Liquiditätsplanung und ein effektives Liquiditätsmanagement aufbauen<br />
zu können. Durch die Erfassung aller zahlungswirksamen<br />
Vorgänge nach Zahlungsfälligkeiten sind belastbare Liquiditätsprognosen<br />
möglich. Die Notwendigkeit einer Liquiditätsplanung<br />
und deren Umfang sollte deshalb auch in der Dienstanweisung<br />
festgelegt werden. Hierzu gehören auch Mittelanforderungen der<br />
budgetbewirtschaftenden Stellen (vgl. Punkt 7.5 [2]).<br />
Die Aufnahme eines Kassenkredites (vgl. Punkt 7.5 [3]) gehört<br />
nicht zu den Kernaufgaben des Kassenverwalters. Erkennt er<br />
jedoch einen Finanzierungsbedarf, muss er die Weisung des<br />
Bürgermeisters einholen (§ 18 Abs. 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO). Der<br />
Bürgermeister wird diese Aufgabe zweckmäßigerweise auf den<br />
FfdF delegieren.<br />
2.2.5 Buchführung (Teil 4)<br />
Die Regelungen unter Punkt 9 können erst nach einer örtlichen<br />
Organisationsentscheidung zur Organisation und Ausrichtung<br />
der doppischen Kasse übernommen werden. So ist unter 9.1 [1]<br />
zu konkretisieren, ob die Buchführung zentral oder dezentral<br />
organisiert ist. Bei einer zentralen Organisation der Buchführung<br />
wird der gesamte Buchungsstoff (d. h. auch die Anlagenbuchhaltung)<br />
durch die Kasse, vorzugsweise in einer eigenen Organisationseinheit,<br />
verarbeitet. Dem Formulierungsvorschlag für eine<br />
„dezentrale Kasse“ liegt eine zentrale Organisation der Kasse mit<br />
dezentralen Elementen zu Grunde. Dabei werden insbesondere<br />
die Aufgaben der Vorkontierung und Erfassung von Forderungen<br />
und Verbindlichkeiten im System und die Anlagenbuchhaltung<br />
der Kasse entzogen und anderen Fachämtern zugewiesen. Der<br />
Formulierungsvorschlag für eine dezentrale Struktur muss auf<br />
die jeweiligen örtlichen Verhältnisse und Organisationsziele angepasst<br />
werden und ist insoweit nicht verbindlich. Die sich aus<br />
den örtlichen Verhältnissen ergebenden Aufgabenzuordnungen<br />
sind dann auch unter 9.1 [3] zu beachten.<br />
Punkt 10 formuliert die Notwendigkeit eines örtlichen Kontenplanes<br />
nach § 23 SächsKom<strong>KB</strong>VO und trifft die Zuständigkeitsentscheidung<br />
für die Einrichtung und Pflege der Konten.<br />
Die Einrichtung von Konten sollte generell nur noch zentral<br />
erfolgen. Zum einen sind die Konten in der Finanzsoftware<br />
regelmäßig in den Stammdaten einzurichten. Hierfür bestehen<br />
häufig gesonderte Zugriffsrechte, sodass der Kreis der Personen<br />
per se beschränkt ist. Zum anderen sind mit der Einrichtung<br />
eines neuen Kontos eine Vielzahl von Verknüpfungen zu anderen<br />
Konten, Listen und Rechnungskomponenten aufzubauen. So<br />
ist einem neuen Konto in der Regel u. a. die Information mitzugeben,<br />
ob und ggf. mit welchem Konto der Finanzrechnung<br />
es verknüpft ist, welchem Teilhaushalt, welchem Produkt und<br />
welchem Budget es zugeordnet wird und welche Verknüpfungen<br />
zur Kosten-Leistungsrechnung bestehen. Programmspezifisch<br />
können jedoch auch noch weitere Stammdaten erforderlich sein.<br />
Dies setzt ein komplexes Wissen voraus.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
In Punkt 11 [3] werden Formulierungsvorschläge für die künftige<br />
Ablage der Belege getroffen. Auch dies setzt zunächst eine<br />
örtliche Entscheidung voraus. Die Belegablage im doppischen<br />
System kann nicht mehr nach den Haushaltsstellen erfolgen.<br />
„Die“ Haushaltsstelle gibt es nicht mehr. Das System der doppelten<br />
Buchführung spricht stets mindestens zwei Konten an.<br />
Alternativ kommt daher eine Belegablage nach Zeitbuchnummer<br />
(chronologische Ablage) oder nach Produktnummer in Frage. Alle<br />
Varianten sind mit Änderungen gegenüber dem bisherigen System<br />
verbunden und bringen Nach- und Vorteile. Die Erfahrungen aus<br />
anderen Bundesländern lassen einen Trend zur chronologischen<br />
Belegablage aller zahlungswirksamen Vorgänge (Ablage nach dem<br />
Datum des Kontoauszugs) erkennen. Problematisch ist hier, dass<br />
Vorgänge, die denselben Sachverhalt betreffen, sachlich nicht mehr<br />
zusammenhängend abgelegt werden können, wenn sie zeitlich<br />
auseinander fallen. Dem Problem kann mit der elektronischen<br />
Belegerfassung und -verarbeitung begegnet werden, was jedoch mit<br />
zusätzlichen Kosten für die Implementierung verbunden ist. Für<br />
die nichtzahlungswirksamen Vorgänge sind auch dann gesonderte<br />
Regelungen zu treffen. Die Zuständigkeit sollte beim Bereich bzw.<br />
der Organisationseinheit Zahlungsverkehr angesiedelt werden, da<br />
hier die Mehrzahl der Belege zuletzt bearbeitet werden.<br />
Die Musterdienstanweisung greift verschiedene Möglichkeiten<br />
der Belegablage auf. Es ist unbedingt zu empfehlen, zunächst<br />
vor Ort eine Organisationsentscheidung unter Abwägung der<br />
Vor- und Nachteile zu treffen. Erst dann sollte eine Regelung in<br />
der örtlichen Dienstanweisung getroffen bzw. etwaige Vorschläge<br />
der Musterdienstanweisung übernommen werden.<br />
Die unter Punkt 12.1 [1] getroffenen Regelungen müssen mit<br />
der Organisationsentscheidung (vgl. Punkt 9.1 [1]) abgestimmt<br />
werden, wobei die jeweilige Formulierung für eine zentrale oder<br />
dezentrale Kasse zu übernehmen ist.<br />
Vorbemerkung<br />
Die in Punkt 12.2 vorgenommenen Änderungen beschränken<br />
sich überwiegend auf die Anpassung an die neuen Begrifflichkeiten.<br />
Gleiches gilt für die Erstellung der Tagesabschlüsse unter<br />
Punkt 12.3.1.<br />
Einer örtlichen Anpassung bedürfen dagegen die Regelungen<br />
unter Punkt 12.3.2 hinsichtlich der Mitwirkung der Kasse an der<br />
Aufstellung des Jahresabschlusses. In der Musterdienstanweisung<br />
wurden der Kasse umfassende Befugnisse zur Mitwirkung bei<br />
der Aufstellung des Jahresabschlusses übertragen (insbesondere<br />
Abschluss und Bestandskontrolle der Zahlungsmittelkonten,<br />
Abschluss der Finanzrechnung, Abschluss der Debitoren- und<br />
Kreditorenkonten, Erstellung von Verbindlichkeiten- und Forderungsspiegel,<br />
Bewertung der Forderungen einschließlich der<br />
Verbuchung, Erfassung der transitorischen und antizipativen<br />
Posten einschließlich der Verbuchung). Hinsichtlich der Bewertung<br />
von Forderungen verweist die Musterdienstanweisung<br />
auf eine gesonderte Dienstanweisung, die Detailregelungen<br />
zum Bewertungsverfahren enthält. Die Notwendigkeit einer<br />
gesonderten Dienstanweisung für diesen Zweck ist örtlich zu<br />
prüfen. Verbindliche, schriftliche Regelungen zur Bewertung<br />
der Forderungen (u. a. Grundsatz der Einzelbewertung, Abgrenzung<br />
von Forderungen nach Art, Alter, Betrag, Dauer des<br />
Zahlungsausfalls, Sätze zur Wertberichtigung) sind jedoch für<br />
alle Kommunen unerlässlich.<br />
Punkt 12.4 regelt abschließend die Aufbewahrung von Unterlagen<br />
und die Aufbewahrungsfristen. Auch diese Vorschrift<br />
wurde im Wesentlichen nur an die neuen Begrifflichkeiten angepasst<br />
und um Regelungen für die Eröffnungsbilanz und den<br />
spätestens ab 2016 zu erstellenden Gesamtabschluss ergänzt.<br />
Darüber hinaus wurden die Regelungen für eine elektronische<br />
Aufbewahrung von Unterlagen an die geltenden Bestimmungen<br />
der SächsKom<strong>KB</strong>VO angepasst.<br />
Dienstanweisung zur Organisation<br />
und Aufgabenwahrnehmung der Kasse<br />
im neuen kommunalen Haushalts-, Kassenund<br />
Rechnungswesen<br />
vom …<br />
(Muster für eine Dienstanweisung)<br />
Diese Dienstanweisung enthält die für Gemeinde/Stadt<br />
gemäß § 39 SächsKom<strong>KB</strong>VO notwendigen näheren und<br />
ergänzenden Vorschriften und Regelungen zur Sicherung der<br />
ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der Kasse nach<br />
der SächsKom<strong>KB</strong>VO unter besonderer Berücksichtigung des<br />
Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie die Verwahrung und<br />
Verwaltung von Wertgegenständen, des Anordnungswesens und<br />
der Buchführung.<br />
Teil 1 Grundlagen des Kassenwesens<br />
1 Rechtsgrundlagen und Kassenaufsicht<br />
1.1 Rechtliche Grundlagen<br />
1.2 Geltungsbereich<br />
1.3 Kassenaufsicht<br />
1.4 Einrichtung der Kasse<br />
2 Aufgaben und Organisation der Kasse<br />
2.1 Aufgaben der Kasse<br />
2.2 Aufgaben des Kassenverwalters<br />
2.3 Organisation der Kasse<br />
247
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
2.4 Automatisiertes Verfahren und technische<br />
Hilfsmittel<br />
3 Zahlstellen, Handvorschüsse, Einzahlungskas-<br />
sen und Zahlungen mit Hilfe von Automaten<br />
3.1 Einrichtung und Auflösung<br />
3.2 Abrechnung und Verwaltung<br />
Teil 2 Geschäftsgang der Kasse<br />
4 Behandlung von Sendungen<br />
5 Kassenanordnungen<br />
5.1 Allgemeines<br />
5.2 Zahlungsanordnungen<br />
6 Schriftverkehr<br />
Teil 3 Zahlungsverkehr und Verwahrungen<br />
7 Zahlungsverkehr und Verwaltung der<br />
Kassenmittel, Kassensicherheit<br />
7.1 Barer und unbarer Zahlungsverkehr<br />
7.2 Zahlungen mittels Scheck<br />
7.3 Leistung von Quittungen<br />
7.4 Konten und Verfügungsberechtigung<br />
7.5 Verwaltung der Kassenmittel<br />
7.6 Aufbewahrung der Zahlungsmittel<br />
7.7 Beförderung von Zahlungsmitteln<br />
7.8 Kassensicherheit<br />
8 Verwahrung von Wertgegenständen und<br />
sonstigen Gegenständen<br />
Teil 4 Buchführung<br />
9 Einrichtung der Buchführung<br />
9.1 Gegenstand und Organisation der<br />
Buchführung<br />
9.2 Beschäftigte in der Finanzbuchhaltung<br />
10 Kontenplan<br />
11 Belege<br />
12 Buchführung<br />
12.1 Allgemeines<br />
12.2 Buchung von Einzahlungen und<br />
Auszahlungen<br />
12.2.1 Einzahlungen<br />
12.2.2 Auszahlungen<br />
12.2.3 Aufrechnungen<br />
12.2.4 Buchungen im automatisierten Verfahren<br />
12.3 Abschlüsse<br />
12.3.1 Tagesabschlüsse und Zwischenabschlüsse<br />
12.3.2 Mitwirkung beim Jahresabschluss<br />
12.4 Aufbewahrung von Unterlagen,<br />
Aufbewahrungsfristen<br />
Teil 5 Schlussbestimmungen<br />
13 Schlussbestimmungen<br />
248<br />
Teil 1 Grundlagen des Kassenwesens<br />
1 Rechtsgrundlagen und Kassenaufsicht<br />
1.1 Rechtliche Grundlagen<br />
Bei der Erledigung von Kassengeschäften sind die Vorschriften<br />
– der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-<br />
GemO)<br />
– der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern<br />
über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den<br />
Regeln der Doppik (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik<br />
– SächsKomHVO-Doppik)<br />
– der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des<br />
Innern über die kommunale Kassen- und Buchführung<br />
(Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung<br />
– SächsKom<strong>KB</strong>VO) sowie<br />
– die sonstigen auf Grundlage von § 129 SächsGemO ergangenen<br />
Verwaltungsvorschriften und<br />
– das Scheckgesetz (ScheckG)<br />
in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.<br />
Die rechtlichen Grundlagen werden mit dieser Dienstanweisung<br />
aus örtlicher Sicht ergänzt und konkretisiert.<br />
1.2 Geltungsbereich<br />
Diese Dienstanweisung gilt für alle Kassengeschäfte der Gemeinde/Stadt<br />
…………. Kassengeschäfte im Sinne dieser Dienstanweisungen<br />
sind insbesondere alle Aufgaben, die sich aus der<br />
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Finanzbuchhaltung<br />
ergeben.<br />
Die für das Sonder- und Treuhandvermögen gebildeten Sonderkassen<br />
(Eigenbetriebe und rechtlich unselbständige Stiftungen),<br />
welche kassenrelevante Tätigkeiten ausüben, orientieren sich an<br />
den Regelungen dieser Dienstanweisung.<br />
Alternativ: Für die bei Sondervermögen und Treuhandvermögen<br />
gebildeten Sonderkassen gilt eine gesonderte Dienstanweisung.<br />
1.3 Kassenaufsicht<br />
Die Kassenaufsicht obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen<br />
(FfdF).<br />
1.4 Einrichtung der Kasse<br />
Die Kasse ist so einzurichten, dass<br />
1. sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß und wirtschaftlich erledigen<br />
kann,<br />
2. für die Sicherheit der Beschäftigten gegen Überfälle angemessen<br />
gesorgt ist,<br />
3. Datenverarbeitungseinrichtungen, Automaten für den<br />
Zahlungsverkehr und andere technische Hilfsmittel nicht<br />
unbefugt genutzt werden können,<br />
4. die Zahlungsmittel, die zu verwahrenden Gegenstände,<br />
die Bücher, das Inventar und die Belege sicher aufbewahrt<br />
werden können.<br />
Das Nähere zum Geschäftsgang in der Kasse ergibt sich aus den<br />
weiteren Regelungen dieser Dienstanweisung.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
2 Aufgaben und Organisation der Kasse<br />
2.1 Aufgaben der Kasse<br />
(1) Eigene Kassengeschäfte<br />
Die Kasse erledigt als Einheitskasse alle Kassengeschäfte der<br />
Stadt/Gemeinde … gemäß § 1 Abs. 1 und 3 SächsKomK-<br />
BVO einschließlich Mahnung, Beitreibung und Einleitung<br />
der Zwangsvollstreckung (zwangsweise Einziehung) sowie die<br />
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass von<br />
Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen<br />
wie Zinsen und Nebenleistungen. Die Buchführung (§ 1 Abs. 1<br />
Nr. 4 SächsKom<strong>KB</strong>VO) ist zentral/dezentral organisiert.<br />
Die Kasse erledigt ebenfalls die mit Schulangelegenheiten zusammenhängenden<br />
Kassengeschäfte, die der Gemeinde/Stadt als<br />
Schulträger obliegen (§ 1 Abs. 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO).<br />
Alternativ:<br />
Kassengeschäfte, die mit Schulangelegenheiten zusammenhängen<br />
und die der Gemeinde/Stadt als Schulträger obliegen, werden dem<br />
Direktor der Schule …., welcher Beschäftigter des Freistaates Sachsen<br />
i. S. v. § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SächsSchulG ist, übertragen. Die<br />
Bestimmungen dieser Dienstanweisung gelten für diese Kassengeschäfte<br />
entsprechend.<br />
(2) Übertragene Aufgaben<br />
Der Kasse werden gemäß § 1 Abs. 4 SächsKom<strong>KB</strong>VO folgende<br />
Aufgaben zur Erledigung übertragen:<br />
– die Unterbreitung von Vorschlägen an das betreffende<br />
Fachamt für die Erteilung von Billigkeitsmaßnahmen<br />
(Stundungen, Niederschlagungen und Erlass) bei Forderungen,<br />
– laufende Überwachung und Kontrolle der Geldanlagen,<br />
nicht jedoch die selbstständige Anlage oder Auflösung<br />
von Geldanlagen, welche nur auf Anweisung des FfdF erfolgen<br />
darf,<br />
– die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen,<br />
– die Erstellung der vierteljährlichen Gemeindefinanzstatistik,<br />
– Bewertung von Forderungen und Verbindlichkeiten für die<br />
Vermögensrechnung<br />
– die Zustellung von Anträgen und Dokumenten für die<br />
Durchführung von Zwangsvollstreckungen (z. B. Mahnbescheid,<br />
Vollstreckungsbescheid, Abnahme der Eidesstattlichen<br />
Versicherung)<br />
– die Führung der Finanzadressdatei (Verwaltung des Adressbestandes<br />
aller Zahlungspflichtigen [Debitoren] und aller<br />
Empfangsberechtigten [Kreditoren])<br />
– ggf. weitere Ergänzungen<br />
(3) Der Kasse obliegen darüber hinaus folgende Aufgaben:<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Aufnahme von Kassenkrediten auf Anweisung des Bürgermeisters/FfdF<br />
die Verwahrung von Bürgschaftsurkunden, Fundsachen,<br />
Vordrucken für Ausweise, Versicherungspolicen<br />
ggf. weitere Ergänzungen<br />
(4) Fremde Kassengeschäfte<br />
Der Kasse werden aufgrund § 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO die Erledigung<br />
der Kassengeschäfte übertragen für:<br />
z. B.<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Verkauf von Müllmarken für den Entsorgungsverband …<br />
Auszahlung von Hilfen an Leistungsempfänger im Auftrag<br />
des Landkreises …<br />
die Stiftung …<br />
ggf. weitere Ergänzungen<br />
Diese Kassengeschäfte dürfen nur wahrgenommen werden,<br />
wenn dies im Interesse der Gemeinde/Stadt liegt. Die fremden<br />
Kassengeschäfte werden mit der Prüfung der Gemeinde-/Stadtkasse<br />
geprüft.<br />
2.2 Aufgaben des Kassenverwalters<br />
(1) Der/Die Leiter/-in der Kasse ist Kassenverwalter im Sinne<br />
des § 86 Abs. 2 SächsGemO. Er/Sie ist verantwortlich für die<br />
Führung und Überwachung der Kassengeschäfte und Vorgesetzter<br />
der in der Kasse tätigen/der mit Kassenaufgaben betrauten<br />
Beschäftigten.<br />
(2) Bei Verhinderung übernimmt der stellvertretende Kassenverwalter<br />
für die Dauer der Vertretung dessen Pflichten und<br />
Befugnisse. Der Bestand der Kassenmittel, der sonstigen Wertgegenstände<br />
und der sonstigen zur Verwahrung anvertrauten<br />
Gegenstände ist an den Vertreter zu übergeben. Bei plötzlicher<br />
Verhinderung des Kassenverwalters sind die Bestände im Beisein<br />
eines Dritten zu übernehmen. Die Übergabe bzw. die Übernahme<br />
sind zu dokumentieren.<br />
(3) Für den Kassenverwalter, seinen Stellvertreter und die anderen<br />
Beschäftigten der Kasse gelten die Bestellungsverbote nach<br />
§ 86 Abs. 3 SächsGemO und hinsichtlich der Befangenheit § 86<br />
Abs. 4 Satz 1 SächsGemO.<br />
(4) Dem Kassenverwalter obliegt im Interesse einer ordnungsgemäßen<br />
und wirtschaftlichen Führung der Kassengeschäfte<br />
die Durchführung aller erforderlichen Verhandlungen und<br />
Anweisungen. Der Kassenverwalter hat u. a. alle Maßnahmen<br />
zu treffen, die eine höchstmögliche innere und äußere Kassensicherheit<br />
gewährleisten.<br />
(5) Ihm wird die Befugnis für die Errichtung und Aufhebung<br />
von Zahlstellen, Einzahlungskassen und Handvorschüssen der<br />
Stadt/Gemeinde … erteilt. Eine Übersicht liegt dem Kassenverwalter<br />
vor. 1<br />
1 Hinweis: In kleineren Gemeinden sollte die Befugnis zur Einrichtung<br />
und Aufhebung von Zahlstellen, Einzahlungskassen und<br />
Handvorschüssen dem FfdF vorbehalten sein. Entsprechend ist<br />
Abs. 5 anzupassen.<br />
249
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
(6) Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO wird der Kassenverwalter<br />
beauftragt, vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel<br />
unter Beachtung von § 89 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO<br />
anzulegen und diese im Bedarfsfalle dem laufenden Bestand<br />
zuzuführen. Hierzu hat er die Weisung des FfdF einzuholen.<br />
2.3 Organisation der Kasse<br />
(1) Die Verteilung der Dienstgeschäfte auf die Beschäftigten<br />
der Kasse regelt der Kassenverwalter im Geschäfts- und<br />
Dienstverteilungsplan, in dem auch die Vertretungsverhältnisse<br />
darzustellen sind. 2<br />
Alternativ: Die Verteilung der Dienstgeschäfte unter Beachtung<br />
der gesetzlichen Vorschriften auf die Beschäftigten regelt der Kassenverwalter.<br />
Der Kassenverwalter kann die Beschäftigten bei<br />
Bedarf auch anderweitig einsetzen.<br />
(2) Die Beschäftigten der Kasse sind nach Prüfung ihrer Zuverlässigkeit,<br />
fachlichen Qualifikation und ihrer wirtschaftlichen<br />
Verhältnisse vom Personalamt im Benehmen mit dem<br />
Kassenverwalter und dem FfdF auszuwählen. Bei Versetzung<br />
von Beschäftigten aus bzw. zu anderen Dienststellen ist der<br />
Kassenverwalter rechtzeitig zu hören.<br />
(3) Für Zahlstellen, Einzahlungskassen und Handvorschüsse<br />
gelten die Regelungen in Abs. 1 und Abs. 2 ab einem genehmigten<br />
Kassenhöchstbetrag von … Euro sinngemäß. Bis zu einem<br />
genehmigten Kassenhöchstbestand von … Euro obliegt diese<br />
Prüfung dem/der Leiter/-in des zuständigen Amtes.<br />
(4) Die Beschäftigten der Kasse haben die ihnen nach dem Geschäfts-<br />
und Dienstverteilungsplan/Aufgabengliederungsplan/den<br />
Arbeitsplatzbeschreibungen 3 zugewiesenen Aufgaben sorgfältig<br />
und unverzüglich zu erledigen und in ihrem Arbeitsgebiet<br />
auf die Kassensicherheit zu achten. Den Beschäftigten obliegt<br />
insbesondere die Pflicht, zur unverzüglichen Einleitung des<br />
Mahn- und Vollstreckungsverfahrens nach Fälligkeit sowie die<br />
zügige Aufklärung unklarer Zahlungsvorfälle. Der Verdacht<br />
von Unregelmäßigkeiten ist dem Kassenverwalter unverzüglich<br />
anzuzeigen. Die Vorschriften über das Steuergeheimnis (§ 30<br />
Abgabenordnung) und zum Datenschutz sind zu beachten.<br />
(5) Kassenbücher, -belege und -akten dürfen, außer an<br />
den Bürgermeister sowie den FfdF und an die örtliche und<br />
überörtliche Prüfungseinrichtung, nur mit Zustimmung des<br />
Kassenverwalters aus den Kassenräumen herausgegeben werden.<br />
Über die Herausgabe ist ein Nachweis zu führen. Die<br />
Einsichtnahme, auch in den Kassenräumen, ist nur dann zu<br />
gestatten, wenn ein dienstliches Interesse nachgewiesen oder<br />
glaubhaft gemacht wird.<br />
(6) Wer Kassengeschäfte zu erledigen hat, hat sich mit den für<br />
das Arbeitsgebiet geltenden Vorschriften vertraut zu machen.<br />
Er hat die Pflicht, eine Entscheidung des Kassenverwalters<br />
2 Diese Regelung ist nur aufzunehmen, soweit ein gesonderter<br />
Geschäftsverteilungsplan für die Kasse erforderlich ist. Ggf.<br />
kann hier auch auf den allgemeinen Geschäftsverteilungs- oder<br />
Aufgabengliederungsplan der Gemeinde verwiesen werden.<br />
3 Nicht zutreffendes streichen.<br />
250<br />
herbeizuführen, wenn ihm vorhandene Vorschriften oder Anweisungen<br />
nicht ausreichen oder zweifelhaft erscheinen.<br />
2.4 Automatisiertes Verfahren und technische Hilfsmittel<br />
(1) Der Einsatz der automatisierten Verfahren und der technischen<br />
Arbeitsmittel werden durch den FfdF, den Kassenverwalter<br />
und den IT- Verantwortlichen im Einvernehmen geplant,<br />
vorbereitet und realisiert.<br />
(2) In der Kasse der Stadt/Gemeinde … wird für das zentrale<br />
Kassenwesen ausschließlich das System … eingesetzt. Es wird<br />
für die Buchhaltung, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die<br />
Speicherung und Archivierung der Bücher und Belege genutzt.<br />
(3) Es ist sicherzustellen, dass bei der Anbindung weiterer Module<br />
an das eingesetzte System der korrekte Datentransfer zwischen<br />
Modul und Basissystem bzw. zwischen den Modulen gewährleistet<br />
ist.<br />
Bei der Planung und Einführung ist der Kassenverwalter rechtzeitig<br />
einzubeziehen.<br />
(4) Der Tätigkeitsbereich „Administration von Informationssystemen<br />
und automatisierten Verfahren“, die fachliche Sachbearbeitung<br />
und die Erledigung von Kassenaufgaben sind gegeneinander<br />
abzugrenzen und die dafür Verantwortlichen zu bestimmen.<br />
(5) Die sonstigen Festlegungen der §§ 6, 33 und 34 SächsKom-<br />
<strong>KB</strong>VO sind zu beachten.<br />
(6) Der Bürgermeister regelt das Nähere über den Einsatz automatisierter<br />
Verfahren sowie deren Sicherung und Kontrolle.<br />
3 Zahlstellen, Handvorschüsse, Einzahlungskassen<br />
und Zahlungen mit Hilfe von Automaten<br />
3.1 Einrichtung und Auflösung<br />
(1) Zahlstellen, Handvorschüsse und Einzahlungskassen (Geldannahmestellen)<br />
dürfen nur dann eingerichtet werden, wenn<br />
dafür ein sachlicher Bedarf besteht.<br />
Es ist nach Möglichkeit zu vermeiden, dass bei einer Dienststelle<br />
mehr als eine Zahlstelle eingerichtet wird. In den einzelnen<br />
Dienststellen soll nach Möglichkeit jeweils nur ein Handvorschuss<br />
bzw. eine Einzahlungskasse geführt werden. Soweit bei<br />
derselben Dienststelle eine Zahlstelle eingerichtet ist, sollen<br />
Handvorschüsse oder Einzahlungskassen nach Möglichkeit<br />
nicht bewilligt werden.<br />
(2) Über die Einrichtung und Auflösung von Zahlstellen entscheidet<br />
der FfdF/Kassenverwalter 4 . Die örtliche Prüfungseinrichtung<br />
ist unverzüglich zu unterrichten.<br />
4 Vgl. getroffene Regelung in Abschnitt 2.2 (5).
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
(3) Zur Leistung von geringfügigen Zahlungen oder als Wechselgeld<br />
können einzelnen Dienststellen oder einzelnen Beschäftigten<br />
Handvorschüsse in bar, mittels Geldkarte oder bargeldlos<br />
über ein Girokonto gewährt werden.<br />
(4) Über die Einrichtung von Handvorschüssen entscheidet der<br />
FfdF/Kassenverwalter auf Antrag der betreffenden Dienststelle.<br />
Diese hat die Notwendigkeit darzulegen. Von der Einrichtung ist<br />
die örtliche Prüfungseinrichtung unverzüglich zu unterrichten.<br />
Dem Kassenverwalter und der örtlichen Prüfungseinrichtung<br />
ist eine Liste der gewährten Handvorschüsse sowie der verantwortlichen<br />
Beschäftigten vorzulegen.<br />
Für die ordnungsgemäße Verwaltung dieser Handvorschüsse<br />
tragen die betreffenden Dienststellen die Verantwortung. Die<br />
aus einem Handvorschuss zu zahlenden Beträge zur Bestreitung<br />
anfallender Auszahlungen des laufenden Dienstbetriebes sollen im<br />
Einzelfall … Euro nicht übersteigen.<br />
(5) Zur Annahme von Zahlungen können Einzahlungskassen<br />
eingerichtet werden. Für diese gelten die Regelungen für Handvorschüsse<br />
sinngemäß.<br />
(6) Für die Annahme von Zahlungen mit Hilfe von Automaten<br />
gilt Absatz 4 Sätze 1 bis 3 entsprechend.<br />
3.2 Abrechnung und Verwaltung<br />
(1) Der Nachweis der Verwendung von Handvorschüssen ist<br />
nach dem dafür vorgesehenen Formblatt/Kassenbuch, welches<br />
von der Gemeindekasse zur Verfügung gestellt wird, zu<br />
führen.<br />
(2) Handvorschüsse können nach Bedarf wieder aufgefüllt<br />
werden. Der Vorschussempfänger hat anhand von Belegen und<br />
dem Formblatt/Kassenbuch, die geleisteten Auszahlungen nachzuweisen<br />
und dem Kassenverwalter die Auszahlungsanordnung<br />
der zuständigen Dienststelle vorzulegen. Handvorschüsse sind<br />
spätestens zum Jahresabschluss abzurechnen. Der FfdF/Kassenverwalter<br />
kann einen kürzeren Abrechnungszeitraum bestimmen.<br />
(3) Soweit bei Dienststellen für die Erhebung von Gebühren,<br />
Entgelten usw. sowie für bestimmte Auszahlungen Zahlstellen<br />
eingerichtet sind, tragen auch diese Dienststellen für die ordnungsgemäße<br />
Kassenführung die Verantwortung. Bei der Erledigung<br />
von Aufgaben der Kasse sind die Zahlstellen jedoch Teil<br />
dieser und unterstehen fachlich dem Kassenverwalter. Diesem<br />
obliegt es deshalb auch, die Zahlstellenführer zu unterweisen,<br />
fachlich zu beaufsichtigen und zu beraten.<br />
(4) Durch Einrichtung einer den Anforderungen des § 22<br />
SächsKom<strong>KB</strong>VO entsprechenden Buchführung ist die ordnungsgemäße<br />
Abrechnung der Zahlstellen, Handvorschüsse und<br />
Einnahmekassen mit der Kasse sicherzustellen.<br />
(5) Die Geldbestände und Geldwertbestände der Zahlstellen,<br />
Handvorschüsse und Einzahlungskassen sind in einem diebes-<br />
und feuersicheren Kassenbehälter oder einer verschließbaren<br />
5 Vgl. getroffene Regelung in Abschnitt 2.2 (5).<br />
Kassette zu verwahren und zu den in der Verfügung über die<br />
Einrichtung angegebenen Terminen, mindestens jedoch vierteljährlich<br />
bis zum 10. des ersten Monats im Quartal an die<br />
Kasse abzuliefern bzw. auf ein von der Kasse benanntes Konto<br />
einzuzahlen.<br />
(6) Auf den Einzahlungsbelegen der Zahlstellen und Einnahmekassen<br />
sind stets Verwendungszweck und Buchungskennzeichen<br />
anzugeben.<br />
(7) Bei Urlaub des Zahlstellen- bzw. Handvorschussverwalters<br />
bzw. des Verwalters der Einzahlungskasse sind der Bestand an<br />
Zahlungsmitteln und die geldwerten Bestände sowie der Belege<br />
und Bücher der Zahlstelle, des Handvorschusses und der<br />
Einzahlungskasse an den Vertreter zu übergeben. Im Falle einer<br />
plötzlichen Verhinderung des Zahlstellenführers ist die Zahlstelle<br />
von dem Vertreter im Beisein des Dienststellenleiters oder eines<br />
von diesem Beauftragten zu übernehmen. Die Übergabe bzw.<br />
Übernahme sind zu dokumentieren. Entsprechendes gilt für die<br />
Übernahme der Handvorschüsse und der Einzahlungskassen.<br />
(8) Für die Annahme von Zahlungen mit Hilfe von Automaten<br />
gilt Absatz 2 entsprechend.<br />
(9) Das Nähere zur Abrechnung von Zahlstellen, Einzahlungskassen<br />
und Handvorschüssen durch die berechtigten Beschäftigten gegenüber<br />
der Kasse und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs bei Zahlstellen,<br />
Einzahlungskassen und Handvorschüssen durch die berechtigten<br />
Beschäftigten sowie die Annahme von Zahlungen mit Hilfe von<br />
Automaten wird in einer gesonderten Dienstanweisung geregelt.<br />
Teil 2 Geschäftsgang der Kasse<br />
4 Behandlung von Sendungen<br />
(1) Sendungen, die an die Kasse gerichtet sind, sind ihr ungeöffnet<br />
zuzuleiten (§ 5 Abs. 4 SächsKom<strong>KB</strong>VO). Gehen Sendungen,<br />
die Zahlungsmittel enthalten, oder Wertsendungen bei einer<br />
anderen Stelle als der Kasse ein, so sind die Sendungen unverzüglich<br />
an die Kasse weiterzuleiten. Der Eingang der Sendung<br />
ist von der abgebenden Stelle in geeigneter Weise aktenkundig<br />
zu machen.<br />
(2) Wertsendungen sind vom Kassenverwalter oder seinem<br />
Vertreter in Gegenwart eines weiteren Beschäftigten zu öffnen.<br />
Über die Öffnung ist ein Protokoll zu fertigen, welches von den<br />
Beteiligten unterzeichnet wird.<br />
5 Kassenanordnungen<br />
5.1 Allgemeines<br />
(1) Die Anordnungsbefugnis gemäß § 7 Abs. 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO<br />
sowie die Befugnis zur sachlichen und rechnerischen Feststellung<br />
(§ 11 Abs. 1 Satz 1 SächsKom<strong>KB</strong>VO) regelt der Bürgermeister<br />
in einer gesonderten Dienstanweisung. Beschäftigte der Kasse<br />
251
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
sollen keine Kassenanordnungen vorbereiten und erteilen (§ 7<br />
Abs. 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO).<br />
Alternativ:<br />
(1) Die zur Anordnung nach § 7 Abs. 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO<br />
Befugten sowie die mit der sachlichen und rechnerischen Feststellung<br />
(§ 11 Abs. 1 Satz 1 SächsKom<strong>KB</strong>VO) Beauftragten<br />
werden in der Anlage 1 zur dieser Dienstanweisung bestimmt.<br />
Beschäftigte der Kasse sollen keine Kassenanordnungen vorbereiten<br />
und erteilen (§ 7 Abs. 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO).<br />
(2) Die der Kasse zugeleiteten Kassenanordnungen sind entsprechend<br />
§ 7 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO zu<br />
prüfen.<br />
(3) Bei Eilbedürftigkeit kann die Kasse offensichtliche Schreib-<br />
oder Rechenfehler in Kassenanordnungen nach Absprache mit<br />
der betreffenden Dienststelle selbst mit Datum und Signatur<br />
berichtigen.<br />
5.2 Zahlungsanordnungen<br />
(1) Die Zahlung erfolgt auf Grundlage der durch die budgetbewirtschaftende<br />
Stelle unter Angabe der Kontierung schriftlich<br />
erstellten oder bei automatisierten Verfahren auf elektronischem<br />
Wege übermittelten Zahlungsanordnung. Der Zahlungsanordnung<br />
sind begründende Unterlagen beizufügen. Auf Rechnungen<br />
als begründende Unterlagen muss das Datum des Rechnungseingangs<br />
erkennbar sein.<br />
In der Zahlungsanordnung ist die sachliche und rechnerische<br />
Richtigkeit schriftlich oder durch elektronische Signatur i. S. v.<br />
§ 2 Nr. 1 bis 3 Signaturgesetz zu bestätigen. Die Anordnung ist<br />
von einer/einem Anordnungsberechtigten schriftlich oder durch<br />
elektronische Signatur i. S. v. § 2 Nr. 1 bis 3 Signaturgesetz zu<br />
erteilen. Die Befugnis zur Erteilung einer Anordnung und zur<br />
Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit wird<br />
durch den Bürgermeister (vgl. Abschnitt 5.1 Abs. 1) geregelt.<br />
(2) Die Zahlungsanordnung und die begründenden Unterlagen<br />
werden zur Zahlung an die Gemeinde-/Stadtkasse<br />
weitergeleitet.<br />
(3) Bei Zahlungsanordnungen ist das Fälligkeitsdatum besonders<br />
zu beachten.<br />
Unbeschadet des § 8 Abs. 2 der SächsKom<strong>KB</strong>VO sind die Zahlungsanordnungen<br />
so fällig zu stellen und der Kasse so rechtzeitig<br />
zuzuleiten, dass Skonti ausgenutzt oder eine drohende Verjährung<br />
eines Anspruches verhindert werden können.<br />
6 Schriftverkehr<br />
(1) Die Kasse führt ihren Schriftwechsel unter der Bezeichnung<br />
Stadt/Gemeinde … – Kasse –, in … Vollstreckungsangelegenheiten<br />
unter der Bezeichnung Stadt/Gemeinde … – Kasse als<br />
Vollstreckungsbehörde –.<br />
(2) Schreiben der Kasse sowie Ersuchen und Anträge im Vollstreckungsverfahren<br />
sind vom Kassenverwalter, in seiner Vertretung<br />
von seinem Stellvertreter zu unterschreiben. Der Kassenver-<br />
252<br />
walter hat seinem Namen die Bezeichnung „Kassenleiter“, der<br />
Stellvertreter die Bezeichnung „Stellvertreter des Kassenleiters“<br />
hinzuzusetzen. Der Kassenverwalter kann Beschäftigte der Kasse<br />
ermächtigen, bestimmte Schriftstücke mit dem Zusatz „Im<br />
Auftrag“ zu unterschreiben.<br />
Teil 3 Zahlungsverkehr und Verwahrungen<br />
7 Zahlungsverkehr und Verwaltung der Kassenmittel,<br />
Kassensicherheit<br />
7.1 Barer und unbarer Zahlungsverkehr<br />
(1) Der Zahlungsverkehr wird, soweit er nicht auf Zahlstellen,<br />
Einzahlungskassen und Handvorschüsse übertragen wurde<br />
oder mit Hilfe von Automaten erfolgt, grundsätzlich zentral<br />
abgewickelt.<br />
(2) Zahlungen sollen nach Möglichkeit/grundsätzlich unbar<br />
durch Überweisung geleistet werden. Für Einzahlungen ist das<br />
Einzugsverfahren/Abbuchungsverfahren zu fördern.<br />
(3) Einzahlungen dürfen mittels Geldkarten, Debitkarten,<br />
Kreditkarten oder Schecks vorgenommen werden, soweit nicht<br />
durch den Bürgermeister Ausnahmen hiervon bestimmt werden.<br />
Auszahlungen sollen nicht mittels Debit- oder Kreditkarten<br />
geleistet werden, soweit deren Verwendung im Einzelfall nicht<br />
ausdrücklich durch den Bürgermeister zugelassen wird.<br />
(4) Bei unbaren Auszahlungen ist auf der Auszahlungsanordnung<br />
oder, falls eine solche nicht vorgeschrieben oder nach<br />
§ 9 SächsKom<strong>KB</strong>VO allgemein erteilt ist, auf der sachlichen<br />
und rechnerischen Feststellung nach § 11 SächsKom<strong>KB</strong>VO<br />
oder auf einem besonderen Beleg anzugeben, an welchem<br />
Tag und auf welchem Weg Zahlungen geleistet worden sind.<br />
Für alle Auszahlungen gilt, dass nach deren Bewirken auf der<br />
Auszahlungsanordnung bzw. dem Datenerfassungsbeleg ein<br />
„bezahlt“ – Vermerk anzubringen ist.<br />
(5) Zahlungsmittel (Bargeld, Schecks, Geldkarten, Debitkarten,<br />
Kreditkarten) dürfen nur in den dazu bestimmten Räumen der<br />
Kasse und nur von den damit beauftragten Bediensteten angenommen<br />
oder ausgegeben werden. Außerhalb dieser Räume<br />
dürfen Zahlungen nur von hierfür ermächtigten Personen (z. B.<br />
Vollstreckungsbedienstete, Verwalter von Zahlstellen, Handvorschüssen<br />
und Einzahlungskassen) oder mit Hilfe von Automaten<br />
angenommen oder ausgezahlt werden. Der Kassenverwalter führt<br />
hierüber ein Verzeichnis.<br />
(6) Die Gemeindekasse darf einem Bediensteten der Gemeinde<br />
keine Zahlungsmittel zur Weitergabe an Dritte aushändigen, es<br />
sei denn, dass die Weitergabe der Zahlungsmittel zum Dienstauftrag<br />
des Beschäftigten gehört oder er die Zahlungsmittel<br />
als gesetzlicher Vertreter oder Bevollmächtigter in Empfang<br />
nehmen kann.<br />
(7) Zahlungsmittel und Wertgegenstände, die nicht zum<br />
Kassenbestand gehören bzw. die der Kasse nicht zur Verwahrung<br />
anvertraut sind und die nicht der Aufgabenerfüllung der<br />
Gemeindekasse dienen, dürfen nicht in den Kassenbehältern<br />
aufbewahrt werden.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
(8) Werden Ansprüche gegenüber der Gemeinde/Stadt an einen<br />
Dritten abgetreten oder von diesem gepfändet, ist für die Abgabe<br />
der Drittschuldnererklärung die Kasse zuständig. Dies gilt nicht<br />
bei Abtretungen und Pfändungen von Lohn- und Gehaltsforderungen.<br />
Über die Anerkennung der Abtretung von Forderungen<br />
aus Bauleistungen entscheidet die Kasse im Einvernehmen mit<br />
dem Fachamt. Die Fachämter sind verpflichtet, bei der Anordnung<br />
abgetretener oder gepfändeter Ansprüche einen entsprechenden<br />
Vermerk auf der Auszahlungsanordnung anzubringen.<br />
(9) Für das Verfahren bei Kassenfehlbeträgen und Kassenüberschüssen<br />
(Kassendifferenzen) gelten die Vorschriften des<br />
§ 30 Abs. 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO. Werden Kassendifferenzen über<br />
… Euro oder andere erhebliche Unregelmäßigkeiten festgestellt,<br />
so sind umgehend der FfdF und die örtliche Prüfungseinrichtung<br />
zu benachrichtigen.<br />
7.2 Zahlungen mittels Scheck<br />
(1) Einzahlungen mit Scheck sind möglich, über Auszahlungen<br />
mit Scheck entscheidet der Kassenverwalter.<br />
(2) Scheckzahlungen dürfen zur Begleichung öffentlich-rechtlicher<br />
Forderungen angenommen werden. Handelt es sich um<br />
eine privatrechtliche Forderung, hat die Kasse darauf zu achten,<br />
dass der Stadt/Gemeinde bei Zug-um-Zug-Leistungen keine<br />
Nachteile entstehen.<br />
Die Übersendung eines Schecks erfolgt auf eigene Gefahr der<br />
Schuldnerin/des Schuldners und ist in der Höhe vorzunehmen,<br />
dass die Forderung und eventuell entstehende Kosten<br />
gedeckt sind. Dies gilt besonders, wenn der Scheck zu Lasten<br />
eines ausländischen Kreditinstitutes ausgestellt wurde. Der/Die<br />
Schuldner/-in ist von der anordnenden Dienststelle darüber zu<br />
informieren.<br />
(3) Einzahlung mittels Scheck dürfen nur angenommen werden,<br />
wenn die Schecks innerhalb der Vorlagefrist von 8 Tagen dem<br />
bezogenen Kreditinstitut vorgelegt werden können. Angenommene<br />
Schecks sind unverzüglich als Verrechnungsschecks zu<br />
kennzeichnen.<br />
(4) In einem Schecküberwachungsbuch sind die Nummer des<br />
Schecks, das bezogene Kreditinstitut, die Kontonummer des Ausstellers,<br />
der Betrag und ein Hinweis, durch den die Verbindung<br />
mit der Buchführung hergestellt werden kann, einzutragen. Von<br />
der Führung des Schecküberwachungsbuches kann abgesehen<br />
werden, wenn in einer anderen Weise die Angaben festgehalten<br />
und die Einlösung des Schecks überwacht werden.<br />
(5) Auf Schecks dürfen Geldbeträge nicht bar ausgezahlt<br />
werden.<br />
(6) Bei Einzahlungen mittels Scheck hat die Quittung den<br />
Vermerk „Zahlung durch Scheck, Eingang vorbehalten“ zu<br />
enthalten.<br />
(7) Über Scheckvordrucke hat die Kasse die Bestandsüberwachung<br />
zu gewährleisten, vorrätige Vordrucke sind unter Verschluss<br />
zu nehmen. Gehen Scheckvordrucke verloren, ist dies<br />
unverzüglich dem kontoführenden Kreditinstitut anzuzeigen.<br />
Ungültige Schecks sind im Bestand zu belassen und entsprechend<br />
zu kennzeichnen.<br />
7.3 Leistung von Quittungen<br />
(1) Die zur Annahme von Zahlungsmitteln ermächtigten<br />
Personen im Sinne von Abschnitt 7.1 Abs. 5 haben über jede<br />
Einzahlung, die durch Übergabe von Zahlungsmitteln entrichtet<br />
wird und die nicht den Gegenwert für verkaufte Wertzeichen,<br />
geldwerte Drucksachen und andere gegen Barzahlung zu festen<br />
Preisen abgegebene Gegenstände und Leistungen darstellt, dem<br />
Einzahler eine Quittung zu erteilen. Die Erteilung einer Quittung<br />
erfolgt stets mit fortlaufenden nummerierten Quittungen;<br />
dabei ist die Art der Zahlung anzugeben.<br />
(2) Die Entgegennahme von Zahlungsmitteln ist mittels Durchschreibequittung<br />
von den zur Annahme ermächtigten Personen<br />
nach Abs. 1 zu quittieren. Sie sind berechtigt, allein rechtsgültig<br />
für die Kasse Quittung zu erteilen. Die übergebenen, nummerierten<br />
Quittungsblocks sind zu registrieren, unter Verschluss zu<br />
nehmen und nur gegen Unterschrift auszuhändigen.<br />
(3) Die für die Zahlstelle und Einzahlungskassen benötigten<br />
Quittungsblocks werden von der Kasse zur Verfügung gestellt.<br />
(4) Nummerierte Quittungsblocks werden nur auf Anforderung<br />
der Dienststelle, bei denen Zahlstellen oder Einzahlungskassen<br />
eingerichtet sind, ausgegeben. Der Empfang ist von der abholenden<br />
Person durch Unterschrift zu bescheinigen.<br />
(5) In der Empfangsbescheinigung sind die Nummern der in<br />
den Blocks enthaltenen Doppelblätter anzugeben. Die Durchschriften<br />
der Quittungen sind von den Dienstsstellen (Zahlstellen<br />
und Einzahlungskassen) aufzubewahren.<br />
(6) Kommt ein Quittungsblock abhanden, so ist über den<br />
Sachverhalt eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift<br />
ist als Beleg zu den Abrechnungen über den Bestand der Quittungsblocks<br />
zu nehmen.<br />
(7) Ungültige Quittungen sind im Original im Quittungsblock<br />
zu belassen.<br />
(8) Die Vordrucke sind sicher unter Verschluss aufzubewahren.<br />
Über die Ausgabe an die berechtigten Beschäftigten ist ein<br />
Nachweis zu führen.<br />
(9) In den Kassenräumen ist ein Aushang mit den Namenszügen<br />
der quittungsberechtigten Beschäftigten anzubringen.<br />
(10) Bei Beträgen, die durch Automaten vereinnahmt werden,<br />
kann von einer Quittungsleistung abgesehen werden. Dies gilt<br />
entsprechend, soweit bei Einzahlungen mit EC-Karte oder<br />
Kreditkarte ein Verfahren zur Anwendung kommt, bei dem<br />
Lastschrifteinzugsermächtigungen erstellt werden.<br />
7.4 Konten und Verfügungsberechtigung<br />
(1) Die von der Gemeinde/Stadt unterhaltenen Konten bei Kreditinstituten<br />
werden unter der Bezeichnung „Gemeinde/Stadt.../<br />
Bewirtschaftung Gemeindekasse“ geführt. Über die Errichtung<br />
253
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
von Konten entscheidet auf Vorschlag des Kassenverwalters der<br />
Bürgermeister.<br />
(2) Über die Guthaben auf den Konten bei den Kreditinstituten<br />
verfügt grundsätzlich die Kasse; sie ist ebenso für die Anerkennung<br />
des Saldos zuständig.<br />
(3) Ermächtigungen an Dritte, Forderungen gegenüber der Gemeinde/Stadt<br />
… bei Fälligkeit mittels Lastschrifteinzugsverfahren<br />
zu befriedigen, sollen auch bei Vorliegen der Voraussetzungen<br />
nach § 16 Abs. 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO nur in Ausnahmefällen von<br />
der Kasse erteilt werden. Die Ermächtigung ist vom Unterschriftsbevollmächtigten<br />
zu unterzeichnen. Über die erteilten<br />
Einzugsermächtigungen ist ein Verzeichnis zu führen.<br />
7.5 Verwaltung der Kassenmittel<br />
(1) Die Kasse hat darauf zu achten, dass die für die Auszahlungen<br />
erforderlichen Kassenmittel rechtzeitig verfügbar sind.<br />
Der Bestand an Bargeld und die Guthaben auf den für den<br />
Zahlungsverkehr bei Kreditinstituten errichteten Konten sind<br />
auf den für Zahlungen notwendigen Umfang zu beschränken.<br />
Der Höchstbetrag der verfügbaren Guthaben auf den Konten soll<br />
………… Euro nicht übersteigen. Der Bestand an Zahlungsmitteln<br />
in der Barkasse soll einen Betrag i. H. v. ….. Euro nicht<br />
übersteigen. Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel<br />
sind unter Beachtung der Regelung in Abschnitt 2.2 Abs. 6 so<br />
anzulegen, dass sie bei Bedarf verfügbar sind. Sofern dies wirtschaftlicher<br />
ist, können die nicht benötigten Gelder auch auf<br />
den laufenden Geschäftskonten verbleiben. Grundlage hierfür<br />
ist eine Liquiditätsplanung, die täglich/wöchentlich/monatlich<br />
fortgeschrieben wird.<br />
(2) Die budgetbewirtschaftenden Stellen haben die Kasse unverzüglich<br />
zu unterrichten, wenn mit Ein- und Auszahlungen<br />
über ………. Euro zu rechnen ist.<br />
(3) Muss der Kassenbestand vorübergehend durch Kassenkredite<br />
verstärkt werden, hat der Kassenverwalter unverzüglich die<br />
Weisung des Bürgermeisters einzuholen.<br />
7.6 Aufbewahrung der Zahlungsmittel<br />
(1) Außerhalb der Dienststunden sind die Kassenräume verschlossen<br />
zu halten. Nach Dienstschluss sind Zahlungsmittel und<br />
Vordrucke für Schecks unter Verschluss zu nehmen. Zahlungsmittel<br />
und Vordrucke für Schecks sind sicher aufzubewahren.<br />
(2) Der Tagesbedarf an Zahlungsmitteln (Geld, geldwerte Bestände,<br />
Schecks) ist in verschließbaren Behältern aufzubewahren.<br />
Die Zahlungsmittel der Kasse, der Zahlstellen, der Einzahlungskassen<br />
und der Handvorschüsse sind nach Dienstschluss, soweit<br />
die örtlichen Verhältnisse es zulassen, unter Doppelverschluss zu<br />
nehmen. Die Schlüssel sind in der dienstfreien Zeit entsprechend<br />
der Schlüsselordnung sicher aufzubewahren.<br />
254<br />
7.7 Beförderung von Zahlungsmitteln<br />
Der Bürgermeister/FfdF/Kassenverwalter 6 bestimmt, welche Personen<br />
in der Kasse nicht benötigtes Bargeld bei den Kreditinstituten<br />
abzuliefern haben. Bei Beträgen über …. Euro soll der<br />
Transport von zwei Beschäftigten oder durch einen beauftragten<br />
Sicherheitsdienst durchgeführt werden. Die Transporte sollen<br />
außerhalb der Kassenstunden aber innerhalb der allgemeinen<br />
Dienststunden vorgenommen werden. Grundsätzlich soll der<br />
nächste und sicherste Weg gewählt werden. Die vorstehende<br />
Regelung gilt entsprechend für die Beförderung von Zahlungsmitteln<br />
der Zahlstellen, Einzahlungskassen und Handvorschüsse<br />
zur Kasse der Gemeinde/Stadt oder zum kontoführenden<br />
Kreditinstitut.<br />
7.8 Kassensicherheit<br />
(1) Die Kasse stellt sicher, dass bei Dienstschluss alle Bücher<br />
und Belege sicher verwahrt werden. Die Kreditkarten und<br />
Kundenkarten der Kreditinstitute sowie die Datenträger mit der<br />
elektronischen Signatur sind unter Verschluss zu nehmen.<br />
(2) Sparbücher oder Vermögensanlagen der Gemeinde/Stadt<br />
und zur Sicherung kommunaler Forderungen übergebene oder<br />
im Vollstreckungsverfahren eingezogene Urkunden sind bis zum<br />
Abschluss des Verfahrens unter Verschluss zu nehmen.<br />
(3) Die unterschriftsbefugten Beschäftigten der Kasse halten<br />
die Bedingungen für die Datenfernübertragung, insbesondere<br />
die Geheimhaltung der Passwörter ein. Die Belehrung über die<br />
Bedingungen ist schriftlich zu dokumentieren.<br />
(4) Überweisungsaufträge, Abbuchungsaufträge und -vollmachten<br />
und Schecks sind von zwei Bediensteten der Gemeinde<br />
zu unterzeichnen. Im automatisierten Verfahren können die<br />
Unterschriften durch elektronische Signaturen ersetzt werden.<br />
8 Verwahrung von Wertgegenständen und sonstigen<br />
Gegenständen<br />
(1) Wertpapiere sollen einem Kreditinstitut zur Verwahrung<br />
übergeben werden. Im Übrigen sind Wertpapiere und andere<br />
Urkunden, welche Vermögensrechte verbriefen oder nachweisen<br />
(Sparbücher, Zertifikate, Bürgschaftsurkunden, Kfz-Briefe), von<br />
der Kasse zu verwahren.<br />
(2) Durch die Kasse sind Sachgegenstände, die der Stadt/Gemeinde<br />
… gehören oder von ihr zu verwahren sind, sicher<br />
aufzubewahren. Über die Annahme und Ausgabe ist ein Verwahrbuch<br />
zu führen. Für Einlieferungen und Auslieferungen<br />
sind schriftliche Anordnungen erforderlich. Für den Inhalt der<br />
Anordnungen gilt § 8 SächsKom<strong>KB</strong>VO sinngemäß.<br />
(3) Bei Einlieferungen ist eine Hinterlegungsbescheinigung<br />
auszustellen, die folgende Inhalte wiedergeben muss:<br />
6 Örtlich regeln. In kleineren Gemeinden sollte die Regelungsbefugnis<br />
dem Bürgermeister vorbehalten sein (§ 19 Abs. 1 Satz 2<br />
SächsKom<strong>KB</strong>VO).
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
1. Name der Einlieferin/des Einlieferers,<br />
2. Art und Stückzahl der Gegenstände (bei Wertpapieren und<br />
Wertzeichen auch der Nominalwert),<br />
3. Zweck der Hinterlegung usw. (Sicherheitsleistung, Pfandstück,<br />
Stiftungswert und dgl.) und<br />
4. Ort und Datum.<br />
(4) Die auszuliefernden Wertgegenstände und sonstigen Gegenstände<br />
sind als Einschreiben oder Wertsendung zu übersenden,<br />
sofern die unmittelbare Aushändigung nicht ausdrücklich<br />
angeordnet oder nicht vom Empfangsberechtigten verlangt<br />
wird. Die Auslieferung erfolgt nur gegen Rückgabe der Hinterlegungsbescheinigung<br />
und gegen Empfangsbestätigung. Die<br />
Hinterlegungsbescheinigung ist dem Kassenbeleg beizufügen.<br />
(5) Die Wertgegenstände i. S. v. § 20 und andere Gegenstände<br />
i. S. v. § 21 SächsKom<strong>KB</strong>VO sind im Tresor aufzubewahren.<br />
(6) Fundgegenstände, soweit es sich hierbei um Bargeld oder<br />
sonstige Zahlungsmittel i. S. v. § 40 Nr. 7 SächsKom<strong>KB</strong>VO<br />
handelt, werden von der Kasse verwahrt und in den Büchern<br />
nachgewiesen. Sonstige Fundgegenstände werden nicht durch<br />
die Kasse verwahrt. Der Kassenverwalter oder ein von ihm beauftragter<br />
Bediensteter sollte mindestens einmal jährlich eine<br />
Bestandskontrolle durchführen. Der Umfang und das Ergebnis<br />
sind schriftlich zu dokumentieren.<br />
Teil 4 Buchführung<br />
9 Einrichtung der Buchführung<br />
9.1 Gegenstand und Organisation der Buchführung<br />
(1) Die Buchführung gliedert sich in die Haupt- und Zeitbuchführung<br />
nach § 24 Abs. 1 SächsKom<strong>KB</strong>VO sowie in die Nebenbuchführung.<br />
Zur Nebenbuchführung gehören die Führung<br />
der Vorbücher (§ 25 Abs. 2, § 27 Abs. 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO), des<br />
Kontogegenbuches (§ 24 Abs. 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO) sowie des<br />
Tagesabschlussbuches (§ 24 Abs. 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO) sowie die<br />
Anlagenbuchhaltung, die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung<br />
und die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung. 7<br />
Die Buchführung wird zentral vom Fachdienst/Amt Kasse 8 , Sachgebiet<br />
Finanzbuchhaltung, wahrgenommen.<br />
Alternativ:<br />
Die Buchführung ist dezentral organisiert. Die Erfassung von<br />
Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt in den Fachämtern,<br />
denen auf Grundlage des Haushaltsplans die Budgetbewirtschaftung<br />
eingeräumt ist. Einzahlungen und Auszahlungen<br />
werden, soweit sie sich nicht auf Zahlstellen, Einzahlungskassen<br />
oder Handvorschüsse beziehen, zentral vom Fachdienst/Amt<br />
Kasse gebucht. Als Nebenbücher werden durch die Kasse die<br />
Kreditoren- und Debitorenbücher geführt sowie die sonstigen<br />
Nebenbücher, die sich auf Ein- und Auszahlungen beziehen,<br />
geführt. Die Erfassung des Anlagevermögens einschließlich der<br />
7 Auf die Erläuterung zur Dienstanweisung wird verwiesen.<br />
8 Alternativ sonstige Bezeichnung.<br />
Nachaktivierungen sowie der Zu- und Abschreibungen (Anlagenbuchhaltung)<br />
und der zugehörigen Sonderposten erfolgen zentral<br />
durch die Kasse/die Finanzverwaltung.<br />
Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung/Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung<br />
wird dem Amt/Sachgebiet … zugeordnet und unterliegt<br />
einer gesonderten Regelung.<br />
(2) Zahlungsverkehr und Buchführung sollen nicht von<br />
denselben Beschäftigten wahrgenommen werden (§ 5 Abs. 2<br />
SächsKom<strong>KB</strong>VO).<br />
(3) Der Kasse werden im Zusammenhang mit der Erledigung<br />
der Buchführung folgende weitere Aufgaben übertragen:<br />
die Aufstellung der Finanzrechnung einschließlich der<br />
Teilrechnungen<br />
die Aufstellung der Ergebnisrechnung einschließlich der<br />
Teilrechnungen<br />
die Liquiditätsplanung<br />
die Anlagenbuchhaltung9 –<br />
–<br />
–<br />
–<br />
– ggf. weitere Ergänzungen<br />
Alternativ:<br />
Das Führen der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung<br />
sowie der Anlagenbuchhaltung obliegt der Finanzverwaltung.<br />
9.2 Beschäftigte in der Finanzbuchhaltung<br />
(1) Die mit den Aufgaben der Buchführung beauftragten<br />
Beschäftigten der Kasse sollen keine Zahlungsanordnungen<br />
vorbereiten oder erteilen (§ 7 Abs. 3 SächsKom<strong>KB</strong>VO).<br />
(2) Die Beschäftigten in der Finanzbuchhaltung haben die<br />
ihnen zugewiesenen Aufgaben sorgfältig und unverzüglich zu<br />
erledigen und in ihrem Aufgabengebiet auf eine vollständige,<br />
richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Buchführung<br />
zu achten.<br />
(3) Die Beschäftigten in der Finanzbuchhaltung haben sich mit<br />
den Vorschriften über die Buchführung und den Zahlungsverkehr,<br />
den besonderen Vorschriften für ihr Aufgabengebiet und<br />
mit dieser Dienstanweisung vertraut zu machen. Wenn ihnen<br />
Vorschriften unklar oder nicht ausreichend erscheinen, ist die<br />
Entscheidung des/der Kassenverwalters/-in einzuholen.<br />
10 Kontenplan<br />
Grundlage der Buchführung ist der gemäß § 23 Satz 3 Sächs-<br />
Kom<strong>KB</strong>VO zu erstellende Kontenplan der Gemeinde/Stadt. Er<br />
basiert auf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums<br />
des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum<br />
Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue<br />
Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat<br />
Sachsen (VwV Haushaltssystematik Kommunen – VwV KomH-<br />
Sys) in der jeweils geltenden Fassung. Der Kontenplan wird<br />
zentral von der Finanzbuchhaltung/der Kasse/der Finanzverwaltung<br />
9 Soweit die Anlagenbuchhaltung der Kasse übertragen wird.<br />
255
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
gepflegt. Er kann bei Bedarf ergänzt werden. Bei Anlage neuer<br />
Konten sind zugleich die Anforderungen der Kosten-Leistungsrechnung<br />
zu berücksichtigen. Die Kasse ist über die Einrichtung<br />
neuer Konten zu informieren. 10<br />
11 Belege<br />
(1) Alle Buchungen müssen durch schriftliche oder auf elektronischem<br />
Wege übermittelte Kassenanordnungen und Zahlungsnachweise<br />
sowie durch begründende Unterlagen, aus denen<br />
sich der Grund der Erträge und Aufwendungen und/oder der<br />
Einzahlungen und Auszahlungen ergibt, im Original belegt sein<br />
(§§ 33 und 34 SächsKom<strong>KB</strong>VO).<br />
Die durch die Dienststellen erteilten Kassenanordnungen sind<br />
hinsichtlich formaler Anforderungen (Beifügung begründender<br />
Unterlagen, Unterschrift oder elektronische Signatur durch ermächtigte<br />
Person) und sachlicher Anforderungen (zutreffende<br />
sachliche Kontierung) zu überprüfen. Ist eine Anordnung zu<br />
beanstanden oder gibt sie zu Bedenken Anlass, so ist sie der<br />
anordnenden Stelle zurückzugeben (vgl. § 7 Abs. 1 Sätze 2 und<br />
SächsKom<strong>KB</strong>VO).<br />
(2) Gebuchte Belege können nur aufgrund einer Kassenanordnung<br />
durch die anordnende Dienststelle von der Finanzbuchhaltung<br />
storniert werden. Die Nummer des zu stornierenden<br />
Beleges ist anzugeben. Ein entsprechender Stornobeleg ist zu<br />
erstellen und abzulegen.<br />
Die Kontenpflege (Ausgleich von Konten, Auszifferungen,<br />
Durchführung von Korrekturbuchungen und Bearbeitung offener<br />
Posten) erfolgt zeitnah durch die Finanzbuchhaltung.<br />
(3) Die Belege werden nach der Ordnung des Kontenplanes und<br />
nach Belegnummern abgelegt.<br />
Alternativ:<br />
(3) Die Belegablage erfolgt geordnet nach dem Produktplan und<br />
zwar nach (Varianten):<br />
– der laufenden Nummer im Zeitbuch<br />
– nach dem Datum der Überweisung bzw. des Zahlungseingangs<br />
– nach dem zugehörigen Aufwandskonto bei Aufwendungen<br />
und dem zugehörigen Ertragskonto bei Erträgen. Innerhalb<br />
der Konten erfolgt die Ablage nach der laufenden Nummer im<br />
Zeitbuch.<br />
– bei Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
nach der entsprechenden Maßnahme. Innerhalb der Maßnahme<br />
erfolgt die Ablage getrennt für Einzahlungen und<br />
Auszahlungen nach der laufenden Nummer im Zeitbuch.<br />
Maßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, die gemäß<br />
§ 4 Abs. 4 Satz 4 SächsKomHVO-Doppik zusammengefasst<br />
werden dürfen, werden gesondert nach der laufenden Nummer<br />
im Zeitbuch abgelegt.<br />
– Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
werden getrennt voneinander nach der laufenden Nummer im<br />
Zeitbuch abgelegt.<br />
10 Nur soweit der Kontenplan nicht durch die Kasse bzw. die Finanzbuchhaltung<br />
selbst aufgestellt und gepflegt wird.<br />
256<br />
(4) Die Ablage ist unverzüglich vorzunehmen. Die Vollständigkeit<br />
der Belegablage ist zu gewährleisten.<br />
(5) Bei der Übernahme der Belege auf unveränderbare elektromagnetische<br />
oder unveränderbare optische Speichermedien sind<br />
die Anforderungen des § 34 Abs. 3 und 4 SächsKom<strong>KB</strong>VO zu<br />
beachten.<br />
12 Buchführung<br />
12.1 Allgemeines<br />
(1) Die Kasse ist für die Zeit- und Hauptbuchführung der Stadt/<br />
Gemeinde … in Form der doppelten Buchführung im automatisierten<br />
Verfahren zuständig (§§ 22 bis 29 SächsKom<strong>KB</strong>VO).<br />
Alternativ:<br />
(1) Die Erfassung der zu buchenden Geschäftsvorfälle erfolgt<br />
dezentral durch die budgetbewirtschaftenden Stellen (vgl. Abschnitt<br />
9.1 Abs. 1).<br />
Der Kasse obliegt die Führung des Kontogegenbuches (§ 24 Abs. 2<br />
SächsKom<strong>KB</strong>VO), des Tagesabschlussbuches (§ 24 Abs. 3 SächsKom-<br />
<strong>KB</strong>VO) sowie der weiteren Nebenbücher (Vorbücher, Debitoren-<br />
/Kreditorenbücher usw.).<br />
(2) In Zahlstellen, Einzahlungskassen und Handvorschusskassen<br />
können auch elektronisch lesbare Kassenbücher verwendet werden,<br />
§ 22 Abs. 3 Satz 2-4 SächsKom<strong>KB</strong>VO ist zu beachten.<br />
12.2 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen<br />
12.2.1 Einzahlungen<br />
(1) Unbare Einzahlungen sind an dem Tag zu buchen, an dem<br />
die Kasse von der Gutschrift Kenntnis erhält oder ein übersandter<br />
Scheck bei ihr eingeht. Barzahlungen sind am Tag des<br />
Eingangs der Zahlungsmittel oder bei der Übergabe der Schecks<br />
zu buchen. Einzahlungen, die außerhalb der Räume der Gemeinde-/Stadtkasse<br />
angenommen werden, werden am Tag der<br />
Abrechnung mit der Gemeinde-/Stadtkasse gebucht.<br />
(2) Einzahlungen, die keinem Debitor zugeordnet werden<br />
können, sind bis zur Aufklärung als sonstige Verbindlichkeiten<br />
zu buchen. Soweit erforderlich können zur Abgrenzung entsprechende<br />
Unterkonten eingerichtet werden.<br />
12.2.2 Auszahlungen<br />
(1) Unbare Zahlungen sind am Tag der Hingabe des Auftrages<br />
an das Kreditinstitut oder bei Übersendung des Schecks und bei<br />
Abbuchungen im Lastschriftverkehr am Tag, an dem die Kasse<br />
von der Abbuchung Kenntnis erhält, zu buchen. Barzahlungen<br />
sind am Tag der Übergabe oder Übersendung der Zahlungsmittel<br />
oder bei Übergabe der Schecks zu buchen.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
(2) Auszahlungen an Kreditoren für Dritte sind als sonstige Forderungen<br />
zu buchen. Soweit erforderlich können zur Abgrenzung<br />
entsprechende Unterkonten eingerichtet werden.<br />
12.2.3 Aufrechnungen<br />
Die Kasse hat vor Leistung von Auszahlungen zur prüfen, ob<br />
nicht eine Aufrechnung zulässig ist. Aufrechnungen sind an dem<br />
Tag zu buchen, an dem die Aufrechnungserklärung der Gemeindekasse<br />
bekannt wird. Die Aufrechnung der Auszahlungen ist<br />
mit der Einzahlungsbuchung vorzunehmen.<br />
12.2.4 Buchungen im automatisierten Verfahren<br />
Wird im automatisierten Verfahren gebucht, können die Buchungen<br />
auch nach den in den vorstehenden Abschnitten 12.2.1<br />
bis 12.2.3 genannten Tagen vorgenommen werden. Sie sind<br />
unverzüglich und stets unter dem Datum vorzunehmen, dass<br />
sich aus den Abschnitten 12.2.1 bis 12.2.3 ergibt.<br />
12.3 Abschlüsse<br />
12.3.1 Tagesabschlüsse und Zwischenabschlüsse<br />
(1) Gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 SächsKom<strong>KB</strong>VO ist die Kasse<br />
täglich abzuschließen.<br />
Alternativ: Abweichend zu § 30 Abs. 1 SächsKom<strong>KB</strong>VO ergeht die<br />
Anordnung, dass aufgrund des geringen Zahlungsverkehrs wöchentlich<br />
nur ein Abschluss vorgenommen wird.<br />
Die Gemeindekasse hat am Schluss des Buchungstages oder vor<br />
Beginn des folgenden Buchungstages den Kassenistbestand zu<br />
ermitteln. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 30 Abs. 1<br />
SächsKom<strong>KB</strong>VO.<br />
(2) Der Kassenistbestand soll mit dem Sollbestand der Kassenmittel<br />
aus der Finanzrechnung abgestimmt werden. Eine Saldierung<br />
von Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ist nicht<br />
zulässig. Maßgeblich sind die im Bereich der Kreditoren- und<br />
Debitorenbuchhaltung erfassten Buchungen in der Finanzrechnung<br />
sowie die etwaig direkt auf den Finanzrechnungskonten<br />
erfassten Buchungen. Die Abstimmung erfolgt mittels eines<br />
technikunterstützten und standardisierten Berichts/Journals.<br />
(3) Gemäß § 31 SächsKom<strong>KB</strong>VO sind mindestens vierteljährlich<br />
Zwischenabschlüsse des Haupt- und des Zeitbuches zu erstellen.<br />
Dabei ist festzustellen, ob die zeitliche und sachliche Buchung<br />
der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und<br />
Auszahlungen im Zeitbuch und Hauptbuch übereinstimmen.<br />
Alternativ:<br />
Gemäß § 31 Satz 2 SächsKom<strong>KB</strong>VO wird angeordnet, dass<br />
bis auf Weiteres von der Erstellung von Zwischenabschlüssen<br />
abgesehen werden kann, soweit die zeitlichen und sachlichen<br />
Buchungen in einem Arbeitsgang vorgenommen werden.<br />
12.3.2 Mitwirkung beim Jahresabschluss<br />
(1) Die Konten der Finanzrechnung sind am Ende des Haushaltsjahres<br />
für die Aufstellung des Jahresabschlusses abzuschließen.<br />
Der buchmäßige Kassenbestand, die offenen Posten sowie ein<br />
Fehlbetrag sind festzustellen und nach den Vorgaben für die<br />
Zeit- und Hauptbuchung in die Bücher des folgenden Jahres<br />
zu übertragen. Die Rechnungsperiode ist das Kalenderjahr,<br />
Abschlussstichtag ist der 31.12. Der Jahresabschluss wird durch<br />
die Finanzbuchhaltung in enger Zusammenarbeit mit dem FfdF<br />
durchgeführt. Für die durchzuführenden Arbeiten ist jährlich ein<br />
Terminplan zu erstellen.<br />
(2) Die Bücher der Zahlstellen, Handvorschüsse und Einnahmekassen<br />
sind am …. (spätestens 31.12. des Hj.) abzuschließen.<br />
Die Ergebnisse sind in das Haupt- und Zeitbuch zu übernehmen.<br />
Die Bestände der Zahlstellen, Einzahlungskassen und<br />
Handvorschüsse sind bis zum …. auf das bezeichnete Konto<br />
der Gemeinde-/Stadtkasse einzuzahlen.<br />
Alternativ: Die Bestände der Zahlstellen, Einzahlungskassen und<br />
Handvorschüsse sind per … (spätestens 31.12. des Hj.) zu ermitteln<br />
und der Kasse unverzüglich mitzuteilen. Der Bestand am Abschlussstichtag<br />
ist zu dokumentieren.<br />
(3) Zum Abschlussstichtag sind durch den/die Kassenverwalter/<br />
-in die Bestände sämtlicher Finanzmittelkonten (Kontengruppe<br />
17) formell festzustellen. Sofern noch nicht erfolgt, sind<br />
die Bestände zu aktivieren. Dabei sind auch die Bestände der<br />
Automaten, die Postwertzeichen und die Guthaben bei Frankiermaschinen<br />
sowie … zu berücksichtigen.<br />
(4) Zum Abschlussstichtag ist die Finanzrechnung zu erstellen.<br />
Korrekturen von Konten (Löschungen, Nicht-Übernahmen,<br />
Bezeichnungen) sollen bis zum Abschlussstichtag erfolgen. Die<br />
Debitorenkonten und die Kreditorenkonten sowie alle sonstigen<br />
Vorbücher sind abzuschließen. Nach dem Abschlusstag dürfen<br />
nur noch Abschlussbuchungen (vgl. § 40 Nr. 1 SächsKom<strong>KB</strong>VO)<br />
vorgenommen werden.<br />
(5) Die Forderungen sind gemäß §§ 37 Abs. 1 Nr. 3 und § 38<br />
Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik wirklichkeitsgetreu zu bewerten<br />
und, soweit erforderlich, wertzuberichtigen. Erkenntnisse über<br />
Risiken und Verluste sind im Jahresabschluss zu berücksichtigen,<br />
auch dann, wenn diese Erkenntnisse erst zwischen dem Abschlussstichtag<br />
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses<br />
bekannt werden, soweit die Ursache des Risikos oder des Verlustes<br />
auf einen Zeitpunkt vor den Abschlussstichtag fällt. Die Wertberichtigungen<br />
aufgrund derartiger Informationen, insbesondere aus<br />
der Vollstreckung, sind nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger<br />
Buchführung zeitnah zu buchen und zu dokumentieren. Das<br />
Nähere zum Verfahren der Wertberichtigung sowie zum Verfahren<br />
bei Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen wird in einer<br />
gesonderten Dienstanweisung geregelt.<br />
(6) Sofern Aufwendungen oder Erträge mehreren Rechnungsperioden<br />
zuzuordnen sind, werden Abgrenzungsbuchungen von der<br />
Kasse/der Finanzbuchhaltung vorgenommen. Die erforderlichen<br />
Informationen sind von der budgetbewirtschaftenden Stelle zu<br />
liefern. Der Tatbestand „Auszahlung vor Aufwand“ sowie „Einzahlung<br />
vor Ertrag“ (Rechnungsabgrenzungsposten) ist auf dem<br />
Buchungsbeleg zu vermerken.<br />
Bei „Aufwand vor Auszahlung“ (sonstige Verbindlichkeiten) oder<br />
„Ertrag vor Einzahlung“ (sonstige Forderungen) ist die Kasse/<br />
Finanzbuchhaltung zu informieren. Zum späteren Zeitpunkt<br />
257
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
der Rechnungserfassung ist die Buchungsnummer der Abgrenzungsbuchung,<br />
die von der Finanzbuchhaltung mitgeteilt wird,<br />
auf dem Buchungsbeleg zur Rechnungserfassung anzugeben.<br />
(7) Rückstellungen i. S. v. § 41 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik<br />
werden durch die budgetbewirtschaftenden Stellen ermittelt,<br />
beantragt und nach Genehmigung durch die Kämmerei/die<br />
Finanzverwaltung von der Finanzbuchhaltung gebucht. Die<br />
von der Finanzbuchhaltung vorgegebenen Formulare sind zu<br />
verwenden.<br />
12.4 Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen<br />
(1) Die Bücher, das Inventar einschließlich der Unterlagen<br />
über die Inventur, die Jahresabschlüsse und die konsolidierten<br />
Gesamtsabschlüsse, die dazu ergangenen Anweisungen und<br />
Organisationsregelungen, die Buchungsbelege und die Unterlagen<br />
über den Zahlungsverkehr sowie die Eröffnungsbilanz sind<br />
geordnet und sicher aufzubewahren.<br />
(2) Die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss und der konsolidierte<br />
Gesamtabschluss sind dauernd aufzubewahren, bei automatisierten<br />
Verfahren in ausgedruckter Form. Die Bücher und<br />
das Inventar sind zehn Jahre, die Belege sechs Jahre aufzubewahren.<br />
Die Fristen beginnen am 1. Januar des der Beschlussfassung<br />
des Rates über die Feststellung des Jahresabschlusses und des<br />
konsolidierten Gesamtabschlusses folgenden Haushaltsjahres.<br />
Gutschriften, Lastschriften und Kontoauszüge der Kreditinstitute<br />
sind wie Belege zu behandeln.<br />
(3) Bei der Archivierung der Bücher, der Belege und der sonst<br />
erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträger oder Bildträger<br />
muss insbesondere sichergestellt sein, dass der Inhalt der Daten-<br />
oder Bildträger mit den Originalen übereinstimmt. Während<br />
der Dauer der Aufbewahrungsfrist muss deren Wiedergabe<br />
möglich sein. Die Daten müssen jederzeit innerhalb einer angemessenen<br />
Frist lesbar gemacht und ausgedruckt werden können<br />
sowie mit den Kassenbüchern und -belegen, den begründenden<br />
Unterlagen sowie den Buchungsbelegen bildlich und mit den<br />
anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar<br />
gemacht werden.<br />
(4) Werden die Bücher und das Inventar in visuell lesbarer Form<br />
geführt, können diese nach Feststellung des Jahresabschlusses<br />
und des konsolidierten Gesamtabschlusses durch den Gemeinderat<br />
entweder auf unveränderbare elektromagnetische oder auf<br />
unveränderbare optische Speichermedien übernommen und in<br />
dieser Form anstelle der Originale aufbewahrt werden. Vorstehender<br />
Abs. 3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.<br />
Teil 5 Schlussbestimmungen<br />
13 Schlussbestimmungen<br />
(1) Notwendige Änderungen und Ergänzungen zu dieser Dienstanweisung<br />
werden von der Kasse veranlasst.<br />
(2) Diese Dienstanweisung tritt am … in Kraft. Gleichzeitig tritt<br />
die Dienstanweisung …. vom …. außer Kraft.<br />
Bürgermeister<br />
Gemeinde/Stadt<br />
Die Organisation des Neuen Kommunalen<br />
Haushalts- und Rechnungswesens<br />
Mit der Einführung der Doppik stehen die Kommunen nicht<br />
nur vor einer Änderung des Rechnungsstils, sondern sind zusätzlich<br />
mit vielen strukturellen Themen und Fragen während<br />
des Umstellungsprozess konfrontiert. Folgende wesentlichen<br />
Fragen stellen sich in der Strukturierung der Organisation des<br />
Neuen kommunalen Rechnungswesens:<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Welche Aufgaben werden mit der Änderung des Rechnungsstils<br />
von welchen Personen wahrgenommen?<br />
Wie müssen rechnungslegungsrelevante Prozesse strukturiert<br />
werden?<br />
Welches Personal muss welche Schulungen erhalten?<br />
Macht es Sinn, Buchungsprozesse zu digitalisieren?<br />
Diese Fragen sind nicht abschließend. Unsere Projekterfahrung<br />
zeigt, dass vielerorts ein falsches Verständnis von zentraler und<br />
dezentraler Buchung vorliegt. Im ersten Schritt ist es entschei-<br />
258<br />
Jan-Hendrik Bahn<br />
Rödl & Partner GmbH<br />
dend, ein Verständnismodell aufzubauen und Transparenz in den<br />
zukünftigen Aufgaben und Abläufen zu schaffen.<br />
Der Aufbau eines Verständnismodells<br />
Die klassischen Aufgaben der Kämmerei (z. B. Haushalts- und<br />
Finanzplanung, über- und außerplanmäßige Ausgaben, Jahresrechnung,<br />
Klärung steuerlicher Fragen etc.) werden durch<br />
die Umstellung auf einen doppischen Haushalt abgelöst. Zum<br />
Einmalaufwand der Umstellung kommen, aufgrund der Einführung<br />
der Doppik, zusätzliche Arbeiten im Hinblick auf die<br />
Anlagenbuchhaltung und Kosten- und Leistungsrechnung auf<br />
die Kommunen zu. Organisatorisch bietet es sich an, das gesamte<br />
Finanzwesen der Kommune unter einer Leitung zu verwalten:<br />
– Haushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionsprogramm),
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Geschäftsbuchführung,<br />
Anlagenbuchhaltung,<br />
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung,<br />
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung,<br />
Steuern,<br />
KLR und Produktcontrolling,<br />
Beteiligungs- und Finanzcontrolling<br />
Das Buchungsgeschäft wird komplexer (z. B. Bestandskonten,<br />
Konten der Ergebnis- und Finanzrechnung, Abschreibungen,<br />
Rückstellungen, Sonderposten, andere bilanzielle Besonderheiten).<br />
Eine hohe Buchungsqualität setzt eine entsprechende<br />
Qualifizierung voraus. Wer in welchem Umfang qualifiziert<br />
wird, ist von der Organisation der Finanzverwaltung und der<br />
Gestaltung der rechnungswesensrelevanten Prozesse abhängig.<br />
In diesem Punkt besteht derzeit der größte Aufklärungsbedarf.<br />
Die erhöhten Anforderungen aufgrund der Komplexität des<br />
neuen Rechnungswesens bestehen im reinen Kontieren. Hier<br />
verändert sich die grundlegende „Handarbeit“. Der Buchungsprozess<br />
in seiner Gesamtheit besteht neben der Kontierung,<br />
aber auch aus der Bestellung/dem Auftragsmanagement, der<br />
Rechnungs- und Mittelprüfung sowie aus der formellen Anordnung.<br />
Eine grundlegende Abgrenzung ist dementsprechend<br />
erforderlich.<br />
Im Sinne des Verständnismodells wird unter einer Zentralsierung<br />
des Rechnungswesens die zentrale Kontierung bei gleichzeitigem<br />
zentralen Rechnungseingang verstanden. Sollte zentral kontiert<br />
werden und ein zentraler Rechnungseingang vorliegen, spricht<br />
man von einem zentralen Rechnungswesen.<br />
Natürlich gibt es in der Praxis nicht die reine schwarz-weiß<br />
Sicht. Die Grundlage für die Entscheidung, welchen Weg die<br />
Kommune geht, kann eine Analyse des Buchungsvolumens und<br />
die Prozessgestaltung unter Berücksichtigung der Integration von<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien bilden.<br />
Die Buchungsanalyse – Hilfsmittel zur Beantwortung<br />
entscheidender Fragen<br />
Die Buchungsanalyse ermittelt in einem zweistufigen Prozess,<br />
welches Personal in welcher Höhe durch das Buchen bzw. durch<br />
das Kontieren gebunden wird. Die Finanzsoftware sollte eine<br />
automatische Unterteilung des Buchungsvolumens pro Person<br />
ausweisen können. Die Buchungsanalyse unterteilt dann in der<br />
ersten Stufe die Buchungen pro Person nach:<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Anzahl der Buchung konsumtiv/investiv<br />
Prozentualer Anteil manueller und automatisierter Buchungen<br />
(maschinell)<br />
Schnittstellen zu Vorsystemen<br />
Anteil der Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) an Buchungs-,<br />
Planungs-, Fach- und Führungsaufgaben (Dreiteilung)<br />
Im Ergebnis erhält man die gebundene Zeitvolumia für Buchungsaufgaben.<br />
Diese Buchungsaufgaben werden in der zweiten<br />
Stufe der Analyse des Buchungsvolumens näher analysiert. Unter<br />
Berücksichtigung des Verständnismodells werden die Buchungsaufgaben<br />
wie folgt voneinander abgegrenzt:<br />
1. Aufgaben im Zusammenhang mit der Bestellung<br />
2. Aufgaben für die Rechnungsprüfung, einschließlich<br />
Mittelprüfung<br />
3. Aufgaben aus dem Kontieren<br />
Um im Ergebnis die dezentral vorgehaltenen Zeitvolumina für<br />
die reinen Aufgaben des Kontierens zu ermitteln, wird in der<br />
zweiten Stufe der Buchungsanalyse der Anteil der Vollbeschäftigteneinheiten<br />
für die Dreiteilung dieser Aufgaben hinterfragt. Es<br />
können hierbei unter Berücksichtigung des Buchungsvolumens<br />
reine Kontierungszeiten ermittelt werden. In der Konsequenz kann<br />
der Zeitaufwand prognostiziert werden, der für die Zentralisierung<br />
des Kontierens notwendig wäre. Aufgrund von Synergie- und<br />
Skaleneffekten wird dieser in der Praxis, in einer zentralen Geschäftsbuchführung,<br />
geringer als die Prognose ausfallen.<br />
Prozessgestaltung des zentralen Rechnungswesens<br />
Nach der Klärung des Personalbedarfs sind alle rechnungswesensrelevanten<br />
Prozesse im Status Quo zu betrachten und unter<br />
Berücksichtigung der dezentralen oder zentralen Strukturierung<br />
des Rechnungswesens neu zu gestalten. Wesentliche Prozesse<br />
sind:<br />
1. Haushaltsplanung/Planansatz<br />
2. Auftragsmanagement/Bestellung (Mittelbindung bei<br />
Vertragsschluss)<br />
3. Debitorenprozess<br />
4. Kreditorenprozess – Anbindung der Anlagenbuchhaltung!<br />
5. Übernahme automatisierter Buchungen (Aufwand und<br />
Ertrag)<br />
Der Rechnungsausgangs- bzw. Debitorenprozess ist meist von<br />
einer Vielzahl automatisierter Buchungen geprägt. Dieser ist in<br />
der Software einmalig neu zu hinterlegen und für die Prozessneustrukturierung<br />
unkritisch.<br />
Der Rechnungseingangs- bzw. Kreditorenprozess ist von einer<br />
Vielzahl manueller konsumtiver und investiver Buchungen geprägt.<br />
Hierbei steht die Entscheidung, ob zukünftig zentral oder<br />
dezentral gebucht werden soll, im Vordergrund. Ein zentrales<br />
Rechnungswesen (zentraler Rechnungseingang, zentrales Kontieren)<br />
setzt unter Berücksichtigung höchstmöglicher Effizienz<br />
des Buchens ein weitgehend flächendeckendes Auftragsmanagement<br />
voraus. Mit der Bestellung bzw. Auftragsauslösung<br />
müssen die Angaben über Budget, Produkt und Kostenstelle<br />
erfolgen. Unter Berücksichtigung dieser Angaben ist die Zuordnung<br />
der Rechnungen im Zentralen Rechnungseingang<br />
vorzunehmen. Die Kontierung erfolgt zentral und wird von der<br />
zentralen Geschäftsbuchführung in die dezentralen Einheiten<br />
zur Prüfung und Anordnung verteilt. Eine qualitative Prüfung<br />
der Rechnungen kann im Sinne eines internen Kontrollsystems<br />
(IKS) noch vor den Zahlungsprozess geschaltet werden. Handelt<br />
es sich um investive Buchungen, ist die Anlagenbuchhaltung<br />
frühzeitig in den Prozess zu integrieren. Folgender Prozessablauf<br />
eines zentralen Rechnungseingangs wäre strukturierbar (siehe<br />
Abbildung folgende Seite).<br />
Die Zentralisierung des Rechnungswesens scheitert in den<br />
meisten Kommunen aufgrund der Abstimmungsproblematik<br />
zwischen den Facheinheiten und der zentralen Geschäftsbuchführung,<br />
sowie der Angst vor dem Aufkommen eines erhöhten<br />
Belegflusses. Beide Probleme sind unter Berücksichtigung der<br />
Digitalisierung des Prozesses und der Integration eines flächendeckenden<br />
Auftragsmanagements lösbar.<br />
259
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Prozessgestaltung unter Berücksichtigung der Integration<br />
von Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
Der „digitalisierte Belegfluss“ birgt ein Effizienz- und Optimierungspotenzial.<br />
Die Kostentreiber in einem papiergebundenen<br />
Belegfluss, welche es zu senken gilt, sind schnell umschrieben:<br />
– Organisation für Belegeingang und -ausgang (Arbeitszeit,<br />
Raumkosten, Technikkosten)<br />
– Organisation im Weiterleitungs- und Verteilerprozess (Kosten<br />
für Material, Arbeitszeit)<br />
– Umfang für laufende Recherche (Arbeitszeit für das Verfolgen,<br />
Verwalten, Auffinden)<br />
– Archivorganisation (Arbeitszeit, Technikkosten, Raumkosten<br />
für Kurzzeit-, Zwischenlager- und Langzeitarchiv sowie<br />
diversen Schattenarchiven in den Fachbereichen)<br />
– Rekonstruktion (Kosten durch Verlust oder Veränderung)<br />
– Aktenvernichtung nach Aufbewahrungsfrist (Kosten für<br />
die Vernichtung)<br />
Neben den genannten Kostenvorteilen stehen in der Regel<br />
gleichwertig qualitative Vorteile im Fokus:<br />
– Schnellerer und flexiblerer Zugriff auf Beleg und Inhalt über<br />
verschiedenste Endgeräte, wie PC, Notebook, Smartphone<br />
und dies losgelöst von Ort und Zeit<br />
– Komfortablerer Zugriff über strukturierte Navigation sowie<br />
Freitext-Suchmechanismen<br />
– Paralleler Zugriff von mehreren Anwender<br />
– Verlässlicher Genehmigungsprozess<br />
– Datensicherung schützt vor Verlust und versehentlicher<br />
Veränderung<br />
260<br />
In vielen Fällen liefern diese Vorteile erst die Grundlage für<br />
erweiterte, geschäftsvorfallindividuelle Vorteile. Zum Beispiel<br />
sind regelmäßige Verbesserungen von Einkaufskonditionen<br />
durch einen umfassenden Einblick in die Historie zu Verträgen,<br />
Liefervorgängen, Mängelrügen, Rechnungseingängen, Stornos<br />
und Gutschriften etc. in Vorbereitung zu den jeweiligen Vertragsverhandlungen<br />
mit dem Lieferanten zu erreichen.<br />
Stellt man sich einen zentralen Rechnungseingang mit sofortiger<br />
Digitalisierung der Eingangsbelege vor und verbindet diesen<br />
mit einer qualifizierten Klassifizierung der „gelesenen Daten“<br />
zur Weiterverarbeitung in dem jeweiligen IT-System zum<br />
neuen kommunalen Rechnungswesen (Stammdaten Lieferant,<br />
Bewegungsdaten zum Buchungssatz bezüglich Entstehung der<br />
Verbindlichkeit), sodass die Daten bestenfalls nur noch bestätigt<br />
und nicht mehr erfasst werden müssen, führt das zu erheblichen<br />
Auswirkungen auf die Ressourcenbindung und auf die bisherige<br />
Organisation in der gesamten Verwaltung.<br />
Die Eingangsrechnung muss zum Zeitpunkt des zentralen Digitalisierens<br />
im Idealfall schon mit der Anlage eines Auftrags im<br />
IT-System – also bei Vergabe des Auftrags an den Lieferanten<br />
(flächendeckendes Auftragsmanagement) – in den Stamm- und<br />
Bewegungsdaten (Lieferant, Konditionen, Kostenstelle, Aufwandsart<br />
etc.) bekannt sein.<br />
Die Vorteile eines digitalisierten Kreditorenprozesses umfasst<br />
mehrere Dimensionen:
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Digitalisierung birgt Effizienzsteigerungspotenzial im<br />
Prozessablauf<br />
Ein flächendeckendes Auftragsmanagement würde eine erhöhte<br />
Verlässlichkeit in der Buchung mit sich bringen. Eine<br />
Digitalisierung des Belegflusses schafft zudem Freiraum<br />
durch Wegfall von manuellen Belegtransporten. Die Frage<br />
nach „Wo ist die Rechnung?“ gegenüber den Lieferanten<br />
oder Fachbereichen entfällt.<br />
Digitalisierung schafft Sicherheit mit Blick auf Schulden<br />
und Liquidität<br />
Ein dezentraler sowie überwiegend manueller Eingangsprozess<br />
führt dazu, dass ein Rechnungseingangsbuch,<br />
welches Auskunft über den jeweiligen Stand der Verbindlichkeiten<br />
liefern kann, nicht umsetzbar ist. Gehen<br />
Eingangsrechnungen zentral ein, sind diese auch zentral<br />
und tagesaktuell bekannt. Die Liquiditätsplanung kann<br />
nur bekannte Rechnungen berücksichtigen. Gegebenenfalls<br />
können Skontofristen nicht genutzt werden, weil<br />
der interne Postweg länger dauert als die Frist es zulassen<br />
würde.<br />
Digitalisierung sichert Ordnungsmäßigkeit im Rahmen<br />
der Aufbewahrungspflicht<br />
In vielen Fällen papiergebundener Archive oder Ablagen<br />
werden Doppelstrukturen über ein und denselben Beleg<br />
angefertigt. Eine Kopie liegt im Fachbereich, eine wurde<br />
ggf. von dem internen Dienstleister wie z. B. der Gebäudewirtschaft<br />
gezogen, während das Original an die Kasse<br />
geht. Es besteht hierbei das Risiko, dass Belege verloren<br />
gehen könnten. Niemand ist im Zweifel über den Bearbeitungsstand<br />
auskunftsfähig.<br />
Digitalisierung verändert die Organisation der dezentralen<br />
Bewirtschaftung<br />
–<br />
Würde ein zentraler Rechnungseingang mit einem flächendeckenden<br />
Auftragsmanagement umgesetzt werden,<br />
hätte dies Einfluss auf das Führen von Aufträgen (Erfassen<br />
der Verpflichtung/Mittelbindung, Zuordnung zum<br />
Buchungsgeschäft) im IT-System. Die zentrale Geschäftsbuchhaltung<br />
hätte eine optimale Kommunikations- und<br />
Informationsgrundlage mit den Haushaltsbewirtschaftern.<br />
Eine Zentralisierung der Kontierung der Geschäftsvorfälle<br />
wäre umsetzbar. Dies entlastet die Fachbereiche und schafft<br />
Freiraum für die eigenen Aufgaben.<br />
Organisationsform prägt die Personalentwicklung<br />
Ist dieser Abwägung von potenziellen Organisationsformen<br />
Rechnungen getragen worden, hat die Entscheidung erheblichen<br />
Einfluss auf das Fortbildungskonzept und die damit<br />
verbundenen Schulungskosten. Nicht alle Fachbereiche<br />
müssen so geschult werden, dass sie die Belege ordnungsgemäß<br />
vorkontieren können. Bei einer Zentralisierung<br />
des Rechnungswesens sind die Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter der zentralen Geschäftsbuchführung grundlegend<br />
zu qualifizieren. Die Ausbildung zum Finanz- oder<br />
Bilanzbuchhalter sollte den Anforderungen des Neuen<br />
Kommunalen Haushalt- und Rechnungswesen in adäquater<br />
Weise Rechnung tragen. Die Stellenbeschreibungen sind<br />
entsprechend der neuen Anforderungen zu überarbeiten.<br />
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune,<br />
insbesondere die Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,<br />
welche weiterhin einen Bezug zum Rechnungswesen<br />
haben, sollten flächendeckend geschult werden.<br />
Abschließend ist festzuhalten, dass mit einer vollständigen<br />
Zentralisierung des Rechnungswesens (zentraler Rechnungseingang,<br />
zentrales Kontieren) die Digitalisierung der Prozesse<br />
einen festen notwendigen Bestandteil der Restrukturierung des<br />
Rechnungswesens bildet.<br />
Trotz düsterer Aussichten –<br />
Naturgefahren bleiben weiterhin versicherbar<br />
Die OKV – Ostdeutsche Kommunalversicherung a. G. mit<br />
Sitz in Berlin bietet Versicherungsschutz auch für Schäden<br />
durch Elementarereignisse an. Gerade die jüngst eingetretenen<br />
Wetterkapriolen haben wieder gezeigt, dass die Absicherung von<br />
Schäden durch Elementarereignisse immer wichtiger wird.<br />
Diese Entwicklung haben wir als Versicherer erkannt und<br />
entsprechend reagiert. Sämtlichen Mitgliedern, welche eine<br />
bestehende Gebäudeversicherung haben, wurde der erweiterte<br />
Versicherungsschutz für die Absicherung von Elementarschäden<br />
angeboten.<br />
Jürgen Meier, Norman Wajand<br />
Ostdeutsche Kommunalversicherung a. G.<br />
Die Elementarschadenversicherung ist ein Sammelbegriff für<br />
die Versicherung gegen Folgen von Naturereignissen. 1 In der<br />
jüngsten Vergangenheit ist eine deutliche Zunahme von Naturereignissen<br />
(Tornado, Starkregen/Hochwasser, Sturm/Hagel),<br />
insbesondere auch in Sachsen, zu beobachten. In Deutschland<br />
muss man sich in den kommenden Jahrzehnten auf immer<br />
häufiger und heftiger auftretende Wetterextreme einstellen – das<br />
ist das Ergebnis einer Klimastudie, die der Gesamtverband der<br />
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit führenden Klimaforschern<br />
des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung,<br />
der Freien Universität Berlin und der Universität Köln aktuell<br />
1 Versicherungsalphabet Frank v. Fürstenwerth, Alfons Weiß<br />
261
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
erstellte. 2 Ausgewählte Ergebnisse werden wir im Folgenden<br />
darstellen.<br />
Ein Wandel im Risikobewusstsein der Gebäudeeigentümer<br />
ist dringend notwendig. Eine Vielzahl von Ereignissen der<br />
jüngsten Vergangenheit machen bereits jetzt das mögliche<br />
Ausmaß deutlich. Neben den baulichen und organisatorischen<br />
Schutzmaßnahmen ist es auch erforderlich, das eigene Versicherungskonzept<br />
optimal zu gestalten. Um sich umfassend gegen<br />
Schäden durch Naturkatastrophen abzusichern, sollten die<br />
betreffenden Objekte nicht nur gegen Feuer- sowie Sturm- und<br />
Hagelereignisse, sondern auch gegen die sogenannten „sonstigen<br />
Elementarschadenereignisse“ versichert werden.<br />
Formen von Elementarschäden<br />
– Sturm, Hagel – durch Kyrill 2007 in ganz Deutschland<br />
bekannt.<br />
– Überschwemmung, Starkregen und Rückstau<br />
Die Hälfte aller Überschwemmungsschäden wird derzeit<br />
durch Starkregen verursacht. Mangelndes Risikobewusstsein<br />
in Gebieten abseits großer Gewässer führt immer<br />
wieder zu großen finanziellen Schäden.<br />
– Erdbeben<br />
Erdbeben treten vor allem in der nord-süd-gerichteten<br />
Störungszone Leipzig-Regensburg in Sachsen auf.<br />
– Erdsenkung (Erdfall), Erdrutsch<br />
Auch in Thüringen (Schmalkalden) wurde in jüngerer<br />
Vergangenheit ein derartiges Naturereignis registriert.<br />
– Schneedruck, Lawinen<br />
Schon geringe Schneehöhen auf Hausdächern verursachen<br />
eine Last, die gerade beim Zusammentreffen mit Niederschlag<br />
aufgrund von Tauwetter zum Einsturz des Dachs<br />
führen kann.<br />
– Vulkanausbruch<br />
Bei einem Vulkanausbruch wäre auch ein Schaden durch<br />
eine Aschewolke möglich.<br />
Aktuelle Szenarien der jüngsten Vergangenheit in Sachsen<br />
– Pressemitteilungen<br />
Der Tornado „Zaza“ am 25.05.2010<br />
„Wirbelsturm zieht lange Spur der Verwüstung<br />
… Zahlreiche Gebäude in der Region wurden zerstört<br />
oder sind einsturzgefährdet. … Das schwere Unwetter in<br />
Sachsen hat auch große Schäden … angerichtet. … Überschwemmungen<br />
drohten insbesondere dort, wo auch die<br />
Deiche beschädigt seien.“ 3<br />
„3000 Gebäude von Tornado beschädigt<br />
Aufräumarbeiten in Großenhain<br />
Der Tornado vom Pfingstmontag hat in Großenhain weit<br />
mehr als 3000 Gebäude und Objekte beschädigt. Oberbür-<br />
2 Pressemitteilung des GDV vom 24.05.<strong>2011</strong><br />
3 Freie Presse vom 27.05.2010<br />
262<br />
germeister Burkhard Müller (CDU) schätzte gestern die<br />
Summe der Schäden auf mindestens acht Millionen Euro.<br />
… Die Aufräumarbeiten würden noch Tage und Wochen<br />
in Anspruch nehmen, hieß es.“ 4<br />
August-Hochwasser 2010<br />
„Sachsen versinkt in den Fluten<br />
Acht Jahre nach dem Jahrhundert-Hochwasser 2002<br />
sind am Wochenende die südlichen Ortsteile der Stadt<br />
Chemnitz und einige angrenzende Gemeinden von einer<br />
vergleichbar schweren Naturkatastrophe heimgesucht<br />
worden. Nachdem rund um Chemnitz innerhalb von 24<br />
Stunden rund 84 Liter Regen pro Quadratmeter fielen,<br />
verwandelten sich die Würschnitz, die Zwönitz und die<br />
Chemnitz in reißende Flüsse. Innerhalb kürzester Zeit<br />
musste Katastrophenalarm ausgerufen werden. …<br />
Land unter in Ostsachsen<br />
Gestern verlagerte sich der Hochwasserschwerpunkt nach<br />
Ostsachsen. Besonders hart betroffen war die Region entlang<br />
der polnischen Grenze. Allein im Landkreis Görlitz<br />
mussten mehr als 1400 Menschen ihre Häuser verlassen,<br />
um in Sicherheit gebracht zu werden. … Der Pegel der<br />
Neiße war gestern auf mehr als sieben Meter gestiegen und<br />
damit über die bisherige Höchstmarke von 6,71 Metern<br />
geklettert; normal sind 1,70 Meter.<br />
…<br />
Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wütete<br />
das Hochwasser insbesondere im Kirnitzschtal und in der<br />
Innenstadt von Sebnitz, die unpassierbar war. Straßen und<br />
Brücken sind schwer beschädigt worden. In Königstein<br />
hatte es einen Erdrutsch gegeben, und 19 Menschen<br />
mussten aus drei Häusern gerettet werden.“ 5<br />
„… Zur Schadensbilanz gibt es seit dem 25. August – gut<br />
zwei Wochen nach dem Hochwasser – eine erste vorläufige<br />
und noch sehr ungenaue Zahl: ca. 800 Millionen Euro.<br />
Diese grobe Schätzung betrifft die Schäden von privaten<br />
Hauseigentümern, freien Trägern, Vereinen, Unternehmen<br />
und an öffentlichem Eigentum der Gemeinden, der<br />
Landkreise, des Freistaates und des Bundes.“ 6<br />
Meldungen über örtlich begrenzte Überschwemmungen durch<br />
lokalen Starkregenniederschlag können derzeit täglich der Presse<br />
entnommen werden – gerade in Gebieten, die weitab von größeren<br />
Flüssen liegen.<br />
Die nachfolgende aus der bereits oben erwähnten Klimastudie<br />
des GDV entnommene Grafik macht ebenfalls noch einmal<br />
deutlich, wie groß das Schadenausmaß einzelner Naturgewalten<br />
in Deutschland bereits war:<br />
4 Freie Presse vom 28.05.2010<br />
5 Freie Presse vom 09.08.2010<br />
6 Regierungserklärung des sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw<br />
Tillich zum Augusthochwasser 2010, Sächsischer Landtag,<br />
1. September 2010
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
Die Klimastudie präsentiert aber auch weitere Ergebnisse über<br />
die Zunahme von Wetterextremen in der Zukunft.<br />
7 Herausforderung Klimawandel – Antworten und Forderungen<br />
der deutschen Versicherer (GDV) – Stand 24. Mai <strong>2011</strong>, URL:<br />
http://www.gdv.de/<strong>Download</strong>s/Sonderseiten/Klimakonferenz_<strong>2011</strong>_Presse_Grafik4_Naturgewalten_in_Deutschland.jpg<br />
(<strong>Download</strong>: 30.05.<strong>2011</strong>)<br />
9<br />
7<br />
Hier wird prognostiziert, dass die Sturmschäden bis zum<br />
Jahr 2100 um mehr als 50 Prozent zunehmen. Auffallend ist<br />
dabei, dass vor allem die Sommermonate schadenträchtiger und<br />
damit auch teurer werden können. Einzelne, extreme Unwetter<br />
werden in Zukunft öfter auftreten und deutlich größere Schäden<br />
an Gebäuden verursachen als heute. Ein besonders schadenträchtiges<br />
Sturmereignis von einer Intensität, wie wir es heute alle<br />
50 Jahre erleben, kann zukünftig alle 10 Jahre eintreten. 89<br />
Bei den Untersuchungen der Überschwemmungen kam es<br />
ebenfalls zu deutlichen Erkenntnissen. Dabei lassen sich klare<br />
Tendenzen ablesen. Die Wiederkehrintervalle der Hochwasser,<br />
wie wir sie zwischen 1971 und 2000 alle 50 Jahre erlebten,<br />
werden in allen Szenarien kleiner. Das heißt, es ist in Zukunft<br />
davon auszugehen, dass in Deutschland Hochwasser und Überschwemmung<br />
häufiger werden. Die Zahl der Schäden durch<br />
Flussüberschwemmungen und Sturzfluten werden bis zum Ende<br />
des Jahrhunderts wahrscheinlich auf mehr als das Doppelte der<br />
heutigen Schäden steigen, auch eine Verdreifachung ist möglich.<br />
Das ergab eine Untersuchung zur Pegelentwicklung der 5 größten<br />
Flüsse in Deutschland. 10<br />
8 Herausforderung Klimawandel – Antworten und Forderungen<br />
der deutschen Versicherer (GDV) – Stand 24. Mai <strong>2011</strong><br />
9 Quelle: Herausforderung Klimawandel – Antworten und Forderungen<br />
der deutschen Versicherer (GDV) – Stand 24. Mai <strong>2011</strong>,<br />
URL: http://www.gv.de/<strong>Download</strong>s/Sonderseiten/Klimakonferenz_<strong>2011</strong>_Presse_Grafik3_Winterstuerme_werden_heftiger.jpg<br />
(<strong>Download</strong>: 30.05.<strong>2011</strong>)<br />
10 Herausforderung Klimawandel – Antworten und Forderungen<br />
der deutschen Versicherer (GDV) – Stand 24. Mai <strong>2011</strong><br />
263
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
264<br />
12<br />
11<br />
1112<br />
Überschwemmungen treten aber nicht nur entlang von Flüssen<br />
auf. Das regelmäßige Auftreten von intensivem Starkregen<br />
verursacht immer wieder, auch weitab von Gewässern, erhebliche<br />
Schäden. Betroffen sind somit auch Regionen, die nicht<br />
in unmittelbarer Nähe von Flüssen und sonstigen Gewässern<br />
liegen.<br />
11 Herausforderung Klimawandel – Antworten und Forderungen<br />
der deutschen Versicherer (GDV) – Stand 24. Mai <strong>2011</strong>; URL:<br />
http://www.gdv.de/<strong>Download</strong>s/Sonderseiten/Klimakonferenz_<br />
<strong>2011</strong>_Presse_Grafik1_Pegelentwicklung_groesste_Fluesse.jpg<br />
(<strong>Download</strong>: 30.05.<strong>2011</strong>)<br />
12 Herausforderung Klimawandel – Antworten und Forderungen<br />
der deutschen Versicherer (GDV) – Stand 24. Mai <strong>2011</strong>
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
Risikobewertung und -einschätzung nicht nur für die<br />
Versicherer<br />
Um Elementarschadenereignisse auch zukünftig versichern zu<br />
können, ist eine entsprechende Prüfung im Vorfeld vorzunehmen.<br />
Die Risikoprüfung umfasst dabei alle Maßnahmen des jeweiligen<br />
Versicherers zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen<br />
sowie zu welchen Beiträgen ein Risiko versicherbar ist.<br />
Im Wesentlichen erfolgt das auf Grundlage der Angaben des<br />
Versicherungsnehmers zu den örtlichen Gegebenheiten, Risikoverhältnissen<br />
und getroffenen Sicherungsmaßnahmen.<br />
Zunehmend werden aber auch unabhängige Risikostatistiken<br />
herangezogen, die die regionale Unterscheidung im Zusammenhang<br />
mit der Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmter Ereignisse<br />
ermöglicht. Das kann die Einteilung in Sturmzonen oder auch<br />
das vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft<br />
weiterentwickelte Zonierungssystem für Überschwemmung- und<br />
Rückstauschäden (ZÜRS Geo) sein, auf welches im Nachfolgenden<br />
näher eingegangen wird.<br />
Das GDV-Zonierungssystem ZÜRS Geo – Was ist das?<br />
ZÜRS steht für (Z)onierungssystem für (Ü)berschwemmung,<br />
(R)ückstau und (S)tarkregen. ZÜRS Geo ist ein Onlinesystem<br />
im Sachversicherungsbereich, um das Überschwemmungsrisiko<br />
besser einschätzen zu können. Dabei ist es möglich, einen Risikostandort<br />
besser zur verorten und zur Risikoeinschätzung Luftbilder<br />
sowie topografische Karten hinzuziehen. Anhand der Postadresse<br />
wird eine Zonierung in Gefährdungsklassen (1–4) vorgenommen.<br />
13 Weiterhin ist über das ZÜRS Geo-Tool auch eine Abfrage<br />
des Umgebungsrisikos für den Umwelthaftpflichtbereich möglich.<br />
13 Kurzerläuterung ZÜRS Geo 2009 – Stand 27.11.2009 – Verfasser<br />
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)<br />
Unterscheidung in Gefährdungsklassen nach ZÜRS<br />
Geo – Möglichkeiten der Hochwasseranalyse<br />
Der GDV hat für die gesamte Versicherungswirtschaft ein Zonierungssystem<br />
für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen<br />
(ZÜRS) entwickelt. Dafür wurden Hochwasserereignisse mit<br />
aufsteigenden Wiederkehrperioden (Jährlichkeiten) simuliert<br />
und es wurden vier Gefährdungsklassen (GK) ermittelt:<br />
GK 4: hohe Gefährdung – Statistische Wahrscheinlichkeit eines<br />
Hochwasser mind. einmal in 10 Jahren<br />
GK 3: mittlere Gefährdung – Statistische Wahrscheinlichkeit eines<br />
Hochwasser einmal in 10 – 0 Jahren<br />
GK 2: geringe Gefährdung – Statistische Wahrscheinlichkeit eines<br />
Hochwasser einmal in 0 – 200 Jahren<br />
GK 1: sehr geringe Gefährdung – Statistische Wahrscheinlichkeit<br />
eines Hochwassers einmal in 200 Jahren oder mehr<br />
ZÜRS Geo ermöglicht damit für alle in Deutschland gelegenen<br />
Flächen eine präzise Risikoeinstufung im Bereich<br />
Hochwasser/Überschwemmung.<br />
Zukünftige Einführung des ZÜRS Public<br />
Damit auch die breite Öffentlichkeit Zugang zu den ZÜRS-Daten<br />
erhält, plant die Versicherungswirtschaft mit der öffentlichen<br />
Hand ZÜRS Public einzuführen. Mit Hilfe von ZÜRS Public<br />
können sich dann interessierte Bürger, Behörden und Unternehmen<br />
künftig darüber informieren, welche Gebiete besonders<br />
14 GDV-Internetseite: http://www.gdv.de/Themen/Schadensverhuetung/NaturgewaltenElementarschaeden/inhaltsseite22828.<br />
html (<strong>Download</strong>: 30.05.<strong>2011</strong>)<br />
14<br />
265
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
hochwassergefährdet sind. 15 Somit kann beispielsweise vermieden<br />
werden, dass in hochwassergefährdeten Gebieten weitere (Neu-)<br />
Baugenehmigungen erteilt werden.<br />
Möglichkeiten der Versicherung gegen Elementarschäden<br />
Bereits in der Bauphase während der Errichtung von Bauwerken<br />
oder Anlagen sind diese sämtlichen Naturgefahren ausgesetzt.<br />
Bei einigen Sparten, wie z. B. Bauleitungsversicherung oder<br />
Maschinen- und Elektronikversicherung, handelt es sich um<br />
die sog. Allgefahrenversicherung, welche zum Teil auch Schäden<br />
durch Naturereignisse mitversichert. Zum Inhalt und Umfang<br />
werden entsprechende Beratungen angeboten.<br />
Für fertiggestellte Bauten wird in der Regel über eine Gebäude-<br />
und Inventarversicherung bereits in der Grunddeckung Versicherungsschutz<br />
gegen Sturm- und Hagelschäden sichergestellt.<br />
Neben den direkten Schäden durch Sturm oder Hagel sind<br />
auch Folgeschäden (Eindringen von Regenwasser, Gebäudebeschädigungen<br />
durch umstürzende Bäume) versichert. Diese<br />
Deckung hat sich am Markt bereits durchgesetzt, sodass für<br />
Gebäude- und Inventarbeschädigungen, die durch die Naturelemente<br />
Sturm und Hagel verursacht werden, häufig bereits<br />
Versicherungsschutz besteht. Die Ergänzung einer bestehenden<br />
Sturm- und Hagelversicherung durch Abschluss einer Zusatzversicherung<br />
gegen weitere Elementarschäden wurde bis vor<br />
einigen Monaten noch weit weniger in Anspruch genommen.<br />
Lediglich ca. 24 % aller Gebäude sind in Deutschland gegen die<br />
erweiterten Elementarschäden versichert. 16 Die Unterschiede<br />
sind jedoch regional erheblich. Im Süden Deutschlands sind die<br />
Gebietskörperschaften – trotz vergleichbarer Risikolage – fast<br />
umfänglich gegen erweiterte Elementarschäden bereits historisch<br />
versichert. Der Bedarf wird trotz knapper Haushaltskassen<br />
nicht in Frage gestellt. In den anderen Bundesgebieten wird<br />
nun versucht, Aufklärung für die notwendige Risikovorsorge<br />
zu betreiben. So nun auch in Sachsen. Im Rahmen von zwei<br />
Versicherungsgipfeln in Sachsen zum Thema Eigenvorsorge<br />
von Schäden durch Elementarereignisse wurden folgende<br />
Feststellungen durch den Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich<br />
getroffen 17 :<br />
–<br />
–<br />
An erster Stelle steht Eigenvorsorge, nicht die Frage nach<br />
staatlicher Hilfe.<br />
Wer ein Haus baut oder ein Unternehmen gründet, muss<br />
auch für Schadensfälle Vorsorge treffen. Angesichts sich<br />
15 Herausforderung Klimawandel – Antworten und Forderungen<br />
der deutschen Versicherer (GDV) – Stand 24. Mai <strong>2011</strong><br />
16 Herausforderung Klimawandel – Antworten und Forderungen<br />
der deutschen Versicherer (GDV) – Stand 24. Mai <strong>2011</strong><br />
17 inhaltlich der Regierungserklärung des sächsischen Ministerpräsidenten<br />
Stanislaw Tillich zum Augusthochwasser 2010, Sächsischer<br />
Landtag, 1. September 2010 entnommen<br />
266<br />
–<br />
–<br />
Fazit<br />
häufender extremer Wetterereignisse kann es jeden treffen.<br />
Überschwemmungen und Starkregen sind Risiken, gegen<br />
die man sich in der Regel versichern kann. Die Kosten einer<br />
solchen Versicherung sind im Verhältnis zum Anschaffungspreis<br />
eines Hauses gering. Sie sind auch bei Objekten<br />
in exponierter Lage möglich und bezahlbar. Dies gilt auch<br />
für die Kommunen.<br />
Keine Versicherung für öffentliches Eigentum abzuschließen,<br />
ist nahezu unverantwortlich, wenn die Gemeinde nicht in der<br />
Lage ist, den entstandenen Schaden selbst zu schultern.<br />
Die generelle Bewertung des Klimawandels in Deutschland auf<br />
Grundlage der Veröffentlichung des GDV „Herausforderung<br />
Klimawandel – Antworten und Forderungen der deutschen<br />
Versicherer“ macht deutlich, dass die allgemeine Annahme, dass<br />
die Intensität und Häufigkeit von Unwetterereignissen zunimmt,<br />
in großen Teilen bestätigt werden kann und in Zukunft weiter<br />
an Bedeutung gewinnen wird.<br />
Auch wenn die wissenschaftlich ermittelten Ergebnisse mit Unsicherheiten<br />
behaftet sind, haben sich alle Beteiligten in den kommenden<br />
Jahrzehnten auf immer häufiger und heftiger auftretende<br />
Wetterextreme einzustellen. Um dieser Herausforderung gerecht<br />
zu werden, ist es erforderlich, alle technischen und organisatorischen<br />
Maßnahmen zur Risikoprävention wahrzunehmen, um<br />
das Ausmaß möglicher Schadenszenarien einzugrenzen. Nicht<br />
nur für den Gebäude- und Inventarbestand der Kommunen<br />
besteht die Möglichkeit, ergänzende Elementarschadenversicherungen<br />
abzuschließen – hierzu bietet Ihnen die OKV als reiner<br />
Kommunalversicherer mit seinem hier spezialisierten Knowhow<br />
eine umfassende Beratung. Hierbei ist hervorzuheben,<br />
dass Versicherungsschutz für sämtliche Gebäude unabhängig<br />
von der Einstufung in die Gefahrenklassen GK 1–4 angeboten<br />
werden kann. Das macht das Schadenrisiko für die Kommune<br />
kalkulierbar. Weiterhin bieten die Versicherer Zugang zu verschiedenen<br />
Alarmierungssystemen, um den Verantwortlichen<br />
in den Kommunen unverzüglich Unwetterwarnungen bereitzustellen.<br />
Auch eine Beratung zu Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
oder Bereitstellung von Daten aus Informationssystemen der<br />
Versicherer (ZÜRS Geo) sind möglich.<br />
Der Abschluss einer umfassenden Elementarschadenversicherung<br />
wird wie die Feuerversicherung zu einem wichtigen Baustein bei<br />
der Bewältigung von Elementarschadenereignissen.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
Langzeitspeicherung und elektronische<br />
Archivierung im Freistaat Sachsen<br />
Im Freistaat Sachsen sind IT-gestützte Vorgangsbearbeitung<br />
und elektronische Aktenführung integraler Bestandteil von<br />
E-Government und stellen ein wesentliches Element der Verwaltungsmodernisierung<br />
dar. 1 Die funktionelle Ausgestaltung<br />
elektronischer Bearbeitung und Aktenführung ist jedoch nicht<br />
zu trennen von der Problematik der künftigen Langzeitspeicherung<br />
und elektronischen Archivierung. Der Langzeitspeicherung<br />
und elektronischen Archivierung von Unterlagen kommt hier<br />
eine Schlüsselrolle zu, da nur durch die revisionssichere Aufbewahrung<br />
elektronischer Unterlagen die Vollständigkeit und<br />
Rechtskonformität mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand<br />
gewährleistet werden kann. Langzeitspeicherung und elektronische<br />
Archivierung sind damit eine wesentliche Voraussetzung<br />
dafür, dass die Ziele der E-Government-Strategie der Sächsischen<br />
Staatsverwaltung erreicht werden können.<br />
Mit Beschluss des Kabinetts vom 30. September 2008 wurde daher<br />
dem Sächsischen Staatsministerium des Innern der Auftrag erteilt,<br />
einen Langzeitspeicher und ein elektronisches Archiv nach den<br />
archivfachlichen Vorgaben des Sächsischen Staatsarchivs im Staatsbetrieb<br />
Sächsische Informatik Dienste technisch umzusetzen. Im<br />
Rahmen der Umressortierung der Abteilung „Verwaltungsmodernisierung<br />
und Informationstechnologie in der Staatsverwaltung“<br />
im Zuge der Landtagswahl im Jahr 2009 ist für die Umsetzung<br />
des Kabinettsbeschlusses nun das Sächsische Staatsministeriums<br />
der Justiz und für Europa verantwortlich.<br />
Zur Realisierung eines landesweit einheitlichen Systems zur<br />
Langzeitspeicherung und elektronischen Archivierung wurde<br />
das ressortübergreifende Projekt „Langzeitspeicherung und<br />
elektronische Archivierung“ (LeA) definiert. 2 Ziel des Projekts<br />
ist es, bis Ende 2012 ein verfahrensunabhängiges System zur<br />
Langzeitspeicherung und elektronischen Archivierung von<br />
elektronischen Unterlagen als zentrale landeseinheitliche Infrastrukturkomponente<br />
zu realisieren. Als Teilprojekt des Vorhabens<br />
ITgVB gliedert sich das Projekt LeA damit in die E-Government-<br />
Strategie des Freistaates ein.<br />
1 Siehe www.egovernment.sachsen.de/37.htm und www.egovernment.sachsen.de/89.htm<br />
(Abrufdatum jeweils: 3. Juni <strong>2011</strong>).<br />
2 Vgl. Huth, Karsten/Nolte, Burkhard: LeA: Langzeitspeicherung<br />
und elektronische Archivierung im Freistaat Sachsen – Ausgangslage<br />
und aktueller Sachstand, in: Generaldirektion der Staatlichen<br />
Archive Bayerns (Hg.): Neue Entwicklungen und Erfahrungen im<br />
Bereich der digitalen Archivierung: Von der Behördenberatung<br />
zum Digitalen Archiv. 14. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung<br />
von Unterlagen aus digitalen Systemen“ vom 1. – 2. März 2010<br />
in München, München 2010, S. 48-54, bes. S. 48-51; Nolte,<br />
Burkhard: Projekt „Langzeitspeicherung und elektronische Archivierung“<br />
(LeA) gestartet, in: Sächsisches Archivblatt 1/2010,<br />
S. 5 f. Weiterführende Informationen sind auch unter www.archiv.<br />
sachsen.de/6265.htm abrufbar (Abrufdatum: 3. Juni <strong>2011</strong>).<br />
Dr. Burkhard Nolte<br />
Sächsisches Staatsarchiv<br />
Um die komplexe Aufgabenstellung effizient zu erledigen, gliedert<br />
das Projekt sich in einen Lenkungsausschuss mit je einem<br />
Vertreter des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für<br />
Europa, des Sächsischen Staatsarchivs und des Staatsbetriebs<br />
Sächsische Informatik Dienste, die Gesamtprojektleitung, die<br />
dem Sächsischen Staatsarchiv übertragen wurde, und die Teilprojekte<br />
„Langzeitspeicherung“ unter Leitung des Sächsischen<br />
Staatsministeriums der Justiz und für Europa, „Elektronische<br />
Archivierung“ unter Vorsitz des Sächsischen Staatsarchivs und<br />
„Informationstechnik“ unter Federführung des Staatsbetriebs<br />
Sächsische Informatik Dienste (vgl. Abb. 1):<br />
Teilprojektteam<br />
Langzeitspeicherung<br />
(SMJus)<br />
Abb. 1: Projektstruktur LeA<br />
Lenkungsausschuss<br />
(SMJus, SID, StA)<br />
Projektleitung<br />
(StA)<br />
Teilprojektteam<br />
Elektr. Archivierung<br />
(StA)<br />
Projektcontrolling<br />
(IMTB)<br />
Teilprojektteam<br />
Informationstechnik<br />
(SID)<br />
Elektronische Archivierung ist eine vielschichtige Tätigkeit.<br />
Sie geht über das reine Speichern von Daten hinaus. Das Ziel<br />
der elektronischen Archivierung ist die authentische Erhaltung<br />
elektronisch gespeicherter Information. Um dieses Ziel zu erreichen,<br />
müssen die archivierten Informationen jederzeit lesbar<br />
dargestellt werden. Dies gelingt nur, wenn die entsprechenden<br />
Informationen durch ein korrektes Zusammenspiel von Hardware<br />
und Software lesbar dargestellt werden.<br />
267
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Das elektronische Archiv dient im Rahmen des gesetzlichen<br />
Auftrages des Sächsischen Staatsarchivs zur dauerhaften Aufbewahrung<br />
elektronischer Unterlagen, denen ein bleibender Wert<br />
zukommt. Bei der Auswahl der archivwürdigen Unterlagen<br />
ist auch eine Entscheidung darüber zu treffen, ob und wenn<br />
ja, welche Funktionalitäten der elektronischen Unterlagen im<br />
Einzelfall erhalten werden sollen und können. Dem elektronischen<br />
Archiv kommt deshalb die Aufgabe zu, archivwürdige<br />
elektronische Unterlagen aus dem Langzeitspeicher, Daten aus<br />
Fachverfahren, Websites der Domäne „sachsen.de“ und nicht<br />
zuletzt auch digitale audiovisuelle Objekte zu übernehmen, das<br />
elektronische Archivgut für unbegrenzte Zeit in einer jederzeit<br />
lesbaren Form zu speichern und eine Plattform für die notwen-<br />
digen Erhaltungsmaßnahmen sowie für die Erschließung und<br />
Nutzung bereitzustellen.<br />
Mit dem Start dieses Projekts konnte nunmehr ein großer<br />
Schritt in Richtung Erhaltung des digitalen Erbes gemacht<br />
werden. Die Ausschreibung des elektronischen Archivs hat<br />
bereits begonnen und das vom Teilprojekt Langzeitspeicherung<br />
erstellte Fach- und Organisationskonzept liegt dem<br />
Lenkungsausschuss zur Abnahme vor. Nach Abschluss der Verfahrensrealisierung<br />
wird mit der Implementierung begonnen,<br />
die sich bis 2012 hinziehen wird. Dann kann ein System zur<br />
Langzeitspeicherung und ein elektronisches Archiv in Betrieb<br />
genommen werden.<br />
„Vom Prozessregister zur Prozessplattform“ –<br />
Der Freistaat Sachsen setzt<br />
bei der Staatsmodernisierung<br />
auf modernes Prozessmanagement<br />
und innovative IT-Unterstützung<br />
Manuela Böttger-Beer, Ralf Pietsch<br />
Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa<br />
Ende 2009 hat der Freistaat Sachsen die EU-Dienstleistungsrichtlinie<br />
umgesetzt. Bei der technischen Umsetzung standen<br />
von Beginn an die Nachnutzbarkeit der Systeme und der Inhalte<br />
über den Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie hinaus im<br />
Fokus der Entwicklungen. Aus welchem Grund? War bei der<br />
EU-Dienstleistungsrichtlinie der Handlungsrahmen noch sehr<br />
eng abgesteckt, stellen sich für die Zukunft des Freistaates und<br />
dessen Verwaltung Herausforderungen in deutlich weiteren<br />
Dimensionen.<br />
Aufgrund sinkender Einnahmen und zurückgehender Bevölkerung<br />
bleibt die Modernisierung der Verwaltung eine der<br />
vordringlichsten Aufgaben. Der Veränderungsdruck ist enorm.<br />
Um die Handlungsfähigkeit in der Verwaltung weiterhin zu<br />
gewährleisten, müssen Aufgaben fortlaufend kritisch hinterfragt<br />
werden. Wesentlich für die Aufgabenkritik ist es, Verwaltungsabläufe<br />
an die personellen Ressourcen anzupassen und unter<br />
Nutzung der Möglichkeiten moderner Informationstechnologie<br />
optimal zu gestalten.<br />
Was in der Wirtschaft vielfach bewiesen wurde, muss auch in der<br />
öffentlichen Verwaltung im Freistaat Sachsen funktionieren: Mit<br />
modernem Prozessmanagement ist es möglich, deutliche Effizienzgewinne<br />
zu erzielen. Die angestrebten Effekte sind vielfältig.<br />
Neben der Einsparung von Kosten und dem Bewältigen der<br />
notwendigen Aufgaben mit dem verfügbaren Personal muss die<br />
Optimierung von Verwaltungsprozessen zum Bürokratieabbau<br />
und einer verstärkten Bürgerorientierung beitragen. Zugleich<br />
soll Transparenz und Wissensbewahrung sowie eine verbesserte<br />
Führungsunterstützung und Zielsteuerung erreicht werden.<br />
268<br />
Modernes Prozessmanagement äußert sich u. a. in der Tatsache,<br />
dass sich Verwaltungsprozesse an den zu erreichenden Ergebnissen<br />
orientieren. Die Erkenntnis, dass nicht mehr Zuständigkeiten<br />
und hierarchische Entscheidungsstrukturen die Basis für erfolgreiches<br />
Verwaltungshandeln sind, erfordert ein radikales Umdenken<br />
der Handelnden. Die Leistung an der jeweiligen Zielgruppe<br />
auszurichten, ist dabei eine der Grundideen. Qualitätskriterien<br />
für die Zielgruppen – und das sind in erster Linie Bürger und<br />
Unternehmen – sind sog. harte Faktoren wie Durchlauf-, Liege-<br />
und Wartezeiten, Bearbeitungsgebühren usw. sowie sog. weiche<br />
Faktoren wie die Verständlichkeit von Rechtsgrundlagen oder die<br />
Einfachheit von Genehmigungsverfahren. Um hier zu konkreten<br />
Verbesserungen zu kommen, ist es erforderlich, die Ist-Situation<br />
genau zu erheben und zu dokumentieren. Erst in einem effektiv<br />
dokumentierten Ist-Prozess lassen sich Optimierungspotenziale<br />
erkennen und geeignete Veränderungen ableiten.<br />
Das Staatsministerium der Justiz und für Europa hat die Zeit<br />
nach der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie intensiv<br />
genutzt, um das Thema Prozessmanagement im Freistaat Sachsen<br />
schrittweise zu etablieren und damit die Modernisierung<br />
voranzutreiben. So sind die Rahmenbedingungen für Prozessmanagement<br />
geschaffen und Standards festgelegt worden, um die<br />
staatlichen Behörden und die Kommunen bei der Einführung<br />
von Prozessmanagement unterstützen zu können.<br />
Insbesondere die neuen Möglichkeiten der Informationstechnologie<br />
sind Treiber des Prozessmanagements in Sachsen.<br />
Mit den E-Government-Basiskomponenten und weiteren<br />
Komponenten stellt der Freistaat leistungsfähige Systeme zur
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
Verfügung, an deren Verbesserung stetig gearbeitet wird. Die<br />
D115-Erweiterungen des Amt24 und die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung<br />
sind nur zwei Beispiele dafür. Beim Schaffen<br />
der technischen Vorraussetzungen für Prozessmanagement wird,<br />
wie eingangs erwähnt, auf Erfahrungen aus der Umsetzung der<br />
EU-Dienstleistungsrichtlinie zurückgegriffen. Die Verfahrensvereinfachung<br />
und die Vereinfachung der Kommunikation<br />
für den Dienstleistungserbringer z. B. über den Einheitlichen<br />
Ansprechpartner hatte zum Ziel, bundes- und EU-weit schnell<br />
und ohne erhöhten bürokratischen Aufwand Dienstleistungen<br />
anbieten zu können.<br />
Das bisher für die Modellierung von für die Umsetzung der EU-<br />
Dienstleistungsrichtlinie relevanten Prozessen genutzte Prozessregister<br />
wird nun zur Prozessplattform ausgebaut. So kann eine<br />
zentrale und standardisierte Form der Prozessdokumentation<br />
erreicht werden. Die Prozessplattform besteht künftig aus dem<br />
zentralen Prozessregister zur Bereitstellung von Verfahrensinformationen<br />
sowohl staatlicher Stellen als auch kommunaler Behörden.<br />
Darüber hinaus stehen dezentrale Modellierungstools zur<br />
Verfügung, die jede Behörde eigenverantwortlich zur Erhebung,<br />
Modellierung und Optimierung eigener Prozesse nutzen kann.<br />
Damit kann die Prozessplattform nicht nur als Informationsplattform,<br />
sondern auch als Werkzeug zur Prozessoptimierung<br />
verwendet werden.<br />
Hierbei kann sowohl technisch als auch inhaltlich auf den<br />
Arbeiten im Rahmen der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie<br />
aufgebaut werden. Im zentralen Prozessregister Sachsen<br />
sind derzeit alle EU-DLR-relevanten Verwaltungsverfahren mit<br />
Hilfe von „Steckbriefen“ dokumentiert. Zu jedem dieser Verwaltungsverfahren<br />
existiert ein Referenzprozess, den die jeweilige<br />
zuständige Behörde auf die konkreten Gegebenheiten anpassen<br />
kann. Für diese so genannte Lokalisierung von Referenzprozessen<br />
besitzt jede für einen EU-DLR-relevanten Prozess zuständige<br />
Behörde einen Online-Zugriff und kann so die den Prozess<br />
beschreibenden Attribute jederzeit aktualisieren. Außerdem<br />
kann jede Behörde in Sachsen das Prozessregister nutzen, um<br />
Informationen über die darin gespeicherten Prozesse zu erlangen.<br />
So ist z. B. jede Kommune in der Lage, Bürgern detaillierte<br />
Auskunft über Verwaltungsverfahren zu geben.<br />
Ziel ist es, auch den inhaltlichen Ausbau des Prozessregisters voranzutreiben.<br />
So soll die Verwendung des Prozessregisters künftig<br />
nicht auf die Verwaltungsverfahren im Umfeld der EU-Dienstleistungsrichtlinie<br />
eingeschränkt bleiben. Um diese inhaltliche<br />
Erweiterung realisieren zu können, und zugleich dem Prinzip<br />
der kommunalen Selbstverwaltung und dem Ressortprinzip<br />
zu entsprechen, werden derzeit einige technische Neuerungen<br />
realisiert. So ergänzen die Modellierungstools das zentrale Prozessregister<br />
zur Prozessplattform Sachsen. Mit einer Instanz des<br />
Modellierungstools hat jede Behörde und jede Kommune die<br />
Möglichkeit, interne und externe Prozesse ihres Verantwortungsbereiches<br />
zu erheben und zu dokumentieren.<br />
Darüber hinaus bietet die Prozessplattform nun die Möglichkeit,<br />
Ist- und Sollprozesse zu modellieren. Diese Prozessmodellierung<br />
wird mit der für den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung besonders<br />
geeigneten sog. PICTURE-Methode durchgeführt. Eine<br />
Instanz des Modellierungstools betreibt jede Behörde in eigener<br />
Verantwortung. Erst, wenn sich eine Behörde dazu entschließt,<br />
eigene Verwaltungsprozessmodelle anderen Behörden zur Nachnutzung<br />
zur Verfügung zu stellen, kann sie diese mit Hilfe der<br />
Exportfunktionen dem zentralen Prozessregister als Referenzmodell<br />
übergeben. Andere Behörden können im Prozessregister<br />
recherchieren und solche Referenzmodelle in ihr eigenes Modellierungstool<br />
importieren. Dort können sie als Basis für die eigene<br />
Arbeit nachgenutzt und weiter entwickelt werden.<br />
Der Freistaat Sachsen hat für die Lizenzierung<br />
von Modellierungstools einen<br />
Rahmenvertrag mit der PICTURE<br />
GmbH als Hersteller der Software abgeschlossen.<br />
Der Abruf dieser Lizenzen<br />
erfolgt für Behörden des Freistaates<br />
über das Sächsische Staatsministerium<br />
der Justiz und für Europa. Um<br />
interessierten kommunalen Behörden<br />
ebenfalls die Möglichkeit zu geben,<br />
die Prozessplattform zu nutzen, besteht<br />
in diesem Rahmenvertrag eine<br />
Öffnungsklausel für Kommunen. Der<br />
Abruf kommunaler Lizenzen erfolgt<br />
für kommunale Gebietskörperschaften<br />
direkt beim Hersteller PICTURE<br />
GmbH unter Bezugnahme auf den<br />
Rahmenvertrag.<br />
Parallel kooperiert der Freistaat Sachsen mit dem Bund beim<br />
Aufbau einer Nationalen Prozessbibliothek. Ziel ist es, die<br />
Vorhaben des Bundes und Sachsens beim Prozessmanagement<br />
stärker zu vernetzen, um gemeinsame Standards zu entwickeln,<br />
Erfahrungen auszutauschen, das vorhandene Wissen zu bündeln<br />
und dieses zur Nachnutzung verfügbar zu machen. Dafür werden<br />
öffentliche Verwaltungsabläufe in das Register eingestellt. In der<br />
Nationalen Prozessbibliothek sollen so die Verwaltungsabläufe<br />
des Bundes, der Länder und der Kommunen gesammelt und<br />
vielfältig genutzt werden.<br />
Ein erfolgreiches Prozessmanagement misst sich jedoch nicht<br />
nur an der Verfügbarkeit technischer Hilfsmittel und inhaltlicher<br />
Vorgaben. Handlungsempfehlungen zum methodischen<br />
Vorgehen und praktische Tipps zur Durchführung von Projekten<br />
spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Hierzu hat die<br />
Stabsstelle Staatsmodernisierung im Staatsministerium der Justiz<br />
und für Europa nun ein Handbuch Prozessmanagement für die<br />
269
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Behörden des Freistaates Sachsen entwickelt. Das Handbuch<br />
bietet Mitarbeitern in den Verwaltungsbehörden, die mit den<br />
Aufgaben Qualitäts- oder Prozessmanagement betraut sind,<br />
eine Unterstützung bei der Einführung von Prozessmanagement<br />
in Form eines fachlichen Leitfadens. Es basiert auf dem<br />
Vorgehensmodell des DIN-Fachberichts 158 (Geschäftsprozessmanagement<br />
in der öffentlichen Verwaltung). Der allgemeine<br />
fachliche Leitfaden kann ebenso den Kommunen des Freistaates<br />
eine Hilfestellung sein.<br />
Die Stabsstelle Staatsmodernisierung im Staatsministerium der<br />
Justiz und für Europa hat vor, das Thema Prozessmanagement<br />
im Rahmen von Pilotprojekten mit den Verwaltungsbehörden<br />
und insbesondere bei ebenenübergreifenden Prozessen zwischen<br />
Kommune und Land stärker voranzutreiben. Erste Schritte zur<br />
Prozessoptimierung werden derzeit im Rahmen eines Projektes<br />
zur Einführung eines Online-Gewerbedienstes gegangen. Hier<br />
werden unter Beteiligung von mehreren Kommunen, Kammern<br />
und staatlichen Behörden die komplexen Gewerbeantragsverfahren<br />
analysiert und auf ihre Optimierungspotentiale untersucht.<br />
Auch dabei kommt der Prozessplattform Sachsen eine zentrale<br />
Bedeutung zu.<br />
Derzeit werden durch Experten der Kommunalen Spitzenverbände,<br />
der SAKD, der KISA und des Sächsischen Staatsministeriums<br />
der Justiz und für Europa Möglichkeiten diskutiert,<br />
wie die verschiedenen Aktivitäten bei der Einführung von<br />
modernem Prozessmanagement synchronisiert werden können,<br />
um sie wo möglich mit einem Ziel zu bündeln: Die künftigen<br />
Anforderungen an die sächsischen Verwaltungen mit knapper<br />
werdenden Ressourcen in der von den Zielgruppen erwarteten<br />
Qualität effizient zu erfüllen.<br />
Für die Beantwortung weiterführender Fragen nutzen Sie gern<br />
den E-Mail-Kontakt: Referat-V.5-P_smj@smj.justiz.sachsen.<br />
de<br />
Delegation aus Dresden<br />
auf Arbeitsbesuch in Brüssel<br />
Unter der Leitung des Ersten Bürgermeisters der Stadt Dresden,<br />
Dirk Hilbert (FDP), reiste am 11. und 12. April eine Delegation<br />
von Vertretern aller Stadtratsfraktionen und Mitgliedern des Wirtschaftsbeirates<br />
der Oberbürgermeisterin nach Brüssel. Die Reise<br />
wurde von Oberbürgermeisterin Helma Orosz (CDU) initiiert, die<br />
auf diese Weise den Entscheidungsträgern ihrer Stadt ein Gefühl<br />
für Europa vermitteln wollte. Dieses Ziel kann nun als erreicht<br />
angesehen werden – die gewonnenen Eindrücke und der Nutzen,<br />
welcher sich aus diesen ziehen lässt, wird von den Mitreisenden,<br />
die in ihrer Stadt die Funktion von Multiplikatoren wahrnehmen,<br />
zu Hause weitergegeben. Im Mittelpunkt der Fachgespräche stand<br />
neben den Themen Energie und europäische Regionalpolitik auch<br />
die für Dresden so bedeutende Nanoelektronik.<br />
Bürgermeister Hilbert betonte die Wichtigkeit der Reise, die den<br />
Blick für die Kommunalrelevanz von Entscheidungen auf der<br />
europäischen Ebene schärfe: „Wir treffen exklusive Fachleute und<br />
haben die Chance, für Dresdner Interessen mehr Aufmerksamkeit<br />
zu erhalten. Ich bin sicher, dass auch dieser kurze Aufenthalt<br />
den Teilnehmern die Meinungsbildungsprozesse in Brüssel und<br />
die Möglichkeiten für Einflussnahme erhellen wird.“<br />
Auf Einladung des Leipziger Europaabgeordneten Hermann<br />
Winkler (CDU) besuchte die Delegation das Europäische Parlament<br />
und informierte sich über aktuelle Gesetzesvorhaben,<br />
insbesondere aus dem Ausschuss für Industrie, Forschung und<br />
Energie sowie aus dem Ausschuss für Regionalpolitik.<br />
Nach der Vorstellung der Arbeit des Europabüros der Sächsischen<br />
Kommunen, welches sich wie viele der kommunalen<br />
Interessenvertretungen in Brüssel nicht nur als Horchposten und<br />
270<br />
Janna Lehmann<br />
Europabüro der Sächsischen Kommunen in Brüssel
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
Frühwarnsystem für aktuelle Entwicklungen in der EU-Gesetzgebung,<br />
sondern auch als Türöffner und Dienstleister speziell für<br />
die sächsischen Kommunen versteht, stand die Energiepolitik<br />
im Mittelpunkt der Vorträge. Das Brüsseler Büro des Verbands<br />
kommunaler Unternehmen informierte über die anstehenden<br />
legislativen Neuerungen und sensibilisierte die Delegation für die<br />
am Abend stattfindende Veranstaltung im Sachsen-Verbindungsbüro,<br />
die mit Energiekommissar Günther Oettinger hochkarätig<br />
besetzt war. Auch hier ging es, quasi als sächsischer Auftakt zur<br />
in Brüssel beginnenden „Woche der Nachhaltigen Energie in der<br />
EU“, um den bedeutenden Bereich der Energiepolitik.<br />
Für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Dresden ist die<br />
Nanoelektronik von besonderem Interesse. Daher waren Bürgermeister<br />
Hilbert und seine Delegation besonders erfreut über die<br />
Gelegenheit zum Austausch mit Vertretern der Generaldirektion<br />
Forschung der Europäischen Kommission, die ihr Fachwissen gern<br />
mit den Dresdenern teilten. Dresden, als ein Standort mit Zukunft<br />
und dem Potenzial zu noch mehr Innovation, stand auch bei den<br />
am Folgetag geführten Diskussionen mit Vertretern der Generaldi-<br />
rektion für Regionalpolitik der Kommission, des Ausschusses der<br />
Regionen und des Rates der Gemeinden und Regionen im Fokus.<br />
Die Zukunft der Regionalpolitik in der Europäischen Union steht<br />
gerade in diesen Tagen im Mittelpunkt aller Debatten. Aktuell<br />
wird der Zuschnitt der kommenden Förderperiode ab 2014 und<br />
nicht zuletzt auch die gerade für Sachsen besonders bedeutende<br />
Frage der Höhe der Mittelzuweisung debattiert.<br />
Abgerundet wurde die Reise mit einem Besuch im Brüsseler<br />
Rathaus, wo die Dresdener Delegation vom Ersten Bürgermeister<br />
und Beigeordneten für Wirtschaft, Jean de Hertog freundschaftlich<br />
empfangen wurde.<br />
Die Reise wurde vom Europabüro der Sächsischen Kommunen<br />
in Zusammenarbeit mit der Abteilung Europäische und Internationale<br />
Angelegenheiten der Stadt Dresden organisiert.<br />
Das Europabüro unterstützt die Sächsischen Kommunen vor Ort<br />
in Brüssel bei Anliegen, die die Europäische Union betreffen.<br />
Kontakt: Janna.Lehmann@Europabuero-SN.de<br />
271
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Chemnitzer Stadträte stimmen digital ab – Moderne<br />
Technik im 100jährigen Jugendstil-Ambiente<br />
<strong>2011</strong> begeht die Stadt Chemnitz ihr 100. Rathausjubiläum.<br />
Neben dem im 15. Jahrhundert errichteten spätgotischen Alten<br />
Rathaus entstand von 1907 bis 1911 das neue Rathaus. Der<br />
Neubau im Stil der Neorenaissance kombiniert mit Elementen<br />
des Jugendstils ist ein bedeutendes Architekturdenkmal der Stadt<br />
Chemnitz und Zeugnis ihrer rasanten Entwicklung bis ins 19.<br />
und 20. Jahrhundert hinein.<br />
Der Chemnitzer Stadtverordnetensaal gehört zu den Glanzpunkten<br />
des Neuen Rathauses. Die kunstvoll gearbeitete Wandvertäfelung,<br />
die Holzdecke mit den Jugendstilleuchtern und die<br />
erhaltenen leicht geschwungenen Tische stellen prägende Elemente<br />
dar. Insbesondere dieser Fortbestand stellt eine Seltenheit dar, die<br />
den Raum zu den wertvollsten Ratssälen in Deutschland macht.<br />
Aufwändige denkmalpflegerische Restaurierungsmaßnahmen<br />
von Juni 2009 bis Dezember 2010 brachten neben einer noch<br />
größeren Annäherung an die historische Raumfassung auch<br />
ideale zeitgemäße Nutzungsbedingungen durch eine unauffällig<br />
integrierte hochmoderne digitale Medien- und Konferenzanlage.<br />
Diese Technik verändert die Arbeit für die Geschäftsstelle des<br />
Stadtrates, da der komplette Sitzungsablauf durch die moderne<br />
Technik effizient unterstützt wird.<br />
Seit Beginn des Jahres <strong>2011</strong> wird die Technik nun genutzt:<br />
Abstimmfunktion, Beschallungstechnik und Visualisierung<br />
auf Bildschirm- und Projektionswand, Kameraübertragung<br />
in andere Räume sowie Steuerung des Lichtsystems und des<br />
Sonnenschutzes mit Fensterlüftung. Eine Induktionsschleife für<br />
Hörgeschädigte ist ebenso im Zuschauerbereich über das System<br />
bei Bedarf zuschaltbar.<br />
272<br />
Für die Stadtratsmitglieder und die Oberbürgermeisterin sowie<br />
die Bürgermeister wurden 75 Tischsprechstellen installiert. Die<br />
patentierte Mikrofonanordnung ermöglicht die Verständlichkeit in<br />
einem breiteren Korridor vor der Sprechstelle. Durch die optisch<br />
ansprechenden Sprechstellen versperrt kein Mikrofon die Sicht auf<br />
den Sprecher. Jeder Stadtrat kann unmittelbar von seinem Platz<br />
aus sprechen. Dafür meldet sich der Sprecher per Knopfdruck<br />
an; die Freigabe der Rednerbeiträge erfolgt am Touchpanel im<br />
Präsidium.<br />
Die Konferenz kann als Audiodatei auf einem Laptop am<br />
Protokollplatz komfortabel aufgezeichnet werden. Während<br />
der Sitzung können Sprungmarken gesetzt werden, um beim<br />
Abhören die gesuchte Stelle einfach zu finden. Die Bedienung<br />
der Mitschnittsoftware ist intuitiv und kann auch per Fußschalter<br />
von Sehbehinderten bedient werden. Es können mehrere<br />
Personen zeitgleich den Mitschnitt abhören.<br />
Wesentlichste spürbare Veränderung: Die Stadträte stimmen<br />
digital ab. Das Abstimmergebnis wird zuerst sitzplatzbezogen<br />
und danach in der Zusammenfassung auf einer großen Leinwand<br />
für die Öffentlichkeit und Medien gut sichtbar angezeigt.<br />
Bei der Einrichtung des Systems wurde den Mitarbeiterinnen<br />
der Geschäftsstelle des Stadtrates schnell bewusst, dass es keine<br />
Erfahrungswerte innerhalb anderer Kommunen gibt, auf die<br />
sie sich stützen können. Nach den Recherchen der Chemnitzer<br />
sind sie die erste Kommune in Deutschland, die den kommunalpolitischen<br />
Willensbildungsprozess im Stadtrat mittels elektronischer<br />
Abstimmung abbilden. Die Abstimmfunktion – ein<br />
Chemnitzer Alleinstellungsmerkmal also.<br />
Die Landesdirektion wird es aufgrund der konkreten Ergebnisse<br />
sicher freuen. Die beteiligten Stimmberechtigten und die Öffentlichkeit<br />
haben die Neuerung bereits wohlwollend akzeptiert. Und<br />
die Verwaltung ist aufgrund der besseren Verwertbarkeit des Ergebnisses<br />
begeistert. Das Stimmverhalten der Stadträte wird exakt<br />
und technisch nachvollziehbar bestimmt. Bei jeder Abstimmung<br />
gibt es jetzt ein konkretes stimmengenaues Ergebnis. Unklarheiten<br />
über eventuelle Mehrheiten, Wiederholung von Abstimmungen,<br />
zeitaufwändiges und fehleranfälliges Zählen durch Mitarbeiter der<br />
Geschäftsstelle sind in Chemnitz kein Thema mehr.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
Auch das besondere Verfahren der „namentlichen<br />
Abstimmung“ ist mit wesentlich<br />
geringerem Aufwand verbunden.<br />
So ist keine Vorbereitung von Listen zur<br />
namentlichen Abstimmung mehr erforderlich.<br />
Nach Erhalt des notwendigen<br />
Quorums erfolgt die Abstimmung wie<br />
jede andere Abstimmung per Konferenzsystem.<br />
Lediglich in der Anzeige des Abstimmungsergebnisses<br />
unterscheidet sie<br />
sich, da hier namentlich dargestellt wird,<br />
wie die einzelnen Stadtratsmitglieder<br />
entschieden haben.<br />
Mit der neuen Technik lässt sich ebenfalls<br />
die geheime Abstimmung abbilden. Hierfür<br />
waren in der Vergangenheit Abstimmungszettel<br />
vorzubereiten. Die geheime Abstimmung<br />
erfolgte in der Wahlkabine und<br />
mittels Einwerfen der Abstimmungszettel<br />
in die Wahlurne. Das Ergebnis wird nunmehr unter Wahrung<br />
der Anonymität ermittelt und anhand eines Säulendiagramms<br />
dargestellt.<br />
Selbst offene Wahlen können mit der Abstimmfunktion durchgeführt<br />
werden. In der Regel sind das Fälle, bei denen eine<br />
Person zur Wahl steht bzw. wenn nur so viele Personen zur Wahl<br />
stehen, wie Plätze zu besetzen sind und einer en-bloc-Wahl nicht<br />
widersprochen wurde.<br />
Während der Sitzung werden die Sprechstellen der abwesenden<br />
Stadtratsmitglieder gesperrt, um unbefugtes Bedienen durch<br />
einen Sitzplatznachbarn zu vermeiden.<br />
Flankierend für den Einsatz der Konferenzanlage mit Abstimmfunktion<br />
wurden Regelungen in der Geschäftsordnung des<br />
Stadtrates geändert und auf die Abstimmungen bzw. Wahlen<br />
per Delegiertensprechstelle angepasst.<br />
Mit der Installation der kabelgebundenen Konferenztechnik<br />
MSC Digital von Beyerdynamic wandelt sich die technische<br />
Seite der Ratsarbeit in Innovation und Komfort. Ganz im Sinne<br />
des Anspruchs der Stadt: Chemnitz – Stadt der Moderne.<br />
Interessenten können sich gern mit Fragen an die Leiterin der<br />
Geschäftsstelle des Stadtrates, Beate Frech (beate.frech@stadtchemnitz.de<br />
bzw. 0371-488 1540), wenden.<br />
Kämmerer als Glücksspieler wider Willen:<br />
Einsatz komplexer Finanzderivate in Kommunen –<br />
Hintergrund und Lösungsmöglichkeiten *<br />
Ende März dieses Jahres hat der BGH eine grundlegende<br />
Entscheidung zu Art und Umfang der Beratungspflichten von<br />
Banken beim Vertrieb strukturierter Finanzprodukte getroffen.<br />
Diese Entscheidung hat in der Finanzwelt für viel Aufsehen<br />
gesorgt, aber auch in den Finanzverwaltungen der Kommunen<br />
dürfte das Verfahren mit Interesse verfolgt worden sein. Denn<br />
neben mittelständischen Unternehmen wurden von den Banken<br />
bevorzugt Kommunen als Kunden für sogenannte innovative<br />
Finanzprodukte geworben und gewonnen.<br />
* Die SAM Sachsen Asset Management GmbH ist ein eigentümergeführtes<br />
und bankenunabhängiges Beratungsunternehmen mit<br />
umfangreicher Markterfahrung. Spezialisten auf dem Gebiet des<br />
Finanzmarktes und den dazugehörigen Rechtsgebieten beraten<br />
laufend öffentliche Kunden im Bezug auf strukturierte Finanzgeschäfte<br />
und Kapitalmarktfragen.<br />
1 Praxis und Umfang der Geschäfte<br />
Die in den letzten Jahren verstärkt den Kommunen angebotenen<br />
hochkomplexen Finanzprodukte wurden oft unter positiv besetzten<br />
Schlagwörtern wie „Zinssicherung“ oder „Zinsoptimierung“<br />
vermarktet. Die zu erwartenden Auszahlungen dieser Produkte<br />
erschienen auf den ersten Blick lukrativ, die Risiken hingegen waren<br />
auch auf den zweiten kaum zu erkennen. Das galt zumindest bei<br />
Abschluss, denn mittlerweile wurden zahlreichen Kommunen die<br />
273
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Risiken durch den starken Zinsrückgang der vergangenen beiden<br />
Jahre mehr als deutlich vor Augen geführt. In die Diskussion sind<br />
dabei insbesondere sogenannte „CMS-Spread-Ladder-Swaps“<br />
geraten, da hierzu die ersten Klagen bei Gericht anhängig sind.<br />
Daneben tauchen zunehmend Bezeichnungen wie „CMS-Memory-Swap“<br />
oder „CMS-Spread-Sammler-Swap“ in der Presse auf. Die<br />
Palette undurchsichtiger Finanzkonstruktionen ist aber deutlich<br />
größer, und bei aller Namensvielfalt gibt es die Gemeinsamkeit der<br />
Verwendung positiv besetzter Begriffe bei deren Bezeichnung.<br />
Mit dem Urteil des BGH vom 22.03.<strong>2011</strong> 1 wurden die Anforderungen<br />
an eine ordnungsgemäße Beratung bei Abschluss von<br />
Zinsderivaten klarer gefasst. Einer solchen Beratung geht oftmals<br />
eine individuelle „kommunale Verschuldungsdiagnose“ durch<br />
typischerweise die Hausbank voraus, in der Möglichkeiten zu einer<br />
vermeintlichen Verringerung der Schuldenlast mit Zinsderivaten<br />
vorgestellt werden. Das Spektrum der vermittelten Produkte ist<br />
ebenso wie die Resonanz der Kämmerer oder Geschäftsführer<br />
kommunaler Unternehmen sehr breit.<br />
Während einige solche Geschäfte grundsätzlich<br />
ablehnen oder allenfalls einfache<br />
Standardprodukte erwägen, gibt es auch<br />
Verantwortungsträger, die diese Instrumente<br />
umfänglich nutzen und dabei komplexe<br />
Wetten auf zukünftige Zinsentwicklungen<br />
eingehen, d. h. spekulieren. Nach unserer<br />
Erfahrung kann aber in den seltensten Fällen<br />
davon ausgegangen werden, dass Kommunen<br />
oder kommunale Unternehmen<br />
hinreichend über Wissen, Kapazitäten und<br />
Erfahrungen verfügen, um eine eigene fundierte<br />
Bewertung hochkomplexer Geschäfte<br />
vorzunehmen. Grundsätzlich können<br />
bei sorgfältiger Analyse und bestehender<br />
Konnexität von Grund- und Sicherungsgeschäft<br />
jedoch einfache Zinsderivate, z. B. als<br />
reine Tauschgeschäfte ausgestaltete Swaps,<br />
durchaus sinnvoll sein, um Zinsänderungsrisiken zu begrenzen.<br />
Für viele in die öffentliche Diskussion geratene Geschäfte wie die<br />
oben namentlich aufgeführten gilt dies allerdings nicht.<br />
Die Motivation für den Abschluss auch komplexer Zinsderivate<br />
war grundsätzlich redlich, nämlich die Zinslast aus aufgenommenen<br />
Schulden zu mindern. Über das Einfallstor „Kommunale<br />
Verschuldungsanalyse“ gelang es den Banken vielfach, komplexe<br />
Zinsderivate zu verkaufen, die vordergründig diesem Ziel unter<br />
Einhaltung der kommunalrechtlich gebotenen Voraussetzungen<br />
(u. a. Konnexität bzw. Beachtung des Spekulationsverbotes) gerecht<br />
werden. Als Argumente wurden dabei zusätzlich Flexibilität<br />
und Unabhängigkeit von bestehenden, in der Regel langfristigen<br />
Finanzierungen der Kommunen angeführt. Mit Hilfe der komplexen<br />
Zinsderivate ließe sich somit neuer Handlungsspielraum<br />
eröffnen.<br />
Chancen, hier die Verminderung von Zinslasten, werden aber bei<br />
Finanzprodukten entweder durch anfängliche Zahlungen (sog.<br />
Prämien) oder die Übernahme von Risiken erkauft. Letztere waren,<br />
um den kommunalrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden,<br />
bei vielen nun in die Kritik geratenen Zinsderivaten versteckt, so<br />
1 Az: XI ZR 33/10<br />
274<br />
dass auf kommunaler Seite oft eine völlig falsche Vorstellung von<br />
deren Wirkungsweise herrschte. Die Risiken waren dabei oftmals<br />
extrem einseitig zu Lasten der Kommunen ausgestaltet, während<br />
deren Chancen, d. h. die Risiken der kontrahierenden Banken,<br />
eng begrenzt wurden.<br />
2 Funktionsweise und Risikopotential anhand eines<br />
Beispielfalles<br />
Das teils enorme Risikopotential dieser komplexen Zinsderivate<br />
soll an einem konkreten Beispiel eines typischen „CMS-Memory-<br />
Swap“, der eine Vereinfachung eines „CMS-Spread-Ladder-Swap“<br />
darstellt, zwischen einer Bank und einer Kommune verdeutlicht<br />
werden.<br />
Die Präsentation einer Bank zur Vorstellung der Grundstruktur<br />
des „CMS-Memory-Swaps“ würde in etwa wie folgt aussehen:<br />
Abbildung 1: Beispiel CMS-Memory-Swap: Ausschnitt aus der Produktpräsentation. Die<br />
Zinsen werden am Ende jedes Quartals ausgetauscht. Der 10-Jahres-CMS (CMS: Constant<br />
Maturity Swap) ist dabei der in einem Standardzinsswap mit zehn Jahren Laufzeit zu<br />
vereinbarende Festzinssatz (Swap Rate), bei dem dieser Standardzinsswap gerade einen<br />
Barwert von null hat. Swap Rates werden fortlaufend am Markt quotiert.<br />
Die Kommune zahlt damit einen Zinssatz, dessen Höhe sich auch<br />
aus dem Zinssatz der vorhergehenden Zinsperiode bestimmt. Dies<br />
ist das als „Memory“ oder „Ladder“ bezeichnete Zinsgedächtnis.<br />
Schief wird das Chance-Risiko-Verhältnis, da der Zinssatz der<br />
Kommune nach unten auf 0 % p. a. begrenzt ist. Zum Nachteil<br />
der Kommune könnte also der „Memory-Zins“ quasi unbegrenzt<br />
anwachsen, wenn der in der Präsentation genannte variable Zinssatz<br />
(10-Jahres-CMS) nur hinreichend tief unter dem Schwellwert<br />
von 4 % p. a. notiert, ein Fallen in gleichem Maße ist jedoch<br />
ausgeschlossen. Der Zinssatz der Kommune kann damit, auch<br />
in Folge des fünffachen Hebels, leicht dreistellig werden und<br />
sich somit fast beliebig vom tatsächlichen Zinsniveau entfernen,<br />
wie nachfolgend demonstriert werden soll. Mit einer Gesamtlaufzeit<br />
von zehn Jahren hat das Geschäft jetzt gerade Halbzeit.<br />
In Abbildung 2 sind der bisherige Verlauf des 10-Jahres-CMS<br />
über die letzten fünf Jahre sowie drei mögliche Entwicklungen<br />
für die nächsten fünf Jahre dargestellt. Das Geschäft entwickelte<br />
sich demnach in den ersten zweieinhalb Jahren zum Vorteil und<br />
danach zum Nachteil der Kommune.<br />
Die sich aus diesem Verlauf des 10-Jahres-CMS ergebenden<br />
Zinssätze für die Kommune sind in Abbildung 3 angegeben.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
Abbildung 2: Bisherige Entwicklung der 10-Jahres-Swap-Rate während der ersten fünf Jahre<br />
Laufzeit des beispielhaften „CMS-Memory-Swap“ und drei mögliche weitere Entwicklungen.<br />
Notiert dabei die 10-Jahres-Swap-Rate über dem Schwellwert von 4 % p. a., so sinkt der<br />
Zinssatz für die Kommune, andernfalls steigt er.<br />
Hiernach hat die Kommune bis März 2009 Nettozahlungen<br />
von der Bank erhalten, d. h. ihr Zinssatz lag unter den 4 % p. a.<br />
der Bank. Seitdem ist jedoch der Zinssatz der Kommune stark<br />
auf über 30 % p. a. angestiegen, so dass pro Euro Nennwert<br />
bisher netto 19 Cent an die Bank flossen. Das ganze Risiko wird<br />
vor allem deutlich, wenn man unterstellt, dass die 10-Jahres-<br />
Swap-Rate der nächsten fünf Jahre spiegelbildlich zu jener der<br />
letzten fünf Jahre verläuft. Dann kommen nicht einfach weitere<br />
Nettozahlungen von 19 Cent für die Kommune hinzu, sondern<br />
die Belastung steigt auf 2,28 EUR je Euro Nennbetrag. Bei den<br />
anderen Zinsszenarien wird es sogar noch teurer, wobei der Zinssatz<br />
der Kommune in der Spitze auf knapp 120 % p. a. steigt.<br />
Anhand dieses exemplarischen Falles eines „klassischen“ CMS-<br />
Memory-Swaps wird das enorme und im Einzelfall existenzgefährdende<br />
Risikopotential komplex strukturierter Zinsderivate<br />
augenscheinlich. Von diesem Grundfall ausgehend gibt es<br />
selbstverständlich eine Vielzahl von Varianten und Fallgruppen<br />
von abweichend strukturierten Zinsderivaten. Diese sind in<br />
Abbildung 3: Entwicklung des von der Kommune aufzubringenden „Memory-Zinses“ im<br />
beispielhaften „CMS-Memory-Swap“ unter den Zinsverläufen aus Abbildung 2. Neben<br />
den Kurven sind die kumulierten Nettozahlungen der Kommune an die Bank je Euro<br />
Nennbetrag angegeben. Während der ersten fünf Jahre Laufzeit des Geschäfts wurden somit<br />
netto 19 Cent je 1 Euro Nennbetrag von der Kommune an die Bank gezahlt. Unter den<br />
drei Szenarien wächst diese Last in den nächsten fünf Jahren auf über 2 Euro je 1 Euro<br />
Nennbetrag an.<br />
ihren Wirkungen zum Teil mit denen des<br />
Beispielsfalls vergleichbar, können aber<br />
durchaus auch ein anderes Risiko aufweisen.<br />
Komplexen Zinsderivaten ist dabei<br />
aber gemein, dass sich aus der Zinsformel<br />
nicht ohne Weiteres Klarheit über das<br />
tatsächliche Risikopotential des Geschäfts<br />
gewinnen lässt.<br />
Für Kommunen erlangen damit zwei Fragen<br />
zentrale Bedeutung. Zunächst ist zu<br />
ermitteln, ob und welche Konsequenzen<br />
sich aus dem enormen Risikopotential derartiger<br />
Geschäfte ergeben. Im Nachgang ist<br />
zu klären, ob sich die nachteiligen Auswirkungen<br />
eines abgeschlossenen Geschäfts<br />
begrenzen oder sogar ausschließen lassen,<br />
was nachfolgend beleuchtet werden soll.<br />
3 Rechtliche Rahmenbedingungen<br />
Schließt eine Kommune einen Vertrag über ein Finanzderivat<br />
mit einer Bank ab, so wird dieser einheitliche Vorgang von zwei<br />
grundsätzlich verschiedenen Rechtsbereichen geprägt: einerseits<br />
das öffentliche Kommunalrecht und andererseits das für jeden<br />
Bankkunden geltende Zivilrecht.<br />
3.1 Kommunalrechtliche Grundsätze<br />
Basis der finanzwirtschaftlichen Betätigung der Kommunen ist<br />
deren nach Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes garantierte Finanzhoheit<br />
als Teil der kommunalen Selbstverwaltung:<br />
„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten<br />
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze<br />
in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände<br />
haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach<br />
Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung<br />
der Selbstverwaltung umfasst auch die<br />
Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung;<br />
zu diesen Grundlagen gehört eine den<br />
Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende<br />
wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.“<br />
Dieser Grundsatz wird in Art. 82 Abs. 2<br />
der Sächsischen Verfassung bekräftigt.<br />
Die kommunale Finanzhoheit sichert<br />
den Kommunen das Recht, selbstständig<br />
Abgaben zu erheben, zu verwalten und zu<br />
vereinnahmen sowie im Rahmen der kommunalen<br />
Haushaltswirtschaft eigenverantwortlich<br />
Haushaltspläne aufzustellen und<br />
die Verwendung der Mittel festzuschreiben.<br />
Die Wahrnehmung dieser Finanzhoheit<br />
setzt u. a. eine geordnete Haushalts- und<br />
Wirtschaftsführung sowie Vermögensverwaltung<br />
voraus, die ihre nähere Ausgestaltung<br />
in den §§ 72 ff SächsGemO findet.<br />
Übergeordnetes Ziel ist die Sicherstellung<br />
und Schaffung der dauerhaften finanziel-<br />
275
Allgemeine Beiträge <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
len Basis zur Erfüllung der vielfältigen hoheitlichen Aufgaben<br />
(siehe § 72 Abs. 1 SächsGemO). Eine weitere Konkretisierung<br />
dieser Grundsätze erfolgt durch untergesetzliche Regelungen,<br />
u. a. seit 1999 durch Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums,<br />
Stichwort: „Derivateerlass“, zuletzt aktualisiert mit der<br />
Verwaltungsvorschrift „Kommunale Haushaltswirtschaft“ vom<br />
20.12.2010.<br />
Die für die Kommunen verbindlichen Verwaltungsvorschriften<br />
enthalten relativ detailliert sowohl verfahrensmäßige und organisatorische<br />
Regelungen als auch inhaltliche Vorgaben zum<br />
Abschluss von Finanzderivaten.<br />
Im Zentrum steht dabei das Spekulationsverbot. Danach ist es<br />
Kommunen untersagt, Derivate ohne zeitliche und inhaltliche<br />
Konnexität zu einem bestimmten Kreditgeschäft als Grundgeschäft<br />
abzuschließen. Zulässige Zielstellung des Derivates darf −<br />
jeweils bezogen auf das Grundgeschäft − nur die Begrenzung von<br />
Zinsänderungsrisiken oder die Zinsoptimierung sein. Dabei wird<br />
nicht ausdrücklich definiert, was Konnexität genau bedeutet. Allerdings<br />
kann zur näheren Bestimmung dieses Rechtsbegriffes auf<br />
allgemeine Bilanzgrundsätze abgestellt werden. Eine hinreichende<br />
Konnexität zwischen Finanzderivat und Grundgeschäft kann<br />
nach diesen Grundsätzen nur dann angenommen werden, wenn<br />
zwischen beiden Geschäften eine sogenannte Bewertungseinheit<br />
gebildet werden kann.<br />
Eine solche Bewertungseinheit ist nur dann gegeben, wenn die<br />
Geschäfte mit ausdrücklicher Sicherungsabsicht abgeschlossen<br />
wurden und folgende Voraussetzungen gemeinsam erfüllt sind:<br />
– weitestgehend gegenläufige Wertentwicklung zwischen Grundund<br />
Sicherungsgeschäft (hohe negative Korrelation, Homogenität<br />
der Risiken),<br />
– Laufzeitkongruenz zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft,<br />
– Betragskongruenz zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft,<br />
– nachvollziehbare Dokumentation des Sicherungszusammenhangs.<br />
Prüft man die in der Praxis von den Banken gern behauptete Konnexität<br />
ihrer angebotenen Produkte, so fällt diese Einschätzung<br />
in der Regel bei der Prüfung der gegenläufigen Wertentwicklung<br />
in sich zusammen. Mit Gegenläufigkeit ist nämlich gemeint, dass<br />
das Derivat auf die konkreten wirtschaftlichen Eigenschaften und<br />
Risiken des Grundgeschäfts Bezug nimmt und in seiner eigenen<br />
Struktur im Sinne einer risikomindernden Wirkung quasi spiegelbildlich<br />
berücksichtigt. Erforderlich ist also einerseits ein bestimmtes<br />
wirtschaftliches Risiko bzw. Chance des Grundgeschäfts und<br />
andererseits die dementsprechend gegenläufige Wirkungsweise<br />
des Derivates. Im Ergebnis müssen sich die Gewinne und Verluste<br />
bzw. die Cashflows aus beiden Geschäften ausgleichen.<br />
Wendet man diese Grundsätze auf den unter Ziffer 2 dargestellten<br />
Beispielsfall an, so fällt auch hier relativ schnell auf, dass<br />
das Geschäft weder zur Begrenzung von (im Beispiel überhaupt<br />
nicht bestehenden) Zinsänderungsrisiken noch zur sonstigen<br />
Optimierung des Grundgeschäfts geeignet ist. Es handelt sich<br />
vielmehr um eine völlig abstrakte Wette mit dem Ziel, zusätzliche<br />
Erträge zu generieren. Anders als die Bank geht die Kommune<br />
dafür neue und unbegrenzte Risiken ein, die in keinem Verhältnis<br />
zu ihren bescheidenen Gewinnchancen stehen.<br />
276<br />
3.1 Zivilrechtliche Grundsätze<br />
Wenn eine Bank mit ihrem Kunden einen Vertrag über ein bestimmtes<br />
Finanzprodukt abschließt, so geht diesem Vertrag in der<br />
Regel ein eigenständiger Beratungsvertrag voraus. Dies gilt auch,<br />
wenn es sich bei dem Kunden um eine Kommune handelt.<br />
Der Beratungsvertrag wird im Regelfall formlos und durch<br />
schlüssiges Handeln wie folgt begründet: Die Bank bzw. deren<br />
Anlageberater tritt an den Kunden (oder auch umgekehrt) heran,<br />
um diesen für den Abschluss eines Finanzproduktes zu gewinnen.<br />
Damit verbunden ist ein Angebot der Bank (im umgekehrten<br />
Fall des Kunden) auf Abschluss eines Beratungs-vertrages. Damit<br />
wird ein Vertrag mit gegenseitigen Rechten und Pflichten im<br />
Sinne der §§ 311, 241 BGB begründet.<br />
Mit der o. g. Entscheidung hat der BGH zunächst seine mittlerweile<br />
seit fast 20 Jahren anwendbare Rechtsprechung zu<br />
Art und Umfang der Beratungspflichten der Banken bestätigt.<br />
Demgemäß ist die Bank nach wie vor zu einer anleger- und<br />
objektgerechten Beratung verpflichtet. Inhalt und Umfang der<br />
Beratungspflichten hängen dabei von den Umständen des Einzelfalles<br />
ab. Der BGH hebt jedoch die qualitativen Anforderungen<br />
an die Beratung auf ein neues Niveau: Bei einem hochkomplexen<br />
Anlageprodukt (im entschiedenen Fall lag ein zum CMS-Memory-Swap<br />
vergleichbarer „CMS-Spread-Ladder-Swap“ zu Grunde)<br />
muss die Aufklärung gewährleisten, dass der Anleger zum Risiko<br />
des Geschäfts im Wesentlichen den gleichen Kenntnis- und<br />
Wissensstand hat wie die beratende Bank. Nur so sei ihm eine<br />
eigenverantwortliche Entscheidung darüber möglich, ob er<br />
die ihm angebotene Zinswette annehmen will. Damit verlangt<br />
der BGH quasi, dass die Verhandlung über den Abschluss des<br />
Zinsderivates auf „Augenhöhe“ erfolgen muss.<br />
Neu und ebenfalls bemerkenswert ist die Forderung des BGH,<br />
dass die Bank bei komplex strukturierten Finanzprodukten über<br />
den negativen Barwert, den sie in die Formel zur Berechnung der<br />
variablen Zinszahlungspflicht des Anlegers selbst einstrukturiert<br />
hat, vor Geschäftsabschluss aufklären muss.<br />
Auf dieser Grundlage werden die Banken ihre Beratung beim<br />
Vertrieb strukturierter Finanzprodukte – zumindest gegenüber<br />
kommunalen Kunden – grundlegend umstellen, wenn nicht gar<br />
einstellen müssen. Bei konsequenter Beachtung der Maßstäbe des<br />
BGH dürfte sich letztlich kein Kämmerer mehr finden lassen,<br />
der sich auf einen Abschluss eines risikoreichen und spekulativen<br />
Zinsderivates einlassen wird.<br />
4 Handlungsbedarf und Lösungsansätze<br />
Risiken für die kommunalen Haushalte können vermieden werden,<br />
wenn und soweit die Kommunen bei ihrer Entscheidung<br />
über den Einsatz von „innovativen“ Finanzinstrumenten eine<br />
eigene und fundierte Prüfung der kommunalrechtlichen Grenzen<br />
anstellen und sich insoweit nicht von der Bank aufs Glatteis führen<br />
lassen. Darüber hinaus kann der Abschluss von ungeeigneten<br />
Geschäften durch eine Verbesserung der Beratungsqualität der<br />
Banken erreicht werden. Wie die Vergangenheit zeigt, kann sich<br />
die Kommune hierauf allerdings nicht verlassen.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Allgemeine Beiträge<br />
Aber auch hinsichtlich der in der Vergangenheit bereits abgeschlossenen<br />
risikoreichen Geschäfte gibt es aussichtsreiche<br />
Möglichkeiten, die bereits eingetretenen Schäden zu begrenzen<br />
oder gar auszuschließen. Wegen möglicher Rechtsverluste<br />
oder weiterer Schäden wäre es kein guter Ratschlag, mögliche<br />
Probleme einfach „auszusitzen“. Stattdessen sollte unbedingt<br />
der Grundsatz „Problem erkannt, Problem gebannt“ beherzigt<br />
werden. In einem ersten Schritt ist dazu das eigene Portfolio an<br />
Derivaten – soweit ein solches überhaupt angelegt wurde – Geschäft<br />
für Geschäft auf das tatsächlich bestehende Risikopotential<br />
zu untersuchen. Wurden dabei riskante und damit für die Kommune<br />
schadensträchtige Geschäfte identifiziert, können in einem<br />
zweiten Schritt wirtschaftliche und rechtliche Lösungsansätze zur<br />
Schadensbegrenzung herausgearbeitet werden. Unterstützung<br />
erhält die Kommune dabei von der aktuellen Rechtsprechung<br />
des BGH. Nicht zu unterschätzen sind aber auch die kommunalrechtlichen<br />
Vorschriften zum Schutz der Kommunen. Wenn<br />
auch bislang noch nicht verbreitet praktiziert, so ergeben sich<br />
hieraus doch verschiedene erfolgversprechende Ansätze, um<br />
gegen schadensträchtige Geschäfte vorzugehen.<br />
KindergartenOnline: Service für<br />
Kommunalverwaltungen – Komfort für Eltern<br />
Mit der Prozess- und Service-Plattform – „KindergartenOnline“<br />
lassen sich Bürgerservices schnell und kostengünstig ins Internet<br />
bringen.<br />
Eltern kennen das Prozedere: Damit der Nachwuchs auf jeden<br />
Fall einen Platz im Wunschkindergarten bekommt, melden viele<br />
ihre Kinder in mehreren Einrichtungen gleichzeitig an. Für die<br />
Kindergärten erschwert das die Planung, da sie in der Regel nicht<br />
über die Anmeldungen in anderen Einrichtungen informiert<br />
sind. Dieses Problem gehört in der T-City Friedrichshafen der<br />
Vergangenheit an.<br />
Denn alle 33 Kindergärten nutzen seit Herbst 2009 das webbasierte<br />
Informationsportal „KindergartenOnline“, das T-Systems<br />
gemeinsam mit der Stadtverwaltung und Vertretern der Kindergärten<br />
entwickelt hat.<br />
Lösung von T-Systems: kinderleicht<br />
„KindergartenOnline“ ist eine Lösungsplattform nach dem Baukastenprinzip,<br />
die sich so an die Anforderungen von Kommunen<br />
anpassen lässt. Sie umfasst folgende Prozesse:<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Vormerkung/Anmeldung<br />
Planung<br />
Platzvergabe<br />
Anwesenheitserfassung<br />
Auswertungen über alle Einrichtungen und Träger<br />
Die Lösung Kindergarten online bildet Verwaltungsprozesse elektronisch<br />
ab. Welche Module eingesetzt und mit welchen Rechten<br />
versehen werden, kann jeder Träger selbst entscheiden.<br />
Die Lösung lässt sich durch generelle Services und Prozessbausteine<br />
sowie durch individualisierte Elemente auf die konkrete<br />
Arbeitsweise einer Kommune zuschneiden und bleibt doch<br />
wirtschaftlich. Die Platz- und Ressourcenplanung wird deutlich<br />
einfacher, effizienter und trägt auch zur optimalen Auslastung<br />
aller Einrichtungen bei. Die Voraussetzungen zur Nutzung<br />
beschränken sich auf einen PC mit Internetbrowser und Internetzugang.<br />
Die Nutzung wird mit einer einmaligen Installationsgebühr<br />
und der monatlichen Pauschale von etwa 50 Euro pro<br />
Monat und Kita abgegolten.<br />
Lösung umfasst drei Portale: für Eltern, Kitas und die<br />
Verwaltung<br />
Über das Elternportal können Erziehungsberechtigte ihre<br />
Kinder online anmelden und für einen Kinderbetreuungsplatz<br />
vormerken lassen. Die Kinderbetreuungseinrichtungen verwalten<br />
über das Kitaportal den Anmeldungsprozess, die Stammdaten<br />
sowie die Bestands- und Anwesenheitsdaten. Als Stammdaten<br />
lassen sich grundsätzlich Informationen zu Einrichtungen (z. B.<br />
Betreuungsformen, Öffnungszeiten), über die Gruppen (z. B.<br />
277
Presseschau <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Betreuer, Größe), Förderprogramme, das Kind (z. B. Name,<br />
Anschrift, Abholberechtigte) sowie Trägerdaten und die Benutzerverwaltung<br />
anlegen.<br />
Über das Verwaltungsportal besteht Zugriff auf die Module<br />
Abrechnung und Planung. Hier werden die in Anspruch genommenen<br />
Leistungen erfasst und Kitagruppen mit Kapazitäten,<br />
Altersstufen, Betreuungsaufwand und weiteren Daten sowie die<br />
Einteilung der Mitarbeiter geplant.<br />
Eltern suchen Kinderbetreuung<br />
Alltag in Städten und Gemeinden: Jahr für Jahr suchen viele Eltern<br />
den am besten geeigneten Platz für ihr Kind in einer Kinderkrippe,<br />
einem Kindergarten, einer Kindertagesstätte oder vergleichbaren<br />
Einrichtungen. Das Angebot ist vielfältig, die Wünsche der Eltern<br />
ebenso. Einige treffen ihre Wahl einfach anhand der Entfernung<br />
von Zuhause, bei anderen hat zum Beispiel die pädagogische oder<br />
religiöse Ausrichtung der Kinderbetreuung Vorrang. Eines ist aber<br />
bei allen gleich: Der Abgleich zwischen Angebot und Nachfrage<br />
ist extrem zeitaufwändig und oft zermürbend, wenn nach Suche,<br />
Erstinformation, Entscheidung und Anmeldung dann eine Absage<br />
mangels ausreichender Kapazitäten kommt.<br />
Kommunen bieten „KindergartenOnline“<br />
Moderne Kommunen bieten Eltern umfassende, vergleichbare<br />
und transparente Informationen und die Möglichkeit der Buchung<br />
von Kinderbetreuungsplätzen über das Internet an. T-<br />
Pressemitteilung 4/11<br />
Neue Fördermöglichkeiten von Schulen und Kitas im ländlichen<br />
Raum mit Wermutstropfen<br />
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag begrüßt die von der<br />
Sächsischen Staatsregierung beschlossene Erweiterung der Förderkulisse<br />
der ILE-Förderung. Mit der Änderung der Förderrichtlinie<br />
zur Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) kann nun auch der<br />
Neubau und die Modernisierung von Schulgebäuden, Schulsporthallen,<br />
Schulsportaußenanlagen und Kindertageseinrichtungen<br />
im ländlichen Raum gefördert werden. Mit dieser Erweiterung<br />
der Förderkulisse wird den Bedürfnissen der Praxis Rechnung<br />
getragen. Den Kommunen im ländlichen Raum kann es damit<br />
leichter fallen, eine zeitgemäße Bildungsinfrastruktur vorzuhalten.<br />
Das ist vor allem für junge Familien ein maßgeblicher Faktor, sich<br />
für den ländlichen Raum zu entscheiden.<br />
„Die Erweiterung der ILE-Förderung ist zunächst einmal eine gute<br />
Nachricht für die Kommunen im ländlichen Raum. Sie ist aber<br />
leider auch mit einem bitteren Wermutstropfen vermengt.“, erklärte<br />
278<br />
Presseschau<br />
Systems hat hierfür eine modulare Lösung auf einer modernen<br />
IT-Plattform entwickelt. Einfach und übersichtlich: Die Eckdaten<br />
aller Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt oder Gemeinde<br />
werden Eltern in einheitlicher Struktur und Informationstiefe<br />
angezeigt. So können sie ihr Kind zum Beispiel online für bis<br />
zu drei Einrichtungen vormerken lassen und diese entsprechend<br />
priorisieren. Die Einrichtung setzt sich dann kurzfristig mit den<br />
Eltern in Verbindung. Erste Praxiserfahrungen haben gezeigt,<br />
dass die Kommunen durch „KindergartenOnline“ den Bedarf an<br />
Kinderbetreuungsangeboten dreimal so schnell planen können<br />
wie beim herkömmlichen manuellen Verfahren. Abgesehen vom<br />
modernen, familienfreundlichen Image profitieren Städte und<br />
Gemeinden auch davon, dass Mehrfachanmeldungen suchender<br />
Eltern vermieden werden.<br />
Die Verantwortung für den reibungslosen Betrieb liegt komplett<br />
bei T-Systems, sodass sich auch der Kämmerer über die Lösung<br />
freut: Denn hohe Investitionskosten gehören der Vergangenheit<br />
an, die Services werden auf Basis einer monatlichen Gebühr bezogen.<br />
So sind die Ausgaben langfristig plan- und kalkulierbar.<br />
Kontakt:<br />
T-Systems International GmbH<br />
Jörg Uterhardt<br />
Holzhauser Straße 4-8<br />
13509 Berlin<br />
Tel. +49 30 835360530<br />
E-Mail: joerg.uterhardt@t-systems.com<br />
www.t-systems.com<br />
Weitere Informationen: www.kindergarten.friedrichshafen.de<br />
Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des SSG. Auf die Kritik des<br />
SSG stoßen die hohen Anforderungen zur Energieeinsparung<br />
im Schul- und Kindertagesstättenbereich. Die geänderte Förderrichtlinie<br />
sieht vor, dass die geltenden Werte in den Gesetzesvorschriften<br />
zur Energieeinsparung bei Sanierungen um 30 %<br />
und beim Neubau des Gebäudes sogar um 45 % unterschritten<br />
werden müssen. „Die hohen energetischen Anforderungen werden<br />
gerade bei Gebäuden im Bestand zu erheblichen Mehrkosten führen.<br />
Das Verhältnis von Aufwand und Nutzen kann dann sehr ungünstig<br />
ausfallen. Außerdem bezweifeln wir, ob bei einigen Bestandsgebäuden<br />
die Werte überhaupt erreicht werden können. Was nur auf<br />
dem Papier funktioniert, wird die Praxis noch vor große Probleme<br />
stellen.“ so Woitscheck weiter.<br />
Die besonderen energetischen Anforderungen führen auch<br />
dazu, dass die bereits bei der SAB vorliegenden Altanträge aus<br />
der Förderung der Schulhausbaurichtlinie überarbeitet werden<br />
müssen. Diese Umplanung wird einen hohen Aufwand an Kosten<br />
und Zeit verursachen.<br />
Dresden, 13. April <strong>2011</strong>
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Presseschau<br />
Pressemitteilung 5/11<br />
Eine vertane Chance zum Bürokratieabbau und zur Stärkung<br />
der Wirtschaftskraft vor Ort – Kommunen fordern Vereinfachungen<br />
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge<br />
Sachsen ist das Schlusslicht unter allen Bundesländern, wenn<br />
es um die Entbürokratisierung und Flexibilisierung des Vergaberechts<br />
geht. Dieses Fazit hat der Sächsische Städte- und Gemeindetag<br />
anlässlich der heutigen VOB-Tagung der Bauindustrie<br />
in Leipzig gezogen. Der kommunale Spitzenverband kritisiert,<br />
dass der Freistaat Sachsen als einziges Bundesland die gültigen<br />
Konjunkturpaket-Wertgrenzen für beschränkte und freihändige<br />
Vergaben über das Jahr 2010 hinaus nicht verlängert hat. Das<br />
gehe auch zu Lasten der regionalen Wirtschaft.<br />
Im Rahmen der effektiven Bekämpfung der Finanz- und Wirtschaftskrise<br />
über das Konjunkturpaket II wurden auch in Sachsen<br />
die Vergabevorschriften in den Jahren 2009 und 2010 gelockert.<br />
Dabei wurden die Wertgrenzen für freihändige Vergaben und<br />
beschränkte Ausschreibungen erhöht, um Aufträge schnell und<br />
effektiv vergeben zu können. Diese Lockerungen haben sich<br />
bundesweit bewährt. Mit Ausnahme Sachsens haben alle anderen<br />
Bundesländer über den 31.12.2010 hinaus daran festgehalten.<br />
Mit Sorge sieht der Sächsische Städte- und Gemeindetag, dass in<br />
Sachsen ganz im Gegenteil ein weiterer Ausbau von Standards im<br />
sächsischen Vergaberecht diskutiert wird. „Das würde die Vergabe<br />
von Aufträgen verzögern, unter Umständen sogar verhindern. Wir<br />
erinnern an die sächsische Koalitionsvereinbarung zwischen CDU<br />
und FDP, wonach die Vergabeverfahren vereinfacht und verkürzt<br />
werden sollten“, sagte der Geschäftsführer des kommunalen<br />
Spitzenverbandes, Mischa Woitscheck.<br />
Die Änderung der Vorschriften des sächsischen Vergaberechts<br />
sowie andere aktuelle Fragestellungen bei der öffentlichen Auftragsvergabe<br />
sind Gegenstand der heutigen VOB-Tagung der<br />
Bauindustrie in Leipzig, an der neben Vertretern der Bauindustrie<br />
auch kommunale und staatliche Vertreter teilnehmen.<br />
Dresden, 14. April <strong>2011</strong><br />
Pressemitteilung Nr. 06/11<br />
SSG begrüßt Winterschadensprogramm und fordert schnelle<br />
und unbürokratische Umsetzung<br />
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) hat im Rahmen<br />
seiner heutigen Präsidiumssitzung die von der Staatsregierung<br />
geplante „Richtlinie Winterschäden <strong>2011</strong> und 2012“ begrüßt.<br />
Der Präsident des SSG, Oberbürgermeister Christian Schramm<br />
aus Bautzen, hob das dringende Bedürfnis für den zügigen Erlass<br />
dieser Richtlinie hervor.<br />
„Die 20 Mio. Euro, die der Freistaat Sachsen in <strong>2011</strong> und 2012<br />
insgesamt für kommunale Straßen zur Verfügung stellt, erfüllen zwar<br />
nicht alle Hoffnungen der kommunalen Ebene. Zusammen mit den<br />
20 Mio. Euro, die die kommunale Familie aus dem kommunalen<br />
Finanzausleich selbst beisteuert, steht den Kommunen aber immerhin<br />
ein Betrag von knapp 670 Euro pro Jahr und Kilometer Straße<br />
zur Verfügung“, sagte Schramm.<br />
Schramm forderte, dass die Mittel nicht nur für größere Deckenbaumaßnahmen<br />
eingesetzt werden können, sondern u. a. auch<br />
für die Beseitigung von Schlaglöchern. Ansonsten komme man<br />
mit den Mitteln nicht sehr weit.<br />
Flexibilität benötigen die Kommunen bei der Erbringung ihres<br />
Eigenanteils von 25%. „Wer <strong>2011</strong> Mittel abruft, der sollte seinen<br />
Eigenanteil auch in 2012 oder Anfang 2013 noch erbringen können“,<br />
stellte der SSG klar. Abgerechnet werden muss erst Ende<br />
März 2013.<br />
Notwendig ist auch, dass in der Richtlinie ein konkreter Termin<br />
festgesetzt wird, an dem die Förderung ausgezahlt wird, um<br />
den Kommunen Planungssicherheit zu geben. Für <strong>2011</strong> ist<br />
dieser Termin schnellstmöglich und für das Jahr 2012 im ersten<br />
Quartal festzulegen.<br />
Dresden, 25. Mai <strong>2011</strong><br />
Pressemitteilung Nr. 07/<strong>2011</strong><br />
Aufschwung geht an den sächsischen Kommunen bislang<br />
vorbei<br />
SSG fordert Investprogramm für Kindergärten<br />
„Der konjunkturelle Aufschwung ist derzeit in den Kassen der<br />
sächsischen Kommunen nicht spürbar“, stellte der Geschäftsführer<br />
des Sächsischen Städte- und Gemeindetages Mischa Woitscheck<br />
heute fest. Erst vergangene Woche hatte der Sächsische<br />
Finanzminister, Prof. Dr. Georg Unland, noch anlässlich der<br />
Vorstellung der Mai-Steuerschätzung berichtet, die sächsischen<br />
Kommunen könnten sich wie der Freistaat über steigende Einnahmen<br />
freuen.<br />
Im ersten Quartal <strong>2011</strong> sind die Einnahmen der sächsischen<br />
Kommunen gegenüber dem Vorjahresquartal (I/2010) um<br />
rund 80 Mio. Euro bzw. knapp 4 % gesunken. Zwar sei bei<br />
den Steuereinnahmen ein leichtes Plus von 1 % zu verzeichnen.<br />
Dies falle aber angesichts des deutlichen Rückgangs der Zuweisungen<br />
des Freistaates Sachsen kaum ins Gewicht. Die wichtigen<br />
Schlüsselzuweisungen seien um mehr als 3 % gesunken, die<br />
Investitionszuweisungen sogar um 35 %.<br />
Den Ausgabenanstieg konnten die Kommunen auf knapp 1 %<br />
begrenzen, obwohl die Tarifsteigerungen zu einem Personalkostenanstieg<br />
von über 4 % geführt haben.<br />
Bedenklich ist, dass das Verhältnis zwischen Einnahmen und<br />
Ausgaben sich trotz anziehender Konjunktur kontinuierlich<br />
verschlechtert. Erstmals seit längerer Zeit rutschten die sächsischen<br />
Kommunen wieder ins Minus. Der Finanzierungssaldo<br />
weist einen Verlust von rund 34 Mio. Euro aus.<br />
Besonders hart traf es die Kreisfreien Städte. Deren Einnahmen<br />
gingen um fast 10 % zurück.<br />
Mit Blick auf die aktuelle Mai-Steuerschätzung <strong>2011</strong> stellte<br />
Woitscheck fest, dass die Einnahmezuwächse vor allem beim<br />
Freistaat Sachsen zu beobachten seien.<br />
Woitscheck forderte daher ein Kindergarteninvestitionsprogramm.<br />
Bislang reiche das Land nur die Investmittel des Bundes<br />
für den Krippenausbau weiter. Gerade in den Großstädten steige<br />
die Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen dramatisch<br />
an. Neue Kindergartenplätze würden jedoch außerhalb von<br />
Orten über 5.000 Einwohnern nicht gefördert.<br />
Dresden, 07.06.<strong>2011</strong><br />
279
Aus Büchern und Zeitschriften <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Neuerscheinungen<br />
Lindner<br />
Verwaltungsvollstreckungsgesetz für den Freistaat Sachsen<br />
Kommentar zum sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz<br />
unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung<br />
<strong>2011</strong>, 668 Seiten, ISBN 978-3-842-3 679- , 79,80 EUR, Books<br />
on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Tel.:<br />
<strong>04</strong>0/ 3 <strong>43</strong> 3 11, Fax: <strong>04</strong>0/ 3 <strong>43</strong> 3 84, E-Mail: info@bod.de,<br />
Internet: www.bod.de<br />
von Tilo Lindner, Justiziar im Landratsamt Meißen<br />
Wenn der Beschwerte eines Verwaltungsakts nicht freiwillig<br />
die darin benannten Pflichten erfüllt, bedarf es einer zwangsweisen<br />
Vollstreckung dieser Pflichten. Zur Vollstreckung von<br />
Verwaltungsakten ist die Verwaltung nicht auf die Tätigkeit der<br />
Gerichtsvollzieher angewiesen. Sie kann auf Basis des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes<br />
selbst vollstrecken.<br />
Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für den Freistaat Sachsen<br />
gliedert sich in vier Teile. Der erste Teil betrifft die allgemeinen<br />
Vorschriften über die Verwaltungsvollstreckung unabhängig von<br />
der Art des zu vollstreckenden Verwaltungsakts. Im zweiten Teil<br />
wird die Vollstreckung von Leistungsbescheiden, im dritten Teil<br />
die Vollstreckung sonstiger Verwaltungsakte geregelt. Im vierten<br />
Teil finden sich die Schluss- und Übergangsbestimmungen.<br />
Diese Kommentierung richtet sich vorwiegend an die Verwaltungen<br />
öffentlich-rechtlicher Körperschaften im Freistaat<br />
Sachsen. Um einen größtmöglichen Praxisbezug herzustellen,<br />
liegt der Schwerpunkt der Arbeit in einer Auswertung der einschlägigen<br />
Rechtsprechung. Rechtstheoretische Betrachtungen<br />
stehen eher im Hintergrund.<br />
Spellbrink u. a.<br />
Verfassungsrechtliche Probleme im SGB II<br />
Neue Regelleistungen und Organisationsreform<br />
<strong>2011</strong>, 96 Seiten, DSGT-Praktikerleitfäden, ISBN 978-3-41 -<br />
<strong>04</strong>639-9, 14,80 EUR, hrsg. vom Deutschen Sozialgerichtstag<br />
e. V., erschienen im Richard Boorberg Verlag GmbH & Co. KG,<br />
Scharrstraße 2, 70 63 Stuttgart bzw. Levelingstraße 6 a, 81673<br />
München, Tel.: 0711/7 38 0, Fax: 0711/7 38 1 00, E-Mail:<br />
mail@boorberg.de, Internet: www.boorberg.de<br />
von Professor Dr. Wolfgang Spellbrink, Richter am Bundessozialgericht,<br />
Leiter der Kommission SGB II des Deutschen Sozialgerichtstags<br />
e. V., mit Vorträgen von Professor Dr. Johannes Münder, TU<br />
Berlin, Lehrstuhl für Sozialrecht und Zivilrecht, und Dr. Steffen<br />
Luik, Richter am Sozialgericht, zzt. BMAS, Referat Grundsatzfragen<br />
der Grundsicherung für Arbeitsuchende<br />
Die verfassungsrechtlichen Probleme im SGB II im Zusammenhang<br />
mit den neuen Regelleistungen und der Organisationsreform<br />
bildeten die Schwerpunkte der Kommission SGB II<br />
unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Spellbrink auf dem<br />
280<br />
Aus Büchern und Zeitschriften<br />
3. Deutschen Sozialgerichtstag am 18. und 19. November 2010<br />
in Potsdam.<br />
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 9. Februar<br />
2010 erstmals ein „Grundrecht auf Gewährleistung eines<br />
menschenwürdigen Existenzminimums“ postuliert. Prof. Dr.<br />
Johannes Münder von der TU Berlin gab auf der Veranstaltung<br />
seine rechtsgutachterliche Stellungnahme zu der Frage ab, ob<br />
der Regierungsentwurf des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen<br />
und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches<br />
Sozialgesetzbuch diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen<br />
gerecht wird. Im Anschluss daran referierte RiSG Dr. Steffen<br />
Luik vom BMAS über die Grundprinzipien der Organisationsreform<br />
des SGB II, die erforderlich geworden war, nachdem das<br />
Bundesverfassungsgericht die bisherige Regelung ebenfalls für<br />
verfassungswidrig erklärt hatte.<br />
Getreu dem Motto „Aus der Praxis für die Praxis“ richtet sich dieser<br />
Band an Personen, die mit dem SGB II beruflich zu tun haben<br />
wie Richter/-innen der Sozialgerichtsbarkeit, Mitarbeiter/-innen<br />
der Grundsicherungsträger, Berater/-innen der Sozialverbände<br />
sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.<br />
Metzler-Müller, Rieger, Seeck, Zentgraf<br />
Beamtenstatusgesetz<br />
Kommentar<br />
2010, 06 Seiten, kartoniert, ISBN 978-3-8293-0881-6,<br />
9,00 EUR, erschienen im Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &<br />
Co. KG, Konrad-Adenauer-Ring 13, 6 187 Wiesbaden, Tel.:<br />
(06 11) 8 80 86 10, Fax: (06 11) 8 80 86 77, E-Mail: bestellung@<br />
kommunalpraxis.de, www.kommunalpraxis.de<br />
Der Kommentar ist dem Rechtsanwender in der Verwaltungspraxis<br />
sowie für den gesamten öffentlichen Dienst in den Bundesländern<br />
eine kompetente und wichtige Orientierungs- und<br />
Arbeitshilfe.<br />
Das Werk enthält ein informatives Vorwort, dem sich eine Inhaltsübersicht<br />
sowie ein Abkürzungs- und ein Literaturverzeichnis<br />
anschließen. Vor dem Gesetzestext im Zusammenhang werden<br />
in einer Einführung die Historie, die Gesetzesentstehung und<br />
der Inhalt des Beamtenstatusgesetzes aufgezeigt. Anschließend<br />
werden die einzelnen Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes erläutert.<br />
Die Verfasser orientieren sich dabei vor allem auch an den<br />
Bedürfnissen und Interessen der Kommunalverwaltungen in den<br />
Ländern. Die Beiträge sind daher praxisnah ausgestaltet unter<br />
Einbeziehung von entsprechenden Beispielen und Übersichten.<br />
Im Anhang sind die Texte der ergänzenden Rechtsvorschriften<br />
abgedruckt. Ein Stichwortverzeichnis ermöglicht dem Benutzer,<br />
sich den Inhalt des Werkes noch besser zu erschließen.<br />
Die Kommentierung erleichtert damit den praktischen<br />
Aufgabenvollzug, denn ab sofort müssen immer zwei Gesetze<br />
parat sein: das Beamtenstatusgesetz und das jeweilige<br />
Landesbeamtengesetz.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Aus Büchern und Zeitschriften<br />
Der Kommentar wendet sich als wichtige Arbeits- und Orientierungshilfe<br />
an alle mit der Materie befassten Personen, insbesondere<br />
an Mitarbeiter in Kommunalverwaltungen und Landesbehörden,<br />
an Rechtsanwälte, Auszubildende und Studierende.<br />
Die AutorInnen: Prof. Dr. Karin Metzler-Müller und Renate<br />
Zentgraf lehren an der Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden.<br />
Dr. Reinhard Rieger leitet das Beamtenrechtsreferat im zentralen<br />
Personalamt beim Senat der Freien und Hansestadt Hamburg.<br />
Erich Seeck war viele Jahre Leiter des Dienstrechtsreferats im<br />
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein.<br />
de Riese<br />
Buchführung für Kommunen<br />
Einführung<br />
<strong>2011</strong>, 40 Seiten, CD-Rom-Ausgabe, ISBN 978-3-8293-09<strong>43</strong>-1,<br />
9,80 EUR, erschienen im Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &<br />
Co. KG, Konrad-Adenauer-Ring 13, 6 187 Wiesbaden, Tel.:<br />
(06 11) 8 80 86 10, Fax: (06 11) 8 80 86 77, E-Mail: vertrieb@<br />
kommunalpraxis.de, www.kommunalpraxis.de<br />
Nahezu alle Bundesländer haben seit einigen Jahren das bisherige<br />
System der sog. kameralistischen Buchhaltung aufgegeben und<br />
eine Variante der allgemeinen kaufmännischen Buchhaltung eingeführt.<br />
So wie es für einzelne Branchen höchst unterschiedliche<br />
Varianten innerhalb des Systems der doppelten Buchführung<br />
gibt, wird es zwangsläufig auch in der kommunalen Doppik<br />
ständige Veränderungen und Anpassungen geben. Der Grundsatz<br />
der sogenannten doppelten Buchführung, kurz Doppik, ist<br />
kaufmännischen Unternehmen seit eh und je vorgeschrieben und<br />
selbstverständlich und sozusagen ein buchhalterisches Grundgesetz<br />
und gilt somit auch für die kommunale Doppik.<br />
Behördenmitarbeiter haben dieses System in ihrer Ausbildung im<br />
Allgemeinen nicht gelernt. Die kurze Anleitung dient dazu, diese<br />
Lücke zu schließen. Ihr Zweck ist eine allgemeine Annäherung<br />
der Mitarbeiter an das sog. doppische System.<br />
„Buchführung für Kommunen“ ist die sichere Hilfe für Mitarbeiter/-innen<br />
in Kommunalverwaltungen, kommunalen Aufsichtsbehörden,<br />
Kommunalberatungen sowie für die Aus- und<br />
Weiterbildung.<br />
Der Autor: Dipl. Handelslehrer, Oberstudienrat i. R. Hans-<br />
Otto de Riese hat während seiner beruflichen Tätigkeit Buchhaltung<br />
gelehrt und ist somit ein Kenner aller Varianten der<br />
Buchführung.<br />
Pöhlker/Lausen<br />
Vergaberecht<br />
Kommentar<br />
<strong>2011</strong>, Loseblattausgabe, 470 Seiten, ISBN 978-3-8293-0884-7,<br />
,00 EUR, erschienen im Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &<br />
Co. KG, Konrad-Adenauer-Ring 13, 6 187 Wiesbaden, Tel.:<br />
(06 11) 8 80 86 10, Fax: (06 11) 8 80 86 77, E-Mail: bestellung@<br />
kommunalpraxis.de, www.kommunalpraxis.de<br />
Das öffentliche Beschaffungs- und Vergaberecht regelt die Vergabe<br />
von Bauleistungen, Lieferleistungen sowie gewerblichen<br />
und freiberuflichen Dienstleistungen durch den öffentlichen<br />
Auftraggeber. Das neue Erläuterungswerk bietet mit den aktuellen<br />
Vergabevorschriften – ergänzt durch VOB/B, VOL/B und<br />
die Richtlinien für Planungswettbewerbe – eine sichere Basis für<br />
die Durchführung von Ausschreibungen.<br />
Die für das innerstaatliche und das europaweite Ausschreibungsverfahren<br />
anzuwendenden Vergabevorschriften (GWB, Vergabeordnung<br />
(VgV), Sektorenverordnung (SektVO), VOB/A,<br />
VOL/A und VOF) wurden erheblich verändert. Dies stellt den<br />
öffentlichen Auftraggeber vor neue Herausforderungen.<br />
Zu erwähnen sind dabei besonders die<br />
– Einschränkungen bei der Vereinbarung von Sicherheitsleistungen<br />
– Erweiterungen der Wertungsmöglichkeiten bei fehlenden<br />
Erklärungen und Preisen<br />
– Freigrenzen für die Durchführung Beschränkter Ausschreibungen<br />
und Freihändiger Vergaben<br />
– Einheitliche Regelungen für Sektorenauftraggeber durch<br />
die Sektorenverordnung freier Wahl der Vergabearten<br />
– Anwendung sozialer, umweltbezogener und innovativer<br />
Vergabekriterien und der Tariftreue und Berücksichtigung<br />
mittelständischer Interessen bei europaweiten Ausschreibungen<br />
– Einschränkung von Bieterrechten in Zusammenhang mit<br />
Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer und dem<br />
OLG.<br />
Im Werk ergänzen praxisorientierte Kommentierungen die Texte<br />
zu den Vergabevorschriften. Beginnend mit der Kommentierung<br />
zur VOB/A, in Kürze durch die Kommentierungen zur VOL/A<br />
und VOF erweitert, werden anschließend die Vorschriften des<br />
GWB, der VgV und der SektVO kommentiert werden.<br />
Der Kommentar ist die ideale Hilfe für öffentliche Einrichtungen,<br />
Kommunen, Kommunalunternehmen, privatwirtschaftliche<br />
Unternehmen, Anwälte, mit dem Vergaberecht befasste<br />
Auftraggeber und Auftragnehmer.<br />
Die Autoren: Dipl.-Ing. Johannes Pöhlker, Rechtsanwalt,<br />
Ldt. Verwaltungsdirektor beim Hessischen Städte- und Gemeindebund.<br />
Dr. jur. Irene Lausen, Referentin im Hessischen<br />
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung.<br />
Beide sind hauptamtliche Beisitzer bei der Vergabekammer des<br />
Landes Hessen.<br />
Pattar<br />
Die Hartz-IV-Synopse<br />
Mit allen Änderungen durch die Bundesratsbeschlüsse vom<br />
25.02.<strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong>, 221 Seiten, broschiert, ISBN 978-3-8329-6611-9,<br />
19,00 EUR, Nomos (in Zusammenarbeit mit Deutscher Verein für<br />
öffentliche und private Fürsorge), Nomos Verlagsgesellschaft Baden-<br />
Baden, Waldseestraße 3- , 76 30 Baden-Baden, Tel.: (0 722 21)<br />
2 10 40, Fax: (0 72 21) 21 <strong>04</strong> 79, E-Mail: nomos@nomos.de,<br />
Internet: www.nomos.de<br />
von Prof. Dr. Andreas Kurt Pattar<br />
Die Reform zu Hartz IV ist verabschiedet. Transparenz war<br />
durch das Bundesverfassungsgericht eingefordert, entstanden ist<br />
nach langem Ringen ein Gesetzespaket, das über die im Kern<br />
betroffenen Regelungen des SGB II und XII hinaus in insgesamt<br />
20 Gesetzen und Verordnungen zu Änderungen geführt hat.<br />
Das Ergebnis langwieriger politischer Diskussionen sind äußerst<br />
unübersichtliche Regelungen.<br />
Der Synopsenband zu Hartz IV führt sicher durch die Neuregelungen.<br />
Durch eine absatzgenaue Gegenüberstellung der<br />
Neu- mit den Altregelungen erfasst man die Änderungen auf<br />
einen Blick. Es kann sofort mit der Fallbearbeitung, auf dem<br />
Hintergrundwissen der alten Regelungen begonnen werden.<br />
281
Aus Büchern und Zeitschriften <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Die vorgeschaltete Gegenüberstellung Alt-Neu erlaubt zudem<br />
das schnelle Auffinden der neuen Vorschriften.<br />
Ganz besonders wichtig: Der Band berücksichtigt alle gesetzlichen<br />
Änderungen bis hin zum Bundesratsbeschluss vom<br />
25. Februar <strong>2011</strong>. Damit werden sämtliche Auswirkungen auf<br />
die Sozialrechtsberatung erfasst.<br />
Müller<br />
Kaufmännische Rechnungslegung im kommunalen Gesamtabschluss<br />
Instrument zur Steuerung des „Konzerns Kommune“<br />
<strong>2011</strong>, 220 Seiten, kartoniert, Reihe: Schriften zur Rechnungslegung,<br />
Band 11, ISBN 978-3- 03-12426-8, 38,60 EUR, Erich Schmidt<br />
Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 1078 Berlin,<br />
Tel.: 030/2 008 0, Fax: 030/2 008 4 1, E-Mail: ESV@ESVmedien.de,<br />
Internet: www.esv.info<br />
Der Gesamtabschluss kennt in der kameralen Haushaltswirtschaft<br />
im Gegensatz zum Jahresabschluss keine Vorläufer. Daher<br />
betreten viele Städte und Gemeinden mit der Aufgabe, einen<br />
Gesamtabschluss zu erstellen, Neuland.<br />
Dr. Florian Müller setzt sich in seinem Buch detailliert mit den<br />
Zielen der kommunalen „Konzernrechnungslegung“ auseinander<br />
und erläutert auch die Wirkungen des Gesamtabschlusses auf<br />
die Steuerung des „Konzerns Kommune“. Basierend auf einer<br />
Analyse der Gesetzgebungsverfahren in allen Flächenbundesländern<br />
beantwortet der Autor dabei die Fragen:<br />
Wie viel Transparenz schafft ein Gesamtabschluss über die<br />
kommunale Verschuldung und was kann der Gesetzgeber tun,<br />
um die Transparenz zu verbessern?<br />
Welche Steuerungsansätze bietet der Gesamtabschluss und wie<br />
können Kommunen ihre Steuerung konkret aufbauen?<br />
Praxisgerechte Fachinformation, die die Normauslegung<br />
erleichtert und wertvolle Ansatzpunkte für die Nutzung des<br />
Gesamtabschlusses bietet!<br />
Gleich/Schentler<br />
Strategische und operative Planung in Kommunen<br />
Koordination, Steuerung, Budgetierung<br />
2010, 1 3 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, Format 1 ,8 x<br />
23, cm, ISBN 978-3- 03-12607-1, 34,00 EUR, Erich Schmidt<br />
Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 1078 Berlin,<br />
Tel.: 030/2 008 0, Fax: 030/2 008 4 1, E-Mail: ESV@ESVmedien.de,<br />
Internet: www.esv.info<br />
von Prof. Dr. Ronald Gleich und Dr. Peter Schentler, aus der Reihe<br />
Kommunale Verwaltungssteuerung, Band 6, herausgegeben von<br />
Prof. Dr. Stefan Müller und Prof. Dr. Christina Schaefer<br />
Ohne strategische und operative Planung kommt keine Organisation<br />
voran. Sie ist heute gerade für Kommunen der Schlüssel<br />
zu mehr Wirtschaftlichkeit und Transparenz, aber auch einem<br />
attraktiven Leistungsspektrum für die Bürger.<br />
Alle wichtigen Grundlagen der strategischen und operativen Planung<br />
im öffentlichen Sektor bietet dieses Buch. Ronald Gleich<br />
und Peter Schentler zeigen dabei, wie Gestaltungsfreiräume in<br />
der Praxis genutzt werden können. Die Schwerpunkte sind:<br />
– Prozesse der strategischen Planung: Strategien formulieren,<br />
entwickeln, implementieren<br />
– operative Planung, Budgetierung und Berichtssystem<br />
– operative und strategische Kontrolle<br />
282<br />
Ob SWOT-Analyse, Balanced Scorecard oder Forecasting – anschauliche<br />
Beispiele erleichtern die Anwendung in der Praxis.<br />
Erhorn-Kluttig, Jank, Schrempf, Dütz, Rumpel, Schrade, Erhorn,<br />
Beier, Sager, Schmidt<br />
Energetische Quartiersplanung<br />
Methoden – Technologien – Praxisbeispiele<br />
<strong>2011</strong>, 326 Seiten, ISBN 978-3-8167-8411-1, 6 ,00 EUR,<br />
Fraunhofer-Gesellschaft, Fraunhofer-Informationszentrum Raum<br />
und Bau IRB, Nobelstraße 12, 70 69 Stuttgart, Tel.: 0711/9 70<br />
2 00, Fax: 0711/9 70 2 08, E-Mail: irb@irb.fraunhofer.de,<br />
www.irb.fraunhofer.de<br />
Vom einzelnen Gebäude bis hin zum neuen Wärmenetz – städtische<br />
Siedlungsräume bieten viele Ansatzpunkte zur Steigerung<br />
der Energieeffizienz. Dieses Potential durch intelligenten Einsatz<br />
und Vernetzung neuer Technologien systematisch zu nutzen und<br />
weiter auszubauen, ist das Ziel der BMWi-Forschungsinitiative<br />
EnEff:Stadt. Der Gedanke einer „integralen Planung“ soll sowohl<br />
in Siedlungsprojekten wie in Nah- und Fernwärmesystemen<br />
realisiert werden – unterstützt durch aktuelle Planungs- und Bewertungsverfahren<br />
sowie die Forschung an Systemkomponenten<br />
und Betriebsweisen. So entsteht gezieltes Know-how für die Stadt<br />
der Zukunft.<br />
Das Fachbuch „Energetische Quartiersplanung“ fasst auf<br />
326 Seiten bereits vorhandene Grundlagen für kommunale<br />
Energieversorgungskonzepte, in den letzten Jahren (weiter-<br />
)entwickelte Technologien im Gebäudebereich und bei der Gebäudetechnik,<br />
sowie unterschiedliche Energieversorgungsarten<br />
zusammen. Weitere Kapitel gehen näher auf Siedlungstypologien,<br />
vorhandene Planungwerkzeuge, Rahmenbedingungen<br />
wie gesetzliche Anforderungen und vorhandene nationale und<br />
internationale Fördermittel, mögliche Bewertungskriterien<br />
für energieeffiziente Stadtteile und Handlungsempfehlungen<br />
ein. Dabei werden insbesondere die Bestandteile der BMWi-<br />
Forschungsinitiative EnEff:Stadt mit ihren Förderkriterien,<br />
laufenden Demonstrationsvorhaben und Messanforderungen<br />
hervorgehoben. Zusätzliche beispielhafte Projekte wurden aus<br />
nationalen und internationalen Vorhaben ausgewählt und beschrieben.<br />
Die möglichen Bewertungskriterien beinhalten einen<br />
Ansatz für einen Energieausweis für Quartiere und erläutern die<br />
ersten Arbeiten zu einem Energiekonzeptberater für Stadtteile.<br />
Im Schlusskapitel werden der Stand der Quartiersplanung in<br />
Deutschland, vorhandene Schwachstellen bzw. Entwicklungsbedarf<br />
und Überlegungen zur Quartiersplanung der Zukunft<br />
erläutert.<br />
Die Publikation entstand im Rahmen des Begleitforschungsprojektes<br />
der Förderinitiative „Energieeffiziente Stadt (EnEff:<br />
Stadt)“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie<br />
(BMWi).<br />
Nachauflagen<br />
Wager<br />
Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung der Eigenbetriebe und<br />
der Kommunalunternehmen<br />
<strong>2011</strong>, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, 212 Seiten,<br />
34,00 EUR, ISBN 978-3-41 -<strong>04</strong> 94-1, erschienen im Richard<br />
Boorberg Verlag GmbH & Co. KG, Scharrstraße 2, 70 63 Stuttgart<br />
bzw. Levelingstraße 6 a, 81673 München, Tel.: 0711/7 38 0,
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Aus Büchern und Zeitschriften<br />
Fax: 0711/7 38 1 00, E-Mail: mail@boorberg.de, Internet: www.<br />
boorberg.de<br />
von Monika Wager, Revisionsdirektorin im Bayerischen Kommunalen<br />
Prüfungsverband (BLPV)<br />
Ausführlich behandelt die Autorin die Ausweis- und Bewertungsprobleme<br />
im Jahresabschluss der Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen.<br />
Der Aufbau des Werkes folgt in seinen beiden<br />
Hauptteilen dem amtlichen Gliederungsschema der Bilanz einerseits<br />
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung andererseits.<br />
Praktische Beispielsfälle veranschaulichen häufig auftretende<br />
Bilanzierungsprobleme. So kann Ausweis- und Bewertungsmängeln<br />
in der Praxis vorgebeugt werden.<br />
Der praxisorientierten Darstellung liegen die Bayerische<br />
Eigenbetriebsverordnung (EBV) und die Verordnung über<br />
Kommunalunternehmen (KUV) zugrunde. Durch das Gesetz<br />
zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz<br />
– BilMoG) vom 25.05.2009 sind die Rechnungslegungsvorschriften<br />
des Handelsgesetzbuchs (HGB) grundlegend<br />
geändert worden. Wegen ihrer dynamischen Verweise auf das<br />
HGB sind davon auch die Eigenbetriebsverordnung und die<br />
Verordnung über Kommunalunternehmen betroffen.<br />
Die neuen Rechnungslegungsvorschriften finden grundsätzlich<br />
erstmals für die in <strong>2011</strong> zu erstellenden Jahresabschlüsse 2010<br />
Anwendung. Die ertragsteuerlichen Bemessungsgrundlagen<br />
werden durch die neuen Vorschriften nicht berührt. Daher<br />
können künftig verstärkte Divergenzen zwischen Handelsbilanz<br />
und Steuerbilanz auftreten; in der Neuauflage werden deshalb<br />
auch wesentliche Ansatz- und Bewertungsunterschiede zwischen<br />
Handelsbilanz und Steuerbilanz dargestellt.<br />
Das Werk berücksichtigt die seit Erscheinen der Vorauflage<br />
eingetretenen Änderungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung,<br />
Technik und Vertragsgestaltung. Schwerpunkte der Darstellung<br />
sind die Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft.<br />
Jäde<br />
Gemeinde und Baugesuch<br />
Einvernehmen – Veränderungssperre – Zurückstellung<br />
<strong>2011</strong>, 4., überarbeitete Auflage, 208 Seiten, 28,00 EUR, ISBN<br />
978-3-41 -<strong>04</strong>633-7, erschienen im Richard Boorberg Verlag<br />
GmbH & Co. KG, Scharrstraße 2, 70 63 Stuttgart bzw. Levelingstraße<br />
6 a, 81673 München, Tel.: 0711/7 38 0, Fax: 0711/7 38<br />
1 00, E-Mail: mail@boorberg.de, Internet: www.boorberg.de<br />
von Henning Jäde, Ltd. Ministerialrat<br />
Der Verfasser behandelt in diesem Werk fundiert die Möglichkeiten<br />
der Gemeinde, auf konkrete Bauvorhaben, die sich<br />
planungsrelevant auswirken können, so zu reagieren, dass keine<br />
unerwünschten Folgen auftreten. In den drei übersichtlich ge-<br />
gliederten Hauptkapiteln<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Gemeindliches Einvernehmen<br />
Veränderungssperre<br />
Zurückstellung<br />
geht er auf alle Probleme ein, mit denen die zuständigen Personen<br />
und Gremien konfrontiert werden. Dazu zählen u. a. die mögliche<br />
Identität von Gemeinde und Baugenehmigungsbehörde,<br />
der Beginn der Einvernehmensfrist, die Einvernehmensfiktion<br />
nach Fristablauf sowie das Nachschieben einer Veränderungssperre.<br />
Ebenso differenziert sind die Ausführungen zur verfahrensrechtlichen<br />
Stellung der Gemeinde im Baugenehmigungs-, im<br />
Anzeige- bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren. Hinweise<br />
zum Rechtsschutz sowie zu Haftungs- und Entschädigungsfragen<br />
runden die einzelnen Kapitel ab.<br />
Dass bereits zwei Jahre nach Erscheinen der dritten eine weitere<br />
Neuauflage erforderlich geworden ist, ist der Dynamik der<br />
höchstrichterlichen Rechtsprechung geschuldet: Das Bundesverwaltungsgericht<br />
hat den materiell-rechtlichen Schutzbereich der<br />
gemeindlichen Planungshoheit in Abgrenzung zu der verfahrensrechtlichen<br />
Schutzposition des gemeindlichen Einvernehmens<br />
präziser konturiert. Der Bundesgerichtshof hat Amtspflichten<br />
und Haftungsrisiken bei rechtswidrig versagtem gemeindlichem<br />
Einvernehmen neu verteilt. Weite Teile des Buches bedurften<br />
daher einer Überarbeitung, um seine praktische Brauchbarkeit<br />
zu sichern und erste Antworten auf sich neu stellende Fragen<br />
zu bieten. Die Darstellung des Rechtsschutzes gegen Veränderungssperren<br />
wurde erweitert und vertieft.<br />
Für Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen und der Bauaufsichtsbehörden<br />
sowie Verwaltungsrichter und Rechtsanwälte<br />
steht damit wieder ein hervorragendes, kompetentes Praxiswerk<br />
zur Verfügung.<br />
Stegmüller/Horn/Kurz<br />
Umsatzsteuer-Erklärung 2010/Umsatzsteuer-Voranmeldung<br />
<strong>2011</strong> Kompakt<br />
<strong>2011</strong>, 2. Auflage, 208 Seiten, kartoniert, 44,90 EUR, ISBN: 978-<br />
3-941480-29-2, HDS-Verlag, Harald Dauber, Stäudach 2, 71093<br />
Weil im Schönbuch, Tel.: 0 71 7/6 1 62, Fax: 0 71 7/62 02 94,<br />
E-Mail: hdauber@hds-gruppe.de, Internet: www.hds-verlag.de<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Formulare erfordern umfassende Kenntnisse des<br />
Umsatzsteuerrechts<br />
Zeile für Zeile der Steuererklärung richtig erklärt<br />
mit zahlreichen Beispielen<br />
auch bei Nutzung der Elster-Formulare unentbehrlich<br />
mit aktueller Rechtsprechung sowie einschlägigen Verwaltungsanweisungen<br />
der Umsatzsteuerrichtlinien 2008 und<br />
des ab 01.11.2010 geltenden Erlasses zur Anwendung des<br />
Umsatzsteuergesetzes<br />
Inhalt: Erläuterung der amtlichen Umsatzsteuervordrucke Zeile<br />
für Zeile und der für die Steuererklärung wichtigen Fragen.<br />
Mit der Kommentierung der Umsatzsteuererklärung USt 2<br />
A 2010 samt Anlagen UR und UN sowie der Umsatzsteuer-<br />
Voranmeldung USt 1 A <strong>2011</strong> und des Antrags auf Dauerfristverlängerung/Anmeldung<br />
der Sondervorauszahlung USt 1<br />
H <strong>2011</strong> werden folgende grundlegenden Themen behandelt:<br />
Unternehmerbegriff, Unternehmen, Organschaft im Umsatzsteuerrecht,<br />
Lieferung und sonstige Leistung, unentgeltliche<br />
Wertabgaben einschließlich Bemessungsgrundlage, Inland,<br />
innergemeinschaftliche Lieferungen und Erwerbe, Einfuhr,<br />
Ort der Lieferung, Ort der sonstigen Leistung mit den ab<br />
01.01.2010 zu beachtenden Neuregelungen, Steuerbefreiungen,<br />
Bemessungsgrundlagen für Lieferungen, sonstige Leistungen<br />
und Leistungen an Arbeitnehmer, Steuersatz und Steuersatzbegünstigungen,<br />
Rechnungsausstellung, Rechnungserteilung<br />
bei der Versteuerung von Voraus- und Abschlagszahlungen,<br />
Rechnungen über Kleinbeträge, Gutschriften als Rechnungen,<br />
Fahrausweise als Rechnungen, unrichtiger und unberechtigter<br />
Steuerausweis, Besteuerung der Kleinunternehmer, Verlagerung<br />
der Steuerschuldnerschaft (Änderungen beim Reverse Charge<br />
zum 01.07.2010 und zum 01.01.<strong>2011</strong>), Vorsteuerabzug und<br />
Vorsteuervergütung, Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach<br />
§ 15a UStG, Differenz-(Margen-)besteuerung, Besteuerungs-<br />
283
Aus Büchern und Zeitschriften <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
verfahren, zusammenfassende Meldung. Mit den Änderungen<br />
des Mehrwertsteuerpakets 2010 der EU!<br />
Die Autoren: Hubert Stegmüller, Diplom-Finanzwirt (FH),<br />
Regierungsdirektor a. D., war Jahrzehnte bei einer OFD als<br />
Umsatzsteuerreferent tätig. Er war Lehrbeauftragter an der FH<br />
Ludwigsburg sowie bei der Steuerberaterkammer Stuttgart.<br />
Oberregierungsrat Wolfgang Horn, Diplom-Finanzwirt (FH),<br />
ist in den Steuerabteilungen der OFD Stuttgart/OFD Karlsruhe<br />
im Bereich Umsatzsteuer tätig. Seit mehr als 20 Jahren Dozent<br />
an der BFA und an privaten Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen.<br />
Oberamtsrat Markus Kurz, Diplom-Finanzwirt<br />
(FH), ist in der Steuerabteilung der OFD Karlsruhe im Bereich<br />
Umsatzsteuer tätig.<br />
Zielgruppe: Steuerberater und deren Mitarbeiter, Finanzverwaltung,<br />
Steuerabteilungen von Unternehmen, Unternehmer<br />
und Unternehmen, Gewerbetreibende, Freiberufler und<br />
Existenzgründer.<br />
Aushangpflichtige Arbeitsgesetze im öffentlichen Dienst<br />
Textausgabe<br />
<strong>2011</strong>, 10. Auflage, 224 Seiten, Softcover mit Bundling, 9,9 EUR,<br />
ISBN 978-3-8073-0231-7, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm<br />
GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München, Tel.: (089) 21<br />
83 79 28, Fax: (089) 21 83 76 20, E-Mail: kundenbetreuung@<br />
hjr-verlag.de, www.rehmnetz.de<br />
Arbeitgeber und damit Personalverantwortliche sind gesetzlich<br />
verpflichtet, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestimmte<br />
Arbeits- und Arbeitsschutzgesetze frei zugänglich zu machen.<br />
Alle Rechtsänderungen zum 1. Februar <strong>2011</strong> sind in dieser Auflage<br />
berücksichtigt. Damit stehen alle wichtigen Arbeitsgesetze<br />
wieder topaktuell zur Verfügung.<br />
Ergänzende arbeitsrechtliche Vorschriften, speziell auf die<br />
Beschäftigten im öffentlichen Dienst abgestellt, runden diese<br />
Textausgabe ab.<br />
Durch die handliche und haltbare Ausführung dieser Textausgabe<br />
mit der Kordel zum Aushängen können sich Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter wieder aktuell über ihre Rechte und Pflichten<br />
informieren.<br />
Glotzbach/Goldbach<br />
Immobiliarvollstreckung aus Sicht der kommunalen Vollstreckungsbehörden<br />
Handbuch für Praxis und Ausbildung von Hans-Jürgen Glotzbach<br />
und Rainer Goldbach<br />
<strong>2011</strong>, . Auflage, 260 Seiten, kartoniert, 42,00 EUR, ISBN<br />
978-3-7922-0097-1, erschienen im Verlag Reckinger, Luisenstraße<br />
100-102, 3707 Siegburg, Telefon: 0 22 41/93 83 40, Telefax:<br />
0 22 41/9 38 34 33, E-Mail: presse@reckinger.de, Internet: www.<br />
reckinger.de<br />
Das Handbuch liefert insbesondere den kommunalen Vollstreckungsbehörden<br />
einen schnellen und umfassenden Überblick<br />
über die verschiedenen Möglichkeiten der Vollstreckung in das<br />
unbewegliche Vermögen zur Realisierung ihrer Forderungen<br />
öffentlich-rechtlicher und zivilrechtlicher Natur.<br />
Soll eine Gemeinde ihre Forderungen bei Gericht lediglich anmelden<br />
oder ist sie besser beraten, einem bereits angeordneten<br />
Verfahren beizutreten? Ab welchem Stadium sollte sie selbst<br />
einen entsprechenden Antrag auf Immobiliarvollstreckung<br />
284<br />
stellen? Diese und andere wichtige Fragen werden kompetent<br />
und ausführlich beantwortet. Die Anmeldung der kommunalen<br />
Forderungen zu diesen einzelnen Verfahren wird ebenfalls eingehend<br />
erläutert.<br />
Neben den kommunalen Vollstreckungsbehörden spricht das<br />
Handbuch auch alle anderen Behörden an, die ihre Forderungen<br />
nach den Regeln des Verwaltungsvollstreckungsrechts<br />
geltend machen, wie etwa die gesetzlichen Krankenkassen oder<br />
die Vollstreckungsabteilungen der Finanzämter. Auch für die<br />
Rechtspfleger der Amtsgerichte ist das Buch ein unverzichtbares<br />
Nachschlagewerk hinsichtlich kommunaler Forderungen.<br />
Hans-Jürgen Glotzbach ist Referent für das Verwaltungszwangsverfahren<br />
im Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.<br />
und Autor mehrerer Fachbücher für Vollstreckungsrecht.<br />
Rainer Goldbach, Rechtspfleger beim Amtsgericht Frankfurt a.<br />
M., referiert im Vollstreckungsrecht und hat zu diesem Thema<br />
diverse Aufsätze in Fachzeitschriften veröffentlicht.<br />
Fudalla/Tölle/Wöste/zur Mühlen<br />
Bilanzierung und Jahresabschluss in der Kommunalverwaltung<br />
Grundsätze für das „Neue Kommunale Finanzmanagement“<br />
(NFK)<br />
<strong>2011</strong>, 3., neu bearbeitete Auflage, 407 Seiten, mit zahlreichen<br />
Abbildungen, 29,9 EUR, ISBN 978-3- 03-12910-2, erschienen<br />
im Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30<br />
G, 1078 Berlin, Tel.: (0 30) 2 0 08 8 8, Fax: (0 30) 2 0<br />
08 8 70, E-Mail: ESV@ESVmedien.deBestellmöglichkeit online<br />
unter www.ESV.info/9783 03129102<br />
Wie bilanziert man in der kommunalen Verwaltung nach den<br />
Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung?<br />
Dieses Lehrbuch vermittelt in geschlossener Form das nötige<br />
Fachwissen für die erfolgreiche Anwendung des Neuen Kommunalen<br />
Finanzmanagements (NFK):<br />
– Bilanzierung und Jahresabschluss unter Berücksichtigung<br />
von Gemeindehaushaltsrecht und Handelsrecht nach dem<br />
BilModG<br />
– Gesamtabschluss von Kommunen<br />
– Ansätze für Bilanzpolitik und Jahresabschlussanalyse<br />
Die Darstellung orientiert sich an der Gesetzgebung Nordrhein-<br />
Westfalens. Sie erleichtert wesentlich den Einstieg in das neue<br />
Gemeindehaushaltsrecht – auch in anderen Bundesländern.<br />
Zusätzlich unterstützen:<br />
– Kontrollfragen und Aufgaben mit Lösungen zur Vertiefung<br />
des Lernstoffes<br />
– detaillierte Anlagen mit allen relevanten Gesetzestexten,<br />
Verordnungen und Musterdokumenten.<br />
Der zuverlässige Begleiter für Studium und Verwaltungspraxis.<br />
Ergänzungslieferungen<br />
Sächsischer Städte- und Gemeindetag und Sächsischer Landkreistag<br />
(Hrsg.)<br />
Sozialhilferecht in Sachsen<br />
Sammlung der in Sachsen geltenden bundes- und landesrechtlichen<br />
Bestimmungen zur Grundsicherung und Sozialhilfe mit<br />
Richtlinien<br />
Loseblattwerk, ca. 1.970 Seiten, 2 Ordner, 9,00 EUR, Stand:<br />
01.01.<strong>2011</strong> einschl. 38. Ergänzungslieferung, 444 Seiten, ISBN 3-
Dieser Kommentar zur sächsischen Gemeindeordnung gilt<br />
unter kommunalen Praktikern als die Arbeitsgrundlage -<br />
und wird für seine Breite und Tiefe ebenso geschätzt wie für<br />
seine fachübergreifende Gesamtdarstellung und die<br />
Praxisbeispiele.<br />
Band I: Kommunales Verfassungsrecht und Rechtsgrundlagen<br />
für die kommunale Finanzwirtschaft<br />
einschließlich Verwaltungsvorschriften.<br />
Band II: Praxisorientierte Erläuterungen zum<br />
Kommunalen Verfassungsrecht.<br />
Band III: Kommentierungen zur kommunalen Finanzwirtschaft.<br />
Mit Vorschlägen zu Wirtschaftlichkeit und<br />
Sparsamkeit, Ausführungen zu Kameralistik u.v.m.<br />
„ ... das qualitativ wie quantitativ gelungenste Gesamtwerk zur<br />
Kommunalen Finanzwirtschaft. Deshalb verwundert es nicht, dass<br />
OVG, OLG und selbst das BVerwG diesen Kommentar immer wieder<br />
zitieren.“<br />
Weitere Informationen:<br />
Kurt Leibbrandt, Erster Bürgermeister i.R., Bietigheim-Bissingen<br />
www.ESV.info/978-3-503-03407-9<br />
in: Kommunal-Kassen-Zeitschrift (KKZ), 10/2010<br />
erich schmidt verl ag<br />
A u f W i s s e n v e r t r a u e n<br />
Bestellungen bitte an den Buchhandel oder direkt an:<br />
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin<br />
Fax: (030) 25 00 85 - 275 · www.ESV.info · ESV@ESVmedien.de<br />
Von OVG, OLG &<br />
BVerwG gern zitiert<br />
Gemeindeordnung für<br />
den Freistaat Sachsen<br />
Ergänzbarer Kommentar mit<br />
weiterführenden Vorschriften<br />
Von Albrecht Quecke †, Ministerialrat a.D. im Innenministerium<br />
Baden-Württemberg, Prof. Hansdieter Schmid,<br />
vormals Hochschule für öffentliche Verwaltung Ludwigsburg,<br />
Ulrich Menke, Ministerialrat im Sächsischen Staatsministerium<br />
des Innern, Heinrich Rehak, Präsident des<br />
Verwaltungsgerichts Dresden a.D., Dr. Andreas Wahl,<br />
Richter am Landesozialgericht Chemnitz, Dr. Harald Vinke,<br />
Fachbereichsleiter im Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien-<br />
und Baumanagement Dresden, Peter Blazek, Assessor/<br />
Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Sächsischer Städte- und<br />
Gemeindetag, und Dr. Bert Schaffarzik, Präsident des<br />
Verwaltungsgerichts Chemnitz<br />
Loseblattwerk, 4.480 Seiten in 3 Ordnern,<br />
Grundwerk € (D)148,–, ISBN 978-3-503-03407-9<br />
Firma / Institution ......................................................<br />
Name / Kd.-Nr. ...........................................................<br />
Funktion ....................................................................<br />
Straße / Postfach ........................................................<br />
PLZ / Ort ....................................................................<br />
Fax ...........................................................................<br />
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken<br />
per Fax über Angebote informieren: ja nein<br />
E-Mail ................................................................<br />
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken<br />
per E-Mail über Angebote informieren: ja nein<br />
Datum / Unterschrift ..................................................<br />
<strong>04</strong>03<br />
Fax (030) 25 00 85-275<br />
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG<br />
Genthiner Straße 30 G<br />
10785 Berlin<br />
Widerrufsrecht: Bestellungen zu Loseblattwerken können innerhalb von zwei<br />
Wochen nach Erhalt der Ware bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt<br />
Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Fax 030/25 00 85-275,<br />
E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de schriftlich widerrufen werden (rechtzeitige<br />
Absendung genügt).<br />
Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten lediglich zur Durchführung des Vertrages,<br />
zur Pfl ege der laufenden Kundenbeziehung und um Sie über unsere Angebote und<br />
Preise zu informieren. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke<br />
jederzeit widersprechen. Bitte senden Sie uns in diesem Fall Ihren Widerspruch<br />
schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail an Service@ESVmedien.de.<br />
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Sitz: Berlin · Persönlich haftende<br />
Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH · Amts gericht: Berlin-Charlottenburg<br />
93 HRB 27 197 · Geschäftsführer: Dr. Joa chim Schmidt<br />
Bestellschein
Aus Büchern und Zeitschriften <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
41 -01 93-9, Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG, Postfach Mit der Neukommentierung der §§ 7a, 21-25 und 127 SächsBG<br />
10 01 60, 01071 Dresden, Tel.: 0711/7 38 0, Fax: 0711/7 38 wird insbesondere der neueren Rechtsprechung zur Zulässigkeit<br />
1 00, E-Mail: mail@boorberg.de, www.boorberg.de<br />
von Altersgrenzen (§§ 7a – Altergrenze für die Berufung –, 21<br />
SächsBG – Altersgrenzen –) und dem „Gesetz zur Regelung des<br />
Diese Ergänzungslieferung berücksichtigt alle Vorschriften, Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts<br />
die bis 31.12.2010 verkündet wurden und bis 01.<strong>04</strong>.<strong>2011</strong> in für den Freistaat Sachsen vom 19.05.2010“ (§ 127 SächsBG –<br />
Kraft getreten sind. Hinzuweisen ist besonders auf folgende Zustellung –) Rechnung getragen.<br />
Änderungen:<br />
Darüber hinaus werden die Vorbemerkungen zu den §§ 100-124<br />
Band 1 („Richtlinien-Band“):<br />
SächsBG aktualisiert.<br />
– Änderung des SächsAGSGB durch Gesetz vom 23.09.2010<br />
(SächsGVBl. S. 269): A 420.21<br />
Der Textteil wird umfassend aktualisiert.<br />
– Fortschreibung der Sozialversicherungsentgeltverordnung<br />
aufgrund der Verordnung vom 10.11.2010 (BGBl. Stegmüller/Schmalhofer/Bauer<br />
I S. 1725): A 422.212<br />
Beamtenversorgungsrecht des Bundes und der Länder<br />
– Aktualisierung folgender Gesetze aufgrund des Haushalts- Kommentar mit Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorbegleitgesetzes<br />
<strong>2011</strong>/2012 vom 15.12.2010 (SächsGVBl. schriften<br />
S. 387):<br />
Loseblattwerk in Ordnern mit ca. 7.162 Seiten, ISBN: 978-<br />
– Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen: 3-782 -0193-4, 189,9 EUR zzgl. Aktualisierungslieferungen,<br />
A 415.01<br />
339,9 EUR Apartpreis, 94. Aktualisierung mit Stand Januar<br />
– SächsAGSGB: A 420.21<br />
<strong>2011</strong>, Ladenpreis: 109,9 EUR, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm<br />
– Landesblindengeldgesetz: A 423.36<br />
GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München, Tel.: (089) 21<br />
– Landeserziehungsgeldgesetz: A 452.12<br />
83 79 28, Fax: (089) 21 83 76 20, E-Mail: kundenbetreuung@<br />
– Gesetz über Kindertageseinrichtungen: A 460.1 hjr-verlag.de, www.rehmnetz.de<br />
– Aufnahme der Düsseldorfer Tabelle und der Unterhaltsleitlinien<br />
des OLG Dresden – Stand jeweils 01.01.<strong>2011</strong>: Die 94. Aktualisierung beinhaltet unter anderem die Überarbei-<br />
A 429.31/III, A 429.31/IV<br />
tung bzw. Neukommentierung zu:<br />
Band 2 („SGB-Band“):<br />
– §§ 50, 52, 57, 70, 71 BeamtVG<br />
Änderungen waren insbesondere durch folgende Gesetze – Art. 1, 2, 94-99, 108-112 BayBeamtVG<br />
veranlasst:<br />
sowie eine Aktualisierung der Sonderzahlungsgesetze der Länder.<br />
– Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung<br />
für Arbeitssuchende vom 03.08.2010 (BGBl. I<br />
S. 1112)<br />
Breier/Dassau/Kiefer<br />
– Drittes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozial- TVöD-Kommentar inkl. Arbeitsrecht im ö. D.<br />
gesetzbuch und anderer Gesetze vom 05.08.2010 (BGBl. Tarif- und Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst<br />
I S. 1127)<br />
Loseblattwerk mit Lexikon Arbeitsrecht im ö. D. – Ruge, ca. .314<br />
– Beschäftigungschancengesetz vom 24.10.2010 (BGBl. I Seiten in Ordnern, ISBN 978-3-8073-0064-1, 179,9 EUR<br />
S. 1417)<br />
zzgl. Aktualisierungslieferungen, 419,9 EUR ohne Aktualisie-<br />
– 23. BAföG-Änderungsgesetz vom 24.10.2010 (BGBl. I rungslieferungen, 44. Aktualisierung mit Stand April <strong>2011</strong> und<br />
S. 1422)<br />
4 . Aktualisierung mit Stand Mai <strong>2011</strong>, Ladenpreis: 44. Aktuali-<br />
– Verordnung zur Änderung der Kommunalträger-Zulassierung: 94,9 EUR, 4 . Aktualisierung: 102,9 €, Verlagsgruppe<br />
sungsverordnung vom 01.12.2010 (BGBl. I S. 1758) Hüthig Jehle Rehm GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München,<br />
– Haushaltsbegleitgesetz <strong>2011</strong> vom 09.12.2010 (BGBl. I Tel.: (089) 21 83 79 28, Fax: (089) 21 83 76 20, E-Mail: kun-<br />
S. 1885)<br />
denbetreuung@hjr-verlag.de, www.rehmnetz.de<br />
– Vierte Verordnung zur Änderung der Arbeitslosengeld II/<br />
Sozialgeld-Verordnung vom 21.12.2010 (BGBl. I 2321) Die 44. Aktualisierung hat folgende Schwerpunkte:<br />
– Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz vom 22.12.2010 1. Die Kommentierung zu § 1 TVöD (Geltungsbereich)<br />
(BGBl. I S. 2262)<br />
im Teil B 1 wurde überarbeitet. U. a. wurden die neuen<br />
Tarifverträge für Beschäftigte in der Fleischuntersuchung<br />
berücksichtigt sowie die Rechtsprechung des BAG zu der<br />
Woydera/Summer/Zängl<br />
Frage, ob Chefärzte mit sog. „Altverträgen“ eine Bezahlung<br />
Beamtenrecht in Sachsen<br />
nach der Entgeltgruppe 15Ü TVöD oder nach Entgeltgrup-<br />
Kommentar<br />
pe I TV-Ärzte/VKA beanspruchen können.<br />
Loseblattwerk, .940 Seiten in Ordnern, 199,9 EUR zzgl. 2. Das BAG hat sich in mehreren Entscheidungen mit der<br />
Aktualisierungslieferungen, 299,9 EUR Apartpreis, ISBN 978-3- Definition des Begriffs der Bereitschaftszeiten (§ 9 TVöD)<br />
8073-094 -3, 73. Aktualisierung, Stand: März <strong>2011</strong>, Ladenpreis: und in diesem Zusammenhang mit der Arbeitszeitgestaltung<br />
89,9 EUR; Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Hultschiner für Hausmeister auseinandergesetzt. Diese Entscheidungen<br />
Straße 8, 81677 München, Tel.: (089) 21 83 79 28, Fax: (089) wurden in den Erläuterungen zu § 9 TVöD im Teil B 1<br />
21 83 76 20, E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de, www. ausgewertet.<br />
rehmnetz.de<br />
3. § 18 TVöD (Leistungsentgelt) im Teil B 1 wurde vollständig<br />
überarbeitet. Das Instrument des Leistungsentgelts wurde<br />
Zur 73. Aktualisierung erfolgt die Erstkommentierung des § 45 mit Inkrafttreten des TVöD 2005 neu in das Tarifrecht von<br />
BeamtStG zur Fürsorge, der den alten § 99 SächsBG ersetzt. Bund und Kommunen eingeführt. In der Tarifrunde 2010<br />
286
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Aus Büchern und Zeitschriften<br />
wurde vereinbart, dass das Budget für das Leistungsentgelt<br />
in mehreren Schritten auf zunächst 2 % erhöht wird.<br />
4. Zu § 26 TVöD (Urlaub) im Teil B 1 sind weiter die Auswirkungen<br />
der EuGH-Rechtsprechung zu den Urlaubsansprüchen<br />
bei Krankheit und deren Umsetzung in Deutschland<br />
aktuell. Diesmal geht es bei der Aktualisierung der Erläuterungen<br />
insbesondere um Folgendes: Derzeit ist unklar,<br />
ob in einem ruhenden Arbeitsverhältnis Urlaubsansprüche<br />
entstehen können – oder anders gefragt: ob der Arbeitgeber<br />
berechtigt ist, Urlaubsansprüche für die Ruhenszeiten zu<br />
kürzen (z. B. Erwerbsminderungsrente, Aussteuerung aus<br />
der Krankenkasse etc.).<br />
5. Mit seiner Entscheidung vom 12.10.2010 (C-45/09, Rosenbladt)<br />
hat der EuGH nun endgültig bestätigt, dass tarifvertragliche<br />
Altersgrenzen für einen Eintritt in den Ruhestand<br />
zulässig sind. Dies gilt selbstverständlich auch für § 33<br />
Abs. 1 a TVöD. Damit endet das Arbeitsverhältnis eines im<br />
Geltungsbereich des TVöD beschäftigten Arbeitnehmers<br />
automatisch, wenn dieser das reguläre Renteneintrittsalter<br />
vollendet. Eine solche Regelung verstößt nach Ansicht des<br />
EuGH nicht gegen das Verbot der Altersdiskriminierung.<br />
An einer wirksamen Beendigung von Arbeitsverhältnissen<br />
mit Rentenbeginnen bestehen daher keine Bedenken mehr.<br />
Diese Rechtsprechung ist in die Kommentierung zu § 33<br />
TVöD im Teil B 1 eingearbeitet worden.<br />
6. Die Protokollerklärung zum 3. Abschnitt des TVÜ-Bund<br />
beinhaltet Übergangsregelungen für die Entgeltsicherung<br />
bei Leistungsminderung. Diese Regelungen wurden neu<br />
kommentiert.<br />
7. In der vorhergehenden <strong>43</strong>. Aktualisierung wurde mit der<br />
Überarbeitung der durchgeschriebenen Fassungen der<br />
Sparten des TVöD begonnen (zunächst TVöD-V). Mit<br />
der vorliegenden Aktualisierung wird der TVöD-V im Teil<br />
B 4.1.2 vervollständigt um die Anlage D und die Legende<br />
als Arbeitserleichterung.<br />
8. In den Teil E wurden als Muster zur Altersteilzeit Arbeitsvertragsmuster<br />
zur Altersteilzeit und zum Modell FAL-<br />
TER sowie das Merkblatt für Altersteilzeitarbeitnehmer<br />
aufgenommen.<br />
9. Teil K 6 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG):<br />
In diesem Abschnitt stehen dem Anwender ausführliche<br />
Hinweise zur Anwendung des AGG in der Praxis zur Verfügung.<br />
Diese enthalten z. B. detaillierte Informationen zur<br />
diskriminierenden Stellenausschreibung, zur Durchführung<br />
von Vorstellungsgesprächen und insbesondere zu den komplizierten<br />
Verfahrensregelungen bei einer Bewerbung von<br />
schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen. Mit<br />
dieser Aktualisierung wird außerdem eine Checkliste für<br />
Einstellungen nach dem AGG zur Verfügung gestellt, die<br />
praxisgerecht bei der Vermeidung von Fehlern hilft und<br />
damit auch bei der Vermeidung von Schadensersatz- oder<br />
Entschädigungsansprüchen.<br />
Die 45. Aktualisierung hat folgende Schwerpunkte:<br />
1. § 3 Abs. 4 TVöD regelt die Berechtigung des Arbeitgebers,<br />
bei begründeter Veranlassung die ärztliche Untersuchung<br />
eines Arbeitnehmers zu veranlassen. In die Erläuterungen<br />
hierzu wurde neue Rechtsprechung zur Frage der Mitbestimmung<br />
des Personalrats eingearbeitet.<br />
2. In den Erläuterungen zu § 6 TVöD (Arbeitszeit) wurde<br />
neue Rechtsprechung ausgewertet, insbesondere zur<br />
Ruhepause im Bereitschaftsdienst, zum Direktionsrecht<br />
des Arbeitgebers bei der Verteilung der Arbeitszeit auf die<br />
287
Aus Büchern und Zeitschriften <strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11<br />
Wochentage, zur Zulässigkeit von Sonntagsarbeit und zum<br />
sog. Ferienüberhang (Umverteilung der Arbeitszeit auf die<br />
Zeiten außerhalb der Schulferien).<br />
3. Mit dieser Aktualisierung wird die Kommentierung zu § 33<br />
Abs. 2 TVöD vervollständigt. Die bereits vorhandene Kommentierung<br />
der Sätze 1 bis 4, die die Beendigung des Arbeitsverhältnisses<br />
bei Bezug einer dauerhaften Erwerbsminderungsrente<br />
betreffen, wurde um die Kommentierung der Sätze 5<br />
und 6 ergänzt. Dem Nutzer stehen nun also umfangreiche<br />
Hinweise rund um das Ruhen des Arbeitsverhältnisses bei der<br />
Gewährung einer zeitlich befristeten Erwerbsminderungsrente<br />
zur Seite. Insbesondere die Voraussetzungen für ein Ruhen<br />
des Arbeitsverhältnisses nach § 33 Abs. 2 Satz 6 TVöD, der<br />
Ruhenszeitraum sowie die Rechtsfolgen werden mit Hilfe von<br />
Beispielen praxisnah dargestellt.<br />
4. Im Teil B 3.1.1 werden die Regelungen für die Arbeitnehmer,<br />
die zu Auslandsdienststellen des Bundes entsandt werden<br />
(§ 45 [Bund] TVöD-BT-V), kommentiert und um neue<br />
Rundschreiben des BMI ergänzt. Die Sonderregelungen für<br />
Beschäftigte im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung<br />
(§ 46 [Bund] TVöD-BT-V) werden neu erläutert.<br />
5. § 17 TVÜ-Bund beinhaltet die Regelungen für die übergangsweise<br />
weiter anzuwendenden Eingruppierungsregelungen,<br />
die bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltverordnung<br />
gelten. Die Kommentierung dieser Regelungen<br />
wurde neu bearbeitet und für den Anwender leichter<br />
handhabbar übersichtlich gestaltet.<br />
6. Nachdem mit den <strong>43</strong>. und 44. Aktualisierungen die<br />
Durchgeschriebene Fassung des TVöD-V vollständig<br />
neu bearbeitet in das Werk aufgenommen wurde, wird<br />
dies in dieser 45. Aktualisierung mit dem ersten Teil der<br />
Durchgeschriebenen Fassung des TVöD-S für Sparkassen<br />
fortgesetzt. Dieser Teil wird mit der nächsten Aktualisierung<br />
vervollständigt werden.<br />
7. In den Teil K des Werks (allgemeine arbeitsrechtliche<br />
Fragestellungen) wird eine umfangreiche Fortsetzung der<br />
Erläuterungen zum Kündigungsrecht aufgenommen. Es<br />
werden insbesondere praxisgerecht aufbereitet die personenbedingte<br />
Kündigung (insbesondere die krankheitsbedingte<br />
Kündigung) und die allgemeinen Voraussetzungen für eine<br />
verhaltensbedingte Kündigung.<br />
Schaetzell/Busse/Dirnberger/Stange<br />
Baugesetzbuch (BauGB)<br />
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke<br />
(BauNVO)<br />
Kommentare<br />
Loseblattwerk, 19. Nachlieferung, Stand: Dezember 2010, ISBN<br />
978-3-8611 -922-3, 782 Seiten, 69,00 EUR; Gesamtwerk: 2.488<br />
Seiten, Preis: 13 ,00 EUR, Kommunal- und Schul-Verlag GmbH<br />
& Co. KG, Postfach 36 29, 6 026 Wiesbaden, Tel.: 0611/ 8 80<br />
86 10, Fax: 0611/ 8 80 86 77, E-Mail: info@kommunalpraxis.<br />
de, www.kommunalpraxis.de<br />
Die 19. Nachlieferung beinhaltet:<br />
Ordner I<br />
Baugesetzbuch (BauGB)<br />
Von Ministerialrat a. D. Johannes Schaetzell, Geschäftsführendem<br />
Präsidialmitglied des Bayerischen Gemeindetages Dr.<br />
Jürgen Busse und Direktor beim Bayerischen Gemeindetag Dr.<br />
Franz Dirnberger<br />
288<br />
Neben der Aktualisierung des Gesetzestextes wurden die Kommentierungen<br />
zu den §§ 19 (Teilung von Grundstücken), 24<br />
(Allgemeines Vorkaufsrecht), 25 (Besonderes Verkaufsrecht) und<br />
26 (Ausschluss des Vorkaufsrechts) BauGB überarbeitet.<br />
Ordner II<br />
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke<br />
(Baunutzungsverordnung – BauNVO)<br />
Von Gustav-Adolf Stange, Staatssekretär a. D.<br />
Der Beitrag wurde neu bearbeitet, wobei der Schwerpunkt auf<br />
die Verarbeitung der einschlägigen Entscheidungen und Literatur<br />
gelegt wurde.<br />
Neuer Ordner II<br />
In dieser Lieferung ist ein zusätzlicher Ordner mit der neuen,<br />
umfangreichen Kommentierung der Verordnung über die bauliche<br />
Nutzung der Grundstücke.<br />
Quecke/Schmid/Menke/Rehak/Wahl/Vinke/Blazek/Schaffarzik<br />
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (GOFS)<br />
Ergänzbarer Kommentar mit weiterführenden Vorschriften<br />
Loseblattwerk, 3 Ordner, ca. 4.480 Seiten, ISBN: 978-3- 03-<br />
03407-9, 148,00 EUR; Lieferung 2/11 mit Stand Juni <strong>2011</strong>, Erich<br />
Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 1078 Berlin;<br />
Tel.: (030) 2 00 8 – 0, Fax: (030) 2 00 8 – 870, E-Mail:<br />
ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglichkeit online unter www.ESV.<br />
info/3 03 03407 9,<br />
Im kommunalverfassungsrechtlichen Teil wurde insbesondere<br />
neuere Rechtsprechung des SächsOVG zu verschiedenen<br />
Rechtsfragen eingearbeitet, so zum Anspruch auf Fraktionszuwendungen<br />
aus Haushaltsmitteln (SächsOVG vom 23.11.2010)<br />
und zur Abwahl eines Beigeordneten und eines Bürgermeisters<br />
(SächsOVG vom 09.12.2010). Fragen zur Wahl des Ortschaftsrats<br />
beantwortet eine Entscheidung vom 28.12.2010; auf eine<br />
mögliche Verjährung der Ansprüche auf Ablieferung von Nebentätigkeitsvergütungen<br />
wird in einer Entscheidung vom 11.03.2010<br />
hingewiesen. Ergänzt wurden die Kommentierungen zu Bürgerbegehren<br />
und Bürgerentscheid mit zahlreichen obergerichtlichen<br />
Entscheidungen.<br />
Vogelgesang/Bieler/Kleffner<br />
Landespersonalvertretungsgesetz für den Freistaat Sachsen<br />
(LPFS)<br />
Ergänzbarer Kommentar mit weiterführenden Vorschriften<br />
Loseblattwerk, ISBN 978-3- 03-03391-1, 1.930 Seiten in 2 Ordnern,<br />
DIN-A , 98,00 EUR, 3 . Lieferung vom April <strong>2011</strong> und<br />
36. Lieferung vom Juni <strong>2011</strong>, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co,<br />
Genthiner Str. 30 G, 1078 Berlin, Tel.: (030) 2 00 8 – 0, Fax:<br />
(030) 2 00 8 – 870, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglichkeit<br />
online unter www.ESV.info/978 3 03 033911<br />
Die 35. Lieferung enthält das Personalvertretungsgesetz in der<br />
Fassung, die es durch das 4. Änderungsgesetz vom 4. November<br />
2010 erhalten hat und die neu erlassene Wahlordnung zum Sächs-<br />
PersVG. Die Aktualisierung der Kommentierungen bezieht sich<br />
schwerpunktmäßig insbesondere auf die Änderungen der Wahlvorschriften<br />
und nimmt im Übrigen die Änderungen des Gesetzes auf.<br />
Die 36. Lieferung enthält die Anpassung der Vorschriften über<br />
die Geschäftsführung des Personalrates an das Personalvertretungsgesetz<br />
in der Fassung, die es durch das 4. Änderungsgesetz<br />
vom 4. November 2010 hat. Ebenfalls in dieser Lieferung ist § 80<br />
vollständig überarbeitet mit neuer Kommentierung enthalten.
<strong>Sachsenlandkurier</strong> 4/11 Dienstleistungsverzeichnis<br />
Außen–Möblierung<br />
Kommunalberatung<br />
Kommunale Bildungsangebote<br />
Kommunale Dienstleistungen<br />
Die leistungsfähige FM-Software<br />
für die öffentliche Verwaltung.<br />
Rahmenvertragspartner<br />
der SAKD<br />
N+P Informationssysteme GmbH<br />
An der Hohen Straße 1<br />
08393 Meerane<br />
Telefon 03764 4000-0<br />
www.spartacus-fm.de<br />
spartacus@nupis.de<br />
Beilagenhinweis<br />
Diese Ausgabe enthält eine Beilage<br />
des Kommunalpolitischen Bildungswerkes<br />
Sachsen (W<strong>KB</strong>) sowie<br />
von Rödl & Partner GmbH,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft
Wir sind eine der führenden deutschen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Rödl & Partner betreut die öffentliche<br />
Hand und Unternehmen weltweit bei ihren Aktivitäten. Wir sind in allen wesentlichen Industrienationen der Welt<br />
vertreten und haben insbesondere in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Asien, Afrika, Lateinamerika und den USA starke<br />
Marktpositionen aufgebaut. Unsere Mandanten werden an 84 Standorten in 37 Ländern weltweit von 3.025 Mitarbeitern<br />
betreut. Unser Unternehmensbereich Public Management Consulting (PMC) ist auf die Prüfung und Beratung der öffentlichen<br />
Hand spezialisiert und hier konsequent interdisziplinär.<br />
Die öffentliche Hand steht täglich vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die nur mit rechtlicher, steuerlicher und wirtschaftlicher<br />
Expertise erfolgreich und sicher gemeistert werden können – im inländischen Umfeld ebenso wie im europäischen<br />
Kontext. Die aktuellen Entwicklungen in Politik und Wirtschaft zeigen dies.<br />
Unsere Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater erarbeiten für Sie Lösungen in interdisziplinärer<br />
und enger partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Ihnen – und das mit einem Ansprechpartner.<br />
Durch unsere Konzentration auf einzelne Branchen im öffentlichen Sektor<br />
haben wir uns über Jahre hinweg eine einzigartige Expertise erarbeitet.<br />
Der Erfolg unserer Mandanten beweist dies.<br />
�������������������������������������������������������������������<br />
Ihr Ansprechpartner für die Beratungsleistungen im Öffentlichen Sektor<br />
in Sachsen<br />
Rödl & Partner GmbH Jan-Hendrik Bahn<br />
Büro Leipzig Associate Partner<br />
Katharinenstraße 23 Telefon: +49 (3 41) 22 55-320<br />
<strong>04</strong>109 Leipzig Mobil: +49 (15 1) 16 68 90 62<br />
E-Mail: hendrik.bahn@roedl.de<br />
Wirtschaftsprüfer<br />
Steuerberater<br />
Rechtsanwälte<br />
Unternehmensberater<br />
> Bund, Land und Kommunen<br />
> Energiewirtschaft (Strom, Gas, Wärme),<br />
erneuerbare Energien<br />
> Wasser und Abwasser<br />
> Gesundheitswesen und Sozialwirtschaft<br />
> Bildung und Forschung<br />
> Verkehr und urbane Mobilität<br />
> Immobilien- und Facilitymanagement<br />
84 Standorte > 37 Länder > ein Unternehmen www.roedl.de
Verlässliche Partner<br />
findet man nicht überall.<br />
Sondern genau da,<br />
wo man sie braucht.<br />
Ob Finanznot, Bürokratie oder Steuerfragen – der Handlungsbedarf<br />
für die Kommunen ist vielfältig. Gut, wenn Sie sich auf einen Partner<br />
stützen können, der umfassendes Wissen über den kommunalen Bereich<br />
besitzt und maßgeschneiderte Lösungen für Sie entwickelt. Der Sie<br />
kompetent und zuverlässig bei der Erfüllung Ihrer steuerlichen Pflichten<br />
berät, Abschlussprüfungen vornimmt, tatkräftig bei der Umstellung der<br />
Rechnungslegung und den Folgeproblemen hilft und Sie in allen sonstigen<br />
wirtschaftlichen Themen vorausschauend betreut. Der wirksame Konzepte<br />
für eine verbesserte Finanzsituation erarbeitet und Sie auch bei allen<br />
anderen kommunalen Themen tatkräftig unterstützt.<br />
www.wibera.de<br />
Für weitere Informationen besuchen<br />
Sie uns im Internet oder sprechen<br />
Sie uns einfach direkt an.<br />
Steffen Döring<br />
Tel.: +49 341 9856-292<br />
steffen.doering@de.pwc.com<br />
Rainer Schindler<br />
Tel.: +49 351 4402-848<br />
rainer.schindler@de.pwc.com<br />
© <strong>2011</strong>. PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der<br />
PricewaterhouseCoopers International Limited.
Die Kommunalversicherung<br />
für Sachsen<br />
Ihre Vorteile<br />
����������������������������������������������������������������������<br />
�������������������<br />
������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������<br />
Unser Service<br />
��������������������������������������������������������������<br />
�����������������������������<br />
������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������<br />
�������������<br />
��������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������<br />
�����������������<br />
����������������������������������������������������������<br />
�����������������������������<br />
��������������������������������������������������������������<br />
Unsere Produkte<br />
��������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������������<br />
���������������<br />
�����������������������������������<br />
������������������������<br />
���������������������������<br />
���������������������������<br />
�������������<br />
���������������������������<br />
������������<br />
www.okv-online.com<br />
Immer für Sie da:<br />
���������������<br />
����������<br />
Maik Franz<br />
����� �������������<br />
������ ���������������<br />
������� ������������<br />
(Landkreise Görlitz, Leipzig,<br />
Meißen, Nordsachsen, Sächsische<br />
SchweizOsterzgebirge,<br />
Städte Dresden, Görlitz, Leipzig,<br />
Zwickau)<br />
Wilfried Gärtner<br />
����� ��������������<br />
����� ���������������<br />
������� ������������<br />
(Landkreis Bautzen, Stadt Hoyerswerda)<br />
Alexander Zippel<br />
����� �������������<br />
������ ���������������<br />
������� ������������<br />
(Landkreise Zwickau, Erzgebirgskreis,<br />
Mittelsachsen, Vogtlandkreis,<br />
Städte Chemnitz, Plauen)<br />
Unser Unternehmensverbund und unsere Partner: KSA – Kommunaler Schadenausgleich der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen WGV – Versicherung AG BK – Bayerische Beamtenkrankenkasse AG



![Straßenverzeichnis [Download,*.pdf, 176,27 KB] - Justiz in Sachsen](https://img.yumpu.com/23736617/1/184x260/strassenverzeichnis-downloadpdf-17627-kb-justiz-in-sachsen.jpg?quality=85)


![(Stand: 01.01.2014) [Download,*.pdf, 175,90 KB] - Justiz in Sachsen](https://img.yumpu.com/23736547/1/184x260/stand-01012014-downloadpdf-17590-kb-justiz-in-sachsen.jpg?quality=85)

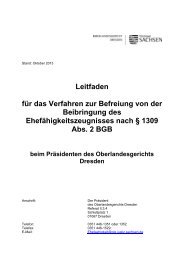

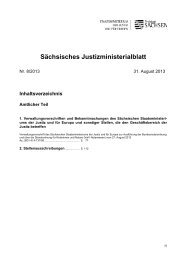
![(Stand: 01.01.2014) [Download,*.pdf, 70,25 KB] - Justiz in Sachsen](https://img.yumpu.com/23736546/1/184x260/stand-01012014-downloadpdf-7025-kb-justiz-in-sachsen.jpg?quality=85)