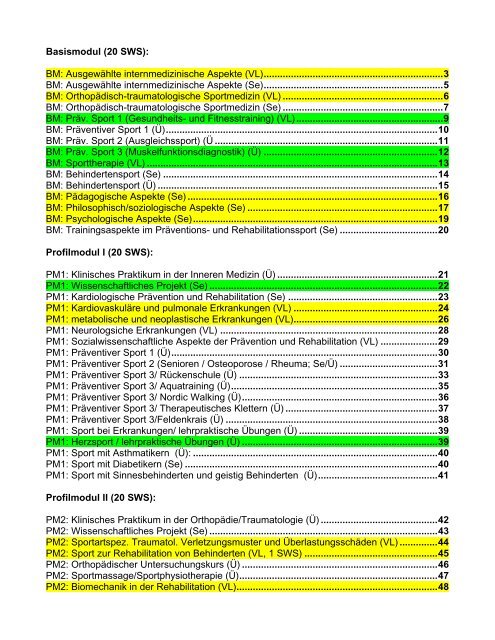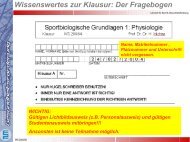Basismodul (20 SWS):
Basismodul (20 SWS):
Basismodul (20 SWS):
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Basismodul</strong> (<strong>20</strong> <strong>SWS</strong>):<br />
BM: Ausgewählte internmedizinische Aspekte (VL)..................................................................3<br />
BM: Ausgewählte internmedizinische Aspekte (Se)..................................................................5<br />
BM: Orthopädisch-traumatologische Sportmedizin (VL) ...........................................................6<br />
BM: Orthopädisch-traumatologische Sportmedizin (Se) ...........................................................7<br />
BM: Präv. Sport 1 (Gesundheits- und Fitnesstraining) (VL)......................................................9<br />
BM: Präventiver Sport 1 (Ü)....................................................................................................10<br />
BM: Präv. Sport 2 (Ausgleichssport) (Ü ..................................................................................11<br />
BM: Präv. Sport 3 (Muskelfunktionsdiagnostik) (Ü) ................................................................12<br />
BM: Sporttherapie (VL) ...........................................................................................................13<br />
BM: Behindertensport (Se) .....................................................................................................14<br />
BM: Behindertensport (Ü) .......................................................................................................15<br />
BM: Pädagogische Aspekte (Se) ............................................................................................16<br />
BM: Philosophisch/soziologische Aspekte (Se) ......................................................................17<br />
BM: Psychologische Aspekte (Se)..........................................................................................19<br />
BM: Trainingsaspekte im Präventions- und Rehabilitationssport (Se) ....................................<strong>20</strong><br />
Profilmodul I (<strong>20</strong> <strong>SWS</strong>):<br />
PM1: Klinisches Praktikum in der Inneren Medizin (Ü) ...........................................................21<br />
PM1: Wissenschaftliches Projekt (Se) ....................................................................................22<br />
PM1: Kardiologische Prävention und Rehabilitation (Se) .......................................................23<br />
PM1: Kardiovaskuläre und pulmonale Erkrankungen (VL) .....................................................24<br />
PM1: metabolische und neoplastische Erkrankungen (VL).....................................................26<br />
PM1: Neurologsiche Erkrankungen (VL) ................................................................................28<br />
PM1: Sozialwissenschaftliche Aspekte der Prävention und Rehabilitation (VL) .....................29<br />
PM1: Präventiver Sport 1 (Ü)..................................................................................................30<br />
PM1: Präventiver Sport 2 (Senioren / Osteoporose / Rheuma; Se/Ü) ....................................31<br />
PM1: Präventiver Sport 3/ Rückenschule (Ü) .........................................................................33<br />
PM1: Präventiver Sport 3/ Aquatraining (Ü)............................................................................35<br />
PM1: Präventiver Sport 3/ Nordic Walking (Ü)........................................................................36<br />
PM1: Präventiver Sport 3/ Therapeutisches Klettern (Ü) ........................................................37<br />
PM1: Präventiver Sport 3/Feldenkrais (Ü) ..............................................................................38<br />
PM1: Sport bei Erkrankungen/ lehrpraktische Übungen (Ü) ...................................................39<br />
PM1: Herzsport / lehrpraktische Übungen (Ü) ........................................................................39<br />
PM1: Sport mit Asthmatikern (Ü): ..........................................................................................40<br />
PM1: Sport mit Diabetikern (Se) .............................................................................................40<br />
PM1: Sport mit Sinnesbehinderten und geistig Behinderten (Ü)............................................41<br />
Profilmodul II (<strong>20</strong> <strong>SWS</strong>):<br />
PM2: Klinisches Praktikum in der Orthopädie/Traumatologie (Ü) ...........................................42<br />
PM2: Wissenschaftliches Projekt (Se) ....................................................................................43<br />
PM2: Sportartspez. Traumatol. Verletzungsmuster und Überlastungsschäden (VL) ..............44<br />
PM2: Sport zur Rehabilitation von Behinderten (VL, 1 <strong>SWS</strong>) .................................................45<br />
PM2: Orthopädischer Untersuchungskurs (Ü) ........................................................................46<br />
PM2: Sportmassage/Sportphysiotherapie (Ü).........................................................................47<br />
PM2: Biomechanik in der Rehabilitation (VL)..........................................................................48
PM2: Sozialwiss. Aspekte der Traumatologie und Sportorthopädie (VL)................................49<br />
PM2: Sport mit Körperbehinderten (Se)..................................................................................50<br />
PM2: Sport bei degenerativen Veränderungen (Ü).................................................................51<br />
PM2: Sporttherapeutische Konzepte nach Verletzungen (VL)................................................52<br />
PM2: Sporttherapeutische Konzepte nach Verletzungen (Ü)..................................................52<br />
PM2: Therapiespezifische Trainingsgeräte (VL/Ü) .................................................................54<br />
VP<br />
VP ZN
BM: Ausgewählte internmedizinische Aspekte (VL)<br />
• Sportmedizinische Diagnostik und Untersuchung, Aktivitätsberatung:<br />
o Definition der Belastbarkeit, Vorüberlegungen zur Gesundheits- und<br />
Belastungsuntersuchung, Erörterung der klinischen Untersuchungsinhalte<br />
(Klinische Untersuchung, Laboruntersuchungen, Lungefunktionstest, EKG,<br />
Echokardiographie), Auswahl unterschiedlicher Ergometrieformen, Interpretation<br />
der Laktatleistungskurve, Indikationen der Spiroergometrie<br />
• Kardiovaskuläre Krankheiten I:<br />
o akuter Myokardinfarkt: Definition, Pathophysiologie, Epidemiologie, Diagnostik,<br />
Therapie (akut/Langzeit) Rehabilitation<br />
o Hypertonie und Sport:<br />
Blutdruckregulationsmechanismen, Definition der Hypertonie, Epidemiologie,<br />
Formen und Stadien der Hypertonie, begünstigende Faktoren, Diagnostik, richtige<br />
Blutdruckmessung, akute Komplikationen und langfristige Folgen der Hypertonie,<br />
Lebenserwartung, Therapie, Kombinationstherapie und Therapie der Hypertonie<br />
bei Sportlern<br />
• Kardiovaskuläre Krankheiten II:<br />
o Untersuchungsmethoden in der Inneren Medizin/Kardiologie<br />
o Anamnese, Ruhe-EKG, Langzeit-EKG, elektrophysiologische Untersuchung, 24 h-<br />
Blutdruckmessung, Kipptischuntersuchung, Belastungs-EKG (Ergometrieformen,<br />
Spiroergometrie), Echokardiographie, Rö-Thorax, Magnetresonanztomographie-<br />
Kardio-MRT-Herzkatheteruntersuchung (Koronarangiographie, PTCA),<br />
Myokardbiopsie<br />
• Kardiovaskuläre Krankheiten III:<br />
o Risikofaktoren der Arteriosklerose<br />
o Koronare Herzkrankheit - akutes Koronarsyndrom - akuter Myokardinfarkt:<br />
Definition, Pathophysiologie, Epidemiologie, Symptomatik, Diagnostik, Therapie<br />
(medikamentös und interventionell)<br />
o Komplikationen, Prognose, Mortalität.<br />
o Differentialdiagnose „Akuter Thoraxschmerz“<br />
• Metabolisches Syndrom I (Diabetes):<br />
o Diabetes mellitus Typ II, Inzidenz des Diabetes in Bezug zur körperlichen Aktivität,<br />
Auswirkung der Intensität und Dauer der Aktivität auf die Diabetesinzidenz,<br />
physiologische Grundlagen des transmembranösen Glucosetransports (GLUT-4),<br />
Glucose und Insulin, Lebensstiländerungen, Wieviel Aktivität ist nötig? Wie wirkt<br />
sich eine Lebensstiländerung auf den Krankheitsverlauf und die Mortalität aus?<br />
• Metabolisches Syndrom II (Fettstoffwechsel):<br />
o Risikofaktoren der Arteriosklerose, Lipoproteine und Subfraktionen, Einfluss<br />
körperlicher Aktivität auf das Lipidprofil, Änderung des Lipidstatus Sport vs. Diät<br />
• Chronische Lungenkrankheiten:<br />
o Definitionen Asthma, COPD und Emphysem. Stadieneinteilung und<br />
Therapieoptionen. Untersuchungstechniken, Interpretation Spirometrie mit<br />
Fallbeispielen. Sport mit Lungenkranken. Ein- und Ausschlusskriterien,<br />
Belastungseinteilung. Praktische Hinweise für die Planung und Durchführung einer<br />
Lungensportgruppe.<br />
• Chronisches Müdigkeitssyndrom:<br />
o Chronic Fatigue Syndrome (CFS) – Definition, Symptomatik, Therapieoptionen.<br />
Überbelastung und Übertraining im Sport – wissenschaftlicher Hintergrund,
Terminologie, Ursachen. Diagnostische Möglichkeiten. Therapieoptionen.<br />
Praktische Tipps zur Vermeidung von Überbelastungssituationen im Sport.<br />
• Risiken körperlicher Aktivität: Plötzlicher Herztod<br />
o Anatomie, Physiologie des Herz-Kreislaufsystems, Reizleitungssystem,<br />
Energieversorgung des Herzens, Herzgröße bei Kindern, Sportlern, versch.<br />
Tierarten in Bezug zum Körpergewicht. Typische EKG-Veränderungen des<br />
Sportlers, Definition und Risiko des plötzlichen Herztodes (auch in Bezug auf<br />
ausgeübte Sportart), ursächliche Erkrankungen Verteilung in Bezug auf Alter,<br />
speziell besprochen Hypertrophe Kardiomyopathie, Myokarditis, Empfehlungen zur<br />
Vermeidung des Plötzlichen Herztodes im Sport<br />
• Körperliche Aktivität im hohen Lebensalter:<br />
o Alterungsprozess des Herz-Kreislaufsystems, insbesondere der Arterien: Zunahme<br />
Wanddicke, Steifigkeit, Durchmesser, Konsequenzen für den Blutfluß,<br />
insbesondere Scherkraft, Folgerungen für die körperliche Aktivität im<br />
Alterungsprozess, Trainierbarkeit der arteriellen Elastizität mit zunehmendem Alter<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Keine Angabe<br />
• Tumorerkrankungen:<br />
o Definition, Epidemiologie, Ätiologie, Krebsentstehung, TNM-System, Therapien,<br />
o Sport und Krebs: Epidemiologische Studien Zielsetzungen, Kontraindikationen<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Hiddemann W, Huber H., Bartram C.: Die Onkologie Teil I und II. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg <strong>20</strong>04<br />
Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland (Hrsg) in Zusammenarbeit mit dem<br />
Robert Koch Institut: Krebs in Deutschland – Häufigkeiten und Trends. 4. Ausgabe, Saarbrücken <strong>20</strong>04.<br />
Friedenreich CM, Orenstein MR: Physical activity and cancer prevention: etiologic evidence and biological<br />
mechanisms. J Nutr. 132 (11 Suppl): 3456-3464 (<strong>20</strong>02).<br />
Lötzerich H, Peters C, Schulz T: Körperliche Aktivität und maligne Tumorerkrankungen. In: Samitz G, Mensink G<br />
(Hrsg): Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag, München <strong>20</strong>02, pp.155-168.<br />
Peters C, Schüle K, Lötzerich H, Uhlenbruck G: Bewegung und Sport als Therapiemöglichkeit in der<br />
Krebsnachsorge. Geburtshilfe Frauenheilkunde. 56(2): M19-23 (1996).<br />
Peters C, Schulz T, Michna H: Exercise in Cancer Therapy. Eur J Sports Sci 2(3): 1-14 (<strong>20</strong>02).
BM: Ausgewählte internmedizinische Aspekte (Se)<br />
• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten<br />
o Wie wird eine Literaturrecherche durchgeführt, Herangehensweise an ein<br />
Referatsthema, Bewertung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen,<br />
Impactfactors von Zeitschriften, Medline-Recherche, Aufbau eines<br />
Literaturverzeichnisses, Zitierweise, Wie präsentiere ich das Thema<br />
• Themenvorstellung durch Studenten (Zweiergruppen)<br />
o mittels einer Literaturrecherche aktuelle medizinische, meist englischsprachige<br />
Literatur in der Medline eigenständig gesucht und erarbeitet werden soll. Die<br />
Präsentation des Themas dauert dann eine Stunde (pro Student 30 min)<br />
anschließend Diskussion mit Beantwortung von Fragen durch die Referenten.<br />
Abgabe eines Handouts.<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
� Athletenscreening bzgl. Plötzlicher Herztod<br />
� Sportliche Aktivität und Schlaganfall<br />
� Belastungshypertonie und Endotheldysfunktion<br />
� „Fit but fat“<br />
� Neue Diätansätze (Atkins, GI, Health Eating etc.)<br />
� Diabetes mellitus- Komplikationen beim Sport<br />
� periphere arterielle Verschlußkrankheit und Sport<br />
� Colonkarzinom und Sport<br />
� Sport bei Stammzelltransplantation<br />
� Einfluß von Sport auf Depressionen<br />
� HIV und Sport<br />
� Höhenkrankheit<br />
� Immunsystem<br />
� Adipositas im Kindes- und Jugendalter<br />
� Kollaps, Synkope, vegetative Dystonie<br />
� Allergie und allergisches Asthma und Sport<br />
� Magen-Darm-Probleme und Sport<br />
� Abnehmen – eine große Problemzone<br />
� Depression und Sport<br />
Eigene Recherche der Studierenden
BM: Orthopädisch-traumatologische Sportmedizin (VL)<br />
Allgemeine Grundlagen:<br />
• Motorische Hauptbeanspruchungsformen im Leistungssport aus orthopädischer Sicht mit<br />
Beispielen aus verschied. Sportarten<br />
• Trainingsformen im Leistungssport aus orthopädischer Sicht<br />
• Sportorthopäd. Untersuchung: Beispiele aus Freizeit- und Leistungssport<br />
• Statik und Haltung des Bewegungs- und Stützapparates<br />
• Orthopäd. Krankheitsbilder und Leistungssport:<br />
o Wirbelkörperaufbaustörung, M.Scheuermann, Spondylolyse/-listhese<br />
o M. Osgood Schlatter/ Sinding-Larsen, Femoropatellares Schmerzsyndrom,<br />
„Jumpers knee“<br />
o Aseptische Knochennekrosen, Laxität, Instabilität<br />
o Knorpelschäden, Arthrose, Arthritis<br />
o Achillodynie, Tarsaltunnel-Syndrom, Fersensporn, Morton`sche Neuralgie<br />
o Knie-, Hüft- und Schulterprothesen<br />
o Sportanatomie<br />
Sportartspezifische Grundlagen:<br />
• Spezielle orthopädische Aspekte im Leistungssport anhand ausgewählter Sportarten:<br />
o Krafttraining, Bodybuilding, Gewichtheben<br />
o Ski nordisch (Diagonal, Skating)<br />
o Ski alpin (Freestyle, Carving)<br />
o Schwimmen, Wasserspringen<br />
o Tennis, Squash, Badminton<br />
o Fußball, Handball<br />
o Bergsteigen, Sportklettern, Segeln<br />
o Leichtathletik<br />
o Volleyball, Basketball<br />
o Radsport, Eishockey<br />
o Turnen u. Wettkampfgymnastik<br />
o Kampfsportarten<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Peterson L., Renström P.: Verletzungen im Sport. Prävention und Behandlung. Deutscher Ärzteverlag. Köln.<br />
<strong>20</strong>02
BM: Orthopädisch-traumatologische Sportmedizin (Se)<br />
• Einführung<br />
• Übersicht: Epidemiologie akuter Verletzungen und Überlastungssyndrome im Sport<br />
o Typ. Verletzungen + Überlastungen bei: -Kindern und Jugendlichen, -Senioren<br />
• Frau im Sport:<br />
o Anatom. Unterschiede Frau-Mann. Konsequenzen?<br />
o Sporthistor. Entwicklung (Sportarten, körperliche Belastbarkeit, Welt-Rekorde)<br />
o Geschlechtsspez. Verletzungen + Überlastungen<br />
• Knie im Sport:<br />
o Femoropatellares Schmerzsyndrom<br />
o Patellaspitzensyndrom (Jumper`s knee)<br />
o Knorpelschaden, Osteochondrosis diss., Arthrose<br />
• Schulter im Sport:<br />
o Impingement-Syndrom<br />
o Laxität, Stabilität und Instabilität<br />
o Rotatorenmanschette<br />
• Ellbogen, Hand + Finger:<br />
o Ellenbogenluxation<br />
o Tennis-, Golfer-, Werferellbogen<br />
o Supinator-, Ulnaris-Syndrom<br />
o Beuge- und Strecksehnenverletzungen d. Hand<br />
• Schwimmen+Tauchen / Trendsport<br />
o Ist Schwimmen gesund? Kritische Fakten<br />
o Apnoe-Tieftauchen. Gefahren-<br />
o Trendsport: Rolle der Medien<br />
o Trendsport: Risiko,/-versicherung, Urteile<br />
o Trendsport: neueste Trends (Speed/CC-Golf, Amazonassurfen etc.)<br />
• Grundzüge der Nachbehandlung + Reha:<br />
o allg. + OSG<br />
o Knie + Schulter<br />
o Neue Erkenntnisse beim Dehnen?<br />
• Bergsport und Skisport:<br />
o Erfrierung + Unterkühlung, Management<br />
o Verletzungen beim Klettern: Indoor-Outdoor<br />
o Verletzungen beim Mountainbike<br />
o Verletzungen beim Telemark<br />
• Wirbelsäule, Rumpf + Becken:<br />
o Spondylolyse, Spondylolisthese im Sport<br />
o M.Scheuermann, Lumbalgie und Sport<br />
o Lumboischialgie, Protrusio, Prolaps im Sport<br />
• Allgemein und Rehabilitation:<br />
o Übertraining<br />
o Sinn und Unsinn der Eisbehandlung<br />
o Entzündung und Schmerz (Stadien etc.)<br />
• Typ. Verletzungen + Überlastung bei best. Sportarten:<br />
o Wassersport: Wakeboarding, Kitesurfen<br />
o Funpark: Skateboarden, BMX, Inline, Rollschuh
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Von Studierenden erarbeitet Literatur zu den jeweiligen Themen.
BM: Präv. Sport 1 (Gesundheits- und Fitnesstraining) (VL)<br />
• Gesundheit, Prävention, Rehabilitation<br />
• Gesundheitspolitische und gesetzliche Rahmenbedingungen<br />
• Gesundheitssurveys<br />
• Motorische Basisdiagnostik<br />
• Fitnesstest<br />
• Planung und Durchführung eines gesundheitsorientierten Trainingsprogramms<br />
• (Spezielle) Ernährung unter speziellen Bedingungen<br />
o Stoffwechsel und Belastung<br />
o Sporternährung<br />
o Vegetarismus<br />
o Parenterale / Enterale Ernährung<br />
o Orthomolekulare Ernährung<br />
o Ernährungsstatus: Erhebungsmethoden<br />
o Anorexia nervosa, Anorexia athletica, Bulimie, Binge-Eating-Störung<br />
Allgemeine Basisliteratur Präventiver Sport:<br />
Bös K, Wydra G, Karisch G: Gesundheitsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport. Perimed Verlag, Erlangen<br />
1992<br />
Hurrelmann K, Klotz T, Haisch J (Hrsg): Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung. Verlag Hans Huber,<br />
Bern <strong>20</strong>04<br />
Samitz G, Mensink G (Hrsg): Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag GmbH,<br />
München <strong>20</strong>02<br />
Schüle K, Huber G: Grundlagen der Sporttherapie. Gustav Fischer Verlag, München <strong>20</strong>00<br />
Vogt L, Neumann A (Hrsg): Sport in der Prävention. Dt Ärzte-Verlag, Köln <strong>20</strong>06<br />
Buskies W., Boeckh-Behrens W.-U. (1996). Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining. Dr. Loges und Co. GmbH,<br />
Winsen, Seite 17.<br />
Allgemeine Basisliteratur Ernährung:<br />
Biesalski, H.K., Grimm, P.: Taschenatlas der Ernährung, Stuttgart: Thieme (<strong>20</strong>01)<br />
Pape, D. et al.: Gesund - Vital- Schlank, Köln: Deutscher Ärzte (<strong>20</strong>01)<br />
Biesalski, H.K. et al.: Ernährungsmedizin. Nach dem Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer,<br />
Stuttgart: Thieme (<strong>20</strong>04)<br />
Leitzmann, C. et al.: Ernährung in Prävention und Therapie. Ein Lehrbuch, Hippokrates (<strong>20</strong>03)<br />
http://www.ernaehrung.de/<br />
http://www.dge.de/<br />
http://www.uni-hohenheim.de/wwwin140/info/hinweise/krankheiten/ernaehrung_und_krankheit.htm<br />
http://www.gesundheit.de/ernaehrung/krankheit-ernaehrung/index.html
BM: Präventiver Sport 1 (Ü)<br />
• Belastungsdosierung<br />
o Belastungskontrolle<br />
o Subjektive Belastungseinschätzung<br />
o Pulskontrolle<br />
o Atmung<br />
o Belastungsintensität<br />
o Belastungsart<br />
o Einflussfaktoren<br />
• Kritische Betrachtung verschiedenster Belastungen im Gesundheitssport<br />
• Kritische Betrachtung diagnostischer Instrumente im Gesundheitssport<br />
o Basisdiagnostik<br />
o Fitnesstests<br />
• Aufwärmen unter bes. Berücksichtigung der Lebensaltersstufen<br />
• Krafttraining unter bes. Berücksichtigung der Lebensaltersstufen<br />
• Grundlagen der Gang-/Laufanalyse<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Balster K: Kinder mit mangelnden Bewegungserfahrungen, Teil 2. Sportjugend LSB NRW (Hrsg). Holterdorf,<br />
Oelde <strong>20</strong>03.<br />
Bös K, Wydra G, Karisch G: Gesundheitsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport. Perimed, Erlangen 1992.<br />
Froböse I, Nellessen G, Wilke C (Hrsg): Training in der Therapie – Grundlagen und Praxis. Urban & Fischer,<br />
München Jena <strong>20</strong>03.<br />
Meusel H: Sport für Ältere. Schattauer, Stuttgart New York 1999.<br />
Samitz G, Mensink G (Hrsg): Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag, München<br />
<strong>20</strong>02.<br />
Schüle L, Huber G (Hrsg): Grundlagen der Sporttherapie. Urban & Fischer, München Jena <strong>20</strong>00.<br />
Williams MH: Ernährung, Fitness und Sport. Ullstein Mosby, Berlin, Wiesbaden 1997.
BM: Präv. Sport 2 (Ausgleichssport) (Ü)<br />
• Methodik + Didaktik des Ausgleichsportes<br />
• Angewandte Sportartenanalyse<br />
o Beispiele aus verschiedenen Sportarten/-aktivitäten<br />
• Angewandte Arbeitsplatzanalyse<br />
o Beispiele ausgewählter beruflicher Tätigkeiten<br />
• Lehrpraktische Erfahrungen<br />
o Themenbearbeitung in Form einer Lehrübung aus dem Katalog der in der<br />
Fakultät angebotenen Sportarten und Aktivitäten bzw. aus verschiedenen<br />
Berufsfeldern durch und mit Studierenden<br />
• Health-Coaching<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Von Studierenden erarbeitete Literatur.<br />
Literatur zu allgemeiner Fitness und sportartspezifische Literatur.
BM: Präv. Sport 3 (Muskelfunktionsdiagnostik) (Ü)<br />
• Didaktik und Methodik der Muskelfunktionsdiagnostik<br />
• Muskelfunktionsketten<br />
• Referenzpunkte<br />
• Beurteilungskriterien<br />
• Tests auf Kraft und Verkürzung<br />
• Test und Befundung der Muskeloberfläche<br />
• Neurologie<br />
• Dermatome<br />
• Praktische Erfahrungen<br />
• Testung der großen Muskeln des Bewegungsapparates nach Kendall und Janda<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Kendall FP/Kendall McCreary E: Muskeln, Funktionen und Test. Fischer Verlag, Stuttgart, <strong>20</strong>01<br />
(Klausurgrundlage)<br />
Janda V: Muskelfunktionsdiagnostik. Verlag Aceo, Leuven, 1994<br />
Putz R/Pabst R: Sobotta. Atlas der Anatomie des Menschen. Urban & Fischer, CD-ROM (Bildmaterial)<br />
Hochschild J:Strukturen und Funktionen begreifen.Band1+2 Thieme Verlag, Stuttgart, 1998 + <strong>20</strong>02 (Palpation)<br />
Banzer W/Pfeifer K/Vogt L: Funktionsdiagnostikdes Bewegungssystems in der Sportmedizin. Springer Verlag,<br />
Berlin, <strong>20</strong>04 (Zusammenfassung Diagnostik allg.)
BM: Sporttherapie (VL)<br />
• Einführung in die Sporttherapie<br />
• Effizienznachweis<br />
• Grundlagen der Ambulanten Sporttherapie<br />
• Maßnahmen und Methoden in der Sporttherapie<br />
• Kooperierende/ Alternative Therapiemethoden<br />
• Struktur der Sporttherapie<br />
• Patientenführung<br />
• Schmerz und Therapie<br />
• Therapie und Immobilisation<br />
• Therapie und Propiozeption<br />
BM: Sporttherapie (Ü):<br />
• Funktionsgymnastik<br />
• Fussgymnastik<br />
• Trainingsgeräte in der Therapie<br />
• Nordic Walking<br />
• Aqua Fitness<br />
• Rückenschule<br />
• Wirbelsäulengymnastik<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Froböse I / Nellessen G / Wilke C: Training in der Therapie. Grundlagen und Praxis. Urban & Fischer Verlag,<br />
München Jena, <strong>20</strong>03.<br />
Schönle CH: Rehabilitation. Thieme Verlag, Stuttgart, <strong>20</strong>03.<br />
Kunz M: Medizinisches Aufbautraining. Erfolg durch MAT in Prävention und Rehabilitation. Urban & Fischer<br />
Verlag, München Jena, <strong>20</strong>03.<br />
Buchbauer J: Krafttraining mit Seilzug und Fitnessgeräten. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf, <strong>20</strong>03.<br />
Ehrich D / Gebel R: Therapie und Aufbautraining nach Sportverletzungen. Philippka Sportverlag, <strong>20</strong>00.<br />
Schüle K / Huber G (Hrsg): Grundlagen der Sporttherapie. Prävention, ambulante und stationäre Rehabilitation.<br />
Urban & Fischer Verlag, München Jena, <strong>20</strong>00.<br />
Radlinger L et al.: Rehabilitatives Krafttraining. Thieme Verlag, Stuttgart, 1998.<br />
Felder H et al.: Ambulante Rehabilitation. Thieme Verlag, Stuttgart, 1998.<br />
Horn HG / Steinmann HJ: Medizinisches Aufbautraining. Fischer Verlag, Stuttgart, 1998.
BM: Behindertensport (Se)<br />
• Behinderungsarten, Konsequenzen für den Sport, Beeinträchtigungen<br />
• Rehasport - Freizeit-/Breitensport – Leistungssport<br />
• Historische Entwicklung des Behindertensports<br />
• Grundlagen der Klassifizierung, Ursprünge bis Aktuelles<br />
• Paralympics, Special Olympics<br />
• Sinnesbehinderungen: Sehschädigungen/ Hilfsmittel, Psychomotorische<br />
Auffälligkeiten<br />
• Goalball: Regelwerk, Spielablauf<br />
• Gehörlosensport, Organisatorisches, Gebärdensprache<br />
• Beinbehinderungen (angeboren/erworben)<br />
• Armbehinderungen (angeboren/erworben)<br />
• Querschnitt<br />
• Zerebralparese, GB<br />
• Kleinwüchsige<br />
Allgemeine Basisliteratur<br />
Arnold W, Israel S, Richter H: Sport mit Rollstuhlfahrern. Johann Ambrosius Barth, Leipzig Berlin<br />
Heidelberg 1992.<br />
Bausenwein I: Sport mit Zerebralparetikern. Hofmann, Schorndorf 1982.<br />
Blaumeister G.: Herausforderung Behindertensport. Spitta, Balingen 1999.<br />
Innenmoser J: Schwimmspaß für Behinderte. Sport Fahnemann, Bockenem 1988.<br />
IPC (ed): Paralympic Winter Games 1976-<strong>20</strong>06. RLC, Paris <strong>20</strong>06.<br />
Kosel H, Froböse I: Rehabilitations- und Behindertensport. Pflaum, München 1998.<br />
Rusch H, Grössing S: Sport mit Körperbehinderten. Hofmann, Schorndorf 1991.<br />
Scheid V (Hrsg): Facetten des Sports behinderter Menschen. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>02<br />
Scheid V, Rank M, Kuckuck R: Behindertenleistungssport. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>03.<br />
Scheid V, Rieder H (Hrsg): Behindertensport - Wege zur Leistung. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>00.<br />
Interessante Internetseiten:<br />
www.paralympic.org<br />
www.dbs-npc.de<br />
www.rollstuhlsport.de<br />
www.bvs-bayern.com<br />
www.dg-sv.de
BM: Behindertensport (Ü)<br />
• Sport mit Sinnesbehinderten: Orientierungstraining für Blinde<br />
• Sport mit Sinnesbehinderten: Laufen auf Schallquelle<br />
• Sport mit Sinnesbehinderten: Springen, Klettern, Balancieren<br />
• Blinde (Goalball)<br />
• Sport mit Beinbehinderungen (ohne Rollstuhl): Gangbild, Spielformen<br />
• Sitzvolleyball<br />
• Sport mit Armbehinderungen<br />
• Elementare und spezifische Rollstuhltechniken<br />
• Mobilitätstraining<br />
• Rollstuhlrugby<br />
• Rollstuhlbasketball<br />
• Rollstuhltennis<br />
• Schwimmen im Behindertensport<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Arnold W, Israel S, Richter H: Sport mit Rollstuhlfahrern. Johann Ambrosius Barth, Leipzig Berlin<br />
Heidelberg 1992.<br />
Bausenwein I: Sport mit Zerebralparetikern. Hofmann, Schorndorf 1982.<br />
Blaumeister G.: Herausforderung Behindertensport. Spitta, Balingen 1999.<br />
Innenmoser J: Schwimmspaß für Behinderte. Sport Fahnemann, Bockenem 1988.<br />
IPC (ed): Paralympic Winter Games 1976-<strong>20</strong>06. RLC, Paris <strong>20</strong>06.<br />
Kosel H, Froböse I: Rehabilitations- und Behindertensport. Pflaum, München 1998.<br />
Rusch H, Grössing S: Sport mit Körperbehinderten. Hofmann, Schorndorf 1991.<br />
Scheid V (Hrsg): Facetten des Sports behinderter Menschen. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>02<br />
Scheid V, Rank M, Kuckuck R: Behindertenleistungssport. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>03.<br />
Scheid V, Rieder H (Hrsg): Behindertensport - Wege zur Leistung. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>00.
BM: Pädagogische Aspekte (Se)<br />
• Pädagogische Aspekte in der Rehabilitation und Prävention<br />
o Freizeitpädagogik<br />
o Empowerment<br />
o Zukunftsforschung<br />
o Qualität im Gesundheitssektor<br />
o Stress<br />
o Gesundheitsförderung; Moderne Gesundheitskonzepte<br />
• Vorstellung von Betrieben und deren Präventions-/Gesundheitsvorsorgeprogrammen<br />
durch Studierende<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Keine Angabe
BM: Philosophisch/soziologische Aspekte (Se)<br />
„Sport in der Prävention und in der Therapie von Krankheiten“<br />
Dieses Seminar möchte Grundlagen der Sport- und Gesundheitssoziologie vermitteln<br />
und dient als Basis für die darauf aufbauenden Profilmodule. Nach einer Einführung in<br />
soziologische Begriffe wie z.B. Sozialisation, Soziales Handeln, Schicht und Kultur wird<br />
auf die Struktur und Entwicklung unseres Gesundheitswesens eingegangen. Hier<br />
werden Aufgaben sozialer Einrichtungen der Rehabilitation und Prävention vorgestellt<br />
und ein Überblick über bestehende Netzwerke gegeben. Im weiteren Seminarverlauf<br />
werden Patientenkarrieren und das Erleben von Krankheit im familiären und<br />
soziokulturellen Kontext besprochen. Im Anschluss werden soziale Aspekte der<br />
Therapeut-Patient-Interaktion diskutiert und mögliche Interventionsformen in der<br />
Rehabilitation und Prävention angeschnitten.<br />
Themenübersicht:<br />
• Einführung, soziologische Begriffe<br />
Rolle, Norm, Sozialisation, Kultur, Institution, Organisation<br />
• Einführung in die Gesundheitssoziologie<br />
Einführung in Begriffe Geschichte, Entwicklung<br />
• Soziale Ressourcen und Strukturen<br />
Soziales Netzwerk - soziale Unterstützung und Gesundheit<br />
• Sozialer Einfluss auf Gesundheit/Krankheit<br />
Schicht, Schichtgradient und soziale Determinanten von Gesundheit<br />
• Sozialer Einfluss auf Gesundheit/Krankheit<br />
Soziale Repräsentationen und subjektive Theorien von Gesundheit<br />
• Soziale Rollen in der Rehabilitation<br />
Krankenrolle – Patientenkarrieren (institutional, personal)<br />
• Interaktion in Rehabilitation und Prävention<br />
Therapeut-Patient-Interaktion, Compliance<br />
• Krankheitserleben und Krankheitsbewältigung<br />
Selbstregulation, Selbsthilfe, Stressbewältigung<br />
• Belastungen für den Therapeuten<br />
Arbeitsbelastung, Berufsrolle und präventive Maßnahmen<br />
• Gesundheitspolitische Maßnahmen und Auswirkung<br />
Staatliche Präventionspolitik, Präventionsforschung<br />
Weitere Themen:<br />
• Struktur des dt. Gesundheitswesens aus soziologischer Perspektive<br />
(Organisation/Institution Krankenhaus-Therapiezentrum)<br />
• Prävention/Präventionsforschung bei Patienten<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Abels, H. (<strong>20</strong>01). Einführung in die Soziologie. Lehrbuch (Bd. 1 & 2). Wiesbaden: VS Verlag.
Giddens, A. (1995). Soziologie. Graz: Nausner & Nausner.<br />
Hurrelmann, K. (<strong>20</strong>03). Gesundheitssoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftliche Theorien von<br />
Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. Weinheim: Juventa Verlag.<br />
Siegrist, J. (1995). Medizinische Soziologie. München: Urban & Schwarzenberg.<br />
Wilker, F.-W., Bischoff, C. & Novak, P. (1994). Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie.<br />
München: Urban & Schwarzenberg.
BM: Psychologische Aspekte (Se)<br />
Die Veranstaltung legt einen Schwerpunkt auf (sport-) psychologische Maßnahmen der<br />
Primärprävention, insbesondere Entspannungsverfahren. Mit der Neufassung des<br />
Sozialgesetzbuch V im Jahr <strong>20</strong>00 hat der Bereich der Primärprävention eine hohe<br />
Bedeutung erhalten, ein Schwerpunkt darin bildet das Präventionsprinzip „Förderung<br />
individueller Kompetenzen der Belastungsverarbeitung zur Vermeidung stressbedingter<br />
Gesundheitsrisiken“ (AG Spitzenverbände, <strong>20</strong>06). Neben theoretischen Grundlagen zu<br />
Wirkung und Wirksamkeit von Entspannungsverfahren wird in der Veranstaltung ein<br />
Einblick in deren Anwendung und Durchführung vermittelt.<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Vaitl, D. & Petermann, F. (Hrsg.) (<strong>20</strong>04). Entspannungsverfahren. Das Praxishandbuch. Weinheim: Beltz<br />
PVU
BM: Trainingsaspekte im Präventions- und Rehabilitationssport (Se)<br />
• Jeweils 1-2 Studierende arbeiten ein Thema aus und tragen dies in<br />
• einem <strong>20</strong> –25 min Referat vor!<br />
• Zum Vortragstermin Abgabe eines „ Handout – Rohentwurfes“ beim Dozenten<br />
• In der folgenden Woche Abgabe des besprochenen und korrigierten Rohentwurfes<br />
mit<br />
• den entsprechenden Literaturangaben! Verteilung des Handouts an die<br />
Studierenden!<br />
• Anerkennung der Veranstaltung gemäß Anwesenheitsregelung u. termingerechter<br />
• Bearbeitung der Themen/ Hospitationen im Hochschulsport mit Hospitationsbericht<br />
Themenübersicht:<br />
• Einführung, Vorstellung der Themen, Themenvergabe<br />
• Beweglichkeit - Problemstellung<br />
• Beweglichkeit –Trainingskonzept<br />
• Krafttraining – Problemstellung<br />
• Krafttraining vs. Leistungstraining<br />
• Trainingskonzept Muskelaufbautraining<br />
• Problem Muskeldiagnostik<br />
• Muskeln/ Koordination: Faktoren der Beurteilung<br />
• Trainingskonzepte Koordination<br />
• Prävention – Problemstellung<br />
• Dimensionen der Prävention<br />
• Trainingskonzepte in der Prävention<br />
• Schlussbesprechung und Resümee<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Von Studierenden erarbeitete Literaturquellen.
PM1: Klinisches Praktikum in der Inneren Medizin (Ü)<br />
Hospitation in der Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin mit<br />
schriftlichem Bericht
PM1: Wissenschaftliches Projekt (Se)<br />
Im Rahmen des wissenschaftlichen Projektes werden die Studierenden an eine<br />
wissenschaftliche Arbeitsweise herangeführt. Dabei werden unterschiedliche Themen im<br />
Bereich der Sportwissenschaft erarbeitet.<br />
• Themenfindung und Erarbeiten einer Fragestellung<br />
• wissenschaftliche Literaturrecherche<br />
• Literaturbearbeitung<br />
• Auswahl geeigneter sportwissenschaftliche Methoden entsprechend der<br />
Fragestellung<br />
• Durchführung wiss. Methoden<br />
• Auswertung und Interpretation von Messdaten<br />
• Schriftliche Ausarbeitung bzw. Präsentation<br />
Die Themen erstrecken sich über die unterschiedlichen Teildisziplinen der<br />
Sportwissenschaft:<br />
• Sportphysiologie<br />
• Sportpsychologie<br />
• Sport und Gesundheit<br />
• Leistungsdiagnostik<br />
• Biomechanik<br />
• Trainingswissenschaft<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Im jeweiligen Projekt recherchierte Literatur.
PM1: Kardiologische Prävention und Rehabilitation (Se)<br />
• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten:<br />
Internet, Pub-med-Recherche, Suchkriterien Studien, Impact-Faktoren, Korrektes<br />
Zitieren<br />
• Themenvorstellung durch Studenten<br />
o Herz-Kreislaufregulation unter Belastung (Ausdauer/Kraft)<br />
o Koronare Herzkrankheit /Primärprävention/akuter Myokardinfarkt<br />
o Sekundärprävention der KHK, Herzsport, soziale Aspekte<br />
o art. Hypertonie und hypertensive Herzkrankheit<br />
o Myokarditis und Endokarditis<br />
o Vitien des Herzens (Mitralstenose und –insuffizienz/ Aortenstenose und<br />
–insuffizienz)<br />
o Kardiomyopathien<br />
o Herzrhythmusstörungen<br />
o Herzinsuffizienz<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Eigene Recherche der Studierenden
PM1: Kardiovaskuläre und pulmonale Erkrankungen (VL)<br />
• KHK/akuter Myokardinfarkt<br />
o Risikofaktoren der KHK, Pathophysiologie, Symptome, Diagnostik, Therapie,<br />
Akuttherapie des Herzinfarktes, EKG des Herzinfarktes und weitere Diagnostik,<br />
Komplikationen des Herzinfarktes, Langzeittherapie<br />
• art. Hypertonie/hypertensive Herzkrankheit<br />
o Hypertonie: Einteilung, sozioökonomische Faktoren, Prävalenz, Symptome,<br />
Hypertoniefolgen. hypertensive Herzerkrankung: Definition, Folgen, Therapie,<br />
Lebensstiländerung, akute und chronische Effekte von Ausdauer- und Krafttraining<br />
bei Hypertonie, Trainingsempfehlung bei Hypertonie<br />
• Myokarditis/Endokarditis<br />
o Definition Myokarditis, Endokarditis, Perikarditis, Myokarditis: Erreger, Symptome,<br />
Diagnostik, Lyme-Borreliose, Perikarditis: Ätiologie, Einteilung, Symptome,<br />
Diagnostik, Therapie, Begleitperikarditis, Dressler-Syndrom, Perikardtamponade<br />
(Symptome, Diagnostik, Therapie), Endokarditis: Pathophysiologie, Risikogruppen,<br />
Ursachen, Erreger, Symptome, Befunde, Komplikationen, Diagnostikkriterien,<br />
Therapie, Prognose, Endokarditisprophylaxe<br />
• Vitien (Aorten/Mitralklappenstenose, Aorten/Mitralinsuffizienz)<br />
o Definition aller Klappenerkrankungen, Pathophysiologie, Symptome, Diagnostik,<br />
Therapie von Aortenstenose, Aorteninsuffizienz, Mitralstenose, Mitralinsuffizienz,<br />
Mitralklappenprolaps<br />
• Kardiomyopathien<br />
o Formen der CM, Pathophysiologie, Symptome, Diagnostik, Therapie, plötzlicher<br />
Herztod, Therapie incl. ICD-Implantation<br />
• Herzrhythmusstörungen<br />
o Grundlagen des EKGs, Wiederholung Reizbildungs- und Reizleitungssystem,<br />
Aussagemöglichkeiten des EKGs, Sinusrhythmus, Sinusarrhythmie, wie<br />
unterscheidet man Rhythmusstörungen, Extrasystolen – ventrikulär und<br />
supraventrikulär, Bradykardie: Ursachen, Einteilung, AV-Block, Symptome, Therapie,<br />
Herzschrittmacher, supraventrikuläre Tachykardien, Definition, Arten und Ursachen,<br />
Vorhofflimmern, Ursachen, Symptome, Befunde, Komplikationen, Therapie,<br />
Antikoagulation, Vorhofflattern, ventrikuläre Rhythmusstörungen Ursachen,<br />
Symptome, Diagnostik und Therapie, Kardioversion und Defibrillation, ICD<br />
• Venöse und arterielle Gefäßerkrankungen<br />
o Übersicht Krankheiten der arteriellen und venösen Gefäße<br />
o periphere arterielle Verschlußkrankheit, Def, Ursachen, Epidemiologie, Symptome,<br />
Stadieneinteilung nach Fontaine, Diagnostik, Therapie, Prognose<br />
o Venöse: Varikosis Einteilung, Epidemiologie, Anatomie des Venensystems,<br />
Diagnostik, Klinik, Stadieneinteilung, Komplikationen, Therapie, Thrombophlebitis:<br />
Ätiologie, Klinik Therapie, Phlebothrombose tiefe: Virchow-Trias, Inzidenz,<br />
prädisponierende Faktoren, Klinik, klinische Diagnose, Diagnostik,<br />
Differentialdiagnose, Komplikationen, Therapie (u.a. Heparin, Marcumar)<br />
Frühkomplikation der Thrombose: Lungenembolie Klinik, Diagnose, Therapie,<br />
Komplikationen, Thromboseprophylaxe, Spätkomplikationen der Thrombose<br />
(postthrombotisches Syndrom, Ulcus cruris, chronisch venöse Insuffizienz)<br />
• Herzinsuffizienz<br />
o Definition, verschiedene Formen, Einteilung, Ursachen, Prävalenz, Symptome,<br />
Diagnostik, Behandlung, Ursache der Belastungintoleranz bei Herzinsuffizienz,<br />
Körperliches Training bei Herzinsuffizienz, Effekte von Sport, Trainingsempfehlung
• COPD<br />
o Definitionen Asthma und COPD. Stadieneinteilung und Therapieoptionen. Ätiologie –<br />
Rauchen und Lungenfunktion. Apparative Befunde bei chronischen Rauchern.<br />
Untersuchungstechniken, Interpretation Spirometrie mit Fallbeispielen. Behandlung<br />
der obstruktiven Atemwegserkrankungen – Medikamente, Wirkmechanismen,<br />
Erfolgsaussichten. Sport mit Lungenkranken. Ein- und Ausschlusskriterien,<br />
Belastungseinteilung. Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zum Outcome<br />
Sport bei Lungenkranken. Praktische Hinweise für die Planung und Durchführung<br />
einer Lungensportgruppe.<br />
• Asthma bronchiale/ allergisches Asthma/Belastungsasthma<br />
o Atemwege (Aufbau, Funktion, Erkrankungen; Pathophysiologie);<br />
o Asthma bronchiale (Epidemiologie, Ätiologie, Pathogenese, Auslöser, Mediatoren,<br />
Einteilung, Symptome, Verlauf, Diagnostik, Schweregrade, Therapie, Notfallplan);<br />
Allergie (Allergene, Symptomatik, Prophylaxe, Therapie, Etagenwechsel); EIA:<br />
(Pathomechanismus; Sport bei EIA, therapeutische Effekte des Sports);<br />
Leistungssport bei Asthma: Dopingproblematik<br />
• restriktive Lungenkrankheiten<br />
o Definition ,Ätiologie; Veränderungen der Lungenfunktionsparameter; Fibrose<br />
(Pathogenese, Ursachen, Symptome); Cystische Fibrose (Krankheitsbild, Symptome,<br />
Therapie) ; Bronchial-Ca; (Epidemiologie; Einteilung; Symptome, Therapie,<br />
Prognose) Sport bei Atemwegserkrankungen<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Keine Angabe
PM1: metabolische und neoplastische Erkrankungen (VL)<br />
Metabolische Erkrankungen (VL):<br />
• Diabetes<br />
o Schwerpunkt Diabetes Typ I, II, Pathogenese, Klinische Kriterien für Typ I und<br />
II, Epidemiologie, Geographische Verteilung, Lebenserwartung,<br />
Komplikationen, Folgeerkrankungen, medikamentöse Therapie (Orale,<br />
Insuline, Zukunftsaussichten)<br />
• Diabetesfolgeerkrankungen<br />
o Besprechung der verschiedenen Folgeerkrankungen des Diabetes,<br />
hauptsächlich Typ II Vom metabolischen Syndrom zum Diabetes, Kosten für<br />
das Gesundheitssystem, Wechselbeziehungen der Risikofaktoren, Nutzen<br />
von körperlicher Aktivität für den Diabetiker, Zusammenhang zwischen<br />
kardiopulmonaler Fitness und der Gesamtmortalität des Diabetikers,<br />
Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels bei Gesunden, Diabetikern und<br />
Einfluss von körperlicher Bewegung, speziell Glut-4 (transmembranöser<br />
Glucosetransport) Vergleich zwischen körperlicher Aktivität und<br />
Medikamentenwirkung auf Glut-4, Prävention des Diabetes durch<br />
Lebensstiländerung<br />
• Lipidstoffwechselstörungen<br />
• Adipositas<br />
o Definition, Gewichtsklassifikation, Prävalenz, Ursachen für Adipositas,<br />
Pathogenese, Body composition, Messmethoden, Klinik der Adipositas,<br />
Komplikationen, Therapie<br />
• Osteoporose<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Keine Angabe<br />
Neoplastische Erkrankungen (VL):<br />
• Definitionen, Begrifflichkeiten<br />
• Epidemiologie<br />
• Molekulare Grundlagen<br />
• Ursachen der Krebsentstehung<br />
• Psychoonkologie<br />
• Aufbau, Risikofaktoren, Pathogenese, Einteilung, Diagnostik, Therapie versch.<br />
Krebsarten:<br />
o Hautkrebs<br />
o Brustkrebs<br />
o Gebärmutterkrebs<br />
o Prostatakrebs<br />
o Kolorektalkrebs<br />
o Leukämie
• Prävention<br />
• Diagnostik<br />
• Grundprinzipien Rehabilitation, Einordnung der Sporttherapie<br />
• Sport in der Krebsnachsorge: Entwicklung, Daten, allg. Grundlagen<br />
• Begründung des Sports in der Krebsnachsorge<br />
• Resultierende Praxisempfehlungen, Kontraindikationen, Einschränkungen<br />
• Gesetzliche Grundlagen des Rehasports<br />
• Chirurgie, Strahlentherapie, Chemotherapie, Alternative Methoden<br />
• Krebsprävention durch Sport – Evidenzen, Prävention durch Ernährung, Erfassung<br />
der genetische Disposition, Empfehlungen, Vorsorgeuntersuchungen<br />
Allgemeine Basisliteratur Krebs:<br />
Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland (Hrsg) in Zusammenarbeit mit<br />
dem Robert Koch Institut: Krebs in Deutschland – Häufigkeiten und Trends 4. Ausgabe. Saarbrücken<br />
<strong>20</strong>04.<br />
Beuth J (Hrsg): Grundlagen der Komplementäronkologie. Hippokrates Verlag, Stuttgart <strong>20</strong>02.<br />
Deutsche Krebshilfe e.V.: Die blauen Ratgeber – Ein Ratgeber nicht nur für Betroffene. www.krebshilfe.de<br />
Deutsche Sporthochschule Köln, Landessportbund NRW e.V. (Hrsg.): Ausbildungscurriculum „Sport in der<br />
Krebsnachsorge“ 1991.<br />
Deutsches Krebsforschungszentrum:<br />
http://www.dkfz.de/epi/Home_d/Programm/AG/Praevent/Krebshom/main/englisch/frame.htm<br />
Friedenreich CM, Orenstein MR: Physical activity and cancer prevention: etiologic evidence and biological<br />
mechanisms. J Nutr. 132 (11 Suppl): 3456-3464 (<strong>20</strong>02).<br />
Hiddemann W, Huber H., Bartram C.: Die Onkologie Teil I und II. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg<br />
<strong>20</strong>04<br />
Krebs – Forschung, Diagnostik, Therapie. Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg 1992.<br />
Krebsmedizin II. Spektrum der Wissenschaft Spezial 3/<strong>20</strong>03.<br />
Lötzerich H, Peters C, Schulz T: Körperliche Aktivität und maligne Tumorerkrankungen. In: Samitz G,<br />
Mensink G (Hrsg): Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag, München<br />
<strong>20</strong>02, pp.155-168.<br />
Lötzerich H, Peters C: Krebs und Sport – Einfluß eines moderaten Ausdauertrainings auf Psyche und<br />
Immunsystem. Sport & Buch Strauss, Köln 1997.<br />
Peters C, Schüle K, Lötzerich H, Uhlenbruck G: Bewegung und Sport als Therapiemöglichkeit in der<br />
Krebsnachsorge. Geburtshilfe Frauenheilkunde. 56(2): M19-23 (1996).<br />
Peters C, Schulz T, Michna H: Exercise in Cancer Therapy. Eur J Sports Sci 2(3): 1-14<br />
Schüle K, Huber G (Hrsg): Grundlagen der Sporttherapie: Prävention, ambulante und stationäre<br />
Rehabilitation. Urban und Fischer Verlag, München - Jena <strong>20</strong>00, pp. 23-56.<br />
Statistisches Bundesamt: http://www.destatis.de/.<br />
Zalpour C (Hrsg): Anatomie, Physiologie. Urban und Fischer Verlag, München <strong>20</strong>02
PM1: Neurologsiche Erkrankungen (VL)<br />
• Einführung in die Neurologie<br />
• Neuroanatomie<br />
• Neurophysiologie<br />
• Diagnostik in der Neurologie<br />
• Vorstellung verschiedener neurologischer Erkrankungen (z.B. M. Parkinson)<br />
o Epidemiologie, Ätiologie, Klinik, Therapie<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Keine Angabe
PM1: Sozialwissenschaftliche Aspekte der Prävention und Rehabilitation (VL)<br />
In der Lehrveranstaltungen wir ein Einblick über kulturelle Entwicklungen und<br />
Bedingungen der Gesundheits- und Krankheitsentstehung gegeben. Im Anschluss<br />
erfolgt eine Vertiefung der im Basis- Modul „Sport in der Prävention und Therapie von<br />
Krankheiten“ angesprochenen Themen unter besonderer Berücksichtigung der sozialen<br />
Entstehungsgeschichte internistischer Krankheitsbilder.<br />
Themenübersicht:<br />
• Kultur und Gesundheit<br />
o Religion und Gesundheit<br />
o Sport: Therapie zwischen Wettkampf und Religion<br />
o Kultur und Gesundheitsverständnis (cultural lag, culture bound syndroms)<br />
o Globalisierung und Gesundheitstrends<br />
• Prävention<br />
o Individualmaßnahmen für den Therapeuten I. Mentale Techniken und ihre<br />
Entstehungsgeschichten<br />
o Individualmaßnahmen für den Therapeuten II. Mentale Techniken<br />
Praxisanwendung<br />
• Krankheitsentstehung<br />
o Familienkultur und Krankheitsentstehung<br />
o Sozialer Stress und kardiovaskuläre Erkrankung<br />
o Sozialer Stress und hormonelle Veränderungen<br />
o Soziale und genetische Faktoren der Krebsentstehung<br />
• Rehabilitation<br />
o Gruppen und Individualmaßnahmen in der internistischen Rehabilitation<br />
o Wiedereingliederung in Alltag und Beruf nach internistischen Erkrankungen<br />
(Netzwerke, Umschulungsmaßnahmen, Zugänge)<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Abels, H. (<strong>20</strong>01). Einführung in die Soziologie. Lehrbuch (Bd. 1 & 2). Wiesbaden: VS Verlag.<br />
Giddens, A. (1995). Soziologie. Graz: Nausner & Nausner.<br />
Hurrelmann, K. (<strong>20</strong>03). Gesundheitssoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftliche Theorien von<br />
Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. Weinheim: Juventa Verlag.<br />
Siegrist, J. (1995). Medizinische Soziologie. München: Urban & Schwarzenberg.<br />
Wilker, F.-W., Bischoff, C. & Novak, P. (1994). Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie.<br />
München: Urban & Schwarzenberg.
PM1: Präventiver Sport 1 (Ü)<br />
• Sport mit Krebspatienten: Mammakarzinom, Prostatakarzinom, Colonkarzinom,<br />
Leukämie, Lungenkarzinom…<br />
o Allgemeine Grundlagen des Sports mit Tumorpatienten<br />
o Spezifische Trainingsprogramme<br />
o Zweckgymnastik<br />
o Ausdauertraining<br />
o Kräftigungstraining<br />
o Angepasste „Kleine Spiele“<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Lötzerich H, Peters C, Schulz T: Körperliche Aktivität und maligne Tumorerkrankungen. In: Samitz G,<br />
Mensink G (Hrsg): Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag, München<br />
<strong>20</strong>02, pp.155-168.<br />
Deutsche Sporthochschule Köln, Landessportbund NRW e.V. (Hrsg.): Ausbildungscurriculum „Sport in der<br />
Krebsnachsorge“ 1991.<br />
Schüle K.: Zum aktuellen Stand von Bewegungstherapie und Krebs. B&G Bewegungstherapie und<br />
Gesundheitssport <strong>20</strong>06; 22 (5): S. 170-175<br />
Vogt L, Neumann A (Hrsg.): Sport in der Prävention. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag; <strong>20</strong>06.<br />
Schulz T, Peters C, Michna H: Körperliche Aktivität in der Krebstherapie. Int. Onkol. 1/<strong>20</strong>05, 15-21.<br />
Schulz T, Peters C, Michna H: Bewegungstherapie und Sport in der Krebstherapie und –nachsorge. DZO<br />
<strong>20</strong>05; 37: 159-168.<br />
Dimeo F et al.: Krebs und Sport. Ein Ratgeber nicht nur für Krebspatienten. Weingärtner Verlag <strong>20</strong>06<br />
Hussain M, Schuker D: Blick nach vorn. Zuckschwerdt, Germering <strong>20</strong>06
PM1: Präventiver Sport 2 (Senioren / Osteoporose / Rheuma; Se/Ü)<br />
• Die sozio-psychologische Situation des alten Menschen in unserer Zeit<br />
• Demographische Entwicklung<br />
• Ursachen für Überalterung<br />
• Verschiedene Definitionen zum Begriff „Altern“<br />
• Alterseinteilung im Sport<br />
• Das Altern als Prozess<br />
• Theorien zur biologischen Altersgrenze<br />
• Psycho-somatische Reaktionen des Organismus auf das Altern<br />
• Wandel der Lebenssituation im Alter<br />
• Altenhilfe<br />
• Sportangebote für Senioren<br />
• Biologische und physiologische Veränderungen im Alter<br />
• Alterungsprozesse (Herz, Gefäße, Blutdruck, Lunge, Stütz- und Bewegungsapparat,<br />
Knochen, Sehnen, Bänder, Muskulatur, Sinnesorgane, Haut)<br />
• Folgen von Bewegungsmangel im Alter auf Herz, Gefäße, Lunge, Bew. Apparat,<br />
Nervensystem<br />
• Positive Effekte des Seniorensportes<br />
• Methodisch-didaktische Konsequenzen für den Seniorensport<br />
• Trainingsschwerpunkte<br />
• Praktische Hinweise für den Seniorensport<br />
• Gefahren beim Alterssport<br />
• Geeignete Sportangebote<br />
• Kontraindikationen<br />
• Epidemiologie der Osteoporose<br />
• Kenntnisse zu biologischen und physiologischen Prozessen der Osteoporose<br />
(Knochenstoffwechsel, Einflussfaktoren auf den Stoffwechsel, Folgen fortschreitender<br />
Osteoporose)<br />
• Risikofaktoren der primären Osteoporose<br />
• Ursachen der sekundären Osteoporose<br />
• Diagnostische Verfahren zur Erkennung von Osteoporose<br />
• Medizinisch-therapeutische Verfahren<br />
• Bewegungstherapie<br />
• Schmerztherapie<br />
• Medikamentöse Therapie<br />
• Bewegungstherapie<br />
• Ziele<br />
• Bewegungstherapeutische Ansätze<br />
• Funktionelle Gymnastik mit Geräten<br />
• Wirbelsäulengymnastik<br />
• Krafttraining an Kraftmaschinen<br />
• Wassergymnastik<br />
• Koordinationstraining<br />
• Körpererfahrungstraining<br />
• Entspannungstraining
• Didaktische Überlegungen<br />
• Besonderheiten beim Sport mit Osteoporosepatienten<br />
• Begriffsklärung Rheuma<br />
• Rheumatischer Formenkreis<br />
• Entzündliche Rheumaerkrankungen<br />
• Degenerative Gelenkerkrankungen<br />
• Weichteilrheumatismus<br />
• Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden<br />
• Diagnostische Ansatzpunkte<br />
• Therapeutische Ansätze<br />
• Medikation<br />
• Krankengymnastik/Physiotherapie<br />
• Physikalische Therapie (Thermo-, Hydro-, Massage, Elektro-, Balneotherapie)<br />
• Ergotherapie<br />
• Psychologische Betreuung<br />
• Operative Eingriffe<br />
• Rehabilitation<br />
• Bewegungstherapie/Sporttherapie<br />
• Sporttherapie<br />
• Ziele der Sporttherapie<br />
• Inhalte der Sporttherapie<br />
• Geeignete Sportarten<br />
• Probleme der Sporttherapie bei rheumatischen Erkrankungen<br />
Themeninhalte Praxis (Ü):<br />
Hospitation in einer Seniorengruppe<br />
• Lehrversuche zu folgenden Themen (Beispiele):<br />
• Hockergymnastik für Senioren<br />
• Koordinationstraining für Senioren<br />
• Eine Seniorensportstunde mit spezifischen Hand- und Kleingeräten<br />
• Gehirnjogging mit Bewegung für Senioren<br />
• Tanzformen und –spiele für Senioren<br />
• Hospitation in einer Osteoporose-Gruppe<br />
• Lehrversuche zu folgenden Themen (Beispiele):<br />
• Einführung ins Krafttraining an Maschinen für neue Teilnehmer einer Osteoporose-<br />
Gruppe im Fitness-Studio<br />
• Funktionelle Kräftigungsgymnastik mit Kleingeräten<br />
• Funktionelle Wirbelsäulengymnastik<br />
• Hospitation in verschiedenen Rheumagruppen<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
keine Angabe
PM1: Präventiver Sport 3/ Rückenschule (Ü)<br />
Ziele, Inhalte (versch. Methoden), Stundenaufbau, Wirkungsweise, Prinzipien der<br />
Rückenschule<br />
Erarbeitung spezieller Themen durch Studierende (Lehrpraxis)<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
BUSKIES W., TIEMANN M., BREHM, W.: Rückentraining - sanft und effektiv. Die besten Programme für<br />
Zuhause. Aachen, Meyer & Meyer, <strong>20</strong>06<br />
BLEIS C.: Wirbelsäulengymnastik. Endlich beschwerdefrei! München, BLV, <strong>20</strong>06<br />
KOSCHEL, D., FERIÉ, C.: Vorbeugende Wirbelsäulen-Gymnastik. Handreichungen für Übungsleiter und<br />
Mitarbeiter in Vereinen. Aachen, Meyer und Meyer, <strong>20</strong>05<br />
DARGATZ T.: Rückenschmerzen. Die neue 4-Säulen-Strategie. Das neuartige Bewegungskonzept, die<br />
besten Wohlfühl-Programme, die optimale Schmerztherapie und die erste richtige Rücken-Diät. München,<br />
Copress-Verl., <strong>20</strong>05<br />
REICHARDT H.: Schongymnastik bei Rückenbeschwerden. München, blv, <strong>20</strong>05<br />
HÖFLER H.: Die Nackenschule. Gezielte Übungen für Kopf, Hals und Schultern. München, blv, <strong>20</strong>05<br />
TRIENEN M., GOER M.: Nackenschule. Sanfte Wege zur Beschwerdefreiheit. Wiebelsheim, Limpert,<br />
<strong>20</strong>05<br />
BAUMBACH, I.: Leitfaden für die präventive, orthopädisch rehabilitative Rückenschule. Wissen -<br />
Konzepte – Praxis. Bundesverband der Deutschen Rückenschulen (BdR e.V.). Hrsg. Claudia Frohberger,<br />
Münster, BdR, <strong>20</strong>04<br />
REICHARDT H: Rückenschule für jeden Tag. München, blv, <strong>20</strong>04<br />
WOTTKE D.: Die große orthopädische Rückenschule. Theorie, Praxis, Didaktik ; 18 Tabellen. Heidelberg,<br />
Springer, <strong>20</strong>04<br />
JUST, M.: Rückenschule für das zahnärztliche Team. Stuttgart, Thieme, <strong>20</strong>04<br />
KEMPF H.-D.: Rückenschule. Grundlagen, Konzepte und Übungen. München, Urban & Fischer, <strong>20</strong>03<br />
FRANKLIN, E.: Locker sein macht stark. Kösel, München,<strong>20</strong>03<br />
GUDEL, D.: Neue Ansätze der Rückenschule. Metatheoretische Betrachtung von Inhalten, Zielen,<br />
Effekten ; Anwendung alternativer pädagogischer Ansätze. Hamburg, Inst. für<br />
bewegungswissenschaftliche Anthropologie, <strong>20</strong>02<br />
NENTWIG C. G., KRÄMER J., ULLRICH C.H.: Die Rückenschule - Aufbau und Gestaltung eines<br />
Verhaltenstrainings für Wirbelsäulenpatienten. Hippokrates Verlag, <strong>20</strong>02<br />
REICHEL H.-S.: Präventive Rückenschule in der Praxis. Richtige Planung führt zum Erfolg. München,<br />
Urban & Fischer, <strong>20</strong>01<br />
MÜLLER, E.: Du spürst unter deinen Füßen das Gras. Frankfurt, Fischer Verlag, <strong>20</strong>00<br />
KRÄMER J.: Bandscheibenschäden vorbeugen durch Rückenschule. Heyne, München, <strong>20</strong>00<br />
DENNER A.: Analyse und Training der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur. Berlin ; Heidelberg,<br />
Springer, 1998<br />
HÖLINER R.G., KLÖCKNER W., PUSSERT E., SCHNEIDER S.: Gesunde Haltung. Von der traditionellen<br />
Rückenschule zur Entwicklung einer ganzheitlichen Haltung, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, 1996<br />
KEMPF H.-D.: Die Sitzschule. Das Programm für Alltag und Beruf. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt,1994<br />
SCHMIDT M.: Rückenschule mit dem grossen Ball. Niedernhausen/Ts., Falken, 1996,Video
LOTTES R. R.: Evaluation von Rückenschulprogrammen. Eine prospektive Komponentenanalyse zur<br />
Bestimmung der Wirksamkeit psychologischer Maßnahmen in orthopädischen Rückenschulprogrammen.<br />
Göttingen, Cuvillier, 1995<br />
HUBER G.: Effektivität von Rückenschulen. Heidelberg, Inst. für Sport und Sportwiss., 1996<br />
CD<br />
Die musikalische Rückenschule. Geführte Aufbau-Übungen zur aktiven Entlastung und Stärkung der<br />
Wirbelsäule. München, BMG-Ariola,1998,<br />
Kursleitermappe<br />
Aktion gesunder Rücken e.V. (AGR): Ausbildung zum Rückenschulleiter.<br />
Forum gesunder Rücken – besser leben.<br />
Zeitschriften<br />
NIESTEN-DIETRICH, U.: Effektivität von Rückenschulkonzepten. Ein Literaturüberblick. Gesundheitssport<br />
und Sporttherapie 15, 1999<br />
Kinder<br />
LEHMANN G.: Die Rückenschule für Kinder. Aufrecht durchs Leben; mit 10 einfachen Tests: Wie gesund<br />
sind Rücken und Muskeln?; mit gezielten Bewegungen Haltungsschwächen ausgleichen; lustige Übungen<br />
für zu Hause und in der Gruppe. Stuttgart, Trias, <strong>20</strong>04<br />
KEMPF H.-D., FISCHER J.: Rückenschule für Kinder. Haltungsschäden vorbeugen; Schwächen<br />
korrigieren; mit Möbelberater. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, <strong>20</strong>04<br />
KOLLMUß S.: Happy Bandschis - rückenfreundliches Verhalten im Alltag - ein Kinderspiel. München,<br />
Pflaum, <strong>20</strong>03<br />
KOLLMUß S., STOTZ, S.: Rückenschule für Kinder – ein Kinderspiel – München, Pflaum,<strong>20</strong>01<br />
LÜTGEHARM R.: Kinder lernen spielerisch. Bewegungsspaß für Rücken, Haltung, Atmung und<br />
Entspannung. München, Heyne, <strong>20</strong>00<br />
PFLUGRADT N.: Kindern den Rücken stärken. Eine Rückenschule mit Gedichten, Bewegungsliedern und<br />
Spielen. München, Don Bosco, 1999<br />
BREITHECKER, D.: Bewegung ist ein Kinderspiel. Mosaik Verlag, München, <strong>20</strong>01<br />
Internet<br />
LÜHMANN, KOHLMANN, RASPE: Die Evaluation von Rückenschulprogrammen als medizinische<br />
Technologie. www.gripsdb.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta<strong>20</strong>02_berichte_de.pdf , 24.4.06,<br />
Interview: STEINAU, MARTIN: „Moderne Rückenschule“ vor Verabschiedung.<br />
www.dvgs.de/news/add_page.php?fnum=2&num=2 , 26.4.06
PM1: Präventiver Sport 3/ Aquatraining (Ü)<br />
• Ziele, Inhalte, Stundenaufbau, Wirkungsweise, Prinzipien des Aquatraining<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Keine Angabe
PM1: Präventiver Sport 3/ Nordic Walking (Ü)<br />
• Ziele, Inhalte, Wirkungsweise, Prinzipien, Technik des Nordic Walking<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Keine Angabe
PM1: Präventiver Sport 3/ Therapeutisches Klettern (Ü)<br />
Ziele, Inhalte (versch. Methoden), Stundenaufbau, Wirkungsweise, Prinzipien des<br />
therapeutischen Kletterns unter besonderer Berücksichtigung versch. Zielgruppen<br />
Erarbeitung spezieller Themen durch Studierende (Lehrpraxis)<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Keine Angabe
PM1: Präventiver Sport 3/Feldenkrais (Ü)<br />
Ziele, Inhalte, Wirkungsweise, Prinzipien, Lernstrategien, Vermittlungsaspekte der<br />
Feldenkraismethode<br />
Praktische Anwendungsbeispiele<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Bernard, André, Stricker, Ursula, Steinmüller, Wolfgang (<strong>20</strong>03). Ideokinese. Ein kreativer Weg zu<br />
Bewegung und Körperhaltung. Bern: Huber<br />
Bielefeld, Jürgen (Baumann, Sigurd Hrsg.) (1991). Körpererfahrung – Grundlage menschlichen<br />
Bewegungsverhaltens. Göttingen: Hogrefe, Verlag für Psychologie<br />
Dornieden, Ralf (<strong>20</strong>02). Wege zum Körperbewusstsein. Körper- und Entspannungstherapien. München:<br />
Pflaum<br />
Feldenkrais, Moshe (1978). Bewusstheit durch Bewegung. Der aufrechte Gang. Frankfurt: Suhrkamp<br />
Feldenkrais, Moshe (1986). Die Entdeckung des Selbstverständlichen. Frankfurt: Inselverlag<br />
Feldenkrais, Moshe (1994). Der Weg zum reifen Selbst: Phänomene menschlichen Verhaltens.<br />
Paderborn: Junfermann<br />
Franklin, Eric (1998). Locker sein macht stark. Wie wir durch Vorstellungskraft beweglich werden.<br />
München: Köselverlag<br />
Franklin, Eric (1999). Befreite Körper: Das Handbuch zur imaginativen Bewegungspädagogik.<br />
Kirchzarten: VAK<br />
Franklin, Eric (<strong>20</strong>02). Beckenboden-Power. Das dynamische Training für sie und ihn München:<br />
Köselverlag<br />
Hanna, Thomas (1990). Beweglich sein - ein Leben lang. Die heilsame Wirkung körperlicher Bewußtheit.<br />
München: Köselverlag<br />
Klinkenberg, Norbert (<strong>20</strong>00). Feldenkraispädagogik und Körperverhaltenstherapie. Stuttgart: Pfeiffer bei<br />
Klett-Cotta<br />
Russell, Roger (1993). Feldstudie zur Wirksamkeit der Feldenkraismethode bei MS – Betroffenen.<br />
Forschungsbericht DMSG, Landesverband Saarland. Saarbrücken<br />
Russell, Roger (1999). Feldenkrais im Überblick. Karlsfeld: Kaubisch<br />
Russell, Roger (<strong>20</strong>03). Dem Schmerz den Rücken kehren. Die kluge Lösung für Rückenschmerzen.<br />
Paderborn: Junfermann<br />
Shafarman, Steven (1998). Die Feldenkraisschule. Gesundheit und Wohlbefinden durch bewußtes<br />
Bewegen. München: Heyne<br />
Shelhav, Chava (1999). Bewegung und Lernen. Die Feldenkraismethode als Lernmodell. Dortmund:<br />
Verlag Modernes Lernen<br />
Steinmüller, Schaefer, Fortwängler (Hrsg.) (<strong>20</strong>01). Gesundheit – Lernen – Kreativität. Alexander-Technik,<br />
Eutonie Gerda Alexander und Feldenkrais als Methoden zur Gestaltung somatopsychischer<br />
Lernprozesse. Bern: Huber<br />
Todd, Mable (<strong>20</strong>01). Der Körper denkt mit. Anatomie als Ausdruck dynamischer Kräfte. Bern: Huber<br />
Wildman, Frank (1996). Feldenkrais. Übungen für jeden Tag. Frankfurt: Fischer-Taschenbuch-Verlag<br />
Zemach-Bersin, David / Reese, Mark (1990 ) Relaxercise. The easy way to health & fitness. New York:<br />
Harper & Row
PM1: Sport bei Erkrankungen/ lehrpraktische Übungen (Ü)<br />
• Selbsterfahrung<br />
Sprache, Gestik, Mimik, Demonstration, Erläuterung einer Übung/eines Spiels,<br />
Stellung zur Gruppe<br />
• Simulierte Lehrerfahrung in Gruppen mit div. Erkrankungen unter besonderer<br />
Berücksichtigung:<br />
Didaktische Schwerpunkte: Lehrverfahren, Lehrverhalten, Stundenorganisation,<br />
Differenzierungs- und Improvisationsfähigkeit, Motivationale Gesichtspunkte<br />
• Videobeobachtung/-analyse<br />
Regularien:<br />
• Je 2 Studierende erarbeiten eine 30 min Einheit für eine Zielgruppe mit Aufwärmen,<br />
Hauptteil und Ausklang<br />
• Ca. 10 min Nachbesprechung in der Gruppe<br />
• Ausarbeitung des Unterrichtsversuchs über 8 Seiten:<br />
• Allgemeine Bedingungsanalyse, Allgemeine Zielanalyse, spezielle<br />
Bedingungsanalyse u. spezielle Zielanalyse, tabellarische Aufstellung der<br />
Lehrprobe, Literaturverzeichnis, Reflexion (1/2 S.)<br />
Themen, u.a.:<br />
o Training zur Stabilisation des USG nach Kapsel/Band Verletzung<br />
o Training zur Verbesserung der Propriozeption nach Knieverletzung<br />
o Training zur Verbesserung der Koord. u. Gangbild nach Hüft – TEP<br />
o Mobilisations u. Beweglichkeitstraining bei chronischen Rückenbeschwerden<br />
o Herzsport: Trainingsgruppe<br />
o Präv.Training: „bewegte Mittagspause“<br />
o Metabolisches Syndrom, Adipositas<br />
o Training mit Hochdruckpatienten<br />
o Training mit Asthmapatienten<br />
o Training mit motor. retardierten Vorschulkindern<br />
PM1: Herzsport / lehrpraktische Übungen (Ü)<br />
• Gruppen- und Belastungsprofil im amb. Herzsport<br />
• Lehrpraktische Übung in einer ambulanten Herzgruppe unter Berücksichtigung …<br />
o Herzfrequenzgesteuertes Training im Herzsport<br />
o Spezielle Aspekte des Unterrichts im Herzsport<br />
o Lehrverhalten<br />
o Spiele und Belastung<br />
o Körperwahrnehmung<br />
o Entspannungsverfahren<br />
o Unterrichtserfahrungen<br />
o Hospitationen bei Herzgruppen<br />
o Lehrpraktische Übungen in Herzgruppen<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Von Studierenden erarbeitete Literatur
PM1: Sport mit Asthmatikern (Ü):<br />
• Medizinische Grundlagen I und II: Physiologie, Pathophysiologie, Auslöser und<br />
medikamentöse Therapie<br />
• Sporttherapeutische Grundlagen: Rahmenbedingungen, motorische<br />
Hauptbeanspruchungsformen<br />
• Atemtherapie und Notfallmanagement<br />
• Umsetzung der Rahmenbedingungen in der Halle<br />
• Vorführstunde mit Jugendlichen im Schwimmbad<br />
• Die von den Stud. erarbeitenden Themen werden in der Schwimmhalle durchgeführt<br />
und besprochen.<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Lecheler J., Biberger A., Pfannebecker B. Asthma & Sport. Theoretische Grundlagen und praktische<br />
Handlungsanleitungen. Ina-Verlag. Berchtesgaden. <strong>20</strong>06.<br />
PM1: Sport mit Diabetikern (Se)<br />
• Trainingseffekte des Sports bei Typ I und Typ II Diabetikern<br />
• Therapeutische Ansätze bei Diabetikersportgruppen<br />
• Diätetik<br />
• Spezielle Aspekte der Sportpraxis bei Diabetikern<br />
• Kleine Spiele<br />
• Ausdauertraining<br />
• Körperwahrnehmung<br />
• Entspannung<br />
• Lehrerfahrungen<br />
• Hospitationen bei verschiedenen Diabetikergruppen<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Borchert P, Klare R, Zimmer P: Der Übungsleiter – Diabetes und Sport. Kirchheim, Mainz <strong>20</strong>06<br />
Thurm U., Gehr B. Diabetes- und Sportfibel. Mit Diabetes weiter laufen. Kirchheim. Mainz. <strong>20</strong>05<br />
Behrmann R., Weineck J. Diabetes und Sport. Spitta. Balingen. <strong>20</strong>01.<br />
Borchert P. Der Übungsleiter Diabetes und Sport. Kirchheim. Mainz. <strong>20</strong>06.<br />
Kuhn D. Sportlich aktiv mit Diabetes. TRIAS. Stuttgart. <strong>20</strong>03
PM1: Sport mit Sinnesbehinderten und geistig Behinderten (Ü)<br />
• Sport mit Blinden und Sehgeschädigten<br />
• Koordination und Orientierung mit der Augenbinde, Stocktraining, Hinternisturnen<br />
• Leichtathletik mit der Augenbinde: Sprint, Mittelstrecke, Weitsprung mit Anlauf.<br />
• Kleine Spiele mit und ohne Ball, Torball nach Regeln.<br />
• Sport mit Hörgeschädigten<br />
• Allgemeine unterrichtliche Hinweise<br />
• Schulung von Gleichgewicht, Rhythmus, Ausdauer.<br />
• Kleine und große Spiele.<br />
• Sport mit Geistig Behinderten<br />
• Ballspiele, Floorhockey, Fangspiele<br />
• Wahrnehmung: Körperschema, Körpererkenntnis, taktile und akustische<br />
Wahrnehmung<br />
• Visuelle, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung, Entspannung, Massage<br />
• Klettern, Schaukeln<br />
• Rhythmisierungsfähigkeit, Rollbrett<br />
• Schwimmen-Theorie, Leichtathletik-Theorie.<br />
• Hospitationen werden vorausgesetzt.<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
keine Angabe
PM2: Klinisches Praktikum in der Orthopädie/Traumatologie (Ü)<br />
Hospitation in der Orthopädie/ Traumatologie im Klinikum rechts der Isar
PM1: Wissenschaftliches Projekt (Se)<br />
Im Rahmen des wissenschaftlichen Projektes werden die Studierenden an eine<br />
wissenschaftliche Arbeitsweise herangeführt. Dabei werden unterschiedliche Themen<br />
im Bereich der Sportwissenschaft erarbeitet.<br />
• Themenfindung und Erarbeiten einer Fragestellung<br />
• wissenschaftliche Literaturrecherche<br />
• Literaturbearbeitung<br />
• Auswahl geeigneter sportwissenschaftliche Methoden entsprechend der<br />
Fragestellung<br />
• Durchführung wiss. Methoden<br />
• Auswertung und Interpretation von Messdaten<br />
• Schriftliche Ausarbeitung bzw. Präsentation<br />
Die Themen erstrecken sich über die unterschiedlichen Teildisziplinen der<br />
Sportwissenschaft:<br />
• Sportphysiologie<br />
• Sportpsychologie<br />
• Sport und Gesundheit<br />
• Leistungsdiagnostik<br />
• Biomechanik<br />
• Trainingswissenschaft<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Im jeweiligen Projekt recherchierte Literatur.
PM2: Sportartspez. Traumatol. Verletzungsmuster und Überlastungsschäden (VL)<br />
• Die Kreuzbandruptur beim Skifahrer: Verletzungsmechanismus, Therapie und<br />
Rehabilitation<br />
• Innenmeniskusläsion und Genu varum: Teufelskreis beim Fußballer und<br />
Therapieansätze<br />
• Wirbelsäulenschädigung beim Kunstturnen: operative und konservative<br />
Therapieansätze<br />
• Die Werferschulter: sportartübergreifende Problematik der Instabilität und Laxität<br />
• Golf- und Tennisellbogen<br />
• akute Verletzung des oberen Sprunggelenks im Hallenballsport:<br />
Bandläsionen/Syndesmosenruptur und Frakturen, kindliche Frakturen;<br />
therapeutische Möglichkeiten<br />
• chron. Instabilität des oberen Sprunggelenk im Hallenballsport: konservative und<br />
operative Maßnahmen<br />
• American Football: Verletzungsmechanismen und Überlastung<br />
• Krafttraining beim heranwachsenden Körper<br />
• „Mein Muskel hat zugemacht“: Muskel und Sehnenverletzungen in der Leichtathletik<br />
• Doping im Sport: Funktionsmechanismen verschiedener Substanzklassen und<br />
Gefahren<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Peterson L., Renström P.: Verletzungen im Sport. Prävention und Behandlung. Deutscher Ärzteverlag.<br />
Köln. <strong>20</strong>02<br />
Engelhardt M. (Hrsg.): Sportverletzungen. Diagnose, Management und Begleitmaßnahmen. Urband und<br />
Fischer bei Elsevier. München. <strong>20</strong>06
PM2: Sport zur Rehabilitation von Behinderten (VL, 1 <strong>SWS</strong>)<br />
• Die Rolle der Psychologie im Sport von Menschen mit Behinderung/<br />
• Internationale Aspekte unter Berücksichtigung der „ICF“<br />
• Fallbeispiel: Schlaganfall / Cerebral Parese<br />
• Messung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei Kindern mit CP<br />
• Motivation und wahrgenommene Kompetenz nach Harter und White; Motivation und<br />
Compliance : Regeln- Rechte- Pflichten<br />
• Umgang mit dem „Patienten/Klienten“ / Gesprächsführung<br />
• Sport zur Integration von Behinderten: Fallbeispiel „Tauchen mit Behinderten und<br />
Nicht- Behinderten“<br />
• Geschichte des Leistungssports von Menschen mit Behinderungen<br />
• Zusammenfassende Diskussion<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
DIMDI (<strong>20</strong>04).Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. WWW.dimdi.de<br />
Harter, Susan 1999: The construction of the self: A developmental perspective. New York: Guilford Press<br />
Ohlert, H. & Beckmann, J. (Hrsg.) (<strong>20</strong>02) Sport ohne Barrieren. Schorndorf: Hofmann.<br />
Schwarz, D. (<strong>20</strong>06) Die Selbstwahrgenommene Kompetenz von Kindern und Jugendlichen mit<br />
frühkindlicher Hirnschädigung. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.<br />
White (1959). Motivation reconsidered. The concept of competence. Psychological Review, 66, 297 - 333.
PM2: Orthopädischer Untersuchungskurs (Ü)<br />
• Schulter<br />
• Knie<br />
• Sprunggelenk, Fuß<br />
• Ellbogen, Hand<br />
• Wirbelsäule<br />
• Hüfte, Becken<br />
• weiterführende Diagnostik obere Extremität<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Peterson L., Renström P.: Verletzungen im Sport. Prävention und Behandlung. Deutscher Ärzteverlag.<br />
Köln. <strong>20</strong>02<br />
Engelhardt M. (Hrsg.): Sportverletzungen. Diagnose, Management und Begleitmaßnahmen. Urband und<br />
Fischer bei Elsevier. München. <strong>20</strong>06
PM2: Sportmassage/Sportphysiotherapie (Ü)<br />
Sportmassage<br />
• Theoretische Einführung (Wirkung, Indikation, Kontraindikation)<br />
• Vorstellung der Grundgriffe<br />
• Unterschenkel<br />
• Oberschenkel<br />
• Sportmassage<br />
• Gesäß, Rücken<br />
• Schulter, Nacken<br />
• Arm<br />
• spezielle Techniken, Wiederholung Schwerpunkt „Sportmassage“<br />
Sportphysiotherapie<br />
• Kryotherapie („hot ice“)<br />
• Tape, Stützverbände<br />
• Massage WH (Rücken)<br />
• Erstversorgung von Muskel- und Kapselbandverletzungen<br />
• Kopfschmerz, Triggerpoints<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Keine Angabe
PM2: Biomechanik in der Rehabilitation (VL)<br />
• Kennen lernen von biomechanische Methoden<br />
• Biomechanische Messverfahren wie z.B. Bodyscanner, Kraftmessplatte,<br />
Isokinet<strong>20</strong>00<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Kummer B.: Biomechanik. Form und Funktion des Bewegungsapparates. Dt. Ärzte Verlag. Köln. <strong>20</strong>05<br />
Wick D. (Hrsg.): Biomechanische Grundlagen sportlicher Bewegung. Spitta. Balingen. <strong>20</strong>05<br />
Schewe H.: Biomechanik – wie geht das? Thieme. Stuttgart. <strong>20</strong>00<br />
Ballreich R., Baumann W. (Hrsg.): Grundlagen der Biomechanik des Sports. Enke. Stuttgart. 1996<br />
Verbandszeitschrift des DVGS: „Bewegungstherapie und Gesundheitssport“.<br />
Zeitschrift Leistungssport.<br />
Dt. Gesellschaft für Biomechanik: http://www.biomechanics.de/dgbiomech/dgbiomech.html
PM2: Sozialwiss. Aspekte der Traumatologie und Sportorthopädie (VL)<br />
In der Lehrveranstaltung wird ein Gesamtüberblick über die bislang behandelten<br />
Themen gegeben. Im Anschluss erfolgt eine Vertiefung der im Basis-Modul<br />
besprochenen Themenschwerpunkte aus der Gesundheitssoziologie unter besonderer<br />
Berücksichtigung von orthopädischen Krankheitsbildern.<br />
Gesundheitssoziologie I, II<br />
• Stoffwiederholung: <strong>Basismodul</strong><br />
• Stoffwiederholung Profilmodul I<br />
Gesundheitssoziologie III<br />
• Sozialstatus und Unfallhäufigkeit<br />
• Sozialstatus und chronisch-degenerative Erkrankungen<br />
Rehabilitation<br />
• Soziale Aspekte chronischer Erkrankungen (z.B. Arthrosen, Rheumatoide<br />
Arthritis, Spondylitis)<br />
• Psycho-soziale Aspekte chronischer Schmerzen<br />
• Kognitive Verfahren in der Orthopädie (z.B. bei Gangschule nach<br />
Schenkhalsfraktur, Umkehrplastik, etc.)<br />
• Kognitive Verfahren und Entspannungstechniken in der Schmerztherapie<br />
Prävention<br />
• Kognitive Verfahren in der Transfer und Rückfallprävention<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Abels, H. (<strong>20</strong>01). Einführung in die Soziologie. Lehrbuch (Bd. 1 & 2). Wiesbaden: VS Verlag.<br />
Giddens, A. (1995). Soziologie. Graz: Nausner & Nausner.<br />
Hurrelmann, K. (<strong>20</strong>03). Gesundheitssoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftliche Theorien von<br />
Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. Weinheim: Juventa Verlag.<br />
Siegrist, J. (1995). Medizinische Soziologie. München: Urban & Schwarzenberg.<br />
Wilker, F.-W., Bischoff, C. & Novak, P. (1994). Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie.<br />
München: Urban & Schwarzenberg.
PM2: Sport mit Körperbehinderten (Se)<br />
• Ursprünge des Behindertenleistungssportes bis zur paralympischen Bewegung<br />
• Zielgruppen des Behindertenleistungssports<br />
• Verbandsstruktur DBS<br />
• Wettkämpfe im Behindertensport<br />
• Training im Behindertenleistungssport<br />
• Anforderungsprofile im Behindertenleistungssport<br />
• Klassifikation im Behindertensport, Minimal Handicap<br />
• Spezifische Sportgeräte im Behindertensport<br />
• Forschung im Behindertenleistungssport<br />
• Grenzen und Probleme im Leistungssport mit Behinderten<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Arnold W, Israel S, Richter H: Sport mit Rollstuhlfahrern. Johann Ambrosius Barth, Leipzig Berlin<br />
Heidelberg 1992.<br />
Bausenwein I: Sport mit Zerebralparetikern. Hofmann, Schorndorf 1982.<br />
Blaumeister G.: Herausforderung Behindertensport. Spitta, Balingen 1999.<br />
Innenmoser J: Schwimmspaß für Behinderte. Sport Fahnemann, Bockenem 1988.<br />
IPC (ed): Paralympic Winter Games 1976-<strong>20</strong>06. RLC, Paris <strong>20</strong>06.<br />
Kosel H, Froböse I: Rehabilitations- und Behindertensport. Pflaum, München 1998.<br />
Rusch H, Grössing S: Sport mit Körperbehinderten. Hofmann, Schorndorf 1991.<br />
Scheid V (Hrsg): Facetten des Sports behinderter Menschen. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>02<br />
Scheid V, Rank M, Kuckuck R: Behindertenleistungssport. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>03.<br />
Scheid V, Rieder H (Hrsg): Behindertensport - Wege zur Leistung. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>00.<br />
www.paralympic.org
PM2: Sport bei degenerativen Veränderungen (Ü)<br />
• Arthrose<br />
• Pathogenese (primär/sekundär), Klinik (Symptome), Ursachen, Einflussfaktoren,<br />
Sport<br />
• Knorpel, Hüft-TEP<br />
• Kapselmuster, Traktion, Aufwärmprogramm, Dehnung, Kräftigung<br />
• Gangschule<br />
• Beobachtungspunkte, Phaseneinteilung, Test, Korrekturmöglichkeiten,<br />
Übungshilfen, Hilfsmittel (UA-Gehstützen)<br />
• Degenerative WS-Erkrankungen<br />
• Lokale/globale Muskulatur, Segmentale Stabilisation<br />
• Rückenschmerzen (BS), Ziele<br />
• Rheumatoide Arthritis<br />
• Diagnose, Klinik, Therapie, Funktionstraining<br />
• M. Bechterew, M. Scheuermann<br />
• Sport, Funktionsgymnastik<br />
• Praxisbeispiele<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
M. SCHMIDT: Gesundheitszustand der Bevölkerung - eine Stichprobe. Sportverletz Sportschaden <strong>20</strong>05;<br />
19: 119-122<br />
FÖLL, J.: Gangentwicklung und Bewegungswahrnehmung im Hüftgelenk in der Rehabilitation nach TEP-<br />
Implantation bei Dysplasiekoxarthrose. Dissertation, Universität Berlin, <strong>20</strong>04<br />
FROBÖSE, I. / NELLESSEN, G. / WILKE, C.: Training in der Therapie. Grundlagen und Praxis. Urban &<br />
Fischer Verlag, München Jena, <strong>20</strong>03<br />
KUNZ, M.: Medizinisches Aufbautraining. Erfolg durch MAT in Prävention und Rehabilitation. Urban &<br />
Fischer Verlag, München Jena, <strong>20</strong>03<br />
PERRY J.: Ganganalyse – Norm und Pathologie des Gehens. Urban & Fischer Verlag, München, Jena,<br />
<strong>20</strong>03<br />
KLEIN-VOGELBACH, S.: Funktionelle Bewegungslehre Ballübungen. Springer Verlag, Berlin, <strong>20</strong>03<br />
BETZ, U./ HEEL, CH.: Bewegungssystem. Lehrbuch zum Neuen Denkmodell der Physiotherapie. Band<br />
1.Thieme Verlag, Stuttgart, <strong>20</strong>02<br />
GÖTZ-NEUMANN, K.: Gehen verstehen. Ganganalyse in der Physiotherapie. Thieme Verlag, <strong>20</strong>02<br />
GOTTLOB, A.: Differenziertes Krafttraining mit Schwerpunkt Wirbelsäule. Urban & Fischer Verlag,<br />
München, <strong>20</strong>01<br />
BIZZINI, M.: Sensomotorische Rehabilitation nach Beinverletzungen. Thieme Verlag, Stuttgart, <strong>20</strong>00<br />
VAN DEN BERG, F.: Angewandte Physiologie 1 – Das Bindgewebe des Bewegungsapparates verstehen<br />
und beeinflussen. Thieme Verlag, Stuttgart, 1999<br />
RADLINGER,L., ET AL: Rehabilitatives Krafttraining. Thieme Verlag, Stuttgart, 1998<br />
FRANKLIN, E.: Locker sein macht stark. Kösel Verlag, München,1998<br />
FELDER, H., et al: Ambulante Rehabilitation. Thieme Verlag, Stuttgart, 1998<br />
HORN, H.-G. / STEINMANN, H.-J.: Medizinisches Aufbautraining. Fischer Verlag,Stuttgart, 1998<br />
BECKERS D., DECKERS J.: Ganganalyse und Gangschulung. Springer Verlag, Berlin, 1997<br />
HÜTER-BECKER, A., ET AL: Physiotherapie, Bd 1-14, Thieme Verlag, Stuttgart, 1996<br />
KLEIN-VOGELBACH, S.: Gangschulung zur Funktionellen Bewegungslehre. Springer Verlag, Berlin,<br />
1995
PM2: Sporttherapeutische Konzepte nach Verletzungen (VL)<br />
Sporttherapeutische Konzepte nach Verletzungen der unteren Extremitäten<br />
• Sprunggelenk<br />
• Kniegelenk<br />
• Hüftgelenk<br />
• der oberen Extremitäten<br />
• Schultergelenk<br />
• Ellenbogengelenk<br />
• Handgelenk<br />
• der Wirbelsäule<br />
• Aufbau:<br />
• typische Verletzungen<br />
• funktionelle Anatomie<br />
• Besonderheiten<br />
• Therapie / Sporttherapie<br />
PM2: Sporttherapeutische Konzepte nach Verletzungen (Ü)<br />
• Supinationstrauma<br />
• Achillessehnenruptur<br />
• Ruptur Vorderes Kreuzband<br />
• Meniskusläsion<br />
• Hüft-ISG-Problematik (Fehlstellungen), Ilio-Tibiales-Band Syndrom<br />
• Gang<br />
• Bandscheibenvorfall LWS<br />
• Instabilität HWS<br />
• Luxation Schulter<br />
• Rotatorenmanschettenruptur<br />
• Tennisellenbogen<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
FROBÖSE, I. / NELLESSEN, G. / WILKE, C.: Training in der Therapie. Grundlagen und Praxis. Urban &<br />
Fischer Verlag, München Jena, <strong>20</strong>03<br />
SCHÖNLE, CH.: REHABILITATION. Thieme Verlag, Stuttgart, <strong>20</strong>03<br />
KUNZ, M.: Medizinisches Aufbautraining. Erfolg durch MAT in Prävention und Rehabilitation. Urban &<br />
Fischer Verlag, München Jena, <strong>20</strong>03<br />
PERRY J.: Ganganalyse – Norm und Pathologie des Gehens. Urban & Fischer Verlag, München, Jena,<br />
<strong>20</strong>03<br />
BUCHBAUER, JÜRGEN.: Krafttraining mit Seilzug und Fitnessgeräten. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf,<br />
<strong>20</strong>03<br />
JUNG, KLAUS: Trauma im Sport, Schors Verlag, Niedernhausen, <strong>20</strong>03<br />
KLÜMPER, A.: Sport-Traumatologie. Handbuch der Sportarten und ihrer typischen Verletzungen.<br />
Ecomed-Verlagsgesellschaft; Landsberg, <strong>20</strong>02<br />
BETZ, U./ HEEL, CH.: BAND 1: Bewegungssystem. Lehrbuch zum Neuen Denkmodell der<br />
Physiotherapie. Thieme Verlag, Stuttgart, <strong>20</strong>02<br />
GOTTLOB, A.: Differenziertes Krafttraining mit Schwerpunkt Wirbelsäule. Urban & Fischer Verlag,<br />
München, <strong>20</strong>01
EHRICH, D. / GEBEL, R.: Therapie und Aufbautraining nach Sportverletzungen. Philippka Sportverlag,<br />
<strong>20</strong>00<br />
BIZZINI, M.: Sensomotorische Rehabilitation nach Beinverletzungen. Thieme Verlag, Stuttgart, <strong>20</strong>00<br />
HOCHSCHILD, J.: Strukturen und Funktionen begreifen. Thieme Verlag, Stuttgart, Bd 2, <strong>20</strong>00<br />
BIZZINI, M.: Sensomotorische Rehabilitation nach Beinverletzungen. Thieme Verlag, Stuttgart, <strong>20</strong>00<br />
HOCHSCHILD, J.: Strukturen und Funktionen begreifen. Thieme Verlag, Stuttgart, Bd 2, <strong>20</strong>00<br />
SCHÜLE, K. / HUBER, G.: Grundlagen der Sporttherapie. Prävention, ambulante und stationäre<br />
Rehabilitation. Urban & Fischer Verlag, München Jena, <strong>20</strong>00<br />
VAN DEN BERG, F.: Angewandte Physiologie – Das Bindgewebe des Bewegungsapparates verstehen<br />
und beeinflussen. Thieme Verlag, Stuttgart, 1999<br />
HOCHSCHILD, J.: Strukturen und Funktionen begreifen. Thieme Verlag, Stuttgart, Bd 1, 1998<br />
RADLINGER,L., ET AL: Rehabilitatives Krafttraining. Thieme Verlag, Stuttgart, 1998<br />
FRANKLIN, E.: Locker sein macht stark. Kösel Verlag, München,1998<br />
FELDER, H., et al: Ambulante Rehabilitation. Thieme Verlag, Stuttgart, 1998<br />
HORN, H.-G. / STEINMANN, H.-J.: Medizinisches Aufbautraining. Fischer Verlag,Stuttgart, 1998<br />
BECKERS D., DECKERS J.: Ganganalyse und Gangschulung. Springer Verlag, Berlin, 1997<br />
HÜTER-BECKER, A., ET AL: Physiotherapie, Bd 1-14, Thieme Verlag, Stuttgart, 1996<br />
LIST, M.: Physiotherapeutische Behandlungen in der Traumatologie. Sptinger Verlag, Berlin,Heidelberg,<br />
New York, 1996<br />
REICHEL,H.-S., SEIBERT,W., GEIGER,L.: Präventives Bewegungstraining. Gesundheits<br />
DialogVerlag,Oberhaching,1995<br />
STEININGER, K., BUCHBAUER, J.: Funktionelles Kraftaufbautraining in der Rehabilitation. Gesundheits-<br />
Dialog-Verlag, Oberhaching, 1994<br />
HINRICHS, H.-U.: Sportverletzungen: Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek bei Hamburg, 1994
PM2: Therapiespezifische Trainingsgeräte (VL/Ü)<br />
Vorstellung von und Arbeiten mit therapiespezifischen Trainingsgeräten:<br />
• MedX<br />
• M³<br />
• Miha<br />
• Cybex<br />
• Kieser<br />
• Dr. Wolff<br />
• Flexibar, Stability Bar<br />
• Gyrotonik<br />
• Isokinet<strong>20</strong>00<br />
• u.a.<br />
Allgemeine Basisliteratur:<br />
Keine Angabe