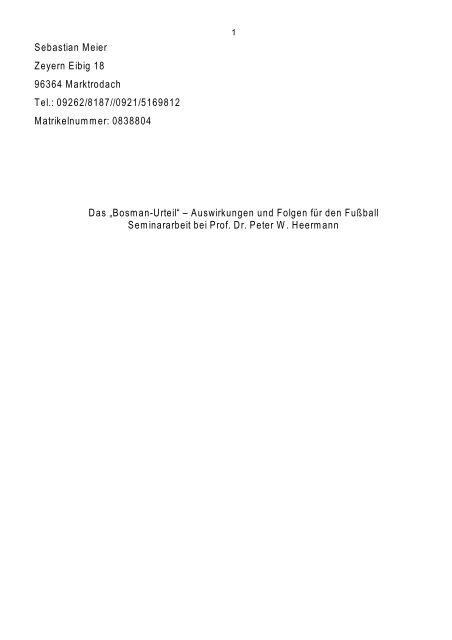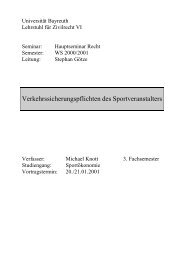Sebastian Meier Zeyern Eibig 18 96364 Marktrodach Tel.: 09262 ...
Sebastian Meier Zeyern Eibig 18 96364 Marktrodach Tel.: 09262 ...
Sebastian Meier Zeyern Eibig 18 96364 Marktrodach Tel.: 09262 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Sebastian</strong> <strong>Meier</strong><br />
<strong>Zeyern</strong> <strong>Eibig</strong> <strong>18</strong><br />
<strong>96364</strong> <strong>Marktrodach</strong><br />
<strong>Tel</strong>.: <strong>09262</strong>/8<strong>18</strong>7//0921/5169812<br />
Matrikelnummer: 0838804<br />
1<br />
Das „Bosman-Urteil“ – Auswirkungen und Folgen für den Fußball<br />
Seminararbeit bei Prof. Dr. Peter W. Heermann
2<br />
Literaturverzeichnis<br />
1) Arens,W.<br />
Der Fall Bosman – Bewertungen und Folgerungen aus der Sicht des nationalen<br />
Rechts<br />
in: SpuRt 1996, S.39ff.<br />
zitiert: Arens, SpuRt 1996, S.<br />
2) Ders.<br />
Transferbestimmungen im Fußballsport im Lichte des Arbeits- und Verfassungsrechts<br />
in: SpuRt 1994, S.179ff.<br />
zitiert: Arens, SpuRt 1994, S.<br />
3) Becker, M.<br />
Verfassungsrechtliche Schranken für die Regelung des Lizenzfußballsports in<br />
der Bundesrepublik Deutschland<br />
Mainz 1982<br />
zitiert: Becker, Verfassungsrechtliche Schranken, S.<br />
4) Buchner, H.<br />
Die Rechtsverhältnisse im deutschen Lizenzfußball<br />
in: RdA 1982, S.1ff.<br />
zitiert:Buchner, RdA 1982, S.<br />
5) Burmeister, J.<br />
Sportverbandswesen und Verfassungsrecht<br />
in: DÖV 1978, S.1ff<br />
zitiert: Burmeister, DÖV 1978, S.<br />
6) Eilers, G.<br />
Transferbestimmungen im Fußballsport. Verbandsrechtliche Regelungen des<br />
DFB, der UEFA und der FIFA<br />
in: Transferbestimmungen im Fußballsport, S.1ff<br />
Heidelberg 1996<br />
zitiert: Eilers, Transferbestimmungen im Fußballsport, S.<br />
7) Fischer, H.-G.<br />
EG-Freizügigkeit und bezahlter Sport - Inhalt und Auswirkungen des Bosman-<br />
Urteils des EuGH<br />
in: SpuRt 1996, S.34ff.<br />
zitiert: Fischer, SpuRt 1996, S.<br />
8) Ders.<br />
EG-Freizügigkeit und bezahlter Sport – Zur EG-rechtlichen Zulässigkeit von
Ausländerklauseln im bezahlten Sport<br />
in: SpuRt 1994, S.174ff<br />
zitiert: Fischer, SpuRt 1994, S.<br />
9) Füllgraf, L.<br />
Der Lizenzfußball<br />
Berlin 1981<br />
zitiert: Füllgraf, Lizenzfußball, S.<br />
3<br />
10) Gebhardt, D.<br />
Modelle für die Reform des Transfersystems für Berufsfußballer aus rechtlicher<br />
und tatsächlicher Sicht<br />
Frankfurt/M. 2000<br />
zitiert: Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.
11) Gramlich, L.<br />
Grundfreiheiten contra Grundrechte im Gemeinschaftsrecht?<br />
in: DÖV 1996, S.801<br />
zitiert: Gramlich, DÖV 1996, S.<br />
12) Häberle, P.<br />
„Sport“ als Thema neuer verfassungsstaatlicher Verfassungen<br />
in: Festschrift für Werner Thieme zum 70 Geburtstag, S.25ff.<br />
Köln, Berlin, Bonn, München 1993<br />
zitiert: Häberle, Thieme-FS, S.<br />
13) Heidersdorf, C.<br />
Ausländerklauseln im Profisport<br />
Frankfurt/M. 1998<br />
zitiert: Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.<br />
14) Hilf, M.<br />
Die Freizügigkeit des Berufsfußballspielers innerhalb der Europäischen Gemeinschaft<br />
in: NJW 1984, S.517ff<br />
zitiert: Hilf, NJW 1984, S.<br />
15) Hilf, M.; Pache, E.<br />
Das Bosman Urteil des EuGH<br />
in: NJW 1996, S.1169ff<br />
zitiert: Hilf/Pache, NJW 1996, S.<br />
16) Hobe, S.; Tietje, C.<br />
Europäische Grundrechte auch für Profisportler<br />
in: JuS 1996, S.486ff.<br />
zitiert: Hobe/Tietje, JuS 1996, S.<br />
4<br />
17) Hüttemann, R.<br />
Transferentschädigungen im Lizenzfußball als Anschaffungskosten eines immateriellen<br />
Wirtschaftsguts<br />
in: DStR 1994, S.490ff.<br />
zitiert: Hüttemann, DStR 1994, S.<br />
<strong>18</strong>) Klose, M.<br />
Die Rolle des Sports bei der Europäischen Einigung: zum Problem von Ausländerklauseln<br />
Tübingen 1989<br />
zitiert: Klose, Die Rolle des Sports bei der Europäischen Einigung, S.
19) Malatos, A.<br />
Berufsfußball im europäischen Rechtsvergleich<br />
Kehl, Strassburg, Arlington, 1988<br />
zitiert: Malatos, Berufsfußball, S.<br />
20) Meyer-Cording, U.<br />
Die Arbeitsverträge der Berufsfußballspieler<br />
in: RdA 1982, S.13ff<br />
zitiert: Meyer-Cording, RdA 1982, S.<br />
21) Mümmler, W.<br />
Der Spielertransfer im Bundesligafußball<br />
Diss. Bayreuth 1982<br />
zitiert: Mümmler, Spielertransfer, S.<br />
22) Münchener Kommentar zum BGB<br />
Bd.1<br />
3.Auflage, München 1993<br />
zitiert: Müko-Bearbeiter, §, Rn.<br />
23) Oppermann, T.<br />
Europarecht<br />
2.Auflage, München 1999<br />
zitiert: Oppermann, Europarecht, S.<br />
24) Palandt; O.<br />
Bürgerliches Gesetzbuch<br />
58.Auflage<br />
München 1999<br />
zitiert: Pal- Bearbeiter, §, Rn.<br />
25) Palme, C.<br />
Das Bosman-Urteil des EuGH: Ein Schlag gegen die Sportautonomie<br />
in: JZ 1996, S.238ff.<br />
zitiert: Palme, JZ 1996, S.<br />
26) Palme, C.; Hepp-Schwab, H.; Wilske, S.<br />
Freizügigkeit im Profisport – EG-rechtliche Gewährleistung und prozessrechtliche<br />
Durchsetzbarkeit<br />
in: JZ 1994, S.343ff.<br />
zitiert: Palme/Hepp-Schwab/Wilske, JZ 1994, S.<br />
27) Parlasca, S.<br />
Kartelle im Profisport<br />
Ludwigsburg, Berlin 1993<br />
5
zitiert: Parlasca, Kartelle, S.<br />
28) Reuter, D.<br />
Probleme der Transferentschädigung im Fußballsport<br />
in: NJW 1983, S.649<br />
zitiert: Reuter, NJW 1983, S.<br />
29) Schilling, T.<br />
Gleichheitssatz und Inländerdiskriminierung<br />
in: JZ 1994, S.8ff<br />
zitiert: Schilling, JZ 1994, S.<br />
30) Schimke, M.<br />
Sportrecht<br />
Frankfurt 1996<br />
zitiert: Schimke, Sportrecht, S.<br />
6<br />
31) Scholz, R.; Aulehner, J.<br />
Die „3+2“-Regel und die Transferbestimmungen des Fußballsports im Lichte des<br />
europäischen Gemeinschaftsrechts<br />
in: SpuRt 1996, S.44ff.<br />
zitiert: Scholz/Aulehner, SpuRt 1996, S.<br />
32) Schroeder, W.<br />
Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 15.12.1995, Rs. C-415/93<br />
in: JZ 1996, S.254ff.<br />
zitiert: Schroeder, JZ 1996, S.<br />
33) Steiner, U.<br />
Verfassungsfragen des Sports<br />
in: NJW 1991, S.2729ff.<br />
zitiert: Steiner, NJW 1991, S.<br />
34) Stern, K.<br />
Verfassungsrechtliche und verfassungsgpolitische Grundfragen zur Aufnahme<br />
des Sports in die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
in: Festschrift für Werner Thieme zum 70.Geburtstag, S.269ff.<br />
Köln, Berlin, Bonn, München 1993<br />
zitiert: Stern, Thieme-FS, S.<br />
35) Streinz, R.<br />
Europarecht<br />
4.Auflage, Heidelberg 1998<br />
zitiert: Streinz, Europarecht, S.
36) Taupitz, T<br />
Art.48 EGV: Arbeitnehmerfreizügigkeit von Fußballprofis<br />
in: JA 1996, S.457ff.<br />
zitiert: Taupitz, JA 1996, S.<br />
37) Trautwein, T.<br />
Art.48 EGV: Arbeitnehmerfreizügigkeit von Fußballprofis<br />
in: JA 1996, S.457ff.<br />
zitiert: Trautwein, JA 1996, S.<br />
38) Trommer, H.-R.<br />
Die Transferregelungen im Profisport im Lichte des „Bosman-Urteils“ im Vergleich<br />
zu den Mechanismen im bezahlten amerikanischen Sport<br />
Berlin 1999<br />
zitiert: Trommer, Transferregelungen S.<br />
39) Wertenbruch, J.<br />
Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 15.12.1995, Rs. C-415/93<br />
in: EuZW 1996, S.91f.<br />
zitiert: Wertenbruch, EuZW 1996, S.<br />
7<br />
40) Ders.<br />
Der Lizenzspieler als Gläubigersicherheit im Konkurs eines Vereins der Fußball-<br />
Bundesligen<br />
in: ZIP 1993, S.1292ff<br />
zitiert: Wertenbruch, ZIP 1993, S.<br />
41) Ders.<br />
Die „Gewährleistungsansprüche“ des übernehmenden Bundesligavereins bei<br />
Transfer eines nicht einsetzbaren DFB-Lizenzspielers<br />
in: NJW 1993, S.179ff.<br />
zitiert: Wertenbruch, NJW 1993, S.<br />
42) Westerkamp, G.<br />
Ablöseentschädigung im bezahlten Sport<br />
Münster 1980<br />
zitiert: Westerkamp, Ablöseentschädigung, S.
43) Westermann, H.P.<br />
Das Recht des Leistungssports – ein Sonderprivatrecht?<br />
in: Festschrift für Fritz Rittner, S.771ff.<br />
München 1991<br />
zitiert: Westermann, Ritter-FS, S.<br />
44) Ders.<br />
Erste praktische Folgen des „Bosman-Urteils“ für die Organisation des Berufsfußballs<br />
in: DZWir 1996, S.82ff.<br />
zitiert: Westermann, DZWir, 1996, S.<br />
8<br />
45) Vieweg, K<br />
Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände: eine<br />
rechtstatsächliche und rechtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Sportverbände<br />
Berlin 1990<br />
zitiert: Vieweg, Normsetzung und –anwendung deutscher und internationaler<br />
Verbände
9<br />
Gliederung<br />
Einleitung S.10<br />
A: Rechtsverhältnisse zwischen den am Transfer Beteiligten S.10<br />
I: DFB - Bundesligaverein S.10<br />
II: DFB – Lizenzspieler S.11<br />
III: Lizenzspieler – Bundesligaverein S.11<br />
IV: FIFA/UEFA – DFB S.12<br />
B: Der Transfer: Rechtsnatur und Entwicklung bis zum Bosman-Urteil S.12<br />
I: Rechtsnatur S.12<br />
II: Entwicklung vor Bosman S.13<br />
1) Die vor Bosman geltenden Transferregeln im Inland S.13<br />
a) Transferliste S.13<br />
b) Transferentschädigung als Voraussetzung für den Spielerwechsel S.13<br />
2) Die bis zum Bosman Urteil geltenden Transferregelungen bei einem Transfer<br />
unter Beteiligung ausländischer Mitgliedsverbände von FIFA bzw. UEFA S.14<br />
III: Änderungen durch das Bosman Urteil S.14<br />
1) Der „Fall Bosman“ S.14<br />
2) Kernaussagen des Urteils S.15<br />
a) Transferregeln als ungerechtfertigter Verstoß gegen die EG-Freizügigkeit<br />
gem. Art. 39 EGV S.15<br />
(1) Profisport als Teil des Wirtschaftslebens im Sinne von Art. 2 EGV S.15<br />
(2) Unmittelbare Drittwirkung der Freizügigkeitsklauseln S.15<br />
(3) Art. 39 EGV als umfassendes Beschränkungsverbot S.16<br />
b) Rechtfertigung S.16<br />
(1) Vereinsfreiheit S.17<br />
(2) Finanzielles und sportliches Gleichgewicht S.17<br />
c) Reichweite des Urteils S.<strong>18</strong>
10<br />
(1) Betroffene Verbände S.<strong>18</strong><br />
(2) Nur Profisport? S.19<br />
(3) Nur bei grenzüberschreitendem Element? S.19<br />
(4)Nur bei Vereinswechsel nach Vertragsende? S.19<br />
C: Auswirkungen des Bosman-Urteils im Hinblick auf den dt. Profifußball S.19<br />
I: Reaktionen auf das Urteil S.19<br />
II: Änderungen im Bereich des Transferwesens S.20<br />
1) Wechsel eines dt. Profis, das Kienaß-Urteil S.20<br />
2) Wechsel eines ausländischen Profispielers S.21<br />
III: Ausländerklauseln im Profifußball S.22<br />
1) Vereinbarkeit der Ausländerklauseln mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit gem.<br />
Art. 39ff EGV S.22<br />
2) Die Reaktion des DFB im Bereich der Ausländerklauseln S.22<br />
3) Der „Sportvorbehalt“ des EuGH S.23<br />
IV: Problem der Inländerdiskriminierung S.23<br />
V: Ökonomische Konsequenzen für die Vereine S.24<br />
D: Auswirkungen des Bosman-Urteils auf den dt. Amateurfußball S.25<br />
E: Wirkung europarechtlicher Rechtsnormen auf verbandsinterne Regelungen<br />
S.27<br />
I: Sport als Bestandteil der Kultur im Sinne von Art. 151 EGV S.27<br />
II: Vorrang des Verbandsrechts unter dem Gesichtspunkt der Verbandsautono-<br />
mie S.28<br />
III: Begrenzung des Geltungsbereichs des EG-Rechts durch das Subsidiaritäts-<br />
prinzip S.28<br />
IV: Der Grundsatz des Vertrauensschutzes S.28<br />
V: „Sportrecht“- Sonderrecht? S.29<br />
VI: Prüfungsmaßstab im Bereich des Sportverbandsrechts S.30
11<br />
VII: Rechtsfolgen eines Verstoßes S.30<br />
1) Rechtsfolgen im Gemeinschaftsrecht S-30<br />
2) Rechtsfolgen im nationalen Recht S.30<br />
F: Anforderungen an ein neues System S.31<br />
I: Anforderungen in rechtlicher Hinsicht S.31<br />
1) EU-Recht S.31<br />
2) Verfassungsrecht S.31<br />
3) Arbeitsrecht S.31<br />
II: Tatsächliche Anforderungen S.31<br />
1) Ausgleichsfunktion S.32<br />
2) Sportliches Gleichgewicht S.33<br />
3) Talentförderung und Machtbalance im Profifußball S.33<br />
G: Reformmodelle im Überblick S.34<br />
I: Kooperationsvertrag S.34<br />
II: Finanzpool S.34<br />
Ergebnis S.34
12<br />
Einleitung<br />
Im folgenden sollen Auswirkungen und Folgen des Bosman-Urteils auf den Fußball dar-<br />
gestellt werden. Zunächst wird ein kurzer Überblick über die Rechtsverhältnisse der am<br />
Transfer Beteiligten gegeben. Der anschließende Komplex befaßt sich mit Rechtsnatur<br />
und Entwicklung des Transfers bis zum Fall Bosman und geht auf die aus dem Fall<br />
Bosman resultierenden Änderungen ein. Die Auswirkungen des Urteils auf den Bereich<br />
Transferwesen werden ebenso dargestellt wie die Beurteilung von Ausländerklauseln im<br />
Profifußball im Lichte des Urteils, das Problem der Inländerdiskriminierung und die öko-<br />
nomischen Konsequenzen für die Vereine. Unter Bezugnahme auf das BGH-Urteil vom<br />
27.9.1999 werden die Auswirkungen im Amateurbereich aufgezeigt. Daran anschließend<br />
folgt eine Untersuchung im Hinblick auf das Verhältnis zwischen europarechtlichen<br />
Rechtsnormen auf der einen und verbandsinternen Regelungen auf der anderen Seite.<br />
Die rechtlichen und tatsächlichen Anforderungen an ein neues System werden hinter-<br />
fragt, abschließend folgt ein kurzer Überblick über mögliche Reformmodelle.<br />
A) Rechtsbeziehungen zwischen den am Transfer Beteiligten<br />
Die Rechtsbeziehungen zwischen den am deutschen Lizenzfußball beteiligten Personen<br />
sind im wesentlichen von einem Dreiecksv erhältnis mit einem Beziehungsgeflecht<br />
DFB/Ligaverband-Verein, DFB- Spieler und Spieler-Verein geprägt 1 . Die hieraus resultie-<br />
renden Rechtsverhältnisse werden überlagert von dem auf der DFB-Satzung beruhen-<br />
den Lizenzspielerstatut, das zwischen allen Beteiligten umfassende Rechte begründet.<br />
I) Das Verhältnis zwischen DFB und den Lizenzvereinen<br />
Im Verhältnis der Lizenzvereine zum DFB sind zwei Komponenten zu berücksichtigen.<br />
Zum einen sind alle Vereine der beiden höchsten deutschen Spielklassen, wie alle ande-<br />
ren Fußballvereine mittelbar verbandsrechtlich über ihre Mitgliedschaft in einem der fünf<br />
Regionalverbände bzw. 21 Landesverbände rechtlich an den DFB gebunden. Daneben<br />
wurden die Rechtsbeziehungen der Bundesligavereine zum DFB bisher maßgeblich<br />
du rch den gem. § 4 Nr.1 LSt. abzuschließenden Lizenzvertrag zwischen Verein und DFB<br />
1 Vgl. Buchner, RdA 1982, 1; Meyer-Cording. RdA 1982, 1ff; Malatos, Berufsfußball, S.101.
13<br />
geprägt, der eine außerordentliche Mitgliedschaft der Lizenzvereine im DFB begründete.<br />
Beim Lizenzvertrag handelte es sich um ein standardisiertes Vertragswerk, durch den<br />
sich der jeweilige Verein ausdrücklich der Satzung, dem Lizenzspielerstatut und den Ent-<br />
scheidungen des DFB unterwarf 2 . In Zukunft werden die 36 Lizenzvereine unter dem<br />
Dach des DFB im neuen Ligaverbandes zusammengefaßt, der seinerseits außerordentli-<br />
ches Mitglied beim DFB wird. Mit Abschluß eines Lizenzvertrages erwirbt der Verein eine<br />
au f ein Jahr befristete Lizenz, sich in den Bundesligen als Verein zu betätigen. Die Li-<br />
zenzerteilung ist im wesentlichen abhängig vom Nachweis der sportlichen Qualifikation<br />
de r Mannschaft sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Dies dient der Sicherung<br />
eines funktionsfähigen Spielbetriebs über die gesamte Saison. Bisher überprüfte dies der<br />
sog. Lizenzierungsausschuss im Lizenzierungsverfahren. Diese Aufgabe und die Lizenz-<br />
erteilung übernimmt in Zukunft der neue Ligaverband.<br />
2 Trommer, Transferregelungen, S.34.
II) Das Verhältnis zwischen DFB und dem Lizenzspieler<br />
14<br />
Dieses Verhältnis ist geprägt vom sogenannten Lizenzvertrag, der zwischen Spieler und<br />
DFB abgeschlossen wird. Darin verpflichtet sich der Spieler im Hinblick auf die Anerken-<br />
nung der “Rechte und Pflichten des Spielers als Lizenzspieler, seine Unterwerfung unter<br />
die Satzung, das Lizenzspielerstatut, die Ordnungen des DFB und die Entscheidungen<br />
de r DFB-Organe“ 3 . Erst mit Abschluß dieses Vertrages erhält der Spieler den Status des<br />
„Lizenzspielers“ und damit die Berechtigung, an der Bundesliga als Profispieler teilzu-<br />
nehmen 4 . Die Lizenz ist somit gleichzeitig als Erlaubnis zur Ausübung des Berufs als Li-<br />
zenzfußballspieler zu sehen 5 . Auf diesem Wege unterliegen die Lizenzspieler, die im<br />
Gegensatz zu den Amateurspielern aus steuerrechtlichen Gründen 6 nicht Mitglieder des<br />
DFB und dessen Lizenzvereinen sind, der Disziplinargewalt des Verbandes. Zusammen-<br />
fassend kann festgehalten werden, daß der DFB mit dem Lizenzspielerstatut und den<br />
darin enthaltenen Regelungen zum Transfer zwingende Rahmenbedingungen für das<br />
Arbeitsverhältnis zwischen Spieler und Verein vorgibt, zu deren Einhaltung sich der Spie-<br />
ler gegenüber dem DFB durch den Lizenzvertrag verpflichtet 7 . Somit behält sich der DFB<br />
korrespondierend mit der disziplinarischen Einflußmöglichkeit die „Einflußnahme unmit-<br />
telbar auf den Inhalt und Bestand des Arbeitsverhältnisses vor“ 8 und rückt somit zumin-<br />
dest „partiell in die Arbeitgeberstellung ein“ 9 . Dafür spricht auch, daß der DFB gem. § 3<br />
des Mustervertrags dem Spieler die Lizenz entziehen kann, dies hat, obwohl der Spieler<br />
eigentlich bei seinem Verein angestellt ist, die Wirkung einer fristlosen Kündigung, denn<br />
ohne L izenz ist der Spieler für seinen Verein nicht einsetzbar 10 .<br />
III) Das Verhältnis zwischen Lizenzverein und Lizenzspielern<br />
Das Rechtsverhältnis zwischen Lizenzverein und Lizenzspieler charakterisiert § 10 LSt..<br />
Demnach sind Lizenzspieler Arbeitnehmer besonderer Art eines vom DFB lizenzierten<br />
Verein, und nach § 15 SpielO/DFB ist Lizenzspieler, „wer den Fußball aufgrund eines<br />
3 Vgl. § 11 Nr.3 LSt..<br />
4 Trommer, Transferregelungen, S.35.<br />
5 J.Burmeister, DÖV 1978, S.1, 2.<br />
6 Arens, SpuRt 1994, S.179ff, <strong>18</strong>2.<br />
7 Trommer, Transferregelungen, S.37.<br />
8 Vgl. Arens SpuRt. 1994, S.179ff, <strong>18</strong>2.<br />
9 ArbG Gelsenkirchen, NJW 1977, 598.
15<br />
vom DFB lizenzierten Arbeitsvertrages mit einem Lizenzverein betreibt“. Es vermag ein-<br />
zuleuchten, daß die bloße Verwendung des Begriffs „Arbeitgeber“ in den Statuten des<br />
DFB nicht ausreicht, um das zwischen Verein und Spieler zugrunde liegende Rechtsver-<br />
hältnis verbindlich als Arbeitsvertrag im Sinne von § 611 BGB zu kennzeichnen 11 . Den-<br />
noch besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß zumindest die Lizenzspieler aufgrund<br />
de s Weisungsrechts des arbeitgebenden Vereins als Arbeitnehmer im Sinne arbeits-<br />
rechtlicher Vorschriften anzusehen sind 12 . In dem vom DFB zur Verfügung gestellten<br />
Musterarbeitsvertrag verpflichtet sich der Spieler, gegen Vergütung sein spielerisches<br />
Können und seine ganze Kraft für den Verein einzusetzen 13 . Gestaltungsfreiheit läßt der<br />
Mustervertrag lediglich im Hinblick auf Laufzeit, Entgelt und Urlaubsdauer 14 . Um für den<br />
arbeitgebenden Verein jedoch auch am Spielbetrieb teilnehmen zu dürfen, bedarf der<br />
Spieler neben der vom DFB zu erteilenden Spiellizenz nach § 26a LSt. (s.o.II) noch eine<br />
sogenannte Spielerlaubnis, die der ihn verpflichtenden Verein beim Ligaausschuß gem.<br />
§ 26 Nr.1 LSt. schriftlich beantragen muß. Dies ist vor allem beim Vereinswechsel von<br />
Bedeutung, denn dem Spieler wird die Spielerlaubnis für den neuen Verein erst erteilt,<br />
wenn die Aufnahme des Spielers auf die Transferliste bekanntgegeben worden ist 15 . Ei-<br />
ne Vereinsmitgliedschaft des Lizenzspielers scheidet aus steuerlichen Gründen aus.<br />
Nach § 55 I Nr.1 AO 1977 dürfen Vereinsmitglieder keine Gewinnanteile und in ihrer Ei-<br />
genschaft als Mitglieder auch sonst keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhal-<br />
ten, ansonsten würde dieser seinen Status der Gemeinnützigkeit verlieren 16 .<br />
IV) Das Verhältnis zwischen FIFA/UEFA und dem DFB<br />
In der „FIFA“ („Federation internationale de football association“), ein Verein schweizeri-<br />
schen Rechts mit Sitz in Zürich, sind weltweit alle nationalen Fußballverbände zusam-<br />
mengeschlossen. Dieser Weltverband gliedert sich intern wiederum auf in kontinentale<br />
Konföderationen, die die nationalen Verbände eines bestimmten Erdteils repräsentieren.<br />
10<br />
Mümmler(Gebhardt) S.36.<br />
11<br />
Schimke, Sportrecht, S.16.<br />
12<br />
Schmidt, RdA 1972, S.84ff, 88; BAGE 23, S.171; LAG Hamm, DB 1990, S.739.<br />
13<br />
Vgl. §§ 2, 5 Musterarbeitsvertrag.<br />
14<br />
Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.3.<br />
15<br />
Trommer, Transferregelungen, S.38.<br />
16<br />
Meyer-Cording, RdA 1982, S.13.
16<br />
Die für den Kontinent Europa (einschließlich Israel) zuständige Konföderation ist die UE-<br />
FA („Union des associations europeennes football“), ebenfalls ein Verein schweizeri-<br />
schen Rechts, mit Sitz in Nyon. Mitglied in der UEFA ist auch der DFB als nationaler Ver-<br />
band. Wie alle in der UEFA zusammengeschlossenen nationalen Verbände, hat sich<br />
au ch der DFB verpflichtet, die Statuten und Reglements sowie die Entscheidungen der<br />
UEFA zu befolgen 17 . In § 3 Nr.1, 2 seiner Satzung erklärt sich der DFB als Mitglied von<br />
FIFA und UEFA und erklärt gleichzeitig bestimmte Teile des Reglements von FIFA und<br />
UEFA, wie beispielsweise in § 3 III Satzung/DFB die Regelungen der FIFA zum Transfer<br />
von Fußballspielern, zum Bestandteil seiner Satzung <strong>18</strong> .<br />
B) Der Transfer: Rechtsnatur und Entwicklung bis zum Bosman-Urteil<br />
I) Rechtsnatur<br />
Maßgeblich geprägt wurde die rechtliche Qualifizierung des Transfers bisher durch die<br />
Transferentschädigung. Nachdem die Transferentschädigung im herkömmlichen Sinne,<br />
auch im Hinblick auf den aktuellen Standpunkt des zuständigen EU-Kommissars Monti<br />
bezüglich Transferentschädigungen bei Vereinswechseln trotz laufenden Vertrags, recht-<br />
lich nicht haltbar sein dürfte, ist fraglich, ob die bisher in der Literatur entwickelten Ansät-<br />
ze noch Gültigkeit besitzen. Zunächst wurde der Transfer als Kaufvertrag im Sinne von §<br />
433ff BGB angesehen. Die Transferentschädigung wurde als Gegenleistung für die Ertei-<br />
lung der Freigabe durch den abgebenden Verein 19 bzw. der Möglichkeit, für den gekauf-<br />
ten Spieler die Spielberechtigung beantragen zu dürfen 20 , angesehen. Eine andere An-<br />
sicht sieht im Transfer einen Vertrag sui generis 21 , da mit Wegfall des Freigabeerforder-<br />
nisses beim Vereinswechsel seit dem „Bosman-Urteil“ kein gegenseitiger verpflichtender<br />
Vertrag, gerichtet auf die Verschaffung eines Rechts, mehr vorliege.<br />
Der EuGH schließlich sieht im Transfer, losgelöst von den anläßlich eines Spielerwech-<br />
sels geschlossenen Verträgen, lediglich „den Vorgang, durch den ein Spieler seine Ver-<br />
17 Trommer, Transferregelungen, S.33.<br />
<strong>18</strong> Trommer, Transferregelungen, S.33.<br />
19 Westerkamp, Ablöseentschädigung, S.75.<br />
20 Becker, Verfassungsrechtliche Schranken, S.123.<br />
21 MüKo-Westermann, § 433 Rn.20; Palandt-Putzo, v.433, Rn.20; Wertenbruch, NJW 1993, S.179, <strong>18</strong>2.
17<br />
einszugehörigkeit wechselt“ 22 . Dies scheint angesichts der Situation nach dem „Bosman-<br />
Urteil“ auch der zutreffende Ansatz sein, kommt es doch gerade bei Vertragsende der<br />
Spieler vielfach zu Spielerwechseln, bei denen abgebende r und aufnehmender Verein<br />
übe rhaupt nicht mehr in Kontakt treten. Dementsprechend läßt sich der Transfer als der<br />
Vorgang definieren, bei dem ein Spieler unter Beendigung des Vertragsverhältnisses mit<br />
seinem bisherigen Verein zu einem anderen Verein wechselt und mit diesem ein neues<br />
Vertragsverhältnis begründet 23 .<br />
II) Die Rechtslage vor Bosman<br />
1) Die vor Bosman geltenden Transferregeln im Inland<br />
a) Die Transferliste<br />
Der Transferliste kommt dahingehend eine große Bedeutung bei Vereinswechsel eines<br />
Spielers zu, als gem. § 20 Nr1. LSt. in sie alle Spieler, die einen Vereinswechsel anstre-<br />
ben, aufgenommen werden müssen. Dieses Procedere ist unabhängig vom Bosman-<br />
Urteil des EuGH nach wie vor verbindlich für alle Vereinswechsel. Die Transferliste dient<br />
der Offenlegung des Vereinswechsels der Lizenzspieler 24 . Der Eintragung, die teilweise<br />
be züglich des abzuschließenden Arbeitsvertrag als rechtsgeschäftlich vereinbartes<br />
Formerfordernis im Sinne von § 125 S.2 BGB betrachtet wird, kommt große Bedeutung<br />
zu, weil von ihr gem. § 26 Nr.2 lit. C LSt. die für die Teilnahme am Spielbetrieb erforderli-<br />
che Erteilung der Spielerlaubnis abhängt. Den zwingend schriftlichen Antrag auf Auf-<br />
nahme in die Transferliste können gem. § 27 Nr.4 LSt. sowohl die wechselbereiten Spie-<br />
ler als auch die Vereine stellen. Die Aufnahme erfolgt, wenn der wechselbereite Spiele<br />
ohne vertragliche Bindung ist bzw. das Einverständnis des abgebenden Vereins zur Auf-<br />
nahme in die Transferliste erhoben wird. Erst dann dürfen der wechselbereite Spieler<br />
und sein neuer Verein einen neuen Arbeitsvertrag abschließen.<br />
b) Die Transferentschädigung als Voraussetzung für einen Spielerwechsel<br />
Bis zum Bosman-Urteil konnte bei einem Transfer der abgebende Verein auch nach Ab-<br />
lauf des Vertrages mit dem wechselbereiten Spieler vom aufnehmenden Verein unter<br />
22 EuGH, Urt. V.15.12.1995, Rs C-415/93, Slg.1995, S.5040ff, S.5045.<br />
23 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.37.<br />
24 Vgl. Becker, Verfassungsrechtliche Schranken, S.105, Füllgraf, Dreiecksbeziehungen, S.79.
<strong>18</strong><br />
Bezugnahme auf § 29 Nr.1, I, LSt a.F. eine Transferentschädigung verlangen. Die Höhe<br />
de r Entschädigung war grundsätzlich frei aushandelbar, im Streitfall entschied ein unab-<br />
hängiges Schiedsgericht 25 anhand eines Berechnungsschemas. Jedenfalls stand dem<br />
abgebenden Verein eine Ablösesumme zu, unabhängig davon, ob er den wechselwilli-<br />
gen Spieler weiterbeschäftigen wollte oder nicht. Konnte oder wollte der aufnehmende<br />
Verein die Ablösesumme nicht aufbringen, blieb dem wechselwilligen Spieler die freie<br />
Wahl des Arbeitsplatzes verwehrt 26 .<br />
2) Die bis zum „Bosman Urteil“ geltenden Transferregelungen bei einem Transfer unter<br />
Beteiligung ausländischer Mitgliedsverbände von FIFA bzw. UEFA<br />
Bei jedem Wechsel eines Berufsspielers unter Beteiligung eines ausländischen Verban-<br />
des, gleich welcher Nationalität der Spieler ist, gleich ob von oder zu einem Verein im<br />
Ausland gewechselt wird, mußte der jeweils abgebende Verband eine Freigabeerklärung<br />
abgeben. Dies geht aus den Bestimmungen der FIFA hervor, die beim Wechsel eines<br />
Berufsspielers unter Beteiligung verschiedener Mitgliedverbände von FIFA bzw. UEFA<br />
zur Anwendung kommen, und vom DFB gem. § 28 Nr.1 LSt anerkannt werden. Der DFB<br />
erteilte die Freigabeerklärung dann, wenn der abgebende Verein keine berechtigten<br />
Einwendungen gegen die Freigabe erhob bzw. keine Einwendungen gegen die Aufnah-<br />
me in die Transferliste vorlagen, § 28 Nr.2 lit. a, b LSt. Der abgebende Verein hatte ge-<br />
mäß der jeweils gültigen Fassung des UEFA Transferreglements einen Anspruch auf<br />
Zahlung einer Ausbildungs- und Förderungsentschädigung. Dies wurde 1993 dahinge-<br />
hend geändert, daß hinsichtlich des internationalen Vereinswechsels nur noch das FIFA-<br />
Reglement zur Anwendung kommen sollte, das jedoch in Art. 14 I dem abgebenden Ver-<br />
ein ebenso einen Anspruch auf Ausbildungs- und Förderungsentschädigung gewährt.<br />
Die UEFA behielt sich jedoch in Art. 1 I, II UEFA Transferreglement von 1993 vor, das<br />
Verfahren, die Art der Berechnung der Ausbildungs- und Förderungsentschädigung und<br />
im Streitfall deren Festsetzung selbst zu regeln.<br />
III) Änderungen durch das Bosman-Urteil<br />
25 Vgl. Eilers, Transferbestimmungen im Fußballsport, S.10ff.
1) Der „Fall Bosman“<br />
19<br />
Der belgische Berufsfußballspieler Jean-Marc Bosman spielte in der Saison 1989/1990<br />
für den belgischen Erstligisten RC Lüttich. Seine Vertragslaufzeit bei diesem Verein en-<br />
dete am 30.Juni 1990, Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem RC Lüttich<br />
im April 1990 scheiterten, so daß sich Bosman gemäß den Statuten des Belgischen<br />
Fußballverbandes „URBSFA“ auf die Transferliste setzen ließ. Die Höhe der Transfer-<br />
entschädigung wurde nach den einschlägigen Reglement des Verbandes auf 11.743<br />
BFR festgesetzt. Im Juli 1990 beabsichtigte der französische Zweitligist US Dünkirchen,<br />
Bosman zu verpflichten. Die beiden Vereine einigten sich bezüglich der Moda litäten des<br />
Transfers und über die Transferentschädigung. Bosman schloß daraufhin einen Arbeits-<br />
vertrag mit dem US Dünkirchen ab. Die Wirksamkeit der Verträge wurde jedoch unter die<br />
Bedingung der Freigabeerteilung durch den belgischen Verband gestellt, da der Spieler<br />
Bosman nur mit dieser Freigabe eine Spielerlaubnis in Frankreich erhalten konnte.<br />
Nachdem der US Dünkirchen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet und sich abzeich-<br />
nete, dass die Transferentschädigung für den Spieler Bosman nicht gesichert erschien,<br />
unterließ es der RC Lüttich, beim belgischen Verband die Ausstellung der Freigabeerklä-<br />
rung zu beantragen, woraufhin der Transfer scheiterte. Von allen Beteiligten unberück-<br />
sichtigt blieb, daß gem. Art. 16 des damals geltenden UEFA-Transferreglements die wirt-<br />
schaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Vereinen in Bezug auf die Ausbildungs-<br />
und Förderungsentschädigung keinen Einfluß auf die sportliche Tätigkeit des Spielers<br />
hätten ausüben dürfen.<br />
Bosman erhob daraufhin Schadensersatzklage vor den belgischen Zivilgerichten, die im<br />
wesentlichen auf die Verletzung vertraglicher Pflichten durch den RC Lüttich und zum<br />
anderen auf die Rechtswidrigkeit des Transfersystems gestützt war 27 . Daneben bean-<br />
tragte Bosman eine einstweilige Verfügung. Der Rechtsstreit beschäftigte schließlich<br />
zwei Instanzen, im Zuge derer durch Streitverkündungen und Neben interventionen sowie<br />
seperater Klagen noch die UEFA, der belgische Fußballverband, der US Dünkirchen und<br />
die Berufsverbände der Berufsspieler aus Frankreich und den Niederlanden verwickelt<br />
waren. Neben den Transferregeln standen auch die sogenann ten Ausländerklauseln im<br />
26 Trommer, Transferregelungen, S.41.
20<br />
Mittelpunkt der gerichtlichen Auseinandersetzung. Schließlich legten die Berufungsin-<br />
stanzen den Fall im Rahmen des Vorlageverfahrens nach Art. 234 EGV dem EuGH zur<br />
Entscheidung vor.<br />
2) Kernaussagen des Urteils<br />
a) Zunächst mußte sich der EuGH mit der Frage befassen, ob das Gemeinschaftsrecht<br />
und damit der zu Debatte stehende Art. 39 EGV überhaupt auf den Sport Zugriff nehmen<br />
kann. Dies schien zum einen deshalb problematisch, weil die Vereine und Verbände den<br />
Sport als ein außerhalb des EG-Rechts stehendes eigenständiges System mit gesell-<br />
schaftsspezifischer Bedeutung ansahen. Zum anderen entfalteten die in Frage gestellten<br />
verbandsrechtlichen Regelungen im vorliegenden Fall Rechtswirkung lediglich zwischen<br />
den p rivaten Rechtssubjekten Verein, Verband, Spieler, eine Berufung des Klägers auf<br />
die Grundfreiheiten des EG-Vertrages erschien möglicherweise deshalb nicht zulässig.<br />
Beide Fragen beantwortete der EuGH unter Beibehaltung seiner bisherigen Rechtspre-<br />
chung 28 im Zusammenhang mit sportrechtlichen Fällen.<br />
(1) Demnach unterliege die sportliche Betätigung insoweit dem Gemeinschaftsrecht, als<br />
sie „einen Teil des Wirtschaftslebens im Sinne von Art. 2 EGV ausmachen“ 29 . Dies sei<br />
bei Profifußballspielern unproblematisch der Fall, „da ihre Tätigkeit eine entgeltliche Ar-<br />
beits-, oder Dienstleistung darstellt“ 30 , sie also als Arbeitnehmer im Sinne der Art.39ff<br />
EGV anzusehen seien. Die Anwendbarkeit europarechtlicher Rechtsnormen und damit<br />
auch des Art.39 EGV auf die von Fußballverbänden aufgestellten Regeln war somit ge-<br />
geben.<br />
(2) Die unmittelbare Drittwirkung des Art. 39 EGV bejahte der EuGH ebenfalls 31 . Im Sin-<br />
ne einer effektiven Durchsetzung der Grundfreiheiten müsse Art. 39 EGV auch bei privat-<br />
rechtlichen Vereinbarungen, wie den Verbandsbestimmungen der Fußballverbände, An-<br />
wendung finden, und zwar dann, wenn durch diese Vorschriften die Freizügigkeit der Ar-<br />
beitnehmer beeinträchtigt würde. Durch die Anwendung des Art. 39 EGV auch auf nicht-<br />
27 Vgl.Trommer, Transferregelungen, S.55.<br />
28 EuGH, Rs. 36/74, Walrave und Koch, Slg. 1974, S.1405ff.<br />
29 EuGH, Rs. 36/74, Walrave und Koch, Slg. 1974, S.1405ff, S.14<strong>18</strong>.<br />
30 EuGH, Rs. 13/76, Dona/Mantero, Slg. 1976, S.1333ff, S.1340.<br />
31 EuGH, Rs. C-415/93, Bosman, Slg. I-1995, S.4921ff, S.5067.
21<br />
staatliche Vorschriften werde eine einheitliche Anwendung und eine weitgehende Si-<br />
cherheit vor Umgehung des Art. 39 EGV gewährleistet 32 .<br />
(3) Mit seiner Interpretation des Art. 39 EGV als umfassendes Beschränkungs- bzw. Be-<br />
einträchtigungsverbot 33 konnte der EuGH unproblematisch in den Transferregeln einen<br />
Verstoß gegen Art. 39 EGV feststellen 34 . Die Tatsache, dass bei einem Vereinswechsel<br />
in einen anderen Mitgliedstaat die Freigabeerteilung durch den Verband untrennbar mit<br />
der Transferentschädigung an den abgebenden Verein verbunden war, schränke die<br />
Freizügigkeit des Berufsfußballspielers unzulässig ein. Denn der den Spieler abgebende<br />
Verein beantrage die Freigabe beim Verband regelmäßig erst nach Zahlung der Trans-<br />
ferentschädigung, darauf hat der Spieler jedoch keinen Einfluß. Eine freie Entscheidung<br />
des Spielers, seinen Herkunftsstaat zu verlassen, um in einem anderen Mitgliedstaat sei-<br />
nen Beruf auszuüben, war somit nicht mehr gewährleistet, vielmehr der Zugang zu<br />
einem Arbeitsmarkt in einem anderen Mitgliedstaat von Entscheidungen Dritter abhän-<br />
gig 35 .<br />
Diese Umstände nahm der EuGH zur Grundlage seiner Feststellung, dass die Freizügig-<br />
keit der Arbeitnehmer nach Art. 39 EGV durch die Transferregelungen beeinträchtigt sei.<br />
Zum gleichen Ergebnis kam der EuGH im Hinblick auf die sogenannten Ausländerklau-<br />
seln. Diese stellten verbandsinterne Regelungen dar, die die Anzahl der in Verbandspie-<br />
len einsetzbaren ausländischer Spieler einschränkten. Der EuGH sah auch in den Aus-<br />
länderklauseln eine Beschränkung der Freizügigkeit der Profispieler im Hinblick auf eine<br />
freie Arbeitsplatzwahl 36 .<br />
b) Rechtfertigung<br />
Die betroffenen Fußballverbände versuchten, um Schadensbegrenzung bemüht, mögli-<br />
che Rechtfertigungsgründe für die Einschränkung der Freizügigkeit von Berufsspielern<br />
du rch die Transferregelungen vorzubringen. Dabei stützten sie sich vor allem auf solche<br />
Aspekte, die auf die Aufrechterhaltung des sportlichen und finanziellen Gleichgewichts<br />
32 Trautwein, JA 1996, S.457ff, S.458.<br />
33 Schroeder, JZ 1996, S.254ff, S.255; Hobe/Tietje, JuS 1996, S.486ff, S.490.<br />
34 EuGH, Rs. C-415/93, Bosman, Slg. I-1995, S.4921ff, S.5069.<br />
35 Trommer, Transferregelungen, S.65.<br />
36 EuGH NJW 96, S.505ff, S.511.
22<br />
zwischen den Vereinen abzielten 37 . Der EuGH prüfte die Stichhaltigkeit der Argumentati-<br />
on mangels einschlägig geschriebener Schranken anhand immanenter Schranken der<br />
Freizügigkeit. Er legte seiner Rechtmäßigkeitsprüfung eine Dreistufigkeit zugrunde 38 und<br />
sah die den Art. 39 EGV beeinträchtigenden Transferregeln als gerechtfertigt an, „ wenn<br />
die Regeln einen mit dem Vertrag zu vereinbarenden berechtigten Zweck verfolgen wür-<br />
den und aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresse gerechtfertigt wären“ 39 . Diese<br />
ane rkannten „zwingenden Erfordernisse der Allgemeinheit“ überprüfte der EuGH sodann<br />
am Verhältnismässigkeitsgrundsatz als „Schranken-Schranke“ und forderte, daß die<br />
„Anwendung dieser Regeln geeignet sein müßten, die Verwirklichung des verfolgten<br />
Zwecks zu gewährleisten, und (...) nicht über das hinausgehen dürften, was zur Errei-<br />
chung des Zwecks erforderlich sei“ 40 . Der EuGH versagte im Ergebnis die Rechtfertigung<br />
im Hinblick auf sämtliche geltend gemachte Aspekte 41 .<br />
(1) Zum einen wurde eine Rechtfertigung unter dem Gesichtspunkt der Vereinigungsfrei-<br />
heit für möglich angesehen, die ein Eingreifen durch die Gemeinschaft zu Lasten der na-<br />
tionalen Sportverbände im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip auf das unbedingt Erfor-<br />
derliche beschränken müsse 42 . Existenz und Geltung der Vereinigungsfreiheit im Euro-<br />
parecht ergibt sich daraus, dass sie als Grundrecht in dem vom EuGH entwickelten pri-<br />
mären Gemeinschaftsrecht verankert ist und im Rahmen des Vertragswerkes von Maa-<br />
stricht in Art. 6 II EUV Geltung finde t. Die Rechtsquelle hierfür stellen die allgemeinen<br />
Rechtsgrundsätzen der Verfassungen der Mitgliedstaaten und Art. 11 der EMRK 43 dar.<br />
Im Hinblick auf das Verhältnis von Freizügigkeit der Berufsspieler und Vereinigungsfrei-<br />
heit der Sportverbände beschränkte sich der EuGH darauf, festzustellen, „daß nicht da-<br />
von auszugehen ist, daß die von Sportverbänden aufgestellten Regeln (...) erforderlich<br />
sind, um die Ausübung dieser Freiheit (...) zu gewährleisten“ 44 , Eine gegenseitige Abwä-<br />
gung seitens des EuGH unter Einbeziehung aller grundrechtsrelevanter Bezüge im Sinne<br />
einer im deutschen Verfassungsrecht geläufigen praktischen Konkordanz unterblieb.<br />
37<br />
Trommer, Transferregelungen, S.66.<br />
38<br />
Vgl. Fischer, SpuRt 1996, S.34ff, S.36; Schroeder, JZ 1996 S.254ff, S.255.<br />
39<br />
Vgl. Streinz, Europarecht, Rn. 687ff; Oppermann, Europarecht Rn.1164.<br />
40<br />
EuGH, Rs C-415/93 Bosman, Slg. I-1995, S.4921ff, S.5071.<br />
41<br />
Vgl. GA Lenz, Schlußanträge, in: EuGH, Rs C-415/93 Bosman, Slg. I-1995, S.4932ff, S.5012.<br />
42<br />
Vgl. Stern, in: Thieme-FS, S.269ff, S.271.<br />
43<br />
Vgl.Gramlich, DÖV 1996, S.801ff, S.807.
23<br />
Diese Vorgehensweise seitens des EuGH wurde in der Literatur heftig kritisiert 45 und<br />
verminderte die Akzeptanz des Urteils 46 .<br />
(2) Zentrales Argument der Verbände im Rahmen der Rechtfertigung war der Hinweis<br />
auf die Funktion der Transferentschädigung als Regulativ zur Aufrechterhaltung des fi-<br />
nanziellen und sportlichen Gleichgewichts innerhalb der Profiligen 47 sowie der Bedeu-<br />
tung der Transferentschädigung als Anreiz für die Talentförderung. Der EuGH erkannte<br />
un ter Hinweis auf die beträchtliche soziale Bedeutung des Sportes die mit den Transfer-<br />
regeln verfolgten Zwecke als berechtigt an, sprach den Transferregeln jedoch bereits die<br />
Geeignetheit zum Zwecke der Aufrechterhaltung des sportlichen und finanziellen Gleich-<br />
gewichts ab. Die Transferregeln würden weder verhindern, „daß die reichsten Vereine<br />
sich die Dienste der besten Spieler sichern würden, noch daß die finanziellen Mittel ein<br />
en tscheidender Faktor beim sportlichen Wettkampf seien“ 48 . Auch im Hinblick auf die<br />
Nachwuchsförderung stellte der EuGH die Eignung der Transferregeln zur Verwirkli-<br />
chung des beabsichtigten Zwecks in Frage. Zu sehr sei die Entwicklung eines Talents<br />
zum Profi vom Eventualitäts- und Zufallscharakter geprägt, als daß die Talentförderung<br />
eine hinreichende Kalkulationsgrundlage für die Wirtschaftspolitik der Vereine im Hinblick<br />
auf zukünftige Transfererträge darstellen könne 49 . Somit versagte der EuGH sämtlichen<br />
geltend gemachten Rechtfertigungsgründen die Rechtswirkung, die Transferregelungen<br />
und d ie Ausländerklauseln stellten einen ungerechtfertigten Verstoß gegen die Freizü-<br />
gigkeit der Berufsfußballspieler dar.<br />
c) Reichweite des Urteils<br />
Der EuGH gewährte in zeitlicher Hinsicht keine Übergangsphase zur Anpassung der<br />
Transferregeln, die neue Rechtslage galt sofort 50 . Die Sportverbände waren somit ge-<br />
zwungen, innerhalb kürzester Zeit gemeinschaftsrechtskonforme Übergangs- und<br />
Ersatzlösungen zu finden.<br />
44 EuGH, Rs C-415/93 Bosman, Slg. I-1995, S.4921ff, S.5065.<br />
45 Fischer, SpuRt 1996, S.34ff, S.36; Schroeder, JZ 1996, S.254ff, S.255f; Palme JZ 1996, S.238ff, S.241; Hilf/Pache,<br />
NJW 1996, S.1169ff, S.1176f; Scholz/Aulehner, SpuRt 1996, S.44ff; Hobe/Tietje JuS 1996, S.486ff, S.490; Gramlich,<br />
DÖV 1996, S.801ff, S.804.<br />
46 Vgl.Trommer, Transferregelungen S.70.<br />
47 Vgl. GA Lenz, Schlußanträge, in: EuGH, Rs C-415/93 Bosman, Slg. I-1995, S.4932ff, S.5014.<br />
48 Vgl. GA Lenz, Schlußanträge, in: EuGH, Rs C-415/93 Bosman, Slg. I-1995, S.4932ff, S.5016.<br />
49 EuGH, Rs C-415/93 Bosman, Slg. I-1995, S.4921ff, S.5072; vgl. Fischer, SpuRt 1996, S.34ff, S.36.<br />
50 Vgl.:Scholz/Aulehner, SpuRt 1996 S.44ff, S.46; Hobel/Tietje, JuS 1996, S.486ff, S.492.
24<br />
(1)aa) Auch für die Arbeitnehmer aus den EFTA-Staaten, zu denen die dem Europäi-<br />
schen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staaten Norwegen, Liechtenstein und Island<br />
gehören, gilt gem. Art. 28 EWR-Abkommen das Recht auf Freizügigkeit. Da dieses<br />
Recht mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit nach dem EGV identisch ist, ist für dessen An-<br />
wendung gem. Art. 6 EWR-Abkommen die Rechtsprechung des EuGH zur Arbeitneh-<br />
merfreizügigkeit zugrunde zulegen 51 . Das Bosman-Urteil gilt somit auch für die Bürger<br />
der EFTA-Staaten.<br />
Für Berufsfußballspieler aus Staaten, die mit den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ein<br />
Assoziierungsabkommen geschlossen haben, gelten besondere Regeln.<br />
bb) Gem. Art. 310 EGV kann die Gemeinschaft mit Staaten oder internationalen Organi-<br />
sationen Abkommen schließen, die eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und<br />
Pflichten herstellen. Zahlreiche auf dieser Grundlage geschlossenen Abkommen enthal-<br />
ten Vorschriften, die die Rechtsstellung der Arbeitnehmer aus dem assoziierten Staat in<br />
einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft betreffen. Die Auswirkungen solcher Auswirkun-<br />
gen auf die Freizügigkeit von Profifußballspielern aus assoziierten Staaten ist vom Inhalt<br />
des jeweiligen Abkommens abhängig 52 und kann daher nicht generell beurteilt werden.<br />
Nach der Rechtsprechung des EuGH stellen Abkommen nach Art. 310 EGV mit ihrem<br />
Inkrafttreten einen integrierenden Bestandteil der Gemeinschaftsrechtsordnung dar und<br />
un terliegen gem. Art 134 I b EGV der Auslegung durch den EuGH 53 . Fraglich ist, ob Be-<br />
stimmungen in Assoziierungsabkommen über die Freizügigkeit unmittelbar anwendbares<br />
Recht darstellen, auf das sich der Einzelne vor nationalen Gerichten berufen kann. Das<br />
hängt laut EuGH davon an, „ob unter Berücksichtigung ihres Wortlauts und im Hinblick<br />
auf den Sinn und Zweck des Abkommens die Bestimmung eine klare und eindeutige<br />
Verpflichtung erhält, deren Erfüllung oder Wirkung nicht von dem Erlaß eines weiteren<br />
Aktes abhängt“ 54 . Bejaht wurde die unmittelbare Anwendbarkeit bei unterschiedlichen<br />
Assoziierungsabkommen mit Marokko, Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, der Tsche-<br />
chischen Republik, der Slowakischen Republik, Tunesien, Algerien, und der Türkei 55 . Ar-<br />
51<br />
Hobe/Tietje, JuS 1996 S.486ff,S.490; Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.30.<br />
52<br />
Wertenbruch, EuZW 1996, S.91.<br />
53<br />
EuGH, Slg. 1974, S.449ff, S.460 Haegeman; EuGH Slg. 1987, S.3719ff, S.3750, Demirel.<br />
54<br />
EuGH Slg. 1987, S.3719ff, S.3750, Demirel.<br />
55<br />
Vgl. Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profifußball, S.76.
25<br />
beitnehmer aus diesen Staaten dürfen hinsichtlich Arbeitsbedingungen, Entlohnung und<br />
Entlassung nicht schlechter gestellt werden als Staatsangehörige des Landes in dem sie<br />
ordnungsgemäß beschäftigt sind. Die Freizügigkeit greift hingegen nicht so weit wie für<br />
Unionsbürger, da sie im Gegensatz zu Art. 39 EGV ein Zuzugsrecht aus der Heimat und<br />
ein Wanderungsrecht innerhalb der Gemeinschaft nicht umfasst 56 . Die Aussagen des<br />
„Bosman-Urteils“ im Hinblick auf die Ausländerklauseln sind jedoch, unter Berücksichti-<br />
gung des konkreten Inhalts des jeweiligen Assoziierungsabkommens, im Falle einer<br />
„ordnungsgemäßen Beschäftigung des Sportlers aus dem assoziierten Staat in Deutsch-<br />
land“ anwendbar 57 .<br />
(2) In materieller Hinsicht ist bezüglich der Reichweite zu berücksichtigen, daß es nur für<br />
den Bereich des Berufsfußballs Anwendung findet. Dies ergibt sich bereits aus der Fest-<br />
stellung, daß allein der Berufsfußball in seiner Gesamtheit am Wirtschaftsleben im Sinne<br />
de s Art. 2 EGV teilnimmt und hierüber der Weg zur Anwendung des Gemeinschafts-<br />
rechts und damit des Art. 39 EGV eröffnet wird. Nicht erfaßt wird somit vom Bosman-<br />
Urteil der gesamte Bereich des Amateur- und Freizeitsports 58 , da nach der Rechtspre-<br />
chung des EuGH Arbeitnehmer und damit Begünstigter des Art. 39 EGV nur sein kann,<br />
wer eine entgeltliche Arbeits- und Dienstleistung erbringt 59 . Etwas anderes muß jedoch<br />
gelten, wenn auch im Amateurbereich entgeltliche Leistungen seitens der Spieler er-<br />
bracht werden. Dies wird in der Folge noch zu untersuchen sein.<br />
(3) Ferner betrifft das Urteil nur den grenzüberschreitenden Transfer eines Unionsbür-<br />
gers. Erst das „grenzüberschreitende Element“ stellt den europarechtlichen Bezug her 60 .<br />
(4) Genausowenig war das Bosman Urteil ursprünglich auf den Fall anwendbar, dass ein<br />
Spieler vor Beendigung seines Arbeitsverhältnisses den Verein wechselt. Das „Heraus-<br />
kaufen“ von Spielern aus laufenden Verträgen war nach damals geltender Ansicht „euro-<br />
parechtlich unbedenklich“ 61 . Die „Ablösesumme“ wurde als Entschädigung<br />
im Hinblick auf für den alten Verein zu erwartende spielerbezogene zukünftige Erlöse<br />
an gesehen, die ihm da<br />
56 Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profifußball, S.76.<br />
57 Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profifußball, S.132.<br />
58 Hilf/Pache, NJW 1996, S.1169ff, S.1174.<br />
59 EuGH, Rs. 13/76, Dona/Mantero, Slg. 1976, S.1333ff, S.1340.<br />
60 Oppermann, Europarecht, Rn.197.
26<br />
durch entgehen, dass er den Spieler vorzeitig aus seinem Vertrag entläßt 62 , bzw. als eine<br />
Art „Vertragsstrafe“<br />
klassifiziert 63 . Diese Ansicht dürfte heute in dieser Form nicht mehr vertretbar sein. Viel-<br />
mehr gibt es seitens des zuständigen EU-Kommissars Monti in jüngster Zeit eindeutige<br />
Aussagen, die auch bei Vereinswechseln trotz laufenden Arbeitsvertrages in der Praxis<br />
der Transferentschädigung einen Verstoß gegen die Freizügigkeit sehen. Die weitere<br />
Entwicklung wird man diesbezüglich abwarten müssen, doch ist nicht auszuschließen,<br />
daß trotz massiver Proteste seitens der Sportverbände auch diese Transferzahlungen in<br />
ab sehbarer Zeit entfallen könnten.<br />
C: Auswirkungen des „Bosman-Urteils“ im Hinblick auf den dt. Profifussball<br />
I) Reaktionen auf das Urteil<br />
1) Der DFB wurde offenbar dadurch überrascht, dass der EuGH keine Übergangsfristen<br />
zugestand. Im Bereich der Ausländerklauseln einigten sich die Bundesligavereine im<br />
Rahmen einer „freiwilligen Selbstbeschränkungserklärung“ 64 darauf, bis zum Ende der<br />
Saison 1995/1996 freiwillig die bisherige Ausländerregelung beizubehalten. Der DFB<br />
reagierte mit einer umfassenden Änderung des Lizenzspielerstatuts im Hinblick auf die<br />
Ausländerregelungen, so daß ab der Saison 1996/1997 auch nach Maßgabe der Ver-<br />
bandsregeln Spieler aus den Mitgliedsstaaten in unbegrenzter Anzahl eingesetzt werden<br />
konnten. Im Bereich des Transferwesens beschloß der DFB eine Übergangslösung bis<br />
zum 1.7.1997, wonach das bisherige Transferwesen mit der Maßgabe weiterpraktiziert<br />
wurde, daß lediglich die Hälfte der gemäß DFB-Richtlinien bestimmten Transfersumme<br />
gezahlt werden mußte. Ziel dieser rechtswidrigen Übergangslösung war es, ertrags-<br />
schwache Vereine zumindest bilanziell in die Lage zu versetzen, Transfers nochmals zu<br />
ihren Gunsten abwickeln zu können 65 .<br />
2) Die FIFA blieb unbeschadet des Bosman-Urteils zunächst bei ihren Transferbestim-<br />
mungen, betraf das Urteil doch nur 21 der 193 der FIFA angeschlossenen Verbände.<br />
61 Vgl. Trommer, Transferregelungen, S.79.<br />
62 Parlasca, Kartelle, S.<strong>18</strong>6.<br />
63 Hobel/Tietje, NJW 1996, S.486ff, S.490; Arens SpuRt, 1996, S.39ff, S.40.<br />
64 Hobel/Tietje, NJW 1996, S.486ff; S.493; Fischer, SpuRt 1996, S.34ff, S.38; Arens, SpuRt 196, S.39ff, S.43.<br />
65 Trommer, Transferregelungen, S.80.
27<br />
Demnach hatte grundsätzlich nach Art.14 I des FIFA-Reglements im Falle des Wechsels<br />
eines Profispielers der abgebende Verein einen Anspruch auf „Ausbildungs- und/oder<br />
Förderungsentschädigung“. Eine Ausnahme machte die FIFA jedoch für den räumlichen<br />
Bereich der EU- bzw. EWG-Angehörigen Mitgliedsstaaten. Art. 14 VIII FIFA-Reglement<br />
wurde dahingehend neu eingeführt, dass vom 1.4.1997 an über das EuGH-Urteil hinaus-<br />
gehend alle Profis bei Vereinswechseln innerhalb der EU und des EWR gleich zu be-<br />
handeln seien. Auf Drängen von Verbands- und Vereinsvertretern, die um Transfererlöse<br />
fürchteten, trat die uneingeschränkte Freizügigkeit sämtlicher Profifußballer jedoch erst<br />
ab dem 1.1.1999 ein 66 .<br />
3) Die UEFA wurde ein Monat nach Urteilsverkündung unter Androhung von Geldbu-<br />
ßen 67 dazu gezwungen, innerhalb von sechs Wochen das Urteil des EuGH in die Praxis<br />
umzusetzen. Dies war notwendig, da die UEFA die laufenden Europapokalwettbewerbe<br />
mit der zu Beginn der Saison geltenden Ausländerregelung zu Ende spielen wollte.<br />
II) Änderungen im Bereich des Transferwesens<br />
1) Wechsel eines deutschen Profis<br />
Wechselt ein deutscher Profi innerhalb der Bundesligen, kann er sich wegen fehlendem<br />
grenzüberschreitenden Bezug nicht auf Art. 39 EGV und somit auch nicht auf das „Bos-<br />
man-Urteil“ berufen. Eine Transferentschädigung wird dennoch nicht fällig. Zum einen gilt<br />
seit 1.4.1999 Art. 14 VIII FIFA-Reglement für alle Profispieler, unabhängig vom grenz-<br />
überschreitenden Bezug (s.o.: C, I, 2). Weiter stehen die Grundsätze der „Kienass-<br />
Entscheidung“ des BAG einer Transferentschädigung bei einem Wechsel innerhalb der<br />
Bundesliga entgegen. Die Entscheidung vom 20.11.1996 in Bezug auf den Wechsel des<br />
deutschen Eishockeyspielers Kienass von den „Eisbären Berlin“ zur „Düsseldorfer EG“<br />
stellt gleichsam die „logische nationale Konsequenz“ 68 des “Bosman-Urteils“ dar. Kienass<br />
berief sich vor dem BAG auf seine Berufsfreiheit gem. Art. 12 I GG und machte geltend,<br />
das Verlangen einer<br />
66 Trommer, Transferregelungen, S.82.<br />
67 Taupitz, JA 1996, S.457ff, S.460.<br />
68 Rauball, in: FAZ v.<strong>18</strong>.12.1996.
28<br />
Transferentschädigung nach den Transferregeln des DEB gem. Art. 59 SpO/DEB durch<br />
die „Eisbären Berlin“ hindere ihn in seinem beruflichen Fortkommen. Das BAG gab Kie-<br />
nass recht und erklärte Art. 59 SpO/DEB gem. Art. 12 I GG i.V.m. §138 BGB für verfas-<br />
sungswidrig, da dieser eine ähnliche Wirkung wie eine objektive Zulassungssc hranke<br />
au fweise 69 . Das BAG verneinte auch eine Rechtfertigung der Transferregelung unter<br />
dem Aspekt des finanziellen Ausgleichs innerhalb der Eishockeyliga zur Aufrechterhal-<br />
tung des Spielbetriebs. Dies stelle kein Gemeinschaftsrechtsgut i.S.d. Rechtsprechung<br />
des BVerfG dar, sondern diene vielmehr primär wirtschaftlichen Zwecken der beteiligten<br />
Vereine, zudem könnte ein wirtschaftlicher Ausgleich unter ungleich starken Vereinen<br />
au ch anders organisiert werden 70 .<br />
Mit dem „Kienass-Urteil“ war eine Transferentschädigung bei Wechseln von Profifußball-<br />
spielern innerhalb der Bundesliga rechtlich nicht mehr haltbar. Der DFB änderte als Re-<br />
aktion darauf sein Lizenzspielerstatut dahingehend, daß auch bei Vereinswechseln in-<br />
nerhalb Deutschlands Profiligen bei deutschen Profispielern keine Transferentschädi-<br />
gung mehr fällig wurde.<br />
2) Wechsel eines ausländischen Profispielers<br />
Seit dem „Bosman Urteil“ kann ein deutscher Profispieler sowohl von der Bundesliga ins<br />
EG-Ausland als auch aus dem EG-Ausland in die Bundesliga ohne Transferentschädi-<br />
gung wechseln.<br />
Die gleiche Regelung gilt für alle EU-Ausländer beim Vereinswechsel innerhalb der EU<br />
mit grenzüberschreitenden Element. Für Wechsel aus oder in Nicht-EU-Ausland gelten<br />
die Transferbestimmungen der FIFA, wonach eine Transferentschädigung zu zahlen ist.<br />
Besonderheiten ergeben sich nur, falls ein EG-Ausländer innerhalb der Profiligen eines<br />
anderen EG-Staates wechseln möchte. Hier fehlt es am grenzüberschreitenden Element,<br />
so daß Art. 39 EGV nicht zur Anwendung kommen kann. Darüber hinaus würde eine zu<br />
zahlende Transferentschädigung den Spieler nicht daran hindern, „sich zur Ausübung<br />
einer wirtschaftlichen Tätigkeit in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates zu bege-<br />
69 Vgl. BAG, SpuRt 1997, S.94ff, S.96.<br />
70 Vgl. BAG, SpuRt 1997, S.94ff, S.96.
29<br />
ben“ 71 , da er sich ja schon dort aufhält. Schließlich muß berücksichtigt werden, daß eine<br />
de rartige Transferentschädigung den ausländischen Spieler nicht mehr belasten würde,<br />
als den inländischen, eine Situation, die der EuGH im Rahmen seiner Rechtsprechung<br />
zum Fall „Keck“ in Bezug auf die Warenfreiheit ausdrücklich gebilligt hat 72 . Will der<br />
EuGH, wie er in diesem Urteil nahelegt, eine strikte Konvergenz der Freiheiten der Ge-<br />
meinschaft praktizieren, so müssen diese Grundsätze auch auf die Personenfreiheiten<br />
an wendbar sein 73 . Das Problem ist mittlerweile ohnehin rein theoretischer Natur, da in<br />
Deutschland seit dem „Kienass-Urteil“ auch bei Wechseln innerhalb der Bundesliga kei-<br />
ne Transferentschädigung mehr anfallen, für die übrigen EG-Staaten gilt ergänzend seit<br />
1.9.1999 gem. Art. 14 VIII des FIFA Reglements der Wegfall der Ablösesummen beim<br />
Vereinswechsel nach Vertragsende.<br />
71 EuGH, Rs. C-415/93, Bosman, Slg. I-1995, S.4921ff, S.5068.<br />
72 EuGH, Rs. C-267/91 u. C-268/91, Keck und Mithouard, Slg. 1993, I-S.6097ff, S.6131.<br />
73 Trommer, Transferregelungen, S.86.
III) Ausländerklauseln im Profifußball<br />
30<br />
1) Vereinbarkeit der Ausländerklauseln mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit gem. Art. 39<br />
EGV<br />
Wie bereits oben angesprochen, erklärte das „Bosman-Urteil“ auch die sogenannten<br />
Ausländerklausel für rechtswidrig. Bis zum „Bosman-Urteil“ galt im Europapokal und dar-<br />
aus abgeleitet in den meisten europäischen Lizenzligen die sog. 3+2 Regel, wonach in<br />
diesen Spielen jeweils nur drei ausländische Spieler eingesetzt werden durften sowie<br />
zwei weitere assimilierte Ausländer, die in den letzten fünf Jahren ununterbrochen in<br />
de m jeweiligen Land spielberechtigt waren 74 . Im deutschen Fußball wurden diese assimi-<br />
lierten Ausländer „Fußball-Deutsche“ genannt. Art. 39 II EGV sieht jedoch ausdrücklich<br />
vor, daß die Freizügigkeit der Arbeitnehmer die Abschaffung jeder auf der Staatsangehö-<br />
rigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten<br />
in bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen umfasst. In<br />
de r Beschränkung auf maximal fünf Spieler ausländischer Herkunft war eine auf die<br />
Staatsangehörigkeit abstellende Benachteiligung ausländischer Profispieler im Vergleich<br />
mit ihren inländischen Kollegen und damit ein Verstoß gegen Art. 39 EGV zu sehen.<br />
Der Begriff des Ausländerklauseln muß aber noch weiter gefaßt werden. Vom Bosman-<br />
Urteil betroffen sind alle Verbandsnormen, die entweder eine Obergrenze bei der Ver-<br />
pflichtung ausländischer Profisportler aus anderen Mitgliedsstaaten festsetzen bzw. auf<br />
die Verpflichtung einer Mindestanzahl deutscher Spieler abstellen, ode r aber den Einsatz<br />
ausländischer Spieler in Wettkampfspielen der Profiligen begrenzen 75 . Erstere Regelun-<br />
gen stellten für die ausländischen Profisportler eine Ungleichbehandlung beim Berufszu-<br />
gang dar, während die letztgenannten zu einer Beschränkung der freien und inländer-<br />
gleichen Berufsausübung führten. Zudem wird auch durch sie der Berufszugang be-<br />
grenzt, da die Vereine Spieler nur in dem Rahmen verpflichten, wie sie auch einsetzen<br />
können 76 . Alle diese Regelungen stellen einen „geradezu klassischen Fall der Diskrimi-<br />
74 § 22 Nr. 2, lit.a) SpielO/DFB a.F.<br />
75 Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.47.<br />
76 Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.47.
31<br />
nierung aufgrund der Staatsangehörigkeit“ 77 und somit einen Verstoß gegen Art. 39 EGV<br />
dar.<br />
2) Die Reaktion des DFB im Bereich der Ausländerklauseln<br />
Die Reaktion des DFB auf das Bosman-Urteil bestand darin, daß ab der Saison<br />
1996 /1997 Spieler aus den Mitgliedsverbänden der UEFA unbeschränkt in den Bundes-<br />
ligen eingesetzt werden durften, darüber hinaus gem. § 7 I lit.c LSt. n.F. jeder Verein je-<br />
doch mindestens zwölf deutsche Spieler unter Vertrag haben muss. Die Lizenzspielerab-<br />
teilung der Bundesligaklubs bestehen je nach Vereinsgröße aus 20-20 Spielern. Die<br />
Verpflichtung von mehr Spielern ist aus sportlicher Sicht nicht sinnvoll, da pro Spiel nur<br />
elf Spieler zuzüglich Auswechselspieler zum Einsatz kommen können. In wirtschaftlicher<br />
Hinsicht ist die Verpflichtung von mehr Spielern aufgrund hoher Spielergehälter für die<br />
meisten Vereine nicht vertretbar. In Anbetracht dessen, darf jeder Bundesligist zwar be-<br />
liebig viele EU-Ausländer unter Vertrag nehmen, in der Praxis wird aber neben dem Min-<br />
destkontingent von zwölf deutschen Spielern wiederum nur eine begrenzte Anzahl EU-<br />
Ausländer verpflichtet werden. Die Reservierung einer bestimmten Anzahl von Arbeits-<br />
plätzen für deutsche Spieler knüpft zwar unmittelbar nur an die Staatsangehörigkeit der<br />
deutschen Fußballer an. Umgekehrt bedeutet eine solche Regelung aber, daß die aus-<br />
ländischen Spieler aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit stets von einem nicht unerhebli-<br />
chen Teil der Arbeitsplätze ausgeschlossen sind. Im Ergebnis steht somit wieder die zah-<br />
lenmäßige Beschränkung der Beschäftigung ausländischer Spieler 78 , die den Tatbestand<br />
de r offenen Diskriminierung gem. Art. 39 EGV erfüllt.<br />
3) Der Sportvorbehalt des EuGH<br />
Es stellt sich die Frage, ob unter oben angeführten Aspekten die Nationalmannschaften<br />
nicht auch für ausländische Spieler geöffnet werden müßten. Dies erscheint auf den er-<br />
sten Blick ungewöhnlich, ist aber nur konsequent, denn gerade in Länderspielen beein-<br />
flussen die Profis ihren Marktwert aufgrund des größeren öffentlichen Interesse in be-<br />
sonderer Weise. Außerdem werden, besonders bei größeren Turnieren wie Welt- oder<br />
77 GA Lenz, Schlußanträge, EuGRZ 1995, S.459ff; S.478.
32<br />
Europameisterschaften auch Prämien gezahlt. Der Anwendungsbereich von Art. 2 EGV<br />
ist somit gegeben, eine wirtschaftliche Tätigkeit liegt vor. In konsequenter Anwendung<br />
muss somit in Regelungen, die den Ausschluß ausländischer Spieler aus den National-<br />
mannschaften vorsehen, ein Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit gem. Art. 49 EGV<br />
gesehen werden, wenn der Spieler entgeltlich, also für Prämienzahlung an Länderspie-<br />
len teilnimmt. Fehlt es an einem Entgelt, so liegt ein Verstoß gegen das allgemeine Dis-<br />
kriminierungsverbot des Art. 12 EGV vor. Der Länderspieleinsatz ist dann dennoch als<br />
wirtschaftliche Betätigung anzusehen, weil er die beruflichen Perspektiven des einge-<br />
setzten Sportlers verbessert 79 . Der EuGH tritt dem entgegen, indem er im Rahmen eines<br />
„Sportvorbehaltes“ 80 feststellt, dass es dem Diskriminierungsverbot nicht entgegenstehe,<br />
“wenn ausländische Spieler von bestimmten Begegnungen aus nichtwirtschaftlichen<br />
Gründen ausgeschlossen werden, die mit dem spezifischen Charakter und Rahmen die-<br />
ser Begegnungen zusammenhängen, und deshalb nur den Sport als solchen betref-<br />
fen“ 81 , wie es bei Spielen der Nationalmannschaften verschiedener Länder der Fall ist.<br />
Jedoch dürfe diese Beschränkung der Freizügigkeit nicht weiter gehen, als ihr Zweck es<br />
erfordere 82 . Der EuGH hat somit in ständiger Rechtsprechung anerkannt, dass die Ver-<br />
tragsbestimmungen über die Freizügigkeit im Rahmen von Länderspielen einem Aus-<br />
schluß ausländischer Spieler nicht entgegenstehen 83 .<br />
IV) Das Problem der Inländerdiskriminierung<br />
Durch das Bosman-Urteil erfolgte in allen betroffenen Nationalverbänden eine Aufspal-<br />
tung des Spielermarktes in transferentschädigungsfreie Wechsel bei rein EU-relevanten<br />
und in transferentschädigungspflichtige Wechsel bei inländischen Spielerwechseln.<br />
Grund hierfür war, daß die Anwendung von Art. 39 EGV einen „zwischenstaatlichen Be-<br />
zug“ erfordert 84 , der eben nur bei einem grenzüberschreitenden Wechsel gegeben ist.<br />
Dies führte jedoch im Umkehrschluß dazu, daß inländische Spieler im Gegensatz zu ih-<br />
78<br />
Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.47.<br />
79<br />
Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.132.<br />
80<br />
Palme/Hepp – Schwab/Wilske, JZ 1994, S.343ff, S.344.<br />
81<br />
EuGH Slg. 1976, S.1333ff, S.1340, Dona.<br />
82<br />
EuGH Slg. 1976, S.1333ff, S.1340, Dona; EuGH, Rs. C-415/93, Bosman, Slg. I-1995, S.4921ff, S.5076; vgl. EuGH<br />
SpuRt 2000, S.148ff, S.151.<br />
83<br />
Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.47.
33<br />
ren EU-ausländischen Kollegen potentiellen Interessenten weiterhin nur ablösepflichtig<br />
zur Verfügung standen. Dies stellt zweifelsohne einen Wettbewerbsnachteil der inländi-<br />
schen Spieler dar, zumal die Einsetzbarkeit der ausländischen Spieler durch den Wegfall<br />
der Ausländerklauseln erheblich gesteigert wurde 85 . Diese Art von Inländerdiskriminie-<br />
rung hat der EuGH bisher als irrelevant angesehen. Begründet wird dies durch das Ex-<br />
klusivverhältnis von Gemeinschaftsrecht gegenüber dem nationalen Recht 86 . Das natio-<br />
nale Recht wird jedenfalls dann nicht vom Gemeinschaftsrecht verdrängt, sofern eine<br />
Benachteiligung außerhalb des Anwendungsbereichs des Gemeinschaftsrechts erfolgt 87 .<br />
Es muss daher auf nationale Grundrechte der betroffenen Inländer zurückgegriffen wer-<br />
den, in Deutschland läge Art. 3 GG in Zusammenhan g mit Art. 12 I GG nahe. Zweifelhaft<br />
erscheint allerdings die Anwendbarkeit von Art. 3 GG auf die Inländerdiskriminierung, da<br />
diese letztlich auf die Diskrepanz zwischen gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen und<br />
nationalem Verbandsrecht zurückzuführen ist 88 . Dieser Diskussion wurde in Deutschland<br />
mit der Anpassung der Sportverbandsregeln nach den Vorgaben des „Bosman-„ und des<br />
„Kienass-Urteils“ jedoch die praktische Bedeutung entzogen.<br />
V: Die ökonomischen Konsequenzen für die Vereine<br />
Für die Vereine hatte die Transferentschädigung in zweierlei Hinsicht Bedeutung. Zum<br />
einen erschien die Transferentschädigung als wirtschaftlicher Wert in den Vereinsbilan-<br />
zen, zum zweiten diente sie als Gläubigersicherheit zur Finanzierung des Spielbetriebs<br />
der einzelnen Vereine 89 .<br />
1.)In steuerrechtlicher Hinsicht wurden die Spieler in der Vergangenheit als „Kapital“ der<br />
Vereine eingestuft. Bilanztechnisch äußerte sich das Ganze dergestalt, daß die gezahl-<br />
ten Transferentschädigungen für einen Spieler als Anschaffungskosten eines abnutzba-<br />
ren Wirtschaftsguts des Anlagevermögens behandelt wurden 90 . Wie der BFH bestätigt<br />
84<br />
Vgl. EuGH Rs. C-332/90, Stehen, Slg. I-1992, S.341ff, :357.<br />
85<br />
Westermann, DZWiR 1996, S.82ff, S.83.<br />
86<br />
EuGH Rs. 175/78, Saunders, Slg. 1979, S.1129ff, S.1135; Rs.35/82,36/82, Morson, Slg. 1982,S.3723ff, S.3726;<br />
Schilling, JZ 1994, S.8ff, S.9.<br />
87<br />
Vgl. Streinz, Europarecht, Rn.172ff, Oppermann, Europarecht, Rn.525ff.<br />
88<br />
Schroeder, JZ 1996, S.254ff, S.256.<br />
89<br />
Trommer, Transferregelungen, S.41.<br />
90<br />
Vgl. Erlass des Fin.Min. Nordrh.West. v. 26.7.1974, DB 1974, S.2085.
34<br />
hat 91 , stellt die für den einzelnen Spieler erteilte, entgeltlich erworbene Spielerlaubnis<br />
„ein der Konzession ähnliches Recht bzw. einen der Konzession ähnlichen Wert“ dar 92 ,<br />
das bzw. der als immaterielles Wirtschaftsgut auf der Aktivseite gem. § 266 II lit. a I Nr.1<br />
HGB zu bilanzieren ist 93 . Die selbständige Bewertbarkeit und die Verkehrsfähigkeit der<br />
Spielerlaubnis wurde im Hinblick auf die Praxis der Transferentschädigung bejaht 94 . Als<br />
abnutzbares Wirtschaftsgut unterliegt die aktivierte Spielerlaubnis somit der Absetzung<br />
für Abnutzung nach § 8I<br />
91 BFH NJW 1993, S.222ff.<br />
92 BFH NJW 1993, S.222.<br />
93 Arens, SpuRt 1996, S.39ff, S.41f; Wertenbruch, EuZW 1996, S.91ff, S.92.<br />
94 Vgl.Hüttemann, DStR 1994, S.490.
35<br />
KStG i.V.m. § 7 I S.2 EstG. Mit dem Bosman-Urteil fielen dies immateriellen Wirtschafts-<br />
güter als Aktivposten in der Bilanz plötzlich weg, mit der Folge eines nicht unbedeuten-<br />
den Ausfalls des Aktivvermögens, die zu einer Überschuldung der Vereine führte. Im Fal-<br />
le einer ertragssteuerlichen Überschuldung ist jeder verantwortungsbewußte Vereinsvor-<br />
stand ((gem. § 9 Nr.2 lit a LSt. ))verpflichtet, zu prüfen, ob auch konkursrechtlich betrach-<br />
tet eine Überschuldung vorliegt. Nach Aussage von Mayer-Vorfelder(FAZ <strong>18</strong>.1.97 S.24)<br />
hätten 1997 zehn Bundesligaklubs nach Aktienrecht Konkurs anmelden müssen, was<br />
jedoch nicht erfolgt ist.<br />
2) Gerade im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens war es gängige Praxis, zur Deckung<br />
der Verbindlichkeiten und damit zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit<br />
zukünftige Transferentschädigungen als Kreditsicherheit abzutreten 95 . Dabei griffen sie<br />
au f den der Spielerlaubnis innewohnenden Wert, der potentiellen, künftigen Transferent-<br />
schädigungsleistung für einen hypothetischen zukünftigen Vereinswechsel zurück 96 . Die-<br />
se Sicherungsabtretung vor Forderungsentstehung war nach zivilrechtlichen Abtretungs-<br />
vorschriften zulässig, da die Höhe der Transferentschädigung und damit der Forderung<br />
nach den Richtlinien des DFB bestimmbar war. Somit konnten viele Vereine den Nach-<br />
weis ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, der zur Erteilung der Lizenz durch den DFB<br />
notwendig war, dadurch erbringen, daß sie zukünftige Transferentschädigungen als<br />
Gläubigersicherheit verwendeten. Dies ist mit Abschaffung der Transferentschädigung<br />
nicht mehr möglich. Der vorhergesagte finanzielle Zusammenbruch vieler Profivereine ist<br />
jedoch bislang ausgeblieben. Gerade die großen Vereine haben es verstanden , dieses<br />
Defizit besonders aus dem Topf der gestiegenen TV-Einnahmen und im Rahmen des<br />
Merchandising zu kompensieren.<br />
D: Auswirkungen des Bosman-Urteils auf den Amateurfußball<br />
Wie oben bereits aufgezeigt, sind der direkten Anwendbarkeit von Art. 39 EGV Grenzen<br />
gesetzt. Zum einen muß die Gemeinschaft überhaupt die Regelungskompetenz im fragli-<br />
chen Bereich haben, zum anderen muß ein zwischenstaatlicher Bezug vorhanden sein.<br />
Ein zwischenstaatlicher Bezug ist beim Amateurfußball in der Regel nicht zu konstruie-<br />
95 Trommer, Transferregelungen, S.43.
36<br />
ren. Seine Regelungskompetenz für den Profisport begründet der EuGH damit, dass es<br />
sich beim Profisport um einen Teil des Wirtschaftslebens i.S.v. Art. 2 EGV handelt. Dies<br />
ist jedoch beim Amateur- und Freizeitsport im klassischen Sinne nicht der Fall, da dieser<br />
seitens der Spieler in der Regel unentgeltlich erfolgt. Eine direkte Anwendung von Art. 39<br />
EGV auf den Amateurfußball scheidet somit aus. Dennoch bestehen zuminde st der<br />
Grundlage nach Parallelen. Auch im Amateurbereich war ursprünglich beim Vereins-<br />
wechsel eine Ausbildungs- und Förderungsentschädigung an den abgebenden Verein zu<br />
zahlen. Die Höhe dieser Summe berechnete sich nach einem verbandsrechtlichen<br />
Schlüssel, der maßgeblich auf die Spielklasse der abgebenden und der aufnehmenden<br />
Vereine abstellte. So war beispielsweise in Bayern für einen Kreisklassenspieler, der in<br />
die Regionalliga wechseln wollte, eine Entschädigung in Höhe von 10.000 Mark an den<br />
abgebenden Verein zu entrichten. Diese Summe erhöhte sich um die Hälfte, falls der<br />
aufnehmende Verein keine Jugendmannschaft im Spielbetrieb hatte und halbierte sich<br />
um die Hälfte, falls der abzugebende Spieler weniger als 24 Monate für seinen alten Ver-<br />
ein spielberechtigt war. Mit seinem Urteil vom 27.9.1999 erklärte der BGH diese<br />
Wechselpraxis im Hinblick auf die entsprechenden Regelungen des Niedersächsischen<br />
Fußballverbandes für nichtig 97 . Er sah darin unter bestimmten Umständen eine Be-<br />
schränkung der Berufsfreiheit gem. Art. 12 I GG. Dies sei immer dann der Fall, wenn<br />
es sich bei dem wechselwilligen Spieler um einen Vertragsamateur handelt. Diese erhal-<br />
ten für ihre Tätigkeit – anders als „reine“ Amateure nicht lediglich gem. § 15 Nr.1 Spie-<br />
lO/DFB eine Aufwandsentschädigung. Vielmehr üben Vertragsamateure gem. § 15 Nr.2<br />
SpielO/DFB „das Fußballspiel mit vertraglicher Bindung gegen Entgelt“ aus und erzielen<br />
da mit Einkommen für den Lebensunterhalt 98 . Der BGH hielt es dabei nicht für bedeut-<br />
sam, daß im Amateurbereich die Erteilung der Spielerlaubnis unabhängig von der Zah-<br />
lung der Ausbildungs- und Förderungsentschädigung erfolgt. Vielmehr sei auf die fakti-<br />
sche Wirkung des Entschädigungsbetrages als finanzielle Verpflichtung für den aufneh-<br />
menden Verein abzustellen, der sich zudem bei Nichtzahlung einer Ahndung durch die<br />
96 Wertenbruch, ZIP 1993, S.1292ff; Westerkamp, Ablöseentschädigungen, S.159ff.<br />
97 Vgl. BGH NJW 1999, S.3352ff.<br />
98 BGH NJW 1999, S.3352ff, S.3352.
37<br />
Verbandsgerichte wegen unsportlichen Verhaltens ausgesetzt sieht 99 . Dies führe dazu,<br />
daß die Verbandsregeln für den Vertragsamateur wie eine objektive Zulassungschranke<br />
im Hinblick auf seine Berufsfreiheit wirke 100 . Eine Rechtfertigung, die im Rahmen der Be-<br />
rufsfreiheit nur im Rahmen der „Abwehr nachweisbarer oder höchstwahrscheinlicher<br />
schwerer Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut“ 101 möglich ist, sah<br />
de r BGH bei den in Betracht kommenden Rechten in Anlehnung an die Rechtsprechung<br />
des EuGH zum Fall Bosman als nicht gegeben an. Bei „normalen“ Amateurspielern, die<br />
nicht den Status des Vertragsamateurs genießen, bleibt das Wechselverfahren unverän-<br />
dert. Wird ein solcher Amateurspieler jedoch Vertragsamateur, so kann er unabhängig<br />
von Wechselfristen gem. § 53 Nr.1 SpielO/BFV bis zum 15.1. jedes Jahres unter soforti-<br />
ger Erteilung der Spielerlaubnis den Verein wechseln. Für den Status des Vertragsama-<br />
teurs wird gem. § 2 Mustervertrag für den Vertragsamateur des BFV ein monatliches<br />
Mindestgehalt von 200,- DM, zzgl. der zu entrichtenden Sozialabgaben vorgeschrieben.<br />
Nur wenn der Amateurvertrag zwischen Verein und Spieler innerhalb von drei Monaten<br />
au fgelöst wird, behält der abgebende Verein einen Anspruch auf Ausbildungsentschädi-<br />
gung 102 . Diese Regelung bietet große Mißbrauchsmöglichkeiten. Dazu ein Beispiel: Eine<br />
Lande sligamannschaft möchte einen Spieler aus der Kreisliga verpflichten. Im Normalfall<br />
wären für den Wechsel eine Ausbildungs- und Förderungsentschädigung in Höhe von<br />
5.000,- DM an den abgebenden Verein zu entrichten. Dabei muß berücksichtigt werden,<br />
daß in der Landesliga die Zahlung von sog. „Aufwandsentschädigungen“ an den Spieler<br />
durchaus üblich und gem. § 15 Nr.1 SpielO/DFB auch zulässig sind. Der Betrag von mo-<br />
natlich 200,- DM dürfte in der Landesliga wohl eher als Untergrenze anzusehen sein.<br />
Verpflichtet der interessierte Verein den Spieler jedoch als Vertragsamateur und verein-<br />
bart die „Aufwandsentschädigung“ als monatliches Mindestgehalt, so spart er sich die<br />
Ausbildungsentschädigung. Der Spieler stimmt dem gerne zu, erhält er doch eine ver-<br />
traglich fixierten monatlichen Gehaltsanspruch und daneben meist ein ordentliches<br />
Handgeld, sein neuer Verein hat sich ja die Entschädigungssumme gespart. Der abge-<br />
bende Verein geht leer aus. Will man das Beispiel auf die Spitze treiben, so lösen der<br />
99 BGH NJW 1999, S.3352ff, S.3353.<br />
100 BGH NJW 1999, S.3352ff, S.3353.<br />
101 BVerfGE 7, S.377ff, S.408f.
38<br />
Spieler und sein neuer Verein den Amateurvertrag nach drei Monaten Laufzeit einver-<br />
nehmlich wieder auf. Der Spieler bleibt seinem neuen Verein als „normaler“<br />
Amateurspieler erhalten und der Verein spart sich die Sozialabgaben. Leer geht<br />
wiederum der ehema<br />
lige Verein des Spielers aus. Wenngleich die Wiederauflösung des Amateurvertrages<br />
nach drei Monaten vom zuständigen Finanzamt sicherlich nicht ohne eingehende „Über-<br />
prüfung“ hingenommen werden dürfte und deshalb diese Vorgehensweise sicher nicht<br />
den Regelfall darstellt, so hat die neue Regelung im Amateurbereich doch schon erhebli-<br />
che Auswirkungen gezeigt. So bezifferte die BFV-Pressestelle 103 die Zahl der Vertrags-<br />
amateure zum 19.10.2000 auf exakt 1532, ein Anstieg von monatlich durchschnittlich<br />
200 neuen Vertragsamateuren sei in Zukunft zu erwarten 104 .<br />
E: Wirkung europarechtlicher Rechtsnormen auf verbandsinterne Regelungen<br />
I) Sport als Bestandteil der Kultur im Sinne von Art. 151 EGV<br />
Eine Kontrolle verbandsrechtlicher Regelungen anhand Vorschriften des EGV setzt vor-<br />
aus, daß die Verbandsnormen an den Grundsätzen des für alle geltenden Rechts zu<br />
messen sind. Fraglich ist , ob für den Bereich des Profisports eine Bereichsausnahme 105<br />
von den Vorschriften des Gemeinschaftsrechts anzuerkennen ist, d.h. ob der Bereich<br />
de s Profisports vom EG-Recht ausgenommen ist. Nach Rechtsprechung des EuGH un-<br />
terfällt der Sport insoweit dem EG-Recht, als er einen Teil des Wirtschaftslebens im Sin-<br />
ne von Art. 2 EGV ausmacht 106 . Dies ist beim Profisport unproblematisch der Fall. Eine<br />
differenzierte Anwendung des europäischen Rechts im Bereich des Sports könnte unter<br />
dem Aspekt der Bedeutung des Sports als kulturelle Erscheinungsform geboten sein.<br />
Der Sport wird üblicherweise unter einen erweiterten Kulturbegriff subsumiert 107 . Mitunter<br />
könnte somit auf Art. 151 EGV zurückgegriffen werden. Dem wird entgegengehalten,<br />
zumindest der Leistungssport sei „aus dem Kontext der kulturellen Angelegenheiten he-<br />
102 Vgl. § 5 Nr.1 Mustervertrag des BFV für den Vertragsamateur.<br />
103 Bayernsport, Nr.44/2000 S.22.<br />
104 Bayernsport, Nr.44/2000 S.22.<br />
105 Hilf, NJW 19984, S.517ff, S.520.<br />
106 EuGH, Rs. 13/76, Dona/Mantero, Slg. 1976, S.1333ff, S.1340.<br />
107 Scholz/Aulehner, SpuRt 1996, S.44; Palme, JZ 1996, S.238f.; Häberle, Thieme-FS, S.40.
39<br />
rausgewachsen“ und mit den Maßstäben des Wirtschaftsrechts zu beurteilen 108 . Aber<br />
selbst wenn man den Sport insgesamt als Bestandteil der Kultur ansieht und die Vor-<br />
schrift des Art. 151 EGV als einschlägig erachtet, ist fraglich, ob dies geeignet ist, die<br />
Vorschriften des EGV im Bereich des Profisports zu verdrängen. Zwar sind die Gemein-<br />
schaftsbefugnisse im Bereich der Kultur gem. Art. 151 EGV beschränkt. Im Anwen-<br />
dungsbereich des Art. 39 EGV kann jedoch über Art. 151 IV EGV, wonach die Gemein-<br />
schaft die kulturellen Aspekte bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen des<br />
Vertrages Rechnung trägt, allenfalls eine Berücksichtigung sportlicher Belange erfol-<br />
gen 109 , nicht jedoch Art. 39 EGV umgangen werden. Der Sport als Erscheinungsform der<br />
Kultur in den Mitgliedstaaten kann also, soweit die Grundfreiheiten der Sportler betroffen<br />
sind, keinesfalls zu einer Verdrängung des EG-Rechts im Bereich des Profisports füh-<br />
ren 110 .<br />
II) Vorrang des Verbandsrechts unter dem Gesichtspunkt der Verbandsautonomie<br />
Der DFB ist, wie andere deutsche Sportverbände ein eingetragener nichtwirtschaftlicher<br />
Verein gem. § 21 BGB, der seine inneren Angelegenheiten gem. § 25 BGB durch Sat-<br />
zungen regelt. Die verfassungsrechtliche Gewährleistung der Vereins- und Verbandsau-<br />
tonomie ergibt sich aus der Vereinigungsfreiheit gem. Art. 9 GG bzw. auf europäischer<br />
Ebene aus Art. 11 EMRK, gem. Art. 6 II EUV ein von der Gemeinschaft anerkanntes<br />
Grundrecht. Das aus der Verbandsautonomie fließende Recht zur Rechtsetzung und<br />
Selbstverwaltung im Rahmen des Verbandszwecks leitet sich also aus staatlichem Recht<br />
ab. Dadurch ist der Vorrang des staatlichen Rechts einschließlich des europäischen<br />
Rechts vor dem Verbandsrecht bereits vorgezeichnet. Eingriffe in die Verbandsautono-<br />
mie dürfen aber ihrerseits die Verbandsautonomie nicht unverhältnismäßig einschrän-<br />
ken, indem sie etwa zu einer Bestandsgefährdung führen. Die Bedeutung von Transfer-<br />
bestimmungen und Ausländerklauseln ist jedoch nicht so entscheidend, daß der Bestand<br />
108 Westermann, Ritter-FS, S.790.<br />
109 Palme, JZ 1996, S.238ff, S.240.<br />
110 Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.21.
40<br />
der Sportverbände gefährdet oder deren Rechtsetzungskompetenz im Bereich der Auf-<br />
rechterhaltung der sportlichen Ordnung im Kern berührt wären 111 .<br />
III) Begrenzung des Geltungsbereichs des EG-Rechtes im Sport durch das Subsi-<br />
diariätsprinzip<br />
Das Subsidiaritätsprinzip als Kompetenzausübungsnorm 112 regelt, ob und wie die Ge-<br />
meinschaftsorgane im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten tätig werden dürfen. Das Subsi-<br />
diaritätsprinzip entfalte also Wirkung zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaa-<br />
ten, es gilt nicht zwischen der Gemeinschaft und privaten Organisationen, wie den<br />
Sportverbänden. Das Subsidiaritätsprinzip als eine Zuständigkeitsregelung zwischen<br />
Gemeinschaft und Mitgliedstaaten ist somit bereits seinem Regelungsinhalt nach nicht<br />
geeignet, die Subsumption eines Sachverhaltes unter EG-Recht zu verhindern 113 . Au-<br />
ßerdem muß berücksichtigt werden, daß im Bereich der Grundfreiheiten, also auch des<br />
Art. 39 EGV das Subsidiaritätsprinzip gem. Art. 5 EGV nicht anwendbar ist, da es sich<br />
hierbei um einen Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit der Gemeinschaft han-<br />
delt 114 .<br />
IV) Der Grundsatz des Vertrauensschutzes<br />
Der Anwendung des EU-Rechts im Bereich des Profifußballs könnte der allgemeine<br />
rechtsstaatliche Grundsatz des Vertrauensschutzes entgegenstehen 115 . Die UEFA ver-<br />
wies im Fall Bosman darauf, daß die bis dahin praktizierte Ausländerregelung mit der<br />
EG-Kommission ausgearbeitet und regelmäßig entsprechend der Neuentwicklung der<br />
Gemeinschaftspoltik zu revidieren sei 116 . Dies könnte so zu verstehen sein, daß es sich<br />
be i der bisher praktizierten Regelung um eine bindende Einigung mit der Kommission<br />
hande lte, und somit ein Vertrauenstatbestand geschaffen worden sei. Gegen einen Ver-<br />
trauenstatbestand sprechen zunächst einmal die Urteile des EuGH in den Sachen Wal-<br />
rave und Dona, die, wenn sie auch noch nicht zu einer endgültigen Klärung geführt ha-<br />
111 Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.22.<br />
112 Streinz, Europarecht, Rn.145a.<br />
113 Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.24.<br />
114 Hilf/Pache, NJW 1996, S.1169ff, S.1177, Palme, JZ 1996, S.238ff, S.241.<br />
115 Scholz/Aulehner, SpuRt 1996, S.44ff, S.46.
41<br />
ben, doch erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ausländerklauseln hervorgeru-<br />
fen haben müssen, da der EuGH darin die Zulässigkeit von Ausländerbeschränkungen<br />
im Sport an enge Voraussetzungen geknüpft hat. Weiter ist die Kommission gar nicht be-<br />
fugt, Garantien hinsichtlich der Vereinbarkeit einer bestimmten Verhaltens mit EU-Recht<br />
zu geben 117 . Weiter hatte die Kommission mehrmals ausdrücklich betont, daß es ihr,<br />
wenn auch schrittweise, um die völlige Abschaffung der Ausländerklauseln ging 1<strong>18</strong> . Ein<br />
schützenswertes Vertrauen, das zu einer Legitimierung der Ausländerklauseln im Profi-<br />
fußball geführt haben könnte, ist somit abzulehnen.<br />
V) Sportrecht - Sonderrecht ?<br />
Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen gibt es kein in sich geschlossenes Sport-<br />
recht. Weder im Grundgesetz noch im EGV findet sich eine Vorschrift, die den Sport un-<br />
mittelbar betrifft. Dennoch wirkt das für alle geltende Recht in den Sportbereich hinein,<br />
der nach ganz herrschender Meinung nicht als rechtsfreier Raum angesehen werden<br />
kann 119 . Insbesondere im Profisport berühren einzelne Verbandsregeln wie die Transfer-<br />
bestimmungen fundamentale Rechtspositionen der Sportler, deren berufliche Tätigkeit<br />
von einem starken Abhängigkeitsverhältnis nicht nur zu ihrem Verein, sondern auch zum<br />
jeweiligen Verband geprägt ist 120 . Entgegen der Auffassung vieler Sportfunktionäre kann<br />
nicht mehr davon ausgegangen werden, daß sich alle Angelegenheiten durch interne<br />
Verbandsregeln und Verbandsgerichtsentscheidungen regeln lassen 121 . Im Kernbereich<br />
geht es um die Frage, inwieweit das Verbandsrecht, dem sich die Sportler und Vereine<br />
un terwerfen, einer Kontrolle und gegebenenfalls einer Korrektur durch staatliches Recht<br />
zugänglich ist. Die Notwendigkeit einer Beurteilung des Sportbetriebes nach den Grund-<br />
sätzen des allgemeinen Rechts steigt in dem Maße, in dem die Ausübung des Sportes<br />
zur wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit wird 122 . Die Verträge des Berufssportlers<br />
und damit seine persönliche Rechtsstellung werden weitgehend durch das Verbands-<br />
116<br />
EuGH, Rs. C-415/93, Bosman, Slg. I-1995, S.4921ff, S.5076.<br />
117<br />
EuGH, Rs. C-415/93, Bosman, Slg. I-1995, S.4921ff, S.5078, Hilf/Pache, NJW 1996, S.1169ff, S.1173.<br />
1<strong>18</strong><br />
Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.28.<br />
119<br />
Klose, Die Rolle des Sports bei der Europäischen Einigung, S.173; Burmeister, DÖV 1978, S.1ff, S.4.<br />
120<br />
Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.9.<br />
121<br />
Reuter, DZWir 1996, S.1ff.<br />
122<br />
Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.9.
42<br />
recht mitbestimmt. Im Hinblick auf die Monopolstellung der Sportverbände und der dar-<br />
aus resultierenden Mißbrauchsgefahr ihrer Verbandsmacht muß eine Heranziehung all-<br />
gemeiner Rechtsgrundsätze zulässig sein – schon um einen Interessenausgleich zwi-<br />
schen Verband und Sportler erzielen zu können. Andrerseits muß zugunsten der Ver-<br />
bände die verfassungsrechtlich gewährleistete Vereinigungsfreiheit und damit verbunden<br />
die Ordnungsfunktion im Bereich der Regelung des Sportbetriebs berücksichtigt wer-<br />
den 123 . Es kann somit ein Hineinwirken des staatlichen Rechts in das Sportverbandsrecht<br />
nicht ernsthaft bestritten werden.<br />
VI) Prüfungsmaßstab im Bereich des Sportverbandsrechts<br />
Fraglich ist, welchen Prüfungsmaßstäben des materiellen Rechts Verbandsnormen, die<br />
die Rechtsstellung der Sportler betreffen, gerecht werden müssen. In Frage kämen im<br />
deutschen Recht die §§ 9 ff AGBG sowie § 242 BGB 124 . Laut § 23 I AGBG findet das<br />
AGBG jedoch keine Anwendung im Bereich des Gesellschaftsrechts, wozu nach herr-<br />
schender Meinung das Vereinsrecht zählt 125 . Der BGH lehnt eine Anwendung des AGBG<br />
mit der Begründung ab, daß die Interessenlagen zwischen dem auf den Leistungsaus-<br />
tausch ausgerichteten Verhältnis zwischen Verwender AGB/Kunde und dem auf einen<br />
geregelten und geordneten Sportbetrieb abzielenden Verhältnis zwischen Ver-<br />
band/Mitglied auf der anderen Seite nicht vergleichbar sei 126 .<br />
Da die §§ 9ff AGBG ihrerseits eine Ausprägung des allgemeinen Grundsatzes von Treu<br />
und Glauben darstellen, bietet sich ein Rückgriff auf § 242 als Anknüpfungstatbestand<br />
einer Inhaltskontrolle von Verbandsvorschriften an. Diese Ansicht hat sich mittlerweile<br />
du rchgesetzt 127 . Eine auf § 242 gestützte Inhaltskontrolle eröffnet im Rahmen der Lehre<br />
von der mittelbaren Wirkung der Grundrechte im Privatrecht zudem die Berücksichtigung<br />
der Grundrechte der Sportler im Verhältnis zu ihrem Verband 128 , was zu einer Korrektur<br />
verbandsrechtlicher Regelungen führen kann. Unter diesem rechtlichen Gesichtspunkt<br />
123 Reuter, NJW 1983, S.649ff, S.652.<br />
124 Vgl. Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.10.<br />
125 Pal-Heinrichs, AGBG, §§ 23,24 Rn.4.<br />
126 BGH NJW 1995, S.583ff, S.585.<br />
127 Vgl. Pal-Heinrichs, BGB § 25, Rn.9.<br />
128 Vieweg, Normsetzung und –anwendung deutscher und nationaler Verbände, S.235.
43<br />
kommt das OLG Frankfurt/M. 129 in seiner Prüfung der Rechtmäßigkeit der Ausländer-<br />
klausel des Deutschen Tischtennisbundes zu einer Berücksichtigung der Arbeitnehmer-<br />
freizügigkeit gem. Art.39 EGV über die Vorschrift des § 242 BGB. Dieser dogmatische<br />
Ansatz erscheint jedo ch zweifelhaft, da er die Lehre von der mittelbaren Drittwirkung der<br />
Grundrecht auf die Grundfreiheiten des Gemeinschaftsrechts überträgt 130 . Der EuGH<br />
geht jedoch ausdrücklich von einer unmittelbaren Drittwirkung der Grundfreiheiten des<br />
EGV im Privatrechtsverkehr aus 131 , so daß aufgrund des Vorrangs des Gemeinschafts-<br />
rechts einer Anknüpfung an § 242 BGB gar nicht mehr bedarf.<br />
VII) Rechtsfolgen eines Verstoßes<br />
Fraglich ist, welche Rechtsfolgen ein Verstoß gegen Art. 39 EGV für den Bestand ver-<br />
bandsrechtlicher Regelungen hat. Rechtsfolgen können sich dabei aus dem Gemein-<br />
schaftsrecht, aber auch aus dem nationalen Recht ergeben.<br />
1)Grundsätzlich kommt dem Gemeinschaftsrecht gegenüber dem nationalen Rechtsord-<br />
nungen Vorrangwirkung zu, mit der Folge der Unanwendbarkeit nationaler Vorschriften,<br />
die gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen 132 . Die Ausländerklauseln im nationalen Ver-<br />
bandsrecht werden daher, soweit ein Verstoß gegen Art. 39 EGV vorliegt, überwiegend<br />
für unanwendbar gehalten 133 .<br />
2)Denkbar erscheint darüber hinaus eine Nichtigkeit gem. § 134 BGB. Dann müßte Art.<br />
39 II EGV Verbotsgesetz i.S.v. § 134 BGB sein. Hat der BGH dies noch 1959 in einem<br />
Urteil unter Hinweis auf den öffentlich rechtlichen Charakter des Art. 4 EGKSV abge-<br />
lehnt, so ist dies doch heute nach ganz herrschender Meinung 134 im Hinblick auf die all-<br />
gemein anerkannte Rechtsprechung des EuGH zur Drittwirkung der Grundfreiheiten des<br />
EGV der Fall. Ausländerklauseln, die gegen Art. 39 EGV verstoßen, sind somit gem. §<br />
134 BGB nichtig, ohne dass es der förmlichen Änderung der einschlägigen Satzungsbe-<br />
stimmungen durch die Verbände bedarf 135 . Auf die Nichtigkeit können sich nicht nur die<br />
129<br />
OLG Frankfurt/M., NJW RR 1994, S.2170.<br />
130<br />
Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.13.<br />
131<br />
EuGH, Rs. C-415/93, Bosman, Slg. I-1995, S.4921ff, S.5067.<br />
132<br />
Oppermann, Europarecht, Rn.525ff.<br />
133<br />
Palme/Hepp – Schwab/Wilske, JZ 1994, S.343ff, S.344; Fischer, SpuRt 1994, S.174ff, S.175.<br />
134<br />
Vgl. Pal-Heinrichs, § 134 Rn.2<br />
135<br />
Heidersdorf, Ausländerklauseln im Profisport, S.73.
44<br />
Spieler, sondern auch die Vereine berufen, verbandsinterne Strafen wie Punktabzüge<br />
wären unzulässig, die Freizügigkeit würde leerlaufen, wenn sich die Vereine nicht darauf<br />
berufen dürfen 136 .<br />
F:Anforderungen an ein neues Transfersystem<br />
Die Anforderungen an ein neues Transfersystem sind vielschichtig. Sie lassen sich in die<br />
Obergruppen der rechtlichen und der tatsächlichen Voraussetzungen unterteilen 137 .<br />
I) Anforderungen in rechtlicher Hinsicht<br />
1) Die Eigenschaft des Berufsfußballs als Teil des Wirtschaftslebens im Sinne des Art. 2<br />
EGV läßt sich ernsthaft nicht bestreiten, auch über die in Art. 151 EGV garantierte Kul-<br />
turautonomie der Mitgliedstaaten läßt sich eine Anwendung der Freizügigkeitsvorschrif-<br />
ten auf den Berufsfußball nicht umgehen. Ein neues Transfersystem muß in gemein-<br />
schaftsrechtlicher Hinsicht die rechtlichen Wertungen des Art. 39 EGV und, falls man Be-<br />
rufsfußballspieler als Unternehmer ansehen möchte, u.U. an Art. 81 EGV orientieren.<br />
2) Im Bereich des Verfassungsrechts muss vor allem Art. 12 I GG berücksichtigt werden,<br />
„der Sport als Beruf ist in das Grundrecht aus Art. 12 I GG hineingewachsen“ 138 . Dem<br />
entgegen steht die in Art. 9 I GG verfassungsrechtlich garantierte Verbandsautonomie,<br />
das dem DFB als Sportverband die Freiheit garantiert, selbständig ein mit der Verfas-<br />
sung zu vereinbarendes Transfersystem einzurichten 139 .<br />
3) Im Bereich des Privat und Arbeitsrechts sind vielschichtige Aspekte zu berücksichti-<br />
gen, besonders die §§ 134, 138 BGB oder die Generalklausel des § 242 BGB 140 .<br />
II) Tatsächliche Anforderungen<br />
Neben den rechtlichen Anforderungen sind an ein Transfersystem auch Anforderungen<br />
tatsächlicher Natur zu stellen, getragen vom Gedanken der Förderung des professionel-<br />
len Fußballsports durch das Transfersystem 141 .<br />
136 Palme/Hepp – Schwab/Wilske, JZ 1994, S.343ff, S.344.<br />
137 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.38<br />
138 Steiner, NJW 1991, S.2729ff, S.2730.<br />
139 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.45.<br />
140 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.46.
1) Ausgleichsfunktion<br />
45<br />
Als neben der Talentförderung wichtigster Aspekt im Rahmen eines Transfersystems<br />
wurde immer wieder die Ausgleichsfunktion gesehen 142 . Ein einen Spieler abgebender<br />
Verein sollte einen finanziellen Ausgleich für den sportlichen Verlust erhalten, und zwar<br />
möglichst durch den aufnehmenden Verein 143 . Daraus resultierend erfolgt ein Finanz-<br />
ausgleich innerhalb aller Lizenzvereine. Es soll also über den Transfer eine Umverteilung<br />
von Geldern von finanziell starken auf finanziell schwache Vereine erfolgen 144 . Das ist in<br />
dieser Form jedoch nicht mehr vertretbar. Der Verlust eines vollständig ausgebildeten<br />
Arbeitnehmers ist im Arbeitsleben ein normaler Vorgang. Es vermag nicht zu überzeu-<br />
gen, warum der aufnehmende Arbeitgeber dem abgebenden Arbeitgeber für diesen Ver-<br />
lust einen Ausgleich zahlen soll 145 . Auch die Funktion des finanziellen Ausgleichs zwi-<br />
schen „reichen“ und „armen“ Lizenzvereinen ist durch das Transfersystem in seiner alten<br />
Form nicht zu erfüllen. Die wenigsten Vereine erzielen aus dem Transfergeschäft Über-<br />
schüsse. Vor der Saison 2000/2001 lediglich sechs Bundesligaclubs 146 . Lediglich Bayer<br />
Leverkusen, jedoch auch nur aufgrund des 40 Mio. DM Transfers des Spielers Emerson<br />
an den AS Rom, erwirtschaftete dabei einen Transferüberschuß von mehr als drei Millio-<br />
nen DM. Die fünf anderen Bunde sligisten blieben unter drei Millionen DM. Diesen Betrag<br />
erhält Energie Cottbus als Schlußlicht in diesem Bereich alljährlich jedoch allein für seine<br />
Trikotwerbung 147 . Beachtet man dabei noch, daß von den sechs Vereinen mit Bayer Le-<br />
verkusen, dem HSV, Schalke 04, Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg fünf ohnehin zu<br />
den finanzstärkeren Vereinen der Liga zählen, so muß man die Eignung eines Transfer-<br />
systems, innerhalb einer Liga für finanziellen Ausgleich zwischen finanzkräftigen und fi-<br />
nanzschwächeren Vereinen zu sorgen, verneinen.<br />
2) Sportliches Gleichgewicht<br />
141 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.36.<br />
142 Malatos, Berufsfußball, S.141.<br />
143 Wertenbruch, NJW 1993, S.179ff, S.<strong>18</strong>0.<br />
144 Hilf/Pache, NJW 1996, S.1169ff, S.1170.<br />
145 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.38.<br />
146 Vgl. Kicker Sonderheft 2000/2001.<br />
147 Kicker Sonderheft 2000/2001, S.177.
46<br />
Mit dem gleichen Argument kann das im Zusammenhang mit der Ausgleichsfunktion im-<br />
mer wieder genannte Kriterium der Notwendigkeit eines Transfersystems zur Aufrechter-<br />
haltung des sportlichen Gleichgewichts innerhalb der Lizenzligen 148 abgelehnt werden.<br />
So erscheint es schon zweifelhaft, ob man überhaupt wirtschaftliche Potenz und sportli-<br />
chen Erfolg in eine zwingende Abhängigkeit zueinander setzen kann. Selbst wenn man<br />
dies annimmt, machen die Transfererlöse, zumindest in der Bundesliga, im Regelfall nur<br />
einen Bruchteil der Einnahmen der Vereine aus. Die finanzielle Potenz der Vereine, und<br />
da mit ihre Fähigkeit Spitzenspieler mit hohem Gehalt zu beschäftigen, basiert mittlerwei-<br />
le zu einem großen Anteil auf Einnahmen aus Fernsehverträgen und Rechtevermark-<br />
tung, die wiederum stark an den sportlichen Erfolg gekoppelt sind. Eine an den Transfer<br />
gekoppelte finanzielle Entschädigung ist zur Aufrechterhaltung des sportlichen Gleich-<br />
gewichts nicht erforderlich, da die<br />
148 Buchner, RdA 1982, S.1ff, S.12.
47<br />
finanzielle Grundversorgung der Vereine über Einnahmen aus anderen Bereichen ge-<br />
währleistet ist.<br />
3) Talentförderung und Machtbalance im Profifußball<br />
a)Es werden immer wieder die negativen Auswirkungen des Bosman-Urteils vor allem im<br />
Hinblick auf die Talentförderung im deutschen Fußball hervorgehoben, und damit die<br />
Forderung verbunden, ein neues Transfersystem müsse diesen Aspekt in besonderem<br />
Maße berücksichtigen 149 . Zum einen würden deutsche Nachwuchsspieler, die den<br />
Sprung in den Profibereich geschafft haben, angesichts der ebenso preisgünstigen Kon-<br />
kurrenz bereits fertig ausgebildeter Spieler aus dem Ausland weniger in den Ligaspielen<br />
eingesetzt 150 . Es würden verstärkt ausländische Spieler verpflichtet, die etwa genauso<br />
viel verdienten wie das deutsche Talent, in ihrer Spielanlage jedoch bereits weiter seien.<br />
Weiterhin seien die Vereine nicht mehr bereit, größere Geldbeträge in den Nachwuchs<br />
zu investieren, denn sie müssen damit rechnen, daß diese Spieler den Verein, wenn sie<br />
fertig ausgebildet sind, ablösefrei verläßt 151 . Bei genauer Betrachtung erscheint jedoch<br />
au ch dieses Argument überzeichnet. So bietet sich den Vereinen die Möglichkeit, ihre<br />
Talente z.B. über langfristige Verträge an sich zu binden. Weiter hat sich in jüngster Zeit<br />
mehrfach gezeigt, daß sich wirklich talentierte junge Spieler auch gegen namhafte aus-<br />
ländische Konkurrenz in Profikadern durchsetzen können. Darüber hinaus entscheiden<br />
letztlich allein sportliche Gesichtspunkte über den Einsatz von Talenten in den Ligaspie-<br />
len, nicht wirtschaftliche oder transferrechtliche. Weiter muß berücksichtigt werden, daß<br />
die Aufgabe der Talentförderung eher den Trainern und den Verbänden als einem neuen<br />
Transfersystem obliegen dürfte.<br />
b) Weiter wird gefordert, ein neues Transfersystem müsse die Machtbalance zwischen<br />
Spielern und Vereinen wieder herstellen. In der momentanen Situation könnten die Profi-<br />
spieler, indem sie interessierte Vereine gegeneinande r ausspielten, Vertragskonditionen<br />
au shandeln, die in Ansehung ihrer spielerischen Qualitäten nicht gerechtfertigt seien 152 .<br />
149 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.51.<br />
150 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.51.<br />
151 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.52.<br />
152 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.56.
48<br />
Mayer-Vorfelder sprach gar von einer „Erpressbarkeit“ der Vereine durch die Spieler 153 .<br />
Dabei wird verkannt, daß es sich bei den zur Diskussion stehende Vorgängen um nor-<br />
male Abläufe des Wirtschaftslebens handelt. Es ist legitim, daß sich ein Arbeitnehmer<br />
nach Ablauf seines Vertrags unter mehreren Interessenten den Arbeitgeber aussucht,<br />
der ihm die besseren finanziellen Perspektiven bietet. Und es spricht nichts dagegen,<br />
daß er seinen alten Arbeitgeber mit einem besseren Angebot die Möglichkeit eröffnet, ihn<br />
zu verbesserten Konditionen weiter zu beschäftigen. Warum gerade im Profisport andere<br />
Maßstäbe gelten sollen als im übrigen Wirtschaftsleben, vermag nicht zu überzeugen.<br />
153 Kicker, 13.11.1997, S.<strong>18</strong>.
G:Reformmodelle im Überblick<br />
I) Kooperationsvertrag<br />
49<br />
Das Modell vom Kooperationsvertrag 154 zielt auf eine Einstufung von Fußballprofis als<br />
selbständige Gewerbetreibende ab. Dies wird dadurch erreicht, daß zwischen Verein und<br />
Spieler kein Arbeits,- sondern ein Kooperationsvertrag, wie z.B. zwischen dem Deut-<br />
schen Tennis Bund und Boris Becker, abgeschlossen wird. Problematisch hierbei ist,<br />
daß über den Lizenzvertrag zwischen Spieler und DFB nicht nur der Verein, sondern<br />
au ch der DFB Arbeitgeberrechte (s.o. A II)gegenüber dem Spieler wahrnimmt und des-<br />
halb als partieller Arbeitgeber der Spieler zu qualifizieren ist 155 . Für eine Rechtsformwahl<br />
bestände angesichts einer eindeutigen Rechtslage somit nach der Rechtsprechung es<br />
BAG kein Raum 156 . Der Berufsfußballspieler muß somit weiterhin als Arbeitnehmer und<br />
nicht als selbständiger Unternehmer qualifiziert werden 157 . Eine Umgehung des Bosman-<br />
Urteils dürfte durch ein derartiges Modell ohnehin nicht möglich sein, da auch die Freizü-<br />
gigkeit der Unternehmer gemeinschaftsrechtlich über Art. 43 EGV gewährleistet wird.<br />
II) Finanzpool<br />
Die Bildung eines Finanzpools wurde bereits von Generalanwalt Lenz in seinen Schluß-<br />
anträgen als mögliches Ersatzsystem vertreten 158 und vom EuGH in das Bosman-Urteil<br />
übernommen 159 . Beim DFB ging man von einem Pool aus, der sich aus Lizenzgebühren<br />
und Mehreinnahmen aus der Fernsehwerbung zusammensetzen sollte 160 . Die zentrale<br />
Vermarktung der Fernsehrechte an Europapokalspielen durch den DFB, kartellrechlich<br />
zumindest fragwürdig, wurde als weitere Einnahmequelle für den Pool ins Auge gefaßt.<br />
Letztlich erscheint die Eignung eines Poolsystems fraglich, da es geschicktes Manage-<br />
ment bestraft, ungeschicktes Wirtschaften jedoch belohnt, da Gewinne in den Pool abge-<br />
führt würden, Verluste jedoch aus dem Pool ausgeglichen würden. 161<br />
154 Vgl. Renz, Sportrecht und Europa, S.191ff, S.201; Niebaum, FAZ 20.01.1996, S.27.<br />
155 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.80.<br />
156 Trommer, Transferregelungen, S.93.<br />
157 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.80.<br />
158 GA Lenz, Schlußanträge, EuGRZ 1995, S.459ff, S.497.<br />
159 EuGH, RS C-415/93, Bosman, Slg. 1995, S.5040ff, S.5072.<br />
160 Hilpert, RdA 1997, S.92ff, S.99.
50<br />
Ergebnis<br />
Durch das „Bosman-Urteil“ wurden die das Transferwesen und die Ausländerklauseln<br />
be treffenden verbandsrechtlichen Normen im Europäischen Fußball plötzlich nichtig.<br />
Zum von vielen befürchteten Kollaps des Profifußballs ist es nicht gekommen und wird<br />
es auch in Zukunft nicht kommen, selbst wenn, wie vom zuständigen EU-Kommissar<br />
Monti beabsichtigt, künftig auch die Transferentschädigung beim Vereinswechseln vor<br />
Vertragsende wegfallen werden. Das Erwirtschaften von Transfererlösen ist für die<br />
meisten Vereine nicht mehr von existenzerhaltender Bedeutung. Vielmehr treten ge-<br />
stiegene Einnahmen aus der Vermarktung von Fernsehrechten und Erträge aus Licen-<br />
cing und Merchandising bei der Finanzierung der Etats der Lizenzvereine in den Vor-<br />
dergrund. Eine weitere Erkenntnis seit „Bosman“ ist, daß man den Sport, gerade da,<br />
wo Profisportler ihren Lebensunterhalt damit verdienen, in Bezug auf über dem Ver-<br />
bandsrecht stehende Rechtsnormen nicht mehr als mehr oder weniger rechtsfreien<br />
Raum ansehen kann, sondern daß die Verbände trotz oder gerade wegen ihrer Ver-<br />
bandsautonomie ihre Satzungen an den Grundsätzen von Verfassungs- und Gemein-<br />
schaftsrecht messen lassen müssen. Dies verdeutlicht der BGH auch im Rahmen sei-<br />
ner Rechtsprechung zum Vertragsamateur.<br />
Bayreuth, <strong>18</strong>.12.2000<br />
<strong>Sebastian</strong> <strong>Meier</strong><br />
161 Gebhardt, Modelle für die Reform des Transfersystems, S.84.