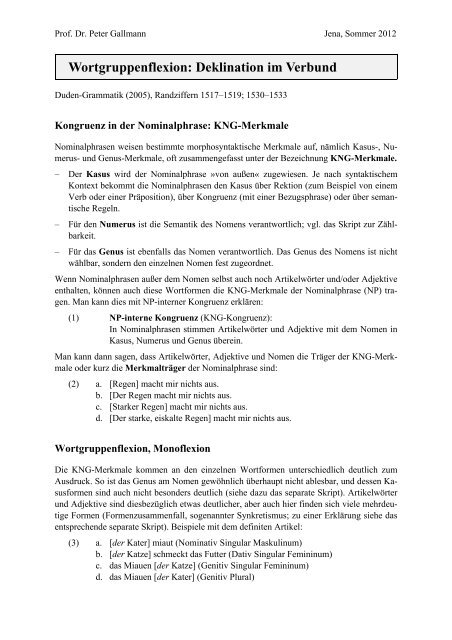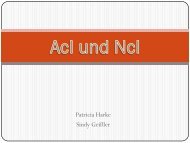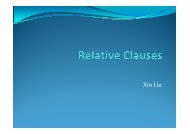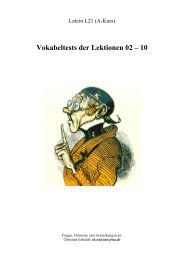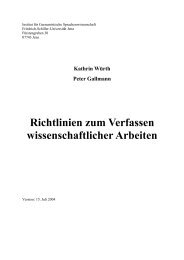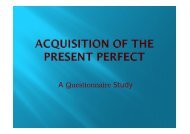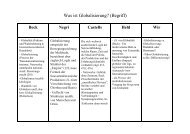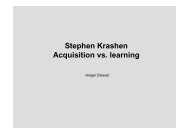Wortgruppenflexion: Deklination im Verbund
Wortgruppenflexion: Deklination im Verbund
Wortgruppenflexion: Deklination im Verbund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prof. Dr. Peter Gallmann Jena, Sommer 2012<br />
<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong><br />
Duden-Grammatik (2005), Randziffern 1517–1519; 1530–1533<br />
Kongruenz in der Nominalphrase: KNG-Merkmale<br />
Nominalphrasen weisen best<strong>im</strong>mte morphosyntaktische Merkmale auf, nämlich Kasus-, Numerus-<br />
und Genus-Merkmale, oft zusammengefasst unter der Bezeichnung KNG-Merkmale.<br />
– Der Kasus wird der Nominalphrase »von außen« zugewiesen. Je nach syntaktischem<br />
Kontext bekommt die Nominalphrasen den Kasus über Rektion (zum Beispiel von einem<br />
Verb oder einer Präposition), über Kongruenz (mit einer Bezugsphrase) oder über semantische<br />
Regeln.<br />
– Für den Numerus ist die Semantik des Nomens verantwortlich; vgl. das Skript zur Zählbarkeit.<br />
– Für das Genus ist ebenfalls das Nomen verantwortlich. Das Genus des Nomens ist nicht<br />
wählbar, sondern den einzelnen Nomen fest zugeordnet.<br />
Wenn Nominalphrasen außer dem Nomen selbst auch noch Artikelwörter und/oder Adjektive<br />
enthalten, können auch diese Wortformen die KNG-Merkmale der Nominalphrase (NP) tragen.<br />
Man kann dies mit NP-interner Kongruenz erklären:<br />
(1) NP-interne Kongruenz (KNG-Kongruenz):<br />
In Nominalphrasen st<strong>im</strong>men Artikelwörter und Adjektive mit dem Nomen in<br />
Kasus, Numerus und Genus überein.<br />
Man kann dann sagen, dass Artikelwörter, Adjektive und Nomen die Träger der KNG-Merkmale<br />
oder kurz die Merkmalträger der Nominalphrase sind:<br />
(2) a. [Regen] macht mir nichts aus.<br />
b. [Der Regen macht mir nichts aus.<br />
c. [Starker Regen] macht mir nichts aus.<br />
d. [Der starke, eiskalte Regen] macht mir nichts aus.<br />
<strong>Wortgruppenflexion</strong>, Monoflexion<br />
Die KNG-Merkmale kommen an den einzelnen Wortformen unterschiedlich deutlich zum<br />
Ausdruck. So ist das Genus am Nomen gewöhnlich überhaupt nicht ablesbar, und dessen Kasusformen<br />
sind auch nicht besonders deutlich (siehe dazu das separate Skript). Artikelwörter<br />
und Adjektive sind diesbezüglich etwas deutlicher, aber auch hier finden sich viele mehrdeutige<br />
Formen (Formenzusammenfall, sogenannter Synkretismus; zu einer Erklärung siehe das<br />
entsprechende separate Skript). Beispiele mit dem definiten Artikel:<br />
(3) a. [der Kater] miaut (Nominativ Singular Maskulinum)<br />
b. [der Katze] schmeckt das Futter (Dativ Singular Femininum)<br />
c. das Miauen [der Katze] (Genitiv Singular Femininum)<br />
d. das Miauen [der Kater] (Genitiv Plural)
<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 2<br />
Zum Glück spannen aber die einzelnen Merkmalträger der NP zusammen, sie wirken also<br />
»<strong>im</strong> <strong>Verbund</strong>«. Ein Beispiel:<br />
(4) Anna will [diese dicken Bücher] lesen.<br />
Die Endung -e des Demonstrativs diese und die Endung -en des Adjektivs dicken können für<br />
sich allein betrachtet vielerlei ausdrücken – <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> kommen aber nur noch die Merkmalbündel<br />
[Nominativ & Plural] oder [Akkusativ & Plural] infrage. Dass tatsächlich eine<br />
Nominalphrase mit Merkmal Plural vorliegt, sieht man an der Form des Nomens. Überhaupt<br />
sind die Numerus- und Genusmerkmale des Nomens häufig der Schlüssel, mit dem sich<br />
mehrdeutige Artikel- und Adjektivformen klären lassen. In unserem Fall wird das Merkmal<br />
[Plural] des Nomens gleich doppelt angezeigt: mit dem Umlaut und mit der Endung -er. Isoliert<br />
könnte diese Endung auch noch das Merkmalbündel [Genitiv & Plural] ausdrücken, aber<br />
die vorliegende Kombination mit dem Demonstrativ diese schließt dies aus (die Genitiv-<br />
Plural-Form hieße hier dieser). Ausgeschlossen ist auch das Bündel [Dativ & Plural] – hier<br />
würde die Form des Nomens Büchern lauten. Der Satzzusammenhang fällt schließlich die<br />
Entscheidung zugunsten des Merkmalbündels [Akkusativ & Plural].<br />
Das Zusammenspiel der einzelnen Flexionsformen, wie es dieses Beispiel zeigt, wird auch als<br />
<strong>Wortgruppenflexion</strong> bezeichnet. Das Deutsche treibt hier einen relativ großen Aufwand. Es<br />
gibt denn auch eine Tendenz, die Merkmale nur noch an einem einzigen Wort der Nominalphrase<br />
anzuzeigen; man spricht dann von Monoflexion. Auch wenn Monoflexion in der<br />
Standardsprache noch nicht allgemein gilt – siehe etwa oben Beispiel (4) –, so findet man<br />
doch schnell entsprechende Beispiele:<br />
(5) a. Anna n<strong>im</strong>mt [die Gabel].<br />
b. Anna n<strong>im</strong>mt [die Gabeln].<br />
(6) a. Otto entfernt [das Gitter].<br />
b. Otto entfernt [die Gitter].<br />
In (5) kommt der Unterschied [Akkusativ Singular] ↔ [Akkusativ Plural] nur am Nomen, in<br />
(6) nur am Artikel zum Ausdruck. (An diesen zwei Beispielen wird übrigens auch klar, warum<br />
die Grundregeln für die Pluralbildung der Nomen, G1–G3, sehr stabil sind; siehe entsprechendes<br />
Skript.)<br />
In (7) ist der Unterschied [Nominativ Singular] ↔ [Genitiv Plural] nur am Adjektiv erkennbar.<br />
(7) a. [Der dicke Balken] muss auch ersetzt werden.<br />
b. Der Architekt ordnete den Ersatz [der dicken Balken] an.<br />
Wie schon oben angedeutet, ist es für Deutschlerner nützlich zu wissen, dass sich die Zahl<br />
der in Frage kommenden Merkmalbündel stark verringert, wenn man das Genus und die Pluralform<br />
des Nomens kennt. Das ist vor allem für das Erkennen des Kasus wichtig:<br />
(8) a. dieser Apfel<br />
→ Nom. Singular Maskulinum (alle anderen Kasus sind hier ausgeschlossen)<br />
b. dieser Birne<br />
→ Dativ oder Genitiv Singular Femininum (ausgeschlossen: Nom., Akk.)<br />
c. dieser Äpfel<br />
→ Genitiv Plural (alle anderen Kasus sind hier ausgeschlossen)<br />
d. dieser Birnen<br />
→ Genitiv Plural (alle anderen Kasus sind hier ausgeschlossen)
<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 3<br />
Die Grundregeln für die <strong>Wortgruppenflexion</strong><br />
Grundlage der <strong>Wortgruppenflexion</strong> ist oben genannte Regel (1), hier wiederholt:<br />
(9) NP-interne Kongruenz (KNG-Kongruenz):<br />
In Nominalphrasen st<strong>im</strong>men Artikelwörter und Adjektive mit dem Nomen in<br />
Kasus, Numerus und Genus überein.<br />
Beispiele:<br />
(10) a. d-er Kaffee, d-ie Schokolade, d-as Wasser<br />
b. dies-er Kaffee, dies-e Schokolade, dies-es Wasser<br />
c. heiß-er Kaffee, heiß-e Schokolade, heiß-es Wasser<br />
Diese Kongruenzregel bewirkt, dass Artikelwörter, Adjektive und Nomen die Merkmalträger<br />
der Nominalphrase sind. Bei genauerer Betrachtung erkennt man hier drei Zuweisungsregeln<br />
und drei Formregeln.<br />
Die drei Zuweisungsregeln:<br />
(11) A Jede Nominalphrase hat einen Hauptmerkmalträger. (Die anderen Wortformen<br />
sind dann Nebenmerkmalträger.)<br />
B Als Hauptmerkmalträger wird die am weitesten links stehende Wortform gewählt,<br />
das kann ein Artikelwort oder ein Adjektiv sein – aber nur, wenn sie eine<br />
Endung tragen (andernfalls ist die nächste weiter rechts stehende Wortform<br />
Hauptmerkmalträger).<br />
C Adjektive (auch nominalisierte) werden parallel flektiert. Das heißt, sie sind<br />
alle entweder Haupt- oder Nebenmerkmalträger.<br />
Und die drei Formregeln:<br />
(12) 1 Artikelwörter haben starke Endungen, wenn sie Hauptmerkmalträger sind,<br />
sonst gar keine.<br />
2 Adjektive haben starke Endungen, wenn sie Hauptmerkmalträger sind, sonst<br />
schwache.<br />
3 Nomen haben tendenziell (!) nur dann Kasusendungen, wenn sie Nebenmerkmalträger<br />
sind.<br />
Die folgenden Tabellen zeigen die starken und schwachen Flexionsformen eines Adjektivs.<br />
Zu einer Erklärung der Felder mit gleichlautenden Formen (= Synkretismusfelder) siehe das<br />
separate Skript zur Adjektivflexion.<br />
Stark (mögliche Endungen: -e, -er, -en, -em, -es):<br />
(13) Maskulinum Neutrum Femininum Plural<br />
Nominativ heißer Kaffee heißes Wasser heiße Speise heiße Speisen<br />
Akkusativ heißen Kaffee heißes Wasser heiße Speise heiße Speisen<br />
Dativ heißem Kaffee heißem Wasser heißer Speise heißen Speisen<br />
Genitiv heißen Kaffees heißen Wassers heißer Speise heißer Speisen<br />
Die starken Formen der Artikelwörter und Pronomen lauten grundsätzlich gleich. Man kann<br />
daher das Adjektiv heiß in der obenstehenden Tabelle beispielsweise durch das Demonstrati-
<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 4<br />
vum dieser ersetzen – es erscheinen die gleichen <strong>Deklination</strong>sformen (außer teilweise <strong>im</strong> Genitiv).<br />
Schwach (mögliche Endungen: nur -e und -en):<br />
(14) Maskulinum Neutrum Femininum Plural<br />
Nominativ der heiße Kaffee das heiße Wasser die heiße Speise die heißen Speisen<br />
Akkusativ den heißen Kaffee das heiße Wasser die heiße Speise die heißen Speisen<br />
Dativ dem heißen Kaffee dem heißen Wasser der heißen Speise den heißen Speisen<br />
Genitiv des heißen Kaffees des heißen Wassers der heißen Speise der heißen Speisen<br />
In den folgenden Beispielblöcken wird das Zusammenwirken der Regeln zur <strong>Wortgruppenflexion</strong><br />
vorgeführt. Die Hauptmerkmalträger sind jeweils unterstrichen. Der erste Beispielblock:<br />
(15) a. [D-er stark-e schwarz-e Kaffee] hilft da sicher.<br />
b. [Dies-er stark-e schwarz-e Kaffee] hilft da sicher.<br />
c. [Mein stark-er schwarz-er Kaffee] hilft da sicher.<br />
d. [Ein stark-er schwarz-er Kaffee] hilft da sicher.<br />
e. [Stark-er schwarz-er Kaffee] hilft da sicher.<br />
Hauptmerkmalträger sind hier Artikelwörter oder Adjektive. Man sieht hier dreierlei:<br />
– Ob Artikelwörter oder Adjektive – wenn sie Hauptmerkmalträger sind, werden sie stark<br />
dekliniert, hier erkennbar an der Endung -er (= Formregeln 1 und 2).<br />
– Die beiden Adjektive werden <strong>im</strong>mer parallel flektiert: Entweder sind beide stark, oder es<br />
sind beide schwach, hier mit Endung -e (= Zuweisungsregel C).<br />
– Die Adjektive sind nur dann Hauptmerkmalträger und damit stark, wenn ihnen entweder<br />
gar kein Artikelwort oder ein endungsloses vorangeht.<br />
Aus dem letzten Punkt kann man den folgenden Merksatz ableiten:<br />
(16) Adjektiv: stark/schwach<br />
Adjektive werden nur dann schwach flektiert, wenn ihnen ein Artikelwort mit<br />
Endung vorangeht. (Andernfalls werden sie stark flektiert.)<br />
Dieser Merksatz ist keine elementare Regel – wie vorgeführt, lässt er sich aus Zuweisungsregeln<br />
B und C sowie Formregel 2 ableiten. Die genannten Regeln (und damit auch der<br />
Merksatz) gelten übrigens auch für nominalisierte Adjektive:<br />
(17) a. Anna trug [d-as klein-e schwarz-e Kleid].<br />
b. Anna trug [d-as klein-e Schwarz-e].<br />
c. Anna trug [ihr klein-es schwarz-es Kleid].<br />
d. Anna trug [ihr klein-es Schwarz-es].<br />
Auch bei lexikalisierten Nominalisierungen:<br />
(18) a. Anna trank [d-as klein-e Hell-e].<br />
b. Anna trank [ein klein-es Hell-es].<br />
(19) a. [D-er neu-e Vorgesetzt-e] schätzt Pünktlichkeit.<br />
b. [Mein neu-er Vorgesetzt-er] schätzt Pünktlichkeit.
<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 5<br />
Das Wesentliche zur <strong>Wortgruppenflexion</strong> des Deutschen ist damit gesagt. Die folgenden<br />
Sonderfälle sind allerdings noch etwas eingehender zu behandeln:<br />
– endungslose Artikelwörter und Adjektive: siehe nachstehend<br />
– Unterlassung der Kasusflexion bei Nomen (Nomen als Hauptmerkmalträger, vgl. Formregel<br />
3): siehe separates Skript<br />
– Kasusflexion und Genitivphrasen: siehe separates Skript<br />
– Schwankungen in der Adjektivflexion (stark/schwach): siehe separates Skript<br />
Endungslose Artikelwörter<br />
Es gibt drei Arten endungsloser Artikelwörter: (i) den Typ mein, (ii) den Typ welch und (iii)<br />
den Typ etwas.<br />
mein, ein, kein<br />
(i) Artikelwörter des Typs mein werden eigentlich adjektivisch flektiert, also wie dieser. Zu<br />
diesem Typ gehören die possessiven Artikelwörter (mein, dein, sein, ihr, unser) sowie ein<br />
und kein. In Nominalphrasen mit best<strong>im</strong>mten Merkmalkombinationen fallen diese Wörter<br />
aber als Hauptmerkmalträger aus und sind dann endungslos:<br />
(20) Nominativ Singular Maskulinum ein dick-er Roman<br />
(21) Nominativ Singular Neutrum ein dick-es Buch<br />
Akkusativ Singular Neutrum ein dick-es Buch<br />
Manche Grammatiken setzen für Adjektive in Nominalphrasen mit Artikelwörtern des Typs<br />
mein eine besondere »gemischte« Flexion an. Das ist eine unnötige Verkomplizierung. Es<br />
reicht, wenn Deutschlerner sich merken, wann die Artikelwörter endungslos sind – die Flexion<br />
von Artikelwort und Adjektiv ergibt sich dann aus den allgemeinen Regeln von selbst:<br />
(22) Nominativ Singular Maskulinum (einer der einzuprägenden Sonderfälle):<br />
Artikelwort endungslos → Adjektiv stark: Das ist [ein dicker Roman].<br />
(23) Dativ Singular Maskulinum (Normalfall, nicht besonders zu merken):<br />
Artikelwort mit Endung → Adjektiv schwach: Er liest in [einem dicken Roman].<br />
(24) Singular Plural<br />
Maskulinum Femininum Neutrum<br />
Nominativ<br />
Akkusativ<br />
Dativ<br />
Genitiv<br />
kein dicker Roman<br />
keinen dicken Roman<br />
keinem dicken Roman<br />
keines dicken Romans<br />
keine dicke Mauer<br />
keine dicke Mauer<br />
keiner dicken Mauer<br />
keiner dicken Mauer<br />
kein dickes Buch<br />
kein dickes Buch<br />
keinem dicken Buch<br />
keines dicken Buches<br />
keine dicken Sachen<br />
keine dicken Sachen<br />
keinen dicken Sachen<br />
keiner dicken Sachen<br />
Dass Artikelwörter des Typs mein in Nominalphrasen mit best<strong>im</strong>mten Merkmalbündeln als<br />
Hauptmerkmalträger ausfallen, kann zum Problem werden, nämlich bei Weglassung des Nomens<br />
(Ellipse). Die strikte Anwendung der Regel würde dazu führen, dass die Nominalphrase<br />
überhaupt keinen Hauptmerkmalträger aufweist.<br />
(25) Das ist nicht [dein Buch], sondern [mein Buch].<br />
→ *Das ist nicht [dein Buch], sondern [mein].
<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 6<br />
Wie der Stern in der zweiten Zeile anzeigt, darf Zuweisungsregel A auf keinen Fall verletzt<br />
werden. In solchen Konfigurationen erhält darum das Artikelwort quasi behelfsweise Endungen,<br />
damit es selbst als Hauptmerkmalträger auftreten kann:<br />
(26) Das ist nicht [dein Buch], sondern [mein Buch].<br />
� Das ist nicht [dein Buch], sondern [mein-(e)s].<br />
Der folgende Beispielblock zeigt, wie sich ganz analog die Aufspaltung einer Nominalphrase<br />
auf die Flexion ihrer Bestandteile auswirkt. Offensichtlich müssen beide Teile einen Hauptmerkmalträger<br />
haben:<br />
(27) a. Es war [kein braun-er Zucker] vorhanden.<br />
b. [Zucker] war [kein braun-er] vorhanden.<br />
c. *[Braun-er Zucker] war [kein] vorhanden.<br />
d. [Braun-er Zucker] war [kein-er] vorhanden.<br />
Auf diese Weise lässt sich auch die unterschiedliche Flexion be<strong>im</strong> pronominalen Gebrauch<br />
dieser Wörter erklären:<br />
(28) a. Das weiß [kein Mensch].<br />
b. → *Das weiß [kein].<br />
c. (Stattdessen:) → Das weiß [kein-er].<br />
welch, manch, solch<br />
Einige sonst adjektivisch flektierte Artikelwörter sind in besonderen Gebrauchsweisen allgemein<br />
endungslos. Dies gilt zum Beispiel für welch in Ausrufesätzen, vgl. Beispiel (29 b),<br />
oder für manch <strong>im</strong> eher gehobenen Stil (30 b):<br />
(29) a. [Welches dicke Buch] liest sie?<br />
b. [Welch dickes Buch] sie da wieder liest!<br />
(30) a. Sie liest [manch-es klug-e Buch].<br />
b. Sie liest [manch klug-es Buch].<br />
etwas, nichts, genug<br />
Nicht alle Artikelwörter und Pronomen werden adjektivisch flektiert, es gibt auch solche mit<br />
nominaler Flexion. Dazu gehören zum Beispiel etwas, nichts, genug sowie Bildungen auf<br />
-erlei. Diese Wörter können – <strong>im</strong> Gegensatz zum Typ mein – be<strong>im</strong> Gebrauch als Pronomen<br />
endungslos sein.<br />
(31) a. Das weiß [niemand].<br />
b. Aber nicht: *Das weiß [kein]. Sondern: Das weiß [keiner].<br />
Be<strong>im</strong> Gebrauch als Artikelwort bewirken sie hingegen, dass das folgende Wort zum Hauptmerkmalträger<br />
wird (und daher, sofern ein Adjektiv, stark flektiert wird):<br />
(32) a. In der Dose ist noch [etwas braun-er Zucker].<br />
b. In der Schachtel waren [allerlei nett-e klein-e Sachen].<br />
c. Anna weiß [nichts Genauer-es].<br />
Ähnlich auch Kardinalzahlen (von 2 bis 999 999):<br />
(33) Was [drei] wissen, wissen bald [dreißig]. Ich habe nicht [drei Bücher] gekauft,<br />
sondern [vier].
<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 7<br />
Endungslose Adjektive<br />
Wenn ein Adjektiv der letzte in Frage kommende Merkmalträger einer Nominalphrase ist,<br />
muss es tatsächlich Merkmalträger sein, und zwar Haupt- oder Nebenmerkmalträger:<br />
(34) a. Das ist [kein lila Kleid], sondern [ein rotes Kleid].<br />
b. Das ist [kein lila Kleid], sondern [ein rotes].<br />
(35) a. Das ist [kein rotes Kleid], sondern [ein lila Kleid].<br />
b. Das ist [kein rotes Kleid], sondern [ein *lila].<br />
b’. Das ist [kein rotes Kleid], sondern [ein lilanes].<br />
(36) a. Sie trug nicht [das rote Kleid], sondern [das *lila / das lilane].<br />
b. Sie trug nicht [das *lila / das lilane], sondern [das rote Kleid].<br />
Bei dem hier gezeigten Farbadjektiv lila wird die Flexion erzwungen, obwohl das Adjektiv<br />
sonst unflektiert bleibt. Die flektierten Formen haben noch nicht die uneingeschränkte Zust<strong>im</strong>mung<br />
der Sprachpflege gefunden. Im traditionellen Stil wird daher oft auf umständlichere<br />
Ersatzformen ausgewichen:<br />
(37) Sie trug nicht [das rote Kleid], sondern [das lilafarbene].