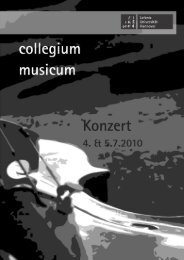Mitwirkende (Fortsetzung) - Collegium Musicum Hannover
Mitwirkende (Fortsetzung) - Collegium Musicum Hannover
Mitwirkende (Fortsetzung) - Collegium Musicum Hannover
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bernd Jacobsen studierte Kontrabass an der Hochschule für Musik und Theater <strong>Hannover</strong><br />
und bei Prof. Günter Klaus in Frankfurt und vervollkommnete sich auf internationalen<br />
Meisterkursen u.a. bei Gary Karr, Ludwig Streicher und Klaus Stoll. Danach<br />
spielte er in verschiedenen Rundfunk-, Opern- und Konzertorchestern. Besonders<br />
prägende Stationen waren Konzertreisen mit dem Kammerorchester Baden-Württemberg<br />
(JKE) unter Leitung der Geigerin Iona Brown oder Helmut Rillings, die durch<br />
Osteuropa und nach Arabien und Pakistan führten. Als alternierender Solobassist im<br />
„London Arts Orchestra“ bereiste er über fünf Jahre viele Kulturzentren Westeuropas.<br />
Als Solist wurde er von Kammerorchestern in Bamberg, Ulm, <strong>Hannover</strong>, Hildesheim,<br />
Goslar, Gehrden und Wolfsburg begleitet. Die musikalische Bandbreite reicht von<br />
Barock- und Oratorienmusik über Kammermusik bis hin zu Avantgarde und Jazz.<br />
Im pädagogischen Bereich ist er als Dozent an der Universität Hildesheim tätig, hat<br />
einen Lehrauftrag an der hiesigen Musikhochschule und mehrere Kontrabassklassen<br />
in und um <strong>Hannover</strong>. Er leitet Basskurse beim AMJ und VDM und betreut seit vielen<br />
Jahren die Kontrabassgruppe des Landesjugendsinfonieorchesters.<br />
Christoph Heidemann, geb. 1965, erhielt mit sechs Jahren seinen ersten Geigenunterricht.<br />
Er studierte Violine bei Werner Heutling und Oscar C. Yatco an der<br />
Hochschule für Musik und Theater <strong>Hannover</strong>. Während dieser Zeit war er u. a.<br />
Konzertmeister der Jungen Deutschen Philharmonie. Im Anschluß an sein Diplom in<br />
der künstlerischen Ausbildung studierte er Chor und Orchesterleitung bei Wolfram<br />
Wehnert.<br />
Die Leitung des <strong>Collegium</strong> <strong>Musicum</strong> übernahm er im Jahre 1994. Seitdem führte er<br />
mit dem Orchester viele Werke der sinfonischen Literatur auf, darunter Sinfonien von<br />
Beethoven, Dvorak, Schumann und Mendelssohn. Seit dem Wintersemester 1999 hat<br />
er einen Lehrauftrag für Orchesterleitung an der Hochschule für Musik und Theater<br />
<strong>Hannover</strong> inne.<br />
Neben seiner dirigentischen Tätigkeit ist er als Geiger hauptsächlich auf dem Gebiet<br />
der Alten Musik tätig, u. a. im Barockorchester L’Arco, dem Ensemble „La Ricordanza“,<br />
der <strong>Hannover</strong>schen Hofkapelle und im Hoffmeister-Quartett.<br />
Ursprünglich hatte Antonin Dvorák geplant, seiner Streicherserenade E-Dur (1875)<br />
und der Bläserserenade d-Moll (1878) noch ein drittes Schwesterwerk –diesmal für<br />
Streicher und Bläser– folgen zu lassen. Er entschied nach den Erfolgen seiner Slawischen<br />
Tänze op. 46 jedoch anders und komponierte ein weiteres Werk unter Einbeziehung<br />
slawischer Folklore, diesmal für kleines Orchester. Es blieb seine einzige Suite.<br />
Sie bekam bei der Uraufführung 1879 in Prag den Beinamen Tschechische Suite und<br />
ist heute bekannter unter dem Namen Böhmische Suite. Die ursprünglichen Satzbezeichnungen<br />
Dvoráks (z.B. Allegro moderato) werden durch die Gattungen der tschechischen<br />
Volkstänze (z.B. Polka, Furiant) ergänzt, die jeweils als Vorbilder dienten.<br />
Die Suite beginnt in klassischer Manier mit einem Präludium. Eine lyrische Melodie,<br />
untermalt mit einer ostinaten Basslinie und einer Bordunquint im Stil einer tschechischen<br />
Sackpfeife versinnbildlichen zusammen mit dem ruhigen Schluss böhmisches<br />
Landleben.<br />
Nach der langsamen Einleitung folgt als schneller 2. Satz eine Polka, ein beschwingter<br />
Rundtanz im 2/4-Takt. Typisch slawisch sind die leicht melancholischen Anklänge,<br />
gepaart mit kräftigen Rhythmuselementen ohne Auftakt. Dvorák verarbeitet als<br />
weitere rhythmische Eigenschaft der tschechischen Folklore die stellenweise Ablösung<br />
vom klassischen 8-Takt-Schema: Am Ende jedes Teiles wird ein zusätzlicher Takt<br />
wie ein Echo des bisherigen Teiles angehängt. Im lebhaften Mittelteil dominieren die<br />
ersten Violinen mit feurigen Sechzehntelfiguren.<br />
Das Gegenstück zum Walzer ist in der tschechischen Folklore die Sousedská. Wie bei<br />
den anderen Teilen der Suite greift Dvorák hier nicht auf bereits bekannte slawische<br />
Melodien zurück, sondern arbeitet in eine eigene Melodie typisch slawische Elemente<br />
hinein. Die Besetzung wechselt für diesen Satz: die Oboen schweigen, stattdessen<br />
gesellen sich Klarinetten und Flöten dazu.<br />
Der 4. Satz, ein Andante con moto, ist eine sehr lyrisch gehaltene Romanze im<br />
wiegenden 9/8-Takt. Sie ist in ihrem Ausdruck eng dem Präludium verwandt und<br />
beschließt die bis hier durchgängige Anmutigkeit der Suite, denn es folgt ein lebhaftes<br />
und feuriges Finale.<br />
Der Furiant ist ein slawischer Tanz im Wechsel von Zweier- und Dreierrhythmus.<br />
(Bayerisches Pendant dazu ist der Zwiefache). Durch die beständigen Betonungswechsel,<br />
das schnelle Tempo, Tonartänderungen und große Dynamikunterschiede wird<br />
dieser Satz zu einem wahren „Rausschmeißer“. Außerdem ist er der einzige, in dem<br />
das ganze Orchester gemeinsam, sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten, musiziert.<br />
Damit bildet der Furiant einen reizvollen Kontrast zum kammermusikalisch-anmutigen<br />
ersten Teil der Suite.