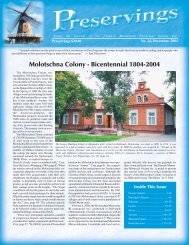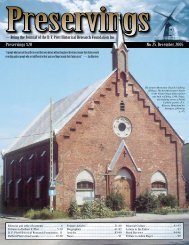Die Molotschna Kolonie - Plett Foundation
Die Molotschna Kolonie - Plett Foundation
Die Molotschna Kolonie - Plett Foundation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Teil III - <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Kapitel 31 <strong>Die</strong> Ansiedlung<br />
Potjomkin starb 1791, seine Kaiserin Katharina II.<br />
1796. Nach dem Tod der beiden erfuhr die mennonitische<br />
Einwanderung eine kurzfristige Unterbrechung.<br />
Ein Gnadenprivileg von Paul I. vom 20.10.1800 sah vor,<br />
dass den bereits ansässigen und zukünftig einwandernden<br />
Mennoniten vollkommene Religionsfreiheit,<br />
Befreiung von Eid, Kriegs- und Zivildienst,<br />
Gewerbefreiheit und für 10 Jahre Abgabenfreiheit<br />
garantiert wurde. Es kam zu einer zweiten großen<br />
Auswanderungswelle.<br />
Das Land am Fluss <strong>Molotschna</strong>ja war schon von<br />
Bartsch und Höppner angesehen worden, aber nachdem<br />
viele Siedler dieses Land gesehen hatten,<br />
weigerten sie sich, dort anzusiedeln: das Land war zu<br />
weit vom Dnjepr gelegen, die Nogaier waren zu nahe.<br />
Aber die Regierung hatte nur dieses Gebiet an der<br />
<strong>Molotschna</strong>ja für die weiteren Ansiedler vorgesehen.<br />
In den Jahren 1803-1805 wanderten 342 mennonitische<br />
Familien aus dem Elbinger und<br />
Marienburgischen Gebiet nach Südrussland ein. Dort<br />
wurden zwischen 1804 und 1806 18 Dörfer angelegt.<br />
Auf dem Weg in die <strong>Molotschna</strong> konnten die<br />
Einwanderer bei ihren Glaubensbrüdern in Chortitza<br />
überwintern. Sie mieteten sich in deren Häusern und<br />
Ställen ein, bis ihre Häuser in der <strong>Molotschna</strong> bezugsfertig<br />
waren.<br />
G. Epp schreibt in der "Geschichte der<br />
Mennoniten in Russland" Band I., Seite 139:<br />
"...Während die Siedler von Chortitza jahrelang<br />
schlecht betreut und versorgt wurden und unter einer<br />
unerfahrenen, unfähigen Verwaltung auch von Seiten<br />
der Regierungsbeamten litten, fanden die Siedler an<br />
der <strong>Molotschna</strong>ja erstaunlich geregelte Verhältnisse<br />
und eine tüchtige Verwaltung vor..." Doch die<br />
Probleme ließen nicht auf sich warten, und schon bald<br />
trat ein Problem auf-die Landnot. Bis 1840 konnte<br />
man in der <strong>Molotschna</strong> dieses Problem im Griff behalten,<br />
da diese <strong>Kolonie</strong> immer noch viel Reserveland<br />
hatte. Erst nach dem Krimkrieg (1853-1856) stand die<br />
Landlosenfrage ernstlich auf der Tagesordnung, die<br />
jedoch durch Eingreifen der Regierung<br />
(Landzuteilung, Wahlrecht für die Landlosen,<br />
Änderung des Steuergesetzes) geregelt werden konnte.<br />
Es gab weiteren Zuzug aus Preußen. Bis zum<br />
Jahre 1865 entstanden dort 57 Dörfer und drei<br />
Vorwerke. Durch Einfluss des Johann Cornies wurde<br />
der "Landwirtschaftliche Verein" gegründet, der die<br />
227<br />
Baumbepflanzung, Verbesserung der Bauten,<br />
Abdämmen der Steppenflüsse, Veredelung von<br />
Schafen, allgemeine Verbesserung der Landwirtschaft,<br />
Erneuerung des Schulsystems in den <strong>Kolonie</strong>n kontrollierte.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kolonie</strong>n kamen auch durch die<br />
Entwicklung des Handwerks zum Wohlstand. So gab<br />
es in der <strong>Molotschna</strong> schon 1809 eine Bierbrauerei,<br />
1810 eine Branntweinbrennerei, drei Essigbrauereien,<br />
eine Wassermühle, 1816 eine Tuchfabrik, 1828 in<br />
Steinbach die erste Ziegelbrennerei. Auch der<br />
Ackerbau kam langsam zum Aufschwung durch<br />
Eröffnung des Hafens in Berdjansk, wo die<br />
Mennoniten ihren Weizen verkaufen konnten.<br />
<strong>Die</strong> Wehrreform von 1870 beunruhigte die<br />
Mennoniten. Wenn bis 1870 keiner an eine<br />
Auswanderung dachte, so waren danach viele, die in<br />
dieser Reform eine Gefahr nicht nur für ihre jungen<br />
Männer, sondern auch für die ganze mennonitische<br />
Gesellschaft sahen. Nach jahrelangen erfolglosen<br />
Verhandlungen mit der Regierung in Sachen der<br />
Wehrpflicht fühlten sich viele gezwungen, dieses Land<br />
wieder zu verlassen. Bis Ende der 1870er Jahren hatten<br />
schon 18 000 Mennoniten Russland verlassen.<br />
Doch die russische Regierung sah es sehr ungern,<br />
dass die Mennoniten auswanderten, und schlugen<br />
ihnen einen Ersatz des Wehrdienstes durch einen<br />
Staatsdienst in den Werkstätten,<br />
Feuerwehrkommandos und Forstressorts vor. <strong>Die</strong><br />
Mennoniten wählten den Forsteidienst (Waldbau in<br />
den Steppen Südrusslands).<br />
100 Jahre hat sich die <strong>Kolonie</strong> <strong>Molotschna</strong> zu<br />
einer blühenden Ansiedlung entwickelt. Dann kam<br />
der Untergang: der I. Weltkrieg, die Landenteignung,<br />
die Revolution 1917, die Massenvernichtung durch die<br />
verschiedenen Banden 1919, Seuchen und Hunger<br />
1921-1922. Das Schicksal der Mennoniten war<br />
bedrohlich, und viele wanderten in den 1920er Jahren<br />
aus Russland nach Amerika, Kanada und Mexiko aus.<br />
<strong>Die</strong> Zurückgebliebenen mussten noch schlimmere<br />
Zeiten erleben: Kollektivierung, Verhaftungen,<br />
Verschleppung und tausende Mennoniten den Tod.<br />
Zum Nachlesen:<br />
Franz Isaak, <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong>er Mennoniten<br />
(Halbstadt, Taurien 1908), 354 Seiten.<br />
Heinrich Görz, <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong>er Ansiedlung<br />
(Steinbach 1950), 211 Seiten.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Winter in Russland. Ein Bild von W. K. Bjalynizkij-Birulja, 1907, aus J. K. Korolew, Gosudarstwennaja tretjakowskaja<br />
galereja (Moskau 1987), Seite 207.<br />
Eines der ersten Gebäuden der mennonitischen Ansiedler in der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, in Blumenort. Foto<br />
aus Quiring und Bartel, Als ihre Zeit erfüllt war,Seite 6.<br />
228
Kapitel 31 <strong>Die</strong> Ansiedlung<br />
Flämische Gemeinde. 1805 entstand die Flämische<br />
Gemeinde in der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>. Zum ersten<br />
Ältesten der <strong>Kolonie</strong> wurde Jakob Enns(1763-1817)<br />
gewählt.<br />
Klaas Reimer(1770-1837) und Kornelius Janzen<br />
aus Petershagen wurden aus der flämischen<br />
Gemeinde wegen ihres Protests gegen das Handeln<br />
des Ältesten (Körperstrafe der <strong>Die</strong>nstarbeiter,<br />
Kriegsunterstützung durch Geldsummen, physische<br />
Kirchengliederzucht u.a.) ausgeschlossen.<br />
Kleine und Große Gemeinde. 1812 gründete Klaas<br />
Reimer die Kleine Gemeinde. Weil diese Gruppe<br />
nur klein war, bekam sie auch den Namen Kleine<br />
Gemeinde. Der Rest der Flämischen Gemeinde<br />
nannte sich weiterhin Große Gemeinde. <strong>Die</strong> Kleine<br />
Gemeinde zog sich zurück, und ihre Glieder lebten<br />
schlicht, enthaltsam und fromm. Sie waren bekannt<br />
als Musterwirte. Das Bestreben der Kleinen<br />
Gemeinde war, ein ernsteres christliches Leben zu<br />
führen und die Gebote Christi auszuleben. Sie<br />
bemühten sich auch, die Schriften von M. Simons,<br />
wie zum Beispiel "Das Fundamentsbuch", und P.<br />
Peters zu übersetzen und neu zu drucken.<br />
1817 starb Jakob Enns, und Jakob Fast aus<br />
Halbstadt wurde zum Ältesten der Großen<br />
Gemeinde gewählt. Als Jakob Fast 1819 starb, trat<br />
Bernhard Fast (1783-1861) an seine Stelle. <strong>Die</strong>ser<br />
versuchte, neue Sitten der pietistischen religiösen<br />
Kultur einzuführen. <strong>Die</strong> meisten Gemeindeglieder<br />
blieben ihrem Glaubensbekenntnis treu und<br />
schlossen sich 1824 zu einer "Rein Flämischen"<br />
Gemeinde unter der Leitung des Ältesten Jakob<br />
Warkentin zusammen.<br />
Ohrloff-Halbstadt Gemeinde, 1824. Damit entstand<br />
ein Kampf zwischen denen, die ihrem<br />
Glauben treu bleiben wollten, und einer kleinen<br />
Gruppe unter der Leitung von Bernhard Fast und<br />
Johann Cornies, die mehr den wirtschaftlichen<br />
Fortschritten nachstrebten. <strong>Die</strong> Gemeinde von<br />
Bernhard Fast nannte sich Ohrloff-Halbstadt. Da<br />
die große Rein Flämische Gemeinde unter der<br />
Leitung von Jakob Warkentin (geb. 1783) mit den<br />
Ordnungen von J. Cornies nicht immer einverstanden<br />
war, verbannte man ihn, und seine<br />
Gemeinde wurde (1842) in drei Teile geteilt:<br />
Lichtenau-Petershagen, Märgenau-Schönsee, und<br />
Pordenau Gemeinden. Später (1847) wurde auch<br />
Ältester H. Wiens (1800-72), Margenau, von seinem<br />
Amt enthoben und in die Verbannung geschickt.<br />
Nach Cornies Tod 1848 kamen die Konservativen<br />
<strong>Die</strong> Gemeindegeschichte<br />
229<br />
wieder ans Licht unter der Leitung des<br />
Oberschulzen David A. Friesen, Halbstadt.<br />
<strong>Die</strong> Landlosigkeit wurde immer größer, und<br />
etliche der Wohlhabenden pachteten das<br />
Reserveland von der <strong>Kolonie</strong> und verpachteten es<br />
weiter an die Landlosen für einen hohen Preis.<br />
Männer wie Prediger Franz Isaak aus Tiege und<br />
Abraham Thiessen aus Neu-Halbstadt, arbeiteten<br />
mit der Regierung in Petersburg, um die<br />
Landlosenfrage zu lösen. Sie hatten etwas Erfolg,<br />
und die Landlosen bekamen Land. Aber 1873<br />
wurde A.Thiessen für diesen Einsatz verbannt.<br />
1835 kam eine Gruppe Einwanderer aus<br />
Brenkenhofswalde und Franzthal bei Dessau,<br />
Neumark, Deutschland, und siedelte im<br />
südöstlichen Teil der <strong>Kolonie</strong> an. Sie gründete das<br />
Dorf Gnadenfeld. <strong>Die</strong>se Gruppe war stark von der<br />
pietistischen Bewegung in Deutschland beeinflusst.<br />
Sie hielten am Separatismus fest, d.h.: Leute<br />
mussten ihre alten Gemeinden verlassen, um selig<br />
zu werden. Sie mussten an das 1000jährige Reich<br />
glauben, so wie Professor Jung Stilling (1740-1817)<br />
es beschrieben hat. <strong>Die</strong> Wiederkunft Christi sollte<br />
im Osten stattfinden, und der russische Zar sollte in<br />
der Versuchungszeit die Kirche verteidigen. <strong>Die</strong>ser<br />
Glaube verbreitete sich bis 1860 in der <strong>Kolonie</strong><br />
<strong>Molotschna</strong> sehr stark. Es ging so weit, dass 18<br />
Männer eine schriftliche Erklärung aufstellten, in<br />
der sie die alten Gemeinden als "gefallene" bezeichneten.<br />
Brüdergemeinde, 1860. Sie gründeten eine neue<br />
Gemeinde und nannten sie Brüdergemeinde. In<br />
den ersten Jahren waren Glieder dieser Gemeinde<br />
(Separatisten) sehr eifrig und ihre<br />
Andachten–lebendig, so dass sie "Hüpfer" genannt<br />
wurden. Ihr Glaube stimmte sehr mit dem<br />
deutschen Baptismus überein, z. B.–die gesetzliche<br />
Notwendigkeit einer dramatischen Erfahrung bei<br />
der Bekehrung und der Untertauchung bei der<br />
Taufe. Im Gegenteil zu den "Hüpfern" wurden die<br />
alten Gemeinden "Kirchliche" genannt, weil sie<br />
den Sinn ihres Glaubens in ihrer Einfachheit auch<br />
auslebten und sie ihre Gemeinde als eine gültige<br />
christliche Ordnung anerkannten. Bis 1917 hatte<br />
die Brüdergemeinde 18 000 Personen aus allen<br />
<strong>Kolonie</strong>n Russlands für ihre Gemeinde gewonnen.<br />
Gleichzeitig hatten die Kirchlichen Gemeinden<br />
80 000 Seelen.<br />
Von Delbert <strong>Plett</strong>, Steinbach, Manitoba.<br />
Oktober 2000.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
"Frieden an der <strong>Molotschna</strong>," ein Gemälde von Johann H. Janzen (1886-1917). Foto aus Mennonite Life,<br />
October 1969, Seite 151.<br />
"Frieden und Wohlstand an der <strong>Molotschna</strong>," ein Gemälde von J. H. Janzen, Zentrallehrer, Ohrloff. Foto<br />
aus P. M. Friesen, Bruderschaft,Seite 776/aus Saints and Sinners,Seite 310.<br />
230
Kapitel 31 <strong>Die</strong> Ansiedlung<br />
Hippenmayer Karte der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong> ca. 1856. Aus Görtz, <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong>er Ansiedlung, Seite<br />
16/17. <strong>Die</strong> erste “alte Reihe” der Dorfer längs dem <strong>Molotschna</strong> Fluss sind schon 1804-1806 angesiedelt.<br />
Noch eine Karte von 1836 ist in Preservings, Nr. 17, Seite 19, veröffentlicht. Siehe auch die von von 1806,<br />
gedrückt in Görz, <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong>er Ansiedlung,Seite 12/13.<br />
231
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
<strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong> 2000<br />
Fahrkarte der <strong>Molotschna</strong>er <strong>Kolonie</strong>, 2000, mit Namen der mennonitischen Dörfer.<br />
232
Kapitel 31 <strong>Die</strong> Ansiedlung<br />
<strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong> 2000<br />
Fahrkarte der <strong>Molotschna</strong>er <strong>Kolonie</strong>, 2000, mit Namen der mennonitischen Dörfer.<br />
233
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Namen der Mennonitischen Dörfer der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Halbstädter Wolost<br />
Namen bei der Namen nach Wirtschaft- Einwohner- Namen ab<br />
Gründung 1915 ten am zahl am 01.01.1945<br />
01.01.1911 01.01.1911<br />
1. Halbstadt Molotschansk 48 915<br />
2. Neu-Halbstadt Novo-Molotschansk 77 231 Molotschansk<br />
3. Muntau Jablokowka 43 587 Jasnowka*<br />
4. Tiegenhagen Jasnoje 50 539 Lewadnoje-T<br />
5. Schönau Priosernoje 32 340 Dolina-T<br />
6. Fischau Rownopolje 43 460 Rybalowka-T<br />
7. Lindenau Krjutschkowo 40 572 Ljubimowka-T<br />
8. Lichtenau Bereschnoje 47 597 Swetlodolinskoje-M<br />
9. Blumstein Tatjanino 39 477 Kamenskoje-M<br />
10. Münsterberg Wjasowka 35 372 Prilukowka-M<br />
11. Altonau Ukrakowka 46 749<br />
12. Ohrloff Orloff 33 550<br />
13. Tiege Beresetschka 33 579 Orlowo<br />
14. Blumenort Pritotschnoje 34 596<br />
15. Rosenort Schipowka 31 409<br />
16. Tiegerweide Kulschanka 47 446 Mostowoje-T<br />
17. Rückenau Uslowoje 49 381 Kosolugowka<br />
18. Fürstenwerder Poworotnoje 61 622 Balkowoje-T*<br />
19. Alexanderwohl Blagoslowennoje 52 604 Swetloje-T<br />
20. Gnadenheim Tschokrak 46 428 Balaschowka-Ts.<br />
21. Kleefeld Stepnoje 62 666 Chutor Weselyj-T*<br />
22. Alexanderkrone Aleksandrowskoje 56 531 Aleksandrowka-Ts.<br />
23. Lichtfelde Tschistopolje 35 431 Gruschewka-T<br />
24. Neukirch Juschanlee 45 446 Udarnik-T<br />
25. Wernersdorf Pogranitschnoje 56 475 Pribreschnoje *<br />
26. Liebenau Chasarowka 34 549 Maiskoje *<br />
27. Schönsee Oserki 42 450 Snegurowka-T<br />
28. Fabrikerwiese Pripisnoje 5 135 Fabritschnoje-T<br />
29. Fürstenau Dolinka 24 409 Lugowka-T<br />
30. Ladekopp Sadowoje 35 461 Ladowka-T<br />
31. Petershagen Petrowskoje 30 420 Kutusowka-T<br />
* Jasnowka existiert ab 1958 nicht mehr<br />
* Balkowoje wurde vor dem Krieg von den Russen auch noch „Faschtawod" genannt.<br />
* Chutor Weselyj ist am 14.02.1968 dem Dorfe Mogutneje angeschlossen worden.<br />
* Pribreschnoje und *Maiskoje sind am 09.04.1974 dem russischen Dorf "Ostrikowka" angeschlossen<br />
worden.<br />
234
Kapitel 31 <strong>Die</strong> Ansiedlung<br />
Gnadenfelder Wolost<br />
Namen bei der Namen nach Wirtschaft- Einwohner- Namen ab<br />
Gründung 1915 ten am zahl am 01.01.1945<br />
01.01.1911 01.01.1911<br />
1. Gnadenfeld Bogdanowka 87 899 Bogdanowka-Ts<br />
2. Konteniusfeld Sarmatowo 54 517 Dolgoje<br />
3. Rudnerweide Pschenitschnoje 55 671 Rosowka-Ts.<br />
4. Großweide Obiljnoje 40 447 Prostorje-Ts.<br />
5. Franzthal Bastanowka 43 423 Lugowoje-Ts. *<br />
6. Pastwa Plugowoje 31 251 Kwitkowoje-Ts.<br />
7. Marienthal Marjino 39 413 Panfilowka-Ts.<br />
8. Pordenau Potjomkino 24 233 Wesnjanka *<br />
9. Schardau Suworowka 30 403 Scharowka *<br />
10. Alexanderthal Zarjowo-Alexandrowo 0 393 Alexandrowka-Ts.<br />
11. Elisabetthal Elisawetino 45 506 Elisawetowka *<br />
12. Steinfeld Kamenistoje 34 343 Ch.Sadowyj-Ts.<br />
13. Prangenau Jasnopolje 49 518 Udarnik-T<br />
14. Friedensruh Malaschowka 39 487 Mirnoje-T<br />
15. Paulsheim Pawlowka 33 309 Pawlowka *<br />
16. Mariawohl Zarizino 25 319 Seljonyj Gai<br />
17. Nikolajdorf Nikolskoje 29 272 Nikolajewka *<br />
18. Gnadenthal Darowka 27 197 Blagodatnoje<br />
19. Margenau Priwolje 39 289 Rankowoje *<br />
20. Friedensdorf Kornilowka 51 464 Chmelnitzkoje-Ts.<br />
21. Landskrone Chlebnoje 64 407 Lankowoje-Ts.<br />
22. Hirschau Primernoje 5 336 Wladowka-Ts.<br />
23. Waldheim Lesnoje * 71 946 Retschnoje *<br />
24. Hamberg Irinowka 28 203 Kamenka-Ts.<br />
25. Klippenfeld Kamennyj Kut 41 291 Molotschnoje *<br />
26. Steinbach Steinbach -- 48 Kalinowka-Ts.<br />
27. Sparau Klinowoje 64 817 Seljonyj Gai-T<br />
* Lugowoje gehörte zum Dorfsowjet "Prostorowskij". Seit dem 12.06.1964 existiert das Dorf nicht mehr.<br />
* Wesnjanka gehört seit 1958 zu "Panfilowka".<br />
* Scharowka gehört seit 1958 zu "Panfilowka".<br />
* Elisawetowka gehört seit 1958 zu "Alexandrowka".<br />
* Chutor Sadowyj gehört heute zu "Udarnik"-T.<br />
* Paulsheim gehörte zum Dorfsowjet "Bogdanowka". Seit 1965 existiert dieses Dorf nicht mehr.<br />
* Nikolajewka, Blagodatnoje und Rankowoje sind heute (1998) zu einem Dorf Namens "Seljonyj Jar"<br />
(Ts.) zusammengeschlossen worden.<br />
* Retschnoje hieß 1935 auch "Rotfront". 1958 ist dieses Dorf dem Dorf "Wladowka" angeschlossen worden.<br />
* Molotschnoje ist 1958 dem Dorf "Stulnewo" angeschlossen worden.<br />
Abkürzungen: T-Bezirk "Tokmakskij"; M-Bezirk "Melitopolskij"; Ts.-Bezirk "Tschernigowskij".<br />
235
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Heinrich Dirks wurde 1842 in Gnadenfeld<br />
geboren. Nach Beendigung der Dorf-und<br />
Fortbildungsschule studierte er in Deutschland,<br />
Barmen, an dem Missionsseminar. 1869 wurde er<br />
vom Missionskomitee in den Niederlanden nach<br />
Indien geschickt. 1881 kehrte er zurück und wurde<br />
zum Ältesten der Gnadenfelder Gemeinde<br />
gewählt. Er war der Herausgeber des<br />
Mennonitischen Jahrbuches. H.Dirks starb 1915. Er<br />
schriebt wie folgt:<br />
...Als die <strong>Molotschna</strong>-Dörfer noch nicht<br />
angelegt waren, war das Land eine öde Steppe, auf<br />
der man meilenweit fahren konnte, ohne Haus<br />
oder Baum zu sehen, auf der großartige<br />
Fatamorganas (Luftspiegelungen) zu sehen waren.<br />
Als die erste Dorfreihe an der <strong>Molotschna</strong> entstand,<br />
war der übrige Teil des Landes noch eine<br />
weite Urwiese. Auf den Mennoniten angewiesene<br />
Land war eine Terrassenwiese, vermengt mit dem<br />
hochstengligen, blaufleckigen Feldsalbei, Thymian<br />
und wildem Klee. Das Gras mit seinem weißen,<br />
flachsartigen Wedel wurde über einen "Arschin" (=<br />
0,71 m) hoch. <strong>Die</strong> Nadeln darin (Steppnadeln)<br />
drangen den Schafen durch die Wolle und das FeIl<br />
bis ins Fleisch hinein. Im Frühjahr blühten auf<br />
dem Felde die Kuhblume (Nießwurz), weiße, blaue<br />
und gelbe Lilien, gelbe und rote Tulpen,<br />
Rittersporn, Butterblumen, Löwenzahn, Nelken,<br />
Osterviolen (Vergissmeinnicht), Königskerze. Im<br />
Getreide wuchs auch manches Unkraut: Disteln,<br />
Hederich, Rade, die Winde, die Windhexe, milder<br />
Mandelstrauch und Pene. Im Herbst wuchs auf<br />
den Stoppelfeldern Kuraj, der jung und grün ein<br />
gutes Futter ist; alt und trocken jedoch zu stachelig<br />
ist, als dass das Vieh ihn fressen sollte. Er ist aber<br />
als Brennmaterial sehr gut zu brauchen. Abgeeggt<br />
und in Haufen gebracht wurde er fuhrenweise von<br />
den Armen zu ihren Wohnungen gebracht und im<br />
Winter verheizt. Der Kuraj diente gerade in den<br />
Misserntejahren zum Notbehelf als Brennmaterial<br />
oder gar als Futter. Mancher Kurajbusch<br />
(Windhexenstaude), vom starken Wind<br />
entwurzelt, rollte im Herbst werstenweit über das<br />
Stoppelfeld oder über die abgeweidete und erstorbene<br />
Weidesteppe, in der Einbildung eine wandel-<br />
Aufzeichnungen eines Alten<br />
236<br />
nde Hexe, daher der Name Windhexe. Auch der<br />
sogenannte Schwanzzabel (weiße und schwarze<br />
Maddel) wächst auf den Äckern, wo Getreide<br />
geerntet ist, zwischen den Stoppeln nach und ist<br />
ein herrliches Grünfutter. <strong>Die</strong> Pferde wurden<br />
geweidet. Viele Wölfe hausten in dem hohen Gras.<br />
<strong>Die</strong> Zieselmäuse richteten großen Schaden<br />
an. Sie vernichteten das Getreide zum größten Teil,<br />
so dass sich die Ansiedler nur kümmerlich und<br />
ärmlich behelfen mussten. Sie wurden ausgerottet,<br />
indem man in ihre Löcher Wasser goß und sie<br />
ersäufte oder vergiftetes Korn in die Löcher streute.<br />
<strong>Die</strong> abgehackten Schwänze der getöteten Mäuse<br />
mussten bei der Polizei vorgezeigt werden, und es<br />
gab per Stück fünf Kopeken Belohnung. Da ist es<br />
auch vorgekommen, dass faule und trügerische<br />
Leute die Obrigkeit mit gefälschten Schwänzen<br />
betrogen.<br />
Auch die Heuschrecken, die in früheren<br />
Jahren oft in großen Schwärmen aus Asien kamen,<br />
richteten ungeheuer viel Schaden an, und man<br />
bekämpfte sie, indem man die, die noch nicht<br />
flügge waren, mit von Pferden gezogenen kammartigen<br />
Quetschen zerquetschte. <strong>Die</strong> wandernden<br />
Heuschrecken wurden mit langen Besen in<br />
gezogene Gräben dirigiert und dort schnell<br />
begraben. <strong>Die</strong> fliegenden Heuschreckenschwärme<br />
hielt man, soweit es möglich war, durch Schreien,<br />
Schießen, Blechgetrommel, oder durch Dampf von<br />
angezündeter feuchter Gülle oder von Stroh von<br />
dem Niederlassen ab. Wo sie sich aber dennoch<br />
niederließen, da fraßen sie alles Grüne weg:<br />
Getreide, Gras, Gemüse, ja selbst die Blätter von<br />
den Bäumen. Wo die tragenden Heuschrecken sich<br />
mit dem Hinterteil in die Erde bohrten, um ihren<br />
Samen dort zu legen, da mussten die Eier eingesammelt<br />
und vernichtet werden, was sehr mühsam<br />
war und viel Zeit beanspruchte.<br />
1804. Im Frühjahr wurden den Mennoniten<br />
120 000 Desjatin Land an dem Flüsschen<br />
<strong>Molotschna</strong>ja und am Tokmak-Fluss gewährt.<br />
Dort, wo die Dörfer Sparrau und Konteniusfeld<br />
angesiedelt wurden, ist der Anfang des Kuruschan-<br />
Flusses, welcher bei Rückenau und Ohrloff vorbeigeht<br />
und zwischen Blumstein und Münsterberg
Kapitel 31 <strong>Die</strong> Ansiedlung<br />
in die <strong>Molotschna</strong> mündet.<br />
Der Steppenfluss Juschanlee nimmt seinen<br />
Anfang ganz an der Ostgrenze des von der<br />
Regierung den Mennoniten zugewiesenen Landes,<br />
hat verschiedene Krümmungen und auf Stellen<br />
steile Felsufer; er mündet dicht an der<br />
Südwestgrenze des Mennoniten-Landes.<br />
Auch verlieh die Krone einigen Mennoniten<br />
Landstücke zur Anlage von Musterwirtschaften<br />
(Steinbach). Ein zweite Landstück von 500<br />
Desjatin, genannt Juschanlee, wurde Johann<br />
Cornies aus Ohrloff zur Musterwirtschaft<br />
übergeben. Auf Cornies Befehl wurden an den<br />
Wegen um die Äcker herum Bäume gepflanzt. <strong>Die</strong><br />
Wirte in den Dörfern waren verpflichtet,<br />
Obstgärten am Hof, _ Desjatin Maulbeerbäume<br />
und Waldbäume anzupflanzen und die<br />
Poststraßen mit Dämmen und Brücken zu versehen.<br />
In Rosenort ist die erste Andacht gewesen.<br />
Dann wurden die Kirchen in Lichtenau und<br />
Ohrloff gebaut. Auch sonst hatte die neue Siedlung<br />
mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Bauholz<br />
musste man weit vom Dnjepr holen.<br />
Als Heizmaterial mussten Gras, Stroh<br />
und getrockneter Mist dienen. Lange<br />
fehlte es an einem Markt. Man<br />
brachte die Produkte erst nach<br />
Taganrog, dann, als Berdjansk<br />
gegründet war, dorthin. An der<br />
großen Poststraße von Charkow, die<br />
über Jekaterinoslaw, Orechow<br />
(damalige Kreisstadt), Kisljar<br />
(Melitopol) in der Krim über<br />
Achmedsched (Simferopol) nach<br />
Bachtschisaraj, dem Sitz des früher<br />
regierenden Chans, ging und die sich<br />
auch durch die Reihe der<br />
Mennonitendörfer an der<br />
<strong>Molotschna</strong> von Ladekopp bis<br />
Altonau zog, musste an den Grenzen<br />
des Mennonitenlandes bei Tokmak<br />
und Altonau auf Befehl der hohen<br />
Obrigkeit jeweils ein von Ziegeln<br />
gemauerter Pfeiler mit Kuppel<br />
errichtet werden. An der der<br />
Poststraße zugekehrten Seite war<br />
eine Tafel angebracht, die unter dem Symbol<br />
zweier einander fassenden Hände die Inschrift<br />
trug: "Semlja Mennonitskogo Bratstwa" (Land der<br />
Mennonitenbrüderschaft), wo öfters hohe<br />
Herrschaften, die auf ihren Karossen nach dem<br />
Süden der Krim reisten, Halt machten, den Pfeiler<br />
besahen und die Inschrift lasen, denn<br />
Eisenbahnen gab es zu jener Zeit im Süden<br />
Russlands noch nicht.<br />
<strong>Die</strong> deutschen Ansiedler wurden zur Zeit des<br />
Zaren Paul I. unter ein Vormundschaftskomitee<br />
gestellt, welches sich in Jekaterinoslaw befand und<br />
dem der Herr Kontenius vorstand.<br />
Nördlich vom Mennonitenland liegt noch<br />
eine Reihe Dörfer deutscher Kolonisten,<br />
lutherischer und katholischer Konfession. Südlich<br />
dagegen befinden sich Nogaier, ein tatarischer<br />
Volksstamm, der größtenteils von Viehzucht lebt.<br />
Südlich von dem Mennonitenland wohnten die<br />
verbannten Molokaner in ihren Dörfern.<br />
Auszug aus H. Dirks, "Aus den<br />
Aufzeichnungen eines Alten," in Der Bote, Nr. 34,<br />
1999.<br />
Missionar Heinrich Dirks (1842-1915). Ältester der<br />
Gnadenfelder Mennoniten-Gemeinde. Foto aus Quiring und<br />
Bartel, Als ihre Zeit erfüllt war, Seite 69. Dirks war ein<br />
Nachfolger von Heinrich Jung-Stilling und war gegen die<br />
Auswanderung der Mennoniten in der 1870er Jahren. Reimer<br />
und Gaeddert, Exiled by the Czar (Newton, Kansas 1956), Seite<br />
71. Seihe auch Urry, None but Saints,Seite 227.<br />
237
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
<strong>Die</strong> Nachbarn der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
<strong>Die</strong> Nogaier.<br />
Als Nachzügler der "Goldenen Horde" des<br />
Tschingis-Chans kamen sie mit den Mongolen<br />
nach Europa. Im 8. Jahrhundert wanderten sie<br />
über den Don, Dnjepr und Dnjestr nach<br />
Bessarabien, wo sie lange Zeit ihr Nomadenleben<br />
fortsetzten, wurden mit der Zeit von den Türken<br />
und Moldawanern bedrückt und baten die<br />
Kaiserin Katharina II. um Aufnahme in den russischen<br />
Untertanenverband. Sie wurden zuerst nach<br />
dem Kaukasus verwiesen, aber schon 1789 bekamen<br />
sie die Erlaubnis, nach der <strong>Molotschna</strong> zu<br />
ziehen.<br />
<strong>Die</strong> Nogaier waren ein wildes und armes Volk.<br />
Sie wohnten in leichten, beweglichen Hütten und<br />
äußerst unreinlich. <strong>Die</strong> Hauptbeschäftigung war<br />
Viehzucht. Als durch die ansässigen Ansiedler<br />
(Mennoniten) ihre Freizügigkeit beengt wurde und<br />
sie ihre Kibitken (Zelte) an einem bestimmten<br />
Platz festsetzen mussten, waren sie gezwungen,<br />
auch Ackerbau zu betreiben. Sie hassten die<br />
Mennoniten als Eindringlinge und fügten ihnen<br />
durch Räubereien viel Schaden zu, ermordeten<br />
sogar einige, indem sie ihnen einen Arkan<br />
(Schlinge) um den Leib warfen, sie vom Pferdesitz<br />
herunterzogen und den Weg entlang schleppten.<br />
Doch die Regierung wusste Rat. <strong>Die</strong><br />
Schuldigen aus ihrer Mitte wurden angezeigt und<br />
ausgesiedelt. Später ließ die Regierung die Nogaier<br />
entwaffnen, und sie mussten das Land verlassen.<br />
Nach dem Krimkrieg 1853-1856 wurden unter<br />
den Mohammedanern die Mekka-Reisen häufig.<br />
<strong>Die</strong> Zurückgekehrten verstanden es, ihrem Volke<br />
den Koran zu predigen und sie zu lehren: sie<br />
mussten aus Russland auswandern und in die<br />
Türkei, das Land ihrer Glaubensgenossen, ziehen.<br />
Der ganze Nogaierstamm im Berdjansker Kreise<br />
machte sich auf und zog in die europäische Türkei.<br />
Sie bereuten es aber sehr, denn bei ihren Brüdern,<br />
den Türken, waren Raub und <strong>Die</strong>bstahl zu Hause.<br />
Sie waren dort bald ganz verarmt.<br />
bauen mit Vorliebe Gemüse an, versehen die<br />
Märkte mit Kraut, Baklaschanen, großen Zwiebeln,<br />
kaufen und zahlen gute Preise für deutsche Pferde<br />
und Wagen. Eine Anzahl der Bulgaren aber sehnte<br />
sich nach ihren türkischen Bergen und kehrte in<br />
die Türkei zurück.<br />
<strong>Die</strong> Molokaner.<br />
<strong>Die</strong>se wurden 1823 aus Tambow und Wladimir<br />
ausgewiesen und inmitten der Nogaier und<br />
Mennoniten angesiedelt. Ihre Dörfer waren<br />
Astrachanka, Nowo-Wasiljewka und Schafkaj. Sie<br />
bildeten eine Sekte, hatten freie Gemeinden mit<br />
Predigern aus ihrer eigenen Reihe, aßen kein<br />
Schweinefleisch, dafür aber viel Hammelfleisch<br />
und tranken viel Milch-daher der Name<br />
Molokaner (Milchleute). <strong>Die</strong> Molokaner waren ein<br />
sehr wirtschaftliches Volk. Sie waren durch Viehund<br />
Schafzucht reich geworden. Äußerlich waren<br />
sie sehr religiös, aber unter ihnen kam auch viel<br />
Schwindel und Betrug vor. Bei den mennonitischen<br />
Kaufleuten machten sie Einkäufe auf Borg<br />
und saßen hier tief in Schulden, die sie aber größtenteils<br />
niemals zahlten. Später zersplitterten sich<br />
die Molokaner in mehrere Gemeinschaften, so<br />
dass es Alt-, Neu- und baptistische Molokaner gab.<br />
<strong>Die</strong> Duchoborzen.<br />
<strong>Die</strong> Duchoborzen Dörfer waren Terpenje,<br />
Troizki, Bogdanowka, Dubowaja Balka,<br />
<strong>Die</strong> Bulgaren.<br />
Tomakowka, wo die aus Russland verwiesenen<br />
Duchoborzen (Geisteskämpfer) wohnten. Sie<br />
kamen aus Tambow und Woronesch nach<br />
Erlaubnis des Kaisers und durften an der<br />
<strong>Molotschna</strong> ansiedeln. Es gab bei ihnen keine<br />
Bethäuser und Geistlichen, denn sie erkannten nur<br />
Christum als Lehrer und Priester an. Sie hatten<br />
Gütergemeinschaft. Da auch bei dieser Gruppe mit<br />
der Zeit alles Geistliche verschwand und sie sogar<br />
Verbrechen begingen, sollten sie nach Sibirien verbannt<br />
werden. Doch da kam Cornies rettende<br />
Hand, und sie durften nach dem Kaukasus<br />
auswandern. Sie verließen alles und fuhren in lan-<br />
Das Land der Nogaier wurde von den aus der gen Reihen von russischen Wagen, mit guten<br />
Türkei kommenden Bulgaren besetzt. <strong>Die</strong> Pferden bespannt, nach dem Kaukasus. Hinter<br />
Bulgaren wurden in den deutschen <strong>Kolonie</strong>n im dem Cornies-Land, hinter Melitopol am<br />
Winter beherbergt und ernährt. Sie wohnten jetzt Taschtschenak, waren noch vier weitere<br />
in einigen Dörfern südlich von dem Duchoborzendörfer: Duchoborzy, Radionowka,<br />
Mennonitenland. <strong>Die</strong>se sind tüchtige Bauern. Sie Garsloj und Damidowka.<br />
238
Kapitel 32 Halbstadt - Molotschansk<br />
1804 wurde Halbstadt mit noch acht anderen<br />
Dörfern in dem <strong>Molotschna</strong>er Gebiet in<br />
Südrussland von den Mennoniten aus<br />
Westpreußen gegründet. Eigentliche Anführer<br />
hatte diese Gruppe nicht, aber Klaas Wiens(geb.<br />
1767) (später Altonau), der von 1804 bis 1806<br />
Oberschulze des Mennonitenbezirks <strong>Molotschna</strong><br />
war, und David Hübert (später Lindenau) hatten<br />
einigermaßen das Ruder in der Hand. Den<br />
Namen gab Klaas Wiens dem Dorf, auf Wunsch<br />
der Ansiedler, nach einem gleichnamigen Dorf in<br />
Preußen. Halbstadt liegt in der Nähe der<br />
Bahnstation Polugorod (Halbstadt). Halbstadt<br />
hat viel länger als die übrigen Dörfer ihren<br />
deutschen Namen beibehalten. Anfänglich<br />
umfasste Halbstadt 21 Vollwirtschaften mit je 70<br />
Desjatin, später wurden ihm noch 25<br />
Kleinwirtschaften zu je 25 Desjatin zugewiesen.<br />
<strong>Die</strong> besondere Bedeutung des Dorfes<br />
bestand am Anfang darin, dass in diesem Dorf<br />
das "Gebietsamt" eingerichtet wurde. Mehr aber<br />
trat die Bedeutung des Dorfes dadurch hervor,<br />
dass es unter all den 58 mennonitischen Dörfern<br />
im Gebiet <strong>Molotschna</strong> die meisten gewerblichen<br />
und industriellen Unternehmungen hatte. Im<br />
Laufe der Zeit sind im Betrieb gewesen: eine<br />
Tuchfabrik, eine Bier-und Essigbrauerei, zwei<br />
große Dampfmühlen, eine Stärkefabrik, eine<br />
Graupenmühle, eine Maschinen-Motor-Fabrik<br />
und zwei Ziegelfabriken.<br />
1816 wurde Halbstadt zu einem<br />
Gebietszentrum. 1869 hatte Halbstadt 21<br />
Vollwirtschaften und 29 Kleinwirtschaften.<br />
1870 entstand in der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, in<br />
Gnadenfeld, noch ein Gebietsamt. Der<br />
Halbstädter Bezirk bestand jetzt aus 30 Dörfern.<br />
1915 wurde Halbstadt in "Polugorod" umbenannt.<br />
1926 gab es nach der Verstaatlichung aller<br />
größeren industriellen Unternehmungen jetzt<br />
nur noch die Bier-und Essigbrauerei und eine<br />
Ziegelei und aus neuerer Zeit noch zwei<br />
Ölpressen.<br />
Anfangs nur aus mennonitischen<br />
Einwanderern bestehend, hat Halbstadt infolge<br />
239<br />
des Zuzugs von Fabrikarbeitern mit der Zeit die<br />
verschiedensten Bevölkerungselemente<br />
aufgenommen. Schon 1914 waren die<br />
Nichtmennoniten in der Mehrheit, wodurch es<br />
den Mennoniten erschwert wurde, sich in ihrer<br />
sozialkulturellen Eigenart zu behaupten.<br />
1926 betrug die Gesamtzahl der Bevölkerung<br />
1455 Personen, davon 482 Mennoniten.<br />
Dorfschule. 1835 hatte Halbstadt eine<br />
Dorfschule, eine Fortbildungsschule (für die<br />
Ausbildung von Lehrern und Predigern), aus der<br />
später eine Zentralschule entstand und die<br />
später nach Neu-Halbstadt verlegt wurde. 1870<br />
wurde in der Zentralschule die russische Sprache<br />
eingeführt.<br />
Mittelschule. 1908 wurde hier eine höhere<br />
Lehranstalt, in Russland "Mittelschule" genannt,<br />
gegründet, wodurch Halbstadt und Neu-<br />
Halbstadt zu einem mennonitischen<br />
Kulturzentrum in der <strong>Molotschna</strong> wurden.<br />
Nachdem diese Schule nach kurzer Zeit in eine<br />
achtklassige Kommerzschule (entspricht einer<br />
deutschen Oberrealschule) umgestaltet wurde,<br />
hatte sie so eine hohe Frequenz, dass mehrere<br />
Jahre Parallelklassen eingerichtet werden<br />
mussten. Seit 1923 bestand sie als "Halbstädter<br />
Landwirtschaftliche Schule".<br />
Tuchfabrik. Sie wurde von Johann Klassen 1815-<br />
16 gebaut. 1839 brannte sie ab und wurde 1842<br />
wieder schöner und vollkommener aufgebaut.<br />
<strong>Die</strong>se Fabrik bekam von der Krone 3000 Desjatin<br />
Land geschenkt. <strong>Die</strong>ser Fabrik war eine Färberei<br />
und Weberei angeschlossen. 1843 beschäftigte<br />
sie 48 Mitarbeiter.<br />
Hermann Neufeld Brauerei. Sie wurde 1832<br />
gegründet und war als Hermann Neufeld Bierund<br />
Essigfabrik und Limonadenfabrik bekannt.<br />
Kreditanstalt. Sie wurde 1860 gebaut. Heute ist<br />
hier eine Turnhalle.<br />
Franz & Schröder Fabrik. Sie wurde in den<br />
1860er Jahren gegründet und beschäftigte 200<br />
Arbeiter. Hier wurden Pumpen und andere<br />
Geräte hergestellt. Zwei Gebäude dieser Fabrik<br />
stehen noch.<br />
Seit 1974 heißt Halbstadt "Molotschansk".
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Karte von Halbstadt und Neu-Halbstadt, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, im Jahre 1913, von William Schroeder,<br />
Mennonite Historical Atlas,Seite 38.<br />
240
Kapitel 32 Halbstadt - Molotschansk<br />
Das Gebietsamt in Halbstadt ursprünglich. Es wurde 1816 gebaut. 1845 wurde ein neues Gebäude für das<br />
Gebietsamt in Neu-Halbstadt gebaut. Heute ist hier ein Laden. Foto aus G. Lohrenz, Seite 133.<br />
Das ehemalige mennonitische<br />
Gebietsamt in Neu-Halbstadt.<br />
Im Keller dieses Gebäudes<br />
wurden viele mennonitische<br />
Männer, die in den Jahren<br />
1937-1938 von der NKWD<br />
verhaftet wurden, knieend<br />
durch einen Kopfschuss von<br />
hinten getötet. <strong>Die</strong> Leichen<br />
wurden in der Nacht in einem<br />
Massengrab geheim begraben.<br />
Text aus Preservings, Nr.13,<br />
Seite 1. Foto: August 1997.<br />
241<br />
<strong>Die</strong>se Tafel hängt am<br />
Gebietsamt in Halbstadt. Im<br />
Text geht es darum, dass sich<br />
1917-1918 in diesem<br />
Gebäude der revolutionäre<br />
Kommissariat und der Stab<br />
der Rotarmisten der Stadt<br />
Molotschansk befanden. Foto:<br />
August 1997.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
<strong>Die</strong> Mühle Heinrich Willms & Sudermann. Hier<br />
war auch die erste Stärkefabrik in Halbstadt.<br />
Anfänglich war sie siebenstöckig. Das Kraftwerk,<br />
in dem eine Dampfmaschine arbeitete, stand<br />
nebenan. Auf der sechsten Etage befand sich ein<br />
Balkon, von dem man einen Überblick über die<br />
ganze Gegend hatte. <strong>Die</strong>se Mühle beschäftigte<br />
120 Arbeiter. Sie brannte in den 1920er Jahren ab,<br />
wurde aber wieder hergestellt. Heute ist hier eine<br />
Milchfabrik.<br />
Rechts: <strong>Die</strong> Willms-Dampfmühle in Halbstadt.<br />
Foto: August 1994.<br />
Das Haus des Mühlenbesitzers Heinrich Willms. Heute ist hier eine Frauenherberge. Foto: August 1994.<br />
242
Kapitel 33 Neu-Halbstadt - Molotschansk<br />
Handwerkersiedlung.<br />
1843 wurde Neu-Halbstadt, am östlichen<br />
Ende von Halbstadt gelegen, von J. Cornies<br />
gegründet. <strong>Die</strong> Bestätigung kam vom<br />
Fürsorgekomitee 1842, weil von den 539<br />
Handwerkerfamilien in Halbstadt 269 Familien<br />
kein Land besaßen. Hier wurden damals nur<br />
Handwerker aufgenommen. <strong>Die</strong>ses Dorf besaß<br />
damals 206 Desjatin im Vergleich zu Halbstadt,<br />
das damals 2022 Desjatin Land besaß. Neu-<br />
Halbstadt entwickelte sich bald zu einem Zentrum<br />
des geistigen und wirtschaftlichen Lebens. Hier<br />
war der Sitz der Wolostverwaltung, der das<br />
Waisenhaus und die Brandversicherung unter-<br />
243<br />
stellt waren. Das Zentrum vom heutigen<br />
Halbstadt war früher Neu-Halbstadt.<br />
1860 hatte Halbstadt 76 Höfe (532 Seelen).<br />
Zentralschule. <strong>Die</strong> 1835 in Halbstadt erbaute<br />
Fortbildungsschule wurde 1878 nach Neu-<br />
Halbstadt verlegt, und gleichzeitig wurde hier ein<br />
zwei jähriger pädagogischer Kursus eröffnet.<br />
<strong>Die</strong>ser Kursus wurde später in ein Lehrerseminar<br />
umgewandelt. Das 1895 neu erbaute<br />
Schulgebäude hatte acht Klassenzimmer, Labor,<br />
Bibliothek und Lehrerwohnungen. 1913 besuchten<br />
diese Schule schon 150 Schüler. Heute ist es ein<br />
Verwaltungsgebäude.<br />
Das erste Halbstädter<br />
Zentralschulgebäude in Alt-<br />
Halbstadt. Gebaut 1835. Foto<br />
aus Lohrenz, Seite 182.<br />
Das zweite Zentralschulgebäude<br />
in Neu-Halbstadt. Erbaut 1860.<br />
Foto aus Lohrenz, Seite 182.<br />
<strong>Die</strong> Zentralschule (das dritte<br />
Schulgebäude von 1895) in<br />
Halbstadt. Das Gebäude wird<br />
als Parteibüro gebraucht. Foto:<br />
August 1997.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Mädchenschule. 1875 ging aus einem kleinen<br />
Unternehmen in Neu-Halbstadt die "Halbstädter<br />
Mädchenschule" hervor. Sie wurde zu einer<br />
Mittelschule mit dem Programm eines weiblichen<br />
Gymnasiums ausgebaut. Heinrich Franz hatte in<br />
einem einfachen Bauernhaus eine<br />
Fortbildungsschule für Mädchen gegründet. Sie<br />
hatte anfänglich nur ein zwei-jähriges Programm.<br />
244<br />
Am 18.12.1909 wurde sie eingeweiht. Heute ist<br />
hier immer noch eine Schule.<br />
Ab 2000 ist die Mädchenschule von einer<br />
Gesellschaft "Freunde eines Mennonitischen<br />
Zentrums, Ukraine," gekauft worden, um den<br />
Bewohnern Hilfe zu leisten und als kulturelles<br />
Zentrum zu dienen. Seihe Preservings, Nr. 18, Seite<br />
64.<br />
<strong>Die</strong> Mädchenschule in Neu-Halbstadt in ihrer ursprünglichen Gestaltung. Foto aus G. Lohrenz, Seite 187.<br />
<strong>Die</strong> Mädchenschule in Neu-<br />
Halbstadt. Foto: August 1997.<br />
Ansicht der Fassade der<br />
Mädchenschule in Neu-<br />
Halbstadt. Foto: August 1997.
Kapitel 33 Neu-Halbstadt - Molotschansk<br />
Altres-und Pflegeheim "Morija". Am 03.12.1909<br />
wurde in Neu-Halbstadt das Diakonissenheim<br />
"Morija" von den Spenden des Peter Schmidt aus<br />
Steinbach eröffnet. Unterhalten wurde dieses<br />
Heim von den Spenden der Mennoniten. Zweck:<br />
Unterhaltung und Versorgung im Alter. Um die<br />
Gründung dieser Anstalt haben sich Franz Wall<br />
und Dr.Tavonius besonders verdient gemacht.<br />
1914 zog diese Anstalt in ein neues zweistöckiges<br />
Gebäude. Das alte Gebäude kaufte Johann<br />
Schröder und richtete dort ein Wohnhaus ein. Als<br />
seine Frau starb und er 1922 eine Witwe aus<br />
Tiegenhagen heiratete, zog er nach Tiegenhagen.<br />
Was mit dem Gebäude später passierte, ist nicht<br />
bekannt.<br />
Bis 1918 sind 89 Personen aufgenommen<br />
worden. 31 Schwestern und 10 Schüler wurden<br />
hier ausgebildet. 1918-1920 wurde das Haus völlig<br />
ausgeraubt, und doch hat es in den schwersten<br />
Jahren eine besondere Segenskraft entfaltet.<br />
Das Diakonissenheim<br />
"Morija" in Neu-<br />
Halbstadt. Hier wurden<br />
auch<br />
Krankenschwestern<br />
ausgebildet. Foto aus<br />
G. Lohrenz, Seite 122.<br />
Kurz vor dem Krieg wurde diese Anstalt sehr erweitert und in einem neuen, zweistöckigen Gebäude in<br />
Neu-Halbstadt untergebracht. Foto aus Quiring und Bartel, Seite 73.<br />
245
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Altenheim. In den Jahren 1900-1905 sammelten die<br />
Mennoniten Spenden zur Errichtung eines großen<br />
Altenheimes. Es wurde im November 1906 eröffnet<br />
und war für 100 Personen ausgerichtet. Alle<br />
Heimbewohner arbeiteten, jeder nach seinen<br />
Kräften.<br />
Verlagsgesellschaft "Raduga". <strong>Die</strong> schriftstellerische<br />
Tätigkeit der Brüder Abraham (1863 - ?)<br />
und Jakob Kröker (1872-?) entwickelte sich derart,<br />
dass sie 1908 aus einer Druckerei (mit 40 Arbeitern),<br />
die J. J. Braun gehörte, ein Verlagshaus in Neu-<br />
Halbstadt gründeten. <strong>Die</strong> Teilnehmer an diesem<br />
Verlagshaus waren außer den genannten Brüdern<br />
Kröker noch andere Glieder der Brüdergemeinde:<br />
Heinrich Braun, Isaak Regehr, Jakob Friesen und<br />
Leiter der russischen Evangelischen Christen<br />
Prochanow (geboren 1869). <strong>Die</strong>ses Verlagshaus<br />
blieb Eigentum einer Gesellschaft. <strong>Die</strong> Brüder<br />
Kröker waren Schriftleiter der "Friedensstimme".<br />
Hier ließ auch P. M. Friesen sein Werk drucken. Es<br />
wurden auch russische Traktate gedruckt.<br />
Das Gebäude der Verlagsgesellschaft "Raduga" in Halbstadt. Foto: August 1997.<br />
Abraham Kröker (1863-?), Redakteur der Hermann Neufeld, Essig-und Bierbrauerei<br />
Zeitschrift "<strong>Die</strong> Friedensstimme" in Halbstadt. Fabrikbesitzer in Halbstadt. Foto aus Quiring und<br />
Foto aus G. Lohrenz, Seite 147.<br />
Bartel, Seite 67.<br />
246
Kapitel 33 Neu-Halbstadt - Molotschansk<br />
Abraham F. Thiessen 1838-89, Revolutionär<br />
Abraham F. Thiessen (1838-89) war der Sohn Staaten nicht einmal mit <strong>Die</strong>ben und Mördern<br />
von Peter Thiessen (1808-73) und Margaretha verfährt. Dass ich nicht mit Mördern in Ketten<br />
Friesen (1810-77), Schönau, <strong>Molotschna</strong>. gefesselt und gezwungen wurde, den ganzen Tag<br />
Margaretha war die Tochter von Abraham Friesen zu meinem Verbannungsort zu Fuß zu gehen,<br />
(1782-1849), dem zweiten Ältesten der Kleinen kostete mich 400 Rubel. Während meiner zwei-<br />
Gemeinde. Abraham F. Thiessen war ein erfolgrejährigen Verbannung kamen diese Worte immer<br />
icher Kaufmann in Halbstadt.<br />
wieder in mein Gedächtnis: Könnte diese<br />
Abraham wurde 1864 aus der Kleinen Verbannung, verbunden mit dem <strong>Die</strong>bstahl<br />
Gemeinde ausgeschlossen, weil er seinen Knecht meines gesamten Eigentums, ohne dass ich eine<br />
geschlagen hatte. Das Ereignis löste 1866 eine Idee hatte, womit ich dies alles verschuldet hatte,<br />
große Spaltung aus.<br />
irgendeinem nützlichem Zweck dienen?"<br />
Um 1867 waren 71 Prozent der Familien in der Thiessen schrieb von dem schrecklichen<br />
<strong>Molotschna</strong> landlos. Das Land, das für eine kün- Missbrauch der Menschenrechte, den er<br />
ftige Ausdehnung reserviert worden war, wurde beobachtete: die alles durchdringende<br />
von wohlhabenden Bauern zum niedrigen Preis Geheimpolizei sowie die bis zum Dach überfüllten<br />
gemietet, die es landlosen Familien zu maßlosen Gefängnisse mit Gefangenen, die jahrelang festge-<br />
Preisen verpachteten.<br />
halten wurden, ohne den Grund zu kennen. Er<br />
Thiessen wurde als Advokat der landlosen beschrieb auch das sträfliche Steuersystem in<br />
Mennoniten in Russland sehr bekannt. Er unter- Russland, verbunden mit sehr strengen<br />
nahm in den Jahren 1866 bis 1873 viele Reisen Einziehungsmethoden, welche es für die<br />
nach St. Petersburg zum Regierungsministerium Russenbauern fast unmöglich machten, jemals<br />
für die rechtlichen Interessen der vom Wahlrecht aus der Armut herauszukommen.<br />
ausgeschlossenen und "stimmlosen" Anwohner, Der Historiker Heinrich N. Fast schreibt, dass<br />
denen Korruption und Betrug widerfuhr, "nachdem seine Frau gestorben war (1873),<br />
einzusetzen.<br />
schickte er seinen einzigen Sohn Johann mit<br />
<strong>Die</strong> Folge war, dass Abraham F. Thiessen von seinem Bruder Peter nach Amerika." Thiessen<br />
seinen Feinden angeklagt und verhaftet wurde. Als flüchtete zwei Jahre später, 1876, aus der Verban-<br />
seine Frau am 1. Juni 1873 starb, wurde Abraham nung. Abraham kam durch Bestechung aus dem<br />
aus dem Gefängnis freigelassen, um der Gefängnis heraus und flüchtete nach Westeuropa<br />
Beerdigung beizuwohnen.<br />
mit allen Abenteuern, wie in einem<br />
Abraham F. Thiessen schrieb vier Bücher, in Spionageroman. Abraham F. Thiessen wanderte<br />
denen er seinen Fall verteidigte. Ein Brief nur für 1876 in Jansen, Nebraska, ein.<br />
die Mennoniten im Berdjanschen Kreis (Odessa, Abraham heiratete zum zweiten Mal, und<br />
1872), 26 Seiten; <strong>Die</strong> Lage der deutschen Kolonisten zwar Anna Heidebrecht, Tochter von Peter<br />
in Russland (Leipzig, 1876), 17 Seiten; Ein Rätsel Heidebrecht, Blumstein, <strong>Molotschna</strong>, einem<br />
oder die Frage: Weshalb war ich vom Jahre 1874 bis wohlhabenden Vollwirt der Kleinen Gemeinde.<br />
1876 in der Verbannung? (n.p., 1876)", 16 Seiten; 1887 kehrte Abraham F. Thiessen nach Russland<br />
und <strong>Die</strong> Agrarwirren bei den Mennoniten in zurück wegen seiner Sorge um die landlosen<br />
Südrussland (Berlin, 1887), 24 Seiten. 1874 wurde Mennoniten, "um für die Armen und Unterdrück-<br />
Abraham Thiessen wegen seiner Bemühungen in ten" zu sprechen. Wieder wird er ins Gefängnis<br />
der Landreform nach Sibirien verbannt.<br />
gesteckt. Durch die Fürsprache von Bruder<br />
Thiessen beschrieb später seine Erfahrungen: Johann P. Thiessen, einem Senator für den Staat<br />
"<strong>Die</strong> Führung Gottes ist nicht erklärbar, und oft Nebraska, wurde Abraham aus dem Gefängnis<br />
erkennen wir Menschen erst später, dass das, was entlassen und aus Russland ausgewiesen.<br />
von uns gefordert wurde, das ist, was ein Abrahams Sohn Johann (1866-1938) wohnte<br />
Bekannter mir am 27. April 1874 auf der Straße auch entlang der "Russischen Straße" in Rosenort,<br />
zurief. <strong>Die</strong>s war ein Tag, an dem ich ohne Cub Creek County, bei Jansen, Nebraska. Um 1880<br />
Gerichtsurteil ergriffen und abtransportiert besaß er schon 240 Acker kultiviertes Land und<br />
wurde, auf eine Art, wie man in europäischen einen Bauernhof im Wert von 3000 Dollar. Er<br />
247
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
wurde ein erfolgreicher Bankkaufmann in Jansen,<br />
Nebraska.<br />
Abraham F. Thiessen wurde eine umstrittene<br />
Gestalt unter den russischen Mennoniten und<br />
hatte viele Kritiker und Unterstützer sowohl<br />
innerhalb als auch außerhalb der Kleinen<br />
Gemeinde. Für die einen war er ein<br />
Abraham F. Thiessen (1838-89), Neu-Halbstadt. Foto<br />
aus Mennonite Life, 1969 April, Seite 77/Aus D. <strong>Plett</strong>,<br />
Saints and Sinners,Seite 129.<br />
Kleinigkeitskrämer und für die anderen ein<br />
visionärender Advokat für die Unterdrückten und<br />
Notleidenden.<br />
Dr. Kornelius Krahn, Bethel College, Newton,<br />
Kansas, nannte Abraham F. Thiessen, "der<br />
Mennonitische Revolutinär". Seihe Mennonite<br />
Life, 1969 April, Seite 77.<br />
Circa 1880. Oberschulz David A. Friesen (1807-93) und Frau Helena Regier Klassen (1812-92), Halbstadt.<br />
David A. Friesen war Oberschulze in der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong> von 1848 bis 1865, 17 Jahre lang. Frau Friesen<br />
war die Tochter von Johann Klassen (1785-1841), Tiegerweide. Klassen und sein Schwager, Johann Regier<br />
(1802-1842), Schönsee, dienten als Oberschulzen von 1827 bis 1842 und arbeiteten in enger Verbindung mit<br />
Johann Cornies. Helenas Bruder, Abraham Klassen (1828-1906), Prangenau, war ein Prediger der Kleinen<br />
Gemeinde, der 1874 nach Amerika zog. Sein Ururenkel, Matt Groening, ist Gründer des Fernseh-Programms<br />
"<strong>Die</strong> Simpsons". Johann Klassen (1785-1841) seine Frau, Helena Regier, war die Enkelin des Peter Epp (1725-<br />
1789), Ältesten der Danziger Gemeinde. Foto aus D. <strong>Plett</strong>, Saints and Sinners,Seite 98.<br />
248
Kapitel 34 Muntau – Molotschansk<br />
1804 wurde Muntau im Nordwesten der<br />
<strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, früher Gouvernement Taurien,<br />
aus 21 Familien unter der Leitung von Klaas Wiens<br />
gegründet. Der Name wurde von einem gleichnamigen<br />
Dorf in Preußen übernommen.1913 bestand<br />
das Dorf aus 700 Personen. Es wurde eine<br />
Dampfmühle und eine Stärkefabrik gebaut, die um<br />
die Jahrhundertwende aufgegeben wurden.<br />
1830 wurde ein Wald angelegt. Johann Koop<br />
(1801-36), Heinrich Reimer (1792-1884) und<br />
Prediger Johann Dück (1801-66) waren drei von den<br />
tüchtigen Bauern aus der Kleinen Gemeinde in<br />
diesem Dorf. Dück sein Tagebuch enthält viele<br />
Tatsachen von der Kleine Gemeinde Lehrdienst aus<br />
249<br />
den Jahren 1848-1860.<br />
Bis 1958 hieß Muntau "Jasnowka", dann wurde<br />
sie an Molotschansk angeschlossen.<br />
Krankenhaus. 1889 ermöglichte eine Stiftung von<br />
Franz Wall die Errichtung eines Krankenhauses, das<br />
1911 durch einen Neubau erweitert wurde. <strong>Die</strong>se<br />
Anstalt ist ein rein privates Glaubenswerk und war<br />
juristisch Eigentum der Familie Wall. 1906 übernahm<br />
der Sohn von Franz Wall die Leitung des<br />
Krankenhauses. Es hatte 60 Betten. 1913 bestand<br />
das Personal aus drei Ärzten und acht<br />
Krankenschwestern. Heute ist hier ein<br />
Kindersanatorium.<br />
Das Muntauer Krankenhaus. Foto aus G. Lohrenz, Seite 126.<br />
Franz Wall mit Frau, Gründer des<br />
Muntauer Krankenhauses. Er wurde in<br />
die Verbannung geschickt. Foto aus G.<br />
Lohrenz, Seite 171.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Doktor Erich Tavonius (1872-1927)<br />
Geboren ist Doktor Tavonius am 3. Oktober<br />
1872 in einer kleinen Festung namens Psebaj im<br />
Gebiet Kuban.<br />
Im Mai 1890 machte er sein Abitur, und<br />
zwecks Studium der Medizin bezog er die<br />
Dorpater Universität. Er absolvierte die<br />
Universität 1895 mit höchstem Lob.<br />
In demselben Jahr erhielt er die Stelle als<br />
Arzt im Hospital in Krementschug,<br />
Gouvernement Poltava, wo er unter der Leitung<br />
des tüchtigen Chirurgen Dr. Bogajewskij arbeitete.<br />
Daraufhin war er kurze Zeit auf einem Gut<br />
des Großfürsten Dimitrij Konstantinovic bei<br />
Mirgorod. <strong>Die</strong>se Stelle vertauschte er aber bald<br />
mit der Stelle eines Semstwoarztes in Nowo-<br />
Wasiljewka, Kreis Berdjansk, wo er bis 1900 blieb.<br />
Als um diese Zeit der Posten des Leiters des<br />
Muntauer Krankenhauses und des<br />
Kolonialarztes frei wurde, kam er durch die<br />
Vermittlung seiner in der Nähe von Nowo-<br />
Wasiljewka wohnenden Freunde Jakob<br />
Sudermann und David Dyck aus Apanlee nach<br />
Muntau.<br />
Der Hausstand des jungen Arztes wurde<br />
1903 durch die Heirat mit der Tochter des Pastors<br />
von Prischib, Baumann, gegründet. Der Gründer<br />
des Muntauer Krankenhauses, Franz Wall, starb<br />
1905.<br />
Tavonius seine Frau Margarethe Baumann,<br />
erkrankte und wurde 1909 in die Irrenanstalt in<br />
Mietau, Ostpreußen, eingewiesen, wo sie auch in<br />
den 20er Jahren starb.<br />
<strong>Die</strong> Zahl der Kranken wuchs, die Räume<br />
wurden zu eng. Ein Anbau und Umbau des<br />
Krankenhauses wurden durchgeführt. Auch das<br />
kleine Diakonissenwerk, das mit dem Muntauer<br />
Krankenhaus verbuden war, erfuhr eine<br />
Belebung, Erweiterung und Neugestaltung, die<br />
zur Gründung des Diakonissenheims "Morija"<br />
führte, in welchem Dr.Tavonius Initiator und<br />
tätigstes Mitglied war und dessen letzte<br />
Umgestaltung und Erhaltung als medizinische<br />
Schule zum allergrößten Teil sein Verdienst ist.<br />
Im Frühling 1915 wurde er mobilisiert und<br />
kam an die Front als Ordinator eines<br />
Reservelazaretts.<br />
Er kehrte im Sommer 1918 nach Hause<br />
zurück und ging mutig an die Arbeit. 1920<br />
erkrankte er an Flecktyphus.<br />
250<br />
Dr. Erich Tavonius. Foto aus Quiring und Bartel,<br />
Seite 79.<br />
Da kam im Winter 1923 eine Influenza. Da<br />
der Sommer bei aller Arbeit ganz gut verlief, so<br />
entschloss sich Dr. Tavonius zu einer Herzkur in<br />
Kislowodsk, Kaukasus.<br />
1927 wurde eine Reise nach Deutschland<br />
geplant.<br />
Neue Lebensimpulse, neue Hoffnungen und<br />
Pläne erfüllten ihn wieder, und hoffnungsvoller<br />
blickten ihr in die Zukunft. Doch da rief ihn der<br />
<strong>Die</strong>nst zu einer Reise nach Melitopol. Dort erkältete<br />
er sich und kam am Karfreitag krank nach<br />
Hause. Das Fieber fiel nach wenigen Tagen, und<br />
am zweiten Feiertag sprach er schon wieder vom<br />
Aufnehmen der Arbeit. Da bekam er am Tage des<br />
dritten Feiertages einen Herzanfall, eine<br />
Entzündung kam hinzu.<br />
Am 29. April 1927, 1 Uhr 20 Minuten hatte<br />
sein Arbeits- und Kampfleben ein Ende.<br />
Der Glaube war seine Stärke in seinem schweren<br />
und verantwortungsvollen <strong>Die</strong>nst und in<br />
den schweren Erfahrungen seines Privatlebens.<br />
Am <strong>Die</strong>nstag, dem 3. Mai, wurde er auf dem<br />
Muntauer Kirchhof beerdigt.<br />
Abgekürzt aus Der Bote, Nr. 15, 1973.
Kapitel 35 Ohrloff – Orlowo<br />
In den Jahren 1803-1804 wanderte aus meterlanges Rohr empor, als Rest eines<br />
Westpreußen eine Anzahl Siedler in kleinen Artesiabrunnens, der jahrelang klares, warmes<br />
Transporten ohne Anführer nach Südrussland. In Wasser lieferte. Das Rohr wurde von den Banditen<br />
Chortitza überwinterten sie. 1805 zogen 12 mit Steinen verstopft und danach nie wieder gere-<br />
Familien auf den bestimmten Plan im inigt.<br />
Gouvernement Orechow (56 Werst von der Stadt 2. Das andere, neben der Ohrloffer Kirche, gehörte<br />
Orechow, die damals Gebietsstadt war, entfernt). der Familie H. Reimer; darin wurden die<br />
<strong>Die</strong>se 12 Familien brachten schon einiges Kapital Pflegebedürftigen untergebracht.<br />
mit.<br />
1930 wurde diese Kirche geschlossen und<br />
1806 trafen noch acht Familien ein. Auf stand leer. 1937 wurde hier ein Heim für behin-<br />
Wunsch der beiden Wirte Gerhard und Klaas derte Kinder eingerichtet. Aber nach wenigen<br />
Reimer erhielt die <strong>Kolonie</strong> den Namen Ohrloff, Tagen war alles kaputtgeschlagen, zerbrochen,<br />
nach einem gleichnamigen Ort in Preußen.<br />
geplündert. <strong>Die</strong>se Kinder vernichteten alles "lose"<br />
1807 hatte dieses Dorf 21 Familien aus auf dem Wege, auch auf dem Friedhof: die<br />
Westpreußen. <strong>Die</strong> Familie Abraham von Riesen Grabstätten wurden geschändet, die Steine umge-<br />
(1756-1810) war eine der vornehmsten Familien worfen, Särge geöffnet und die Gebeine in alle<br />
im Dorf. Sohn Abraham Friesen (1782-1849) war Richtungen zerstreut. Auch von Johann Cornies<br />
der zweite Älteste der Kleinen Gemeinde, Grab war wenig übriggeblieben. Auf seinem<br />
Schwiegersohn Klaas Reimer, Petershagen, der Grabstein war die Spitze absichtlich abgeschlagen<br />
erste Älteste und Großsohn Johann Friesen (1828- worden.<br />
72), Neukirch, der dritte Älteste der Kleinen Fortbildungsschule. 1822 wurde auf Anweisung<br />
Gemeinde.<br />
von J. Cornies die erste Fortbildungsschule an der<br />
1894 wird in Ohrloff die mennonitische <strong>Molotschna</strong> von einem privaten Verein gegründet<br />
Konferenz abgehalten. 1910 hat das Dorf trotz und deshalb auch "Christliche Vereinsschule"<br />
Auswanderungen immer noch 127 Familien mit genannt. Hier sollten Lehrer für mennonitische<br />
insgesamt 548 Personen.<br />
Schulen ausgebildet werden. Tobias Voth (1791-?)<br />
Nach der Entkulakisierung in den 1920-30er aus Westpreußen war der erste Lehrer hier. Leider<br />
Jahren wurden viele Häuser an die war Voth ein fanatischer Adwokat der religiösen<br />
Wolhyniendeutschen verkauft.<br />
Kultur des Separatist-Pietismus, dass sicherlich<br />
Bethaus. 1809 wird das erste Bethaus von einem grosse Unruhe unter den Eltern der Schüler weck-<br />
Siemens aus Chortitza mit Mitteln der Krone te. Johann Cornies legte in den 1820er Jahren eine<br />
gebaut. 1839 wird das alte Bethaus abgebrochen große Bibliothek, die 1845 223 Werke und 355<br />
und ein neues gebaut. In der Baukommission Bände zählte, an.<br />
waren Isaak Wiens und Larion Testejew, ein Zentralschule. 1847 brannte das Gebäude ab, und<br />
Baumeister aus Melitopol. Er verrichtete auch die schon 1848 wurde hier eine Zentralschule gebaut,<br />
Maurerarbeiten. <strong>Die</strong> Gemeinde in Ohrloff, die die 1913 durch einen staatlichen Neubau ersetzt<br />
auch die Bewohner der Nachbardörfer Tiege, wurde. Der Saal hatte eine Fläche von 10x18 m. <strong>Die</strong><br />
Rosenort und Blumenort mitzählte, hatte im Jahre Schule ist nicht mehr da.<br />
1905 980 Mitglieder und 580 Kinder.<br />
Dorfschule. 1936 wurde in der Ohrloffer<br />
1910 wurden die zwei Dörfer Tiege und Dorfschule ein Schülerheim eingerichtet. Der<br />
Ohrloff zusammengeschlossen. Am westlichen Unterricht aller Klassen wurde in der Zentralschule<br />
Ende des Dorfes standen zwei Gebäude auf durchgeführt. 1938 wurde der deutsche Unterricht<br />
Nachbarschaft:<br />
verboten.<br />
1. Eines gehörte einst J. Cornies, später Philip Mädchenschule. 1908 wurde die Mädchenschule<br />
Wiebe. Im Vorgarten der Corniesschen Wirtschaft erbaut.<br />
stand einst ein Brunnenhäuschen ohne Brunnen. Krankenhaus. 1910 wurde ein Krankenhaus mit<br />
Aus der Mitte, im inneren des Häuschens, ragte ein den Gaben der Erben der Familie Reimer gebaut.<br />
251
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Karte der Dörfer Ohrloff und Tiege, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, aus William Schroeder, Seite 40.<br />
<strong>Die</strong> Straße von Ohrloff. Foto: Mai 1999.<br />
252
Kapitel 35 Ohrloff – Orlowo<br />
<strong>Die</strong> alte Straße von Ohrloff, wie sie einstmals war. Foto aus G. Lohrenz, Seite 194.<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaft von Johann Cornies in Ohrloff, <strong>Molotschna</strong>. Foto aus G. Lohrenz, Seite 99. Siehe auch<br />
Quiring, "Johann Cornies - A Great Pioneer," in Mennonite Life,July 1948, Seiten 30-34.<br />
253
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Das Bethaus in Ohrloff, Moltschna <strong>Kolonie</strong>. Heute ist hier eine Anstalt für Geisteskranke. Foto aus Quiring<br />
und Bartel, Seite 82.<br />
Das ehemalige Bethaus in Ohrloff von der Hofseite. Foto: Mai 2000.<br />
254
Kapitel 35 Ohrloff – Orlowo<br />
Friedhof des Dorfes Ohrloff, <strong>Molotschna</strong>. Der Friedhof am Südwestende des Dorfes ist ganz zerstört und<br />
heute fast unerkennbar. Foto aus Lohrenz, Seite 72.<br />
Dreschen im Dorf Orhloff. Aussicht zum Nordwesten. Ganz hinten sieht man die <strong>Molotschna</strong> Höhen, die<br />
westlich vom <strong>Molotschna</strong> Fluss liegen. Foto aus Quiring und Bartel, Seite 80.<br />
255
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Alte Wirtschaft in Ohrloff. Bemerke den Spitzgibel vorne am Haus. Foto aus Quiring und Bartel, Seite 80.<br />
In Russland fuhren die Mennoniten mit den Verdeckwagen. Hier ist ein besonderes Modell mit Vier-<br />
Pferdegespann. Es ist ergänzt durch einen "Hinterleiter" und Fenstern. <strong>Die</strong>ses schöne Fahrzeug gehört<br />
David Dycks von Apanlee. Foto aus Lohrenz, Seite 248.<br />
256
Kapitel 36 Tiege - Orlowo<br />
1805 wurde das Dorf von 20 Familien aus<br />
Westpreußen gegründet. Der Name kommt vom<br />
Tiege Fluss, der die Große Werder in der Alten<br />
Heimat durchschnitt. <strong>Die</strong>se Auswanderer kamen<br />
1804 und überwinterten in Chortitza. Sie hatten<br />
keinen Anführer und kamen auch nicht in einer<br />
Gruppe. Das Land dieser <strong>Kolonie</strong> zieht sich von<br />
Nordwest nach Südost zum Steppenfluss<br />
Juschanlee. Auf Wunsch eines älteren Ansiedlers,<br />
Kornelius Töws, wurde das Dorf nach einem gleichnamigen<br />
in Preußen genannt. Kornelius Töws<br />
und Franz Isaak (1784-1853) waren so reich, dass<br />
sie die Unterstützung der Krone nicht brauchten.<br />
Franz Isaak sein Sohn Johann war Glied der<br />
Kleinen Gemeinde und wohnte später in Schönau.<br />
Johann sein Sohn Abram (1852-1938) war<br />
Schullehrer und Prediger der Holdemans<br />
Gemeinde in Grünfeld (Kleefeld), Manitoba. Franz<br />
sein Sohn, Peter Isaak, Großweide, diente als<br />
Schul-Inspektor und Direktor eines Waisenheims.<br />
Sein Sohn Gerhard (1836-86), zog 1876 nach<br />
Minnesota und später nach Kansas, wo seine<br />
Töchter Susanna (geb. 1860) und Elisabeth (geb.<br />
1867) berühmte Ärtze waren. 1898 war Susanna<br />
Doctorin in Winkler, Manitoba und 1921 in Altona.<br />
Franz sein Bruder Peter Isaak (1780-1857), in<br />
1898 was war der Vater von Franz (1816-99),<br />
(Schreiber der Geschichte, <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong>er<br />
Mennoniten (Halbstadt 1908)), Kornelius (1821-86)<br />
und Jakob (1815-66), einem Künstler der Fraktur.<br />
257<br />
Alle drei Brüder waren Schullehrer und Prediger<br />
der Ohrloff-Halbstadt Gemeinde.<br />
Peter seine Töchter Justina und Elisabeth<br />
waren verheiratet mit den Schullehrern Bernhard<br />
(1809-78), Rosenort, und Johann Fast (1813-92),<br />
Schönau. <strong>Die</strong> Brüder Fast haben die 1848<br />
"Gemeindeberichte" für ihre Dörfer geschrieben.<br />
Bernhard sein Sohn Peter I. Fast (1831-1916), hat<br />
jahrelang ein Tagebuch geschrieben. Er zog 1876<br />
nach Jansen, Nebraska, USA. Sein Sohn M. B. Fast,<br />
diente später als Redakteur der Mennonische<br />
Rundschau.<br />
Johann Fast (1813-92) zog 1873 nach Marion<br />
County, Kansas, und kaufte das Land wo die<br />
Krimer Brüdergemeinde 1874 ansiedelte, heute<br />
Hillsboro, Kansas. Tochter Anna Isaak (1807-73)<br />
war zum dritten Mal verheiratet mit Witwer Johann<br />
Friesen (1808-72), einem wohlhabenden Bauer aus<br />
Neukirch, und drittem Ältester der Kleine<br />
Gemeinde.<br />
Franz Isaak (1784-1853) sein Bruder Philip<br />
(1769-1813), wurde von einem tollwutkranken<br />
Hund gebissen, wodurch er eines schrecklichen<br />
Todes sterben musste. Sein Sohn Abraham Isaak<br />
(1795-1864) war Prediger der Ohrloff-Halbstadt<br />
Gemeinde. Sein Großsohn Peter R. Isaak (1855-<br />
1942) ist 1930 über Moskau geflüchtet und in<br />
Arnaud, Manitoba, Kanada, angesiedelt. Peter sein<br />
Großsohn Helmut Pankratz diente in den 1980er<br />
Jahren als Bürgermeister von Steinbach, Kanada.<br />
<strong>Die</strong> Taubstummenschule<br />
in Tiege in ihrer<br />
ursprünglichen<br />
Gestaltung. <strong>Die</strong>ses<br />
Gebäude wurde 1890<br />
gebaut. Sie wurde 1881<br />
gegründet. 1908 wurde<br />
auch eine Mädchenschule<br />
in Tiege gegründet. Foto<br />
aus G. Lohrenz, Seite 126.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
<strong>Die</strong> Organisation einer Taubstummenschule<br />
wurde von Ambrazum Grigorievic Ambrazumow,<br />
ein evangelischer Armenier, ergriffen. Seine<br />
Versuche mit taubstummen Kindern waren auf<br />
einige Personen begrenzt, die er in einem privaten<br />
Heim in Münsterberg unterrichtete.<br />
Am 22. Dezember 1881 erhielt man die<br />
Erlaubnis zur Errichtung dieser Schule. Es entstand<br />
die "Marien-Schule für Taubstumme".<br />
1884 trat im Auftrag der Konferenz eine<br />
Kommission zur Ausbreitung einer Schulordnung<br />
zusammen, die kurz darauf bestätigt wurde.<br />
1885 wurde in Blumenort unter der Leitung<br />
des Lehrers Ambrazumow die Schule eröffnet.<br />
Am 03.01.1890 wurde das neue Gebäude für<br />
40 Schüler in Tiege eröffnet.<br />
1895 wurden eine Werkstatt und 1902 eine<br />
kleinere Farm erworben. Hauptquelle der<br />
Unterstützung waren die Spender der großzügigen<br />
Öffentlichkeit. Es wurden Geld, Mehl,<br />
Schweine, Kühe, Hühner und Gänse gespendet.<br />
Am 13. September 1905 übergab Johannes<br />
Wiebe seine Stellung als Direktor offiziell seinem<br />
Nachfolger Jakob Schröder aus Ohrloff. Er war der<br />
letzte Direktor der Schule. Im ersten Stock der<br />
Schule waren drei Schlafsäle für die Knaben<br />
gegenüber der Hauselternwohnung, die auch aus<br />
drei Zimmern bestand, ein großer Esssaal, Küche<br />
und Speisekammer mit Keller, ein Lehrerzimmer,<br />
ein Zimmer für die Köchin und zwei Zimmer für<br />
die Hausmädchen.<br />
Im zweiten Stock befanden sich ein Esssaal<br />
und drei Schlafsäle für Mädchen. Geheizt wurde<br />
durch Kachelöfen, die es in jedem Zimmer gab<br />
und die von Schulgehilfen täglich mit Kohlen<br />
<strong>Die</strong> Taubstummenschule<br />
258<br />
gefüllt wurden.<br />
Der große Hof war von einem hohen<br />
Ziegelzaun umgeben. In der Mitte war das große<br />
Haupttor und an der Seite ein Tor für die Wagen.<br />
An der anderen Seite des Hofes waren Wasch- und<br />
Badestuben. Es gab auch einen Stall mit Raum für<br />
Gespann und einen Raum für Pferde von<br />
Besuchern. Ein Raum für sechs Kühe war auch da.<br />
Als die Schule 1885 eröffnet wurde, gab es nur<br />
einige Schüler und einen Lehrer. Schon Ende des<br />
Jahres gab es genügend neue Schüler. 1886 wurde<br />
der zweite Lehrer, Jakob Dörksen, ein Absolvent<br />
des Instituts für Taubstummenlehrer in Frankfurt<br />
am Main, Deutschland, eingestellt.<br />
1891 beschloss Ambrazumow, die Schule zu<br />
verlassen. Jetzt übernahmen Heinrich Joh. Janzen<br />
und seine Frau die Stelle der Hauseltern.<br />
Peters, Janzen, Sudermann und Unruh bildeten<br />
bis in die 1920er Jahren, einen soliden<br />
Lehrerkörper. Heinrich Janzen trat, nachdem er 30<br />
Jahre an dieser Schule unterrichtet hatte, aufgrund<br />
seiner Krankheit zurück. Er blieb aber in<br />
der Schule und verrichtete sonstige Aufgaben.<br />
1930 wurde die Marien-Schule von den<br />
Kommunisten geschlossen. Alle Lehrer wurden<br />
von der Schule verwiesen und neue kommunistische<br />
Lehrer eingesetzt. <strong>Die</strong> Schule wurde mit der<br />
Taubstummenschule in Saporoschje zusammengelegt<br />
und blieb noch bis 1939 eröffnet.<br />
Mit Beginn des 2.Weltkrieges hörte die Schule<br />
auf zu existieren. Während des Krieges war hier<br />
ein Hospital, danach ein Invalidenheim. Heute ist<br />
es ein Verwaltungsgebäude.<br />
Auszug aus “<strong>Die</strong> Taubstummenschule in<br />
Tiege” von Hildi Janzen, Der Bote, Nr.15, 1999.<br />
Das Gebäude der früheren<br />
mennonitischen<br />
Taubstummenschule in<br />
Tiege. Heute ist hier eine<br />
Parteiverwaltung. Foto:<br />
August 1994.
Kapitel 36 Tiege - Orlowo<br />
Heinrich Balzer 1800-46 - Verteidiger des Glaubens<br />
Heinrich Balzer (1800-46) war der Sohn von<br />
Heinrich Balzer (1773-1842). Heinrich Balzer sen.<br />
kam wahrscheinlich aus Muntau, Westpreußen,<br />
und zog nach seiner ersten Heirat in das Gebiet<br />
von Stuhm. Er wurde 1810 zum Prediger der<br />
friesischen Gemeinde Tragheimersweide gewählt.<br />
1819 zog die Familie nach Russland, zusammen<br />
mit anderen Gemeindegliedern, unter Führung<br />
des Ältesten Franz Goertz. <strong>Die</strong> Familie siedelte im<br />
Dorf Großweide, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, an.<br />
Heinrich Balzer jun. wohnte in Tiege,<br />
<strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>. <strong>Die</strong> Volkszählung von 1835<br />
wirft ein wenig Licht auf Balzers persönliches<br />
Leben. 1820 heiratete er Helena Dyck (geb. 1802)<br />
und zog von Großweide nach Tiege, wo er sich in<br />
der Wirtschaft fünf ansiedelte, die vorher ihrem<br />
früheren Ehemann Franz Martin Klassen (1773-<br />
1820) gehörte. Franz hatte einen Bruder, Martin<br />
Klassen (geb. 1770), dessen Sohn Martin (1822ca.88)<br />
und Tochter Katharina (1819-99) Glieder<br />
der Kleinen Gemeinde waren.<br />
1827 war Heinrich Balzer Prediger der<br />
Gemeinde Ohrloff. <strong>Die</strong>s war die Zeit, als<br />
Anhänger der Separatisten-Pietisten die<br />
Glaubensgemeinschaften der Mennoniten in<br />
Russland angriffen, indem sie danach trachteten,<br />
Glieder der Kirchengemeinden fortzulocken und<br />
sie gegen ihre Familien und den Glauben ihrer<br />
Väter abspenstig zu machen. Aber in Balzers Fall<br />
passierte das Gegenteil. Er lehnte den kämpferischen<br />
Pietismus seiner elterlichen Gemeinde<br />
Rudnerweide sowie den gemäßigteren Pietismus<br />
in Ohrloff ab. 1833 schloss sich Balzer der Kleinen<br />
Gemeinde an aus Gründen, die er in einem<br />
weitschweifigen Brief, den er an den Ältesten<br />
Bernhard Fast von der Ohrloffer Gemeinde<br />
schrieb, erläuterte.<br />
1833 schrieb Balzer seine berühmte<br />
Abhandlung unter dem Titel "Verstand und Vernunft".<br />
Balzer war der Ansicht, dass Menno<br />
Simons "unter dem Schutt" des Irrtums vieler<br />
Jahrhunderte "die einfachen Lehren des Herrn<br />
wiederentdeckt hatte". Balzer lobte die<br />
Gemeinden des ersten Jahrhunderts als klassisches<br />
Modell des Christentums. <strong>Die</strong> ersten<br />
Christen waren vom Heiligen Geist überführt<br />
worden, "dass sie in dieser Welt glücklicher leben<br />
würden, wenn sie sich ganz der Schlichtheit<br />
Christi hingeben würden. ...Bruderliebe machte<br />
259<br />
sie zu einer großen Familie, und niemand wünschte<br />
ein Vorrecht für sich auf Kosten eines<br />
anderen."<br />
"Wenn der Heilige Geist in einem wiedergeborenen<br />
Herzen ruft: ‘Abba, lieber Vater’”,-schrieb<br />
Balzer,- "werden göttliche Gaben in den<br />
Gläubigen ausgegossen und dringen in seinen<br />
Verstand ein. Sie erfüllen ihn mit einer neuen<br />
Weisheit und Kenntnis Jesu Christi. Je mehr und<br />
freier das Herz eines Menschen für den Heiligen<br />
Geist geöffnet wird, desto mehr Wissen wird er<br />
erlangen, desto größere Reichtümer an göttlichen<br />
Gaben wird er empfangen, und desto mehr wird<br />
sein Herz vorbereitet für die Innewohnung des<br />
Dreieinigen Gottes."<br />
Balzer behandelt ausführlich die Dichotomie<br />
(Zweiteilung) zwischen "Glauben", einem unterbewussten,<br />
existentiellen Wissen, in Christus zu<br />
sein, und dem, was er "Vernunft" nannte, wobei<br />
Logik und Selbstsucht das Herz in Besitz nehmen<br />
und seine Handlungen dirigieren. Er fühlte, dass<br />
Gläubige "zufrieden sein sollten, wenn sie<br />
Nahrung und Kleidung haben; Streben nach<br />
großem Reichtum oder nach einer Stellung von<br />
hohem Rang in dieser Welt ... hat bestimmt eine<br />
Einschränkung auf geistigem Gebiet zur Folge.<br />
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze<br />
Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner<br />
Seele? (Matth. 16,26)".<br />
Heinrich Balzer war ein begabter Dichter, der<br />
dynamische Poesie der Zählmaß- und Rhytmus-<br />
Tradition benutzte nach dem Muster des<br />
Gesangbuches, um seine Botschaft einer<br />
erneuerten und neu belebten Kirche zu übermitteln.<br />
Zählmaß und Rhytmus sind typisch für die<br />
Abfassung dieser Art der Dichtkunst. <strong>Die</strong> folgenden<br />
Verse aus seinem Epos von 1833 "Ein<br />
Abschiedsgedicht", die seine Gefühle zu der Zeit,<br />
als er die Gemeinde in Ohrloff verließ, ausdrücken,<br />
dienen als Beispiel:<br />
1. Inn'rer Drang und heftges Treiben,<br />
Angst, Beklommenheit und Not<br />
hart und fest einander reiben.<br />
Tiefe Demut, inn'res Leid<br />
pressen, drücken allezeit,<br />
heißt es: Fliehe von den Sünden!<br />
2. Adventstage zweiter Woche,<br />
ihr wart mir ein harter Stand;
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
in euch ward in Jesu Joche<br />
und um Eitelkeit und Tand<br />
Streit und Kampf mit Ernst geführt.<br />
Jesus selber triumphiert,<br />
Gott sei Dank, als Überwinder<br />
und in ihm auch ich nicht minder.<br />
Mit seinem glänzenden Verstand wurde<br />
Heinrich Balzer der deutlichste Verteidiger des<br />
evangeliums-zentrischen Glaubens in Russland. Er<br />
war ein außergewöhnlich begabter Denker und<br />
Theologe, der versuchte, die Theologie des<br />
Mennonitentums zu entwickeln, dass heiszt, einen<br />
Glauben, der sich ganz und gar auf Christus und<br />
seine Gebote aufbaute. Balzers Erfolg bei der<br />
Erklärung seiner Vision wurde von Dr. Robert<br />
Friedmann anerkannt, der schrieb, dass "Verstand<br />
und Vernunft eine der anregensten Darlegungen<br />
der mennonitischen Literatur ist" (Friedmann,<br />
Mennonite Piety, 259).<br />
Auszug aus den Schriften von Heinrich Balzer<br />
und Dr. James Urry, “Heinrich Balzer (1800-1846):<br />
Prediger und konservativer mennonitischer<br />
Philosoph der Kleinen Gemeinde,” in D. <strong>Plett</strong>,<br />
Redakteur, Leaders, (Steinbach, 1993), Seiten 295-<br />
304. <strong>Die</strong> Schriften von Heinrich Balzer, einschließlich<br />
zwei Predigten und ein Epos-Gedicht,<br />
sind ins Englische übersetzt und in den<br />
Historischen Serien der Kleinen Gemeinde veröffentlicht<br />
worden.<br />
1819 kamen Älteste Wedel und Görtz mit ihren Gemeinden nach Russland. <strong>Die</strong>se fromen Herren waren<br />
soweit in der Kultur und Sprache des separatistischen Pietismus verwickelt, dass, wenn Klaas Reimer ihnen<br />
sagte, dass die, die an die Kindertaufe, Eidschwuren und Kriegführen glaubten, nicht richtigdenkende<br />
Christen waren, seien sie sonst auch noch so from als sie wollen, waren sie von Schreck erfüllt.Wedel sprang<br />
von seinem Stuhl und rief laut, ganz empört: "Mann, du hast eine schreckliche Aussage gemacht, die konnt<br />
nicht stehen." Mann sieht, dass die Ältesten, die ihr Volk führen sollten, selber auf dem falschen Weg waren.<br />
Ein Gemälde von Ron Kroeker, Rosenort, Manitoba, aus D. <strong>Plett</strong>, Saints and Sinners,Seite 54.<br />
260
Kapitel 37 Blumenort - Orlowo<br />
1805 wurde im Gouvernement Taurien,<br />
Halbstädter Wolost, das Dorf von 20 Familien<br />
gegründet. Sie kamen aus Preußen in kleinen<br />
Transporten ohne Anführer. Das Dorf lag östlich<br />
von Tiege am Steppenfluss Kurudjuschan. Das<br />
Land war von Nogaiern besetzt, welche den Ort<br />
räumen mussten, aber doch Nachbarn blieben.<br />
Johann Warkentin, (1760-1825), (mein Vorfahr,<br />
A.R.), gab diesem Dorf den Namen nach seinem<br />
Geburtsort in Preußen. Am 11. November 1808<br />
brannte die Wirtschaft von Gerhard Goossen ab,<br />
und 1821 brannte das Schulhaus ab.<br />
1911 hatte das Dorf 566 Einwohner (76<br />
Familien), alles Mennoniten, darunter zwei<br />
jüdische Familien, die das Schneiderhandwerk<br />
ausübten. Vier Familien kamen aus der Wolga-<br />
Gegend dazu. Das Dorf hatte eine Dorfschule<br />
mit 40 Schülern.<br />
Eine alte mennonitische Wirtschaft in Blumenort, <strong>Molotschna</strong>. <strong>Die</strong>ses Dorf hat Johann Warkentin (1760-<br />
1825) gegründet, als er von Preußen nach Russland einwanderte. Foto aus G. Lohrenz, Seite 51.<br />
Holländische Windmühle und ein altes mennonitisches Bauernhaus mit Stall in Blumenort. Foto aus<br />
They seek a Country,Seite 29/Aus Saints and Sinners,Seite 308. Siehe auch Lohrenz, Seite 189.<br />
261
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
<strong>Die</strong> ältere Frau Unruh, 85 Jahre alt, wohnte<br />
1996 im Dorf Blumenort. Sie erzählte ihre<br />
Geschichte. Sie wurde mit zwei Kleinkindern im II.<br />
Weltkrieg mit dem Kolchosvieh nach dem Osten<br />
geschickt. Ihr Mann war verschleppt worden.<br />
Unterwegs wurde sie, nicht weit von ihrem<br />
Heimatdorf, von einem Bombenangriff überrascht.<br />
Sie verließ das Vieh irgendwo auf dem<br />
Wege und flüchtete zurück, nach Hause.<br />
In ihrem Dorf Blumenort angekommen, traf<br />
sie keine mennonitische Familie mehr an. Sie<br />
waren alle nach dem Westen geflüchtet. So blieb<br />
sie für immer in diesem Dorf alleine wohnen. Von<br />
den Dorfbewohnern wurde sie sehr schlecht<br />
behandelt. Ihr Elternhaus bekam sie nicht mehr<br />
zurück. Da sie aber einige Zeit versuchte, es mit<br />
<strong>Die</strong> Geschichte der Frau Unruh<br />
262<br />
allen Mitteln zurückzubekommen, wurde ihr<br />
gedroht, man würde sie umbringen, wenn sie<br />
nicht endlich ihren Anspruch auf das Haus<br />
aufgäbe. So musste sie in ein heruntergekommenes<br />
Russenhaus ziehen.<br />
Später arbeitete sie in dem Invalidenheim für<br />
Kriegsinvaliden, das in der Taubstummenschule<br />
in Tiege seine Unterkunft hatte, und heiratete dort<br />
einen Invaliden, einen Russen. Sie hat zwei Söhne:<br />
einer ist in Deutschland, der andere in der<br />
Ukraine in einer Großstadt. Sie will trotz aller<br />
Schwierigkeiten, die sie, als einzige Mennonitin<br />
nach dem Krieg erlebt hat, nicht von ihrem<br />
Heimatdorf wegziehen. Sie lebt in einem winzig<br />
kleinen Häuschen, mitten auf einem sehr verwüsteten<br />
Grundstück. Foto: Mai 1996.<br />
Links: Frau Unruh in Blumenort<br />
unterhählt sich mit ihren neuen<br />
Freunden aus Kanada. Foto: 1996.<br />
Unten: Während der Machnov-<br />
Zeiten gabt es viele Massengräber<br />
der Ermordeten. Am 10. November<br />
1919 wurden 20 Blumenorter<br />
ermordet von der "Konovalovzy"<br />
(ein asiatisches Regiment) und das<br />
halbe Dorf wurde niedergebrannt.<br />
<strong>Die</strong>ses Massengrab befand sich in<br />
Blumenort, <strong>Molotschna</strong>. Foto aus<br />
Lohrenz, Seite 258.
Kapitel 37 Blumenort - Orlowo<br />
Johann Warkentin wurde am 15.05.1760 in<br />
Blumenort, Preußen, geboren. Seine erste Ehe<br />
war nur kurz. Der Name der ersten Frau ist nicht<br />
bekannt. Aus dieser Ehe stammt Tochter<br />
Katharina. <strong>Die</strong> zweite Ehe ging er mit Margarete<br />
Thiessen aus Klein-Mausdorf ca. 1785 ein. Sie<br />
lebten in Klein-Mausdorf. Margarete starb 1808.<br />
<strong>Die</strong> dritte Frau war eine Susanne Heyde, die er<br />
wahrscheinlich 1808 heiratete. Nach der Heirat<br />
mit Margarete Thiessen zogen sie nach<br />
Grubenhagen, Elbing, Preußen.<br />
1804 wanderte diese Familie nach<br />
Südrussland aus. Von Beruf war Johann Grütz-<br />
Müller und besaß 1808 eine Wirtschaft von 2<br />
Wagen, 1 Pflug, 5 Pferde, 9 Rinder, 13 Schafe, 12<br />
KTschw (Korn in Tschetwertj = 204,8 kg), 141<br />
KSch (Korn ungedroschen in Schock), 31 FH<br />
(Fuhren Heu).<br />
Den Winter 1804-1805 wohnte die Familie<br />
sehr wahrscheinlich in der Alten <strong>Kolonie</strong> bei<br />
Bekannten oder Verwandten zur Miete. Sie<br />
siedelten in Blumenort am 06.06.1805 an.<br />
Blumenort war ein Dorf, wo einige aus der<br />
Kleinen Gemeinde ansiedelten. Auch seine<br />
Schwiegersöhne Heinrich Friesen und Peter<br />
Brandt wohnten hier (aus Saints and Sinners,<br />
Seite 59).<br />
Da er bemittelt war, übernahm er in<br />
Blumenort gleich zwei Wirtschaften Nr. 3 und Nr.<br />
18 zu je 65 Desjatin Land. <strong>Die</strong> Wirtschaft Nr. 18<br />
übergab er 1812 seinem Sohn Johann. Doch<br />
wegen Missernte, Viehseuchen und anderer<br />
Misserfolge gab er das Wirtschaften auf und widmete<br />
sich ganz dem Lehrerberuf.<br />
1820 zog er nach Tiegerweide. Seine<br />
Wirtschaft verkaufte er an einen Driediger. 1835<br />
gehörte seine Wirtschaft einem Heinrich<br />
Rogalski. Warkentin starb 1825 in Ladekopp an<br />
den schwarzen Pocken. Seine Witwe heiratete<br />
Jakob Driediger.<br />
Johann Warkentin gründete auch das Dorf<br />
Rosenort und nannte es auch nach dem<br />
Nachbardorf in Preußen. Er besaß zusammen<br />
mit Peter Friesen in Rosenort eine Ziegelei.<br />
Zu seiner Lebenszeit schrieb Johann<br />
Warkentin ein Familienverzeichnis, das bei<br />
seinem Schwiegersohn Kornelius Fast aufbe-<br />
Johann Warkentin 1760-1825<br />
263<br />
wahrt wurde. <strong>Die</strong>ser wiederum gab das<br />
Verzeichnis seinem Sohn Kornelius Fast (später<br />
Lehrer in Steinbach, Manitoba), der es verloren<br />
hat.<br />
Noch in den letzten Tagen seines Lebens<br />
dichtete Johann Warkentin ein Lied, das erkennen<br />
läßt, dass unsere Voreltern viele Dornen auf<br />
ihren Wegen hatten und dass in ihren Herzen ein<br />
Sehnen nach der seligen Heimat dort droben<br />
war.<br />
Der Wanderer.<br />
Es reiste ein Wanderer alt und müde das steile<br />
Felsental hinan,<br />
wo selten ein Röschen, ein Blümchen verblühte.<br />
Der Weg ward schmal und steinig die Bahn,<br />
und droben, da ragte die felsige Spitze noch viele<br />
Meilen weit hinauf.<br />
Bald brauste ein Sturmwind, bald drückte die<br />
Hitze, bald hielt ein Abgrund im Wandern ihn<br />
auf.<br />
Er setzte sich endlich im Abendrot nieder und<br />
sah betrübt den Abendstern an.<br />
Ach, funkelnder Stern, jetzt schimmerst du<br />
wieder, und meine Reise ist noch nicht getan.<br />
Wie ist mir die Reise so schwer und so bitter, wie<br />
wenig Freud' hab ich gehabt,<br />
da mehr Sonnenstiche, mehr schweres Gewitter<br />
als des Lebenswonne mich gelabt.<br />
Ein Jüngling erschien dann im Abendstern<br />
glänzend dem armen Wandrer vors Gesicht:<br />
"Ich komm nun, um dich mit Palmen zu kränzen,<br />
verlier nicht den Mut und zage nicht mehr".<br />
Er führte den Wand'rer durch etliche Spalten, im<br />
Schimmer des dämmernden Abendlichts fort.<br />
Im herrlichsten Frühling und jubelnden Walten<br />
ist gegen diesen Anblick nichts.---<br />
Es lagen zehn Städte im weitesten Kreise, mit<br />
Auen von Blumen, von Bächen getränkt.<br />
Nun sagte der Jüngling: "<strong>Die</strong>s Ende der Reise<br />
wird dir, o Wand‘rer, vom König geschenkt.<br />
Du Frommer, Getreuer, dein Leben voll Leiden<br />
war nur Geburtsweh zum ewigen Glück.<br />
Geh ein zu noch nie empfundenen Freuden und<br />
lasse dein trauriges Reis'kleid zurück".<br />
Auszug aus Peter Isaak, Stammbuch meiner<br />
Voreltern, (Stern, Alberta 1915), Seiten 10-12.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
John Denver 1943-97 - Höhen und Tiefen<br />
Henry John Deutschendorf wurde am weiter, aber seine Popularität nahm ab. Trotz<br />
31.12.1943 in Roswell, New Mexiko, U.S.A. seines musikalischen Abstiegs versuchte er, sich<br />
geboren. Er war ein Nachkomme von Johann nützlich zu machen, indem er einige<br />
Warkentin (1760-1825). Sein Vater war ein Hilfsorganisationen und Umweltschutzkomitees<br />
Testpilot. Henry sollte nach Vaters Wunsch auch ins Leben rief.<br />
Pilot werden, und tief war Vaters Enttäuschung, 1988 heiratete er die 20-jährige Cassandra<br />
als Henry eine andere Bahn einschlug, und Dolaney, und 1989 wurde Tochter Jesse Bell<br />
zwar–die der Musik.<br />
geboren. Gerüchte und Lügen machten auch<br />
1963 zog er nach Los Angeles und verdiente diese Ehe kaputt. Sie gingen getrennte Wege,<br />
sein Geld mit Singen in kleineren Clubs. In aber er liebte seine Frau sehr. In den zwei letzten<br />
dieser Zeit änderte er auch seinen Namen. Er Jahren verbesserte sich ihr Verhältnis, nicht<br />
wählte "John Denver". 1964 wurde er für die zuletzt durch ihre gemeinsame Tochter, die John<br />
Gruppe der Country-Musik "Mitchel-Trio" als unwahrscheinlich lieb hatte.<br />
Solosänger geworben. 1965 traf er auf einem Im September 1997 kaufte er das letzte<br />
Konzert in St. Peter, Minnesota, eine Flugzeug. Es war ein Sonntag, der 12. Oktober. Er<br />
Collegefreundin, Annie Martell. Sie verliebten ging zum Flugplatz Monteney. 5.12 Uhr. Er<br />
sich und heirateten 1967. 1969 kam sein erstes machte einige Versuche und Drehungen und<br />
Album und 1971 seine Platte "Take Me Home, schwang in die Höhe. Augenzeugen berichten,<br />
Country Roads" mit großem Erfolg auf den dass die Maschine plötzlich in Flammen<br />
Markt. 1970 verließ er die Gruppe "Mitchel-Trio" aufging, sich auf die rechte Seite legte und mit<br />
und zog nach Aspen. Das Ehepaar adoptierte der Nase ins Meer stürzte. Sein plötzlicher Tod<br />
zwei Kinder: Zachary, geboren 1974, und Anne war der Abschluss seines so bewegten Lebens,<br />
Kate, geboren 1978.<br />
seiner phantastischen Erfolge, Geheimnisse,<br />
1976 wurde er von seinem Vater im Fliegen<br />
unterrichtet. Er erhielt einen Pilotenschein und<br />
fing an, die Himmel Colorados zu durchkreuzen.<br />
<strong>Die</strong> größten Leidenschaften seines Lebens<br />
waren Musik und Fliegen. Seine Erlebnisse beim<br />
Fliegen gab er in seinen Liedern wieder.<br />
In den 1970er Jahren gab es für den Sänger<br />
einen gewaltigen Aufschwung seiner musikalischen<br />
Karriere. Er bewies, dass seine Musik sentimental<br />
sein kann. "Einige von meinen Liedern<br />
sind über ganz einfache, kleine Dinge des<br />
Lebens", sagte er, "aber diese kleinen Teilchen<br />
seiner Karriere.<br />
haben für mich eine große Bedeutung, haben<br />
etwas für jeden Mensch der Welt, gerade in den<br />
Schwierigkeiten."<br />
Ein Teil seines Vermögens steckte er in<br />
Während John Denver (hinten, Mitte) versuchte,<br />
ein sorgfältiger Vater zu sein, hatte seine<br />
Arbeit ihn oft von seinen Kindern entfernt. Von<br />
links: Anna Kate, Jesse Bell und Zachary um<br />
Flugzeuge. Er kaufte einen Doppeldecker, zwei 1993. John Denver sein Song-Album "John<br />
Cessna 210s und Long Ez, in dem er später starb. Denvers Greatest Hits" wurde über zehn<br />
1982 ließ er sich von seiner Frau scheiden. Millionen Mal verkauft. Foto und gekürzter<br />
Es folgten unzählige Erfolge und Misserfolge, Bericht aus "People", Oktober 1997. Siehe auch<br />
Reisen und Erschöpfung. Er arbeitete tüchtig Preservings, Nr. 11, Seite 13.<br />
264
Kapitel 38 Rückenau - Kosolugowka<br />
Das Dorf wurde 1811 in der Halbstädter<br />
Wolost von 11 Familien gegründet. Acht Familien<br />
davon kamen schon 1810 aus dem Elbingschen<br />
Gebiet in Preußen ohne Anführer. Der Name des<br />
Dorfes kommt von einem gleichnamigen in<br />
Preußen.<br />
1819 bestand das Dorf schon aus 20 Wirten.<br />
1855 hatte das Dorf 60 Familien.<br />
Rückenau war ein wichtiges Zentrum in der<br />
Geschichte der Kleinen Gemeinde. <strong>Die</strong> Brüder<br />
Jakob und Martin Barkmann dienten beide zu<br />
ihrer Zeit als Dorfschulze. 1825 hat der Kaiser, als<br />
er Südrussland besuchte, bei Martin Barkman zu<br />
Mittag gegessen.<br />
Zwei Söhne vom Ältesten Abraham Friesen<br />
(1782-1849), Ohrloff, Heinrich und Abraham,<br />
wohnten in Rückenau und beschäftigten sich mit<br />
Baumanpflanzung und Seidenraupenzucht.<br />
Ältester Abraham Friesen ist in Rückenau beerdigt<br />
worden.<br />
1874 ist Rückenau das Zentrum der<br />
Brüdergemeinde, für die es mit der Zeit sechs<br />
Bethäuser gab: Rückenau, Tiege, Tiegenhagen,<br />
Alexanderthal, Waldheim, Sparrau.<br />
<strong>Die</strong> ersten Versammlungen in Rückenau<br />
waren in einem Privathaus, dass zu diesem Zweck<br />
1874 gekauft wurde. <strong>Die</strong>ses Haus, später "das alte<br />
Versammlungshaus" genannt, war viele Jahre eine<br />
Schenke gewesen, die den Leuten im Dorf viel<br />
Kummer und Ärger verursacht hatte. <strong>Die</strong> Schenke<br />
wurde dann zu einem Bethaus umgewandelt.<br />
02.10.1883. <strong>Die</strong> Brüdergemeinde weiht ihr<br />
"neues Bethaus" ein. Es ist 84 Fuß lang, 42 Fuß<br />
breit, 14,5 Fuß hoch. Erbaut wurde es unter der<br />
Leitung von Johann Koop aus Fürstenau. Am Tag<br />
der Einweihung waren zwei-Drittel der Baukosten<br />
bezahlt. <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> Brüdergemeinde hatte<br />
1910 485 Mitglieder und 1060 Seelen.<br />
In den 1930er Jahren, als die Kirche<br />
geschlossen wurde, war in diesem Gebäude die<br />
Schule; nach dem Krieg wurde hier eine Ölpresse<br />
eingerichtet. Das Gebäude ist heute (1997) zwar<br />
sehr umgebaut, aber noch gut erhalten. 1998 ist<br />
auch die Ölpresse wegen Mangel an Rohstoffen<br />
abgestellt worden.<br />
Schule. 1844 wurde das erste Schulgebäude nach<br />
Cornies Anweisung gebaut. Das Gebäude wird<br />
auch heute (1997) noch als Schule genutzt.<br />
Altenheim. 1895 wird in einem Haus (mit Garten),<br />
das von P. M. Friesen zu diesem Zweck geschenkt<br />
wurde, ein Altenheim eingerichtet. Es wurden dort<br />
15 alte Menschen untergebracht. Nach dem Krieg<br />
war hier eine kurze Zeit die Schule, danach ein<br />
Wohnheim (bis heute noch).<br />
Der Laden. Auch 1997 noch immer als Laden<br />
benutzt.<br />
Zum Nachlesen: Leona Wiebe Gislason,<br />
Rückenau: From its <strong>Foundation</strong> in 1811 to the<br />
Present...(Winnipeg 1999), 260 Seiten.<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaft von Martin J. Barkman (1796-1872) in Rückenau, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, Russland. In diesem<br />
Hause war der russische Zar 1825 zum Mittagessen. Martin J. Barkmans Sohn Jakob M. Barkman (1824-<br />
75), Prediger der Kleinen Gemeinde, war 1874 einer der ersten Ansiedler in Steinbach, Manitoba. Er ist<br />
1875 im Roten Fluss ertrunken. <strong>Die</strong>ses Foto ist 1908 vom Urgroszsohn Martin B. Fast, Redakteur der<br />
Rundschau, aufgenommen worden. <strong>Die</strong> grosse Querscheune war damals schon abgebrochen gewesen.<br />
Foto aus Saints and Sinners,Seite 46/Siehe auch Quiring und Bartel, Seite 9.<br />
265
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Das Dorf Rückenau, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong> im Jahre 1915, William Schroeder, Seite 41.<br />
266<br />
Das "neue Bethaus" der<br />
Brüdergemeinde in seiner<br />
ursprünglichen Gestaltung.<br />
Foto aus G. Lohrenz, Seite<br />
137.<br />
Das Kirchengebäude der<br />
Brüdergemeinde in<br />
Rückenau von der<br />
Straßenseite. Foto: August<br />
1997.
Kapitel 38 Rückenau - Kosolugowka<br />
Das Altenheim in Rückenau in seiner ursprünglichen Gestaltung. Foto aus G. Lohrenz, Seite 122.<br />
267<br />
Das mennonitische<br />
Altenheim in<br />
Rückenau. Heute<br />
ist hier ein<br />
Wohnheim. Foto:<br />
August 1997.<br />
<strong>Die</strong> ehemalige<br />
mennonitische<br />
Dorfschule in<br />
Rückenau. Foto:<br />
August 1997.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Das Haus der Familie Heinrich Koop (1895-1941) in Rückenau, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>. Mit freundlicher<br />
Genehmigung von der Tochter des Heinrich Koop, Anna Koop-Brotzmann.<br />
Dasselbe Haus der Familie Heinrich Koop in Rückenau, die es 1943 für immer verlassen musste. Aufnahme<br />
von August 1997. Heinrich Koop ist nach der Verhaftung verschollen. <strong>Die</strong> Tochter von Heinrich, Anna Koop-<br />
Brotzmann, wohnt heute in Neuwied, Deutschland. Sie ist in diesem Haus 1932 geboren worden.<br />
268
Kapitel 39 Gnadenheim - Balaschowka<br />
1821 wurde das Dorf am linken Ufer des<br />
Flusses Begimtschokrak, 47 Werst von der damaligen<br />
Gebietsstadt Orechow entfernt, von 16<br />
Familien gegründet. Das Land war damals unbewohnt<br />
und wurde von den Viehherden der Russen<br />
und Nogaier beweidet. 1822 kamen noch vier<br />
Familien dazu. 1848 waren es 24 Familien. Der<br />
Name der <strong>Kolonie</strong> wurde von Johann Cornies bestimmt.<br />
Er sagte: "Ihr dürft euch ebenso gut der<br />
Gnade des Kaisers zu erfreuen wie die Nachbarn<br />
in Alexanderwohl, die ihr Dorf nach dem Kaiser<br />
Alexander nannten, und deshalb sollt ihr euer<br />
Dorf Gnadenheim nennen."<br />
Schule. 1825 wurde ein 30 Fuß langes und 28 Fuß<br />
breites Schulhaus aus Luftziegeln gebaut. 1844<br />
wurde unter der Leitung des landwirtschaftlichen<br />
Vereins eine neue Schule aus gebrannten Ziegeln<br />
und mit holländischen Dachziegeln gebaut.<br />
1829 wurde auf Verlangen der Behörde ein<br />
Vorratsmagazin (Lagerhalle) gebaut. 1836 wurde<br />
mit der Pflanzung der Garten-und Waldanlagen<br />
begonnen.<br />
<strong>Die</strong> Familie Quiring aus Calgary, Kanada, hat 1997 das Dorf ihrer Vorfahren besucht und auch das<br />
Grundstück der Wirtschaft gefunden. Leider ist nichts mehr von der Wirtschaft erhalten geblieben. Nur<br />
noch einige Andenkenstücke konnten sie von diesem Ort mitnehmen. Foto: Mai 1997.<br />
Das ist der Ort, wo die Gnadenheimer Kirche stand. Verwüstet und leer... Foto: Mai 1997.<br />
269
Kapitel 40 Kleefeld - Chutor Wesjolyj<br />
1854 wurde das Dorf von 40 Familien am<br />
linken Ufer des Flusses Juschanlee gegründet.<br />
Kornelius <strong>Plett</strong> (1820-1900), ein Glied der<br />
Kleinen Gemeinde, diente in der ersten Zeit als<br />
Dorfschulze. Abraham Reimer (1808-92), der Sohn<br />
von Klaas Reimer (Gründer der Kleinen Gemeinde),<br />
wohnte auch in Kleefeld. Er war sehr beschäftigt,<br />
indem er seine Tagebücher schrieb und Sterne<br />
studierte. Deshalb bekam er den Kosename "fauler<br />
270<br />
Reimer" und "Sternschauer Reimer". Seine Söhne<br />
zogen 1874 nach Manitoba, Kanada, wo sie das<br />
Dorf Steinbach gründeten, heute eine Stadt.<br />
Das Dorf ist am 14.02.1968 dem russischen<br />
Dorfe Mogutneje angeschlossen worden. Seit den<br />
1990er Jahren existiert das Dorf nicht mehr und<br />
auch kein einziges Haus mehr. Es ist dem Erdboden<br />
gleichgemacht. Der Friedhof ist auch umgepflügt<br />
worden.<br />
Einer von vielen Transportzügen der Firma "Reimer-Express" aus Winnipeg, Manitoba, unterwegs in<br />
Wyoming, USA. Es war mir wichtig, weil der Name meiner Mutter auch "Reimer" ist. Wie sich später herausstellte,<br />
sind wir mit diesen Reimers nicht verwandt. Sie sind die Nachkommen von Klaas Reimer,<br />
Gründer der Kleinen Gemeinde.Der Ururgroßsohn von Abram F. Reimer (1808-92), Frank F. Reimer, ist der<br />
Gründer der Firma "Reimer-Express." Foto: September 1999.<br />
Auf diesem Feld stand das Dorf Kleefeld. Heute ist nichts mehr da, was noch an das Dorf erinnern könnte.<br />
Außer diesem runden Gebäude, (laut Nachforschungen des Archivdirektors in Saporoschje A. Tedeew<br />
sollte dieses Gebäude zu einer Dampfmühle gehört haben), ist alles umgepflügt. Foto: August 1994.
Kapitel 40 Kleefeld - Chutor Wesjolyj<br />
271<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaft von Abram Klassen in Kleefeld. <strong>Die</strong> junge Leute sind auf dem Weg zu einem Picknik und Mai Festival. <strong>Die</strong>ses Bild ist bestimmt<br />
noch in der Sowjetszeit aufgenommon worden. Weil die Front 1943 wochenlang in der <strong>Molotschna</strong> stand, sind viele Dörfer, so wie Kleefeld,<br />
ganz vom Erdboden verschwunden. Foto aus Quiring und Bartel, Seite 95.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Elisabeth Rempel Reimer 1814-93 - <strong>Die</strong> Matriarch<br />
Elisabeth Rempel wurde 1814 in Reinland,<br />
Preußen, geboren. Sie war die Tochter von Peter<br />
Rempel (1792-1837) und Katharina Berchen (1780-<br />
1831). <strong>Die</strong> Familie wanderte 1817 nach Russland aus<br />
und erwarb eine Wirtschaft in Lichtfelde,<br />
<strong>Molotschna</strong>.<br />
<strong>Die</strong> Rempel-Sippschaft, wie manche andere<br />
Auswanderer nach Russland, war von dem separatistischen<br />
Pietismus in Preußen beeinflusst worden.<br />
<strong>Die</strong>se Bewegung betonte die Endzeit der<br />
Prophezeihungen, verschmähte materielle<br />
Bequemlichkeit u.s.w. <strong>Die</strong> 17-jahrige Elisabeth hatte<br />
eine Tante und zwei Onkel, welche diesen fanatischen<br />
Lehren anheimgefallen waren. Ihr Onkel<br />
Johann starb an einer Krankheit, die eine Folge der<br />
Ausübung dieser Lehre war. Ohne Zweifel hat<br />
Elisabeth sich vorgenommen, solches nicht in ihrer<br />
Familie zu dulden.<br />
Im Juni 1834 wurde Elisabeth auf ihr ernstes<br />
Glaubensbekenntnis getauft und in die Kleine<br />
Gemeinde aufgenommen. Ein Jahr später heiratete<br />
sie Abraham, Sohn von Klaas Reimer, Petershagen,<br />
Gründer der Kleinen Gemeinde 1812. Es schien eine<br />
gute Wahl zu sein. Intelligent, geistreich und<br />
Sprössling einer wohlhabenden Familie. Welches<br />
Fräulein würde nicht diesen Abraham haben<br />
wollen?<br />
Doch in mancher Hinsicht war Elisabeths Wahl<br />
weniger perfekt. Es stellte sich bald heraus, dass es<br />
Abraham am Charakter fehlte, wie Fleiß,<br />
Gründlichkeit und Arbeitsamkeit.<br />
1836 zog das junge Paar nach Rosenort,<br />
<strong>Molotschna</strong>, wo sie ihre eigene Wirtschaft gründete.<br />
Aufzeichnungen zeigen, dass die Familie auf die<br />
Wohltätigkeit der Gemeinde angewiesen war, um<br />
ihre Bedürfnisse zu decken. 1856 erhielten sie 561<br />
Rubel, um ein neues Haus zu bauen, wahrscheinlich<br />
im neuen Dorf Kleefeld. Abraham wurde bald<br />
als der "Sternschauer" und "Fula Reimer" bekannt.<br />
1864 zogen Abraham und Elisabeth zusammen<br />
mit Söhnen Abraham und Klaas nach der neuen<br />
Siedlung Markusland. 1869 zogen sie nach<br />
Steinbach, Borosenko, wo sie ihre eigene Wirtschaft<br />
hatten. Elisabeth Rempel Reimer war ohne Zweifel<br />
Matriarch oder Tonangeber in dem "alten"<br />
Steinbach, im kaiserlichen Russland. Fünf ihrer<br />
Kinder mit Familien wohnten auch in diesem Dorf.<br />
Glücklicherweise war Elisabeth eine Frau mit<br />
viel Energie, großer Entschlossenheit und Festigkeit.<br />
Es war nicht ihre Natur, zu sitzen und über das<br />
nachzugrübeln, was das Schicksal aufgetischt hatte.<br />
Sie übernahm die finanzielle Verantwortung in der<br />
Familie. Sie war eine fähige Schneiderin und nähte<br />
272<br />
für andere. Vorbildlich diente sie als Hebamme,<br />
Krankenschwester und Totenbestatterin. Man rief<br />
sie zu irgendeiner Stunde des Tages um Hilfe an.<br />
Während all dieser Tätigkeiten beobachtete<br />
Abraham nicht nur seine Frau, die er herzlich liebte,<br />
er schrieb auch alles nieder, was er sah. Sein<br />
Tagebuch beschreibt Elisabeth als eine Frau von<br />
unglaublich großer Energie, beschäftigt von früh bis<br />
spät, auf Reisen von einem Dorf zum anderen, bald<br />
mit ihrem Sohn, bald mit dem Schwiegersohn,<br />
immer helfend, Besuche, Geburten, Sterbende und<br />
mit all den Ereignissen der Jahreszeiten und<br />
Lebenszeiten. Vor allem aber war sie um die<br />
Erziehung ihrer eigenen Familie besorgt, welche sie<br />
in Steinbach, Borosenko um sich gesammelt hatte.<br />
Regelmäßig wurde sie von einer<br />
geheimnisvollen Krankheit überfallen, aber immer<br />
wieder konnte sie die überwinden. Sie lebte für ihre<br />
Familie, unzählbare Freunde und Verbindungen<br />
und die Kirchengemeinschaft.<br />
Elisabeth konnte auch sehr lebhaft sein, welches<br />
aus einer Begebenheit im Jahre 1870 zu erkennen<br />
ist. Nachdem ihr Gatte oft erwähnt hatte, dass seine<br />
Frau kränklich sei, und das Fieber sie ans Bett fesselte,<br />
schrieb er am 3. Juli "dass sie schon zwei Tage<br />
nacheinander schwimmen gegangen sei in der<br />
,Ritsch' und dass sie so fröhlich schon lange nicht<br />
gewesen sein. Unglücklicherweise war das<br />
Schwimmen nicht allzugut für sie gewesen, denn<br />
schon zwei Tage später schrieb Abraham "Sie war<br />
wieder sehr krank." Man muss sich das Bild (vom<br />
Schwimmen) nur vorstellen, wie diese 205 Pfund<br />
schwere Dame in ihrem "Badeanzug" in dem<br />
Bazawluk Flüsschen herumhüpfte und ihr<br />
<strong>Die</strong>nstmädchen Wache stand. (Im kaiserlichen<br />
Russland hatten sogar arme Leute <strong>Die</strong>ner.)<br />
Elisabeth war es, welche die wichtigen<br />
Entscheidungen für die Familie machte.<br />
1874 entschloss sich die ganze Reimer-<br />
Sippschaft, ihre wohlhabenden Wirtschaften im<br />
kaiserlichen Russland zu verlassen und nach Nord-<br />
Amerika auszuwandern. <strong>Die</strong> Entscheidung war,<br />
wenigstens teilweise, auf einer Vision begründet, in<br />
welcher Elisabeth einen klaren Hinweis von Gott<br />
erhielt, dass diese Auswanderung der richtige<br />
Schritt für sie sei.<br />
Elisabeth und drei ihrer Kinder siedelten in<br />
dem wohlhabenden Dorf Blumenort, (Kanada) an.<br />
<strong>Die</strong> anderen vier Kinder, welche mit dem letzten<br />
Trupp der Kleinen Gemeinde reisten und Russland<br />
1874 verließen, siedelten in Steinbach, etwa drei<br />
Meilen südlich, an.<br />
1875 vernichteten Heuschrecken die erste gute
Kapitel 40 Kleefeld - Chutor Wesjolyj<br />
Ernte der Pionieransiedler in Steinbach. Als man im<br />
Frühling 1876 entdeckte, dass die Erde voller<br />
Heuschreckeneier war und sicherlich nach dem<br />
Ausbrüten die neugesäte Ernte vernichten würden,<br />
"versammelte sich die Reimer-Sippschaft an einem<br />
warmen Sonntagnachmittag in dem geräumigen<br />
Heim von Sohn Klaas in Steinbach. Sie besprachen<br />
die Möglichkeit, von Steinbach, wo ihnen der<br />
Hunger ins Gesicht starrte, nach Mountain Lake,<br />
Minnesota, auszuwandern."<br />
<strong>Die</strong> meisten Versammelten waren mit diesem<br />
Vorschlag einverstanden. "Nach der Besprechung<br />
erhob sich die ältere Elisabeth langsam, und mit<br />
Tränen in den Augen bat sie ihre "dickköpfigen"<br />
Söhne und Schwiegersöhne, doch noch ein Jahr zu<br />
warten. Sie betonte, wie unwillig sie gewesen war ihr<br />
gemütliches Heim (in Russland) zu verlassen und<br />
wie, noch ehe sie sich mit ihrer großen Familie in<br />
das neue, unbekannte Land begab, der Herr Gott im<br />
Himmel, der schon ihren Ahnen auf der Suche nach<br />
einer Heimat geholfen hatte, auch ihr eine klare<br />
Vision gegeben hatte,-Ihm völlig zu vertrauen. Sie<br />
war überzeugt, dass diese Heuschreckenplage nur<br />
eine vorübergehende Erscheinung, eine<br />
"Glaubensprüfüng sei." (Klaas J. B. Reimer, in<br />
"Historical Sketches of Steinbach", Seite 2.)<br />
Elisabeths gefühlvolles Bitten verfehlte nicht<br />
ihr Ziel: die Kinder gaben nach. Hätten ihre Söhne<br />
Klaas und Johann und die Schwiegersöhne<br />
Abraham S. Friesen und Peter P. Töws diesen Ort<br />
wie geplant verlassen, so hätte sich das bürgerliche<br />
Gemeindeleben nicht so entwickelt, und die<br />
Triebkraft für ökonomischesWachstum anderswo<br />
verlegt worden. Ihre Söhne und Enkel wurden<br />
Werkzeuge in der Entwicklung von Steinbach zu<br />
einer wohlhabenden Stadt und einem Zentrum im<br />
südöstlichen Manitoba.<br />
Elisabeth hatte ein Herz voller Erbarmen, auch<br />
wenn es manchmal riskant war.<br />
Geschichtsschreiber Royden Loewen, beschreibt<br />
einen Fall, wo sie drei betrunkenen einheimischen<br />
Männer, die draußen im Unwetter waren,<br />
Nachtlager gewährte. Sie schliefen auf dem<br />
Fußboden, während sie die ganze Nacht Wache<br />
hielt. Des Morgens gab sie ihnen Frühstück und<br />
schickte sie ihres Weges, ausgeruht und ausgenüchtert.<br />
Es war in Manitoba, wo Elisabeth mit Ernst als<br />
Mantel- und Hütenäherin an die Arbeit ging. In<br />
einem Brief von 1889 beschreibt Abraham die<br />
außerordentlich große Näharbeit seiner Frau. Sie<br />
hatte schon "21 Pelze, viele Männermäntel,<br />
Unterwäsche und Schildmützen angefertigt. In<br />
einem Jahr machte sie 150 Schildmützen; gewöhlich<br />
100, 70 oder 80 jeden Sommer und im Winter etwa 70<br />
Wintermützen." Am 13. Juli 1891 schrieb Abraham<br />
273<br />
1904. <strong>Die</strong> Hochzeit von Maria B. Reimer (1884-<br />
1938) und Jakob R. "J. R." Friesen (1879-1950); eine<br />
Zusammenkunft von zwei der mächtigsten<br />
Familien in Steinbach, Kanada. "J. R." sein Vater<br />
Abraham S. Friesen, baute die Windmühle in<br />
Steinbach 1877 und gründete eine Geschäfts-<br />
Dynastie. "J. R." seine Mutter war die Tochter von<br />
Elisabeth Rempel Reimer. Maria ihr Großvater,<br />
Klaas R. Reimer (1837-1906) Steinbach<br />
Geschäftsman, war der Sohn von Elisabeth Rempel<br />
Reimer. 1914 gründete "J. R." das erste Ford-Auto-<br />
Verkaufts-Geschäft im westlichen Kanada. Foto<br />
aus Preservings,Nr. 9, Teil 1, Seite 73.<br />
wieder "Ich bin schön gesund, aber meine Frau ist so<br />
krank, dass sie in den letzten drei - vier Jahren nicht<br />
mehr gut gehen oder stehen konnte. Sie näht noch<br />
jeden Tag, aber zwei- oder dreimal am Tage legt sie<br />
sich auf die Ruhbank, um sich ezwas zu erholen"...<br />
Elisabeth starb 1893. Sie überlebte Abraham<br />
etwas länger als ein Jahr. Es war Elisabeth, die ihren<br />
Kindern den Wert der Arbeit und den Glauben an<br />
Gott eingeprägt hatte. Elisabeth Rempel Reimer<br />
steht als eine Heldin unter den Pionier-Frauen.<br />
Es war Elisabeths Verdienst, dass unter ihren<br />
Urenkeln die erfolgreichsten Pionier-Unternehmer<br />
in Manitoba sind: Frank F. Reimer, Steinbach,<br />
Gründer der "Reimer Express Line"; Jake Epp diente<br />
als Kanadischer Gesundheitsminister (in Ottawa);<br />
Ray Loewen gründete "Loewen<br />
Beerdigungs–Gesellschaft"; C.T. Loewen gründete<br />
die "Loewen Tischlerei und Holzfabrick" in<br />
Steinbach, und Peter K. Penner ist der Gründer von<br />
"Penner International" (Transport), und viele<br />
andere.<br />
Verkürzt aus D. <strong>Plett</strong>, Saints and Sinners, Seiten<br />
215-218. Ubersetzt von Jake Hildebrandt, Winkler,<br />
Manitoba.
Kapitel 41 Landskrone - Lankowoje<br />
1839 wurde am Fluss Begimtschokrak, einem<br />
Nebenfluss des Kurudjuschan, bei Stulnewo<br />
dieses Dorf gegründet. Vor der Ansiedlung war die<br />
Steppe Pachtgut des Einwohners der Dorfes<br />
Schönsee, Heinrich Janzen, der ein Unterpächter<br />
des Johann Cornies war. In Landskrone wurde<br />
Jakob S. Friesen geboren (1862-1931), der 1913 in<br />
Steinbach, Kanada, die Zeitschrift "Steinbach-<br />
Post" gründete.<br />
1913 hatte das Dorf 600 Seelen. Es wurden<br />
vorwiegend Ackerbau und Viehzucht betrieben.<br />
Das Dorf besaß eine dreiklassige Elementarschule<br />
mit drei Lehrern. Nach 1913 arbeitete hier<br />
mehrere Jahre eine mehrklassige<br />
Fortbildungsschule.<br />
Kirche. Seit 1910 besteht hier die Landskroner<br />
Kirchengemeinde als Abteilung der vereinigten<br />
"Margenau-Alexanderwohl-Landskroner"<br />
Kirchengemeinde mit einem in Landskrone<br />
erbauten Bethause.<br />
Karte des Dorfes Landskrone, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>. Aus Der Bote.<br />
274
Kapitel 41 Landskrone - Lankowoje<br />
<strong>Die</strong> ehemalige Kirche in Landskrone. Foto: August 1997.<br />
275<br />
Kirche in Landskrone 1910. Foto<br />
aus Quiring und Bartel, Seite<br />
93.<br />
<strong>Die</strong> Reste der Landskroner<br />
Kirche. Foto: Mai 1996.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
276<br />
Links: Ein Tor in Landskrone<br />
zeigt die mennonitische<br />
Bauart von damals. Foto:<br />
August 1997.<br />
Unten: <strong>Die</strong> Eingangspforte<br />
eines ehemalige prachtvollen<br />
Bauernhofes in Landskrone.<br />
Foto: August 1997.
Kapitel 42 Schönsee - Snegurowka<br />
1805 wurde das Dorf von 19 Familien aus<br />
Preußen unter der Leitung von Klaas Wiens zwischen<br />
Ladekopp und Petershagen am Fluss Tokmak<br />
gegründet. Bis 1812 lag das Dorf am linken Ufer<br />
des Flusses Tokmak. Da diese drei Dörfer zu nahe<br />
beieinander lagen, wurde Schönsee 1812 zehn<br />
Werst oberhalb des Dorfes Tokmak umgesiedelt.<br />
Genannt wurde es auf Wunsch eines Ansiedlers<br />
Jakob Regier nach seinem Geburtsort. Das Land<br />
wurde vor der Ansiedlung von den Bewohnern<br />
Tokmaks zur Viehweide genutzt.<br />
Zu dieser Zeit hatte das Dorf 35 Familien und<br />
einige Landlose mit insgesamt 500 Einwohnern.<br />
<strong>Die</strong> meisten waren Handwerker. Das Dorf hatte<br />
später einen Laden, eine kleine landwirtschaftliche<br />
Maschinenfabrik mit 30 Arbeitern, eine große<br />
Mühle, eine Schmiede und eine holländische<br />
Mühle.<br />
1919, während des Bürgerkrieges, lag<br />
Schönsee mehrere Jahre an der Frontlinie und<br />
erlitt große Schäden. In den 1930er Jahren wurden<br />
aus Schönsee 72 Männer verbannt.<br />
Kirche. <strong>Die</strong> mennonitische Gemeinde war bis<br />
1842 Teil der Großen Gemeinde in Lichtenau,<br />
danach bis 1900 Teil der Gemeinde Margenau.<br />
1903 wurde sie unter H. Peters unabhängig. Zu<br />
dieser Gemeinde gehörten die Dörfer Fürstenau,<br />
Fabrikerwiese, Schönsee, Liebenau, Wernersdorf,<br />
Hamberg und Klippenfeld, zusammen 1500<br />
Personen, fast alle Landwirte.<br />
1909 entstand am östlichen Ausgang des<br />
Dorfes ein neuer Bau, eine der größten und schönsten<br />
mennonitischen Kirchen in Russland. Sie<br />
wurde im neugotischen Stil gebaut. Der bedeutendste<br />
Älteste dieser Kirche war Alexander Ediger<br />
seit 1922.<br />
1931 wurde das Kirchengebäude zuerst als<br />
Kornspeicher benutzt und dann in einen Club<br />
umgewandelt. Zwischen den Fenstern wurden<br />
lebensgroße Porträts von Lenin und Stalin angebracht.<br />
Während der deutschen Besatzung wurde<br />
dieses Gebäude wieder als Kirche genutzt (ganz<br />
kurze Zeit). Heute wird die Kirche langsam zerstört.<br />
Dorfschule. Sie hatte zwei Klassenzimmer und<br />
zwei Lehrer. Heute ist das Gebäude umgebaut.<br />
Das Kirchengebäude der Mennoniten Gemeinde in Schönsee, so wie sie ursprünglich aussah. Foto aus<br />
Mennonite Life,July 1948, Seite 30.<br />
277
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Oben: Das Kirchengebäude der Gemeinde in Schönsee<br />
im Jahre 1954. Man sieht genau wie das Gebäude verfällt.<br />
Damals waren noch die Fenstergläser ganz,<br />
obwohl das Gebäude schon als Lagerhalle genutzt<br />
wurde. Foto erhalten von Frau Ediger aus Fulda,<br />
Deutschland. 1999.<br />
Links: <strong>Die</strong> Innenansich der Schönsee Kirche. Der alte<br />
Stil der Kanzel ist noch vorhanden so wie früher, aber<br />
die ganze übrige Einrichtung zeigt schon einen<br />
anderen Geist. Foto aus Mennonite Life, July 1948,<br />
Seite 30.<br />
Unten: Elemente des Baustils an der Kirche in<br />
Schönsee, so wie es 1994 aussieht. Foto: August 1994.<br />
278
Kapitel 42 Schönsee - Snegurowka<br />
Das Bethaus in Schönsee so wie sie 1994 aussah. Foto aus August 1994.<br />
Das Kirchengebäude in Schönsee. Anfang der 1990er Jahre wollte ein Geschäftsmann aus Saporoschje in<br />
diesem Gebäude eine Autowerkstatt einrichten. Er hatte gerade das Dachgerüst aufgebaut, da kam auch<br />
schon das unbegründete Verbot von der Regierung. So steht diese Kirche bis heute ungenutzt und wird von<br />
den Dorfbewohnern zerstört. Foto: Mai 1996.<br />
279
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Antrag für den Bau.<br />
15. April 1909.<br />
An die Verwaltung des Gouvernements Taurien, Bauabteilung vom Bevollmächtigten des<br />
Schönseer Mennonitischen Kirchenspiels der <strong>Kolonie</strong>n Klippenfeld, Hamberg, Wernersdorf,<br />
Libenau, Schönsee, Fabrikerwiese, Nikolaj Franzevic von Garnje, wohnhaft in Orechow, Kreis<br />
Berdjansk.<br />
Begleitschreiben<br />
Anliegend erhalten Sie eine Bittschrift in einer Doppelausfertigung über den Bau des gemeinschaftlichen<br />
Bethauses in Schönsee auf dem Gemeindeland, das von den oben genannten<br />
<strong>Kolonie</strong>n für diesen Zweck zur Verfügung gestellt ist, und eine Vollmacht, die von der<br />
Dorfverwaltung ausgestellt ist. Ich bitte das Bauamt, den aufgeführten Punkt zu überprüfen und zu<br />
genehmigen. N. von Garnje, Orechow, Gouvernement Taurien, Gogolewskaja Str. 13.<br />
Übersetzt aus dem Russischen von A. Reger.<br />
Tauffest in Schönsee 1930. Vorne in der Mitte sitzt Ältester A. Ediger. Foto erhalten von Frau Peters,<br />
Darmstadt, Deutschland, 1997.<br />
280
Kapitel 42 Schönsee - Snegurowka<br />
Eine bedeutende Person.<br />
...Alexander war in Berdjansk 1892 geboren<br />
worden, wo sein Vater Heinrich Ediger bedeutende<br />
Ämter bekleidete: Bankdirektor, Besitzer einer<br />
Druckerei und eine Zeitlang stellvertretender<br />
dänischer Konsul. Seine Mutter war die Tochter<br />
eines reichen Berdjansker Mühlenbesitzers, J.<br />
Friesen. Seine drei Söhne hatten eine gute<br />
Ausbildung bekommen. Einer von ihnen war<br />
Doktor für Philosophie, Theodor Ediger.<br />
...Alexander absolvierte das Gymnasium in<br />
Berdjansk durch einen Hauslehrer, wobei auch die<br />
Musik nicht vernachlässigt wurde. Er wurde ein<br />
Klaviervirtuose, und ohne selbst singen zu können,<br />
übte er später komplizierte Lieder und Kantaten<br />
mit seinem Chor ein. Dann besuchte er die historisch-philologische<br />
Fakultät der Universität in St.<br />
Petersburg und studierte einige Zeit in Berlin und<br />
Wien. Während der Revolution flüchtete er nach<br />
der Krim, wo er auch heiratete. Seine Frau war die<br />
Tochter des Zeltmissionaren Jakob Dyck aus der<br />
Krim.<br />
...1923 wurde er zum Prediger und dann zum<br />
Ältesten der Schönseer Kirchengemeinde ordiniert.<br />
Neues geistliches Leben kam in die Gemeinde<br />
hinein. Man fand nun in der eigenen Gemeinde<br />
das, was man sonst in anderen Gemeinden gesucht<br />
hatte. Der Gesang erreichte eine noch nie da gewe-<br />
Alexander Ediger 1892-193?<br />
sene Höhe. Sein Wirken erstreckte sich weit über<br />
die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus.<br />
...Er war Vorsitzender der KfK (Kommission für<br />
Kirchliche Angelegenheiten) und musste deshalb<br />
oft nach Charkow und Moskau reisen. Auch war er<br />
Redakteur von "Unser Blatt", damals der einzigen<br />
mennonitischen Zeitschrift in Russland.<br />
...Doch die Mächte der Finsternis waren schon<br />
am Werke, und er wurde 1929 verhaftet und in das<br />
Melitopoler Gefängnis gebracht, kam aber wieder<br />
frei. 1933 wurde er zum zweiten Mal verhaftet und<br />
nach Murmansk in den hohen Norden verbannt.<br />
Später kam er mit Frau zusammen nach dem<br />
östlichen Sibirien. 1938 kam Frau Ediger von dort<br />
zurück, und es gelang ihr später, nach Kanada zu<br />
entkommen. Ihre Kinder aber blieben alle in<br />
Russland. Alexander hat in der Gefangenschaft sehr<br />
schwere Zeiten durchgemacht, so dass er<br />
herzkrank wurde. Seitdem ist nichts Weiteres über<br />
sein Schicksal bekannt.<br />
Quelle:<br />
A. A. Töws: "Alexander war ein Beweis dafür,<br />
dass hohe Geistesbildung und einfältiger Glaube<br />
sehr gut vereinbar sind." Auszug aus H. Görtz, <strong>Die</strong><br />
<strong>Molotschna</strong>-<strong>Kolonie</strong>, Seite 140-142 und A.A.Töws,<br />
Mennonitische Märtyrer, Band I., (Winnipeg 1949),<br />
Seiten 73-75.<br />
Alexander Ediger und seine Frau. Foto aus A. A.<br />
Töws, Mennonitischen Märtyrer, Band I. Konsul Heinrich Ediger aus Berdjansk. Foto aus<br />
(Winnipeg 1949), Seite 73.<br />
Quiring und Bartel, Seite 98.<br />
281
Kapitel 43 Petershagen - Kutusowka<br />
1805 wurde dieses Dorf von bereits im Jahr<br />
1804 eingewanderten Ansiedlern gegründet.<br />
Größtenteils waren es junge Familien, von denen 12<br />
bemittelt und acht mittellos waren. Das Dorf<br />
Petershagen lag am Fluss Tokmak, fünf Werst vom<br />
Dorf Tokmak entfernt.<br />
Jeder Partie wurde nach Überschreiking der<br />
Grenze ein wegekundiger Soldat zur Verfügung<br />
gestellt. Den Winter haben sie in der Chortitza<br />
<strong>Kolonie</strong> zugebracht. Viele waren nicht zufrieden mit<br />
den geistlichen Umständen in der <strong>Molotschna</strong>, und<br />
Klaas Reimer (1770-1837), Johann Warkentin (1760-<br />
1825), später Blumenort, und Jakob Schellenberg<br />
(geb. 1772), später Tiegenhagen, fuhren das große 1<br />
000 000 Rubel teure Volenko-Landgut (Chutor)<br />
beschauen um es zu Kaufen. Als sie erfuhren, dass<br />
eine große Anzahl Leibeigenen dabei waren, verweigerten<br />
sie den Kauf, weil es gegen ihrer<br />
Glaubens-Konfession war, Sklaven zu eignen.<br />
Benannt wurde Petershagen auf Wunsch des<br />
Ansiedlers Abraham Janzen (1747-1822), nach<br />
einem gleichnamigen in Preußen, wo manche von<br />
den Ansiedler herstammten. Abraham sein Bruder<br />
Johann (1752-1823) war Führer diese Gruppe mit<br />
bedeutendem Vermögen. Er hatte drei verheiratete<br />
Söhne, einschließend Cornelius (geb. 1780), der<br />
1805 als Prediger gewählt wurde und später<br />
Mitgründer der Kleine Gemeinde war. In Chortitza<br />
haben sich noch 16 Familien mit Johann Janzen<br />
zusammengeschlossen, um das neue Dorf<br />
Petershagen zu gründen.<br />
Petershagen und Münsterberg, die Anfangs-<br />
Dörfer der Kleine Gemeinde, waren zwei der<br />
wohlhabendsten in der <strong>Molotschna</strong>. Also, es ist zu<br />
verstehen, dass diese Reformator-Gruppe, die<br />
ursprünglich aus wohlhabenden Bürgern bestand,<br />
mit den religiösen Umständen und der Richtung der<br />
Pionier-Gemeinde unter Jakob Enns nicht zufrieden<br />
waren. Schließlich wurde, nach schwierigem<br />
Versuchen mehr von den Lehren M. Simons usw.<br />
einzuführen, 1812 die sogenannte Kleine Gemeinde<br />
gegründet.<br />
1810 wird hier das erste Bethaus in der<br />
<strong>Molotschna</strong> gebaut. 1831 baute die<br />
"Warkentinsche" Gemeinde, die sich 1824 von der<br />
Ohrloffer-Petershagen Gemeinde trennt, ihr eigenes<br />
Bethaus. 1858 wird das 1810 erbaute Haus abgebrochen<br />
und aus diesem Material in Halbstadt ein<br />
neues Bethaus erbaut. <strong>Die</strong> Gemeinde nannte sich<br />
ab sofort "Ohrloff-Halbstadt".<br />
1892 wird hier eine neue Kirche gebaut. 1990 ist<br />
dort ein Getreidespeicher. 1999 wurde der alte<br />
Getreidespeicher von der Regierung einer Gruppe<br />
(unter der Leitung von Frank Dyck, Calgary,<br />
Kanada), zurückgegeben. Frank Dyck hat sich für<br />
den Wiederaufbau dieser Kirche sehr verdient<br />
gemacht und gründete dort auch eine Mennoniten-<br />
Gemeinde.<br />
Das Dorf wird in Russisch auch "Sladkaja<br />
Balka" genannt.<br />
<strong>Die</strong> Kirche der Mennoniten Gemeinde in Petershagen nach der Restauration, die 1999 beendet war. 184<br />
Personen haben die Abschiedsfeier vom Prediger-Ehepaar Frank und Nettie Dyck beigewohnt, als sie am<br />
19. April 2000 zurück nach Kanada fuhren. Foto von Orlando Hiebert, Tourond, Manitoba, April 2000/Aus<br />
Preservings,Nr. 16, Seite 50.<br />
282
Kapitel 43 Petershagen - Kutusowka<br />
Klaas Reimer 1770-1837 - Edler Reformator<br />
Klaas Reimer war ein Mann der Tat, dessen<br />
Energie, Überzeugung und tapferer Glaube 1812<br />
Leben in die junge Kleine Gemeinde hauchte und<br />
sie mit einer Vision für die Wiederherstellung der<br />
apostolischen Kirche erfüllte.<br />
Klaas Reimer wurde 1770 in Petershagen,<br />
Westpreußen, als Sohn von Heinrich Reimer und<br />
Agatha Epp geboren. Seine Mutter war die<br />
Schwester an Peter Epp (1725-89), Neunhuben,<br />
Ältester der flämischen Gemeinde zu Danzig. Sein<br />
Vater starb im frühen Alter, und seine Mutter<br />
heiratete wieder, und zwar Abraham Janzen (1747-<br />
1822), einen wohlhabenden Bauern aus demselben<br />
Dorf.<br />
1790 heiratete Klaas Reimer mit Maria Epp<br />
(1760-1806), Tochter von Peter Epp (1725-89),<br />
Neunhuben (also seine Cousine). 1801 wurde<br />
Klaas Reimer zum Prediger der Danziger<br />
Landgemeinde bei Neunhuben gewählt.<br />
1804 immigrierte Klaas Reimer zusammen<br />
mit etwa 30 Seelen aus der Landgemeinde<br />
Neunhuben in das kaiserliche Russland. Klaas und<br />
Maria hatten eine enge Beziehung zu ihrem<br />
Onkel, Ohm Cornelius Epp (1728-1806), der mit<br />
ihnen auswanderte und wenigstens zeitweise bei<br />
ihnen wohnte.<br />
Am 5. Juni 1805 siedelten Klaas und Maria in<br />
der Wirtschaft Nr. 4 in Petershagen, <strong>Molotschna</strong><br />
an. Am 6. November 1806 starb Klaas Reimers<br />
Frau Maria. Am 9. Januar 1807 heiratete Klaas<br />
Reimer mit Helena Friesen, die 17 Jahre jünger<br />
war. Sie war die Tochter von Abraham von Riesen<br />
(1756-1810) und Margaretha Wiebe (1752-1810)<br />
von Kalteherberge, Preußen, die seit kurzem in<br />
Ohrloff, <strong>Molotschna</strong>, wohnten, eine prominente<br />
Familie.<br />
Als Helenas Eltern beide 1810 starben, nahmen<br />
Klaas und Helene Reimer ihren jüngsten<br />
Bruder Klaas (1793-1870) auf und behandelten ihn<br />
wie ihren Sohn. In einem Brief nach Kronsgarten<br />
von 1831 erwähnte Helenas Bruder Abraham<br />
(1782-1849), Ohrloff (der 1838 zum zweiten<br />
Ältesten der Kleinen Gemeinde gewählt wird),<br />
dass sein Schwager Klaas Reimer sehr krank gewesen<br />
ist, dass es ihm aber wieder besser geht und zu<br />
hoffen ist, dass er in der Lage sein wird, am folgenden<br />
Sonntag das Abendmahl auszuteilen.<br />
Zusammen mit Münsterberg am anderen<br />
Ende der <strong>Kolonie</strong> war Petershagen der Geburtsort<br />
283<br />
der Kleinen Gemeinde, die 1812 enstandt.<br />
<strong>Die</strong> Ereignisse von Klaas Reimers mutigem<br />
geistlichen Amt und <strong>Die</strong>nst als Gründer und erster<br />
Ältester der Kleinen Gemeinde sind wohlbekannt.<br />
In seiner Autobiografie unter dem Titel "Ein<br />
kleines Aufsatz" beschrieb er die<br />
Herausforderungen, denen er sich<br />
gegenübergestellt sah, als er sich bemühte, die<br />
Kleine Gemeinde auf der Grundlage der Lehre des<br />
Evangeliums zu gründen. "Ein kleines Aufsatz"<br />
sowie zwei Briefe von 1819 und 1830 wurden 1993<br />
veröffentlicht (Leaders, Seiten 121-221). Eine<br />
"Ermahnung für die Bruderschaft" von 1825<br />
existiert ebenfalls (Heinrich F. Loewen, Journal).<br />
Obwohl Klaas Reimer unter Verachtung seitens<br />
der Prediger der Separatist-Pietisten litt und<br />
ihm zweimal mit einem Exil in Sibirien gedroht<br />
wurde, war zweifellos die schwierigste Krise in<br />
seinem Leben die falsche Demutsbewegung in<br />
seiner eigenen Gemeinde 1828-29.<br />
Drei Predigten von Ohm Klaas sind übersetzt<br />
und veröffentlicht worden. Sie zeigen einen Mann<br />
mit einem scharfen Sinn für seine Berufung und<br />
Leidenschaft, die Liebe Jesu zu lehren. Dr. Al<br />
Reimer, Winnipeg, Manitoba, hat geschrieben: "Er<br />
(Klaas Reimer) hat nicht die Ehre empfangen, die<br />
ihm als Prediger gebührt." Seine "Predigt für das<br />
Abendmahl" von 1829 ist auf einer "tiefen, vertrauensvollen<br />
Geistigkeit und Gelassenheit"<br />
basiert und ist "ausgestattet mit reichen Juwelen<br />
biblischer Bildersprache." <strong>Die</strong> Predigt über das<br />
"Gleichnis vom Weizen und Unkraut" von 1832<br />
zeigt eine "feine Klarheit in der Auslegung" und<br />
"ist gefüllt mit einem Geist der bescheidenen<br />
Vollmacht und Leidenschaft für seine Herde." <strong>Die</strong><br />
dritte Predigt über Liebe und Bruderschaft, die er<br />
1830 brachte, wird als "tiefempfundene, klar ausgedrückte<br />
Predigt über Liebe, Demut, Buße und<br />
Vergebung" beschrieben, die "... frei ist von jedem<br />
Geist der Rechtfertigung ... und ist übergossen von<br />
einem Geist reifer und tröstender Gelassenheit."<br />
Nach Ansicht von Dr. Al Reimer "umfasst sie<br />
die reinste Form, die ich kenne, was nach meiner<br />
Meinung das Wesen der traditionellen Kleine<br />
Gemeinsche-Botschaft über die Nachfolge Jesu<br />
durch ein sanftmütiges, liebevolles und<br />
geheiligtes Leben ist."<br />
Klaas Reimers <strong>Die</strong>nst konzentrierte sich auf<br />
die Wiederherstellung der Vision der mennonitis-
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
chen Reformatoren vom 16. Jahrhundert zum<br />
Ethos der neutestamentlichen Gemeinde und zu<br />
einer neuen Weltordnung, in der alle menschlichen<br />
Beziehungen von der Bergpredigt<br />
geleitet werden. Aus diesem Grunde sind Klaas<br />
Reimers Lehren und Predigten heute ebenso<br />
zutreffend wie vor 150 Jahren.<br />
Klaas Reimer war ein Mann mit vielen<br />
Talenten. Er las viel in den Ur-Schriften des<br />
Glaubens der Anabaptist-Mennoniten und war<br />
damit beschäftigt, diese Werke vom<br />
Holländischen ins Deutsche zu übersetzen. Ein<br />
Beispiel dieser Übersetzungsarbeit-ein Auszug<br />
aus Menno Simons "Fundamentsbuch" oder<br />
"Grundlage der christlichen Lehre", welches die<br />
Praxis des Ausschlusses behandelt-wurde von<br />
Prediger Gerhard Schellenberg (1827-1908) aus<br />
Ohrloff, später Rosenfeld, Manitoba, aufbewahrt.<br />
Ohm Klaas schätzte Bücher von guter Qualität;<br />
seine Bibel-welche kürzlich als Ausstellungsstück<br />
ins "Mennonite Heritage Museum" in Steinbach,<br />
Manitoba, gekommen ist-wurde 1660 gedruckt<br />
und besaß einen teuren Ledereinband. Dort<br />
befinden sich auch zwei Holzschnitte, ein<br />
Spazierstock und ein Federkasten, die Klaas<br />
Reimer als junger Mann geschnitzt hat; beide<br />
Stücke zeigen eine große artistische Fertigkeit<br />
und eine feste Hand (D. <strong>Plett</strong>, Klaas Reimers<br />
Spazier-stock in Preservings, Nr. 7, Dezember<br />
1995, Seite 46).<br />
Es war vielleicht passend, dass Klaas Reimers<br />
Tod eintrat, während er zu Pferd auf einer geistigen<br />
Besuchsreise war. Er wurde von einer<br />
Krankheit überfallen und starb unterwegs. Am<br />
Montag, 28. Dezember 1837, dem letzten Abend<br />
seines Lebens, hielt er sich im Heim von Peter<br />
Kröker in Lindenau (Wirtschaft 15) auf, wo er bis<br />
11 Uhr abends sprach. Nachdem sich die Brüder<br />
verabschiedet hatten und ihre getrennten Wege<br />
gegangen waren, legte sich Klaas Reimer zum<br />
Schlaf hin, um friedlich zu ruhen. Er hatte nur<br />
kurze Zeit geruht, als er starke Schmerzen in der<br />
Brust verspürte, die auf sein Herz drückten. <strong>Die</strong><br />
Uhr hatte kaum 4 Uhr morgens geschlagen, als<br />
ihn seine Seele verließ und heimging, um bei<br />
seinem geliebten Herrn zu sein, dem er so viele<br />
Jahre treu gedient hatte. Es wird berichtet, dass<br />
sie nach seinem Tod die Botschaft zu seinem<br />
Heim geschickt haben, dass er ernsthaft krank<br />
sei, obwohl er schon tot war. Das geschah, um sie<br />
davor zu schützen, dass sie solch eine drastische<br />
284<br />
Nachricht so plötzlich und unerwartet erhielten.<br />
Kurz danach wurde die Nachricht gebracht, in<br />
der sie darüber informiert wurden, dass er tatsächlich<br />
gestorben war.<br />
Klaas Reimer wurde am <strong>Die</strong>nstag, 4. Januar<br />
1838, beerdigt, vermutlich auf dem Friedhof in<br />
Petershagen. Er hatte das Alter von 67 Jahren, 2<br />
Monaten und 13 Tagen erreicht. Historiker sind<br />
nicht immer freundlich zu Klaas Reimer gewesen.<br />
Peter M. Friesen betrachtete ihn als<br />
unchristlich und ,,ohne jedes freudige Wissen um<br />
Gottes Gnade" (Seite 93). Jeder, der die Predigten<br />
von Ohm Klaas gelesen hat, kann daraus nur<br />
schließen, dass Friesen ein fanatischer Pietist<br />
war, der jeden verachtete, der nicht in seinen<br />
gesetzlichen Erlösungsplan, sein sektiererisches<br />
Programm und seine Endzeitphantasien hineinpasste.<br />
Reimer ist auch nicht die Ehre zuteil<br />
geworden, die er als historischer<br />
Chronikschreiber, für seine Journale und<br />
Schriften, die zu den sehr wenigen gehören, die<br />
sich mit der Pionierzeit der <strong>Kolonie</strong> <strong>Molotschna</strong><br />
befassen, verdiente.<br />
Andere Schreiber sind glücklicherweise freundlicher<br />
und in ihrem Urteil gerechter gewesen.<br />
In seinem epischen Gedicht über den Tod von<br />
Klaas Reimer berichtet Heinrich Balzer, dass der<br />
Heilige Geist Ohm Klaas mächtig in seinem<br />
<strong>Die</strong>nst geleitet hat, besonders während der letzten<br />
vier Jahre.<br />
Reimer sprach nicht weniger als 80-mal zu<br />
der Bruderschaft, wobei er sie ermahnte und<br />
ihnen den Weg zu Christus wies (Heinrich Balzer,<br />
"Ein Lied über das Absterben des Ältesten Klaas<br />
Reimer," (The Golden Years, Seiten 210-212).<br />
1838 widmete Klaas Friesen (1793-1870),<br />
Altonau, später, Rosenort, Schwager und<br />
Pflegesohn, in einem Brief an Bruder Peter in<br />
Preußen, Reimer die folgende Huldigung:<br />
"Tatsächlich ist unser beliebter Ältester während<br />
der Zeit seines Weilens hier vor uns wie ein Vater<br />
den Weg der Wahrheit gegangen. Er fürchtete<br />
nicht die ermüdende Reise oder andere<br />
schwierige Umstände, wenn nur die Gemeinde<br />
dadurch gebessert wurde. O dass wir die dringenden<br />
Ermahnungen beachten und eingedenk<br />
sein wollten, die sich auf das Wort Gottes gründen,<br />
dass er uns in seinen Predigten sowie in den<br />
Zusammenkünften der Bruderschaft und bei<br />
anderen passenden Gelegenheiten brachte.<br />
Denn soviel ich weiß, war er bedacht, allen
Kapitel 43 Petershagen - Kutusowka<br />
Menschen eine gute Lehre und Erinnerung zu<br />
bringen, die aus der Tiefe seines Herzens kamen,"<br />
(Klaas Friesen, "Brief an Peter von Riesen, 1838").<br />
Klaas Reimer war ein konservativer<br />
Intellektueller, dessen Stimme mit einzigartiger<br />
Klarheit über die Jahrhunderte hinweg spricht,<br />
durch eine Zeit, als traditionelle Lehren und<br />
Gedanken oft verachtet wurden und chiliastische<br />
Fantasien und fanatischer Separatismus große<br />
Mode waren. Ohm Klaas wird zur zentralen Persönlichkeit<br />
in jedem Studium der Kleinen<br />
Gemeinde und der konservativen<br />
Glaubenstradition, die sie lehrt. Er wird zum<br />
Siedepunkt in dem Programm der Separatist-<br />
Pietisten, um den traditionellen mennonitischen<br />
Glauben in Russland auszurotten. Wenn Ohm<br />
Klaas erfolgreich verächtlich gemacht und der<br />
Lächerlichkeit preisgegeben werden könnte,<br />
dann könnte die Kleine Gemeinde und wirklich<br />
der ganze konservative Flügel des mennonitischen<br />
Glaubens, leicht veräußert werden, so dass<br />
man sich von ihm als von belanglosen und<br />
rechthaberischen Reaktionären distanziert.<br />
Auszug aus D. <strong>Plett</strong>., Ed., Leaders of the<br />
Kleinen Gemeinde (Steinbach, Kanada 1993),<br />
Seiten 113-120, und Delbert <strong>Plett</strong>, Saints and<br />
Sinners (Steinbach, 1999), Seiten 67-70.<br />
1825 wurde eine schwere Anklage gegen die Kleine Gemeinde in Odessa erhoben, weil sie sich von der<br />
Begleitung der <strong>Die</strong>be und Überwachung von Gefangenen entsagten. <strong>Die</strong> Kleine Gemeinde wurde<br />
genötigt zu dieser Klage Stellung zu nehmen, welche das Ergebnis haben könnte, dass Klaas Reimer nach<br />
Sibirien verbannt werden würde."Ich habe auf Knien mit Gott und der Gemeinde den Bund geschlossen,<br />
dass ich keine Rache üben werde und bevor ich das tue, bin ich bereit das anzunehmen, was der Kaiser<br />
und die Regierung für mich bestimmen werden." Der Richter stimmte ihm zu, dass seine Einsicht richtig<br />
sei, und er wurde freigelassen. Ein Gemälde von Ron Kroeker, Rosenort, Manitoba, aus D. <strong>Plett</strong>, Saints<br />
and Sinners,Seite 56.<br />
285
Kapitel 44 Juschanlee - Kirowo<br />
<strong>Die</strong> Steppe am Mittellauf des Juschanlee-<br />
Flusses hatte seit 1830 der Bauer aus Ohrloff,<br />
Johann Cornies (1789-1848), gepachtet. Seine<br />
Gäste waren die Zaren Alexander I. und Alexander<br />
II. Nach Cornies Tod ging die Wirtschaft an Philip<br />
Wiebe über.<br />
1879 ging Juschanlee gegen den Willen und<br />
das Wissen der Cornies-Nachkommen in den<br />
Besitz der Reimer-Familie über. <strong>Die</strong> neuen<br />
Besitzer bauten die ganze Wirtschaft um: anstelle<br />
des Wohnhauses baute man ein kleines Schloss<br />
auf. Nur der Glockenturm in der Mitte des Hofes<br />
blieb als Zeuge einer Riesenarbeit stehen.<br />
Nach der Revolution wurde der Eigentümer<br />
vertrieben und das Anwesen nationalisiert. In den<br />
1920er Jahren entstand hier die Sowjetwirtschaft<br />
"Mogutscheje".<br />
Heute wird der gesamte Komplex als ein psychiatrisches<br />
Hospital genutzt, und Juschanlee<br />
gehört zum Kolchos "Kirowo".<br />
Der Eingang zum Reimer-Gut, früher Cornies Chutor. Foto: August 1997.<br />
Ein Nebengebäude auf dem Reimer-Gut in Juschanlee. Foto: August 1994.<br />
286
Kapitel 44 Juschanlee - Kirowo<br />
287<br />
Karte des Vorwerkes Juschanlee, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>. Mit Freundlicher Genehmigung von G. Walter, Ludwigsburg, Deutschland.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
288<br />
Oben, links ist die Paradeseite des<br />
Reimer-Hauses in Juschanlee. Foto:<br />
August 1997.<br />
Oben, rechts ein Turm an der südlichen<br />
Seite des Hauses. Anschließend ist ein<br />
schöner Garten. Foto: August 1997.<br />
Links, die Hintenseite des Reimer-<br />
Hauses in Juschanlee. <strong>Die</strong>ses war auch<br />
der Hof der Familie Cornies. Das Haus<br />
von Cornies ist sehr stark von der<br />
Reimer-Familie umgebaut worden.<br />
Foto: August 1997.
Kapitel 44 Juschanlee - Kirowo<br />
...Am 20. Juni 1789 wurde Johann Cornies in<br />
Burwalde bei Danzig geboren...<br />
...Sein Vater war ein Mann von praktischem<br />
Sinn und starker Willenskraft. In seinen jüngeren<br />
Jahren war er Matrose des Danziger Hafens, und<br />
er war sehr weit in der Welt herumgefahren...<br />
...1804 wanderte die Familie Cornies, bestehend<br />
aus Eltern und vier Söhnen, nach Russland<br />
aus. Johann war damals 16 Jahre alt. Nach einem<br />
zweijährigen Aufenthalt in der <strong>Kolonie</strong> Chortitza<br />
zogen sie weiter nach der <strong>Molotschna</strong>. Hier<br />
übernahmen sie im neu gegründeten Dorf<br />
Ohrloff eine Wirtschaft Nr.7, gegenüber der<br />
Schule. Der Anfang war schwer, aber der praktische<br />
Vater Cornies fand einen Ausweg. Es gab auf<br />
der ganzen Ansiedlung weit und breit keinen<br />
Arzt. Cornies Senior hat aus Preußen einige<br />
Kenntnisse von Krankheiten und Heilkräutern<br />
und einige Doktorbücher mitgebracht. So<br />
begann er, die Leute zu heilen. Damit verdiente<br />
er genug Geld, um die Wirtschaft aufzubauen.<br />
Der älteste Sohn Johann war auch nicht<br />
müßig, er wurde Müllerknecht auf der Mühle in<br />
Ohrloff. Als er genug Geld hatte, gab er die Stelle<br />
in der Mühle auf und kaufte sich ein Fuhrwerk.<br />
<strong>Die</strong>ses belud er mit allerlei Lebensmitteln und<br />
fuhr in die Großstädte (Stawropol und andere),<br />
um sie dort zu verkaufen. <strong>Die</strong>sen Handel betrieb<br />
er drei Jahre lang. Während dieser ganzen Zeit<br />
arbeitete er an seiner eigenen Fortbildung.<br />
Immer hatte er seine Bücher mit. Er hatte nie<br />
eine Schule besucht. Dazu gesellte sich noch die<br />
Schule des Lebens, und auf diesem Wege wurde<br />
aus Cornies ein kenntnisreicher, erfahrener<br />
Mann, der durchaus kompetent war, die<br />
<strong>Kolonie</strong>n später zu leiten, nicht nur<br />
wirtschaftlich, sondern auch das Schulwesen zu<br />
reorganisieren und zu reformieren...<br />
...Mit 22 Jahren heiratete er Agnes Klassen<br />
aus Ohrloff, übernahm eine Wirtschaftsstelle<br />
und wurde Landwirt. Er betrieb Getreidebau,<br />
Viehwirtschaft und Schafzucht. Seine Herden<br />
wuchsen schnell an. Er pachtete am Fluss<br />
Juschanlee ein großes Stück Kronsland. Hier entstand<br />
nun nach und nach das berühmte Vorwerk<br />
"Juschanlee". Später umfasste das Gut<br />
Johann Cornies 1789-1848<br />
289<br />
Johann Cornies (1789-1846). Foto aus G.<br />
Lohrenz, Seite 150.<br />
Juschanlee 3200 Desjatin Land, und der größte<br />
Teil des Landes wurde Cornies 1836 von Kaiser<br />
Nikolaj I. geschenkt. Hier in Juschanlee hatte<br />
Cornies nun die Gelegenheit, seine Pläne und<br />
Ideen auszuleben, und in der Regel gelang ihm<br />
alles, was er versuchte...<br />
...1817 wurde Cornies von der Regierung<br />
zum „Bevollmächtigten aller Mennoniten"<br />
ernannt.<br />
Besonders ging es Cornies um<br />
Baumbepflanzungen in der baumlosen Steppe,<br />
wo er mit gutem Beispiel auf seinem Gut voranging.<br />
Es war Cornies auch sehr gelegen, das<br />
Handwerk in der jungen Ansiedlung zu fördern.<br />
1841 gründete er bei Halbstadt den Industrieort<br />
Neu-Halbstadt....<br />
...1843 wurde das gesamte Schulwesen an<br />
der <strong>Molotschna</strong> dem "Landwirtschaftlichen<br />
Verein" unterstellt und damit Cornies. <strong>Die</strong>ses<br />
gab ihm die Möglichkeit, eine durchgehende<br />
Schulreform vorzunehmen. Er ließ gebildete<br />
Lehrer aus Deutschland kommen; in jedem Dorf<br />
wurden zweckentsprechende Schulhäuser
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
gebaut...<br />
...Cornies Einfluss erstreckte sich nicht nur<br />
auf die Mennoniten, sondern auch auf die<br />
Nachbarbevölkerung: Hutterer, Molokaner,<br />
Duchoborzen und Nogaier.<br />
...<strong>Die</strong> Verehrung und Hochachtung von<br />
Cornies war so groß, dass es sich die Leute<br />
zuweilen gefallen ließen, dass er sich in ihre<br />
Angelegenheiten einmischte. Bisher hatten die<br />
Eltern die Kinder nach ihrem Gutachten verheiratet,<br />
ohne auf deren Wünsche und<br />
Sympathien zu achten. Cornies räumte ganz<br />
radikal mit dieser allzu patriarchalischen Sitte<br />
auf....<br />
...Das Vermögen vor seinem Tode war 1 000<br />
000 Rubel; aber er könnte noch viel reicher<br />
gewesen sein, wenn sein Streben nur das<br />
Reichwerden gewesen wäre. Sein Reichtum kam<br />
ihm so nebenbei, wie von selbst. Sein<br />
Hauptbestreben galt seiner öffentlichen Arbeit<br />
zum Wohl seiner Glaubensgenossen...<br />
...Es ist wahr, dass sein Temperament bis zur<br />
Schroffheit und Härte entschieden war. <strong>Die</strong><br />
Obrigkeit betraute ihn mit absoluter Gewalt in<br />
den <strong>Kolonie</strong>n, und er machte auch Gebrauch<br />
von dieser Gewalt.<br />
Es ist anzunehmen, dass er zuweilen auch<br />
zu weit ging: wer sich seinen Verordnungen<br />
widersetzte, musste seinen starken Arm fühlen,<br />
manchmal im buchstäblichen Sinne des<br />
Wortes...<br />
...Von Seiten der Regierung erntete Cornies<br />
aber viel Lob und Anerkennung. 1838 wurde er<br />
sogar zum "korrespondierenden Mitglied" des<br />
Ministeriums der Reichsdomäne ernannt. Aber<br />
diese Ehrungen stiegen ihm nicht zu Kopf, sondern<br />
er blieb ein einfacher Mann...<br />
...Sehr interessant sind auch seine archäologischen<br />
Ausgrabungen, zu deren Zweck eine<br />
ganze Reihe von Kurganen in der südrussischen<br />
Steppe aufgegraben wurden...<br />
...Was Cornies noch als Mensch charakterisierte,<br />
ist seine bis ins kleinste gehende<br />
Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Wenn es um Geld<br />
ging, besonders fremdes, war er peinlich genau<br />
und ehrlich. Es zeichnete ihn eine große Milde<br />
und Güte gegenüber den Schwachen und Armen<br />
aus...<br />
290<br />
...Bemerkenswert ist Cornies große<br />
Duldsamkeit in religiösen Dingen, etwas, was in<br />
jenen Tagen durchaus selten war, besonders bei<br />
den Mennoniten. Als sich 1812 die Kleine<br />
Gemeinde abteilte, musste sie viel Verachtung<br />
und Bedrängnis erleiden. Man wollte sie nicht<br />
als selbständige Gemeinde anerkennen. Aber in<br />
Cornies fanden sie in ihrer Not einen starken<br />
Fürsprecher und Beschützer. Er wirkte bei der<br />
Regierung eine völlige Gleichstellung der<br />
"Kleingemeinde" mit der Großen aus...<br />
...Cornies starb am 13. März 1848. In seinen<br />
letzten Jahren wurde er schweigsam und in sich<br />
gekehrt. Sein Begräbnis trug einen internationalen<br />
Charakter...<br />
...Cornies war durchaus nicht ohne Fehler,<br />
und weil er ein großer Mann war, so erschienen<br />
auch seine Fehler sehr groß. Trotz seiner Fehler<br />
war Cornies einer der größten Wohltäter seines<br />
Volkes. Auf dem Ohrloffer Friedhof wurde<br />
Cornies ein Denkmal gesetzt, das leider den<br />
Stürmen der Zeit zum Opfer gefallen ist...<br />
Quelle: Ein Auszug aus H. Görz, <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong><br />
Ansiedlung (Steinbach 1950), Seiten 28-39.<br />
Denkmal für Johann Cornies in Ohrloff,<br />
<strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>. Foto von D. H. Epp, Johann<br />
Cornies,(Steinbach 1946), Seite 148.
Kapitel 44 Juschanlee - Kirowo<br />
Cornies Büro auf seinem Hof in Ohrloff, von wo er die Arbeit des Landwirtschaftlichen Vereins verwaltete.<br />
Foto aus Quiring, "Johann Cornies - A Great Pioneer," in Mennonite Life,July 1948, Siete 31.<br />
Ein teil von den Gebäuden und Ställen auf dem Gut Jushanlee so wie es mal war. Foto aus Quiring,<br />
Mennonite Life,July 1948, Seite 32.<br />
291
Kapitel 45 Alexanderkrone - Gruschewka<br />
<strong>Die</strong>ses Dorf wird 1857 in der Halbstädter<br />
Wolost gegründet. Das Dorf liegt im Südwesten<br />
der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, am linken Ufer des<br />
Flusses Juschanlee, Gouvernement Taurien. Im<br />
Dorf befinden sich eine Ziegelfabrik, eine<br />
Dampfmühle und zwei Windmühlen. <strong>Die</strong> Mühlen<br />
sind im niederländischen Stil gebaut und funk-<br />
tionierten bis 1952. 1913 zählte das Dorf 550<br />
deutschsprechende Einwohner, vorwiegend<br />
Landwirte, auf 2888 Desjatin Land.<br />
Dampfmühle. Ein Wiebe besaß eine<br />
Dampfmühle, die sich in der Nähe der holländischen<br />
Mühle befand. Heute (1998) ist die<br />
Dampfmühle nicht mehr da.<br />
Das ehemalige Kirchengebäude der Alexanderkroner Mennoniten Gemeinde wurde 1890 gebaut. <strong>Die</strong><br />
Gemeinde war selbständig. Sie hatte sich von der Margenauer Gemeinde abgeteilt. 1913 besteht die<br />
Gemeinde aus 1700 Seelen, darunter 1100 Kinder. Ältester ist Heinrich Koop, geb.1844. Heute wird das<br />
Gebäude von der Orthodoxen Kirche genutzt. Foto: Mai 1996.<br />
Das Dorf Alexanderkrone, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, William Schroeder, Seite 35.<br />
292
Kapitel 45 Alexanderkrone - Gruschewka<br />
<strong>Die</strong> Zentralschule in Alexanderkrone so wie sie eintsmals aussah. Sie entsteht 1906 als eine dreiklassige<br />
russische Handelsschule mit ca. 90 Schülern. Foto aus Quiring und Bartel, Seite 97<br />
293<br />
<strong>Die</strong> Zentralschule in<br />
Alexanderkrone. Foto:<br />
August 1994<br />
<strong>Die</strong> Dorfschule in<br />
Alexanderkrone. Foto:<br />
August 1994.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
<strong>Die</strong> Privatklinik von Doktor Büttner. Links war seine Praxis; rechts seine Apotheke. Heute ist in diesem<br />
Gebäude die Dorfverwaltung. Foto: August 1994.<br />
294<br />
Der Koops-Laden in<br />
Alexanderkrone von der<br />
Straßenseite. Foto: Mai 1996.<br />
Der Keller des ehemaligen Koops-<br />
Ladens. Foto: Mai 1996.
Kapitel 45 Alexanderkrone - Gruschewka<br />
Frau Pankratz in Alexanderkrone mit Orlando Hiebert, Tourond, Manitoba (rechts), Mai 2000, zu der Zeit<br />
President der Hanover Steinbach Historischen Verein. Frau Pankratz war während des II.Weltkrieges nach<br />
Sibirien verschleppt. Ihr Mann, ein Ukrainer, wurde in die Armee eingezogen. Nach dem Krieg holte er<br />
seine Frau aus Sibirien und sie kehrten in ihr Heimatdorf zurück. Das Elternhaus von Frau Pankratz war<br />
von Fremden besetzt und sie mussten sich in einem anderen, leerstehenden Haus ihr Heim einrichten. Sie<br />
lebt jetzt mit ihrer verheirateten Tochter in diesem Haus. Es ist ein altes mennonitisches Haus und steht in<br />
der Nähe der holländischen Mühle. Links auf dem Foto sitzen Frau Pankratz ihren Tochter und<br />
Schwiegersohn. Foto aus Preservings, Nr. 17, Seite 56.<br />
Rechts: <strong>Die</strong> holländische Mühle in Alexanderkrone.<br />
<strong>Die</strong>se Mühle ist die einzige, mennonitische Mühle,<br />
die noch steht. Sie gehörte einem Mann in<br />
Alexanderkrone namens Wiebe. Sie war vier-stöckig.<br />
<strong>Die</strong>se Windmühle wurde aus Holz gebaut, mit<br />
inneren Ziegelwänden. Sie wurde noch bis 1952<br />
gebraucht, dann brannte sie ab. Foto: August 1994.<br />
Unten: Das Innere der Mühle in Alexanderkrone.<br />
Foto: August 1994.<br />
295
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Das ehemalige Krankenhaus (Entbindungsstation?)<br />
in Alexanderkrone. Es wurde von einem Wiebe<br />
gebaut. Heute ist hier eine Lagerhalle. Foto: August<br />
1994.<br />
<strong>Die</strong> Innenansicht des Krankenhauses heute. Foto:<br />
August 1994.<br />
Hofansicht des Krankenhauses heute. Foto: August 1994.<br />
296
Kapitel 45 Alexanderkrone - Gruschewka<br />
<strong>Die</strong> Straße in Alexanderkrone, so wie sie einstmals aussah. Foto aus Quiring, Als ihre Zeit erfüllt war,Seite 96.<br />
Eine alte Wirtschaft in Alexanderkrone. <strong>Die</strong>se gehörte Heinrich Koop. Foto aus Quiring, Seite 95.<br />
297
Kapitel 46 Margenau - Seljonyj Jar<br />
1819 wurde in der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, Kreis<br />
Berdjansk, dieses Dorf von 24 Familien unter der<br />
Leitung des Oberschulzen Peter Töws, gegründet.<br />
Es hatte 300 Einwohner und lag am Fluss<br />
Kurudjuschan. <strong>Die</strong>se Steppe war vor der<br />
Ansiedlung Pachtland gewesen und wurde von<br />
den Nogaiern als Viehweide genutzt.<br />
<strong>Die</strong> Margenau-Gemeinde. 1832 baute die<br />
"Warkentinsche" Gemeinde, die sich 1824 von<br />
der Großen Ohrloffer Gemeinde trennte, ihr<br />
eigenes (das vierte!) Bethaus. Mit 3000 Seelen ist<br />
diese (Margenauer) Gemeinde die größte in der<br />
<strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>. Sie stand bis zum Weltkrieg<br />
1914 in hoher Blüte. Seit der Revolution 1917 hat<br />
die Gemeinde aufgehört zu existieren.<br />
Auch in der Geschichte der Kleinen<br />
Gemeinde hatte das Dorf Margenau eine große<br />
Bedeutung. In den 1850er Jahren waren acht<br />
Familien aus Margenau Glieder der Kleinen<br />
Gemeinde. Unter ihnen waren auch Peter Penner<br />
(1813-1884) und Peter W. Töws (1831-1922),<br />
später Blumenort, Manitoba, Kanada.<br />
Johann Harms (1798-1887) zog 1826 nach<br />
Margenau, wo er ein tüchtiger Bauer war. Er<br />
diente jahrelang als Dorfschulze und 1848 unterschrieb<br />
er die Gemeindeberichte. Sein Sohn<br />
Jakob (1826-98) war der Vater von Johann F.<br />
Harms (1855-1945), Minnesota, USA, ein bekannter<br />
Schriftleiter und Publizist der<br />
Brüdergemeinde. Johann Harms (1798-1887) sein<br />
Sohn Abraham Harms (1833-1909) gehörte zu der<br />
Kleinen Gemeinde und war Schullehrer in<br />
Margenau. 1875 zog er mit der Krimer<br />
Mennoniten Brüdergemeinde nach Gnadenau,<br />
Kansas.<br />
1997 findet man an dieser Stelle nichts, was<br />
an das ehemalige Dorf erinnern könnte. Auf<br />
Russisch war das Dorf auch Marnowka genannt.<br />
Margenau. Eine Aussicht in Richtung Nordost. Im Vordergrund sieht man das Fundament eines<br />
Kolchostalls. Man kann zu dieser Stelle nur noch auf einem Feldweg kommen. Foto aus Preservings, Nr.<br />
15, Seite 82.<br />
Friedhof im ehemaligen Dorf Margenau. In den 1980er Jahren wohnten hier noch etliche Familien, die<br />
aber in dieser Zeit wegzogen. Seitdem existiert das Dorf nicht mehr. Das Dorf lag am Fluss Kurudjuschan<br />
und zog sich in Richtung Südost zum Friedhof. Foto aus Preservings,Nr. 15, Seite 82.<br />
298
Kapitel 46 Margenau - Seljonyj Jar<br />
299<br />
Das Andachtshaus der Mennoniten Gemeinde in Margenau, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>. Ganz links steht Gerhard <strong>Plett</strong> aus Hierschau, der seit 1907<br />
Ältester der Margenauer Gemeinde war. Foto erhalten von Tina Mathies, Coaldale, Alberta, 1999.
Kapitel 47 Liebenau - Maiskoje<br />
1822 kamen 13 Familien aus Preußen unter<br />
der Leitung ihres Lehrers Peter Franz. Neun von<br />
diesen Familien schlossen sich anderen 11<br />
Familien an, die schon früher eingewandert<br />
waren, und gründeten 1825 dieses Dorf am<br />
Tokmak-Fluss. Der Dorfname wurde von dem<br />
Ein alter Zaun in Liebenau. Foto: August 1997.<br />
300<br />
damaligen Gebietsvorsteher Gerhard Enns bestimmt.<br />
Liebenau hatte eine Schule und eine<br />
Manufaktur-Fabrik des Jakob Franz. 1869 hatte<br />
Liebenau 20 Vollwirtschaften. Seit 1974 gehört es<br />
zum russischen Dorf "Ostrikowka".<br />
<strong>Die</strong> ehemalige mennonitische Schule in Liebenau. Foto: 1954.<br />
Im Gespräch mit einer<br />
mennonitischen Frau Fast,<br />
85 Jahre alt. Sie konnte<br />
nach dem Krieg wieder in<br />
ihr Heimatdorf zurückkehren.<br />
Rechts von Frau<br />
Fast ist Frank Dyck, ein<br />
kanadischer Missionar in<br />
der Ukraine. Frau Fast<br />
starb 1995. Foto: August<br />
1994.
Kapitel 48 Gut Steinbach - Kalinowka<br />
1812 wurden dem ersten Oberschulzen Klaas<br />
Wiens 390 Desjatin zuerkannt, worauf sich das<br />
Vorwerk Steinbach bildete, aus sechs Wirtschaften<br />
bestehend. 1819 wurden Klaas Wiens bei<br />
Steinbach noch 362 Desjatin vom Zaren zum<br />
ewigen vererblichen Eigentum geschenkt. Der Zar<br />
war begeistert von der Baumbepflanzung mitten<br />
in der öden Steppe.<br />
1828 wurde hier die erste Ziegelbrennerei an<br />
der <strong>Molotschna</strong> gegründet. Steinbach ist heute<br />
eine Einrichtung für 180 geistig behinderte Kinder<br />
Jakob und Maria Dück, Besitzer des Gutes<br />
Steinbach, <strong>Molotschna</strong>. Foto aus G. Lohrenz, Seite<br />
150.<br />
301<br />
im Alter von vier bis 22 Jahren.<br />
<strong>Die</strong> späteren Besitzer von Steinbach waren<br />
der Schwiegersohn von K.Wiens, Peter Schmidt<br />
und Jakob Dück. Peter Schmidt und seine Gattin<br />
waren einfache, biedere, gläubige, treukirchliche<br />
Mennoniten und haben mit ihrem großen<br />
Reichtum manchem Armen unter die Arme gegriffen<br />
und Hunderte, ja Tausende für die Mission<br />
gespendet. Er gründete hier eine<br />
Fortbildungsschule und hat Jünglinge zu Lehrern,<br />
Predigern und Missionaren ausbilden lassen.<br />
Plan des Gutes Steinbach, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>,<br />
1.Jakob Dick Haus, 2.Jakob Dick Scheune,<br />
3.Klaas Wiens Haus und Scheune, 4Nikolaj<br />
Schmidt Haus, 6. Private Schule, 7.Scheune,<br />
8.Garage, 9.Stromstation, 10.Küche, 11.Friedhof,<br />
12. Schenke, 13.Schmiede, 14.Schmiede-Haus,<br />
15.Arbeiter-Küche, 16.Private Residenz, 17.<br />
Gärtnerhaus.<br />
Aus Der Bote,Nr. 10, 1995, Seite 5.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Das Ökonomiegebäude in Steinbach. Foto aus G. Lohrenz, Seite 104. Für viele Jahre haben die reichen<br />
Bauern in der <strong>Molotschna</strong> das <strong>Kolonie</strong>sland billig gepachtet und dann es weiter für das Fünf-oder<br />
Zehnfache an die Landlosen verpachtet. Auf solche Weise sind etliche zu reichen Gutsbesitzern geworden<br />
und haben große Paläste gebaut. Klaas Wiens, der Gründer des Gutes Steinbach, war aber ein fromer,<br />
christlicher Mann, der viel für sein Volk getan hat. Er war auch ein guter Freund der Reformatoren der<br />
Kleine Gemeinde und hat mit ihnen in der <strong>Molotschna</strong> in den esten Jahren zusammen gearbeitet. Später<br />
hat Johann Cornies Wiens seine Arbeit übernommen und sehr vergrößert.<br />
302<br />
Ein mennonitisches<br />
Gebäude in Steinbach.<br />
Foto: Mai 1996.<br />
<strong>Die</strong> alte Brücke über<br />
den Bach bei Steinbach.<br />
Foto: Mai 1996.
Kapitel 49 Gnadenfeld – Bogdanowka<br />
Um dem furchtbaren Druck eines polnischen<br />
Edelmannes zu entgehen, zogen 1765 32<br />
Mennonitenfamilien aus der Gegend von<br />
Schwetz in Westpreußen, welches damals polnisch<br />
war, in eine moorige, mit Weidengesträuch<br />
bewachsene Gegend am rechten Netzeufer (im<br />
heutigen Brandenburg) und gründeten dort<br />
unter der Leitung des königlichen Geheimrates<br />
Franz von Brenkenhoff die beiden nach ihm<br />
benannten <strong>Kolonie</strong>n–Franzthal und<br />
Brenkenhofswalde. Sie gehörten zu den Alt-<br />
Flämingern, waren aber sehr von dem Pietismus<br />
beeinflusst.<br />
Als aber auch hier die Privilegien der<br />
Mennoniten eingeschränkt wurden, blickten<br />
viele nach Südrussland. 1833 wanderten sie aus<br />
und gründeten 1835 das Dorf Gnadenfeld (40<br />
Wirte, vier Handwerkerfamilien und 30<br />
Anwohnerstellen).<br />
Da die Ausreisegenehmigung für 40<br />
Familien ausgestellt war, aber zur Ausreise keine<br />
40 mennonitische Familien zusammenkamen,<br />
so reisten noch einige von den evangelischen<br />
(lutherischen) Familien mit. <strong>Die</strong>ser Umstand<br />
erklärt die nicht mennonitischen Namen:<br />
Lenzmann, Lange und andere in dieser <strong>Kolonie</strong>.<br />
Der erste Älteste war Wilhelm Lange. Der Name<br />
wurde dem Dorf vom Gebietsvorsteher gegeben,<br />
<strong>Die</strong> Hauptstraße von Gnadenfeld. Foto: Mai 1999.<br />
303<br />
indem er ein "Denkmal" der kaiserlichen Gnade<br />
stiften wollte.<br />
1873-1880 wanderten siebzehn Familien<br />
nach Amerika aus.<br />
1908 hatte das Dorf 75 Gutsbesitzer auf<br />
26537 Dsjt. Land.<br />
1926 hatte das Dorf 671 Einwohner, von<br />
denen 419 Glieder der Gemeinde waren. Von den<br />
671 Einwohnern waren 632 mennonitischer<br />
Abstammung. Das Dorf besaß eine<br />
Arbeitsschule (früher Elementar-, später<br />
Zentralschule), eine höhere Agrarschule, ein<br />
Postamt, eine ambulante Klinik, eine<br />
Motormühle, eine Bank.<br />
Zentralschule. 1859 wurde eine<br />
Lehrerbildungsanstalt gegründet, die dann 1873<br />
zur Zentralschule umgewandelt wurde. Sie ist<br />
noch da.<br />
Mädchenschule (1907). Sie wurde von Kornelius<br />
Reimer gebaut und stand in der Dorfmitte.<br />
Sie ist nicht mehr da.<br />
Kirche. Sie wurde 1854 gebaut. Ist noch da.<br />
Klinik. Ist noch da.<br />
Auf Russisch wurde das Dorf auch Kantow<br />
genannt.<br />
Zum Nachlesen: A. Löwen Schmidt 1835-1943<br />
Gnadenfeld, <strong>Molotschna</strong> (Kitchener, Ont. K.d.),<br />
Seiten 44 bis 84.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
304<br />
Karte des Dorfes Gnadenfeld, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>. Karte aus Agatha Schmidt, Gnadenfeld (Kitchener, Ontario, Kanada).
Kapitel 49 Gnadenfeld – Bogdanowka<br />
Das ehemalige Postamt in Gnadenfeld. Foto: Mai 1999.<br />
Ein ehemaliges mennonitisches Gebäude in Gnadenfeld. Foto: Mai 1999.<br />
305<br />
Ein mennonitisches<br />
Gebäude in<br />
Gnadenfeld von<br />
der Straßenseite.<br />
Foto: Mai 1999.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Das alte Krankenhaus in Gnadenfeld, das die deutsche Wehrmacht während des II. Weltkriegs als ihr<br />
Hospital nutzte.<br />
Das ehemalige Krankenhaus in Gnadenfeld. Foto: Mai 1999.<br />
Ein Gebäude in Gnadenfeld, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>. Foto: Mai 1999.<br />
306
Kapitel 50 Fürstenwerder - Balkowoje<br />
1821 wurde dieses Dorf von 26 Familien aus<br />
Preußen und vier bereits in Russland befindlichen<br />
Familien gegründet. An der <strong>Kolonie</strong> vorbei, unten<br />
im Tal, führt der fast immer wasserlose Fluss<br />
Begimtschokrak vorbei.<br />
1837 wurde hier eine Baumbepflanzung<br />
durchgeführt, wobei jeder Wirt ein Drittel seines<br />
Landes mit Maulbeerbäumen, Akazien und<br />
anderen Bäumen bepflanzen musste. Schon 1848<br />
konnte man kaum an ihren Wirtschaften die<br />
damals herrschende Armut erkennen.<br />
1915 wurde Fürstenwerder in "Poworotnoje"<br />
umbenannt; nach 1917 wieder Fürstenwerder; ab<br />
1945 und bis heute: Balkowoje. Vor der<br />
Kollektivierung gab es hier noch 32 Großwirte und<br />
307<br />
43 Kleinwirte. <strong>Die</strong> zwei Windmühlen gehörten<br />
Gerhard Pauls und Isaak Berg.<br />
1930. Fürstenwerder hatte kein eigenes<br />
Bethaus. <strong>Die</strong> Einwohner gehörten zu der<br />
Kirchengemeinde in Alexanderwohl oder zu der<br />
Brüdergemeinde in Rückenau. Vor dem Zweiten<br />
Weltkrieg gab es in einem Ladengebäude bei<br />
Gerhard Unger ein Andachtslokal.<br />
Fleischerei. Gehörte Peter Dyck. Nicht mehr da.<br />
<strong>Die</strong> Schmiede. Sie gehörte Peter Klassen. Nicht<br />
mehr da.<br />
Schule. Sie steht heute (1997) noch und wird als<br />
Wohnheim benutzt.<br />
Auf Russisch wird das Dorf auch Faschtawod<br />
genannt.<br />
<strong>Die</strong> ehemalige<br />
mennonitische<br />
Schule in<br />
Fürstenwerder.<br />
Foto: Mai 1995.<br />
<strong>Die</strong> alte Brücke über den Fluss<br />
Begimtschokrak in<br />
Fürstenwerder. Der Vater des<br />
Jungen auf der Brücke, Vitalij<br />
Schmidt, der auch seinen Teil<br />
für die Gründung der<br />
Mennoniten-Gemeinde in<br />
Saporoschje 1994 beigetragen<br />
hat, ist 1999 an Herzinfarkt<br />
gestorben. Vitalij hat sich sehr<br />
für die mennonitische<br />
Geschichte interessiert. Sein<br />
Vater war ein Mennonit, die<br />
Mutter eine Jüdin. Er ist in<br />
Halbstadt geboren. Foto:<br />
August 1994.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Karte des Dorfes Fürstenwerder, ca. 1930. Gezeichnet von A. Reger nach Angaben der ehemaligen Einwohner<br />
von Fürstenwerder Johann Klassen (Frankenthal) und Katharina Warkentin (Neuwied, Deutschland), 1995.<br />
308
Kapitel 50 Fürstenwerder - Balkowoje<br />
Das Reimer-Haus in<br />
Fürstenwerder. Foto:<br />
Mai 1995.<br />
Das Innere des Reimer-<br />
Hauses in<br />
Fürstenwerder. Foto:<br />
August 1994.<br />
<strong>Die</strong> ehemalige Wirtschaft von Aron Reimer (1842-1916), meines Ururgroßvaters, in Fürstenwerder. Das ist<br />
alles, was von dem Haus (oben) geblieben ist. 150 Jahren hat das Haus auf diesem Platz gestanden, Feuer<br />
und Krieg überstanden. Aber als wir anfingen uns für die Geschichte unserer Vorfahren zu interessieren,<br />
haben die Sowjets es nicht übers Herz gebracht und in zwei Jahren das Haus total zerstört. Foto: August<br />
1997.<br />
309
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Jack Dick (links) aus Sardis, B.C. und<br />
Frau Maria Golaj, geborene Beskutzki,<br />
eine Ukrainerin, die in Fürstenwerder<br />
geboren ist, die deutsche Schule<br />
besucht hat und sehr gut Hochdeutsch<br />
und Plattdeutsch spricht. Sie wusste<br />
noch von jedem Haus im Dorf etwas<br />
zu erzählen. Ihre Eltern waren die<br />
Hirtenfamilie im Dorf und sind in<br />
Fürstenwerder geboren. Ihr Vater<br />
wurde im Krieg von der deutschen<br />
Armee, als er aus dem Dorf fliehen<br />
wollte, durch einen Schuss in den<br />
Rücken getötet. Zwei von ihren<br />
Verwandten waren mit Mennoniten<br />
aus Fürstenwerder verheiratet und<br />
leben in Amerika. Sie stehen hier im<br />
Reimer-Haus. Foto: August 1995.<br />
<strong>Die</strong> Sommerküche der<br />
ehemaligen Aron<br />
Reimer-Wirtschaft in<br />
Fürstenwerder. Sie<br />
gehört heute der<br />
Nachbarsfamilie, die<br />
ihren Zaun einfach<br />
zwischen dem Reimer-<br />
Haus und der<br />
Sommerküche gezogen<br />
hat. <strong>Die</strong>ses kleine<br />
Gebäude wird heute<br />
als Hühnerstall<br />
genutzt. Foto: August<br />
1997.<br />
<strong>Die</strong> Hauptstraße in Fürstenwerder. Eine ganz typische Straßenansicht, so wie es heute in den <strong>Molotschna</strong>er<br />
Dörfer ist. Foto: August 1997.<br />
310
Kapitel 50 Fürstenwerder - Balkowoje<br />
Mein Urgroßvater Aron Reimer wurde 1870 in<br />
Fürstenwerder geboren. Nach der Heirat mit Sara<br />
Janzen gründeten sie in Fürstenwerder ihre eigene<br />
Kleinwirtschaft.<br />
1899 zog Aron Reimer nach dem Dorf<br />
Stepanowka bei Orenburg. Aron diente als<br />
Prediger in der Kirchen Gemeinde. In demselben<br />
Jahre bekehrten sie sich beide [Wahrschienlich ist<br />
hier gemeint, das sie sich zu dem Separatist-<br />
Pietistischen Glauben bekehrt haben: Bemerkung<br />
vom Redakteur D. P.] und wurden in die<br />
Brüdergemeinde "Kamenka" aufgenommen.<br />
<strong>Die</strong>se Gemeinde wurde 1905 in drei Gemeinden<br />
aufgeteilt, und unsere Reimers gehörten jetzt der<br />
Brüdergemeinde "Klubnikowo" an. Durch seinen<br />
Predigerdienst hatte Aron viel Gelegenheit, unter<br />
den Russen zu arbeiten, wozu er auch große<br />
Freudigkeit hatte. <strong>Die</strong> Prediger hatten es besonders<br />
schwer, weil sie ja auch alle Bauer waren und<br />
ihren Hof bestellen mussten, so wie alle anderen.<br />
In dieser Familie mussten die Kinder die meiste<br />
Arbeit auf dem Feld verrichten. Wie schwer sie als<br />
Kinder arbeiten mussten, erzählte mein Großvater<br />
sehr oft.<br />
1909 zog Aron Reimer wieder weiter, und<br />
zwar in die Kulunda-Steppe im Altaj. Zu dieser<br />
Zeit hatten die Reimers schon funf Pferde und alle<br />
notwendigen Haushalts- und Wirtschaftsgeräte,<br />
die sie nach Altaj mitnehmen konnten. Den<br />
Grund dieser Umsiedlung weiß ich nicht, denn zu<br />
dieser Zeit ging es der Familie in Orenburg<br />
wirtschaftlich nicht schlecht. Er siedelte in<br />
Schöntal an und gründete dort eine Gemeinde.<br />
Man schreibt, dass die meisten Ansiedler sehr arm<br />
waren. Er war bald in der Gemeinde sehr beliebt.<br />
Im Herbst 1909 organisierte er im Dorf<br />
Ohrloff das erste Erntedankfest und hielt auch<br />
eine Festrede. 1910 baute man in Schöntal eine<br />
Kirche.<br />
1917 gab es im Slawgoroder Gebiet schon 12<br />
Kirchen, von denen die Schöntaler die größte war.<br />
1920 wurde er zum Ältesten des ganzen<br />
Slawgoroder Gebietes ordiniert. Sein<br />
Schwiegersohn Kornelius <strong>Plett</strong> schreibt über Aron<br />
Reimer: "...Er hatte ein wunderbares Talent, eine<br />
Gemeinde zu leiten. Was die Redekunst angeht, so<br />
hatte er nicht den höchsten Flug des Genies. Aber<br />
die Kunst, eine Gemeinde zu überwachen, zu weiden,<br />
zu pflegen und zu erbauen, habe ich in den<br />
Aron Reimer 1870-1931<br />
311<br />
verschiedenen Gemeinden, die ich kennengelernt<br />
habe, nicht nochmal gefunden... Er war 180 Tage<br />
im Jahr von zu Hause weg, und trotzdem hielt jedermann<br />
es für selbstverständlich, dass er bei jeder<br />
Dorfarbeit dabei war, und wenn es galt, eine<br />
Kollekte zu sammeln, musste er mit gutem<br />
Beispiel vorangehen und die größte Summe<br />
zahlen"...<br />
Arons wirtschaftliche Lage war auch nicht<br />
immer aufs beste, und doch hat der Herr ihn nie<br />
darben lassen. 60-70 Desjatin Land wurden<br />
jährlich bearbeitet, obzwar man keine Arbeiter<br />
annehmen durfte. Aron war ein guter Tischler und<br />
Riemenmacher, so dass er das Notwendigste für<br />
die Wirtschaft selbst herstellen konnte. Sie hatten<br />
schon 13 Pferde, zwei Pflüge, Kühe, Schweine,<br />
Schafe.<br />
Im Dezember 1922 erkrankte seine Frau Sara<br />
und starb. Sie hatten 30 glückliche Ehejahren<br />
erlebt.<br />
Im Frühling 1923 heiratete er zum zweiten<br />
Mal-Witwe Maria Dürksen-Lepp. Sie war eine gute<br />
und sehr geduldige zweite Mutter. Unter dem<br />
kommunistischen Regime hatten die Gemeinden<br />
viel zu leiden. Als der bolschewistische Druck in<br />
den mennonitischen Dörfern immer<br />
unerträglicher wurde, richteten die Menschen<br />
ihren Blick nach Kanada. Viele Prediger wurden<br />
verbannt. Aron Reimer wurde von der Regierung<br />
mit unerträglichen Steuern belegt, und man<br />
suchte Ursachen, um ihn zu arretieren.<br />
Parteimänner aus den Mennoniten schickten ihm<br />
zuletzt heimlich eine dringende Nachricht: er<br />
solle eiligst das Land verlassen. So entschloss sich<br />
auch Aron zur Auswanderung. Leider wurde in<br />
Kanada nach einer neuen Anordnung die<br />
deutsche Sprache in den Schulen verboten.<br />
1921 waren von der mexikanischen Regierung<br />
uneingeschränkte Freiheit in religiösen Ansichten<br />
und der Sprache zugesichert. Im Sommer erhielten<br />
die Reimers die Ausreiseerlaubnis. Aron borgte<br />
sich von seiner Gruppe 800,00 $ und reiste mit<br />
fünf unverheirateten Kindern aus. Vier verheirateten<br />
blieben in Russland.<br />
1925 siedelten Reimers im Dorf Irapuato in<br />
Mexiko an. An Vermögen hatten die Reimers<br />
nichts mehr. Weil das Land hier in Irapuato zu<br />
teuer war, entschlossen sich viele Familien, im<br />
Durango Staat anzusiedeln.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Als 1926 die Regierung den Ansiedlern neues<br />
Land anbot, siedelten 24 Familien am 02.03.1926<br />
in El Trebol, 96 Meilen hinter Durango, an. <strong>Die</strong><br />
"Kansas Board" borgte den Familien Reisegeld,<br />
um zu dem Ansiedlungsort zu fahren. Aron<br />
Reimer schreibt in einem Brief am 04.03.1926 an<br />
die "Rundschau": "Wir sind alle froh, aus Russland<br />
herausgekommen zu sein, und zum anderen, dass<br />
wir, die wir fast alle ganz ohne Mittel sind, ein<br />
Heim gründen dürfen. Viele, die Mittel haben,<br />
wandern nach Kanada aus, aber wir, die bei<br />
keinem etwas borgen können, müssen hier<br />
bleiben; also wollen wir auch. Und obwohl die<br />
"Canada Board" uns eine Einreiseerlaubnis<br />
schickte, konnten wir es ohne Geld nicht wagen,<br />
noch einen Umzug zu machen. "Außer den sonntäglichen<br />
Gottesdienste hatte man dort keine<br />
Versammlungen mehr gehabt. Drei Jahre wohnte<br />
er mit seiner Familie in Mexiko. Auch dort hatte er<br />
noch manchen Weg zu Fuß zurückgelegt, um verlassene<br />
Menschen aufzusuchen und zu trösten. Er<br />
war trotz mancher Entmutigung immer willig, für<br />
den Herrn zu arbeiten.<br />
Am Sonntag, dem 18. Mai 1927, konnte Aron<br />
zum ersten Mal wegen seiner Krankheit nicht<br />
mehr zum Gottesdienst gehen. Er hatte von<br />
seinem Typhus als Folge den Rheumatismus<br />
bekommen. Mit der Zeit erging an die mennonitischen<br />
Siedlungen der Befehl, die deutsche<br />
Sprache in den Schulen zu unterlassen und den<br />
Religionsunterricht einzustellen. Dazu kamen<br />
Überfälle mexikanischer Banden auf die<br />
Kolonisten. <strong>Die</strong>se Gefahren ließen den Gedanken<br />
aufkommen, Mexiko wieder zu verlassen.<br />
1928 wanderte Aron nach Corn, Oklahoma,<br />
und wenig später nach Bessie aus, wo er sich mit<br />
der Familie ein kleines Stadteigentum erwarb.<br />
Aron war schon leidend, als er hier ankam, und<br />
die Leiden wurden immer schlimmer, so dass er<br />
zuletzt nur noch das Bett hütete. Er wurde von<br />
seiner lieben Gattin aufs beste gepflegt. Er starb<br />
am 3. September 1931.<br />
Eine kurze Zusammenfassung aus dem<br />
Tagebuch von Aron Reimer.<br />
Familie des Aron Aron Reimer (1871-1931) und Frau Sara, geborene Janzen (vorne in der Mitte), mit<br />
Kindern: hinten, von links: Nikolaj, Gerhard, Sara, Aron; vorne, von links: Johann, Tina, die älteste Tochter<br />
mit ihrem Kind Susie, Agatha, Helene, Jakob, Cornelius <strong>Plett</strong>, der Ehemann von Tochter Tina. Schöntal, bei<br />
Slawgorod, Gebiet Altaj, Russland. 1913.<br />
312
Kapitel 50 Fürstenwerder - Balkowoje<br />
Am 30.05.1900 wurde ich in Stepanowka,<br />
Gebiet Orenburg, Russland, geboren. Im<br />
Frühjahr 1909 zogen meine Eltern mit uns in das<br />
Dorf Schöntal im Gebiet Slawgorod (Altaj).<br />
Im Winter 1917 konnte ich an einem Abend<br />
Frieden mit Gott finden.<br />
1919 wurde ich in die Koltschak-Armee nach<br />
Slawgorod einberufen. Wir wurden als wehrlose<br />
Mennoniten in eine "Nestrojewaja Rota"<br />
(Hilfstruppe=nicht an der Front) eingeführt. Ich<br />
wurde zuerst in der Küche eingestellt, später<br />
kam ich in die Musikkapelle. <strong>Die</strong> Soldaten unserer<br />
Koltschak-Armee waren fast alle "rot angehaucht".<br />
Wer wollte wohl nicht ein freier Mann<br />
sein, wie es die Roten allen versprachen? Wer<br />
eben die Möglichkeit hatte, lief nachts heimlich<br />
zu den Roten über. Mein Freund und ich<br />
entliefen aus der Armee, und es dauerte mehrere<br />
Tage der Angst, Kälte und des Hungers, bis wir<br />
todmüde am 1. Dezember 1919 doch endlich zu<br />
Hause ankamen. Im Juni 1920 ließ ich mich<br />
taufen.<br />
Am 04.07.1922 heiratete ich Agatha Penner.<br />
Ich nahm im Nachbardorf eine Lehrerstelle an.<br />
Ende Mai 1923 zogen wir wieder ins Elternhaus<br />
nach Schöntal. Da die Lehrerarbeit für Gläubige<br />
immer schwieriger wurde, vereinigten sich<br />
einige Männer aus dem Dorf und versuchten das<br />
"Glück" mit Pferdeverkauf, der aber auch keinen<br />
Verdienst brachte. Wir verloren Pferde und Geld,<br />
da kaum einer ein Pferd kaufte, und das bischen<br />
Geld vom Verkauf einiger Pferde brauchten wir<br />
für die Unterkunft. Wie sollte es weitergehen?<br />
Wir schrien beide zu Gott: ER sollte uns nicht zu<br />
Bettlern werden lassen.–Und der Herr half!<br />
Im Gebiet Slawgorod wurden die Christen<br />
immer mehr verfolgt. Da mein Vater Aron<br />
Reimer in dieser Gegend ein berühmter Prediger<br />
und Gemeindeleiter gewesen war, könnte es<br />
schlechte Folgen für uns Kinder haben. Wir<br />
gedachten, durch einen Umzug den Folgen der<br />
Berühmtheit zu entfliehen.<br />
1927 zogen mein Bruder Gerhard (1899-<br />
1978) und ich mit unseren Familien nach dem<br />
Kaukasus. Hier wurde Ende 1922 in den wasserlosen<br />
Steppen eine Pferdezuchtgesellschaft<br />
gegründet.<br />
Nikolaj Reimer 1900-77<br />
313<br />
Agatha (Penner) und Nikolaj Reimer mit<br />
Kindern Kolja (klein) und Katja (beim Vater).<br />
Hinten: Liese Penner, die Schwester von Agatha,<br />
und ?. Schöntal, Gebiet Altaj 1926. Foto aus<br />
Preservings,Nr. 17, Seite 140.<br />
Im Frühjahr 1928 siedelten wir in<br />
Neuhoffnung (Trakehn), Kaukasus, an. Wir<br />
besaßen fast kein Geld, da wir unser Hab und<br />
Gut in Schöntal den Leuten ausgeborgt hatten.<br />
Wenn sie den Weizen verkauft hätten, sollten sie<br />
uns das Geld abgeben. Da die Regierung ihnen<br />
aber den Weizen wegnahm, kamen sehr viele<br />
Klage- und Entschuldigungsbriefe, aber kein<br />
Geld. Es kam letztendlich so weit, dass wir ohne<br />
Geld und ohne Brot waren. Wir bauten auf<br />
unserer neuen Hofstelle eine Lehmhütte und<br />
deckten sie mit Rundholz. Im Herbst erhielten<br />
wir von der Regierung ein gewisses Maß an<br />
Getreide. Wir hatten regelmäßig Gottesdienste.<br />
Ich war Chorleiter, was mir sehr viel Freude<br />
machte. Mein Bruder Aron (1897-1945) war zu<br />
dieser Zeit in Moskau und wartete auf seine<br />
Ausreisepapiere. Er schickte immer wieder<br />
Telegramme: wir sollten sofort kommen, es<br />
fahren so viele fort.<br />
Am 15.09.1929 reisten wir nach Moskau
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
und...trafen dort von den vielen Menschen nur<br />
noch eine Familie an, die krankheitshalber nicht<br />
ausreisen durfte und auch nicht zurücktransportiert<br />
worden war. ... So kamen wir bettelarm<br />
wieder in Trakehn an. <strong>Die</strong>ser Schlag war für uns<br />
fast unerträglich...<br />
1931 war ich schon Expediteur im Kolchos,<br />
und das Leben wurde immer leichter. Meine<br />
Frau betrieb Schweinezucht. So arm man uns<br />
zuvor gekannt hatte, so reich pries man uns<br />
jetzt. Der Neid uns gegenüber breitete sich aus,<br />
so dass wir beide es für gefährlich hielten, weiter<br />
hier zu leben.<br />
Im Herbst 1932 verkauften wir wieder alles<br />
und zogen in die Stadt Pjatigorsk, wo schon<br />
mein Bruder Aron wohnte. Hier beschäftigte ich<br />
mich mit Privathandel. Das war auch nicht ganz<br />
ungefährlich, da ich damit keine Berufstätigkeit<br />
nachweisen konnte. Es ging uns in materieller<br />
Hinsicht immer besser. Doch fehlte uns die<br />
Gemeinschaft mit Kindern Gottes. Einige Male<br />
wurde ich zur NKWD (Volkskommissariat für<br />
Innere Angelegenheiten) gerufen. Jedesmal,<br />
wenn ich wieder glücklich zu Hause angekommen<br />
war, schrien wir zu Gott: ER solle uns vor<br />
einer Trennung bewahren.<br />
Doch am Abend des 29.01.1936 wurde ich<br />
von der Miliz abgeholt. Wir feierten gerade den<br />
Geburtstag meiner lieben Frau. Bis spät in den<br />
Sommer wurde ich Tag für Tag zum Staatsanwalt<br />
gebracht, wo ich oft bis 5 Uhr morgens verhört<br />
wurde. <strong>Die</strong> Hauptanklagepunkte waren: konterrevolutionäre<br />
Versammlungen in meinem<br />
Hause, (ich sollte angeben, wer dabei war), dass<br />
wir einen Regierungssturz planten und ähnlicher<br />
Quatsch! Es waren religiöse und politische<br />
Beschuldigungen.<br />
Am 25.11.1936 begann unser<br />
Gerichtsprozess, der funf Tage dauerte. An allen<br />
funf Tagen musste ich während des Verhörs stehen,<br />
denn alle Schuld der 32 Männer wurde mir<br />
zugeschrieben. Am späten Abend wurde dann<br />
das Urteil vorgelesen: Das Herz schlug bei uns<br />
immer heftiger, da bisher weder mein Name<br />
noch der einiger anderer genannt worden war.<br />
Endlich hieß es aber doch "Reimer" und<br />
"Erschiessung"!!!<br />
Meine Frau fiel in Ohnmacht, und Tochter<br />
Katja (12 Jahre alt) schrie. Als ich bei meiner<br />
Tochter vorbeiging, klammerte sie sich an meine<br />
314<br />
Beine und weinte fürchterlich. Ich versprach ihr:<br />
"Ich komme bald wieder!" Als meine Frau hinausgeführt<br />
wurde (sie bekam drei Jahre<br />
Gefängnishaft), bat sie den Soldaten-er solle sie<br />
doch auf die Toilette lassen. <strong>Die</strong>se Gelegenheit<br />
nutzte sie, um sich von ihrer Tochter Katja zu<br />
verabschieden. Sie sagte kein Wort und gab der<br />
Tochter keinen Rat mehr. Sie konnte nichts mehr<br />
für ihre Kinder tun. Es gibt keine Worte, die<br />
diesen Augenblick beschreiben können.<br />
Meine Frau wurde mit all den anderen<br />
Verbrechern ins Gefängnis gefahren. <strong>Die</strong> Kinder<br />
wurden unter Verwandten und Bekannten<br />
verteilt, nur unsere Älteste blieb alleine im<br />
Hause wohnen, denn sie wollte so gerne die<br />
Schule weitermachen. Ein Zimmer im Hause<br />
hatte meine Frau an vier Männer (Buchhalter)<br />
vermietet. Vier Männer und ein junges Mädchen<br />
in einem Haus–und es ist nie etwas passiert! Gott<br />
hielt seine Hand über unser Kind !!!<br />
Wir wurden mit noch zwei Räubern in die<br />
Todeszelle Nr. 21 gesteckt. Am 40. Tag unseres<br />
Aufenthaltes in dieser Zelle kam Antwort auf<br />
unseren Kassationsantrag. Sie lautete: "Das<br />
Oberste Gericht hat das Urteil des Gerichtes als<br />
richtig erfunden".<br />
Am 08.03.1937 erhielt ich von meiner Frau<br />
einen Brief aus dem Gefängnis. In dieser Nacht,<br />
ersetzte man uns die Todesstrafe durch eine 10jährige<br />
Gefängnisstrafe.<br />
Am 10. März, dem 100. Tag unseres<br />
Verweilens in der Todeszelle, führte man uns<br />
wieder in eine große Zelle, und es gab ein freudiges<br />
Wiedersehen mit den "Lebendigen". Meine<br />
Tochter konnte mir einige Male kleine<br />
Geschenke übergeben. Einmal waren es<br />
gekochte Kartoffeln und rohe Karotten. Hier<br />
konnte ich bis September mit meinem Bruder<br />
Aron zusammen sein. Aber die Trennung kam<br />
doch.<br />
Am 23.09.1937 wurden wir nach Wladimir-<br />
Kljasma transportiert. (Wladimir ist bis heute<br />
eine Gefangenen-Verteilungszentrale für ganz<br />
Russland. A.R.).<br />
Am 25.11.1937 fand unser Transport nach<br />
Kem, einem Hafen am Weißen Meer, statt.<br />
1938 wurde meine liebe Frau nach dem hohen<br />
Norden, Komi ASSR, verschickt, und unsere<br />
Kinder hatten niemanden mehr, nicht einmal im<br />
Gefängnis. Das Haus wurde von der Regierung
Kapitel 50 Fürstenwerder - Balkowoje<br />
enteignet, und unsere Tochter Katja blieb auf der<br />
Straße.<br />
Am 06.08.1939 wurde ich auf die<br />
Zentralinsel "Solowki" im Weißen Meer<br />
gebracht, und am 16.08.1939 ging es per Schiff<br />
weiter bis zum Hafen Dudinka, Sibirien. Wir<br />
mussten täglich gegen den Schnee ankämpfen.<br />
Bei Sturm und Unwetter wurden wir in die<br />
Tundra getrieben, sehr oft auch in der Nacht.<br />
Meine Frau war 1939 aus der<br />
Gefangenschaft entlassen worden, und sie sammelte<br />
die Kinder wieder. In der Stadt durften sie<br />
nicht mehr leben, weil sie stimmlos und vorbestraft<br />
war. Sie wohnten dann bei einer Familie im<br />
Nachbardorf zur Miete.<br />
Am 10.10.1941 musste meine Familie ihr<br />
Heim verlassen. Sie wurden nach Kasachstan<br />
verschleppt. Unterwegs erkrankte meine Frau an<br />
den Lungen.<br />
Sie starb in der Nacht, als sie in Kasachstan<br />
ankamen. Als ich später schon wieder zu Hause<br />
war, erzählte meine Tochter Katja immer wieder<br />
von dem Fall, wie unsere Mennoniten mit ihrer<br />
toten Mutter umgegangen sind: sie warfen sie<br />
einfach aus dem Waggon, sie fiel mit dem<br />
Gesicht auf den Steinboden. Jemand<br />
beobachtete es und sagte: "Doch nicht so grob!<br />
Legt sie wenigstens vernünftig hin." Darauf rief<br />
ein anderer: "Ist doch egal. Sie ist ja sowieso<br />
schon verreckt." Man legte sie in eine Kammer,<br />
und meine kleine Tochter Katja besuchte sie jede<br />
Nacht und weinte stundenlang.<br />
Am 22.11.1941 wurde meine liebe Frau zu<br />
Grabe getragen. Ich wusste von all diesem zu<br />
dieser Zeit noch nichts... <strong>Die</strong> Kinder lebten im<br />
Wald in einer Baracke (Holzhaus) zusammen mit<br />
einer Familie Peters. Meine Tochter musste<br />
schwer im Wald arbeiten–Bäume fällen. Sie hatten<br />
nichts. <strong>Die</strong> Kleider wurden ihnen unterwegs<br />
gestohlen. Im Sommer aßen sie Beeren, Pilze,<br />
Vogeleier usw. Mein Sohn Kolja musste in die<br />
Trudarmee nach Karaganda, und Wowa arbeitete<br />
mit 13 Jahren auch schon im Wald.<br />
Katja kam nur zum Wochenende nach<br />
Hause zu den Kindern. <strong>Die</strong> ganze Woche saßen<br />
diese alleine und warteten auf ihre Schwester,<br />
die ihnen vielleicht ein Stück Brot bringen<br />
würde. Zu Essen gab es nichts mehr. <strong>Die</strong> Kinder<br />
wurden von einem Haus zum anderen getrieben,<br />
denn niemand brauchte damals fremde Kinder.<br />
315<br />
Nikolaj Reimer (1900-77) nach seiner Entlassung<br />
aus der Gefangenschaft. Foto: Norilsk, Sibirien,<br />
1947. Foto aus Preservings,Nr. 17, Seite 140.<br />
Als Katja 1944 ein wenig stärker war, baute<br />
sie sich mit ihrer Freundin in der Erde eine<br />
Hütte, die im Frühling voller Wasser lief. Sie<br />
hatten wieder "alles" verloren. Und doch gab es<br />
in dieser schrecklichen Zeit immer wieder Leute,<br />
die sich über die Kinder erbarmten, und Gott<br />
war ein ständiger Begleiter meiner Tochter.<br />
Am 25.11.1946 wurde ich freigelassen. Mit<br />
großer Mühe kam ich noch auf das erste Schiff,<br />
das nach Wiedereröffnung der Navigation nach<br />
Nowosibirsk ging. Dann folgten die lange<br />
Eisenbahnfahrt und zuletzt 13 km Fußweg.<br />
Wie viele Illusionen hatte ich mir gemacht!<br />
Langsam schritt ich dem Ziel zu. Es war mir, als<br />
träumte ich. Ich konnte es immer noch nicht<br />
fassen, dass sich hier ganz in der Nähe meine<br />
Kinder befanden. Ich beobachtete, wie zwei<br />
junge Frauen an einem halbfertigen Häuschen<br />
arbeiteten. Eine von ihnen blickte plötzlich in<br />
meine Richtung. Da fiel ihr der Lehm aus der<br />
Hand. Ich musste mich an einen Zaun lehnen,<br />
denn mir wurde schwindlig. In diesem Moment<br />
fiel mir mein liebes Kind um den Hals. Ein solches<br />
Wiedersehen kann man nicht beschreiben.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Alle zusammen bauten wir das Häuschen<br />
fertig. Meine Kinder waren bettelarm. Gleich am<br />
ersten Abend sammelte ich meine Familie, und<br />
wir lasen aus der Bibel und beteten. <strong>Die</strong> Kost war<br />
sehr schwach. Es gab nur Brot, und das wurde<br />
zugeteilt. Meine zwei Söhne waren zu der Zeit in<br />
Karaganda, und bald nach meiner Heimkehr<br />
kamen die beiden zu uns. Ich besuchte ständig<br />
die Versammlungen der russischen Geschwister.<br />
Am 14.12.1947 heiratete ich Tina Sukkau<br />
(früher Rückenau). Nun besuchten wir zu zweit<br />
die Gottesdienste. <strong>Die</strong> Versammlungen fanden<br />
bei verschlossenen Türen und verdunkelten<br />
Fenstern statt. <strong>Die</strong> Verkündigung des Wortes<br />
Gottes lag jetzt auf meinen Schultern, da der alte<br />
Bruder, der das Evangelium von Deutschland<br />
hierher gebracht hatte, gestorben war.<br />
Ende Oktober 1950 konnten wir nach<br />
Kuschmurun, Kasachstan, einem größeren Dorf,<br />
ziehen und uns in der Nähe von unserem Sohn<br />
Waldemar ein kleines Häuschen kaufen.<br />
In Kuschmurun waren sehr viele Deutsche.<br />
Wir versammelten uns in den Häusern. Das<br />
wurde sehr bald bei den Behörden bekannt, und<br />
wir bekamen während der Versammlungen<br />
Besuch von der Regierung.<br />
Ich hatte dem Herrn versprochen, dass ich,<br />
wenn ER mich wieder glücklich zu meiner<br />
Familie führen würde, wirklich Matth. 6,33<br />
ausleben wollte.<br />
Zu Gottes Ehre darf ich gestehen: Gott hat<br />
unser schwaches Leben mit geistlichen Dingen<br />
gesegnet. Der Kreis der Gemeinden, mit denen<br />
wir bekannt wurden, vergrößerte sich ständig.<br />
Meine Arbeit erlaubte es mir, während der<br />
<strong>Die</strong>nstreisen auch Geschwister an den verschiedenen<br />
Orten zu besuchen. Doch die gottlose<br />
Welt war empört, dass die Zahl der<br />
Gläubigen wuchs, und sie ergriff abschreckende<br />
Maßnahmen gegen sie.<br />
Am 20.10.1959 wurde in meinem Betrieb ein<br />
Arbeitsgericht organisiert. Es wurde ein Kampf<br />
gegen die Baptisten angesagt. Ich durfte auf die<br />
Bühne gehen und von dort unsere Tätigkeit<br />
verteidigen. Es waren ernste Stunden. Ich wurde<br />
wieder verhaftet.<br />
Am 17.04.1963 wurde ich in das Gefängnis in<br />
Kustanaj gebracht. Weshalb? Warum? Wozu? Ich<br />
kam in das Steinbruchlager Dschetygora. Aber<br />
der Tag meiner Entlassung kam.<br />
316<br />
Am 17.10.1964 wurde ich von meinen<br />
Kindern aus dem Gefängnis abgeholt. Es gab ein<br />
frohes Wiedersehen mit vielen Verwandten und<br />
Freunden. Wegen der Verfolgung der Gemeinde<br />
in Kuschmurun verließen viele Geschwister<br />
diesen Ort.<br />
Da wir schon alt waren, baten uns unsere<br />
Kinder, unser Häuschen in Kuschmurun zu<br />
verkaufen und zu ihnen nach Amankaragaj,<br />
einem 50 km entfernten Dorf, zu ziehen.<br />
Dorthin zogen wir im April 1965. Es war ein<br />
schwerer Anfang, da an dem von uns erworbenen<br />
Haus noch einige Bauarbeiten durchgeführt<br />
werden mussten. Doch der Herr schickte Hilfe.<br />
IHM sei die Ehre dafür.<br />
<strong>Die</strong> Gemeinde in Amankaragaj hatte keinen<br />
Leiter. Es wurde verboten, uns in den Häusern<br />
zu versammeln. Deswegen fuhren Bruder<br />
Heinrich Franz und ich 1966 nach Moskau. Wir<br />
erhielten die Erlaubnis, uns solange in den<br />
Häusern zu versammeln, bis ein Bethaus gebaut<br />
war. Das alte Haus mussten wir abbrechen und<br />
ein neues aufbauen. Immer wieder versuchten<br />
die Behörden, uns daran zu hindern. Doch am<br />
23.12.1967 durften wir den Einzug in das neue<br />
Gemeindehaus feiern.<br />
1966 konnte ich an einer<br />
Vorbereitungssitzung in Karaganda, Kasachstan,<br />
und auch an der allgemeinen<br />
Baptistenkonferenz in Moskau teilnehmen.<br />
1969 konnte ich an der zweiten<br />
Baptistenkonferenz in Moskau teilnehmen,<br />
allerdings nur als Gast, da ich nicht bei guter<br />
Gesundheit war.<br />
1974-76 zogen unsere Kinder mit ihren<br />
Familien nach der Republik Moldawien, da es<br />
hieß, man könne von dort leichter nach<br />
Deutschland ausreisen. <strong>Die</strong>se Trennung war für<br />
uns fast unerträglich gewesen. Doch hatten wir<br />
die Aussicht, im nächsten Frühjahr auch nach<br />
Moldawien zu ziehen, um dann gemeinsam mit<br />
unseren Kindern nach Deutschland auszureisen.<br />
Einsam !!! Einsam!!!<br />
<strong>Die</strong> Lebensgeschichte von Nikolaj Reimer<br />
erscheint hier in gekürzter Form. Am 13.03.1977<br />
schrieb Großvater die letzten Zeilen nieder. Er<br />
starb am 20.04.1977 in Amankaragaj,<br />
Kasachstan.<br />
Zum Nachlesen: N. Reimer, Nur aus Gnaden,<br />
Red., A. Reger (Kischinew 1996), 152 Seiten.
Kapitel 51 Wernersdorf - Pribreschnoje<br />
1824 wurde diese <strong>Kolonie</strong> am linken Ufer<br />
des Flusses Tokmak unter Anweisung des<br />
Schulzen Johann Klassen gegründet. <strong>Die</strong><br />
Hofstellen waren 90x150 m groß. Sieben<br />
Familien kamen aus Preußen, zwei von den<br />
hiesigen und elf Familien aus dem Chortitza<br />
Bezirk. Der Name wurde dem Dorf nach einem<br />
gleichnamigen in Preußen gegeben.<br />
1837 wurde unter Anleitung des<br />
Landwirtschaftlichen Vereins eine Waldanlage<br />
gepflanzt.<br />
1848 wohnten hier immer noch nur 20<br />
Familien. Der Dorfschulze war Bernhard Epp.<br />
1855 gab es schon 30 Wirtschaften mit insgesamt<br />
469 Personen.<br />
1892 hatte Wernersdorf schon 59<br />
Wirtschaften auf 2410 Desjatin Land.<br />
1913-1914 wurde von Mennoniten eine<br />
Bahnstrecke von Großtokmak bis Werchnij<br />
Tokmak gebaut, die sich auch durch das<br />
Wernersdorfer Land zog.<br />
1915 - das Dorf wird in "Pogranitschnoje"<br />
umbenannt.<br />
1917 - wieder Wernersdorf genannt.<br />
Im Mai 1924 wurde das 100 jährige Jubiläum<br />
des Dorfes gefeiert. Der Kolchos "Nadeschda"<br />
(so hieß das Dorf ab 1926) hatte einen großen<br />
Obstgarten. Viele Einwohner besuchten die<br />
Andachten in Schönsee.<br />
Schule. 1825 wird die Schule erbaut. <strong>Die</strong> Schule<br />
war 1934 vier-klassig.<br />
1936 wurde der deutsche Unterricht in den<br />
Schulen verboten. 1948 wurden die Wände<br />
dieser Schule mit einem Traktor niedergerissen<br />
und als Baumaterial verwendet. Sie stand auf<br />
dem Platz, wo heute (1997) eine Bushaltestelle<br />
ist.<br />
Andachtslokal. 1938 wurde dieses Lokal<br />
geschlossen und darin ein Klub eingerichtet.<br />
Wernersdorf lag im Zweiten Weltkrieg<br />
immer an der Frontlinie und wurde dadurch<br />
immer sehr zerstört.<br />
Ab 1945 heißt Wernersdorf-"Pribreschnoje".<br />
Seit 1974 gehört Wernersdorf zu dem russischen<br />
Dorf Ostrikowka.<br />
Ein altes mennonitisches Haus in Wernersdorf. Es sieht gut aus, ist aber stark umgebaut. Foto: August<br />
1997.<br />
317
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
318<br />
Karte des Dorfes Wernersdorf, 1943. Gezeichnet von Luci Braun, (New Hamburg, Ontario, Kanada).
Kapitel 51 Wernersdorf - Pribreschnoje<br />
319<br />
David Johann Brauel (1861-1933) mit seine Studenten in Wernersdorf. Der Kleidertracht nach muß dieses Bild ca. 1910 aufgenommen worden<br />
sein. David J. Brauel war der Großsohn von Jakob Johann Brauel (1803-66), der von 1824 bis 1858 als Lehrer in Rudnerweide diente. Er<br />
war ein begabter Lehrer in Rechnen, Singen und Schönschrieben, und konnte fließend Russisch. Er war auch ein begabter Tischler. Als<br />
anerkennung wird seine Schule 1830 von die Russische Regierung zur Musterschule gefördert, gleich mit die Vereins-Schule in Ohrloff. Davon<br />
ist zu sehen dass die Mennoniten auch begabte Lehrer hatten, nicht nur solche was fremden Religionen unter ihren Schülern verbreiten wollten,<br />
so wie der Tobias Voth in Ohrloff. Foto aus J. P. Dyck, Brauel Genealogy 1670-1983,(Springstein, Man. 1983), Seite 28.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
320<br />
Das alte Regier-Haus in Wernersdorf.<br />
<strong>Die</strong>ses Haus war ursprünglich 9 x 16 m<br />
groß. Als 1945 in dieses, noch 1943 von<br />
den letzten Regier-Bewohnern verlassene<br />
Haus, die Ukrainer einzogen,<br />
hatte das Haus noch seine<br />
ursprüngliche Größe. Dem neuen Wirt<br />
war das Haus zu groß. Er riss die Hälfte<br />
des Hauses ab und baute aus diesem<br />
Baumaterial ein neues für seine Familie<br />
auf dem Nachbargrundstück. <strong>Die</strong><br />
andere Hälfte des Hauses verkaufte er.<br />
Hier sehen wir also die Original–Hälfte<br />
des Regier-Hauses. Das Haus steht auf<br />
der Hauptstraße; hatte früher die<br />
Nummer 6; heute ist es die<br />
Woroschilowa-Straße Nr.114. Es wird<br />
heute als Datscha von Leuten aus der<br />
Stadt Saporoschje genutzt. Foto: Mai<br />
1995.<br />
Einige Bauelemente am Regier-Haus<br />
in Wernersdorf, die den Baustil eines<br />
Hauses ende des 19. Jahrhunderts<br />
zeigen. Foto: Mai 1995.<br />
Im Hintergrund das<br />
Haus der Familie<br />
Thomas in<br />
Wernersdorf. Nach<br />
dem II. Weltkrieg war<br />
hier die Schule. <strong>Die</strong><br />
Frau mit der<br />
Dachpfanne ist die<br />
Tochter der Lehrerin<br />
dieser Schule, die das<br />
Haus jetzt als Datscha<br />
benutzt. Foto: Mai<br />
1996.
Kapitel 51 Wernersdorf - Pribreschnoje<br />
Auf diesem Platz war die ehemalige Wirtschaft von Franz Ediger. 1954 war auf diesem Platz nichts mehr<br />
erhalten geblieben. Foto erhalten von Frau Ediger, Fulda, Deutschland, 1998.<br />
321<br />
Der Friedhof in<br />
Wernersdorf und in der<br />
Ferne das russische Dorf<br />
Ostrikowka, zu dem heute<br />
auch Wernersdorf gehört.<br />
Foto: August 1994.<br />
Auf dem Friedhof in<br />
Wernersdorf sind nur<br />
noch einige alte<br />
Grabsteine, die teilweise in<br />
der Erde vergraben sind,<br />
erhalten geblieben. In den<br />
1960er Jahren gab es hier<br />
einen starken Sandsturm,<br />
der den alten Friedhof mit<br />
einer dicken Sandschicht<br />
bedeckte. Dadurch sind<br />
jetzt nur wenige<br />
Grabsteine zu finden. Foto:<br />
Mai 1995.
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
Isaak Pötker 1885-1944 - Evangelist und Arzt<br />
Mein Vater, Isaak Pötker, wurde am 01.01.1885<br />
in Wernersdorf geboren. Hier lebte er bis zu seiner<br />
Vertreibung. Schon als Kind hatte er den Wunsch,<br />
Missionar zu werden. Für sein Studium verdiente er<br />
sich anfänglich das Geld in einer Schmiede. Dann<br />
ging er ins Ausland.<br />
1911-1913 besuchte er die Bibelschule in<br />
Berlin, Deutschland, dann ging er nach London,<br />
um an einem medizinischen Kursus teilzunehmen.<br />
Sein Lieblingsfach war die Zahnmedizin. Im zweiten<br />
Jahr seines Studiums bekam er ein Telegramm,<br />
dass seine Mutter krank sei. Er kehrte nach Hause<br />
zurück in der Hoffnung, nach seinem<br />
Heimatbesuch wieder nach London zu gehen, um<br />
das Studium fortzusetzen. <strong>Die</strong> Mutter starb, und<br />
die Grenzen Russlands wurden dicht gemacht, das <strong>Die</strong> Familie des Evangelisten Isaak Pötker (1885heißt<br />
er konnte nicht mehr nach England zurück- 1944). Aus A. A. Töws Mennonitische Märtyrer,<br />
kehren. In diesen schweren Jahren in Russland Band I. Seite 220.<br />
predigte er das Evangelium. Es wurde eine junge Männer an einem Tag auf dem Heimweg mit<br />
Zeltmission organisiert, wo er mit Brüdern und Stöcken geschlagen und stark zugerichtet.<br />
Schwestern von Dorf zu Dorf ging oder fuhr und Am 28.05.1924 heiratete er Luise Wolf aus<br />
predigte die Botschaft [des Separatist-Pietistmus. Wernersdorf. Sie hatten zwei Töchter, Pauline<br />
Red. D. P.] Es war eine gefährliche Aufgabe, und (1927) und Magdalene (1930).<br />
viele aus dieser Zeltmission sind von der Machno- Schließlich war auch er 1931, wie viele andere,<br />
Bande getötet worden. Auch hatten ihn einige gezwungen, sein Heimatdorf zu verlassen. Sie<br />
flüchteten nach Kolontarowka, Nordkaukasus. Hier<br />
wie auch schon in der Ukraine arbeitete Vater als<br />
Arzt und Mutter als Hebamme. In der Gemeinde<br />
predigte er und leitete einen Chor, bis 1934 alle<br />
Kirchen geschlossen wurden.<br />
Am 06.05.1936 wurde er verhaftet und mit<br />
noch zwei Brüdern [darunter auch mein Großvater<br />
Nikolaj Reimer. A.R.] zum Tode verurteilt, was<br />
später durch 10 Jahren Gefängnishaft ersetzt<br />
wurde. Er wurde, wie auch die anderen, in den<br />
hohen Norden, später in die Stadt Norilsk,<br />
gebracht, wo er als einziger Zahnarzt in der ganzen<br />
Stadt gearbeitet hat. Eine Zeitlang ging es ihm gut,<br />
er konnte sogar Briefe nach Hause schreiben. Doch<br />
durch den Krieg 1941 wurde er nach Kasachstan<br />
verschleppt und wieder beschuldigt, verurteilt und<br />
weggeschickt. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.<br />
Auf unsere Nachforschung bekamen wir eine<br />
Bescheinigung, dass er am 30.11.1944 in Sajarsk,<br />
Gebiet Irkutsk, Russland gestorben sein soll. Der<br />
liebe Gott alleine weiß, wo all unsere lieben Väter<br />
begraben sind oder auch nicht...<br />
Magda, geborene Pötker, Reimer-Franz, Tochter Geschrieben von Tochter Magdalene<br />
von Isaak Pötker. Foto:1999.<br />
Franz,Troisdorf, Deutschland, den 31.10.2000.<br />
322
Kapitel 52 Felsenthal - Trudowoje<br />
...Der Gutshof Felsenthal (Nr.1) wurde am<br />
Fluss Kajkulak in der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>,<br />
Südrussland, 1820 von David Reimer aus<br />
Kronsgarten gegründet und zeichnete sich<br />
durch seine musterhaften Obstbaumanlagen<br />
und Baumschulen aus. Nach David Reimers Tod<br />
wurde es von seinem Bruder Jakob Reimer weitergeführt.<br />
Eine Zeitlang war hier der Mittelpunkt<br />
einer mystischen Richtung, die ein kontemplatives<br />
Leben in Ehelosigkeit und<br />
Gütergemeinschaft betätigte...<br />
...Nach dem Tode des Jakob Reimer war die<br />
Tochter von Jakob Reimer-Gertrude Reimer<br />
lange Zeit Besitzerin des Gutes. Sie verkaufte<br />
das Gut an den Enkel des David Klassen.<br />
Fräulein Gertrude Reimer ( "Tante Trudchen"),<br />
80 Jahre alt, hat sich mit zwei ihrer Freundinnen<br />
in ein kleineres Heim, genannt<br />
"Kleinfelsenthal", in der Nähe des alten Heimes<br />
zurückgezogen...(Aus P. M. Friesen,<br />
Bruderschaft, Seite 133.)<br />
Frau Magdalene Franz, die Tochter des<br />
berühmten Arztes und Evangelisten Isaak<br />
Pötker, erinnert sich: "Mein Großvater mütterlicherseits,<br />
Kornelius Wolf, ist ca. 1845 in<br />
Münsterberg, <strong>Molotschna</strong>, geboren. Er hatte<br />
viele Jahre in Felsenthal als Wirtschaftler in dem<br />
Haus, wo die sogenannten "Gemütsfreundinen"<br />
wohnten, gedient. <strong>Die</strong>se Frauen hatten in ihren<br />
jungen Jahren dem Herrn das Versprechen<br />
(Gelübde) gegeben, sich nicht zu verheiraten,<br />
sondern ihr ganzes Leben dem Herrn zu wid-<br />
Kornelius und Pauline, geborene Schönfeld, Wolf,<br />
Wernersdorf, 1898. Foto erhalten von Magda<br />
Franz, Troisdorf, Deutschland.<br />
men. Mein Großvater heiratete 1893 Pauline<br />
Schönfeld und kaufte eine Wirtschaft in<br />
Wernersdorf. <strong>Die</strong> Verbindung zu Felsenthal<br />
wurde aber auch weiterhin aufrechterhalten.<br />
Meine Mutter, Luise Pötker, geborene Wolf<br />
(1905-68), kannte noch vier dieser<br />
"Freundinnen": Lieschen, Trudchen, Agatha, ?.<br />
<strong>Die</strong> anderen waren schon verstorben.<br />
1919 wurde auch dieses Heim zerstört. In<br />
einer Nacht kamen die Machnowzen auf den Hof<br />
der Gemütsfreundinen, erschossen den<br />
Wächter, trieben alle Bewohner in einen<br />
anderen Raum zusammen und warfen in das<br />
Haus eine Handgranate. Das Dach "hob" sich<br />
von den Wänden, aber Menschen wurden nicht<br />
getötet. <strong>Die</strong> Gemütsfreundinen wurden in verschiedenen<br />
Familien aufgenommen. Eine der<br />
letzten Gemütsfreundinen verlebte ihre letzten<br />
Jahren in der Familie meiner Großeltern Wolf.<br />
Eine schwere Last betrübte das Herz von Tante<br />
Lieschen, denn eine ihrer Freundinnen hatte das<br />
Gelübde gebrochen und im Alter von ca. 60<br />
Jahren geheiratet. Denn nicht umsonst steht es<br />
in der Heiligen Schrift: "Opfere Gott Dank und<br />
erfülle dem Höchsten deine Gelübde", Psalm 50,<br />
<strong>Die</strong> vier Gemütsfreundinnen in ihrem Heim<br />
"Kleinfelsenthal". Foto erhalten von Magda Franz.<br />
14. Es ist eine ernste Warnung für die, die ein<br />
Gelübde abgelegt haben.<br />
323
Kapitel 53 Fürstenau - Lugowka<br />
1805 wurde unter Anleitung vom<br />
Oberschulzen Klaas Wiens von 12 Familien aus<br />
Preußen dieses Dorf gegründet. Bis 1810 kamen<br />
noch 9 Familien aus Preußen dazu.<br />
1869 hatte das Dorf 20 Voll-, zwei Halb- und<br />
37 Kleinwirtschaften.<br />
1915 hieß Fürstenau "Dolinka"; 1917 wieder<br />
Fürstenau und seit 1945 - Lugowka (auch Kolchos<br />
"Kalinina") und gehört zum Dorfsowjet<br />
Ostrikowka.<br />
Dorfschule. <strong>Die</strong> Schule steht an der Mittelstraße,<br />
gegenüber vom Haus des Wiehelm Neufeld. Sie<br />
wurde Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet und<br />
bestand anfänglich aus einem Klassenzimmer.<br />
Auf Russisch wurde das Dorf auch Farschtnau<br />
genannt.<br />
<strong>Die</strong> Dorfschule in Fürstenau. <strong>Die</strong>ses Gebäude ist nach dem Johann Cornies Muster gebaut, mit die holländischen<br />
Gibeln. Foto: Mai 1995.<br />
Ein altes mennonitisches Haus in Fürstenau. Foto: Mai 1995.<br />
324
Kapitel 53 Fürstenau - Lugowka<br />
Das Neufelds Haus. Das Haus gehörte Wilhelm<br />
und Maria Neufeld. Es war das einzige Gut in<br />
Fürstenau und war aus Ziegeln und Steinen<br />
gebaut. Es bestand aus einem neuen und einem<br />
alten Teil. Der große Festsaal war im viktorianischen<br />
Stil gebaut. Eine Wand bestand beinahe<br />
ganz aus Spiegeln, an der anderen Wand hingen<br />
Teppiche und Bilder von klassischen Künstlern.<br />
Aus diesem Saal ging es durch eine Flügeltür in<br />
eine mit Teppichen belegte Halle. Das blaue und<br />
grüne Gästezimmer mit Badezimmer war an<br />
einem Ende der Halle. Links von dem Saal ging<br />
es in die rote Stube, dem Schlafzimmer von<br />
Wilhelm und Maria... Eine Doppeltür führte in<br />
den alten Teil des Hauses. Dort befanden sich<br />
Eckstube, Mittelstube, Wohnzimmer und<br />
Mägdezimmer. Später wurde ein großes<br />
Esszimmer gebaut. Etwa 50 Personen konnten<br />
Das Neufeld-Haus in Fürstenau. Foto: August 1994.<br />
325<br />
an dem riesigen Tisch Platz nehmen. Der elektrische<br />
Strom wurde von Neufelds eigenem<br />
Dynamo erzeugt.<br />
Aus der großen Stube ging es in eine<br />
Glasveranda. Vor der großen Halle führte eine<br />
Treppe in das Gewächshaus. Überall im Haus<br />
standen Spucknäpfchen herum für Raucher und<br />
Tabakkauer. Eine Zentralheizung im Keller und<br />
Kachelrohre in den Stuben hielten das Haus im<br />
Winter warm. Im Keller, der aus einem neuen<br />
und einem alten Teil bestand, waren der große<br />
Ofen und Räume, in denen Obst, Gemüse und<br />
getrocknete Esswaren aufbewahrt wurden. In<br />
den Garagen standen Kraftwagen. Man konnte<br />
in alle Nebengebäude gelangen, ohne ganz ins<br />
Freie zu kommen.<br />
Auszug aus H.A. Neufeld, Mary Neufeld and the<br />
Repphun Story. (Van Nuys, Cal. 1987), 234 Seiten.<br />
Das Neufeld-Haus. Es ist<br />
stark verändert worden, die<br />
wenig erhaltene Schönheit<br />
der mennonitischen Bauart<br />
ist mit schwarzer Farbe überstrichen<br />
worden. Rund um<br />
das Haus ist von der einst<br />
prachtvoller Umgebung<br />
keine Spur mehr erhalten<br />
geblieben. Foto: Mai 1995.
Kapitel 54 Ladekopp - Ladowka<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kolonie</strong> wurde 1805 von 16 Familien aus<br />
Preußen gegründet. Genannt wurde das Dorf nach<br />
einem gleichnamigen in Preußen. <strong>Die</strong> meisten<br />
Ansiedler waren unbemittelt, und nur sechs<br />
Familien konnten ihre Häuser aus eigenen Mitteln<br />
erbauen. <strong>Die</strong> ersten Wohnungen waren<br />
Bretterbuden. Das Holz holte man sich aus der<br />
326<br />
Stadt Alexandrowsk.<br />
<strong>Die</strong> Schule. <strong>Die</strong> erste Schule wurde 1840 gebaut.<br />
Das zweite, das neue Gebäude wurde<br />
wahrscheinlich vor 1911 erbaut. <strong>Die</strong>ses Gebäude<br />
ist heute (1997) noch in einem guten Zustand und<br />
wird als Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle benutzt.<br />
<strong>Die</strong> Dorfschule in Ladekopp von der Straßenseite. Foto: August 1997.<br />
<strong>Die</strong> Dorfschule in<br />
Ladekopp von der<br />
Hofseite. In der alten<br />
mennonitischen<br />
Tradition werden<br />
Gemeinschaftsgebäude,<br />
sowie Schulen und<br />
Andachtshäuser, parallel<br />
zu der Strasze<br />
gebaut. Foto: August<br />
1997.
Kapitel 54 Ladekopp - Ladowka<br />
Eine alte Wirtschaft in Ladekopp. Heute werden die Gebäude nicht mehr genutzt. Auf diesem Hof gibt es<br />
mehrere betonierte Löcher. Man sagt, dass man in diesen Löchern früher Gemüse eingelegt hat, das dann<br />
im Winter verkauft wurde. Foto: August 1997.<br />
Eine ehemalige Wirtschaft in Ladekopp. Foto: August 1997.<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaft von Johann Dück (1856-1922) in Ladekopp. Er war der Großsohn von Jakob Dück (1800-68),<br />
Muntau, einem Bruder des Klein-Gemeinde Predigers Johann Dück (1801-66), Muntau. Johann Dück (1856-<br />
1922) zog 1888 nach Samojlowka und gründete dort einen Chutor mit 400 desjatin. In 1905 zog er zuruck<br />
nach die <strong>Molotschna</strong> und baute in Ladekopp diese Wirtschaft, die für Jahre als Musterhof angesehen wurde.<br />
1918 wurde dieses Gebäude von die Machnowze verbrannt. Johann Dück sein Urenkel Ernest R. Dyck war ein<br />
Rechtsanwalt in Steinbach, Kanada in den 1970-er Jahren. Foto aus J. P. Dyck, Klaas Dück and his<br />
Descendants,(Springstein, Man. 1981), 122 Seiten.<br />
327
Kapitel 55 Bolschoj Tokmak<br />
1780 siedelten am Fluss Tokmak einige<br />
Kosaken-Familien aus Saporoschje an. Auch<br />
Leibeigene flüchteten hierher. Aus anderen<br />
Dörfern siedelten Menschen hier im<br />
Wandergebiet der Nogaier an.<br />
1784 entstand die Siedlung Bolschoj<br />
Tokmak. Der Name „Tokmak" stammt aus dem<br />
Tatarischen und bedeutet "satt"; „Bolschoj"<br />
heißt groß--deswegen, weil dieses Dorf im<br />
Vergleich zu den anderen, naheliegenden<br />
Dörfern doch sehr groß war. 1795 wurde hier eine<br />
orthodoxe Kirche gebaut.<br />
1797 wurde hier die Gebietsverwaltung des<br />
Gebietes Mariupol, Gouvernement Novorossijsk<br />
gegründet. 1798 wurde ein Weg nach<br />
Alexandrowsk gebaut.<br />
Als 1801 die Stadt Orechow zum<br />
Gebietszentrum des Mariupoler Kreises und bis<br />
1842 auch des Melitopoler Kreises wurde, wurde<br />
auch die Gebietsverwaltung dorthin verlegt.<br />
Orechow entstand 1796 zuerst als eine Siedlung<br />
Orechowaja Balka. <strong>Die</strong> Verwaltung des Kreises<br />
Melitopol wurde 1842 nach Berdjansk verlegt.<br />
<strong>Die</strong> wirtschaftliche Bedeutung der Stadt<br />
Tokmak wuchs wegen der günstigen geographischen<br />
Lage.<br />
1836 wurde hier die erste Schule gebaut.<br />
Aber nicht alle Kinder konnten die Schule<br />
besuchen. Das Schulwesen wurde nicht<br />
gefördert. Der größte Teil der Bewohner waren<br />
Staatsleibeigene. 1838 zählte Tokmak 703<br />
Hofstellen mit 4905 Seelen. 1844 hatte Tokmak<br />
zwei Wasser-und 15 Windmühlen, sowie drei<br />
Ölpressen.<br />
1861 gehörte diese Stadt zum Berdjansker<br />
Gebiet. Wirtschaftlich wurde hauptsächlich<br />
Schafzucht betrieben. Getreide wurde nur für<br />
private Zwecke angebaut. Später wurden auch<br />
auf diesem Gebiet große Fortschritte erreicht.<br />
Handel und Handwerke verbreiteten sich.<br />
Zweimal im Jahr wurden hier große Messen<br />
organisiert, wo die Händler aus aller Welt ihre<br />
Ware zusammenbrachten. <strong>Die</strong> Häuser wurden<br />
immer noch aus Lehmziegeln gebaut. Gedeckt<br />
wurden sie mit Rohr. <strong>Die</strong>se Erdhütten zogen sich<br />
328<br />
längs dem Fluss sechs km lang. Im Frühjahr gab<br />
es sehr oft Überschwemmungen.<br />
Ab 1866 durften die Einwohner, meist<br />
Leibeigene, ihre Grundstücke behalten, mussten<br />
aber hohe Steuern zahlen. Viele von diesen<br />
Leuten konnten ihre Steuern nicht bezahlen und<br />
verkauften ihr Land an die Wohlhabenden.<br />
Zwischen 1882 und 1886 wurden hier eine<br />
Fuchs-Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen<br />
von einem Österreicher Kleinert, eine ähnliche<br />
und eine große Ziegel- und Dachpfannen-Fabrik<br />
gebaut.<br />
1914 bauten die großen Besitzer eine<br />
Eisenbahn nach Prischib, die auf der Strecke<br />
Charkow-Sewastopol lag. Später wurde eine<br />
Abzweigung nach Fedorowka gebaut und eine<br />
Station "Bolschoj Tokmak". Das Dorf bestand<br />
immer noch vorwiegend aus Erdhütten. Mit dem<br />
Anfang des Ersten Weltkrieges wurden die<br />
Fabriken alle den Besitzern enteignet. Sie produzierten<br />
nur noch Waffen für die Armee. 1918<br />
kam die Stadt unter die Macht der Partisanen.<br />
<strong>Die</strong> Industrie wurde verstaatlicht.<br />
1921 wurden die Fabriken "Fuchs" und<br />
"Kleinert" zu einem Betrieb zusammengeschlossen,<br />
der sich ab sofort "<strong>Die</strong> erste<br />
staatliche Fabrik für landwirtschaftliche<br />
Maschinen und Geräte" nannte.<br />
Am 07.11.1922 trägt diese Fabrik den Namen<br />
"Krasnyj Progress". 1923 wurde diesem Betrieb<br />
noch die Fabrik "Berger", die Aktiengesellschaft<br />
"Neufeld & Co" aus Waldheim, eine Fabrik aus<br />
Einlage und eine aus Halbstadt angeschlossen.<br />
<strong>Die</strong>ser Betrieb wurde zu einem der größten in der<br />
Ukraine. Man begann hier mit der serienmäßigen<br />
Herstellung des Traktors "Saporoschez". Der<br />
erste Mustertraktor wurde in Einlage in der<br />
Fabrik Nr. 14 auf der Basis des Motors "Triumph",<br />
der in Bolschoj Tokmak hergestellt wurde,<br />
gebaut. <strong>Die</strong> Stadt wurde zu einem<br />
Rayonzentrum.<br />
<strong>Die</strong> "<strong>Die</strong>selmotor - Fabrik imeni Kirowa" war<br />
der größte Betrieb dieser Art in der Stadt. Hier<br />
wurden in Russland die ersten mit Gas betriebenen<br />
Motoren, hergestellt.
Kapitel 55 Bolschoj Tokmak<br />
Russische Bauern auf dem Jahrmarkt, wo sie kaufen und verkaufen und die vielen Ausstellungen besichtigen.<br />
In Tokmak war jedes Jahr eine Ausstellung, welche auch die mennonitische Bauern besuchten. Foto<br />
aus Quiring, Seite 18.<br />
<strong>Die</strong> Kleinrussischen Bauern auf der Rast.Vorne steht ein Samovar zum Teemachen, eine Sitte, was für viele<br />
Mennoniten auch angenehm geworden ist. <strong>Die</strong> mennonitischen Bauern im 19. Jahrhundert machten<br />
einen Unterschied zwischen den Kleinrussen (später Ukrainer genannt) und Russen. In den früheren<br />
Zeiten waren die Mennoniten fast ausschließlich von der Russischen Kultur beeinflusst, z.B. in den<br />
Leihwörtern, Kleidung und Essen, das sie in ihre Kultur mithineinnahmen. Foto aus Lohrenz, Seite 46.<br />
329
Kapitel 56 Das Ende von <strong>Molotschna</strong>, Oktober 1943<br />
Bürgerkrieg: Während des Bürgerkrieges und der<br />
Revolution 1917 war die Front fast zwei Jahre lang in<br />
der <strong>Molotschna</strong>, wodurch die Mennoniten dort sehr<br />
belastet wurden. Sie mussten ständig Soldaten in<br />
ihre Wohnungen aufnehmen und diese vollständig<br />
bewirten. Jede Partei (Rote oder Weiße) versuchte<br />
beim Abzug alles mitzunemhmen, was man konnte:<br />
Wagen, Pferde, Kleider und anderes. Es folgten<br />
Hunger und Krankheiten.<br />
Zwar war das negative Verhältnis seitens der<br />
Sowjet-Regierung zu den Mennoniten deutlich<br />
bemerkbar geworden, doch wollten es viele nicht<br />
glauben. Es gab eine gute Ernte, obwohl die Preise<br />
auch ziemlich hoch gestiegen waren. Mann machte<br />
sich Hoffnung, dass nach dem Bürgerkrieg und<br />
Revolution, sich wohl wieder alles positiv entwickeln<br />
würde. Doch nur kurz war diese Freude.<br />
Schon im Januar 1918 bekam man zu hören,<br />
dass sich in Halbstadt die Sowjet-Regierung befestigt<br />
hatte und sechs Mennoniten von den Roten<br />
erschossen wurden...(Nähere Tatsachen zu diesem<br />
Ereignis sind in Mennonitische Märtyrer von A. A.<br />
Töws, Band Zwei, Seiten 241-244 nachzulesen).<br />
...Im Frühjahr 1918 fing die deutsche Besatzung<br />
an, die im Großen und Ganzen von unseren Leuten<br />
sehr warm begrüßt wurde. Ich kann diese<br />
Begeisterung nicht teilen,...weil wir durch so eine<br />
Einstellung die russische Bevölkerung gegen uns<br />
aufreizten... Im Sommer fingen Vertreter des<br />
deutschen Militärs an, junge Leute aus unserer<br />
Mitte militärisch zu drillen,<br />
Gewehre wurden unter ihnen<br />
verteilt und der Selbstschutz wurde<br />
gegründet... Doch von Guljaj Pole<br />
schalten schon die Gerüchte, wo<br />
überall Machno seinem<br />
Anarchismus freien Lauf ließ... Als<br />
im Oktober die Deutschen gezwungen<br />
waren abzuziehen, trat der<br />
Selbstschutz seine Arbeit an...<br />
Selbstschutz....1919. Im Februar<br />
brach der Selbstschutz zusammen.<br />
Man war gezwungen sich der<br />
Machno-Bande zu unterwerfen.<br />
Mann sollte alles geben, besonders<br />
wurden Gewehre gesucht, die ja<br />
unter uns waren. Niemand aber<br />
wollte sie herausgeben, da er<br />
fürchtete sich als Selbstschützler zu<br />
entpuppen... Es wurden Leute aus<br />
den Dörfern als Geiseln gefangen<br />
330<br />
genommen und gedroht sie zu erschießen, wenn<br />
nicht alle Gewehre abgeliefert wurden. Es wurden in<br />
einigen Dörfern Listen zusammengestellt, in denen<br />
sich jeder eintragen musste, der mit seiner<br />
Unterschrift bestätigen sollte, kein Gewehr bei sich<br />
zu haben. Man war erstaunt, was dabei alles zum<br />
Vorschein kam... Es waren ja auch Gewehre<br />
begraben worden... Da ich ein Gegner des<br />
Selbstschutzes war, hatte manch einer seine<br />
Gewehre auf unserem Lande vergraben und in<br />
unserer Scheune versteckt, was für mich schlimme<br />
Folgen haben könnte...(Ein kurzer Auszug aus dem<br />
Tagebuch von Abram Willms, Calgary, Alberta,<br />
1957).<br />
Blumenort in der <strong>Molotschna</strong> fiel zum Opfer<br />
der Machno-Bande.<br />
Hungersnot: 1920-1923 trat die große Hungersnot<br />
ein. Es wurden die so genannten "amerikanische<br />
Küchen" eingerichtet, die vielen Tausenden<br />
Mennoniten das Leben retteten.<br />
1923-1926 wanderten viele Mennoniten von<br />
Russland aus, um sich in Kanada eine neue Heimat<br />
zu suchen.<br />
Enteignung: 1929 machte die Sowjetregierung ihre<br />
Absicht deutlich, im Rahmen des Fünfjahresplans,<br />
die Selbständigkeit der Bauern zu beseitigen. Alle<br />
Großbesitzer wurden ihres Besitzes enteignet und<br />
verbannt. Am 2. April 1930 wurden auf der Station<br />
Lichtenau 13 Waggone mit verbannten Mennoniten<br />
zu je 45 Person nach dem Norden abtransportiert.<br />
Eine Sitzung eines Dorfsowjets in den 1920ger Jahren. Auf solchen<br />
Versammlungen wurden die Bauern und Prediger verklagt durch<br />
Augenzeugen, und zum Tode, Verbannung und Enteignung<br />
verurteilt. Auf dem Schild steht geschrieben: "Das Leben ist besser<br />
und froher!" Foto aus Peter Derksen, Es wurde wieder ruhig<br />
(Winnipeg 1989), Seite 62.
Kapitel 56 Das Ende von <strong>Molotschna</strong>, Oktober 1943<br />
Fast in allen Dörfern war es unruhig, Alle<br />
strömten wieder nach Moskau, um eine<br />
Ausreiseerlaubnis zu bekommen. Doch bei weitem<br />
nicht alle, die bei Moskau herum angesiedelten<br />
Mennoniten, kamen weg. Ein großer Teil wurde verhaftet<br />
und verbannt, und deren Familien<br />
zwangsmäßig in ihre Herkunftsdörfer zurückgeschickt.<br />
1930-1931 waren die Jahre der Entkulakisierung<br />
und Kollektivierung. <strong>Die</strong> enteigneten Landbesitze<br />
wurden zu einer Kollektive zusammengeschlossen<br />
und die Bauern mit hoher, fast immer<br />
unbezahlbaren, Steuern belegt. Man musste dem<br />
Staat Fleisch, Butter und anderes, liefern, obwohl<br />
man schon keine Schweine und Kühe hatte.<br />
Große Terror. 1937-1938 waren Jahre des größten<br />
Terrors, die durch Massenverhaftungen,<br />
Verschleppungen, Erschießungen gekennzeichnet<br />
waren.<br />
Krieg: 1941. <strong>Die</strong> Mennoniten wurden aus ihren<br />
Dörfern vertrieben und die Russen besetzten<br />
blitzschnell die voll ausgestatteten Wirtschaften. Im<br />
September 1941 wurde die ganze deutsch<br />
sprechende Bevölkerung in der <strong>Molotschna</strong> zu den<br />
Bahnhöfen zusammengepfercht, um sie dann nach<br />
Kasachstan zu verschicken, damit sie nicht den<br />
Deutschen im Krieg eine Hilfe sein könnten. <strong>Die</strong><br />
Männer waren noch früher alle nach dem Norden<br />
verschleppt worden.<br />
...Viele Dörfer, wie die an der Juschanlee von<br />
Kleefeld bis Marienthal - wurden alle in Züge verladen<br />
und weggebracht; auch die an der<br />
<strong>Molotschna</strong>. Aber aus Mangel an Zügen, und weil<br />
die Deutschen mit einmal alles besetzten, kam der<br />
Rest, der auf den Bahnhöfen in Halbstadt, Groß-<br />
Tokmak und Stuljnewo (bei Waldheim) schon viele<br />
Tage im Regen und Sturm unter freiem Himmel<br />
gelagert hatten - nicht weg, sondern fiel in die<br />
Hände der Deutschen. Da atmeten viele erleichtert<br />
auf. (Sie durften wieder in ihre Dörfer zurückkehren).<br />
Doch waren viele Familien schon<br />
auseinandergerissen... Am 5. Oktober 1941 zog die<br />
deutsche Armee in Halbstadt ein, und in wenigen<br />
Tagen war die ganze <strong>Kolonie</strong> besetzt. Bald kamen<br />
die Männer und Frauen vom Schanzengraben<br />
zurück und es begann wieder ein mehr ruhiges normales<br />
Leben...<br />
Der Flucht, 1943. Doch nur kaum zwei Jahre währte<br />
diese schöne Zeit. Als die Deutschen die Schlacht<br />
bei Stalingrad verloren, und sie einsahen, daß sie<br />
wahrscheinlich den Rückmarsch antreten würden,<br />
dann begann man in den deutschen <strong>Kolonie</strong>n<br />
fieberhaft zu arbeiten, um die Aussiedlung aller<br />
deutschen Kolonisten nach dem Westen<br />
vorzunehmen... Anfangs September 1943 kam der<br />
Befehl, wir sollten uns fertig machen... (A. A. Töws,<br />
Band Zwei, Seiten 377-378).<br />
Das war das Ende von der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>.<br />
1923-24 wanderten viele Mennoniten aus Russland aus. Einladen in den Zug auf dem Bahnhof bei<br />
Lichtenau, <strong>Molotschna</strong>, 1924. Foto aus Frank H. Epp, Mennonite Exodus (Altona, Kanada 1962), Seite 152.<br />
331
Teil III <strong>Die</strong> <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
332<br />
Deutsche Einsatzsoldaten und mennonitische Frauen in der <strong>Molotschna</strong>, Sommer 1942. <strong>Die</strong>ses Foto bezeichnet die unruhige Zusammenkunft<br />
von zwei Zweigen der Deutschen und Niederdeutschen Kulturen: der Militarismus Preußens sowie des Dritten Reiches, und zum Gegenteil--die<br />
Wehrlosigkeit der mennonitischen Religiösen Kultur. Das Welt-Deutschtum ist viel reicher dadurch, dass unter ihnen noch eine Gemeinschaft<br />
war, die sich nicht mit der militärischer Nazi-Dummheit beschmutzt hat. Ähnlich wie die Kunst der großen Komponisten wie Beethoven und<br />
Brahms, steht die Geschichte der Russlandmennoniten als Kennzeichen des Lichtes der Gutheit, das in der Finsternis des Schlechten brennt. <strong>Die</strong><br />
moderne Deutsche Republik könnte wohl stolz sein, dass sie so viele von diesen guten Helden in den 1980er Jahren in das Land ihrer Ahnen<br />
zurück aufgenommen hat. Foto aus Peter Derksen, Es wurde wieder ruhig (Winnipeg 1989), Seite 80.
Teil IV - <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Kapitel 57 <strong>Die</strong> Bergthal <strong>Kolonie</strong> – Respublika<br />
Ansiedlung.<br />
der Altkolonie. Der Name Bergthal selbst wurde von<br />
<strong>Die</strong> Ansiedlung Bergthal wurde 1836 von 136 der Schaffarm der <strong>Kolonie</strong> Chortitza, die auch<br />
jungen Familien, hauptsächlich aus der "Alt"-<br />
<strong>Kolonie</strong> Chortitza, gegründet; es gehörte aber auch<br />
"Bergthal" hieß, hergenommen.<br />
eine kleine Anzahl aus der <strong>Molotschna</strong> dazu. <strong>Die</strong> Landlosigkeit.<br />
Uhrsache für die Neuesiedlung war der große <strong>Die</strong> Bergthaler blieben verschont von der<br />
Landmangel in die Mutter-<strong>Kolonie</strong>n. <strong>Die</strong> Bergthal schlimmsten sozialen Funktionslosigkeit, die von<br />
Siedler waren vernünftig gut mit Proviant versorgt, die Landlosigkeit in den älteren mennonitischen<br />
da es jeder Familie erlaubt war, fünf <strong>Kolonie</strong>n verursacht wurde. Um 1857 war die<br />
Wagenladungen Güter, dazu noch Vieh und Pferde Bevölkerung auf 367 Familien angewachsen, von<br />
mitzunehmen. Viele wurden von wohlhabenden denen 149 (40 Prozent) Landbesitzer und 218 (60<br />
Eltern unterstützt, welche die Weitsicht und Vision Prozent) nicht Landbesitzer (Anwohner – 126 und<br />
hatten, ihren Kindern eigenes Land zu schaffen, Arbeiter – 92) Familien waren. <strong>Die</strong>se Statistiken<br />
was zu der Zeit nur einer von drei lassen sich vorteilhaft mit der Chortitza und<br />
Russlandmennoniten erstrebte.<br />
<strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>n vergleichen, wo 42 Prozent<br />
Der Bergthaler Historiker William Schroeder beziehungsweise 44 Prozent Landbesitzer waren.<br />
schrieb: ,,Drei kompetente Männer, Wilhelm <strong>Die</strong>selben Statistiken zeigen auch, dass 38 Prozent<br />
Rempel, Jakob Martens und Johann Wiebe wurden in der <strong>Molotschna</strong> landlose Arbeiter waren, im<br />
gewählt, um die Gestaltung der neuen <strong>Kolonie</strong> zu Vergleich zu 10% und 20 % in den <strong>Kolonie</strong>n<br />
überwachen. Es war ihre Aufgabe, für jedes Dorf Chortitza und Bergthal. Eine andere Quelle erwäh-<br />
einen geeigneten Platz auszuwählen und die allgent 266 Familien in Bergthal im Jahre 1857: 140<br />
meine Anlegung der Dörfer in funktioneller und Familien mit Landbesitz und 126 Anwohnersinnvoller<br />
Art zu planen," (Schroeder, The Bergthal Familien, die bis 32 Desjatin Land besaßen (John<br />
Colony, Seite 17).<br />
Dyck, Oberschulze, Seiten 31-32).<br />
<strong>Die</strong> Ansiedlung Bergthal lag 20 Meilen nord- Im Jahre 1867 war das durchschnittliche<br />
westlich von Mariupol und etwa 50 Meilen Landbesitzrecht in Bergthal 23.0 Desjatin je<br />
nordöstlich von Berdjansk, beides Seehäfen am Familie, im Vergleich zu 20,5 Desjatin je Familie in<br />
Asowschen Meer. Das Land bestand aus 10.000 der Altkolonie und 24,5 Desjatin je Familie in der<br />
Desjatin. Zwischen 1836 und 1853 wurden fünf <strong>Molotschna</strong>. Sechsunddreißig Prozent in Bergthal<br />
Dörfer - Bergthal, Heuboden, Schönthal, Schönfeld waren Landbesitzer, im Vergleich zu 40 Prozent in<br />
und Friedrichsthal am Fluss Bodena [Berda] ent- der Altkolonie und 38 Prozent in der <strong>Molotschna</strong>.<br />
lang und verschiedene Nebenorte gegründet . Bergthal hatte 397 Familien, Chortitza 1451 und die<br />
Das Land war relativ eben, baumlos und mit <strong>Molotschna</strong> 4229 (A. Klaas, Unsere <strong>Kolonie</strong>n, Seiten<br />
Gras bedeckt, von gelegentlichen tiefen Tälern 231 und 232). Bergthal hatte einen höheren<br />
durchsetzt. Eine kleine gebirgige Formation drei Prozentsatz an Weide und Heuland, was auf eine<br />
Kilometer nördlich des Dorfes Bergthal war als größere Spezialisierung auf Schafe, Milchwirtschaft<br />
"Kamennaja Mogila", wörtlich "Steingräber" und Rindfleisch schließen lässt, im Gegensatz zu<br />
bekannt.<br />
dem Weizenverkauf, der in den älteren <strong>Kolonie</strong>n<br />
Der Name Bergthal wurde vom Oberschulzen Vorrang hatte.<br />
Bartsch von der Chortitzer <strong>Kolonie</strong> vorgeschlagen, Als 1874 die Entscheidung zur Auswanderung<br />
da er die physische Umgebung beschreibt mit dem getroffen wurde, war die Bevölkerung in Bergthal<br />
Miniaturberg im Norden und dem Bodena-Tal auf 525 Familien angewachsen. Das Verhältnis von<br />
[Berda], in welchem Bergthal, das erste Dorf, Vollwirten zu Anwohnern (den Landlosen) war<br />
angelegt wurde, (Wm. Schroeder, The Bergthal gefallen, aber 33 Prozent war gut über dem Durch-<br />
Colony, Seiten 9-28). <strong>Die</strong> natürliche Lage von schnitt der Russland-Mennoniten von 25 Prozent,<br />
Bergthal mit seinem tiefen Fluss und Stromtälern der sogar noch weiter auf 20 Prozent im Jahre 1910<br />
erinnerte sie bestimmt an ihre frühere Heimat in abnahm.<br />
333
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Landwirtschaftliche Gesellschaft.<br />
Bergthal wurde als Teil des<br />
Landwirtschaftlichen Vereins (gegründet 1817)<br />
organisiert, der unter Johann Cornies (1789-1848)<br />
zur Berühmtheit kam. Der Zweck der Gesellschaft<br />
war, die landwirtschaftlichen Methoden und<br />
Technologien in Gebieten mit Viehzucht zu<br />
verbessern, Erntesteigerungen usw. Bei der am 5.<br />
März 1869 durchgeführten Wahl wurden die folgenden<br />
Personen als Vorsitzer gewählt: Bernhard<br />
Wiebe, Heuboden; Jakob Kämpfer, Bergthal, und<br />
Jakob Braun, Friedrichsthal (Oberschulze, Seite<br />
122).<br />
<strong>Die</strong> Revisions-Listen (Volkszählung) von 1858<br />
für die fünf Bergthal-Dörfer sind noch vorhanden.<br />
<strong>Die</strong> Listen von Heuboden und Friedrichsthal<br />
"bleiben im Depot des Rathauses von<br />
Alexandrowsk (SAZR)", wurden aber in<br />
Kurzfassung in Preservings, Nr. 13, Seite 57, veröf-<br />
W<br />
N<br />
S<br />
E<br />
fentlicht. <strong>Die</strong> Revisions-Listen für Bergthal,<br />
Schönthal und Schönfeld sind "enthalten im<br />
Depot der Schatzkammer des Distrikts Mariupol<br />
im Staatsarchiv der Region Donetsk (SADoR)," -<br />
(Siehe A. Tedeyev, Preservings, Nr. 8, Juni 1996, Teil<br />
1, Seite 58). <strong>Die</strong>se stehen noch nicht zur<br />
Nachforschung zur Verfügung. <strong>Die</strong> komplette<br />
Revision (Volkszählung) von 1858 wird, wenn verfügbar,<br />
einen höchst genauen Querschnitt über die<br />
Bevölkerung der Bergthal-Dörfer nach Alter,<br />
Anzahl der Wirtschaften usw. bieten und detailliertere<br />
sozialökonomische Analysen, Stammbaumund<br />
Familienstudien zu Tage fördern. Solche<br />
Information wird es auch ermöglichen, Muster der<br />
Bergthaler Ansiedlung in den "Ost- und West-Reserven,<br />
Manitoba" in den Jahren 1878 bis 1881 zu<br />
studieren und abzuschätzen, in welchem Ausmaß<br />
die Muster der Alte-Welt-Dörfer und<br />
Verwandtschaftsnetze zusammenpassten.<br />
Karte der <strong>Kolonie</strong> Bergthal, welche die Landbesitze von jedem der Dörfer zeigt. <strong>Die</strong> Karte wurde von<br />
Prediger Heinrich Doerksen (1855-1934), Schönthal, Ost-Reserve, Manitoba, Bruder vom Sommerfelder<br />
Ältesten Abr. Doerksen, gezeichnet. <strong>Die</strong> Inschrift auf der Karte lässt sieben Orte erkennen: 1. mein<br />
Wohnort (nämlich Heinrich Doerksens); 2. meine Schule; 3. mein Geburtsort; 4. die große Kirche; 5. das<br />
Gebietsamt oder Rathausbüro; 6. Mutters Geburtsort und 7. Mutters Schule. Er berichtet auch: ,,Vater<br />
erwarb Land, 30 Desjatin", angrenzend an die Südseite des Landkomplexes von Bergthal mit der<br />
Andeutung, dass Abraham Doerksen sr. privat ein zusätzliches Stück Land für sich kaufte. <strong>Die</strong> Straße<br />
nach Nordosten führt in das Land Schönthal, überquert dann das "kleinere steinige Sumpfloch", dann<br />
über die Landstraße nach Grunau (das deutsche Kolonistendorf), und überquert das "große steinige<br />
Sumpfloch", bevor sie in das Land Friedrichsthal führt, was das gesamte Westende des Landbesitzes der<br />
<strong>Kolonie</strong> überspannt. Etwas weiter nach Nordosten war der "Steinhaufen", eigentlich "Steinstapel", die<br />
"Kamennaja Mogila" und ein Chutor (Einzelgehöft). Freundlicherweise vom Urenkel Wm. Rempel,<br />
Niverville, Manitoba, genehmigt / von Preservings,Nr. 11, Seite 2.<br />
334
Kapitel 57 <strong>Die</strong> Bergthal <strong>Kolonie</strong> – Respublika<br />
Das Bethaus der <strong>Kolonie</strong> Bergthal, in der Dorfmitte von Bergthal gelegen, hatte 1000 Sitzplätze. Maße: 40<br />
zu 100 Fuß (12,19 m x 30,48 m). Das Kreuz und der Glockenturm kamen nach 1876 hinzu. Foto freundlicherweise<br />
genehmigt aus The Bergthal Colony, Seite 37 / Preservings, Nr. 11, Seite 4.<br />
Das Gebietsamt oder Rathausbüro in Bergthal, in den 1860er Jahren erbaut. Es hatte ein Sitzungszimmer,<br />
in dem der Oberschulze und seine 15 Ratsmitglieder ihre Beratungen abhielten, und ein Büro und<br />
Privatresidenz für das Sekretariat. <strong>Die</strong> Bergthaler prahlten nicht mit ihrem finanziellen Fortschritt, aber<br />
die gut konstruierten und modernen öffentlichen Gebäude sprechen für sich selbst. Foto freundlicherweise<br />
genehmigt aus The Bergthal Colony, Seite 30 / Preservings, Nr. 11, Seite 5.<br />
335
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Eine alte Zeichnung von dem Dorf Bergthal, welche die in T-Form angelegten Straßen und die<br />
Anwohnerstraße zur Rechten zeigt. <strong>Die</strong> Originalzeichnung gehörte Jakob Klassen. Foto freundlicherweise<br />
genehmigt von H. Gerbrandt/W. Schroeder, The Bergthal Colony,Seite 18.<br />
Foto von 1905 von dem Dorf Bergthal. Foto freundlicherweise genehmigt von "Mennonite Library and<br />
Archives", Newton, Kansas/Aus W. Schroeder, The Bergthal Colony,Seite 18.<br />
Eine Ansicht von Kamennaja Mogila, 1979 vom<br />
Bergthal-Historiker und Kartographen William<br />
Schroeder fotografiert, als das Reisen in der<br />
Sowjetunion noch ein Angst einflößendes Wagnis<br />
war. Foto freundlicherweise genehmigt von W.<br />
Schroeder, The Bergthal Colony,Seite 1.<br />
336<br />
Heuboden im Jahre 1998. Foto von Orlando<br />
Hiebert, Tourond, Manitoba / Preservings,Nr.15,<br />
Seite 36.
Kapitel 57 <strong>Die</strong> Bergthal <strong>Kolonie</strong> – Respublika<br />
Enleitung.<br />
<strong>Die</strong> Bergthaler waren mit weisen und weitsichtigen<br />
Leitern gesegnet. Der erste Älteste war<br />
Jakob Braun, 1791 im Dorf Chortitza, Altkolonie,<br />
als Sohn von Jakob und Christina Braun geboren.<br />
Jakob Braun wurde 1824 zum Prediger gewählt. Er<br />
wurde gebeten, 1836 die erste Gruppe der<br />
Bergthal-Siedler zu begleiten. Der Bergthal-<br />
Historiker William Schroeder schrieb: ,,Ältester<br />
Braun traf während des Winters 1840/41 die<br />
Vereinbarung, bei Franz Thiessen, einem<br />
Handelsmann aus Neuendorf, Chortitza, eine<br />
Anleihe aufzunehmen. Das Geld wurde benutzt,<br />
um betroffenen Bergthaler Kolonisten zu helfen,<br />
die fast die Hälfte ihrer Schafe verloren hatten,<br />
und das zu einer Zeit, als Wolle noch das<br />
Haupthandelsprodukt war. 1855 wurde Braun<br />
gebeten, den Chortitzer Ältester Gerhard Dyck zu<br />
ordinieren". Jakob Braun starb 1868.<br />
Wie Mose führte Ältester Gerhard Wiebe<br />
(1827-1900), Heuboden, sein Volk 1874-76 von der<br />
bevorstehenden Gefahr zu einer neuen Heimat<br />
und Zuflucht in Manitoba. 1874 bot der Zar<br />
Gerhard Wiebe ein feudales Gut, komplett mit<br />
Land, Leibeigenen und für sich und seine<br />
Nachkommen den Adelstitel an, wenn er sein Volk<br />
überreden würde, in Russland zu bleiben. Obwohl<br />
das eine ernste Versuchung war, wählte er den<br />
schmerzlichen und opfervollen Weg des Pilgers<br />
und blieb Gott treu, obwohl er von Seiner<br />
Kaiserlichen Majestät gewarnt worden war, dass<br />
Verachtung und Spott seine einzige Belohnung<br />
sein würden.<br />
Zu den anderen bedeutenden Leitern gehörte<br />
Jakob Peters (1813-84), Heuboden, Oberschulze<br />
der <strong>Kolonie</strong> Bergthal in Russland. Peters erhielt<br />
vom Zar eine goldene Uhr und Auszeichnung für<br />
,,Fleiß in den Jahren 1854 und 1855", als Bergthal<br />
während des Krimkrieges für Pflegedienste und<br />
andere Hilfe sorgte. Peters war ein geschickter<br />
Politiker, der die Emigration von 3000 Menschen<br />
von einem Kontinent zum anderen beaufsichtigte<br />
und die Verpflanzung ihrer Gemeinden und<br />
sozialen Einrichtungen in ein neues Land. Peter<br />
Friesen (1812-75), Bergthal, diente als Waisenvater<br />
für das Bergthaler Waisenamt von seiner<br />
Eröffnung im Jahre 1842 bis zu seinem Tod und<br />
war der Patriarch von drei Generationen der<br />
Friesen in Manitoba, die ihm in dieses Büro folgten.<br />
<strong>Die</strong> Ansiedlung hatte viele unternehmerische<br />
Bürger, wie Abraham Doerksen (1827-1916),<br />
Schönthal, der "ein Maschinengeschäft hatte, ...<br />
wo er landwirtschaftliche Maschinen wie Pflüge,<br />
337<br />
Eggen, Kultivatoren und Wagen herstellte. Er<br />
beschäftigte vier Tischler und einen Schmied.<br />
(Wm. Schroeder, The Bergthal Colony, Seite 35).<br />
Seine Vision zeigte sich in der Tatsache, dass drei<br />
seiner Söhne als Prediger ihrer Gemeinde dienten,<br />
einschließlich Abraham, erster Ältester der<br />
Sommerfelder Gemeinde. Peter Neufeld (1821-<br />
1922), Schönthal, war ein weiterer erfolgreicher<br />
Unternehmer, "der einen Laden und eine Schenke<br />
unterhielt und später eine Wirtschaft besaß. ... Er<br />
besaß scheinbar Vieh, da er beachtliche<br />
Kenntnisse in der Behandlung von<br />
Viehkrankheiten hatte, wie sie in den Herden in<br />
Russland üblich waren", (John Dyck, "Kleefeld<br />
Nr. 1", Historical Sketches ("Historische Skizzen"),<br />
Seite 150).<br />
Eine weitere Person von einiger Bedeutung<br />
war Peter Unger (1812-88) BGB A10, geboren in<br />
Einlage, <strong>Kolonie</strong> Chortitza, der im Dorf Bergthal,<br />
Bergthal <strong>Kolonie</strong>, ansiedelte. Unger erhielt auch<br />
vom Zar eine goldene Uhr für ,,<strong>Die</strong>nste während<br />
des Krimkrieges". Unger muss ein intelligenter<br />
und sprachbegabter Mann gewesen sein, da er<br />
auch zu der Zeit im Bergthaler Gebietsamt als<br />
Sekretär arbeitete (Oberschulze, Seite 29). Unger<br />
wanderte 1876 nach Kanada aus und gründete das<br />
"Gut" Felsenton auf NE22-6-6E und NW23-6-6E,<br />
gerade südlich von Steinbach. Unger hatte 22<br />
Kinder und war der Patriarch der "Felsenton"<br />
Ungers.<br />
Eine dritte goldene Uhr für ehrenwerten<br />
<strong>Die</strong>nst während des Krimkrieges erhielt Abraham<br />
Hiebert, Schönthal, der auch als Distriktsekretär<br />
bezeichnet wird. Jede Uhr war 150 Rubel wert,<br />
etwas mehr oder weniger als sechs gute Pferde.<br />
Insgesamt nur vier Uhren mit diesem Wert wurden<br />
Personen in den <strong>Molotschna</strong> und Chortitza<br />
<strong>Kolonie</strong>n als Belohnung überreicht, obwohl 11<br />
weniger wertvolle Uhren als Belohnung gegeben<br />
wurden, davon eine an Samuel Kleinsasser von<br />
Hutterthal, ein Hutterer.<br />
Bergthal hatte auch farbenreiche Bürger, so<br />
wie das von Johann Schroeder (1807-84), der als<br />
"Polizeihauptmann, Feuerwehrchef und zeitweise<br />
als Sozialarbeiter und Eheberater diente." Als<br />
seine zweite Frau starb, traf Johann Vorkehrungen,<br />
um noch eine Frau zu freien. Seine Magd, Maria<br />
Dyck (1840-1900), eine intelligente Person, stand<br />
an der Tür und beobachtete diese Vorbereitungen.<br />
Sie gewann sein Herz, indem sie einige Zeilen aus<br />
Goethes Dichtung zitierte: "...Sieh, das Gute liegt<br />
so nah'," (siehe Wm. Schroeder, Preservings, Nr. 8,<br />
Juni 1996, Teil 1, Seiten 44-46
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
1899 – Peter Neufeld (1821-1922) siedelte in<br />
Ebenfeld, Manitoba, auf dem Section 4-7-6E, eine<br />
Meile westlich von Steinbach an der Nordseite des<br />
heutigen P. T. H 52, wo heute Dr. Paul Peters wohnt,<br />
indem er einen "Chutor" (Einzelgehöft) von 800<br />
Acker erstklassiges Farmland für sich und seine<br />
Söhne absteckte. Peter Neufeld wurde in der<br />
Chortitza <strong>Kolonie</strong> geboren, erlebte den Umzug<br />
nach die Bergthal <strong>Kolonie</strong> und dann 1874 die<br />
Auswanderung nach Kanada. Er wurde der<br />
"Hundert Joascha" genannt, Foto freundlicherweise<br />
genehmigt von Preservings,Nr. 11, Seite 6.<br />
338<br />
Maria Dyck-Schroeder (1840-1900), eine der<br />
dynamischen Frauen von Bergthal im kaiserlichen<br />
Russland. Sie gewann das Herz ihres Mannes,<br />
indem sie Goethes Poesie zitierte. Foto freundlicherweise<br />
genehmigt von Wm. Schroeder, The<br />
Bergthal Colony, Seite 43 / Preservings, Nr. 11,<br />
Seite 6.<br />
Circa 1859. Franz Thiessen (1833-<br />
1901) und Elisabeth Hamm-Thiessen<br />
(1826-95) mit Sohn Franz. Sie emigrierten<br />
von Schönfeld, Bergthal <strong>Kolonie</strong>,<br />
nach Manitoba, wo sie in Neuenburch<br />
oder Reichenbach, Ost-Reserve,<br />
ansiedelten; und dann zogen sie nach<br />
Schönau, West-Reserve, in der Nähe<br />
des heutigen Altona. Ihre Enkelin<br />
Agatha Thiessen (1885-1978) heiratete<br />
"Dr." Peter P. Friesen ("Droatbranna")<br />
von Grünthal, Manitoba. Foto The<br />
Oak (Steinbach 1995) freundlicherweise<br />
genehmigt von Ostreserve 125<br />
Jahre (Steinbach 1999), Seite 13.
Kapitel 57 <strong>Die</strong> Bergthal <strong>Kolonie</strong> – Respublika<br />
Prediger Abram Friesen (1816-71), Bergthal <strong>Kolonie</strong>,<br />
war der Onkel von Peter M. Friesen, Autor des<br />
Geschichtsbuches "Mennonitische Brüderschaft",<br />
obwohl P.M. Friesen das in seinem Buch nicht<br />
anerkennt. Viele evangelistische oder pietistische<br />
Mennoniten von heute schämen sich mit ihren konservativen<br />
mennonitischen Verwandten, und bezeichnen<br />
dadurch ihren begrenzten und verarmten<br />
Weltblick und Kulturfeindlichkeit. Prediger Abram<br />
Friesens Witwe und Kinder wanderten 1875 aus und<br />
siedelten in Strassburg, Ost-Reserve, Manitoba, an<br />
(heute Niverville). Fünf ihrer Kinder sind auf dieser<br />
Fotografie zu sehen, die vor 1899 aufgenommen<br />
wurde: (von links nach rechts) Cornelius (1864-1928),<br />
Peter (1858-99), Aaron (1848-1923), Abraham (1839-<br />
?); und vorne sitzend Aganetha, Frau Peter Harder<br />
(1851-?). Peter Friesens Enkelin Helen und ihr Mann<br />
Eugene Derksen waren lange Zeit Eigentümer der<br />
Druckerei Derksen in Steinbach. Foto freundlicherweise<br />
genehmigt von Dr. Reinhard<br />
Friesen/Preservings,Nr. 11, Seite 38.<br />
339<br />
Erdmann Penner (1836-<br />
1907) und Partner Otto<br />
Schulz, Main Street (“Haupt<br />
Straße”), Winnipeg, im<br />
Jahre 1880. Penner wanderte<br />
1874 von der Bergthal<br />
<strong>Kolonie</strong> nach Manitoba,<br />
Kanada, aus. Er wurde bald<br />
einer der prominentesten<br />
Geschäftsführer in der Provinz.<br />
Er eröffnete 1876 den<br />
ersten Laden in Tannenau,<br />
Ost-Reserve. Er stieg in das<br />
Flachbootgeschäft ein und<br />
versorgte Mennoniten mit<br />
allem Notwendigen. Er<br />
eröffnete die erste Ladenkette<br />
in Manitoba. Er und<br />
sein Partner verschifften<br />
1878 die ersten 10<br />
Zugladungen Weizen zum<br />
Export aus Manitoba. Foto<br />
freundlicherweise genehmigt<br />
von Manitoba<br />
Diamond Jubilee<br />
(Jubiläum) 1930 /<br />
Preservings,Nr.17, Seite 1.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Schulen von Bergthal.<br />
Jedes Dorf in Bergthal hatte sein eigenes zentral<br />
gelegenes Schulhaus. <strong>Die</strong> Lehrer waren oft Personen<br />
aus dem Ort, welche die Gabe und das Interesse hatten,<br />
die Kinder zu lehren. Sie wurden aber auch von<br />
den <strong>Kolonie</strong>n <strong>Molotschna</strong> und Chortitza angestellt.<br />
<strong>Die</strong> Lehrmethoden folgten dem Stand jener Zeit.<br />
<strong>Die</strong> Lehrer in der <strong>Kolonie</strong> waren 1848 folgende:<br />
Bergthal - Heinrich Wiens (Gerhard Dueck);<br />
Schönfeld - Abraham Friesen (Abraham Enns);<br />
Schönthal - Franz Dyck (Corn. Neufeld); Heuboden<br />
- Abraham Wiebe (Johann Hiebert); und<br />
Friedrichsthal - (Johann Buller); (Oberschulze, Seite<br />
121). Der zweite Name, der in Klammern steht, war<br />
der Ersatzmann oder Lehrer-Praktikant. <strong>Die</strong> Lehrer<br />
in der <strong>Kolonie</strong> Bergthal im Jahre 1857 waren:<br />
Bergthal - Gerhard Dueck; Schönfeld - Abraham<br />
Enns; Schönthal - Cornelius Neufeld; und<br />
Heuboden - Johann Hiebert (Oberschulze, Seite 22).<br />
Peter Klippenstein (1831-1904) ist ein gutes<br />
Beispiel der hingebungsvollen Lehrer von Bergthal.<br />
1846, als er erst 15 Jahre alt war, begann er im Dorf<br />
Bergthal zu unterrichten, indem er ein<br />
,,Rechenbuch" zusammenstellte. Zu Beginn jedes<br />
Abschnittes stellte er eine Titelseite her, die er mit<br />
einigen der feinsten vorhandenen Frakturkünste<br />
illustrierte. Lehrer wie Klippenstein waren echt am<br />
Wohlergehen und dem geistigen Wachstum ihrer<br />
Studenten interessiert. In einigen Fällen war das<br />
Unterrichten ein Sprungbrett zur Leitung in der<br />
Gemeinde, z.B. David Stoesz (1842-1903), der in<br />
Friedrichsthal Lehrer war und später Ältester der<br />
Bergthaler Gemeinde wurde, da er 1882 Gerhard<br />
Wiebe ersetzte.<br />
<strong>Die</strong> Philosophie der Erziehung lautete bei den<br />
konservativen Mennoniten, dass die Schulen den<br />
Kindern ,,Echten Glauben einflößen sollten, ...<br />
bevor die Mächte der Vernunft von ihnen Besitz<br />
ergreifen und ein wahres Verständnis der Einfalt in<br />
Christus' verhindern." Der Zweck des Schulsystems<br />
war nicht unbedingt, sich in den Mechaniken des<br />
Lernens hervorzutun, sondern vielmehr, ,,die<br />
Jugend vorzubereiten, ein existentielles christliches<br />
Leben in Frömmigkeit und Ehrfurcht vor Gott zu<br />
führen auf der Grundlage der Einfalt und Liebe zum<br />
Mitmenschen. Eine gute Erziehung öffnet das Herz<br />
eines Kindes und ermöglicht es, dass die Kenntnis<br />
Christi Wurzeln schlägt."<br />
Was auch immer zur höheren Ausbildung<br />
gehörte, wurde als etwas angesehen, was zu<br />
,,Spitzfindigkeit, Unglauben und Verdorbenheit der<br />
Gemeinde führt, denn Erkenntnis bläht auf (1. Kor.<br />
8,1)." Heinrich Balzer, "Verstand und Vernunft".<br />
<strong>Die</strong> Wahrheit dieser Aussage wurde in vielen<br />
der Russland-Mennoniten beobachtet, so in dem<br />
Historiker Peter M. Friesen und anderen, welche die<br />
340<br />
separatistischen - pietistischen Bibelschulen in<br />
Europa und anderswo besuchten und mit<br />
Verachtung für ihren traditionellen Glauben erfüllt<br />
waren und anfingen, leidenschaftlich für alle Arten<br />
von ,,Fabeln" der Endzeitlehren zu werben, die sich<br />
auf die Novellen von Jung Stilling beriefen, der<br />
glaubte, dass Jesu zweites Kommen im Osten geschehen<br />
würde und dass der kaiserliche Zar der<br />
Verteidiger der Kirche in der Endzeit sei (Urry, None<br />
but Saints ("Nichts als Heilige"), Seite 227). Zum<br />
Glück predigten diese Leute aus dem Stegreif. Wenn<br />
sie ihre Predigten sorgfältig zusammengestellt und<br />
aufgeschrieben hätten, wie es die konservativen<br />
Prediger taten, wären ihre Nachkommen wegen der<br />
Predigten und wegen dieser Lehren, die sie so<br />
fanatisch propagierten, und welche sich im Laufe<br />
der Zeit total als Unwahrheit bewiesen haben,<br />
enorm in Verlegenheit gebracht worden.<br />
Das Erziehungssystem in Bergthal ist<br />
ungerechterweise oft von Schriftstellern kritisiert<br />
worden, die sich der Modernisierung Typologie ver-<br />
Ein Muster aus dem Rechenbuch des Lehrers Peter<br />
Klippenstein (1831-1904). <strong>Die</strong> Titelseite für den<br />
"Multiplikationsteil" stellt eine mit einer Mauer<br />
umgebene Stadt dar, bekannt als "Kreml". Könnte es<br />
möglicherweise der nahe Seehafen von Mariupol<br />
sein? 1875 kam Peter Klippenstein nach Manitoba<br />
und siedelte in Bergthal, Öst-Reserve, nördlich von<br />
Mitchell, an. 1881 zog die Familie nach Neu-<br />
Bergthal in der Nähe von Altona. Siehe Jake Peters,<br />
Mennonite Private Schools ("Mennonitische<br />
Privatschulen"), Seiten 17-18. Foto East Reserve<br />
125 years,(Steinbach 1999), Seite 31.
Kapitel 57 <strong>Die</strong> Bergthal <strong>Kolonie</strong> – Respublika<br />
schrieben hatten, oder von solchen, deren fanatische<br />
religiöse Neigung es für sie notwendig machte,<br />
alles Christliche, was nicht mit jedem einzelnen<br />
Detail ihres engstirnigen Glaubens übereinstimmte,<br />
zu verunglimpfen.<br />
James Urry, der leitende Historiker der<br />
Russland-Mennoniten, berichtet von ,,einem<br />
Ereignis in der Schule vom Dorf Bergthal in den<br />
1850er Jahren" mit dem Vermerk, dass es ,,ein hilfreicheres<br />
Bild des Schulunterrichts bietet, als<br />
spätere Berichte erkennen lassen," (Seite 158). <strong>Die</strong><br />
späteren Berichte wurden typisch von<br />
Assimilationisten (Gleichmachern) geschrieben<br />
und basierten auf der negativen Karikatur, die von<br />
Johann Cornies zurechtgemacht worden war, um<br />
seine drakonischen (sehr strengen)<br />
Reformmaßnahmen zu rechtfertigen. <strong>Die</strong> Kritik an<br />
dem Lehrsystem in Bergthal scheint von denen<br />
auszugehen, die sich der Modernisierung Typologie<br />
verschrieben hatten, und/oder von denen, deren<br />
frömmlerischer Eifer oder imperialistisches<br />
religiöses Program es für sie notwendig machte,<br />
konservative und/oder orthodoxe Mennoniten<br />
anzuschwärzen.<br />
Es stimmt, dass Bergthal nicht direkt von den<br />
Reformen des Johann Cornies betroffen war, in dem<br />
Sinne, dass die Schulen nie seiner Aufsicht unterstellt<br />
wurden. Aber dies war wahrscheinlich ein<br />
Segen und kein Nachteil. Bergthal erhielt indirekt<br />
viele Nutzen durch verschiedene Emigranten, die<br />
so späte als 1853 in der neuen Siedlung angekommen<br />
waren, und durch Lehrer, die von auswärts<br />
angestellt wurden, von der <strong>Molotschna</strong> sowie von<br />
der Altkolonie, z.B. Jakob Warkentin (geb. 1836),<br />
Tiege, Mol., Pioneers and Pilgrims, Seite 187, und<br />
Johann Abrams (1794-1856), BGB A 58, von Pastwa,<br />
Mol., Lehrer in Schönfeld 1843.<br />
Vertreter der Reformen von Cornies vergessen<br />
praktisch, dass diese Maßnahmen enorme soziale<br />
Spaltungen und Disputationen verursachten, als sie<br />
in der <strong>Molotschna</strong> und in den Altkolonien durchgeführt<br />
wurden, da sich die Mehrheit der Bevölkerung<br />
davon distanzierte. Indem er strenge<br />
Regeln festsetzte, unterdrückte er die Kreativität der<br />
besten Lehrer der alten Linie und untersagte traditionelle<br />
mennonitische Kunstformen wie<br />
Schönschreiben und Fraktur, die er als veraltet betrachtete.<br />
<strong>Die</strong> Vertreter ignorieren auch einige negative<br />
Aspekte der Pädagogik nach Cornies (der sogenannten<br />
,,Franz-Schule"): diese Lehrer waren als<br />
schrecklich streng und fast abusive Züchter bekannt.<br />
Viele ihrer Studenten wurden anfällig für einen<br />
kriecherischen russischen Nationalismus und/oder<br />
Pan-Germanismus. Viele wurden Opfer der phanatischen<br />
Lehren des deutschen Separatisten-<br />
Pietismus und, am schlimmsten von allem, sie wur-<br />
341<br />
den sozialisiert, die plautdeutsche Sprache und die<br />
plattdeutsche Kultur zu verachten, welche einst den<br />
Umgang und das gesellschaftlich-ökonomische<br />
Leben in Nordeuropa und in der Umgebung der<br />
Ostsee im Mittelalter beherrscht hatte.<br />
<strong>Die</strong>jenigen, welche die Schulen von Bergthal so<br />
vollständig und gründlich denunzierten, haben<br />
scheinbar niemals die Schriften der Lehrer von<br />
Bergthal/Chortitza und sogar gewöhnlicher Laien<br />
studiert. Beispielsweise sind die Predigten vom Ältesten<br />
Gerhard Wiebe (1827-1900) mit Juwelen biblischer<br />
Allegorie übersät und zeigen eine gesunde<br />
Exegese (Auslegung) und einen wahrhaft inspirierten<br />
Glauben, der heute ebenso dauerhaft ist wie<br />
in den 1860er Jahren, als sie geschrieben wurden,<br />
und die alles überragten was seine Feinde<br />
geschrieben haben. <strong>Die</strong> Tagebücher des Chortitzer<br />
(Bergthaler) Ältesten David Stoesz und des<br />
Predigers Heinrich Friesen (1842-1921) sind ein<br />
konkreter Beweis, dass das Schulsystem von<br />
Bergthal Promovierte hervorbrachte, die nicht nur<br />
mit einer Liebe zu Jesus erfüllt waren, sondern auch<br />
fähige Schriftsteller und begabte Denker waren.<br />
Abgekürzt aus Preservings, Nr. 13, Seiten 114-<br />
116.<br />
Abraham Rempel, Rechenbuch, Bergthal,<br />
Russland, 1858. <strong>Die</strong>s war ein von Hand<br />
hergestelltes, gezeichnetes und koloriertes<br />
Lehrbuch: 8 1/2 Zoll zu 6 3/4 Zoll (21,6 cm x 17,15<br />
cm). Foto freundlicherweise genehmigt von Ethel<br />
Abrahams, Frakturmalen,Seite 122/East Reserve<br />
125 years,(Steinbach 1999), Seite 31.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Fraktur-Kunst.<br />
Fraktur war eine traditionelle Kunstform, die<br />
ihren Ursprung in Holland und Nord-Deutschland<br />
hatte. Sie hatte ihre Wurzeln in den handschriftlichen<br />
Verzierungen durch Mönche im<br />
Mittelalter, die Manuskripte schrieben und dabei<br />
den natürlichen Wunsch hatten, sie zu verschönern.<br />
Hiervon kommt die Form der "Illumination"<br />
(Buchmalerei), die sich zum wunderschönen<br />
Kunstwerk entwickelte, welche im Mittelalter viele<br />
Manuskripte verzierte. Erasmus (1466-1536),<br />
Schüler der Renaissance, "betonte die<br />
Notwendigkeit der richtigen Proportion, des<br />
Abstandes und der Anordnung." Mit der<br />
Erfindung der Druckerpresse wurden Kalligraphie<br />
(Schönschreibkunst) - Bücher wie Mercators<br />
erstes holländisches handgeschriebenes<br />
Handbuch im Jahre 1540 weit verbreitet.<br />
In ihrem Werk "Frakturmalen und<br />
Schönschreiben" schrieb Ethel Ewert Abrahams,<br />
dass ,,es möglich ist, dass mennonitische Gelehrte<br />
und Schulmeister für die ersten mennonitischen<br />
Schulen den deutschen Manuskripten gegenüber<br />
offen waren", die ein Grundprinzip der Fraktur-<br />
Formen und Muster zeigten sowie<br />
Schönschreiben oder Kalligraphie. Abrahams hat<br />
mehrere Kategorien der Kunstform erkannt:<br />
Schreiben von Mustern ("Vorschriften"), die<br />
gebraucht wurden, um das Alphabet zu lehren,<br />
und das Schreiben von Weihnachts- und<br />
Neujahrsgrüßen - eine besondere Form des<br />
Schreibens von Mustern; Exlibris<br />
("Bücherzeichen") - eine Jahrhunderte alte Sitte,<br />
einem hochgeschätzten Buch eine persönliche<br />
Note zu geben, was den zwingenden Beweis des<br />
Eigentümers erbringt; erläuternde Texte, wie sie<br />
am meisten in den ,,Rechenbüchern" zu sehen<br />
sind. Sie waren handgeschriebene und farbig<br />
illustrierte Lehrer-Handbücher, unterteilt nach<br />
Themen; jeder Teil enthielt einen Satz<br />
Mathematikaufgaben; Belohnungen und<br />
Segnungen für das Heim, - ausgegeben von<br />
Lehrern für gute Arbeit, oder eine farbenfrohe<br />
Zeichnung mit einem Motto oder Bibelvers, die als<br />
Dekoration gebraucht wurde, möglicherweise für<br />
die Innenseite einer ,,Kjist"; ,,Maize" (,,Irrgarten")<br />
- ein Labyrinth, durch das der Schüler ein Gedicht<br />
oder einen Vers suchte, gleichsam eine geistige<br />
Pilgerreise, die benutzt wurde, um eine Moral-<br />
Lektion zu lehren; und Ausschneidearbeit<br />
("Scherenschnitte") - eine Schere wurde<br />
342<br />
gebraucht, um ein wunderschönes Muster zu<br />
schaffen, das manchmal auch mit Fraktur verziert<br />
wurde und bei der Unterrichtung von<br />
geometrischen Formen, Mathematik und dekorativen<br />
Geschicklichkeiten hilfreich war.<br />
Fraktur und Schönschreiben wurden in den<br />
mennonitischen Schulen in Preußen gelehrt und<br />
während der Emigration von 1788-89 und 1803-4<br />
nach Russland gebracht. Ethel Ewert Abrahams<br />
schrieb, dass die hochentwickeltsten Beispiele der<br />
Kunstform zwischen 1780 und 1845 datieren. Der<br />
Verfall der Kunstform nach 1845 stimmt mit dem<br />
Zeitraum überein, als sich Johann Cornies die<br />
Kontrolle über Schulen in der <strong>Molotschna</strong><br />
anmaßte und Fraktur verbot mit der Begründung,<br />
dass es etwas für Weichlinge sei. Obwohl sie im allgemeinen<br />
mit Cornies bei den meisten seiner Reformen<br />
eifrig zusammenarbeiteten, fuhren Kleine<br />
Gemeinde-verbundene Lehrer wie Cornelius P.<br />
Friesen (1844-99), später Blumenort, Manitoba,<br />
und Jakob Isaak (1815-66), Tiege, fort, die<br />
Kunstform zu praktizieren und zu lehren. Siehe<br />
Preservings Nr. 8, Juni 1996, Teil zwei, Seiten 55-56,<br />
wo die Fraktur-Kunst des Blumenorter Lehrers<br />
Cornelius P. Friesen (1844-99) und ein ,,Irrgarten"<br />
sowie ein Scherenschnitt abgebildet sind, die<br />
benutzt wurden, um geometrische Prinzipien,<br />
künstlerische Gestaltung usw. zu lehren.<br />
A Splendid Harvest (,,Eine hervorragende<br />
Ernte") von Michael Bird und Terry Kobyashi<br />
(Toronto 1981) 240 Seiten. Ein anderes Werk in<br />
dieser Kategorie, behandelt das deutsche Volk und<br />
dekorative Künste in Kanada mit dekorativer<br />
Kultur der Russlandmennoniten als eine<br />
Abteilung. Es ist eine Ergänzung dessen, was<br />
Ethel Abrahams zusammengestellt hat, da es die<br />
Analyse und den historischen Hintergrund enthält<br />
und einige Information über die Herkünfte und<br />
Entwicklungen der Fraktur als Kunstform bietet.<br />
Es ist hilfreich als allgemeines Nachschlagewerk,<br />
da es eine erweiterte Skala materieller Kultur, einschließlich<br />
Architektur, Wohnungseinrichtung,<br />
Textilien, Grabsteingravierung, möglicherweise<br />
sogar weltlicher Gegenstände wie Staubtücher für<br />
Plätzchen, Scharniere, Schmuckkästchen usw.<br />
umschließt.<br />
Quellen:<br />
Ethel Ewert Abrahams, Frakturmalen und<br />
Schönschreiben (North Newton, Kansas, 1980), 158<br />
Seiten.
Kapitel 57 <strong>Die</strong> Bergthal <strong>Kolonie</strong> – Respublika<br />
Das "Siegel der Mennoniten-Gemeinde in<br />
Bergthal" in Russland. <strong>Die</strong>ser Abdruck befand sich<br />
auf einem Dokument, das vom Ältesten David<br />
Stoesz am 7. Februar 1889 unterschrieben und versiegelt<br />
wurde. Aus W. Schroeder, The Bergthal<br />
Colony,Seite 18.<br />
Helena Penner (1874-1970), Tochter des<br />
Geschäftsmanes Erdmann Penner, Gretna, war das<br />
erste mennonitische Bäby in Winnipeg geboren, und<br />
auch die erste Mennonitische Frauensperson in<br />
Manitoba mit Universitätsgrad. Sie heiratete Dr.<br />
Gerhard Hiebert, Mountain Lake, Minnesota, der an<br />
der McGill-Universität studierte und in Übersee. Sie<br />
kehrten 1906 nach Winnipeg zurück, wo Dr. Hiebert<br />
im General-Hospital,Winnipeg, als Chirurg und von<br />
1917-1919 als Oberchirurg diente. Foto aus<br />
Tante Maria Enns mit der im Jahre 1630 gedruckten<br />
Bibel, die ihr Ururgroßvater Abraham von Riesen<br />
(1769-1823) von Preußen mit nach Nieder-<br />
Chortitza, Russland, gebrachte hat. Sein Sohn Jakob<br />
nahm die Bibel mit nach Bergthal und später nach<br />
Manitoba. 1877 verkauft er die Bibel an seinen Sohn,<br />
Prediger Heinrich Friesen (1842-1921), Hochfeld,<br />
Ost-Reserve. Foto von Doris Penner/Aus Preservings,<br />
Preservings,Nr. 10, Teil Zwei, Seite 10.<br />
Nr. 2, Seite 1.<br />
343
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
<strong>Die</strong>nste und Hilfe.<br />
<strong>Die</strong> geistliche Gesinnung der Einwohner von<br />
Bergthal wird an drei Musterbeispielen der<br />
ländlichen Agrargemeinschaften deutlich:<br />
Familie, Dorf und Kirche. Der Glaube wurde durch<br />
eine Unzahl von sozialen <strong>Die</strong>nsten in die Tat<br />
umgesetzt: Gegenseitige gemeinschaftliche Hilfe<br />
und ethno-kulturelle Aktivitäten, die mittels einer<br />
Aufstellung der sozio-religiösen Einrichtungen<br />
durchgeführt wurden, welche auf den Prinzipien<br />
der Volksdemokratie basierten.<br />
<strong>Die</strong> gegenseitige Hilfe umfasste informelle<br />
Aktivitäten wie Bährungen ("Häuser und<br />
Scheuneaufbau"), Schweineschlachten<br />
("Schwins-jkast"), Krankenpflege und<br />
Hebammendienst; zu den mehr formell institutionalisierten<br />
Strukturen gehörten das<br />
Waisenamt, das für die Übertragung der Güter<br />
sorgte, die Investition der Gelder von Waisen und<br />
Witwen sowie Darlehen an Mitglieder der<br />
Gemeinschaft; der Gemeindespeicher, in dem der<br />
Jahresertrag an Mehl und Saatgut gelagert wurde,<br />
die Brandordnung<br />
(Feuerversicherungsgesellschaft auf<br />
Gegenseitigkeit) und die Dorfversammlung<br />
(,,Schultebut"), in der Entscheidungen betreffs<br />
des Dorflebens im demokratischen und öffentlichen<br />
Forum getroffen wurden. In Übereinstimmung<br />
mit dem alten flämischen Gesetz<br />
wurde den Frauen volle Gleichberechtigung<br />
eingeräumt im Erbschaft.<br />
Soziale <strong>Die</strong>nste wurden gemäß der<br />
Anweisung der Bergthaler Gemeinde gewährt,<br />
"sich der Nöte der Heiligen anzunehmen". <strong>Die</strong>s<br />
schloss die Zulassung einer gesunden<br />
Grundausbildung für alle in der Gemeinschaft ein,<br />
gleich ob sie wohlhabend oder sozial schwach<br />
waren, Versorgung von Pflegeeltern und/oder<br />
Vormündern von Waisenkindern, besondere Hilfe<br />
für Behinderte und Invaliden sowie finanzielle<br />
Hilfe für Witwen und Ältere. Zusätzlich zu den<br />
bereits erwähnten mehr formellen Einrichtungen<br />
wurden diese Objekte sozialer Versicherung auf<br />
dem Weg der Armenkasse erreicht, welche Gelder<br />
bereitstellte, die von Diakonen gebraucht wurden,<br />
die sich um die Armen, Witwen und Vaterlosen<br />
kümmerten.<br />
<strong>Die</strong>se sozialen Strukturen und andere<br />
Gemeinschaftskonstrukte wie eine enge Verbindung<br />
von Großfamilien, Dorfgemeinschaften<br />
und natürlich der Gemeinde selbst gewährten ein<br />
344<br />
soziales Sicherheitsnetz für die Armen,<br />
Benachteiligten und an den Rand Gedrängten<br />
innerhalb der Bergthaler Gemeinde, die ihrer Zeit<br />
um Jahrhunderte voraus war. <strong>Die</strong>se Institutionen<br />
wurden 1874 völlig vom kaiserlichen Russland<br />
nach Manitoba transplantiert.<br />
Bergthal wurde ein erfolgreiches Beispiel für<br />
das Siedlungssystem in <strong>Kolonie</strong>n unter den<br />
Russlandmennoniten. Durch weise Führung und<br />
die Vorsehung Gottes ging Bergthal dem<br />
extremen Fanatismus, der von radikalen<br />
Separatisten-Pietisten betrieben wurde, aus dem<br />
Wege, deren leidenschaftliche<br />
Proselytenmacherei ausbrach und viele Familien<br />
und Kirchengemeinden in der Altkolonie und<br />
<strong>Molotschna</strong> zerstörte.<br />
Der Disput der Landlosen, eine nahe Revolte<br />
von Arbeitern in der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, denen<br />
das Wahlrecht aberkannt war, wurde von den<br />
Landbesitzern in Bergthal gemieden, die bereit<br />
waren, von Zeit zu Zeit immer wieder von ihrem<br />
Eigentum zu opfern, um die Notleidenden oder<br />
weniger begünstigten Nachbarn und Freunde zu<br />
versorgen. Zur Zeit der Auswanderung setzten<br />
Ältester Wiebe, Oberschulze Peters und andere,<br />
ein Beispiel, indem sie einen Abschlag von ihrem<br />
Guthaben zugunsten des Waisenamtes zustimmten.<br />
<strong>Die</strong>s sorgte für einen Fonds, so dass<br />
sogar die Ärmsten in der Gemeinschaft von 1874<br />
bis 1876 nach Manitoba auswandern konnten.<br />
David W. Friesen (1879-1951), Gründer der<br />
"Friesens Corporation", Altona, Manitoba, einer<br />
von den größten Druckereien Nord-Amerikas. Er<br />
war ein Nachkommen des Jakob Friesen (1793-<br />
1843), einem der ersten Pionieren der Bergthal<br />
<strong>Kolonie</strong>. Foto aus Preservings,Nr. 14, Seite 34.
Kapitel 57 <strong>Die</strong> Bergthal <strong>Kolonie</strong> – Respublika<br />
Das verstoßene Kind.<br />
<strong>Die</strong> Geschichte von dem ,,verstoßenen Kind",<br />
buchstäblich dem abgelehnten Kind, beschreibt<br />
besser als alles den religiösen Glauben und die<br />
Spiritualität der Leute von Bergthal.<br />
Am 12. April 1863 wurde von einer jungen russischen<br />
Frau im Heim ihrer Verwandten, dem russischen<br />
Hirten in Heuboden, ,,das verstoßene Kind"<br />
geboren. <strong>Die</strong> Mutter hatte als Magd in Schönfeld<br />
gearbeitet. Sie wollte das Baby nicht, und so wurde<br />
es in einen Schweinestall geworfen.<br />
Das Baby wurde von Frau Johann Doerksen<br />
gerettet und von Frau Jakob Harder, Heuboden,<br />
gepflegt. Nachdem die Pflegemutter gestorben war,<br />
wurde sie durch eine Frau ersetzt, der das Kind gleichgültig<br />
war. Und als es zur Auswanderung kam,<br />
sagten sie ihm, dass sie es sich nicht leisten könnten,<br />
ihn mitzunehmen.<br />
Am Abend, nachdem seine Pflegeeltern fortgefahren<br />
waren, fand der Oberschulze Jakob Peters<br />
das Kind weinend am Dorfbrunnen.<br />
"Johann, bist du noch nicht fort?" fragte Jakob<br />
Peters.<br />
Langsam erhob sich Johann, blickte angstvoll<br />
in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war,<br />
und erkannte den Oberschulzen.<br />
"<strong>Die</strong> anderen sind alle fort, außer<br />
mir," erwiderte er. "Sie wollten mich<br />
nicht mitnehmen."<br />
"Dann musst du mit mir kommen,"<br />
sagte Jakob Peters ohne Zögern.<br />
,,Du kannst bei uns bleiben, bis sich<br />
eine andere Gelegenheit findet."<br />
Johann stand auf ergriff die<br />
dargebotene Hand und ließ sich zum<br />
Heim von Peters führen. Hier gab ihm<br />
der Oberschulze etwas zu essen und<br />
zu trinken. Dann sagte er: "Johann, du<br />
bist jetzt mein Sohn; wenn es dir hier<br />
gefällt, kannst du hier bleiben. Im<br />
nächsten Jahr will ich nach Amerika<br />
ziehen, und du kannst mitkommen.<br />
Ich werde dich nicht hierlassen ..."<br />
Getreu seinem Wort brachte der<br />
Oberschulze Johann 1876 nach<br />
Manitoba. 1887 schloss sich Johann<br />
der Chortitzer Gemeinde an und<br />
erhielt den Namen Johann Peters. Mit<br />
der Zeit heiratete Johann und zog eine<br />
große Familie auf. (Siehe William<br />
Schroeder, The Bergthal Colony,<br />
Seiten 39-40. Ein mehr detaillierter<br />
Bericht ist zu finden in John Dyck,<br />
Oberschulze Jakob Peters und William<br />
Enns, Das verstossene Kind, 132<br />
Seiten).<br />
345<br />
Lebensgroße Steinfiguren, genannt "Baba", die<br />
im Gebiet Bergthal gefunden wurden, sind von<br />
Skythen, hergestellt worden, die einst, von 800 vor<br />
Chr. das Gebiet besetzt hatten. Foto aus Wm.<br />
Schroeder, The Bergthal Colony,Seite 15.<br />
Fahrkarte der Bergthal Gegend, mit Namen der Dörfer. 2000.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Emigration von 1874-6.<br />
Etwa 500 Familien kamen ab Mitte August<br />
1874 bis 1876 in der ,,Ost-Reserve", Manitoba,<br />
Kanada, an. Hier wurden sie als die Chortitzer in<br />
der Ost-Reserve und später auch als<br />
Sommerfelder in der West-Reserve bekannt.<br />
Ungeachtet eines extremen Landmangels<br />
unter den Mennoniten in Russland hörten alle<br />
Kaufaktivitäten seitens der Mutterkolonien auf,<br />
als die Emigrationsbewegung begann, so dass<br />
die Bergthal <strong>Kolonie</strong> an Nicht-Mennoniten<br />
verkauft werden musste. So gingen die<br />
Ländereien dieser florierenden und malerischen<br />
Siedlung in andere Hände über. Der Planer der<br />
<strong>Kolonie</strong> Gruna kaufte Bergthal für die Katholiken<br />
und Schönfeld für die Lutheraner. Heuboden<br />
und Schönthal wurden von der Evangelischen<br />
Separatisten-Brüdergemeinde aus dem Dorf<br />
Neuhoffnung in der Nähe von Berdjansk<br />
gekauft, und Friedrichsthal wurde von den<br />
Russen gekauft.<br />
346<br />
<strong>Die</strong> Erfahrungen der deutschen Kolonisten,<br />
die diese Besitztümer kauften, waren ähnlich<br />
denen anderer Fremder in Russland. Unter den<br />
Sowjets wurde die <strong>Kolonie</strong> Bergthal in<br />
"Respublika" umbenannt.<br />
Es sind heute nur noch wenige Beweise<br />
geblieben, dass die geschickte Mennoniten der<br />
Altkolonie einst hier in dieser malerischen<br />
Gegend des Flusses Bodena eine blühende<br />
Siedlung aufgebaut haben.<br />
Zum Nachlesen:<br />
William Schroeder, The Bergthal Colony,<br />
(Winnipeg 1986), 141 Seiten.<br />
John Dyck, Oberschulze Jakob Peters (1813-<br />
1884): Manitoba Pioneer Leader ("Pionier-Führer<br />
Manitoba"), (Steinbach 1990), 130 Seiten<br />
William Enns, Das verstossene Kind,<br />
(Steinbach, k.d.) 132 Seiten<br />
Klaas Peters, <strong>Die</strong> Bergthaler Mennoniten<br />
(Steinbach 1983), 52 Seiten<br />
Einfahrt von Bergthal im Jahre 1994. Foto von Orlando Hiebert, Tourond, Manitoba / Preservings,Nr.4,<br />
Seite 6.<br />
Foto des Dorfes<br />
Bergthal von<br />
1979. Beachte die<br />
A nwohner-<br />
Straße. Foto freundlicherweise<br />
genehmigt von<br />
Wm. Schroeder,<br />
The Bergthal<br />
Colony,Seite 19.
Kapitel 57 <strong>Die</strong> Bergthal <strong>Kolonie</strong> – Respublika<br />
347<br />
Fahrkarte für die Melitopoler, Berdjansker, Mariupoler und Saproroschjer Gegend. <strong>Die</strong>se Karte bezeichnet die asphaltierte Wege zwischen<br />
diesen Siedlungen. Um sich noch besser zurechtzufinden können die Touristen auch die Karten einzelner <strong>Kolonie</strong>n oder Siedlungen benutzen.
Kapitel 58 Pukhtin - Schönfeld-Brazol<br />
"Pukhtin," von John Dyck, Winnipeg, Manitoba.<br />
Ansiedlung.<br />
Mennoniten begannen, dort zu siedeln und<br />
Landwirtschaft zu betreiben, was Pukhtin werden<br />
sollte, nur wenige Jahre nachdem die<br />
Bergthal <strong>Kolonie</strong> 1836 gegründet war. Nördlich<br />
von <strong>Molotschna</strong> gelegen, war Pukhtin wenige<br />
Kilometer nördlich von einer direkten Linie zwischen<br />
den Siedlungen Chortitza und Bergthal.<br />
Seine Lage, fast auf halbem Weg zwischen den<br />
zwei Siedlungen, machte Pukhtin zu einer logischen<br />
Zwischenstation zwischen Bergthal und<br />
Chortitza. (Siehe Schönfeld und Gulaipole auf<br />
der Landkarte, Seite 68). <strong>Die</strong> Mehrzahl der ersten<br />
Siedler von Pukhtin kamen aus der <strong>Molotschna</strong><br />
<strong>Kolonie</strong>.<br />
David Schellenberg, ein Pionier von<br />
Manitoba, der dort geboren wurde, schrieb, dass<br />
das Dorf von Pukhtin "etwa 60 Meilen in<br />
nördlicher Richtung von Berdjansk" lag (Note 1).<br />
<strong>Die</strong> Postadresse für Pukhtin war "Wolost<br />
Woskressenski, Post Fedorowka, Gebiet<br />
Alexandrowsk, Provinz Jekaterinoslaw" (Note 2).<br />
Pukhtin wird in der Mennonitische<br />
Rundschau während der 1880er Jahren häufig<br />
erwähnt und hatte einige Jahre sogar einen<br />
regelmäßigen Korrespondenten, der seine<br />
Adresse als "Neuanlage (Pukhtin)" angab. Jedoch<br />
hatte es weder ein Postamt noch war es eine<br />
Wolost (Regierungsbezirk), und seine Grenzen<br />
scheinen lose bestimmt worden zu sein. <strong>Die</strong><br />
Bezeichnung "Pukhtin" wurde so gebraucht, dass<br />
es die Dörfer Neuanlage (Note 3), Silberfeld (Note<br />
4), Blumenheim, Blumenfeld, Schönfeld (Note 5),<br />
Rosenhof (Note 6), Heinrichsfeld (Note 7) und<br />
Apukhtin (Note 8) umschloss sowie das<br />
Städtchen Gulaipole (Note 9).<br />
Etliche Biographien in Aron A. Toews,<br />
Mennonitische Märtyrer (Note 10) und Karl<br />
Stummp, der Listen von deutschen Einwohnern<br />
in der Ukraine in den 1940er Jahren gesammelt<br />
hat, zeigen Pukhtin-Verbindungen.<br />
Der Anfang.<br />
<strong>Die</strong> ersten beiden mennonitischen<br />
Siedlungen in Südrußland, Chortitza und<br />
<strong>Molotschna</strong>, waren um etwa 1830 in großer<br />
348<br />
Landnot. Dass sie danach trachteten, im Gebiet<br />
von Pukhtin, welches leicht zugänglich war, Land<br />
zu kaufen, scheint vernünftig. Helen Koop<br />
Johnson legt nahe, dass die Schönfelder Wolost,<br />
die die Pukhtin-Dörfer einschloss, ihren<br />
Ursprung in einem Chutor (Landgut) hatte, der<br />
1839 von der Familie Michael Janzen gegründet<br />
wurde. Das war drei Jahre, nachdem die Bergthal<br />
<strong>Kolonie</strong> gegründet worden war. <strong>Die</strong>ser Chutor<br />
führte zur Bildung des Dorfes Silberfeld, das<br />
ungefähr 10 Meilen von Gulaipole entfernt lag.<br />
Dass einige erste Pukhtin-Familien aus der<br />
<strong>Molotschna</strong> kamen, ist in P. M. Friesen,<br />
Bruderschaft, vermerkt und in den<br />
Familienberichten dokumentiert. Einige der<br />
Familien sind im Erfassungsbogen der<br />
Volkszählung von 1835 in der <strong>Molotschna</strong> zu<br />
finden. Als weiterer Beweis der <strong>Molotschna</strong>-<br />
Verbindung dient die Tatsache, dass die dortige<br />
Gemeinde der Lichtenauer Gemeinde<br />
angegliedert wurde.<br />
1843 siedelten Jakob Driedger und acht verwandte<br />
Familien aus dem Dorf Ladekopp,<br />
<strong>Molotschna</strong>, auf einem Grundbesitz von 7500<br />
Desjatin, den sie im Jahr davor in der Nähe von<br />
Silberfeld gekauft hatten. Sie gründeten das Dorf<br />
Blumenfeld. In den 1840er Jahren siedelte Jakob<br />
Janzen von Petershagen vier Janzen-Familien auf<br />
einem Chutor an, der schließlich Teil von<br />
Blumenfeld wurde.<br />
Einige Familien hatten auch Verbindugen<br />
nach Chortitza. Erdmann Nikkel zog von<br />
Chortitza zur <strong>Molotschna</strong> und später nach<br />
Pukhtin. Schon in den 1840er Jahren kaufte<br />
Heinrich Thiessen, Mühlenbesitzer, ehemals aus<br />
Chortitza und später Jekaterinoslaw, 6000 Akker<br />
Land, nur leicht westlich vom Pukhtin-Gebiet<br />
und siedelte Familienmitglieder auf einem<br />
Grundbesitz, den er Hochfeld nannte. Heinrich<br />
Janzen kam, wie unten vermerkt, aus der<br />
Chortitza <strong>Kolonie</strong> via Bergthal (Note 11).<br />
Dörfer von Pukhtin.<br />
Silberfeld, etwa 10 Meilen von Gulaipole,<br />
war wahrscheinlich das erste Dorf, das in dem<br />
später "Pukhtin-Kreise" gegründet wurde. Der
Kapitel 58 Pukhtin - Schönfeld-Brazol<br />
von der Familie Michael Janzen 1839 gegründete<br />
Chutor führte zur Bildung des Dorfes. Mehrere<br />
Familien aus Silberfeld kamen in den 1870er<br />
Jahren nach Manitoba und gründeten ein Dorf<br />
mit demselben Namen am Nordende der Ost-<br />
Reserve. Als sie einige Jahre später zur West-<br />
Reserve umzogen, benutzten sie den Namen zum<br />
dritten Mal. <strong>Die</strong>ses lag nordöstlich von Gretna.<br />
Blumenfeld wurde 1843 von Jakob Driedger<br />
und acht verwandten Familien aus Ladekopp<br />
gegründet. <strong>Die</strong> vier Janzen-Familien aus<br />
Petershagen wurden Teil dieses Dorfes. Prediger<br />
Peter H. Enns, der hier von 1906 als Schullehrer<br />
diente, berichtet in seinen Erinnerungen von<br />
Blumenfeld (Note 12). Das Dorf hatte zu der Zeit<br />
10 Bauernhöfe, alle an einer Seite der ein Werst<br />
langen Straße. Auf der gegenüberliegenden Seite<br />
der Straße, in der Dorfmitte, befanden sich die<br />
Schule und die Kirche. Alle 10 Eigentümer waren<br />
Nachkommen einer Janzen-Driedger-<br />
Familienlinie. Ihre Namen waren <strong>Die</strong>trich<br />
Janzen, Abram A. Janzen, Abram I. Janzen,<br />
Kornelius A. Janzen, Peter Janzens Kinder, Franz<br />
A. Janzen, Gerhard Braun, (Prediger) Gerhard<br />
Wiens, Johann I. Janzen und <strong>Die</strong>trich Driedger.<br />
Peter H. Enns seine Memoiren beschreiben auch<br />
das schwierige Ende der mennonitischen<br />
Siedlung im Jahre 1919.<br />
Heinrichsfeld wurde 1861 auf dem Land<br />
gegründet, das von Heinrich Janzen aus<br />
Silberfeld gekauft worden war (Note 13). <strong>Die</strong> acht<br />
Gründerfamilien waren um 1900 auf die Zahl von<br />
18 Familien angewachsen, mit 950 Desjatin<br />
Land. Inzwischen war es 1894 wieder<br />
Alexandrowka genannt worden. Alles Land<br />
wurde im Sommer 1900 zu 140 Rubel je Desjatin<br />
verkauft, und im September zogen 12 Familien,<br />
die aus 48 Einzelpersonen bestanden, zur mennonitischen<br />
Siedlung in Samara.<br />
Neuanlage wurde mehr übereinstimmend in<br />
der Rundschau als Teil der Pukhtin-Siedlung<br />
erwähnt. Das geschah vielleicht, weil bei der<br />
Einwanderung in Manitoba in den 1870er Jahren<br />
mehr Leute aus Neuanlage kamen. Während des<br />
Schuljahres 1862/1863 hatten 21 Familien in<br />
Neuanlange 51 Schüler im Alter von fünf bis 14<br />
Jahren im Klassenzimmer, wie folgt:<br />
Peter Abrahams - Peter 13, Katarina 10,<br />
Justina 8; Jakob Adrian - Heinrich 9, Elisabeth 8,<br />
349<br />
Eva 6; Abraham Bornn - Peter 13, Abraham 13,<br />
Maria 8, Elisabeth 6; Abraham Enns - Jakob 10;<br />
Aron Enns - Jakob 6, Anna 10, Katarina 8; Isaak<br />
Goossen - Aron 13, Isaak 10, Johann 7, Aganetha<br />
12, Agatha 9; Jakob Hamm - Agatha 9; Peter<br />
Harms - Peter 11, Jakob 5, Agatha 7; Peter<br />
Heinrichs - Abraham 7; Abraham Isaak -<br />
Margaretha 12; Johann Klaassen - Martin 10,<br />
Johann 8; Witwe Klassen - Jakob 10, Aganetha 13;<br />
Peter Kroeker - David 8, Maria 13; Erdmann<br />
Nikkel - Abraham 9, Johann 8, Katharina 12;<br />
Witwe Pauls - Maria 5; Jakob Penner - Peter 10,<br />
Abraham 8; Johann Thiessen - David 13, Wilhelm<br />
10; David Unger - Johann 8, Peter 6; Gerhard<br />
Warkentin - Abraham 12, Klaas 11, Agatha 8;<br />
Heinrich Warkentin - Heinrich 8, Katarina 13,<br />
Maria 6; Jakob Warkentin - Peter 13, Johann 11,<br />
Heinrich 8 (Note 14).<br />
<strong>Die</strong> Familien Abrams kamen aus dem Dorf<br />
Großweide, <strong>Molotschna</strong>, nach Pukhtin. Peter<br />
Abrams, geb. 1823, und sein jüngerer Bruder<br />
Heinrich, geb. 1832, wanderten zusammen mit<br />
ihrem Vater Jakob, geb. 1799, im Juli 1875 in<br />
Kanada ein. Jakob Abrams (manchmal<br />
"Abrahams" geschrieben) war von Großweide<br />
nach Wernersdorf, nach Klippenfeld, nach<br />
Pukhtin und dann nach Manitoba gezogen wo er<br />
in der Ost-Reserve das Dorf Großweide gründete.<br />
Später zogen sie nach der West-Reserve (Note<br />
15).<br />
Peter Friesen wird in dem Jahr als<br />
Schullehrer erwähnt (Note 16). Der Dorfschulze<br />
war 1862 ein Mann mit Namen Bornn und ein<br />
Klaassen im Jahre 1863. Der Beisitzer hieß<br />
Heinrichs. 1883 bestellten Freunde in Amerika<br />
die Rundschau (15. Juni 1883, Seite 3) für Peter<br />
Janzen in Neuanlage (Pukhtin). War er vielleicht<br />
ein Sohn des oben erwähnten Bergthaler<br />
Heinrich Janzen?<br />
Apukhtin wird kaum als Dorf erwähnt. Es<br />
wird erwähnt, dass Abram Froese in diesem Dorf<br />
wohnte und den reisenden Prediger der<br />
Brüdergemeinde unterstützte. Cornelius H. Pauls<br />
wurde hier 1891 dem Ehepaar Heinrich und<br />
Justina (Hiebert) Pauls geboren (Rundschau, 12.<br />
Dezember 1973). Nach einer von Cornelius Pauls<br />
hinterlassenen Aufzeichnung wurde sein Vater<br />
1862 auch im selben Dorf geboren und starb dort<br />
1920.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
<strong>Die</strong> Gemeinden.<br />
<strong>Die</strong> Gemeinde von Lichtenau-Petershagen<br />
in der <strong>Molotschna</strong> organisierte Abteilungen in<br />
den Dörfern Schönfeld 1868, Rosenhof 1870 und<br />
Blumenfeld 1872. Jedes dieser Dörfer hatte ein<br />
Kirchengebäude und wurde von einem ortsansässigen<br />
Prediger bedient (Friesen, Bruderschaft,<br />
Seite 896). Von Schönfeld und Blumenfeld heißt<br />
es, dass sie vom Postamt in Gulaipole bedient<br />
wurden. Einige Jahre später wurde Peter Enns,<br />
ein Glied der Lichtenauer Gemeinde in der<br />
<strong>Molotschna</strong>, zu dem <strong>Die</strong>nst gewählt, während er<br />
dort als Schullehrer arbeitete. Später wurde er<br />
der erste Älteste der Lichtenauer Mennoniten-<br />
Gemeinde in der Nähe von Arnaud in Manitoba<br />
(Note 17).<br />
<strong>Die</strong> Brüdergemeinde von Rückenau,<br />
<strong>Molotschna</strong>, hatte hier<br />
Mitgliederversammlungen, bei denen ortsansässige<br />
Prediger dienten. Während es so scheint,<br />
dass sie vor 1910 keine Kirchengebäude hatten,<br />
wurden sie in späteren Jahren eine stärkere<br />
Präsenz. Bezüglich der Brüdergemeinde in der<br />
<strong>Molotschna</strong> schrieb P.M. Friesen: "<strong>Die</strong> zusammengeschlossene<br />
Gruppe von Pukhtin, wird<br />
gegenwärtig als Gnaden-Blumenfeld im Gebiet<br />
von Alexandrow angesehen. Wir wissen nichts<br />
von dieser Gruppe und ihrem Ursprung, nur dass<br />
sie des öfteren in den Berichten der reisenden<br />
Prediger (Mennoniten-Brüder) erwähnt wird,<br />
welche den Plan von Mariupol besuchten und<br />
bei diesen Gliedern blieben und Versammlungen<br />
durchführten" (Friesen, Bruderschaft, Seite 518).<br />
Pukhtin und Bergthal<br />
Verbindungen zwischen den Einwohnern<br />
von Pukhtin und Bergthal mögen damit<br />
begonnen haben, dass man Pukhtin als passende<br />
Zwischenstation zwischen Chortitza und<br />
Bergthal benutzte. Mit dem Umzug einer jungen<br />
Familie von Pukhtin nach Bergthal wurden die<br />
Verbindungen verstärkt.<br />
<strong>Die</strong> Familienakte sagt, dass Peter Friesen<br />
(1812-75) und seine Frau Anna Banman (1808-<br />
86), die zur Bergthal Gemeinde gehörten, aus<br />
Pukhtin kamen (Note 18). <strong>Die</strong> Witwe Anna<br />
Friesen wanderte später nach Kanada aus und<br />
wohnte im Dorf Osterwick, Ost-Reserve" (Note<br />
19). Ihr Uhrgroßsohn Martin C. Friesen war<br />
Ältester der Menno <strong>Kolonie</strong> in Paraguay ab 1927.<br />
350<br />
<strong>Die</strong> zeitig zwischen den Einwohnern von<br />
Bergthal und Pukhtin entstandenen<br />
Freundschaften veranlassten Bergthaler Familien<br />
dazu, Land zu mieten und zu bearbeiten oder auf<br />
Bauernhöfen und in den Mühlen der Pukhtin-<br />
Gegend zu arbeiten. Franz Harder (geb. 1829),<br />
ein Bergthaler der zweiten Generation, und seine<br />
Frau Elisabeth Schmidt, die in Chortitza<br />
aufgewachsen war, heirateten 1848. Dreizehn<br />
Jahre später zogen sie nach Silberfeld, wo sie<br />
Land und Gebäude mieteten. Sie betrieben hier<br />
acht Jahre Landwirtschaft und zogen dann in das<br />
Don-Gebiet, 200 Meilen östlich.<br />
1876, nachdem die letzten Mennoniten aus<br />
Bergthal ausgewandert waren, kehrten die<br />
Harders nach Pukhtin zurück, diesmal nach<br />
Gulaipole. Drei Jahre später schlossen sie sich<br />
einer Gruppe <strong>Molotschna</strong>-Familien an, die in die<br />
Vereinigten Staaten auswanderte, wo sie in<br />
Nebraska ansiedelten. Ihre Tochter Sara heiratete<br />
Cornelius Warkentin und zog 1891 nach Dallas,<br />
Oregon, und später nach Shafter, Kalifornien.<br />
Auswanderung.<br />
Achtzehn Familien aus Pukhtin schlossen<br />
sich der Auswanderung der Bergthaler nach<br />
Kanada in den 1870er Jahren an. <strong>Die</strong> meisten von<br />
ihnen waren junge Familien, die wahrscheinlich<br />
nach mehr Land suchten. Ein Vergleich von<br />
bekannten Pukhtin-Familien mit der<br />
Information im Schulregister von 1862 zeigt, dass<br />
viele aus Neuanlage kamen. Einige Familien<br />
waren jedoch vom Dorf Silberfeld (Gerhard<br />
Spenst) und eine aus dem Dorf Heinrichsfeld<br />
(Heinrich Loewen). Acht oder neun dieser<br />
Familien kamen 1875 und 1876 an und siedelten<br />
in der Ost-Reserve in den Dörfern Osterwick,<br />
Silberfeld und Großweide an. Weitere neun<br />
Familien kamen 1878 und, nachdem sie die<br />
Freunde aus ihrem Heimatdorf in Rußland<br />
besucht hatten, die jetzt in der Ost-Reserve<br />
wohnten, gründeten sie die Dörfer Neuanlage<br />
und Silberfeld in der West-Reserve, wohin ihnen<br />
ihre Freunde bald folgten.<br />
Schluss.<br />
In einem Brief von 1906 berichtet David<br />
Schellenberg etwas von dem Ruhestand jener<br />
ersten Pioniere und ihr unaufhörliches nostalgisches<br />
Interesse an ihre frühere Heimat in
Kapitel 58 Pukhtin - Schönfeld-Brazol<br />
Rußland-Pukhtin.<br />
"Ich möchte gern etwas von früheren<br />
Pukhtinern hören. Von denen, die von dort nach<br />
Kanada auswanderten, gehören mehrere nicht<br />
mehr zu den Lebenden. <strong>Die</strong> alten Peter Abrams<br />
leben noch und befinden sich bei ihrem Sohn<br />
Peter Abrams in Rosthern, Saskatchewan.<br />
Heinrich Abrams leben auch noch beide. Sie<br />
haben ihr Land ihren Kindern verkauft und<br />
wohnen in Halbstadt. <strong>Die</strong> alte Frau des Heinrich<br />
Löwen ist vor längerer Zeit gestorben. Er wohnt<br />
bei seinem Sohn Peter hier in Gretna. Jakob<br />
Hamm ist auch schon seit zehn Jahren tot; seine<br />
Frau wohnt bei ihrem Sohn Jakob in Didsbury,<br />
Alberta. <strong>Die</strong> alte Frau Klaassen ist seit vier Jahren<br />
sehr krank, kann kaum (?) und ist sehr schwach.<br />
Sie hat ihre Töchter Anna und Katharina bei sich;<br />
beide ledig. Kornelius Voths sind beide tot. Von<br />
den Jüngeren sind einige gestorben.<br />
"Nun, liebe Witwe Joh. Heinrichs, wo hältst<br />
Du Dich auf? Ich habe lange auf einen Brief von<br />
Dir gewartet, aber vergeblich. Wir bekamen kürzlich<br />
einen Brief aus Silberfeld, und die<br />
Nachrichten von dort sind traurig, obwohl<br />
Silberfeld selbst noch verschont worden ist. Ich<br />
muss auch berichten, dass wir unser Land<br />
unserem Sohn Peter Schellenberg, der bei uns<br />
wohnt und uns pflegt, vermietet haben."<br />
"David und Aga. Schellenberg, früher<br />
Pukhtin" (Rundschau, 21. März 1906).<br />
Was ursprünglich die lose definierte<br />
Siedlung von Pukhtin war, wurde später Teil der<br />
Schönfelder Wolost. Viele spätere mennonitische<br />
Schriftsteller schrieben nur von Schönfeld oder<br />
Schönfeld-Brasol.<br />
Endnoten:<br />
(1) B. Schellenberg "Unser Anfang in Manitoba",<br />
Mennonitisches Jahrbuch, 1954.<br />
(2) Rundschau, kurz vor dem 1. April 1881.<br />
(3) Rundschau, 15. July 1882, 3, Spalte 1.<br />
(4) Ein Brief von Neuanlage, Pukhtin, sagt, dass<br />
Gerhard Spenst von Silberfeld, Pukhtin, gekommen<br />
ist. Siehe Rundschau, 15. July 1882.<br />
(5) Blumenheim, Schönfeld und Blumenfeld<br />
werden in Verbindung mit Pukhtin-Gulaipole in<br />
P. M. Friesen, Bruderschaft, 589 und 896 erwähnt.<br />
(6) Anna Epp Ens, The House of Heinrich<br />
(Winnipeg 1980), Seite 84, erwähnt Rosenhof als<br />
Glied der Lichtenauer Gemeinde und bemerkt,<br />
351<br />
dass Kornelius Epp (1844-1916) dort wohnte.<br />
(7) Rundschau, 2. Januar 1901<br />
(8) "Eine Reise über Memrik, Anadol, Asow und<br />
Mariopoler Kreis, Apukhtin und Gnüden," in<br />
Zionsbote, Seite 27. Februar 1901.<br />
(9) Rundschau, 1. Februar 1883, Seite 3.<br />
(10) Aron A. Toews, Redakteur, Mennonitische<br />
Märtyrer der Jüngsten Vergangenzeit und der<br />
Gegenwart (Clearbrook, Band I 1949 und Band II<br />
1954).<br />
(11) Helen Koop Johnson, Tapestry of Ancestral<br />
Footprints (Lockport, Kanada 1995), Seiten 89-<br />
99.<br />
(12) Peter H. Enns, "Mein Eden: Erinnerungen aus<br />
meinem Leben", 66ff. MHCA, Band 650.<br />
(13) Rundschau, 2. Januar 1901, Seite 1,<br />
"Heinrichsfeld (später Alexandrowka)<br />
erloschen." <strong>Die</strong>s ist möglicherweise der vollständigste<br />
Bericht über die Anfangsgeschichte<br />
jedes Dorfes in der Pukhtin-Gemeinde.<br />
(14) Peter Brauns Archiv-Sammlung von<br />
Microfilmen in MHCA.<br />
(15) Siehe Cathy Barkman, "Heinrich Abrams<br />
1832-1910 and Family," in Preservings, Nr. 11<br />
Seite 76-78.<br />
(16) <strong>Die</strong>s mag Peter Friesen gewesen sein, der mit<br />
Anna Banman (A3 in John Dyck, editor,<br />
Bergthaler Gemeinde Buch (Steinbach 1993),<br />
Seite 13-14, bei dem im Pionier-Porträts" Nr. 58,<br />
Red River Valley Echo bemerkt ist, dass er aus<br />
Pukhtin gekommen ist. Es könnte aber auch der<br />
Peter Friesen gewesen sein, der in Abe Friesen,<br />
Nachkommen von Peter Friesen und Maria<br />
Rempel 1828-1994 (Steinbach 1994) beschrieben<br />
wird .<br />
(17) Enns, "Mein Eden", MHCA, Band 650.<br />
(18) Red River Valley Echo, "Pioneer Portraits,"<br />
Nr. 58.<br />
(19) Siehe Katherine Friesen Wiebe, "Osterwick",<br />
in John Dyck, editor, Historical Sketches of the<br />
East Reserve 1874-1910 (Steinbach 1994), Seite<br />
184-196.<br />
Anerkennung:<br />
<strong>Die</strong>ser Artikel ist verkürzt von John Dyck,<br />
"Pukhtin: A <strong>Molotschna</strong>-Chortitza Community,"<br />
in Adolf Ens, Jake E. Peters und Otto Hamm, editors,<br />
Church, Family and Village Essays on<br />
Mennonite Life on the West Reserve (Winnipeg<br />
2001), Seiten 25-40.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Heinrich Loewen (1823-1908), Heinrichsdorf<br />
<strong>Die</strong> Geschichte von Heinrich Loewen (1823-<br />
1908) ist typisch für die Pionier-Siedler von<br />
Pukhtin. Er ist in Blumenort, <strong>Molotschna</strong>, aufgezogen<br />
worden, dann hat er in Silberfeld gewohnt<br />
bis 1861. In diesem Jahr kaufte er ein Landgut wo<br />
er das Dorf Heinrichsdorf gegründet hat. 1876<br />
sind sie nach Kanada gezogen und siedelten in<br />
Rechts: <strong>Die</strong> Heinrich Loewen Familie,<br />
Heinrichsdorf, Russland, und später<br />
Silberfeld, West Reserve, Manitoba,<br />
Kanada, von links nach rechts: Katharina,<br />
Frau Sara Toews Loewen, Anna, Peter,<br />
Heinrich Loewen Sr., Heinrich Loewen Jr.<br />
und Jakob. Bill Loewen, Winnipeg,<br />
Gründer der Firma "Comcheq", ist der<br />
Enkel von Heinrich Loewens Sohn Peter.<br />
Foto mit freundlicher Genehmigung von<br />
Marvin Loewen, Winkler, Manitoba, zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
352<br />
Großweide, Ost-Reserve an. Später zogen sie nach<br />
Silberfeld, West-Reserve, Manitoba. Sie waren<br />
Glieder der Sommerfelder Gemeinde.<br />
<strong>Die</strong> Bilder und Information über die Heinrich<br />
Loewen Familie ist von Dolores Harder,<br />
Abbotsford, B. C., freundlicherweise zur<br />
Verfügung gestellt worden.<br />
Links: Ein Schönschreiben, dass Heinrich<br />
Loewen in der Schule in Blumenort, <strong>Molotschna</strong>,<br />
Oktober 1836, gemacht hat. Solche schöne<br />
Kunstarbeit wurde von Johann Cornies,<br />
Reformator, abgeschaft und verachtet. <strong>Die</strong><br />
Spuren der mennonitischen konfessionellen<br />
Schultradition sind in Büchern wie Tielemann<br />
Jansz von Braght, <strong>Die</strong>...für die Kinder der<br />
Christen geöffnete Tugend-Schule zum<br />
Gebrauch der in der Holländischen Sprache<br />
unkundigen Kindern aus dem Holländischen<br />
übergesetzt....,(K.P. 1743), 96 Seiten, zu finden.
Kapitel 58 Pukhtin - Schönfeld-Brazol<br />
Schönfeld Wolost<br />
SCHÖNFELD<br />
WOLOST<br />
Karte der Gegend der Schönfelder Wolost, gegründet 1873. Aus William Schroeder, Mennonite Historical<br />
Atlas (Winnipeg 1996), Seite 31.<br />
353<br />
W<br />
N<br />
S<br />
E
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Karte der Schönfeld, Naumenko und Memrik Gegenden, von Anna Epp Ens, The House of Heinrich<br />
(Winnipeg 1980), Seite 84.<br />
354<br />
W<br />
N<br />
S<br />
E
Kapitel 58 Pukhtin - Schönfeld-Brazol<br />
Der Anfang von Brazol - Schönfeld, 1868<br />
Johann B. Fast (1824-1906) war der Sohn von<br />
Bernhard Fast (1790-1854), Lichtenau, und Anna<br />
Warkentin (geb. 1798), Tochter von Johann<br />
Warkentin (1760-1825), Blumenort, <strong>Molotschna</strong><br />
(Seihe Kapital 37). Johann B. Fast sein Bruder<br />
Bernhard wohnte in Rosenort und hatte den<br />
Kosenamen, "Bauer Fast", um ihn von dem<br />
Schullehrer Bernhard Fast zuunterscheiden.<br />
Bernhard B. Fast hatte viel in die Mennonitische<br />
Rundschau geschrieben.<br />
Johann B. Fast wohnte mehrere Jahre in<br />
Münsterberg, <strong>Molotschna</strong>. Später war er einer<br />
der Gründer und Prediger der Schönfeld-Brazol<br />
Seidlung. Gerhard Toews, erzählt in seinem<br />
Buch Schönfeld Werde-und Opfergang, einer<br />
deutschen Siedlung in der Ukraine (Winnipeg<br />
1939), Seite 9-11, die spannende Geschichte, wie<br />
durch Johann B. Fast diese neue Siedlung zu<br />
Stande gekommen ist.<br />
Zur Zeit des Krimkrieges diente der<br />
Leutnant Dimitrij Nikonow Brasol in der russischen<br />
Armee. Da er einen Posten in der<br />
Intendantur bekleidete, kam er des Öfteren in<br />
Berührung mit den Kolonisten. Er kam in ihre<br />
Dörfer, während seiner Reisen zwecks Einkäufe<br />
für die Armee. Er traf die Kolonisten, wenn sie<br />
mit ihren Fuhrwerken in die Krim fuhren oder<br />
auf dem Heimwege waren. Mehreremale hatte<br />
Leutnant Brasol mit dem Mennoniten Johann<br />
Fast, aus Blumstein, geschäftlich zu tun. Fast<br />
hatte eine Schmiede und machte in dieser Zeit<br />
durch Brasol Warenlieferungen, Erzeugnisse<br />
seines Handwerks, an die russische Armee.<br />
Brasols Besitzungen lagen im<br />
Gouvernement Jekaterinoslaw, etwa 75 Werst<br />
von den mennonitischen Dörfern entfernt. Dort<br />
weideten seine großen Schafherden in der freien<br />
Steppe. Oft, wenn er durch die deutschen Dörfer<br />
fuhr und den Fleiß der Ansiedler sah, wie sie<br />
durch ihre Arbeit, durch die vielen<br />
Baumpflanzungen das Antlitz der Steppe<br />
änderten, dann kamen ihm wohl Gedanken an<br />
seinen Besitz und die baumlose Steppe zu<br />
Hause. Niemand hatte versucht, dort Bäume zu<br />
pflanzen und der Pflug hatte noch nur wenige<br />
Acker urbar gemacht. Der Acker aber war gut<br />
und harrte nur des Meisters. Dann sagte Brasol<br />
wohl zu Fast, als sie wieder eine Lieferung beredet<br />
hatten und der Leutnant sah, wie Fast im<br />
Schweiße seines Angesichtes sein Handwerk<br />
pflegte:<br />
,,Wie ihr Deutschen arbeitet! Und das beste<br />
Land habt ihr hier auch nicht in Händen. Ja,<br />
mein Land zu Hause...Ihr wißt ja nicht, was<br />
fruchtbarer Boden ist...''<br />
,,So,'' lächelte wohl Fast, ,,und wo mag das<br />
sein? Wohl dort, wo es 12 Monate im Jahr<br />
Winter?''<br />
Brasol schien den Spott nicht herauszuhören,<br />
oder wollte nicht. Seine Augen<br />
blickten versonnen ins Weite, das deutsche Dorf<br />
um ihn verschwand... ,,Weit kannst Du dort<br />
sehen. Unendlich scheint die Steppe und der<br />
Wind spielt im hohen Grase. Flüsse sammeln die<br />
Wasser ringsum und tragen sie dem alten Dnjepr<br />
zu. Kaum ist...Raum...Doch was spreche ich zu<br />
einem Deutschen von Raum. Ihr seit es ja<br />
gewöhnt zusammengepfercht in euren Dörfern<br />
zu sitzen. Ihr Deutschen! Mir aber gib die<br />
Steppe, die weite, weite unendliche Steppe...''<br />
Fast wußte nicht recht, sollte er sich ärgern,<br />
sollte er lachen. Dimitrij Nikonow hatte verschiedene<br />
Launen zu verschiedenen Zeiten.<br />
- So ein Russe, nun sehnt er sich nach seiner<br />
wilden Steppe - dachte der Deutsche. Laut aber<br />
sprach er:<br />
,,Was soll das heißen, Dimitrij Nikonow:<br />
gewöhnt zusammengepfercht zu werden. Was<br />
sollten wir sonst, wenn wirs nicht wollten. Was<br />
sollte ich in der Wildernis der Steppe.''<br />
Brasol antwortete nicht und fuhr, in<br />
Gedanken versunken, ab. - Jetzt wird er sich das<br />
Heimweh vertreiben - dachte Fast und ging an<br />
seine Arbeit.<br />
Später bei einer anderen Gelegenheit kam<br />
Brasol wieder auf seine Steppe zu reden:<br />
,,Wenn's dir hier mal zu enge wird, dann<br />
komm zu mir, ich verkaufe dir ein Stück Land,<br />
daß du nicht mal übersehen kannst.''<br />
,,Wo ist es denn, dieses Land, Dimitrij<br />
Nikonow?''<br />
Da beschrieb ihm der russische Leutnant<br />
den Weg zu seinem Besitz und fügte hinzu:<br />
,,Also, wenn es dir zu enge wird, dann komm<br />
355
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
hin.''<br />
Plötzlich lachte er auf:<br />
,,Vielleicht ist es mir bis dann auch leid<br />
geworden, oder ich hab das ganze Land verkloppt.<br />
Wir sind ja so: heute ist's und morgen:<br />
heidi, hast es gesehen. So wie mit dem Chonuk.<br />
Sitzen wir und spielen, du weißt ja wie es bei uns<br />
ist - leichtsinnig sind wir, Gott sei's geklagt.<br />
Doch wer kann es ändern, sind mal so gebaut,<br />
liegt uns im Blut. Also wir spielen. Der Chonuk<br />
ist bei mir in der Kreide, nicht im Kleinen.<br />
Plötzlich wird er ernst. - Hör Dimitrij Nikonow,<br />
alles oder nichts. Dort ist mein Land, die<br />
Solonaja entlang, ich setz es gegen meine<br />
Schuld: Pan oder Propal. Willst - Ich tats. Es war<br />
für Chonuk propal und für mich Pan. Schicksal!<br />
Und wenn du mal kommst, vielleicht verkauf ich<br />
dir das Chonukowsche Land, wenn ich bis dahin<br />
nicht auch schon Propal bin. Nun, mit<br />
Gott!''<br />
Der Krimkrieg war aus. Brasol fuhr zu<br />
seinen Schafen und Leibeigenen. Fast werkte<br />
weiter um sein Fortkommen. Jahre gingen<br />
und Jahre kamen. Wenn Fast mal in<br />
Gedanken in den Norden blickte, dachte er<br />
auch an den Leutnant Brasol und ein<br />
Lächeln ging ihm übers Gesicht.<br />
Inzwischen hob der Zar-Befreier die<br />
Leibeigenschaft auf. Der russische Bauer<br />
wurde sein eigener Herr. Dann dachte Fast<br />
wohl wieder an seinen Freund Brasol: was er<br />
jetzt wohl ohne sein menschliches Vieh tun<br />
würde, ob er jetzt noch immer Pan sei? Fast<br />
eröffnete inzwischen einen Laden in<br />
Lichtenau.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kolonie</strong> aber wurde voller, enger,<br />
schon mancher suchte freieres Gelände. In<br />
die Krim zogen mennonitische Siedler. Neue<br />
Dörfer entstanden dort. Je älter das 7.<br />
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurde, desto<br />
öfter kam Fast der Pan Brasol in den Sinn.<br />
Aus Gedanken wurden Worte. Er sprach mit<br />
Cornelius Friesen. Sie redeten hin, sie redeten<br />
her. Andere fanden sich, die diesem<br />
Gerede ein williges Ohr gaben. Aus Spaß, aus<br />
Lachen, wurde Ernst.<br />
,,Wir gehen nach dem Norden. Dem<br />
Mutigen gehört die Welt. Es ist ja auch nicht<br />
so sehr weit. Was in der <strong>Kolonie</strong> die Pioniere<br />
konnten, das können wir auch auf neuem<br />
Land.'' So gingen die Kundschafter zum Pan<br />
Brasol. Leutnant Dimitrij Nikonow Brasol fand<br />
die freie Steppe ohne seine Leibeigenen nicht<br />
mehr so köstlich. Sie wurde ihm zu weit, die<br />
unendliche. Verkloppt hatte er seinen Besitz<br />
auch noch nicht. <strong>Die</strong> deutschen Kolonisten<br />
kamen ihm wie gerufen. Sie wurden handelseinig:<br />
der russische Edelmann und die deutschmennonitischen<br />
Siedler. <strong>Die</strong> Urkunden über den<br />
Kauf des Landes wurden unterzeichnet. Das<br />
Handgeld wurde an Brasol bezahlt. So entstand<br />
im Anfang eine neue deutsch-mennonitische<br />
Ansiedlung in der Steppe des Alexandrowsker<br />
Kreises des Gouvernements Jekaterinoslaw, die<br />
Ansiedlung Schönfeld. Als der Handel zwischen<br />
den Deutschen und Brasol abgeschlossen<br />
wurde, schrieb man das Jahr 1868.<br />
Johann B. Fast, einer der Gründer von Schönfeld - Brazol.<br />
Foto aus Quiring und Bartel, Seite 101.<br />
356
Kapitel 58 Pukhtin - Schönfeld-Brazol<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaft von<br />
Neufeld in Schönfeld -<br />
Brazol. <strong>Die</strong> Gäste mit<br />
ihrem Verdeckwagen<br />
sind "vorgefahren". Foto<br />
aus Quiring und Bartel,<br />
Seite 96.<br />
357<br />
Beim Dreschen in<br />
der Schönfeld -<br />
Brazol Gegend.<br />
Foto aus Quiring<br />
und Bartel, Seite<br />
96.<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaft von<br />
Neufeld in<br />
Schönfeld - Brazol.<br />
Wahrscheinlich ist<br />
es ein Bild von den<br />
russischen Arbeiter<br />
des Bauers Neufeld.<br />
In der Mitte stehen<br />
zwei Männer in<br />
Uniform, die vielleicht<br />
Kosaken sind,<br />
die von den Bauern<br />
m a n c h m a l<br />
angenommen wurden,<br />
um ihre<br />
Wirtschaften zu<br />
überwachen. Foto<br />
aus Quiring und<br />
Bartel, Seite 96.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaft von Klaas Thiessen, Schönfeld - Brazol. Klaas Thiessen war ein Schwiegersohn zu Kornelius<br />
Friesen der 1869 nach Schönfeld zog. Siehe Rudy Friesen, Descendants of Cornelius Friesen, (Headingly,<br />
Manitoba 1986), Seite 16. Foto aus Quiring und Bartel, Seite 100.<br />
358<br />
<strong>Die</strong> Schule in<br />
Münsterhof,<br />
Schönfeld - Brazol.<br />
Foto aus Quiring<br />
und Bartel, Seite<br />
100.<br />
<strong>Die</strong> Zentralschule in<br />
Schönfeld. Foto aus<br />
Quiring und Bartel,<br />
Seite 100.
Kapitel 58 Pukhtin - Schönfeld-Brazol<br />
David Peter Dyck (geb. 1852) ist 1885 als<br />
Gebietsschreiber angestellt worden. Er hatte manche<br />
Schwierigkeiten überwältigen müßt. 1906 wurde das<br />
neue Gebietsamt-Gebäude gebaut, zugleich mit der<br />
Wohnung für den Schreiber. Foto aus Gerhard Toews,<br />
Schönfeld,Seite 26.<br />
359<br />
Abraham Driedger und Familie, 1891. Er war der<br />
erste Oberschulze der Schönfeld Wolost. In den<br />
Jahren 1968 bis 1972 diente sein Ururenkel,<br />
Albert Driedger als Reeve (Oberschulz) der Rural<br />
Municipality (Bezirk) von Hanover, Manitoba,<br />
Kanada und später als Verkehrsminister der<br />
Regierung Manitobas in den 1990er Jahren. Foto<br />
aus Quiring und Bartel, Seite 101.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Heinrich Epp (1872-1921), Sohn von<br />
Kornelius, wird 1918 von den Machnowzen<br />
beraubt. Später wird er verbannt und 1921<br />
ist er in Tarashcha an Typhus und Hunger<br />
gestorben. Er ist auf seinen Knien tot gefunden<br />
worden. Seine Frau wurde nach Sibirien<br />
verbannt. Später konnte sie zurückt nach<br />
Chortitza und mit dem Treck nach<br />
Deutschland flüchten, wo sie 1944 starb.<br />
Foto aus Anna Epp Ens, House of Heinrich,<br />
Seite 83.<br />
360<br />
Kornelius Epp (1844-1916) war ein<br />
wohlhabender Gutsbesitzer in Rosenhof,<br />
Schönfeld - Brazol mit 1683 Desijatin<br />
Land, einer Ziegelfabrik und anderen<br />
Geschäften. Er war auch Prediger.<br />
Kornelius Epp war in Rosenort,<br />
<strong>Molotschna</strong>, aufgezogen. Er war ein<br />
Uhrgroßsohn von Peter Epp (1725-1789),<br />
Danzig. Foto aus Anna Epp Ens, House of<br />
Heinrich (Winnipeg 1980), page 83.
Kapitel 58 Pukhtin - Schönfeld-Brazol<br />
Johann Dueck (1857-1914), Oberschulz der Schönfeld Wolost von 1897 bis 1909. Seine erste Frau war die<br />
Tochter von Abraham Driedger, den ersten Oberschulze. Als sie 1889 starb hat seine Schwiegermutter ihren<br />
Sohn besorgt. Als Johann ein paar Monate später ihn besuchen kam, hat seine Schwiegermutter ihm<br />
gesagt, "Johann fing die mohl nie Fru, eck sie tu olt tum die junge hingaraun ranie." Er bekamm den Rat<br />
nach die <strong>Molotschna</strong> zu fahren, da waren viele "alte Merjallis". Zwei Monate später kam er zurück mit<br />
eine neue Frau, sie war 26 und er war 34. Johann war ein guter Bauer. Am 18. Oktober 1914 ist er gestorben.<br />
Auf dem Bild sehen wir seine Familie bei seinem Sarg. Foto aus Johnson, Tapestry of Ancestral Prints<br />
(Lockport, 1995), Seite 117.<br />
Ein Begräbnis auf dem Hof des Predigers J. L. Dyck, Schönfeld. <strong>Die</strong> Trauernden sind gerade bereit zum<br />
Friedhof zu gehen mit den Gebeinen des Gestorbenen. Mann merkt hier, wie die Begräbnissitten sich von<br />
der alten Zeit geändert haben. Vergleiche mit Seite 85. Foto aus Quiring und Bartel, Seite 100.<br />
361
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
<strong>Die</strong> Schönfeld - Brasol Ansiedlung<br />
Brasol.<br />
Brasol, eine mennonitische Ansiedlung im<br />
Kreis Alexandrowsk, nördlich von Berdjansk im<br />
russischen Gouvernement Jekaterinoslaw. <strong>Die</strong><br />
Ansiedlung setzt sich aus einer großen Anzahl<br />
kleiner Ortschaften und Güter zusammen, die seit<br />
etwa 1868 durch den Ankauf von privaten<br />
Ländereien gegründet wurden. Insgesamt zählt sie<br />
etwa 75 000 ha Land mit 400 Familien und 2000<br />
Einwohnern. <strong>Die</strong> wichtigsten Ortschaften sind 1.<br />
Schönfeld [später Krasnopol], in dem sich die<br />
Wolostverwaltung (Bezirk) befindet, dazu eine<br />
Kirche, eine Volksschule und eine Zentralschule<br />
nach dem Muster der <strong>Molotschna</strong>er (gegründet<br />
nach 1905); 2. Blumenfeld mit Kirche und Schule;<br />
3. Blumenheim mit Kirche und Schule; 4. Rosenhof<br />
mit Kirche und Schule. In kirchlicher Beziehung<br />
gehören die meisten Bewohner der<br />
Kirchengemeinde Lichtenau-Petershagen<br />
(Halbstädter Bezirk) oder den Gemeinden an, aus<br />
denen sie hervorgegangen sind.<br />
Aus Mennonitisches Lexikon, Band I., Seite 256.<br />
Schönfeld.<br />
Schönfeld, ehemalige mennonitische<br />
Siedlung in Rußland im Kreis Alexandrowsk,<br />
Provinz Jekaterinoslaw. Mittelpunkt der Siedlung<br />
war ein Gut von ca. 5665 ha, das dem<br />
Großgrundbesitzer D. N. Brasol am 20. Juli 1868<br />
abgekauft wurde. <strong>Die</strong>ses Land lag nördlich der<br />
Siedlung <strong>Molotschna</strong> und östlich von Chortitza<br />
und wurde zum Unterschied zu den meisten<br />
Siedlungen in Rußland vorwiegend von<br />
Privatpersonen gekauft. Es war über einen großen<br />
Bezirk zerstreut und durch Siedlungen anderer<br />
Deutscher und Russen unterbrochen. Nur wenige<br />
Dörfer glichen dem traditionellen Muster.<br />
Im Jahre 1869 wurde weiteres Land von dem<br />
Edelmann Tschonuk erworben. Wie im ersten Falle<br />
kamen die Siedler von der <strong>Molotschna</strong>. Zwei<br />
Familien, Kornelius und Peter Epp, kamen direkt<br />
aus Preußen und kauften den huterischen<br />
Bruderhof Kowalitscha, dessen Bewohner in die<br />
Vereinigten Staaten auswanderten. <strong>Die</strong> gesamte<br />
Siedlung trug den Namen Schönfeld, gelegentlich<br />
auch Brasol.<br />
Im Jahre 1885 kauften weitere Siedler ein Gut<br />
von 590 ha von dem Eigentümer Samojlenko. <strong>Die</strong>se<br />
Siedlung erhielt den Namen Schönbrunn. Durch<br />
weitere Ankäufe entstand 1855 bis 1875 die Siedlung<br />
Rosenhof mit den Gütern Rosenhof, Tiegenhof,<br />
Blumental, Solenaja, Hochfeld, Schönberg, Bergtal,<br />
Olejew und Krukow. <strong>Die</strong> Siedler kamen von der<br />
362<br />
<strong>Molotschna</strong> und aus Chortitza. Zwischen 1875 und<br />
1879 wurden die Dörfer Blumenheim und<br />
Kronberg, sowie das Gut Eichental von Siedlern aus<br />
der <strong>Molotschna</strong> gegründet. Ein Dorf namens<br />
Silberfeld war schon früher in der Nähe der Station<br />
Pologi gegründet worden.<br />
Laut Statistik von Gerhard Töws bestand die<br />
Siedlung aus 202 Bauernhöfen, 53 756 ha Land und<br />
einer Einwohnerzahl von 1 056 Personen. <strong>Die</strong> von<br />
den Siedlern benutzten Bahnstationen waren<br />
Gaitschur, Metschetnaja, Obschaja und Gulaj Pole.<br />
<strong>Die</strong> Siedlungen hatten 14 Grundschulen und<br />
eine Zentralschule, die 1907 von den Mennoniten<br />
gegründet und von diesen unterhalten wurde. Der<br />
erste Lehrer der Zentralschule war Hermann A.<br />
Rempel. Im ersten Jahr erfolgte der Unterricht in der<br />
Schönfelder Volksschule. Als zweiter Lehrer wurde<br />
Jakob J. Dueck angestellt. Im Herbst 1909 konnte<br />
das ansehnliche Gebäude der Zentralschule bezogen<br />
und als dritter Lehrer Abram P. Toews angestellt<br />
werden. Franz Ediger wurde Nachfolger von<br />
Hermann Rempel und G. Schröder von Abraham<br />
Toews. Später wirkten dort als Lehrer: Aron Rempel,<br />
Heinrich Neufeld, Peter Sawatzky, Susanna Loewen,<br />
Helena Fröse, Jakob Thiessen und Jakob Neufeld.<br />
Zuerst besuchten nur Jungen die Schule, später<br />
wurden auch Mädchen zugelassen. Für Lehrer wurden<br />
zwei weitere Wohnungen erbaut.<br />
<strong>Die</strong> Mennonitengemeinde zu Schönfeld<br />
wurde 1868 gegründet. Zweiggemeinden befanden<br />
sich in Rosenfeld und Blumenfeld. <strong>Die</strong> Gemeinden<br />
blieben abhängig von der Muttergemeinde<br />
Lichtenau-Petershagen in der <strong>Molotschna</strong>. Der<br />
Älteste der Gemeinde hielt Tauf- und<br />
Abendmahlsgottesdienste. Älteste waren Jakob<br />
Töws und Bernhard Epp. Während der Revolution<br />
wurde die Gemeinde von dem Ältesten Johann<br />
Klassen, Schönwiese, bedient.<br />
Im Jahre 1883 wurde in Schönfeld die erste<br />
Kirche errichtet. Vorher hatten die Gottesdienste in<br />
einem alten Gebäude stattgefunden. <strong>Die</strong><br />
Gemeinden Rosenhof und Blumenfeld hatten ihre<br />
eigenen Kirchen. Verschiedentlich wurden<br />
Andachten auch in Privathäusern abgehalten. Im<br />
Jahre 1905 betrug die Seelenzahl der Schönfelder<br />
Gemeinde 585, wovon 276 getauft waren. <strong>Die</strong> beiden<br />
andern Gemeinden zählten zusammen 178<br />
Seelen, davon 90 getaufte.<br />
Der erste Prediger war Peter Neufeld, der am<br />
12. Januar 1873 gewählt wurde und 1898 starb.<br />
Weitere Prediger waren: Kornelius Epp (1845-1916)<br />
und Jakob Enns, gleichzeitig Reiseprediger. Jakob<br />
D. Dück (1852-1922) wurde am 1. März 1881 zum
Kapitel 58 Pukhtin - Schönfeld-Brazol<br />
Prediger gewählt. Als er im Jahre 1888 nach<br />
Schönfeld kam, wurde er leitender Prediger.<br />
Gerhard Töws (1861-1924) wurde 1892 Prediger der<br />
Gemeinde. Johann Driedger (geb. 1871), der heute<br />
noch (1959) in Kanada lebt, wurde 1909 zum<br />
Prediger gewählt. Nikolai Thiessen und Johann<br />
Hübert, Missionare in Java, stammten aus der<br />
Schönfelder Mennonitensiedlung. <strong>Die</strong> Schönfelder<br />
Kirche wurde 1920 zerstört.<br />
<strong>Die</strong> Mennoniten der zerstreut liegenden<br />
Siedlung erhielten nach ausgedehnten<br />
Verhandlungen im Jahre 1873 das Recht der<br />
Selbstverwaltung. Der erste leitender<br />
Gebietsschreiber war Peter Harder. <strong>Die</strong> Verwaltung<br />
wurde als "Schönfelder Wolost" bekannt. Dazu<br />
gehörten nachstehende Dörfer: Schönfeld,<br />
Silberfeld, Blumenheim, Kronberg, Rosenhof und<br />
Blumenfeld. Schönfeld lag in der Mitte dieser<br />
Siedlung, einige Dörfer ca. 30 km entfernt. Folgende<br />
Männer waren "Oberschulzen" der Siedlung:<br />
Abraham Driedger, Johann Cornies, Johann Dück<br />
und Heinrich Wiens. Gebietsschreiber waren: Peter<br />
Harder und David B. Dück. Im Jahre 1902 wurde ein<br />
neues Steingebäude für die "Schönfelder Wolost"<br />
errichtet.<br />
<strong>Die</strong> Schönfelder Siedlung bestand hauptsächlich<br />
aus Bauernfamilien, doch entwickelte sich auch<br />
ein großes Netz von Industrien. In Rosenhof<br />
betrieben Kornelius Epp und Abraham A. Sawatzky<br />
Ziegeleien. In Schönfeld bestanden eine Anzahl<br />
weiterer Ziegeleien. Später entstanden in allen<br />
Bezirken Mühlen, die auch von der umgebenden<br />
russischen Bevölkerung benutzt wurden. Schönfeld<br />
Frau Thomas Wiens, Gutsbesitzerin. Sie wurde<br />
nahe dem Grichino-Bahnhof 22. September, 1919,<br />
zusammen mit einem von ihren Söhne von den<br />
Banditen (Anarchisten) ermordet. Foto aus John P.<br />
Nickel, Redakteur, Hope Springs Eternal,Seite 173.<br />
363<br />
Nestor Machno (1887-1934), ein Anarchist. Foto<br />
aus John P. Nickel, Redakteur, Hope Springs<br />
Eternal (Nanaimo, B.C., 1988), Seite 171.<br />
hatte eine Wagenfabrik und andere Fabriken, eine<br />
Gießerei und zwei Ölpressen. An der Station<br />
Sofijewka besaß Heinrich Neufeld eine Fabrik für<br />
landwirtschaftliche Maschinen. Außerdem waren in<br />
den Dörfern zahlreiche Geschäfte eröffnet worden.<br />
<strong>Die</strong> jährlichen Ausstellungen wurden von nah und<br />
fern besucht.<br />
Auf landwirtschaftlichem Gebiet züchteten die<br />
Mennoniten Schafe, Kühe, Schweine und Pferde.<br />
Um die Jahrhundertwende war der harte<br />
Winterweizen allgemein eingeführt. Auf gesundheitlichem<br />
Gebiet wurden die Siedler von den traditionellen<br />
"Knochenärzten", Hebammen und<br />
Heilpraktikern bedient. Vor dem ersten Weltkrieg<br />
standen einige ausgebildete Ärzte zur Verfügung.<br />
Während des Ersten Weltkrieges und der<br />
Revolution litt diese Siedlung ähnlich den andern.<br />
Vorübergehend war sie von der deutschen Armee,<br />
dann von der Weißen und schließlich von der Roten<br />
Armee besetzt. Dabei löste sich die Siedlung nach<br />
und nach auf. Während der chaotischen Jahre 1918-<br />
1920 plünderten die Banditen aus der Umgebung<br />
die Dörfer und Höfe und töteten viele Einwohner.<br />
<strong>Die</strong> Übriggebliebenen flohen in die nächsten<br />
Siedlungen. Nach der Festigung der Sowjet-<br />
Regierung kehrten manche zu ihren Besitzungen<br />
zurück. Viele Häuser waren zerstört. <strong>Die</strong> Bewohner<br />
teilten das Schicksal der anderen<br />
Mennonitensiedlungen. Einige wurden in die<br />
Verbannung geschickt, andere sind nach Kanada<br />
oder Süd-Amerika ausgewandert.<br />
Aus Mennonitisches Lexikon, Band. IV., Seiten<br />
87-88.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Schönfeld Dorf<br />
N<br />
E<br />
W<br />
S<br />
Brasol-Reihe<br />
Gorkaja Fluss<br />
Grenz Weg<br />
364<br />
Soljonaja Fluss<br />
Chonuk-Reihe<br />
Friedhof<br />
Terse Fluss<br />
Karte der Schönfeld Gegend, ca. 1912. Gezeichnet ist die Brazol-Reihe und die Chonuk-Reihe mit Namen der Eigentümer der Chutors. Jedes<br />
Grundstück hatte einen langen schmalen Landstreifen, ausgelegt nördlich und südlich, zwischen dem Grenzweg (Mitte) und der äußeren<br />
Grenze der Siedlung. Im Fenster, oben rechts, das Dorf Schönfeld. <strong>Die</strong>se Karte ist nach Kanada von Heinrich B. Wiens, Leamington, Ontario,<br />
mit gebraucht worden. Mit freundlicher Genehmigung von der Mennonite Heritage Centre, 600 Shaftesbury Blvd., Winnipeg, Manitoba,<br />
Kanada, RR3P 0M4. <strong>Die</strong>se Karte ist auch in G. Schroeder, Miracles of Grace and Judgment,Seite 261, gedruckt.
Kapitel 59 Nestor Machno 1889-1934 - Ein Anarchist<br />
"...Nestor Iwanowitsch Michnenko wurde<br />
am 27. Oktober 1889 im Dorf Guljai-Pole<br />
geboren. Der Name Machno, unter dem er<br />
bekannt wurde, war eine Abkürzung des väterlichen<br />
Familiennamens. Machnos Vater war<br />
noch als Leibeigener geboren. Als er starb, hinterließ<br />
er seine Witwe und vier minderjährige<br />
Söhne, von denen der jüngste, Nestor, erst 10<br />
Monate alt war. <strong>Die</strong> drei Brüder von Nestor<br />
wuchsen auch als Revolutionäre und<br />
Anarchisten auf...<br />
"...Weil die Familie arm war, musste Nestor<br />
bereits als sieben-jähriger Junge für die<br />
Dorfbauern Schafe und Kühe hüten. Mit acht<br />
Jahren begann er die Volksschule. Nach<br />
Beendigung dieser Schule arbeitete Machno bei<br />
den deutschen Großbauern und auf den Gütern<br />
der Großgrundbesitzer in der Umgebung von<br />
Guljai-Pole. Später verrichtete er Schwarzarbeit<br />
in seinem Heimatdorf in der Gießerei der<br />
Kröger-Fabrik. <strong>Die</strong> Löhne waren niedrig, und<br />
Machnos Familie blieb arm. Aber vielleicht<br />
vergeudeten sie auch ihr niedriges Einkommen...<br />
"...Während der Revolution 1905-06 gewann<br />
der Anarchismus seine ersten Anhänger auch in<br />
Guljai-Pole. Der Grundsatz der Anarchisten war:<br />
Der zerstörende Geist ist ein schöpferischer<br />
Geist. Für diese Tätigkeit brauchten sie Geld. <strong>Die</strong><br />
Gruppe in Guljai-Pole bestand zuerst aus 10<br />
Männern und war mit Revolvern versorgt...<br />
"...Nach einem Überfall auf einen<br />
Postwagen wurden die Täter mehrere Jahre<br />
gesucht. Einer von ihnen war Machno. Er wurde<br />
später gefasst und zu lebenslänglicher<br />
Zwangsarbeit verurteilt. Doch musste er acht<br />
Jahren im Butyrka-Gefängnis in Moskau verbringen,<br />
aus dem er 1917 befreit wurde. So schwer<br />
und hoffnungslos das Leben in der Butyrka auch<br />
war, dennoch bemühte sich Machno ständig,<br />
seinen dortigen Aufenthalt zur Förderung seiner<br />
Bildung zu benutzen. Er lernte russische<br />
Grammatik, Mathematik, russische Literatur,<br />
Kulturgeschichte und Volkswirtschaft. <strong>Die</strong>se<br />
"Katorga" (Zuchthaus) war die einzige Schule, in<br />
der Machno seine historischen und politischen<br />
Kenntnisse erwarb, die ihm später in seinem revolutionären<br />
Leben eine große Hilfe waren. Der<br />
Aufenthalt in der "Katorga" hatte andererseits<br />
365<br />
aus Machno ein grausames Tier gemacht. Nach<br />
dem Kaisersturz 1917 kam Machno frei und<br />
kehrte in sein Heimatdorf zurück...<br />
"...Als Anarchist empörte er sich über die<br />
bürgerliche Entwicklung in seinem Dorf. Er setzte<br />
sich mit dem neuen Dorfrat auseinander,<br />
dass die Anarchisten keine neue Ordnung<br />
brauchten. Es endete mit einem Boykot der<br />
Anarchisten, die einen neuen Bauernsowjet<br />
gründeten, und Nestor Machno wurde als<br />
Vorsitzender gewählt...<br />
"...Schon im August 1917 war Machno so<br />
stark, dass er von allen Gutsbesitzern,<br />
wohlhabenden Bauern und sonstigen<br />
Unternehmern des Rayons Auskünfte und<br />
Urkunden über ihre Ländereien, ihren Besitz<br />
und ihre Inventare verlangte. Angrenzend an der<br />
Guljai-Pole Wolost lag die deutsch-mennonitische<br />
Schönfelder Wolost. Sie umfasste<br />
wohlhabende Dörfer und Gutsbesitzer: Jakob<br />
Neufeld, Gerhard Klassen, David Schröder,<br />
Wilhelm Janzen und andere. Besonderen<br />
Gefallen hatten Machno und seine Anhänger an<br />
den Federwagen. Er freute sich, wenn Häuser<br />
brannten. Seine Augen glänzten, wenn auf der<br />
Straße eine Schießerei entstand. Es gefiel ihm,<br />
den qualvollen Tod eines unschuldigen<br />
Menschen mit anzusehen. Als man eines Tages<br />
eine Gruppe erschreckter Leute zu ihm brachte,<br />
schrie er: ,,Zerhackt sie alle". Und es geschah<br />
auch so. Das Ergebnis: anstelle lebendiger<br />
Menschen ein Haufen verstümmelter, blutiger<br />
Leichen; Köpfe lagen herum und Hände mit<br />
gekrümmten Fingern. Machno, der diese<br />
Tatsache mit einem Lächeln ansah, sprang plötzlich<br />
auf den Leichenhaufen und trampelte auf<br />
den Leibern der Toten herum. Eine Minute<br />
später sagte er: ,,Das war es". Menschliche<br />
Gefühle hatte Machno nicht. Nichts beeindruckte<br />
ihn, weder Tränen der Mütter noch das<br />
Weinen der Kinder noch ein Schwur der Männer.<br />
Unter allen Atamanen der Ukraine war Machno<br />
der grausamste...<br />
"...Am schwersten haben die <strong>Kolonie</strong>n<br />
Sagradowka, Chortitza und ihre Tochterkolonie<br />
Nikolaifeld, Jasykowo <strong>Kolonie</strong>, gelitten. <strong>Die</strong> neue<br />
ukrainische Regierung unterzeichnete einen<br />
Sonderfrieden mit den Mittelmächten.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
"...Um die Ukraine vor einer bolschewistischen<br />
Okkupation zu schützen, lud sie deutsche<br />
und österreichisch-ungarische<br />
Besatzungstruppen ins Land ein. <strong>Die</strong><br />
Machnobewegung zerstreute sich schlagartig.<br />
Machno floh nach Moskau. Er verbrachte die<br />
Zeit bis zu seiner Heimkehr bei einer Familie<br />
Arschinow. In dieser Zeit konferierte er mit einigen<br />
hohen Regierungsleuten, unter anderen<br />
auch mit Lenin. Lenin lobte seine Tätigkeit in<br />
Guljai-Pole und erklärte sich bereit, Machno zu<br />
helfen, allerdings nur in der besetzten Ukraine.<br />
Lenin veranlasste, dass Machno ein falscher<br />
Personalausweis ausgestellt wurde, in dem er<br />
,,Iwan Jakowlewitsch Schepelj" genannt wird.<br />
Mit diesem Pass kehrte er in die Ukraine<br />
zurück...<br />
"...Seit Juli 1918 war Machno wieder in<br />
Guljai-Pole. Hier angekommen, schuf Machno<br />
die ,,Machnobewegung", die gegen die<br />
Sowjetregierung gerichtet war. Der Grundsatz<br />
dieser Bewegung lautete: jeden Gutsbesitzer,<br />
jeden Milizionär, jeden Offizier, jeden, der an der<br />
Bedrückung der armen Bauern und Arbeiter<br />
teilgenommen hatte, ohne weiteres umzubringen.<br />
Als Ende 1918 der deutsche Rückzug<br />
befohlen wurde, die Regierung der Ukraine fiel,<br />
war der ganze südukrainische Raum der Willkür<br />
der Machnowzy ausgeliefert. Wenn Machno eine<br />
Stadt besetzte, wurde alles geraubt, was auf<br />
Bauernwagen fortgeschafft werden konnte; er<br />
selbst behielt das Wertvollste für sich...<br />
"...Auch die andere Seite dieser Bande sollte<br />
hier erwähnt werden. Das Lagerleben, der<br />
Mangel an Seife und sanitären Einrichtungen<br />
trugen dazu bei, dass sich ansteckende<br />
Krankheiten seuchenartig verbreiteten.<br />
Besonders Typhus und Durchfall wirkten verheerend.<br />
Da die Armee keine Lazarette hatte,<br />
blieben die kranken Machnowzy in den<br />
Häusern, in denen sie einquartiert waren, und<br />
übertrugen ihre Krankheiten auf die<br />
Dorfbewohner. Es entstanden<br />
Ernährungsprobleme. <strong>Die</strong> Männer waren zu<br />
schwach, um die Toten zu begraben. Es folgte<br />
eine Hungersnot, die viele Opfer forderte...<br />
"...Obwohl Machno große Verluste in seiner<br />
Armee hatte, füllten sich seine Reihen immer<br />
wieder mit neu hinzukommenden Rekruten. Ihr<br />
Banner blieb die schwarze Fahne. Machnos<br />
366<br />
Gnadenfrist in Guljai-Pole war nur kurz. Bald<br />
war der Raum um die Ortschaft von Einheiten<br />
der Roten Armee eingeschlossen. Mit großer<br />
Mühe gelang es Machno, aus der Umzingelung<br />
auszubrechen. Mit einem kleinen Gefolge irrte er<br />
in den Wäldern und Flussniederungen umher.<br />
Verwundet und von Hunger und Durst gepeinigt,<br />
erreichte Machno die rumänische Grenze...<br />
"...Am 28. August 1921 überquerte er den<br />
Dnestr und kehrte Russland für immer den<br />
Rücken. Zuerst war er in Rumänien in Sicherheit.<br />
<strong>Die</strong> rumänische Regierung gewährte ihm und<br />
seiner Frau vorläufiges Asyl und erlaubte ihnen,<br />
in Bukarest in einer Privatwohnung zu leben,<br />
während seine Anhänger in Lagern interniert<br />
waren. Am 11. April 1922 wurde er von der<br />
rumänischen Regierung gezwungen, das Land<br />
zu verlassen, und er begab sich daraufhin nach<br />
Polen..."<br />
1923 verließ er auch Polen und wanderte<br />
nach Danzig, später nach Berlin. Hier kam er in<br />
das Krankenhaus. Bei ihm wurde Tuberkulose<br />
festgestellt. Von Berlin kam er nach Paris. Hier<br />
fand er seinesgleichen und wurde in eine<br />
Anarchistenfamilie aufgenommen. Machno<br />
starb am 25. Juli 1934 in Paris.<br />
Auszug aus Victor Peters, Nestor Machno<br />
(Winnipeg, Kanada k.d.), 139 Seiten.<br />
Bemerkungen: Wadim Telizin schreibt in seinem<br />
Buch Nestor Machno (Moskau 1998): "Machnos<br />
Gestalt muss man nicht unbedingt idealisieren, er<br />
ist kein Robin Hood (die Machnobewegung hat<br />
300 000-400 000 Menschenleben auf dem<br />
Gewissen- das war der Preis eines neuen<br />
Experiments), aber er ist auch kein Monster,<br />
dessen grausame Eigenschaften die offizielle sowjetische<br />
und die linke westeuropäische Presse<br />
(und danach auch die russische<br />
Geschichtswissenschaft) ihm zulegen wollten. Er<br />
ist ein Produkt jener Epoche, in der alles - vom<br />
Höchsten bis zum Lächerlichsten, vom<br />
Naivsauberen bis zur Gemeinheit, vom<br />
Romantischen bis zum Verbrecherischen zusammengeflochten<br />
war".<br />
<strong>Die</strong>se Charakterisierung Machnos bringt<br />
einen Menschen, der selbst oder seine Vorfahren<br />
die grausame Machnozeit erlebt hat, zum<br />
Nachdenken und weckt Gefühle, die kaum zu<br />
unterdrücken sind. Bemerkung von A. Reger.
Kapitel 59 Nestor Machno 1889-1934 - Ein Anarchist<br />
Prediger Johann J. Nickel (1859-1920)<br />
"Biographie des Predigers Johann J. Nickel (1859-1920)," Auszüge von Enkel John P. Nickel, Hope<br />
Springs Eternal (Box 1674, Battleford, Saskatchewan, Kanada, S0M 0E0, 1988), Seiten 1-34.<br />
Johann J. Nickel war im Dorf Chortitza, Alte<br />
<strong>Kolonie</strong>, im Jahre 1859 geboren. Sein Vater war ein<br />
Schullehrer, ein Beruf den Johann sich auch wählte.<br />
1879 heiratete Johann Margaretha Dyck,<br />
Neuendorf, deren Vorväter Gerhard Dyck, Jakob<br />
Dyck I und Jakob Dyck II zu ihrer Zeit als Ältesten<br />
der Chortitza Gemeinde dienten.<br />
Johann diente 12 Jahre als Schullehrer in<br />
Kronsgarten. 1882 wird Johann als Prediger<br />
gewählt. 1894 ging Johann nach New York<br />
(Novogorodskoye), Ignatyevo, und war dort Lehrer<br />
bis seine Frau 1912 starb. Dann ging er nach<br />
Woronesch und später Arkadak. 1915 heiratete er<br />
Katharina Enns Thiessen, eine wohlhabende Witwe<br />
von Schönfeld-Brazol. Sie wohnten zusammen auf<br />
ihrer Wirtschaft in Rosenhof, und erfuhren den<br />
schrecklichen Terror des Nestor Machno, der in<br />
dem naheliegenden Städtchen Gulai Pole sein<br />
Hauptquartier hatte.<br />
Im August 1919 flüchteten sie nach Burwalde<br />
in der Alt-<strong>Kolonie</strong>, wo er 1920 starb.<br />
<strong>Die</strong> Prediger der Separatist-Pietistischen<br />
Mennoniten predigten vorläfig--nur so, wie es<br />
ihnen in die Gedanken kam, irgendetwas um ihre<br />
Zuhörer anzuregen. <strong>Die</strong>ses bestätigt keine hohe<br />
Qualität von Predigten. Unter den konservativen<br />
Mennoniten, im Gegendteil, war es sittlich, dass die<br />
Prediger, unter der Leitung des Heiligen Geistes,<br />
ihre eigenen Predigten schrieben, oder ausgewählte<br />
Predigten von sehr begabten Predigern<br />
vorlasen. <strong>Die</strong>se Predigten sind durchweg sehr gute<br />
Auslegungen des Evangeliums und der Heligen<br />
Schrift.<br />
Johann J. Nickel schrieb auch seine eigene<br />
Predigten, von denen noch etliche vorhanden sind.<br />
Sie stehen als ein Zeichen des wahren liebevollen<br />
Glaubens der Kirchlichen Mennoniten, der sich<br />
ganz auf Christus und sein Evangelium bildet und<br />
nicht auf emotionale Aufregungen, wo nur wenig<br />
Raum für den Heiligen Geist zum Arbeiten blieb.<br />
Prediger Nickel hat auch ein Tagebuch geführt,<br />
das eine sehr wichtige Quelle der zeitlichen<br />
Tatsachen ist. Besonders wichtig sind seine<br />
Bemerkungen über die schreckliche Machno-Zeit.<br />
Hier folgen etliche Auszüge aus seinem Tagebuch<br />
von 1918-1919:<br />
Johann J. Nickel (1859-1902) mit seinen Eltern<br />
Johann B. Nickel (1837-1915) und Elisabeth Prediger Johann J. Nickel als Witwer in New York,<br />
Klassen (1833-1919). Foto aus John P. Nickel, ed., Russland, 1910. Hinten, Jakob und Elisabeth.Vorne:<br />
Hope Springs Eternal (Nanaimo, B. C. 1988), Seite Daniel, Johann Sr. und Margaretha. Foto aus John P.<br />
2/Aus Preservings,Nr. 18, Seite 139.<br />
Nickel, ed., Hope Springs Eternal, Seite 4.<br />
367
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
12. Januar 1918.<br />
Getötet, getötet, getötet! Ein Kennzeichen<br />
dieser Zeit in unserer Gegend...<br />
30. Januar 1918.<br />
An diesem Morgen bekamen wir schlechte<br />
Nachricht, dass Aaron Thiessen und seine<br />
Nichte, die Tochter von Abraham Thiessen,<br />
ermordet worden sind... Aaron Thiessen war zu<br />
seinem Bruder Abraham gefahren, und in seiner<br />
Abwesenheit hatten die Banditen sein Haus<br />
geplündert.... Abrahams Neffe, Gerhard, war zu<br />
der Zeit dort und wurde sehr hart behandelt...,<br />
dann haben sie Abraham, Gerhard und Aaron<br />
gegen einen Wandschrank gestellt und<br />
geschossen. Sie trafen die Männer nicht, sondern<br />
schossen zwischen ihnen in den Schrank<br />
hinein. <strong>Die</strong> zum Tode verängstigte Tochter Anna,<br />
war auch gegenwärtig, und ging hin und her vor<br />
ihrer lieben Familie mit ihrem kleinen Bruder<br />
auf den Armen, in dem Glauden, dass sie<br />
dadurch die Banditen ablenken würde nochmals<br />
auf die Männer zu schießen. Ganz unschuldig<br />
sagte sie sogar: "Papa, die werden sie<br />
erschießen," und damit fiel auch schon ein<br />
Schuss.<br />
"Ich bin getroffen worden," schrie sie und<br />
sank in die nächste Stube hinein. Ganz<br />
geschwächt fiel sie auf die Knien und legte ihren<br />
Bruder sanft auf den Fußboden...<br />
<strong>Die</strong> Mutter, die in einer anderen Stube<br />
eingeschlossen war, rief in der Zwischenzeit: "Sie<br />
haben mein Kind ermordet und lassen mich<br />
nicht sie zu sehen." Mit diesen Worten lief sie<br />
schnell zu ihrer sterbenden Tochter. Welch ein<br />
Beispiel einer wahren Mutterliebe! Vater Aaron<br />
wurde von seiner Tochter auf einer brutaler Art<br />
und Weise weggerissen. Sie sagten zu ihm:<br />
"<strong>Die</strong>ses ist deine letzte Reise." Dann hatte Aaron<br />
Thiessen musst ein Brecheisen holen und seinen<br />
Geldschrank aufbrechen, wo nur 150 Rubel<br />
waren. <strong>Die</strong> Kleiderschränke waren auch leer.<br />
<strong>Die</strong>ses hat die Banditen wahrscheinlich sehr<br />
wütend gemacht und durch ein paar Schüsse<br />
legten sie Aaron nieder. Er war gleich tot. Wie hat<br />
er musst leiden? Wollen wir hoffen, dass er sich<br />
Das Tagebuch 1918<br />
Das Tagebuch des Predigers Johann J. Nickel (1859-1920), 1918," Auszüge von Großsohn John P.<br />
Nickel, Redaktuer, Hope Springs Eternal (Nanaimo, B. C., 1988), Seite 174-276.<br />
368<br />
ganz in Jesu Hände gegeben hat...<br />
1. Februar 1918.<br />
Haben Nachricht bekommen,... dass beide<br />
Söhne von Kachel (Heinrich) Thiessen ermordet<br />
worden sind... <strong>Die</strong>se Tat wurde wie folgt ausgeführt:<br />
Gleich nach dem Abendessen um 8 Uhr<br />
saß die ganze Familie von Heinrich Thiessen<br />
traurig im großen Gang. Heinrich Thiessen junior<br />
und seine Frau spielten mit ihrem jüngsten<br />
Kind. Plötzlich kam das <strong>Die</strong>nstmädchen ins<br />
Zimmer gelaufen und schrie: "Es ist etwas<br />
passiert!" Mutter Thiessen reagierte auf dieses<br />
Geschrei nicht, denn das <strong>Die</strong>nstmädchen hatte<br />
gestern auch schon mal dasselbe gesagt. In<br />
diesem Moment kommt eine Anzahl bewaffneter<br />
Banditen ins Haus und schrie: "Hände hoch!"<br />
Jeder tat wie befohlen, auch der junge Vater<br />
Thiessen hob eine Hand hoch und mit der<br />
anderen hielt er sein erschrockenes Kind fest.<br />
Das Kind wurde aus seinen Armen gerissen und<br />
der Frau überreicht. Dann wurden alle Männer:<br />
der junge Vater, die Jungen und der alte Mann in<br />
eine andere Stube geschoben. Auch die junge<br />
Frau und die Schwiegermutter wurden in<br />
einzelne Zimmer getrieben und dabei mit<br />
Fäusten geschlagen. Solche jämmerliche<br />
Feiglinge! <strong>Die</strong> junge Frau rief durch die<br />
geschlossene Tür und wollte ihre Kinder so gut<br />
wie möglich beruhigen. Dann fiel sie auf ihre<br />
Knien und stieß ein heißes Gebet zu ihrem<br />
Herrn. Plötzlich fiel ein Schuss, noch einer, dann<br />
wurde es still und dann noch einer. Das Herz der<br />
Frau schlug heftig. Was ist passiert? Es war alles<br />
still, nur hin und wieder hörte man Schritte im<br />
Gang. Es herrschte Totenstille. <strong>Die</strong> junge Mutter<br />
lag noch immer auf ihren Knien. Sie zitterte in<br />
Furcht. <strong>Die</strong> Minuten schleppten sich wie<br />
Stunden hinfort, und eine Stunde war wie eine<br />
Ewigkeit. Sie konnte sich nicht mehr<br />
beherrschen, kroch bis zur Tür auf ihren Händen<br />
und Knien und versuchte die Tür zu öffnen, weil<br />
sie glaubte, dass die Tür geschlossen war. Sie versuchte<br />
es noch einmal, gab der Tür einen kräftigen<br />
Stoß und sie öffnete sich. Sie wartete mit<br />
gestocktem Atem eine Weile, ob nicht jemand
Kapitel 59 Nestor Machno 1889-1934 - Ein Anarchist<br />
aus der Finsternis herauskommt. Alles war still.<br />
Sie kroch längs dem Gang zu der Stube, wo die<br />
Männer waren. <strong>Die</strong> Tür war offen. Sie kroch weiter.<br />
Ihre Hände fühlten etwas warmes und klebriges<br />
- Blut. Sie reichte weiter in die Finsternis<br />
hinein und fühlte den Kopf ihres Mannes. Im<br />
lauten Schrei sackte sie zusammen! Alles war<br />
still, wie in einem Grab. Und es war auch ein<br />
Grab. Als sie ihren Ehemann noch einmal drückte,<br />
hörte sie ihre Mutter rufen: "Agatchen, lebst<br />
du noch?" "Ja. Ich bin hier," antwortete die<br />
Tochter. Zusammen fanden die Beiden eine<br />
Lampe, zündeten sie an, und - da lagen sie:<br />
Heinrich - Agatha ihr Ehemann und Vater von<br />
fünf Kindern; Peter, der sich diese Weihnachten<br />
mit Susie Loewen von Rosenhof verlobt hatte<br />
und im Frühling heiraten wollte, - beide tot.<br />
Gerhard atmete noch schwer, aber als sie seinen<br />
Kopf aufrichteten hörte er auf zu atmen. Bei<br />
allen drei Männern waren die Hände auf dem<br />
Rücken zusammengebunden.<br />
22. Februar 1918.<br />
Wir waren sehr überrascht zu hören, dass<br />
unser lieber Ältester Isaak Dyck verhaftet wurde<br />
und man von ihm zwei Millionen Rubel Lösegeld<br />
verlangte. <strong>Die</strong>se freche Burschen sagten: "Er ist<br />
so wie ein Gott für die Chortitzer Menschen, wir<br />
werden ihn verhaften. Wenn die Menschen ihn<br />
wirklich lieb haben müssen sie das Geld zusammenlegen,<br />
um ihn loszulösen"... Sechs Geiseln,<br />
einschließlich des 60jährigen Kornelius<br />
Hildebrandt, sind im Gefängnis...<br />
1. März 1918.<br />
Zuerst gingen sie [die Banditen] zu Neufelds,<br />
um ihn als Kutscher mitzunehmen, von dort<br />
nach Sawatzkys, dann zu uns und schließlich zu<br />
Thiessens...Am längsten blieb die Bande bei<br />
Neufelds. Sie verhielten sich sehr brutal und<br />
schlugen den Vater bis er plädierte: "Schlag mich<br />
nicht, ich gebe euch was immer ihr haben wollt."<br />
Nachdem sie von ihm alles bekommen hatten,<br />
stellten sie den Vater mit zwei seiner Söhne<br />
mit dem Gesicht zur Wand und drohten sie zu<br />
erschießen. Dann wandten sie sich freundlich zu<br />
den Mädchen und verbrachten ihre Zeit mit<br />
ihnen. Wie schmerzten solche Minuten, die<br />
einem als Stunden vorkamen. Schließlich wollten<br />
die Banditen sich noch prächtig amüsieren,<br />
wobei Maria Neufeld spielen und ihre<br />
369<br />
Schwestern ein russisches Lied singen mussten.<br />
Dann wurde der ganzen Familie befohlen, sich<br />
hinzusetzen und sitzen zu bleiben bis die<br />
Banditen weg waren. Beim Verlassen drohten sie:<br />
"Wir haben euer Leben geschont und ihr müsst<br />
uns jetzt gehorsam sein. Wenn ihr uns bei der<br />
Obrigkeit verklagen werdet, ist das ein plötzlicher<br />
Tod für euch."<br />
29. März 1918.<br />
<strong>Die</strong> Brasol-Deutschen hatten eine schwere<br />
Zeit. <strong>Die</strong> russischen Bauern kamen in die<br />
deutschen Wirtschaften, forderten die Schlüssel<br />
und sagten: "Raus mit euch! <strong>Die</strong>ses ist nun alles<br />
unser." Einer Familie, die gerade sechs Schweine<br />
geschlachtet hatte, wurde befohlen, am nächsten<br />
Tag die Wirtschaft nur in den Kleidern, die<br />
sie anhatten, zu verlassen.<br />
15. April 1918.<br />
Gestern abends hatten wir Besuch - es war<br />
die furchtbare Nikiforowa-Bande.<br />
21. April 1918.<br />
Nikolaj Friesens besuchten die Eltern der<br />
Frau in Ebenberg. <strong>Die</strong> Bolschewiken haben hier<br />
auch Angriffe ausgeführt, auch in Andreasfeld,<br />
dem Nachbardorf. Drei Männer sind erschossen<br />
worden, wobei einer allmählich sterben wird. Sie<br />
haben geprügelt und Frauen vergewaltigt. Es<br />
wurde gesagt, dass ein Mädchen gerade noch<br />
den Angriff einer Bestiall-Bande Ruffi überlebt<br />
hat. Ein Schreck!<br />
31. Dezember 1918.<br />
Frau Goossen und ihr Kutscher wurden<br />
ermordet als sie von Rosenhof nach Felsenberg<br />
fuhren. Ihre Körper wurden in einer tiefen<br />
Schlucht gefunden, etliche Werst von ihrem<br />
Chutor entfernt. Eine Bande von 15 Männer<br />
hatte diese beiden überfallen, ihr Fahrzeug geraubt<br />
und sie dann etliche Werst vom Wege ab<br />
erschossen, ungefähr um 2.30 Uhr nachts.<br />
6-8. November 1918.<br />
Am 6-8. November waren wir bei Thiessens<br />
und halfen dort beim Schweinschlachten...<br />
Nachbar Sawatzky kam plötzlich hinein und<br />
erzählte, dass die Machno-Bande und seine<br />
Armee aus Lukaschowo nach Rosenhof<br />
marschieren... "Wir flüchten sofort", sagte ich.<br />
"Gegen diese können wir nicht widerstehen."<br />
Inzwischen machte die Frau die Kinder bereit<br />
das Heim zu verlassen. Sie packte einige Sachen
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
und das Essen ein, und wir fuhren weg. Auf der<br />
Straße hielten wir, um Isaak Thiessens<br />
mitzunehmen. Der alte Onkel Thiessen weigerte<br />
sich den Ort zu verlassen. "Dann fahre ich auch<br />
nicht, ich werde ihn hier nicht alleine lassen,"<br />
sagte sein Sohn Isaak.<br />
Als ich zurück zu meinem Wagen eilte, kam<br />
ein Ritter entgegen. <strong>Die</strong>ses Mal war es Gerhard<br />
Epp. Wir dachten er eilte uns mitzuteilen, dass<br />
wir flüchten sollten. Zu unserer Überraschung<br />
sagte er, das momentan keine Gefahr droht.<br />
Machno ist in Nikolajewka, ungefähr 25-30 Werst<br />
entfernt. Keiner wusste genau, wo er als nächstes<br />
hinfährt. Wir fuhren wieder nach Hause und setzten<br />
unsere Arbeit, das Schweineschlachten,<br />
fort. Bei Sonnenuntergang waren wir fertig.<br />
Einige junge Männer kamen vorbei geritten, um<br />
uns die letzten Nachrichten mitzuteilen. Das<br />
Dorf beschloss, eine Nachtwache aus sechs<br />
Männer, jeder für drei Stunden, einzusetzen. Wir<br />
waren um neun Uhr gerade zu Bett gegangen, als<br />
ein Ritter vorbeikam. Später erfuhren wir, dass es<br />
Johann Peters war. Plötzlich merkte ich, dass ein<br />
Nachtwächter zu unserer Tür eilte. Ich lief zur<br />
Tür. Jakob kam aus der Sommerküche gelaufen<br />
und sagte: "Fahr gleich weg. Wir ältere Jungen<br />
bleiben im Hause." Eilend bereiteten wir uns vor,<br />
einschließend Onkel Thiessen (der dieses Mal<br />
zustimmte mitzufahren) und Frau Hoffmann mit<br />
ihrem einzigen Kind. Wir hielten bei Hermann<br />
Neufelds, um unseren Johann und meine<br />
Schwester Maria über unsere Flucht zu<br />
benachrichtigen. Wir rieten ihnen auch irgendwo<br />
eine Zuflucht zu finden... <strong>Die</strong> Möglichkeit<br />
eines Angriffs plagte mich. Wir fuhren bis<br />
Wölken nach Sofijewka, wo wir sicher waren,<br />
wenigstens für einige Zeit. Viele andere<br />
Flüchtlinge kamen auch hierher, und bald war<br />
der ganze Hof voll. Unser Johann war auch da,<br />
und auch meine Schwester Maria, dessen Kinder<br />
mit uns mitgekommen waren. Liese kam mit<br />
dem Zug von Halbstadt an. Alle Wirte von<br />
Rosenhof waren da, insgesamt über 300<br />
Personen. Keiner war da von Verbova<br />
[Werbowo], sie haben die Nachricht wahrscheinlich<br />
noch nicht bekommen... Halbzehn kam<br />
Gerhard Weisse und sagt: "Fahrt weiter, denn<br />
eine Bande von etwa 50 Wagen greifen gerade die<br />
Eppen Hofstelle an." (<strong>Die</strong> Eppen wohnten zwei<br />
370<br />
Werst von Rosenhof ab). David Epp kam zu<br />
berichten, dass sein Bruder wahrscheinlich<br />
ermordet worden ist. In weniger als 15 Minuten<br />
war der Wölken Hof leer und eine lange Reihe<br />
von Wagen fuhren nach Alexandrowsk.<br />
Ein Tag später hörten wir, dass die Eppen<br />
Familie große Verluste erlitten hat. Nicht nur<br />
allein, dass ihr Gerhard ermordet wurde, aber<br />
auch, das sein Vetter Abraham brutal von den<br />
Machnowzy ermordet ist....Alles hat angefangen,<br />
als Gerhard mit noch einigen Männern bei<br />
unserer Sommerküche anhielten (während einer<br />
von ihnen sich wegen des möglichen Angriffs<br />
umschaute). Als Gerhard dann zu seinem Chutor<br />
fuhr, um etwas abzuholen, wurde er von einer<br />
Bande von 51 Wagen, die zufällig vorbeifuhr,<br />
angegriffen. Erstens raubten sie ihm 23 000<br />
Rubel, nahmen seine Kleidung und dann töteten<br />
sie ihn mit einem Säbelschlag durch den Hals.<br />
Kurz nach diesem Geschehen kam Abraham Epp<br />
auf den Hof, ohne zu wissen, was geschehen war.<br />
<strong>Die</strong> Banditen umkreisten seinen Wagen,<br />
schleppten ihn herunter, warfen ihn auf die<br />
Erde, zogen seine Kleider aus und prügelten ihn<br />
unbarmherzlich. Epp bittet um sein Leben. "Ich<br />
habe neun kleine Kinder und bin nicht reich",<br />
bettelte er.<br />
Von Machnowzen konnte man keine<br />
Barmherzigkeit erwarten. "Lauf für dein Leben!<br />
Lauf für dein Haus," schrie ein Mann.<br />
"Gib mir wenigstens etwas Kleider, es ist<br />
eine Schande so zu laufen."<br />
"Lauf!"<br />
Epp lief durch den Garten. Sie folgten ihm<br />
nach, sie stichen ihn durch und noch einmal<br />
durch mit ihren Säbeln. Epp schloss seine Hände<br />
im Gebet zusammen.<br />
Machno schrie: "So, du betest auch noch?!",<br />
und schlug ihn zur Erde nieder.<br />
Da lag Epp jetzt, gleich wie der gefallene<br />
Mann zu Jericho. Als die Bande weg war, trugen<br />
die <strong>Die</strong>ner ihn hinein. Noch lebend legten sie ihn<br />
neben seinem toten Vetter Gerhard. Er bat ihn<br />
mit einer Decke zuzudecken, denn ihm war kalt.<br />
Sein ganzer Körper war so voller Säbelwunden,<br />
dass, wenn er Wasser trank, es aus den Wunden<br />
wieder herauslief. Um vier Uhr starb Abraham<br />
Epp. <strong>Die</strong> Männer wurden beide auf dem Eppen<br />
Chutor ohne Sarg begraben.
Kapitel 60 Markusland <strong>Kolonie</strong><br />
In den 1860er Jahren hat sich Isaak Harms<br />
(1811-91) aus Lindenau, <strong>Molotschna</strong>, in der<br />
Umsiedlung der Landlosen der Kleinen Gemeinde<br />
sehr verdient gemacht. Im Juli 1863 reiste er mit<br />
seinem Sohn Kornelius und Peter Töws (1841-<br />
1922), später Ältester, um einige Ländereien als<br />
Pachtland für diesen Zweck anzusehen. Sie<br />
besuchten unter anderem auch das Markusland,<br />
das am linken Ufer des Dnjepr, gegenüber Einlage,<br />
15 km nördlich, lag. Sie statteten auch dem<br />
Großfürsten Markussow, dem das Land gehörte,<br />
einen Besuch ab. Es gab hier ein Dorf gleichen<br />
namens, "Markussowo" (Pawlo-Kitschkas). Nach<br />
einer gewissen Verhandlung wurde der<br />
Pachtvertrag für sechs Jahre unterschrieben. Im<br />
Herbst wurde das Dorf Friedrichsthal angelegt. Im<br />
nächsten Frühling (1864) wurde das Dorf<br />
Andreasfeld (heute Andrejewka) gegründet.<br />
Insgesamt siedelten hier ca. 50 Familien an.<br />
Amtlich unterschrieben wurde der Vertrag erst am<br />
23.11.1864. Von dem Dorf Friedrichsthal ist, seitdem<br />
die Kleine Gemeinde dort weggezogen ist,<br />
nichts mehr zu finden. Entweder hat man das Dorf<br />
umbenannt, oder es wurde nicht mehr bewohnt,<br />
da es ja Pachtland war. Weil der Vertrag nur für<br />
sechs Jahre galt, suchte man nach einer Lösung.<br />
<strong>Die</strong>se Lösung fand man in der Borosenko Gegend,<br />
die 30 km nordwestlich von Nikopol lag. Obwohl<br />
der Pachtvertrag erst 1869 ablief, siedelten viele<br />
Familien schon vorher nach der neuen Siedlung<br />
um. Als der Pachtvertrag nach sechs Jahren abgelaufen<br />
war, zog auch I. Harms nach Heuboden,<br />
Borosenko, und 1874 nach Jansen, Nebraska. Er<br />
war der Bruder an Johann Harms, Margenau.<br />
Karte der Chortitza/Saparoschje Gegend aus dem Jahr 1930, vor dem Bau des Staudammes bei Einlage.<br />
<strong>Die</strong>se Karte zeigt Einlage II (Kitschkas) und Andrejewka (Andreasfeld). <strong>Die</strong> Karte stammt aus den<br />
Militärunterlagen der U. S. Armee und wurde von William Schroeder, Winnipeg, gefunden. Mit freundlicher<br />
Genehmigung von William Schroeder/Preservings,Nr. 17, Seite 92.<br />
371
Kapitel 61 Andreasfeld - Andrejewka<br />
Das Dorf Andreasfeld wurde 1864 im<br />
Gouvernement Jekaterinoslaw von ca. 25<br />
Familien der Mennoniten der Kleinen Gemeinde<br />
aus der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong> auf 925 Desjatin Land<br />
gegründet. Das Dorf lag am linken Dnjepr-Ufer,<br />
etwa 15 km nördlich von der Stadt Saporoschje.<br />
Eine Filiale der Kleinen Gemeinde wurde 1864<br />
hier gegründet und anerkannt. 1869 zogen alle<br />
Glieder der Kleinen Gemeinde vom Markusland<br />
fort, und damit wurde dieser Teil der Geschichte<br />
der Kleinen Gemeinde abgeschlossen.<br />
Andreasfeld grenzte laut Angaben des<br />
Archivdirektors in Saporoschje, A. Tedeew, an die<br />
Chutors "Kleinfeld" des August Appenrot (ein<br />
preußischer Bürger) und "Fröse" des Peter Peter<br />
Fröse.<br />
Nahe Andreasfeld wurden noch die<br />
Pachtdörfer Ebenfeld und Blumenau, meistens<br />
von den Gliedern der Brüdergemeinde, gegründet.<br />
<strong>Die</strong>se drei Dörfer hatten ihre eigenen<br />
Schulen. In Andreasfeld war die Schule unter<br />
einem Dach mit der Kirche der Brüdergemeinde.<br />
Neben dem Versammlungshaus wohnte von Juni<br />
1871 bis 1872 der Prediger August Liebig.<br />
Bis 1903 war hier ein Gemeindezentrum der<br />
Brüdergemeinde mit 60 Mitgliedern (12 Familien),<br />
weil der Älteste Aron Lepp und Prediger Johann<br />
Siemens hier wohnten. Hier fand die erste<br />
jährliche Bundeskonferenz der Brüdergemeinde<br />
Russlands vom 14.-16. Mai 1872 statt. Auch später<br />
wurden hier solche Konferenzen abgehalten.<br />
Andreasfeld hatte auch eine Filiale der<br />
Kronsweider Gemeinde. Der letzte Prediger war<br />
Peter Falk. Für ihre Andachten brauchte diese<br />
Gemeinde (und später auch die Allianz<br />
Gemeinde) auch das Schulhaus. Der<br />
letzte Lehrer war Heinrich Löwen.<br />
Andreasfeld hat durch die<br />
Revolution 1917 sehr gelitten. Heinrich<br />
Hildebrand (1872-1925) wurde durch<br />
einen Schuss verletzt, aber nicht<br />
tödlich. Einmal wurden drei Männer<br />
erschossen. Andere wurden geprügelt<br />
und die Frauen vergewaltigt. Im<br />
Oktober 1917 wurde Johann Janzen<br />
zerhackt. Zu dieser Zeit verließen die<br />
Einwohner das Dorf. Viele flüchteten<br />
nach Einlage über den Dnjepr.<br />
Augenzeugen berichten, dass<br />
Andreasfeld ein großes Dorf war und<br />
sich von dem heutigen Andrejewka bis<br />
Woljno-Andreewka, ca. vier km längs<br />
372<br />
dem Dnjepr-Ufer, zog. Laut A. Tedeew, Archivist,<br />
bestand Andreasfeld nur bis vor der Revolution<br />
1917, weil für die Zeit danach keine Angaben über<br />
Andreasfeld zu finden sind. Auf der Karte von Karl<br />
Stummp, 1942, wird Andreasfeld schon mit dem<br />
russischen Namen "Andrejewka" genannt.<br />
1932, nach dem Bau des Staudammes<br />
"Dnjeproges", verschwand Andreasfeld ganz<br />
unter den Fluten des Dnjepr-Flusses. <strong>Die</strong><br />
Einwohner von Andreasfeld wurden umgesiedelt<br />
und gründeten einige neue Dörfer in der nahen<br />
Umgebung: Kruglik, Sokolowka, Schewtschenko,<br />
Saporoschskoje, Iwanowskoje, Sergejewka,<br />
Wolno-Andrejewka, Filtrowo u.a.<br />
Das einzige, was von dem ehemaligen<br />
Andreasfeld noch einigermaßen gut erhalten ist,<br />
ist das Krankenhaus mit einigen<br />
Wirtschaftsgebäuden. Es gehört zum<br />
Erholungskomplex, des Werkes "Progress". Um<br />
das Krankenhaus herum stehen heute viele kleine<br />
Häuser, die sehr wahrscheinlich nach dem II.<br />
Weltkrieg gebaut wurden und von den<br />
Einwohnern von Saporoschje als Datscha<br />
(Wochenendhaus) genutzt werden.<br />
Fahrplan nach Andreasfeld: aus Saporoschje-<br />
Richtung "Charkow", "Skworzowo", Autobahn<br />
"Simferopol-Moskau", weiter am Schild<br />
"Andrejewka acht km" vorbei und am Schild<br />
"Sokolowka" abbiegen. Nach 1,5 km kommt<br />
Sokolowka, dann nach 5,5 km liegt Andrejewka.<br />
Von Saporoschje bis Andreasfeld sind es etwa 30<br />
km zu fahren.<br />
Verkürtzt aus Preservings, Nr.17, 2000, Seiten<br />
91-96.<br />
Kornelius Toews (1836-1908),<br />
einer von die Pioniere des<br />
Friedrichtsthal. Später zog er<br />
nach Grünfeld, Borosenko, und<br />
1874 nach Grünfeld, Ost-<br />
Reserve, Manitoba. 1873 diente<br />
er als Delegat der Blumenhoff<br />
Kleine Gemeinde zu Nord-<br />
Amerika. Foto aus Preservings,<br />
Nr. 17, Seite 93.
Kapitel 61 Andreasfeld - Andrejewka<br />
Karte des Dorfes Andreasfeld, Anno 1870. Aus J. H. Epp, Iwanowka (Bielefeld 1992), Seite 87/Preservings,<br />
Nr. 17, Seite 91.<br />
373<br />
S<br />
Bethaus (und Schule) der<br />
Einlager Brüdergemeinde in<br />
Andreasfeld. Es war das erste<br />
Bethaus der Brüdergemeinde<br />
in Russland. Foto aus P. M.<br />
Friesen, Bruderschaft,Seite<br />
406/Preservings,Nr. 17, Seite<br />
94.<br />
W<br />
E<br />
N
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Das ehemalige Krankenhaus in Andreasfeld. Foto: Mai 2000/Preservings, Nr. 17, Seite 96.<br />
Unweit des ehemaligen Krankenhauses in Andreasfeld steht dieses neue Gebäude. Es ist ein Sanatorium<br />
vom Motorbauwerk "Progress" in Saporoschje. Foto: Mai 2000/Preservings, Nr. 17, Seite 95.<br />
374<br />
An dieser Stelle<br />
liegt unter den<br />
Fluten des Dnjepr<br />
das mennonitische<br />
Dorf<br />
A ndreasfeld.<br />
Aussicht vom<br />
Krankenhaus<br />
zum Norden.<br />
Foto: Mai<br />
2000/Preservings,<br />
Nr. 17, Seite 94
Kapitel 62 Borosenko (Borsenkowo) <strong>Kolonie</strong><br />
Borosenko war eine Siedlung bei Nikopol im<br />
russischen Gouvernement und Kreis<br />
Jekaterinoslaw, die 1865-66 von den Chortitza-<br />
Mennoniten (Alt-<strong>Kolonie</strong>) und der Kleinen<br />
Gemeinde aus der <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong> auf selbst<br />
gekauftem Lande angelegt wurde. Das Land wurde<br />
von einem russischen Edelmann Borsenko<br />
gekauft. Von den Alt-<strong>Kolonie</strong>rn wurden sechs<br />
Dörfer gegründet: Schöndorf, Nikolajthal,<br />
Ebenfeld, Felsenbach, Eichengrund und<br />
Hochstädt, von denen die größten Nikolajthal<br />
(Nowosofiewka) und Felsenbach (Mariapol)<br />
waren. Von der Kleinen Gemeinde wurden<br />
Heuboden, Blumenhoff, Annafeld, Steinbach,<br />
Rosenfeld und Neuanlage gegründet. <strong>Die</strong> ganze<br />
<strong>Kolonie</strong> besaß 12 000 Desjatin Land.<br />
Ein Alt-<strong>Kolonie</strong>r Jakob Fehr (1859-1952),<br />
später Haskett, Manitoba, Kanada, schrieb, dass<br />
viele Alt-<strong>Kolonie</strong>r mit der Kleinen Gemeinde eine<br />
neue Siedlung gründen wollten, um dort eine<br />
bessere Gemeindeordnung einzuführen. Aber<br />
auch hier waren die Alt-<strong>Kolonie</strong>r nicht immer mit<br />
der Kleinen Gemeinde gleichgesinnt, denn als<br />
1872 die Nikolajthaler Wolost gegründet wurde,<br />
wirkte die Kleine Gemeinde dagegen, weil sie keine<br />
Ämter, in denen sie amtliche Aussagen gegen<br />
andere Personen machen müssten, bekleiden<br />
wollten. Sie wurden dann von solchen<br />
Aussagenmachungen freigesprochen.<br />
<strong>Die</strong> Kleine Gemeinde besaß in dieser Siedlung<br />
6137 Desjatin Land, das für 184 110 Rubel gekauft<br />
wurde. Zwischen 1866 und 1867 wurden hier von<br />
der Kleinen Gemeinde noch die Dörfer<br />
375<br />
Friedensfeld und Grünfeld und 1872 der Chutor<br />
Hochfeld gegründet.<br />
Bis 1869 siedelte fast die gesamte Siedlung<br />
"Markusland" (wegen Auslaufs des Pachtvertrages)<br />
nach Borosenko über, und Borosenko war jetzt das<br />
"Herz" der Kleinen Gemeinde.<br />
Bis 1874 wohnten ungefähr 90 Familien der<br />
Kleinen Gemeinde in der <strong>Kolonie</strong> und noch 30<br />
Familien in den Nebendörfern Friedensfeld und<br />
Grünfeld, sowie den Chutors Hochfeld und<br />
Sawatzky, die eigentlich nicht zu der <strong>Kolonie</strong><br />
Borosenko gehörten, aber in der mennonitischen<br />
Geschichte zu der <strong>Kolonie</strong> gerechnet werden.<br />
1874-75 wanderte die gesamte Kleine<br />
Gemeinde aus der Ansiedlung nach Kanada und in<br />
die Vereinigten Staaten aus, und seitdem gab es in<br />
Russland keine Kleine Gemeinde mehr.<br />
<strong>Die</strong> Einwohnerzahl der 12 Dörfer in der<br />
<strong>Kolonie</strong> betrug 1915 600 Personen (120 Familien).<br />
<strong>Die</strong> Ansiedlung hatte eine eigene<br />
Wolostverwaltung in Nikolajthal. Während der<br />
Machno-Zeiten 1919 hat die Borosenko <strong>Kolonie</strong><br />
am meisten gelitten. Südlich von der <strong>Kolonie</strong>, über<br />
den Fluss Soljonaja, sind Hügel, wo Eisenerz<br />
gewonnen wird.<br />
Fahrplan zu der <strong>Kolonie</strong> im Jahre 2000: man<br />
fährt bis zur Ostseite der Stadt Nikopol, dann auf<br />
den Hochweg Nr.58 zum Norden bis an den Fluss<br />
Soljonaja. Hier fährt man links über die Brücke,<br />
dann wieder links durch ein kleines Dorf<br />
"Tawritscheskoje", dann fünf km südwestlich bis<br />
Heuboden. Wenn man die A58 weiter nördlich<br />
fährt, kommt man an Grünfeld vorbei.<br />
Namen der Dörfer<br />
Bei der Gründung 1930 Heute<br />
1. Blumenhoff Aleksandrowka (Borsenkowo) Aleksandrowka<br />
2. Heuboden Marjino Marjewka<br />
3. Steinbach Kusmitskoje nicht mehr da<br />
4. Annafeld Schischkowka Schischkino (?)<br />
5. Rosenfeld Ekaterinowka nicht mehr da<br />
6. Neuanlage Iwanowka nicht mehr da<br />
7. Schöndorf Olgino Nowosofijewka<br />
8. Nikolajthal Nowosofijewka Nowosofijewka<br />
9. Felsenbach Mariapol Marinopol<br />
10. Ebenfeld Uljanowka Uljanowka<br />
11. Eichengrund Petrowka Schewtschenko<br />
12. Hochstadt Aleksandropol Aleksandropol<br />
13. Grünfeld Chutor Seljonyj Seljonoje<br />
14. Friedensfeld Gogolewka Miropol
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Fahrkarte der Borosenko Gegend mit Angaben der mennonitischen Dörfer. <strong>Die</strong> Dörfer der ehemaligen<br />
Borosenko <strong>Kolonie</strong> liegen heute in den Dorfsowjets Kirowskij, Pawlowskij, Loschkarewskij, Kreis Nikopol<br />
und in den Dorfsowjets Dserschinskij, Solonjanskij, Gebiet Dnjepropetrowsk. <strong>Die</strong>se Angaben stammen<br />
aus dem Staatsarchiv in Saporoschje von A. Tedeew.<br />
376
Kapitel 63 Heuboden - Marjewka<br />
Das Dorf wurde drei km östlich von<br />
Blumenhoff am Fluss Soljonaja gegründet. <strong>Die</strong><br />
Hauptstraße war ca. ein km lang. Der Platz war<br />
sehr eben. Am südlichen Ende des Dorfes im<br />
Flussbett, das im Frühling überschwemmt wird,<br />
liegt das schöne Heuland. Daher kommt<br />
wahrscheinlich auch der Name „Heuboden".<br />
Unter der Leitung des Ältesten Abraham L.<br />
Friesen entstand hier die Heubodener Gemeinde,<br />
eine Filiale der Kleinen Gemeinde, mit 50-60<br />
Familien. 1874 zog diese Gemeinde nach Jansen,<br />
Nebraska, und gründete unter anderem dort das<br />
Dorf "Heuboden".<br />
Bauern der Kleinen Gemeinde fuhren manchmal<br />
am Sonntag nach dem russischen Dorf<br />
Scholochowo um Arbeiter zu mieten. An einem<br />
Sonntag war das Andachtshaus ziemlich leer. Der<br />
Vorsänger stimmte das Lied "Liebster Jesu, wir<br />
sind hier" an, und plötzlich sagte ein Alter aus den<br />
Reihen: „und die anderen sind in Scholochowo".<br />
Friedhof. Er lag eine halbe Meile östlich vom Dorf,<br />
längs der Hauptstraße, in der Nähe eines<br />
Skythien-Hügels. Mennonitische Gräber befinden<br />
E<br />
N<br />
S<br />
W<br />
377<br />
sich in der südwestlichen Ecke des Friedhofes.<br />
Anschließend, zum Norden hin, sind noch einige<br />
Grabsteine von Mennoniten, die das Dorf 1874<br />
von der Kleinen Gemeinde kauften, zu finden,<br />
zum Beispiel zwei Grabsteine von Schellenbergs.<br />
Wahrscheinlich hatte die Kleine Gemeinde<br />
diesen Platz für den Friedhof ausgesucht. Auf dem<br />
Hügel hatten die Russen später ihren Friedhof<br />
gemacht.<br />
Es ist anzunehmen, dass Isaak Löwen (1783-<br />
1873), ein Musterwirt von Lindenau, <strong>Molotschna</strong>,<br />
und weitbekannter Patriarch der Kleine<br />
Gemeinde, hier begraben liegt. Von ihm wurde<br />
erzählt, dass Johann Cornies Studenten und<br />
Forscher der Bauernwirtschaft zu ihm schickte,<br />
um von ihm zu lernen, besonders im<br />
Seidenraupenbau.<br />
Heuboden ist heute (1998) ein stabiles Dorf<br />
mit etwa 60-80 Hofstellen. Mitten im Dorf steht<br />
ein Gebäude, das früher die Schule war.<br />
Anschließend steht ein längeres Gebäude, längs<br />
der Straße, so wie die mennonitischen Schulen<br />
und Kirchen früher gebaut wurden.<br />
Karte des Dorfes Heuboden, Borosenko <strong>Kolonie</strong>. <strong>Die</strong> Zahl der ukrainischen Häuser ist nur ungefähr<br />
angegeben. Gezeichnet von D. <strong>Plett</strong>, Steinbach 1998.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
378<br />
Heubodener<br />
Friedhof. Aussicht<br />
von oben vom<br />
Kurgan im<br />
Südwesten.<br />
Wahrscheinlich<br />
haben die Kleine<br />
Gemeinde Pioniere<br />
dieser Gegend<br />
diesen Platz neben<br />
dem Kurgan ausgesucht.<br />
Etliche<br />
mennonitische<br />
Grabsteine sind<br />
hier noch zu finden.<br />
Foto 1998. Aus<br />
Preservings, Nr.12,<br />
Seite 41.<br />
Zwei mennonitische Original-<br />
Gebäude in Heuboden: Schule<br />
und Kirche. Heuboden war<br />
auch die Heimat des<br />
Mitgliedes der Kleinen<br />
Gemeinde, David Klassen<br />
(1813-1900), später Rosenhof,<br />
Manitoba, Kanada. Er war<br />
Delegat der Heubodener<br />
Gemeinde für die<br />
Auswanderung nach Amerika<br />
1873. Foto aus Saints and<br />
Sinners von D. <strong>Plett</strong>, Seite 119.<br />
Ein Haus in Heuboden an der<br />
Ostseite des Dorfes. Ein<br />
Nachbar erzählte 1998, dass<br />
dieses Haus einem Jakob Funk<br />
gehörte, der später nach<br />
Karaganda, Kasachstan kam,<br />
dann nach Deutschland. Aus<br />
Deutschland bekam dieser<br />
noch einige Briefe von Jakob<br />
Funk. <strong>Die</strong>ses Haus ist<br />
wahrscheinlich sehr umgebaut<br />
worden. Ein Haus auf der<br />
Westseite der Straße in der<br />
Mitte des Dorfes ist scheinbar<br />
das einzige Haus im<br />
Heuboden was noch steht, das<br />
nach der mennonitischen Art<br />
gebaut wurde. Der Stall ist<br />
abgebrochen. Siehe<br />
Buchumschlag, vorne. Foto:<br />
Mai 1998.
Kapitel 64 Blumenhoff - Alexandrowka<br />
Das Dorf lag 10 km südwestlich vom Dorf<br />
"Tawritscheskoje", längs dem Fluss Soljonaja. Es<br />
wurde 1865 von 30-40 Familien gegründet. <strong>Die</strong>ses<br />
Dorf war das größte in Borosenko. Das Dorf liegt<br />
auf einer Anhöhe. Nördlich vom Dorf ist eine 10<br />
Fuß hohe Stufe im Landspiegel. Im Süden war das<br />
niedrige Land beim Fluss Soljonaja. Fruchtbares<br />
Bauernland lag im Norden und im Osten. Im<br />
Westen war eine große Schlucht und ein kleiner<br />
Fluss. Man sagt, dass man auf dem Weg zwischen<br />
Ebenfeld und Nikolajthal Blumenhoff sehen konnte,<br />
wahrscheinlich durch die tiefe Schlucht am<br />
östlichen Ende des Dorfes.<br />
Unter der Leitung von Ältesten Peter P. Töws<br />
(1841-1922) entstand hier die Blumenhoff<br />
Gemeinde, eine Filiale der Kleinen Gemeinde. Zu<br />
dieser Gemeinde gehörten ca.100 Familien.<br />
Blumenhoff war Zentrum dieser Gemeinde.<br />
Am 05.06.1872 wurde von der Kleinen<br />
Gemeinde der Entschluss zum Bau eines (des<br />
ersten) Andachtshauses getroffen. <strong>Die</strong>ses<br />
Gebäude hat auch eine Schule und<br />
Lehrerwohnungen. Dorfschulze Cornelius <strong>Plett</strong><br />
(1820-1900) leitete dieses Bauwerk.<br />
Auf dem Friedhof von Blumenhoff ist Johann<br />
Töws (1793-1873) beerdigt. Er war Autor des<br />
Buches "Das wachsame Auge Gottes". Der Vater<br />
von Johann Töws, Kornelius Töws (1766-1831),<br />
war einer der Pioniere in Lindenau, <strong>Molotschna</strong><br />
<strong>Kolonie</strong>. Er hat in seinem Leben viele Bücher der<br />
europäischen Aufklärung (Voltaire) gelesen. In<br />
seinen späteren Jahren in Russland ist ihm die<br />
Lust an solchen Büchern vergangen und er bat<br />
seinen Sohn Johann, diese Bücher zu verbrennen.<br />
Trotzdem ist die Liebe zum Lesen in der Töws-<br />
Familie immer stark gewesen. Der Sohn von<br />
Johann Töws (1793-1873) Peter Töws (1841-1922),<br />
wurde 1870 zum Gemeindeältesten gewählt.<br />
Johann Warkentin (1817-86), ein wohlhabender<br />
Bauer, war sehr beschäftigt mit Landankauf<br />
und Weiterverkauf an seine Glaubensgenossen.<br />
Warkentin war aus Blumstein in der <strong>Molotschna</strong>;<br />
daher kommt auch der Name "Blumenhoff".<br />
Als Machno 1919 nach Blumenhoff kam, versteckten<br />
sich alle Männer. Machno übernachtete<br />
in einem Haus an der Querstraße, südlich vom<br />
Friedhof. Das Haus ist nicht mehr da.<br />
Einer der Einwohner erzählte (1998), dass<br />
Blumenhoff früher „Borosenko" hieß (siehe Karte<br />
von 1930). Man könnte annehmen, dass<br />
Blumenhoff das Gut des Edelmannes Borosenko<br />
gewesen ist, von dem die Kleine Gemeinde das<br />
Land kaufte. <strong>Die</strong>ser Mann sagte auch, dass<br />
Blumenhoff ein aussterbendes Dorf ist. Nur die<br />
alten Einwohner bleiben noch hier, weil das Land<br />
billig ist. Auf dem Friedhof sind noch einige Steine<br />
zu finden. <strong>Die</strong>se gehören zu den Mennoniten, die<br />
das Dorf 1874 von der Kleinen Gemeinde kauften.<br />
Karte des Dorfes Blumenhoff, Borosenko <strong>Kolonie</strong>. Gezeichnet von D. <strong>Plett</strong>, Steinbach 1998.<br />
379<br />
E<br />
N<br />
S<br />
W
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Peter Töws (1841-1922) aus Blumenhoff, Borosenko,später<br />
Grünfeld, Manitoba, Kanada. Er war der sechste Älteste der<br />
Kleinen Gemeinde, Poet und Historiker. Foto aus Saints and<br />
Sinners,Seite 308.<br />
Vier-fünf km westlich und nördlich von<br />
Blumenhoff waren die Judendörfer<br />
"Chmelnitzkoje" und "Ordschonikidse". 1941<br />
sind die Juden aus diesen Dörfern von der S.S.<br />
erschossen worden.<br />
380<br />
Ein Privat-<br />
Haus in<br />
Blumenhoff.<br />
Nach dem II.<br />
Weltkrieg war<br />
hier die<br />
Schule. Heute<br />
wohnt hier<br />
eine deutsche<br />
Familie Stehle.<br />
Foto: Mai<br />
2000.<br />
Kolchosstall in<br />
Blumenhoff.<br />
Gebaut wurde er<br />
sehr wahrscheinlich<br />
aus den Ziegeln<br />
eines mennonitischen<br />
Gebäudes an<br />
der Nordseite des<br />
Dorfes. Es wird vermutet,<br />
dass er<br />
vielleicht sogar aus<br />
der Kirche, die die<br />
Kleine Gemeinde<br />
1872 baute, gebaut<br />
wurde. Foto von D.<br />
<strong>Plett</strong>, 1996.
Kapitel 64 Blumenhoff - Alexandrowka<br />
Kolchosstall in Blumenhoff, so wie er im Jahre 2000 aussah. Der Kolchosstall ist 1999 abgebrochen worden<br />
und nun ist nur noch ein Teil der Wände und ein Haufen Ziegeln zu sehen. Foto: Mai 2000.<br />
Blumenhoff. Aussicht zum Süden von dem Platz, wo die Mühle mal gestanden hat. Links ist das Gebüsch<br />
vom Friedhof zu sehen. Vorne liegt die Querstraße. Hinten, über den Fluss Soljonaja, sieht man die Hügel,<br />
wo heute Eisenerz gewonnen wird. Foto aus Preservings,Nr.12, Seite 42, Juni 1998.<br />
Aussicht zum Südosten vom Friedhof. Man sieht die Umgebung und den Kolchosstall, der 1999 abgebrochen<br />
wurde. <strong>Die</strong> Leute vorne stehen auf der Querstraße. Foto aus Preservings,Nr.12, Seite 42, Juni 1998.<br />
381
Kapitel 65 Steinbach – Kusmitskoje<br />
Der Name "Kusmitskoje" kommt von Iwanowka, in dem an der Eisenbahn ein großer<br />
"Kusma"–einem alten männlichen Getreidespeicher (Elevator) steht. Man muss bis<br />
Kosakennamen. Der Name "Steinbach" kommt an das östliche Ende dieses Dorfes fahren, um<br />
von den Felsenketten, die am Ufer des Flusses heute nach Steinbach zu kommen.<br />
Basawluk zu finden sind.<br />
Fahrplan: von Ebenfeld fährt man drei km<br />
Steinbach wurde 1865 auf der Westseite des östlich, dann rechts, dann drei km bis zum rus-<br />
Flusses Basawluk gegründet und ist auf einer sischen Dorf Mironowka, das gerade gegenüber<br />
alten Militärkarte von 1866 verzeichnet. Hier vom ehemaligen Steinbach, am anderen Ufer,<br />
siedelten 20 Familien von der Kleinen Gemeinde liegt.<br />
und einige andere an. Ein Teil des Dorflandes Mironowka ist ein großes Dorf mit einigen<br />
von Steinbach wurde von Gerhard Siemens und tausend Einwohnern. Ein älterer Russe aus<br />
Jakob Klassen gekauft und dann weiter an ihre diesem Dorf konnte sich 1998 noch an das ehe-<br />
Glaubensgenossen verkauft.<br />
malige mennonitische Dorf Steinbach erinnern,<br />
In den Tagebüchern von Abraham ("Fula") besonders an die Namen Kraus, A.Penner und<br />
Reimer (1808-92) kann man über viele interes- Enns. Seine Eltern waren <strong>Die</strong>ner bei David<br />
sante Tatsachen lesen, die im Dorf Steinbach Abramowitsch Penner, welcher der Ermordung<br />
zwischen 1870 und 1874 passiert sind.<br />
1919 entgehen konnte und nach Amerika<br />
Das Dorf zieht sich vom Osten zum Westen. flüchtete. Wahrscheinlich haben seine Eltern<br />
Am westlichen Ende des Dorfes ist ein Hügel, ein Abram Penner in ihrem Garten begraben. <strong>Die</strong><br />
wenig nördlich ein Kurgan. Etwa ein km südlich Petermanns Karte von 1898 stimmt nicht mit<br />
vom Dorf sind die Basawluk-Ufer sehr steinig – den Plätzen der Dörfer Steinbach, Blumenhoff<br />
eine Seltenheit in dieser Gegend. In den ersten und Rosenfeld überein.<br />
Gründungsjahren gab es hier über den Basawluk Gibt es noch irgendwo alte Bilder und<br />
eine Furte, die sehr wahrscheinlich noch die Schriften von den Gebäuden und Einwohner des<br />
Tschumaken genutzt haben.<br />
Sieben von die Familien Steinbachs zogen<br />
1874 nach Manitoba, Kanada, wo sie das Dorf<br />
Steinbach gründeten. <strong>Die</strong>ses Dorf ist zu einem<br />
Städchen mit 10 000 Einwohnern gewachsen<br />
und ist heute das Geschäftszentrum des ganzen<br />
Südostens von Manitoba.<br />
Alle Mennoniten wurden 1919 von den<br />
Machnowzy ermordet. Da waren 54 Leichen<br />
begraben.<br />
Wahrscheinlich wurden viele mennonitische<br />
Häuser nach den Machno-Angriffen abge-<br />
ehemaligen Steinbach und anderen Dörfern?<br />
brochen, die anderen wurden von den<br />
Ukrainern aus den Nachbardörfern bewohnt.<br />
Wegen Überschwemmungsgefahr siedelten mit<br />
der Zeit aus Steinbach alle nach Mironowka<br />
über.<br />
Einige Quellen behaupten, dass hier früher<br />
E<br />
über den Basawluk-Fluss eine Brücke war, die<br />
dann später, wegen der vielen Kämpfen in dieser<br />
S<br />
N<br />
Gegend vernichtet wurde. Auf der Karte von<br />
W<br />
1930 ist Steinbach noch verzeichnet. Westlich Karte des Dorfes Steinbach, Borosenko <strong>Kolonie</strong>.<br />
von Steinbach liegt heute das Dorf Nowo-<br />
382<br />
Gezeichnet von D. <strong>Plett</strong>, Steinbach 1998.
Kapitel 65 Steinbach – Kusmitskoje<br />
Eine schöne Aussicht der Borosenko Gegend. Aufgenommen ungefähr ein km westlich von Steinbach.<br />
Aussicht in nordöstlicher Richtung. Einige Gebäude des Dorfes Mironowka sind hinten rechts zu sehen.<br />
Foto aus Preservings,Nr. 15, Dezember 1999, Seite 80.<br />
Eine Aussicht von der Mitte des ehemaligen Dorfes Steinbach in Richtung Osten. Zu sehen ist etwas<br />
Strauch am Ufer, wo Teile des Fundamentes und Müll von gewesenen Gebäuden hingeschoben sind.<br />
Hinten ist ein Teil des russischen Dorfes Mironowka zu sehen. Foto aus Preservings,Nr.15, Seite 78.<br />
Aussicht über den Basawluk Fluss zum Nordwesten, dem Platz des ehemaligen Dorfes Steinbach,<br />
Borosenko <strong>Kolonie</strong>. Links sieht man eine Reihe von Bäumen, die wahrscheinlich früher zu Steinbach<br />
gehörten. Auf der Anhöhe (Mitte, links) könnte der Friedhof von Steinbach gewesen sein. Vorne ist das<br />
Land des Dorfes Mironowka, wo die Kühe gemolken werden. Foto aus Saints and Sinners,Seite 120.<br />
383
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Einleitung.<br />
<strong>Die</strong> Tagebücher von Abraham "Fula" Reimer<br />
(1812-92), Steinbach, Borosenko, sind typish für<br />
die Tagebücher, welche die konservativen<br />
Mennoniten in Russland, und früher auch in<br />
Preußen und Niederlanden, geführt haben. Eine<br />
von ihren Lehren war, dass alle Gläubige lesen<br />
und schreiben könnten, um die Bibel verstehen<br />
und auslegen zu können. Deswegen haben sie in<br />
jeder neuen Siedlung immer als erstes eine gute<br />
Grundschule für ihre Kinder gegründet.<br />
<strong>Die</strong> konservativen Mennoniten waren nicht<br />
Edelleute und auch nicht Leibeigene oder<br />
Passanten (Landvolk). Sie waren freie Leute und<br />
besaßen ihr eigenes Land. Sie gehörten zu einer<br />
Mittel-oder Zwischen-Klasse.<br />
In dem ökonomischen Stand sind gewöhnlich<br />
zwei Zweige gemeint. Der kommerzielle<br />
Erzeuger (Kapitalist) mietet Arbeiter und produziert<br />
seine Ware und Produkte für einen kommerziellen<br />
Markt. Der andere Zweig sind die<br />
Bauern (Passanten), oder Leibeigene, die nur<br />
produzieren, damit sie existieren können.<br />
<strong>Die</strong> konservativen Mennoniten ihre<br />
ökonomische Anordnung hat einen<br />
Haushaltsvorstand (in English, eine "Household<br />
economy"), d.h. sie waren kommerzielle<br />
Erzeuger, aber brauchten die Arbeitskraft ihrer<br />
eigenen Familie, um dieses zu schafen. Trotzdem<br />
war ihr Ertrag doch auf einer kommerziellen<br />
Höhe gestaltet. Sie kauften Land, verarbeiteten<br />
es, mieteten Arbeiter in der Erntezeit, u.s.w.<br />
In diesem Haushaltsvorstand hatten Mann<br />
und Frau beide wichtige Rollen in Arbeit und<br />
Verwaltung, deswegen waren sie beide<br />
Teilinhaber, d.h. Einer war dem Andern kein<br />
Vorgezetzter oder Herrscher.<br />
Um solche Wirtschaften zu betreiben war es<br />
notwendig, dass sie eine Vorstellung über die<br />
Tatsachen des Bauernlebens hatten, z.B. Wetter:<br />
Sie mussten wissen, wann der letzte Frost im<br />
Frühling kam und der erste Frost im Herbst;<br />
wieviel Zoll Regen und wann; den Stand der<br />
Viehzucht; wieviel sie jedes Jahr gesät hatten,<br />
und die Ernteausmaßen.<br />
Wer ein Musterwirt sein wollte musste solches<br />
alles wissen. Weil keine Regierungs-Abteilung<br />
<strong>Die</strong> Tagebücher des Abr. Reimer<br />
384<br />
zu der Zeit da war, die solche Tatsachen bekannt<br />
machte, mussten die konservativen Mennoniten<br />
selbst solche Tatsachen in Tagebüchern aufführen.<br />
<strong>Die</strong> Umwelt der konservativen Mennoniten<br />
war oft chaotisch und durcheinander. <strong>Die</strong><br />
Tagebücher waren ein Weg, wodurch sie für sich<br />
selbst Ordnung und Regeln davon schafen konnten.<br />
In seinem Tagebuch erschaft der Schreiber<br />
Ordnung über die Dinge, die in seiner Umwelt<br />
oftmals herumkreisten.<br />
<strong>Die</strong>se Tagebücher bezeichnen, dass die konservativen<br />
Mennoniten in Russland und früher in<br />
Preußen, ein einfaches und schlichtes Leben<br />
führten. Ihren Haushaltsvorstand zu führen war<br />
nicht leicht, es war schwere und harte Arbeit. Von<br />
diesen Tagebüchern bekommt der Leser auch ein<br />
Verständnis über die Ansichten und<br />
Weltanschauungen dieser Leute.<br />
<strong>Die</strong> Tagebücher bezeichneten auch, dass die<br />
konservativen Mennoniten ein wertvolles und<br />
interessantes Leben führten. Sie waren nahe zu<br />
der Natur und den Kreislaufen des Lebens:<br />
Geburt, Sterben; Säen und Ernten; Frühling,<br />
Sommer, Herbst und Winter. Sie gehörten und<br />
waren ein notwendiger Teil von den wichtigen<br />
Kreisen ihres Volkes, d.h. Familien, Dorf und<br />
Gemeinde.<br />
Das ganz Wertvollste aber war, dass die<br />
Tagebücher die Mundart von einem Volk enthalten,<br />
das über Jahrhunderte das Beste von verschiedenen<br />
Sprachen und Ländern gesammelt<br />
und bewahrt hat. Obwohl die Mennoniten eine<br />
Art Danziger Hochdeutsch brauchen zum<br />
Schreiben, enthalten Reimer seine Schriften<br />
noch Stücke von der Niederdeutsch-<br />
Holländischer Umgangssprache, und sogar, von<br />
der Sächsischen, weil es mehr mit dem<br />
Englischen resoniert, mit der Grammatik und<br />
Schreibweise, z.B. er braucht oft das "c" anstatt<br />
"k".<br />
Hier folgen etliche Auszüge aus dem<br />
Tagebuch von Abraham "Fula" Reimer,<br />
Steinbach, Borosenko, aus den Jahren 1870 bis<br />
1874. Es ist ein wertvolles Beispiel von den<br />
Tagebüchern der konservativen Mennoniten.<br />
Von D. <strong>Plett</strong>, Steinbach, Kanada.
Kapitel 65 Steinbach – Kusmitskoje<br />
1. Januar, 1870. Andacht in Rosenfeld. Wolkig. Eine<br />
Kuh hat gekalbt. Frau Abr. Friesen wurd from<br />
Rosenfeld nach Klaas Reimers geholt.<br />
8. April. Mit. Morgens 1 grad kalt, spater 8 grad<br />
warm. Klar. Nordwind, Fertigten Säen, Pflugen und<br />
Eggen.<br />
16. April. 8 grad warm, später 18. <strong>Die</strong> Schwalbe sind<br />
zuruck und die Froschen fangen an zu krächzen,<br />
und der Storch ist al zeit anfangs April zuruck.<br />
24. April, Fritag. Morgens 16 grad warm, später 20.<br />
Der alte Hein. Reimer, Molotsch, spazierte hier.<br />
Jakob Barkman, Friedensfeld, der Waisenman, war<br />
hier. <strong>Die</strong>d [S. Friesen, Schullehrer, bei Reimers im<br />
Quartier], für mit nach Nicolaithal auf geschäfte.<br />
Joh. Reimer kamm zu Hause mit Holz.<br />
28. April. <strong>Die</strong>ngstag. Margens 6 grad warm, später<br />
16. Abr. Reimer [Sohn von Blumenhof] und<br />
Schwager Gert Willms, Krim, kammen zu Mittag<br />
hier mit ein Far. Wein. Regen und Gewitter durch<br />
die Nacht.<br />
3. Mai. Sontag. Margens 10 grad warm, später 21.<br />
Andacht bei Siemens. <strong>Die</strong>d wurde in die Kirche<br />
aufgenommen, weil er hier fur 8 Wochen gearbeitet<br />
hat. Seine Eltern waren auch hier und auch die<br />
Kinder, Abr. Reimers, Blumenhof, die Jungere, und<br />
die alte Abr. Friesens, Rosenfeld.<br />
5. Mai. <strong>Die</strong>nstag. Margens 10 grad warm, später 10<br />
grad warm. Jak. Friesens sind fruh verlassen nach<br />
Hause, so wie auch Kl. Reimers und Martin<br />
Klassens, allesamt sechs. Haben Montag Abend<br />
gefischt. Der Kooko haben wir nun al 8 Tagen<br />
gehört.<br />
5. Juli. Sontag. Margens bei Uhr 6, 16 grad warm,<br />
das Tages nur 22 grad warm. Wieder stärke<br />
Nordwind. Da Brante Peter Barkmans, Rosenfeld,<br />
ab [die Mühle], es war bei 4 Uhr, Vesper. Da waren<br />
die Kinden in Rosenfeld. Es war meine Frau der Tag<br />
über Krank. Sie konnte schlecht aufstieg.<br />
13. August. <strong>Die</strong>nstag. Das Margen ist 12 grad warm.<br />
Das Tages ist 19 grad warm. Wind. Meine wieder<br />
nach Rosenfeld. Er bei bei alte Penners geholt,<br />
nach unsere Penners, Uhr 6 das Morg: da gebarm.<br />
eine Tochter ubr. des abends also sie gut 1 Stunde<br />
aufs härste, also ist gut 2 Stund nach....<br />
18. August. Donnerstag. Morgens 19 grad warm,<br />
später 19. Noch viel Wind. Da war hier bei Kl.<br />
Reimer der Warutewas krank [ein Arbeiter], er war<br />
so 3 Tage sehr krank. Unsere Pennersche in<br />
Rosenfeld war vormittage sehr Krank.<br />
4. September. Fritag. Des margens ist 6 grad warm.<br />
Des Tages ist 14 grad warm. Reimer bekommpt<br />
<strong>Die</strong> Tagebücher, 1870 - 1874<br />
385<br />
Peter P. Reimer (1877-1949), Enkel des Abr. Reimers.<br />
Er war Ältester der Ôst-Reserve Kleinen Gemeinde,<br />
Manitoba, ab 1926. 1948 leitete er 100 Treue<br />
Familien seiner Gemeinde nach Jagueyes, Mexiko,<br />
wo diese Gemeinschaft zu der modernen Kleinen<br />
Gemeinde mit über 2500 Glieder in fünf Ländern<br />
gewachsen ist. Foto aus East Reserve 125 Years,<br />
Seite 58.<br />
91/2 Tsch. Gerste und 8 Tsch. Haf. Dunkel, Wind.<br />
Auch sind von die Krim, Ält. [Jakob] Wiebe und<br />
Cornel. Enns hier in diese Dörfer geswesen.<br />
7. Oktober. Montag. Des Morgens so 1 grad warm.<br />
Des Tages so 5 grad warm. Sind Joh. Reimers erst<br />
fur Vesper hier. dan nach Blumenfeld nach Doctor<br />
Löwen. Schlachten hier Hein. Branten Schwein,<br />
Halfen ung jun...<br />
21. Oktober. Montag. Des morgens 6 grad warm.<br />
Des Tages 8 grad warm. Dunkel. Spät Abends 6 grad<br />
warm. Auch so die Nacht, dunkel und 6 grad warm.<br />
Da sind Klas. Reimer knecht und Kjäksche weg<br />
gegangen.<br />
26. Oktober....Abr. Reimer und Pet Kah. die kammen<br />
mit meine Frau auch nach Rosenfeld, auch<br />
kam Kl. Reimer mit die neue Kjäksche auch nach<br />
Rosenfeld nach unsere Friesens und nahm meine<br />
Frau mit nach Hause.<br />
28. Oktober. Mitwoche....Ich war bei unsere<br />
Friesens. Da war sie wieder krank. Auch hatte ich<br />
ein bischen Fiber. Auch hatte die Grünfelder ihren<br />
Ältester Peter Töws, Blumenhof bestätigt.<br />
17. Dezember. Donnerstag. Auf morgens ist auf<br />
nul. Das Tages ist 2 grad warm. Da fing die Ritsch
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
an zu laufen. Auch sol die Nepre hoher sein als im<br />
Frujahr.<br />
Jan. 2, 1871. Sonnabend. Des Tages so 3 grad kalt,<br />
dunkel. Es waren auch Ältester Abraham Friesen<br />
und mein Schwager Peter Friesen von Neu<br />
Marienthal bei Johann Friesens in Rosenfeld.<br />
Jan. 26, <strong>Die</strong>nstag. Des margens 14 grad kalt, des<br />
Tages 12 grad kalt. Stark ost Wind und Stimmte<br />
sehr. Hat Goossen in Anafeld Verlobung. Auch war<br />
ein Schuster Jud hier und näht.<br />
Feb. 10, Mittwoch. Des margens 9 grad kalt, des<br />
Tages 3 grad kalt. Dunkel, still und Schneut sehr.<br />
Solten auf die zuruck Reise von Korkof so vor 3<br />
Wochen 40 Man russen mit war und 40 Pherd Tod<br />
gefroren. Auch sollte 7 Russen Arbeiter gefrohren<br />
by Katrins.<br />
16. Februar. Des margens 1 grad warm. Des Tages<br />
gut 4 grad warm. Al Dag regen. Süd Wind, auch hat<br />
Pet Reimer verkaufen seinen Stal und Katstäd mit<br />
Siemens seine Halbe Feuerstell almont: laß aus<br />
schrieben.<br />
17. Februar. Des margens gut 2 grad warm.<br />
Vormittag 3 grad warm. auch hat es nacht oft<br />
geregnet. Da ist das Waßer eben so hoch gekommen<br />
als es aufs Höhste war und war früh margens<br />
da mußten sie aber aus die Simlin Waß schäupfen,<br />
der Hirt zog zum Dorf.<br />
25. Februar. Des margens so 3 grad kalt. Des Tages<br />
1 grad warm. Spät Abends so 1 grad warm. Auch<br />
war unser Abr. Friesen von Rosenfeld hier und<br />
kaufte Pet. Reimer ihr Stal und die Halbe<br />
Feuerstelle vor 2000 rubel und Ab. Frie. seine<br />
Feuerstelle 3000.<br />
11. März. Donnerstag. Des Morgens so auf nul und<br />
das Tages so 3 grad warm. War klar und nord Wind.<br />
Auch ist Peter Penner und Unger und Martin<br />
Klassen von Anafeld mit dem über der Ritsch<br />
fahren aber in Busaluk gefalen.<br />
12. März. Fritag. Das Morgens 5 grad kalt. Das Tag 4<br />
1/2 grad warm. Nord Wind. Haben [Jakob] Klassen<br />
und Peter Friesen hier al jeder je 1 Margen Weitzen<br />
gesät und gepflugt.<br />
13. März. Sonabend. Des margens so 3 grad kalt.<br />
Des Tages 5 1/2 grad warm. Ganz klar, fast still.<br />
Beim Sawatke ging es wieder gut durch zufahren...<br />
14. März. Sontag. Des Margens so aufs nul. Des<br />
tages 7 grad warm. Klar, Kalter nord Wind. Auch<br />
war in Heuboden bei David Klassens Andacht.<br />
Haten wir mit ____ zusammen Andacht. Da Lehrte<br />
Joh. Friesen. Auf waren al die Kinder von<br />
Rosenfeld.<br />
25. März. Donnerstag....Habe ich die Glock rein<br />
386<br />
gemacht. Auch hat Joh. Friesen uns bericht das wir<br />
ferner hin immer mit Heubodner wollen die<br />
Andacht zusammen halten. Es ist noch immer<br />
Frost in die Erde.<br />
29. März. Montag....Da war keine Andacht. Aber in<br />
Heuboden war Andacht. Da war von unsere wol<br />
keiner da. Da ist es mit die Vereinigung fast wieder<br />
vorbei weil auch in Bruderschaft die meiß nich bei<br />
Stimmten. Auch waren al die Kinder hier.<br />
21. April. Montag...Peter Reimers sind nach ihre<br />
Feuerstelle gezogen. Hier Siemens nach Molotsch<br />
gefahren. <strong>Die</strong> Kalber sind ausgetrieben.<br />
22. April. <strong>Die</strong>ngstag. Des margens 10 grad warm.<br />
Des Tages so 15 grad warm. Es Regnet hier...Ist Kl.<br />
Reimer und Hein. Brand nach Nicopol gefahren, de<br />
galt da Weit 10.25 rubel aber die Kartoffelen galten<br />
nur 8 rubel Dest.<br />
8. Mai Sonnabend....Auch sind unsere Abr. Friesens<br />
hier von Rosenfeld; auch war hier ein Griecher mit<br />
seine Waren, auch sind Siemens am 5ten nach<br />
Haus gekommen.<br />
6. Juni. Sontag....Da führen Joh. Reimers mit den<br />
langen Wagen nach Scharlach holten sich eine<br />
Kjäksche; auch waren Töwse. Da kam Waldheim<br />
Barkmans.<br />
21. Juni. <strong>Die</strong>ngstag. Des margens so 17 grad warm.<br />
Des Tag so 25 grad warm. War Dunkel, Wind. Hier<br />
fing Pet. Friesen an Gerst zu Hauen. <strong>Die</strong> war gut<br />
Halbreif. In Blumenhof wird al Rog und Gerst<br />
gehauet.<br />
14. August. Sonabend. Es war 18 grad warm, das<br />
Tages gut 25 grad warm. War klar, fast still, ein bischen<br />
Wind. Fuhr ich mit Kl. Reimer uhr 1/2 2 nach<br />
Nicopol: zu Jahtim: kam so um 7, hier ab. Er war al<br />
2 Tage gefahren. Es fuhren auch Töwsen, Pet.<br />
Reimers und Joh. Reimers, aber mit Weitzen. Es galt<br />
so 8 rubel, 70 cop.<br />
4. Sept. Sonabend. Das Morgen so 5 grad Warm, des<br />
Tages gut 8 grad warm. Dunkel. Wind, nördöst. Kalt<br />
so das auf viele stellen hier wird eingehitzt im Ofen.<br />
Auch wird al sehr die Erdschochen und gelbe<br />
Rüben aus gegraben. Hein. Brandt hat sein Zaun<br />
gebaut.<br />
4. November. <strong>Die</strong>ngstag. Des margens so 5 grad<br />
warm, des Tages bis 9 grad warm. Dunkel. Fast still.<br />
Da mußten al die Wirten vom Dorf nach Nicolaihof<br />
nach die Molotsch fahren, und mit den<br />
Friedensrichter reden und mußten eins in die<br />
Russchen Seele liste ein schrieben laßen und von<br />
Gefängnis bewacht. und Gegängenen fuhren wir<br />
durch freigelaßen.<br />
6. November. Sonnabend. Des nacht 6 grad warm.<br />
Des Tage 9 grad warm. Dunkel, Südwind. Da
Kapitel 65 Steinbach – Kusmitskoje<br />
schlachten wir bei Kl. Reimers 3 Schwiene. 1 hat so<br />
4 zoll und die andere so 3 zoll. In al so 8 Eimmer<br />
Schmolt. Auch sind die Wirten al den 5ten um 10<br />
1/2 uhr zuhause gekommen. Auch hat der alte<br />
Penner in Rosenfeld am 1ten Nov. da am Weg noch<br />
Rog gesät.<br />
9. November. <strong>Die</strong>ngstag. Des margen so 4 grad<br />
warm. Des Tages so 6 grad warm. Dunkel. Ist hier<br />
ein Deutscher Doctor aus Deutschland nacht<br />
gewesen. Auch schlacht hier Machlinsk 2<br />
Schweine, oder Stärk. 1 war 2 1/2 zol und im al so 6<br />
eimmer Schmolz. Auch hat Hein. Friesen in<br />
Rosenfeld noch Rog gesät.<br />
26. November. Fritag. Des margens 2 grad warm.<br />
Südwind. Es war klar. Des Tages 8 grad warm. Auch<br />
hollen wir alle Tage noch was von Joh. Reimers hier.<br />
Auch war Abr. Reimer hier von Blumenhof zu mittag<br />
und Vesper. Auch sind die Lehrer zusammen<br />
gewesen in Blumenhof. Auch sind hier Töwsen<br />
Vorge Sonab. zu Hause kommen von die Molosch,<br />
sind so 15 Tage weg.<br />
Klaas Reimer (1770-1837) seine Kjist.<br />
Wahrscheinlich hat Klaas Reimer diese Kjist von<br />
Preußen 1804 nach Russland gebracht. 1875 ist sie<br />
mit der Familie seines Sohnes Klaas nach Jansen,<br />
Nebraska, gekommen. Heute ist diese Kjist das<br />
Eigentum von Susanna Reimer Penner, Spanish<br />
Lookout, Belize (links), die auf dem Bild mit<br />
Schwester Tina Reimer <strong>Plett</strong> steht. <strong>Die</strong> Frauen sind<br />
Töchter von Kornelius R. E. Reimer (1902-59),<br />
Enkel des Abr. Reimers, und Ältester der Kleine<br />
Gemeinde in Mexiko von 1950 bis zu seinem Tod.<br />
Foto aus Preservings,Nr. 12, Seite 93.<br />
387<br />
4. Januar, 1872. <strong>Die</strong>nstag. Des Margens so 4 grad<br />
kalt. Des Tages bei 2 grad warm. Sind gestern<br />
unsere Friesens bei Töwsen gewesen. Auch hat Kl.<br />
Reimer seine Kjäksche geholt, ist auch eine<br />
Katerina. Er giebt gut 100 rubel.<br />
23. Januar. Sontag. Des Margens ist 20 grad kalt.<br />
Des Tages bei 4 grad kalt. Es war klar, still. Da war in<br />
Rosenfeld eine Lehrerwahl. Da wurde der Diacon<br />
Lehrer in Hochfeld Ab. Löwen und Diacon Jakob<br />
Kroeker in Heuboden. Auch war Abends und fast<br />
die ganze Nacht fast der Ganze Himmel Roth und<br />
Weide gelbe schtriefen.<br />
8. Februar. <strong>Die</strong>nstag. Des Morgens so an 16 grad<br />
kalt. Des Tages gut 6 grad kalt. klar. So Nordöst<br />
wind. Auch ist Pet. Reimer und unsere Abr. Friesen<br />
von Rosenfeld dem 3ten nach Nicopol gefahren<br />
und Holz kauft. zum Wohnhaus, Scheune und<br />
Tritmühle bauen, 32 Fuhren. Da kammen die<br />
Letzten Fuhren.<br />
18. Februar. Fritag. Des Morgens 8 grad kalt.<br />
Dunkel. Südwest Wind. Und des Tages so 2 grad<br />
Warm. Des Abends so 2 grad kalt. Auch sollte die<br />
große Stadt Fischer [?] in Kleinasien so anfangs<br />
____ von die Erdbebung fast ganz sein zu Grunde<br />
gegangen.<br />
21. Februar. Montag. Des margens ist 5 grad kalt.<br />
Der Tages so 1 grad kalt. Dunkel, ware mord wind,<br />
auch warm. Auch waren unsere Penners von<br />
Rosenfeld hier zu vesper auch unsere Töwsen.<br />
Auch fahren Kl. Reimer so ihre 4 nach Sawitke und<br />
Pachten da Land zu 2:00.<br />
24. Februar. Donnerstag. Des Morgens 1 grad kalt.<br />
Des Tages 1 grad warm. Immer Dunkel. Wares Süd<br />
Wind. Auch fuhren Kl. Reimer und ihre mehr nach<br />
Sawitke und brachten ihm den Kontrakt warin das<br />
Land verschrieben war, mit land ist 350 Dißtin.<br />
26. Februar. Sonnabend. Des Margens 1 grad kalt.<br />
Des Tages 1 1/2 grad warm. Sehr Dunkel, still. Al<br />
zogen unsere weg, nach die Alt-<strong>Kolonie</strong>n die neue<br />
Dörfer ist bei 30 werst. Auch hat unsere Abr. ein<br />
neue Schweinestall gemacht. Der kost 17 rubel und<br />
mit der Zaun, in alem 18 rubel.<br />
28. Februar. Montag. Des Morgens so 1 grad warm.<br />
Des Morgens geregnet. Sehr Dunkel. So Südwind.<br />
Da hollen sie al Gestern den neuen Schulehrer Fast<br />
hier auch kamm. der Besluk bei so 1 1/2 mehr<br />
Wasser. Auch war der Schulehrer das Abends hier.<br />
3. März. Fritag. Des Margens 1 grad warm. Des<br />
Tages über 6 grad warm. Sehr still bis Mittag. Nach<br />
Mittag klar. Sonnenschien. Und war 6 Uhr Abends<br />
noch 6 grad warm. Auch kam das Margens viel<br />
Wasser. <strong>Die</strong> Ritsche voll so bei 3 Fuß höher als erst<br />
war.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
4. März. Sonnabend. Des Margens so 1 1/2 grad<br />
warm. Des Tages dunkel, Südöst wind und so 7 1/2<br />
grad warm. Auch kam des Margens so 1/2 7 des<br />
höchste Wasser. Es war so 1 Arschin höher als<br />
zuvor. Auch Trieb die Ritsch sehr voll Eis. Das<br />
Wasser war 10 Schritt ab von die bl. Schmid.<br />
5. März. Sontag. Des Margens 1 grad kalt. Des Tages<br />
4 grad warm. Südwind, Dunkel. Abends klar. Auch<br />
war in Blumenhof Andacht. Aber von hier war<br />
keiner da, denn es kannte keiner über die Ritsch.<br />
Auch holte hier Janzen sein Kind von Heuboden,<br />
zur ______.<br />
13. März. Montag. Des Margens ist 1 grad Kalt.<br />
Dunkel. Kalt Südwind. Fing Pet. Reimer, Abr.<br />
Friesen und Joh. Reimer und mehr sehr an zu<br />
Pflugen und Säen. Des Tages so 5 grad warm.<br />
Zogen Buhlers her von Rosenfeld und Gernalskor<br />
zogen nach Klar Pwrantez [?].<br />
11. April. <strong>Die</strong>ngstag. Des Margens so 8 grad warm.<br />
Klar. Still. In Rosenfeld ist es 20 grad warm gewesen,<br />
aber in Blumenhof ist 27 grad warm gewesen.<br />
Da führen auch Ab. Dicken von Anafeld und ihre<br />
Großeltern, Alte Hein. Reimers von Blumen. nach<br />
der Molotsch spatzieren.<br />
11. April. Sontag. Östern. Des Margs. ist 6 grad<br />
warm. Über des Tages 16 grad warm. Etwas dunstig.<br />
Still. Auch war in Heuboden Andacht. Es war<br />
von uns keiner da. Auch ist unserer Vetter Pet.<br />
Friesen von Rudnerweide da von die Molasch.<br />
5. Juni. Mitwoche. Des Margen 12 grad warm. Des<br />
Tages so bei 21 grad. Wolk. Da wir ale beide in<br />
Grünfeld in die Andacht. Da war auch<br />
Bruderschaft: von alt. Abr. Friesen in Rosenf. und<br />
von eine Schule oder Kirch bauen in Blumenh. Und<br />
der Gert. Warkentin helt an, und wir waren auch<br />
bei Abr. Reimers zu mittag.<br />
24. Juli. Montag. Des Margens ist 7 uhr al 23 grad<br />
warm. Des 28 grad warm. De wooll. stapt Südwind.<br />
<strong>Die</strong> Nacht blitzt er oft überal. Gluh ist her al Sonab.<br />
abends frißt Wasser kamm. Gestern Margen kamm<br />
es er ubral 1 zol hoh und die bruk wol ganz vol und<br />
dies Ende lauft uber dem Dam. Auch ist gestern<br />
Pet. Reimer das Schußin. gemert.<br />
29. August. <strong>Die</strong>ngstag. Des Margens so 6 grad<br />
warm. Klar, nach mitag wind. Da für ich mit<br />
Siemens und Kröker nach Kaußant. nacht den<br />
Jahrmarkt. und war so 5 stund weg. Des Tages war<br />
es 20 grad warm. Auch waren Abr. Reimer von<br />
Blumenh. hier zu mit. und vesper.<br />
2. Sept. Sontag. Des Margens so 5 grad warm. Des<br />
Tages so 15 grad warm. Dink. so nordwind. Auch ist<br />
gestern Spät nachmittag hier Abr. Friesen mit 12<br />
tchwert Weitz nach Nicop. gefahren. Da galt der<br />
388<br />
Weitzen von 9 rubel 90, und etwa bragen 10 und 20<br />
Cp. Auch ist Gößen in Grünfeld begraben.<br />
10. Sept. Sontag. Des Margens so 6 grad warm. Des<br />
Margens sehr nebl. Des Tag wölk, westwind und 29<br />
grad in Blume. Auch war da das erste mal Andacht<br />
in die neue Schul. Da waren so über 200 Leute, und<br />
war auch etliche Familie von die Molochn. auch<br />
brachte dar al. 3 Lehr, Löwen, und Klassen, und<br />
Töws.<br />
13. Sept. Mitwoch. Des margens so 3 grad warm.<br />
des Tag so 18 grad warm. So Südöstwind. Da kam<br />
hier Töws zurruck von Nicop. Hat 5 Tschert Weitz<br />
Verkauft als 10 rubel. Auch ist alte Joh. Warkentin<br />
Hochfeld wird abgebrant, seine Kornige wrstall<br />
verbrant und an Geld 3400 rubel und Vieh 500 verlust.<br />
26. Sept. <strong>Die</strong>ngstag. Des Morgens so fingen sie hier<br />
an rog zu säen. Auch war in Scharlach<br />
[Scholowkovo_____] Jahrmark. Da war Klas Reimer<br />
und Joh. Reimer. Da waren viel Arbeiter billig Preis.<br />
Es war so 16 grad wa. Klar.<br />
30. Sept. Sonnabend. Des Margens ist 5 grad warm.<br />
Des Tages Wind still. Ist 1 gra. wa. Da ging ich nach<br />
Rosenf. nach unsere Penners. Da hat die<br />
Machlimsche al 3 tage gewaschen und abends<br />
führte er uns nach Hause. Auch sind Joh. Friesens<br />
von Nicolaithal hier und,...<br />
8. Okt. Des margens hat es stede 2 grad frohren.<br />
Des Tages 12 gra. wa. klar. stil. Da fuhr ich von<br />
Rosenf. mit Schellenberg nach Blumen. nach die<br />
Andacht. Da lehrte Töws, auch wird vorgelesen<br />
und geret was sie in Petersberg geredet haben und<br />
das die reise so in 24 Tag 160 rubel gekostet hat.<br />
12. Okt. Donnerstag. Des marg. ist 5 grad wa. Des<br />
Tag ist 15 gr. wa. dunk. was es reging neuanlage.<br />
klar. stil sehr schön. Und auch war in Blumen. in<br />
die Schule bruderschaft da die Ält. Töws und Abr.<br />
Friesen ihr Krim fahr. da mit dem Kaiser zu reden.<br />
12. Nov. Sontag. Des Marg. ist 2 grad wa. dunk<br />
kalter östwind. Wieder in Blumenh. Andacht. War<br />
auch etwas bruderschaft von wegen einer Wolost<br />
zu bauen, und sedten mit den zereden.<br />
15. Nov. Mitwoch. Des margens ist 3 grad warm.<br />
Des Tag ist 7 grad warm. Dunk. Frost, stil. Da kam<br />
ein Preus, 8 Okt. 19 Jahr, ein Michael Blok. Der vermiete<br />
sich hier bei Kla. Reimer. Drei Jahr zu 80 rub.<br />
Auch holte uns. Abr. Penner meine Frau nach ihren<br />
nach Rosen.<br />
18. Nov. Sonnabend. Des margens so 3. Des Tag so<br />
8 grad. wa. Dunk. stil. Nach mitag Wolk. Auch war<br />
Abr. Reimer hier von Blumenh. Auch ist so von<br />
<strong>Die</strong>nst. bis Freit. die Woche beredet das in<br />
Nicolaith. bei die Altkolonier einen Wolost sol aufs
Kapitel 65 Steinbach – Kusmitskoje<br />
das Jahr gebaut werden.<br />
13. Dez. Mitwoch. Des margens so 8 grad kalt,<br />
dunst, fast still. Des Tages so 3 grad kalt. Abr.<br />
Friesen die Frau krank. Waren wir bei Kl: Branten,<br />
wieder ein Begrabniß und meine [Frau] ist den Tag<br />
über da gewesen und hat ihr Kl. angezogen. Auch<br />
hat unsere Kuh noch gekablt und hate ein bol.<br />
27. Dez. Mitwoch. Des margens aus 3 grad warm.<br />
Hat die nacht geschneut so 1 zol. Durch des Tages<br />
ist 4 1/2 grad warm, dunk, still. Da war in<br />
Blumenhof ein Bruderschaft. Wurde junge Pet.<br />
Harms gesondert wegen Ehebrucht ausicht mit ein<br />
<strong>Die</strong>nstmädchen.<br />
3. Januar, 1873. Mitwoche. Des margen so 3 grad<br />
warm. Wolk. Etwas so Westwind. Auch hat uns alte<br />
Kl. Reimer gestern auch 2 rubel geld gegeben, aber<br />
er ist denn doch noch 1 rub. rest geblieben. Auch<br />
war Hein. Friesen von Rosenfeld hier hate 2<br />
gedruckte Briefe, mit von die gesetzen die in<br />
Petersburg an gegeben.<br />
5. Jan. Fritag. Des margens gut 2 grad warm. Wolk.<br />
Des Tages so 6 grad warm. Südwind. Auch zogen<br />
Machlinehes wieder von Grünfeld. Es half ihm so<br />
Titel-Blatt von Ält. Klaas Reimers (1770-1837),<br />
Petershagen, Mol., Bibel, gedruckt 1664. Foto von<br />
Henry Fast/Aus Saints and Sinners,Seite 70. 1827<br />
hat die Kleine Gemeinde das erste Buch unter al<br />
die Russlandmennoniten gedruckt, eine ubersetzung<br />
des "Spiegel der Gierigkeit," von Pieter<br />
Pieters (1574-1651), ein Ältester der Waterländer<br />
Gemeinde in Holland.<br />
389<br />
das ganzes Dorf. Holen wol so stück 11 wagens her,<br />
denn er kaufte sich die Hirte Simlin, zu 15 rub.<br />
13. Jan. Sontag. Des margens so 1 grad warm. Wolk:<br />
Ware Sonneschein. Südöst östwind. Auch war die<br />
Busuluk bis gut gegen uns ganz aufgethauet. Auch<br />
ist Joh. Reimer sein Vieh weggegangen. Auch<br />
fuhren Peter Töwsen nach Rosenfeld, und ihre<br />
Russche Kjäkjsche hat ausgedient.<br />
22. Jan. Montag. Des margens ist 8 grad kalt. Des<br />
Tages so 1 grad kalt. Klar so Südöst Wind. Auch<br />
waren alte Joh. Warkentins und junge Isak Warkent.<br />
bei uns zu vesper. Später auch fuhr hier Töws und<br />
Kl. Reimer so ihre 8 nach Katrinsl. mehl zu kaufen.<br />
Auch war Peter Enns der von Berdjansk den Herbst<br />
nach Kutschebo zog hier abends.<br />
1. Feb. Donnerstag. Des margens so 1 grad kalt. Da<br />
schneit es sehr so bis vesper. War viel Schnee, so bei<br />
5 zol. Dik und Hugel so 3 Fus, gegen abend stümtes<br />
etwas, war so nord Wind. Auch kamm Ält. Töws<br />
und Abr. Loewen zu Hause von der Molosch. Auch<br />
kamm hier Pet. Friesen zurruck von Blumenfeld<br />
von Doct. Loewen.<br />
4. Feb. Sontag. Des margens gut 10 grad kalt. Fast<br />
stil. Des Tages so 6 grad kalt. Da waren die Kinder<br />
ohne die Friesens aber in die Andacht in<br />
Blumenhof. Da war eine Große Bruderschaft. Da<br />
wird Cornelius Töws von Grünfeld gestimmt als<br />
gedeptierten mit Dav. Klassen von Heuboden nach<br />
Amerika zu besehn. Der Mak. vor 1500 ru. Auch<br />
wird mit Joh. Wark. geredet vom gebiets lohn, das<br />
heilt bis so 1/2 6 abends.<br />
13. Feb. Donnerstag. Des margens so 2 grad warm.<br />
Da kam die Ritsch so hoch das die Brück ganz<br />
unter; da die Leute mußten bei Sawitske durch<br />
fahren. Und hier waren die Päln. am Teg so unter.<br />
Waren aber die Schlitbahn.<br />
18. Feb. Sontag. Des margens so nul. Des Tages so<br />
Wolk, fast stil. 2 grad warm. Da fuhren hier die<br />
Kinder fast ale nach Blu. nach die Andacht, aber<br />
Joh. Reimer blieben auf dem Dam hier liegen das<br />
die andere ihnen mußten zuruck helfen als das von<br />
hier keiner in die Andacht gewesen. Und der neue<br />
Lehrer Ja. Barkman, Predigte in Friedensfeld.<br />
1. März. Donnerstag. Des margens ist 2 grad warm.<br />
Des Tages so 7 grad warm. Wol fast stil. Es war noch<br />
wieder Schnee auf die Step. Auch waren Abr.<br />
Dicken hier zu vesper und <strong>Die</strong>d. Isaken waren noch<br />
auf dem Schlithen bei Abr. Friesens zu vesper. Auch<br />
solten die 2 Huterthaler nach Heub. kommen um<br />
zu reden von Amerika zu fahren.<br />
2. März. Fritag. Des margens so 3 grad warm. Des<br />
Tages so an 11 grad warm. Wolk. Etwas Südöst<br />
Wind. Da war auch bei Franz Krökers Verlobnung
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
mit ihre Kjäkjsche und Corn. <strong>Plett</strong>, oder alte. Abr.<br />
Rempel seine Tochter Helena. Auch ist alte Peter<br />
Thiesche in Neuanlage gestern begraben, ist alt<br />
geworden 65 Jahr, im Ehestand gelebt so 42 Jahr<br />
[die Mutter von Abr. T., Neu-Halbstadt, Seite 247].<br />
24. März. Sonabend. Des margens so 3 grad warm.<br />
Wolk. Fast stil. Das Tages so 11 grad warm. Und<br />
wird noch sehr gepflugt den es ging diese Woche al<br />
sehr gut Pflug. Auch ware Abr. Reimer von<br />
Blumenhof hier Spatzieren und bracht Kl. Reimer<br />
das Martyrbuch mit und holen da ja ale<br />
Martyrbücher die von Amerika geschickt sind.<br />
15. April. Sontag. Des margens so 6 grad warm. Des<br />
tages bis 12 grad warm. Dunk. Etwas Östwind. Da<br />
fuhr ich mit Kl. Reimer ihr 6 margens nach<br />
Rosenfeld nach Abr. Penners und die fuhren erst<br />
Uhr 8 margens ab nach die Maloch nach die<br />
Barche [Bergensche] in Alexanderwohl da sie sich<br />
wolte Curen laßen. Und meine Frau ist dar nacht<br />
gewesen...<br />
23. Mai. Montag. Des margens so 13 grad warm.<br />
Des Tages so 25 grad warm. Sich waren mit Hein.<br />
Bran. die Kinder ihre Poken ist am schlimmsten.<br />
Maria ihre Augen waren beinahe zu. <strong>Die</strong> Brandche<br />
konte stets nicht mehr reden. Auch ist die Pet.<br />
Reimerche wied. gelind. Aber Montag Scheen zu<br />
Sterben.<br />
26. Mai. Sonnabend. Des margens so 13 grad<br />
warm. Des Tages am 25 grad warm. Dunk. Etwas so<br />
Südwest Wind. Mit die Hein. Brandsche nam es<br />
immer ab. Es sind noch Posatsch dabie. Sie bekam<br />
viel Hitz. Auch waren ale wacht immer Leute dar. 2<br />
nacht alte Hein. Reimer von Blumenhof, die<br />
mitelzte 1 nacht und mehre von andere Dörfer. <strong>Die</strong><br />
alt und mitelzte waren etwas hier.<br />
9. June. Sonnabend. Des margens so 12 grad warm.<br />
Wolk. Fast stil. Auch ging ich uhr 9 margens nach<br />
Pet. Reimers da hat es mit sehr abgenomen. Aber er<br />
liesß so als konne sie bis abends oder auch wol bis<br />
margens leben. Aber 1/2 10 nam es sehr ab mit die<br />
luft bis uhr 11 vormit. Da starb sie und war alt 23<br />
Jahr und 6 monat. Des Tages so 21 grad warm.<br />
19. Juni. <strong>Die</strong>ngstag. Des margens so 14 grad warm.<br />
Des Tages so 24 grad warm. Fast stil. Da waren Ab.<br />
Reimers bei Töwsen zu fahren dar zu mit. bei uns<br />
zu vesper. Auch ist so Sontag das Schrieben gekommen<br />
von Amerika von David Klassen und Corn.<br />
Töws. Von jeder 2 Briefe aber sie wollten noch über<br />
700 werst fahren. so im Westen.<br />
22. Juni. Freitag. Des margens so 14 grad warm. Des<br />
Tages so 24 grad warm. Dunk. Ist Süd Wind. Nach<br />
mitag regnete es so das Wasser stand. Aber an beide<br />
Seit regnete es viel mehr und war auch gewiter.<br />
390<br />
Auch fing der Schnit Jüd Wilem, da al mitwoche an<br />
zu schneiten. Auch ist gestern alte Isak Löwen,<br />
Heuboden, gestorben.<br />
23. Juni. Sonnabend. Des margens so 13 grad<br />
warm. Des Tages so 21 grad warm. Östwind, regnet,<br />
so mehr fast stil. Da Thielte Pet. Reimers an Elizab.<br />
425 rub. [Autor D. <strong>Plett</strong> seine Großmutter]. Sein<br />
Vermögen war 850 rub. Auch ist alte Isak Löwen in<br />
Heub. bei großer Jakob Friesen begraben und ist alt<br />
geworden 86 Jahr wenig. 2 Woche. Er ist über 232<br />
kinder Großvater und 145 leben noch....<br />
30. Juni. Sonnabend. Des margens so 15 grad<br />
warm. Des Tages so 25 grad warm. Wolkig. Fast stil.<br />
Da fuhren wir nach Frühstük mit P. Reimer nach<br />
Blumehof. nach Corn. <strong>Plett</strong>en nach Pet. Reimer<br />
sein Verlobung. Da waren wol gut 84 Personen<br />
da....Auch sind ab im Montag alt. Isak Löwen sein<br />
Bücher und al seine Sachen verkauft.<br />
17. Juli. <strong>Die</strong>ngstag. Des margens so 14 grad warm.<br />
Des Tages so 22 grad warm. Wolk. Auch ist gestern<br />
wol bald nach mittage ein Große Russen Hund der<br />
Tol Wus, hier in die Schmied unter den Jeuer hnerd<br />
unt. gekorchen und ist erst so uhr 7 abends gesehen,<br />
und ist von Kl. Reimer sein Russ und uns.<br />
Friesen mit Heu gabel Tod gestochen.<br />
26. August. Sontag. Des margens fruh 14 grad warm<br />
und uhr 8 al 18 grad warm. Und des Tages war gut<br />
20 grad. Wolk. Nach mitag nördöst Wind. So abends<br />
noch 16 grad warm. Da war in Blumenhof<br />
Bruderschaft von die Hauser verkaufen und<br />
Amerika ziehen. Und sind die Molosch. Rempels al<br />
Fritag nach Rosenfeld gekommen. Auch sind Abr.<br />
Penners al Freitag hier spaz. und ich heut in Ros.<br />
5. Okt. Freitag. Des margens so 4 grad warm. Des<br />
Tages so 14 grad warm. Klar, stil. Auch waren wol<br />
Abr. Penners bei uns. Auch kam der Franz<br />
Neustätger von Kutschebe des Abends hier nach<br />
Schulehrer Fasten. Auch sind so diese Kaufleute<br />
gewesen von Hochstadt die wollen hir das ganze<br />
Dorf kaufen und baten von land und Häuser 40<br />
rub. per desjetin.<br />
19. Okt. Freitag. Des margens so nul und an stellen<br />
ist die Ritsch zu gefroren. Des Tages so 10 grad<br />
warm. Wolkig. Des abends kam ich mit Wilms und<br />
Pet. Reimer und Kl. Reimer nach Hause [von<br />
Rosenf.]. Da waren Wilms abend hier nacht. Auch<br />
handelten die Kolnisten hier sehr um das Land<br />
aber sie boten nur 34 rub. disjetin.<br />
29. Okt. Montag. Des margens so 3 grad warm.<br />
Dunk. regnesch, so Westwind. Des Tages so 8 grad<br />
warm. Da kammen noch gestern nachmitag<br />
wieder 20 Man, kolnisten, etliche von Felsenbach,<br />
und von andere Dörfer, auch von die Molosch. Es
Kapitel 65 Steinbach – Kusmitskoje<br />
waren 4 wagens, die kauften des ganzes Dorf, die<br />
desjatin fur 37 rub., es wurde so Vesp. erst zu<br />
geschl. und gaben 300 rub. Handgelt. Sie waren bei<br />
Friesens zu vesper und abend kost, und so Halb 11<br />
fuhren sie Weg....<br />
22. Nov. Donnerstag. Des margens so 1 grad kalt.<br />
Des Tages es an 5 grad warm. Wolk. So Süd Wind.<br />
Auch wurde sehr geschaft zum Ausruf. Auch waren<br />
hier ihre mehr so zweiflich, nach Amerika zu<br />
ziehen. Auch die Grünfelder waren fast mutloß ob<br />
sie noch auf das Fruhjahr nach säeten und erst<br />
dem Herbst nach Amerika ziehen.<br />
24. Nov. Sonnabend. Des margens so auf nul. Woll<br />
so Südwind. Aber kalt. Des Tages ist 5 grad warm.<br />
Auch waren heut oder gestern Kaufleute die wollen<br />
das ganze Blumenhof kaufen und boten al 37 rub.,<br />
die deutsche. Auch waren in Grünfeld rüssen die<br />
boten al 40 desjatin.<br />
27. Nov. <strong>Die</strong>ngstag. Des margens ist 2 grad kalt.<br />
Wolk. So west wind. Des Tages 2 grad warm. Auch<br />
fing sich heute des Dorfs ausruf an. Erst mit Pferd,<br />
darnach mit hornvieh. Da kammen auch Abr.<br />
Reimers zu mitag und blieben nacht. Auch war<br />
nachmit. klar. Nicht viel wind. Auch [Martin]<br />
Klassens ihre Tochter in Scharlach abends.<br />
15. Feb. 1874. Fritag. Des margens gut 4 grad kalt.<br />
Des Tages so bis 4 grad kalt. Stärk östwind. Wolk.<br />
Auch sind Joh. Reimers und Hei. Bra. nach<br />
Heuboden auch waren Krökers nach Blumenh.<br />
gefahren. Da war dir Ritsch wol 1 Fus tiefer als<br />
gestern. Auch 3 Tage ausruf in Heub. von <strong>Die</strong>ns. bis<br />
Donnerstag.<br />
18. Feb. Montag. Des margens ist 13 grad kalt. Des<br />
Tages 11 grad kalt. Heiter nord Wind, sehr kalt. Wir<br />
heiszen und andere Leute 3 mal des Tages den<br />
ofen. Auch war gestern in Heuboden so ein<br />
Deptirter von Amerika, der hat dar viel geredet, da<br />
von auch nicht als die Warheit wird sein. Denn er<br />
rathet uns sehr nach die Verreinigte Staten.<br />
1. März. Fritag. Des margens 2 grad warm. Fast stil.<br />
Des Tages so 10 grad warm. Schön klar. Da fuhre<br />
ich mit Joh. Reimer und Hein. Brand so halb 8 nach<br />
dem Stän[?]. Auch fuhren alle Männer im Dorf<br />
ohne die kolnisten, denn wir mußten dar die<br />
Bitschrift al auf 2 mal unterschrieben. Auch die<br />
Heub. und Nicolaithaler, so aber.<br />
2. März. Sonnaben. Des margens so 3 grad warm.<br />
Des Tages 7 grad warm. Südwind, dunk. regnisch.<br />
Auch kammen wos gestern 1/2 7 zu hauß. Auch<br />
ertrunken gestern gleich nachmitag dem Hag. der<br />
die bei Krökers wohnen 2 Kinder, seine Tochter<br />
aber ihre Stief Tochter von 6 Jahr und seine auch ihr<br />
Sohn von 3 Jahr. Und in die Ritsch so gegen Klas.<br />
391<br />
In den alten Zeit war es Sitte dass die Familien-<br />
Väter ihre Sippschaft für ihre Kinder<br />
auschrieben. Ält. Klaas Reimer (1770-1837),<br />
Petershagen, Mol., hat die Tatsachen seiner<br />
Familie in seiner Bibel aufgeschrieben. Foto von<br />
Henry Fast/Aus Saints and Sinners,Seite 70.<br />
Das eis war die bsteztel hieltes 1 man aus, es war.<br />
6. März. Mitwoch. Des margens so 2 grad kalt. Süd<br />
Wind. Sehr dunk. Auch hat Töws hier Kl. Reimer al<br />
Montag in die Schmied geholfen. Auch hat uns.<br />
Abr. Friesen al gestern die Kolnisten ihr Land auf<br />
die Step vermeßen geholfen. Auch haben so dienst.<br />
und mitwoche sehr gefischt.<br />
April 5. Fritag. Des Margens so 6 grad warm. Des<br />
nachts so 16 grad warm. Woll oft Süd Wind. Da<br />
kammen auch hier Pe. Buler und von Nicolaithal<br />
vom Fürstenland Jacob Friesen erst gegen abend<br />
nach Hause und sind so 4 Wochen und 5 Tage so<br />
weg gewesen, und sind in Simveropel gewesen<br />
beim Govenier und in die Krim bei Cornelius<br />
Ennsen. Der solte uns zustellen die Papieren, aber<br />
sie kön. al nun 4 Woche oder 2 Monat und wol nach<br />
länger.<br />
April 10. Mitwoche. Des margens so 1 grad warm.<br />
Des Tages so 12 grad warm. So Süd Wind. Auch<br />
haben al durch die vorige Woche al an fangt die<br />
Froschen zu Shraüen. Auch ist die Abr. Reimersche<br />
so von Montag bis <strong>Die</strong>ngstag die ganz krank gewesen.<br />
Auch ist meine Frau al von Östern gansz krank,<br />
das sie oft nicht den Tag über könte aufstehen, aber<br />
diese Woche hat sie noch sehr Halsschmerzen<br />
gehat, das wir oft daruber betrubt waren.
Kapitel 66 Annafeld – Schischkowka<br />
Ursprünglich war Annafeld ein kleines<br />
Pachtdorf mit nur acht Familien am Fluss<br />
Basawluk. Nach Johann R. Dück (1863-1937),<br />
später Rosenhof, Manitoba, liegt Annafeld dreivier<br />
km nordöstlich von Steinbach.<br />
Im Juni 1874 verzeichnete die Brandordnung<br />
der Kleinen Gemeinde in Annafeld folgende Wirte:<br />
Jakob Enns, Kornelius Friesen, Anna Friesen, Maria<br />
Friesen, Kornelius Goossen, Klaas Friesen, Martin<br />
Klassen, Elisabeth Klassen, Gerhard Siemens,<br />
Abraham Dück, Jakob Friesen, Jakob Wiebe.<br />
In der Zeit, als die Glieder der Kleinen<br />
Gemeinde hier wohnten, besuchten die Kinder die<br />
Schule in Steinbach, drei km südwestlich. Als die<br />
Kleine Gemeinde 1874 nach Amerika zog,<br />
verkauften sie das Land an deutsche Kolonisten.<br />
Annafeld<br />
Später hatte Annafeld eine eigene Schule.<br />
Nach Petermanns Mitteilungen 1898 wurde<br />
dieses Dorf nicht mehr zu der mennonitischen<br />
Wolost Nikolajthal gezählt.<br />
Das Wasser war im Sommer im Basawluk<br />
nicht hoch, so dass man ihn zu Fuß überqueren<br />
konnte. Bei Hochwasser wurden die Leute mit<br />
einem Boot, das die Familie Stobbe besaß, über<br />
den Fluss gefahren. Der Fluss war ca. 30-40 m breit<br />
und reich an verschiedenen Fischarten. Es gab hier<br />
auch Schildkröten.<br />
1906 hat einer von diesen Siedlern, Edward<br />
Goldbeck, eine Karte von diesem Dorf gezeichnet.<br />
Es kann nicht genau festgestellt werden, aber sehr<br />
wahrscheinlich könnte Annafeld das heutige Dorf<br />
Schischkowka sein.<br />
Karte des Dorfes Annafeld, Borosenko <strong>Kolonie</strong>. Gezeichnet von Edward Goldbeck, 1906.<br />
392<br />
N<br />
W<br />
E<br />
S
Kapitel 67 Felsenbach - Marinopol<br />
Isaak Derksen schreibt in seinem Buch Es<br />
wurde wieder ruhig, Seite 4: ...Felsenbach wurde<br />
von 35 Familien am Fluss Basawluk gegründet.<br />
Seite 15: ...Am 06.12.1919 wurde angesagt,<br />
dass dieses Dorf an der Reihe sei, von der<br />
Machnobande besucht zu werden. Es war<br />
dunkel, als ein langer Treck mit Wagen und<br />
Reitern kam. <strong>Die</strong> Erde war gefroren, und man<br />
hörte die Wagen und die Pferde von weitem<br />
kommen. Wer flüchten konnte, der floh. Ich lag<br />
im Gebüsch auf dem Eis. Unter mir hatte ich<br />
Rohr. Unser Dorf war umstellt. Im russischen<br />
Dorf Scharapowo war ein Herr Solonskij, der<br />
eine Bande führte. <strong>Die</strong>se Gruppe nannte sich<br />
Selbstbeschützer und bestand aus etwa 90<br />
Personen. Der Onkel von Solonskij war 13 Jahre<br />
Hirte in Felsenbach gewesen. Er rief jetzt seinen<br />
Neffen ins Dorf, und es fand eine Beratung in der<br />
Kirche statt. Durch Solonskij wurde der<br />
Mordanschlag auf Felsenbach verhindert... Auch<br />
aus Scholochowo kam eine Weiße Garde. Als<br />
diese den Berg am Basawluk erreichte, sahen sie,<br />
dass Felsenbach umstellt war. Sie richteten ihre<br />
Pferde mit dem Hinterteil nach Felsenbach und<br />
brachten ihre Maschinengewehre in Bewegung.<br />
<strong>Die</strong> Bande musste aus dem Dorf flüchten. Als es<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaft von Abram Derksen in Felsenbach. Der Hof war winkelartig<br />
angelegt, mit einem großen Stall. Foto aus Peter (Isaak) Derksen, Es wurde<br />
wieder ruhig (Winnipeg 1989), Seite 7. Aufnahme aus dem Jahre 1928/Foto aus<br />
Preservings,Nr. 17, Seite 136.<br />
393<br />
Karte des Dorfes Felsenbach, Borosenko <strong>Kolonie</strong>.<br />
Gezeichnet von D. <strong>Plett</strong>, Steinbach 1998.<br />
dunkel wurde, kamen sie zurück nach<br />
Felsenbach. Es wurden doch noch einige<br />
Personen ermordet und 12 schwer verletzt...<br />
Aron Peters, dessen Haus heute noch in<br />
Felsenbach steht, war<br />
der Großvater von<br />
Jakob Sawatzky, heute<br />
wohnhaft in White<br />
Rock, BC, Kanada.<br />
Jakob Sawazkys<br />
Bruder Franz<br />
Sawatzky wurde 1941<br />
von den Nazis zum<br />
Tode verurteilt, weil er<br />
sich gegen ihren<br />
Umgang mit den<br />
Juden äußerte.<br />
E<br />
Zum Nachlesen:<br />
Jakob Sawatzky, “From<br />
Servant to Master”,<br />
Errinerungen, 60<br />
Seiten.<br />
N<br />
S<br />
W
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Das Haus von<br />
Abram Derksen in<br />
Felsenbach. Es stand<br />
längs der Straße. Es<br />
wurde 1912 aus<br />
gebrannten Ziegeln<br />
gebaut und hatte<br />
ein Zinkblechdach.<br />
Es war das schönste<br />
und größte Haus im<br />
Dorf. Foto aus Peter<br />
(Isaak) Derksen, Es<br />
wurde wieder ruhig,<br />
Seite 7.<br />
<strong>Die</strong> Dampfmühle in Felsenbach am Südende des Dorfes. Peter (Isaak) Derksen schreibt in seinem Buch Es<br />
wurde wieder ruhig, dass sie einem Franz Fröse, der 1919 von den Machnowzy auf dem Eis zerhackt<br />
wurde, gehörte. <strong>Die</strong>se Mühle hatte schon einen Benzinmotor, aber wurde immer noch Dampfmühle<br />
genannt. Foto: Mai 2000.<br />
Das Dorf Felsenbach mit der Fröse-Dampfmühle von der Rückseite. Aussicht vom Südwesten, vom<br />
Feldweg aus Schischkowka. Foto: Mai 2000.<br />
394
Kapitel 67 Felsenbach - Marinopol<br />
Geschichte eines Predigers.<br />
Peter (Isaak) Derksen wurde am 30.01.1905 in<br />
Felsenbach, <strong>Kolonie</strong> Borosenko, Südrussland,<br />
geboren. Seine Eltern waren Abram und Katharina<br />
Derksen.<br />
Schon am Anfang seines Lebens war sein<br />
Dasein nicht von guten Zeiten bestimmt. Es waren<br />
dunkle Zeiten der Revolution (1904-05), des Ersten<br />
Weltkriegs (1914), der Revolution (1917). Der Hass<br />
gegen die Deutschen hatte schwere Auswirkungen.<br />
1918–die deutsche Besatzung der Ukraine, die zwar<br />
für kurze Zeit Ruhe brachte, aber sehr bald von<br />
Zeiten der grausamsten Ereignisse überholt wurde.<br />
Derksen schreibt: "...alle Dorfeinwohner in<br />
Steinbach sind ermordet...in Annafeld wurden die<br />
Deutschen auch ermordet...Mein Bruder wohnte in<br />
Steinbach...Meinem Bruder war die rechte Hand<br />
abgehackt. Zweimal wurde er mit dem Säbel in den<br />
Kopf gehackt, zweimal wurde sein Hals<br />
durchgestochen, und dann noch einen Herzstich.<br />
Er lag im Wohnzimmer mit dem Kopf über die<br />
Schwelle. Seine Frau Greta hatte die Hände voll<br />
Brotteig. <strong>Die</strong> Mulde mit dem Teig stand auf dem<br />
Ofen, der Teig übergegangen und vom Ofen herabgeflossen.<br />
Ihr war der Schädel gespalten..." Peter<br />
(Isaak) Derksen, Es wurde wieder ruhig, (Winnipeg<br />
1989), Seiten 9-11.<br />
Trotz all dieser unmenschlichen Verhältnisse<br />
ging das Leben weiter: "Ich fütterte bei uns und vielen<br />
anderen das Vieh, das vor Hunger brüllte. <strong>Die</strong><br />
Pferde fraßen Krippen durch. Keiner war da zum<br />
Tränken und Ausmisten. Ich arbeitete von<br />
Dunkelheit bis Dunkelheit bis über meine Kräfte"...,<br />
schreibt er.<br />
Es folgen die 1920er Jahre mit Missernten,<br />
Hunger, Krankheiten, Auswanderungen,<br />
Verhaftungen und Gefängnissen. Auch das<br />
Peter (Isaak) Derksen<br />
395<br />
Glaubensleben wurde stark angegriffen. Das<br />
Christentum war geschwächt. Es waren entscheidende<br />
Momente des Glaubensgehorsams, Ihm im<br />
Vertrauen zu folgen.<br />
<strong>Die</strong> 1930er Jahre. Das Überleben stand auf dem<br />
Spiel. Kein Gemeindeleben. Enteignung,<br />
Verfolgung, Entwürdigung, Einschränkungen;–das<br />
Ziel war,–religiöse Gemeinschaften<br />
einzuschrumpfen. Und trotzdem hielten viele ihr<br />
Glaubensbekenntnis aufrecht. Isaak war ein Christ,<br />
der Gott fürchtete und nicht den Menschen; der<br />
Gott gehorsam war und nicht den Menschen. Er<br />
blieb ein Christ, auch in den schwersten<br />
wirtschaftlichen und politischen Jahren in<br />
Russland.<br />
1941. Deutsche Okkupation, Bombenangriffe,<br />
aber auch Mähen, Dreschen und Taufen. Dann –<br />
Flucht nach dem Westen. Hunderttausende Bürger<br />
begaben sich per Zug, Wagen und zu Fuß zu den<br />
Grenzen Deutschlands. Aber Gott hatte Erbarmen...<br />
Unter unmenschlichen Bedingungen wurde<br />
wieder Gottes Wort verbreitet. ...Verfolgung, Verrat,<br />
Hunger, Bedrohungen, Beleidigungen ...Ein Extrem<br />
jagte das andere, und es gab kaum Zeit, sich zu<br />
erholen, nachzudenken, nachzukommen. Eine<br />
Hast nach Überleben ...irgendwie.<br />
1945. Trotz allen Schwierigkeiten konnte er<br />
immer wieder einstimmen: "Lobe den Herrn,<br />
meine Seele..." Flucht nach Deutschland,<br />
Rückmarsch nach Russland (Sibirien), wieder<br />
Verhaftung, 10 Jahre Lagerhaft, Übersiedlung nach<br />
Kasachstan und 1979 nach Deutschland,<br />
Espelkamp.<br />
Aber ..."es ist eine Geschichte, die noch nicht<br />
zu Ende ist, und keiner kann sagen, wann sie es sein<br />
wird", schreibt Peter (Isaak) zum Schluss in seinem<br />
Buch.<br />
Beim Planen einer Reise nach<br />
Kanada anno 1926. Peter<br />
(Isaak) Derksen mit seinen<br />
Schwestern Agatha, Anna,<br />
Susanna und Katherina, und<br />
Mutter Derksen. Nach Jahren<br />
von Folterung, Gefängnisse<br />
und Schwerer Sklavenarbeit<br />
trat Isaak Derksen in den<br />
Ruhestand in Paderborn,<br />
Deutschland. Foto aus P.<br />
Derksen, Es wurde wieder<br />
ruhig,Seite 38.
Kapitel 68 Schöndorf - Nowosofijewka<br />
Schöndorf hat heute noch immer (im Jahre<br />
2000) eine große Anzahl mennonitischer Häuser.<br />
<strong>Die</strong> ehemaligen mennonitischen Dörfer<br />
Schöndorf und Nikolajthal sind mit der Zeit zu<br />
einem Dorf namens "Nowosofiewka" zusammengewachsen.<br />
Nikolajthal war der Sitz der<br />
Borosenko Wolost mit dem Namen "Nikolajthaler<br />
Wolost", die 1872 gegründet wurde. Heute ist hier<br />
eine Kolchoszentrale.<br />
Frank Dyck, der Missionar in Saporoschje in<br />
den 1990er Jahren, hat viele Jahre in Nikolajthal<br />
gewohnt.<br />
Ein mennonitisches Haus im Original in Schöndorf,<br />
Borosenko. Es steht an der Südwestseite des Dorfes und<br />
ist das Haus von Cornelius Penner, dem Großvater von<br />
Harold Jantz, Winnipeg, Manitoba, der dieses Haus<br />
1999 besucht hat. Foto aus Preservings,Nr.15, Seite 77.<br />
Harold Jantz, früher Redakteur der "MB Herald", Winnipeg, Kanada, und die heutige Wirtin von C.<br />
Penners Haus. Original erhalten geblieben ist auch die Schlaf-oder Ruhbank, auf der die beiden sitzen.<br />
Was für ein Erlebnis für H. Jantz! Foto aus Preservings,Nr. 15, Seite 78.<br />
396
Kapitel 68 Schöndorf - Nowosofijewka<br />
Ein Haus in Schöndorf. Ist wahrscheinlich auch sehr umgebaut worden. Foto: Mai 2000.<br />
Ein mennonitisches Haus in Schöndorf. Foto: Mai 2000<br />
Ein Haus am Südende (Westseite) des Dorfes. Es könnte die Schule von Schöndorf gewesen sein. Foto: Mai<br />
2000.<br />
397
Kapitel 69 Ebenfeld – Uljanowka<br />
Heute ist es ein zweireihiges russisches Dorf.<br />
Ebenfeld lag ungefähr neun Werst westlich von<br />
Nikolajthal entfernt. ...Nach 1919, als alle<br />
Einwohner von Machno ermordet worden waren,<br />
ist auch das mennonitische Dorf vernichtet worden.<br />
Als Machno mit seiner Bande dieses Dorf besuchte,<br />
forderte er Geld. Da die Einwohner wahrscheinlich<br />
nicht genügend Geld hatten, schlachtete er das Dorf<br />
aus. Eine Frau konnte sich im Schornstein verstecken<br />
und blieb somit am Leben. Das Massengrab<br />
E<br />
N<br />
S<br />
W<br />
Karte des Dorfes Ebenfeld, Borosenko <strong>Kolonie</strong>.<br />
Gezeichnet von D. <strong>Plett</strong>, Steinbach 1998.<br />
398<br />
befindet sich an der Ostseite des Friedhofes. Um<br />
heute (2001) zum Friedhof zu kommen, muss man<br />
über ein Privatgrundstück gehen. Der Eigentümer<br />
dieses Grundstückes, geboren 1920, erzählte, dass<br />
um den Friedhof (1865-1919) herum früher ein<br />
Ziegelzaun war. Seit 1919 ist hier niemand mehr<br />
begraben worden. Es steht nur noch ein Grabstein,<br />
die anderen wurden gebraucht, um im Dorf einen<br />
Kolchosstall zu bauen. Jetzt liegt auch der Stall<br />
schon in Trümmern.<br />
Johann Bergen, geboren 1895 in Steinbach,<br />
Borosenko, und ermordet in Ebenfeld, am 7.<br />
Dezember, 1919. Foto von der Nichte Margaret<br />
Bergen, Winnipeg, der Schwester an Marie Bergen,<br />
Frau von John Schroeder (1938-96), Eigentümer<br />
von Assiniboine Travel, Winnipeg, der viele Reisen<br />
nach die Ukraine in den 1980er Jahren gestaltet<br />
hat. Foto aus Preservings,Nr. 11, Seite 42.<br />
Ein Kolchosstall in<br />
Ebenfeld, der 1997 abgebrochen<br />
ist. Für den Bau<br />
wurden Grabsteine vom<br />
mennonitischen Friedhof<br />
genommen. Einer von den<br />
Grabsteinen, der 1999 noch<br />
in der Wand war (siehe<br />
kleines Foto), liegt heute<br />
(2000) daneben.<br />
Wahrscheinlich brauchten<br />
die Dorfbewohner<br />
Baumaterial und haben<br />
den Stall abgebrochen.<br />
<strong>Die</strong>ser Grabstein gehört<br />
Maria Teichröb (1840-<br />
1911). Foto: Mai 2000.<br />
Kleines Eckfoto aus<br />
Preservings,Nr.15, Seite 76.
Kapitel 69 Ebenfeld – Uljanowka<br />
<strong>Die</strong> Gedenkfeier einer Gruppe aus Kanada, der „Kleine Gemeinde Heritage Tour" im Mai 1998, auf dem<br />
Friedhof in Ebenfeld, Borosenko <strong>Kolonie</strong>, zu Ehren, der am 17. November 1919 von Machno ermordeten<br />
Ebenfelder und Steinbacher. Foto aus Preservings,Nr. 12, Juni 1998, Seite 43.<br />
Friedhof in Ebenfeld. Vorne steht Prediger Frank Dyck. Aussicht zum Süden. <strong>Die</strong> Opfer des Massenmordes<br />
von 1919 sind am Ostende des Friedhofs beerdigt worden. Foto aus Preservings,Nr.12, Juni 1998, Seite 43.<br />
Jakob Bergen (1872-1941) und Katharina Teichröb Bergen (1872-<br />
1919) mit ihren Kindern Johann (1895-1919) und Jakob (1897-<br />
1991), die in Steinbach, Borosenko, geboren waren. Dann zogen die<br />
Eltern nach Ebenfeld, Borosenko. Jakob war der Vater von Margaret<br />
Bergen, Winnipeg, Manitoba, Kanada. Katharina Teichröb Bergen<br />
wurde auf eine brutale Weise von den Machnowzy am 04.12.1919<br />
ermordet. Foto aus Preservings, Nr. 11, Seite 41. In seinen<br />
"Erinnerungen" schrieb Abram A. Enns von dem Massenmord in<br />
Steinbach und Ebenfeld: ,,Am 2. Nov. 1919 kammen die Banditen<br />
nach Ebenfeld und forderten Kleider von Kornelius Loewen. Sie warfen<br />
ihn zu Boden und prügelten ihn schrecklich. Nachts schossen sie<br />
ihn durch den Körper. In seiner Not kroch er zu den Nachbarn. Bei<br />
den Nachbarn vergewaltigten die Banditen seine Frau vor ihm.<br />
Dann schloss er seine Augen für immer....Etliche Tage später haben<br />
die Bandtien Frau Jakob Bergen, die nach Felsenbach geflüchtet war,<br />
ermordet. Erst hackten sie ihr die Hand ab. Den nächsten Morgen<br />
haben sie sie erschossen." Aus Preservings,Nr. 16, Seiten 88-89.<br />
399
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Bericht von Heinrich Epp 1900-89<br />
Machnozeiten, 1919.<br />
Unser Nachbar, ein Russe, gab uns noch sein Pferd<br />
Es war Ende Oktober, als ich meinen Wohnort und fuhr auch mit uns. Wir waren zu dritt: der<br />
von Felsenbach nach Schöndorf verlegte. Es war Nachbar, der Bruder meiner Frau, Franz und ich.<br />
Kriegszeit. <strong>Die</strong> meiste Zeit waren wir ohne In Ebenfeld angekommen versteckten wir unsere<br />
jeglichen Regierung, ohne Gesetz, ohne Polizei. Pferde im Stall. Von Haus zu Haus gingen wir zu<br />
Tagsüber waren es Landsleute aus den Fuß und konnten all die Mordtaten kaum fassen.<br />
Nachbardörfern, die die mennonitische Dörfer Zuerst gingen wir ins Haus von Johann<br />
immer wieder besuchten und jedesmal mitnah- Schmidt. Onkel Schmidt saß tot in seinem Bett.<br />
men, was immer ihnen gefiel: Pferd,Kuh, Wagen Der Flur war mit Federn bedeckt. <strong>Die</strong> Wände ver-<br />
oder Pflug.<br />
rieten den Kampf ums Leben in seinen letzten<br />
Nachts wurden wir meistens von Banden Minuten. Alles war mit Blut verschmiert. Man<br />
besucht, so auch dieses Mal. Es war Sonntag hatte ihm in den Kopf gehackt.<br />
Abend, als 12 Reiter unser Dorf besuchten. Ihr Dann gingen wir zu Kornelius Löwen. Das<br />
Führer, Schurka genannt, war ein Jude. Er befahl Rindvieh war an den leeren Krippen angebunden<br />
jedem Wirt, mit seinem gesamten Geld beim und brüllte vor Hunger. Wir ließen es los, damit es<br />
Dorfvorsteher J. Funk zu erscheinen. Bei Funk in sich selber im Hof Futter suchen konnte.<br />
der Großstube waren Musikinstrumente. Auf Das nächste war das Haus meiner Cousine<br />
Befehl musste sein Sohn Kirchenlieder spielen, Maria Penner, die mit einem Hildebrandt ver-<br />
und der Führer versuchte zu tanzen, zuerst heiratet war. Das Bild hier war unbeschreiblich<br />
alleine, dann nahm er abwechselnd einen Wirt grausam. In der Eckstube lag Frau Hildebrandt auf<br />
zum Partner. Als er merkte, dass es den Wirten dem Rücken ganz entkleidet. Einer ihrer Arme lag<br />
peinlich war zu tanzen, machte es ihm erst recht mitten im Zimmer. Ihr jüngstes Baby lag tot in der<br />
Spaß. Er holte seine Peitsche von draußen und Wiege.<br />
schlug ihnen auf die Beine, damit sie die Beine Wir kamen zu Quirings. Der Onkel und sein<br />
höher heben sollten. Er provozierte die Wirte, Schwager A. Penner aus Blumenhoff lagen tot in<br />
damit er dann Ursache hatte, sie zu töten. <strong>Die</strong> den Betten. Dem einen hingen seine Beine über<br />
alten Männer hatten den Tod ständig vor Augen die Bettkante und es war zu sehen, wie man ihm<br />
und taten alles, was ihnen befohlen wurde. Der das Fleisch von den Beinen in Streifen geschnitten<br />
Führer reichte seinen Säbel herum, dann musste hatte. Einige Familienangehörige konnten sich<br />
jeder den küssen, sonst gab es eine Ohrfeige oder durch Flucht retten.<br />
sonst etwas. Ein alter Mann, der angeblich nicht Bei Bernhard Penners lag der Onkel im<br />
genug Geld gebracht hatte, musste sich ganz Esszimmer unter dem Tisch. Dort lagen auch<br />
ausziehen und sich mitten im Raum auf den noch einige von seinen Kindern. Sie versuchten zu<br />
Boden setzen. Er wollte ihn mit seinem Säbel in Peter Epp zu flüchten, kamen aber nicht weit. <strong>Die</strong><br />
Stücke zerhacken, aber das ließ seine Mannschaft Mörder holten sie unterwegs ein und zerhackten<br />
doch nicht zu... An diesem Abend wurde niemand sie. So fanden wir sie tot im Hof liegen.<br />
getötet.<br />
Bei Peter Epp ging ich nicht ins Haus. <strong>Die</strong><br />
Anfang Dezember erhielten wir die schreck- Eltern mit ihrem Sohn lagen tot im Haus. <strong>Die</strong><br />
liche Nachricht, dass Steinbach und Ebenfeld aus- Tochter jedoch fehlte.<br />
geschlachtet worden waren. Am 7. Dezember kam Abram Penners Frau war Vaters älteste<br />
ein Mann namens Fuhrmann zu uns ins Haus und Schwester. Mit ihnen lebte ihre Tochter van<br />
teilte uns mit, dass Vaters Bruder Kornelius Funk Kampen mit Familie (eine Witwe). Alle neun<br />
aus Steinbach und ein Teil seiner Familie von der Personen waren in der Sommerstube tot auf<br />
Bande ermordet worden sei. Einige von den Funk- einem Haufen, einige ganz entkleidet. Einer von<br />
Kindern sollten überlebt haben und wanderten den van Kampens Söhnen atmete noch, starb aber<br />
schwer verwundet im Dorf herum. Es musste Hilfe einen Tag später. Der älteste Sohn Jakob überlebte,<br />
geleistet werden, aber es war auch gewagt sich in weil er gerade nicht zu Hause war.<br />
die Nähe der Mörder zu begeben. Wir hatten noch Wir gingen zurück zu unserem Fuhrwerk. Ich<br />
ein lahmes Pferd im Stall stehen und einen Wagen. konnte mir dieses alles nicht mehr ansehen und<br />
400
Kapitel 69 Ebenfeld – Uljanowka<br />
wollte auch nicht, denn ich zitterte am ganzen<br />
Leibe. Wir gingen bei Jakob Bergens vorbei. Zu<br />
Hause war nur der eine Sohn Johann. Tante<br />
Bergen wurde einige Tage später in Felsenbach<br />
von den Banditen erkannt und auf eine<br />
schändliche Art und Weise ermordet. Onkel<br />
Bergen und die Kinder Jakob, Heinrich und<br />
Susanna blieben am Leben, da sie sich in<br />
Felsenbach versteckt hatten.<br />
An der anderen Straßenseite lebte <strong>Die</strong>trich<br />
Penner. Ein Sohn kam mit einem Schuss ins Bein<br />
doch noch mit dem Leben davon. Der älteste, der<br />
an der Universität in Charkow studierte, war gerade<br />
zu Hause. Er versuchte auch zu flüchten,<br />
wurde aber von den Mördern auf halbem Wege<br />
eingeholt. Zuerst wurde ihm ein Bein abgehackt,<br />
und dann wurde er ganz getötet. Der dritte Sohn<br />
<strong>Die</strong>trich ergab sich selbst den Mördern, und<br />
wurde auch auf der Stelle getötet, nachdem er<br />
gesehen hatte, was mit seiner Familie passiert war.<br />
Auch in die Schule waren die Mörder eingekehrt<br />
und hatten den Lehrer getötet.<br />
Im ganzen zählte man 67 Personen, die an<br />
einem Tag getötet wurden.Ebenfeld war ein Ort, in<br />
dem ich gerne gewesen bin. Ich kannte dort jeden,<br />
und auch mich kannte jeder.<br />
Das ganze Dorf war voller Russen aus den<br />
Nachbardörfern. Sie kamen, um nachzusehen, ob<br />
sie noch etwas für sich retten konnten, und nahmen<br />
auch alles, was sie konnten, mit. Eine Frau<br />
drehte einen Toten um und zog ihm den Mantel<br />
aus. Dabei behandelte sie ihn wie ein Stück Vieh.<br />
<strong>Die</strong> Russen hatten uns schon im Auge, und es war<br />
höchste Zeit, das Dorf zu verlassen.<br />
<strong>Die</strong>se meine letzten Erinnerungen an<br />
Ebenfeld werde ich nie vergessen.<br />
Wir begaben uns auf den Weg nach Steinbach,<br />
ca. 3-4 Meilen von Ebenfeld entfernt. Von den<br />
Russen erfuhren wir, dass im Dorf noch drei<br />
Schwerverwundete am Leben waren: Anna<br />
Neufeld, Liese Funk und ein Junge von 10-12<br />
Jahren. Peter Neufeld, der Bruder von Anna, konnte<br />
aus dem Dorf flüchten. Anna konnte wieder<br />
ganz gesund werden. <strong>Die</strong> anderen beiden sind<br />
kurz danach gestorben. Weiter sind wir nicht in<br />
die Häuser gegangen, denn der Tag ging zu Ende.<br />
Bei uns zu Hause hatte sich eine Menge<br />
neugieriger Nachbarn versammelt und auf die<br />
Nachricht aus Ebenfeld und Steinbach gewartet.<br />
Es wurde gleich auch eine Gruppe von Männern<br />
organisiert, die am nächsten Tag die Leichen in<br />
401<br />
diesen Dörfern begraben sollten. Ich meldete<br />
mich dieses mal nicht, denn meine Nerven waren<br />
zu stark angegriffen.<br />
In Steinbach wurden die 54 Leichen am 9.<br />
Dezember in einem Massengrab begraben.<br />
In Ebenfeld wurden sie (67 Personen) einige<br />
Tage später begraben. <strong>Die</strong> Tage nach diesen<br />
Mordtaten waren für uns schrecklich, denn wir<br />
lebten in ständiger Angst. Wann wird unser Ende<br />
kommen? Mit diesen Gedanken beschäftigten wir<br />
uns Tag und Nacht, bis dann am 3. Januar 1920 die<br />
Rote Armee aus dem Norden zu uns kam und uns<br />
von den furchtbaren Banden befreite. Sie setzten<br />
dann auch eine Regierung ein.<br />
Der volle Text des Heinrich Epp Berichtes ist in<br />
Englisch in Preservings, Nr.8 Teil II, Seiten 5-7,<br />
veröffentlicht worden. <strong>Die</strong>ser Bericht ist durch freundliche<br />
Vermittlung von Heinz Dyck, Grant<br />
Cresent, Calgary, Kanada, dem Bruder des<br />
Missionaren Frank Dyck, zugeschickt worden.<br />
Anna Warkentin, Großtante an Tina Warkentin<br />
Peters, Winkler, Manitoba. Anna wurde während<br />
des Massenmordes Steinbach am 7. Dezember,<br />
1919, ermordert. Foto aus Preservings, Nr. 16,<br />
Seite 90.
Kapitel 70 Grünfeld - Seljonoje<br />
Das Dorf wurde 1867 von sieben Familien<br />
aus der Kleinen Gemeinde gegründet. <strong>Die</strong> Hälfte<br />
des Dorfes war russisch und nannte sich<br />
"Gerwerf", die andere mennonitische hieß<br />
Grünfeld. Es lag 24 Werst nördlich von Heuboden<br />
am Fluss Seljonaja. Unter den Einwohnern waren<br />
Kornelius Löwen (1827-93), später Steinbach,<br />
Manitoba, und der Schullehrer Abraham Isaak<br />
(1852-1938), später Grünfeld, Manitoba.<br />
Der Name "Seljonoje" bedeutet aus dem<br />
Russischen übersetzt–"grün". Es war ein<br />
zweireihiges Dorf mit Fluss und Tränke in der<br />
Mitte. Es ist ein km lang und liegt in einem<br />
flachen Tal mit wunderschöner Aussicht. Nach<br />
dem II. Krieg haben Ukrainer und Russen aus<br />
den Nachbardörfern die Häuser, die noch zu<br />
bewohnen waren, besetzt. Eine Frau erzählte,<br />
dass sie mit Familie 1953 nach Grünfeld gezogen<br />
sind, und sie waren immer noch auf Leichen<br />
vom Zweiten Weltkrieg gestoßen. Etliche<br />
Gebäude im Südosten des Dorfes stehen noch<br />
als Ruinen.<br />
402<br />
Karte von Grünfeld, Borosenko <strong>Kolonie</strong>. Gezeichnet<br />
von D. <strong>Plett</strong>, Steinbach 1998.<br />
W<br />
<strong>Die</strong> Straße in<br />
Grünfeld,<br />
Borosenko, in<br />
R i c h t u n g<br />
Nordost. Foto<br />
aus Preservings,<br />
Nr.15, Seite 80.<br />
<strong>Die</strong> Straße in<br />
Grünfeld,<br />
Borosenko, in<br />
R i c h t u n g<br />
Südwest. Foto<br />
aus Preservings,<br />
Nr.15, 1999,<br />
Seite 79<br />
N<br />
S<br />
E
Kapitel 71 Friedensfeld - Miropol<br />
1866 kaufte die Kleine Gemeinde aus der<br />
<strong>Molotschna</strong> 5400 Acker Land 30 km nördlich von<br />
Nikopol und gründete Friedensfeld. <strong>Die</strong> erste<br />
Ansiedlung wurde an das Westufer des Flusses<br />
Soljonaja versetzt. Der Prediger im Dorf war Jakob<br />
Barkmann (1824-75), der 1875 im Roten Fluss in<br />
Manitoba ertrank. Er war der Sohn von Martin<br />
Barkmann (1796-1872) aus Rückenau. Im Süden<br />
der Stadt Steinbach, Manitoba, Kanada, wird ein<br />
Landstück "Friedensfeld" zur Ehre des gleichnamigen<br />
Dorfes in Russland, genannt.<br />
Unter den ersten Ansiedlern war Johann<br />
Thielmann aus Neukirch, der hier einen großen<br />
Chutor gründete. Einer seiner Nachkommen ist<br />
Doktor Harry Löwen, Kelowna, B.C., Kanada, ein<br />
weitbekannter Historiker. Auch die Brüder Peter<br />
(Lehrer) und Bernhard L. Dueck, später Diakon bei<br />
der Brüdergemeinde. Bernhards Sohn Bernhard B.<br />
Dueck (1869-1936) war ein berühmter Chorleiter.<br />
Zusammen mit Johann Löwen hat er ein "Menno-<br />
Lied" für die I. Weltkonferenz der Mennoniten in<br />
Basel, Schweiz (1925) geschrieben.<br />
Peter Penner und sein Bruder Jakob (1829-<br />
97)gehörten auch zu den Ersteinwohnern von<br />
Friedensfeld. Ihr Vater Peter Penner (geboren 1799),<br />
Prangenau, <strong>Molotschna</strong>, war Prediger der Kleinen<br />
Gemeinde. Sein Sohn Jakob war einer der größten<br />
mennonitischen Landwirte in ganz Russland. Er<br />
hatte auf einmal 1000 Desjatin Land gekauft. Er<br />
hatte 100 <strong>Die</strong>ner, 100 Pferde und 100 Ochsen. Es<br />
folgten Zeiten von Missernte und Trockenheit. Er<br />
konnte seine Schulden nicht mehr bezahlen und<br />
verlor alles. Durch all diese Schicksalsschläge<br />
bekam er einen Herzschlag und starb 1897. <strong>Die</strong><br />
403<br />
Frau von Jakob Penner war die Tochter des Johann<br />
Dueck (1801-66), ein Prediger der Kleinen<br />
Gemeinde aus Muntau. Dann haben die<br />
Verwandten von Jakob Penner in Grünfeld, Kanada,<br />
Geld gesammelt, damit die Penners-Kinder nach<br />
Kanada kommen konnten. Unter diesen Kindern<br />
war Peter Penner, der in Winnipeg ein<br />
Möbelgeschäft hat. Er wird "Möbel-Penner" genannt.<br />
Sein Sohn Jakob war ein Kommunist,<br />
Rechtsanwalt und viele Jahre im Stadtrat von<br />
Winnipeg. Er wird "Kommunist-Penner" genannt.<br />
Als Stadtsratsabgeordneter hatte er sich für die<br />
Armen und Unterdrückten eingesetzt. Im Jahre<br />
2000 hat die Regierung ihm für seine Arbeit eine<br />
Anerkennung verliehen. Sein Sohn Roland Penner<br />
ist auch ein leitender Rechtsanwalt und Professor<br />
in Winnipeg gewesen und diente als Justizminister<br />
von Manitoba in den 1970er Jahren.<br />
Brüdergemeinde. Als die Kleine Gemeinde 1874<br />
nach Kanada zog, schlossen sich viele im Dorf der<br />
Brüdergemeinde an. 1875 war Friedensfeld die<br />
Filiale der <strong>Molotschna</strong>er Brüdergemeinde. Im<br />
Januar 1885 hatte sie schon 100 Mitglieder. Nach<br />
1900 wurde sie selbständig.<br />
Fahrplan: vom südlichen Ende Grünfelds fährt<br />
man 6 km westlich bis Krinitschewatoje. Auf dem<br />
Weg an der linken Seite ist das russische Dorf<br />
"Dolgowka" (das heißt "Langes Dorf"); südlich von<br />
einem hohen Hügel. In Krinitschewatoje teilt sich<br />
der Weg, man fährt links (nordöstlich) auf einen<br />
guten Landweg (nicht asphaltiert), danach noch 8-<br />
10 km bis Friedensfeld. Der russische Name<br />
„Miropol" bedeutet: Mir heißt "Friede" und Pol(e)<br />
heißt "Feld".<br />
W<br />
S<br />
Karte des Dorfes<br />
Friedensfeld. Aus O.<br />
Rempel, Einer von<br />
Vielen,(Winnipeg,<br />
1979), Seite 37/Aus<br />
Preservings, Nr. 9,<br />
Teil II, Seite 2.<br />
N<br />
E
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Friedensfeld, Borosenko. Aussicht vom Nordwestende der großen Tränke. <strong>Die</strong> Mühle steht am linken Ufer.<br />
Nach 1919 ist noch eine zweite Reihe von Häusern an der Südseite der Tränke entstanden. Foto aus Saints<br />
and Sinners,Seite 119.<br />
Eine ehemalige Mühle in Friedensfeld. 1999 war um die Mühle herum noch ein Ziegelzaun, jetzt ist er<br />
nicht mehr da. <strong>Die</strong> Innenausrüstung ist im Gebäude noch teilweise erhalten und verrottet jetzt. Hier sieht<br />
man den Anfang der Zerstörung. Foto: Mai 2000.<br />
404
Kapitel 71 Friedensfeld - Miropol<br />
Olga Rempel schreibt in ihrem Buch, Einer von<br />
vielen, Seite 38: „Es war am ersten Weihnachtstag<br />
1920. Es waren schon viele Leute im Gotteshaus versammelt,<br />
auch unsere Familie...Der Chor stimmte<br />
gerade das erste Lied an, als man draußen<br />
Pferdegetrappel hörte...Da wurde auch schon die<br />
Kirchentür aufgerissen, und mehrere bewaffnete<br />
Männer stürmten herein, ihre Gewehre auf die<br />
Menschen gerichtet. Sie schrieen, der Gesang sollte<br />
sofort aufhören, denn sie hätten etwas zu sagen. Ein<br />
lähmender Schreck war auf alle gefallen. Da stand<br />
Vater (Prediger Aron Töws) auf, bestieg die Kanzel<br />
und sagte zu den Versammelten: „Wollen nicht mutlos<br />
werden... denn wir stehen in Gottes Schutz."<br />
Dann ging er zu den Banditen und fragte sie, was sie<br />
wollten... Sie nannten eine Summe Geld, die sie<br />
haben wollten. Nach dem einige Männer aus der<br />
Versammlung und Vater das Geld im Dorf gesammelt<br />
hatten, gingen sie zurück ins<br />
Versammlungshaus...Der Dorfschmied hatte keine<br />
Ahnung von der Verhandlung mit den Banditen und<br />
feuerte einen Schuss ab, denn er wollte Vater helfen.<br />
Vater hob die Hand und schrie, er solle nicht mehr<br />
schießen. Ehe Vater sich besonnen hatte, kam auch<br />
405<br />
schon ein Bandit aus der Kirche herausgesprengt,<br />
um zu sehen, was los sei. Vater hatte ihnen versprochen,<br />
dass kein Schuss fallen würde. Als er sah,<br />
dass alles in Ordnung war, beruhigte er sich. In der<br />
Kirche wurde ihnen das Geld gegeben, und sie<br />
zogen ab! Gott hat geholfen und eingegriffen...<br />
Später beim Mittagessen zeigte Vater uns seine<br />
Hand, in der die Schrotkörner saßen, sonst aber war<br />
er heil und gesund..."<br />
Prediger und Lehrer Aron Töws ist am<br />
10.02.1887 in Fürstenau, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong><br />
geboren. Er beendete die Halbstädter<br />
Zentralschule und bestand ein Lehrerexamen in<br />
Simferopol. Seine erste Lehrerstelle bekam er 1908<br />
auf dem Gut "Alexejewka" bei Nikopol. 1910<br />
heiratete er Maria Sudermann, die Tochter des<br />
Gutsbesitzers. 1925 wurde er zum Prediger der<br />
Mennonitengemeinde in Chortitza ordiniert. 1934<br />
wurde er verhaftet und ins Gefängnis nach<br />
Saporoschje gebracht. Später wurde er nach<br />
Sibirien verbannt. 1941 erhielt die Familie die letzte<br />
Nachricht von ihm.<br />
Aus Mennonitisches Lexikon, Band IV, Seiten<br />
346-347.<br />
<strong>Die</strong> ehemalige Kirche in Friedensfeld. Heute ist hier die Schule. Foto: Mai 2000.<br />
Aron P. Töws, als junger Ehemann, 1913.<br />
Aus Olga Rempel, Einer von Vielen<br />
(Winnipeg 1979), Seite 25.
Kapitel 72 Neuanlage - Iwanowka<br />
Neuanlage - Iwanowka<br />
Am Anfang war das Dorf als Mariafeld bekannt.<br />
Nach Petermanns Mitteilungen von 1898 war der<br />
russische Name "Iwanowka". Es war die zweitkleinste<br />
Siedlung in Borosenko. Der Ansiedlungsort ist<br />
heute nicht mehr genau festzustellen. Nach einigen<br />
Informationen soll das Dorf 10 km von Rosenfeld<br />
entfernt gewesen sein. Eine andere Karte zeigt das<br />
Dorf 10 km nördlich von Rosenfeld und nördlich<br />
von dem Fluss Soljonaja in der Nähe von Grünfeld.<br />
Sehr bekannt war hier ein Großbauer aus<br />
Mariawohl, <strong>Molotschna</strong>, Johann Koop (1831-97),<br />
der später das Dorf Neuanlage bei Steinbach,<br />
Manitoba, gründete. Johann Koop war immer sehr<br />
gut zu seinen Arbeitern und hatte sie auch beim<br />
Essen in seinem Haus am Tisch dabei, was zu der<br />
Zeit nicht selbstverständlich war. Meistens aßen die<br />
Arbeiter draußen auf dem Feld. Wenn er sich aus der<br />
Stadt Arbeiter holte, wollten die Russen alle für ihn<br />
arbeiten. Koop war auch wegen seiner<br />
Nervenkrankheit bekannt. Wenn er nicht 16<br />
Stunden am Tag auf seiner Wirtschaft arbeiten konnte,<br />
bekam er einen Nervenzusammenbruch. Unter<br />
seinen Nachkommen sind der Historiker Royden<br />
Löwen und Dichter Patrick Friesen.<br />
Eine ältere Frau aus dem Dorf Grünfeld<br />
erzählte, dass das Dorf Neuanlage 2 km östlich vom<br />
südlichen Ende Grünfelds gewesen war.<br />
Wahrscheinlich war Neuanlage im II. Weltkrieg ganz<br />
zerstört worden. Das Dorf lag an einem hohen<br />
Hügel. Es könnte sein, dass dort noch der alte<br />
Friedhof zu finden ist.<br />
Es könnte das Dorf "Iwanowka" gewesen sein,<br />
das auf der Karte von 1930 noch da ist. Ganz in der<br />
Nähe liegt heute ein kleines Russendorf, genannt<br />
"Nowaja Balta" (Neu-Balta).<br />
waren die großen Familien von Peter Penner (1816-<br />
84) und Peter W. Töws (1831-1922), später in<br />
Blumenort, Manitoba, Kanada. Peter K. Barkmann<br />
(1826-1917) aus Rückenau, später Margenau, hatte<br />
in Rosenfeld eine Mühle, die 1872 abbrannte. In der<br />
Schule der Kleinen Gemeinde wurde von Lehrer<br />
<strong>Die</strong>trich S. Friesen Russisch unterrichtet.<br />
Auf einer Karte von 1930 ist das Dorf Rosenfeld<br />
noch verzeichnet mit der Bemerkung „Sanatorij Nr.<br />
7" und dem Namen "Glinjanka" ("Glina" heißt<br />
Lehm).<br />
Heute ist das Dorf nicht mehr da, aber bis 1999<br />
war hier noch ein Feldweg, der vom Nordende<br />
Nikolajthals kam, der ein Jahr später umgepflügt<br />
wurde. Bis vor ein paar Jahren war auch noch der<br />
Friedhof durch einige dort noch erhaltene Bäume<br />
zu erkennen.<br />
Hochfeld<br />
Der Chutor Hochfeld wurde 1872 von Johann<br />
Warkentin (1817-86) aus Blumstein, <strong>Molotschna</strong>,<br />
mit seinen Kindern und Schwager David Löwen<br />
(1836-1915), Lindenau, zusammen gegründet. In<br />
der Schule in Hochfeld wurde auch Russisch unterrichtet.<br />
Ein russisches Dorf namens "Wysokopolje",<br />
übersetzt aus dem Russischen „Hochfeld", liegt<br />
westlich von der Autobahn 56, in der Nähe des<br />
Flusses Seljonaja. Es könnte sein, dass dieses Dorf<br />
der ehemalige Chutor Hochfeld ist; diese<br />
Vermutung stimmt aber nicht mit einigen anderen<br />
Quellen überein.<br />
Eichengrund - Schewtschenko<br />
Rosenfeld - Ekaterinowka<br />
<strong>Die</strong> Dörfer Eichengrund und Hochstadt, waren<br />
Dörfer von deutschen Kolonisten und gehörten<br />
auch zu der <strong>Kolonie</strong> Borosenko. Später wurden<br />
noch die Dörfer Rosenthal und Lilienthal gegrün-<br />
Das Dorf lag östlich von Steinbach zwischen det. Von Eichengrund geht der Feldweg heute (2000)<br />
dem Fluss Basawluk und dem Dorf Nikolajthal und westlich, längs der Südseite einer Schlucht, durch<br />
drei km westlich vom nördlichen Ende des Dorfes die Dörfer Rosenthal und Liliental, die zu einem<br />
Nikolajthal. Es hatte viele große Wirtschaften und größeren Dorf "Maximowka" zusam-<br />
gute Häuser. <strong>Die</strong> meisten Einwohner gehörten zur mengeschlossen sind. Eichenrgund ist wahrschein-<br />
Heubodener Gemeinde, einer Filiale der Kleinen lich 1919 durch die Machnowzy ausgeschlachtet<br />
Gemeinde. Unter den Einwohnern von Rosenfeld worden.<br />
406
Kapitel 72 Neuanlage - Iwanowka<br />
Ca. 1860. <strong>Die</strong> Heinrich B. Friesen Familie von Rosenfeld, Borosenko. Er war der Großsohn von Abraham<br />
Friesen (1782-1849), Ohrloff, zweiten Ältester der Kleine Gemeinde. Seine Frau Helena, war die Tochter<br />
des Predigers die Kleine Gemeinde Abraham Friesen (1807-91), Neukirch. Er war der Bruder des Ältester<br />
Johann Friesen, Neukirch. <strong>Die</strong> Heinrich B. Friesen Familie zog 1874 nach Manitoba, Kanada, und 1875<br />
nach Jansen, Nebraska. <strong>Die</strong>ses Bild zeigt die Kleidertracht der Mennoniten zu dieser Zeit. Foto aus Saints<br />
and Sinners,Seite 82.<br />
407
Kapitel 73 <strong>Die</strong> Jasykowo <strong>Kolonie</strong><br />
Eine Ansiedlung, etwa 26 km nördlich von<br />
Chortitza entfernt, 7351 Desjatin groß, wurde 1868<br />
von der Mutterkolonie Chortitza von dem russischen<br />
Edelmann Jasykow erworben. Vier Dörfer:<br />
Nikolajfeld, Franzfeld, Eichenfeld und Adelsheim,<br />
zusammen 147 Wirtschaften zu je 50 Desjatin,<br />
wurden sofort angelegt. <strong>Die</strong>se Dörfer, zu denen<br />
später (1872) auch noch Hochfeld hinzukam,<br />
bildeten zusammen mit dem Gut Petersdorf, das<br />
35 Jahre früher angelegt wurde, den "Nikolajpoler<br />
Bezirk" mit (1911) 440 Familien (2200 Seelen).<br />
Außer diesen sechs Bauerndörfern gehörten<br />
zu Nikolajpoler Wolost noch die Dörfer Eichenfeld,<br />
Gut Paulsheim, Gut Reinfeld und etliche<br />
Einzelgüter. <strong>Die</strong> Siedler der Nikolajpoler Siedlung<br />
waren ausschließlich Mennoniten. <strong>Die</strong> Hofstellen<br />
waren ziemlich groß. <strong>Die</strong> Steppe war vollständig<br />
kahl. Es war weder Baum noch Strauch da. <strong>Die</strong><br />
Häuser der Siedler waren schutzlos dem<br />
grausamen Schneesturm im Winter und der brennenden<br />
Sonne im Sommer ausgesetzt. Auf den<br />
Hofgrenzen wurden Maulbeerhecken oder<br />
Kirschenhecken angepflanzt. <strong>Die</strong> Straße entlang<br />
pflanzte man Holzbirnen (die berühmten<br />
Kruschtje-Bäume). <strong>Die</strong> Kruschtjen waren bei den<br />
Russen beliebt. Manch ein Stück Schlachtgeflügel<br />
haben sie dafür ins Dorf gebracht (eingetauscht).<br />
1913 hatte das zaristische Russland seine<br />
Rekordernte. <strong>Die</strong> Dörfer der Nikolajpoler Wolost<br />
ernteten in dem Jahr eine Million Pud Getreide (16<br />
500 Tonnen). Dann kam der I. Weltkrieg und damit<br />
der Niedergang von Jasykowo.<br />
<strong>Die</strong> große Mehrheit der Siedler gehörte der<br />
Mennonitengemeinde Chortitza an. Das<br />
408<br />
Andachtshaus befand sich zwischen Franzfeld und<br />
Nikolajfeld. Es gab aber auch eine Gruppe in den<br />
Dörfern und auch in Reinfeld und Petersdorf, die<br />
zur Brüdergemeinde gehörten.<br />
1918 versammelte Machno die ersten<br />
Banditen um sich herum. Beim Vormarsch von<br />
Chortitza auf Dnjepropetrowsk benutzte er den<br />
großen Salztrakt, der aus der Krim nach Charkow<br />
ging. <strong>Die</strong>ser Trakt schneidet die Jasykower <strong>Kolonie</strong><br />
in zwei Teile. Östlich vom großen Wege lagen die<br />
Siedlungen Paulsheim, Petersdorf, Eichenfeld und<br />
Adelsheim. Westlich blieben Reinfeld, Nikolajpol,<br />
Franzfeld und Hochfeld. Bei einem Vormarsch am<br />
26. Oktober 1919 wurden auch alle Dörfer der<br />
Jasykower <strong>Kolonie</strong> von den Machnowzen gefüllt.<br />
Es wurde geraubt und gemordet. An dem Tage und<br />
in der Nacht wurden 109 Personen in der<br />
Jasykower <strong>Kolonie</strong> ermordet. Am 16. Dezember<br />
1919 setzten sich die Machnowzen alle in Richtung<br />
Nikopol in Bewegung.<br />
Anfang der 1930er Jahren wurden die Kirchen<br />
in der Jasykower <strong>Kolonie</strong> geschlossen. Es wurden<br />
die Kolchosen gegründet, und immer mehr<br />
Neusiedler wurden aus verschiedenen Orten in die<br />
Kolchose aufgenommen. Viele Wohnungen<br />
mussten gebaut werden. Der Bau war zu dieser<br />
Zeit doppelt so schwer, weil die Backsteine alle aus<br />
alten abzutragenden Gebäuden gewonnen werden<br />
mussten. Nur in Franzfeld wurden bis 1941 50<br />
neue Häuser gebaut. Es waren im Dorf schon 15<br />
schwedische Familien, acht Ukrainer-Familien,<br />
fünf Mischlingsfamilien und andere mehr.<br />
Zum Nachlesen: Julius Loewen, Jasykowo,<br />
(Winnipeg 1995), 120 Seiten.<br />
<strong>Die</strong> Namen der Dörfer: 1917 Heute<br />
Nikolajfeld Nikolajpol Nikolaj Pole<br />
Franzfeld Warwarowka Nikolaj Pole<br />
Eichenfeld Dubowka Nowopetrowka<br />
Adelsheim Dolinowka Dolinowka<br />
Hochfeld Morosowo Morosowka<br />
Petersdorf Peterschiwka Tscherwonyj Jar<br />
Paulsheim Iwangorod Iwangorod<br />
Reinfeld Jawornitskoje Jawornitskoje<br />
Eine Fahrkarte, die die Jasykowo <strong>Kolonie</strong> enthält, ist im Kapitel 13 "Chortitza <strong>Kolonie</strong>" nachzusehen.
Kapitel 73 <strong>Die</strong> Jasykowo <strong>Kolonie</strong><br />
<strong>Die</strong>ses Gut lag dreieinhalb (3.5) Meilen westlich<br />
von Nikolajpol und fünf Meilen nordwestlich<br />
von Petersdorf. <strong>Die</strong> Bewohner waren alle<br />
Nachkommen von Daniel Peters (1794-1879).<br />
Zwei seiner Töchter, Lena (Pauls) und Anna<br />
(Siemens), bekamen Land und waren (etwa 1875)<br />
Gründer des Dorfes Reinfeld. Es gab hier sieben<br />
Bauernhöfe. <strong>Die</strong>se zwei Familien kauften noch<br />
Reinfeld - Jawornitskoje<br />
Land dazu, und somit gehörten ihnen 1000<br />
Desjatin.<br />
1919 musste Reinfeld von allen Bewohnern<br />
verlassen werden. Sie flüchteten in andere Dörfer.<br />
<strong>Die</strong> meisten blieben von den Massenmorden verschont,<br />
außer Johann Schellenberg und Kornelius<br />
Pauls. Später sind viele Reinfelder nach Kanada<br />
ausgewandert.<br />
Karte der Dörfer der ehemaligen Jasykowo <strong>Kolonie</strong>. Aus William Schroeder, Mennonite Historical Atlas,<br />
(Winnipeg 1996), Seite 58.<br />
409
Kapitel 74 Petersdorf - Tscherwonyj Jar<br />
Daniel Peters kam als 13-jähriger 1807 aus der<br />
Danziger Gegend nach Südrussland. Er kaufte<br />
später für einen sehr niedrigen Preis etliche<br />
tausend Desjatin Land und gründete Petersdorf.<br />
Petersdorf lag etwa 18 Werst von Chortitza entfernt<br />
am großen Postweg, der nach Jekaterinoslaw<br />
führte und nur sechs große Wirtschaften hatte.<br />
Sein Sohn Franz Peters wurde am 08.09.1843<br />
geboren. Seine Frau hieß Aganetha Warkentin. Sie<br />
hatten sieben Kinder. Franz besaß 2000 Desjatin<br />
Land. In der Nikolajpoler Wolost war er in den<br />
1890er Jahren sechs Jahre lang Oberschulze. Dann<br />
war er auch noch sechs Jahre Präsident über die<br />
mennonitischen Forsteien und mehrere Jahre<br />
Mitglied im Landratsamt in Jekaterinoslaw.<br />
Am 05.11.1919 wurde er in seinem Haus von<br />
Daniel Peters (1794-1879), Gründer des Gutes<br />
Petersdorf. Foto aus G. Lohrenz, Seite 176.<br />
Machnowzen überfallen und mit den Säbeln zerhackt<br />
und so zugerichtet, dass er vier Stunden<br />
später starb. Sein jüngster Sohn Kornelius, 32<br />
Jahre alt, der auf dem Hof wohnte, wurde vor der<br />
Tür erschossen. Am 18.11.1919 wurde sein ältester<br />
Sohn Daniel in Nikolajpol erschossen.<br />
<strong>Die</strong> noch Überlebenden mussten das Dorf<br />
räumen. <strong>Die</strong> meisten flüchteten nach Nikolajpol.<br />
1920 wurden die Gebäude abgebrochen, und<br />
Petersdorf hörte auf zu existieren. Später bauten<br />
Russen sich auf diesem Platz armselige Hütten<br />
auf. <strong>Die</strong> Gärten waren vertrocknet, die Brunnen<br />
eingefallen.<br />
Drei Familien von Franz D. Peters Kindern<br />
kamen nach Kanada, die übrigen sind in Russland<br />
geblieben.<br />
Franz Peters (1843-1919), Sohn von Daniel Peters.<br />
Er wurde ermordet. Foto aus G. Lohrenz, Seite 176.<br />
Johann Peters (1864-1919) und Frau Agatha. Foto Johann Peters (1888-1919) und Frau Maria,<br />
aus G. Lohrenz, Seite 176.<br />
geborene Siemens. Foto aus G. Lohrenz, Seite 176.<br />
410
Kapitel 74 Petersdorf - Tscherwonyj Jar<br />
Victor Peters (1915-98) - Akademiker<br />
Victor Peters wurde am 27. Juli 1915 in benutzt zu haben." Es wurde nie wieder zum<br />
Petersdorf, Jasykowo <strong>Kolonie</strong>, Südrussland, zur Gesprächsthema. <strong>Die</strong> Ironie ist, dass alle meine<br />
Zarenzeit geboren und starb in Michigan auf dem Lehrer in Landmark "Russlenda" waren.<br />
Weg von seinem Heim in Winnipeg, um die Beachtet die Fähigkeit der Lehrerschaft: Dr.<br />
Stratford-Festspiele in Ontario zu besuchen, am 9. Peters internationaler Historiker; seine Frau, Dr.<br />
September 1998.<br />
Elisabeth Peters, Proffessorin bei Universität von<br />
Victor Peters kam gerade vor Ausbruch des Manitoba; Anne Ediger, spätere Missionarin in<br />
Zweiten Welt-krieges als Lehrer in die Ostreserve Indien und Direktorin für das gesamte christliche<br />
Manitobas, Kanada. Seine erste Stelle war in Radio dort; Frank Neufeld, Schulinspektor. Wie<br />
Barkfield in der Nähe von Grünthal; dann kam er anders wäre unsere mennonitische Gesellschaft in<br />
nach Landmark, wo er drei Tage in unserem Heim Manitoba gewesen, wenn die Geschichte nicht<br />
zu Gast war.<br />
diese "Russlenda" aus der Ukraine vertrieben und<br />
Er hatte den Horror der russischen Revolution in unsere kanadischen Prärien gebracht hätte!<br />
und des Bürgerkrieges durchlebt, wo er Zeuge der Viele Beamte waren bei seiner Beerdigung<br />
Ermordung seines Großvaters und seines Vaters (ganz in Deutsch) zusammengekommen, um<br />
durch die Machno -Banditen war. Trotz der Not dieses Leben zu ehren, das sich vom zaristischen<br />
nach ihrer Ankunft in Winkler half ihm seine harte russischen Reich zur nachsowjetischen Zeit, in die<br />
Arbeit und akademische hervorragende Leistung, wir gekommen sind, spannte. Wegen seines<br />
ein anerkannter Lehrer zu werden. <strong>Die</strong> letzten Fortgangs sind wir alle ärmer geworden. Mit<br />
Jahre in Russland waren bitter gewesen. <strong>Die</strong> seinem Abscheiden hat unsere mennonitische<br />
deutsche Kultur, die sie gepflegt hatten, wurde Gemeinschaft einen ihrer führenden Historiker<br />
ihm sehr wertvoll.<br />
verloren.<br />
Sein Aufenthalt in unserem Heim hoben den Auszug aus einem Bericht von Wilmer<br />
Kontrast zwischen dem Leben der ,,Kanadja" und Penner, Box 1305, Steinbach, Manitoba, ROA 2A0,<br />
,,Russlenda" Mennoniten hervor. <strong>Die</strong> Lehre in aus Preservings, Nr. 13, Seite 58. Wilmer Penner,<br />
unserer "Kleinen Gemeinde" war, dass das Landmark, Manitoba, ist ein berühmter<br />
Weltliche unter allen Umständen vermieden werden<br />
muss; doch in unserer Familie war es uns<br />
möglich, die Ansprachen von Hitler und Churchill<br />
auf Kurzwelle über sein Radio zu hören. Auf sein<br />
weißes Hemd (meine Mutter wunderte sich, wie er<br />
es für eine ganze Woche ohne Flecken halten konnte!),<br />
kam eine Krawatte -- für uns die erste, aber<br />
für ihn ein Zeichen seines Berufes.<br />
Aber in der Bildung war der Kontrast am<br />
meisten zu bemerken. In unserer ländlichen<br />
Gemeinschaft versuchten die Jungen sehr, vor<br />
dem gesetzlichen Ende der Schulzeit mit vierzehn<br />
die Farmarbeit zu erlernen. Victor Peters war eine<br />
Vorstellung des "Herrn Lehrer" mit dem großen<br />
Auftrag, unter diesen Ruhelosen in Klasse VIII<br />
Ordnung zu halten.<br />
Viel später vertraute mir Herr Peters an, dass<br />
ein Schulverwalter zu Weihnachten gekommen<br />
war, um zu fragen. "Bist du ein Russlenda?" "O<br />
bitte, sagen Sie es nicht zu anderen, weil wir uns<br />
plattdeutscher Schauspieldichter.<br />
entschlossen haben, solche nicht mehr<br />
anzunehmen, weil die ersten Russländer- Victor Peters (1915-98). Foto aus G. Lohrenz, Seite<br />
Schullehrer den Ruhm hatten, den Riemen zu sehr<br />
411<br />
177.
Kapitel 75 Franzfeld – Nikolaj Pole<br />
Franzfeld hatte 34 Vollwirtschaften. 1912 Siedlung gebaut.<br />
gab es in Franzfeld kein Haus mehr, das mit Buchhandel. Er wurde 1913 von Lehrer<br />
Stroh gedeckt war. Das Nachbardorf Nikolajfeld Redekopp gegründet. Er kaufte den Buchladen<br />
lag drei Viertel km von Franzfeld entfernt. Eine den Brüdern Hamm in Nikolajpol ab und<br />
schattige Allee verband die beiden Dörfer. Auf eröffnete ihn in Franzfeld. Das Geschäft arbeit-<br />
halbem Weg lag das Andachtshaus der ete bis 1919, dann wurde Redekopp von den<br />
Mennoniten-Gemeinde. Gleich neben dem Machnowzy erschossen, und das Geschäft ging<br />
Andachtshaus lag die Zentralschule. Stolz waren ein.<br />
die Franzfelder auf ihren Teich. Das Angeln war Ziegelfabrik. Sie lag hinter dem Damm des<br />
im Dorfe für jedermann frei. Zwei-drei Mal im Dorfteiches und wurde von Isaak Friesen<br />
Jahr wurde der Teich mit dem Schleppnetz eröffnet. <strong>Die</strong> Fabrik hatte zwei Öfen, jeder fasste<br />
abgefischt. <strong>Die</strong> Einnahmen für die Fische 30 000 Ziegelsteine. Sie blieb bis zum Schluss<br />
flossen in die Gemeindekasse.<br />
mennonitisches Eigentum. <strong>Die</strong> Arbeiter kamen<br />
1923 wurden in der näheren Umgebung aus Großrussland. 1914 wurde die Fabrik durch<br />
neue Russendörfer angelegt. <strong>Die</strong> Franzfelder den Krieg stillgelegt, und in den<br />
mussten auch einen Teil ihres Landes an den Revolutionsjahren (1917) wurde sie vernichtet.<br />
russischen Rayon Seljonoje abgeben. Ein Baumschule. 1908 wurde sie von G.Thiessen<br />
Streifen an der Westgrenze ging an das Dorf gegründet. Sie lag am Westende des Dorfes, am<br />
Schirokoje ab. <strong>Die</strong> Nordwestecke des Ufer des Teiches. Nach dem Krieg 1914 gab<br />
Dorflandes fiel an die Gemeinde Wolosskoje. Thiessen den Gartenbau auf. <strong>Die</strong> Baumschule<br />
Auf diesem Lande entstand eine neue Siedlung verwilderte und ging ein.<br />
mit dem Namen "Ljubow" (Liebe). Das übrige Ölmühle. Fünf Jahre hat in Franzfeld auch eine<br />
Land wurde von den Franzfeldern zu 28 Hektar Ölmühle gearbeitet. Sie wurde von den Brüdern<br />
pro Wirtschaft eingeteilt.<br />
J. und A. Braun betrieben. Doch um die<br />
Ambulanz-Klinik. 1908 baute die Nikolajpoler Jahrhundertwende wurde sie geschlossen, da<br />
Wolost ein geräumiges Haus und richtete dort sie nicht mehr den Forderungen der Zeit<br />
an einem Ende eine Apotheke und am anderen entsprach.<br />
Ende das Sprechzimmer und die Wohnung des Schule. Leider kam es im ersten Jahr nicht gle-<br />
Arztes ein. <strong>Die</strong>ses Gebäude lag am Ende ich dazu, eine Schule zu bauen. Man dingte den<br />
Franzfelds an der Allee. Anfang der 1930er Jahre Bauern G.Wölk als Lehrer für den ersten Winter.<br />
war Elfriede Becker, die Frau des Apothekers Er unterrichtete die Dorfkinder in seinem<br />
Wilhelm Tavonius aus Schönwiese, als Leiterin Wohnzimmer.<br />
der Apotheke eingestellt.<br />
Doch 1870 wurde das Schulhaus gebaut,<br />
Dampfmühle. Sie lag gegenüber der Ambulanz und ein Lehrer zog in das neue Schulhaus ein.<br />
und der Windmühle und war zweistöckig. Sie <strong>Die</strong> Schule war sehr einfach gebaut und hatte<br />
wurde in den 1890er Jahren von D. Letkemann ein Strohdach. 1890 brannte diese Schule ab. In<br />
erbaut. 1917 ist die Dampfmühle heil durch den dem selben Jahr wurde eine neue gebaut. 1910<br />
Krieg gekommen. Sie wurde von einer wurde der Bau vergrößert, und es wurden<br />
Produktionsgesellschaft wieder instand gesetzt Lehrerwohnungen eingerichtet. <strong>Die</strong> Lehrer hat-<br />
und arbeitete 1943 immer noch.<br />
ten bis zu 60 Kinder zu unterrichten.<br />
Windmühle. Sie stand an der Nordwestecke des Kolchos-Kuhstall. Er wurde in den 1930er<br />
Dorfes gegenüber der Dampfmühle. Der Jahren in dem Wirtschaftsgebäude des Jakob<br />
Besitzer war J. Epp.<br />
Fröse eingerichtet. Hier waren Scheune und<br />
Kaufladen. Er wurde von einem der ersten Stall unter einem Dach, und die Bauten waren<br />
Siedler, A.Wieler, in den ersten Jahren der aus Backsteinen.<br />
412
Kapitel 75 Franzfeld – Nikolaj Pole<br />
Kolchos-Schweinestall. Er lag gegenüber dem<br />
Kuhstall in dem Gebäude des verbannten<br />
Franzfelders Franz Peters in den 1930er Jahren eingerichtet<br />
worden. Hier waren Wohnhaus und Stall<br />
unter einem Dach. Er wurde noch um 42 Fuß vergrößert.<br />
Peters-Hof-Komplex. Peter Epp aus Bielefeld,<br />
Deutschland berichtet in Der Bote, Nr.3 1993 auf<br />
Seite acht folgendes: "...<strong>Die</strong>se Familie Peters ging<br />
ca. 1923 nach Kanada. Frau Peters war eine<br />
geborene Wieler. Ihre Wieler-Geschwister gingen<br />
alle nach Kanada, außer ihrem Bruder Johann<br />
Wieler. <strong>Die</strong>sem Johann Wieler hinterließen die<br />
Peters den ganzen großen Hof. In den 1920er<br />
Jahren verpachtete Johann alle Häuser an verschiedene<br />
Organisationen und Wohnungsmieter...<br />
...Haus Nr. 1 (siehe Plan) hatte die Kooperation<br />
gepachtet und einen Laden eingerichtet. In der<br />
Kooperation waren alle Einwohner des Dorfes<br />
Mitglieder, also gehörte der Laden dem Dorf. Nach<br />
1930 wurde der Laden ganz nach dem Ostende des<br />
Dorfes, in ein Haus, das Heinrich Peters gehörte,<br />
verlegt. H. Peters wurde ausgesiedelt...<br />
...Haus Nr. 2 war ein Wohnhaus mit einer offenen<br />
Veranda. Johann bewohnte in diesem Haus nur<br />
ein Zimmer, die anderen Zimmer vermietete er.<br />
Nach 1930 wurde in diesem Haus die<br />
Kolchosverwaltung und "Rote Ecke" eingerichtet.<br />
<strong>Die</strong> Mieter, Familie Kornelius Epp, mussten<br />
ausziehen....<br />
...Haus Nr. 3 war der Stall mit Scheune. Ein<br />
Ende des Stalles wurde vom Dorf gemietet. Dort<br />
standen die Rassenzuchtbullen der Rasse<br />
"deutsche rote Kuh". Nach 1930 wurde in dem Stall<br />
ein Getreidespeicher eingerichtet...<br />
...Haus Nr. 4 war eine Molkerei und Butterei,<br />
betrieben vom Holländischen Verband, der seinen<br />
Sitz in Chortitza hatte. Nach 1930 wurde hier eine<br />
Lebensmittelkammer eingerichtet...<br />
...Haus Nr. 5 ist heute nicht mehr da. Von 1930<br />
bis 1942 wohnte hier Johann Wieler selbst.<br />
...1930 wurde Johann Wieler enteignet. Er<br />
"durfte" in das kleinste Haus Nr.5 ziehen, und 1942<br />
starb er hier an einem Schlaganfall..."<br />
Plan des Petershofskomplexes aus P. Epp,<br />
Der Bote,Nr. 3, 1993, Seite 8.<br />
Karte des Dorfes Franzfeld, Kreis Saporoschje, Gebiet Dnjepropetrowsk. Aufgenommen von der Stumpp<br />
Gruppe am 22.05.1942.<br />
413
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Ein Laden in Franzfeld. Das Haus Nr.1 der Peters-Wirtschaft. Foto: Mai 2000.<br />
Ein mennonitisches Haus in Franzfeld, das Haus Nr. 2 der Peters-Wirtschaft. Foto: Mai 2000.<br />
Ein Gebäude in Franzfeld, das Haus Nr. 3 der Peters-Wirtschaft. Foto: Mai 2000.<br />
414
Kapitel 75 Franzfeld – Nikolaj Pole<br />
Ein mennonitisches Haus in Franzfeld, an der Östseite der Strasze, gebaut 1898. Es gibt noch etwas von<br />
den schönen Vorgärten der Mennnoniten zu sehen. Foto: Mai 2000.<br />
Ein Laden an der Westseite der Strasze in der Mitte von Franzfeld. Foto: Mai 2000.<br />
Ein Gebäude in Franzfeld am nördlichen Ende, bei die Querestrasse. Heute ein Wohnhaus. Foto: Mai 2000.<br />
415
Kapitel 76 Nikolajfeld - Nikolaj Pole<br />
Das Dorf wurde 1869 gegründet.<br />
Als Leiter der Schule war ein Jude namens<br />
Gemeinden. 1905 hatte die Nikolajfeld- Eichorn eingesetzt.<br />
Gemeinde 1046 Mitglieder und 806 Ungetaufte. Gebietsamtsgebäude. In den 1930er Jahren<br />
Das Andachtshaus der Kirchengemeinde lag auf befand sich hier die Direktion der Schule für<br />
halbem Wege nach Franzfeld. <strong>Die</strong> Kirche war<br />
sehr solide gebaut, aber einfach und schlicht<br />
eingerichtet. Seit Ende der 1870er Jahre hat die<br />
Kolchosarbeiter.<br />
Einlager Brüdergemeinde hier ein<br />
Versammlungshaus.<br />
Zentralschule (Höhere Knabenschule). Sie lag<br />
gleich neben der Kirche und wurde 1905 gebaut.<br />
Für diesen Bau hatten sich besonders der<br />
Gutsbesitzer J. J. Peters, der Gemeindeschreiber<br />
P. Peters und der Kaufmann J. Neufeld eingesetzt.<br />
<strong>Die</strong> Bauleitung übernahm der mennonitische<br />
Architekt P. Peters. Das zweistöckige Das Siegel des Nikolajfelder Dorfältesten. <strong>Die</strong>ses<br />
Hauptgebäude war mit der Frontseite der Straße Siegel ist in den Teilungsverträgen des<br />
zugekehrt und hatte an der Hofseite zwei Flügel Waisenamtes gestempelt worden, was von den<br />
mit je einer Lehrerwohnung. Der Bau wurde im Aussiedlern bei der Auswanderung 1875 nach<br />
gotischen Stil aufgeführt. Es wurden noch zwei Manitoba, Kanada mitgebracht worden sind.<br />
Häuser mit drei Lehrerwohnungen gebaut. <strong>Die</strong><br />
nötigen Ställe und Scheunen kamen in den<br />
Hinterhof. Im unteren Stock des Hauptgebäudes<br />
war ein Internat für 50 Schüler. Im 2. Stock<br />
waren die Klassenzimmer, das Lehrerzimmer,<br />
Bibliothek und das Labor. Außerdem war oben<br />
noch ein großer Raum für Gesang und Sport.<br />
1908 arbeitete die Schule vollständig mit<br />
vier Klassen und fünf Lehrern.<br />
Nach der Revolution durften auch Mädchen<br />
diese Schule besuchen. In den 1920er Jahren<br />
Foto aus Old Colony Mennonites in Canada<br />
wurde aus der Zentralschule eine<br />
Ackerbauschule gemacht. Schulleiter war bis<br />
1930 ein Herr Prinz, der der Schule einen neuen<br />
Einfluss gab. <strong>Die</strong> Schule verlor die meisten<br />
Schüler aus der Jasykower Wolost. 1930 wurde<br />
die Ackerbauschule nach Prischib verlegt und<br />
mit ihr auch die ganze Einrichtung der<br />
Zentralschule. 1943 arbeitete die Schule mit 10<br />
Klassen und 10 Lehrern.<br />
Meteorologische Station. Sie wurde 1930 nach<br />
Sofijewka übergeführt.<br />
Dorfschule. Bei der Aussiedlung der<br />
Großbauern (1930) hatte man in dieser Schule In einem russischen Dorf steht noch ein<br />
eine Schule für Kolchosspezialisten eingerichtet.<br />
416<br />
Dreschstein aus den alten Zeiten. Foto: Mai 1997.
Kapitel 76 Nikolajfeld - Nikolaj Pole<br />
W<br />
S<br />
N<br />
E<br />
417<br />
Karte des Dorfes Nikolajfeld, Jasykowo <strong>Kolonie</strong>, 1917. Aus Ike Warkentin, John Warkentin and his Descendants (Winnipeg 1990), Seite 273.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Der Teich zwischen Nikolaifeld und Franzfeld, 1910. Foto aus Peter Zacharias, Klassen A Family Heritage<br />
(Winnipeg 1980), Seite 130.<br />
<strong>Die</strong> Allee zwischen Nikolaifeld und Franzfeld, 1910. Im Hintergrund sind die Kirche und Zentralschule zu<br />
erkennen. Foto aus Peter Zacharias, Klassen A Family Heritage (Winnipeg 1980), Seite 130.<br />
418<br />
Johann Klassen (bekannt als "Fabrika<br />
Klause"), Winnipeg, Manitoba, Kanada<br />
besucht 1976 seinen alten Wohnort in<br />
Nikolajfeld. Hier steht er bei der gewesenen<br />
Buchhandlung der Gebrüder Hamm<br />
in Nikolajfeld, die nicht nur Bücher und<br />
Schreibmaterial verkauften, sondern<br />
auch Halwa, echte englishe<br />
Fruchtmarmelade und Süssigkeiten. <strong>Die</strong><br />
Zentralschüler konnten kaum verbei<br />
gehen, ohne hier täglich einen Besuch zu<br />
machen. Foto aus Peter Zacharias,<br />
Klassen A Family Heritage (Winnipeg<br />
1980), Seite 302.
Kapitel 76 Nikolajfeld - Nikolaj Pole<br />
<strong>Die</strong> Zentralschule in Nikolajfeld. <strong>Die</strong>ser prachtvolle und schöne Bauschmuck am Gebäude zeigt den<br />
Wohlstand der Jasykowo <strong>Kolonie</strong>. Foto aus Preservings,Nr. 18, Seite 25.<br />
419
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Im Jahre 1906 wurde zwischen den Dörfern Nikolajfeld und Franzfeld, die mit einer wohlgepflegten Allee<br />
von Bäumen verbunden waren, eine Zentralschule gebaut. Foto aus Peter Zacharias, Klassen A Family<br />
Heritage Seite 134.<br />
Lehrerwohnungen. Ein Teil von dem Schulkomplex in Nikolajfeld (Oder war es des Kirchengebaude der<br />
Brüdergemeinde? Seihe Karte, Seite 417). Foto: Mai 2000.<br />
Lehrer der Zentralschule 1914-1915: Gerhard S. Derksen, Heinrich Andres, Heinrich Epp, Abram Froese<br />
und Abram Isaak. 1923 zog Gerhard Derksen nach Saskatchewan, Kanada. 1930 kaufte er die "Steinbach<br />
Post" von Arnold Dyck. Foto aus Peter Zacharias, Klassen A Family Heritage Seite 134.<br />
420
Kapitel 76 Nikolajfeld - Nikolaj Pole<br />
Das Andachtshaus der Kirchen-Gemeinde in Nikolajfeld. Foto aus Lohrenz, Seite 85.<br />
Das ehemalige Gebäude der Kirchen-Gemeinde in Nikolajfeld. Foto: Mai 2000.<br />
421<br />
Das ehemalige<br />
Gebäude der<br />
Kirchen-Gemeinde<br />
in Nikolajfeld. Foto:<br />
Mai 2000.
Kapitel 77 Eichenfeld - Dubowka Nr.4<br />
Das Dorf wurde 1969 gegründet. 1913 hatte es<br />
307 Einwohner. <strong>Die</strong> Schule wurde von 40 Schülern<br />
besucht.<br />
1919 wurde es von der Machnobande ausgeraubt.<br />
Zu dieser Zeit war auch die Zeltmission mit<br />
fünf Mitarbeitern in Eichenfeld und veranstaltete<br />
ihre Abende in der Dorfschule. Es waren der Leiter<br />
Jakob Dyck, O. Juschkewitsch, ein Lette, Galizin,<br />
ein Russe, Regina Rosenberg, eine Jüdin und Luise<br />
Hübert-Sukkau. Sie wurden alle getötet. <strong>Die</strong><br />
Leichen der Zeltmissionare lagen alle bei Isaak<br />
Warkentins in der Scheune, die abseits vom Stall<br />
gebaut war, wo alle durch Säbelhiebe getötet worden<br />
waren (Grab Nr.8).<br />
Jedes Haus und jeder Hof war voller Militär.<br />
26. Oktober 1919 – <strong>Die</strong> Nacht des Terrors.<br />
Am 23. Oktober 1919 strömten tausende von<br />
Machnowzy auf ihrem Weg nach Jekaterinoslaw<br />
durch das kleine Eichenfeld. <strong>Die</strong> leichten<br />
Federwagen, die mit vier oder fünf Männern<br />
beladen waren, wie sie bei den Machnowzys<br />
charakteristisch sind, bis an die Zähne bewaffnete<br />
Reiter sowie Herden von gestohlenem Vieh zogen<br />
ununterbrochen durch den Ort. Um zehn Uhr<br />
morgens strömten einige Banditen auf dem Hof<br />
von Heinrich Heinrichs. Es gab Schreie, und dann<br />
krachte ein Schuss. Heinrich Heinrichs war getötet<br />
worden. Andere Machnowzy betraten die Häuser<br />
entlang der breiten Straße von Eichenfeld und<br />
forderten Essen und Unterkunft für die Nacht.<br />
Gegen fünf Uhr am Nachmittag hatte der Verkehr<br />
etwas nachgelassen. <strong>Die</strong> Dämmerung begann<br />
hereinzubrechen.<br />
Als es gerade dunkel geworden war, raste eine<br />
unheilvolle Gruppe Machnowzy in vollem Gallopp<br />
in das Dorf. Sie blockierten die Zufahrten zum<br />
Dorf und stationierten in jedem Hof Männer. Der<br />
Befehl wurde erteilt, dass niemand sein Haus verlassen<br />
durfte und alle die Nacht über Brot backen<br />
sollten. Um 5 Uhr morgens sollten sie das<br />
Frühstück servieren.<br />
In der verhängnisvollen Nacht ging die<br />
Todeskommission von Tür zu Tür. Männer wurden<br />
verhört. Wenn sie Eigentum besaßen, wurden sie<br />
nach draußen geschickt um Peitschenhiebe zu<br />
empfangen. Nach den Artikeln von David Quiring<br />
in "Der Bote", Band XLIX, Nr. 34-42, wurde Jakob<br />
422<br />
Fast alle Bewohner (83 Personen) wurden in einer<br />
Nacht getötet. Man tötete alle Männer über 16<br />
Jahren, nur wenige kamen mit dem Leben davon.<br />
<strong>Die</strong> Gräber wurden mit dicken Brettern zugedeckt<br />
und ein Fuß Erde drauf geschüttet. Es hieß, es<br />
solle noch eine Kommission zur Untersuchung<br />
kommen. Im Frühling wurden die Bretter entfernt<br />
und die Gräber mit Erde zugeschüttet.<br />
<strong>Die</strong> restlichen Einwohner wurden östlich von<br />
Hochfeld angesiedelt und gründeten das Dorf<br />
Eichenfeld Nr. 2. Ältester J. Klassen hat ein Gedicht<br />
"Schmerzensweg: Eichenfeld-Leichenfeld" über<br />
die tragische Zeit dieses Dorfes gedichtet.<br />
Siehe Ike Warkentin, John Warkentin and his<br />
Descendants (Winnipeg 1980), Seiten 292-293.<br />
Quiring in seiner Wohnung gefragt, ob er Eigentum<br />
besitze. Als er bejahend antwortete, nahm ein<br />
Bandit eine Gitarre, ein anderer eine Violine, und<br />
sie begannen mit teuflischem Grinsen zu spielen.<br />
Jakob wurde befohlen, seine Kleider auszuziehen,<br />
die die Banditen dann unter sich verteilten. Und<br />
dann musste er hinausgehen, um fünfundzwanzig<br />
Peitschenhiebe zu empfangen.<br />
Nach einer schlaflosen und vom Terror erfüllten<br />
Nacht-die Banditen verschwanden vor<br />
Tagesanbruch-gingen die Familien hinaus in den<br />
frostigen und nebligen Morgen, um nach ihren<br />
Lieben zu suchen. Schreie von Kummer und<br />
Entsetzen ballten durch das Dorf, als Familie auf<br />
Familie ihre Männer tot hinter der Scheune oder<br />
auf dem Misthaufen entdeckte. Viele Körper waren<br />
verstümmelt worden. <strong>Die</strong> Mörder hatten scheinbar<br />
satanische Freude daran gehabt, Hände<br />
abzuschlagen, Kehlen durchzuschneiden und die<br />
Körper mit ihren Säbeln aufzuschlitzen.<br />
Das Schlachten war kaltblütig geplant und<br />
grausam ausgeführt worden, wobei sie gleichzeitig<br />
an beiden Enden des Dorfes begonnen hatten. <strong>Die</strong><br />
Männer von der Westseite des Dorfes waren mit<br />
den Säbeln niedergestreckt worden, während<br />
diejenigen von der Ostseite erschossen worden<br />
waren.<br />
Jede Familie hatte ihre eigene<br />
Schreckensgeschichte zu erzählen. Susanna<br />
Warkentin hatte sich tapfer vor ihren Mann gestellt<br />
und bat die Banditen, sie nicht von ihrem Mann zu
Kapitel 77 Eichenfeld - Dubowka Nr.4<br />
trennen. <strong>Die</strong> Banditen taten ihr den Gefallen,<br />
indem sie beide erschossen. <strong>Die</strong> Frau des<br />
Schullehrers wurde vergewaltigt, während ihr<br />
Mann neben ihr auf dem Boden lag und die letzten<br />
Atemzüge tat. <strong>Die</strong> meisten männlichen Personen<br />
über 16 Jahren waren in der Nacht getötet worden,<br />
und eine Orgie brutaler Vergewaltigung war gefolgt.<br />
Im Bewusstsein des enormen Ausmaßes des<br />
Horrors flohen die überlebenden Dorfbewohner<br />
über die matschigen Felder zu den benachbarten<br />
Mennonitendörfern.<br />
Am daraurfolgenden Montag oder <strong>Die</strong>nstagdie<br />
Tage der Woche hatten jegliche Bedeutung verloren-kehrten<br />
Männer aus den in der Nähe gelegenen<br />
Dörfern mit den Witwen zurück, um mit der<br />
herzzerbrechenden Aufgabe zu beginnen, die<br />
Leichen der Väter, Brüder, Söhne und Verwandten<br />
aufzuladen, um sie zum Friedhof zu befördern. <strong>Die</strong><br />
Leichname wurden in große offene Gräber gelegt.<br />
Sehr wenige waren gewaschen oder in Decken<br />
gehüllt worden. Nur zwei Leichen wurden in Särge<br />
gelegt. Es wurde keine Leichenrede gehalten. Nur<br />
die Schreie und die Gebete der Einzelnen stiegen<br />
zu Gott empor. Das Füllen der Gräber und formeler<br />
Beerdigungsgottesdienst sollten später folgen.<br />
Peter Abram Giesbrecht konnte es nicht verstehen,<br />
wie ein liebender und barmherziger Gott<br />
solch ein grausames und mutwilliges Töten<br />
zulassen konnte, und beging am 30. Oktober<br />
Selbstmord. Sein Leichnam wurde in dasselbe<br />
423<br />
Grab gelegt wie die der fünf Evangelisten, die zur<br />
Zeit des Massakers in Eichenfeld eine Reihe von<br />
Erweckungsversammlungen durchgeführt hatten.<br />
<strong>Die</strong> meisten Eichenfelder kehrten vor<br />
Einbruch der Dunkelheit in die Nachbardörfer<br />
zurück. Aber einige blieben, um das Vieh zu versorgen<br />
und sich um die Kühe zu kümmern, die seit<br />
Tagen nicht gemolken worden waren. Während der<br />
nächsten Tage durchstöberten zahllose Plünderer<br />
das Dorf und trugen alles fort, was beweglich war.<br />
Es kehrten auch einige Banditen zurück, und<br />
sieben weitere Eichenfelder verloren ihr Leben.<br />
Insgesamt starben siebenundsiebzig Männer und<br />
sechs Frauen.<br />
Dannach flohen alle Eichenrelder und<br />
kehrten nie zurück. Aber die höllische und<br />
satanische Schlechtigkeit jenes 26. Oktober 1919<br />
konnte nie aus ihrem Gedächtnis ausgelöscht werden.<br />
Mit freundlicher Genehmigung von Garry<br />
Penner, Steinbach, Manitoba. Geschrieben von Art<br />
Töws in Cornelius Heinrichs and his Descendants<br />
1872-1979, (Winnipeg 1980), Seiten 81-82.<br />
Zum Nachlesen: Katharina Hildebrand,<br />
"Tagebuch," aus I. Warkentin, John Warkentin and<br />
his Descendants, (Winnipeg 1990), 324 Seiten.<br />
Marianne Janzen, "The Eichenfeld Massacre<br />
October 26, 1919," in Preservings, Nr. 18, Seiten 25-<br />
31.<br />
Ein Gebäude in Eichenfeld Nr. 2. Es könnte die Schule gewesen sein. Foto: Preservings,Nr. 16, Seite 52.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
N<br />
E<br />
W<br />
S<br />
Karte des Dorfes Eichenfeld I, Jasykowo <strong>Kolonie</strong>, 1919. Aus I. Warkentin, John Warkentin and his<br />
Descendants 1820-1990,Seite 276.<br />
424
Kapitel 78 Adelsheim - Dolinowka<br />
Das Dorf wurde 1869 gegründet und besaß<br />
1950 Desjatin Land. 1913 hatte es 240 Einwohner.<br />
Das Dorf lag sechs km vom Dnjepr entfernt, 45 km<br />
südlich von Jekaterinoslaw. In diesem Dorf waren<br />
zwei Gemeinden vertreten: die Mennoniten-<br />
Gemeinde und Brüdergemeinde. <strong>Die</strong><br />
Brüdergemeinde hatte ihre Versammlungen in<br />
den Häusern.<br />
Karte des Dorfes Adelsheim, Jasykowo <strong>Kolonie</strong>. Aus I. Warkentin, John Warkentin and his Descendants,<br />
(Winnipeg 1990), Seite 274-275.<br />
425<br />
S<br />
W<br />
E<br />
N
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Der letzte Sonntag in Adelsheim, der 3.<br />
Oktober 1943. Eine lange, schwere Reise,<br />
geschreiben von Anna Loewen, Adelsheim.<br />
Wir haben Befehl, daß unsere Männer morgen<br />
im Treck mit Pferden abreisen sollen. Frauen<br />
und Kinder sollen etliche Tage später unsern<br />
Männern nachfahren. Da versammelten wir uns<br />
heute noch einmal zum Abschied in unserer<br />
Schule. Prediger Peter Günther hielt die<br />
Abschiedsrede. Er sprach über den Vers "Bis hierher<br />
hat uns der Herr geholfen" (1. Sam. 7, 12).<br />
Dann sprach Prediger David Penner an Hand von<br />
Psalm 23, 1: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird<br />
nichts mangeln."<br />
Ja, wenn der Herr bis hierher geholfen hat<br />
und auch verspricht, unser Hirte zu sein, wollen<br />
wir auch weiter vertrauen, daß er Gnade zu<br />
unserer Reise geben wird. Nach all der Angst, die<br />
wir hier durchgemacht haben, ist uns die Heimat<br />
auch nicht mehr so teuer wie früher. Wohnen wir<br />
doch nur sechs Kilometer vom Dnjepr entfernt<br />
und schon mehrere Mal ist die Front fast bis zum<br />
Dnjepr gekommen... Abschuß und Einschläge<br />
tönen klar herüber von der Front. Kommt die<br />
Nacht, hängen über den Nachbarstädten<br />
Dnjepropetrowsk, Saporoschje oder<br />
Dnjeprostroij die Fallschirmlampen wie<br />
Kerzenbäume... Wir... erfahren, daß die Russen<br />
sich bemühen, Boote über den Dnjepr zu setzen.<br />
<strong>Die</strong> Deutschen verteidigen das rechte Ufer,<br />
daher des Gefecht. Wie sind wir müde von Angst<br />
und Aufregung! O schweigt, ihr Waffen, wir<br />
wollen schlafen.<br />
4. Oktober. Heute sind unsere Männer mit<br />
Fuhren abgefahren. Das Vieh und die Schafe<br />
wurden getrieben. Sie haben vorläufig Befehl, bis<br />
Apostolowo zu fahren, wo wir uns wieder treffen<br />
sollen. Wie ist es nun so leer, seit sie weg sind!...<br />
...Ach es ist so unheimlich hier, haben die<br />
feindlichen Flieger in dieser Nacht doch mehrere<br />
Bomben auf unser liebes Adelsheim geworfen.<br />
Gott sei Dank, sie trafen nicht genau... "Herr, laß<br />
leuchten dein Antlitz über uns und gib uns<br />
deinen Frieden." -<br />
7. Oktober. Gestern erhielten unsere<br />
Nachbardörfer Befehl, mit ihren Fuhrwerken auf<br />
unsere Höfe zu kommen, um uns nach dem<br />
kleinen Bahnhof Kanzerowka zu bringen. Wir<br />
Eine lange, schwere Reise<br />
426<br />
durften unser Gepäck wie Betten, Kleider, Mehl<br />
und Fett mitnehmen. Wir versammelten uns auf<br />
dem Ende des Dorfes. Wir mußten auf etliche<br />
Nachzügler warten und dabei fällt mir ein, ich<br />
habe den Schlüssel vom Piano in meiner<br />
Handtasche. Ich laufe zurück, denn es wäre<br />
schade, wenn sie es aufbrechen. Ich schließe das<br />
Klavier auf und nehme noch einmal Abschied,<br />
indem ich meine Hand liebkosend darüber gleiten<br />
lasse. Dann aber fort, fort! Es ist ja so unheimlich<br />
leer hier. Hinaus, wo die Wagen stehen, wo<br />
ich meine Kinder sehe!<br />
Dort wird es wieder leichter. Ich setze mich<br />
neben die lieben Kinder, die noch sogar kein<br />
Verständnis dafür haben, was es heißt, eine<br />
Heimat zu verlieren. Wir fahren langsam los. <strong>Die</strong><br />
beladenen Erntewagen knarren, sind wir doch<br />
mehrere Familien auf jedem. <strong>Die</strong> Sonne steigt<br />
höher, der Staub wirbelt in die Luft. Lange<br />
schauen wir noch mit feuchten Augen zurück.<br />
Dort liegt das liebe Heimatdorf ja so friedlich<br />
und stille, als wollte es sagen: ,,Ach, laßt mich<br />
doch nicht so alleine zurück; es war doch einst so<br />
schön in unsern Mauern." Jetzt ist es unsern<br />
Augen entschwunden. Lebe wohl, du liebes Dorf!<br />
Teure Heimat, sei gegrüßt aus der Ferne, sei<br />
gegrüßt!<br />
8. Oktober. Gestern abend setzte sich unser Zug<br />
in Bewegung, um unsern Männern nachzufahren<br />
nach Apostolowo. Als wir eine kurze<br />
Strecke gefahren waren, erlebten wir auf dem<br />
Bahnhof Nikopol den ersten Fliegerangriff. Doch<br />
der liebe Gott erhörte unsere Gebete und Schreie<br />
um Hilfe, und der Zug blieb verschont. Nach<br />
dem Angriff fuhren wir weiter und kamen glücklich<br />
in Apostolowo an, wo wir stehen blieben...<br />
...Wir mußten noch im Zuge bleiben und der<br />
Dinge, die da kommen sollten, warten.<br />
10. Oktober. Gestern abend hat man uns endlich<br />
ausgeladen und bis Nowo-Alexandrowka<br />
gebracht. Dort traf ich dann auch meinen lieben<br />
Mann, der froh war, daß er uns mit Milch<br />
bewirten konnte, hatte er doch eine Kuh, an den<br />
Wagen gebunden, mitgeführt. Heute morgen<br />
ging es auf schlechten, staubigen Straßen<br />
Oljenowka zu. Hier angekommen, wurden wir<br />
auf Befehl bei den armen Russen in ihren elenden<br />
Hütten untergebracht. Wir wohnten mit
Kapitel 78 Adelsheim - Dolinowka<br />
meiner Schwester, Maria Schapansky, und ihrer ...Ich fror sehr, dazu schmerzten mir die<br />
Tochter und mit Tante Epp (der Witwe des ver- Glieder, ich wurde heiser und meine Stimme<br />
storbenen Ältesten Heinrich Epp) und mit schwand. ...Kein Schlaf erquickte den müden<br />
meines Mannes Mutter zusammen in einem Körper, und morgens mußten wir wieder zum<br />
Zimmer einer elenden Erdhütte. Doch Stroh zum Bahnhof.<br />
Schlafen ist da und Betten haben wir mit. Zu Dann kam Befehl, alles liegen lassen und zu<br />
essen haben wir auch genug, wir haben hier Fuß nach dem zwölf Kilometer entfernten<br />
noch ein Schaf geschlachtet. Doch warum hat Bahnhof zu gehen. Der Beamte schrie unter das<br />
man uns hierher gebracht so abgelegen von der Volk: "Wenn ihr geht, können wir euch vielleicht<br />
Bahn? Wenn dann mit einmal die Russen kom- noch helfen, morgen aber kann es schon zu spät<br />
men, was wird aus uns? Wie wenig heimeln uns sein." Wie betäubt standen wir da. Erst zögernd,<br />
diese Hütten an. <strong>Die</strong> andern Transporte fuhren dann aber im Ernst machten wir uns darauf<br />
durch nach Litzmannstadt, nur unser Transport gefaßt. Ein Wagen wurde auf der Straße erwischt<br />
wurde aufgehalten. Man sagte, die Bahnlinien und da setzten wir die Alten und einige Kinder<br />
seien überfüllt, wir sollen warten. In diesem hinein. Wir aber machten uns fertig, etwas zu<br />
Transport befinden sich die Dörfer Adelsheim, tragen und loszugehen. Doch ehe wir fort sind,<br />
Einlage, Kronsweide, Neuenburg, Nieder- kommt Befehl, alle hier zu bleiben, wir bekom-<br />
Chortitza, Chortitza und Burwalde. Es waren men Waggone. "Du hörst, ja du erhörst Gebet,<br />
aber nicht die ganzen Dörfer...<br />
du, der von ferne schon versteht."<br />
19. Oktober. Gestern bekamen wir Befehl, daß 25. Oktober. ...Heute morgen sind unsere<br />
unsere Männer weiterfahren sollten nach Waggone wirklich gekommen. Zwar sind es<br />
Proskurow an der polnischen Grenze. Frauen Kohlenwaggone, offen, aber es ist doch nicht so<br />
und Kinder sollen wieder mit der Bahn fahren. kalt, wie auf der Erde. Mit all den Personen und<br />
<strong>Die</strong> Männer wollten nicht fahren ehe wir fort dem Gepäck ist es sehr voll und furchtbar enge.<br />
wären, ist doch die Front wieder ganz nahe. Es wird noch auf mehr Flüchtlinge gewartet, und<br />
Doch da gab's keine Widerrede, Befehl ist wir müssen noch eine Nacht hier stehen. Man<br />
Befehl...<br />
sagt, dies sei der letzte Transport.<br />
23. Oktober. Eine schöne Nacht ist überstanden. 26. Oktober. Als es gestern abend kaum dunkel<br />
In aller Eile haben wir gebacken und gepackt. war, die Kinder hatten wir schon zur Ruhe<br />
Um 3 Uhr nachts fuhren wir los, doch bekamen gebracht, da wird es plötzlich ganz hell. O<br />
wir so wenig Fahrgelegenheit, daß man von dem Schrecken! Wir fahren in Angst zusammen, denn<br />
Wenigen, das wir mit hatten, noch wieder so immer noch werden Fallschirmlampen über uns<br />
vieles mußten liegen lassen. Es schneidet einem gehängt. Da kommen auch schon die schweren<br />
ans Herz, wenn man daran denkt, ins Ungewisse Bomber, und schon dröhnt die erste Bombe<br />
zu fahren und die Nahrungsmittel liegen zu herunter. <strong>Die</strong> Erde bebt, aber doch, die Bombe<br />
lassen. Dort ließ ich auch ein paar Säcke Mehl, explodiert nicht - ein Blindgänger. Dann aber<br />
das Fleisch, Küchengeschirr und verschiedenes folgt Krach auf Krach. Wir reißen die Kinder aus<br />
anderes. Betten, Kleider, sowie Fett und etwas den Betten und laufen in die Nacht hinein, nie-<br />
Mehl konnte ich mitnehmen. "Sehet die Vögel mand weiß, wohin. Wir werfen uns nieder, dann<br />
unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten stehen wir wieder auf und laufen weiter. Ich<br />
nicht, und Gott im Himmel nährt sie doch." bleibe mit meinen Kindern an einem kleinen<br />
24. Oktober. Gestern kamen wir mittags hier in Strohhaufen. Mit den Kindern in den Armen<br />
Apostolowo an, doch weil der Bahnhof liegen wir und schreien zu Gott. <strong>Die</strong> Kleine sagt<br />
Fliegerangriffen ausgesetzt ist, mußten wir zur immer wieder unter Tränen: ,,Lieber Heiland,<br />
Nacht in ein vier Kilometer entferntes Dorf bewahre uns!" O, wie erschaudert man, wenn<br />
fahren. Das war die erste Nacht unter freiem eine Bombe mit lautem Getöse herniedersaust,<br />
Himmel. Mutter hatte ich in einem russischen und bange fragt man sich: ,,Wird diese Bombe<br />
Hause untergebracht <strong>Die</strong> Kinder legten wir nahe mein Leben beschließen?" Endlich haben sie<br />
ans Haus, wo sie etwas vor dem Wind geschützt ihre Last abgeworfen und fliegen davon. Um uns<br />
waren. Ich saß die ganze Nacht auf dem Wagen herum zählen wir 46 große Bombenkrater. Voller<br />
und bewachte unsere Sachen.<br />
Angst erwarten wir den Morgen.<br />
427
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
26. Oktober. Heute mittag fuhren wir endlich von<br />
diesem so schrecklichen Apostolowo ab.<br />
Vormittags wurde noch ein Kind beerdigt, das<br />
die Mutter gestern beim Fliegerangriff erstickt<br />
hatte. Wir sind noch nicht weit gefahren und stehen<br />
nun auf dem Bahnhof Beresinowataja<br />
[Beresnegowatoje].<br />
27. Oktober. Wir stehen immer noch auf derselben<br />
Stelle, und die Lokomotive hat uns verlassen.<br />
Es ist dunkel und sieht nach Regen aus.<br />
Mein Bruder und Gerhard Quiring versuchen<br />
den Wagen mit Decken zu decken. Etliche Bretter<br />
nahmen sie gestern von den zusammengeschossenen<br />
Häusern. Dunkel ist's<br />
draußen, dunkel ist's drinnen. ,,Gott, sei mir<br />
gnädig, denn Menschen schnauben wider mich.<br />
Täglich streiten sie und ängstigen mich." Ps. 56,<br />
2.<br />
28. Oktober. Wir sind immer noch auf derselben<br />
Stelle. Es hat gestern nicht geregnet, und das<br />
Wetter ist umgeschlagen. Wind und Frost haben<br />
sich eingestellt. <strong>Die</strong> Kinder gehen mit steifgefrorenen<br />
Händen umher, die Großmütter sind<br />
müde und krank, und die Männer sind ziemlich<br />
mutlos, daß man uns einfach auf offener Straße<br />
stehen läßt. Verpflegung gibt es keine, außer daß<br />
wir uns draußen ein Feuer anmachen und etwas<br />
kochen. Nachts ist noch ein kleiner Erdenpilger<br />
im offenen Waggon geboren... .Eben zog ich<br />
einen Spruch: "Sei stille dem Herrn und warte<br />
auf ihn." Also wollen wir auch weiter ihm vertrauen.<br />
29. Oktober. Das Wetter ist schön geworden.<br />
Gefroren hat es tüchtig, aber die Sonne scheint<br />
warm. Vormittag hatten wir im Freien<br />
Gottesdienst. Prediger Neufeld sprach über 2.<br />
Mose 14, 14: ,,Der Herr wird für euch streiten,<br />
und ihr werdet still sein." Er machte es wichtig,<br />
daß wir nicht murren sollen über unser<br />
Schicksal, damit Gott uns nicht noch tiefere<br />
Wege führen müsse. Er machte uns darauf<br />
aufmerksam, daß wir viel Ursache zum Danken<br />
haben, daß Gott uns so wunderbar beim<br />
Bombenhagel bewahrt habe. Es ist eben Befehl<br />
gekommen, daß wir um vier Uhr abfahren sollen.<br />
Behüt uns Gott!<br />
30. Oktober. Wir sind gestern doch nicht abgefahren.<br />
Man läßt uns ohne weiteres bei dieser<br />
Kälte auf offener Straße stehen. Ach, daß sich<br />
Gott über uns erbarme! Der Zugführer macht<br />
sich um uns viel Mühe, doch er bekommt immer<br />
428<br />
noch keine Lokomotive. Es sterben immer mehr<br />
Kinder. ,,Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn<br />
und züchtige uns nicht in deinem Grimm."<br />
31. Oktober. Heute frühmorgens bekamen wir<br />
eine Lokomotive und sind nun vielleicht eine<br />
Stunde unterwegs. Wir fuhren oben über den<br />
Fluß Ingulez, und jetzt stehen wir, weil hier nur<br />
ein Bahngeleise ist und dasselbe sehr<br />
beansprucht wird. - "Der dich behütet schläft<br />
nicht." -<br />
1. November. Wir sind gestern eine ziemliche<br />
Strecke gefahren, bis spät abends, dann hielt der<br />
Zug. Morgens erfuhren wir, daß wir 10 Kilometer<br />
von Nikolajew seien. Des nachts ist wieder ein<br />
Kind gestorben, und Prediger Neufeld sprach zu<br />
dem Textwort: "Christus ist mein Leben und<br />
Sterben mein Gewinn." Nachmittag fuhren wir<br />
los und zwar rückwärts, denn hier ist alles voll<br />
und es ist sehr schwer weiterzukommen. Jetzt<br />
haben die Deutschen wieder die Bahnlinie von<br />
Kriwoj Rog in ihren Händen, so daß wir wohl die<br />
Strecke fahren werden.<br />
2. November. Wir fuhren von gestern mittag fast<br />
ununterbrochen... Jetzt fahren wir durch die<br />
Gegend, wo die Russen durchgebrochen waren.<br />
Es sieht schauerlich aus. Hier liegt Panzer an<br />
Panzer, teils verbrannt oder gesprengt. Viel<br />
Häuser sind zerschossen und hin und wieder<br />
liegen tote Soldaten. <strong>Die</strong> Russen sind hier vier<br />
Tage gewesen. Morgens waren wir auf der Station<br />
Kuzewka und jetzt sind wir auf dem Wege nach<br />
Snamenka. Das soll eine gefährliche Stelle wegen<br />
Luftangriffen sein. "Bis hierher hat der Herr<br />
geholfen durch seine große Güte."<br />
3. November. Gestern sind wir eine lange Strecke<br />
gefahren und um Mittag erreichten wir<br />
Snamenka. Dort bekamen wir zwei<br />
Frachtwaggone für die Kranken. ...Gestern<br />
kamen wir zur Station Bobrinskaja und da gab es<br />
11 Uhr abends eine Graupensuppe. Am Tage<br />
haben wir uns im Freien auch etwas gekocht,<br />
denn man muß schließlich doch essen.<br />
4. November. Wir verließen gestern Bobrinskaia<br />
und kamen heute morgen auf den Bahnhof<br />
Kasatin, wo wir wohl den ganzen Tag stehen werden.<br />
...<strong>Die</strong> Kinder müssen heute den ganzen Tag<br />
in Betten verpackt sitzen. Unsere Mutter ist<br />
ziemlich krank und kann fast nichts essen. Ich<br />
gehe den ganzen Tag mit kalten Füßen umher,<br />
dazu die Sorge um meinen Mann. Wo finden wir<br />
uns wieder? Oder sind die vielleicht mit ihren
Kapitel 78 Adelsheim - Dolinowka<br />
Wagen den Russen in die Hände gefallen? Es ist<br />
bald abend, und wir sollen heute noch weiterfahren.<br />
Man sagt, die Partisanen hätten auf<br />
dieser Strecke einen Zug gesprengt. "Vater, laß<br />
die Augen dein über unserm Wege sein.”<br />
5. November. Es hat gestern nur ganz wenig<br />
geregnet, doch jetzt ist es kalt geworden. Wieder<br />
müssen die Kinder im Bett bleiben. Nachts sind<br />
wir eine lange Strecke gefahren. Fastow vorbei.<br />
Heute morgen standen wir ganz kurz auf dem<br />
Bahnhof Winitza...<br />
6. November. Wir sind nachts ununterbrochen<br />
gefahren. Wir meinten, diese Nacht bis<br />
Proskurow zu kommen, und nun hören wir, daß<br />
wir das schon hinter uns haben. Es ist Befehl<br />
gekommen, uns nicht in Proskurow abzusetzen,<br />
sondern bis Litzmannstadt zu bringen. Wir<br />
haben noch zwei Stunden bis Lemberg, und da<br />
soll es Verpflegung geben. Hier fahren wir durch<br />
viel Wald. Wie unheimlich ist das wegen der<br />
Partisanen. ,,Du wirst uns bewahren, Du kannst<br />
stets bewahren, allmächtig bist Du. -<br />
7. November. Es ist heute Sonntag, der liebe<br />
Sonntag, auf den man sich früher so gefreut hat.<br />
Doch heute ist alles anders, heute ist alles tot. Als<br />
ich gestern abend eingeschlafen war, erwachte<br />
ich plötzlich und merke, es tropft durch. Schnell<br />
stehe ich auf und decke mehr über die Kinder.<br />
Doch es regnet und schneit sehr. <strong>Die</strong> Kinder<br />
erwachen und die Kleinste weint:<br />
"Mama, wir sind naß." Man ist ratlos. Ich<br />
ziehe sie aus den Betten, aber wohin? Es regnet<br />
überall durch, denn die Decken auf dem Dach<br />
liegen dick voll Schnee. Der Zug hält.<br />
Ich nehme beide Kinder an die Hand und<br />
laufe hinaus. Vorne sind etliche Frachtwaggone,<br />
und da laufe ich hin. Ich werde da aufgenommen,<br />
und so waren wir doch wenigstens im<br />
Trocknen, wenn die Sachen auch naß werden.<br />
Um 10 Uhr kamen wir in Lemberg [Lwow] an<br />
und bekamen eine Mehlsuppe. Heute taut der<br />
Schnee, der gestern auf dem Deckendach liegen<br />
blieb, und so gibt es wieder Wasser aufzufangen.<br />
Es sieht häßlich aus...<br />
8. November. Wir fahren immer noch durch<br />
Polen. Es will scheinbar kein Ende nehmen. Es<br />
hat diese Nacht sehr gefroren, und die Füße werden<br />
den ganzen Tag nicht warm. Dazu kann man<br />
nicht kochen, weil wir ohne zu halten vorwärts<br />
fahren und außer der Mehlsuppe in Lemberg gab<br />
es noch keine Verpflegung. <strong>Die</strong> Kinder baten den<br />
429<br />
ganzen Tag um Essen. Wie man sagt, sind wir<br />
bald da, vielleicht kommen wir noch zum Abend<br />
hin. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, noch<br />
eine Nacht hier im Waggon zu verbringen. <strong>Die</strong><br />
Betten sind naß und kalt von gestern. Vielleicht<br />
bekommen wir heute noch eine Suppe, oder<br />
wenn wir wenigstens unter Dach kämen! Wenn's<br />
auch nur ein Stall oder Schuppen ist. Wir sind<br />
ganz erschöpft, hungrig und verfroren. Es verlangt<br />
uns so nach Ruhe, endlich einmal unsere<br />
Glieder auszustrecken. O, wie bin ich so müde<br />
und habe solch Reißen in den Knieen. Wie lange<br />
sitzen wir nun schon so zwischen unsern<br />
Sachen! Wer hätte es auch je für möglich gehalten,<br />
bei solchem Frost in offenen Waggonen zu<br />
fahren. Das Wasser draußen ist alles hart<br />
gefroren... ,,Bittet, daß eure Flucht nicht im<br />
Winter geschehe." -<br />
10. November. ...Wir kamen spät abends... bis<br />
Pabianitze.... Dort sollten wir in ein<br />
Entlassungslager, wie man das nannte. Mutter<br />
durfte ich nicht mitnehmen, weil alle Kranken<br />
ins Krankenhaus sollten. So blieb ich denn da,<br />
bis ich Mutter ins Krankenhaus gebracht hatte.<br />
Dann fuhr ich meinen Kindern nach. Da bekamen<br />
wir denn auch endlich eine Suppe und ein<br />
Stück Brot. Das war eine große Freude nach dem<br />
langen Warten.<br />
Morgens kamen wir gleich ins Bad. Wie man<br />
sagt, sollen wir heute noch weiterfahren. Unser<br />
Gepäck wird schon umgeladen. Wir sollen in<br />
Personenwagen weiterfahren, um doch als<br />
Menschen an unserm Bestimmungsort<br />
anzukommen. Mutter habe ich im Krankenhaus<br />
besucht...<br />
12. November. Unsere Lage hat sich verändert:<br />
wir sitzen im geschlossenen Wagenabteil und<br />
fahren unserer neuen Heimat zu. Es geht nach<br />
Oberschlesien. Wir bekamen heute schon<br />
Verpflegung: Brot, ein Stückchen Butter, Wurst<br />
und Marmelade. Wie haben wir uns gefreut!<br />
Wären unsere Männer nur auch erst hier...<br />
13. November. Gestern um 3 Uhr nachmittags<br />
kamen wir hier in Lissick an, das uns nun vorläufig<br />
eine Heimat werden soll. Es ist ein großes<br />
Kloster, wo man uns untergebracht hat. Viel<br />
kleinere Zimmer sind darin und drei ganz große,<br />
in denen zu 50 Personen wohnen. Jeder hat auf<br />
seine Familie Betten bekommen, die<br />
nebeneinander stehen. Jeden Morgen und<br />
Abend gibt es Kaffee und ein Stückchen Brot und
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
mittags eine Suppe...<br />
29. November. Wir sind immer noch auf derselben<br />
Stelle. Wie sah es uns in den ersten Tagen so<br />
dunkel aus, daß wir hier fünf Wochen bleiben<br />
sollten, wie es anfangs hieß. Nun geht ein Tag<br />
nach dem andern hin, und man gibt sich darein.<br />
Zudem sind wir auf unsere Zimmer angewiesen,<br />
und die Türen nach der Straße sind verschlossen.<br />
Auf den Hof dürfen wir, doch sollen wir fünf<br />
Wochen Quarantäne haben. Sonst ist noch alles<br />
beim alten und unsere Männer sind immer noch<br />
nicht da. Wieviel wird das zu erzählen geben<br />
nach all dem Leid, das wir durchgemacht haben.<br />
Möge Gott geben, wir könnten bald wieder<br />
Freude und Leid teilen. -<br />
...30. Dezember. Mit welchen Empfindungen ich<br />
heute schreibe, läßt sich kaum sagen: unsere<br />
liebe Mutter und Großmutter ist heute ruhig in<br />
Gott entschlafen. Sie wurde nach der schweren<br />
Reise nicht gesund, so gerne sie auch ihre Söhne<br />
noch sehen wollte... Gestern abend konnte sie<br />
nicht mehr sprechen, schlief dann ein. Heute um<br />
acht Uhr morgens starb sie, und um vier Uhr<br />
abends steht ihr jüngster Sohn Jakob Falk vor<br />
dem Tor. Wie mir dabei zu Mute war, läßt sich<br />
schlecht wiedergeben...<br />
1. Januar 1944. Heute drei Uhr nachmittag ist<br />
mein Mann gekommen. Wir hatten ihm die<br />
Trauernachricht nach Hindenburg geschickt,<br />
und er durfte kommen. Gott sei Dank, nun ist er<br />
da! Wir warteten schon sehr auf ihn, denn heute<br />
ist das Begräbnis seiner Mutter. Weil es schon zu<br />
spät wurde, wird sie morgen früh beerdigt. Dann<br />
muß mein Mann wieder zurück und den 8.<br />
Januar kommen sie dann alle.<br />
16. August 1944. Ich habe acht Monate nicht<br />
geschrieben. Das Leben war so eintönig in dieser<br />
Zeit, daß es fast nicht der Mühe wert war. Heute<br />
ist nun doch so ganz was Besonderes gekommen,<br />
daß ich es aufschreiben muß: Morgen<br />
sollen wir dies Lager verlassen, das uns neun<br />
Monate eine Heimat ersetzte. Manches Schöne<br />
und manches Schwere knüpft sich an diese Zeit.<br />
Es hatte aber einen großen Vorteil: wir<br />
Adelsheimer durften alle unter einem Dach<br />
wohnen. Wir fühlten uns in dieser Zeit noch viel<br />
enger verbunden. Wer weiß, wo wir uns jetzt zerstreuen<br />
werden? Wo finden wir noch einmal ein<br />
Plätzchen, dem wir den lieben Namen "Heimat"<br />
geben dürfen? "So hat man mich gefragt, was<br />
drückt dich schwer? Ich kann nicht nach Hause,<br />
430<br />
hab keine Heimat mehr."<br />
19. August. Ich will nun kurz unseren Abschied<br />
aus dem Lager Lissick beschreiben. Den 17.<br />
August fuhren wir ab, und der Abschied fiel uns<br />
nicht so schwer, da sich in letzter Zeit etwas<br />
Unangenehmes zwischen der Lagerführung und<br />
uns eingestellt hatte. Sie hatten sich von dem<br />
Wenigen, das wir von der Regierung bekamen,<br />
bereichern wollen. Wir aber wollten unsere<br />
Ration, die schon so klein war, ganz haben.<br />
Jedoch, genug davon.<br />
"Schreib in den Sand, was dich betrübet,<br />
vergiß und schlafe drüber ein, denn was du in<br />
den Sand geschrieben, das wird schon morgen<br />
nicht mehr sein."<br />
Um zwei Uhr nachmittag fuhren wir von<br />
Lissick ab. Am 18. mittags kamen wir in<br />
Löwenstadt an. Dort hielt unser Zug. Es regnete<br />
in Strömen, aber trotzdem mußten wir mit den<br />
Kindern und mit dem Gepäck hinaus, wurden<br />
auf die bereitstehenden Wagen verteilt und in ein<br />
12 Kilometer entferntes Lager Schimanischka<br />
gebracht. Hier wurden wir trotz der Einfachheit,<br />
die da herrschte, doch freundlich aufgenommen.<br />
Ganz durchnäßt kamen wir hier an. Heute<br />
scheint die Sonne, und wir müssen unsere<br />
Betten und Kleider trocknen. Es ist fast alles, was<br />
wir haben, naß, da es die ganze Zeit regnete<br />
...30. August 1944. Wir wurden am 28. August aus<br />
dem Lager Schimanischka hinausgefahren und<br />
auf die Dörfer verteilt, wo wir sollen helfen, die<br />
Ernte einbringen. Wir wären schon lieber im<br />
Lager geblieben, doch man muß sich fügen. Wir<br />
sind jetzt nur 120 Kilometer von Warschau ab, wo<br />
die Front steht. Wenn die Russen mit einmal<br />
durchbrechen, wo sollen wir hin? Zudem geht es<br />
zum Winter. Doch, es soll ja kein Haar ohne<br />
seinen Willen vom Haupt fallen.<br />
15. April 1945. Es sind bald acht Monate verstrichen<br />
seit meiner letzten Eintragung... Den 17.<br />
Januar 1945 erhielten wir plötzlich Befehl,<br />
schnell unsere Wagen zu bespannen, es wäre<br />
höchste Zeit. Zu lange hatte man gewartet uns<br />
hinauszulassen. Niemand durfte ohne Befehl<br />
fahren. Dann sollten Frauen und Kinder mit der<br />
Bahn und die Männer im Treck fahren. Nun kam<br />
der Durchbruch der Russen aber so schnell, daß<br />
an eine Flucht mit der Bahn gar nicht mehr zu<br />
denken war. <strong>Die</strong> Bahnhöfe wurden sehr bombardiert,<br />
denn die Russen waren nur einige
Kapitel 78 Adelsheim - Dolinowka<br />
Kilometer ab. Jede Telephonverbindung war<br />
abgeschnitten und alles war kopflos.<br />
Wir sahen es ja schon vorher kommen und<br />
hatten gebackt und gepackt. Schnell wurde<br />
aufgeladen, und so führen wir halb zwei Uhr<br />
nachts auf den 18. Januar los. <strong>Die</strong> Nacht war kalt,<br />
und der Schnee glitzerte bei hellem<br />
Mondenschein. <strong>Die</strong> Straßen waren glatt, und die<br />
Pferde hatten schlechten Tritt. <strong>Die</strong> Wagen wollten<br />
immer ausgleiten, und so fuhren wir in die<br />
kalte Nacht und eine trostlose Ungewißheit<br />
hinein.<br />
Wir sollten über Litzmannstadt fahren, doch<br />
als wir die halbe Strecke gefahren waren, kam<br />
Befehl, über Kirschberg und Pabianitza zu<br />
fahren, da die Russen schon bis Löwenstadt<br />
vorgedrungen seien und Litzmannstadt bombardieren.<br />
<strong>Die</strong>ser Umweg hatte zu viel von der<br />
knappen Zeit genommen.<br />
Als wir kurz vor Pabianitza waren, wurde<br />
dort sehr bombardiert. Wir ließen die Wagen stehen<br />
und liefen in die Häuser. An<br />
Vorwärtskommen war fast nicht mehr zu<br />
denken. <strong>Die</strong> Straßen waren wie zugemauert:<br />
Militär, schwere Geschütze, Panzer, Flüchtlinge,<br />
alles durcheinander. <strong>Die</strong> Straße, auf der wir<br />
fuhren, war breit, so daß manchmal drei bis vier<br />
Reihen nebeneinander fuhren. Wir gingen neben<br />
dem Wagen und mußten immer aufpassen, daß<br />
wir nicht in den Straßengraben glitten.<br />
Als es erst dunkel wurde, war die Straße so<br />
mit fliehendem Militär besetzt, daß man uns<br />
arme Flüchtlinge ganz aus der Reihe warf. So<br />
standen wir mit noch etlichen Bekannten fast die<br />
ganze Nacht da. Der Wind blies eisigkalt. Was<br />
habe ich in jener Nacht gefroren! Müde und<br />
kraftlos hielt ich mich hinten am Wagen. Jeden<br />
Augenblick drohte ich in die Knie zu sinken. <strong>Die</strong><br />
Angst saß in allen Gliedern. Feuer in der dunkeln<br />
Nacht hinter uns von der Front und vor uns vom<br />
Fliegerangriff. Als der Morgen graute, setzte sich<br />
unser Treck wieder in Bewegung. So fuhren wir<br />
am frühen Morgen durch Pabianitza. Doch, o<br />
weh, wie sah es hier aus?! <strong>Die</strong> ganze Straße war<br />
furchtbar zugerichtet: zerschossene Häuser,<br />
Militärautos, tote Soldaten und Flüchtlinge,<br />
deren Wagen standen, tote Pferde, Koffer und<br />
Fahrräder standen umher, daß einem angst und<br />
bange wurde.<br />
Doch im Herzen schrie es: "Fort, nur fort!"<br />
Und schon waren die ersten Tiefflieger über uns.<br />
431<br />
Wir ließen die Wagen stehen, und warfen uns in<br />
die Straßengraben. Sie ließen ihre Mordwaffen<br />
über uns knattern und warfen auch Bomben ab.<br />
Als sie fort waren, fuhren wir schnell weiter über<br />
Lask. Doch die Tiefflieger blieben nicht aus und<br />
haben uns an dem Tage fünfmal angegriffen. Im<br />
Walde legten wir uns nieder, sonst in den<br />
Straßengraben. <strong>Die</strong> Maschinengewehre knatterten<br />
so niedrig, daß wir jeden Augenblick mit<br />
dem Tode rechnen mußten. Wie haben wir<br />
gebetet! Und Gott hat uns erhört, wir blieben<br />
unversehrt. Aber wieviel Angst haben wir und<br />
auch die armen Kinder an dem Tage<br />
durchgemacht. <strong>Die</strong> Kleine bat immer wieder:<br />
"Aber laßt mich nicht auf dem Wagen, wenn ihr<br />
lauft!" Aber die Angriffe kamen immer so plötzlich,<br />
daß wir fast nicht fertig kamen herunterzusteigen.<br />
...Bis abend hatten wir eine furchtbare<br />
Strecke hinter uns und standen nun vor der<br />
Warthe, einem Fluß, über den eine lange<br />
Holzbrücke führte. Wieder mußten wir fast die<br />
ganze Nacht stehen, da alles verstopft war. Mit<br />
Morgengrauen fuhren wir über die Brücke und<br />
kamen in die Stadt Schieratz.<br />
Überall sah man dasselbe, wie die Leute<br />
flüchteten oder schon tot waren. Abends kamen<br />
wir bis Kalisch, einer größeren Stadt. O, wie<br />
unheimlich war es auch hier. <strong>Die</strong> Deutschen hatten<br />
alles vernebelt, es war unheimlich finster<br />
und keine Straße zu sehen. Frauen und Kinder<br />
lagen mit ihren Wagen im Graben und schrien<br />
um Hilfe, doch wer konnte helfen?<br />
Es galt nur zu fahren, denn kam jemand aus<br />
der Reihe, kam er nicht mehr hinein, weil Wagen<br />
an Wagen fuhr, ließ man ihn nicht mehr herein.<br />
Obzwar die Straße so dunkel war, konnten wir<br />
doch nicht warten. Nur vorwärts, vorwärts!<br />
Da die Menschen fast nicht aßen, nicht<br />
schliefen und nur in Angst weitereilten, waren<br />
manche schon nicht mehr ganz richtig im Kopf.<br />
Sie konnten nicht mehr denken und verloren<br />
ihre Wagen und Familien. War die Straße verstopft,<br />
fütterten wir die Pferde.<br />
Hier in Kalisch bekamen wir von den<br />
Soldaten ein Pferd. Bis dahin waren wir zu zwei<br />
Familien mit einem Pferd gefahren. Jetzt konnten<br />
wir auch mehr mitfahren. Verschiedene<br />
Sachen hatten wir abgeworfen, und nun hatten<br />
wir noch das zweite Pferd. Als wir nachts durch<br />
Kalisch fuhren, war es ganz still, doch am andern<br />
Tage wurde die Stadt wieder von russischen
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Panzern beschossen. Viele der Unsern waren<br />
noch in der Stadt, und Jakob Wölk kam da ums<br />
Leben. Er hatte seine Töchterlein von 9 und 11<br />
Jahren an der Hand. Wölk wurde zerrissen, eine<br />
Tochter war gleich tot, die andere schwer verwundet.<br />
<strong>Die</strong> Tote wurde beim Vater in den<br />
Straßengraben gelegt - und weiter gings. Seine<br />
Frau lag mit ihrem Kinde, das sie vor drei Tagen<br />
geboren hatte, im Wagen und wurde auch schwer<br />
verwundet, daß sie verblutete. Sie bat aber,<br />
doch so lange anzuhalten, daß sie sterben konnte.<br />
Ihre Geschwister waren auch auf dem<br />
Wagen, hielten an - und die Frau starb.<br />
Inzwischen war auch die zweite Tochter gestorben.<br />
So wurde nun auch die Mutter mit der<br />
anderen Tochter in den Straßengraben gelegt.<br />
Dann galt es, schnell die verlorene Zeit<br />
nachzuholen. Das kleine Töchterlein von drei<br />
Tagen und der kleine Peter von drei Jahren<br />
blieben am Leben. Dort wurden auch die Pferde<br />
des Johann Janzen getroffen. Er nahm seine<br />
Kinder vom Wagen und lief. Als sie ein paar<br />
Meter gelaufen waren, kam ein Volltreffer, und<br />
sein Wagen ging in die Luft. Er hatte alles verloren,<br />
nicht einmal die Handtasche und Papiere<br />
waren gerettet. Auch drei Kinder von Heinrich<br />
Schulz wurden verwundet. <strong>Die</strong>se waren alle aus<br />
Adelsheim. Wie viele wird es getroffen haben, die<br />
nicht aus unserm Dorf waren?...<br />
Abends um 5 Uhr fuhren wir durch<br />
Ostrowo... Mein Mann konnte fast nicht mehr, er<br />
war so ermüdet, daß ihm oft Leine und Peitsche<br />
aus den Händen fielen. Es war wohl die fünfte<br />
oder sechste Nacht ohne Rast. Hier schlief er nun<br />
von 2 bis 5 Uhr in einem Haus, dann tranken wir<br />
warmen Kaffee und es ging weiter.<br />
Den nächsten Tag fuhren wir durch<br />
Pleschen. Dort mußten wir unsern Wagen<br />
umtauschen, denn die Räder schleiften immer<br />
mit. Dann ging es weiter über Lissa, wo wir in<br />
einer großen Kaserne blieben. Da trafen wir<br />
Helene Regier, geb. Harder. <strong>Die</strong> war auch sehr<br />
niedergeschlagen, denn sie hatte ihren Mann<br />
und die Schwiegertochter verloren. <strong>Die</strong> Kinder<br />
der Schwiegertochter waren bei ihr. Hier kochten<br />
wir uns auch einmal etwas zum Abendbrot, ruhten<br />
aus und fuhren frühmongens weiter. So<br />
fuhren wir fünf Tage ohne Adelsheimer zu treffen.<br />
Als wir eines Tages die Pferde fütterten, wurden<br />
wir mit einmal von unsern Geschwistern<br />
432<br />
Jakob Falks und Schellenbergs eingeholt. Das<br />
war eine Freude! Onkel Schellenberg hatten wir<br />
auch verloren. Von da an gaben wir uns Mühe<br />
zusammenzubleiben und nachts zu rasten.<br />
Frühmorgens aber fuhren wir bei knisterndem<br />
Schnee weiter. Wir waren nun bald an der Oder<br />
und immer dasselbe Bild: <strong>Die</strong> Häuser leer und<br />
die Ställe voll Vieh. <strong>Die</strong> Kühe brüllten, wollten<br />
gemolken sein, und die Schweine schrien nach<br />
Futter. Ein Bild der Verwüstung! Bei Neusalz<br />
fuhren wir über die Oder, und wie waren wir so<br />
froh, als wir auf der andern Seite waren, endlich<br />
einmal Leute in ihren Häusern zu treffen. Und<br />
die Bäckereien arbeiteten.<br />
Nun konnten wir uns endlich Brot für Mehl<br />
eintauschen.<br />
Doch hier stellte sich eine neue Not ein.<br />
Fuhren wir früher einfach auf die leeren Höfe,<br />
fütterten die Pferde, kochten uns etwas und<br />
schliefen daselbst, so war es jetzt ganz anders.<br />
Hier wohnten die Leute, hatten ihre feinen<br />
Zimmer und wollten sie nicht von den schmierigen<br />
Flüchtlingen besudeln lassen. Als wir bis<br />
Sagan kamen, schneite es sehr, und die armen<br />
Pferde mußten ihre ganze Kraft einsetzen.<br />
Bergan schoben wir nach. Hier froren Annie die<br />
Füße an, und da hat sie fast Tag und Nacht<br />
gejammert.<br />
Von Sagan ging's nach Forst, vor Forst<br />
blieben wir in einem Dorf über Nacht und da<br />
trafen wir sieben Wagen Adelsheimer... Von Forst<br />
fuhren wir über Sorau nach Kotbus. Da bekamen<br />
wir Befehl, bis Lüben zu fahren und uns da zu<br />
melden. Dort würden wir wohl bleiben.<br />
Nach vielen Strapatzen kamen wir am 6.<br />
Februar in Lüben an. Welche Überraschung: hier<br />
waren schon viele unserer lieben Adelsheimer!<br />
<strong>Die</strong> Freude des Wiedersehens war groß. Jeder<br />
hatte seine eigene Geschichte zu erzählen. Hier<br />
fanden sich manche verlorenen Familien, auch<br />
Onkel Schellenberg fanden wir hier. Das<br />
Schwere war für uns, daß meine Geschwister mit<br />
Mutter nicht dabei waren, auch hatte sie niemand<br />
nach dem ersten Tage gesehen. Sollten die<br />
wohl den Russen in die Hände gefallen sein?<br />
Doch man tröstet uns, die könnten uns noch<br />
nachkommen.<br />
Hier wurden wir nun alle registriert, um die<br />
Familien zusammenzubringen. Von hier wurden<br />
wir auf die Dörfer verteilt... Auf unsere Fragen<br />
erfuhren wir, daß wir 47 Kilometer von Frankfurt
Kapitel 78 Adelsheim - Dolinowka<br />
an der Oder seien, wo der Russe hart angreife.<br />
Auch flogen nachts wieder feindliche Flieger<br />
über uns und bombardierten die Nachbarstädte.<br />
Am 17. Februar wurden wir auf die Höfe<br />
verteilt. Wir kamen zu einem Bauern namens<br />
Lehnieger. <strong>Die</strong> waren ganz gut zu uns, während<br />
manche von uns schlimme Stellen bekamen.<br />
Den 20. Februar starb hier nach kurzem, schweren<br />
Leiden Jakob Falks anderthalbjähriges<br />
Söhnchen. Den begruben wir noch, und am 24.<br />
bekamen wir wieder Befehl weiterzufahren.<br />
Am 25. Februar fuhren wir nach fast 20tägiger<br />
Rast von neuem los...<br />
15. April 1945. Wir danken Gott, daß wir die<br />
Reise überstanden haben und nun so weit ins<br />
Reich gekommen sind, daß wir beim<br />
Zusammenbruch dem Amerikaner in die Hände<br />
fielen...<br />
Es waren die ersten amerikanischen<br />
Soldaten...<br />
13. August 1945... Nach zwei Monaten unter<br />
amerikanischer Herrschaft hörten wir hin und<br />
wieder, als ob nach der Aufteilung Sachsen und<br />
Thüringen wohl dem Russen zufallen würden.<br />
Das beunruhigte uns sehr. Weiterfahren durften<br />
wir nicht mehr, waren doch überall die<br />
Zonengrenzen festgesetzt. Viele hatten auch ihre<br />
Pferde nicht mehr, und Züge gingen keine.<br />
Wir beteten und hofften, daß es vielleicht<br />
nicht so kommen würde. Da, eines Tages, als wir<br />
von der Arbeit kommen, hören wir, über Radio<br />
sei gekommen, daß Mitteldeutschland (Sachsen<br />
und Thüringen) dem Russen zufallen solle.<br />
Verblüfft standen wir da, kaum unsern Ohren<br />
trauend. Ruhe- und ratlos lief einer zum andern:<br />
Was nun? Unsere Männer baten die<br />
Militärregierung, man möchte uns erlauben<br />
weiterzufahren. Doch es wurde uns abgesagt.<br />
Wir beteten und hofften auf Hilfe. Von Zeit<br />
zu Zeit versuchten wir es bei der<br />
Militärregierung. Da, eines Tages erfuhren wir,<br />
daß der Herr die Herzen der Menschen lenken<br />
kann wie Wasserbäche. Unsere Männer kamen<br />
wieder und hatten die Papiere, daß wir nach<br />
dem Westen in die englische Zone fahren<br />
durften... Viele aber glaubten nicht, daß der<br />
Amerikaner das Gebiet abgeben würde und<br />
wollten noch warten, bis Näheres über Radio<br />
kommen würde... So kam es, daß wir uns von<br />
unsern lieben Adelsheimer trennen mußten. Auf<br />
der ganzen Flucht hatten wir uns bemüht,<br />
433<br />
zusammenzubleiben und nun, wo es ruhig war,<br />
teilten wir uns.<br />
Nur zwei Wagen verließen den Kreis Zeitz.<br />
Noch heute danken wir dem Herrn, daß er es so<br />
führte, daß wir keine Ruhe hatten, bis wir<br />
fuhren... Eines Tages wurde das Gebiet von den<br />
Russen besetzt. <strong>Die</strong> Ärmsten wurden nach<br />
Rußland zurückgeschickt und sind heute in der<br />
Verbannung. Nur wenige wagten die Flucht<br />
später schwarz über die Grenze und brachten<br />
uns die traurige Nachricht von dem Schicksal<br />
der andern.<br />
Unsere Fahrt ging von Sachsen über<br />
Thüringen und Hessen nach Westfalen, wo wir<br />
heute sind. Am 19. Juni fuhren wir ab und waren<br />
mit Wagen und Pferden zwei Wochen unterwegs.<br />
Viele, viele Trümmer sahen wir, je weiter wir<br />
nach dem Westen kamen.<br />
<strong>Die</strong> einst so blühenden Städte Deutschlands<br />
lagen jetzt in Trümmern und Asche - eine Stätte<br />
des Grauens und der Verwüstung. Wir durchfuhren<br />
die Städte Gera, Jena, Gotha, Weimar,<br />
Eisenach, Kassel und Paderborn. Als wir bei<br />
Paderborn vorbei waren, hielten wir Rast und<br />
suchten Arbeit und Unterkunft. Beides fanden<br />
wir hier auf dem Gut Ringelsbruch.<br />
13. Januar 1946. Wieder ist Weihnachten<br />
vorüber, schon das dritte Mal seitdem wir unser<br />
liebes Adelsheim verließen. 1943 waren wir in<br />
Oberschlesien im Lager. Weihnachten 1944<br />
feierten wir in Polen. 1945 sind wir nun in<br />
Westfalen, wo mögen wir wohl die nächsten<br />
Weihnachten feiern?<br />
Seitdem der liebe Bruder C. F. Klassen uns<br />
hier aufgesucht hat, sind wir alle nicht mehr so<br />
niedergeschlagen. Als ob neues Leben in unsere<br />
Glieder gekommen ist, so hat uns die Hoffnung<br />
belebt, noch einmal eine Heimat zu bekommen.<br />
Wir hoffen alle zuversichtlich, daß unsere<br />
Glaubensgeschwister aus Übersee uns mit<br />
Gottes Hilfe herüberhelfen werden. Doch wo<br />
sind unsere Geschwister und unsere Mutter? Bis<br />
heute suchen wir vergebens. "Was Gott tut, das<br />
ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille."<br />
Anmerkung des Verfassers: <strong>Die</strong>se<br />
Reisebeschreibung erschien in der<br />
,,Mennonitischen Rundschau" fortlaufend im<br />
Jahre 1948.<br />
<strong>Die</strong>ses ist ein gekürzter Bericht von Anna<br />
Loewen, Adelsheim, aus G. Fast, Das Ende von<br />
Chortitza (Winnipeg 1973), Seite 120-138.
Kapitel 79 Hochfeld - Morosowka<br />
Das Dorf wurde 1872 gegründet. Das Land<br />
wurde von der russischen Gutsbesitzerin<br />
Morosowa gekauft. Das Dorf lag nördlich von<br />
Franzfeld und war das jüngste von den fünf<br />
Dörfern der Jasykower <strong>Kolonie</strong>. Im Süden grenzte<br />
Hochfeld an Franzfeld, an den anderen drei Seiten<br />
grenze es an die Russendörfer. Hochfeld war 50<br />
km südlich von Jekaterinoslaw gelegen und 12 km<br />
vom Dnjepr entfernt. Einer der ersten Einwohner<br />
von Hochfeld war Gerhard Kehler (1825-1902). Er<br />
zog 1875 nach Kanada und siedelte im Dorf<br />
Hochfeld, Ostreserve, bei Steinbach, Manitoba,<br />
an. Sein Urenkel Al Reimer war ein berühmter<br />
Schreiber und Verfasser des Romans „When my<br />
Harp ist turned to Mourning", wo es um die<br />
Revolution und den Bürgerkrieg geht.<br />
Nach den Hungerjahren 1921-1922 folgten<br />
gute Ernten, die den Wiederaufbau der<br />
Landwirtschaft begünstigten. 1924 wurde hier<br />
eine landwirtschaftliche Genossenschaft mit dem<br />
Geschäftsführer <strong>Die</strong>trich Rempel gegründet. Das<br />
Geschäft kam in kurzer Zeit zur hohen Blüte. Eine<br />
Butterfabrik wurde eingerichtet, die bis 1000 Liter<br />
Milch am Tag verarbeitete.<br />
Ein Gebäude in Hochfeld. Aussicht zum Norden.Vielleicht ist es ein Laden gewesen. Hinten rechts steht ein<br />
Speicher. Foto: Mai 2000.<br />
Das selbige Gebäude. Aussicht zum Westen von der Querestrasze. Foto: Mai 2000.<br />
434
Kapitel 79 Hochfeld - Morosowka<br />
Arnold Dyck 1889-1970 - Schriftsteller<br />
Er machte seine Sache mit voller Hingabe und<br />
Begeisterung und war immer bereit, sich für die<br />
Sache der mennonitischen Kultur voll einzusetzen.<br />
Arnold Dyck wurde am 19. Januar 1889 in<br />
Hochfeld, <strong>Kolonie</strong> Jasykowo, Russland geboren.<br />
Seine Eltern waren Bernhard Dyck (Neuhorst) und<br />
Helene, geborene Töws (Rosengart).<br />
Im Herbst 1903 trat er in die zweite Klasse der<br />
Zentralschule in Chortitza ein. <strong>Die</strong> von ihm<br />
bevorzugten Fächern waren deutsche und russische<br />
Literatur, jedoch sein Lieblingsfach war<br />
Zeichnen.<br />
1906 wurde er in die 4. Klasse der<br />
Kommerzschule in Jekaterinoslaw aufgenommen.<br />
Doch die Malerei ließ ihn trotz aller Beschäftigung<br />
nicht in Ruhe, und im Frühling 1909 fuhr er nach<br />
München. Er wurde in die "Malschule des<br />
Kunstmalers Knirr" in Stuttgart in der<br />
Kunstakademie aufgenommen.<br />
Anfang 1911 machte er in der Tschernolesskoje<br />
Lesnitschestwo (Forstei) seinen Ersatzdienst.<br />
Nach Neujahr 1913 zog er wieder hinaus, um<br />
sein Kunststudium weiterzumachen. <strong>Die</strong>ses Mal<br />
ging er nach St. Petersburg in eine private<br />
Malschule des Kunstmalers Goldblatt.<br />
Nach den Sommerferien 1914, ging er nach<br />
Moskau und trat in die Schule des Malers<br />
Meschkow ein. Hier fühlte er sich sehr wohl. Es fing<br />
der I. Weltkrieg an, und Arnold musste, nach nur<br />
einem Jahr seines Studiums, in den Sanitätsdienst<br />
nach Jekaterinoslaw.<br />
Im Mai 1918 wurde Arnold aus dem <strong>Die</strong>nst<br />
entlassen. In demselben Jahr heiratete er Katharina<br />
Vogt aus Schönwiese, und sie zogen in die<br />
Sommerstube zu seinen Eltern nach Hochfeld.<br />
A.Dyck mit noch einigen Hochfeldern gründeten<br />
hier eine Fortbildungsschule.<br />
Während der Banden-Zeiten (1918-19) war<br />
Arnold als Wolostsowjetsekretär tätig, danach<br />
durfte er wieder in der Schule als Zeichenlehrer<br />
arbeiten, später auch in der Zentralschule in<br />
Nikolajfeld und Franzfeld. Er arbeitete mit<br />
Begeisterung. Doch nach zwei Jahren gab er diesen<br />
<strong>Die</strong>nst wegen des kommunistischen<br />
Schulprogramms, mit dem er sich nicht identifizieren<br />
konnte, auf.<br />
Am 23. August 1923 kam die Familie Arnold<br />
Dyck in Steinbach, Manitoba, Kanada an.<br />
Am 1. März 1924, übernahm er den Betrieb<br />
"Steinbach-Post" bei Jakob S. Friesen, nachdem er<br />
einige Monate als Handsetzer und Drucker gearbeitet<br />
hatte. Später wurde er zum Alleinbesitzer des<br />
Betriebes. Dann verkaufte er die "Steinbach-Post"<br />
an Gerhard Derksen.<br />
1953 siedelte er nach Deutschland zu seiner<br />
Tochter um. Er arbeitete weiter im „Echo-Verlag",<br />
schrieb weiter mennonitische Geschichten und<br />
war mit Leib und Seele ein Schreiber.<br />
Im Alter von 72 Jahren legte er manchmal an<br />
einem Vormittag bis zu 70-80, ja sogar 100 km mit<br />
dem Fahrrad zurück. Er starb am 10. Juni 1970 in<br />
Darlaten bei Bremen, Deutschland.<br />
Zum Nachlesen: Collection der Werke von Arnold<br />
Dyck in vier Bänden (Manitoba Mennonite<br />
Historical Society: Winnipeg 1985).<br />
Eine Zeichnung von A. Dyck in seiner sehr<br />
beliebten plattdeutschen Geschichte. Foto aus A.<br />
Arnold Dyck, (1889-1970) und Frau Katharine Vogt Dyck, "Koop enn Bua opp Reise", Band II.,<br />
(1894-1966) Foto aus Preservings,Nr. 13, Seite 89. (Steinbach 1985), Seite 124.<br />
435
Kapitel 80 <strong>Die</strong> Fürstenland <strong>Kolonie</strong><br />
Es ist eine Tochterkolonie der Chortitza<br />
<strong>Kolonie</strong>, die in den Jahren 1864-1868 aus sechs<br />
Dörfern entstand: Alexanderthal, Georgsthal,<br />
Michaelsburg, Olgafeld, Rosenbach und<br />
Sergejewka.<br />
<strong>Die</strong> Dörfer der Fürstenland <strong>Kolonie</strong>, außer<br />
Rosenbach, wurden nach den Namen der Kinder<br />
des Großfürsten Michail Nikolaewitsch (1832-<br />
1909) benannt. Michail Nikolajewitsch war der<br />
vierte Sohn vom Zaren Nikolaj I., auf dessen<br />
Ländereien im Melitopoler Kreis (Taurien), Wolost<br />
Werchnij-Rogatschik die Fürstenland <strong>Kolonie</strong> entstand.<br />
Er hatte 78 000 Desjatin Land in<br />
Gruschewka, das unter der Verwaltung von einem<br />
Moritz Schumacher war. Während eines Besuches<br />
in der Chortitza <strong>Kolonie</strong>, hat er den Mennoniten<br />
angeboten, etwas Land zu verpachten (aus P.<br />
Zacharias, Reinland, Seite 21).<br />
...Vorsitzender des "Landwirtschaftlichen<br />
Vereins" Peter Dueck aus Schöneberg, machte den<br />
ersten Pachtvertrag mit Schumacher aus. Der<br />
Pachtpreis für die ersten 15 Jahre betrug für 1<br />
Desjatine 1,25 Rubel. Peter Dueck war auch der<br />
erste Vorsteher (Oberschulz) in Fürstenland. Er<br />
zog nach Michaelsburg. Sein Schwiegersohn<br />
Franz Fröse, später in Reinland, Manitoba, war der<br />
zweite Vorsteher für die Westreserve ... (aus P.<br />
Zacharias, Reinland, Seiten 21-22).<br />
...1863 geschah in Osterwick ein großes<br />
Unglück. Frau Johann Teichröb hatte in der<br />
Pfanne Öl überhitzt, das in Flamen aufging und<br />
ein großen Brandt auslöste. <strong>Die</strong>ser Brandt zerstörte<br />
ihr eigenes Heim und 60 andere. Eine ganze<br />
Reihe von Familien wurden an einem Tag obdachlos.<br />
Viele von diesen zogen in die neue <strong>Kolonie</strong><br />
Fürstenland (aus Teichröb, Seite 9).<br />
Fürstenland war also eine Pachtkolonie. Das<br />
Pachtareal betrug 19 000 Desjatin Land.<br />
Fürstenland hatte gutes Land für den Anbau von<br />
Mais und Kartoffeln, aber Wassermelonen brachten<br />
den besten Ertrag. Aus diesen Wassermelonen<br />
kochten die Mennoniten Sirup, der in den<br />
Wintermonaten als Brotaufstrich gebraucht<br />
wurde. Jedes Dorf hatte außer dem Namen noch<br />
eine Nummer und zwischen 18-35 Wirtschaften.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kolonie</strong> besaß zwei Mühlen: eine in<br />
Sergejewka und die andere in Georgsthal. Jedes<br />
436<br />
Dorf hatte eine Schule. <strong>Die</strong> Einwohner gehörten<br />
zu der Chortitzer-Gemeinde, hatten aber ihren<br />
eigenen Ältesten.<br />
Am 24.10.1867 besuchte Prediger Jakob D.<br />
Epp vom Judenplan die Siedlung Fürstenland. In<br />
seinem Tagebuch schreibt er: diese Siedlung ist<br />
eine stabile und wohlhabende mit vielen schönen,<br />
teuren Häusern.<br />
Verzeichnis der Amtspersonen für die<br />
Kolonialverwaltung, welche im Laufe der Monate<br />
November bis Dezember 1870 von den<br />
Kolonistengemeinden gewählt wurden:<br />
Georgsthal: Beisitzer–Peter Klassen; Stellvertreter<br />
–Jakob Krahn. Olgafeld: Beisitzer – Georg<br />
Letkemann; Stellvertreter–Franz Peters.<br />
Michaelsburg: Schulz–Isaak Janz;<br />
Stellvertreter–Peter Klassen; Beisitzer – Peter Wall;<br />
Stellvertreter: Franz Janz. Rosenbach:<br />
Beisitzer–Kornelius Martens; Stellvertreter-Peter<br />
Hamm. Alexanderthal: Schulz–Kornelius Peters;<br />
Stellverteter–Franz Peters; Beisitzer–Kornelius<br />
Janzen; Stellverteter –Abraham Knelsen.<br />
Sergejewka: Schulz–Jakob Elias;<br />
Stellvertreter–Kornelius Banmann; Beisitzer –<br />
Peter Ginter; Stellvertreter–Isaak Bergen.<br />
(Odessaer Zeitung, 18. Februar 1871).<br />
Verzeichnis der Amtspersonen für die<br />
Kolonialverwaltung, welche für die Jahre 1870<br />
und 1871 von den Kolonistengemeinden gewählt<br />
wurden: Georgsthal: Schulz–Jakob Pauls;<br />
Stellvertreter–David Giesbrecht; Beisitzer–Peter<br />
Raker; Stellvertreter – Kuduring. Olgafeld:<br />
Schulz–Isaak Dück; Stellvertreter–Johann Lakwen;<br />
Beisitzer–Johann Klassen; Stellvertreter–Araham<br />
Peters. Michaelsburg: Beisitzer–Franz Fröse;<br />
Stellvertreter–Franz Janzen. Rosenbach: Schulz–<br />
David Rempel; Stellvertreter–Martin Riesen;<br />
Beisitzer–Peter Teichröb; Stellvertreter–Jakob<br />
Klassen. Alexanderthal: Beisitzer–Isaak Janz;<br />
Stellvertreter–Gerhard Klassen. <strong>Kolonie</strong> Nr. 6<br />
(Sergejewka ): Beisitzer – Jakob Boschmann;<br />
Stellvertreter–Peter Peters. (Odessaer Zeitung, 13.<br />
Februar 1870).<br />
(<strong>Die</strong>se zwei Verzeichnisse sind mit freundlicher<br />
Genehmigung von Jake E. Peters,<br />
Winnipeg, Manitoba, Kanada hier angegeben<br />
worden. 16. März 2001.)
Kapitel 80 <strong>Die</strong> Fürstenland <strong>Kolonie</strong><br />
1875 wanderten 1100 Personen mit ihrem<br />
Ältesten Johann Wiebe (1837-1905) aus nach<br />
Kanada und siedelten in Manitoba, Westreserve,<br />
an, wo sie die "Reinländer Gemeinde" (später<br />
genannt „Alt-<strong>Kolonie</strong> Gemeinde") 1875 gründeten.<br />
1911 zählte die Fürstenland <strong>Kolonie</strong> 1800<br />
Einwohner (Menn. Lexikon, Band II., Seite 21).<br />
Nach der Revolution emigrierten in den Jahren<br />
1924 bis 1926 noch 160 Familien nach Kanada. <strong>Die</strong><br />
14 noch zurückgebliebenen Familien haben wohl<br />
das gleiche Schicksal gehabt wie die meisten<br />
Mennoniten in der Zeit. 1923 wurde das Dorf<br />
Karlowka mit 10 Wirtschaften der <strong>Kolonie</strong><br />
zugeteilt.<br />
Moderne Fahrkarte zu den ehemaligen Dörfer der Fürstenland <strong>Kolonie</strong>. Sergejewka ist unten links, aber<br />
nicht auf die Karte zu sehen. Oben rechts ist Nikopol, an der Nordseite des Dnjepr, und an der Südseite<br />
ist Kamenka. Ein Pram (Fähre) fährt zwischen diesen beiden Städten, damit die Leute hin und zurück<br />
über den Fluss fahren können, so wie es vor hundert Jahren auch war.<br />
437
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Entstehung. Der Großfürst Michail<br />
Nikolajewitsch, Bruder von Alexander II., hatte<br />
zu seiner Zeit im südlichen Russland ein<br />
Landstück von 78 000 Desjatinen. Davon lagen<br />
40 000 Desjatinen am rechten Ufer des Flusses<br />
Dnjepr im Chersonschen Gouvernement, und 25<br />
000 am linken Ufer des Flusses im Taurischen<br />
Gouvernement. In den 1860er Jahren ließ der<br />
Großfürst seine Vertreter bei der Chortitzer<br />
Wolost um mennonitische Ansiedler für sein<br />
Land werben. Das Angebot war: Kaufen mit<br />
jährlicher Anzahlung von zwei Rubel pro<br />
Desjatine 50 Jahre lang oder Pachten mit<br />
jährlicher Pachtzahlung von 1,25 Rubel pro<br />
Desjatine. Für welchen Zeitrum der erste<br />
Pachttermin abgeschlossen war, weiß ich nicht,<br />
aber es konnte immer wieder gepachtet werden,<br />
bis auf Kindes-Kinder und noch länger.<br />
In Pawlowka (Osterwick) war ein großer<br />
Brand gewesen, wobei viele obdachlos wurden.<br />
Es fanden sich viele von denen, die dann hier<br />
ansiedeln wollten, und sie wurden sich einig zu<br />
pachten.<br />
1864 wurden auf dem linken Ufer des<br />
Dnjepr, im Taurischen Gouvernement zuerst<br />
drei Dörfer angelegt: Georgsthal (Nr.1), Olgafeld<br />
(Nr.2) und Michaelsburg (Nr.3). Nun wurde für<br />
diese drei Dörfer ein Landstreifen, längs der<br />
östlichen Grenze, angrenzend an das Land der<br />
Russendörfer Groß Snamenka und Werchnij<br />
Rogatschik, abgeschnitten. Davon bekam<br />
Michaelsburg einen Anteil von 2600 Desjatin,<br />
angrenzend im Osten an Groß Snamenka und<br />
nördlich an den kleinen Fluss Konka, der parallel<br />
zum Dnjepr floss und dort in denselben mündete.<br />
Das Land wurde für 40 Familien mit je 65<br />
Desjatin Land berechnet. Das Dorf Michaelsburg<br />
wurde neben der Konka in einer ebenen<br />
Niederung angelegt, ein sehr guter Platz für den<br />
Gartenbau. <strong>Die</strong> anderen beiden Dörfer wurden<br />
im südlichen Teil des Landes in einem Tal,<br />
genannt Rogatschik (auch Solotaja Balka) am<br />
rechten Ufer des Flusses Rogatschik angelegt. Für<br />
jedes Dorf waren 1950 Desjatin bestimmt, für 30<br />
Franz Doerksen<br />
Material gesammelt und geschrieben von Franz Isaakovic Doerksen, Eyebrow, Box 131,<br />
Sask.,Kanada, 3. Januar 1935, wobei <strong>Die</strong>trich G. Thiessen, ebenfalls Eyebrow, behilflich war. <strong>Die</strong>ser<br />
Bericht ist ein wenig abgekürzt.<br />
438<br />
Wirtschaften zu 65 Desjatin. Weil das Tal<br />
Schwenkungen hatte, wurde das Dorf Olgafeld in<br />
einem Winkel angelegt. Das Dorf Georgsthal<br />
hatte eine gerade Straße, und die Dörfer lagen<br />
nahe beieinander.<br />
Es kamen aus den Dörfern der Chortitzer<br />
<strong>Kolonie</strong> bald mehr Ansiedler dazu, und es wurden<br />
nach und nach noch drei Dörfer gegründet.<br />
Jedes Dorf erhielt 1950 Desjatin Land für 30<br />
Wirtschaften pro 65 Desjatin. <strong>Die</strong> Dörfer<br />
Rosenbach (Nr.4) und Alexanderthal (Nr.5) wurden<br />
im Tal Rogatschik am linken Ufer des Flusses<br />
Rogatschik, gegenüber der zwei ersten Dörfern<br />
Nr.1 und Nr.2, hart angelegt. Das letzte Dorf<br />
Sergejewka (N.6) wurde 20 Werst westlich von<br />
diesen Dörfern am linken Ufer des Dnjeprs<br />
angelegt. Sergejewka hatte im Sommer einen<br />
Schiffshafen, Michaelsburg hatte ebenfalls 6 km<br />
ab einen Hafen „Uschkalka". <strong>Die</strong>ser Hafen war<br />
von den vier Dörfern (1, 2, 4, 5) 18 Werst entfernt.<br />
<strong>Die</strong> nächste Bahnstation war in den ersten<br />
Jahren Michajlowka, 75 Werst entfernt. Später, als<br />
die 2. Ekatarinen Bahn gebaut wurde, wurde<br />
Nikopol, 40 Werst entfernt, die nächste<br />
Bahnstation. Das Land gehörte zur Werchne-<br />
Rogatschiker Wolost und lag im Melitopoler<br />
Kreis, Taurisches Gouvernement.<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaftsgebäude wurden fast alle<br />
nach einem Maß in gerader Linie gebaut: die<br />
Wände aus Lehm und die Dächer aus Stroh. Vom<br />
Großfürsten bekam jedes Dorf das Holz für den<br />
Bau einer Schule kostenlos. Der Großfürst hatte<br />
auf seinem Land mehrere Ökonomien, die<br />
Gebäude aber waren nur sehr schlecht und billig<br />
gebaut. Eine Ökonomie Gruschewka, wo der<br />
Oberverwalter wohnte, war 40 Werst über den<br />
Dnjepr entfernt, dann kam eine Ökonomie<br />
Konsawod–sieben Werst entfernt von uns, wo ein<br />
Unterverwalter wohnte. <strong>Die</strong>se beiden<br />
Ökonomien kamen nur für die Pächter in<br />
Betracht.<br />
<strong>Die</strong> Verwaltung. <strong>Die</strong> Pächter in den sechs<br />
<strong>Kolonie</strong>n mussten aus ihrer Mitte einen Mann
Kapitel 80 <strong>Die</strong> Fürstenland <strong>Kolonie</strong><br />
wählen und ihn dem Oberverwalter vorstellen.<br />
Letzterer bestätigte ihn als Vorsteher über die<br />
sechs <strong>Kolonie</strong>n. <strong>Die</strong>ser musste das Pachtgeld zur<br />
bestimmten Zeit einfordern und in die<br />
Verwaltung bringen. Er war auch der Vermittler<br />
zwischen den Pächtern und der Verwaltung in<br />
allen Sachen in Bezug auf die Ansiedlung. Dafür<br />
bekam er von der Verwaltung seinen<br />
Landanteil–65 Desjatin frei.<br />
<strong>Die</strong> Ansiedler waren so mehr alle aus der<br />
Chortitzer <strong>Kolonie</strong> und ließen sich auch nicht<br />
nach der Rogatschiker Wolost überführen, sondern<br />
blieben bei jener Wolost stehen, zahlten alle<br />
Abgaben dort ein. Dem Vorsteher wurde als<br />
Gehilfe noch ein Schreiber an seine Seite gestellt.<br />
<strong>Die</strong>se beiden mussten die Verwaltung für diese<br />
Dörfer leiten. Alle Vorschriften der Chortitzer<br />
Wolost wurden durch diese beiden Männer<br />
erledigt. Streitigkeiten wurden auch durch sie<br />
beigelegt, wobei bei schweren Fällen auch mal<br />
die Dorfbeamten zugezogen wurden. Es hat die<br />
meiste Zeit ziemlich gut gegangen. Man wollte<br />
sich von den Russen nicht verurteilen lassen.<br />
Ich kam mal 1895 als Lehrer nach Olgafeld<br />
und blieb im Dorf bis 1925, bis ich nach Amerika<br />
zog... Als ich dort ankam, war der Oberverwalter<br />
ein Reichsdeutscher namens Peterson. Nach<br />
Peterson kam ein Garne; seine Nationalität ist<br />
mir unbekannt. Letzterer blieb bis zum<br />
Ende...Unterverwalter war bei Peterson ein sehr<br />
freundschaftlicher Mann namens von Riesen,<br />
auch ein Reichsdeutscher. Nach ihm, bis zum<br />
Ende – ein Herr Ritter, ein Deutscher, aber russischer<br />
Untertan. Von den Vorstehern war wohl der<br />
erste Onkel Peter Peter Lepp. Nach ihm war<br />
Kornelius Enns, bis er nach Amerika zog. Danach<br />
war Franz Unrau (Sergejewka), bis der<br />
Vorsteherposten einging.<br />
<strong>Die</strong> Brandordnung war hier auch ein Zweig<br />
der Chortitzer Wolost. <strong>Die</strong> Kasernensteuer wurde<br />
auch unter Chortitzer direktiv verwaltet. Auch<br />
hatten sie auf dem Fürstenlande eine<br />
Waisenverwaltung, eine Filiale des Neuendorfer<br />
Waisenamtes. Verwaltet wurde sie hier in<br />
Rosenbach von einem Onkel Abram Andres und<br />
Onkel Jakob Isaak.<br />
Landwirtschaft. Der Boden auf dem Lande war<br />
fruchtbar und gab gute Ernte. Im Stroh war das<br />
439<br />
Getreide nur niedrig. Im Pachtkontrakt war bestimmt,<br />
der 6. Teil des Ackerlandes sollte jährlich<br />
gebracht werden, aber es wurde erlaubt die<br />
Brach mit Hackfrüchte zu bepflanzen. Der größte<br />
Teil wurde mit Welschkorn bepflanzt, dann<br />
Melonen, Wassermelonen und Kartoffeln. Wenn<br />
die Brache gut besorgt wurde, brachten die<br />
Früchte eine schöne Einnahme. Besonders gut<br />
gediehen die Wassermelonen. Wenn diese Frucht<br />
reif war, wurden 21 Fuß lange Bretterwagen eingerichtet<br />
und damit Wassermelonen eingefahren.<br />
Alle Töpfe füllten sich mit dieser Frucht.<br />
Sobald die Russen in den benachbarten Dörfern<br />
merkten, dass die Mennoniten Wassermelonen<br />
einfuhren, kamen sie von allen Seiten und<br />
Straßen und die Höfe füllten sich mit Käufern.<br />
<strong>Die</strong> Russen hatten sehr wenig Land; daher konnten<br />
sie diese Frucht nicht anbauen und kauften<br />
sie bei den Deutschen. <strong>Die</strong> Einnahmen waren<br />
jedoch verschieden, nachdem er seine Brache<br />
besorgt hatte, oder es ihm geglückt hatte beim<br />
Verkaufen, doch stieg die Einnahme auf die<br />
Wirtschaft bis 150 Rubel und mehr. In<br />
Michaelsburg haben einige bis 500 Rubel<br />
erbracht.<br />
Das Welschkorn war auch ein sehr gutes<br />
Produkt als Futter für Schweine, Pferde und<br />
Geflügel. Das Stroh war gutes Futter für das<br />
Rindvieh. Für die Kobben wurden aus Brettern<br />
lange, schmale Speicher aufgestellt, welche<br />
damit angefüllt wurden. Im Frühjahr, wenn der<br />
Rest des Welschkorns erst trocken war, wurde es<br />
gedroschen und verkauft. Mit der Brache gab es<br />
viel Arbeit, aber es gab auch eine gute Einnahme.<br />
Das Getreide schippte man zum Dnjeprhafen; oft<br />
konnte man es gleich in ein Gefäß schütten, und<br />
der Preis war dann gewöhnlich höher, wie in<br />
Nikopol. Eier und Butter war auch immer für<br />
Geld zu verkaufen. Übrige Kühe kauften die<br />
Russen aus umliegenden Dörfern für annehmbaren<br />
Preisen ebenso auch Pferde.<br />
Gute Pferde brachte man nach Kachowka<br />
zum Jahrmarkt. Dort fanden sich immer gute<br />
Kaufleute aus allen Gegenden, sogar aus dem<br />
Ausland und die zahlten gute Preise. Im nächsten<br />
Russendorf war einmal wöchentlich ein Basar<br />
(Markt), und dort konnte man kaufen und<br />
verkaufen.<br />
<strong>Die</strong> Ansiedlung war gelungen und wer etwas
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
sparsam war kam bald zu Geld und Wohlstand.<br />
Wohl alle hatten Obstgärten, auf Stellen sehr<br />
schöne, welche auch immer eine Einnahme<br />
brachten. <strong>Die</strong> meisten, sobald sie etwas Bargeld<br />
hatten, verkauften ihre Wirtschaften und zogen<br />
auf eignen Land.<br />
<strong>Die</strong> Auswanderungen. Es gab auch immer<br />
Auswanderungen nach Amerika. <strong>Die</strong> erste große<br />
Auswanderung nach Amerika, veranlasst durch<br />
den Soldatendienst, fand statt, als Ältester<br />
Johann Wiebe mit dem größten Teil seiner<br />
Gemeinde 1875 auswanderte. Später fanden<br />
immer kleinere oder größere Auswanderungen<br />
nach Amerika, auch nach Dörfern auf eigen Land<br />
statt. <strong>Die</strong> Auswanderungsursache war später<br />
auch noch die Pachtpreiserhöhung. Bei den<br />
größeren Auswanderungen waren die<br />
Wirtschaften billig, und die Ärmeren kauften sie<br />
dann. <strong>Die</strong> Wirtschaftsgebäude wurden nur<br />
sparsam unterhalten, um nicht viel Geld<br />
hineinzulegen.<br />
In den mennonitischen Dörfern auf eigenem<br />
Land waren die Wände und der Giebel der<br />
Häuser aus gebrannten Ziegeln; die Dächer aus<br />
Blech, oder Pfannen; die Straßenzäune ebenfalls<br />
aus gebrannten Ziegeln mit hohen<br />
Einfahrtspfosten. Hier dagegen blieben die<br />
Gebäude mit Strohdächern und Lehmwänden,<br />
die Straßenzäune aus mangelhaften Brettern.<br />
Weil hier so viele auswanderten und ebenso<br />
viele auch wieder einwanderten, findet man<br />
überall Leute, die auf dem Fürstenlande gewohnt<br />
haben, und viele sagen auch: es gibt nur ein<br />
Fürstenland, also war der Platz wohl der beste.<br />
Erziehungswesen. <strong>Die</strong> Olgafelder Dorfgemeinde<br />
hatte mich 1895 als Lehrer eingeladen. Damals<br />
standen die Schulen unter Gemeindeaufsicht,<br />
wenigstens kam der Kreisinspektor nicht in die<br />
Schulen und die Lehrer hatten auch keine<br />
schriftliche Beziehungen zu ihm. Während auf<br />
anderen Stellen die Schulen längst dem<br />
Ministerium für Volksaufklärung unterstellt<br />
waren. Es schien so, als ob Fürstenland in allen<br />
Dingen seine eigene Verwaltung hatte, und daher<br />
wurde scherzweise gesagt: es sei nicht Russland,<br />
sondern Fürstenland. <strong>Die</strong> Schulen waren nicht<br />
vernachlässigt.<br />
440<br />
<strong>Die</strong> in Georgsthal und Michaelsburg zeichneten<br />
sich aus, da die Schulhäuser und Gärten<br />
gut unterhalten wurden und sie auch tüchtige<br />
Lehrer hatten. In Michaelsburg hatte mal der verstorbene<br />
Ältester der Chortitzer Gemeinde sechs<br />
Jahre gearbeitet, danach der gegenwärtige<br />
Ältester Heinrich <strong>Die</strong>trich Epp, der in Jasykowo<br />
<strong>Kolonie</strong> mehr als 15 Jahre, bis 1895, gearbeitet<br />
und nach diesen zu meiner Zeit schon Kirchen<br />
Ältester Johann Martens aus der Kronsweider<br />
Gemeinde, gegenwärtig in der Verbannung, gearbeitet.<br />
Dann in Georgsthal hat ein Lehrer und<br />
Prediger Kornelius Enns auch viele Jahre gearbeitet.<br />
Ich glaube, es ist immer ein Vorteil für<br />
Schüler und Lehrer, wenn der Leher längere Zeit<br />
auf einer Stelle bleiben kann. In dem Jahre, als<br />
ich hinkam, wurden die Lehrer auf dem<br />
Fürstenlande fast alle ausgetauscht und der<br />
Inspektor ließ sich auch bald hören. Noch vor<br />
Neujahr bekam jeder Lehrer einen Brief von ihm,<br />
sein Lehrerzeugnis einzuschicken. Einige Lehrer<br />
hatten keine, und wer eins hatte, der hatte es<br />
nicht eingereicht. Mit der Zeit mussten alle ihre<br />
Zeugnisse einreichen, und wer keins hatte,<br />
musste sich eins erwerben. Dann war auch<br />
wieder alles gut. Nun kam er auch, um die<br />
Schulen zu besuchen, wovon Lehrer auch<br />
Schüler nur Vorteil hatten, denn es gab doch<br />
einen Ansporn. Wir waren nur sechs Lehrer, fast<br />
alle einander unbekannt. Aber der Vorsteher<br />
Franz Unrau lud uns Lehrer, alle Prediger und<br />
Dorfältesten zu sich zu einer Konferenz ein. Es<br />
wurde über manches beraten, und es wurden<br />
Beschlüsse gefasst, damit das Schulwesen mehr<br />
übereingetrieben werde. Der leitende Prediger<br />
Peter Peter Lepp mit seinem Amtskollegen sollte<br />
alle Schulen zweimal jährlich besuchen, und die<br />
Lehrer sollten dann auch einander besuchen.<br />
Dann fanden wir Lehrer es für gut, dass jeder<br />
Lehrer eine Konferenz mit seinen Kollegen<br />
abhalten sollte und dabei zwei Probelektionen<br />
geben, die dann unter die Kritik der Lehrer<br />
genommen werden sollten. Nun wurde das auch<br />
noch in die Beschlüsse gefasst, und so mehreres,<br />
dass die Prediger nur die deutsche Sprache und<br />
Religion beaufsichten mussten, die andere<br />
Fächer waren dem Inspektor unterstellt. <strong>Die</strong><br />
Konferenzen gaben eine schöne Übung. Sechs
Kapitel 80 <strong>Die</strong> Fürstenland <strong>Kolonie</strong><br />
Konferenzen gaben 12 Lektionen anzuhören und<br />
zu besprechen. <strong>Die</strong> Konferenzen hatten wir am<br />
Sonnabend-Vormittag. Nachmittags wurde dann<br />
auch noch vieles besprochen. Wir waren<br />
zueinander vertraulich und hatten einen großen<br />
Nutzen dabei, aber so auch die Schulen. Ich muss<br />
sagen, es war dieses die schönste Zeit meines<br />
Lebens.<br />
Gemeindeordnung. Einen Kirchenältesten hatte<br />
die Gemeinde seit Auszug des Ältesten Johann<br />
Wiebe nach Amerika, nicht. Zu Taufhandlungen<br />
und Abendmahl kam der Älteste von Chortitza.<br />
Andachten wurden in den Schulhäusern abgehalten.<br />
Für die Täuflinge wurde mit einem<br />
Taufunterricht noch vor Weihnachten begonnen<br />
(auch in den Schulhäusern). Später wurde bei<br />
Prediger Peter Lepp die große<br />
Maschinenscheune eingerichtet, wo sie dann alle<br />
von allen sechs Dörfern zum Taufunterricht sich<br />
versammelten.<br />
Als ich Lehrer war, hatte ich mit der Jugend<br />
einen Sängerchor. Es hatten noch manche<br />
Beschwerden, bis er zu Stande kam. Das größte<br />
Hindernis war, dass die älteren Leute den Gesang<br />
nicht anerkennen wollten. Als wir schon ganz gut<br />
sangen, gab es mal Gelegenheit, mit dem ganzen<br />
Chor nach der Ökonomie zum Unterverwalter<br />
Herrn von Riesen zu fahren, gerade in der<br />
Weihnachtszeit. Beim Verwalter wohnte noch<br />
seine alte Mutter und sie waren alle Deutsche.<br />
Wir hatten uns besprochen mal nichts zu<br />
nehmen, aber als wir erst mal etwa 20 Lieder<br />
vorgesungen hatten, hatte er schon von den<br />
seinen Gästen 12 Rubel zusammenkollektiert,<br />
und die musste ich nehmen. Nun gab es da schon<br />
für jeden Sänger ein Exemplar der “Liederperlen”<br />
und der Chor fand mehr Anerkennung und die<br />
Sänger größere Lust zum Singen.<br />
In Georgsthal bildete sich ein Sängerchor<br />
unter den Dirigenten Kroeger, so das schon zwei<br />
Chöre waren. Wenn wir dann mal Singstunden<br />
hatten kamen einige Eltern der Sänger schon<br />
zuhorchen, aber zum Gottesdienst gab es noch<br />
nicht Zulass. Als Ältester Isaak Dyck es erst zu<br />
beschwerlich war zum Tauffest herauszukommen,<br />
wurde hier ein Ältester gewählt, und es traf<br />
von Olgafeld J. Martens, der weilend bei Foam<br />
Lake [Manitoba] auf Land sitzt. Als nun die<br />
441<br />
Sowjetregierung es nicht mehr erlaubte, sich in<br />
den Schulhäusern zu versammeln und<br />
Andachten abzuhalten, wurde die Scheune bei P.<br />
P. Lepp wieder für Gottesdienste eingerichtet,<br />
und für den Chor wurde vorne eine Platform<br />
gemacht, wo der ganze Georgsthaler Chor einen<br />
beständigen Platz während der Andacht hatte.<br />
Der Chor wurde nun fortan nicht nur geduldet,<br />
sondern wurde sogar aufgefordert, abwechselnd<br />
während des Gottesdienstes zu singen und er<br />
singt auch hier in Amerika.<br />
Ich werde auch Prediger aufnennen, weiß<br />
aber nicht ob ich sie alle treffen werde: Leitender<br />
Prediger Peter P. Lepp, Peter Andres, Isaak<br />
Warkentin, Heinrich Wiebe, Johann Martens Sr.,<br />
Peter Niebuhr, David Rempel, Jakob Janzen,<br />
Johann I. Martens Jr., Ältester Peter Martens,<br />
Peter Schellenberg, Peter Warkentin, ? Penner, ?<br />
Penner.--------<br />
<strong>Die</strong> Brüdergemeinde hatte sich sehr verzweigt,<br />
aber von ihrem Entstehen auf dem Fürstenlande<br />
kann ich leider wenig sagen. Einer von den<br />
ersten, glaube ich war, der Fabrikbesitzer Jakob<br />
Janzen auf Sergejewka. Dessen Tochter, Witwe<br />
Kornelius Neufeld, die nachher die Fabrik hatte,<br />
wohnt in Winnipeg, bei ihrem Schwiegersohn,<br />
Editor Hermann Neufeld, und denke, letzterer in<br />
Verbindung mit Mr. Johann Martens aus Sperling<br />
würde über die BG in Sergejewka und auch über<br />
die Industrie (Fabriken) auf Sergejewka den<br />
genauesten Bericht geben können.<br />
In dem Jahr, als ich nach Fürstenland kam,<br />
waren nur einzelne Glieder in der Gemeinde und<br />
auch nicht in allen Dörfern. Ihr leitender<br />
Prediger war damals Peter Nickel, gegenwärtig in<br />
Hepburn, Sask. Ihre Versammlungen hielten sie<br />
in Privathäusern ab. Später wurde ein abgebranntes<br />
Haus wieder aufgebaut zu einem<br />
Versammlungshaus in Alexanderthal.<br />
Aber es taten sich immer mehr zu ihrer<br />
Gemeinde schon aus allen Dörfern und das<br />
Versammlungshäuschen konnte sie nicht alle<br />
fassen. 1910 baute der Fabrikbesitzer Jakob<br />
Niebuhr in Olgafeld ein entsprechendes schönes<br />
Versammlungshaus mit sehr guter Einrichtung<br />
inwendig: Kanzel und erhöhte Platform für den<br />
Sängerchor, passende lange Bänke und alles<br />
schön eingerichtet. Das Haus sollte nach und
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
nach von der Gemeinde entrichtet werden. Doch<br />
es kam schon nicht dazu; es wurde von den<br />
Genossen 1922 oder 1923 nationalisiert. <strong>Die</strong><br />
Gottesdienste wurden sehr rege geführt. Es gab<br />
öffentlich sehr große Versammlungen,<br />
Bibelbesprechungen, Gebetsstunden und<br />
Singstunden. Es waren auch viele aus anderen<br />
Gemeinschaften. Es wurde auch Mission unter<br />
den Russen getrieben. Nachdem der leitende<br />
Prediger Peter Nickel nach Amerika gezogen war,<br />
wurde Johann Enns leitender Prediger. <strong>Die</strong><br />
anderen Prediger waren: <strong>Die</strong>trich Wiebe, eine<br />
Zeit lang Peter Dyck, Jakob Epp, Jakob Knelsen<br />
und Johann Andres. Jakob Knelsen war auch der<br />
Gesangleiter im Sängerchor.<br />
<strong>Die</strong> Pachtpreise. <strong>Die</strong> Pachtpreise stiegen rapide<br />
höher, und die Bauern waren unruhig. Es wurden<br />
Delegaten mit Bittschrift, um Pachtpreis zu<br />
ermäßigen nach St. Petersburg gesandt zum<br />
Großfürsten, aber mit wenig Erfolg und so kam es<br />
1901 wieder zu einer großen Auswanderung nach<br />
Amerika. Doch alle konnten sich nicht abgehen<br />
und die Zurückgebliebenen mussten sich schon<br />
zu den Preisen fügen. <strong>Die</strong> Dörfer wurden kleiner,<br />
und das übriggebliebene Land nahmen die<br />
Ökonomien ihnen wieder ab. Es wurde auch kein<br />
Vorsteher mehr angestellt. Jedes Dorf vertrat sich<br />
nun selbst bei der Ökonomie. <strong>Die</strong>ses hatte zur<br />
Folge, das manche <strong>Kolonie</strong>nordnungen gelockert<br />
wurden. Am meisten traf es zuerst die Schulen.<br />
Einige sagten ihre Lehrer, ganz ab, andere verringerten<br />
dem Lehrer das Gehalt derart, dass sie<br />
sich nicht halten konnten. In zwei Jahren hatten<br />
die damals bestehenden Lehrer ihre Schulen verlassen.<br />
Es wurden ja wieder Lehrer eingestellt<br />
und auf Stellen auch noch ganz gute. Georgsthal<br />
und Michaelsburg zeichneten sich wieder dabei<br />
aus. Ich verließ die Schule 1902 und nahm den<br />
Posten als Buchhalter und Kassierer in der Fabrik<br />
von Jakob Niebuhr in Olgafeld an und blieb in<br />
dem Geschäft bis 1917, schon bei dem folgenden<br />
Besitzer Ingenieur Alexander Nikolajewitsch<br />
Perchow, bis letzterer das Geschäft liquidierte.<br />
Industrie und Handel. Fast in allen Dörfern<br />
waren zu einer oder zwei Handlungen mit<br />
<strong>Kolonie</strong>swaren. Auch waren in den ersten Jahren<br />
recht viele Tretmühlen; in Rosenbach waren es<br />
442<br />
wohl drei, Georgsthal zwei und in Alexanderthal<br />
eine. Als erstmal die großen Dampfmühlen mit<br />
den Weizenstühlen ankamen, hatten die<br />
Tretmühlen keine Arbeit und sie verschwanden<br />
nach und nach. In Rosenbach war es eine<br />
Werkstatt mit den Abteilungen für Tischlerei,<br />
Schlosserei, Schmiedearbeiten. In Georgsthal<br />
war eine Schmiede, eine Werkstatt und eine<br />
Maschinenhandlung. In Michaelsburg waren<br />
zwei große Werkstätten, die da Wagen und<br />
Bucker [eine Art von Schrag-Pflugen] fabrizierten.<br />
<strong>Die</strong> eine Werkstatt wurde später zu<br />
einer Mühle und Ölpresse umgebaut und mit<br />
einem großen Motor betrieben. Es gab hier ein<br />
großes Mühlengeschäft. Auf Sergejewka entstanden<br />
zwei Fabriken für landwirtschaftliche<br />
Maschinen und Geräte. <strong>Die</strong> eine wurde von<br />
Abram Klassen angelegt und die andere von<br />
Jakob Janzen. <strong>Die</strong> Fabriken gingen über in den<br />
alleinigen Besitz von Kornelius Neufeld In<br />
Olgafeld war eine Schmiede und es entstand<br />
auch noch eine Fabrik für landwirtschaftliche<br />
Maschinen.<br />
Jakob Gergardowitsch Niebuhr, zu einer Zeit<br />
ein armer Mann, arbeitete in Chortitza bei<br />
Abram Lepp [andere Quellen geben Abram Koop<br />
an. A.R.] in der Fabrik mehrere Jahren, sammelte<br />
sich Kenntnisse in Maschinenbau und es gelung<br />
ihm mit der Zeit 700 Rubel überzusparen. Dan<br />
kam er nach Olgafeld, nahm von Lepp<br />
Maschinen auf Kommision auszuhandeln und<br />
legte eine Werkstatt an und arbeitete mit drei<br />
Mann anfänglich. Das war 1881. Das Geschäft<br />
ging rasch aufwärts und es wurde zu einer Fabrik.<br />
Da dieses hier Pachtland war und die<br />
Eisenbahnstation weit entfernt war, sah Niebuhr<br />
bald ein, dass es nicht Sinn hatte, hier sich fest<br />
anzubauen und er nahm zu sich einen<br />
Kompanion Gerhard Rempel und legte im<br />
Bachmutschen im Dorf New-York, eine Fabrik<br />
an, welche Rempel fünf Jahre verwalten sollte,<br />
und dann wollten sie sich teilen.<br />
Das Geschäft ging dort auch sehr gut, und<br />
Niebuhr kaufte sich im selben Dorf noch eine<br />
Werkstatt und richtete die dritte Fabrik ein, um<br />
nach Ablauf der fünf Jahren mit Rempel sich die<br />
beiden Fabriken dort zu teilen. Niebuhr dachte<br />
die größere Fabrik dann zu bekommen und<br />
Rempel die letztere, die kleinere. Aber es ging
Kapitel 80 <strong>Die</strong> Fürstenland <strong>Kolonie</strong><br />
nicht nach Niebuhr seinem Wunsch. Rempel<br />
nahm die größere. Nun musste die kleine Fabrik<br />
ausgebaut werden, und das schwächte die<br />
Fabrik in Olgafeld sehr. Als ich 1902 dort hinein<br />
kam, war große Geldknappheit. Aber die<br />
Produkte, welche gemacht wurden, waren immer<br />
leicht zu verkaufen.<br />
<strong>Die</strong> Nachfrage nach Maschinen war groß.<br />
Der Absatzkreis wurde immer größer, und es<br />
mussten mehr Maschinen gebaut werden; die<br />
Behausung erwies sich schon bald zu klein. Das<br />
Umsatzkapital hatte sich in ein paar Jahren sehr<br />
gemehrt, und der Kredit wurde größer und so<br />
beschlossen sie sich die Olgafelder Fabrik größer<br />
auszubauen. <strong>Die</strong>ses geschah 1907. Es wurden<br />
viele tausende hinein gebaut und alle für<br />
Bargeld. Nun wurden anstatt 1200<br />
Mähmaschinen 3000 hergetstellt und dannach<br />
auch alle andere Fabriken wurden vermehrt.<br />
Sogar neue Fabrikate, wie Motoren, große<br />
Dreschmaschinen, Putzmühlen und<br />
Häckselmaschinen wurden noch in Massen<br />
gemacht. Wir waren gewohnt, dass alles jährlich<br />
war auszuhandeln. Ebenso dachten alle<br />
Fabriken, machten immer mehr Maschinen<br />
wodurch die Überproduktion so groß wurde und<br />
die Produkte zur Hälfte stehen blieben. Man<br />
dachte, es sei nur so ein Übergang, und am nächsten<br />
Jahr wurde wieder auf soviel ausgeholt.<br />
Hierzu wurde schon der große Kredit in<br />
Anspruch genommen.<br />
1914 brach der I. Weltkrieg aus, die<br />
Mannschaft wurde mobilisiert und somit zahlte<br />
niemand. Nun die großen Schulden in den<br />
Banken, der Druck der Kreditoren wurde sehr<br />
empfindlich.<br />
Auch war es solche böse Zeit, dass die<br />
Deutschen in Russland sehr verhasst waren. Man<br />
durfte nicht deutsch sprechen. Es musste nun<br />
ein reicher Mann gesucht werden, der das ganze<br />
Vermögen von zwei Fabriken, eine Dampfmühle,<br />
einen Kurort auf Gelentschik, [Krim] mit dem<br />
ganzen Portfell, der die ganzen Fabrikschulden<br />
liquidierte nach Übereinkunft den Kreditoren<br />
und noch ein Kapital an die Niebuhrs- Familie<br />
zahlen konnte. Ein solcher fand sich endlich in<br />
Petergrad [Petrograd, später St. Petersburg] in<br />
Ingenieur Alexander Nikolajewitsch Perchow,<br />
dieser Mann zahlte den Niebuhrs nicht alles<br />
443<br />
auch den Kreditoren nicht. Dann arbeitete er<br />
hiernach beinahe zwei Jahre, und dann gab es<br />
Feuer, und der größte Teil von Gebäude brannte<br />
aus. Dann schleppte er die besten Maschinen<br />
nach jener Fabrik und arbeitete dort mit<br />
Hochdruck auf Munition für Kriegszwecke. Er<br />
machte ungeheuer viel Geld. Aber als erst die<br />
„Genossen" sich zeigten, verschwand er und sein<br />
Direktor Bole belud noch zwei Eisenbahnzüge<br />
mit den besten Maschinen und flüchtete nach<br />
Stawropol. Dort wurde er krank und starb. Es<br />
schien so, als wenn der Kaukasus und das<br />
Dongebiet sich von Russland abteilen würden.<br />
<strong>Die</strong> Niebuhrs bekammen nicht alles verabredete<br />
Geld und dazu war es schon sehr im Wert gefallen.<br />
Das war der Schluß davon. Wie gewonnen, so<br />
zerronnen.<br />
<strong>Die</strong> Landverwaltung wurde den Pächtern auch<br />
brutal gegenüber. Im Pachtkontrakt waren ja<br />
immer schwere Punkte, aber die wurden immer<br />
nicht beachtet. Z.B., einen Baum abmachen war<br />
Strafe 100 Rubel. Deswegen hackte man Bäume<br />
nieder und pflanzte wieder und niemand sagte<br />
etwas dagegen. Nun hatte ein Angestellter in der<br />
Fabrik einen Hof sich erworben vom Dorf und<br />
baute ein Haus darauf und pflanzte auch einen<br />
Obstgarten dabei, wozu er sechs alte<br />
Baumstumpfen ausgrub. Als der Verwalter es<br />
erfuhr, verlangte er vom Dorf 600 Rubel Strafgeld<br />
und sie mussten es auch einzahlen. Der betreffende<br />
Angestellte hatte den Kontrakt nicht unterschrieben<br />
und daher sollte er sich vom Land entfernen.<br />
Und der Fabrikbesitzer hatte, ohne bei<br />
ihm anzufragen, die Fabrik vergrößert und sollte<br />
in vier Jahren die Fabrik räumen. Ich war auch<br />
zweimal bei ihm deswegen, er nahm mich auch<br />
sehr freundlich auf, aber daran war nichts zu rütteln.<br />
Er sagte, der Großfürst hatte ihm erlaubt frei<br />
zu handeln und nun wolle er sein Vornehmen<br />
auch ausführen.<br />
Allein der Krieg brach aus und der<br />
Angestellte wurde auch eingezogen und musste<br />
der Verwalter mit seiner Handlung abwarten bis<br />
nach dem Krieg. Nach Beendigung des Krieges<br />
kamen die „Genossen", und die Herren vom<br />
Lande musten sich entfernen, um ihre Haut zu<br />
retten...
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
<strong>Die</strong> Revolution war auf dem Fürstenlande nicht<br />
aufs schwerste, doch darüber zu schreiben würde<br />
Bücher geben. Abgemordet wurden wohl nur<br />
sechs Personen, davon auf Sergejewka der<br />
Leitende der Fabrik Aron Fast. Der Buchhalter<br />
Klassen musste sich hinknien des Nachts im<br />
Garten und wurden erschossen und Jakob<br />
Görzen, der Schwiegersohn zu Fast, der da wollte<br />
die Frauen schützen, wurde mit einer<br />
Handbombe zerrissen. Dann drei Mann fuhren<br />
Pferde suchen und davon David Letkemann und<br />
Jakob Wiebe gingen in eine Wolost hinein,<br />
danach fragen, und beide wurden gleich auf der<br />
Stelle niedergeknallt. Der dritte, Jakob Löwen,<br />
war auf dem Wege geblieben. Er warf sich in den<br />
Wagen und sprengte davon, und es traf ihn keine<br />
Kugel.<br />
Der Prediger Jakob Kröger ging auf der<br />
Straße abends mit Singbüchern in der Hand zur<br />
Versammlung um Übstunde mit den Sängern zu<br />
haben. Da nahmen die Genossen ihn auf und<br />
brachten ihn nach Rogatschik in den Keller und<br />
nächste Nacht wurde er mit noch 20 Russen von<br />
der Trojka erschossen. Vergewaltigungen sind<br />
nur drei vorgekommen, dann aber geraubt und<br />
geplündert ohne Ende. Sie kamen in die Häuser<br />
und nahmen, was sie wollten. Sehr, sehr viel<br />
Fuhrwerke musste man geben. Während der<br />
Kämpfen standen fast immer Kriegsabteilungen<br />
in unseren Dörfern, welche dann auf unsere<br />
Kosten lebten.<br />
Quelle:<br />
Aus der "Jakob Cornelius Töws Kollektion",<br />
R.R.2, Leamington, Ontario, Kanada.<br />
Umgeschrieben von Peter Goertzen, Edmonton,<br />
Alberta, 1976. <strong>Die</strong>ser Bericht ist mit freundlicher<br />
Genehmigung des Mennonite Heritage<br />
Zentrums, 600 Shaftesbury Blvd., Winnipeg,<br />
Kanada, R3P 0M4 hier gedruckt worden.<br />
<strong>Die</strong> Gegend von der Fürstenland <strong>Kolonie</strong> im Jahre 2000. Ansicht zum Nordösten. Gleich vorne liegt<br />
Georgsthal, unten rechts ist Alexanderthal, und links war früher Olgafeld. Foto: Mai 2000.<br />
444
Kapitel 80 <strong>Die</strong> Fürstenland <strong>Kolonie</strong><br />
Ältestenwahl in Fürstenland, 1870<br />
13. September [1870]. Um 1 Uhr nachmittags<br />
fand ein allgemeines Bruderschaftstreffen in Peter<br />
Lepps Geräteschuppen in Georgsthal statt. Lepp ist<br />
Vorsteher der Ansiedlung. Der geliebte Älteste,<br />
Gerhard Dyck, war dort, um die Wahl eines Ältesten<br />
aus den drei Predigern zu leiten. Von den Kollegen<br />
aus Chortitza war nur Prediger David Wiens gekommen.<br />
Diakon Johann Enz und wir, Prediger von<br />
außerhalb der Ansiedlung, nahmen in dem Raum<br />
Platz, den die Brüder auf dem Weg zur Wahl passierten.<br />
Durch Mehrheitsbeschluss wurde Prediger<br />
Johann Wiebe mit 55 Stimmen in das wichtige Amt<br />
eines Ältesten gewählt. Abraham Wiebe erhielt 41<br />
Stimmen und Franz Bükkert 23. Möge der Herr den<br />
gewählten Ältesten mit seinem Heiligen Geist ausrüsten<br />
und ihm die Gaben schenken, die er für die<br />
hohe Berufung braucht!<br />
14. September. <strong>Die</strong> Einsegnung des neuen<br />
Ältesten fand an diesem Nachmittag in<br />
Anwesenheit einer großen Versammlung in Lepps<br />
Geräteschuppen statt. <strong>Die</strong> Feier begann mit dem<br />
Singen von neun Versen des Liedes Nr. 142: "Ein<br />
fröhlich Herz". In seiner Einleitungspredigt<br />
erläuterte der beliebte Älteste Gerhard Dyck den<br />
Zweck der Feier und betete. Dann wurde der<br />
Bibeltext verlesen, und ich hielt eine Predigt über<br />
die Pflichten, die ein Ältester und seine Gemeinde<br />
gegenseitig haben. Nachdem der neugewählte<br />
Älteste die zwei üblichen Fragen mit ,,Ja" beantwortet<br />
hatte und die Gemeinde die ihr gestellten<br />
Fragen beantwortet hatte, indem sie schweigsam<br />
blieb, beteten wir wieder.<br />
Dann kniete Wiebe vor dem Ältesten Gerhard<br />
Dyck, der ihn mit dem Wort Gottes und durch<br />
Auflegen der Hände zum Ältesten ordinierte. Darauf<br />
richtete er ihn auf und küsste ihn. Ältester Dyck lud<br />
die Brüder, die mit am Wort dienten ein, dem neu<br />
ordinierten Ältesten zu gratulieren; und als Prediger<br />
David Wiens schon gegangen war, war ich der erste.<br />
Nachdem ich ihn geküsst hatte, sagte ich zu ihm:<br />
,,So spricht der Herr Zebaoth: Wenn du in meinen<br />
Wegen wandeln wirst und meine Satzungen,<br />
Gebote und Ordnungen hälst, wird dir alles gelingen,<br />
was du tust. Ich versichere dir, dass jene, die<br />
dich umgeben, dir folgen werden. Mögen die<br />
Segnungen Jehovas über dein Haupt in Strömen<br />
ausgegossen werden, damit du die Kraft habest,<br />
Seine Herde zu weiden nach Seinem Willen und zu<br />
Seiner Zufriedenheit."<br />
445<br />
<strong>Die</strong> Gratulationen der anderen Kollegen<br />
lauteten etwas anders, aber in jedem Fall küssten sie<br />
einander. Der Diakon Johann Enz verlas seine<br />
Segnung. Der frisch ordinierte Älteste sprach einige<br />
zu Herzen gehenden Worte, und wir sangen Lied Nr.<br />
603 "Ach bleib' mit deiner Gnade". Ältester Gerhard<br />
Dyck brachte eine Predigt. <strong>Die</strong> Versammlung kniete<br />
sich zum Gebet, und die Feier endete mit dem<br />
Singen von fünf Strophen des Liedes 244 "Jesus,<br />
unsere Heiligung".<br />
<strong>Die</strong>s ist eine kurze Beschreibung der<br />
Ordinierung dieses Ältesten, auch mit der Absicht,<br />
dass die Menschen in der Zukunft wissen können,<br />
wie es gemacht wurde.<br />
Aus dem Tagebuch des Jakob Epp, Seiten 299-<br />
300, 1870 (herausgegeben von Professor Harvey<br />
Dyck, Toronto, Kanada 1991).<br />
Jakob und Judith Epp und ihre Kinder Elisabeth<br />
und Johann, circa 1880. Foto aus Harvey Dyck,<br />
Redakteur, A Mennonite in Russia The Diaries of<br />
Jakob D. Epp (Toronto 1991), Title page/Aus<br />
Preservings,Nr. 18., Seite 24.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Das Dorf entstand 1865 und lag etwa zwei km<br />
vom Dnjepr entfernt. Es ist heute ein zweireihiges<br />
Dorf mit einem Flüsschen in der Mitte. Einige<br />
Häuser sind noch vorhanden, aber sehr stark<br />
Das Siegel des Michaelsburger<br />
Schulzenamtes, das auf die<br />
Waisenverträgen aufgestempelt<br />
war, und das die<br />
Emigranten 1875 nach<br />
Manitoba mitbrachten. Foto<br />
aus D. <strong>Plett</strong>, Old Colony,Seite<br />
21.<br />
Michaelsburg - Michailowka<br />
446<br />
umgebaut. Sie sind nicht mehr als mennonitische<br />
Häuser zu erkennen. Eine Kirche gab es hier nicht.<br />
<strong>Die</strong> Schule ist zerstört worden. Nach dem Krieg<br />
gab es hier auch keine Deutschen mehr.<br />
Das einzige ehemalige mennonitische Haus in Michaelsburg, Fürstenland <strong>Kolonie</strong>. Es ist sehr stark umgebaut.<br />
Foto: Mai 2000.<br />
Gegründet 1866. 1905 hatte das Dorf 109<br />
Glieder. 1928-1929 kam es zu einer Neugründung.<br />
Rosenbach - Alexandrowka<br />
Im Jahre 2000 sind keine mennonitischen<br />
Gebäude mehr zu sehen.<br />
<strong>Die</strong> Hauptstraße von Rosenbach, Fürstenland <strong>Kolonie</strong>. Aussicht zum Nordosten. Foto: Mai 2000.
Kapitel 81 Olgafeld - Georgijewka<br />
Gegründet 1868. <strong>Die</strong> Bewohner gehörten zu<br />
der "Fürstenländer Mennoniten-Gemeinde",<br />
einer Filiale der Chortitzer Gemeinde. 1905 hatte<br />
447<br />
das Dorf 242 Einwohner. 1910 wurde hier eine<br />
Kirche gebaut. <strong>Die</strong>ses Dorf ist heute nicht mehr<br />
da, außer dem Friedhof und der Straße.<br />
Das Dorf Olgafeld vor der Zerstörung. Oben, rechts sieht man die Niebuhr-Fabrik. Aussicht zum<br />
Nordosten. Foto aus Quiring und Bartel, Seite 62.<br />
Das Dorf Olgafeld im Jahre 2000. Es existiert heute nicht mehr, nur teilweise der Friedhof (in der Mitte<br />
unter den Bäumen) ist noch zu finden. Aussicht zum Norden. In der Mitte links stehen die Kolchosställe,<br />
wahrscheinlich in den 1930er Jahren gebaut. Foto: Mai 2000.<br />
Der Friedhof in Olgafeld. Foto: Mai 2000.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Karte des Dorfes Olgafeld zwischen 1900 und 1915. Aufgezeichnet von I. P. Krüger, Saskatoon, Sask., 1976.<br />
Aus P. Goertzen, Teichröb,(Winnipeg, Manitoba, Kanada 1979), Seite 5.<br />
Peter und Elisabeth (Dyck) Niebuhr. Peter war der<br />
Sohn von Jakob Niebuhr (1847-1913). Elisabeth ist<br />
1880 in Michaelsburg geboren. 1898 zog Vater<br />
Jakob Niebuhr mit den Söhnen Peter und Gerhard<br />
nach New York. Am 08.09.1901 wurde Peter und<br />
Elisabeth Niebuhr ein Sohn Jakob, der IV, in New Anzeige aus dem Jahre 1912. Foto aus Hans Hecker,<br />
York, Bachmut <strong>Kolonie</strong> geboren. Foto aus John <strong>Die</strong> Deutschen im Russischen Reich, in der<br />
Dyck, ed., Descendants of Jakob Dyck and Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, (Köln`<br />
Elisabeth Jäger (Winnipeg 1991),Seite 175. 1994), Seite 112, Band 2.<br />
448<br />
W<br />
N<br />
S<br />
E
Kapitel 81 Olgafeld - Georgijewka<br />
<strong>Die</strong> Niebuhr Fabriken<br />
Jakob Niebuhr (1766-1835) wohnte in Nachlass gehörten noch zwei Mühlen, eine in<br />
Tiegenhof, Westpreußen, wo er eine Windmühle Olgafeld und eine in Jelenowka. Beim Abschluss<br />
hatte. 1789 wanderte er nach Russland aus und 1912 ergab sich ein Vermögen von 1,5 Millionen<br />
siedelte in Alt-Kronsweide, Chortitza <strong>Kolonie</strong>, Goldrubel. Nach dem Krieg 1914 ging alles langsam<br />
Südrussland, an. Hier baute er eine Windmühle und bergab...<br />
daneben eine Bäckerei. Unter seinen fünf Söhnen ...Am 15.10.1915 verkauften die Nachkommen<br />
befand sich Gerhard (1818-56). Ein Sohn von das ganze Werk zu einem Spottpreis für 135 000<br />
diesem Gerhard war Jakob Gerhard Niebuhr (1847- Rubel. Da aber in dieser Zeit die Geldentwertung in<br />
1913), Gründer der Niebuhr-Fabriken für land- Russland stattfand, waren sie bettelarm, ehe sie zur<br />
wirtschaftliche Maschinen. Er ist am 20.10.1847 in Besinnung kamen...<br />
Kronsthal geboren. Seine Eltern starben früh, und er ...Sein Sohn Jakob ist am 21.05.1874 in<br />
kam als acht jähriger Junge zu seinem Onkel Chortitza geboren und hat 50 Jahre in Olgafeld,<br />
Abraham Niebuhr nach Chortitza, wo er auf einer Fürstenland, gewohnt. 1930 flüchtete er nach<br />
Tretmühle arbeitete...<br />
Einlage. Zur Zeit der deutschen Besatzung 1941-<br />
...Am 18.01.1868 heiratete er und nahm eine 1943 in der Ukraine kamen sie nach Deutschland.<br />
Stelle in einer Mühle in Nikopol an, kehrte aber bald Hier starb seine Frau. <strong>Die</strong> acht Kinder von Jakob<br />
wieder nach Chortitza zurück und arbeitete in der Niebuhr sind zerstreut in Russland und Amerika.<br />
Schmiede bei Abraham Koop. Er war 11 Jahre bei Einer von seinen Söhnen, Jakob, der Verfasser dieses<br />
A.Koop als Werkführer tätig und erzielte in dieser Berichtes, wohnte 1980 in Ontario, Kanada...<br />
Zeit mehrere neue Erfindungen in der land- Eine Kurzfassung des Artikels von Jakob<br />
wirtschaftlichen Maschinenindustrie.<br />
Niebuhr aus Der Bote, Nr.39, Seite 7, 1980.<br />
...Am 11.11.1881 zog er nach Olgafeld. Dort Ein alter Einwohner von Georgsthal konnte sich<br />
wohnte sein Bruder Peter. Hier kaufte er eine noch sehr gut an die Niebuhrs erinnern. Er erzählte,<br />
Kleinwirtschaft und baute eine Werkstube mit dass im Privathaus der Niebuhrs auf einem Ende<br />
Schmiede. 1886 wurde das Gebäude mit auch noch die Schule war. Nach 1930 wurde in<br />
Maschinenhaus, einer Mühle und Schlosserei seinem Haus eine Berufsschule eingerichtet. Seine<br />
errichtet. In dieser Zeit machte er eine der größten Fabrik wurde geschlossen. Von der Windmühle, die<br />
Erfindungen in der Industrie für landwirtschaftliche einem Raab gehörte, fehlt auch jede Spur.<br />
Maschinen:<br />
(Gründel). ..<br />
das Modell eines Pflugbaumes<br />
...In den Jahren 1905-1914 wurden nur in<br />
Olgafeld und New York (<strong>Kolonie</strong> Ignatjewo) jährlich<br />
4500 Buggerpflüge hergestellt.<br />
...Sein Sohn Jakob wurde am 21.05.1874 in<br />
Chortitza geboren. Er ging 1893 nach Deutschland,<br />
Mittweida, Sachsen, und nahm dort an drei<br />
Semestern eines Werkmeisterkurses teil. Er wurde<br />
seinem Vater eine willkommene Hilfe bei seinen<br />
Erfindungen...<br />
...1898 zog Vater Jakob mit seinen Söhnen Peter<br />
und Gerhard nach New York. Später kauften sie in<br />
Olgafeld noch eine Hofstelle mit Fabrikanlagen<br />
eines Peter Thiessen. In den 1890er Jahren machte<br />
Vater weitere Erfindungen. In New York wurden<br />
außer landwirtschaftlichen Maschinen auch andere<br />
Geräte und Ersatzteile für Dampfmühlen<br />
hergestellt. Vater hinterließ seinen drei Söhnen drei<br />
Fabriken, in denen jährlich 20 000 landwirtschaftliche<br />
Maschinen gebaut wurden. Zum<br />
Gründer der Niebuhr-Fabriken Jakob G. Niebuhr<br />
(1847-1913). Foto aus Der Bote,Nr. 39, 1980.<br />
449
Kapitel 82 Georgsthal - Georgijewka<br />
Das Dorf wurde 1864 gegründet. <strong>Die</strong> Schule<br />
stand hier noch 1998, danach wurde sie zerstört.<br />
Während der Banditenzeit kamen Einwohner aus<br />
dem Nachbardorf Rogatschik und verteidigten die<br />
Einwohner von Georgsthal und anderen<br />
deutschen Dörfern.<br />
Nach Aussagen der Überlebenden war die<br />
Front während des II. Weltkrieges in einer<br />
Entfernung von sieben km. <strong>Die</strong> Wehrmacht nahm<br />
die leeren Häuser auseinander und baute Straßen<br />
und Bunker daraus. <strong>Die</strong>ses ist auch der Grund,<br />
weshalb heute so wenige original-mennonitische<br />
Häuser zu sehen sind.<br />
<strong>Die</strong> meisten Mennoniten zogen in den 1920er<br />
Jahren weg, und es kamen neue Siedler aus<br />
Wolhynien und anderen Orten.<br />
Karte des Dorfes Georgsthal im Jahre 2000. Aussicht zum Nordosten. Foto: Mai 2000.<br />
Karte von dem Dorf Georgsthal. Aufgezeichnet von I. P. Krüger. Aus Peter Goertzen, Teichröb,Seite 5. Da<br />
ist noch eine Karte von alle die vier Dörfern im Rogatschik Tal 1923-1926, aufgezeichnet von J. J. Krahn,<br />
(geb. 1909), Rivers, Manitoba.<br />
450
Kapitel 83 Alexanderthal - Alexandrowka<br />
Ein Dorf im Süden der <strong>Kolonie</strong>, in einem<br />
Tal gelegen. Gegründet wurde es 1867. 1911<br />
hatte das Dorf 270 Bewohner, von denen die<br />
meisten Mennoniten waren. <strong>Die</strong> Mennoniten<br />
waren Glieder der "Fürstenländer Gemeinde".<br />
In der mennonitischen Schule war nach dem<br />
Krieg ein Klub, heute ist es ein<br />
Getreidespeicher.<br />
Alexanderthal. Aus einem mennonitischen Getreidespeicher wurde ein Kolchosklub gebaut. Heute sind es<br />
Ruinen. Foto: Mai 2000.<br />
Der Getreidespeicher in Alexanderthal von der Hofseite. Foto: Mai 2000.<br />
<strong>Die</strong> Dörfer Alexanderthal und Rosenbach rechts, hinten. In der Ferne ist Georgsthal zu sehen. Aussicht<br />
zum Nordosten. Foto: Mai 2000.<br />
451
Kapitel 84 Nikolaithal - Gruschewka<br />
Nikolaithal - Gruschewka, von Henry N. Fast, Box 387, Steinbach, Manitoba, R0A 2A0.<br />
<strong>Die</strong> Dörfer Nikolaithal, Simonfeld und<br />
Marienheim, lagen nördwestlich von der<br />
Mündung des Bazavluk in den Dnjepr-Fluss. <strong>Die</strong>se<br />
Dörfer lagen nahe zu dem russischen Dorf<br />
Gruschewka, der Ökonomie des Großfürsten<br />
Michail Nikolajewitsch, wo sein Oberverwalter<br />
sein Hauptquartier hat.<br />
Eine Gruppe von ungefähr 20 Familien aus<br />
der <strong>Molotschna</strong> hatten hier Land gepachtet und<br />
das Dorf Nikolaithal 1864 gegründet.<br />
Eine Einladung vom 1. December 1873, von<br />
Heinrich Fast (1826-90) (später Steinbach,<br />
Manitoba) für die Hochzeit seiner Tochter Maria,<br />
enhält Namen von etlichen Nikolaithal-Familien:<br />
Franz Schroeder, Ehrsammen Peter Enns,<br />
Kornelius Loewen, Jacob Peters, Jacob Warkentin,<br />
Jacob Friesen, Peter Klassen, Ehrs. Gerhard<br />
Kliewer, Peter Wall, Witwe Bolt, Gerhard Fast,<br />
Johann Wiens, Peter Klassen, Heinrich Klassen,<br />
Johann Pankratz, Ehrs. Jacob Bolt, Heinrich<br />
Janzen, Klaas Wiebe, David Flaming, Peter Friesen,<br />
Peter Adrian, Bernard Warkentin, Witwe Kroeker,<br />
Johann Friesen, Heinrich Wiebe, Heinrich Kasdorf,<br />
und Jacob Janzen. Siehe Henry Fast, "Heinrich and<br />
Charlotte Fast," Pres., No. 9, Teil II, Seiten 37-39.<br />
Gerhard Schroeder, Sohn des Franz<br />
Schroeder, und Heinrich Doerksen, Stiefsohn des<br />
Bernard Warkentin, wohnten 1895 in Sagradowka.<br />
Kornelius Loewen sein Sohn (Dalton, South<br />
Dakota), schrieb am 17. Feb. 1904, dass sein Vater<br />
in Pordenau gewohnt hat bevor er nach<br />
Nikolaithal zog.<br />
<strong>Die</strong> zweite Frau des Johann Wiens, geb. Maria<br />
Flaming (später Jefferson County, Nebraska),<br />
stammt aus Fürstenland. David Flaming von<br />
Nikolaithal zog 1874 nach Jefferson County, wo er<br />
im selbigen Jahr die Witwe Jacob Bartel (geb.<br />
Agatha Fast) heiratete.<br />
Johann Friesen (1812-84), Enkel von Abraham<br />
von Riesen (1756-1810), Ohrloff, war Schullehrer<br />
in Marienthal, Pordenau und Elizabeththal. 1864<br />
zog er nach Nikolaithal und 1874 nach Harvey<br />
County, Kansas. Peter Klassen (geb. 1822) war der<br />
Bruder an Jakob Klassen, später Ältester der<br />
Krimer Brüdergemeinde in Inman. Peter Klassen<br />
sein Sohn Peter (1847-95) wohnt auch in<br />
Nikolaithal und zog nach Harvey County, Kansas.<br />
Jakob Friesen (1822-75), Bruder an Johann,<br />
452<br />
zog 1864 nach Nikolaithal. 1874 zog er nach<br />
Manitoba, wo er 1875 im Roten Fluss ertrunken<br />
ist, zusammen mit Prediger Jakob Barkman (1824-<br />
75).<br />
Etliche von den Leuten in Nikolaithal<br />
gehörten zu der Kleine Gemeinde. Prediger<br />
Gerhard Goossen (1832-72), Grünfeld, Borosenko,<br />
ist hingefahren zum Predigen. <strong>Die</strong> Mehrheit<br />
gehörten zu verschiedenen Kirchengemeinden<br />
und etliche bekehrten sich zum Pietistischen<br />
Glauben und gingen zu der Brüdergemeinde über,<br />
was schwere Streitigkeiten mit sich brachte.<br />
Mit der Zeit sind die Mennoniten von<br />
Nikolaithal weggezogen und es ist ein katholisches<br />
Dorf geworden.<br />
Abgekürzt von Henry Fast, "Nikolaithal<br />
(Gruschewka), Kaiserliches Russland," aus<br />
Preservings, Nr. 13, Seite 87.<br />
Quellen: Etliche Briefe in der Men. Rundschau<br />
berichten von Nikolaithal, unter anderen folgende:<br />
Oct. 8,1884; May 29, 1895; Oct 9, 1889; April<br />
24, 1895; Sept 8. 1909.<br />
Maria Schierling Friesen (1818-1914), geb. in<br />
Marienthal, Mol., und ihr Eheman Johann K.<br />
Friesen (1812-84), wohnten in Nikolaithal. 1874<br />
zogen sie nach Harvey County, Kansas. Solche<br />
Bilder von den alten Matriarchen sind leider nur<br />
sehr wenig vorhanden. Foto aus Preservings, Nr.<br />
14, Seite 99.
Kapitel 85 <strong>Die</strong> Sagradowka <strong>Kolonie</strong><br />
"...Im Gouvernement Cherson, am Fluss Sagradowka befand, war auch mitgekauft worden.<br />
Ingulez, liegt das große Russendorf Sagradowka. Er bestand aus einem Steinhaus, Pferdestall, einem<br />
Seinen Namen hat es von dem Gutsbesitzer, dem gewölbten Keller und Obstgarten. Das ganze war<br />
das umliegende Land und mit ihm auch die Bauern mit einer 10 Fuß hohen Steinmauer umgeben...<br />
des Dorfes als Leibeigene gehörten. <strong>Die</strong>ser Mann "...1898 wurden die Wege, die von einem Dorf<br />
hieß Sagradskij und soll ein Pole gewesen sein. zum anderen führten, von beiden Seiten mit<br />
Später war dieses Land im Besitz eines Mannes Bäumen bepflanzt. Doch der arme, unwissende<br />
namens Kotschubej Leo...<br />
Russe konnte der Versuchung nicht widerstehen:<br />
"...Als 1871 die <strong>Molotschna</strong>-Mennoniten nach die kleinen Bäume wurden ausgerissen und als<br />
einem größeren Landstück Ausschau hielten, war Peitschen benutzt, die Größeren als Deichseln.<br />
Leo Viktorowitsch Kotschubej bereit, den Rest Wollte er durch eine deutsche Siedlung fahren, so<br />
seines sehr schönen Guts zu verkaufen. <strong>Die</strong> andere nahm er gleich auch eine Axt mit, um die<br />
Hälfte, die am linken Ufer lag, hatte er 1870 an Gelegenheit auszunutzen. Jahrelang pflanzten die<br />
lutherische und katholische Siedler verkauft. <strong>Die</strong>se Leute nach, sie machten um jeden Baum einen<br />
gründeten die Kronauer Siedlung...<br />
Zaun, doch vergebens. Der Plan musste<br />
"...Der Kauf wurde am 15. Juni 1871 aufgegeben werden. 1925 standen nur noch ganz<br />
abgeschlossen. Das gekaufte Landstück betrug wenige von diesen Bäumen.<br />
21276 Desjatin des allerbesten Landes. Noch im "...In den ersten Jahren waren die Ansiedler<br />
Sommer 1871 schnitt die <strong>Molotschna</strong>er nicht in der Lage, sich Arbeiter anzunehmen.<br />
Landkommission die Dorfpläne zu. Sagradowka Sobald sich die Verhältnisse besserten, mietete<br />
war die erste Tochtersiedlung der <strong>Molotschna</strong> man Russen für die arbeitsreichste Zeit des Jahres...<br />
<strong>Kolonie</strong>. 1872 wurden die ersten sechs Dörfer ...1890 wurde die zweite Katharinenbesiedelt...<br />
Eisenbahn bis in die Nähe der Ansiedlung gebracht.<br />
"...<strong>Die</strong> Sagradower Siedlung mit einer eigenen <strong>Die</strong> Station Nikolo-Koselsk, 15 Werst von der<br />
Verwaltung erhielt den Namen „Ohrloffer Wolost". Ansiedlung entfernt, wurde das Tor, durch das die<br />
Ganz am Anfang ist die Wolostverwaltung auf dem Außenwelt leichter zu erreichen war. 1916 wurde<br />
Chutor nahe dem Dorf Ohrloff gewesen. 1874 die Eisenbahnstrecke Cherson-Meresa, die ganz in<br />
entschloss man sich, ein Wolostgebäude in Tiege, der Nähe der Ansiedlung vorbeiging, fertig gebaut,<br />
mehr zentral gelegen, zu erbauen...<br />
und in der Station Belaja-Kreniza erhielt die<br />
"...Der erste Oberschulze war ein Sukkau <strong>Kolonie</strong> eine Verbindung mit dem Hafen und einer<br />
(1872-75). Jakob Reimer aus Neu-Schönsee hatte Großstadt des Landes...<br />
der Wolost 16 Jahre als Oberschulze gedient (1878- "...Wie in anderen Siedlungen hatte auch<br />
1896). In den Dörfern, in denen Freikäufer Sagradowka eine Feuerversicherung. Brannte<br />
ansiedelten, bestand die Wirtschaft aus 65 Desjatin jemandem das Haus ab, so wurde er bar<br />
Land. In den Losdörfern hatte die Wirtschaft 32,5 entschädigt, und auch die Nachbarn halfen unent-<br />
Desjatin. <strong>Die</strong> Hofstellen waren 210 Fuß breit und geltlich, den Schutt wegzuräumen...<br />
560 Fuß lang, was genau eine Desjatine ausmachte. "...<strong>Die</strong> Dörfer, die an den russischen Besitz<br />
<strong>Die</strong> Straße war 210 Fuß breit. Hinter den Gärten grenzten, hatten oft Schwierigkeiten damit, dass<br />
verlief ein Weg. An der anderen Seite des Weges die Russen ihr Vieh in deutsches Getreide ließen.<br />
musste jeder Bauer ein Wäldchen so breit wie seine Um diese Misswirtschaft zu verhindern, mieteten<br />
Hofstelle und etwa 40 Fuß tief anpflanzen und sich einige Dörfer einen oder zwei bewaffnete<br />
sauberhalten...<br />
Kosaken als Wächter...<br />
"...Jedes Dorf erhielt außer seinem Namen "<strong>Die</strong>se Praxis musste aber bald aufgegeben<br />
auch eine Nummer; auch jede Wirtschaft im Dorf werden, denn die Wächter behandelten die Russen<br />
erhielt eine Nummer. Jeder, der ansiedeln wollte, so, dass sich die russische Bevölkerung sehr<br />
zog in der <strong>Molotschna</strong> ein Los; die Nummer, die empörte. Nach dem russischen Gesetz musste<br />
ihm zufiel, bestimmte seinen zukünftigen Wohnort. jedes Dorf einen Polizeibeamten (Desjatzkij)<br />
Ein Freikäufer musste die Hälfte des Preises gleich haben, und in der Wolost stand der "Sotskij"<br />
bezahlen. Der Gutshof, der sich im Russendorf (Schulze) vor.<br />
453
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
...1880 hatte die Regierung beschlossen, im<br />
südlichen Russland sechs Kasernen für mennonitische<br />
<strong>Die</strong>nende zu erbauen. Im Chersoner<br />
Gouvernement wurde Kronsland (3000 Desjatin)<br />
zur Verfügung gestellt. Auf diesem Lande befanden<br />
sich ein Brunnen und ein Stück Wald. 1882 baute<br />
man hier die ersten Gebäude, von denen das erste<br />
1906 abbrannte. In jeder Stube wohnten 10-11<br />
Kerle. 1914 gab es auf dieser "Wladimirower"<br />
Forstei 131 mennonitische <strong>Die</strong>nende. Ihre Arbeit<br />
war meistens Waldarbeit, denn hier musste Wald<br />
gepflanzt werden-800 Bäume pro Tag/Mann...<br />
...Unter den Mennoniten Russlands war die<br />
Geburtsrate so hoch, wie das biologische Gesetz es<br />
erlaubte. Es ist berechnet worden, dass sich die<br />
mennonitische Bevölkerung alle 25 Jahre verdoppelte.<br />
In Sagradowka dauerte es auch nicht lange,<br />
bis jede Wirtschaft in den 16 Dörfern besetzt war.<br />
<strong>Die</strong> Preise fürs Land stiegen. So zogen schon 1893<br />
etliche Familien an den Don; 1894 ging eine große<br />
Anzahl nach Ufa; 1900 ging ein Teil der Ansiedler<br />
nach dem Terek. <strong>Die</strong> größte Abwanderung aber<br />
fand 1908 statt. 1907 wurde den Umsiedlerwilligen<br />
in Sibirien von der Regierung das Land geschenkt.<br />
Nicht ein einziger Großwirt verkaufte sein Land in<br />
Sagradowka und ging nach Sibirien, aber ihre verheirateten<br />
Söhne gingen fast alle. Wer nicht gerade<br />
eine Wirtschaft sein eigen nannte, verschwand von<br />
Sagradowka. Besonders bemerkbar war es am Ende<br />
des Dorfes, dem Anwohner-Ende, wo nach der<br />
Abwanderung die stille und leere Häuser standen...<br />
...Juli 1914. Es fing die Hetze gegen die<br />
Deutschen an. Sie waren plötzlich fremde<br />
Eindringlinge, denen man nicht trauen konnte,<br />
obwohl das Verhältnis zwischen den Deutschen<br />
und den Russen niemals schlecht gewesen war.<br />
Unsere Dreschmaschinen fuhren in die<br />
Russendörfer und droschen den Soldatenfrauen<br />
unentgeltlich das Getreide. Unsere Wolost gab jeder<br />
Soldatenfrau der umliegenden Russendörfer eine<br />
gewisse Mithilfe pro Monat. Namhafte Summen<br />
wurden immer wieder der Regierung geschenkt.<br />
Trotz allem verfügte die russische Regierung am 2.<br />
Februar 1915, dass allen Deutschen Land enteignet<br />
werden solle. In Scharen zogen damals die Russen<br />
durch unsere Dörfer und beschauten sich ihre<br />
zukünftigen Heime...<br />
...Es war daher für unsere Mennoniten<br />
erfreulich, als im März 1917 die Kaiserregierung<br />
fiel. Als aber im November 1917 die Bolschewiken<br />
an die Regierung kamen, da war es mit Frieden und<br />
454<br />
Sicherheit bald vorbei. <strong>Die</strong> umwohnenden Russen<br />
erhielten Land, Pferde und Ackergeräte von unserer<br />
Wolost. Als 1918 die Deutschen unser Gebiet<br />
besetzten, mussten die genommenen Sachen<br />
wieder zurückgebracht werden. 1918 hatte die<br />
Ansiedlung nur noch 4067 Einwohner...<br />
...Wir hatten uns aller mennonitischen<br />
Tradition zum Trotz von den Deutschen bewaffnen<br />
lassen. Nach Abzug der Deutschen bedrohten<br />
organisierte ruchlose Banden unser aller Recht und<br />
unsere Sicherheit. Viele zitterten erschreckt und<br />
entsetzt um ihr Leben, und da will der Mensch sich<br />
so gerne helfen. Eine Zeitlang konnte unsere auf<br />
Wache stehende Jungmannschaft die Banditen aus<br />
unserer Ansiedlung fernhalten. Im Frühling 1919<br />
mussten wir die Waffen abliefern. Im Sommer<br />
kamen immer wieder Banden und beraubten uns,<br />
nahmen Pferde, Kleider und Droschken. Ob nun<br />
Rote oder Weiße an der Regierung waren, immer<br />
ging der Bürger mit Angst zu Bett. Bewaffnete<br />
Banden zogen im Land umher, raubten und<br />
mordeten ungestraft. <strong>Die</strong> schlimmste war die<br />
"Machnobande", die im Herbst 1919 sechs unserer<br />
Dörfer überfiel.<br />
...Das Land wurde von der Regierung unter<br />
allen Einwohnern, die auf dem Lande wohnten und<br />
bauern wollten, gleichmäßig verteilt. Der Besitzer<br />
wurde als Verbrecher hingestellt; der Arme, ob verschuldet<br />
oder unverschuldet, galt immer als der<br />
Edle und Unterdrückte; er wurde gegen die<br />
Wohlhabenden aufgestachelt..."<br />
...1922 waren die Häuser, in denen es noch<br />
Brot gab, fast fortwährend von Hungernden<br />
belagert. Es waren nicht Mennoniten, sondern<br />
Fremde. Unter Hecken und Zäunen lagen sie und<br />
starben, ohne dass auch noch jemand nach ihnen<br />
schaute...<br />
...Im Frühjahr 1922 wurden dann die<br />
"Amerikanischen Küchen" eingerichtet, ohne die<br />
auch mancher der Unseren verhungert wäre. Im<br />
Herbst 1922 wurde es etwas ruhiger. Überfälle und<br />
Morde wurden etwas seltener. <strong>Die</strong> Regierung wurde<br />
stärker. Mehr und mehr wurden fremde<br />
Kommunisten in die Dörfer geschickt, in deren<br />
Hände die Verwaltung gelegt wurde. Viele von<br />
ihnen waren gemeine Verbrecher. Der Wunsch vieler<br />
Mennoniten war, Russland zu verlassen. Als sich<br />
in den Jahren 1924-1927 die Möglichkeit ergab, verließen<br />
viele Russland...<br />
...1924 gab die Regierung uns ein wenig mehr<br />
Freiheit, und 1927 ging es vielen von uns recht gut.
Kapitel 85 <strong>Die</strong> Sagradowka <strong>Kolonie</strong><br />
Doch schon 1928 änderte die Regierung plötzlich<br />
die Taktik: die Kollektivierung wurde strengstens<br />
durchgeführt; niemand durfte mehr auswandern;<br />
viele wurden in die Verbannung nach Sibirien<br />
geschickt. Um nun ihre Sklaven auch ganz gefügig<br />
zu machen, ließ die Regierung sie immer wieder<br />
hungern. Im Frühling 1933 starben als Resultat<br />
dieser Raubwirtschaft im Süden Russlands<br />
Millionen von Menschen, viele davon auch in<br />
unseren Dörfern. Gottesdienste wurden sehr selten<br />
abgehalten. Trauungen waren nicht mehr nötig; die<br />
Leute ließen sich einfach zusammenschreiben und<br />
richteten dann einen großen Tanz aus, auf dem der<br />
Branntwein reichlich floss. <strong>Die</strong> Prediger, die noch<br />
nicht verbannt waren, jagte man aus den Dörfern...<br />
...1937-1938 gab es neue große Verhaftungen.<br />
Wer erst einmal genommen war, kam selten<br />
zurück.<br />
...Dann kam der Krieg 1941. <strong>Die</strong> Sagradower<br />
mußten auch mit den zurückziehenden Russen<br />
fort, kamen aber alle 1941 in deutsche<br />
Gefangenschaft und kehrten wieder in ihre Dörfer<br />
zurück. Unter den Deutschen lebten sie besser. Im<br />
Oktober 1943 hieß es, die Heimat zu verlassen und<br />
westlich zu gehen. 3.500 Einwohner der Siedlung<br />
zogen mit der deutschen Wehrmacht mit in den<br />
Westen. Per Wagen, zu Fuß und auch per Bahn wurden<br />
tausende Meilen zurückgelegt. Im Warthegau<br />
wurden die Sagradower mit vielen anderen angesiedelt<br />
und eingebürgert. 1944 wurden unsere<br />
Männer in die deutsche Wehrmacht eingezogen.<br />
455<br />
Im Frühling 1945 wurden die Sagradower von den<br />
Russen in Güterzügen wieder zurück nach<br />
Russland verschleppt, leider nicht mehr in ihre<br />
Heimat, sondern in das eisige Sibirien...."<br />
Aus Gerhard Lohrenz, Sagradowka (Rosthern<br />
1947).<br />
Gerhard Lohrenz (1899-1986). Foto aus J. Friesen,<br />
Redakteur, Mennonites in Russia: Essays in Honour<br />
of Gerhard Lohrenz (Winnipeg 1989), Seite xi.<br />
<strong>Die</strong> Dörfer in Sagradowka:<br />
Deutsche Namen russische Namen Gründungsjahr<br />
1. Alexanderfeld Nr.1 Nowo-Alexandrowka 1872<br />
2. Neu-Schönsee Nr.2 Ozerowka 1872<br />
3. Friedensfeld Nr.3 Ozerowka 1872<br />
4. Neu-Halbstadt Nr.4 Rownopolje 1872<br />
5. Nikolajfeld Nr.5 Nikolskoje 1872<br />
6. Ohrloff Nr.6 Orlowo 1872<br />
7. Blumenort Nr.7 Swetlowka 1873<br />
8. Tiege Nr.8 Kotschubejewka 1873<br />
9. Altonau Nr.9 Prigorje 1873<br />
10. Rosenrot Nr.10 Rosowka 1874<br />
11. Münsterberg Nr.11 Dolinowka 1874<br />
12. Gnadenfeld Nr.12 Gnadowka 1876<br />
13. Schönau Nr.13 Krasnowka 1878<br />
14. Steinfeld Nr.14 Kamenka 1879<br />
15. Nikolajdorf Nr.15 Nikolajewka 1879<br />
16. Reinfeld Nr.16 Sofijewka 1882<br />
17. Alexanderkrone Nr.17 Lugowka 1883
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Karte der Sagradowka <strong>Kolonie</strong>. Foto aus W. Schroeder, Mennonite Atlas,Seite 46.<br />
Moderne Fahrkarte der Sagradowka <strong>Kolonie</strong> mit Umgebung bis Nikopol.<br />
456<br />
W<br />
N<br />
S<br />
E
Kapitel 86 Ohrloff - Orlowo<br />
Das Dorf wurde 1871 von 41 Bauern, 65<br />
Desjatin Land je Hof, gegründet. Das Dorf hatte<br />
eine Länge von 1,5 km und nur eine lange Straße.<br />
Am Nordende wurde später eine neue Straße für<br />
Jungverheiratete gegründet. 1911 hatte das Dorf<br />
schon 297 Einwohner.<br />
Während der deutschen Besatzung 1941-<br />
1943 hieß Ohrloff „Marienburg", Kreis Kronau.<br />
Allianz Gemeinde. 1907 entstand in Ohrloff die<br />
„Evangelische Mennonitengemeinde" in einem<br />
Laden, Allianz genannt. 1914 baute die<br />
Gemeinde in Ohrloff ein modernes<br />
Gemeindehaus. 1922 zählt die Gemeinde 214<br />
Mitglieder... (Gerhard Lohrenz, Sagradowka,<br />
Seite 80.)<br />
Holländische Mühle. Das Dorf hatte am Südende<br />
eine vier-stöckige Holländermühle. Am<br />
Nordende stand noch eine kleine Windmühle.<br />
Schmiede. Es gab noch eine Schmiede mit einem<br />
vollautomatischen Hammer.<br />
<strong>Die</strong>trich Wiebe Fabrik. Sie stellte landwirtschaftliche<br />
Maschinen her.<br />
<strong>Die</strong> Kirche der Evangelischen Mennonitengemeinde in Ohrloff, Sagradowka, in der alten Zeit. Foto aus G.<br />
Lohrenz, Seite 90.<br />
Das Gebäude der ehemaligen Allianz-Gemeinde in Ohrloff, Sagradowka. Noch ein anderes Bild von dieser<br />
Kirche ist auf dem Buchumschlag (hinten) abgedruck. Foto: Mai 2000.<br />
457
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Eines der Massengräber ermordeter Mennoniten in Sagradowka, Opfer der Machnowschina von 1919.<br />
Foto aus G. Lohrenz, Sagradowka,Seite 97.<br />
Das Massengrab in Ohrloff, Sagradowka. Hier wurden 1919 die am 29. November von Machno auf<br />
grausamste Weise ermordete Menschen (70 Personen) an einem Tag beerdigt. Heute liegt das Grab außerhalb<br />
des Friedhofs, auf dem Feld, erkennbar durch einen kleinen Hügel, wo die Autorin steht. Hinten,<br />
rechts, in südlicher Richtung, ist der alte mennonitische Friedhof zu sehen. Foto: Mai 2000.<br />
458
Kapitel 87 Münsterberg - Dolinowka<br />
Das Dorf wurde 1875 gegründet. 1878 musste<br />
das Dorf nach einer Überschwemmung umgesiedelt<br />
werden. 1913 hatte das Dorf 250 Einwohner.<br />
Im Oktober 1919 wurde das Dorf von den<br />
Machno-Banditen überfallen, und 100 Bewohner<br />
459<br />
wurden getötet.<br />
Ziegelfabrik. 1910 wurde von Gerhard Wiebe und<br />
David Friesen (beide aus Ohrloff) eine Ziegelfabrik<br />
gebaut. <strong>Die</strong> Maschinen bezogen sie aus dem<br />
Ausland.<br />
<strong>Die</strong>se zwei Höfe sind alles, was von dem blühenden mennonitischen Dorf Münsterberg geblieben ist.<br />
Wenn man den Fundamenten von den Häusern nachgeht, kann man noch die Hauptstraße des Dorfes<br />
erkennen. In der Ferne, am anderen Ufer des Ingulez-Flusses, ist das russische Dorf Schesternja. Foto: Mai<br />
2000.<br />
Ein mennonitisches Haus in Münsterberg. Es wird heute nicht mehr bewohnt. Foto: Mai 2000.
Kapitel 88 Tiege - Kotschubejewka<br />
Das Dorf wurde 1871-1872 von den landlosen<br />
Übersiedlern der Brüdergemeinde aus der<br />
<strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong> im Gouvernement Cherson<br />
gegründet.<br />
Brüdergemeinde. 1882 baute die<br />
"Brüdergemeinde" ein Bethaus in Altonau. 1885<br />
hatte die Kirche schon 100 Mitglieder. 1888 wurde<br />
in Tiege ein Versammlungshaus aus gebrannten<br />
Ziegeln gebaut, und am 09.10.1888 eingeweiht. Bis<br />
1902 war es eine Filiale der Friedensfelder<br />
Gemeinde, dann wurde die Gemeinde selbständig.<br />
Sie hatte 1922 427 Mitglieder. 1929 wurde<br />
die Kirche geschlossen und darin ein Klub ein-<br />
gerichtet.<br />
Gebietsamt. Gebaut 1874. 1912 wurde das alte<br />
Gebäude abgebrochen und ein neues gebaut.<br />
Mühle. 1896 erbaute Heinrich Görzen in Tiege<br />
eine moderne Dampfmühle.<br />
Apotheke. 1877 kam ein Herr August Gauderer, ein<br />
Balte, nach Tiege und eröffnete eine Apotheke.<br />
Gleichzeitig wurde auch eine Ambulanz mit<br />
Arztwohnung gebaut. Beide Bauten waren aus<br />
Stein und mit Blech gedeckt. Er starb 1943 in<br />
Tiege.<br />
Postamat. 1900 wurde in Tiege ein Postamt<br />
gebaut.<br />
Das Bethaus der Brüdergemeinde in Tiege, Sagradowka. Foto aus Quiring und Bartel, Seite 101.<br />
Das ehemalige Kirchengebäude der Brüdergemeinde in Tiege. Das Gebäudeteil vorne ist später angebaut<br />
worden. Eine Zeitlang war hier eine Mühle. Heute zerfällt das Gebäude. Foto: Mai 2000.<br />
460
Kapitel 88 Tiege - Kotschubejewka<br />
<strong>Die</strong> Gebietsversammlung der Sagradower Ansiedlung in Tiege. Anfang der 1920er Jahre. 1.Reihe, l-r:<br />
Zentralschullehrer Iwanow; Wolostschreiber, B.Fast; Abram Bergen; Richter; Postmeister- ein Pole;<br />
H.Derksen–Oberschulze; P. Goossen–Schreiber; Leitender Lehrer der Zentralschule Weingart; Schulze<br />
Gerhard Lohrenz; Schulze Boldt; 2.Reihe, l-r: der 5.von links ist der Zentralschullehrer Gerhard Penner.<br />
Foto aus G. Lohrenz, Damit es nich vergessen werde, Seite 216.<br />
Das ehemalige Gebietsamt von Tiege. Später war hier eine Berufsschule. Heute – eine Lagerhalle. Foto: Mai<br />
2000.<br />
Das Gebäude der ehemaligen Mennonitischen Apotheke in Tiege. <strong>Die</strong> Apotheke befindet sich seit 1999 in<br />
einem neuen Gebäude. Foto: Mai 2000.<br />
461
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Am Nordende des Dorfes Tiege lebt noch eine Frau Teske mit ihrer Tochter. Sie war mit einem Russen verheiratet<br />
und wurde 1941 verbannt. Nach der Verbannung kamen sie wieder zurück nach Tiege. Sie hat<br />
noch eine Schwester in Deutschland. Frau Teske will aber in ihrem Heimatdorf wohen bleiben. Sie spricht<br />
noch gerne Plattdeutsch und Hochdeutsch. Der Autor A. Reger unterhält sich hier mit Frau Teske über die<br />
grausame Stalin-Zeit. Links, an der Pforte, steht Frau Teske ihre Tochter. Foto: Mai 2000.<br />
<strong>Die</strong> ehemalige mennonitische Käsefabrik in Tiege. Heute ist sie nicht mehr in Gebrauch. Foto: Mai 2000.<br />
462
Kapitel 88 Tiege - Kotschubejewka<br />
<strong>Die</strong> Schreckenstage - November 1919<br />
Am 28. November hatten wir zwei Schweine und gemordet wird. O wie fürchteten wir uns so<br />
geschlachtet. Zum Helfen waren unsere beider- sehr, und wie schrien wir zu Gott um Schutz und<br />
seitigen Eltern und die Nachbarn Johann Hilfe für jene Armen und auch für uns selber.<br />
Martens gekommen. Es wurde soviel von Mord Gegen Abend zog ich unsere Kinder aus und<br />
und Vergewaltigungen, die ja beide an der legte sie zu Bett. Unser Söhnchen Franz war<br />
Tagesordnung waren, erzählt, dass ich mich vor damals zwei Jahre alt, und Liese war neun<br />
Erregung krank und schwach fühlte.<br />
Monate alt. Das <strong>Die</strong>nstmädchen ging melken,<br />
Meine Eltern K. Regehr fuhren zur Nacht und das Kindermädchen wollte gerade den Tisch<br />
nach Hause. Meines Mannes Eltern, Peter zum Abendessen decken, da kam mein Mann<br />
Bargens, blieben bei uns, da sie glaubten, hier in totenbleich hereingelaufen und sagte: "Jetzt sind<br />
Tiege, sicherer zu sein als in Altonau. Dort waren sie hier! Sie kommen von Ohrloff. Das brennt."<br />
schon fremde Reiter erschienen und hatten Kaum hatte er es gesagt, da war unser Hof und<br />
gesagt, dass Altonau noch Besuch bekommen Haus schon so voller Räuber, dass sie dicht<br />
solle. Ehe unsere Eltern von uns fortfuhren, lasen beieinander gehen und stehen mussten. Sie<br />
wir noch zusammen den 91. Psalm und beteten. sahen aus wie die leibhaftigen Teufel. Sie waren<br />
<strong>Die</strong> Nacht verlief ruhig. Der nächste Tag voller Schmutz und Blut. Viele trugen den bloßen<br />
jedoch, der 29. November, wurde für uns zum Säbel in der Hand, die waren mit geronnenem<br />
schrecklichsten Tag unseres Lebens. Morgens Blut bedeckt; an manchen sah ich sogar<br />
ging ich mit einer Leberwurst und etwas fettem Blutzapfen.<br />
Rippenfleisch, wie Onkel Martens es sich David Wiens von Steinfeld wohnte mit sein-<br />
bestellt hatte, zu unseren Nachbarn. Tante er Frau bei uns in der Sommerstube. Auf der<br />
Martens kam mir schon verängstigt entgegen Suche nach seiner Frau drängte er sich durch die<br />
und sagte, dass sie die ganze Nacht nicht Menge der Räuber in die Küche. <strong>Die</strong>se schrien<br />
geschlafen hatte. Onkel Martens hatte sich nicht ihn als Wirt an. In seiner Angst sagte Wiens: "Ich<br />
mal ausgezogen. Als ich in die Stube kam, da bin nicht der Wirt. Das ist der Wirt" und zeigte<br />
weinte Onkel Martens und sagte: "Heute ist mein auf meinen lieben Franz. <strong>Die</strong> Unholden rissen<br />
Geburtstag, aber ich werde heute auch ermordet meinen Mann von meiner Seite. Zwei von denen<br />
werden. Sie werden kommen und mich töten." schwangen ihre blutbedeckten Säbel. Der eine,<br />
Ich riet ihm, den Prediger Franz Klassen kom- schwer besoffen, brüllte immer wieder: "Ich<br />
men zu lassen; der würde ihn trösten können schlage dir den Kopf ab!" und hieb dann wieder-<br />
und auch mit ihm beten. Nachmittags ist Klassen holt nach meinem Mann, traf ihn aber nicht,<br />
dann auch bei Martens gewesen.<br />
sondern hackte große Löcher in die Wand. Franz<br />
Als ich nach Hause ging, stand bei uns an sagte kein Wort. Ich hatte unser Baby, schon im<br />
der Straße eine ganze Anzahl Nachbarn, die da Nachtkleid, auf dem Arm, unser Söhnchen an<br />
ihre Furcht miteinander austauschten. Vater der Hand, stand und schaute dem schrecklichen<br />
Bargen fuhr auch bald nach Hause, Mutter blieb Bild zu, das ich Zeit meines Lebens nie vergessen<br />
bei uns. Mein Mann zog sich nun seine schlecht- werde.<br />
esten Arbeitskleider an, um von den Räubern Unser Söhnchen ging dann zu einem der<br />
nicht als ein vermögender Mann angesehen zu Mörder und versuchte, ihm die Flinte<br />
werden. An den Füßen zog er alte Holzpantoffeln abzunehmen, indem er sagte: "Gib das her, das<br />
an, die er schon Jahre nicht mehr getragen hatte. gehört meinem Vater." Dann spickte ein Bandit<br />
Mutter und ich räumten das Fleisch auf, ihm etwas in den Rücken und sagte zu einem<br />
während das 15jährige Kindermädchen Rosa mit Genossen: "Schlag den Kleinen tot, es gibt ohne-<br />
den Kindern spielte und das <strong>Die</strong>nstmädchen hin nur ein Volksfeind aus ihm." Doch der andere<br />
Pauline uns einen Kaffee kochte.<br />
streichelte Fränzchens Kopf und antwortete:<br />
Da kam Franz, mein Mann, herein und "Lass das Kind leben."<br />
sagte, dass in Gnadenfeld schon gebrandschatzt Wärend dieser Unterbrechung hatte mein<br />
463
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Mann die Stube verlassen. Da er so schlecht gekleidet<br />
war, hielt man ihn wahrscheinlich für<br />
einen Arbeiter und ließ ihn überall durch. Einer<br />
hatte noch zu ihm gesagt, er solle sich nur verstecken,<br />
denn sie würden alle ermorden. Franz<br />
hatte dann seine Pantoffel ausgezogen und war<br />
in den Garten in Richtung Nikolajfeld entkommen.<br />
Von mir verlangten die Räuber Geld und<br />
Gold. Mit ihren blutigen Säbeln schlagend,<br />
trieben sie mich von einem Zimmer ins andere.<br />
Mit einmal riss einer der Männer mir das Kind<br />
aus dem Arm und warf es so grob, wie er nur konnte,<br />
von einem Ende der Stube zum anderen. Es<br />
schrie nur einmal auf und blieb dann still liegen.<br />
Unseren Jungen hatte ich auch schon aus den<br />
Augen verloren.<br />
<strong>Die</strong> Räuber verlangten nun mit viel Fluchen<br />
und Stoßen, ich solle ihnen zu willen sein, wenn<br />
nicht, würden sie mich zerhacken. Ich bat sie, sie<br />
möchten es doch tun, aber erst sollten sie meine<br />
Kinder töten. Nun mischte unsere Mutter sich in<br />
die Verhandlung. Sie bat, man möge mich in<br />
Frieden lassen, da ich doch krank sei. Damit<br />
schlugen sie auf die alte Frau los und vergaßen<br />
mich. Ich raffte mein Kind auf, es war schlapp<br />
und blau, und ich drängte mich bis ins Vorhaus.<br />
Dort führte einer der Männer mir unser<br />
Söhnchen zu und winkte mir mit den Augen<br />
nach der Tür, ich solle machen, dass ich<br />
wegkomme. Ich drängte mich mit meinen zwei<br />
Kindern durch den fluchenden Haufen und<br />
entkam ins Freie.<br />
Noch als man mich drinnen herumriss, sah<br />
ich durchs Fenster, wie unser Nachbar Johann<br />
Martens mit einem langen Stock über die Brust<br />
geschlagen wurde. Nach etlichen Hieben zog der<br />
Räuber eine kurze Flinte und erschoß ihn. Später<br />
erfuhr ich, dass er mit einer Sprengkugel<br />
erschossen worden war.<br />
Als ich draußen war, riefen mich unsere zwei<br />
<strong>Die</strong>nstmädchen, die sich im Schweinehock, das<br />
an die Scheune angebaut war, versteckt hielten.<br />
Dort unter all den Schweinen und im Dreck, der<br />
fast bis an die Knie reichte, kam unser Baby zu<br />
sich und fing an, jämmerlich zu weinen. Ein<br />
Fenster führte aus dem Raum, in dem wir waren,<br />
in die Scheune, und die war voller Banditen.<br />
Hätten sie durch das Loch geschaut, hätten sie<br />
464<br />
uns entdeckt. Aber Gott hielt seine Hand über<br />
uns.<br />
Es war so kalt, dass der Kot steif gefroren<br />
war. Ich zog mein Kleid und den Unterrock aus<br />
und wickelte mein weinendes Kind darin ein.<br />
Beide Kinder und auch die Mädchen weinten. In<br />
der Scheune war aber so ein Heidenlärm, dass<br />
sie uns dort wohl nicht hören konnten. Wie<br />
haben wir dort zu Gott geschrien! <strong>Die</strong> Kinder<br />
schliefen endlich ein, aber wir drei Erwachsenen<br />
saßen zitternd und zagend da.<br />
Plötzlich hörten wir lautes Fluchen und<br />
banges Stöhnen in der Scheune. Ich fürchtete,<br />
dass man dort meinen Mann mißhandelte, und<br />
wagte es, durch die Öffnung zu schauen. Aber<br />
was musste ich sehen? Ein sehr schönes junges<br />
Mädchen wurde von einer Herde von Räubern<br />
schändlich misshandelt. Dann gab es auf einmal<br />
auf dem Hof einen Zusammenlauf. Jemand<br />
schrie, er habe eins seiner Mädel gegriffen. <strong>Die</strong><br />
Banditen aus der Scheune liefen alle hinaus. Ihr<br />
Opfer blieb da auf dem Stroh liegen. Ich rief sie<br />
zu mir. Sie hatte noch so viel Kraft, bis zum<br />
Fenster zu kommen, und die beiden Mädchen<br />
zogen sie durch. Kaum war sie an unserer Seite,<br />
als ihre Quäler zurückkamen. Überall suchten sie<br />
nach ihrem entlaufenen Opfer, aber das Loch in<br />
der Wand bemerkten sie nicht. Wie schrien wir zu<br />
Gott um Schutz!<br />
Wir hörten da einen der Räuber vorschlagen.<br />
Sie wollten das Haus anzünden, dann würden<br />
diejenigen, die sich darin versteckt hatten, schon<br />
umkommen. Wir verließen unser Versteck und<br />
entkamen wirklich. Als wir uns schon vom Felde<br />
nach unserem Dorf umschauten, sahen wir viele<br />
Höfe in Flammen stehen. Wir hörten, wie das<br />
Vieh in den brennenden Ställen brüllte. Als wir<br />
uns etwas hinsetzten, um uns ein wenig auszuruhen,<br />
erzählte das Mädchen, dass man meinen<br />
Mann umgebracht habe. Wie weh tut das! Ich<br />
konnte aber kein Wort sagen und keine Träne<br />
weinen. Als man dem Mädchen am nächsten<br />
Morgen erzählte, dass ihr Vater auch ermordet<br />
war, wie weinte sie doch so herzzerreißend!<br />
Wir flüchteten die ganze Nacht. Unsere<br />
Schuhe hatten wir verloren. Wir gingen barfuß<br />
über das gepflügte und gefrorene Land. Von Zeit<br />
zur Zeit hörten wir Menschen in unserer Nähe<br />
gehen oder laufen, da wir aber nicht wussten, ob
Kapitel 88 Tiege - Kotschubejewka<br />
es Freunde oder Feinde waren, so schwiegen wir<br />
ganz still.<br />
Als wir in Blumenort ankamen, fanden wir<br />
keinen Menschen da. Alle waren geflüchtet. Ist<br />
so ein leeres Dorf aber unheimlich! Wir liefen<br />
weiter nach Alexanderkrone.<br />
<strong>Die</strong> Mädchen trugen unseren Jungen<br />
abwechselnd. Ich hatte die ganze Zeit das Baby<br />
auf den Armen, da es an meiner Brust lag und<br />
anders nicht stillzuhalten war. In der Finsternis<br />
kamen wir kurz vor dem Dorf aufs Eis. Ich brach<br />
durch und fiel bis an die Arme ins Wasser, auch<br />
mein Kind wurde nass. Jetzt konnte ich nicht<br />
mehr weiter. <strong>Die</strong> Mädchen schleppten mich bis<br />
zum nächsten Haus. <strong>Die</strong> Bewohner, Peter<br />
Friesens, waren gerade zum Flüchten bereit. Sie<br />
gaben mir und meinen Kindern trockene<br />
Sachen, luden mich, so krank wie ich war, auf<br />
den Wagen und brachten mich nach Neu-<br />
Schönsee zu Jakob Janzens.<br />
Frau Janzen steckte mich in ein warmes Bett<br />
und pflegte mich, so gut sie konnte. Ich bedurfte<br />
aber nötig eines Arztes. Wir dachten, ich werde<br />
sterben müssen. Mir war es recht, denn dann<br />
würde ich meinen Mann wiedersehen.<br />
Nachmittags kam plötzlich Nachricht, die<br />
Räuber seien im Anzug. Alles flüchtete, bloß Frau<br />
Janzen blieb bei mir. <strong>Die</strong> Ankömmlinge waren<br />
aber nicht Räuber, sondern Flüchtlinge, unter<br />
ihnen auch mein totgeglaubter Mann. War das<br />
ein Wiedersehen! Jetzt konnten wir weinen; bis<br />
dahin hatten wir beide noch keine Träne<br />
vergießen können. Es war zuviel über uns<br />
gekommen.<br />
Bald mussten wir auch von Schönsee flüchten.<br />
Man lud mich auf und fuhr mich nach Neu-<br />
Halbstadt, wo ich bei Prediger Janzens ins Bett<br />
gebracht wurde. Auch diese liebe Frau pflegte<br />
mich wie eine Mutter ihr Kind.<br />
Nach funf Tagen, als alle Banditen abgezogen<br />
waren, konnten wir wieder in unser Heim<br />
einziehen. Aber, o, weh, wie sah das aus! Von<br />
Kleidern und Betten war keine Spur. <strong>Die</strong><br />
Schubladen von der Kommode lagen vor der Tür<br />
und waren mit Mist besudelt. Im Hinterhaus auf<br />
dem großen Esstisch lag ein Haufen zerschlagener<br />
Gläser mit eingemachtem Obst und<br />
Marmelade. Auf und unter dem Tisch hatten die<br />
Banditen ihre natürlichen Bedürfnisse verrichtet.<br />
Trotz all dieser Verluste waren wir glücklich,<br />
es unser Haus zu nennen. Unsere Lieben lebten<br />
alle – sehr viele konnten es von sich nicht<br />
sagen...<br />
Kleine Überfälle blieben an der<br />
Tagesordnung. Raub, Vergewaltigung und<br />
Totschlag verübte, wen danach gelüstete.<br />
Niemand, weder arm noch reich, weder<br />
Deutscher, Russe oder Jude, war sich seines<br />
Lebens sicher.<br />
Quelle: Frau Franz Bargen, "Erinnerungen", aus<br />
G. Lohrenz, Sagradowka, Seiten 98-102.<br />
Altonau, Sagradowka <strong>Kolonie</strong>, 1925. Elisabeth Regehr (auf dem Bild die zweite von rechts, stehend), die<br />
später Franz Bargen heiratete, ist die Verfasserin dieses Berichtes. Ein Sohn von Elisabeth und Franz<br />
Bargen, Peter Bargen, wohnte 1994 in Winfield, B.C., Box 522, V0H 2C0.<br />
465
Kapitel 89 Altonau - Prigorje<br />
Das Dorf Altonau war 1873 in der Niederung<br />
des Flusses Ingulez, 120 Werst von der Kreisstadt<br />
Cherson entfernt, angesiedelt worden. 1876-77-78<br />
gab es in den Unterdörfern eine schwere Überschwemmung.<br />
Altonau hatte im Jahr davor schon<br />
eine erlebt. Bei der zweiten Überschwemmung<br />
standen manche Häuser bis ans Dach im Wasser.<br />
<strong>Die</strong> Russen hatten unsere Ansiedler gleich am<br />
Anfang gewarnt und ihnen geraten, nicht am Fluss<br />
anzusiedeln. Der Deutsche ließ sich aber nicht<br />
gerne von Russen belehren. Nach der Überschwemmung<br />
wurde beschlossen, das Dorf<br />
abzubrechen und oben auf dem Bergrücken frisch<br />
aufzubauen. 1909 wanderten 95 Mennoniten<br />
nach Sibirien aus. Altonau umfasste 1376 Desjatin<br />
Land mit 36 Höfen und hatte 1913 180 Einwohner.<br />
Es gab in Altonau eine Windmühle, Ziegelfabrik,<br />
Dampfmühle, einen Korallensteinbruch und eine<br />
Schreinerei.<br />
Friedhof. Er ist nicht mehr da.<br />
Gemeinde. Am 14.05.1907 wurde hier die<br />
Evangelische Mennoniten-Gemeinde unter der<br />
Leitung von Franz Martens gegründet. Sie zählte<br />
275 Mitglieder und besaß ein Bethaus in Ohrloff.<br />
<strong>Die</strong> Volksschule in<br />
A l t o n a u ,<br />
Sagradowka<br />
<strong>Kolonie</strong>. Foto aus<br />
Quiring und<br />
Bartel, Seite 101.<br />
Ein stark umgebautes Haus in Altonau. 1944, als diese Frau in dieses Haus einzog, war es noch mit Stroh<br />
gedeckt. <strong>Die</strong> Wände sind nicht aus Ziegeln, sondern aus Steinen aus dem naheliegenden Steinbruch. Foto:<br />
Mai 2000.<br />
466
Kapitel 90 Baratow - Schljachtin <strong>Kolonie</strong><br />
Eine mennonitische Ansiedlung im Kreis<br />
Werchnednjeprowsk im russischen Gouvernement<br />
Jekaterinoslaw, etwa 100 km südwestlich von der<br />
Stadt Jekaterinoslaw entfernt, wurde im Jahre 1871<br />
von 74 Mennonitenfamilien aus der Chortitzer<br />
<strong>Kolonie</strong> gegründet. Sie umfasst die beiden Dörfer<br />
Neu-Chortitza (Nowo-Chortitza) und Gnadenthal<br />
(Wodjanaja), insgesamt 3900 Desjatin Land und ist<br />
(1914) von 556 Mennoniten bewohnt, die alle zur<br />
Neu-Chortitzer Mennonitengemeinde gehörten. In<br />
Gnadenthal siedelten 35 Familien an und erhilten<br />
je 50 Desjatin Land. Auch Prediger Jakob Epp<br />
siedelte hier an, der seit 1852 Prediger in der Alt-<br />
<strong>Kolonie</strong> war. In der Umgangssprache werden die<br />
Dörfer Neu-Chortitza und Gnadenthal gewöhnlich<br />
„Baratow" genannt. <strong>Die</strong>se Benennung stammt von<br />
Ein Dorf im Gouvernement Jekaterinoslaw, 20<br />
Werst von der Bahnstation Sofijewka (Südbahn)<br />
entfernt. Gegründet wurde Hochfeld vom<br />
Mühlenbesitzer Heinrich Thiessen aus<br />
Jekaterinoslaw, der im Jahre 1848 hier 1900 Desjatin<br />
Hochfeld<br />
Neu-Chortitza - Nowo-Chortitza<br />
der Tochter (verheiratet mit Fürst Baratow) des<br />
früheren Besitzers des Landes, Fürsten Repnin.<br />
Im Osten grenzen an diese Ansiedlung, die im<br />
Jahre 1874 am Fluss Saksagan von Mennoniten<br />
gegründeten Dörfer Grünfeld (Selenopole) und<br />
Steinfeld (Kamenopole). <strong>Die</strong>se Siedlung in der<br />
Nähe der Stadt Kriwoj Rog nannte man<br />
"Schljachtin". (Aus Mennonitisches Lexikon, Band I.<br />
Seite 124)<br />
In der Nähe dieser <strong>Kolonie</strong>n befanden sich<br />
auch die Dörfer des Judenplans. In den sechs<br />
Dörfern: Nowo-Witebsk, Nowo-Kowno, Kamenka,<br />
Nowo-Schitomir, Nowo-Podolsk, Islutschistoje,<br />
wohnten 50 mennonitische Familien, die ebenfalls<br />
zur Neu-Chortitzer Mennoniten-Gemeinde<br />
gehörten.<br />
Land kaufte und seine Kinder auf demselben<br />
ansiedelte. Infolge der Nationalisierung aller<br />
Ländereien ist diese mennonitische Siedlung<br />
aufgegeben worden.<br />
Aus Mennonitisches Lexikon, Band II., Seite 321.<br />
1872 begann die Besiedlung des Ortes Nr.1 Personen von der NKWD (Volkskommissariat für<br />
Neu-Chortitza mit 36 Wirtschaften zu je 50 Innere Angelegeheiten) verschleppt worden, von<br />
Desjatin. 1926 hatte das Dorf 390 Einwohner denen nur drei wieder zurückkehrten. 15<br />
auf 1902 Desjatin Land. Hier siedelte Prediger Personen sind 1944-1945 als deutsche Soldaten<br />
Jakob Pätkau an, der seit 1866 Prediger war und gefallen. Im russischen Soldatendienst wurden<br />
bis zu seinem Tode 1919 dieses Amt bekleidete. drei Personen vermißt.<br />
Er wurde auch als leitender Prediger der Neu- Anerkennung: Bei der Zusammenstellung des<br />
Chortitzer Gemeinde gewählt und blieb in Abschnitts über die Baratow-Schljachtin <strong>Kolonie</strong><br />
diesem Amt bis 1910, als die Gemeinde sich haben John N. Klassen (Steinfeld), Meckenheim,<br />
selbständig machte und er als Ältester gewählt Deutschland, Hans von Niessen, (Steinfeld),<br />
wurde. Außerdem siedelten hier noch Prediger Rengsdorf, Deutschland, Walter Wiebe<br />
Gerhard Enns (seit 1870) und Anton Sudermann (Grünfeld), Neuwied, Deutschland und Anna<br />
(seit 1870) an. Nach dem Tod von Jakob Pätkau und Maria Klassen (Neu-Chortitza), Neuwied,<br />
berief die Gemeinde Prediger und Lehrer Jakob<br />
Rempel (1883-1941) zu ihrem Ältesten, der bis zu<br />
Deutschland, mitgeholfen.<br />
seiner Verhaftung im Jahre 1929 in diesem Amt Zum Nachlesen:<br />
blieb. Von 1929-1930, bis zur Entkulakisierung, John Friesen, Against the Wind: The Story of<br />
war Peter Funk Prediger. Während der deutschen four Mennonites Villages, (Winnipeg 1994), 165<br />
Besatzung war Jakob Friesen Prediger.<br />
Seiten;<br />
Als "Kulaken" sind in den 1930er Jahren acht Jakob J. Martens, Ein langer Weg in die<br />
Familien aus dem Dorf vertrieben worden. Freiheit, (Filadelphia, Paraguay 2000), 360<br />
In der Zeit von 1936 bis 1939 waren 36 Seiten.<br />
467
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
S<br />
W<br />
E<br />
N<br />
468<br />
Karte der Baratow-Schljachtin <strong>Kolonie</strong>. Aus C. Klassen, Von Niessen,Seite 5.
Kapitel 91 Steinfeld - Kamenopole<br />
Steinfeld wurde 1874 von 40 Familien am<br />
Fluss Saksagan gegründet. <strong>Die</strong> Siedler kamen<br />
meistens aus Alt-Kronsweide und jede Familie<br />
erhielt 50 Desjatin Land. Steinfeld lag etwa sieben<br />
km nördlich von Grünfeld auf der Flussebene des<br />
Saksagan Flusses. Der erste Schulze und Leiter der<br />
Ansiedlung war Abram Krause.<br />
In den Jahren 1895 bis 1900 fand die<br />
Brüdergemeinde in Steinfeld Einzug. Ihr erster<br />
Prediger war Franz Krause und später wurde noch<br />
Abtram Neufeld dazugewählt. Als Diakon wurde<br />
D.Schapansky eingesetzt. Sie kauften beim<br />
Einwohner namens Gross das Wohnhaus und<br />
richteten es als Versammlungshaus ein.<br />
Während der deutschen Besatzung begann<br />
man wieder Pläne zu schmieden für die Zukunft.<br />
Im Frühjahr 1942 erlebten die Steinfelder eine<br />
neue Zuwanderung. <strong>Die</strong> deutschen<br />
Verwaltungsbehörden wollten die Deutschen in<br />
der Ukraine in geschlossene Dörfer zusammenführen.<br />
Es gab im Nachbarkreis Pjatichatka ein<br />
mennonitisches Dorf Neuland, oder auch<br />
Kusmitskoje genannt, etwa 40 km von Steinfeld<br />
entfernt. <strong>Die</strong> Einwohner von Neuland wurden auf<br />
Steinfeld und Grünfeld verteilt. Dagegen mussten<br />
die Ukrainer aus diesen Dörfern nach Neuland<br />
ziehen. Unter denen, die aus Neuland nach<br />
Steinfeld kamen befanden sich auch Karl Fast und<br />
Hans von Niessen. Das Land der Kolchose wurde<br />
aufgeteilt und jeder Bauer bekam 7,5 h Land.<br />
Schon am 19.10.1943 mussten die Steinfelder<br />
Haus und Hof räumen und sich auf die Flucht<br />
begeben.<br />
Steinfeld liegt 180 km westlich von<br />
Saporoschje. <strong>Die</strong> Hauptstraße liegt noch so, wie<br />
die Vorfahren sie angelegt hatten, ist aber etwas<br />
länger. <strong>Die</strong> Mittelgasse, ein beliebter Spielort für<br />
die mennonitischen Kinder, ist versperrt. An der<br />
südlichen Seite des Dorfes führt eine<br />
Eisenbahnlinie vorbei. Am Wetsende befindet sich<br />
noch der kreisformiger See "Beikusch". Durch<br />
einen Staudamm ist auch am Ostende ein See entstanden.<br />
Seit 1930 ist das Dorf eine Kolchose. Der<br />
frühere Dreschplatz ist ein offenes Gelände. Der<br />
große Obstgarten nebenan ist zu einem<br />
ummauerten Geräte- und Gerümpelhof geworden.<br />
Der Fluss Beikusch am Westende von Steinfeld. So schön wie eh und je. Das Wasser und die Wiesen waren<br />
die Lust für die Kinder. Foto freundlichst zur Verfügung gestellt von John N. Klassen, Meckenheim,<br />
Deutschland. Aufnahme von 1993.<br />
469
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
S<br />
E<br />
W<br />
N<br />
Karte des Dorfes Steinfeld, Baratow-Schljachtin <strong>Kolonie</strong> aus C. Klassen, Von Niessen,Seite 5.<br />
470
Kapitel 91 Steinfeld - Kamenopole<br />
Das Haus von Johann P. Klassen (1870-1930) und Maria Fröse (1876-1911). Sie waren die Großeltern von<br />
John N. Klassen, heute wohnhaft in Meckenheim, Deutschland. Sein Vater Johann Klassen (1905-1937)<br />
wurde am 10.09.1937 verhaftet, nach Kriwoj Rog gebracht und seit dem fehlt von ihm jede Spur. Aufnahme<br />
von 1930. Das Foto wurde mit freundlicher Genehmigung von John N. Klassen zur Verfügung gestellt.<br />
Mary und John N. Klassen an der Stelle, wo einst ihr Haus in Steinfeld, Obere Str.7, stand. Foto: Juni 1993.<br />
Erhalten von John N. Klassen.<br />
<strong>Die</strong> größeren Häuser wurden während des II. Weltkrieges alle, außer zwei, zerstört. Hier sehen wir die<br />
kleinen, neu aufgebauten Häuser der Ukrainer. Foto: Juni 1993 von John N. Klassen.<br />
471
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Abram P. Martens Haus-Stall in Steinfeld 1910. Foto aus John Bestvater, et.al., Redakteur, The Family of<br />
Abram P. Martens 1875-1985 (Steinbach 1984), Seite 19.<br />
Steinfeld. Ein Teil vom Martens-Haus, links (nicht auf dem Bild) der Klub, wo jetzt die Schule ist. Rechts<br />
im Bild, Ruth Klassen, die Tochter von John N. Klassen. Foto: Juni 1993 von John N. Klassen.<br />
<strong>Die</strong> Rote-Kuh-Herde am Ostende von Steinfeld. <strong>Die</strong> berühmt gewordene Kuh bei den Deutschen in<br />
Südrussland. Foto: Juni 1993 von John N. Klassen.<br />
472
Kapitel 92 Grünfeld – Selenopole<br />
Grünfeld wurde 1874 von 40 Familien aus 100. Das dritte Schulhaus war ein zweistöckiges<br />
Einlage zu je 50 Desjatin Land und 32 Gebäude des Johann Fröse. <strong>Die</strong>se Schule wurde<br />
Anwohnerfamilien gegründet. Der erste Schulze 1926 eingerichtet. Sie hatte acht Lehrer und war<br />
von Grünfeld war Peter Klassen, der auch die siebenklassig...<br />
ganze Ansiedlung leitete.<br />
"...1902 wurden 21 Häuser durch die<br />
"...<strong>Die</strong>ses war ein Landkomplex mit rund Zugmaschine in Brandt gesetzt. Der her-<br />
2000 Desjatin Land, zwei großen Tränken, drei beigeeilte Zug aus Dolginzewo (18 Werst entfer-<br />
Erddämmen und einem schönen Wald neben nt), löschte das Feuer. 1905 wurde am anderen<br />
der Eisenbahn. Am Ende des Dorfes durchzog Ende ein Viertel des Dorfes durch eine Zigarette<br />
die Jekaterininskaja Eisenbahn das Land seit in Brandt gesetzt. Inmitten blieb eine Wirtschaft<br />
1887-1889 und führte mit einer doppelten von Heinrich Kehler verschohnt. Auf dem Hof,<br />
Schienenbahn nach Jekaterinoslaw.<br />
wo das Feuer "Fuß fasste" wurde später die<br />
Zwei Schafställe, Bäume, Sträucher, Kirche gebaut.<br />
Weideland waren im Kauf miteingeschlossen. "...In der Maienblütezeit 1923 wurde das 50<br />
Grünfelds Straße war 1,5 Werst lang.<br />
jährige Bestehen der Siedlung „Schljachtin"<br />
"...Kirche. Mitten im Dorf stand die große gefeiert. Für die 2000 erschienenen Gäste war<br />
Kirche, die am 27.10.1909 eingeweiht wurde. ein Mittagessen vorbereitet: Borsch, Rindsuppe,<br />
Jakob Aron Rempel war hier von 1920 bis 1929 Kottleten, Fleisch und Obstmoos. <strong>Die</strong> Feier fand<br />
Ältester. Am 16.10.1929 wurde die Kirche von in der zweistöckigen Fabrik statt.<br />
einem Parteimann Eduard Gross geschlossen. In 1923 wanderten 23 Familien (198 Personen)<br />
der Zeit 1941-1943, als die Kirche wieder nach Kanada aus.<br />
geöffnet wurde, hatte die Gemeinde zwei 1924 (?) bekam jede Familie 16 Desjatin<br />
Prediger: Peter Sawatzky und Abram Rempel. Land zugeteilt; die großen Familien bekamen 24<br />
Dirigentin des Chores war Luise Harder. Durch Desjatin.<br />
den II. Weltkrieg ist die Kirche beschädigt wor- "...Bis 1928 wanderten insgesamt 48<br />
den; ein anderes Dach, andere Fenstern, die Familien nach Kanada aus.<br />
große Eingangstür ist weg. Sie wurde später für "...1929. Das Land wurde enteignet, die<br />
verschiedene Zwecke genutzt.<br />
Kolchose „1. Mai" gegründet und 14 Familien<br />
"...Auszug aus den statistischen Angaben: aus Grünfeld ausgewiesen. 13 fremde Familien<br />
1873 hatte Grünfeld eine Fabrik für land- zogen in die Häuser der Verbannten ein...<br />
wirtschaftliche Maschinen, eine Gießerei, eine "...1936-1941. 140 Familien (521<br />
Apotheke, einen Arzt (Dr. Bobenko), einen Personen)–deutsche Bevölkerungszahl. 45<br />
Esssaal, ein Auto „Ford", ein Motorrad (1911), Familien (147 Personen) – Ukrainer. 100<br />
zwei Dampfmühlen, drei Schmieden, eine Personen wurden in vier große Ziegelhäuser aus<br />
Ziegelbrennerei, eine Baumschule, zwei der Stadt hierher versetzt. 90 Personen wurden<br />
Kaufläden, eine Ölmühle, eine Käserei, ein in drei große Ziegelhäuser und die Kirche mit<br />
Fotostudio, eine Feuerwehr, ein Arresthäuschen, Fahrschülern verteilt. <strong>Die</strong> Gesamtzahl der<br />
ein Postamt, eine Werkstube, eine Einwohner in Grünfeld betrug 1941 185<br />
Dampfdreschmaschine, vier Motore. Ackergerät Familien mit 858 Personen....<br />
und Pferdedreschmaschinen besaß jeder Bauer. "...Am 15. Mai 1942 wurden die Ukrainer<br />
Schule. <strong>Die</strong> erste Schule wurde 1873 erbaut. Es nach dem Dorf Kusmitskij [Neuland, Kreis<br />
war ein Lehmhaus das durch den „Orkan" 1926 Pjatichatka] umgesiedelt. <strong>Die</strong> Deutschen von<br />
zerstört wurde. <strong>Die</strong> zweite wurde aus Ziegeln Kusmitskij kamen nach Grünfeld und<br />
gebaut mit drei Lehrerwohnungen und 5-6 Steinfeld... Eine neue Gemeinde wurde gegrün-<br />
Klassenzimmern. 1908 betrug die Schülerzahl det...<br />
473
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Am 21.10.1943 wurden 138 Familien nach<br />
dem Westen evakuiert; zwei blieben zurück....<br />
"...1945-1946. 76 Familien wurden von den<br />
Russen zurück nach Russland verschleppt. 1947-<br />
1951 sind 44 Familien aus Deutschland nach fünf<br />
Kontinenten ausgewandert. 16 Familien sind in<br />
Deutschland geblieben..."<br />
"...Nach dem II. Weltkrieg standen nur noch<br />
acht Häuser, die nicht vom Krieg beschädigt<br />
waren.<br />
Eine kurze Zusammenfassung aus dem Buch<br />
von Sara H. DeFehr, Im Wandel der Jahre<br />
(Winnipeg 1975), Seiten 192.<br />
In den 1920er Jahren gehörte dieses Dorf zum<br />
Kreis Kriwoj Rog und hatte 2300 Desjatin Land.<br />
Nach der Nationalisierung behielt es nur noch<br />
474<br />
1500 Desjatin Land. Es hatte eine Fabrik für landwirtschaftliche<br />
Maschinen, eine Getreidemühle,<br />
eine Butterei mit mechanischem Antrieb und ein<br />
Laden. 1928 betrug die Einwohnerzahl 550.<br />
Grünfeld war auch der Wohnsitz von Jakob A.<br />
Rempel, des Ältesten der Neu-Chortitzer<br />
Mennonitengemeinde.<br />
Um nach Grünfeld heute zu kommen, muss<br />
man zuerst nach "Wesjolyje Terny" fahren und<br />
von dort kommt man auf den alten Steinfeld-<br />
Grünfeld-Weg.<br />
<strong>Die</strong> Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen<br />
und Gießerei ist nicht mehr da.<br />
Zum Nachlesen:<br />
Sara DeFehr, Im Wandel der Jahre, (Winnipeg<br />
Kanada 1975), 195 Seiten.<br />
<strong>Die</strong> Kirche in Grünfeld wurde<br />
1909 erbaut.Von 1929 bis 1993<br />
als Getreidespeicher, Stall für<br />
Zuchtbullen, Heim für<br />
Fahrschullehrer, Klubhaus<br />
und Kino genutzt. Seit 1992<br />
wird es von der örtlichen<br />
Orthodoxen Gemeinde für ihre<br />
Gottesdienste genutzt. Der<br />
Priester dieser Kirche heißt<br />
Timofej Maruschkaj. Der erste<br />
orthodoxe Gottesdienst fand<br />
Ostern 1993 statt. Foto aus<br />
Sara DeFehr, Im Wandel der<br />
Jahre, (Winnipeg Kanada<br />
1975), Seite 122<br />
<strong>Die</strong> ehemalige Kirche der<br />
Mennoniten-Gemeinde in<br />
Grünfeld nach dem II.<br />
Weltkrieg. Foto aus Der Bote,<br />
Nr.25, 1995, Seite 9.
Kapitel 92 Grünfeld – Selenopole<br />
S<br />
W<br />
E<br />
N<br />
Karte des Dorfes Grünfeld, Baratow-Schljachtin <strong>Kolonie</strong>. Aus Sara DeFehr, Im Wandel der Jahre<br />
(Winnipeg, Kanada 1975), Seite 121.<br />
475
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Ältesten Jakob A. Rempel 1883-1941?<br />
Jakob wurde am 9. April 1883 in Heuboden, Prediger in der örtlichen Mennonitengemeinde.<br />
<strong>Kolonie</strong> Borosenko, Russland geboren. Er war ein 1920 wurde er zum Ältesten der<br />
sehr begabter Junge und besuchte zuerst die Mennonitengemeinde Neu-Chortitza (<strong>Kolonie</strong><br />
Elementarschule. Danach arbeitete er zwei Jahre Baratow) gewählt und am 02.05.1920 vom<br />
als Lehrer ohne Lehrerexamen in einer Ältesten der Mennonitengemeinde Chortitza ins<br />
Privatschule bei den Musterwirten in der Ältestenamt eingeführt. Zu dieser Zeit traf auch<br />
Judenkolonie „Nowo-Schitomir", bei Krivoj Rog, die Bestätigung zum Universitätsprofessor ein,<br />
Gouvernement Cherson.<br />
die ihn an die Universität nach Moskau berief.<br />
1903-1904 war er Lehrer an der Dorfschule in Nach der Wahl zum Gemeindeältesten wurde er<br />
Kitschkas im Gouvernement Orenburg und von der Universität durch die kommunistische<br />
machte in Orenburg sein Lehrerexamen. Dann Regierung abgemeldet. Bald darauf bat ihn auch<br />
kehrte er wieder in die Mutterkolonie Chortitza die Gemeinde in Nikolajthal (Borosenko), ihr<br />
zurück, wo er in Neuhorst ein Jahr als Lehrer tätig Ältester zu werden. Zu seinem Wohnsitz wählte er<br />
war.<br />
Grünfeld (Baratow).<br />
Beim Mühlenbesitzer J. J. Thiessen aus Da durch die schweren Zeiten der<br />
Jekaterinoslaw (heute Dnjepropetrowsk), der ger- Auswanderung, der Epidemien, der<br />
ade einen Jungen suchte, um ihn nach der Bandenüberfälle und der Verhaftungen immer<br />
Schweiz in die Bibelschule zu schicken, bewarb weniger Prediger in den Gemeinden blieben,<br />
er sich um ein Stipendium. Er hatte Glück und wurde Jakob Rempel auch noch von der<br />
durfte in der Schweiz an der Predigerschule Gemeinde Nikolajfeld, Sagradowka, gebeten<br />
studieren. Nebenbei machte er sein Reifeexamen einzugreifen.<br />
(Gymnasium) und studierte an der Universität 1921 hielt die Alte <strong>Kolonie</strong> in Grünfeld eine<br />
Theologie und Philosophie.<br />
Konferenz ab, um wieder Ordnung in den<br />
Da es in Chortitza an Lehrern fehlte brach er Gemeinden zu schaffen. Im Oktober fand eine all-<br />
ein Jahr vor Abschluss sein Studium ab und gemeine Konferenz der Mennoniten Russlands in<br />
kehrte nach Hause zurück. Er wurde Lehrer an Chortitza statt, deren Vorsitzender Jakob Rempel<br />
der Zentralschule und am Lehrerseminar in war.<br />
Chortitza. Der zweite Grund, weshalb er vorzeitig Am 10.03.1921 heiratete er Sophie<br />
das Studium abgebrochen hat, war der Tod seiner Sudermann, die Schwester der verstorbenen<br />
Mutter und das Mitleid zu seinen Geschwistern Frau. Aus dieser Ehe hatte er sechs Kinder.<br />
(er war der Älteste von 13 Geschwistern). <strong>Die</strong>se 1923 wanderten viele aus seiner Gemeinde<br />
sechs Jahre im Ausland waren sehr arbeitsreich, nach Amerika aus. Durch diesen Auszug und den<br />
aber auch die schönsten in seinem so bewegten Druck der Roten Regierung wurde die<br />
Leben.<br />
Gemeindearbeit fast unmöglich. Er wanderte<br />
Von 1912 bis 1915 war er in Chortitza Lehrer. nicht aus, denn er glaubte, hierbleiben zu müssen<br />
In dieser Zeit wurde er auch ins Predigeramt und der Gemeinde zu dienen.<br />
berufen.<br />
1925 nahm er an der allrussischen Konferenz<br />
1914 heiratete er Maria Sudermann aus der Mennoniten in Moskau teil und wurde zur<br />
Miloradowka, Kreis Werchnje-Dnjeprowsk, Mennonitischen Weltkonferenz nach der<br />
Gouvernement Jekaterinoslaw. Aus dieser Ehe Schweiz geschickt. Wäre da nicht die Gemeinde<br />
hatte er zwei Kinder, Alexander und Leonora. gewesen, wäre er zumindest nach dieser Reise in<br />
1918 starb seine Frau.<br />
die Schweiz ausgewandert...<br />
1915 wurde er von der Schulbehörde in 1926 verließen sie Grünfeld und zogen nach<br />
Odessa als Lehrer für Deutsch und Französisch Ohrloff, <strong>Molotschna</strong> <strong>Kolonie</strong>, wo eine Bibelschule<br />
nach Jusowka (Donezk), geschickt.<br />
eröffnet werden sollte, die nicht nur Prediger aus-<br />
1916 versetzte ihn die Schulbehörde an das bilden, sondern auch ein Kulturzentrum für<br />
Gymnasium nach Nikopol.<br />
jegliche Geistesbildung sein sollte. Da der Bau der<br />
1918 wurde er Privatdozent für Germanistik Bibelschule abgesagt wurde, zogen sie<br />
an der Universität in Jekaterinoslaw und auch wahrscheinlich wieder nach Grünfeld zurück.<br />
476
Kapitel 92 Grünfeld – Selenopole<br />
Somit war auch Jakob von den<br />
Auswanderungsgedanken nicht mehr frei.<br />
Er arbeitete am „Unser Blatt", einer mennonitischen<br />
Zeitschrift, die in der Zeit zwischen 1925<br />
und 1928 herausgegeben wurde, und kämpfte vor<br />
Gericht wegen der Sache der Wehrlosigkeit.<br />
1928 stellte er einen Antrag auf<br />
Ausreisepässe, der ihnen abgesagt wurde. Er<br />
machte seine Arbeit weiter, indem er zahlreiche<br />
mennonitische Dörfer in verschiedenen <strong>Kolonie</strong>n<br />
besuchte und in deren Gemeinden diente. Er<br />
arbeitete viel auch in den Orenburgschen<br />
Gemeinden.<br />
Am 08. September 1929 wurden sie aus<br />
Grünfeld verbannt. Er hätte dieser Verbannung<br />
entgehen können, hat es aber um Christiwillen<br />
nicht getan und wählte den Weg der Verbannung.<br />
<strong>Die</strong> Familie wurde am 13. Oktober von Haus und<br />
Hof gejagt und nach dem Dorf Zentral im<br />
Gouvernement Woronesch geschickt.<br />
Am 16. November 1929 reiste er mit seiner<br />
Familie nach Moskau, um auszuwandern. Dort<br />
wurde er verhaftet, acht Monate in dem<br />
berühmten Moskauer Gefängnis "Butyrka" festgehalten<br />
und zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.<br />
Er wurde auf die "Solowetzkije Ostrowa" (Inseln<br />
im Weißen Meer) geschickt. Seine Familie wurde<br />
zurück nach Zentral geschickt.<br />
Am 24. Januar 1932 floh er aus der<br />
Verbannung...<br />
An dieser Stelle möchte ich einen Ausschnitt<br />
aus der Lebensgeschichte meines Großvaters<br />
Nikolaj Reimer einfügen, wo er über Jakob<br />
Rempel schreibt.<br />
"...1930 konnte er aus der Gefangenschaft<br />
fliehen und tauchte bald darauf in der mennonitischen<br />
Ansiedlung im Gebiet Omsk unter dem<br />
Namen „Sudermann" auf. Als ihm dort der Boden<br />
zu heiß wurde, kam er nach Rostow/Don (Eine<br />
Stadt an der Mündung des Don-Flusses in das<br />
Asowsche Meer) und arbeitete dort als Tischler."<br />
"...1932 war er schon wieder auf dem<br />
Trakehn, Kaukasus, auf dem Erntedankfest, und<br />
er war auch einmal in unserem Haus. Er gab sich<br />
zu erkennen und verschwand dann wieder.<br />
Obwohl ich ihn 1929 in Moskau im Gefängnis in<br />
einer Zelle getroffen hatte, erkannte ich den alten<br />
Mann jetzt nicht, da er einen langen Bart trug.<br />
Wenn ich mich recht erinnere, war es im Sommer<br />
1934, als er mit seiner Frau nochmal bei uns war."<br />
"...1936. Nun sollte ich dem Staatsanwalt<br />
477<br />
angeben, wo sich Rempel-Sudermann versteckt<br />
hielt. Ich wusste es wirklich nicht. Zur Strafe für<br />
meine „Aussagenverweigerung" musste ich<br />
mehrere Monate auf der „Parascha" (Nachttopf)<br />
sitzen, d.h. meine kleinen und großen<br />
Bedürfnisse auf dem großen Nachttopf (meistens<br />
eine Tonne) verrichten, und meine<br />
Zellengenossen mussten es dann hinaustragen.<br />
„Sie werden diesen Nachttopf so lange benutzen,<br />
bis Sie mir den Aufenthaltsort von Rempel-<br />
Sudermann verraten", - sagte der Staatsanwalt..."<br />
Siehe Nikolaj Reimer, Kapitel 47.<br />
...Nach der ersten Flucht wurde Jakob<br />
Rempel wieder verhaftet, aber am 01. Mai 1934<br />
konnte er nochmal flüchten. Wieder wurde er verhaftet.<br />
Wieder Flucht, und im Oktober 1934 war er<br />
in Turkestan bei den Mennoniten mit seinem<br />
Sohn Alexander vereint. Hier blieb er den Winter<br />
1934-1935.<br />
Er äußert sich in einem Brief vom 01.01.1935<br />
wie folgt darüber: „Ich mache mir nur selten<br />
besondere Gedanken und schwere Sorgen. Als ich<br />
seinerzeit in meiner Arbeit kaltgestellt wurde,<br />
vom Leben getrennt, in die Einsamkeit geführt,<br />
Leiden auf Leiden folgten, Krankheiten sich<br />
ablösten und die Genesung die Geburtsstunde<br />
neuer Leiden war, da fragte ich mich, was Jesus<br />
dazu sagen würde. Nachdem ich mich erst davon<br />
innerlich überzeugt hatte, dass Jesus schweigen<br />
würde, wie er in seinem Leiden geschwiegen hat,<br />
da wurde ich nicht nur still, sondern liebte die<br />
Stille über alles. In tiefster Gerborgenheit ertrug<br />
ich das Schwerste ohne Menschenhilfe.<br />
Gott führte mich in die<br />
Leidensgelegenheiten, Menschen führten sie aus,<br />
Gott aber beschützte und führte wieder heraus. Je<br />
tiefer das Leiden, desto stiller die Umgebung. Ich<br />
lernte schweigen und leiden. Nur in den<br />
Leidensferien habe ich um Hilfe gerufen, dasselbe<br />
vielleicht manchmal lauter als nötig. Mir ist<br />
es nachher oft leid gewesen, dass ich womöglich<br />
Menschen unruhig machte und sie in ihrer<br />
Gemütlichkeit störte. Ich wollte durchaus<br />
schweigen, wie auch Jesus in seinem Leiden<br />
geschwiegen hat. Aber auch Jesus rief am Kreuz:<br />
"Mich dürstet!" Das gab mir Mut zu meinem<br />
Schrei in der Not und Stärkung"...<br />
Am 13. März 1936 wurde Jakob Rempel in<br />
Chiwa, Turkestan, wieder verhaftet und im April<br />
1937 in Pjatigorsk, Kaukasus, zum Tode<br />
verurteilt. Das Urteil wurde später gemildert.
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Zuerst saß er im "Politisolator" in Wladimir bei<br />
Moskau, dann in einem Gefängnis in Orel in<br />
Mittelrussland.<br />
Ein Brief vom 12. Juni 1941 ist der letzte<br />
Ältester J. A. Rempel (1883-1941) als Student in<br />
Basel, 1911. A. A. Töws, Seite 31/Foto aus Sara<br />
DeFehr, Im Wandel der Jahre,Seite 122.<br />
478<br />
gewesen. Er ist dann wohl erschossen worden.<br />
Aus Mennonitisches Lexikon Band III, Seiten 470-<br />
474 und Mennonitische Märtyrer, Band I.,<br />
(Winnipeg 1949), Seite 30-46.<br />
J. A. Rempel in der Verbannung am 22.11.1933. A.<br />
A. Töws, Seite 32/Foto aus Peter Derksen, Es wurde<br />
wirder ruhig,Seite 84<br />
Kirche der<br />
Mennoniten-<br />
Gemeinde in Neu-<br />
Chortitza, Baratow<br />
<strong>Kolonie</strong>. Foto aus<br />
Quiring und Bartel,<br />
Seite 60.
Kapitel 93 Juden in Südrussland und Ukraine<br />
<strong>Die</strong> Juden wohnten in "Kiewer Rusj" seit ca. Hetze auf die Juden immer stärker. Während des<br />
9.-10. Jahrhundert. Professor O. Subteljnyj Blutbades in den Jahren 1919-1920 wurden zwis-<br />
schreibt, dass "die größte Migration der Juden chen 35 000 und 50 000 Juden umgebracht.<br />
fand unter der Herrschaft Polens im 16.-17. Vor dem II. Weltkrieg hieß der „Judenplan"<br />
Jahrhundert statt. <strong>Die</strong> meisten Juden siedelten mit schon 13 jüdischen Dörfern „Kreis<br />
in den neu gegründeten Städten an, und ihr Stalindorf". Ein Geschichtslehrer aus<br />
Handel und Handwerk blühte. Anfang des 18. Tschkalowo erzählte 1999, dass 1000 jüdischer<br />
Jahrhunderts wohnten in Südrussland 12 000 Einwohner im II. Weltkrieg aus den jüdischen<br />
Juden..."<br />
Siedlungen von der deutschen Wehrmacht hier<br />
"...Von der russischen Regierung wurden in Tschkalowo (in der Nähe der ehemaligen<br />
diese neuen Bürger gesondert behandelt. Sie sah mennonitischen Siedlung Nepljujewo) am Ufer<br />
in den jüdischen Händlern eine Konkurenz für eines kleinen Flusses erschossen wurden. In<br />
die russischen Händler. Deshalb wurde es den zwei Gruppen je 500 Mann, wurden sie an dieses<br />
Juden verboten, sich auf dem russischen Ufer gebracht, wo schon tiefe Gräben auf die<br />
Territorium anzusiedeln. <strong>Die</strong> meisten jüdischen Leichen warteten. <strong>Die</strong> Einwohner des Dorfes<br />
Siedler wohnten Ende des 18. Jahrhunderts erinnern sich heute noch, wie im nächsten<br />
immer noch nur im Westen Südrusslands, Frühling immer wieder Leichen an das Ufer<br />
hauptsächlich am rechten Dnjeprufer. <strong>Die</strong>se geschwemmt wurden. Viele Jahrzehnte hat sich<br />
"Grenze" der jüdischen Ansiedlungen bestand um diese Erschossenen niemand gekümmert.<br />
bis 1917. Ende des 19. Jahrhunderts lebten in Erst 1999 wurden von der jüdischen Gesellschaft<br />
....[Ukraine] zwei Milloinen Juden, d.h.–8 aus Nikopol zwei Denkmäler am Ufer des<br />
Prozent der ukrainischen Bevölkerung...," Flusses, auf dem Platz der Hinrichtung,<br />
Aus O. Subteljnyj, Istorija Ukrainy errichtet.<br />
("Geschichte der Ukraine"), Seiten 355-356.<br />
<strong>Die</strong> Mennonitische Rundschau berichtet<br />
Judenplan: "...Judenplan, so nennt man den<br />
über den jüdischen Friedhof in Chortitza folgendes:<br />
<strong>Die</strong> Ruinen eines jüdischen Friedhofes in<br />
Versuch der russischen Regierung 1847 im der ehemaligen mennonitischen <strong>Kolonie</strong><br />
Chersoner Gouvernement, eine Chortitza befindet sich an der südwestlichen<br />
Ackerbaukolonie mit jüdischer Bevölkerung zu Kante der heutigen Siedlung Werchnjaja<br />
gründen. Damit die Juden den Betrieb des Chortitza, die jetzt Teil der Stadt Saporoschje ist.<br />
Ackerbaus gründlich erlernten, sollten unter <strong>Die</strong> Ausmaße des Friedhofes und die geringe<br />
ihnen deutsche Landwirte, vornehmlich Anzahl der zurückgebliebenen Grabsteine,<br />
Mennoniten, als Musterlandwirte angesiedelt weisen auf kleine Gruppen Juden hin, die Ende<br />
werden. Zu dieser Siedlung gehörten damals die des 19. Jahrhunderts in der mennonitischen<br />
Dörfer: Nowopodolsk, Nowowitebsk, Kamenka, <strong>Kolonie</strong> lebten. Einige jüdische Familiennamen<br />
Islutschistoje, Nowokowno und Nowoschitomir. sind noch auf den Steinen zu<br />
<strong>Die</strong> Lage der Musterwirte in den erkennen:Lemberg, Berljand, Schuman,<br />
Hebräerkolonien war in wirtschaftlicher Schljanman. <strong>Die</strong> Grabsteinen sind aus<br />
Beziehung eine recht ungünstige. <strong>Die</strong> Felder der Sandstein, Granit oder "Labradorit" hergestellt.<br />
Musterwirte lagen mitten unter denen der Juden <strong>Die</strong> Inschriften auf den Grabsteinen sind meis-<br />
zerstreut. <strong>Die</strong> Juden aber gaben ihr unbebautes tens in zwei Sprachen, Hebräisch und Russisch.<br />
Land den Russen zum Heuschlag ab, die ihr Vieh Der Friedhof befindet sich in einem zerfallenen<br />
dort weideten und die bestellten Felder der Zustand.<br />
Mennoniten zertraten. In kurzer Zeit waren auch <strong>Die</strong> jüdische Synagoge (1890-1923). Sie befand<br />
die reichen mennonitischen Musterwirte ver- sich in der Nähe des Jahrhundertdenkmals, an<br />
armt. Erst nach 30 Jahren wurde den der Straße, die die Alte Reihe mit der Neuen ver-<br />
Mennoniten ihr Land gesondert abgeschnitten... band. Es war ein langes Gebäude auf einem<br />
(Mennonitisches Lexikon, Seiten 437-438)<br />
großen Grundstück, das an die Buchhandlung<br />
Während der Revolution 1917 wurde die von Peter Enns grenzte.<br />
479
Teil IV <strong>Die</strong> Tochterkolonien<br />
Judenplan Verwalter.<br />
<strong>Die</strong>trich Epp (1819-1900) war 48 Jahre<br />
Verwalter des Judenplans. Er war der Großsohn<br />
des Ältester David Epp (1750-1802). <strong>Die</strong> Epps<br />
gehörten zu den angesehenen Leuten: Bauern,<br />
Judenplanverwalter <strong>Die</strong>trich Epp (1819-1900) und<br />
Frau Katharina Siemens (1821-1900). Johann Epp<br />
(1898-1998), der Rayonchef von Chortitza, war ihr<br />
Großohn (siehe Kapitel "Werchnjaja Chortitza"). Foto<br />
aus Harvey Dyck, A Mennonite in Russia The Diaries<br />
of Jakob D. Epp 1851-1880 (Toronto 1991), Seiten<br />
308/309.<br />
Lehrer, Prediger, Ältesten, Schriftsteller und<br />
Dichter. Zu den ersten Einwanderern in Russland<br />
gehörte David Epp (1750-1802). <strong>Die</strong>trich Epp war<br />
der Bruder des Schullehrers Heinrich Epp (1827-<br />
96).<br />
Das jüdische Nationalgebiet „Stalindorf" im Kreis Nikopol (früher zum Teil „Judenplan") vor dem II.<br />
Weltkrieg. Das Dorf Stalindorf lag in der Nähe vom russischen Dorf Loschkarewka. <strong>Die</strong> Dörfer<br />
Wojkowdorf, Larine und Freidorf könnten zwischen den heutigen Dörfern Kirowo und Tawritscheskoje<br />
gewesen sein. <strong>Die</strong> Karte erhalten von A. Tedeew, Staatsarchiv der Stadt Saporoschje.<br />
480