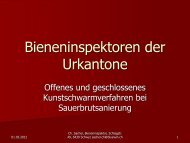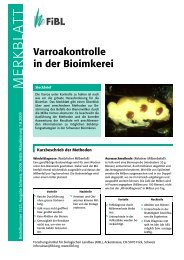Leitfaden Bienengesundheit - Verein Hinterthurgauer Bienenfreunde
Leitfaden Bienengesundheit - Verein Hinterthurgauer Bienenfreunde
Leitfaden Bienengesundheit - Verein Hinterthurgauer Bienenfreunde
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Leitfaden</strong> <strong>Bienengesundheit</strong> des Zentrums für Bienenforschung<br />
4. Acariose<br />
(Tracheenmilbenkrankheit)<br />
4.1 Allgemeines<br />
Die parasitische Milbe Acarapis woodi lebt in den Luftröhren<br />
von erwachsenen Bienen. Sie vermehrt sich dort. Dies<br />
wirkt sich insbesondere bei den langlebigen Winterbienen<br />
aus und kann als starke Belastungen eingestuft werden,<br />
welche Völker insgesamt schwächt. Im Winter und<br />
Frühjahr können Acarapis-geschädigte Völker eingehen. In<br />
den letzten Jahrzehnten ist diese Krankheit sehr selten<br />
geworden. Die Ursache für den Rückgang der Parasitierung<br />
könnte in der flächendeckenden Varroabehandlung<br />
liegen.<br />
Die Übertragung erfolgt von Biene zu Biene. Nur relativ<br />
junge Bienen können „angesteckt“ werden. Die Generationsdauer<br />
der Tracheenmilbe beträgt ca. 15 Tage. Bei der<br />
kurzen Lebensdauer der Sommerbienen von ca. 20 Tagen<br />
führt die Milbenvermehrung in der Regel nicht zu gefährlichen<br />
Befallsgraden.<br />
den Bienenumsatz und die Entwicklung der Völker unterstützen.<br />
Für die Zucht sind nur Völker zu verwenden, die<br />
keine Anzeichen von Anfälligkeit auf Tracheenmilbenbefall<br />
zeigen. Stark von Tracheenmilben befallene und<br />
erkrankte Völker sind mögliche Rückinvasionsherde. Diese<br />
sind auszumerzen. Die Behandlung der Völker im August-<br />
September mit Ameisensäure gegen Varroamilben wirkt<br />
gleichzeitig auch gegen allfällige Tracheenmilben. Sollten<br />
ausnahmsweise trotzdem Anzeichen von Acarapismilbenbefall<br />
feststellbar sein, können im Frühjahr 3 Stossbehandlungen<br />
mit Ameisensäure in wöchentlichen Intervallen<br />
durchgeführt werden. Die Dosierung und Anwendung<br />
erfolgen analog wie bei der Varroa-Behandlung. Es kann<br />
eine Wirksamkeit von über 90 % erwartet werden. Honig<br />
solcher Völker ist in der Regel nicht verkehrsfähig (Säurerückstände).<br />
4.2 Symptome<br />
Das klinische Bild der Tracheenmilbenkrankheit äussert<br />
sich in Störungen, die am Verhalten des Volks sowie am<br />
Verhalten und Aussehen einzelner Bienen beobachtet<br />
werden können:<br />
• Volk ist unruhig, schwach<br />
• Asymmetrische gespreizte Flügelstellung bei einzelnen<br />
Bienen<br />
• Krabbelnde, flugunfähige Bienen<br />
• Bienenverluste<br />
• Völker können im Frühjahr eingehen<br />
Diese Anzeichen allein reichen nicht aus für eine sichere<br />
Diagnose Tracheenmilbenbefall. Die eindeutige Diagnose<br />
erfolgt im Labor, indem Acarapis-Milben in den Luftröhren<br />
der Bienen mikroskopisch nachgewiesen werden.<br />
4.3 Massnahmen / Vorbeugung<br />
Imker/innen sollten im Verdachtsfall den/die Bieneninspektor/in<br />
benachrichtigen. Wenn der Befund positiv ist,<br />
muss das Untersuchungslabor oder der/die Inspektor/in<br />
dem zuständigen Veterinäramt Meldung erstatten (Art.<br />
291 TSV). Für eine Laboruntersuchung ist eine Probe von<br />
mindestens 30 verdächtigen Bienen erforderlich, die im<br />
Gefrierschrank oder in Alkohol abgetötet werden. Die Einsendung<br />
ins Labor erfolgt in einer stabilen luftdurchlässigen<br />
Verpackung (z.B. Zündholzschachtel). Acarapis-Diagnosen<br />
sind vor allem im Winter (Wintertotenfall) und im<br />
Frühjahr sinnvoll. Vom Mai bis Oktober werden wegen des<br />
starken Bienenumsatzes nur selten Milben gefunden.<br />
Es sind vor allem präventive Massnahmen zu ergreifen.<br />
Wichtig ist ein Standort mit günstigen Voraussetzungen<br />
für eine rege Volksentwicklung (gute Trachtverhältnisse,<br />
keine übermässigen Schwankungen des lokalen Klimas im<br />
Winter und Frühjahr). Die imkerlichen Massnahmen sollen<br />
ALP forum Nr.84 | 2011<br />
21