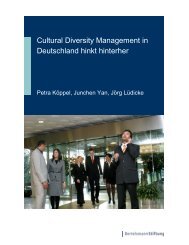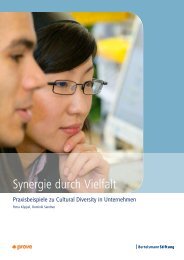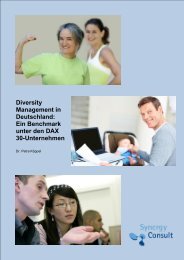Facette, 01/2012 - Synergy Consult
Facette, 01/2012 - Synergy Consult
Facette, 01/2012 - Synergy Consult
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
18<br />
www.facette-online.de<br />
Skizzen zu den beiden „Tudorf“<br />
„Doppelt gemoppelt hält besser“<br />
Ein Beitrag von Stefan Voßschmidt<br />
Die Geschichte von zweien der sechs Dörfer des alten Amtes Wewelsburg<br />
sei kurz skizziert: Der „Tudörfer“. Nach heute überwiegend<br />
vertretener Auffassung lässt sich die erste Silbe „Tu/Tiu“<br />
auf das gleichlautende keltische Wort zurückführen. Genau<br />
genommen heißt “Tudorf“ daher „DorfDorf“. Die Doppelung ist<br />
aber nicht beabsichtigt.<br />
Bereits der frühmittelalterliche<br />
Bauer dürfte den keltischen<br />
Ursprung des Wortes und<br />
seine Bedeutung nicht mehr<br />
gekannt haben. Viele Namen<br />
im Paderborn-Bürenschen lassen<br />
sich auf keltische Worte<br />
zurückführen (z. B. auch das „A“<br />
im Namen des landschaftsprägenden<br />
Flüsschens Alme auf das<br />
keltische A bzw. das lateinische<br />
aqua = Wasser, ähnlich im<br />
Münsterland die Flüsse mit dem<br />
Namen Aa, münstersche Aa,<br />
Bocholter Aa usw.). Besonders<br />
originell ist, dass sich bei dem<br />
„DorfDorf“ auch die beiden<br />
verselbständigten Teile unter<br />
der Beibehaltung dieses Namens<br />
bis heute erhalten haben:<br />
Obern- und Niederntudorf. Die<br />
Differenzierung im Nachbardorf<br />
Ahden in Obern- und Niedernahden<br />
endete mit dem Untergang<br />
von Niedernahden. Da der<br />
Unterscheidungsbegriff „Ober“<br />
danach nicht mehr notwendig<br />
war, verblieb das ursprüngliche<br />
„Ahden“.<br />
Jürgen Beinen (Berendtshaus),<br />
Jürgen Wietfeld (Scheefenhaus),<br />
Meilf Ottomeyers, Hermann<br />
Amtmeyer (Steffenhaus). Der<br />
Amtshof – auch Amtmeierhof<br />
genannt – war der Haupthof<br />
des Domkapitels. Sein vom<br />
Grundherrn zum Dorfschulzen<br />
eingesetzter Inhaber besaß als<br />
Entgelt für seine Amtsführung<br />
gewisse Privilegien. Um das<br />
Jahr 1600 wurde der sehr große<br />
Hof geteilt, abgezweigt wurden<br />
der Janberenshof (Johann<br />
Bernd) und die Mühle (Koken<br />
Mühle). Neben dem Domkapitel<br />
waren weitere Grundherrn die<br />
Freiherrn von Brenken und das<br />
Kloster Böddeken; gemeinsam<br />
besaßen diese drei Grundherren<br />
das Obereigentum an allen<br />
(Niedern- und Obern-) Tudorfer<br />
Höfen.<br />
Im Jahre 1502 wird der parochuis<br />
Berthold als Pastor<br />
von Niederntudorf bezeichnet.<br />
Erwähnt wird darüber hinaus<br />
ein Tönnies Rissen, sowie der<br />
Richter Johannes Rissen.<br />
Die verhältnismäßig große<br />
Siedlung Niederntudorf wurde<br />
durch drei ehemalige Villikationszentralen<br />
unterschiedlicher<br />
Grundherrschaften dominiert,<br />
deren Äcker in drei großen<br />
Blöcken um den Ort verteilt<br />
lagen:<br />
Osthoff – Stift Geseke<br />
Loehoff (Lohof) - Stift/ Kloster<br />
Böddeken<br />
Amtshoff – Domkapitel Paderborn<br />
(Pb).<br />
Bei den Häusern innerhalb der<br />
Dörfer sind weitere Differenzierungen<br />
festzustellen. Von den 98<br />
festgestellten Häusern in Tudorf<br />
hatten als Grundherren:<br />
Nach der Säkularisation übernahm<br />
der Fiskus im Jahre 1803<br />
1. Oberntudorf<br />
Oberntudorf liegt am kleinen<br />
Hellweg, ca. fünf Kilometer von<br />
Salzkotten entfernt, am Ostrand<br />
des Hellwegraumes, nur wenige<br />
Kilometer vom Flughafen<br />
Paderborn/Lippstadt entfernt.<br />
Auch der Schnellbus Paderborn-<br />
Flughafen fährt stündlich durch<br />
den schönen Ort.<br />
Der Name Tudorf wird als<br />
Thiuthorp bereits in einer Urkunde<br />
Bischofs Heinrich II von<br />
Paderborn vom 17. Mai 1127<br />
erwähnt. Am 6. April 1256 ist<br />
bereits eine villicacio (ein spätmittelalterlicher<br />
Höfeverband,<br />
in der Regel einem Haupthof<br />
zugeordnet und einem Grundherrn<br />
abgabepflichtig) vorhanden,<br />
zweiundzwanzig Jahre<br />
später wird erstmals zwischen<br />
der Siedlung auf der Höhe und<br />
im Tal unterschieden. In einem<br />
Bödddeker Kopiar aus dem 15.<br />
Jahrhundert werden die beiden<br />
Tudorpe als zwei selbständige<br />
Pfarreien des Domprobstes<br />
den umfangreichen Waldbesitz<br />
des Klosters Böddeken, sieben<br />
Jahre später den Waldbesitz<br />
des Domkapitels. Große Teile<br />
dieser Waldgebiete blieben als<br />
ungeteilter Kommunalwald<br />
erhalten. Denn während fast<br />
alle anderen westfälischen<br />
Gemeinden den Gemeinschaftsbesitz<br />
an Wald als unzeitgemäß<br />
und nicht den Anforderungen<br />
der Moderne entsprechend<br />
aufteilten, blieb hier die auf<br />
das Mittelalter zurückgehende<br />
„Waldgemeinheit“ bestehen.<br />
Dieser Kommunalwald war im<br />
19. Jahrhundert so ertragreich,<br />
dass die Gemeinde Niederntudorf<br />
keine Steuern erhob. Noch<br />
heute befindet sich zwischen<br />
Niederntudorf und Henglarn<br />
ein großes Waldgebiet, welches<br />
zu Niederntudorf (Stadt<br />
Salzkotten, 544 Hektar) gehört.<br />
Bei den seit Jahren steigenden<br />
Holzpreisen dürfte dieser Wald<br />
ertragreich sein und bei nachhaltiger<br />
Bewirtschaftung auch<br />
immer bleiben.<br />
Die Tudorfer Anekdoten der<br />
70er Jahre um Meta und Löwen-<br />
Harry, die zugezogene Lehrerin,<br />
die den Gänsen klageweise das<br />
Schnattern verbieten wollte, das<br />
Geschäft Montag, das immer<br />
auch Sonntags nach der Kirche<br />
geöffnet hatte und viele mehr,<br />
sind vor Ort noch in aller Munde.<br />
Sie zeigen bruchstückhaft<br />
vergangenes bäuerliches Leben,<br />
z.B. war bis 1933 in den Dörfern<br />
Westfalens der Sonntag der<br />
Haupteinkaufstag an dem die<br />
Geschäfte selbstverständlich<br />
geöffnet waren (mit Ausnahme<br />
der Messezeiten). Zur Verbreitung<br />
der Anekdoten kann auch<br />
der geteilte Standort der Schule<br />
in Niedern- und Oberntudorf<br />
beitragen. Einen Mittelpunkt<br />
Niederntudorfs bildet seit 1997<br />
bezeichnet. Möglicherweise<br />
hatten beide Dörfer ursprünglich<br />
einen gemeinsamen Pfarrer,<br />
von 1620 bis 1729 gab es diese<br />
Personalunion nachweislich. Die<br />
schöne, dem Drachentöter Sankt<br />
Georg geweihte, Kirche bildet<br />
seit alters her schon optisch<br />
den Mittelpunkt des Dorfes.<br />
Der Drache findet sich auch<br />
im Wappen des Dorfes. Dies<br />
muss nicht auf die christliche<br />
Legende zurückgehen. Sagen<br />
vom mythischen Drachentöter<br />
findet sich auch bei den noch<br />
nicht christianisierten Germanen,<br />
nicht nur der Siegfried des<br />
Nibelungenliedes, sondern auch<br />
der altgermanisch-angelsächsische<br />
Held Beowulf (König der<br />
Gauten) tötet einen Drachen.<br />
Da alle Gefährten bis auf einen<br />
ängstlich fliehen, stirbt Beowulf<br />
(Beowulf=Bienenwolf=Bär)<br />
der die Ungeheuer Grendel<br />
und Hak besiegte, bei diesem<br />
letzten Kampf.<br />
Nach Ansicht des Heimatforschers<br />
Tönsmeyer gehören<br />
die Gemeinden Obern- und<br />
Niederntudorf seit 1598 zum<br />
Amt Wewelsburg. In jedem Fall<br />
ist die Zuordnung der beiden<br />
Tudorf zum Gebiet des auch<br />
als „Restamt“ bezeichneten<br />
das schön restaurierte Heimathaus<br />
„Spissen“, ehemals<br />
Gaststätte „Roter Hirsch“. Die<br />
Hausstätte mitten im Dorf geht<br />
auf das 15./16. Jahrhundert<br />
zurück. In den Dörfern des Almetales<br />
sind bis heute bei vielen<br />
älteren Häusern eigenständige<br />
„Hausnamen“ üblich, die sich<br />
teilweise wie hier über Jahrhunderte<br />
im „Ortsvokabular“<br />
gehalten haben und heutzutage<br />
mancherorts leider aussterben.<br />
Der Name des Hauses „Spissen“<br />
erscheint erstmals im Jahre<br />
1642, als ein Mann mit dem<br />
Beinamen „Spissen“ mitten im<br />
dreißigjährigen Krieg – der das<br />
Paderborner und Bürener Land<br />
verwüstete und ganze Landstriche<br />
entvölkerte, vgl. nur die<br />
Schilderungen in Grimmelshausens<br />
Simplizissimus – das Haus<br />
erneuerte. Ein bekannter Sohn<br />
Niederntudorfs ist der dort im<br />
Jahre 1856 geboren Lehrer und<br />
Dichter Doktor Jakob Löwenberg<br />
(Loewenberg). Sein Vater<br />
Levi Löwenberg (1806-1876)<br />
gehörte zum westfälischen<br />
Landjudentum und arbeitete als<br />
Hausierer bzw. Klein- und Wanderhändler<br />
(Kiepenkerl). Bereits<br />
dessen Vater war im Jahre 1791<br />
nach Niederntudorf gekommen.<br />
Die Mutter Friederike (Friedchen)<br />
Löwenberg geborene<br />
Rosa (1812-1888) stammte aus<br />
Pömbsen (heute Ortsteil von<br />
Bad Driburg). In Niederntudorf<br />
lebten Anfang des 19. Jahrhunderts<br />
acht jüdische Familien,<br />
darunter auch die Familie des<br />
Bruders der Mutter. Im Jahre<br />
1868 zog die Familie Löwenberg<br />
nach Oberntudorf. Juden war<br />
es auch vor der Säkularisation<br />
des Fürstbistums Paderborn im<br />
Jahre 1802/03 gestattet, sich in<br />
der Region niederzulassen, was<br />
ihnen in anderen Fürstbistümern<br />
verboten war. Erst Anfang<br />
Amtes Wewelsburg erst mit der<br />
Etablierung der Bischöflichen<br />
Drostei nach 1589 rechtlich<br />
festgeschrieben worden. Zuvor<br />
scheinen die vom Kloster Böddeken<br />
eingesetzten Dorfrichter<br />
das bischöfliche „Schireikengogericht“<br />
– Gericht zwischen<br />
Salzkotten und Wewer – besucht<br />
zu haben. Im Laufe des 16.<br />
Jahrhunderts werden die beiden<br />
Dörfer weitgehend den Amtleuten<br />
der Wewelsburg unterstellt.<br />
Das Dorfrichteramt wird zum<br />
landesherrlichen Dienst mit<br />
zeitweiliger Steuerbefreiung.<br />
Das Patronatsrecht über die<br />
Oberntudorfer Kirche St.Georg,<br />
welches ursprünglich den Freiherrn<br />
von Büren zugestanden<br />
hatte, war seit 1394 auf die Familie<br />
von Brenken übertragen.<br />
Am 17. April 1585 erhielt der<br />
Pastor von Oberntudorf als Brenkenscher<br />
Meier den Halbscheid<br />
vom Hofe Werneken Salms zu<br />
Niederntudorf. Seit 1620 waren<br />
die Pfarreien von Obern- und<br />
Niederntudorf in Personalunion<br />
vereinigt, das Patronatsrecht<br />
wurde abwechselnd von der<br />
Familie von Brenken und vom<br />
Domprobst ausgeübt.<br />
Durch Arnold von Brenken ging<br />
dann das Patronatsrecht über<br />
beide Tudorfer Kirchen mit<br />
Vertrag vom 12. April 1670 an<br />
das Domkapitel von Paderborn<br />
über, in dessen Zuständigkeit<br />
es bis zur Auflösung des Domkapitels<br />
im Jahre 1810 blieb.<br />
Die Familie von Brenken erhielt<br />
im Wege des Tausches das<br />
des 19. Jahrhunderts wurden für<br />
sie Familiennamen üblich.<br />
Nach dem Besuch mehrerer<br />
Elementarschulen, z.B. ging er<br />
jahrelang zu Fuß anderthalb<br />
Stunden zur jüdischen Schule<br />
in Salzkotten, begann Jakob Löwenberg<br />
eine Ausbildung an der<br />
Marks Haindorf Stiftung (Marks<br />
Haindorf Lehrerbildungsanstalt)<br />
in Münster. Im Jahre 1873<br />
legte er die erste Elementarprüfung<br />
ab und unterrichtete<br />
fünf Jahre in Geseke, wo seine<br />
Familie bereits zwei Jahre lebte.<br />
Weitere Prüfungen und Studien,<br />
u.a. in Heidelberg folgten. eine<br />
staatliche Unterrichtstätigkeit<br />
war ihm möglich, weil mit<br />
der Gründung des deutschen<br />
Kaiserreiches im Jahre 1871 das<br />
für den norddeutschen Bund<br />
erlassene Emanzipationsgesetz<br />
in ganz Deutschland galt. Das<br />
Gesetz eröffnete Juden den<br />
Weg in den Polizei-, Schul- und<br />
Staatsdienst. Wegen der vorherrschenden<br />
Praxis, Juden bei<br />
der Vergabe dieser Ämter dennoch<br />
zu benachteiligen, konnte<br />
Löwenberg erst im Jahre 1886<br />
eine Festanstellung in Hamburg<br />
erhalten, wo er ein privates Lyzeum<br />
leitete und im Jahre 1929<br />
als geachteter Pädagoge starb.<br />
Seinen drei Kindern gelang es in<br />
die USA zu emigrieren, wohin<br />
mehrere Geschwister bereits im<br />
19. Jahrhundert ausgewandert<br />
waren.<br />
Die 2.700 Einwohner Gemeinde<br />
Niederntudorf hat Dr. Löwenberg<br />
durch eine nach ihm<br />
benannt Straße geehrt. Seine<br />
literarischen Werke wurden<br />
1933 verboten und verbrannt,<br />
danach weitgehend vergessen.<br />
Daher sei hier an sein Laterne<br />
Gedicht, trotz der Eingangszeile<br />
nicht zu verwechseln mit dem<br />
berühmten Kinderlied, erinnert<br />
Patronatsrecht über die Kirche<br />
im Ort Brenken.<br />
In einem Schreiben von 1592<br />
werden Georg Steinkuhle und<br />
Meinolf Siring als Schöffen<br />
in Oberntudorf erwähnt. Das<br />
Verzeichnis von 1672 erwähnt<br />
in Oberntudorf die beiden<br />
Vorsteher Johann Niernhöffer<br />
und Johann Smies, sowie den<br />
Richter Henrich Amptmeyer, der<br />
das Verzeichnis führte.<br />
Im Spätmittelalter vollzogen<br />
sich in Tudorf wesentliche<br />
Veränderungen. Zwischen 1455<br />
und 1479 gingen nahezu alle<br />
Höfe in fremde, zuvor unbekannte<br />
Hände über. Viele Namen<br />
verweisen auf den Herkunftsort,<br />
weisen die Neuen Hofinhaber<br />
als Zugezogene aus. Einige<br />
Hofesnamen überdauerten und<br />
gingen auf den neuen Bauern<br />
über. Es bleiben aber die westlichen<br />
Funktionsträger im Dorf:<br />
Der Pastor, der Richter und die<br />
beiden Vorsteher.<br />
2. Niederntudorf<br />
Niederntudorf liegt ca. 6,5 Kilometer<br />
südöstlich von Salzkotten<br />
am linken Talhang der Alme.<br />
Bereits in einer Urkunde der<br />
Äbtissin Ermgard von Böddeken<br />
vom 1. Mai 1278 wird zwischen<br />
Obern- und Niederntudorf –<br />
„Tudorf Superior“ und „Tudorf<br />
inferior“ – unterschieden. Die<br />
Augustiner die das Kloster<br />
Böddeken im 15. Jahrhundert<br />
neu gründeten, sicherten mit<br />
großem Erfolg den alten Grundbesitz<br />
des Klosters und erwarben<br />
und das Ende zitiert.<br />
„Laterne! Laterne! Sonne, Mond<br />
und Sterne! Meine Laterne<br />
brennt so schön! Morgen wollen<br />
wir wieder gehen“<br />
Zur weiterführenden Lektüre:<br />
Westfälisches Urkundenbuch<br />
(W U B) Bd. II, Nr.2<strong>01</strong>, Bd. IV,<br />
Nr. 646, Nr. 1509, Staatsarchiv<br />
Münster (STMS), Akte, Reichskammergericht,<br />
D 317,318 Bd.1<br />
und 2, Tönsmeyer, Josef, Amt<br />
Salzkotten, Tudorf, in: Stadt und<br />
Amt Salzkotten, hg. vom Amt<br />
Salzkotten – Boke, Redaktion<br />
Franziska Knoke, Franz Josef<br />
Ewers, Josef Bürger, Paderborn<br />
1970, S. 383-529, Lienen, Bruno<br />
H., Obern- und Niederntudorf<br />
S. 204f., 257, Finke, Wilhelm,<br />
Niederntudorf, in: 750 Jahre<br />
Stadt Salzkotten, Bd.1 S.451-<br />
482, 454ff., Henkel, Gerhard,<br />
Geschichte und Geographie<br />
des Kreises Büren, Paderborn<br />
1974, S. 202-204 eine gewisse<br />
Berühmtheit haben die Niederntudorfer<br />
Kleinpflastersteine<br />
AUSGABE JAnUAr 2<strong>01</strong>2<br />
neuen dazu. Es erfolgte eine<br />
stärkere Anbindung Tudorfs<br />
an das Kloster, das sich im<br />
Lohhof – Hof Hiebeln – einen<br />
Haupthof schuf („curia principalis<br />
et judicalis“), dessen Meier<br />
neben besonderen Pflichten,<br />
beispielsweise die Eintreibung<br />
der fälligen Abgaben, auch besondere<br />
Rechte verliehen waren.<br />
Er vertrat – u. a. beim Holting<br />
(Holzgericht) – den Prior von<br />
Böddeken, der im Holting als<br />
oberster Holzherr und Holzgraf<br />
grundsätzlich das Recht hatte,<br />
die Holzmark zu öffnen und zu<br />
schließen, das Holzgericht einzuberufen<br />
und die verhängten<br />
Strafen zu vollstrecken.<br />
Im Jahre 1384 hatte Bischof<br />
Simon II die Burg und Dynastie<br />
Wewelsburg mit Obern- und<br />
Niederntudorf –„cum parochiis<br />
Bodeken, Kerchberge, utriusque<br />
Tudorp“ von Simon von Büren<br />
und dessen Brüdern gekauft und<br />
an Friedrich von Brenken für<br />
424 Mark reinen Silbers verpfändet.<br />
Ende des 16. Jahrhunderts<br />
setzte sich das Domkapitel von<br />
Paderborn in beiden Tudorf als<br />
reichster Grundherr endgültig<br />
durch. Sein Lagerbuch vom 14.<br />
Oktober 1673 zählt 18 eigenbehörige<br />
Höfe und Kotten namentlich<br />
auf: Amtshof, Janberenshof,<br />
Tigges Stoppelen, Jost Thiele<br />
genannt Paggels, Meilf Klönner,<br />
Jürgen Tombroeke, Heinrich<br />
Stoppelen genannt Rötz, Johann<br />
Bellen, Johann Meyers genannt<br />
Ottenhans, Meilf Schuggenadel,<br />
Johann Klocken, Johann Didrich<br />
Prangen (Schweinehaus),<br />
Bei den Häusern innerhalb der Dörfer sind weitere Differenzierungen<br />
festzustellen. Von den 98 festgestellten Häusern<br />
in Tudorf hatten als Grundherren:<br />
Gesamt Oberntudorf Niederntudorf<br />
Kloster Böddeken 38 12 26<br />
Domkapitel Pb 32 12 20<br />
Von Brenken 10 7 3<br />
Bischof von Pb ? ? ?<br />
Damenstift Geseke 3 1 2<br />
Pfarrkirche OT 10 4 6<br />
Pfarrkirche NT 5 ? 5<br />
Zwar sind im Bedenregister (Abgabenregister) 107 zahlende<br />
Familien vermerkt, doch könnte es sich bei den neun fehlenden<br />
um Einliegerhaushalte handeln, die in den meisten<br />
Zählungen als vom Bauernhof Abhängige, auch dem Hof<br />
zugeordnet wurden.<br />
(Tudorfer Pflaster, z. B. in Deelen),<br />
ebd. S. 204.<br />
http.//www.niederntudorf.de/<br />
heimathaus.html, Jakob Löwenberg,<br />
Aus zwei Quellen, 1914<br />
Geschichte als Hobby:<br />
Stefan Voßschmidt<br />
Der Autor studierte Jura und Geschichte<br />
(Abschluss Magister Artium)<br />
und ist zur Zeit als Volljurist<br />
zum Bundesministerium des Innern<br />
abgeordnet. Sein Hobby ist die<br />
westfälische Geschichte.