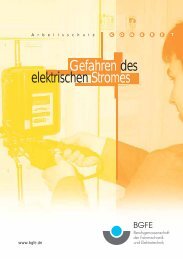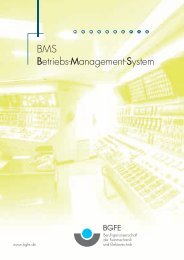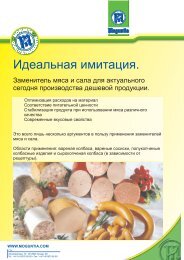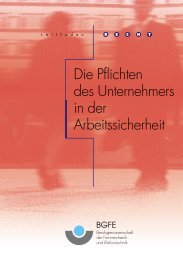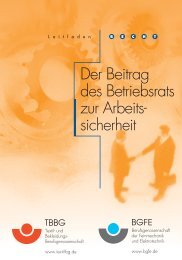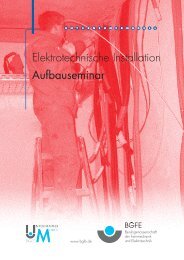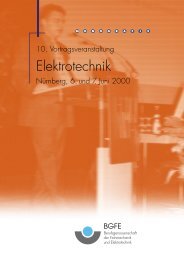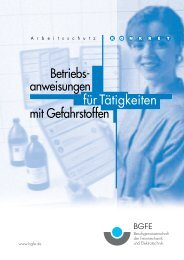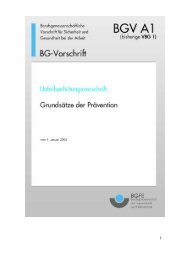Gefahrstoffe - M/S VisuCom GmbH
Gefahrstoffe - M/S VisuCom GmbH
Gefahrstoffe - M/S VisuCom GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Herausgeber:<br />
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik<br />
Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
6. Auflage 2006
SICHER ARBEITEN<br />
MIT GEFAHRSTOFFEN<br />
Dr. Andreas Doll<br />
Margret Böckler<br />
Peter E. Michels
2<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DER INHALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
1 Vorwort 5<br />
2 Verantwortung 6<br />
3 Was sind <strong>Gefahrstoffe</strong>? 8<br />
3.1 Erkennen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n 9<br />
3.2 Sicherheitsdatenblatt 13<br />
4 Aufnahmewege und Wirkungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n 18<br />
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 23<br />
5.1 Erfassen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n (Gefahrstoffverzeichnis) 25<br />
5.2 Freigabeverfahren 28<br />
5.3 Feststellung der Gefährdung 30<br />
5.4 Messungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n 31<br />
5.5 BG/BGIA-Empfehlungen 33<br />
5.6 Messverfahren 35<br />
5.7 Biomonitoring 40<br />
6 Übersicht über das Gefahrstoffrecht 41<br />
7 Schutzstufenkonzept nach der Gefahrstoffverordnung 45<br />
8 Schutzmaßnahmen 48<br />
8.1 Tätigkeiten mit geringer Gefährdung 48<br />
8.2 Grundmaßnahmen 51<br />
8.2.1 Substitution 51<br />
8.2.2 Rangordnung der Schutzmaßnahmen 57<br />
8.2.3 Technische Schutzmaßnahmen 58<br />
8.2.4 Organisatorische Schutzmaßnahmen 70<br />
8.2.5 Arbeitsmedizinische Vorsorge 78<br />
8.2.6 Persönliche Schutzausrüstung und Hygiene 82<br />
8.2.7 Hautschutz 92<br />
3
4<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Der Inhalt<br />
Anhang 1 Beispiele für Tätigkeiten mit geringer Gefährdung 98<br />
Anhang 2 Sicherheitstechnische Kenngrößen 100<br />
Anhang 3 Checkliste zu TRGS 400 105<br />
Anhang 4 Abkürzungen/Fachausdrücke/Fremdwörter 112<br />
Anhang 5 Literatur und Informationsmaterial 115
1 VORWORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
In vielen Lebensbereichen und besonders in der heutigen Arbeitswelt<br />
werden chemische Produkte in immer neuen Variationen eingesetzt.<br />
Die Palette der chemischen Verbindungen nimmt stetig zu.<br />
In den Mitgliedsbetrieben der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik<br />
und Elektrotechnik werden Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n in<br />
den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen wie z. B. beim Reinigen<br />
oder Entfetten, in der Metallbearbeitung und Oberflächenbehandlung,<br />
beim Schweißen, bei der Herstellung von Batterien oder bei<br />
der Instandhaltung von Maschinen und Anlagen durchgeführt. <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
können aber auch verfahrensbedingt entstehen.<br />
Dies muss natürlich auch Konsequenzen für den Arbeitsschutz im<br />
Betrieb haben.<br />
An die Beschäftigten, die Tätigkeiten mit „<strong>Gefahrstoffe</strong>n“ durchführen,<br />
werden daher erhöhte Anforderungen gestellt.<br />
Grundlage für die Sicherheit bei Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n ist<br />
das ausreichende „Wissen“ über die Wirkung und Gefährlichkeit<br />
von Stoffen sowie die zur Gefahrenabwehr erforderlichen Schutzmaßnahmen<br />
und Verhaltensregeln.<br />
Alle Vorgesetzten im Betrieb, besonders die „Meister vor Ort“, tragen<br />
hierfür in ihren Zuständigkeitsbereichen die Verantwortung.<br />
Eben hier soll die vorliegende Broschüre Hilfestellung bieten.<br />
Ziel soll es primär sein, dieser Personengruppe zu zeigen, wie Gefahrstoffprobleme<br />
im Betrieb systematisch und praktisch angegangen<br />
und gelöst werden können.<br />
5
6<br />
2 VERANTWORTUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Wie bereits aus anderen Bereichen bekannt, trägt der Vorgesetzte<br />
für die Sicherheit bei Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n in seinem Zuständigkeitsbereich<br />
die Verantwortung.<br />
Die Meister vor Ort sind hier besonders betroffen, da sie nichts<br />
oder nur unwesentliches von ihren Aufgaben, etwa auf andere<br />
Meisterbereiche, übertragen können.<br />
Es gibt also keine Entlastung durch Delegation. Die Verantwortung<br />
besteht für jeden Vorgesetzten zwangsläufig, es herrscht das „Gesetz<br />
der Unauflösbarkeit“.<br />
Vorgesetzte ohne Verantwortung gibt es nicht<br />
Aufgrund der vorliegenden Gesetzgebung muss der direkte Vorgesetzte<br />
seine Mitarbeiter vor Unfällen, aber auch vor berufsbedingten<br />
Erkrankungen, z. B. durch <strong>Gefahrstoffe</strong>inwirkungen, bewahren.<br />
In erster Linie muss der Unternehmer und natürlich jeder Vorgesetzte<br />
dafür Sorge tragen, dass die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften,<br />
vor allem:<br />
• die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“<br />
BGV A1<br />
• das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)<br />
• die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)<br />
• und die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit ihren speziellen<br />
Technischen Regeln für <strong>Gefahrstoffe</strong> (TRGS)<br />
im Betrieb umgesetzt und eingehalten werden.<br />
Damit dies auch dauerhaft gewährleistet ist, muss ein funktionierendes<br />
Arbeitsschutzmanagement-System eingeführt sein. Dies beginnt<br />
damit, dass Zuständigkeiten verbindlich geregelt und Pflich-
2 Verantwortung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
ten auf die Vorgesetzten möglichst schriftlich übertragen werden.<br />
Die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes gehört zu den<br />
Grundpflichten des Unternehmers und ist im vierten Kapitel der<br />
BGV A1 verankert.<br />
Die Sicherheitsorganisation beinhaltet in der Hauptsache die Bestellung<br />
von Fachkräften für Arbeitssicherheit, Betriebsärzten, Sicherheitsbeauftragten<br />
und die Sicherstellung der Ersten Hilfe.<br />
Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt unterstützen<br />
den Unternehmer bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen<br />
im Arbeitsschutz, u.a. bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.<br />
Dies ist besonders bei Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
der Fall, wenn der Unternehmer nicht selbst über entsprechende<br />
Kenntnisse verfügt.<br />
Damit alle Vorgesetzten im Betrieb ihrer Verantwortung gerecht<br />
werden können, muss der Informationsfluss durchgängig organisiert<br />
und die Sicherheitsorganisation für jeden Beschäftigten transparent<br />
sein.<br />
Insbesondere sollen sie die Funktionen von Sicherheitsfachkraft,<br />
Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragten und Betriebsrat kennen, nutzen<br />
und schätzen lernen. Nicht zuletzt bieten auch die Berufsgenossenschaften<br />
umfangreiche Hilfestellung an.<br />
Keinesfalls sollte ein Vorgesetzter „vorschnelle“ Entscheidungen<br />
treffen, also z. B. Beschäftigte ohne besondere Kenntnisse mit einem<br />
Gefahrstoff umgehen lassen. Denn der vielleicht zunächst gewonnene<br />
Zeitvorteil kann sehr schnell in haftungsrechtliche Konsequenzen,<br />
d. h. Geldbuße, Freiheitsstrafe, Regress o. ä. umschlagen.<br />
7
8<br />
3 WAS SIND GEFAHRSTOFFE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Will ein Vorgesetzter der im vorgenannten Abschnitt geschilderten<br />
Verantwortung gerecht werden, muss er wissen, was überhaupt<br />
ein Gefahrstoff ist.<br />
Ein Stoff, eine Zubereitung oder ein Erzeugnis ist immer dann ein<br />
Gefahrstoff, wenn bestimmte gefährliche Eigenschaften vorliegen<br />
(§19 Abs. 2 und § 3a Abs.1 Chemikaliengesetz).<br />
Danach sind <strong>Gefahrstoffe</strong>:<br />
1. Gefährliche Stoffe und Zubereitungen mit gefährlichen Eigenschaften<br />
wie:<br />
• explosionsgefährlich<br />
• brandfördernd<br />
• hochentzündlich<br />
• leichtentzündlich<br />
• entzündlich<br />
• sehr giftig<br />
• giftig<br />
• gesundheitsschädlich<br />
• ätzend<br />
• reizend<br />
• sensibilisierend<br />
• Krebs erzeugend<br />
• fortpflanzungsgefährdend<br />
• Erbgut verändernd<br />
• umweltgefährlich.<br />
2. Explosionsfähige Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse.<br />
Explosionsfähig sind beispielsweise Stäube brennbarer Stoffe,<br />
wenn eine ausreichende Konzentration davon in der Luft vorhanden<br />
und die Teilchengröße klein genug ist. Organische,
3 Was sind <strong>Gefahrstoffe</strong>?<br />
3.1 Erkennen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
natürliche Stäube von Kohle oder Holz bzw. anorganische<br />
Stäube von Aluminium oder Zink sind typische brennbare und<br />
explosionsfähige Stoffe.<br />
3. Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, aus denen bei der Herstellung<br />
oder Verwendung Stoffe oder Zubereitungen nach der<br />
Nummer 1 oder 2 entstehen oder freigesetzt werden können.<br />
Es kann sich z. B. um freiwerdende Rauche und Gase bei der<br />
Verwendung von basischumhüllten Schweißelektroden, Dämpfe<br />
und Aerosole bei der Verwendung von Kühlschmierstoffen oder<br />
künstliche Mineralfasern kritischer Abmessungen bei der Verwendung<br />
von Mineralwolle-Dämmstoffen handeln.<br />
4. Sonstige gefährliche chemische Arbeitsstoffe<br />
Hierbei sind die Gefahren durch physikalisch-chemische Eigenschaften<br />
der Stoffe zu berücksichtigen. Tätigkeiten mit heißer<br />
Luft oder Wasserdampf sowie Arbeiten in sauerstoffreduzierten<br />
Räumen fallen somit unter diese Definition.<br />
In den folgenden Abschnitten werden Gefahren und Schutzmaßnahmen<br />
bei Tätigkeiten mit brand- und explosionsgefährlichen<br />
Stoffen nicht näher ausgeführt, da die Meisterbroschüre MB 24<br />
„Sicherheit durch Brand und Explosionsschutz“ hierzu umfangreiche<br />
Hinweise enthält.<br />
3.1 Erkennen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
Den ersten Hinweis darauf, dass es sich um einen Gefahrstoff handelt,<br />
welche gefährlichen Eigenschaften dieser besitzt, welche Gefahren<br />
auftreten können und welche Schutzmaßnahmen erforderlich<br />
sind, erhält der Unternehmer aus der Kennzeichnung.<br />
9
10<br />
3 Was sind <strong>Gefahrstoffe</strong>?<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Erkennen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
Der Inverkehrbringer hat gefährliche Stoffe und Zubereitungen<br />
gemäß § 5 GefStoffV einzustufen und entsprechend der Einstufung<br />
zu verpacken und zu kennzeichnen.<br />
Gefahrensymbole und Gefahrenbezeichnungen (Abbildung 1)<br />
machen auf die Hauptgefahren aufmerksam.<br />
E O<br />
Explosionsgefährlich Brandfördernd<br />
F+ F<br />
Hochentzündlich Leichtentzündlich<br />
T+ T<br />
Sehr giftig Giftig<br />
C Xi<br />
Ätzend Reizend<br />
Xn N<br />
Gesundheitsschädlich Umweltgefährlich<br />
Abb. 1: Gefahrensymbole und Gefahrenbezeichnungen nach Gefahrstoffverordnung in<br />
Verbindung mit Anhang II, Richtlinie 67/548/EWG
3 Was sind <strong>Gefahrstoffe</strong>?<br />
3.1 Erkennen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Standardisierte Hinweise auf besondere Gefahren (Risiken) geben<br />
die sogenannten R-Sätze.<br />
Über den R-Satz erfährt der Anwender z. B., unter welchen Bedingungen<br />
und in welcher Weise der Stoff gefährlich sein kann.<br />
Die R-Sätze sind über die Richtlinie 67/548/EWG europaweit<br />
verbindlich festgelegt.<br />
So sind beispielsweise giftige Stoffe und Zubereitungen mit den R-<br />
Sätzen R 23, R 24, R 25, R 39, R 48, R 54, R 55, R 56, R 57 und<br />
R 58 zu kennzeichnen:<br />
•<br />
•<br />
R 23 giftig beim Einatmen<br />
R 24 giftig bei Berührung mit der Haut<br />
R 25 giftig beim Verschlucken<br />
R 39 ernste Gefahr irreversiblen Schadens<br />
R 48 Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.<br />
R 54 giftig für Pflanzen<br />
R 55 giftig für Tiere<br />
R 56 giftig für Bodenorganismen<br />
R 57 giftig für Bienen<br />
R 58 kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt<br />
haben.<br />
Es gibt aber auch so genannte Kombinations-R-Sätze, z.B. R 48/<br />
23/24/25 giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer<br />
Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch<br />
Verschlucken.<br />
Die wichtigsten Schutzmaßnahmen beschreiben die sogenannten<br />
S-Sätze (Sicherheitsratschläge). Auch diese sind europaweit standardisiert.<br />
11
12<br />
3 Was sind <strong>Gefahrstoffe</strong>?<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Erkennen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
Ein Beispiel für die ordnungsgemäße Kennzeichnung eines Behälters<br />
mit ätzender Salzsäure zeigt Abbildung 2.<br />
Gefahrensymbol und Gefahrenbezeichnung<br />
C<br />
Ätzend<br />
Salzsäure<br />
(30%-ig)<br />
Hinweise auf besondere Gefahren<br />
Verursacht schwere Verätzungen<br />
Reizt die Augen und die Atmungsorgane<br />
Sicherheitsratschläge<br />
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich<br />
aufbewahren<br />
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich<br />
mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen<br />
Bei Unfall und Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen<br />
Fa. Mustermann, Rheinufer 130, 53450 Köln<br />
Telefon 0211 3778 999, Telefax: 0211 3778 395<br />
231 - 595 - 7 EG-Kennzeichnung<br />
Bezeichnung<br />
des Stoffes<br />
R-Sätze<br />
S-Sätze<br />
Hersteller<br />
Anschrift/Tel.<br />
EG-Nr. mit<br />
Vermerk<br />
Abb. 2: Kennzeichnung eines Säurebehälters nach Gefahrstoffverordnung
3 Was sind <strong>Gefahrstoffe</strong>?<br />
3.2 Sicherheitsdatenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3.2 Sicherheitsdatenblatt<br />
Weitere Informationen erhält der Anwender durch das Sicherheitsdatenblatt.<br />
Nach § 6 Abs.1 GefStoffV muss der Inverkehrbringer<br />
den Abnehmern spätestens bei der ersten Lieferung ein Sicherheitsdatenblatt<br />
nach der Richtlinie 91/155/EWG übermitteln (Abbildung<br />
3a und 3b).<br />
Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält folgende Angaben (siehe<br />
auch TRGS 220 „Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und<br />
Zubereitungen“):<br />
11. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung<br />
12. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen<br />
13. Mögliche Gefahren<br />
14. Erste-Hilfe-Maßnahmen<br />
15. Maßnahmen zur Brandbekämpfung<br />
16. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung<br />
17. Handhabung und Lagerung<br />
18. Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstungen<br />
19. Physikalische und chemische Eigenschaften<br />
10. Stabilität und Reaktivität<br />
11. Angaben zur Toxikologie<br />
12. Angaben zur Ökologie<br />
13. Hinweise zur Entsorgung<br />
14. Angaben zum Transport<br />
15. Vorschriften<br />
16. Sonstige Angaben<br />
Damit stehen dem Verwender bereits recht umfassende Informationen<br />
über den Gefahrstoff zur Verfügung, nach denen er unter<br />
Berücksichtigung der speziellen betrieblichen Verhältnisse die<br />
wichtigsten Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz konzipieren kann.<br />
13
14<br />
Sicherheitsdatenblatt<br />
Sicherheitsdatenblatt für chemische Stoffe und Zubereitungen<br />
gemäß 91/ 155 / EWG<br />
Druckdatum: überarbeitet am: Seite 1/8<br />
1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung<br />
1.1 Angaben zum Produkt<br />
Handelsname<br />
1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten<br />
Hersteller/Lieferant<br />
Straße/Postfach<br />
Nat.-Kennz./PLZ/Ort<br />
Telefon Telefax<br />
Auskunftgebender Bereich Telefon<br />
Notfallauskunft Notfallnummer<br />
2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen<br />
2.1 Chemische Charakterisierung<br />
CAS-Nr. Bezeichnung nach EG-Richtlinie Kennb. R-Sätze<br />
R<br />
Identifikationsnummer(n)<br />
Chemische Charakterisierung<br />
(Zubereitung)<br />
2.2 Gefährliche Inhaltsstoffe<br />
CAS-Nr.<br />
zusätzliche<br />
Hinweise:<br />
Bezeichnung nach EG-Richtlinie Gehalt Einheit Kennb. R-Sätze<br />
R<br />
R<br />
R<br />
R<br />
R<br />
R<br />
3. Mögliche Gefahren<br />
Gefahrenbezeichnung<br />
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt<br />
Abb. 3a: Auszug (Seite 1) aus dem Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt für chemische Stoffe und Zubereitungen<br />
gemäß 91/ 155 / EWG<br />
Druckdatum: überarbeitet am: Seite 2/8<br />
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen<br />
Allgemeine Hinweise<br />
nach Einatmen<br />
nach Hautkontakt<br />
nach Augenkontakt<br />
nach Verschlucken<br />
Hinweise für den Arzt<br />
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung<br />
geeignete Löschmittel<br />
aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel<br />
Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder<br />
entstehende Gase<br />
Besondere Schutzausrüstung<br />
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung<br />
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen<br />
Abb. 3b: Auszug (Seite 2) aus dem Sicherheitsdatenblatt<br />
15
16<br />
3 Was sind <strong>Gefahrstoffe</strong>?<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Sicherheitsdatenblatt<br />
Der Kennzeichnung und dem Sicherheitsdatenblatt kann der Unternehmer<br />
grundsätzlich vertrauen. Leider weisen auch heute noch<br />
etliche Sicherheitsdatenblätter inhaltliche Mängel auf oder liefern<br />
unzureichende Informationen. Von daher verpflichtet die Gefahrstoffverordnung<br />
den Inverkehrbringer ausdrücklich, dass das Sicherheitsdatenblatt<br />
von einer fachkundigen Person erstellt wird<br />
und fachlich richtig und vollständig ausgefüllt ist.<br />
Verharmlosende Angaben, wie z. B. nicht giftig, nicht gesundheitsschädlich,<br />
nicht kennzeichnungspflichtig, dürfen Verpackung,<br />
Kennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt nicht enthalten. Sicherheitsdatenblätter,<br />
die derartige Hinweise enthalten oder unvollständig<br />
ausgefüllt sind, sollten grundsätzlich nicht akzeptiert und<br />
an den Hersteller zurückgeschickt werden.<br />
Auch Produktinformationen, technische Merkblätter oder Verarbeitungshinweise<br />
des Herstellers enthalten mehr oder weniger deutlich<br />
Hinweise zum Arbeitsschutz, da dort in der Regel angegeben<br />
wird, wie mit dem Produkt bestimmungsgemäß umzugehen ist.<br />
Soll beispielsweise ein Tauchlack als Spritzlack verwendet werden,<br />
erfordert dies die Zugabe einer Verdünnung. Die Produktinformation<br />
gibt daher genau an, welche Zubereitungen in welcher<br />
Menge dem Tauchlack zugegeben werden müssen, um ihn als<br />
Spritzlack zu verwenden.<br />
Wird aber ein Arbeitsstoff eingesetzt, der nicht kennzeichnungspflichtig<br />
ist, bleiben Zweifel. Auch in diesem Fall muss der Unternehmer<br />
prüfen, ob bei der vorgesehenen Tätigkeit stoffbedingte<br />
Gefahren, also <strong>Gefahrstoffe</strong> bei der Verwendung oder im Fertigungsprozess<br />
freigesetzt werden können. Erforderlichenfalls muss<br />
er sich hierzu fachlich beraten lassen (z. B. vom Hersteller).
3 Was sind <strong>Gefahrstoffe</strong>?<br />
3.2 Sicherheitsdatenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Bei der Bearbeitung (Sägen, Schleifen, Fräsen etc.) von Buchenund<br />
Eichenholz werden beispielsweise Holzstäube freigesetzt, die<br />
als eindeutig Krebs erzeugend eingestuft sind, obwohl das Ausgangsmaterial<br />
solche Eigenschaften nicht aufweist (Abbildung 4).<br />
Aber auch bei der Anwendung<br />
eines nicht kennzeichnungspflichtigen<br />
wassergemischten Kühlschmierstoffes<br />
können während<br />
der Einsatzzeit Krebs erzeugende<br />
Nitrosamine entstehen, wenn<br />
bestimmte Auswahlkriterien bzw.<br />
Pflegemaßnahmen nicht beachtet<br />
werden.<br />
Verbleiben trotzdem noch Ungewissheiten<br />
über die Gefährdung<br />
durch <strong>Gefahrstoffe</strong>, sollte der<br />
Unternehmer eine konkrete Anfrage<br />
beim Hersteller stellen.<br />
Abb. 4: Freisetzung von Holzstäuben bei der Holzbearbeitung<br />
17
18<br />
4 AUFNAHMEWEGE UND WIRKUNGEN VON<br />
GEFAHRSTOFFEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Die Aufnahme von <strong>Gefahrstoffe</strong>n in den menschlichen Körper wird<br />
hauptsächlich von der physikalischen Erscheinungsform des Stoffes<br />
bestimmt. Nach der physikalischen Erscheinungsform wird unterschieden<br />
in Gase, Dämpfe, Schwebstoffe, Flüssigkeiten und<br />
Feststoffe, wobei die Erscheinungsform eines Stoffes wiederum<br />
von physikalischen Größen wie Temperatur und Dampfdruck oder<br />
mechanischen Bearbeitungsvorgängen wie Mahlen, Schleifen<br />
oder Schweißen abhängt (Abbildung 5).<br />
Physikalische Erscheinungsformen<br />
von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
Gase Dämpfe Flüssigkeiten Feststoffe<br />
Aerosole<br />
Abb. 5: Physikalische Erscheinungsformen von Stoffen
4 Aufnahmewege und Wirkungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Zu einer Gefährdung der Gesundheit kann es erst kommen, wenn<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong> in den Körper aufgenommen werden.<br />
Dabei werden drei Aufnahmewege unterschieden (Abbildung 6):<br />
•<br />
Inhalation (Einatmen)<br />
Resorption durch die (unverletzte) Haut<br />
orale Aufnahme (Verschlucken)<br />
Physikalische Erscheinungsformen<br />
von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
Aerosole<br />
Nebel Rauche Stäube<br />
19
20<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aufnahmewege und Wirkungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
Abb. 6: Aufnahme von <strong>Gefahrstoffe</strong>n in den menschlichen Körper<br />
Dem Einatmen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n kommt im industriellen Bereich<br />
die größte Bedeutung zu.<br />
Die Haut ist der zweitwichtigste Eintrittspfad für <strong>Gefahrstoffe</strong> in<br />
den menschlichen Körper. Hautresorptive Stoffe sind besonders<br />
kritisch zu betrachten, da sie oft unbemerkt über die unverletzte
4 Aufnahmewege und Wirkungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Haut in den Körper gelangen und entscheidend zur inneren Exposition<br />
beitragen können.<br />
Solche Stoffe sind daher in der TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“<br />
mit einem „H“ (z. B. Xylol als Lösemittel in Anstrichstoffen)<br />
oder mit den R-Sätzen (R 21, R 24, R 27 oder entsprechende Kombinationssätze<br />
R 21/22 oder R 48/21) gekennzeichnet.<br />
Das Verschlucken von <strong>Gefahrstoffe</strong>n steht am Arbeitsplatz zwar<br />
nicht im Vordergrund, es kann aber trotzdem zu einer zusätzlichen<br />
Belastung kommen. Dies erfolgt dann, wenn Aerosole im<br />
Mund- und Rachenraum abgeschieden werden und mit Hilfe des<br />
natürlichen Reinigungsmechanismus durch Verschlucken in den<br />
Verdauungstrakt gelangen und dort ggf. wirksam werden.<br />
Gesundheitsgefährdende Mengen an <strong>Gefahrstoffe</strong>n können auch in<br />
den Magen-Darm-Trakt gelangen, wenn Ess-, Trink- und Rauchverbote<br />
in Arbeitsbereichen nicht beachtet werden, oder wenn <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
unsachgemäß in Behältnissen für Lebensmittel aufbewahrt werden<br />
(z. B. Reinigungsverdünnung in einer Mineralwasserflasche).<br />
Die gesundheitsschädigende Wirkung eines Stoffes ist abhängig von:<br />
• der Menge (Dosis)<br />
• den spezifischen Eigenschaften und<br />
• der individuellen Empfindlichkeit (Vergiftungen laufen beim Einzelnen<br />
unterschiedlich ab)<br />
Dabei wird zwischen akuten und chronischen Vergiftungen unterschieden.<br />
Im Allgemeinen führen hohe Einzeldosen zu akuten Vergiftungen,<br />
während chronische Vergiftungen durch die Einwirkung dauernd<br />
wiederholter, kleinerer Mengen verursacht werden.<br />
21
22<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aufnahmewege und Wirkungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
Bei einigen Stoffen liegt zwischen dem Zeitpunkt der Stoffaufnahme<br />
und dem Ausbruch einer Erkrankung eine beschwerdefreie Latenzzeit.<br />
Diese kann sich über Stunden (z. B. Stickoxidvergiftung beim<br />
Einsatz eines Autogenbrenners in kleinen Räumen), aber auch Tage<br />
oder Jahre (Silikose beim Abbau von Kohle) erstrecken.<br />
Im Verlauf einer chronischen Schadstoffaufnahme (z. B. Bleistaub<br />
bei der Herstellung von Akkumulatoren) kann sich der Stoff im Körper<br />
ansammeln (kumulieren) und nach Beendigung der Aufnahme<br />
entweder rasch, langsam oder gar nicht ausgeschieden werden.<br />
Allergische Reaktionen spielen bei den Wirkungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
auf die Haut oder das Atemsystem eine Rolle.<br />
Als Allergie versteht man eine im Laufe des Lebens erworbene<br />
Überempfindlichkeit gegenüber körperfremden Stoffen, die auf einer<br />
Antigen-Antikörper-Reaktion beruht und verschiedene Krankheitszeichen<br />
an der Haut (z. B. allergisches Kontaktekzem bei<br />
Tätigkeiten mit Methylmethacrylat in Dentallabors) oder an den<br />
Schleimhäuten (z. B. Isocyanatasthma bei der Verarbeitung von<br />
unausgehärteten Polyurethanen) zeigen.<br />
Neben allergischen Hauterkrankungen treten verstärkt Abnutzungsdermatosen,<br />
in der Regel an den Händen auf. Diese sind<br />
u. a. auf ständigen, wiederholten und langjährigen Kontakt mit<br />
Haut gefährdenden Stoffen oder Zubereitungen (Lösemittel, Kühlschmierstoffe,<br />
Laugen etc.) zurückzuführen.<br />
Manche Stoffe können zur Entartung von Zellen führen und bösartige<br />
Geschwülste verursachen. Über die Entstehungsmechanismen<br />
von Tumoren durch Krebs erzeugende Stoffe liegen nach wie vor unzureichende<br />
Erkenntnisse vor, so dass nach Möglichkeit im Betrieb<br />
derartige Stoffe und Zubereitungen nicht eingesetzt werden sollten.
5 INFORMATIONSERMITTLUNG UND<br />
GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Der Unternehmer ist verpflichtet festzustellen, ob Beschäftigte Tätigkeiten<br />
mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n durchführen oder ob <strong>Gefahrstoffe</strong> bei<br />
diesen Tätigkeiten entstehen bzw. freigesetzt werden.<br />
Ist dies der Fall, so hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen<br />
für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten unter folgenden<br />
Gesichtspunkten zu beurteilen:<br />
1. gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Zubereitungen,<br />
2. Informationen des Herstellers oder Inverkehrbringers zum Gesundheitsschutz<br />
und zur Sicherheit insbesondere im Sicherheitsdatenblatt,<br />
3. Ausmaß, Art und Dauer der Exposition unter Berücksichtigung<br />
aller Expositionswege,<br />
4. physikalisch-chemische Wirkungen (z.B. Brand- und Explosionsverhalten),<br />
5. Möglichkeiten einer Substitution von Stoffen oder Verfahren,<br />
6. Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der Arbeitsmittel<br />
und der Gefahrstoffmenge,<br />
7. Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte,<br />
8. Wirksamkeit der getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen,<br />
9. Schlussfolgerungen aus durchgeführten arbeitsmedizinischen<br />
Vorsorgeuntersuchungen.<br />
Dabei müssen bestehende Herstellungs- und Verwendungsverbote<br />
sowie die Beschäftigungsverbote und -beschränkungen nach § 18<br />
GefStoffV sowie des Anhanges IV beachtet werden.<br />
Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung für bestimmte Tätigkeiten<br />
aufgrund<br />
1. der Arbeitsbedingungen,<br />
2. einer nur geringen verwendeten Stoffmenge und<br />
3. einer nach Höhe und Dauer niedrigen Exposition<br />
23
24<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
insgesamt eine nur geringe Gefährdung der Beschäftigten und reichen<br />
die nach § 8 Abs.1 bis 8 GefStoffV ergriffenen Maßnahmen<br />
zum Schutz der Beschäftigten aus, so müssen keine weiteren Maßnahmen<br />
getroffen werden (Schutzstufe 1).<br />
Für die im Betrieb verwendeten Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse<br />
muss hier also für die jeweilige Tätigkeit ermittelt werden,<br />
welche Gefahren auftreten und welche Schutzmaßnahmen erforderlich<br />
sind. Die Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren,<br />
darin ist auch anzugeben, wie die Wirksamkeitskontrolle erfolgt.<br />
Wichtig ist, dass der Unternehmer unabhängig von der Zahl der<br />
Beschäftigten eine Tätigkeit mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n erst aufnehmen lassen<br />
darf, nachdem eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen<br />
wurde und die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden.<br />
Der Unternehmer kann die Gefährdungsbeurteilung entweder<br />
selbst oder von Fachkundigen erstellen lassen. Die Fachkraft für<br />
Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt werden in der Verordnung<br />
explizit als fachkundige Personen genannt.<br />
Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Hersteller von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
eine Gefährdungsbeurteilung mitliefert, die dann vom Betrieb<br />
übernommen werden kann. Hält sich der Betrieb an die dort<br />
beschriebenen Vorgaben, benötigt er keine eigene Gefährdungsbeurteilung<br />
für diese Tätigkeit.<br />
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind Gefährdungen durch<br />
physikalisch-chemische Eigenschaften, insbesondere durch Brandund<br />
Explosionsgefahren, sowie durch besondere und toxische Eigenschaften<br />
der Stoffe zu unterscheiden und zu bewerten.
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
5.1 Erfassen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n (Gefahrstoffverzeichnis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Hilfestellung liefern die TRGS 400 „Ermitteln und Beurteilen der<br />
Gefährdungen durch <strong>Gefahrstoffe</strong> am Arbeitsplatz: Anforderung“<br />
und die TRGS 440 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen<br />
durch <strong>Gefahrstoffe</strong> am Arbeitsplatz: Ermitteln von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
mit Methoden zur Ersatzstoffprüfung“. Weitere Hinweise erhält<br />
der Anwender aus der Handlungshilfe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz<br />
und Arbeitsmedizin für die Anwendung der GefStoffV<br />
in Klein- und Mittelbetrieben bei <strong>Gefahrstoffe</strong>n ohne Arbeitsplatzgrenzwert<br />
(einfaches Maßnahmenkonzept).<br />
5.1 Erfassen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n (Gefahrstoffverzeichnis)<br />
Der Unternehmer ist verpflichtet, die <strong>Gefahrstoffe</strong>, mit denen im<br />
Betrieb Tätigkeiten ausgeführt werden in einem Verzeichnis zu erfassen<br />
(§ 7 Abs. 8 GefStoffV). Auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter<br />
ist hinzuweisen.<br />
Das Gefahrstoffverzeichnis ist eine Aufstellung der <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
aus den einzelnen Arbeitsbereichen eines Betriebes sowie jener<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong>, die beim Fertigungs- oder Produktionsablauf entstehen<br />
können. Das Gefahrstoffverzeichnis sollte folgende Angaben<br />
enthalten:<br />
1. Bezeichnung des <strong>Gefahrstoffe</strong>s,<br />
2. Einstufung des <strong>Gefahrstoffe</strong>s oder Angabe der gefährlichen Eigenschaften,<br />
3. Mengenbereiche des <strong>Gefahrstoffe</strong>s im Betrieb,<br />
4. Arbeitsbereiche.<br />
Es hat den Zweck, einen Überblick über die im Betrieb hergestellten,<br />
verwendeten und freigesetzten <strong>Gefahrstoffe</strong> zu geben. Das<br />
Verzeichnis muss allen betroffenen Beschäftigten und ihren Vertre-<br />
25
26<br />
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Erfassen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n (Gefahrstoffverzeichnis)<br />
tern zugänglich sein und ist auf dem aktuellen Stand zu halten.<br />
Dabei sollte sichergestellt werden, dass Informationen über diejenigen<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong>, die bislang im Betrieb eingesetzt wurden,<br />
nicht verloren gehen, um bei späteren Erkrankungen von Beschäftigten<br />
recherchieren zu können, mit welchen <strong>Gefahrstoffe</strong>n zum<br />
Zeitpunkt der Beschäftigung Tätigkeiten ausgeführt wurden. Hierzu<br />
empfiehlt sich, im Verzeichnis eine zusätzliche Spalte für den<br />
Verwendungszeitraum bzw. für die Einsatzdauer vorzusehen.<br />
Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung, dass Tätigkeiten nur<br />
zu einer geringen Gefährdung der Beschäftigten führen, kann auf<br />
das Verzeichnis verzichtet werden.<br />
Einen Auszug aus einem betrieblichen Gefahrstoffverzeichnis<br />
zeigt Abbildung 7.<br />
Die Angaben im Gefahrstoffverzeichnis beziehen sich immer auf<br />
einen Arbeitsbereich. Sofern es wegen der Größe eines Betriebes<br />
oder aufgrund ähnlicher Fertigungsbereiche zweckmäßig erscheint,<br />
kann der Gefahrstoff eines Arbeitsbereiches einem übergeordneten<br />
Teilbereich (z.B. Lackiererei mit Arbeitsbereichen wie Spritzlackieren,<br />
Bereich Airlessverfahren) oder dem gesamten Betrieb<br />
(Blei in der Akkufertigung) zugeordnet werden.<br />
Betriebe, die Anlagen für elektrolytische und chemische Oberflächenbehandlung<br />
betreiben, können Muster-Gefahrstoffverzeichnisse<br />
für die Verfahren und das Lager bei unserer Berufsgenossenschaft<br />
anfordern (Bestell-Nr. S 15).<br />
Aus vielen Betrieben wird berichtet, dass beim Erstellen des Gefahrstoffverzeichnisses<br />
etliche Arbeitsstoffe vorgefunden werden,<br />
die nicht mehr eingesetzt bzw. benötigt werden. Diese Arbeitsstoffe<br />
wurden ordnungsgemäß entsorgt. Damit konnte die Anzahl<br />
der <strong>Gefahrstoffe</strong> im jeweiligen Arbeitsbereich verringert werden.
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
5.1 Erfassen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n (Gefahrstoffverzeichnis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Nr.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Bezeichnung<br />
des <strong>Gefahrstoffe</strong>s<br />
Schwefelsäure<br />
80 %-ig<br />
PUR-Decklack<br />
(1,5 % Diphenylmethan-<br />
4,4-diisocyanat)<br />
Kaltreiniger XB<br />
IT-Dichtungen<br />
200<br />
Holzstaub<br />
Dieselmotoremissionen<br />
Einstufung<br />
oder gef.<br />
Eigenschaften<br />
ätzend<br />
R:35<br />
S: 26-30-45<br />
gesundheitsschädlich<br />
R:42<br />
S: 26-28-38-45<br />
gesundheitsschädlich<br />
R:20<br />
S: 23-24/<br />
25-36/37<br />
asbesthaltig<br />
Krebs erzeugend<br />
Kategorie 3<br />
Krebs erzeugend<br />
Kategorie 2<br />
Mengenbereiche<br />
im Betrieb<br />
3000 kg<br />
500 kg<br />
100 kg<br />
10 Stück<br />
Weiterhin stellte sich heraus, dass für gleiche Tätigkeiten in verschiedenen<br />
Arbeitsbereichen unterschiedliche Produkte (z.B. Reinigungsmittel<br />
für die Metallentfettung) eingesetzt wurden. Setzt<br />
–<br />
2 Stapler<br />
Abb. 7: Auszug aus einem betrieblichen Gefahrstoffverzeichnis<br />
Arbeitsbereiche<br />
Galvanik<br />
Lackiererei<br />
Werkstatt<br />
Neutralisation<br />
Schreinerei<br />
Verladehalle<br />
Zeitraum<br />
des<br />
Einsatzes<br />
seit 1985<br />
seit 1986<br />
seit 2003<br />
1984–1994<br />
seit 1986<br />
seit 1998<br />
27
28<br />
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Freigabeverfahren<br />
man zukünftig dafür nur ein geeignetes Produkt ein, so kann dies<br />
oftmals zur Verringerung der Kosten und zur Reduzierung der Anzahl<br />
der <strong>Gefahrstoffe</strong> und der damit verbundenen Pflichten des<br />
Unternehmers nach der Gefahrstoffverordnung führen.<br />
5.2 Freigabeverfahren<br />
In einigen Betrieben hat sich ein so genanntes Freigabeverfahren<br />
für Arbeitsstoffe (innerbetriebliches Melde-, Prüf- und Zulassungsverfahren)<br />
bewährt.<br />
Danach darf ein Arbeitsstoff erst beschafft werden, wenn das Produkt<br />
durch den Betriebsarzt, die Sicherheitsfachkraft, und ggf.<br />
dem Abfall- und Gefahrgutbeauftragten freigegeben wurde.<br />
Soll ein anderer, neuer Arbeitsstoff in dem Arbeitsprozess eingesetzt<br />
werden, muss dazu zunächst ein Anforderungsschein (Bedarfsmeldung)<br />
ausgefüllt werden. Stimmt der Vorgesetzte diesem<br />
Bedarf zu, wird geprüft, ob bereits eine Produktinformation und<br />
ein Sicherheitsdatenblatt für diesen Arbeitsstoff im Betrieb vorliegen<br />
bzw. ob dieser bereits vom Betrieb für den Einsatz freigegeben<br />
wurde. Ist dies nicht der Fall, werden die notwendigen Informationen<br />
beschafft und dem Betriebsarzt sowie der Sicherheitsfachkraft<br />
zur Bewertung vorgelegt. Danach wird der Arbeitsstoff<br />
entweder für den Betrieb zugelassen oder mit eingehender Begründung<br />
abgelehnt.<br />
Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass alle notwendigen sicherheitstechnischen<br />
Daten über den Arbeitsstoff vorliegen und diese<br />
übergreifend für den betrieblichen Arbeitsschutz genutzt werden<br />
können.
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
5.2 Freigabeverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Vom Unternehmer muss jedoch festgelegt werden, wer innerbetrieblich<br />
die erforderlichen Informationen beschafft und wo diese<br />
aufbewahrt bzw. verwaltet werden. Abbildung 8 zeigt ein Ablaufschema<br />
für das Freigabeverfahren.<br />
Bedarf festlegen<br />
Vorgaben des Planungs-,<br />
Entwicklungs- und Investitionsprozess<br />
Kann die Tätigkeit<br />
mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n vermieden<br />
werden?<br />
nein<br />
Angabe der technischen<br />
Bedingungen für den sicheren Einsatz<br />
der Arbeitsstoffe<br />
Beschaffen von Angeboten einschließlich<br />
notwendiger Stoffdatenblätter<br />
Prüfung durch betriebliche Freigabestelle:<br />
• Verfahren ohne Tätigkeiten mit<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
• Auswahl des Stoffes mit dem<br />
geringsten Gefährdungspotenzial<br />
• Gefährdungsbeurteilung<br />
• Festlegung der Schutzmaßnahmen<br />
• Dokumentation<br />
Werden alle<br />
erforderlichen Schutzmaßnahmen<br />
erfüllt?<br />
ja<br />
Freigabe des <strong>Gefahrstoffe</strong>insatzes im<br />
Betrieb, mit Angabe der erforderlichen<br />
Schutzmaßnahmen<br />
Abb. 8: Beispiel für ein betriebliches Freigabeverfahren<br />
ja<br />
nein<br />
Verfahren ohne Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n!<br />
Bei Tätigkeiten mit Arbeitsstoffen sind<br />
die Mindest-Schutzmaßnahmen nach<br />
TRGS 500 zu beachten<br />
Vorgabe an den Hersteller/Inverkehrbringer:<br />
Arbeitsstoffe/<strong>Gefahrstoffe</strong> mit möglichst<br />
geringem Gefährdungspotenzial<br />
Beteiligung fachkundiger Personen nach<br />
§ 7 GefStoffV:<br />
Sicherheitsfachkraft, Betriebsarzt, ggf.<br />
Abfallbeauftragten, Umweltbeauftragten,<br />
Verantwortlicher für den Einsatz der<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong>:<br />
Ggf. Ergänzung der Gefährdungsbeurteilung;<br />
Umsetzung der notwendigen<br />
Maßnahmen; Erstellen der arbeitsplatzund<br />
tätigkeitsbezogenen Betriebsanweisungen;<br />
Unterweisung der Mitarbeiter;<br />
Arbeitsmedizinische Vorsorge<br />
Aufnahme des <strong>Gefahrstoffe</strong>s in das<br />
Gefahrstoffverzeichnis<br />
29
30<br />
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Feststellung der Gefährdung<br />
5.3 Feststellung der Gefährdung<br />
Kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei den Tätigkeiten <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
eingesetzt bzw. freigesetzt werden, muss das Ausmaß<br />
der Gefährdung ermittelt werden. Dies kann durch Messungen der<br />
Konzentration des <strong>Gefahrstoffe</strong>s in der Luft am Arbeitsplatz, durch<br />
zuverlässige Berechnungen, durch Anlagenvergleiche aber auch<br />
durch Bestimmung der aufgenommenen Stoffe in den menschlichen<br />
Körper geschehen.<br />
Dabei ist sicherzustellen, dass der Arbeitsplatzgrenzwert nach der<br />
TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ eingehalten wird.<br />
Als Arbeitsplatzgrenzwert wird in § 3 Abs. 6 GefStoffV definiert:<br />
Der „Arbeitsplatzgrenzwert" ist der Grenzwert für die zeitlich gewichtete<br />
durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft<br />
am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum.<br />
Er gibt an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder<br />
chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen<br />
nicht zu erwarten sind.<br />
Liegt für einen Gefahrstoff die ermittelte Konzentration oberhalb<br />
des Arbeitsplatzgrenzwertes, so sind unverzüglich Maßnahmen<br />
nach der GefStoffV erforderlich.<br />
In der Gefahrstoffverordnung wird auch der biologische Grenzwert<br />
definiert. Danach ist der „biologische Grenzwert" der Grenzwert<br />
für die toxikologisch-arbeitsmedizinisch abgeleitete Konzentration<br />
eines Stoffes, seines Metaboliten oder eines Beanspruchungsindikators<br />
im entsprechenden biologischen Material, bei<br />
dem im Allgemeinen die Gesundheit eines Beschäftigten nicht be-
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
5.4 Messungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
einträchtigt wird (§ 3 Abs. 7 GefStoffV). Die biologischen Grenzwerte<br />
werden in der TRGS 903 „Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte<br />
– BAT-Werte“ aufgeführt.<br />
5.4 Messungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
Entsprechende Hinweise zu Messungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n enthalten<br />
die Technischen Regeln TRGS 402 „Ermittlung und Beurteilung<br />
der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen“<br />
und die TRGS 403 „Bewertung von Stoffgemischen in der<br />
Luft am Arbeitsplatz“.<br />
Die TRGS 402 beinhaltet die grundlegende Strategie zur Überwachung<br />
von Arbeitsbereichen. In der Regel wird zunächst eine Arbeitsbereichsanalyse<br />
erstellt, die im Wesentlichen auf die Informationen<br />
aus der Gefährdungsbeurteilung zurückgreift.<br />
Um das Ergebnis der Arbeitsbereichsanalyse auch zukünftig sicherzustellen,<br />
ist es durch Kontrollmessungen regelmäßig zu überprüfen.<br />
Der zeitliche Abstand der Kontrollmessung richtet sich<br />
nach der Höhe der ermittelten Konzentration und kann 16, 32<br />
oder 64 Wochen betragen.<br />
Auf regelmäßige Kontrollmessungen kann verzichtet werden,<br />
wenn die Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes dauerhaft gesichert<br />
ist.<br />
Der Befund „dauerhaft sichere Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes”<br />
liegt vor:<br />
• wenn sichergestellt ist, dass die Schichtmittelwerte langfristig<br />
nicht größer als ein Viertel des Grenzwertes sind (hierbei ist<br />
Anhang 1 der TRGS 402 zu beachten),<br />
31
32<br />
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Messungen von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
• bei Einhaltung eines verfahrens- und stoffspezifischen Kriteriums<br />
(VSK, TRGS 420),<br />
• bei Dauerüberwachung, (hierbei ist Anhang 2 der TRGS 402<br />
zu beachten).<br />
Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) sind Expositionsbeschreibungen<br />
zu Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n oder der Freisetzung<br />
von <strong>Gefahrstoffe</strong>n bei Tätigkeiten, bei denen die Exposition<br />
ein tolerierbares Maß nicht überschreitet und geben in der Regel<br />
den Stand der Technik wieder.<br />
VSK werden vom Ausschuss für <strong>Gefahrstoffe</strong> aufgestellt und durch<br />
den BMAS bekannt gemacht (Abbildung 9).<br />
Gesetzliche Unfallversicherungen,<br />
Länder, Verbände, Hersteller<br />
Tätigkeits- und Maßnahmenbeschreibung,<br />
Expositionsermittlung<br />
Messungen, Datenbanken, Berechnungen, ...<br />
nein<br />
Expositionsbeschreibung<br />
AGS<br />
AGW nach<br />
TRGS 900?<br />
ja<br />
Anforderungen<br />
VSK erfüllt?<br />
nein<br />
Risikobewertung<br />
ja<br />
Hilfen zur Gefährungsbeurteilung<br />
• BG/BGIA-Empfehlungen (BGI 790)<br />
• LASI-Empfehlungen<br />
• TRGS „Verfahrens- und<br />
stoffspezifische Kriterien“<br />
(mit Vermutungswirkung)<br />
Abb. 9: Ablaufschema für die Erstellung von VSK<br />
Sie legen fest, wie Tätigkeiten mit Stoffen durchgeführt und Stoffe<br />
in Verfahren eingesetzt werden können, damit die Anforderungen
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
5.5 BG/BGIA-Empfehlungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
der Gefahrstoffverordnung hinsichtlich der zu treffenden Schutzmaßnahmen<br />
für die Beschäftigten erfüllt sind. Somit enthalten VSK<br />
Hinweise zur Gefährdungsbeurteilung und zur Wirksamkeitskontrolle<br />
und beschreiben Schutzmaßnahmen. Wird im Rahmen der<br />
Gefährdungsbeurteilung festgestellt, dass die Vorgaben des VSK<br />
erfüllt werden, können bestimmte Maßnahmen wie z.B. Arbeitsplatzmessungen<br />
entfallen.<br />
5.5 BG/BGIA-Empfehlungen<br />
BG/BGIA-Empfehlungen sind Expositionsbeschreibungen für bestimmte<br />
Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n bzw. für Verfahren in denen<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong> freigesetzt werden können. Sie repräsentieren den<br />
Stand der Technik und können im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung<br />
für die Bewertung der Exposition sowie für die Festlegung<br />
der erforderlichen Schutzmaßnahmen herangezogen werden.<br />
Die BG/BGIA-Empfehlung „Weichlöten mit dem Lötkolben an elektrischen<br />
und elektronischen Baugruppen oder deren Einzelkomponenten<br />
„Kolbenlöten“ beschreibt die Kriterien für den Verzicht auf<br />
Kontrollmessungen bei bestimmten Weichlötarbeiten. Sie gilt für<br />
das Fugenlöten mit punktförmigen Lötstellen mit Weichloten<br />
(Liquidustemperatur des Lotes < 450 °C) an Arbeitsplätzen, an denen<br />
elektrische und elektronische Baugruppen bzw. deren Einzelkomponenten<br />
• im Rahmen der Fertigung<br />
• bei Montage-, Prüf- und Kontrollarbeiten<br />
im Rahmen von Reparaturlötungen<br />
•<br />
verlötet werden. Hierzu gehören z.B. das Löten an Leiterplatten<br />
oder elektronischen Kleingeräten (Abbildung 10) und das Verzinnen<br />
von Leiterenden.<br />
33
34<br />
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 BG/BGIA-Empfehlungen<br />
Diese BG/BGIA-Empfehlung gilt aber nicht für Flamm- und Hartlötverfahren,<br />
Lötanlagen, Kolbenlöten mit flammbeheizten Lötkolben,<br />
Weichlötarbeiten bei der Pfeifenherstellung im Orgelbau, Weichlötarbeiten<br />
mit Sonder-Weichloten, die Antimon, Cadmium oder<br />
Silber enthalten sowie für das Löten von Blei. Werden in einem Betrieb<br />
Weichlötarbeiten durchgeführt, sollte geprüft werden, ob<br />
diese BG/BGIA-Empfehlung für das Arbeitsverfahren zutrifft. Ist<br />
dies der Fall, kann auf Kontrollmessungen verzichtet werden. Dabei<br />
ist zu beachten, dass der Anwender dies zu dokumentieren<br />
hat. Weiterhin muss er sich jährlich vergewissern, ob die Vorgaben<br />
den BG/BGIA-Empfehlungen entsprechen.<br />
Weitere BG/BGIA-Empfehlungen existieren für<br />
• Kühlschmierstoffe<br />
• WIG-Schweißen<br />
• Galvanotechnik<br />
Abb. 10: Weichlöten mit dem Lötkolben
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
5.6 Messverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
5.6 Messverfahren<br />
Die Ermittlung bzw. die Messung von <strong>Gefahrstoffe</strong>n in der Luft am<br />
Arbeitsplatz erfordert ein hohes Maß an Fachwissen. Der Gesetzgeber<br />
fordert deshalb:<br />
Wer Messungen durchführt, muss über die notwendige Fachkunde<br />
und über die erforderlichen Einrichtungen verfügen. Der Unternehmer,<br />
der eine akkreditierte Messstelle beauftragt, kann davon ausgehen,<br />
dass die von dieser Messstelle festgestellten Erkenntnisse<br />
zutreffend sind (§ 9 Abs. 6 GefStoffV).<br />
Abb. 11: Probenahme an einer Person<br />
Abbildung 11 zeigt die Probenahme an einer Person mit einem<br />
anerkannten Probenahmeverfahren. Die Analyse des <strong>Gefahrstoffe</strong>s<br />
erfolgt anschließend in einem Labor. Einen Überblick über<br />
mögliche Messstellen zeigt Abbildung 12.<br />
35
36<br />
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Messverfahren<br />
innerbetriebliche<br />
Messstellen<br />
Unterstützung des<br />
Unternehmers bei der<br />
Expositionsermitllung<br />
Messstellen<br />
außerbetriebliche<br />
Messstellen<br />
Zulassung durch den<br />
AKMP*<br />
*AKMP =Akkreditierungsstelle der Länder für Mess- und Prüfstellen<br />
berufsgenossenschaftliche/staatliche<br />
Messstellen<br />
Beratung,<br />
Kontrollaufgaben,<br />
Berufskrankheiten-<br />
Ermittlungsverfahren<br />
Abb. 12: Messstellen zur Überwachung von Arbeitsbereichen<br />
Einige Betriebe verfügen über eine innerbetriebliche Messstelle.<br />
Diese sollte sich dem Verfahren der Eigenüberprüfung zur Anerkennung<br />
der Messergebnisse durch innerbetriebliche Messstellen<br />
unterziehen, dass von den Berufsgenossenschaften unterstützt wird.<br />
Das Messverfahren umfasst das oder die Analyseverfahren, die<br />
Anzahl der zu nehmenden Proben und deren räumliche und zeitliche<br />
Verteilung sowie die Rechenvorschrift, die zum Ergebnis führt.<br />
Analyseverfahren enthalten als wesentliche Verfahrensschritte die<br />
Probenahme und die analytische Bestimmung.
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
5.6 Messverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Bei der Probenahme wird grundsätzlich zwischen passiver und aktiver<br />
Probenahme unterschieden (Abbildung 13). Die passive Probenahme<br />
erfolgt nach dem Prinzip der Diffusion. Die aktive Probenahme<br />
erfolgt durch Ansaugen einer definierten Luftmenge über<br />
einen Probenträger mit einer Pumpe. Als Probenträger eignen sich<br />
u.a. Aktivkohle, Silicagel, spezielle Waschlösungen und diverse<br />
Filtermaterialien (Glasfaserfilter, Membranfilter, imprägnierte bzw.<br />
beschichtete Filter).<br />
Aktive Probenahme<br />
(mit Pumpe)<br />
Probenträger und verschiedene<br />
Pumpen<br />
Abb. 13: Überblick Probenahmeverfahren<br />
Probenahmeverfahren<br />
Passive Probenahme<br />
(ohne Pumpe)<br />
Diffusionssammler für Kohlenwasserstoffverbindungen<br />
und Formaldehyd<br />
37
38<br />
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Messverfahren<br />
Ein Sonderfall der aktiven Probenahme ist das direktanzeigende<br />
Mess-System, indem Probenahme und Analysenverfahren integriert<br />
sind. Dabei wird unterschieden zwischen unspezifischen<br />
und spezifischen Mess-Systemen. Die unspezifischen Mess-Systeme<br />
FID (Flammenionisationsdetektor) und PID (Photoionisationsdetektor)<br />
eignen sich zur Ermittlung von Gefahrstoffquellen organischer<br />
Gase und Dämpfe. Sie können aber auch spezifisch eingesetzt<br />
werden, wenn ein Einzelstoff am Arbeitsplatz vorliegt und<br />
das System vorher darauf kalibriert wurde. Spezifische Mess-Systeme<br />
sind u.a. für Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide,<br />
Ozon, Quecksilber, Vinylchlorid und Schwefelwasserstoff auf dem<br />
Markt erhältlich.<br />
Expositionsmessungen sind in der Regel sehr aufwendig und können<br />
insbesondere kleine und mittlere Betriebe vor große Probleme<br />
stellen. Vereinfachte Messverfahren bzw. Messverfahren zur Abschätzung<br />
der Gefahrstoffkonzentration haben deshalb in der betrieblichen<br />
Praxis eine große Bedeutung. So können beispielsweise<br />
mit Prüfröhrchen und einer Handpumpe eine Vielzahl unbekannter<br />
Substanzen aufgespürt, aber auch einige <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
(z.B. Ammoniak, Kohlendioxid) relativ genau bestimmt werden (Abbildung<br />
14).<br />
Das Prüfröhrchenverfahren ist vergleichsweise kostengünstig, leicht<br />
zu handhaben und liefert in kurzer Zeit Messwerte, oftmals bereits<br />
nach ein bis zwei Minuten.<br />
Beim Einsatz von Prüfröhrchen sollte aber unbedingt darauf geachtet<br />
werden, dass der Anzeigebereich für den Stoff zwischen<br />
10 und 200 % des Grenzwertes liegt und das mögliche Störkomponenten<br />
am Arbeitsplatz ausgeschlossen werden. Das Haltbarkeitsdatum<br />
der Prüfröhrchen ist zu beachten, abgelaufene Prüf-
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
5.6 Messverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Abb. 14: Anwendung des Prüfröhrchen-Messverfahrens mittels Handpumpe<br />
röhrchen dürfen nicht mehr verwendet werden.<br />
Der Beipackzettel zu den Prüfröhrchen beschreibt die Bedingungen<br />
des Einsatzes, die bei der Messung beachtet werden müssen.<br />
Des Weiteren sollten Mehrfachmessungen (mehrere Röhrchen ca.<br />
15 Stück/Schicht im Arbeitsbereich, s.a. Tabelle 1 zur TRGS 402)<br />
durchgeführt werden.<br />
Werden bei der Prüfröhrchenmessung Messwerte im Bereich des<br />
Grenzwertes ermittelt, sollte in diesem Arbeitsbereich eine Gefahrstoffmessung<br />
mit einem anerkannten Messverfahren durchgeführt<br />
oder unverzüglich wirksame technische Maßnahmen ergriffen<br />
werden. Für eine große Anzahl von Stoffen, u.a. Lösemittel, sind<br />
auch einfach zu handhabende Diffusionssammler (passive Probenahme)<br />
im Gebrauch (Abbildung 15). Im Gegensatz zur oben be-<br />
39
40<br />
5 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 Biomonitoring<br />
schriebenen aktiven Probenahme erfolgt<br />
hier der Schadstofftransport durch Diffusionsvorgänge,<br />
so dass bei Anwendung<br />
dieses Mess-Systems eine Pumpe nicht<br />
benötigt wird. Die Analyse der <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
erfolgt aber in der Regel in einem Labor.<br />
Wichtig ist, dass die ermittelten Daten aufgezeichnet<br />
und dokumentiert werden.<br />
5.7 Biomonitoring<br />
Abb. 15: Einsatz eines Diffusions- Neben der Kontrolle der Einhaltung von<br />
sammlers bei Innenraummessungen<br />
Arbeitsplatzgrenzwerten ist die Überwachung<br />
der Konzentration von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
im biologischen Material (Blut oder Urin) sinnvoll, insbesondere<br />
dann, wenn zusätzlich zum Aufnahmeweg von <strong>Gefahrstoffe</strong>n über<br />
den Atemtrakt eine Aufnahme über den Mund (orale Aufnahme<br />
z.B. auch durch mangelnde Hygiene) oder über die Haut (bei<br />
hautresorptiven Stoffen) möglich ist.<br />
Ein solches Biomonitoring wäre auch dann angezeigt, wenn sich<br />
Stoffe (z.B. PCB, Schwermetalle) im Körper anreichern können<br />
(kumulative Wirkung).<br />
Zur Bewertung der Konzentration von <strong>Gefahrstoffe</strong>n im biologischen<br />
Material sind die biologischen Grenzwerte nach TRGS 903<br />
heranzuziehen.
6 ÜBERSICHT ÜBER DAS GEFAHRSTOFFRECHT . . . . .<br />
Eine grobe Einteilung zum Regelwerk für <strong>Gefahrstoffe</strong> zeigen die<br />
Abbildungen 16 und 17.<br />
Rechtssystematisch wird unterschieden in die von den Berufsgenossenschaften<br />
erlassenen Vorschriften, Regeln und Informationen<br />
und in staatliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Regeln).<br />
Chemikaliengesetz<br />
(ChemG)<br />
Chemikalien-<br />
Verbotsverordnung<br />
(ChemVO)<br />
Gefahrstoff-<br />
Verordnung<br />
(GefStoffV)<br />
für <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
(TRGS)<br />
Abb. 16: Struktur des Gefahrstoffrechtes<br />
EG-Richtlinien<br />
Arbeitsschutzgesetz<br />
(ArbSchG)<br />
Biostoff-<br />
Verordnung<br />
(BioStoffV)<br />
Technische Regeln<br />
für Biostoffe<br />
(TRBA)<br />
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz<br />
(GPSG)<br />
Arbeitsstätten-<br />
Verordnung<br />
(ArbStättV)<br />
zur ArbStättV<br />
(TRAS/ASR)<br />
Von staatlicher Seite ist das Chemikaliengesetz (ChemG), das Arbeitsschutzgesetz<br />
(ArbSchG) und das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz<br />
(GPSG)von Bedeutung.<br />
Betriebssicherheits-<br />
Verordnung<br />
(BetrSichV)<br />
zur BetrSichV<br />
(TRBS)<br />
41
42<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Übersicht über das Gefahrstoffrecht<br />
Berufsgenosenschaftliches<br />
Regelwerk zu <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
Sozialgesetzbuch (SGB)<br />
7. Buch<br />
Unfallverhütungsvorschriften<br />
BGV A 1 Grundsätze der Prävention<br />
BGV A 8 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung<br />
am Arbeitsplatz<br />
BG-Regeln<br />
BG-Informationen<br />
BGR 121 Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen<br />
BGR 189 Einsatz von Schutzkleidung<br />
BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeräten<br />
BGR 197 Benutzung von Hautschutz<br />
BGR 217 Mineralischer Staub<br />
BGI 536 Gefährliche chemische Stoffe<br />
BGI 564 Umgang mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n – Für die Beschäftigten<br />
Abb. 17: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Regeln, Informationen zu<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong>n (Auswahl)
6 Übersicht über das Gefahrstoffrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Die Verordnung zum Schutz vor <strong>Gefahrstoffe</strong>n (GefStoffV) konkretisiert<br />
mit dem Abschnitt zum Inverkehrbringen das ChemG und<br />
mit § 7 Gefährdungsermittlung und -beurteilung bei Tätigkeiten mit<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong>n das ArbSchG. Nähere Hinweise zu einzelnen Paragraphen<br />
enthalten die Technischen Regeln für <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
(TRGS).<br />
Die wichtigste Unfallverhütungsvorschrift für Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
ist die BGV A1 „Grundsätze der Prävention“. Weitere<br />
Hinweise zu <strong>Gefahrstoffe</strong>n befinden sich in den berufsgenossenschaftlichen<br />
Regeln (BGR) und den berufsgenossenschaftlichen Informationen<br />
(BGI).<br />
Neben den genannten Arbeitsschutzvorschriften sind für den Betrieb<br />
noch einige Umweltschutz relevante Bestimmungen, u.a. das<br />
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), das Kreislaufwirtschafts-<br />
und Abfallgesetz (KrW-AbfG), das Wasserhaushaltsgesetz<br />
(WHG) und das Abwasserabgabengesetz (AbwAG) von Bedeutung.<br />
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)<br />
Zweck der Verordnung ist es, den Menschen vor arbeitsbedingten<br />
und sonstigen Gesundheitsgefahren sowie die Umwelt vor stoffbedingten<br />
Schädigungen zu schützen.<br />
Demnach gilt diese Verordnung für das Inverkehrbingen von Stoffen,<br />
Zubereitungen und Erzeugnissen, zum Schutz der Beschäftigten<br />
und anderer Personen vor Gefährdungen ihrer Gesundheit<br />
und Sicherheit durch <strong>Gefahrstoffe</strong> und zum Schutz der Umwelt vor<br />
stoffbedingten Schädigungen.<br />
Ein Schema zum Aufbau der GefStoffV zeigt Abbildung 18.<br />
43
44<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Übersicht über das Gefahrstoffrecht<br />
Verordung zum Schutz vor <strong>Gefahrstoffe</strong>n (GefStoffV)<br />
Anwendungsbereich und<br />
Begriffsbestimmungen<br />
Gefahrstoffinformation<br />
Anhang I<br />
in Bezug genommene Richtlinien<br />
der EG<br />
Anhang II<br />
Besondere Vorschriften zur<br />
Information, Kennzeichnung<br />
und Verpackung<br />
Allgemeine Schutzmaßnahmen<br />
Ergänzende Schutzmaßnahmen<br />
Verbote und Beschränkungen<br />
Vollzugsregelungen und<br />
Schlussvorschriften<br />
Ordnungswidrigkeiten und<br />
Straftaten<br />
Anhang III<br />
Besondere Vorschriften für bestimmte<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong> und Tätigkeiten<br />
Anhang IV<br />
Herstellungs- und Verwendungsverbote<br />
Anhang V<br />
Arbeitsmedizinische Vorsorge<br />
Abb. 18: Übersicht GefStoffV
7 SCHUTZSTUFENKONZEPT NACH DER<br />
GEFAHRSTOFFVERORDNUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind u.a. die akut und<br />
chronisch-toxischen Eigenschaften der eingesetzten Gefahstoffe zu<br />
ermitteln und zu bewerten. Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung<br />
wird der Tätigkeit eine bestimmte Schutzstufe<br />
zugeordnet. Dieser Begriff wird allerdings nicht näher definiert,<br />
sondern liefert lediglich eine Erleichterung für die Berücksichtigung<br />
notwendiger Schutzmaßnahmen.<br />
Abbildung 19 zeigt ein Ablaufschema, aus dem für die jeweilige<br />
Schutzstufe die zu berücksichtigenden Maßnahmen zu entnehmen<br />
sind.<br />
Beurteilung des Arbeitsplatzes<br />
GefStoffV<br />
§ 7 Abs. 9<br />
Reichen<br />
Maßnahmen<br />
des § 8?<br />
Schutzstufe<br />
1<br />
Maßnahmen:<br />
• geeignete Arbeitsmittel<br />
• geeignete Arbeitsverfahren<br />
• Begrenzung der Menge<br />
• Begrenzung der Dauer<br />
• Anzahl der Beschäftigten<br />
begrenzen<br />
• Hygienemaßnahmen<br />
ja<br />
nein<br />
Geringe Menge<br />
und Exposition?<br />
GefStoffV<br />
§7Abs.10<br />
Reichen<br />
Maßnahmen der<br />
§§ 8 und 9?<br />
Schutzstufe<br />
2<br />
Maßnahmen: wie S1+<br />
• Substitution<br />
• Absaugung<br />
• PSA<br />
• Messung/VSK<br />
• Betriebsanweisung<br />
• Unterweisung<br />
• Arbeitsmedizinische<br />
Vorsorgeuntersuchung<br />
• Schwarz-/Weiß-Bereiche<br />
Werden<br />
T oder T+ Stoffe<br />
verwendet oder<br />
frei?<br />
Schutzstufe<br />
3<br />
Maßnahmen: wie S2+<br />
• Geschlossenes System<br />
• Ermittlung<br />
• Messung<br />
• VSK<br />
Abb. 19: Schutzstufen für die toxischen Eigenschaften und Maßnahmen<br />
nein<br />
Werden<br />
KMR F-Stoffe<br />
verwendet oder<br />
frei?<br />
nein GefStoffV ja<br />
GefStoffV ja<br />
§10<br />
§11<br />
nein<br />
AGW<br />
eingehalten oder<br />
VSK<br />
ja ja nein<br />
nein<br />
ja<br />
Schutzstufe<br />
4<br />
Maßnahmen: wie S3+<br />
• Keine Rückführung der<br />
Abluft<br />
• technische Störungen<br />
berücksichtigen<br />
• Abgrenzung der<br />
Gefahrenbereiche<br />
• Messung<br />
45
46<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Schutzstufenkonzept nach der Gefahrstoffverordnung<br />
Für Krebs erzeugende, Erbgut verändernde und fruchtbarkeitsgefährdende<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong> (KMR F-Stoffe) ist die höchste Schutzstufe 4<br />
anzuwenden. Als geforderte Schutzmaßnahmen werden alle Maßnahmen<br />
der Stufen 1 bis 3 und zusätzlich die Abgrenzung von<br />
Gefahrenbereichen, eine notwendige Gefahrstoffmessung und das<br />
Verbot der Rückführung von Abluft gefordert. Nur bei sicherer Einhaltung<br />
des AGW oder bei Durchführung der Tätigkeiten nach berufsgenossenschaftlichen<br />
oder behördlich anerkannten Verfahren<br />
(VSK) besteht die Möglichkeit des Übergangs in die Schutzstufe 3.<br />
Die Schutzstufe 2 umfasst alle Grundmaßnahmen (Substitution,<br />
Absaugung, Lüftung, PSA, Betriebsanweisung, Unterweisung, arbeitsmedizinische<br />
Vorsorgeuntersuchung etc.), wie sie auch schon<br />
aus der alten GefStoffV ableitbar waren. Anzuwenden ist die<br />
Schutzstufe 2 bei allen Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n, die nicht als<br />
KMR F-Stoffe oder sehr giftig bzw. giftig eingestuft sind und die verwendete<br />
Menge nicht gering ist. Sobald Tätigkeiten mit sehr giftigen<br />
oder giftigen Stoffen (nicht KMR F) erfolgen, müssen die Maßnahmen<br />
der Schutzstufe 3 angewendet werden. Dies bedeutet<br />
u.a. erhöhte Anforderungen an die Zugangsbeschränkung und<br />
den Einsatz möglichst geschlossener Anlagen.<br />
Die Schutzstufe 1 stellt den Fall für Tätigkeiten mit chemischen Stoffen<br />
und Zubereitungen dar, von denen nur eine geringe Gefährdung<br />
ausgeht und bei denen allgemeine Grundmaßnahmen zum<br />
Schutz der Beschäftigten ausreichen. Ergibt die Gefährdungsbeurteilung<br />
für die Tätigkeit nur eine geringe Gefährdung, können alle<br />
weiteren Maßnahmen aus den §§ 9 bis 17 der GefStoffV entfallen.<br />
Das bedeutet u. a. keine Betriebsanweisung, keine Unterweisung,<br />
keine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung. Als Schutzmaßnahme<br />
reicht ggf. die Einhaltung der allgemeinen Hygienestandards,<br />
wie sie in der TRGS 500 „Schutzmaßnahmen: Mindeststandard“<br />
festgelegt sind. Solange es zu dem Begriff „geringe
7 Schutzstufenkonzept nach der Gefahrstoffverordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Menge“ keine Festlegungen gibt, liegt diese Einschätzung in der<br />
Verantwortung des Unternehmers und seiner Gefährdungsbeurteilung.<br />
In jedem Fall sind mögliche Brand- und Explosionsgefahren (§ 12<br />
und Anhang III Nr.1) und die sonstigen Gefahren z.B. Erstickungsgefahr<br />
durch Sauerstoffmangel in der Gefährdungsbeurteilung zu<br />
bewerten und ggf. notwendige Schutzmaßnahmen zu treffen.<br />
47
48<br />
8 SCHUTZMASSNAHMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor Gesundheitsgefahren<br />
durch <strong>Gefahrstoffe</strong> müssen bereits im Vorfeld, also vor dem<br />
praktischen Einsatz im Betrieb ansetzen.<br />
Generell müssen bei Tätigkeiten mit Arbeitsstoffen gewisse Mindest-Schutzmaßnahmen<br />
eingehalten werden (TRGS 500 „Schutzmaßnahmen:<br />
Mindeststandard“). Darüber hinaus sind bei Tätigkeiten<br />
mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n weitergehende Maßnahmen zu beachten.<br />
8.1 Tätigkeiten mit geringer Gefährdung<br />
Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung aufgrund der Arbeitsbedingungen<br />
für bestimmte Tätigkeiten eine nur „geringe Gefährdung“<br />
(Schutzstufe 1 nach GefStoffV), können die Maßnahmen<br />
auf die Mindest-Schutzmaßnahmen beschränkt bleiben.<br />
Bedingungen für Tätigkeiten mit geringer Gefährdung:<br />
•<br />
•<br />
geringe verwendete Stoffmenge<br />
nach Höhe und Dauer geringe Exposition<br />
Maßnahmen nach § 8 GefStoffV (Mindest-Schutzmaßnahmen)<br />
sind ausreichend<br />
keine Tätigkeiten mit giftigen, sehr giftigen, Krebs erzeugenden,<br />
Erbgut verändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong>n der Kategorie 1 oder 2<br />
Die Mindest-Schutzmaßnahmen umfassen u.a.:<br />
• Gestaltung des Arbeitsplatzes, wie leicht zu reinigende Arbeitsflächen,<br />
Waschgelegenheiten mit Handtüchern, Hautschutz etc.<br />
Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel<br />
•
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.1 Tätigkeiten mit geringer Gefährdung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
• Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten, die <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
ausgesetzt sind<br />
• Begrenzung der Dauer und des Ausmaßes der Exposition<br />
• Angemessene Hygienemaßnahmen<br />
• Begrenzung der Gefahrstoffmenge am Arbeitsplatz<br />
• Geeignete Arbeitsmethoden, welche die Gesundheit und Sicherheit<br />
der Mitarbeiter nicht beeinträchtigen<br />
• Innerbetriebliche Kennzeichnung von Behältern, Apparaturen<br />
und Rohrleitungen<br />
• Aufbewahrung und Lagerung von <strong>Gefahrstoffe</strong>n, so dass die<br />
Gesundheit und die Umwelt nicht gefährdet werden. Verhindern<br />
von Missbrauch und Fehlgebrauch.<br />
• Aufbewahrung und Lagerung in geeigneten, verwechselungssicheren<br />
Behältnissen<br />
(weitere Hinweise sind in der TRGS 500 „Schutzmaßnahmen:<br />
Mindeststandards“ zu finden)<br />
Beispiele für Tätigkeiten mit geringer Gefährdung sind Klebearbeiten<br />
im Büro (Abbildung 20) oder das Reinigen von PC-Bildschirmen<br />
mittels handelsüblichen Glasreinigern (Abbildung 21).<br />
Abb. 20:<br />
Klebearbeiten am<br />
Büroarbeitsplatz<br />
49
50<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Tätigkeiten mit geringer Gefährdung<br />
Abb. 21: Reinigen von PC-Bildschirmen mit einem Glasreiniger<br />
Für Tätigkeiten mit geringer Gefährdung hat der Gesetzgeber Erleichterungen<br />
bei den Schutzmaßnahmen vorgesehen:<br />
• der Gefahrstoff muss nicht in das Gefahrstoffverzeichnis aufgenommen<br />
werden<br />
• es muss keine Betriebsanweisung nach § 14 GefStoffV erstellt<br />
werden<br />
• es muss keine Unterweisung nach § 14 GefStoffV durchgeführt<br />
werden<br />
• es müssen keine arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen<br />
erfolgen<br />
Die Erleichterung bezüglich der Unterweisung nach §14 GefStoffV<br />
entbindet nicht von der Unterweisungspflicht nach dem Arbeitsschutzgesetz<br />
und der BGV A1.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Die Entscheidung, ob eine Tätigkeit mit einem Gefahrstoff ohne<br />
Betriebsanweisung und Unterweisung oder ohne arbeitsmedizinische<br />
Vorsorgeuntersuchung auskommt, kann sehr weit reichend<br />
sein. Letztlich muss dies im Betrieb verantwortlich entschieden werden.<br />
Die Gefährdungsbeurteilung als Grundlage für diese Entscheidung<br />
ist daher durch eine fachkundige Person vorzunehmen.<br />
Anhang 1 dieser Broschüre enthält weitere Beispiele für Tätigkeiten<br />
mit geringer Gefährdung.<br />
8.2 Grundmaßnahmen<br />
8.2.1 Substitution<br />
Hat die Informationsermittlung ergeben, dass Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
vorliegen oder <strong>Gefahrstoffe</strong> bei den Tätigkeiten entstehen,<br />
ist bereits bei der Gefährdungsbeurteilung nach § 7 GefStoffV<br />
• der Einsatz eines ungefährlicheren Produktes oder<br />
• die Anwendung eines Verfahrens ohne Gefährdung bzw. ein<br />
emissionsarmes Verfahren<br />
fachkundig zu prüfen.<br />
Ersatzstoffe<br />
Der Einsatz eines ungefährlicheren Ersatzstoffes reduziert schon<br />
im Ansatz mögliche Gefährdungen für den Beschäftigten. Dies<br />
kann erhebliche Einsparungen ggf. notwendiger technischer Schutzmaßnahmen<br />
erbringen und somit auch rein wirtschaftlich von Vorteil<br />
sein.<br />
Die TRGS 440 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen durch<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong> am Arbeitsplatz: Ermitteln von <strong>Gefahrstoffe</strong>n und Methoden<br />
zur Ersatzstoffprüfung“ enthält zur Erfüllung dieser Unternehmerpflicht<br />
konkrete Hilfen.<br />
51
52<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Produkt<br />
Gefährdung:<br />
sehr<br />
hohe<br />
hohe<br />
mittlere<br />
geringe<br />
vernachlässigbare<br />
Die TRGS zeigt u. a. auf, wie das von verschiedenen Produkten<br />
ausgehende gesundheitliche Risiko verglichen und wie bei der Entscheidung<br />
über Ersatzlösungen die Frage nach der Zumutbarkeit<br />
beantwortet werden kann.<br />
Das in der TRGS 440 enthaltene „Spaltenmodell“ ermöglicht dies<br />
u.a. durch Vergleich der R-Sätze, der Einstufung und einiger sicherheitstechnischen<br />
Kennzahlen (Dampfdruck, Flammpunkt, Wassergefährdungsklasse).<br />
Spalte für Spalte wird die Höhe der Gefährdung<br />
ermittelt und ergibt für jedes Produkt einen stoffspezifischen<br />
Verlauf. Diese können dann verglichen und das Produkt mit<br />
den günstigsten Eigenschaften ermittelt werden. Ein Beispiel für<br />
drei Reiniger zeigt Abbildung 22.<br />
Gesundheit:<br />
akut<br />
Reiniger 1<br />
Reiniger 2<br />
Reiniger 3<br />
Gesundheit:<br />
chronisch<br />
Umwelt Brandund<br />
Explosion<br />
Freisetzung<br />
Verfahren<br />
Abbildung 22: Beispiel für eine Bewertung für Reiniger nach dem<br />
Spaltenmodell
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Die Auswahl muss nicht zwingend das Produkt mit den geringsten<br />
„akuten Gesundheitsgefahren“ ergeben. Wird beispielsweise ein<br />
geschlossenes Verfahren eingesetzt, kann der Betrachtungsschwerpunkt<br />
auch bei den Brand- und Explosionsgefahren liegen. Ein Betrieb<br />
mit sehr gut umgesetztem Brand- und Explosionsschutz wird<br />
dennoch ein Produkt auswählen können, bei dem die Brand- und<br />
Explosionsgefahren eine hohe Gefährdung dafür aber bei den<br />
akuten Gesundheitsgefahren ein geringes Risiko ergeben haben.<br />
Das gesundheitliche Risiko von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen<br />
ist außerordentlich komplex und hängt von verschiedenen<br />
Faktoren ab. Dies sind u. a.:<br />
• arbeitsmedizinisch-toxikologische Faktoren (z. B. Aufnahme und<br />
Wirkung des Stoffes, schädigende Stoffeigenschaften, Wahrscheinlichkeit<br />
eines möglichen Gesundheitsschadens)<br />
• chemisch-physikalische Faktoren (z. B. Aggregatzustand, Siedepunkt,<br />
Dampfdruck, Schmelzpunkt, Mischungsverhältnis, Sättigungskonzentration)<br />
• betriebs- und verfahrenstechnische Faktoren (z. B. Arbeitsverfahren,<br />
Exposition am Arbeitsplatz)<br />
Für einige Stoffe existieren bereits Ersatzlösungen. So werden Ersatzstoffe,<br />
Ersatzverfahren und Verwendungsbeschränkungen für<br />
einige <strong>Gefahrstoffe</strong> in bestimmten Anwendungsbereichen in den<br />
TRGS 602 bis 619 beschrieben.<br />
Beispiele:<br />
Ersatzstoffe für Hydrazin<br />
Hydrazin wird in unseren Mitgliedsbetrieben hauptsächlich als Zusatz<br />
zum Kesselspeisewasser eingesetzt. Hydrazin ist gemäß der<br />
GefStoffV als Krebs erzeugend eingestuft, zudem hautresorptiv,<br />
umfangreiche Arbeitsschutzmaßnahmen sind bei dessen Einsatz<br />
53
54<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
erforderlich. Es kann durch eine Reihe handelsüblicher ungefährlicherer<br />
Zusätze ersetzt werden. Die TRGS 608 „Ersatzstoffe, Ersatzverfahren<br />
und Verwendungsbeschränkungen für Hydrazin in<br />
Wasser- und Dampfsystemen“ gibt hierzu<br />
einige Hinweise.<br />
Abb. 23: Entfettungsanlage<br />
mit wässrigen Medien<br />
Einsatz wässriger Reinigungsmittel als Ersatz<br />
für Chlorkohlenwasserstoffe<br />
Reinigungs- und Entfettungsverfahren auf<br />
der Basis wässriger Tenside bieten heute<br />
gegenüber den gefährlicheren Chlorkohlenwasserstoffen<br />
(z. B. Tetrachlorethen, Trichlorethen)<br />
häufig eine kostengünstigere Alternative,<br />
betrachtet man allein die beim CKW-<br />
Einsatz erforderliche Anlagentechnik sowie<br />
die Entsorgung aufgrund von Arbeitsschutzund<br />
Umweltauflagen (Abbildung 23 und<br />
24).<br />
Ersatzstoffe für Bleichromatpigmente<br />
Bleichromat als Pigment in Lacken und<br />
Farben kann durch andere ungefährlichere<br />
Pigmente ersetzt werden.<br />
Für Bleichromat besteht ein begründeter Verdacht auf eine Krebs<br />
erzeugende Wirkung. Des Weiteren ist Bleichromat als eindeutig<br />
fruchtschädigend eingestuft. Der Hersteller/Lieferant sollte angesprochen<br />
werden, ob ungefährlichere Pigmente eingesetzt werden<br />
können.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Emissionsarme Verfahren oder Verwendungsformen<br />
Können keine Ersatzstoffe eingesetzt werden, so steht als nächstes<br />
die Frage nach einem emissionsärmeren Verfahren und dem Einsatz<br />
emissionsarmer Verwendungsformen des Arbeitsstoffes an.<br />
Es sind also solche Überlegungen anzustellen, die zu einer Verfahrensänderung<br />
mit dem eingesetzten Gefahrstoff führen, bei dem<br />
das Auftreten des <strong>Gefahrstoffe</strong>s am Arbeitsplatz allerdings verhindert<br />
bzw. vermindert wird.<br />
Beispiele:<br />
Geschlossenes System<br />
Gibt es aus fertigungstechnischen Gründen z. B. keinen Ersatz für<br />
Tetrachlorethen (als Reinigungs- und Entfettungsmittel, etwa in der<br />
Abb. 24: Geschlossene Entfettungsanlage mit Tetrachlorethen (Per) als Reinigungsmittel<br />
55
56<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Galvanotechnik) sind solche Verfahren einzusetzen, die einen<br />
Kontakt der Beschäftigten zu diesem Gefahrstoff ausschließen.<br />
Dies ist möglich durch den Einsatz einer geschlossenen Anlage<br />
(Abbildung 24).<br />
Emissionsarmes Verfahren<br />
Das elektrostatische Pulverbeschichten bietet verfahrensbedingt<br />
gegenüber dem „Nasslackieren“ mit lösemittelhaltigen Farben<br />
und Lacken den erheblichen Vorteil, dass keine Lösemitteldämpfe<br />
entstehen (Abbildung 25).<br />
Ungefährlichere Verwendungsformen<br />
Sogenannte „ungefährlichere Verwendungsformen“ können sich<br />
ebenfalls erheblich auf die freiwerdende Gefahrstoffkonzentration<br />
am Arbeitsplatz auswirken. Anstelle staubförmiger <strong>Gefahrstoffe</strong> lassen<br />
sich diese z. B. häufig auch in Granulatform (Abbildung 26),<br />
als Pasten oder ggf. in gelöster, flüssiger Form einsetzen.<br />
Abb. 25: Elektrostatische Pulverbeschichtungsanlage<br />
Abb. 26: Ungefährliche Verwendungsform eines<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong>s z. B. Antimontrioxid in Granulatform
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
8.2.2 Rangordnung der Schutzmaßnahmen<br />
Abb. 27: Rangordnung der Schutzmaßnahmen<br />
Beseitigung bzw. Verminderung der Gefahr<br />
Beseitigung durch Einsatz bzw. Verminderung eines ungefährlichen der Gefahr Er-<br />
durch Einsatz eines<br />
satzstoffes ungefährlicheren Ersatzstoffes<br />
Isolierung der Gefahr durch Wahl eines<br />
emissionsarmen, Isolierung der Gefahr z. durch B. geschlossenen Wahl Arbeitsverfahrens<br />
eines emissionsarmen, (Gase, z.B. geschlossenen Dämpfe oder<br />
Arbeitsverfahrens (Gase, Dämpfe oder<br />
Schwebstoffe Schwebstoffe können können nicht nicht frei werden, frei auch werden,<br />
auch ein Hautkontakt ein Hautkontakt wird ausgeschlossen) wird ausgeschlossen)<br />
Absaugung freiwerdender <strong>Gefahrstoffe</strong> an<br />
Absaugung freiwerdender <strong>Gefahrstoffe</strong> an der<br />
der Austritts- Austritts- oder oder Entstehungsstelle Entstehungsstelle<br />
Lüftungsmaßnahmen im Raum als Ergänzung<br />
zur Absaugung an der Entstehungs-<br />
Lüftungsmaßnahmen im Raum als Ergänzung<br />
stelle (Zu- und Abluft im Raum zum Aus-<br />
zur Absaugung an der Entstehungsstelle (Zu- und<br />
gleich Abluft der im Raum Luftbilanz) zum Ausgleich der Luftbilanz)<br />
Persönliche Schutzausrüstung z. B. Schutzhandschuhe,<br />
z.B. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Atemschutz Atemschutz.<br />
57
58<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Lässt sich die Gefährdung durch die beschriebene Substitution von<br />
Stoffen oder Verfahren nicht vermeiden, ist diese durch Maßnahmen<br />
entsprechend der Rangordnung der Schutzmaßnahmen auf<br />
ein Mindestmaß zu verringern (Abbildung 27).<br />
8.2.3 Technische Schutzmaßnahmen<br />
Technische Schutzmaßnahmen haben absoluten Vorrang vor organisatorischen,<br />
persönlichen oder arbeitsmedizinischen Schutzmaßnahmen.<br />
Sie sollen möglichst zwangsläufig dafür sorgen, dass gefährliche<br />
Gase, Dämpfe, Stäube etc. nicht in den Arbeitsbereich<br />
des Beschäftigten gelangen können, bzw. ein Kontakt zu den <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
auf ein Mindestmaß beschränkt bleibt.<br />
Als Maßstab dient hier der „Stand der Technik“, also der Entwicklungsstand<br />
fortschrittlicher Verfahren, der sich in der praktischen<br />
Anwendung bewährt hat.<br />
Entsprechend der Rangordnung ihrer Wirksamkeit werden folgende<br />
technische Maßnahmen unterschieden:<br />
Auswahl von Arbeitsverfahren, Anlagentechniken etc., die ein<br />
Freiwerden von <strong>Gefahrstoffe</strong>n ausschließen (geschlossene Anlage)<br />
Für besonders gefährliche Krebs erzeugende <strong>Gefahrstoffe</strong> sind<br />
den Verarbeitungsverfahren in geschlossenen Anlagen und Apparaturen<br />
stets Vorzug zu geben.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Beispiele:<br />
Geschlossene Befülleinrichtung (Zudosieren) für Bäder in der Galvanotechnik<br />
Das Befüllen von Bädern in Betrieben der Galvanotechnik, z. B.<br />
mit Säuren, Laugen und sonstigen gefährlichen Zubereitungen, ist,<br />
soweit dies noch aus Behältnissen „von Hand“ geschieht, mit erheblichen<br />
Unfallgefahren (unbeabsichtigtes Verspritzen, Verschütten,<br />
Sturz beim Transport u. a.) verbunden. Ideal ist hier die<br />
Versorgung der Bäder durch geschlossene Befüllsysteme (Abbildung<br />
28).<br />
Abb. 28: Versorgung von Bädern in der Galvanotechnik aus geschlossenem Befüllsystem<br />
59
60<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Tätigkeiten mit Quecksilber in geschlossenen Apparaturen<br />
Metallisches Quecksilber wird zu einer besonderen Gefahr, wenn<br />
es verschüttet und dann fein verteilt und nicht mehr sichtbar in den<br />
Arbeitsbereich gelangt (Quecksilber zerspringt in kleinste Kügelchen,<br />
wenn es z. B. auf den Boden fällt).<br />
Schon bei Raumtemperatur können so unbemerkt gefährliche<br />
Quecksilberdampfkonzentrationen im Raum entstehen.<br />
Bei Tätigkeiten in geschlossenen Anlagen sind die beschriebenen<br />
Verunreinigungen der Arbeitsbereiche weitgehend ausgeschlossen.<br />
Ein Unterdruck in der Anlage sorgt zudem dafür, dass keine<br />
giftigen Quecksilberdämpfe durch Undichtigkeiten der Kapselung<br />
entweichen können (Abbildung 29).<br />
Abb. 29: Einfüllen von Quecksilber im geschlossenen System
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Absaugung freiwerdender <strong>Gefahrstoffe</strong> an der Austritts- oder Entstehungsstelle<br />
Kann nun durch das Arbeitsverfahren doch nicht sicher ausgeschlossen<br />
werden, dass <strong>Gefahrstoffe</strong> in den Arbeitsbereich des Beschäftigten<br />
gelangen, müssen diese an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle<br />
erfasst (d.h. abgesaugt) und gefahrlos für Mensch und<br />
Umwelt fortgeleitet werden.<br />
Was bedeutet dies für die Praxis?<br />
Beim Entweichen von Gasen, Dämpfen, Stäuben etc. in die Luft<br />
am Arbeitsplatz stellt sich für den verantwortlichen Vorgesetzten<br />
stets die Frage, ob <strong>Gefahrstoffe</strong> in gefährlichen Konzentrationen<br />
auftreten.<br />
Klarheit über das Ausmaß der Gefährdung kann hier eine entsprechende<br />
Gefahrstoffmessung verschaffen, deren Ergebnis auch Basis<br />
für die technische Auslegung von absaugtechnischen Maßnahmen<br />
ist (s. auch Abschnitt 5).<br />
Hinsichtlich ihrer Effektivität unterscheidet die Lüftungstechnik drei<br />
grundsätzliche Erfassungssysteme.<br />
Eine Übersicht in der Rangfolge ihrer Wirksamkeit zeigt Abbildung<br />
30.<br />
61
62<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
geschlossenes<br />
Erfassungssystem<br />
halboffenes<br />
Erfassungssystem<br />
offenes<br />
Erfassungssystem<br />
Abb. 30: Übersicht über die Erfassungssysteme
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Geschlossenes Erfassungssystem<br />
In diesem allseitig geschlossenen Anlagensystem sorgt die integrierte<br />
Absaugung dafür, dass keine etwa brand- und explosionsgefährlichen<br />
Konzentrationen entstehen oder <strong>Gefahrstoffe</strong> an Undichtigkeiten<br />
der Kapselung austreten können (Abbildung 31).<br />
Abb. 31: Absaugung mit geschlossenem Erfassungssystem<br />
Halboffenes Erfassungssystem<br />
Die Emissionsquelle an der Maschine oder Anlage ist hierbei bis<br />
auf unbedingt notwendige Bedienungsöffnungen gekapselt. An<br />
dieser halboffenen Kapselung (Erfassung) ist die Absaugung angeschlossen<br />
(Abbildung 32).<br />
63
64<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Offenes Erfassungssystem<br />
Die Emissionsquelle ist nicht umschlossen.<br />
Die Erfassung der <strong>Gefahrstoffe</strong>, mittels Saugtrichter,<br />
-rüssel o. ä. kann zwar auch zu<br />
guten Ergebnissen führen, jedoch ist es oft<br />
aus technischen Gründen unmöglich, nahe<br />
genug an die Emissionsquelle heranzukommen,<br />
oder die Erfassung wird nicht optimal<br />
nachgeführt (Maßnahme wirkt nicht zwangsläufig!)<br />
(Abbildung 33).<br />
Abb. 32:<br />
Absaugung mit halboffenem Erfassungssystem<br />
Abb. 33: Absaugung mit offenem Erfassungssystem
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Lüftungsmaßnahmen im Raum<br />
Hierunter versteht man Maßnahmen, die bezogen auf den Raum<br />
für den notwendigen Luftaustausch (Frischluftzufuhr bzw. Wärmeabfuhr)<br />
sorgen.<br />
Die einfachste Art der Raumlüftung ist die Fensterlüftung, jedoch<br />
gerade in den Wintermonaten hat jeder bestimmt schon feststellen<br />
müssen, dass hiermit kein akzeptabler Lüftungseffekt erzielt wird.<br />
Eine technische Zu- und Abluftanlage im Raum ist immer dann erforderlich,<br />
wenn an verhältnismäßig vielen Maschinen Absauganlagen<br />
installiert sind, bzw. wenn eine ausreichende Erfassung der<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong> an der Entstehungs- oder Austrittstelle nicht möglich<br />
ist.<br />
Die technische Lüftung muss zum einen dafür sorgen, dass ein Ausgleich<br />
der Luftbilanzen im Raum erfolgt, zum anderen muss ausreichend<br />
Frischluft zugeführt werden.<br />
Maschinenabsaugungen und Raumlüftung müssen also aufeinander<br />
abgestimmt sein.<br />
Wichtig ist auch, dass eine Luftströmung im Raum erzeugt wird,<br />
die dafür sorgt, dass die <strong>Gefahrstoffe</strong>missionen nicht über den<br />
Atembereich des Beschäftigten, sondern von ihm weg geleitet<br />
werden (Abbildung 34 und 35).<br />
Grundlage für die Auslegung und Planung lufttechnischer Anlagen<br />
sind zunächst die Luftströme die zur <strong>Gefahrstoffe</strong>rfassung (Erfassungsluftstrom)<br />
und zur Raumlüftung (Außen- und Umluftströme)<br />
benötigt werden. Sie sind entsprechend den jeweils zu erwartenden<br />
Stoff- und Wärmelasten zu bemessen. Zielvorgabe sind neben<br />
der Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte<br />
65
66<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Abluft<br />
auch die mindestens einzuhaltenden klimatischen Raumbedingungen<br />
(Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Strahlungstemperatur),<br />
die in der Arbeitsstättenverordnung bzw. den Arbeitsstättenrichtlinien<br />
(ASR 5 „Lüftung“ und ASR 6 „Raumtemperatur“)<br />
festgelegt sind.<br />
Zuluft<br />
Abb. 34: Schlechte Luftführung im Raum<br />
Zuluft<br />
Abb. 35: Gute Luftführung im Raum
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Weitere wichtige Orientierungshilfen für die Planung lufttechnischer<br />
Anlagen sind in der BGR 121 „Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische<br />
Maßnahmen“ sowie in der VDI 2262 Bl. 3 „Luftbeschaffenheit<br />
am Arbeitsplatz; Minderung der Exposition durch luftfremde<br />
Stoffe“ enthalten.<br />
Reinluftrückführung<br />
Wird die am Arbeitsplatz abgesaugte belastete Luft über einen<br />
wirksamen Abscheider geführt und dann wieder als gereinigte Luft<br />
in den Arbeitsraum zurückgeleitet, spricht man von der sogenannten<br />
Reinluftrückführung.<br />
Voraussetzung für die Reinluftrückführung ist die ausreichende Abscheidung<br />
luftfremder Stoffe. Hinsichtlich des Abscheidegrades<br />
und der Wirksamkeit werden daher ganz spezielle Anforderungen<br />
an den Abscheider gestellt. Ob ein Abscheider die Anforderungen<br />
erfüllt, erkennt der Betriebspraktiker am einfachsten an<br />
dem Prüfzeugnis, ausgestellt durch eine anerkannte Prüfstelle.<br />
Beispielsweise wird geprüft, ob hinter dem Abscheider bestimmte<br />
Grenzkonzentrationen eingehalten werden. Für <strong>Gefahrstoffe</strong> mit<br />
Arbeitsplatzgrenzwerten darf ein fünftel des vorgeschriebenen<br />
Wertes nicht überschritten werden (siehe hierzu VDI 2262 Bl. 3).<br />
In Arbeitsbereichen, in denen mit Krebs erzeugenden Stoffen umgegangen<br />
wird, darf abgesaugte Luft grundsätzlich nicht zurückgeführt<br />
werden. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn die<br />
Reinluftrückführung unter Anwendung behördlich oder berufsgenossenschaftlich<br />
anerkannter Verfahren oder Geräte geschieht.<br />
Konkrete Hinweise gibt hier die TRGS 560 „Luftrückführung beim<br />
Umgang mit Krebs erzeugenden <strong>Gefahrstoffe</strong>n“. Auf die Einhaltung<br />
der hierin enthaltenen Festlegungen sollte der Anwender bereits<br />
beim Einkauf achten (Herstellerbescheinigungen).<br />
67
68<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Lufttechnische Einrichtungen mit Reinluftrückführung können ortsveränderlich<br />
oder auch ortsfest sein.<br />
Weit verbreitet sind Entstauber, Industriestaubsauger oder Kehrsaugmaschinen<br />
für den ortsveränderlichen Betrieb. Das Berufsgenossenschaftliche<br />
Institut für Arbeitsschutz (BGIA) in Sankt Augustin<br />
prüft solche Einrichtungen und veröffentlicht die positiv bescheinigten<br />
staubbeseitigenden Maschinen und Geräte in regelmäßigen<br />
Abständen. Neben der staubtechnischen Prüfung auf der<br />
Grundlage der DIN EN 60335-2-69 Anhang AA, findet auch eine<br />
sicherheitstechnische Prüfung entsprechend dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz<br />
(GPSG) sowie eine Begutachtung hinsichtlich<br />
des Staubexplosionsschutzes statt (Abbildung 36).<br />
Abb. 36: Industriestaubsauger, Verwendungskategorie<br />
S, geeignet zum<br />
Aufsaugen brennbarer Stäube –<br />
Staubexplosionsklasse St 1 und St 2<br />
in Zone 11<br />
Bei der Auswahl ortsveränderlicher Geräte<br />
sind die unterschiedlichen Verwendungskategorien<br />
und Eignungsbereiche von Bedeutung.<br />
In Abbildung 37 werden die früher<br />
gebräuchlichen Verwendungskategorien und<br />
Eignungsbereiche ortsveränderlicher Staub<br />
beseitigender Maschinen und Geräte auf<br />
der Basis der alten, nicht mehr gültigen Einteilung<br />
dargestellt. Nach den neuen Prüfgrundsätzen<br />
gibt es nur noch drei Staubklassen<br />
in Abhängigkeit vom maximalen<br />
Durchlassgrad: L, M und H. Abbildung 38<br />
(aus BGIA-Handbuch: Sicherheit und Gesundheitsschutz<br />
am Arbeitsplatz, Sachgruppe<br />
510210, Erich Schmidt Verlag, Bielefeld)<br />
zeigt die nach der internationalen<br />
Norm festgeschriebenen neuen Eignungskriterien.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Verwendungskategorie<br />
U<br />
S<br />
G<br />
C<br />
K1<br />
K2<br />
B1<br />
Eignung für Stäube<br />
mit MAK-Werten<br />
> 1 [mg/m 3 ]<br />
mit MAK-Werten<br />
> 0,1 [mg/m 3 ]<br />
mit MAK-Werten<br />
– mit MAK-Werten<br />
– von Krebs erzeugenden<br />
Stoffen<br />
(§ 35, GefStoffV),<br />
ausgenommen<br />
besonders gefährliche<br />
Krebs<br />
erzeugende<br />
Stoffe (§ 15a,<br />
GefStoffV)<br />
– mit MAK-Werten<br />
– von Krebs erzeugenden<br />
Stoffen<br />
(§ 35, GefStoffV)<br />
– mit Krankheitserregern<br />
der Staubexplosionsklassen<br />
St1<br />
und St 2 in Zone11<br />
Durchlassgrad<br />
[%]<br />
≤ 5<br />
≤1<br />
≤ 0,5<br />
≤ 0,1<br />
≤ 0,05<br />
Filterflächenbelastung<br />
[m 3 m -2 h -1 ]<br />
≤ 500<br />
≤ 1000 1)<br />
≤ 200<br />
≤ 200<br />
≤ 200<br />
≤ 200<br />
Vorabscheider<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
Vorab- Kontrolleinrichtung VorabAbreinischeiderscheidergungseinrichtung Anzeige<br />
–<br />
IS, KSM<br />
IS, KSM<br />
IS, KSM<br />
IS, KSM<br />
Warnsignal<br />
o. Abschaltung<br />
Abb. 37: Staub beseitigende Maschinen und Geräte (SBM) – Verwendungskategorien,<br />
Eignung, staubtechnische Anforderungen an Kehrsaugmaschinen (KSM), Industriestaubsauger<br />
(IS), Entstauber (EOB) anhand der alten, nicht mehr gültigen Einteilung, neue Einteilung<br />
siehe Abb. 38<br />
1) bei Industriestaubsaugern, die bestimmungsgemäß zur Reinigung von Büroräumen, Verkaufsstätten oder ähnlichem<br />
eingesetzt werden.<br />
2) bei Geräten für Stäube mit Krankheitserregern nur Wechselfilter<br />
3) bei Geräten für Stäube mit Krankheitserregern kontaminationsfrei<br />
EOB<br />
EOB<br />
EOB<br />
EOB<br />
EOB<br />
–<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
alle SBM 2)<br />
Staubsammelbehälter<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
je nach sonstiger Verwendungskategorie (S, G, C oder K)<br />
Vorab- Entsorgung Vorabscheiderscheider<br />
staubarm<br />
–<br />
alle SBM<br />
–<br />
–<br />
–<br />
staubfrei<br />
–<br />
–<br />
alle SBM<br />
alle SBM<br />
alle SBM 3)<br />
69
70<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Staubklasse<br />
L leicht<br />
M mittel<br />
H hoch<br />
Zusätzlich<br />
B 1<br />
Eignung für Stäube mit<br />
Expositionsgrenzwerten<br />
>1mgm -3<br />
≥0,1mgm -3<br />
alle (inkl. Krebs erzeugende<br />
Stäube und Stäube<br />
mit Krankheitserregern)<br />
brennbare Stäube aller<br />
Staubexplosionsklassen in<br />
Zone 11<br />
Asbeststaub im Geltungsbereich<br />
der TRGS 519<br />
Durch<br />
lassgrad<br />
max.<br />
[%]<br />
1<br />
0,1<br />
0,005<br />
Filtermaterial<br />
je nach Staubklasse M oder H<br />
Prüfung<br />
Staubklasse H (Verwendungskategorie K 1)<br />
Abb. 38: Staub beseitigende Maschinen und Geräte (SBM) – Staubklassen, Eignung, staubtechnische<br />
Anforderungen an Kehrsaugmaschinen (KSM), Industriestaubsauger (IS),<br />
Entstauber (ENT)<br />
8.2.4 Organisatorische Schutzmaßnahmen<br />
X<br />
X<br />
Filterelement<br />
X<br />
Gesamtgerät<br />
Herstellungs- und Verwendungsverbote<br />
Diese bestehen nach § 18 GefStoffV in Verbindung mit Anhang IV<br />
für Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die:<br />
X<br />
X
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
• Krebs erzeugende oder Erbgut verändernde Eigenschaften haben,<br />
• sehr giftig oder giftig sind oder<br />
die Umwelt schädigen können.<br />
•<br />
Im Anhang IV der GefStoffV wird detailliert geregelt für welche<br />
Anwendungsfälle das Verbot konkret gilt und welche Ausnahmen<br />
es gibt. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung muss geprüft werden,<br />
ob Stoffe für die ein Herstellungs- oder Verwendungsverbot<br />
gilt eingesetzt werden bzw. ob solche Stoffe bei der Tätigkeit entstehen.<br />
Generell ist nach dem Substitutionsgebot bereits im betrieblichen<br />
Freigabeverfahren festzulegen, solche Stoffe zu ersetzen.<br />
Beispiele für Herstellungs- und Verwendungsverbote:<br />
Asbest Asbest sowie asbesthaltige Zubereitungen<br />
und Erzeugnisse mit einem Massengehalt<br />
von mehr als 0,1% Asbest dürfen nicht<br />
hergestellt oder verwendet werden.<br />
Das Verbot gilt beispielsweise nicht für<br />
Abbruch-, Sanierungs-, oder Instandhaltungsarbeiten<br />
an bestehenden Anlagen.<br />
(siehe hierzu TRGS 519 „Asbest: Abbruch-,<br />
Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten“)<br />
Aliphatische Chlorkohlen- Die Verwendung ist nur in geschlossenen<br />
wasserstoffe u.a. Anlagen erlaubt.<br />
• Tetrachlormethan<br />
• Trichlormethan (Chloroform)<br />
• 1,1,1-Trichlorethan<br />
71
72<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Kühlschmierstoffe Kühlschmierstoffe, denen nitrosierende<br />
Agenzien als Komponenten zugesetzt<br />
worden sind, dürfen nicht verwendet<br />
werden.<br />
In der praktischen Umsetzung heißt dies,<br />
dass beim Einsatz wassergemischter KSS<br />
in der spanenden Metallbearbeitung regelmäßige<br />
Kontrollen nach nitrosierenden<br />
Agenzien, d.h. Nitrit, Nitrat, durchgeführt<br />
werden müssen (siehe auch<br />
TRGS 611 „Verwendungsbeschränkungen<br />
für wassermischbare bzw. wassergemischte<br />
Kühlschmierstoffe, bei deren<br />
Einsatz N-Nitrosamine auftreten können“).<br />
Zum Schutz besonders schutzbedürftiger Personengruppen wie Jugendliche,<br />
werdende und stillende Mütter und gebärfähige<br />
Frauen gelten besondere Schutzmaßnahmen (siehe auch § 4 Arb-<br />
SchG).<br />
Die Regelungen zum Mutterschutz sind in der Mutterschutzrichtlinienverordnung<br />
näher ausgeführt.<br />
In Heimarbeit Beschäftigte dürfen nur Tätigkeiten mit geringer Gefährdung<br />
durchführen.<br />
Weiterhin können Beschäftigungsbeschränkungen bzw. -verbote<br />
aufgrund arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen vom Betriebsarzt<br />
ausgesprochen werden, wenn bei dem Beschäftigten<br />
gesundheitliche Bedenken vorliegen.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Betriebsanweisung und Unterweisung<br />
Um falsche Handhabungen und mögliche Verhaltensfehler als Unfallursachen<br />
auszuschalten, hat der Unternehmer für Tätigkeiten<br />
mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebsanweisungen<br />
zu erstellen (§ 14 GefStoffV). Die zu erstellende Betriebsanweisung<br />
muss letztlich der Gefährdungsbeurteilung Rechnung<br />
tragen, die bei Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n oder wenn <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
bei Tätigkeiten entstehen, durchzuführen ist. Nicht zu<br />
verwechseln ist dies mit der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung.<br />
Die Betriebsanweisung soll nur noch die Anweisungen<br />
enthalten, die neben den bereits getroffenen technischen, persönlichen<br />
und organisatorischen Schutzmaßnahmen ein sicheres Arbeiten<br />
mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n ermöglichen.<br />
Eine Betriebsanweisung muss mindestens enthalten:<br />
Informationen über die am Arbeitsplatz auftretenden <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
(Bezeichnung, Kennzeichnung, Gefährdungen)<br />
Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln und Maßnahmen,<br />
insbesondere<br />
• Hygienevorschriften,<br />
• Maßnahmen zur Verhütung einer Exposition,<br />
• Tragen und Benutzen von Schutzausrüstung und Schutzkleidung<br />
Informationen über Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen<br />
und Notfällen sowie zur Verhütung dieser Ereignisse<br />
Die TRGS 555 „Betriebsanweisung und Unterweisung“ konkretisiert<br />
diese Mindestforderungen.<br />
73
74<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Hierin wird eine Gliederung nach folgenden Punkten empfohlen:<br />
•<br />
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong> (Bezeichnungen)<br />
Gefahren für Mensch und Umwelt<br />
Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln<br />
Verhalten im Gefahrfall<br />
Erste Hilfe<br />
Sachgerechte Entsorgung<br />
Die für eine Betriebsanweisung notwendigen Informationen können<br />
aus der Kennzeichnung, aus Produktinformationen, Herstellerhinweisen<br />
und aus dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.<br />
Hinweise zu möglichen Gefahren, die von einigen <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
ausgehen enthält u. a. die BGI 536 „Gefährliche chemische<br />
Stoffe“.<br />
Einige Betriebe haben firmeninterne Arbeitsstoffmerkblätter verfasst,<br />
die den verantwortlichen Beschäftigten zur Information zur<br />
Verfügung gestellt werden und eine Hilfe bei der Erstellung der Betriebsanweisung<br />
sein können.<br />
Die Betriebsanweisung muss an geeigneter Stelle im Betrieb bekannt<br />
gemacht und vom Betriebsleiter offiziell eingeführt werden.<br />
Datum und Unterschrift sollten auf keinen Fall fehlen.<br />
Eine Muster-Betriebsanweisung für Tätigkeiten mit Mineralwolle-<br />
Dämmstoffen ist in Abbildung 39 dargestellt.<br />
Weitere Muster-Betriebsanweisungen sowie Hilfestellungen zur Erstellung<br />
von Betriebsanweisungen sind in der Broschüre „Betriebsanweisungen<br />
für Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n (Baukasten mit CD-<br />
ROM)“ der BGFE enthalten; Bestell-Nr. B 00.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Firma:<br />
BETRIEBSANWEISUNG Stand: ____________<br />
Arbeitsbereich: Instandhaltung<br />
GEM. § §14 14 ABS.1 GEFSTOFFV GEFSTOFFV<br />
Verantwortlich: ______________________________<br />
Unterschrift<br />
Arbeitsplatz:<br />
Tätigkeit: Arbeiten mit Mineralwolle-Dämmstoffen<br />
Gefahrstoffbezeichnung<br />
Mineralwolle-Dämmstoffe Produktbezeichnung: _____________________________________<br />
Sie bestehen aus unterschiedlich dicken Glas-, Stein- oder Schlackenfasern, die mit Kunststoffen gebunden<br />
und denen Mineralöle zugegeben sind.<br />
Diese Betriebsanweisung gilt nur für Mineralwolle-Dämmstoffe, für die keine Einstufung als Krebs erzeugend<br />
vorliegt (z.B. Kanzerogenitätsindex KI ≥ 40, Biopersistenz ≤ 40 Tage).<br />
Gefahren für Mensch und Umwelt<br />
Bei der Demontage und Montage von Mineralwolle-Dämmstoffen können Gesundheitsgefahren<br />
von freigesetzten Faserstäuben und von den Zusatzstoffen ausgehen.<br />
Insbesondere kann es beim Abriss zu einer erheblichen Staubbelastung kommen.<br />
Die Faserstäube können Reizungen der Haut, Augen und der Atemwege verursachen.<br />
Infolge der Staubeinwirkung kann es zu Beeinträchtigungen der Atemfunktionen kommen.<br />
Zusatzstoffe (z.B. Formaldehyd-Harze) können allergische Reaktionen auslösen.<br />
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln<br />
Oberstes Gebot: Staubentwicklung vermeiden!<br />
– vorkonfektionierte Mineralwolle-Dämmstoffe bevorzugen,<br />
– Material nicht werfen,<br />
– Verpackung erst an der Einbaustelle öffnen (vorsichtig aufschneiden),<br />
– Arbeitsplatz im Umkreis von ca. 5 m absperren,<br />
– zu entfernendes Material möglichst befeuchten,<br />
– Material möglichst vorsichtig demontieren und montieren, nicht reißen,<br />
– zu entfernendes Material unmittelbar an der Ausbaustelle in Säcke verpacken,<br />
– Zuschnitt nur auf fester Unterlage mit scharfem Messer,<br />
– Arbeitsplatz nach Beendigung und erforderlichenfalls während der Arbeit mit Staubsauger<br />
Typ: _______________________ reinigen, keinesfalls mit Druckluft abblasen,<br />
– nach Beendigung der Arbeit Kleidung, Haut und Werkzeug reinigen (abwaschen mit Wasser oder<br />
absaugen, niemals mit Druckluft abblasen),<br />
– am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und rauchen.<br />
Augenschutz: Bei starker Staubentwicklung und Überkopfarbeiten Korbbrille tragen.<br />
Handschutz: Schutzhandschuhe aus Leder oder Kunststoff (mit Gewebeeinlage) tragen.<br />
Atemschutz: Atemschutzgerät mit Partikelfilter der Partikelfilterklasse P2 bzw. FFP2 verwenden.<br />
Hautschutz: Schutz (vor der Arbeit) ____________________________<br />
Reinigung (vor Pausen und zu Arbeitsende) ____________________________<br />
Körperschutz: Einweganzug benutzen, bei Überkopfarbeiten Kapuze aufsetzen oder Nackenschutz verwenden.<br />
Verhalten im Gefahrfall<br />
Werden bei Abisolierarbeiten Materialien vorgefunden, bei denen es sich um Asbest<br />
handeln könnte, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Vorgesetzte ist zu<br />
verständigen.<br />
Erste Hilfe<br />
Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen.<br />
Ersthelfer: ______________________, Tel.: _______________ Notruf: _______________<br />
Sachgerechte Entsorgung<br />
Mineralwolle-Dämmstoffe (entferntes Material, Verschnitt) direkt an der Ausbau- bzw. Einbaustelle<br />
in Säcke verpacken; Staubentwicklung dabei möglichst gering halten. Beim Verschließen<br />
der Säcke die Luft vorsichtig herausdrücken. Entsorgung über: ______________________<br />
Abb. 39: Muster-Betriebsanweisung für Tätigkeiten mit Mineralwolle-Dämmstoffen<br />
75
76<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Anhand der Betriebsanweisung sind die Beschäftigten über die<br />
auftretenden Gefahren sowie über die zu treffenden Schutzmaßnahmen<br />
vor der Beschäftigung und danach mindestens einmal<br />
jährlich zu unterweisen. Die Unterweisungen sind zu dokumentieren<br />
und von den unterwiesenen Personen durch Unterschrift zu bestätigen.<br />
Im Rahmen der Unterweisungen sollen die Beschäftigten darüber<br />
hinaus eine allgemeine arbeitsmedizinische-toxikologische Beratung<br />
unter Beteiligung eines Arbeitsmediziners erhalten. Hierbei<br />
soll auch auf die Angebotsuntersuchungen sowie auf besondere<br />
Gesundheitsgefahren bei Tätigkeiten mit bestimmten <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
hingewiesen werden (§ 14 Abs. 3 GefStoffV).<br />
Bei Tätigkeiten mit geringer Gefährdung kann die Betriebsanweisung<br />
mit Unterweisung nach § 14 GefStoffV entfallen (siehe auch<br />
Abschnitt 8.1). Die generelle Verpflichtung zur Unterweisung nach<br />
BGV A1 bleibt jedoch hiervon unberührt.<br />
Erste Hilfe<br />
Trotz aller Schutzmaßnahmen sind Unfälle bei Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
nie völlig auszuschließen. Der Betrieb muss sich daher<br />
auf dieses ungewünschte Ereignis bestmöglich einrichten.<br />
Die Wirksamkeit einer „Ersten Hilfe“ ist wesentlich bestimmt von<br />
einem reibungslosen Funktionieren der Ersten-Hilfe-Organisation,<br />
d. h. der sogenannten Rettungskette im Betrieb.<br />
Abgestimmt auf das bei Tätigkeiten mit einem Gefahrstoff mögliche<br />
Unfallrisiko sind entsprechende materielle und personelle<br />
Voraussetzungen zu schaffen.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“<br />
BGV A 1 hat der Unternehmer u. a. dafür zu sorgen, dass<br />
• die erforderlichen Einrichtungen, d. h. Erste-Hilfe-Material, Rettungsgeräte,<br />
Meldeeinrichtungen<br />
und<br />
• ausreichend ausgebildete Ersthelfer<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass nach einem Unfall sofortige<br />
Erste Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung<br />
veranlasst wird.<br />
Konkrete Hinweise zur Ersten Hilfe sind den Sicherheitsdatenblättern<br />
sowie u. a. den BG-Informationen:<br />
• BGI 536 „Gefährliche chemische Stoffe“<br />
• BGI 509 „Erste Hilfe im Betrieb“<br />
zu entnehmen.<br />
Soweit bei Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n damit zu rechnen ist,<br />
dass bei Unfällen Maßnahmen erforderlich werden, die nicht Gegenstand<br />
der üblichen Ersthelfer-Ausbildung sind, muss der Unternehmer<br />
für die erforderliche zusätzliche Aus- und Fortbildung sorgen.<br />
Für bestimmte Arbeitsbereiche, z. B. Laboratorien, galvanotechnische<br />
Betriebe wird die Installation leicht und schnell erreichbarer<br />
Notduschen bzw. Augenduschen erforderlich, da hier durch möglicherweise<br />
verspritzende oder auslaufende ätzende Stoffe Haut<br />
77
78<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
und Augen geschädigt werden können (Abbildung<br />
40).<br />
Bei Arbeiten in Behältern oder Arbeitsbereichen<br />
mit erhöhter gastechnischer Gefährdung,<br />
kann das Bereithalten besonderer Rettungsgeräte,<br />
z. B. Atemschutz, Sicherheitsund<br />
Rettungsgeschirre erforderlich werden.<br />
Die Festlegungen zur Ersten Hilfe sind in<br />
die Betriebsanweisung aufzunehmen.<br />
8.2.5 Arbeitsmedizinische Vorsorge<br />
Technische und organisatorische Maßnahmen<br />
zur Vermeidung von Gesundheitsge-<br />
Abb. 40: Notdusche in einem fahren haben grundsätzlich Vorrang. Ver-<br />
Arbeitsbereich mit Verätzungsgefahr bleiben dennoch Gefahren, sind vom Unternehmer<br />
bei Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge<br />
zu treffen. Dazu gehören u.a. die arbeitsmedizinische Beurteilung<br />
gefahrstoff- und tätigkeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen<br />
einschließlich der Empfehlung geeigneter Schutzmaßnahmen,<br />
die Aufklärung und Beratung der Beschäftigten über die mit der<br />
Tätigkeit verbundenen Gesundheitsgefährdungen sowie spezielle<br />
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung<br />
von Gesundheitsstörungen und Berufskrankheiten.<br />
Die speziellen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen werden<br />
vom Unternehmer veranlasst oder angeboten und erfolgen als<br />
1. Erstuntersuchungen vor Aufnahme einer gefährdenden Tätigkeit,
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Nachuntersuchungen in regelmäßigen Abständen während<br />
dieser Tätigkeit,<br />
3. Nachuntersuchungen bei Beendigung dieser Tätigkeit,<br />
4. Nachuntersuchungen bei Tätigkeiten mit Krebs erzeugenden<br />
(C) oder Erbgut verändernden (M) Stoffen der Kategorien 1<br />
und 2 auch nach Beendigung der Beschäftigung,<br />
5. Untersuchungen aus besonderem Anlass nach § 16 Abs. 4<br />
GefStoffV<br />
Abbildung 41 veranschaulicht diesen Zusammenhang.<br />
Erstuntersuchung<br />
Nachuntersuchungen<br />
gefährdende<br />
Tätigkeit<br />
Nachuntersuchung<br />
Beginn Ende<br />
keine<br />
gefährdende<br />
Tätigkeit<br />
Abbildung 41: Spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen<br />
Nachuntersuchung<br />
bei CM-Stoffen<br />
79
80<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Die Gefahrstoffverordnung enthält eine klare Aussage zur Qualifikation<br />
der Ärzte. Der Unternehmer darf für die arbeitsmedizinische<br />
Vorsorge nur Ärzte beauftragen, die entweder Fachärzte für<br />
Arbeitsmedizin sind oder die die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“<br />
führen (Abbildung 42).<br />
Unternehmer<br />
beauftragt<br />
Betriebsarzt<br />
Facharzt für Arbeitsmedizin oder<br />
Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“<br />
Arbeitsmedizinische<br />
Vorsorgeuntersuchungen<br />
zieht ggf. hinzu<br />
Ärzte mit besonderen Fachkenntnissen<br />
oder spezieller Ausrüstung<br />
Abbildung 42: Anforderungen an den Betriebsarzt<br />
Die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sind als Angebots-<br />
oder Pflichtuntersuchungen geregelt. Die Pflichtuntersuchung<br />
wird gefordert und ist Voraussetzung für die Beschäftigung:<br />
• bei Tätigkeiten mit Stoffen nach Anhang V Nr.1, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert<br />
nicht eingehalten wird
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
• bei Tätigkeiten mit den in Anhang V Nr.1 gennanten Stoffen,<br />
sofern Hautkontakt mit hautresorptiven Stoffen besteht oder<br />
bei Tätigkeiten nach Anhang V Nr. 2.1 GefStoffV<br />
•<br />
Stoffe nach Anhang V Nr.1 sind u.a. Blei und seine Verbindungen,<br />
einatembarer und alveolengängiger Staub, Chrom(VI)-Verbindungen,<br />
Hartholzstaub, Methanol, Tetrachlorethen.<br />
Tätigkeiten nach Anhang V Nr. 2.1 GefStoffV sind u. a. Tätigkeiten<br />
mit Belastung durch unausgehärtete Epoxidharze und Kontakt<br />
über die Haut oder die Atemwege.<br />
Angebotsuntersuchungen sind vom Unternehmer anzubieten bei<br />
einer Exposition gegenüber den in Anhang V Nr. 1 gelisteten <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
und bei Tätigkeiten nach Anhang V Nr. 2.2.<br />
Für die Durchführung der Vorsorgeuntersuchungen bestehen „Berufsgenossenschaftliche<br />
Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“.<br />
Die Grundsätze beschreiben, wie die Untersuchungen<br />
vom Arzt durchzuführen und wie die Untersuchungsergebnisse<br />
zu beurteilen sind.<br />
Für die Beschäftigten, die ärztlich untersucht worden sind, ist vom<br />
Arbeitgeber eine Vorsorgekartei zu führen.<br />
Der Unternehmer hat weiterhin sicherzustellen, dass für alle Beschäftigten,<br />
die Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n durchführen, eine allgemeine<br />
arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung durchgeführt<br />
wird. Diese Beratung soll im Rahmen der Unterweisung erfolgen.<br />
Dabei sind die Beschäftigten über Angebotsuntersuchungen nach<br />
der GefStoffV zu unterrichten sowie auf besondere Gesundheitsgefahren<br />
bei Tätigkeiten mit bestimmten <strong>Gefahrstoffe</strong>n hinzuweisen.<br />
81
82<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
8.2.6 Persönliche Schutzausrüstung<br />
und Hygiene<br />
Nicht immer ist durch technische<br />
Schutzmaßnahmen allein<br />
ein ausreichender Schutz der<br />
Beschäftigten zu erreichen. In<br />
der betrieblichen Praxis ist dies<br />
besonders bei Instandhaltungssowie<br />
bei Reinigungsarbeiten<br />
der Fall (Abbildung 43).<br />
Als persönliche Schutzausrüstung<br />
(PSA) kommen insbesondere<br />
in Betracht:<br />
• Augen- und Gesichtsschutz<br />
• Atemschutzgeräte<br />
• Schutzkleidung<br />
• Schutzhandschuhe<br />
Abb. 43: Persönliche Schutzausrüstung bei Instand- • Fuß- und Kopfschutz<br />
haltungsarbeiten<br />
Ganz deutlich sei an dieser<br />
Stelle noch einmal herausgestellt, dass zwangsläufig wirksame<br />
technische Schutzmaßnahmen immer Vorrang haben müssen.<br />
Wo solche Maßnahmen möglich sind, darf PSA nur als vorübergehende<br />
– oder ergänzende – Maßnahme zur Anwendung kommen.<br />
Das Arbeitsschutzgesetz (§ 4) und die GefStoffV (§ 9) regeln konkret,<br />
dass „individuelle Maßnahmen nachrangig zu anderen Maßnahmen“<br />
zu treffen sind.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Die BGV A1 bestimmt nach § 29 die Bereitstellung von PSA nach<br />
der PSA-Benutzungsverordnung.<br />
Hiernach muss die PSA:<br />
• der 8. Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz<br />
über das Inverkehrbringen von PSA entsprechen<br />
• Schutz gegenüber der zu verhütenden Gefährdung bieten<br />
ohne selbst eine größere Gefährdung zu verursachen<br />
• für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet sein<br />
• den ergonomischen Anforderungen und den gesundheitlichen<br />
Erfordernissen der Beschäftigten entsprechen<br />
• den Beschäftigten individuell passen und grundsätzlich für den<br />
Gebrauch durch eine Person bestimmt sein<br />
Der Beschäftigte muss vor der Bereitstellung der PSA angehört<br />
werden. Dies empfiehlt sich schon aus Gründen der hiermit zu erreichenden<br />
Akzeptanzerhöhung bei den betroffenen Beschäftigten.<br />
Die Wirksamkeit einer PSA ist entscheidend abhängig von:<br />
• dem sicherheitsbewussten Verhalten des Beschäftigten (wird<br />
die PSA auch getragen?)<br />
• der Akzeptanz durch den Beschäftigten<br />
• den Trageeigenschaften der PSA<br />
• der zweckgerichteten Auswahl der PSA (auf die Tätigkeit, den<br />
Gefahrstoff abgestimmt)<br />
• der richtigen Anwendung der PSA<br />
Die Auswahl geeigneter PSA ist u.a. abhängig von:<br />
•<br />
dem zu schützenden Körperteil<br />
den <strong>Gefahrstoffe</strong>igenschaften und -wirkungen<br />
83
84<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
•<br />
der Art der Tätigkeit mit dem Gefahrstoff<br />
den auftretenden Gefahrstoffkonzentrationen<br />
den Umgebungsbedingungen (Sauerstoffgehalt, Klima, Hitze etc.)<br />
der Eignung des Beschäftigten<br />
Die Auswahl geeigneter PSA liegt im Verantwortungsbereich des<br />
Vorgesetzten, der sich natürlich durch die betriebliche Sicherheitsfachkraft,<br />
den Betriebsarzt und nicht zuletzt durch die Berufsgenossenschaft<br />
beraten lassen sollte.<br />
Wertvolle Hinweise und Auswahlkriterien geben hier die „Regeln für<br />
den Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen“, u. a.:<br />
•<br />
BGR 189 „Einsatz von Schutzkleidung“<br />
BGR 190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“<br />
BGR 192 „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“<br />
BGR 195 „Einsatz von Schutzhandschuhen“.<br />
Zu den Anwendungsbereichen von PSA einige Beispiele:<br />
Augenschutz<br />
Bei Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n, die die Augen schädigen können<br />
(z. B. ätzende Stoffe, wie Säuren und Laugen) sowie in bestimmten<br />
Arbeitsbereichen (z. B. chemischen Laboratorien, Galvaniken)<br />
sollte das Tragen von Augenschutz für die Beschäftigten<br />
selbstverständlich sein (Abbildung 44 und 45).<br />
Art und Ausführung des Augenschutzes richten sich nach den gefährlichen<br />
Eigenschaften des <strong>Gefahrstoffe</strong>s, der Konzentration sowie<br />
Art und Umfang der Tätigkeiten.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Abb. 44: Gestellbrille mit Seitenschutz<br />
in chemischen Laboratorien oder für<br />
Überwachungsaufgaben im Betrieb<br />
Abb. 45: Tragen von Gesichtsschutz in Kombination<br />
mit anderer Schutzkleidung beim Spritzentfetten<br />
mit alkalischem Medium<br />
Atemschutz<br />
Das Tragen von Atemschutz wird dann erforderlich, wenn für den<br />
Beschäftigten die Gefahr besteht, dass <strong>Gefahrstoffe</strong> in gesundheitsgefährlicher<br />
Konzentration eingeatmet werden können. Häufig<br />
ist dies bei Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie bei unkontrollierten<br />
Betriebszuständen der Fall.<br />
Atemschutzgeräte wirken durch ihr Gewicht und ihren Atemwiderstand<br />
auf den Träger belastend. Sie dürfen daher nur von dafür<br />
geeigneten und arbeitsmedizinisch überwachten Personen getragen<br />
werden.<br />
85
86<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
gegen Partikel<br />
z. B. Stäube von<br />
Quarz, Blei, Asbest<br />
Partikelfilter Partikelund<br />
filtrierende<br />
Atemanschluss Halbmaske<br />
Filtergeräte<br />
gegen Gase und<br />
Dämpfe<br />
z. B. Stickoxide,<br />
Kohlenmonoxid,<br />
Ammoniak,<br />
Lösemitteldämpfe<br />
Gasfilter Filtrierende<br />
und Atem- Halbmaske<br />
anschluss gegen Gase<br />
und Dämpfe<br />
gegen Partikel sowie<br />
Gase und Dämpfe<br />
z. B. Farbnebel<br />
Kombinations- Filtrierende<br />
filter und Atem- Halbmaske<br />
anschluss gegen Partikel,<br />
Gase<br />
und Dämpfe<br />
Abb. 46: Übersicht über die Filtergeräte
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Isoliergeräte<br />
nicht frei tragbare frei tragbare<br />
Frischluft-Schlauchgeräte<br />
Saugschlauch:<br />
Atemluft wird aus schadstofffreier<br />
Atmosphäre<br />
vom Träger angesaugt<br />
Druckschlauch:<br />
Atemluft wird aus Druckluftflaschen,Luftverdichtern<br />
u. a. zugeführt<br />
(geringer Überdruck)<br />
Druckluft-Schlauchgeräte<br />
Atemluft wird mit einem<br />
Überdruck bis zu 16 bar<br />
an das Atemgerät herangeführt!<br />
Abb. 47: Einteilung der Isoliergeräte<br />
Behältergeräte<br />
Pressluftatmer oder<br />
Überdruckpressluftatmer<br />
Regenerationsgeräte<br />
Das Ausatemgas wird<br />
im Gerät zu Sauerstoff<br />
regeneriert<br />
87
88<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Grundsätzlich teilt man Atemschutzgeräte in abhängig von der<br />
Umgebungsluft wirkende Filtergeräte sowie unabhängig von der<br />
Umgebungsluft wirkende Isoliergeräte ein.<br />
Filtergeräte dürfen nur dann angewandt werden, wenn:<br />
• die Umgebungsluft mindestens 17 Vol % Sauerstoff enthält<br />
und<br />
• die höchstzulässige Gefahrstoffkonzentration nicht überschritten<br />
wird.<br />
In allen anderen Fällen wären die unabhängig von der Umgebungsluft<br />
wirkenden Isoliergeräte einzusetzen.<br />
Die Abbildungen 46 und 47 geben eine grobe Übersicht über Filtergeräte<br />
und Isoliergeräte (siehe hierzu BGR 190).<br />
Schutzhandschuhe<br />
Die häufigste Kontaktmöglichkeit zu <strong>Gefahrstoffe</strong>n erfolgt in der<br />
Regel über die Hände.<br />
Kann ein Hautkontakt verfahrensbedingt nicht ausgeschlossen<br />
werden, müssen den betroffenen Beschäftigten geeignete Schutzhandschuhe<br />
zur Verfügung stehen und diese von ihnen getragen<br />
werden.<br />
Was heißt nun geeignet?<br />
Wichtig ist zunächst einmal, dass das Handschuhmaterial gegen<br />
den Gefahrstoff, gegen den es schützen soll, ausreichend beständig<br />
und undurchlässig ist (Abbildung 48).
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Ein Handschuhmaterial, das eine gute<br />
Schutzwirkung gegen einen bestimmten<br />
Gefahrstoff aufweist, muss noch lange nicht<br />
auch gegen einen anderen Stoff schützen.<br />
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ein<br />
Handschuh, auch wenn er äußerlich keine<br />
Beschädigungen aufweist, nicht unbegrenzt<br />
haltbar ist bzw. nur eine bestimmte Zeitdauer<br />
ggf. nur für Stunden seine Schutzwirkung<br />
behält (Herstellerinformation zur<br />
Durchbruchszeit beachten).<br />
Die Angaben des Herstellers zur Verwendungsdauer<br />
sind daher strikt zu beachten.<br />
Abb. 48: Schutzhandschuhe bei Arbeiten<br />
mit ätzenden Flüssigkeiten<br />
Bei der Auswahl von Schutzhandschuhen sind neben den Forderungen<br />
nach bestmöglichem Schutz auch Fragen bezüglich des<br />
Tragekomforts, des Tastgefühls und des Greifvermögens abzuklären.<br />
Denn die Akzeptanz der Beschäftigten, den Schutzhandschuh<br />
auch zu tragen, wird von diesen Faktoren wesentlich beeinflusst.<br />
Schutzhandschuhe dürfen nicht getragen werden, wenn die Gefahr<br />
des Erfasstwerdens an Maschinen mit rotierenden Werkstücken<br />
oder Werkzeugen besteht (z. B. Bohren, Drehen, Fräsen).<br />
Auch beim längeren Tragen von Schutzhandschuhen werden deren<br />
Nachteile offenbar. Durch Schweißbildung quillt die Haut auf<br />
und verliert hierdurch ihre natürliche Abwehrkraft. Der Schweißbildung<br />
können z. B. Baumwollunterziehhandschuhe entgegenwirken<br />
(Abbildung 49).<br />
89
90<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Des Weiteren kann eine Verschmutzung<br />
der Handschuhinnenseite,<br />
z. B. durch mehrmaliges<br />
Aus- und Anziehen der<br />
Handschuhe, die Haut intensiver<br />
schädigen.<br />
Das Tragen feuchtigkeitsdichter<br />
Schutzhandschuhe ist hautbelastend<br />
und sollte keinesfalls un-<br />
Abb. 49: Unterziehhandschuhe aus Baumwolle nötig über einen längeren Zeitraum<br />
erfolgen. Daher ist den<br />
Beschäftigten, die regelmäßig mehr als 2 Stunden Tätigkeit mit<br />
feuchtigkeitsdichten Schutzhandschuhen ausführen, eine arbeitsmedizinische<br />
Vorsorgeuntersuchung anzubieten. Für Tätigkeiten<br />
ab 4 Stunden ist die Vorsorgeuntersuchung verpflichtend durchzuführen.<br />
Konkrete Ausführungen zu dieser als „Feuchtarbeit“ eingestuften<br />
Tätigkeit enthält TRGS 531 „Gefährdungen der Haut durch Arbeiten<br />
im feuchten Milieu (Feuchtarbeiten)“.<br />
Ob ein Schutzhandschuh für den jeweiligen Verwendungszweck<br />
geeignet ist, geht aus der vorgeschriebenen Kennzeichnung des<br />
Schutzhandschuhs sowie den Angaben des Herstellers hervor. Die<br />
BG-Regel „Einsatz von Schutzhandschuhen“ BGR 195 geben weitere<br />
praktische Hinweise.<br />
Hygiene am Arbeitsplatz<br />
Hygiene am Arbeitsplatz sollte bei Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
eigentlich selbstverständlich sein. Denn durch mangelnde Hygiene<br />
können <strong>Gefahrstoffe</strong> über den Verdauungstrakt (orale Aufnahme)<br />
in den menschlichen Körper gelangen.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong> können in Bereiche verschleppt werden (z .B. Privatbereich),<br />
wo eigentlich nicht mit der Anwesenheit dieser Stoffe gerechnet<br />
wird und dementsprechend auch keine Schutzmaßnahmen<br />
ergriffen werden.<br />
Es sind daher einige grundsätzliche Voraussetzungen zu schaffen<br />
bzw. „Hygieneregeln“ zu beachten:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz unterlassen<br />
Lebensmittel nicht am Arbeitsplatz vorrätig halten<br />
Im Betrieb leicht zugängliche Waschgelegenheiten schaffen<br />
(inkl. Hautschutzstation und Hautschutzplan) (Abbildung 50)<br />
PSA vor Verschmutzung geschützt aufbewahren<br />
Arbeitskleidung regelmäßig (mindestens bei Bedarf) wechseln<br />
Arbeits- und Schutzkleidung, die mit Krebs erzeugenden <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
verunreinigt ist, ggf. sofort wechseln<br />
Schaffung von Waschräumen sowie Möglichkeiten zur getrennten<br />
Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung,<br />
wenn mit sehr giftigen, giftigen, Krebs erzeugenden, fruchtschädigenden<br />
oder Erbgut verändernden Stoffen umgegangen<br />
wird<br />
Arbeits- und Schutzkleidung<br />
ist durch den Arbeitgeber reinigen<br />
zu lassen (keinesfalls<br />
privat waschen!)<br />
Abb. 50: Waschgelegenheiten im Betrieb<br />
91
92<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
Abb. 51: Arbeiten mit Gießharzen bei<br />
der Muffenmontage<br />
Abb. 52: Hautbelastung durch künstliche<br />
Mineralfasern<br />
8.2.7 Hautschutz<br />
Die Haut ist Barriere zwischen Organismus<br />
und äußerer Umgebung und muss vielfältige<br />
Schutzaufgaben übernehmen. Die in<br />
der Praxis am häufigsten auftretenden Hautgefährdungen<br />
entstehen u. a. durch Kühlschmierstoffe,<br />
Maschinenöle, Lösemittel, Lacke,<br />
Säuren, Laugen, Gießharze, Mehrkomponentenharze,<br />
Klebstoffe, Mineralwolle-<br />
Dämmstoffe (Abbildung 51 und 52).<br />
Um Hauterkrankungen zu verhindern, kommen<br />
eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen<br />
in Betracht.<br />
Vorrang haben auch hier technische Maßnahmen,<br />
die zwangsläufig verhindern, dass<br />
hautgefährdende Stoffe mit der Haut in<br />
Kontakt kommen.<br />
Das ist z. B. dann gewährleistet, wenn <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
in einem geschlossenen System<br />
zur Anwendung kommen.<br />
Aber auch der Einsatz von Hilfswerkzeugen<br />
sowie die saubere Arbeitsweise eines<br />
jeden Einzelnen kann dazu beitragen, dass<br />
der Hautkontakt mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n vermieden<br />
bzw. reduziert wird (Abbildung 53).
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Abb. 53: Vorbildliche Ausstattung eines Gießharzplatzes<br />
Abb. 54: Eintauchkörbe am Entfettungsbad<br />
93
94<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
So kann man z. B. Eintauchkörbe beim Entfetten von Kleinteilen<br />
einsetzen (Abbildung 54) oder Zangen und Pinzetten bei Klebearbeiten<br />
verwenden.<br />
Nicht immer ist es möglich z. B. bei Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen<br />
an Bohr-, Fräs- oder Drehwerkzeugen den Kontakt zu Haut<br />
gefährdenden Stoffen zu verhindern.<br />
Der Einsatz von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln<br />
ist dann die einzige Möglichkeit, die Haut zu schützen.<br />
Wichtige Hinweise dazu geben die BG-Regel für die „Benutzung<br />
von Hautschutz“ BGR 197.<br />
Abb. 55: Hautschutzpräparate für verschiedene Anwendungszwecke
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Eine Liste mit Herstellern von Hautschutzmitteln enthält Anhang 2<br />
der BGR 197.<br />
Nun sollte man sich nicht der lllusion hingeben, es gäbe einen universellen<br />
Hautschutz. Dies ist leider nicht der Fall, denn der Hautschutz<br />
muss auf die spezielle Hautgefährdung abgestimmt sein.<br />
Ein wirksamer Hautschutz erfolgt in der Regel in drei Stufen:<br />
1. Stufe „Spezieller Hautschutz“<br />
Dadurch soll ein Eindringen von schädigenden Arbeitsstoffen in<br />
die Haut verhindert und gleichzeitig die spätere Hautreinigung erleichtert<br />
werden.<br />
Hautschutzpräparate (Abbildung 55) sind vor jedem Arbeitsbeginn,<br />
also auch nach Pausen, auf die gereinigte Haut aufzutragen.<br />
2. Stufe „Hautreinigung“<br />
Durch die Anwendung von Hautreinigungsmitteln soll die Haut<br />
von anhaftenden Stoffen gereinigt werden.<br />
Die Hautreinigung soll schonend vor Pausen und zum Arbeitsschluss<br />
erfolgen und auf die Art und den Grad der Verschmutzung<br />
abgestimmt sein.<br />
Je milder das Reinigungsmittel ist, desto weniger wird die Haut insbesondere<br />
bei oftmals notwendiger Reinigung beansprucht.<br />
Waschgelegenheiten in der Nähe der Arbeitsbereiche, in denen<br />
mit Haut schädigenden Stoffen umgegangen wird, ermöglichen<br />
die konsequente Hautreinigung insbesondere vor den Pausen (Abbildung<br />
50).<br />
95
96<br />
8 Schutzmaßnahmen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Grundmaßnahmen<br />
3. Stufe „Hautpflege“<br />
Hautpflegemittel sollen nach Arbeitsende nach der Hautreinigung<br />
die Regeneration der Haut unterstützen, indem ihr wieder ausreichend<br />
Fett und Feuchtigkeit zugeführt werden.<br />
Hautschutzplan<br />
Der Unternehmer muss für die speziellen Arbeitsbereiche geeignete<br />
Hautschutzmaßnahmen festlegen und diese in einem Hautschutzplan<br />
aufnehmen (Abbildung 56).<br />
Der Hautschutzplan ist als Ergänzung der Betriebsanweisung<br />
gemäß § 14 GefStoffV bzw. TRGS 555 „Betriebsanweisung und<br />
Unterweisung“ anzusehen.
8 Schutzmaßnahmen<br />
8.2 Grundmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Hautschutzplan Stand:<br />
Betriebsbereich: Arbeitsplatz:<br />
Hautgefährdende Tätigkeit/Arbeitsvorgang: Verantwortlich für den Hautschutzplan:<br />
Hautschädigender Arbeitsstoff/Material:<br />
Besondere Gefährdungen durch Arbeitsstoff/Arbeitsvorgang:<br />
Allergie auslösend (sensibilisierend) mechanische Abnutzung (abrasiv)<br />
Gefahrstoffaufnahme durch die Haut (hautresorptiv) Feuchtarbeit<br />
reizend/ätzend Sonstiges:<br />
vor Arbeitsbeginn<br />
zu Beginn der Pausen<br />
und zum Arbeitsschluss<br />
nach Arbeitsschluss<br />
(nach dem<br />
Hände waschen!)<br />
Information/Einweisung<br />
zur Anwendung<br />
der Hautschutzmittel<br />
Schutzmaßnahmen<br />
Verhalten im Gefahrfall und bei besonderen Hautveränderungen<br />
Bei Benetzung mit dem hautschädigenden Produkt:<br />
– durchtränkte Kleidung sofort ausziehen<br />
– benetzte Körperpartien ausgiebig mit reinigen/abspülen<br />
Ansprechpartner: Frau/Herrn , Tel.<br />
Hautschutzpräparat auftragen<br />
(Farbkennzeichnung von Gebinde/Spender/Tube nennen!)<br />
Schutzhandschuhe tragen; Dichtigkeitsprüfung durchführen!<br />
Handschuhe nur während der hautgefährdenden Tätigkeit tragen. (Hautaufweichungseffekte bei<br />
längerem Tragen machen besondere Hautschutz-Präparate erforderlich!)<br />
Hautreinigungsmittel benutzen<br />
(Farbkennzeichnung von Gebinde/Spender/Tube nennen!)<br />
(Hände nie mit Lösemitteln, Kaltreinigern o. ä. reinigen;<br />
nach Möglichkeit keine Reinigungsmittel mit Reibmitteln verwenden!)<br />
Hautpflegemittel auftragen<br />
(Farbkennzeichnung von Gebinde/Spender/Tube nennen!)<br />
Unterweisung durch Frau/Herrn , Tel.<br />
Grundsätzlich: Hautschutzmittel vor Beginn der gefährdenden Tätigkeit einige Minuten einziehen lassen!<br />
Schutz- und Pflegepräparate stets besonders sorgfältig an Hand- und Fingerrücken, in den Fingerzwischenräumen,<br />
an Gelenken und am Nagelbett auftragen und einreiben.<br />
Bei auffälligen Hautveränderungen sofort den Betriebsarzt oder einen Hautarzt aufsuchen!<br />
Abb. 56: Muster eines Hautschutzplanes (durch betriebliche Angaben zu ergänzen)<br />
97
98<br />
ANHANG 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Beispiele für Tätigkeiten mit geringer Gefährdung<br />
(Schutzstufe 1)<br />
Arbeitsplatz Tätigkeit Gefahrstoff/Einstufung/<br />
Gefährlichkeitsmerkmal<br />
Werkzeugbau<br />
Sanitärbereich<br />
Büro<br />
Büro<br />
Einsprühen von<br />
Werkzeugen<br />
Verbrauch:<br />
Eine Druckdose pro<br />
Vierteljahr<br />
Oberflächenreinigung<br />
von Hand<br />
Tätigkeiten mit Korrekturflüssigkeit<br />
Reinigen von Oberflächen<br />
Druckdosen mit<br />
Korrosionsschutzöl<br />
F, Xn<br />
Diverse Reinigungsmittel<br />
F, Xn<br />
Korrekturflüssigkeit<br />
F<br />
Reiniger<br />
Xn
Büro<br />
Spanende Metallbearbeitung<br />
Ständerbohrmaschine<br />
im Werkzeugbau<br />
Gewindeschneiden von<br />
Hand im Werkzeugbau<br />
Qualitätskontrolle<br />
Klebearbeiten<br />
Minimalmengenschmierung<br />
KSS-Dosierung<br />
von Hand<br />
KSS-Dosierung<br />
von Hand<br />
Kontrolle wassergemischter<br />
KSS nach<br />
TRGS 611<br />
u.a. Bestimmung der<br />
Konzentration mit<br />
dem Refraktometer<br />
Kleber<br />
F<br />
Kühlschmierstoff (KSS)<br />
keine Einstufung<br />
nichtwassermischbarer<br />
Kühlschmierstoff (KSS)<br />
keine Einstufung<br />
nichtwassermischbarer<br />
Kühlschmierstoff (KSS)<br />
keine Einstufung<br />
wassergemischter<br />
Kühlschmierstoff (KSS)<br />
keine Einstufung<br />
99
100<br />
ANHANG 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Sicherheitstechnische Kenngrößen<br />
AGW (Arbeitsplatzgrenzwert)<br />
Der Arbeitsplatzgrenzwert ist der Grenzwert für die zeitlich gewichtete<br />
durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft<br />
am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum.<br />
Er gibt an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder<br />
chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen<br />
nicht zu erwarten sind.<br />
BGW (Biologischer Grenzwert)<br />
Der biologische Grenzwert ist der Grenzwert für die toxikologischarbeitsmedizinisch<br />
abgeleitete Konzentration eines Stoffes, seines<br />
Metaboliten oder eines Beanspruchungsindikators im entsprechenden<br />
biologischen Material, bei dem im Allgemeinen die Gesundheit<br />
eines Beschäftigten nicht beeinträchtigt wird.<br />
MAK-Wert (nicht mehr gültig)<br />
Definition nach GefStoffV bis 31.12.2004<br />
Die Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) ist die Konzentration<br />
eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der im Allgemeinen<br />
die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt wird.<br />
TRK-Wert (nicht mehr gültig)<br />
Definition nach GefStoffV bis 31.12.2004<br />
Die Technische Richtkonzentration (TRK) ist die Konzentration eines<br />
Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, die nach dem Stand der<br />
Technik erreicht werden kann. TRK-Werte werden für solche gefährlichen<br />
Stoffe benannt für die zur Zeit keine toxikologisch-arbeitsmedizinisch<br />
begründeten MAK-Werte aufgestellt werden können<br />
(z. B. Krebs erzeugende Stoffe).
Anhang 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
BAT-Wert (nicht mehr gültig)<br />
Definition nach GefStoffV bis 31.12.2004<br />
Der Biologische Arbeitsplatztoleranzwert (BAT) ist die Konzentration<br />
eines Stoffes oder seines Umwandlungsproduktes im Körper<br />
oder die dadurch ausgelöste Abweichung eines biologischen Indikators<br />
von seiner Norm, bei der im Allgemeinen die Gesundheit<br />
der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt wird.<br />
EKA-Wert<br />
Das Expositionsäquivalent für einen Krebs erzeugenden Stoff ist<br />
die Beziehung zwischen der Stoffkonzentration in der Luft am Arbeitsplatz<br />
und der Stoff- bzw. Metabolitenkonzentration im biologischen<br />
Material.<br />
Flammpunkt<br />
Der Flammpunkt einer brennbaren Flüssigkeit ist die niedrigste<br />
Temperatur, bei der sich aus der Flüssigkeit unter festgelegten Bedingungen<br />
Dämpfe in solcher Menge entwickeln, dass sich ein<br />
durch Fremdzündung entflammbares Dampf/Luft-Gemisch bildet.<br />
Dichteverhältnis<br />
Das Dichteverhältnis gibt die Dichte des betreffenden Stoffes im<br />
dampf- oder gasförmigen Zustand bezogen auf Luft (Luft = 1) des<br />
gleichen Zustandes an.<br />
Gase oder Dämpfe mit einem Dichteverhältnis >1 sind schwerer<br />
als Luft und sammeln sich am Boden an, solche mit einem Dichteverhältnis<br />
102<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang 2<br />
Explosionsgrenze und Explosionsbereich<br />
Mischungen brennbarer Gase, Dämpfe, Stäube und Nebel mit Luft<br />
sind nur innerhalb eines bestimmten Bereiches explosionsfähig.<br />
Eine Explosion kommt nicht zustande, wenn die Konzentration unter<br />
der unteren Explosionsgrenze (UEG) bzw. über der oberen Explosionsgrenze<br />
(OEG) liegt. Unterhalb der UEG ist das Gemisch<br />
zu mager, oberhalb der OEG zu fett.<br />
Im Bereich zwischen UEG und OEG, dem Explosionsbereich,<br />
herrscht Explosionsgefahr!<br />
Die Explosionsgrenzen werden in Volumenprozent (1Vol % =<br />
10 000 ppm) angegeben.<br />
Für Stäube haben die Explosionsgrenzen nicht die Bedeutung wie<br />
für Gase und Dämpfe.<br />
Die Konzentration kann sich durch Aufwirbelung oder durch Absetzen<br />
von Staub stark verändern. Es ist z. B. möglich, dass durch<br />
Aufwirbeln von Staubablagerungen explosionsfähige Atmosphäre<br />
entsteht. In Gegenwart abgelagerter Stäube ist daher stets mit Explosionsgefahr<br />
zu rechnen.<br />
Dampfdruck<br />
Der Dampfdruck dient als Maß für das Bestreben einer Substanz,<br />
in den dampfförmigen Zustand überzugehen. Der Übergang eines<br />
festen oder flüssigen Stoffes in die Dampfphase geschieht bei gegebener<br />
Temperatur unter einem ganz bestimmten Druck. Bei einer<br />
chemisch einheitlichen Substanz ist dieser Dampfdruck nur von<br />
der Temperatur, nicht von der Stoffmenge abhängig. Die Angabe<br />
erfolgt in der Regel in mbar und bezieht sich auf 20 °C. Je höher
Anhang 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
der Dampfdruck eines Stoffes ist, desto größer ist seine Flüchtigkeit<br />
und damit das Risiko des Auftretens gesundheitsschädlicher<br />
Dampfkonzentrationen.<br />
Siedepunkt<br />
Der Siedepunkt ist die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit bei Zufuhr<br />
von weiterer Energie in den gasförmigen Aggregatzustand<br />
übergeht. Die Siedetemperatur ist vom Druck über der Flüssigkeitsoberfläche<br />
abhängig. Eine Flüssigkeit siedet, wenn der äußere<br />
Luftdruck gleich dem Dampfdruck ist. Der Siedepunkt wird in °C<br />
angegeben und bezieht sich auf einen Druck von 1013 mbar.<br />
103
104<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang 2<br />
Sicherheitstechnische Kenngrößen einiger Stoffe<br />
Stoffbezeichnung<br />
Aceton<br />
Acetylen<br />
Ammoniak<br />
Cyanwasserstoff<br />
(Blausäure)<br />
Ethanol<br />
Kohlenstoffmonoxid<br />
Methan<br />
Methanol<br />
Propan<br />
Toluol<br />
Wasserstoff<br />
1) Sublimationstemperatur<br />
2) Selbstzerfall<br />
3) Die Gemische enthalten Raumluft üblicher Feuchte<br />
4) Ehemaliger MAK-Wert<br />
Dampfdruck<br />
mbar bei<br />
20 °C<br />
233<br />
30600<br />
8500<br />
830<br />
59<br />
–<br />
–<br />
128<br />
8300<br />
27,8<br />
–<br />
Siedepunkt<br />
°C<br />
(Luft=1)<br />
56<br />
-814 1)<br />
-33<br />
26<br />
78<br />
-191<br />
-161<br />
65<br />
-42<br />
111<br />
-253<br />
Dichteverhältnis<br />
2,00<br />
0,90<br />
0,59<br />
0,93<br />
1,59<br />
0,97<br />
0,55<br />
1,10<br />
1,56<br />
3,18<br />
0,07<br />
Flammpunkt<br />
°C<br />
< -20<br />
–<br />
–<br />
< -20<br />
12<br />
–<br />
–<br />
11<br />
–<br />
6<br />
–<br />
Explosionsgrenzen in<br />
Luft Vol-%<br />
untere<br />
2,5<br />
2,3<br />
15,4<br />
5,4<br />
3,5<br />
10,9 3)<br />
4,4<br />
5,5<br />
1,7<br />
1,2<br />
4,0<br />
obere<br />
13<br />
78/100 2)<br />
33,6<br />
46,6<br />
15,0<br />
76,0 3)<br />
16,5<br />
< 44<br />
10,9<br />
7,8<br />
77,0<br />
Arbeitsplatzgrenzwert<br />
mg/m 3<br />
1200<br />
–<br />
35 4)<br />
11 4)<br />
960<br />
35<br />
–<br />
270<br />
1800<br />
190<br />
–
ANHANG 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Anlage 1 zur TRGS 400 Ermittlung und Beurteilung der<br />
Gefährdungen durch <strong>Gefahrstoffe</strong> am Arbeitsplatz – Checkliste<br />
Stand 3/99<br />
Im Zuge der neuen Gefahrstoffverordnung wird diese Checkliste<br />
überarbeitet.<br />
1 Ermittlungspflicht<br />
1.1 Informationsbeschaffung über Arbeitsstoffe<br />
Ermittlung<br />
Welche Arbeitsstoffe (Stoffe, Zubereitungen,<br />
Erzeugnisse) werden im<br />
Arbeitsbereich eingesetzt oder hergestellt?<br />
Sind die Arbeitsstoffe als gefährlich<br />
eingestuft, enthalten die Arbeitsstoffe<br />
im Hinblick auf die vorgesehenen<br />
Tätigkeiten gefährliche Stoffe und<br />
Zubereitungen oder können aus den<br />
Arbeitsstoffen beim vorgesehenen<br />
Umgang gefährliche Stoffe und Zubereitungen<br />
freigesetzt werden?<br />
Enthalten die Arbeitsstoffe Stoffe mit<br />
unbekannten oder unzureichend bekannten<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong>igenschaften?<br />
Anmerkungen<br />
Es ist auf gekennzeichnete und ungekennzeichnete<br />
Arbeitsstoffe sowie auch<br />
auf Hilfsstoffe und Nebenprodukte zu<br />
achten. Es ist sinnvoll, auch die Arbeitsstoffe<br />
in das Gefahrstoffverzeichnis<br />
nach Nummer 1.2 aufzunehmen.<br />
Es ist zu beachten, dass gefährliche<br />
Stoffe und Zubereitungen auch<br />
durch das Arbeitsverfahren gebildet<br />
werden können, z. B. Schweißrauch<br />
aus Elektrodenmaterial.<br />
Viele Lieferanten/Hersteller halten<br />
auch für nicht gekennzeichnete Produkte<br />
Sicherheitsdatenblätter oder<br />
Produktinformationen bereit.<br />
105
106<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang 3<br />
1.2 Gefahrstoffverzeichnis<br />
Ermittlung<br />
Es ist ein Verzeichnis aller nach<br />
Nummer 1.1 ermittelten <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
zu erstellen und zu führen. Das Gefahrstoffverzeichnis<br />
muss folgende<br />
Angaben enthalten:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Bezeichung des <strong>Gefahrstoffe</strong>s<br />
Einstufung des <strong>Gefahrstoffe</strong>s<br />
oder Angabe der gefährlichen<br />
Eigenschaften<br />
Mengenbereiche des <strong>Gefahrstoffe</strong>s<br />
im Betrieb<br />
Arbeitsbereiche, in denen mit dem<br />
Gefahrstoff umgegangen wird<br />
1.3 Ersatzstoffe/Ersatzverfahren<br />
Ermittlung<br />
Es ist zu prüfen, ob Stoffe, Zubereitungen<br />
und Erzeugnisse mit geringerem<br />
gesundheitlichem Risiko erhältlich<br />
sind.<br />
Es ist zu prüfen, ob die erhältlichen<br />
Stoffe, Zubereitungen und Erzeug-<br />
Anmerkungen<br />
Hinweise zur Erstellung eines Gefahrstoffverzeichnisses:<br />
siehe TRGS<br />
440. Beispiele hierzu in BlA-Report<br />
6/99: „<strong>Gefahrstoffe</strong> ermitteln und ersetzen“.<br />
Das Gefahrstoffverzeichnis ist bei wesentlichen<br />
Änderungen fortzuschreiben<br />
und mindestens einmal jährlich<br />
zu überprüfen.<br />
Das Gefahrstoffverzeichnis ist Grundlage<br />
der Arbeitsbereichsanalyse.<br />
Anmerkungen<br />
Vorschlag zum relativen Vergleich<br />
des gesundheitlichen Risikos: siehe<br />
TRGS 440 (hier speziell die Faktoren<br />
W und F).<br />
Beispiele hierzu enthält BIA-Report<br />
6/99: „<strong>Gefahrstoffe</strong> ermitteln und<br />
ersetzen“.<br />
Hinweise zur Ermittlung der Zumutbarkeit<br />
des Einsatzes von Ersatzlö-
Anhang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
nisse mit geringerem gesundheitlichem<br />
Risiko technisch geeignet sind<br />
und ob ihre Verwendung zumutbar<br />
ist.<br />
Kann der Schutz von Leben und Gesundheit<br />
der Arbeitnehmer vor Gefährdung<br />
durch <strong>Gefahrstoffe</strong> am Arbeitsplatz<br />
nicht durch andere Maßnahmen<br />
gewährleistet werden, so<br />
muss der Arbeitgeber prüfen, ob<br />
durch Änderung des Herstellungsund<br />
Verwendungsverfahrens oder<br />
durch den Einsatz emissionsarmer<br />
Verwendungsformen das Auftreten<br />
von <strong>Gefahrstoffe</strong>n am Arbeitsplatz<br />
verhindert oder vermindert werden<br />
kann.<br />
Die Ermittlungsergebnisse bzgl. Ersatzstoffen<br />
und Ersatzverfahren sind<br />
zu dokumentieren.<br />
1.4 Gefahrenermittlung und -abwehr<br />
Ermittlung<br />
Die Gefahren, die von den Tätigkeiten<br />
mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n ausgehen,<br />
sind vor dem Umgang zu ermitteln<br />
und zu bewerten.<br />
sungen nach § 16 GefStoffV enthält<br />
Anlage 1 zur TRGS 440.<br />
Beispiele hierzu enthält BIA-Report<br />
6/99: „<strong>Gefahrstoffe</strong> ermitteln und<br />
ersetzen“.<br />
Vorschlag zum relativen Vergleich<br />
des gesundheitlichen Risikos: siehe<br />
TRGS 440 (hier speziell Faktor V).<br />
Zumutbarkeit und technische Eignung<br />
beachten!<br />
Beispiele hierzu enthält BIA-Report<br />
6/99: „<strong>Gefahrstoffe</strong> ermitteln und<br />
ersetzen“.<br />
Anmerkungen<br />
Hinweise auf Gefahren geben die<br />
Sicherheitsdatenblätter und die<br />
Kennzeichnung (R-Sätze). Weitere<br />
Hinweise enthalten die einschlägigen<br />
Arbeitsschutzvorschriften.<br />
107
108<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang 3<br />
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr<br />
sind vor den Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
zu regeln.<br />
2 Überwachungspflicht<br />
2.1 Arbeitsbereichsanalyse<br />
Ermittlung<br />
Es ist zu ermitteln, ob das Auftreten<br />
von <strong>Gefahrstoffe</strong>n in der Luft am Arbeitsplatz<br />
sicher auszuschließen ist.<br />
Hinweise auf Maßnahmen zur Gefahrenabwehr<br />
geben die Sicherheitsdatenblätter<br />
und die Kennzeichnung<br />
(S-Sätze). Weitere Hinweise enthalten<br />
die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften,berufsgenossenschaftliche<br />
Informationssysteme oder LASI-<br />
Veröffentlichungen wie z. B. GESTIS<br />
(Hrsg.: Hauptverband der gewerblichen<br />
Berufsgenossenschaften) oder<br />
WINGIS (Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft<br />
der Bau-Berufsgenossenschaften). Es<br />
sind die Maßnahmen nach Abschnitt<br />
5 und 6 der Gefahrstoffverordnung,<br />
mindestens jedoch die allgemeinen<br />
arbeitshygienischen Normen<br />
(Grundmaßnahmen gemäß<br />
TRGS 500) zu beachten.<br />
Anmerkungen<br />
Das Auftreten von <strong>Gefahrstoffe</strong>n kann<br />
z. B. sicher ausgeschlossen werden,<br />
• wenn kein Umgang mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
vorliegt bzw. keine <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
entstehen<br />
oder wenn
Anhang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Ist das Auftreten von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
in der Luft am Arbeitsplatz nicht sicher<br />
auszuschließen, so ist zu ermitteln,<br />
ob die Arbeitsplatzgrenzwerte<br />
(AGW) nach TRGS 900 unterschritten<br />
sind.<br />
• bei Umgang mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
ausschließlich geschlossene Systeme<br />
verwendet werden.<br />
Hinweis: Das Auftreten von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
aufgrund allgemeiner Umweltbelastungen<br />
oder einer Innenraumbelastung<br />
fällt nicht unter die<br />
Regelungen der Gefahrstoffverordnung,<br />
da kein „Umgang“ damit verbunden<br />
ist. Hier ist auf die Bestimmungen<br />
der Arbeitsstättenverordnung<br />
zu verweisen.<br />
Grundlage der Beurteilung ist der<br />
im Rahmen der Arbeitsbereichsanalyse<br />
nach TRGS 402 aufgestellte Befund;<br />
der Befund kann auf<br />
• Berechnungen<br />
• Ergebnissen vergleichbarer Arbeitsbereiche<br />
• der Einhaltung verfahrens- und<br />
stoffspezifischer Kriterien (VSK)<br />
• BG/BlA-Empfehlungen<br />
oder<br />
• Messungen<br />
beruhen. Der Befund der Arbeitsbereichsanalyse<br />
ist bei wesentlichen<br />
Änderungen zu überprüfen. In der Arbeitsbereichsanalyse<br />
sind die Überprüfungszeiten<br />
festzulegen, inner-<br />
109
110<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang 3<br />
Ist das Auftreten von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
in der Luft am Arbeitsplatz nicht sicher<br />
auszuschließen, so ist zu ermitteln,<br />
ob die Auslöseschwelle überschritten<br />
wird.<br />
halb derer die Gültigkeit der Arbeitsbereichsanalyse<br />
zu überprüfen<br />
ist. Liegt keine dauerhaft sichere Einhaltung<br />
der Grenzwerte vor, ist zu<br />
prüfen, ob durch Maßnahmen die<br />
Exposition gesenkt werden kann;<br />
der Befund der Arbeitsbereichsanalyse<br />
ist durch regelmäßige Kontrollmessungen<br />
zu überprüfen. Der Kontrollmessplan<br />
muss genaue Anweisungen<br />
für die Durchführung der<br />
Kontrollmessungen enthalten, z. B.<br />
Ort, Zeitpunkt und Dauer der Probenahme.<br />
Werden Messungen bei einer<br />
außerbetrieblichen Messstelle in<br />
Auftrag gegeben, kann der Arbeitgeber<br />
davon ausgehen, dass die Ergebnisse<br />
zutreffend sind, wenn die<br />
Messstelle von den Ländern anerkannt<br />
ist. Von den Ländern anerkannte<br />
Messstellen werden in einem<br />
Messstellenverzeichnis im Bundesarbeitsblatt<br />
bekanntgemacht.<br />
Grundlage der Beurteilung sind<br />
•<br />
der Befund nach TRGS 402<br />
die Bewertung sonstiger Kriterien<br />
zur Beurteilung der Auslöseschwelle<br />
(z. B. unmittelbarer Hautkontakt<br />
nach TRGS 150).
Anhang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Ist das Auftreten von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
in der Luft am Arbeitsplatz nicht sicher<br />
auszuschließen, so ist die Gesamtwirkung<br />
verschiedener gefährlicher<br />
Stoffe in der Luft am Arbeitsplatz<br />
zu beurteilen.<br />
Die Ergebnisse der Ermittlungen und<br />
Messungen im Rahmen der Arbeitsbereichsanalyse<br />
sind aufzuzeichnen<br />
und mindestens 30 Jahre aufzubewahren.<br />
Grundlage der Beurteilung sind<br />
•<br />
der Befund nach TRGS 402<br />
die Bewertung nach TRGS 403<br />
Zum Umfang der Dokumentation<br />
zählen insbesondere:<br />
• die Arbeitsbereichsanalyse mit<br />
der Begründung des Befundes<br />
• die Ergebnisse der Kontrollmessungen<br />
• die Maßnahmen zur Qualitätssicherung<br />
111
112<br />
ANHANG 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Abkürzungen/Fachausdrücke/Fremdwörter<br />
AGW Arbeitsplatzgrenzwert<br />
AGS Ausschuss für <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
Allergen Stoff, der Allergien auslösen kann<br />
Allergien vom normalen Verhalten abweichende Reaktionen<br />
des Organismus auf bestimmte<br />
(körperfremde) Stoffe; Überempfindlichkeit<br />
BAT Biologischer Arbeitsplatztoleranzwert<br />
(nicht mehr gültig)<br />
Biomonitoring Biomonitoring ist die Untersuchung biologischen<br />
Materials der Beschäftigten zur Bestimmung<br />
von <strong>Gefahrstoffe</strong>n, deren Metaboliten<br />
oder deren biochemischen bzw.<br />
biologischen Effektparametern<br />
BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (Unfallverhütungsvorschrift)<br />
BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit<br />
und Gesundheit bei der Arbeit<br />
BGI Berufsgenossenschaftliche Informationen<br />
BGIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz<br />
BGW Biologischer Grenzwert<br />
BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales<br />
ChemG Chemikaliengesetz<br />
Emission/emittieren Ausströmen luftverunreinigender Stoffe in<br />
die Luft<br />
EKA Expositionsäquivalente Krebs erzeugender<br />
Arbeitsstoffe<br />
Exposition Ausgesetzt sein von Beschäftigten gegenüber<br />
gefährlichen Stoffen in der Atemluft<br />
oder auf der Haut unter Berücksichtigung<br />
der Konzentration und der Zeit<br />
GPSG Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
Anhang 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
GefStoffV Verordnung zum Schutz vor <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
(Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)<br />
Hautresorptiv Aufnahme von Stoffen über die unverletzte<br />
Haut in den Körper<br />
Inhalation Einatmen von Stoffen<br />
Karzinogene Stoffe Stoffe, die Krebs hervorrufen können<br />
(Kanzerogenität)<br />
Kontaminiert mit schädigenden Stoffen verunreinigt/verseucht<br />
LAS Landesamt für Arbeitsschutz<br />
Latenzzeit Zeitdauer von der ersten Aufnahme eines<br />
gefährlichen Stoffes bis zum Ausbruch einer<br />
Erkrankung<br />
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration<br />
(nicht mehr gültig)<br />
Mikrobiell durch Mikroorganismen hervorgerufen oder<br />
erzeugt<br />
Noxe(n) Stoff(e) die eine schädigende Wirkung auf<br />
unseren Körper ausüben können<br />
Ödem schmerzlose nicht gerötete Schwellung infolge<br />
Ansammlung wässriger Flüssigkeiten<br />
Oral Aufnahme von Stoffen über den Mund<br />
ODIN Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen<br />
Partikel kleines festes Teilchen<br />
Penetration eindringen<br />
penetrieren<br />
Präventiv vorbeugend, verhütend<br />
reversibel umkehrbar<br />
R-Sätze Hinweise auf besondere Gefahren<br />
SGB Sozialgesetzbuch<br />
Sensibilität/sensibel empfindlich gegenüber Stoffen, Reizen und<br />
Eindrücken<br />
113
114<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang 4<br />
S-Sätze Sicherheitsratschläge<br />
TRGS Technische Regeln für <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
TRK Technische Richtkonzentration<br />
(nicht mehr gültig)<br />
Toxizität/toxisch Giftigkeit/giftig<br />
UVV Unfallverhütungsvorschrift<br />
ZAs Zentrale Erfassungsstelle asbeststaubgefährdeter<br />
Arbeitnehmer
ANHANG 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Literatur und Informationsmaterial<br />
Kühn/Birett „Merkblätter gefährliche Arbeitsstoffe“, ecomed Verlagsgesellschaft<br />
mbH<br />
Welzbacher „Neue Datenblätter für gefährliche Arbeitsstoffe nach<br />
der Gefahrstoffverordnung“, Weka-Fachverlag <strong>GmbH</strong><br />
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit<br />
bei der Arbeit – Unfallverhütungsvorschriften<br />
(zu beziehen bei unserer Präventionsabteilung)<br />
BGV A 1 Grundsätze der Prävention<br />
BGV A 4 Arbeitsmedizinische Vorsorge<br />
BGV A 8 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am<br />
Arbeitsplatz<br />
Berufsgenossenschaftliche Regeln (BG-Regeln), berufsgenossenschaftliche<br />
Informationen (BG-Informationen)<br />
(zu beziehen beim Carl-Heymanns-Verlag KG,<br />
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln)<br />
BGR 121 Arbeitsplatzlüftung – lufttechnische Maßnahmen<br />
BGR 143 Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen<br />
BGR 163 Umgang mit Krebs erzeugenden und Erbgut verändernden<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
BGR 189 Einsatz von Schutzkleidung<br />
BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeräten<br />
BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz<br />
BGR 195 Einsatz von Schutzhandschuhen<br />
115
116<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang 5<br />
BGR 197 Benutzung von Hautschutz<br />
BGI 504 Auswahlkriterien für die spezielle arbeitsmedizinische<br />
Vorsorge nach den Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen<br />
für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen<br />
BGI 509 Erste Hilfe im Betrieb<br />
BGI 536 Gefährliche chemische Stoffe<br />
BGI 564 Umgang mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n – Für die Beschäftigten<br />
BGI 671 Merkblatt: Beförderung gefährlicher Güter<br />
BGI 744 Gefahrgutbeförderung im PKW<br />
Gesetze, Verordnungen und andere staatliche Arbeitsschutzvorschriften<br />
(zu beziehen beim Carl-Heymanns-Verlag KG,<br />
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln)<br />
Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen<br />
Chemikaliengesetz (ChemG )<br />
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)<br />
Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)<br />
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und Verordnungen zum GPSG<br />
Technische Regeln für <strong>Gefahrstoffe</strong> (TRGS):<br />
TRGS 101 Begriffsbestimmungen<br />
TRGS 150 Unmittelbarer Hautkontakt mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n, die durch<br />
die Haut resorbiert werden können – Hautresorbierbare<br />
<strong>Gefahrstoffe</strong><br />
TRGS 220 Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und Zubereitungen<br />
TRGS 300 Sicherheitstechnik
Anhang 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
TRGS 400 Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen durch <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
am Arbeitsplatz: Anforderungen<br />
TRGS 402 Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher<br />
Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen<br />
TRGS 403 Bewertung von Stoffgemischen in der Luft am Arbeitsplatz<br />
TRGS 420 Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen durch <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
am Arbeitsplatz: Verfahrens- und stoffspezifische<br />
Kriterien (VSK) für die betriebliche Arbeitsbereichsüberwachung<br />
TRGS 440 Ermitteln und Beurteilen von Gefährdungen durch <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
am Arbeitsplatz: Ermitteln von <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
und Methoden zur Ersatzstoffprüfung<br />
TRGS 500 Schutzmaßnahmen: Mindeststandards<br />
TRGS 505 Blei und bleihaltige <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
TRGS 507 Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern<br />
TRGS 514 Lagern sehr giftiger und giftiger Stoffe in Verpackungen<br />
und ortsbeweglichen Behältern<br />
TRGS 515 Lagern Brand fördernder Stoffe in Verpackungen und<br />
ortsbeweglichen Behältern<br />
TRGS 518 Elektroisolierflüssigkeiten, die mit PCDD und PCDF verunreinigt<br />
sind<br />
TRGS 519 Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten<br />
TRGS 521 Faserstäube<br />
TRGS 526 Laboratorien<br />
TRGS 540 Sensibilisierende Stoffe<br />
TRGS 551 Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem<br />
Material<br />
TRGS 552 N-Nitrosamine<br />
TRGS 553 Holzstaub<br />
TRGS 554 Dieselmotoremissionen (DME)<br />
TRGS 555 Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 14 Gef-<br />
StoffV<br />
117
118<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang 5<br />
TRGS 557 Dioxine (polyhalogenierte Dibenzo-p-Dioxine und Furane)<br />
TRGS 608 Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungsbeschränkungen<br />
für Hydrazin in Wasser- und Dampfsystemen<br />
TRGS 610 Ersatzstoffe und Ersatzverfahren für stark lösemittelhaltige<br />
Vorstriche und Klebstoffe für den Bodenbereich<br />
TRGS 611 Verwendungsbeschränkungen für Wasser mischbare<br />
bzw. Wasser gemischte Kühlschmierstoffe, bei deren<br />
Einsatz N-Nitrosamine auftreten können<br />
TRGS 710 Biomonitornig<br />
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte<br />
TRGS 901 Begründungen und Erläuterungen zu Grenzwerten in<br />
der Luft am Arbeitsplatz<br />
TRGS 903 Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte – BAT-Werte<br />
TRGS 905 Verzeichnis Krebs erzeugender, Erbgut verändernder<br />
oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe<br />
TRGS 906 Verzeichnis Krebs erzeugender Tätigkeiten oder Verfahren<br />
nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV<br />
TRGS 907 Verzeichnis sensibilisierender Stoffe<br />
Verzeichnis der Normen<br />
DIN EN 60335-2-69 Anhang AA<br />
Besondere Anforderungen für Staubsauger, Kehrsaugmaschinen<br />
und Entstauber zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden<br />
Staub.
Anhang 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Informationsmittel<br />
(zu beziehen bei unserer Abteilung Kommunikations-/Öffentlichkeitsarbeit)<br />
• Broschüren für Auszubildende<br />
AB 05 <strong>Gefahrstoffe</strong><br />
AB 11 Hautschutz<br />
• Broschüren für den Meister<br />
MB 01 Persönliche Schutzausrüstung<br />
MB 24 Sicherheit durch Brand- und Explosionsschutz<br />
MB 27 Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen<br />
MB 29 Betriebsanweisungen für Tätigkeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
• Faltblätter für Fachkräfte (Tipps für...)<br />
T 06 Hautschutz<br />
T 21 Umgang mit Kühlschmierstoffen<br />
• Muster-Hautschutzplan (S 03)<br />
• <strong>Gefahrstoffe</strong> in der Galvanotechnik und der Oberflächenveredelung<br />
(S15)<br />
• Betriebsanweisungen (B01 bis B40)<br />
• Baukasten für Betriebsanweisungen (B00)<br />
• Schulungsprogramme Präsentationen „<strong>Gefahrstoffe</strong>“<br />
PU 05 Sicheres Arbeiten mit Kühlschmierstoffen<br />
PU 06 Betriebsanweisung und Unterweisung<br />
PU 09 Sicherer Arbeiten mit <strong>Gefahrstoffe</strong>n<br />
119
120<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang 5<br />
• Video- bzw. DVD-Unterweisungen<br />
PU 13 SF6-Anlagen PU 14 Kühlschmierstoffe<br />
PU 15 Galvanotechnik<br />
PU 16 Spritzlackieren<br />
PU 17 Reinigen und Entfetten<br />
PU 18 Kleben und Vergießen
Bestell-Nr. MB 11<br />
6 · 5(35) · 02 · 06 · 4<br />
Alle Rechte beim Herausgeber<br />
Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier