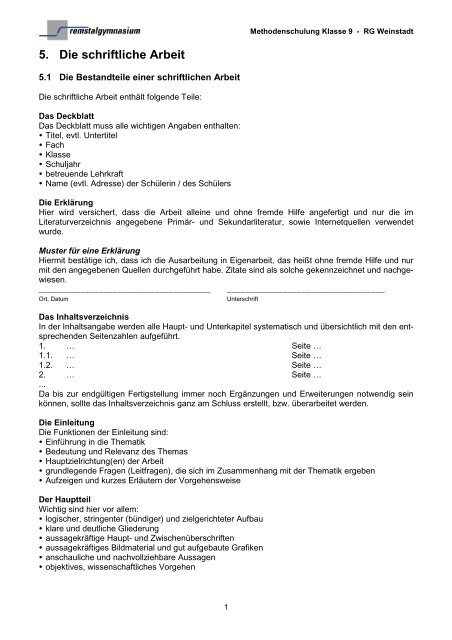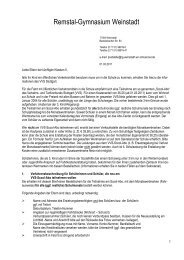5. Die schriftliche Arbeit Kl.9 _Wb_
5. Die schriftliche Arbeit Kl.9 _Wb_
5. Die schriftliche Arbeit Kl.9 _Wb_
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Methodenschulung Klasse 9 - RG Weinstadt<br />
<strong>5.</strong> <strong>Die</strong> <strong>schriftliche</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
<strong>5.</strong>1 <strong>Die</strong> Bestandteile einer <strong>schriftliche</strong>n <strong>Arbeit</strong><br />
<strong>Die</strong> <strong>schriftliche</strong> <strong>Arbeit</strong> enthält folgende Teile:<br />
Das Deckblatt<br />
Das Deckblatt muss alle wichtigen Angaben enthalten:<br />
Titel, evtl. Untertitel<br />
Fach<br />
Klasse<br />
Schuljahr<br />
betreuende Lehrkraft<br />
Name (evtl. Adresse) der Schülerin / des Schülers<br />
<strong>Die</strong> Erklärung<br />
Hier wird versichert, dass die <strong>Arbeit</strong> alleine und ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im<br />
Literaturverzeichnis angegebene Primär- und Sekundarliteratur, sowie Internetquellen verwendet<br />
wurde.<br />
Muster für eine Erklärung<br />
Hiermit bestätige ich, dass ich die Ausarbeitung in Eigenarbeit, das heißt ohne fremde Hilfe und nur<br />
mit den angegebenen Quellen durchgeführt habe. Zitate sind als solche gekennzeichnet und nachgewiesen.<br />
_____________________________________ __________________________________<br />
Ort, Datum<br />
Unterschrift<br />
Das Inhaltsverzeichnis<br />
In der Inhaltsangabe werden alle Haupt- und Unterkapitel systematisch und übersichtlich mit den entsprechenden<br />
Seitenzahlen aufgeführt.<br />
1. … Seite …<br />
1.1. … Seite …<br />
1.2. … Seite …<br />
2. … Seite …<br />
...<br />
Da bis zur endgültigen Fertigstellung immer noch Ergänzungen und Erweiterungen notwendig sein<br />
können, sollte das Inhaltsverzeichnis ganz am Schluss erstellt, bzw. überarbeitet werden.<br />
<strong>Die</strong> Einleitung<br />
<strong>Die</strong> Funktionen der Einleitung sind:<br />
Einführung in die Thematik<br />
Bedeutung und Relevanz des Themas<br />
Hauptzielrichtung(en) der <strong>Arbeit</strong><br />
grundlegende Fragen (Leitfragen), die sich im Zusammenhang mit der Thematik ergeben<br />
Aufzeigen und kurzes Erläutern der Vorgehensweise<br />
Der Hauptteil<br />
Wichtig sind hier vor allem:<br />
logischer, stringenter (bündiger) und zielgerichteter Aufbau<br />
klare und deutliche Gliederung<br />
aussagekräftige Haupt- und Zwischenüberschriften<br />
aussagekräftiges Bildmaterial und gut aufgebaute Grafiken<br />
anschauliche und nachvollziehbare Aussagen<br />
objektives, wissenschaftliches Vorgehen<br />
1
Methodenschulung Klasse 9 - RG Weinstadt<br />
Der Schluss<br />
zusammenfassende Schlussfolgerung(en)<br />
Transfer<br />
Ausblick<br />
Das Literaturverzeichnis<br />
<strong>5.</strong>2 Aufbau des Literaturverzeichnisses<br />
Für die Gestaltung des Literaturverzeichnisses gilt als oberster Grundsatz: Jedes in der <strong>Arbeit</strong> zitierte<br />
Werk ist aufzunehmen, und es werden nur Werke aufgeführt, die auch im Text erwähnt sind. Dabei<br />
werden die Angaben aus den inneren Copyrightseiten entnommen, da der Titel auf dem Umschlag<br />
oft unvollständig ist. Wichtig für die Lesbarkeit des Literaturverzeichnisses ist eine gute Unterscheidung<br />
der einzelnen Quellen, z.B. durch hängende Absätze, Zeilenabstand, … (aber keine Aufzählungszeichen).<br />
<strong>Die</strong> Ordnung des Literaturverzeichnisses erfolgt alphabetisch ohne Unterteilung nach Themen-,<br />
Sach- oder Wissenschaftsgebieten. Ausschlaggebend für die Einordnung einer Quelle in das<br />
Literaturverzeichnis ist der Familienname des Autors (ohne akademische Titel). Werden von einem<br />
Autor mehrere Werke angegeben, so werden sie chronologisch nach dem Erscheinungsjahr geordnet<br />
(ältester Titel zuerst). Titel mit mehreren Autoren (Koautoren) kommen erst nach der Auflistung<br />
aller Titel des erstgenannten Autors. Dabei gilt als erstes Kriterium die alphabetische Reihenfolge<br />
der Koautoren, als zweites Ordnungskriterium das Erscheinungsjahr.<br />
Literatur kann auch von einer Person, einer Personengruppe oder beispielsweise einer Institution<br />
herausgegeben werden. Ist dies der Fall, ist dieser als „Hrsg.“ (Herausgeber) gekennzeichnet.<br />
Printmedien<br />
Bücher und Sammelwerke<br />
Nachname, Vorname-Initial. (ggf. „Hrsg.“) (Erscheinungsjahr). Titel. Untertitel (ggf. Auflage). Verlagsort:<br />
Verlag.<br />
Beispiele Bücher<br />
BAUER, E. W. (Hrsg.) (2006). Humanbiologie. Berlin: Cornelsen.<br />
CHRISTNER, J., DREHER, C., FRANK, R. & SCHWEIZER, J. (Bearbeitung) (2003). Biologie für Gymnasien. Natura Kurstufe.<br />
Baden- Württemberg 4. Stuttgart: Klett.<br />
FRANK, G. (2002). Koordinative Fähigkeiten im Schwimmen. Der Schlüssel zur perfekten Technik. Schorndorf: Hofmann<br />
Beispiel Sammelwerk<br />
PREUSCHOFT, H. <strong>Die</strong> Biomechanik des aufrechten Ganges und ihre Konsequenzen für die Evolution des Menschen. In<br />
CONARD, N. J. (Hrsg.) (2006). Woher kommt der Mensch Tübingen: Attempto.<br />
Bei Artikeln aus Zeitschriften werden die erste und letzte Seite des Artikels mit angegeben:<br />
Nachname, Vorname-Initial. (Erscheinungsjahr). Titel. Name der Zeitschrift, Jahrgang, Seitenangaben.<br />
Beispiel<br />
KLENK, H.-D. (2001). Influenza. Gefürchtet und verharmlost. biologenheute. 457. 2-7.<br />
Zeitungen<br />
Nachname, Vorname-Initial. (Erscheinungsdatum). Titel. Name der Zeitung, Ausgabennummer,<br />
Seitenangaben.<br />
2
Methodenschulung Klasse 9 - RG Weinstadt<br />
elektronische Medien<br />
Es wird empfohlen, nur Quellen einzusetzen, deren Beständigkeit zuverlässig eingeschätzt werden<br />
kann. <strong>Die</strong> Trennungen von Internetadressen sind zu vermeiden. Sind sie jedoch bei langen URLs<br />
notwendig, so darf die Trennung nur nach einem Schrägstrich „/“ oder vor einem Punkt durch Einfügen<br />
eines Leerzeichens erfolgen; ein Trennstrich „-“ darf nicht eingefügt werden. ’Google’ ist keine<br />
Quelle!<br />
www-Seiten<br />
Das Internet ist ein schnelllebiges Medium. Bei der Zitation von Internetseiten aus dem World-Wide-<br />
Web (WWW) ist vor allem auf die genaue Angabe des Datums des Zugriffs zu achten: Tag (als Zahl),<br />
Punkt, Monat (ausgeschrieben) und Jahr.<br />
Beispiele<br />
BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG. Zugriff am 7. November 2008 unter http://www.bpb.de/publikationen/JNSCIW,<br />
0,Umweltpolitik.html<br />
DEUTSCHE HAUPTSTELLE FÜR SUCHTFRAGEN E.V. Zugriff am 03. Oktober 2008 unter http://www.dhs.de/web/infomaterial/<br />
broschueren.php<br />
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT. Zugriff am 23. August 2008 unter http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/multimedial/<br />
techmax/index.html<br />
pdf-Versionen<br />
Beispiele<br />
BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (BZGA). (Hrsg.) (2008). HIV / Aids von A bis Z - Heutiger<br />
Wissensstand. Zugriff am 7. November 2008 unter www.bzga.de/pdf.phpid=f6773ef186fafa054a553ad<br />
3f80fb056<br />
DEUTSCHER BASKETBALL BUND. (Hrsg.) (2000). Regelwerk für die Schule. Zugriff am 07. November 2008 unter http://www.<br />
basketball-bund.de/basketball-bund/de/kids_und_schule/schulsport/regelwerk/1653.html<br />
Bilder und andere graphische Darstellungen werden unter Bildnachweis gesondert aufgeführt:<br />
Name des Bildes, aus: [bibliographische Angaben der Quelle]<br />
Beispiel<br />
Industrialisierung brachte CO 2-Schub, aus: Spiegel Online. Zugriff am 07. November 2008 unter http://www.spiegel.de<br />
/wissenschaft/natur/0,1518,grossbild-320279-322781, 00.html<br />
[ technischer Hinweis: eingefügte Bilder (insbesondere hochauflösende Fotos) in ’Word’ und ’PowerPoint’ sollten<br />
komprimiert werden: „Format“ „Grafik“ („Grafik formatieren“) „Bild“ „komprimieren“ („Bilder komprimieren“) <br />
„Auflösung 200dpi“ . . . ]<br />
<strong>5.</strong>3 Das richtige Zitieren<br />
Zitat<br />
Sämtliche Aussagen einer <strong>Arbeit</strong>, die nicht von ihrem Verfasser selbst stammen, müssen gekennzeichnet<br />
werden. Ihre Herkunft ist so genau anzugeben, dass sie vom Leser jederzeit mit einem<br />
Minimum an <strong>Arbeit</strong>saufwand überprüft werden können. Alle im Text angegebenen Literaturstellen<br />
müssen ins Literaturverzeichnis aufgenommen werden.<br />
Zitate sollten nur dann verwendet werden, wenn es sich um besonders prägnante Sätze handelt, auf<br />
deren Wortlaut es ankommt. Ein Zitat ist eine wörtliche Übernahme einer fremden Aussage in den<br />
eigenen Text. Eine derartige Übernahme muss buchstaben- und zeichengetreu erfolgen. Dabei ist<br />
auch auf die Übernahme der Rechtschreibung, Zeichen- oder Grammatikfehler zu achten.<br />
Zitate werden grundsätzlich durch doppelte Anführungszeichen gekennzeichnet „...".<br />
Auslassungen in Zitaten werden durch eckige Klammern mit drei Punkten kenntlich gemacht [...],<br />
vgl. DUDEN 2013, S. 33, K17.<br />
Muss man ein Zitat abändern, z.B. damit es in den eigenen Satz passt, so werden die Änderungen<br />
durch eckige Klammern […] kenntlich gemacht. Auch eigene Zusätze, um einen Namen oder einen<br />
Begriff in einem Zitat verständlicher zu machen, werden in eckige Klammern gesetzt.<br />
Kurze Zitate (weniger als vier Zeilen) erscheinen im fortlaufenden Text. Lange Zitate (mehr als vier<br />
Zeilen) werden eingerückt und bilden einen Block für sich. <strong>Die</strong> zitierte Stelle wird mit einer Kurzform<br />
belegt, die auf das Literaturverzeichnis verweist. <strong>Die</strong>se Kurzform umfasst den Familiennamen des<br />
3
Methodenschulung Klasse 9 - RG Weinstadt<br />
Autors, das Erscheinungsjahr der <strong>Arbeit</strong> und die genaue Angabe der Seite(n), auf welcher das Zitat<br />
zu finden ist (z.B. „S. 20“ oder „S. 20-23“). Hat ein Text drei bis fünf Autoren, wird diese Autorengruppe<br />
bei der Erstnennung vollständig, im weiteren Text nur noch der erstaufgeführte Autor mit dem<br />
Zusatz „u.a." genannt (z.B. „MAIER u.a., 1998, S. 144“).<br />
Beispiele<br />
Nach GÜNTHER-ARNDT & KOCKA (1987, S. 69) musste Deutschland auf seinem Weg im 19. Jahrhundert „Anders als seine<br />
großen Nachbarstaaten England und Frankreich […] die Hauptprobleme seiner neueren Geschichte, die Industrialisierung<br />
und damit verknüpft die soziale Frage, die nationale Einigung und schließlich die Freiheits- und Verfassungsfrage auf<br />
einmal und zu gleicher Zeit lösen“.<br />
Nach GÜNTHER-ARNDT & KOCKA musste Deutschland auf seinem Weg im 19. Jahrhundert „Anders als seine großen<br />
Nachbarstaaten England und Frankreich […] die Hauptprobleme seiner neueren Geschichte, die Industrialisierung und<br />
damit verknüpft die soziale Frage, die nationale Einigung und schließlich die Freiheits- und Verfassungsfrage auf einmal<br />
und zu gleicher Zeit lösen“ (1987, S. 69).<br />
„Obwohl der größte Anteil der Weltbevölkerung in Entwicklungsländern lebt, benötigen die Industrienationen in Nordamerika<br />
und Europa am meisten Energie“ (DREHER u.a., 2007, S. 179).<br />
Sekundärzitat<br />
Werden Zitate bei anderen Autoren gefunden und übernommen, muss die Quellenangabe den Zusatz<br />
„zitiert nach...“ erhalten.<br />
Beispiel<br />
DARWIN (1859, S. 456) trifft folgende Aussage: <strong>Die</strong> gemeinsame Abstammung sei „die einzige sicher bekannte Ursache von<br />
Ähnlichkeit bei Lebewesen“ (zitiert nach JUNKER, 2006, S. 12).<br />
Zum Verständnis: Zitiert wird DARWIN, jedoch wird nicht dessen Werk eingesehen, sondern das von<br />
JUNKER, und man vertraut auf die Richtigkeit des bei JUNKER gefundenen Zitats von DARWIN.<br />
Fremdsprachliches Zitat<br />
Grundsätzlich werden fremdsprachliche Zitate in der fremden Sprache zitiert. In einer Anmerkung (in<br />
Fußnoten) ist die Übersetzung beizufügen, wenn in einer anderen Sprache als Englisch zitiert wird<br />
oder wenn das englische Zitat als zu schwierig erscheint.<br />
Paraphrase (das indirekte sinngemäße Zitat)<br />
Bei einer Paraphrase wird ein fremder Text nicht wortgetreu, sondern nur sinngemäß wiedergegeben.<br />
Hat man z.B. dem Werk eines Autors einen Gedanken entnommen oder behandelt man<br />
einen Sachverhalt mit anderen Worten als der Autor, so ist dies kenntlich zu machen. Dabei entfallen<br />
die Anführungszeichen. Es muss jedoch unmissverständlich erkennbar sein, dass es sich um die<br />
Wiedergabe fremder Gedanken handelt. Der Beleg ist deshalb am Ende der betreffenden Passage<br />
mit einem „vgl.“ zu kennzeichnen.<br />
Beispiel<br />
Originaltext<br />
Der größte Nutzen von Bakterien liegt darin, dass sie unser Immunsystem auf Trab halten. Ohne diese Stimulation könnte<br />
es sich nämlich nicht richtig entwickeln. Das beweisen Experimente, die an keimfreien Tieren vorgenommen wurden: Sie<br />
haben verkümmerte Lymphknoten, eine verkleinerte Milz und bestimmte Immunzellen in der Nähe des Darms reifen nicht<br />
richtig heran.<br />
Paraphrase<br />
Unser Immunsystem wird durch Bakterien auf Trab gehalten. Durch diese Stimulation kann es sich richtig entwickeln. An<br />
keimfreien Tieren wurden Experimente durchgeführt und beweisen folgendes: <strong>Die</strong>se Tiere haben verkümmerte<br />
Lymphknoten, eine verkleinerte Milz und bestimmte Immunzellen in der Nähe des Darms reifen nicht richtig heran (vgl.<br />
BLECH, 2000, S. 36-37).<br />
Literatur<br />
LANDESINSTITUT FÜR SCHULENTWICKLUNG – LANDESBILDUNGSSERVER. GFS - von der Idee zur Präsentation. Zugriff am 03.<br />
November 2008 unter http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/deutsch/fachdidaktik/gfss/gfs4/gfs1.pdf<br />
UNIVERSITÄT TÜBINGEN, INSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT (2002). Anfertigung wissenschaftlicher <strong>Arbeit</strong>en. Tübingen.<br />
4