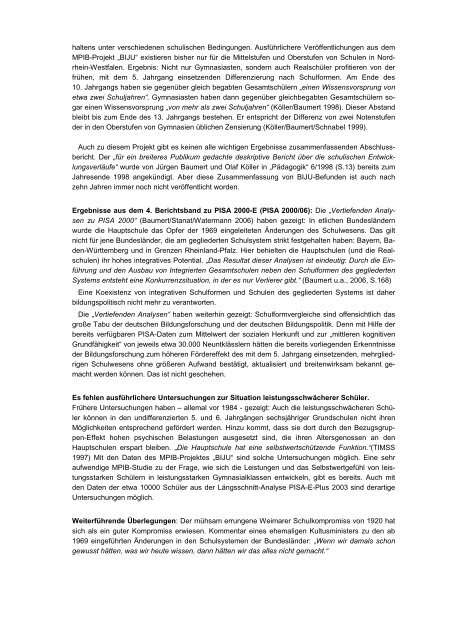Projekte des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung (MPIB) im ...
Projekte des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung (MPIB) im ...
Projekte des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung (MPIB) im ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
haltens unter verschiedenen schulischen Bedingungen. Ausführlichere Veröffentlichungen aus dem<br />
<strong>MPIB</strong>-Projekt „BIJU“ existieren bisher nur für die Mittelstufen und Oberstufen von Schulen in Nordrhein-Westfalen.<br />
Ergebnis: Nicht nur Gymnasiasten, sondern auch Realschüler profitieren von der<br />
frühen, mit dem 5. Jahrgang einsetzenden Differenzierung nach Schulformen. Am Ende <strong>des</strong><br />
10. Jahrgangs haben sie gegenüber gleich begabten Gesamtschülern „einen Wissensvorsprung von<br />
etwa zwei Schuljahren“. Gymnasiasten haben dann gegenüber gleichbegabten Gesamtschülern sogar<br />
einen Wissensvorsprung „von mehr als zwei Schuljahren“ (Köller/Baumert 1998). Dieser Abstand<br />
bleibt bis zum Ende <strong>des</strong> 13. Jahrgangs bestehen. Er entspricht der Differenz von zwei Notenstufen<br />
der in den Oberstufen von Gymnasien üblichen Zensierung (Köller/Baumert/Schnabel 1999).<br />
Auch zu diesem Projekt gibt es keinen alle wichtigen Ergebnisse zusammenfassenden Abschlussbericht.<br />
Der „für ein breiteres Publikum gedachte <strong>des</strong>kriptive Bericht über die schulischen Entwicklungsverläufe“<br />
wurde von Jürgen Baumert und Olaf Köller in „Pädagogik“ 6/1998 (S.13) bereits zum<br />
Jahresende 1998 angekündigt. Aber diese Zusammenfassung von BIJU-Befunden ist auch nach<br />
zehn Jahren <strong>im</strong>mer noch nicht veröffentlicht worden.<br />
Ergebnisse aus dem 4. Berichtsband zu PISA 2000-E (PISA 2000/06): Die „Vertiefenden Analysen<br />
zu PISA 2000“ (Baumert/Stanat/Watermann 2006) haben gezeigt: In etlichen Bun<strong>des</strong>ländern<br />
wurde die Hauptschule das Opfer der 1969 eingeleiteten Änderungen <strong>des</strong> Schulwesens. Das gilt<br />
nicht für jene Bun<strong>des</strong>länder, die am gegliederten Schulsystem strikt festgehalten haben: Bayern, Baden-Württemberg<br />
und in Grenzen Rheinland-Pfalz. Hier behielten die Hauptschulen (und die Realschulen)<br />
ihr hohes integratives Potential. „Das Resultat dieser Analysen ist eindeutig: Durch die Einführung<br />
und den Ausbau von Integrierten Gesamtschulen neben den Schulformen <strong>des</strong> gegliederten<br />
Systems entsteht eine Konkurrenzsituation, in der es nur Verlierer gibt.“ (Baumert u.a., 2006, S.168)<br />
Eine Koexistenz von integrativen Schulformen und Schulen <strong>des</strong> gegliederten Systems ist daher<br />
bildungspolitisch nicht mehr zu verantworten.<br />
Die „Vertiefenden Analysen“ haben weiterhin gezeigt: Schulformvergleiche sind offensichtlich das<br />
große Tabu der deutschen <strong>Bildungsforschung</strong> und der deutschen Bildungspolitik. Denn mit Hilfe der<br />
bereits verfügbaren PISA-Daten zum Mittelwert der sozialen Herkunft und zur „mittleren kognitiven<br />
Grundfähigkeit“ von jeweils etwa 30.000 Neuntklässlern hätten die bereits vorliegenden Erkenntnisse<br />
der <strong>Bildungsforschung</strong> zum höheren Fördereffekt <strong>des</strong> mit dem 5. Jahrgang einsetzenden, mehrgliedrigen<br />
Schulwesens ohne größeren Aufwand bestätigt, aktualisiert und breitenwirksam bekannt gemacht<br />
werden können. Das ist nicht geschehen.<br />
Es fehlen ausführlichere Untersuchungen zur Situation leistungsschwächerer Schüler.<br />
Frühere Untersuchungen haben – allemal vor 1984 - gezeigt: Auch die leistungsschwächeren Schüler<br />
können in den undifferenzierten 5. und 6. Jahrgängen sechsjähriger Grundschulen nicht ihren<br />
Möglichkeiten entsprechend gefördert werden. Hinzu kommt, dass sie dort durch den Bezugsgruppen-Effekt<br />
hohen psychischen Belastungen ausgesetzt sind, die ihren Altersgenossen an den<br />
Hauptschulen erspart bleiben. „Die Hauptschule hat eine selbstwertschützende Funktion.“(TIMSS<br />
1997) Mit den Daten <strong>des</strong> <strong>MPIB</strong>-<strong>Projekte</strong>s „BIJU“ sind solche Untersuchungen möglich. Eine sehr<br />
aufwendige <strong>MPIB</strong>-Studie zu der Frage, wie sich die Leistungen und das Selbstwertgefühl von leistungsstarken<br />
Schülern in leistungsstarken Gymnasialklassen entwickeln, gibt es bereits. Auch mit<br />
den Daten der etwa 10000 Schüler aus der Längsschnitt-Analyse PISA-E-Plus 2003 sind derartige<br />
Untersuchungen möglich.<br />
Weiterführende Überlegungen: Der mühsam errungene We<strong>im</strong>arer Schulkompromiss von 1920 hat<br />
sich als ein guter Kompromiss erwiesen. Kommentar eines ehemaligen Kultusministers zu den ab<br />
1969 eingeführten Änderungen in den Schulsystemen der Bun<strong>des</strong>länder: „Wenn wir damals schon<br />
gewusst hätten, was wir heute wissen, dann hätten wir das alles nicht gemacht.“