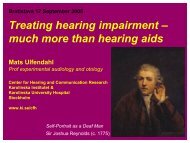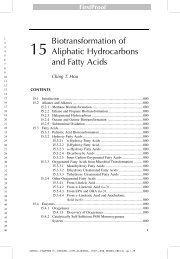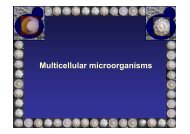Die Kunst des wissenschaftlichen Schreibens und Sprechens1
Die Kunst des wissenschaftlichen Schreibens und Sprechens1
Die Kunst des wissenschaftlichen Schreibens und Sprechens1
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
<strong>Schreibens</strong> <strong>und</strong> Sprechens 1<br />
Peter Auer<br />
——————<br />
1 <strong>Die</strong>ser Text geht auf ein Forschungsprojekt zurück, das die Volkswagenstiftung an der<br />
Universität Freiburg gefördert hat. An seinem Zustandekommen war Harald Baßler<br />
wesentlich beteiligt. <strong>Die</strong> kontrastiven Analysen zum Russischen <strong>und</strong> Deutschen wurden<br />
von Anna Breitkopf durchgeführt (vgl. auch A. Breitkopf, 2006, Wissenschaftsstile im<br />
Vergleich. Freiburg).
0. Einleitung<br />
Auch im <strong>wissenschaftlichen</strong> Schreiben (<strong>und</strong> Sprechen) kommt es auf die<br />
Form an; es gibt gut <strong>und</strong> schlecht geschriebene wissenschaftliche Texte.<br />
<strong>Die</strong> stilistischen Normen unterscheiden sich nach wissenschaftlicher<br />
Disziplin, historischer Epoche <strong>und</strong> Kulturkreis. Aber: auch Wissenschaftler<br />
müssen sich durchaus Gedanken über die sprachliche Form ihrer Publikationen<br />
machen, um von ihren Kollegen gelesen <strong>und</strong> geschätzt zu<br />
werden. <strong>Die</strong>s war nicht immer so, sondern hat sich erst im Lauf der<br />
Entwicklung <strong>des</strong> modernen abendländischen Wissenschaftsbegriffs (<strong>und</strong><br />
unauflöslich mit ihm verb<strong>und</strong>en) ergeben. Aber etwa am Ende <strong>des</strong><br />
18. Jahrh<strong>und</strong>erts haben sich – zunächst in den Naturwissenschaften --<br />
Stilprinzipien für das wissenschaftliche Schreiben entwickelt, die einerseits<br />
im Zusammenhang mit den spezifischen Funktionen <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Arbeitens zu sehen, andererseits aber auch auf die Normen einzelner<br />
wissenschaftlicher Gemeinschaften zurückzuführen sind. Es handelt sich<br />
um stilistische Prinzipien, die in ihrer besonderen Kombination nur in der<br />
Wissenschaft gelten <strong>und</strong> ihren Diskurs mit definieren: Wer nicht so<br />
schreibt, wird nicht gelesen.<br />
<strong>Die</strong> Linguistik, deren Forschungsgegenstand der Gebrauch der Sprache,<br />
vornehmlich der nicht-literarischen Sprache, in verschiedensten<br />
kommunikativen Sphären <strong>und</strong> Medien ist, hat sich in den vergangenen<br />
Jahrzehnten diesem Thema verstärkt zugewandt (vergleiche zuletzt<br />
Fløttum u.a. 2006) <strong>und</strong> dabei einiges zur Aufdeckung der verdeckten <strong>und</strong><br />
offenen Stilnormen der Wissenschaft beigetragen. Einige dieser Stilnormen<br />
werden im Folgenden beschrieben.<br />
1. Wissenschaftlicher Sprachstil: Sprache auf der Suche<br />
nach der Wahrheit<br />
Würde man Laien wie Wissenschaftler fragen, was Wissenschaft eigentlich<br />
tut, so würde man wohl häufig die Antwort hören, dass sie die Welt erforscht,<br />
um sie besser zu verstehen. Es geht darum, Zusammenhänge in
der Welt aufzudecken <strong>und</strong> zu beschreiben, um dadurch allgemeingültige<br />
Merkmale <strong>und</strong> Mechanismen herauszustellen. Wissenschaftler wählen dazu<br />
Erscheinungen in der Welt aus <strong>und</strong> klassifizieren sie oder sie führen<br />
Experimente durch. <strong>Die</strong> Ergebnisse werden dann benutzt, um Verallgemeinerungen<br />
zu gewinnen, aus denen sich im Idealfall abstrakte<br />
Theorien über die Welt bauen lassen. Für die Publikation der Ergebnisse<br />
dieser Art <strong>wissenschaftlichen</strong> Forschens scheint ein sprachlicher Stil<br />
angemessen, der durch Exaktheit <strong>und</strong> Neutralität (Objektivität) gekennzeichnet<br />
ist, weil er nichts tun soll, als die Dinge als solche darzustellen. Er<br />
ist <strong>des</strong>halb auch universell, das heißt unabhängig vom Autor <strong>und</strong> seiner<br />
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur oder Gesellschaft. <strong>Die</strong>s ist die<br />
(oder zumin<strong>des</strong>t eine) landläufige Meinung. Wie sieht es nun mit dieser<br />
Exaktheit, Neutralität/Objektivität <strong>und</strong> Universalität <strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
<strong>Schreibens</strong> in der Praxis aus Textlinguistische Untersuchungen<br />
belegen, dass sie zwar nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, jedoch in<br />
mancherlei Hinsicht modifiziert werden müssen.<br />
1.1. <strong>Die</strong> Exaktheit von Wissenschaftssprache<br />
Bei der Benennung von Phänomenen im Objektbereich einer Wissenschaft<br />
ist die Sprache selbst ein Problem. <strong>Die</strong> Alltagssprache reicht zur Kategorisierung<br />
nicht aus; sie ist bei weitem nicht genug ausdifferenziert, um die<br />
ständig sich erneuernden <strong>und</strong> verfeinernden Beobachtungen <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Forschens zu erfassen. Es werden also neue Wörter benötigt, die für<br />
Laien häufig unverständlich sind, weil sie nicht zur Alltagssprache gehören,<br />
sondern innerhalb der <strong>wissenschaftlichen</strong> Disziplin entstanden sind <strong>und</strong> in<br />
ihrem Rahmen definiert werden. So wird in dem folgenden Ausschnitt aus<br />
einem medizinischen Aufsatz über die durch Zecken übertragene<br />
Borreliose dafür eine Gruppe von Bakterien verantwortlich gemacht, die<br />
»Spirochäten«:<br />
Beispiel 1:<br />
<strong>Die</strong> auslösende Spirochäte Borrelia burgdorferi sensu lato ist sehr heterogen <strong>und</strong><br />
kann in min<strong>des</strong>tens 10 verschiedene Spezies unterteilt werden, von denen aber<br />
nur 3 sicher humanpathogen sind: B. afzelii, B. garinii <strong>und</strong> B. burgdorderi sensu<br />
stricto [40].
Quelle: Huppertz/Krause 2003: 175<br />
Über die Unschärfe <strong>des</strong> Alltagswortschatzes hinausgehende, präzise definierte<br />
Fachtermini sind ein besonders markantes Kennzeichen von Wissenschaftstexten.<br />
Sie entsprechen den Idealen der Exaktheit, Eindeutigkeit,<br />
Kontextunabhängigkeit <strong>und</strong> evaluativen Neutralität der Wissenschaftssprache<br />
(vergleiche Baßler 2002). Als exakt gelten Fachwörter, weil sie definiert<br />
sind. Für eindeutig werden sie gehalten, weil ein Fachwort nur eine Bedeutung<br />
hat beziehungsweise einer Bedeutung nur ein Fachwort zugeordnet<br />
werden kann. Solche Fachwörter können/müssen auch ohne den (Satz-/<br />
Text-/Situations-) Kontext verständlich sein, sie sind also kontextunabhängig.<br />
Als evaluativ neutral gelten sie schließlich, weil bei der Bildung<br />
solcher Fachwörter keine ästhetischen Gr<strong>und</strong>sätze beachtet werden müssen<br />
<strong>und</strong> in sie keine Bewertungen einfließen.<br />
Dem Gedanken, Wissenschaftler benutzten neue Wörter (Termini) zur<br />
Kategorisierung neu entdeckter Phänomene, liegt die idealistische, ja naive<br />
Vorstellung zugr<strong>und</strong>e, dass Welt bereits vor jeder Erkenntnis vorhanden sei<br />
<strong>und</strong> durch die Sprache lediglich abgebildet würde. Tatsächlich ist aber die<br />
Wahrnehmung der Welt durch die Erfahrungen menschlicher Subjekte<br />
geprägt <strong>und</strong> wird überhaupt erst durch diese Erfahrungen in je spezieller<br />
Weise hergestellt. Dass wissenschaftliches Denken <strong>und</strong> Schreiben trotz<br />
aller Bemühungen um exakt definierte Begriffe letztendlich seine Basis <strong>und</strong><br />
seinen Ausgangspunkt in der (alltäglichen) Erfahrung <strong>des</strong> einzelnen Wissenschaftlers<br />
hat, wird aus linguistischer Perspektive nicht zuletzt dadurch<br />
belegt, dass zur Benennung neu entdeckter Phänomene oder Zusammenhänge<br />
nur selten wirklich völlig neue Wörter geschaffen werden. Manchmal<br />
werden Wörter der Alltagssprache neu definiert (vergleiche etwa den<br />
Begriff Wurzel in der Mathematik beziehungsweise Linguistik oder den Begriff<br />
Erbgut in der Genetik). <strong>Die</strong> Verbindung zwischen der alltagssprachlichen<br />
<strong>und</strong> der <strong>wissenschaftlichen</strong> Verwendung <strong>des</strong> Worts ist dann in der<br />
Regel metaphorisch; die Bedeutungskomponenten <strong>des</strong> alltagssprachlichen<br />
Begriffs werden in versteckter Weise mit in die wissenschaftliche Verwendung<br />
transportiert, obwohl sie nicht Teil der kodierten Terminologie sind<br />
(etwa die Idee <strong>des</strong> Gr<strong>und</strong>legenden, Ursprünglichen, Nahrungsspendenden<br />
bei Wurzel oder <strong>des</strong> wirtschaftlichen Besitztums, das von einer Generation<br />
auf die andere weitergegeben wird <strong>und</strong> so zum Wohlstand der Familie beiträgt<br />
bei Erbgut).
Viel häufiger wird bei der <strong>wissenschaftlichen</strong> Begriffsbildung jedoch auf<br />
Elemente anderer Sprachen zurückgegriffen: Vor allem das Lateinische <strong>und</strong><br />
Griechische haben dabei in den Natur- <strong>und</strong> Geisteswissenschaften <strong>des</strong><br />
Abendlan<strong>des</strong> eine herausragende Rolle gespielt. Viele von diesen Bildungen<br />
sind reine Übersetzungen (Radikal anstelle von Wurzel), andere sind jedoch<br />
– jedenfalls für die Eingeweihten – ebenfalls hochgradig metaphorisch <strong>und</strong><br />
bauen auf vor<strong>wissenschaftlichen</strong> Bildwelten auf (vergleiche zum Beispiel<br />
die Appendicitis acuta/akute Blinddarmentzündung in der Medizin aus<br />
lateinisch appendix/Anhängsel mit der Konnotation nicht essentiell,<br />
überflüssig, nutzlos). Wieder andere lehnen sich metaphorisch an die<br />
Verwendung in einer anderen <strong>wissenschaftlichen</strong> Fachsprache an (wie die<br />
IT-Verwendung von Virus sich metaphorisch an den medizinischen Sprachgebauch<br />
anschließt). In all diesen Fällen wird die wissenschaftliche Objektivität<br />
zunächst gegen den Strich einer alltagssprachlichen Subjektivität gebürstet<br />
(solange, bis niemand mehr sich bewusst macht, dass er oder sie<br />
metaphorisch schreibt, wenn von Wurzeln, Erbgut oder Viren die Rede ist).<br />
<strong>Die</strong> Basis der <strong>wissenschaftlichen</strong> Terminologie liegt also außerhalb ihrer<br />
selbst <strong>und</strong> sie trennt sich nur idealtypisch vollständig von ihr.<br />
Um hinreichende spezifische Termini zu erhalten, werden außerdem<br />
verschiedene Verfahren der kompositionellen Wortbildung eingesetzt.<br />
Neben Zusammensetzungen vom Typ Kollektivgut oder Regressionsgerade gehören<br />
dazu zum Beispiel Mehrwortbildungen (Alle-oder-Niemand-Verträge,<br />
win-win-situation), Kombinationen mit Eigennamen (Gaussche Normalverteilung)<br />
oder Buchstaben-Wort-Verbindungen (F-Skala, SOEP-Daten).<br />
Auf der Satzebene führt das Streben nach Exaktheit in der Wissenschaftssprache<br />
zur Erweiterung von Satzgliedern durch Attribute. Im folgenden<br />
Beispiel 2 wird das Nomen Erythema durch vorangestellte, erweiterte<br />
Partizipialkonstruktionen sowie ein nachgestelltes Relativsatzattribut erweitert,<br />
in Beispiel 3 folgt dem Nomen Diskussion ein adjektivisch erweitertes<br />
Präpositionalattribut, <strong>des</strong>sen nominaler Kern selbst wieder durch ein Genitivattribut<br />
spezifiziert wird:<br />
Beispiele 2 <strong>und</strong> 3:<br />
Dabei findet sich ein nicht jucken<strong>des</strong>, sich zentrifugal ausbreiten<strong>des</strong> Erythema, das bei<br />
längerem Bestehen eine zentrale Abblassung zeigen kann.<br />
Quelle: Huppertz/Krause 2003: 176<br />
<strong>Die</strong> Diskussion über die situativen <strong>und</strong> die dispositionellen Bedingungen (überdauernden
Persönlichkeitseigenschaften) <strong>des</strong> Gehorsamkeitsverhaltens dauert an <strong>und</strong> lenkt den<br />
Blick wieder stärker auf differentielle Aspekte:<br />
Quelle: Steiner/Fahrenberg 2000: 330<br />
Allerdings sind nicht alle in der Sprache prinzipiell möglichen Formen der<br />
Erweiterung im <strong>wissenschaftlichen</strong> Stil gleichermaßen gebräuchlich. Der<br />
moderne westliche Wissenschaftsstil zeichnet sich durch eine starke Tendenz<br />
zur Nominalisierung aus; Nominalgruppen werden durch andere<br />
Nominalgruppen erweitert. Was bis ins 19. Jahrh<strong>und</strong>ert beliebt war, nämlich<br />
vielfach eingebettete <strong>und</strong> verzweigte Nebensatzkonstruktionen, wird<br />
hingegen heute vermieden. Dadurch bleibt der Bau der Sätze gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
einfach <strong>und</strong> transparent, auf der Ebene der Phrasen erhöht sich die Komplexität<br />
allerdings beträchtlich:<br />
Beispiel 4:<br />
<strong>Die</strong> graphischen Umsetzungen dieser Formeln in (29) sollen die drei Fragmente illustrieren,<br />
[…]<br />
Quelle: Egg 2006: 17<br />
Statt: Dadurch, dass die Formeln in (29) graphisch umgesetzt werden, sollen<br />
die drei Fragmente illustriert werden<br />
Bemerkenswert ist dabei, dass durch diese Art der Informationskondensierung<br />
in der Nominalgruppe bestimmte logische Operatoren, wie in Beispiel<br />
4 das modale dadurch, entfallen können beziehungsweise müssen. Entgegen<br />
dem Ideal der Exaktheit werden die Texte dadurch vager <strong>und</strong> interpretationsbedürftiger.<br />
<strong>Die</strong> Leser müssen eine ganze Reihe von Leerstellen<br />
auffüllen, die durch diese kondensierten Konstruktionen entstehen. Dafür<br />
ein weiteres Beispiel:<br />
Beispiel 5:<br />
Nach diesen Vorüberlegungen können im fünften Abschnitt die Implikationen der<br />
strukturellen Beschaffenheit von Entscheidungssituationen auf die Erklärungsleistung, die<br />
man von Rational-Choice-Modellen erwarten kann, differenzierter <strong>und</strong> genauer<br />
untersucht werden<br />
Quelle: Mensch 2000: 247
Statt: Nachdem dieses vorher überlegt worden ist, kann im fünften Abschnitt<br />
differenzierter <strong>und</strong> genauer untersucht werden, was die strukturelle Beschaffenheit<br />
von Situationen, in denen Entscheidungen gefällt werden, für die Leistungen,<br />
Sachverhalte zu erklären, implizieren, die man von Rational-Choice-<br />
Modellen erwarten kann<br />
Insgesamt entsteht ein sehr stark verdichteter Stil, in dem aber durchaus<br />
Interpretationsspielräume enthalten sind, wie die einzelnen Denotate zueinander<br />
in Beziehung stehen. Wissenschaftsstil ist auf der Ebene der<br />
Objektbenennungen (die in der Regel durch Nominalphrasen geleistet<br />
werden) also tendenziell sehr genau; auf der Ebene der Aussagen über<br />
diese Objekte ist aber ein erhebliches Vor- <strong>und</strong> Weltwissen erforderlich.<br />
1.2. Neutralität <strong>und</strong> Objektivität der Wissenschaftssprache<br />
Objektivität <strong>und</strong> Neutralität gelten vielen Wissenschaftstheoretikern als<br />
forschungsleitende Prinzipien (vergleiche Drescher 2003). <strong>Die</strong> Sprache, mit<br />
der die wissenschaftliche Beobachtung der Welt den Fachkollegen zugänglich<br />
gemacht wird, muss diesem Ziel dienen <strong>und</strong> ebenfalls objektiv <strong>und</strong><br />
neutral sein. <strong>Die</strong> verwendeten sprachlichen Mittel müssen <strong>des</strong>halb nicht<br />
nur Eindeutigkeit garantieren, sondern vor allem sachlich, neutral, ja unpersönlich<br />
sein. Harald Weinrich (1990) leitet daraus drei Verbote ab, die<br />
allerdings alle drei faktisch nicht eingehalten werden, obwohl sie als<br />
Normen durchaus akzeptiert werden. Eines davon ist das sogenannte<br />
»Metaphern-Verbot«, mit dem wir uns schon beschäftigt haben.<br />
Als weiteres Verbot führt Weinrich das »Ich-Verbot« an: Wissenschaftler<br />
führen sich selbst in die Texte nicht mit ich ein. Als Gr<strong>und</strong> dafür nennt<br />
Weinrich, dass die Beobachtung <strong>und</strong> das wissenschaftliche Handeln frei<br />
sein soll von »individuellen Besonderheiten der einzelnen Forscherpersönlichkeit«<br />
(Weinrich 1990: 8). Und tatsächlich verwenden die Autoren wissenschaftlicher<br />
Texte Strategien, um die Ich-Referenz zu vermeiden. Sie<br />
weichen zum Beispiel auf das Wir aus, obwohl sie sich eigentlich selbst bezeichnen,<br />
<strong>und</strong> erwecken damit den Eindruck, dass sie zusammen mit dem<br />
Leser oder Zuhörer eine Gruppe bilden:
Beispiel 6:<br />
In diesem Beitrag wollen wir die Frage angehen, welche Auswirkungen die<br />
neuen Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologien auf die Arbeit haben.<br />
Quelle: Knoblauch 1996<br />
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Autoren von sich in der<br />
dritten Person schreiben, wie in folgendem Abstract:<br />
Beispiel 7:<br />
Da dem Autor die erste Option wenig realistisch erscheint, plädiert er abschießend<br />
für eine gradualistische Strategie zur Realisierung der zweiten gr<strong>und</strong>legenden<br />
politischen Alternative.<br />
Quelle: Offe 1998: 359<br />
Ein weiteres Verfahren, um die Ich-Referenz zu vermeiden, ist die Wahl<br />
von syntaktischen Konstruktionen, die den Autor als Handelnden völlig in<br />
den Hintergr<strong>und</strong> drängen. Dafür steht vor allem das Passiv zur Verfügung<br />
(Beispiel 8), das als typisch für die Wissenschaftssprache gilt.<br />
Beispiel 8:<br />
<strong>Die</strong>ser Geltungsanspruch wird hier bestritten.<br />
Quelle: Aretz 1997: 79<br />
<strong>Die</strong>ses Verfahren hat aber insbesondere im englischen Wissenschaftsstil in<br />
den letzten Jahrzehnten an Boden verloren, wie die folgende Graphik zeigt.<br />
Waren 1961 noch ziemlich genau zwei Drittel aller finiten Verbalphrasen in<br />
<strong>wissenschaftlichen</strong> Texten im Passiv (<strong>und</strong> zwar im britischen <strong>und</strong> im<br />
amerikanischen Englisch), so ist dieser Anteil dreißig Jahre später erheblich<br />
gesunken (insbesondere im amerikanischen Englisch, dem in Hinblick auf<br />
diesen Stilwandel daher Führungsfunktion zukommt). Abbildung 1 stellt<br />
die Zahlenverhältnisse graphisch dar:
80<br />
70<br />
60<br />
67 66<br />
57<br />
50<br />
40<br />
42<br />
30<br />
20<br />
10<br />
1961<br />
0<br />
BrE<br />
AmE<br />
1991 / 1992<br />
Abbildung 1: Passivanteile aller finiten Verbphrasen in der Wissenschaftsprosa nach Seoane 2004<br />
Schließlich kann dem Text selbst Handlungscharakter zugesprochen werden;<br />
das Produkt steht dann metonymisch für seinen Autor:<br />
Beispiel 9:<br />
Der vorliegende Artikel versucht, auf der Basis verfügbarer Informationen über<br />
gesellschaftliche Mentalitäten herauszufinden, wie es um die Durchsetzungsfähigkeit<br />
kosmozentrischer Ethiken steht.<br />
Quelle: Döbert 1994:306<br />
Trotz dieses »Ich-Verbots« zeigen allerdings viele empirische Studien aus<br />
den letzten Jahren, dass Autoren viel häufiger auf sich selbst mit ich verweisen,<br />
als das bisher vermutet wurde – Tendenz steigend. Der Wissenschaftsstil<br />
wird also persönlicher. Ein typisches Beispiel:<br />
Beispiel 10:<br />
Im folgenden werde ich zunächst kurz skizzieren, mit welchen Formulierungen<br />
Louis Wirth zum populären Theoretiker von »Urbanität« werden konnte. Dabei<br />
handelt es sich im Kern um die Aussage, Großstädte seien Brutstätten von Toleranz<br />
<strong>und</strong> Zivilisation, in Großstädten könne daher die Integration von heterogenen<br />
Kulturen <strong>und</strong> Lebensstilen am besten gelingen. Da sich Wirth weitgehend<br />
auf Simmel stützt, werde ich anschließend den Text von Simmel noch einmal
esümieren – was zu einem etwas anderen Ergebnis führt als in Wirths verkürzter<br />
Rezeption. Das Simmelsche Konzept, das den Prozess der Individualisierung<br />
ins Zentrum stellt, konfrontiere ich dann mit den Vorstellungen von Robert Park<br />
bzw. der Chicago Schule, für die der Prozess der Gruppenbildung durch Segregation<br />
die entscheidende Dimension von »Stadtkultur« ist.<br />
Quelle: Häußermann 1995: 90<br />
Wie dieser Soziologe, so benutzen viele Autoren die selbstreferentielle erste<br />
Person vor allem dann, wenn sie die Leser darüber informieren wollen, wie<br />
der Text aufgebaut ist <strong>und</strong> welche Fragestellung sie darin zu beantworten<br />
suchen. Häufig geschieht das im Einleitungsteil von Zeitschriften- oder<br />
Buchartikeln, wo die grobe Argumentationsstruktur <strong>und</strong> die Absichten <strong>und</strong><br />
Zielsetzungen dargelegt werden. Es gibt dabei allerdings kulturelle <strong>und</strong><br />
fachspezifische Unterschiede. Breitkopf (2006) stellt zum Beispiel fest,<br />
dass deutsche Soziologinnen beziehungsweise Soziologen mehr das Ich benutzen,<br />
russische Soziologen dagegen viel häufiger das Wir. Hylands<br />
(2002) Studie lässt vermuten, dass gerade in soziologischen <strong>und</strong> philosophischen<br />
Texten Ich-Konstruktionen diesen Typs besonders häufig vorkommen,<br />
in der Biologie aber beispielsweise deutlich seltener benutzt werden.<br />
Auch Sanderson (2006) weist sowohl kulturelle wie disziplinentypische<br />
stilistische Präferenzen nach.<br />
Der Wissenschaftler als Individuum tritt besonders häufig dann in<br />
Erscheinung, wenn es um metatextuelle Leseanweisungen geht. Zudem<br />
wird die Subjektivität <strong>des</strong> Autors aber auch durch viel feinere Verfahren ins<br />
Spiel gebracht. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich nämlich, dass Wissenschaftstexte<br />
keineswegs nur Fakten darstellen, sondern dass die Autoren<br />
ihre Aussagen häufig relativieren beziehungsweise abschwächen <strong>und</strong> damit<br />
ihre Haltung zum Wahrheitscharakter der Aussage ausdrücken. Ein ganz<br />
offensichtliches Beispiel ist das folgende:<br />
Beispiel 11:<br />
Ich schätze, dass die Hälfte der Ostdeutschen 1990/91 die Beschäftigung gewechselt<br />
oder verloren hat (gegenüber ca. 20% in Westdeutschland).<br />
Quelle: Zapf 1994: 297
Der Verfasser schützt sich hier gegen Einwände, indem er seine Aussage<br />
durch ein Verb modalisiert; er übernimmt eine deutlich geringere Verpflichtung,<br />
für die Wahrheit <strong>des</strong> Aussagegehalts einzustehen, dass »die<br />
Hälfte der Ostdeutschen 1990/91 die Beschäftigung gewechselt oder verloren<br />
haben«, indem er sie als Schätzung deklariert. Der Verfasser baut hier<br />
einem Gesichtsverlust gegenüber den Rezipienten vor, der sich ergäbe,<br />
wenn er die Wahrheit <strong>des</strong> Gesagten nicht belegen könnte.<br />
Besonders häufig in Wissenschaftstexten ist die Abschwächung durch<br />
das Modalverb scheinen:<br />
Beispiel 12:<br />
<strong>Die</strong>se Spezies scheinen im Sinne eines Organotropismus bevorzugt bestimmte<br />
System <strong>des</strong> Körpers zu befallen, wodurch die unterschiedlichen Manifestationen<br />
der Lyme-Borreliose erklärt werden.<br />
Quelle: Huppertz/Krause 2003: 175<br />
Würde man das Verb scheinen weglassen, würde die Aussage als nachweisbares<br />
Faktum erscheinen. Durch die Formulierung mit scheinen schwächen<br />
die beiden Wissenschaftler ihren Anspruch ab, das endgültige Wissen über<br />
die verschiedenen Spezies der Borrelien zu besitzen. Damit können sie in<br />
mehrfacher Hinsicht ihr Gesicht wahren: Einerseits schützen sie sich selbst<br />
vor möglicher Kritik aus der scientific community. Andererseits sind sie höflich:<br />
Sollte es sich bei der Aussage um eine neue wissenschaftliche Erkenntnis<br />
handeln, die in der scientific community noch nicht verbreitet ist <strong>und</strong> der<br />
der Kollegen widerspricht, so ermöglicht es die Verpackung der Feststellung<br />
mit dem Verb scheinen, diese Kollegen nicht vor den Kopf zu stoßen.<br />
Auch hier gibt es kulturelle Unterschiede, auf die ich noch zurückkommen<br />
werde.<br />
Das dritte Verbot, das Weinrich für den <strong>wissenschaftlichen</strong> Stil annimmt,<br />
ist das sogenannte Erzähltabu. »Ein Wissenschaftler erzählt nicht«<br />
(Weinrich 1990: 9), sondern er beschreibt. Auch dieses Verbot wird allerdings<br />
nicht immer befolgt. Zunächst gibt es einige wissenschaftliche Disziplinen<br />
wie die Anthropologie oder die historischen Wissenschaften, teils<br />
auch die Medizin <strong>und</strong> Psychologie (Fallbeschreibungen), in denen narrative<br />
Texte zumin<strong>des</strong>t als Teiltexte innerhalb wissenschaftlicher Publikationen<br />
durchaus eine Rolle spielen <strong>und</strong> zum Kanon der Darstellungstechniken gehören.<br />
Aber auch in anderen Disziplinen kommen narrative Strukturen
vor: So wird zum Beispiel in dem folgenden Textausschnitt ein autobiografisches<br />
Detail zum Ausgangspunkt für die allgemeine Aussage, dass bei<br />
Paaren in der Regel der Mann das Auto steuert:<br />
Beispiel 13:<br />
Als ich neulich – als Fußgänger! – ein Auto an mir vorbeifahren sah, w<strong>und</strong>erte<br />
ich mich darüber, dass die Frau auf der Fahrerseite saß, der Mann daneben –<br />
bis ich erkannte, dass es sich um ein britisches Fahrzeug handelte.<br />
Quelle: Burkart 1994: 230<br />
Im folgenden Ausschnitt dient die Geschichte zwar auch als Anknüpfungspunkt<br />
für allgemeingültige Aussagen, aber sie spricht die Leser stärker an<br />
<strong>und</strong> soll sie so dazu bringen, sich stärker auf den Argumentationsprozess<br />
<strong>des</strong> Verfassers einzulassen. Das wird dadurch erreicht, dass der Autor eine<br />
hypothetische Geschichte erzählt, deren Held der Leser ist:<br />
Beispiel 14:<br />
I want us to consider ›Saintly Cooperation.‹ One day, while you are waiting to<br />
deposit your Social Security check in a bank you are approached by an eccentric<br />
tycoon. She has a million dollars but very little time. She offers you ten dollars if<br />
you assure her that you will deposit her million dollars in her bank account. She’s<br />
in a hurry and can’t get any details about you that would enable her to track you<br />
down if you failed to keep your promise. What do you do Is it rational for you to<br />
put the money in her account After all, you are still doing better (namely, ten<br />
dollars better) than if you had given no assurance at all. But can we really consider<br />
this clearly moral, indeed saintly, decision as rational<br />
Quelle: Hyland 2004: 14<br />
Wissenschaftler erzählen auch manchmal, welche Vorgeschichte der Beitrag<br />
hat beziehungsweise wie es überhaupt zu ihm gekommen ist. Das<br />
machen sie besonders gerne in Fußnoten, wie zum Beispiel der folgende<br />
Linguist gleich in einer Fußnote zum Titel seines Aufsatzes:<br />
Beispiel 15:<br />
Der vorliegende Beitrag ist aus zwei Vorträgen an der Universitäten Siegen <strong>und</strong><br />
Wuppertal hervorgegangen. […]
Quelle: Ramers 2006: 95<br />
In dieser Art von Fußnoten gehen die Autoren dann auch immer wieder in<br />
Danksagungen an Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen über, die »wertvolle […] Anregungen<br />
<strong>und</strong> kritische […] Einwände« (ebd.: 96) zu dem Beitrag machten.<br />
Entgegen landläufiger Meinung sprechen Wissenschaftler also sehr wohl<br />
explizit von <strong>und</strong> über sich selbst <strong>und</strong> erzählen auch Begebenheiten aus<br />
ihrem Leben. Sie tragen damit dazu bei, dass ihr Artikel eine persönliche<br />
Note bekommt, den Leser stärker anspricht <strong>und</strong> an der Argumentation<br />
beteiligt sowie in manchen Fällen auch die Authentizität <strong>des</strong> Beobachteten<br />
erhöht.<br />
2. Wissenschaft erfolgt nicht im luftleeren Raum<br />
Wissenschaftler stellen neues Wissen her. Allerdings geschieht dies nicht<br />
einsam am Schreibtisch, sondern ist in der Regel selbst bereits ein kommunikativer<br />
Prozess, bei dem die Interaktion mit anderen Wissenschaftlern<br />
eine entscheidende Rolle spielt <strong>und</strong> der in einer sozialen Umgebung stattfindet<br />
(vergleiche Knorr-Cetina 1991). <strong>Die</strong>se soziale Umgebung umfasst<br />
sowohl die unmittelbare Arbeitsumgebung <strong>des</strong> einzelnen Forschers (sein<br />
Labor, sein Forschungsinstitut) als auch die scientific community (die sich auf<br />
Kongressen, im Internet, durch Publikationen <strong>und</strong> auf vielen anderen<br />
Wegen, oft über nationale Grenzen hinweg, konstituiert) <strong>und</strong> die Gesellschaft,<br />
in der der Wissenschaftler lebt. Alle drei Sphären legen der <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Forschung eben <strong>des</strong>halb enorme Beschränkungen auf, weil<br />
diese sich als soziale Aktivität an den in jenen gültigen normativen Gegebenheiten,<br />
an Machtverhältnisse <strong>und</strong> Statusverteilungen orientieren muss.<br />
Der Leiter eines Labors hat andere Möglichkeiten, Forschungsgegenstände<br />
zu bestimmen <strong>und</strong> zwischen interessanten <strong>und</strong> uninteressanten Themen zu<br />
entscheiden als ein Doktorand, <strong>des</strong>sen Arbeitsbedingungen formal <strong>und</strong><br />
inhaltlich von der Laborleitung diktiert werden. <strong>Die</strong> Institutionen der <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Selbstorganisation wie die nationalen Forschungsförderungsinstitutionen<br />
(etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft) regeln<br />
nicht nur die Zuweisung von Forschungsmitteln ganz direkt durch die Genehmigung<br />
von Anträgen, sie definieren auch, welche Forschung (welche<br />
Themen, welche Theorien, welche Methoden) akzeptiert ist <strong>und</strong> welche
nicht. (So können ganze Forschungsthemen kommen <strong>und</strong> gehen. Ein bekanntes<br />
Beispiel ist die Frage nach dem Ursprung der Sprache: Bis in das<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>ert hinein war sie eines der wichtigsten Themen sprachwissenschaftlicher<br />
Forschung; nach der Etablierung der modernen Sprachgeschichtsforschung<br />
im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert wurde das Thema zu einem rein<br />
spekulativen, unseriösen Gegenstand erklärt: zu einem Un-Thema. Erst<br />
vor wenigen Jahren hat sich dies erneut geändert.) Schließlich definiert der<br />
gesellschaftliche Kontext Themen, die in <strong>und</strong> gesellschaftlich (wirtschaftlich<br />
oder politisch) verwertbar sind, <strong>und</strong> solche, die out sind. Sie beeinflussen die<br />
Forschungsaktivitäten <strong>des</strong> Einzelnen nicht nur <strong>des</strong>halb, weil wirtschaftliche<br />
Interessen die Ressourcenverteilung in ökonomisch relevanten Disziplinen<br />
unmittelbar beeinflussen. Auch gesellschaftliche <strong>und</strong> kulturelle Fragen spielen<br />
eine Rolle. So hat die Formierung der europäischen Nationalstaaten im<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>ert die Erforschung der Geschichte, Sprache <strong>und</strong> Kultur dieser<br />
Nationalstaaten gefördert, weil sich auf diese Weise ihre Existenz überhaupt<br />
erst rechtfertigen ließ.<br />
Bereits die Wahl <strong>des</strong> Gegenstands, die Konstitution der Daten <strong>und</strong><br />
natürlich die Art <strong>und</strong> Weise, wie diese bearbeitet werden, erfolgen also vor<br />
dem Hintergr<strong>und</strong> bestimmter Interessen, Machtverhältnisse <strong>und</strong> natürlich<br />
eines bestimmten Kenntnis- <strong>und</strong> Diskussionsstan<strong>des</strong> in der <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Disziplin selbst. Der Diskurs einer Wissenschaft – der bestimmt,<br />
was dazu gehört, was randständig ist, was als wichtig angesehen wird, was<br />
altmodisch <strong>und</strong> was modern ist, was als erforschbar <strong>und</strong> das was als unseriöse<br />
Spekulation gilt – findet in <strong>und</strong> mit der Sprache statt. Zur Wissenschaftskommunikation<br />
gehören <strong>des</strong>halb nicht nur die klassischen schriftlichen<br />
<strong>wissenschaftlichen</strong> Publikationsformen (Zeitschriftenaufsatz, Rezension,<br />
Abstract et cetera) <strong>und</strong> die entsprechenden mündlichen Gattungen<br />
wie der wissenschaftliche Vortrag oder Diskussionsbeitrag, sondern auch<br />
wissenschaftliche Projektanträge <strong>und</strong> die Formen der Entscheidungsabläufe<br />
in den Gremien, die über diese Anträge entscheiden, wissenschaftliche<br />
Anhörungen, Gutachten aller Art <strong>und</strong> nicht zuletzt der Small Talk am<br />
Rande all dieser offiziellen Ereignisse, in der die Bewertung der Fachkollegen<br />
<strong>und</strong> -kolleginnen untereinander stattfindet. Der wissenschaftliche<br />
Diskurs formiert sich in diesem kommunikativen Raum.
2.1. Das Rezeptionsgebot<br />
Doch zurück zum Stil der <strong>wissenschaftlichen</strong> Publikation selbst. Wissenschaftliches<br />
Arbeiten gilt nur als seriös, wenn man in seinen eigenen Forschungspublikationen<br />
belegt, dass man die Ergebnisse <strong>und</strong> Meinungen<br />
anderer verarbeitet hat. (Weinrich 1988: 46 spricht von einem »Rezeptionsgebot«.)<br />
Der Nachweis darüber erfolgt durch Bezugnahmen auf die<br />
Arbeiten anderer in Form von Zitaten, sinngemäßen Wiedergaben oder<br />
auch nur Verweisen. Wissenschaftliche Texte sind also in einem hohen <strong>und</strong><br />
expliziten Maß intertextuell: Sie stellen ein engmaschiges Netz von<br />
gegenseitigen Bezugnahmen zwischen den verschiedenen Textproduzenten<br />
her. <strong>Die</strong>se Vernetzung geht in ihrer heutigen Form auf das 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
zurück, also auf die Zeit, in der sich viele Fachdisziplinen<br />
institutionalisierten <strong>und</strong> es zu einem regelrechten Forschungsboom kam<br />
(Bazerman 1988a).<br />
Der Bezug auf die anderen Stimmen (also die Publikationen der anderen<br />
Wissenschaftler) dient aber nicht nur dazu, deren Erkenntnisse »Falsifikationsversuchen«<br />
auszusetzen <strong>und</strong> sie damit entweder zu erhärten oder zu<br />
Fall zu bringen (Weinrich 1988: 46). Mit Eva-Maria Jakobs (1997) können<br />
vielmehr sach- <strong>und</strong> beziehungsorientierte Funktionen von Bezugnahmen<br />
unterschieden werden. Zu den sachbezogenen Funktionen von Bezugnahmen<br />
gehört es besonders,<br />
– die vorgelegten Forschungsergebnisse innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft<br />
anschlussfähig zu machen;<br />
– Belege für eigene Behauptungen anzuführen;<br />
– die Ergebnisse anderer Forscher zu bestätigen oder zu widerlegen;<br />
Beziehungsorientierte Funktionen von Bezugnahmen sind zum Beispiel,<br />
– seine Belesenheit zu beweisen;<br />
– durch Verweise auf die eigenen Publikationen Werbung für sich selbst<br />
zu machen;<br />
– durch Verweise auf Autoritäten Glaubwürdigkeit zu gewinnen;<br />
– die Wichtigkeit anderer Wissenschaftler herauszustellen, die ihrerseits<br />
mit dem eigenen Ansatz verb<strong>und</strong>en sind <strong>und</strong> ihn bestätigen;<br />
– durch Zitierkartelle Schulen innerhalb einer Wissenschaft zu bilden;<br />
– umgekehrt durch kritische Bezugnahmen oder schlichtes Ignorieren<br />
andere Wissenschaftler beziehungsweise wissenschaftliche Schulen zu<br />
bekämpfen.
Durch Zitate verortet sich der Autor also in einem <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Diskurs; er zeigt, wo er hingehört. Und er erwartet natürlich auch, dass die<br />
von ihm Zitierten (jedenfalls wenn sie hierarchisch gleichrangig oder untergeordnet<br />
sind) ihrerseits auf ihn verweisen <strong>und</strong> so seinen <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Rang bestätigen. Auf diese Weise trägt der Verfasser je<strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Textes auch zur Fortsetzung eines thematisch geb<strong>und</strong>enen<br />
Diskurses bei <strong>und</strong> kann sich so »wissenschaftliches Kapital« (Bourdieu<br />
1988; 1998) aneignen.<br />
Allerdings: Wer etabliert ist, kann es sich unter Umständen leisten,<br />
wenig oder gar nicht zu zitieren, Anfänger müssen hingegen das Rezeptionsgebot<br />
schon <strong>des</strong>halb einhalten, weil ihre Arbeiten sonst nicht publiziert<br />
werden.<br />
2.2. Publish or perish<br />
Neben dem Rezeptionsgebot gilt nach Weinrich (1988: 45) für das wissenschaftliche<br />
Arbeiten ein »Veröffentlichungsgebot«: »Denn etwas wissen<br />
<strong>und</strong> es wissenschaftlich wissen, ist nichts wert, wenn es nicht auch den<br />
anderen Wissenschaftlern bekanntgegeben wird« (Weinrich 1988: 45). Dass<br />
sich dieser Gr<strong>und</strong>satz erst in den letzten 50 Jahren in Deutschland ausgebreitet<br />
hat, wird an folgenden Zahlen deutlich: 1954 lehrten an den Universitäten<br />
der ehemaligen Bun<strong>des</strong>republik 24 Anglistik-Professoren. Sie publizierten<br />
in jenem Jahr zwölf Bücher <strong>und</strong> eine noch kleinere Zahl von Artikeln.<br />
1984 waren an den bun<strong>des</strong>deutschen Universitäten bereits 300 Professuren<br />
für Anglistik besetzt. Publiziert wurden in diesem Jahr 60 Bücher<br />
<strong>und</strong> 600 Artikel (Zahlen nach Weingart u.a. 1991: 288). Peter Weingart<br />
zeigt sehr schön auf, wie die Zunahme an Forschern <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Publikationsexplosion zu einer neuen Unüberschaubarkeit führt.<br />
Weder können sich die Beteiligten alle untereinander wahrnehmen, geschweige<br />
denn die produzierte Literatur umfassend rezipieren. <strong>Die</strong> Zahlen<br />
zeigen aber noch mehr: <strong>Die</strong> Publikationen pro Professor haben sich mehr<br />
als verdoppelt. Ein Wissenschaftler musste im Jahre 1954 nicht unbedingt<br />
regelmäßig publizieren. Überdies hat sich (in den Geisteswissenschaften)<br />
die Gattung der <strong>wissenschaftlichen</strong> Publikation verändert: War in der Anglistik<br />
Mitte <strong>des</strong> vergangenen Jahrh<strong>und</strong>erts noch das Buch die herausragende<br />
Plattform für wissenschaftliche Neuheiten, hat sich das Verhältnis<br />
inzwischen eindeutig zu Gunsten <strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong> Zeitschriften- <strong>und</strong>
Buchartikels verlagert. In vielen <strong>wissenschaftlichen</strong> Disziplinen ist das<br />
monographische Buch heute nur noch in Form <strong>des</strong> Lehrbuchs relevant; die<br />
Forschung findet in internationalen <strong>wissenschaftlichen</strong> Zeitschriften statt,<br />
die durch ein striktes System <strong>des</strong> peer-reviewing (also der Begutachtung der<br />
einzelnen Aufsätze durch Fachkollegen) vergleichbare Standards zu garantieren<br />
scheinen. (<strong>Die</strong> traditionelle wissenschaftliche Zeitschrift <strong>des</strong> 19. Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />
bei der ein Einzelner oder ein kleines Team von Herausgebern<br />
über die Qualität <strong>und</strong> damit über die Veröffentlichung der eingereichten<br />
Manuskripte entscheidet, hat sich nur in manchen kultur<strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Fächern noch in Ansätzen erhalten.) Da wissenschaftliches Renommee<br />
zunehmend durch die Anzahl der Veröffentlichungen gemessen wird, ist<br />
diese Vergleichbarkeit der Standards auch notwendig.<br />
<strong>Die</strong> Form der Ergebnispräsentation verändert sich auch durch neue<br />
Kommunikationsformen; vom Poster bei einem <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Kongress bis zur PowerPoint-Präsentation, die heute für viele<br />
Wissenschaftler die normale mediale Unterstützung <strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Vortrags ist, der sich in vielerlei Hinsicht vom traditionellen,<br />
monomedialen Vortrag unterscheidet.<br />
3. <strong>Die</strong> Gattungen <strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong> Diskurses: einige<br />
Beispiele<br />
Es ist also wichtig, sich vor Augen zu halten, dass der wissenschaftliche<br />
Diskurs durch eine Vielzahl von mündlichen <strong>und</strong> schriftlichen Gattungen<br />
bestimmt ist. Nicht alle Akteure in der Wissenschaft müssen all diese<br />
Gattungen beherrschen: <strong>Die</strong> Wissenschaftler, die Festvorträge halten,<br />
Memoranden schreiben, Gutachten zur Vergabe von Forschungsmitteln<br />
oder über die An- oder Abnahme einer Habilitationsschrift verfassen, sind<br />
nur eine kleine Untergruppe der <strong>wissenschaftlichen</strong> Gemeinschaft.<br />
Wissenschaftskommunikation erschöpft sich aber auch nicht für den<br />
„durchschnittlichen“ Wissenschaftler im Schreiben von Büchern <strong>und</strong><br />
Artikeln sowie im Ablesen von Vorträgen. Hier einige Beispiele:
3.1. Abstracts<br />
Eine wichtige, wenn auch kleine wissenschaftliche Gattung ist das<br />
Abstract, vor allem, wenn es - wie durchgängig in den<br />
Naturwissenschaften, aber immer mehr auch zum Beispiel in der Linguistik<br />
– Zugangsvoraussetzung für die aktive Teilnahme an Kongressen ist: die<br />
Begutachtung von vorweg eingereichten Abstracts dient hier der Annahme<br />
oder Ablehnung von Vorträgen, sie ist mithin ein „ticket“ für die<br />
Teilnahme am <strong>wissenschaftlichen</strong> Diskurs. Tabelle 1 (aus Busch-Lauer<br />
2006) zeigt exemplarisch Unterschiede auf, die in verschiedenen<br />
Fachgebieten <strong>und</strong> Sprachen durch die Analyse der Teiltextsegmente in<br />
Abstracts ermittelt wurden.<br />
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, folgen Abstracts, die auf Experimenten<br />
<strong>und</strong> Versuchen beruhen, einem festen Schema, nach dem zunächst die<br />
Forschungslücke aufgezeigt wird <strong>und</strong> danach die Zielstellung, das Material<br />
<strong>und</strong> die verwendete Methodik der Untersuchung vorgestellt werden, bevor<br />
schließlich die wichtigsten Ergebnisse diskutiert oder Konsequenzen für<br />
die weitere Forschung abgeleitet werden.
Tabelle 1:<br />
Übersicht zu den Teiltextsegmenten in verschiedenen Fachgebieten<br />
Autor Fachgebiet/Sprachen Teilsegmente<br />
A. Oldenburg<br />
(1997: 70–75):<br />
Hutz<br />
(1997: 107ff.)<br />
Ad-Hoc<br />
Working<br />
Group (1987)<br />
Pädagogik<br />
Maschinenbau<br />
Deutsch<br />
Englisch<br />
Sozialpsychologie<br />
Deutsch<br />
Englisch<br />
Medizin<br />
Englisch<br />
(1) Globale Charakterisierung<br />
<strong>des</strong> Forschungsfel<strong>des</strong> <strong>und</strong>/oder<br />
der Forschungssituation;<br />
(2) Hauptziel/Hauptuntersuchungsgegenstand<br />
der Arbeit;<br />
(3) Darstellung der Untersuchungsergebnisse;<br />
(4) Methoden/Modelle/Experimente/Verfahrensschritte;<br />
(5) Konsequenzen für die Forschung<br />
<strong>und</strong> Praxis.<br />
(1) Einführung in das Forschungsgebiet<br />
<strong>und</strong> Zielsetzung<br />
der Studie;<br />
(2) Angaben zu experimentellen<br />
<strong>und</strong> methodischen Gr<strong>und</strong>lagen;<br />
(3) Darlegung der wichtigsten<br />
Untersuchungsergebnisse;<br />
(4) Diskussion der Ergebnisse.<br />
Originalartikel: Objective, Design,<br />
Setting, Patients or Participants,<br />
Interventions, Main Outcome<br />
Measures, Results & Conclusion<br />
Das folgende Beispiel stammt aus der Technik.<br />
Beispiel 4:<br />
Bekanntermaßen führen Unterschiede in der Partikelgrößenverteilung von Pigmenten<br />
zu Unterschieden in der Teilchenpackung <strong>und</strong> in der Mikrostruktur von Papierstrichen<br />
(EINORDNUNG IN DAS FORSCHUNGSFELD). Es wurde bereits eine Vielzahl<br />
von Untersuchungen durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen Strichstruktur <strong>und</strong><br />
Bedruckbarkeitseigenschaften zu ermitteln. Allerdings konzentrierte sich das Interesse<br />
überwiegend auf Modellpigmente oder relativ isotrope Pigmente, wie rhomboedrische<br />
PCC-Typen, während Arbeiten zur systematischen Bewertung von Kaolinen nur in<br />
minimalem Umfang vorliegen (AUFZEIGEN DER FORSCHUNGSLÜCKE). Bei der vorliegenden<br />
Untersuchung wurden an Kaolinstrichen die Veränderungen in der Strichstruktur
während <strong>des</strong> Glättvorgangs systematisch erforscht (REFERENZ AUF DIE ZIELE UND<br />
METHODEN DER EIGENEN UNTERSUCHUNG). <strong>Die</strong> Untersuchungen bezogen sich auch<br />
auf Veränderungen in der Oberflächenrauhigkeit, Partikelorientierung <strong>und</strong><br />
Porenstruktur <strong>des</strong> Strichs <strong>und</strong> diese Veränderungen wurden zum Farbwegschlag <strong>und</strong><br />
zur Druckglanzentwicklung in Beziehung gesetzt. Anschließend wurde bei einer Reihe von<br />
maßgeschneiderten Kaolinen die Beziehung zwischen Porenstruktur <strong>und</strong> Bedruckbarkeit<br />
untersucht (VERWENDETES UNTERSUCHUNGSVERFAHREN). <strong>Die</strong> Ergebnisse bestätigen<br />
die Bedeutung <strong>des</strong> Pigment<strong>des</strong>igns für eine optimale Bedruckbarkeit <strong>des</strong> Strichs<br />
(KURZDARSTELLUNG DES ERGEBNISSES UND SCHLUSSFOLGERUNG).<br />
Quelle: Druck <strong>und</strong> Druckindustrie, 2/2000; mit Kommentaren der Verfasserin in Kapitälchen<br />
<strong>Die</strong> Sätze 1–3 führen zur Forschungslücke, die die Untersuchung notwendig<br />
macht. Satz 4 beschreibt das Untersuchungs<strong>des</strong>ign. <strong>Die</strong> Sätze 5–6<br />
benennen die Faktoren, die untersucht wurden <strong>und</strong> ihren Zusammenhang.<br />
Satz 7 thematisiert schließlich die Konsequenzen <strong>des</strong> Untersuchungsergebnisses.<br />
3.2. PowerPoint<br />
In den letzten Jahren ist eine massive Ausbreitung von audiovisuellen<br />
Präsentationen zu beobachten. Durch die Vorherrschaft einer bestimmten<br />
Software-Gruppe werden diese Präsentationen nach deren Programm<br />
benannt: Wir reden gemeinhin von »PowerPoint-Präsentationen«, die die<br />
älteren Formaten wie etwa Folienpräsentationen mittels<br />
Tageslichtprojektor, Diaprojektor-gestützte Vorträge <strong>und</strong> so weiter<br />
weitgehend abgelöst haben.<br />
Günthner <strong>und</strong> Knobloch (2006: 62-3) haben diese Form der<br />
Kommunikation untersucht <strong>und</strong> die typischen Merkmale von PowerPoint-<br />
Präsentationen herausgearbeitet: „<strong>Die</strong> Präsentation zeichnet sich schon<br />
binnenstrukturell durch Besonderheiten aus. Als Bezugspunkt <strong>des</strong> Vortrags<br />
dienen visuelle Darstellungen, Schaubilder, Graphiken <strong>und</strong> Textausschnitte,<br />
die meist mittels eines Beamers für ein Präsenzpublikum simultan während<br />
<strong>des</strong> mündlichen Vortrages auf eine Leinwand projiziert werden. <strong>Die</strong>se<br />
Darstellungen folgen einer mittlerweile schon eingespielten Typik, die zwar<br />
von der Software geleitet ist, aber keineswegs von ihr determiniert wird<br />
(wie Tufte meint), da sie immerhin mit bestimmten außenstrukturellen<br />
Faktoren variiert: Naturwissenschaften neigen zum Bildlichen,
Geisteswissenschaften zum Text, die freie Wirtschaft zum Emblematischen<br />
(vergleiche Pötzsch <strong>und</strong> Schnettler 2006). Auch im binnenstrukturell<br />
Sprachlichen zeigen sich offenk<strong>und</strong>ige Unterschiede, zu denen zum einen<br />
die Check-Listen, also das Herunterspulen von items, wie sie die<br />
PowerPoint-Listen nahe legen, gehören. Ein weiteres Merkmal der<br />
PowerPoint-Vorträge ist auch das Item-Paraphrase-Format: Es wird ein<br />
Begriff oder Textausschnitt von einer – für alle sichtbar projizierten –<br />
Folie abgelesen <strong>und</strong> dann – häufig in einem ausgeprägt umgangssprachlichen<br />
Stil – paraphrasiert (Schnettler 2006). Hierbei kommt ein<br />
weiteres typisches Verfahren von PowerPoint-Präsentationen zum Tragen:<br />
Der Verweis auf das Bild. Ob mit Gesten, Zeigehandlungen oder<br />
Körperwendungen – ein ganzes performatives Arsenal dient dem Umstand,<br />
dass hier etwas präsentiert wird. <strong>Die</strong>se Performanz – ein Merkmal<br />
der situativen Realisierungsebene besteht vor allem darin, dass Bild <strong>und</strong><br />
gesprochenes Wort (seltener auch: <strong>des</strong> vorgelesenen gesprochenen Wortes,<br />
denn der typische Modus der Präsentation ist eine Art von »fresh talk«<br />
(Goffman 1981a [2005])) miteinander verb<strong>und</strong>en werden. Trotz Medialisierung<br />
ist es gerade der menschliche Körper, der gleichsam als Dreh- <strong>und</strong><br />
Angelpunkt die Verbindung zwischen beiden Ebenen leistet, die vor allem<br />
in den verschiedenen Formen <strong>des</strong> Zeigens (mit Fingern, Laserpointern<br />
oder Mauspfeilen) kulminiert.“ Nicht mehr der Sprecher, sondern das<br />
gebeamte Bild bildet den Fokus der visuellen Aufmerksamkeit bildet. <strong>Die</strong>s<br />
verändert die situative Struktur der Präsentation auf eine solche Weise,<br />
dass schon aus diesem Gr<strong>und</strong>e eine Differenz zum traditionellen Vortrag<br />
zu vermuten ist.<br />
3.3. Diskussionen nach dem Vortrag<br />
<strong>Die</strong>se Gattung hat ihre ganz besonderen Tücken. Auch hier sind die<br />
Gepflogenheiten von Anlass zu Anlass (großer Kongress, wo meist über<br />
Mikrofon eine Frage gestellt wird, kleiner Workshop mit informeller<br />
Verteilung <strong>des</strong> Rederechts, Diskussion nach einem Vortrag in einer Sektion<br />
einer Tagung, wo meist extremer Zeitdruck herrscht) recht unterschiedlich,<br />
<strong>und</strong> wieder unterscheiden sich die <strong>wissenschaftlichen</strong> Disziplinen. Mehr als<br />
sonst vielleicht in der Wissenschaftskommunikation tritt der Status <strong>des</strong>
oder der Fragenden in den Vordergr<strong>und</strong>; eine Frage einer internationalen<br />
Zelebrität nach dem Vortrag eines Anfängers kann aufbauend sein (in der<br />
Regel ist das so) oder ihn/sie in seiner weiteren Karriere massiv schädigen.<br />
Eine Frage eines Anfängers an einen hochberühmten Redner kann<br />
umgekehrt peinlich sein (wenn der Frage sich eine Autorität anmaßt, die er<br />
nicht hat) oder ihn zu einem Star machen. Es gibt in diesem Bereich also<br />
stillschweigende Regeln der Angemessenheit, die den Novizen nicht immer<br />
klar sind – schon, weil er oder sie vielleicht die Hierarchien <strong>und</strong> Netzwerke<br />
nicht gut kennt.<br />
Ein Beispiel für die formale Struktur von Diskussionsbeiträge<br />
diskutiert H. Baßler (2006). Es handelt sich dabei um den dritten<br />
Diskussionsbeitrag zu einem Vortrag bei der Tagung Familie <strong>und</strong> soziale<br />
Ungleichheit, in dem sich der Vortragende mit der damals aktuellen<br />
offiziellen Familien- <strong>und</strong> Gleichstellungspolitik der Bun<strong>des</strong>regierung<br />
auseinandersetzte <strong>und</strong> darin enthaltene Paradoxien herausstellte. <strong>Die</strong><br />
Situation ist die einer Sektion mit relativ wenig Teilnehmern <strong>und</strong> einer eher<br />
informellen Atmosphäre. Der Ausschnitt setzt in dem Moment ein, als der<br />
Moderator unmittelbar nach dem zweiten Diskussionsbeitrag einer<br />
weiteren Teilnehmerin (DI), die sich offensichtlich nonverbal bemerkbar<br />
machte, das Wort erteilt:<br />
Beispiel 8:<br />
01 MD:<br />
02 DI:<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
ja bitte<br />
äh mein name is angelika (feingeld)<br />
ich bin vom max planck institut (hier) in stuttgart <strong>und</strong> ich hab<br />
auch eine frage zu ihren gesellschaftspolitischen forderungen.<br />
ihrer/(.) eine ihrer hauptforderungen war ja (.)<br />
ausbau der kinderbetreuung was ich erst mal sehr sympathisch<br />
finde.<br />
andererseits äh (-)<br />
ich weiß nicht ob dieses argument (nich) immer wieder überbewertet<br />
wird.<br />
wenn man sich zum beispiel (einstellung zu) kinderbetreuung in<br />
westdeutschland anguckt (-)<br />
sagen zum beispiel sehr viele frauen ja also kinderbetreuung is<br />
ne gute sache aber mein eigenes kind (.) das würd ich (nicht in<br />
die krippe geben). (-)<br />
<strong>und</strong> äh ob (--) da nicht einfach (-) über (-) das einfach<br />
überschätzt wird. die bedeutung von kinderbetreuung
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23 VO:<br />
wenn man nich andere maßnahmen (.) äh mit einbezieht. nicht<br />
mit berücksichtigt (dass das) kinderbetreuungssystem in westdeutschland<br />
(--) nur ein teil eines ganzen systems is was frauen<br />
aus dem arbeitsmarkt äh (-) frauen nich aber frauen mit kindern<br />
aus=m arbeitsmarkt raus(hält).<br />
ja is sicherlich richtig dass die (-) tatsächliche […]<br />
Quelle: Freiburger Korpus zu deutschen <strong>und</strong> russischen Wissenschaftsgattungen<br />
Bassler analysiert das Beispiel wie folgt: „<strong>Die</strong> Erteilung <strong>des</strong> Rederechts<br />
lediglich mit der Formulierung ja bitte macht der Diskutantin deutlich, dass<br />
sie nicht zu dem inneren Kreis der Kommunikationsteilnehmer gehört, die<br />
durch regelmäßigen Kontakt miteinander vertraut sind, denn diese kennen<br />
sich namentlich (vergleiche auch Webber 2002: 246). <strong>Die</strong>s führt dazu, dass<br />
sich die Diskutantin zunächst einmal vorstellt: Zur Identifizierung wählt sie<br />
die syntaktisch vollständige Vorstellungsformel mein name is mit Vor- <strong>und</strong><br />
Familiennamen unter Zusatz ihrer beruflichen Wirkungsstätte. (In anderen<br />
Diskussionen, in denen der Moderator ebenfalls das Rederecht ohne<br />
namentliche Nennung zuweist, treten auch syntaktisch verkürzte Varianten<br />
auf, wie zum Beispiel rolf wudlik universität erfurt.) In der Einleitungsphase<br />
ihres Diskussionsbeitrags vollzieht die Diskutantin eine weitere<br />
thematische Aktivität, die bei vielen anderen Diskutanten ebenfalls zu<br />
beobachten ist: Mit der Formulierung ich hab auch eine frage zu ihren<br />
gesellschaftspolitischen forderungen klassifiziert sie zunächst ihren Redebeitrag.<br />
<strong>Die</strong> Klassifikation <strong>des</strong> eigenen Beitrags als Frage ist dabei recht typisch.<br />
Andere Möglichkeiten sind:<br />
– ich habe ne eher gesellschaftspolitische anmerkung<br />
<strong>und</strong> aus einer Konferenz über den deutschen Naturforscher <strong>und</strong> Weltumsegler<br />
Georg Forster:<br />
– gestatten Sie mir einige bemerkungen zu dem besuch auf der osterinsel<br />
(Ventola 2002a: 40);<br />
– ich wollt nur, nur eine kurze bemerkung (Ventola 2002b: 353).<br />
<strong>Die</strong> Einstufung <strong>des</strong> eigenen Beitrags als Frage oder als Anmerkung<br />
suggeriert, dass man den Vortragenden nicht attackieren möchte: Eine<br />
Frage suggeriert, dass der Diskutant auf seiner eigenen Seite ein<br />
Wissensdefizit entdeckt hat, dass er etwas noch nicht weiß. Macht man
dagegen eine Anmerkung oder Bemerkung, wird recht neutral eine<br />
thematische Ergänzung angedeutet. Zudem fokussieren die Diskutanten<br />
mit den daran angeschlossenen präpositionalen Elementen (zum Beispiel<br />
zu ihren gesellschafts-politischen forderungen) die Aufmerksamkeit <strong>des</strong> Referenten<br />
(<strong>und</strong> natürlich auch der übrigen Zuhörer) auf einen bestimmten Aspekt,<br />
den sie in ihrem Beitrag thematisieren möchten. Wie in unserem Beispiel<br />
geben die Diskutanten dann meist Aspekte aus dem Vortrag in ihren<br />
eigenen Worten wieder. Daher kommen hier auch häufig Ausdrücke <strong>des</strong><br />
Sagens vor, an die sich eine Redewiedergabe anschließt:<br />
– andererseits (-) ist der fall dass sie gesagt haben mittlere <strong>und</strong> höhere bildungsgruppen<br />
wurden befragt;<br />
– sie haben einerseits institutionalistische konzepte angesprochen (-) kulturalistische<br />
konzepte ähm (-);<br />
– äh du hast erzählt die alleinerziehenden (.) die mit ner anderen erwachsenen<br />
im haushalt leben werden als paare gekennzeichnet.<br />
Bei den wiedergegebenen Elementen handelt sich in der Regel um Interpretationen<br />
der Diskutanten, was sie durch Formulierungen anzeigen wie<br />
– ich wiederhol noch mal wie ich das verstanden habe;<br />
– wenn ich=s richtig verstanden hab;<br />
– so hab ich das verstanden.<br />
<strong>Die</strong> Diskutanten machen damit nicht nur ihre subjektive Perspektive<br />
deutlich, aus der sie den Vortrag gehört haben, sondern räumen den<br />
Vortragenden auch später die Möglichkeit ein, ihre interpretierten<br />
Ausführungen als Missverständnis vom Tisch zu wischen.<br />
Vor der Formulierung <strong>des</strong> eigentlichen Anliegens bewerten die<br />
Diskutanten häufig auch den Vortrag, zumin<strong>des</strong>t Aspekte daraus. In dem<br />
Ausschnitt oben bek<strong>und</strong>et die Diskutantin zum Beispiel zunächst einmal<br />
Sympathie mit der Forderung, die Kinderbetreuungsplätze auszubauen (was<br />
ich erst mal sehr sympathisch finde). <strong>Die</strong> Mitteilung von Nettigkeiten, zu denen<br />
auch das Lob der Verständlichkeit <strong>und</strong> der Überzeugungskraft oder die<br />
Signalisierung von Konsens gehören, sind aber nur eine Möglichkeit der<br />
Bewertung. Statt<strong>des</strong>sen kann nämlich auch direkt Kritik vorgebracht<br />
werden, wobei die Diskutanten Negatives selten explizit, sondern eher<br />
implizit formulieren <strong>und</strong> die kritische Äußerung erst aus dem Kontext<br />
deutlich wird. <strong>Die</strong>se klassische ja-aber-Strategie mit vorangestellter positiver<br />
Bewertung ist damit eine Höflichkeitsstrategie, mit der die Diskutantin
ihren nachfolgenden Einwand <strong>und</strong> damit die Kritik an dem Vortragenden<br />
abschwächt.<br />
Ab Zeile 9 formuliert die Diskutantin, worum es ihr eigentlich geht; das<br />
Argument <strong>des</strong> Vortragenden Erhöhung der Geburtenrate durch mehr<br />
Kinderbetreuungsplätze hält sie für überbewertet (ich weiß nicht ob dieses argument<br />
(nich) immer wieder überbewertet wird). Es handelt sich also um eine Kritik –<br />
was übrigens nach einer anderen Untersuchung von Diskussionsbeiträgen<br />
bei medizinischen Konferenzen für 30 Prozent der gestellten Fragen gilt<br />
(vergleiche Webber 2002: 230ff.). <strong>Die</strong> Kritik in unserem Fall tritt zwar<br />
durch Verwendung <strong>des</strong> Verbs überbewertet offen zu Tage. <strong>Die</strong> Diskutantin<br />
schwächt aber gleichzeitig ihren Einwand in mehrfacher Hinsicht ab: Sie<br />
formuliert ihn gerade nicht als kategorische Aussage (»<strong>Die</strong>ses Argument<br />
wird überbewertet«), sondern tarnt ihn als indirekte Frage, die abhängig ist<br />
von der Formulierung ich weiß nicht. Damit hält sie beide Möglichkeiten,<br />
Über- oder Unterschätzung <strong>des</strong> Arguments Kinderbetreuung, offen.<br />
Zudem wird durch die Ich-Perspektive der Einwand als subjektive Meinung<br />
dargestellt. Sie vermeidet damit einen harschen Angriff auf den<br />
Vortragenden. Eigentlich könnte es die Diskutantin bei dieser Frage<br />
bewenden lassen <strong>und</strong> ihren Beitrag abschließen. Das tut sie aber nicht.<br />
Statt<strong>des</strong>sen erläutert sie ihren Einwand mehrfach: <strong>Die</strong> erste Erläuterung hat<br />
die Funktion, den Einwand zu rechtfertigen. Sie stützt sich dabei auf Frauen,<br />
deren Einstellung gegen Kindertagesstätten in Form einer kollektiven<br />
Redewiedergabe dargestellt wird: sagen zum beispiel sehr viele frauen ja also<br />
kinderbetreuung is ne gute sache aber mein eigenes kind (.) das würd ich (nicht in die<br />
krippe geben).<br />
Nach dieser Rechtfertigung ihrer Position kommt die Diskutantin noch<br />
einmal auf ihr Anliegen zurück: (-) <strong>und</strong> äh ob (--) da nicht einfach (-) über (-) das<br />
einfach überschätzt wird. die bedeutung von kinderbetreuung. <strong>Die</strong>ses Mal wiederholt<br />
sie ihren Einwand aber bereits sicherer: zwar immer noch als untergeordnete<br />
Entscheidungsfrage, aber nicht mehr abhängig von einer übergeordneten<br />
Unsicherheitsformulierung wie beim ersten Mal. Und wieder<br />
schiebt sie zur Stützung <strong>des</strong> reformulierten Einwands eine weitere Rechtfertigung<br />
nach, dass nämlich Kinderbetreuung nur ein teil eines ganzen systems ist,<br />
was frauen mit kindern aus=m arbeitsmarkt raushält. <strong>Die</strong> Diskutantin macht also<br />
ihren Beitrag schrittweise verständlicher, stellt aber damit das anfänglich<br />
zaghaft, für den Vortragenden wenig gesichtsbedrohend vorgebrachte Anliegen<br />
durch Rechtfertigungen <strong>und</strong> Reformulierung auch immer eindring-
licher dar, so dass der Druck für den Vortragenden größer wird, sich<br />
intensiv mit dem Beitrag auseinanderzusetzen.<br />
In anderen Fällen werden statt<strong>des</strong>sen Gründe genannt, die dem<br />
Vortragenden erläutern, warum man eine Frage stellt: zum Beispiel weil<br />
man als Zuhörer etwas im Vortrag vermisst hat oder weil einem etwas<br />
unklar blieb:<br />
– in ihrem vortrag is=es gar nicht so: (.) zur sprache gekommen;<br />
– ähm zwei sachen sind mir noch nicht ganz klar geworden.<br />
Schaut man sich die Diskussionsbeiträge anderer Tagungen an, zum Beispiel<br />
die, die Webber (ebd.) bei zwei internationalen Medizinkongressen<br />
mit deutscher Beteiligung gesammelt hat, dann stellt man eine etwas andere<br />
Struktur der Diskussionsbeiträge fest. Hier kommen die Teilnehmer<br />
schneller, ohne Umschweife zur Sache. <strong>Die</strong>s hängt sicher auch mit der<br />
angesetzte Diskussionszeit zusammen: Bei den soziologischen Tagungen,<br />
aus denen die oben aufgeführten Beispiele stammen, wurde durchschnittlich<br />
pro Vortrag über zwölf Minuten diskutiert, während bei den Medizinkonferenzen<br />
lediglich fünf Minuten für die Diskussion vorgesehen waren.<br />
Webber (ebd.) untersucht in ihrem Material besonders die Fragetypen,<br />
die der Formulierung <strong>des</strong> Anliegens dienen: <strong>Die</strong> größte Gruppe machen<br />
bei ihr solche Fragen aus, mit denen die Diskutanten versuchen, noch<br />
mehr Informationen hervorzulocken, die über den Vortrag <strong>des</strong> Referenten<br />
hinausgehen (sogenannte »information-eliciting questions«). Dazu gehören<br />
zum einen Fragen der Art Könnten Sie x kommentieren beziehungsweise Was<br />
ist ihre Meinung zu/über x Zum anderen bilden Fragen wie Haben Sie versucht,<br />
x zu tun einen neutraleren Fragetyp. Webber stellt fest, dass dieser Fragetyp<br />
vor allem dann vorkommt, wenn die Vortragenden in ihrem Referat<br />
von Problemen sprachen, die sie noch nicht gelöst hatten. Implizit enthalten<br />
solche Fragen Vorschläge für den Vortragenden, wie er eventuell die<br />
angesprochenen Probleme lösen kann. <strong>Die</strong>ser Typ macht aber bei Webber<br />
(ebd.: 231) nur neun Prozent aus.“
4. Universalität <strong>und</strong> Kulturalität wissenschaftlicher Stile<br />
»Internationalität ist ein Wesenszug <strong>und</strong> ein Bedürfnis der Wissenschaft.«<br />
Mit diesem Satz leitet der Philosoph Jürgen Mittelstraß einen Aufsatz über<br />
die Internationalität von Wissenschaft ein (vergleiche Mittelstraß 2002).<br />
International sei Wissenschaft nicht nur, weil es wissenschaftliche Institutionen<br />
<strong>und</strong> damit wissenschaftliches Handeln praktisch in jeder Gesellschaft<br />
gebe (<strong>und</strong> diese Institutionen heutzutage in einer globalen Wissenschaftsszene<br />
miteinander vernetzt seien), sondern auch, weil immer mehr<br />
Probleme der heutigen Welt nur durch gemeinsames wissenschaftliches<br />
Handeln über nationale Grenzen hinweg gelöst werden könnten – man<br />
denke zum Beispiel an ökologische Probleme oder an die Kluft zwischen<br />
Industrienationen <strong>und</strong> Staaten der Dritten Welt.<br />
Jenseits dieser Herausforderungen, die von außen an die Wissenschaft<br />
herangetragen werden, hat sich auch in der Wissenschaftskommunikation<br />
selbst Einiges verändert. In jüngster Vergangenheit wird für jeden <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Arbeitenden die Tendenz zur Globalisierung immer deutlicher.<br />
Was für Naturwissenschaftler schon seit längerer Zeit gilt, ist inzwischen<br />
auch bei den geistes- <strong>und</strong> sozial<strong>wissenschaftlichen</strong> Disziplinen angekommen:<br />
Der Kontakt zwischen Wissenschaftlern über Lan<strong>des</strong>- <strong>und</strong> Sprachgrenzen<br />
wird immer normaler, der Wissenschaftsbetrieb unifiziert sich.<br />
Dazu haben neben verbilligten Reisemöglichkeiten <strong>und</strong> verstärkter elektronischer<br />
Zusammenarbeit auch die politischen Veränderungen seit den<br />
Achtzigerjahren beigetragen. <strong>Die</strong> Möglichkeiten, sich mit Kolleginnen <strong>und</strong><br />
Kollegen aus osteuropäischen Ländern zu treffen <strong>und</strong> mit ihnen zusammenzuarbeiten,<br />
sind heute wesentlich vielfältiger als noch vor 30 Jahren. In<br />
Europa wird die Integration neuer Länder in die Europäische Union diesen<br />
Prozess in den nächsten Jahren noch verstärken. Spezielle Programme<br />
nationaler Förderungsinstitutionen unterstützen die Internationalisierung<br />
der Wissenschaft. So investiert zum Beispiel die Volkswagen-Stiftung, die<br />
von Rainer Nicolaysen (2002: 1) als »leistungsstärkste wissenschaftsfördernde<br />
Stiftung in Deutschland« bezeichnet wird, zwischen zehn <strong>und</strong><br />
20 Prozent ihres jährlichen Finanzvolumens, das über 90 Millionen EURO<br />
beträgt (Zahlen nach Mittelstraß 2002: 470), in die Förderung international<br />
orientierter Forschung. Auch die nationale Einrichtung für Forschungsförderung<br />
DFG investiert in solche internationalen Programme.<br />
Das führt uns zum letzten der Klischees über Wissenschaftsstil: nämlich<br />
der Auffassung, dass wissenschaftliches Handeln universalen Prinzi-
pien folgt <strong>und</strong> damit auch die oben aufgeführten Stilprinzipien für wissenschaftliche<br />
Texte kulturunabhängig seien. Aus dem oben Gesagten ist allerdings<br />
schon abzuleiten, dass eine solche Kulturunabhängigkeit nur dann zu<br />
erwarten wäre, wenn Wissenschaftstexte wirklich ausschließlich der objektiven<br />
<strong>und</strong> wertungsfreien, exakten Übermittlung von Aussagen über die Welt<br />
dienten. Wir haben diese Auffassung bereits ausführlich kritisiert. Sobald<br />
aber Wissenschaft als ein Aggregat von Diskursen gesehen wird, die unterschiedlichen<br />
Regulierungsverfahren unterliegen <strong>und</strong> innerhalb derer sich<br />
die Wissenschaftler durchaus auch subjektiv positionieren, sobald Wissenschaft<br />
auch als ein Prozess gesehen wird, in der nicht jeder gleich gut zu<br />
Wort kommt <strong>und</strong> gleich gehört wird, wird Konformität mit den Normen<br />
<strong>des</strong> Diskurses zu einem wesentlichen Kriterium. Zahlreiche Studien<br />
belegen inzwischen, dass sich diese Normen in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen<br />
<strong>und</strong> in verschiedenen Wissenschaftskulturen durchaus<br />
unterscheiden (vergleiche etwa Hyland 1999; Ivanic 1998; Kotthoff<br />
2001; Kreutz/Harres 1997; Mauranen 1992; Breitkopf 2006; Sanderson<br />
2006). Wie stark sich das »Rezeptionsgebot« in Verweisen auf andere Autoren<br />
niederschlägt, wie sehr sich der Autor als Person in der Ich-Perspektive<br />
herausstellt, wie viel subjektive Modalität erlaubt ist, wie wichtig lineare<br />
Textstruktur <strong>und</strong> klare Argumentationslinie sind, welche Formen der Kritik<br />
erlaubt sind – diese <strong>und</strong> viele andere Merkmale wissenschaftlicher Texte<br />
sind unterschiedlich geregelt. <strong>Die</strong> kulturellen Differenzen auf diesem Gebiet<br />
sind weniger national, als nach kulturellen Wissenschaftsräumen organisiert:<br />
Zum Beispiel ließ sich zumin<strong>des</strong>t bis vor einigen Jahrzehnten in<br />
Europa ein deutsch-nordeuropäisch-osteuropäischer Stilraum von einem<br />
romanischen <strong>und</strong> einem angloamerikanischen unterscheiden. Inzwischen<br />
scheinen sich allerdings diese kulturellen Unterschiede anzugleichen, während<br />
die zwischen den Disziplinen weiterhin eine große Rolle spielen<br />
(Sanderson 2006). Für diese Angleichung ist der genannte Trend zu globalisierten<br />
<strong>wissenschaftlichen</strong> Märkten verantwortlich, die über internationale<br />
Publikationsorgane einen erheblichen Druck auf die alten kulturellen<br />
Schreibtraditionen ausüben <strong>und</strong> diese vereinheitlichen. Allerdings ist dabei<br />
der angloamerikanische Wissenschaftsstil nicht zuletzt aufgr<strong>und</strong> seiner<br />
Leserfre<strong>und</strong>lichkeit, vor allem aber natürlich als Konsequenz der beherrschenden<br />
Stellung US-amerikanischer Wissenschaftler in vielen Bereichen<br />
der Gewinner: Er setzt sich, zusammen mit der Publikationssprache<br />
Englisch, mehr <strong>und</strong> mehr durch <strong>und</strong> verdrängt die anderen <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Diskurs- <strong>und</strong> Stilgemeinschaften. Manche sehen das als eine Ver-
armung der Wissenschaft (vergleiche Graefen <strong>und</strong> Thielmann in diesem<br />
Band), andere betrachten die Unifizierung der Wissenschaften als Chance<br />
<strong>des</strong> weltweiten verstärkten Austauschs (vergleiche Ventola in diesem Band).<br />
Bei der Diskussion über diese Frage sollte man freilich nicht vergessen,<br />
dass wissenschaftliche Diskurse nie frei von Regeln der Darstellung <strong>und</strong><br />
der Präsentation waren, die inhaltliche Aspekte überlagert haben; <strong>und</strong> dass<br />
nie alle (National-) Sprachen als Wissenschaftssprachen akzeptiert wurden.<br />
Anhang: deutscher <strong>und</strong> russischer Wissenschaftsstil im<br />
Vergleich (aus: Breitkopf/Vassileva 2006)<br />
Unter der rhetorischen Struktur eines <strong>wissenschaftlichen</strong> Textes versteht<br />
man die Abfolge von <strong>und</strong> den Zusammenhang zwischen einzelnen thematischen<br />
Teilen im Text. <strong>Die</strong> rhetorische Struktur eines Textes kann zum<br />
Beispiel linear sein, wenn sich das Hauptthema über eine Kette aneinander<br />
geknüpfter Einzelthemen entfaltet. Von einer digressiven rhetorischen<br />
Struktur spricht man dagegen dann, wenn die Entwicklung <strong>des</strong> Hauptthemas<br />
durch die Einführung von Nebenaspekten unterbrochen wird<br />
(Clyne 1987). <strong>Die</strong>se Nebenaspekte haben keinen direkten Zusammenhang<br />
zum Hauptthema, dienen aber dazu, zusätzliche Informationen zu vermitteln,<br />
die in der Regel die Argumentation <strong>des</strong> Autors unterstützen. Osteuropäische<br />
Wissenschaftler scheinen in ihren Artikeln einen digressiven Textaufbau<br />
einem linearen vorzuziehen. Zu diesem Ergebnis kamen nicht nur<br />
Kaplan (1966), Galtung (1985), Čmejrkova/Daneš (1997) <strong>und</strong> Duszak<br />
(1997), sondern auch Punkki/Schröder (1989), die einen russischen soziologischen<br />
Artikel aus dem Jahr 1986 zur Problematik sowjetischer Industriebetriebe<br />
analysierten, der 1986 in der Zeitschrift Sociologičeskije issledovanija<br />
erschienen ist. In dem Aufsatz werden folgende Themen behandelt:<br />
<strong>Die</strong> Rolle der Soziologie in der sowjetischen Gesellschaft, Probleme der<br />
sowjetischen Planwirtschaft, Aspekte der Sozialplanung, die Rolle<br />
soziologischer Befragungen im Industriebetrieb, die Beteiligung der Werktätigen<br />
an der Leitung sozialer Prozesse im Industriebetrieb, Aspekte der<br />
Entlohnungssysteme sowie Fluktuation <strong>und</strong> Arbeitszufriedenheit. <strong>Die</strong><br />
Autoren stellten fest, dass die Teilthemen <strong>des</strong> Textes keinen expliziten Bezug<br />
zueinander haben <strong>und</strong> damit für den Leser kein klares thematisches
Zentrum bilden. Allenfalls lassen sich die einzelnen Themen unter Einbeziehung<br />
von Hintergr<strong>und</strong>wissen durch die Konstruktion eines übergeordneten<br />
Themas verbinden<br />
<strong>Die</strong> Tendenz, einen Text so zu schreiben, dass er nur auf der Basis gemeinsamen<br />
Hintergr<strong>und</strong>wissens verstanden werden kann, ist auch bei anderen<br />
russischen Soziologen zu beobachten (vergleiche Breitkopf 2005). <strong>Die</strong>s<br />
lässt sich am Beispiel der Verwendung von intensivierenden Modalwörtern<br />
wie конечно (selbstverständlich) oder естественно (natürlich) in russischen<br />
<strong>und</strong> deutschen Wissenschaftstexten verdeutlichen. <strong>Die</strong>se Modalwörter können<br />
sowohl am Anfang als auch in der Mitte eines Satzes vorkommen.<br />
Stehen sie im Deutschen am Anfang eines Satzes, so erwartet man eine<br />
konzessive Struktur: Gegen die so eingeleitete Meinung wird im Folgesatz<br />
eine andere gestellt, die der Verfasser vertritt (im Sinne der Konstruktion<br />
zwar […] aber):<br />
Beispiel 1:<br />
Natürlich können die Akteure, die zwischen Kooperation <strong>und</strong> Nicht-Kooperation<br />
wählen müssen, über Kommunikation im Dunstkreis <strong>des</strong> Nutzenkalküls<br />
eine Strategiekombination wählen, die zum Pareto-Optimum führt (Feld I).<br />
Nachdem sie aber miteinander vereinbart haben, zu kooperieren, steht jeder<br />
rationale Akteur im weiteren Handlungsverlauf vor der Wahl, ob er nun der<br />
Vereinbarung folgt oder nicht.<br />
Quelle: Aretz 1997<br />
Eine nahe liegende Lesart ist hier: Es ist zwar richtig, dass die Akteure<br />
zwischen Kooperation <strong>und</strong> Nicht-Kooperation wählen können; sie sind<br />
aber in ihren weiteren Handlungsentscheidungen frei.<br />
In russischen Wissenschaftstexten ist es hingegen durchaus möglich,<br />
dass die Modalwörter конечно oder естественно einen Satz einleiten, ohne<br />
einen Kontrast aufzubauen. <strong>Die</strong> Modalwörter funktionieren dann, im<br />
Wortsinn der Adverbien, nicht als Konzessivmarker sondern als Verweise<br />
auf geteiltes Hintergr<strong>und</strong>wissen, das der Leser mit dem Verfasser teilen<br />
sollte. <strong>Die</strong>ses Hintergr<strong>und</strong>wissen wird im Satz nicht explizit erläutert, dient<br />
aber als Mittel, um verschiedene thematische Teile zu verbinden:<br />
Beispiel 2:<br />
Конечно, Россия такая страна, где распространенные во всем мире понятия
и явления не могут рассматриваться так же, как в нормальном политическом<br />
и экономическом дискурсе. А значит, тем более необходимо проанализировать,<br />
что представляет собой современный средний класс, каковы<br />
его функции и состав, экономическая роль и идеология, в чем состоит<br />
особенность для российского общества, каковы перспективы его формирования<br />
и развития в России.<br />
Übersetzung:<br />
Natürlich ist Russland ein Land, in dem Begriffe <strong>und</strong> Erscheinungen, die in der<br />
ganzen Welt verbreitet sind, nicht so betrachtet werden können, wie es in einem<br />
normalen politischen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Diskurs geschieht. Deshalb ist es um<br />
so notwendiger zu analysieren, was die zeitgenössische Mittelschicht an sich<br />
darstellt, durch welche Funktionen, Bestandteile, wirtschaftliche Rolle <strong>und</strong> Ideologie<br />
sie gekennzeichnet ist, worin ihre Besonderheit für die russische Gesellschaft<br />
besteht, welche Perspektiven für ihre Herausbildung <strong>und</strong> Entwicklung in<br />
Russland vorhanden sind.<br />
Quelle: Belajeva 1996<br />
<strong>Die</strong> russische Verfasserin will sagen: »Wie wir alle wissen, ist Russland ein<br />
Land, in dem die üblichen gesellschaftlich-politischen Phänomene anders<br />
als in einem stabileren Land sind.« Aus diesem gemeinsamen Wissen<br />
werden nun (siehe in Beispiel 2: <strong>des</strong>halb) weitere Aussagen abgeleitet. Ein<br />
deutscher Leser würde nach dem ersten Satz hingegen ein folgen<strong>des</strong>, mit<br />
jedoch, trotzdem oder aber eingeleitetes Gegenargument erwarten.<br />
Auch in der Textgliederung osteuropäischer wissenschaftlicher Artikel<br />
lassen sich Unterschiede gegenüber der westlichen Tradition feststellen.<br />
Während die Texte angloamerikanischer <strong>und</strong> in der neuesten Zeit auch<br />
zunehmend kontinentalwesteuropäischer Natur- <strong>und</strong> Geisteswissenschaftler<br />
eine einheitliche sogenannte IMRD-Struktur aufweisen, die aus einer<br />
Einleitung (introduction), einer Methodendarstellung (methods), Ergebnissen<br />
(results) <strong>und</strong> einer abschließenden Diskussion (discussion) besteht (siehe<br />
Swales 1990; Graefen/Thielmann 2006), folgen die meisten Artikel<br />
osteuropäischer (russischer, bulgarischer, tschechischer, polnischer)<br />
Wissenschaftler nicht diesem Gliederungsmuster. Nicht selten kommt es<br />
vor, dass die osteuropäischen Texte keine markierte Gliederung in Form<br />
von Kapitelüberschriften aufweisen. Außerdem können die Anzahl der<br />
Kapitel sowie ihre Überschriften – falls sie vorkommen – von Verfasser zu<br />
Verfasser stark variieren (Prozorova 1997; Vassileva 1995; 2000; Čmejrkova/Daneš<br />
1997; Duszak 1997).
Zum Metadiskurs zählen Konstruktionen, mit deren Hilfe der Autor über<br />
den Aufbau <strong>des</strong> Textes informiert, so dass der Leser einen Überblick über<br />
die gesamte Textstruktur sowie über die einzelnen Textteile bekommt.<br />
Metadiskursive Konstruktionen sind zum Beispiel Verweise auf das, was<br />
im Text demnächst kommt, wie im Folgenden, im nächsten Kapitel, oder auf<br />
das, was bereits gesagt wurde, zum Beispiel wie bereits erwähnt (vergleiche<br />
auch Graefen/Thielmann in diesem Band). Außerdem zählen dazu Signale<br />
<strong>des</strong> Themenwechsels zum Beispiel in Form von Fragen (Wie sehen nun die<br />
Ergebnisse für die zweite Kohorte aus) <strong>und</strong> natürlich Überschriften beziehungsweise<br />
Kapitelbezeichnungen (Crismore 1984; Vande Kopple 1988). Typisch<br />
für Artikel osteuropäischer (russischer, bulgarischer <strong>und</strong> tschechischer)<br />
Wissenschaftler sind explizite Markierungen <strong>des</strong> Themenwechsels wie zum<br />
Beispiel Переходим собственно к нашим наблюдениям над употреблением слов<br />
(Wir gehen eigentlich nun zu unseren Beobachtungen zum Wortgebrauch<br />
über) (Vanhala-Aniszewski 2001). Verweise auf das Kommende oder auf<br />
das bereits Gesagte als Zeichen thematischer Übergänge, die zur Textgliederung<br />
beitragen, kommen jedoch selten vor. In den Texteinleitungen<br />
fehlen oft Ankündigungen <strong>des</strong> allgemeinen Themas <strong>des</strong> Artikels, wie sie in<br />
der westlichen Diskurstradition üblich sind (Čmejrkova/Daneš 1997: 53;<br />
Vassileva 2000; Vanhala-Aniszewski 2001). Das heißt, dass mikro-textuelle<br />
metadiskursive Ausdrücke, die die Übergänge zwischen kleineren thematischen<br />
Teilen markieren, typischer für die Texte osteuropäischer Wissenschaftler<br />
sind als Konstruktionen, die sich auf die Makroebene <strong>des</strong> Texts<br />
beziehen.<br />
Eine weitere Besonderheit <strong>des</strong> osteuropäischen Wissenschaftsstils betrifft<br />
die Titel wissenschaftlicher Beiträge. Im Gegensatz zur angloamerikanischen<br />
Tradition, in der versucht wird, bereits mit den Titeln das Interesse<br />
<strong>des</strong> Lesers/Hörers zu wecken, machen osteuropäische Wissenschaftler<br />
weniger Werbung für ihren Beitrag. Sie deuten vielmehr nur den theoretischen<br />
Rahmen <strong>des</strong> Beitrags an (vergleiche Yakhontova 2002). Für die<br />
Titel englischsprachiger Wissenschaftler sind zum Beispiel Doppelpunkt-<br />
Konstruktionen typisch, die das Interesse <strong>des</strong> Lesers auf konkrete Themen<br />
fokussieren, wie zum Beispiel Adjectives or pronouns: the status of pronominal<br />
possessives. Zusätzlich können darin Wortspielereien vorkommen: A new<br />
metaphor for metaphor: evidence for a single dynamic metaphorical category. In den<br />
Titeln russischer <strong>und</strong> ukrainischer Wissenschaftler kommen solche Doppelpunkt-Konstruktionen<br />
fast nie vor. <strong>Die</strong> Titel beginnen statt<strong>des</strong>sen mit<br />
Präpositionen к (zu) oder о (über) <strong>und</strong> stellen eine manchmal detaillierte
Beschreibung <strong>des</strong> theoretischen Rahmens <strong>des</strong> Beitrages dar: О некоторых<br />
номинациях в концептосфере русского языка (Zu einigen Nominierungen im<br />
Konzeptbereich der russischen Sprache). Solche Konstruktionen können<br />
auch zu detailliert sein, um dem Leser eine klare <strong>und</strong> knappe Vorstellung<br />
über das Thema <strong>des</strong> Beitrags zu vermitteln (siehe auch Busch-Lauer 2005:<br />
339 zu Zwischenüberschriften der Dissertationsabschnitte). Somit scheinen<br />
solche Titel weniger geeignet zu sein, das Interesse <strong>des</strong> Lesers für den<br />
Beitrag zu wecken. Möglicherweise ist diese Tendenz zur Vermeidung der<br />
Eigenwerbung osteuropäischer Wissenschaftler auf fehlende Erfahrungen<br />
im Wettbewerbsverhalten zurückzuführen, die die sozialistische Wissenschaftskultur<br />
charakterisierte (vergleiche Toren 1988). <strong>Die</strong>s hat damit zu<br />
tun, dass es während der Sowjetzeit in sozialistischen Ländern keine<br />
Arbeitslosigkeit gab, weil der Staat allen Bürgern Arbeitsplätze garantierte.<br />
<strong>Die</strong> Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt war daher unbekannt.<br />
Unter Subjektivität versteht man Verweise auf die Präsenz <strong>des</strong> Autors im<br />
Text. Sie werden vor allem durch Personalpronomina wie ich, wir <strong>und</strong> die<br />
entsprechenden Possessivpronomina wie mein – beziehungsweise unser – realisiert.<br />
Nach traditioneller Vorstellung sollten Personalpronomina in <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Texten vermieden werden (siehe zum Beispiel Foucault<br />
1977: 126; Weinrich 1990: 8ff.). <strong>Die</strong> Vermeidung der Personenreferenz<br />
beziehungsweise das Ersetzen der Personalpronomina durch Passiv- oder<br />
man-Konstruktionen soll den Eindruck vermitteln, das dargestellte Wissen<br />
sei objektiv <strong>und</strong> existiere unabhängig vom Forscher als Individuum. <strong>Die</strong><br />
neusten Studien zu Wissenschaftsstilen zeigen jedoch, dass die Verwendung<br />
von ich, mein- <strong>und</strong> ähnlichen Pronomina längst kein Tabu mehr ist<br />
(Hyland 1999; 2001; 2002). Insbesondere in der angloamerikanischen Kultur<br />
ist diese subjektive Ausdrucksweise verbreitet. Im osteuropäischen Wissenschaftsdiskurs<br />
scheint hingegen die persönliche Ausdrucksweise (noch)<br />
weniger akzeptiert zu sein.<br />
<strong>Die</strong> Tendenz zur unpersönlichen Schreibweise wird vor allem in den<br />
Texten osteuropäischer Wissenschaftler sichtbar, die bis Ende der achtziger<br />
Jahre veröffentlicht wurden (siehe Punkki/Schröder 1989; Wiese 1989;<br />
Vassileva 1998; 2000; Stănescu 2003). Wie Beispiel 3 aus einem russischen<br />
soziologischen Text zeigt, werden Formen wie ich <strong>und</strong> mein selbst dann<br />
vermieden, wenn es um den Ausdruck der persönlichen Meinung <strong>des</strong><br />
Verfassers geht. Statt <strong>des</strong>sen verwenden selbst Einzelautoren Konstruktionen<br />
wie мы думаем (wir glauben) oder на наш взгляд (aus unserer Sicht).
Beispiel 3:<br />
Меньшая степень удовлетворенности ориентированных только на свободное<br />
время, на наш взгляд, связана с несоответствием между высокими запросами<br />
и реальными возможностями использования свободного времени.<br />
Übersetzung:<br />
Ein niedrigeres Niveau der Befriedigung bei denjenigen, die sich nur an die<br />
Freizeit orientieren, ist, unserer Meinung nach, mit der Diskrepanz zwischen den<br />
hohen Ansprüchen an <strong>und</strong> den tatsächlichen Möglichkeiten zur Nutzung der<br />
Freizeit verb<strong>und</strong>en.<br />
Quelle: Patrušev 1979<br />
Mit diesem Wir bewirkt der Autor – wie mit dem Passiv- oder man-<br />
Konstruktionen –, dass er als Subjekt in den Hintergr<strong>und</strong> tritt. Vermutlich<br />
wurde diese unpersönliche Schreibweise in der osteuropäischen Wissenschaftstradition<br />
zusätzlich durch die dominierende Rolle der kommunistischen<br />
Ideologie begünstigt, in der das Kollektiv über den Einzelnen<br />
gestellt wurde.<br />
Wissenschaftliche Texte, die in den neunziger Jahren, also nach dem<br />
Zusammenbruch <strong>des</strong> sozialistischen Systems in Osteuropa, erschienen<br />
sind, weisen eine deutliche Tendenz zur Aufhebung <strong>des</strong> unpersönlichen<br />
Stils auf. Ich <strong>und</strong> mein sind kein Tabu mehr, statt wir glauben zu schreiben,<br />
wählen osteuropäische Wissenschaftler zunehmend Konstruktionen wie ich<br />
glaube, ich denke (vergleiche zum Beispiel für das Russische Breitkopf 2006).<br />
Man kann also von einem stilistischen Wandel sprechen, der sehr wahrscheinlich<br />
auf die gesellschaftspolitische Veränderung <strong>und</strong> auf die Intensivierung<br />
der Kontakte zu westlichen Wissenschaftlern zurückzuführen ist.<br />
Trotzdem wird die wir-Form in den Texten osteuropäischer Wissenschaftler<br />
immer noch häufiger als in den westlichen <strong>wissenschaftlichen</strong> Texten<br />
verwendet. Typisch für den russischen <strong>wissenschaftlichen</strong> Stil sind zum<br />
Beispiel Konstruktionen wie betrachten wir, schauen wir uns an, nun gehen wir zu<br />
folgendem Beispiel über, die den Leser durch den Text leiten <strong>und</strong> das nächste<br />
Thema einführen (siehe den Abschnitt Metadiskurs). Hierzu ein Beispiel<br />
aus einem russischen soziologischen Artikel:<br />
Beispiel 4:<br />
Присмотримся к тому, как происходит инсценирование новых культурных
стилей. Возьмем, например, стиль хиппи.<br />
Übersetzung:<br />
Schauen wir uns genauer an, wie die Inszenierung neuer Kulturstile abläuft.<br />
Nehmen wir als Beispiel den Hippie-Stil.<br />
Quelle: Ionin 1995<br />
<strong>Die</strong>ses Wir schließt sowohl den Autor selbst als auch den Leser ein. <strong>Die</strong><br />
Leser werden quasi mit in den Argumentationsprozess einbezogen (Breitkopf<br />
2006). Zu einer weiteren Anhäufung der wir-/unser-Formen kommt<br />
es zumin<strong>des</strong>t in einigen russischen soziologischen Texten dadurch, dass die<br />
Soziologen auch häufiger die ganze Gesellschaft beziehungsweise Nation<br />
thematisieren: наша история (unsere [das heißt russische; die Verfasserinnen]<br />
Geschichte), наш средний класс (unsere Mittelschicht). Der Verfasser<br />
verweist damit auf eine Gruppe, der auch er angehört (Breitkopf 2006).<br />
Möglicherweise hängt diese Verwendung der Personal- <strong>und</strong> Possessivpronomina<br />
der ersten Person Plural mir der wachsenden Selbstwahrnehmung<br />
Russlands als Nation zusammen, die im Laufe der gesellschaftspolitischen<br />
Veränderungen den früher propagierten Internationalismus ersetzt hat.<br />
Höflichkeit spielt im Alltag, aber auch in der <strong>wissenschaftlichen</strong> Kommunikation<br />
eine wichtige Rolle (Myers 1989). Wie offen darf ein Wissenschaftler<br />
seine Gegner bei einer Diskussion oder in einer Publikation kritisieren<br />
Wie kann man mögliche Kritik seitens der Leser oder Hörer vermeiden<br />
Wie kategorisch dürfen wissenschaftliche Behauptungen sein Welche<br />
Form der Kritik kann für andere Wissenschaftler beleidigend sein <strong>Die</strong>se<br />
Fragen werden durch Höflichkeitskonventionen geregelt, die je nach Kultur<br />
recht stark variieren können.<br />
<strong>Die</strong> bisherigen Studien haben ergeben, dass im osteuropäischen <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Diskurs nicht dieselben Höflichkeitsregeln wie im westlichen<br />
gelten. Offene Kritik scheint wenig angebracht zu sein, positive oder neutrale<br />
Stellungnahmen gegenüber fremden Behauptungen sind hingegen<br />
üblicher. So gilt in russischen <strong>wissenschaftlichen</strong> Texten ein zurückhaltender<br />
Umgang mit Kritik als höflich. Wenn russische Wissenschaftler zum<br />
Beispiel Rezensionen schreiben, sind sie sehr sparsam mit negativen Bewertungen<br />
<strong>und</strong> großzügig mit Lob (Grimm 1999). Auch in <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Artikeln ist die explizite Kritik an fremden Autoren eher selten<br />
(Baßler 2003).
<strong>Die</strong> seltenen kritischen Äußerungen osteuropäischer Wissenschaftler<br />
haben möglicherweise zur Folge, dass vom Leser/Hörer beziehungsweise<br />
der Wissenschaftsgemeinschaft ebenfalls weniger Kritik erwartet wird. <strong>Die</strong>s<br />
führt zur Verwendung eher kategorischer Formulierungen. Eine vorsichtige<br />
Ausdrucksweise, die möglicher Kritik vorbeugt, ist dementsprechend<br />
weniger üblich als im Westen. <strong>Die</strong>se Tendenz zur kategorischen Ausdrucksweise<br />
kann – besonders in den Geisteswissenschaften – erneut auf<br />
die frühere dominierende Rolle <strong>des</strong> Marxismus zurückgeführt werden. In<br />
den von der marxistischen Monokultur dominierten Diskursgemeinschaften<br />
war es unüblich, Gleichgesinnte zu kritisieren; nur ideologische Gegner<br />
(Vertreter bourgeoiser Wissenschaften) durften attackiert werden. Außerdem<br />
war eine tentative, unsichere Ausdrucksweise für überzeugte Marxisten<br />
unangebracht. <strong>Die</strong>se Sichtweise wird dadurch unterstützt, dass sich in<br />
den <strong>wissenschaftlichen</strong> Texten nach der Transformation eine Tendenz zu<br />
einer weniger kategorischen, also vorsichtigeren Ausdrucksweise zeigt.<br />
<strong>Die</strong>s kann auf die Pluralisierung der osteuropäischer Wissenschaftsgemeinschaften<br />
sowie auf den Einfluss westlicher Traditionen zurückzuführen<br />
sein. Was also für westliche Wissenschaftler durchaus akzeptabel ist (Grimm<br />
1999; Breitkopf 2006), kann von ihren osteuropäischen Kollegen als unhöflich<br />
empf<strong>und</strong>en werden. Dasselbe gilt auch umgekehrt.<br />
Zur Höflichkeit gehört auch die Vermeidung zu kategorischer Behauptungen<br />
im Text. Eine stark kategorische Behauptung kann für den Verfasser<br />
gesichtsbedrohend wirken, weil er sich damit anmaßt, die alleinige<br />
Wahrheit zu kennen <strong>und</strong> eventuell sogar die Überzeugung seiner Leser<br />
(anderer Wissenschaftler) indirekt in Frage stellt (siehe zum Beispiel Myers<br />
1989; Namsaraev 1997). Um eine Behauptung weniger kategorisch zu<br />
machen, werden <strong>des</strong>halb in <strong>wissenschaftlichen</strong> Texten abschwächende Ausdrücke<br />
wie vielleicht, möglicherweise, man kann sagen <strong>und</strong> ähnliche verwendet.<br />
<strong>Die</strong>s lässt sich an einem Beispiel aus einem deutschen soziologischen Text<br />
erläutern:<br />
Beispiel 5:<br />
Vielleicht ist dies der richtige Zeitpunkt, diesem soziokulturellen Phänomen<br />
etwas mehr sozialwissenschaftliche Aufmerksamkeit zu widmen, als das bisher<br />
der Fall war. Zwar gibt es eine reichhaltige <strong>und</strong> verzweigte Literatur über das<br />
Auto – auf eine soziologische Diskurstradition kann man sich jedoch nicht<br />
stützen.<br />
Quelle: Burkart 1994
Der Verfasser erklärt hier, warum er sich in seinem Artikel mit dem Thema<br />
Auto auseinandersetzt <strong>und</strong> begründet seine Auswahl dadurch, dass diesem<br />
Thema im soziologischen Diskurs bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt<br />
wurde. Um diejenige Soziologen nicht anzugreifen, die es versäumt<br />
haben, über die gesellschaftliche Rolle <strong>des</strong> Autos zu forschen, obwohl der<br />
richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, schwächt der Verfasser seine<br />
Aussage durch das Modalwort vielleicht ab. Ohne das Modalwort wäre die<br />
Aussage zu kategorisch.<br />
In den Texten westlicher Wissenschaftler ist dies eine übliche Praxis. In<br />
russischen Artikeln kommen diese abschwächenden Ausdrücke deutlich<br />
seltener vor. Viel häufiger werden Behauptungen mit Ausdrücken wie<br />
разумеется (selbstverständlich), несомненно, безусловно (zweifelsohne), можно с<br />
уверенностью сказать (man kann mit Sicherheit sagen) versehen, was dazu<br />
führt, dass die russischen Texte im Vergleich zu den deutschen insgesamt<br />
kategorischer wirken (Breitkopf 2006):<br />
Beispiel 6:<br />
Основной »образовательной« проблемой книги можно, безусловно, считать<br />
проблему первичной и вторичной социализации, которую Бергер и Лукман<br />
исследуют весьма продуктивно.<br />
Übersetzung:<br />
Als wesentliches »bildungsbedingtes« Problem dieses Buches kann man zweifellos<br />
das Problem der primären <strong>und</strong> der sek<strong>und</strong>ären Sozialisierung ansehen, das<br />
Berger <strong>und</strong> Luckmann recht produktiv erforschen.<br />
Quelle: Zborovskij 1997<br />
Auch in Artikeln bulgarischer Wissenschaftler erscheinen abschwächende<br />
Formulierungen seltener als zum Beispiel in den Texten englischsprachiger<br />
Wissenschaftler (Vassileva 1997; 2001).
Zitierte Literatur<br />
Baßler, Harald (2002), »Definierte Wörter. Fachsprachliche Terminologie«, in: Dittmann,<br />
Jürgen/Schmidt, Claudia (Hgg.), Über Wörter – Gr<strong>und</strong>kurs Linguistik, Freiburg<br />
im Breisgau, 211–231.<br />
— (2006), »Diskussionen nach Vorträgen bei <strong>wissenschaftlichen</strong> Tagungen«, in:<br />
Auer, Peter/Baßler, Harald (Hg.), Reden <strong>und</strong> Schreiben in der Wissenschaft.<br />
Frankfurt, 133-156.<br />
Bazerman, Charles (1988a), Rhetoric of the Human Sciences, Madison/Wis.<br />
Bourdieu, Pierre (1988), Homo academicus, Frankfurt am Main.<br />
— (1998), Vom Gebrauch der Wissenschaft: für eine klinische Soziologie <strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Fel<strong>des</strong> (Edition discours; 12), Konstanz.<br />
Breitkopf, Anna (2005), »Hegding in deutschen <strong>und</strong> russischen <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Aufsätzen: sprachliche <strong>und</strong> funktionale Unterschiede«, in: Wolff, Armin/Riemer,<br />
Claudia/Neubauer, Fritz (Hgg.), Sprache lehren – Sprache lernen (Materialien Deutsch<br />
als Fremdsprache; 74), Regensburg, 293–325.<br />
— (2006), Wissenschaftsstile im Vergleich: Subjektivität in deutschen <strong>und</strong> russischen Zeitschriftenartikeln<br />
der Soziologie, Freiburg im Breisgau.<br />
— / Vassileva, Irena (2006), »Osteuroäischer Wissenschaftsstil«, in: Auer,<br />
Peter/Baßler, Harald (Hg.), Reden <strong>und</strong> Schreiben in der Wissenschaft.<br />
Frankfurt, 211-224.<br />
Busch-Lauer, Ines-Andrea (2001), Fachtexte im Kontrast. Eine linguistische Analyse zu<br />
den Kommunikationsbereichen Medizin <strong>und</strong> Linguistik, Frankfurt am Main u.a.<br />
— (2006), »Abstracts «, in: Auer, Peter/Baßler, Harald (Hg.), Reden <strong>und</strong> Schreiben in<br />
der Wissenschaft. Frankfurt, 99-114.<br />
Clyne, Michael (1987), »Cultural Differences in the Organization of Academic<br />
Texts: English and German«, Journal of Pragmatics 11, 217–247.<br />
Čmejrkova, Svetla/Daneš, František (1997), »Academic Writing and Cultural Identity:<br />
The Case of Czech Academic Writing«, in: Duszak, Anna (Hg.), Intellectual<br />
Styles and Cross-Cultural Communication, Berlin/New York, 41–62.<br />
Crismore, Avon (1984), The Rhetoric of Textbooks: Metadiscourse as Rhetorical Act, New<br />
York.<br />
Drescher, Martina (2003), »Sprache der Wissenschaft, Sprache der Vernunft Zum<br />
affektleeren Stil in der Wissenschaft«, in: Habscheid, Stephan/Fix, Ulla (Hgg.),<br />
Gruppenstile. Zur sprachlichen Inszenierung sozialer Zugehörigkeit (Forum Angewandte<br />
Linguistik; 42), Frankfurt am Main, 53–80.<br />
Duszak, Anna (1997), »Analyzing Digressiveness in Polish Academic Texts«, in:<br />
Duszak, Anna (Hg.), Intellectual Styles and Cross-Cultural Communication, Berlin/<br />
New York, 323–342.
Fløttum, Kjersti/Dahl, Trine/Kinn, Torodd (2006), Academic Voices: Across Languages<br />
and Disciplines (Pragmatics & Beyond; 148), Amsterdam u.a.<br />
Foucault, Michel (1977), »What is an Author«, in: Bouchard, Donald (Hg.),<br />
Language, Counter-memory, Practice. Selected Essays and Interviews, Oxford, 113–138.<br />
Galtung, Johan (1985), »Struktur, Kultur <strong>und</strong> intellektueller Stil. Ein vergleichender<br />
Essay über sachsonische, teutonische, gallische <strong>und</strong> nipponische Wissenschaft«,<br />
in: Wierlacher, Alois (Hg.), Das Fremde <strong>und</strong> das Eigene, München, 151–193.<br />
Graefen, Gabriele/Thielmann, Winfried (2006), »Der Wissenschaftliche Artikel«,<br />
in: Auer, Peter/Baßler, Harald (Hg.), Reden <strong>und</strong> Schreiben in der Wissenschaft.<br />
Frankfurt, 67-98.<br />
Grimm, Anja (1999), »Höflichkeit in der Wissenschaftssprache (am Beispiel deutscher<br />
<strong>und</strong> russischer Rezensionen)«, in: Doleschal, Ursula (Hg.), Linguistische<br />
Beiträge zur Slavistik. VI. JungslavistInnen-Treffen Wien, München, 49–67.<br />
Günthner, Susanne/Knoblauch, Hubert (2006), »Wissenschaftliche<br />
Diskursgattungen - PowerPoint et al.«, in: Auer, Peter/Baßler, Harald (Hg.),<br />
Reden <strong>und</strong> Schreiben in der Wissenschaft. Frankfurt, 53-67.<br />
Hutz, Matthias (1997), Kontrastive Fachtextlinguistik für den fachbezogenen Fremdsprachenunterricht.<br />
Fachzeitschriftenartikel der Psychologie im interlingualen Vergleich, Trier.<br />
Hyland, Ken (1999), »Disciplinary discourses: writer stance in research articles«, in:<br />
Hyland, Ken/Candlin, Christopher N. (Hgg.), Writing: Texts, Processes, and<br />
Practices, London, 99–121.<br />
— (2001), »Humble Servants of the Discipline Self Mention in Research<br />
Articles«, English for Specific Purposes 20, 207–226.<br />
— (2002), »Authority and Invisibility: Authorial Identity in Academic Writing«,<br />
Journal of Pragmatics 34, 1091–1112.<br />
Ivanic, Roz (1998), Writing and Identity. The Discoursal Construction of Identity in<br />
Academic Writing, Amsterdam.<br />
Jakobs, Eva-Maria (1997), Textvernetzung in den Wissenschaften: Zitat <strong>und</strong> Verweis als<br />
Ergebnis rezeptiven, reproduktiven <strong>und</strong> produktiven Handelns (Reihe germanistische<br />
Linguistik; 210), Tübingen.<br />
Kaplan, Robert B. (1966), »Cultural Thought Patterns in Inter-cultural Education«,<br />
Language Learning XVI, 1–20.<br />
Knorr-Cetina, Karin (1991), <strong>Die</strong> Fabrikation von Erkenntnis: zur Anthropologie der<br />
Naturwissenschaft (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaften; 959), Frankfurt am<br />
Main.<br />
Kotthoff, Helga (2001), »Vortragsstile im Kulturvergleich: Zu einigen deutschrussischen<br />
Unterschieden«, in: Jakobs, Eva-Maria/Rothkegel, Annely (Hgg.),<br />
Perspektiven auf Stil. Festschrift für Barbara Sandig, Tübingen, 321–350.<br />
Kretzenbacher, Heinz L. (1998), »Fachtextsorten der Wissenschaftssprachen III.<br />
Abstract <strong>und</strong> Protokoll«, in: Hoffmann, Lothar/Kalverkämper,<br />
Hartwig/Wiegand Herbert Ernst (Hgg.), Fachsprachen. Ein internationales<br />
Handbuch zur Fachsprachenforschung <strong>und</strong> Terminologiewissenschaft, Berlin/New York,<br />
493 – 499.
Kreutz, Heinz/Harres, Annette (1997), »Some Observations on the Distribution<br />
and Function of Hedging in German and English Academic Writing«, in:<br />
Duszak, Anna (Hg.), Culture and Styles of Academic Writing (Trends in Linguistics.<br />
Studies and Monographs; 194), Berlin/New York, 181–202.<br />
Martín-Martín, Pedro (2005), The Rhetoric of the Abstract in English and Spanish Scientific<br />
Discourse. A Cross-Cultural Genre-Analytic Approach, Frankfurt am Main u.a.<br />
Mauranen, Anna (1992), »Reference in Academic Rhetoric: A Contrastive Study of<br />
Finnish and English Writing«, in: Lindeberg, Anne-Charlotte u.a. (Hgg.), Nordic<br />
Research on Text and Discourse. Nordtext Symposium 1990, Åbo, 237–250.<br />
Mittelstraß, Jürgen (2002), »Universalität <strong>und</strong> Internationalität. Über die Selbstorganisation<br />
der Wissenschaft <strong>und</strong> die Wissenschaftsförderung«, in: Impulse geben<br />
– Wissen stiften. 40 Jahre VolkswagenStiftung, Göttingen, 453–480.<br />
Myers, Greg (1989), »The Pragmatics of Politeness in Scientific Articles«, Applied<br />
Linguistics 10, 1–35.<br />
Namsaraev, Vasili (1997), »Hedging in Russian Academic Writing in Sociological<br />
Texts«, in: Markkanen, Raija/Schröder, Hartmut (Hgg.), Hedging and Discourse:<br />
Approaches to the Analysis of a Pragmatic Phenomenon in Academic Texts, Berlin/New<br />
York, 64–79.<br />
Nicolaysen, Rainer (2002), Der lange Weg zur VolkswagenStiftung. Eine Gründungsgeschichte<br />
im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft <strong>und</strong> Wissenschaft, Göttingen.<br />
Pötzsch, Frederik S./Bernt Schnettler (2006), »Bürokraten <strong>des</strong> Wissens ›Denkstile‹<br />
computerunterstützter visueller Präsentationen«, in: Gebhardt, Winfried/Hitzler,<br />
Ronald (Hgg.), Nomaden, Flaneure, Vagab<strong>und</strong>en: Wissensformen <strong>und</strong> Denkstile der Gegenwart,<br />
Wiesbaden, 186–204.<br />
Prozorova, Lyubov (1997), »If not Given, then what Things that Come First in<br />
Academic Discourse«, in: Duszak, Anna (Hg.), Culture and Styles of Academic<br />
Writing (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 194), Berlin/New<br />
York, 305–322.<br />
Punkki, Marja/Schröder, Hartmut (1989), »Argumentative Strukturen in russischsprachigen<br />
Texten der Gesellschaftswissenschaften – Beispiele für pragmatisch<br />
bedingte Argumentation <strong>und</strong> deren Sprachmittel«, in: Kusch, Martin/Schröder,<br />
Hartmut (Hgg.), Text, Interpretation, Argumentation, Hamburg, 110–124.<br />
Sanderson, Tamsin (2006), A Contrastive Analysis of German and English Academic<br />
Texts, o.O. (= unveröffentl. Dissertation, Freiburg im Breisgau).<br />
Schnettler, Bernt (2006), »Orchestrating Bullet Lists and Commentaries. A Video<br />
Performance Analysis of Computer Supported Presentations«, in: Knoblauch,<br />
Hubert u.a. (Hgg.), Video Analysis – Methodology and Methods. Qualitative Audiovisual<br />
Data Analysis in Sociology, Frankfurt am Main u.a., 155–168.<br />
Seoane, Elena (2004), »Changing Styles: On the Recent Evolution of Scientific<br />
British and American English«, Vortrag bei der 13 th International Conference<br />
on English Historical Linguistics, Wien, August 2004.<br />
Stănescu, Speranţa (2003), »Der Autor wissenschaftlicher Arbeiten: anonym, bescheiden<br />
oder selbstbewusst«, in: Habscheid, Stephan/Fix, Ulla (Hgg.), Gruppenstile:
zur sprachlichen Inszenierung sozialer Zugehörigkeit (Forum Angewandte Linguistik;<br />
42), Frankfurt am Main, 81–100.<br />
Swales, John M. (1990), Genre Analysis. English in Academic and Research Settings.<br />
Cambridge u.a.<br />
Tibbo, Helen R. (1992), »Abstracting across the Disciplines: A Content Analysis of<br />
Abstracts from the Natural Sciences, the Social Sciences, and the Humanities<br />
with Implications for Abstracting Standards and Online Information Retrieval«,<br />
LISR 14, 31–56.<br />
Toren, Nina (1988), Science and Cultural Context. Soviet Scientists in Comparative Perspective,<br />
New York.<br />
Vande Kopple, William (1985), »Some Exploratory Discourse on Metadiscourse«,<br />
College Composition and Communication 36, 82–93.<br />
Vanhala-Aniszewski, Marjatta (2001), »Tekstoobrazujuščij metatekst v russkoj i<br />
finskoj naučnoj reči«, Scando-Slavica 47, 39–52.<br />
Vassileva, Irena (1995), »Some Aspects of the Rhetorical Structure of Specialized<br />
Written Discourse in English, Bulgarian and Russian«, International Journal of<br />
Applied Linguistics 5, 173–190.<br />
— (1998), »Who am I/who are We in Academic Writing«, International Journal of<br />
Applied Linguistics 8, 163–190.<br />
— (2000), »Who is the Author A Contrastive Analysis of Authorial Presence in<br />
English, German, French, Russian and Bulgarian Academic Discourse«, Sankt<br />
Augustin.<br />
— (2001), »Commitment and Detachment in English and Bulgarian Academic<br />
Writing«, English for Specific Purposes 20, 83–102.<br />
— (2002) »Speaker-Audience Interaction: the Case of Bulgarians Presenting in<br />
English«, in: Ventola, Eija/Shalom, Celia/Thompson, Susan (Hgg.), The Language<br />
of Conferencing, Frankfurt am Main, 255–276.<br />
Ventola, Eija (2002a), »Why and what Kind of Focus on Conference<br />
Presentations«, in: Ventola, Eija/Shalom, Celia/Thompson, Susan (Hgg.), The<br />
Language of Conferencing, Frankfurt am Main u.a., 15–50.<br />
— (2002b), »Should I Speak English or German – Conferencing and Language<br />
Code Issues«, in: Ventola, Eija/Shalom, Celia/Thompson, Susan (Hgg.), The<br />
Language of Conferencing, Frankfurt am Main u.a., 333–360.<br />
Webber, Pauline (2002), »The Paper Is Now Open for Discussion«, in: Ventola, Eija/<br />
Shalom, Celia/Thompson, Susan (Hgg), The Language of Conferencing, Frankfurt<br />
am Main u.a., 227–253.<br />
Weingart, Peter u.a. (1991), <strong>Die</strong> so genannten Geisteswissenschaften – Außenansichten<br />
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft; 965), Frankfurt am Main.<br />
Weinrich, Harald (1988), Wege der Sprachkultur, München.<br />
— (1990), »Formen der Wissenschaftssprache«, in: Weinrich, Harald u.a., Wissenschaftssprache<br />
<strong>und</strong> Sprachkultur (Tutzinger Materialie; 61), Tutzing, 3–21.
Wiese, Eva (1989), »Subjektive <strong>und</strong> objektive Darstellungsperspektive in russischsprachigen<br />
Texten <strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong> Funktionalstils«, Linguistische Arbeitsberichte<br />
67, 68–73.<br />
Yakhontova, Tatyana (2002), »Titles of Conference Presentation Abstracts: A<br />
Cross-cultural Perspective«, in: Ventola, Eija/Shalom, Celia/Thompson, Susan<br />
(Hgg.), The Language of Conferencing, Frankfurt am Main, 277–300.