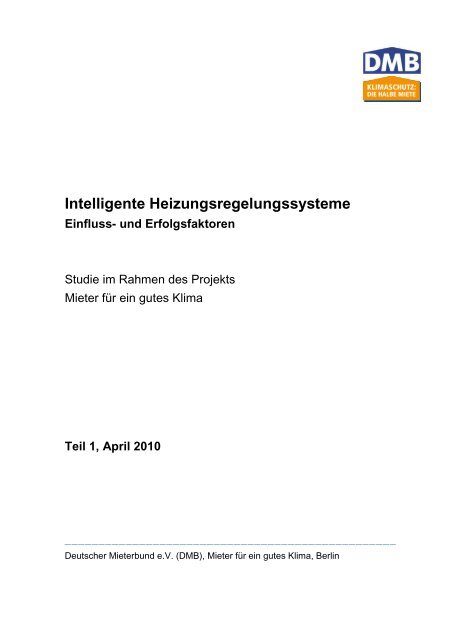Intelligente Heizungsregelungssysteme - Deutscher Mieterbund
Intelligente Heizungsregelungssysteme - Deutscher Mieterbund
Intelligente Heizungsregelungssysteme - Deutscher Mieterbund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Intelligente</strong> <strong>Heizungsregelungssysteme</strong><br />
Einfluss- und Erfolgsfaktoren<br />
Studie im Rahmen des Projekts<br />
Mieter für ein gutes Klima<br />
Teil 1, April 2010<br />
_________________________________________________<br />
<strong>Deutscher</strong> <strong>Mieterbund</strong> e.V. (DMB), Mieter für ein gutes Klima, Berlin
<strong>Intelligente</strong> <strong>Heizungsregelungssysteme</strong><br />
Einfluss- und Erfolgsfaktoren<br />
DMB-Studie, Teil 1, Berlin April 2010<br />
Herausgeber <strong>Deutscher</strong> <strong>Mieterbund</strong> e.V. (DMB)<br />
Littenstraße 10<br />
10179 Berlin<br />
Tel. 030-22323-0<br />
www.mieterbund.de und www.mieter-machen-mit.de<br />
Auftragnehmer Institut für Gebäudetelematik<br />
Aninstitut am TWZ der Technischen Hochschule Wildau<br />
Prof. Birgit Wilkes<br />
Bahnhofstraße<br />
15745 Wildau<br />
Bearbeitung im DMB Heike Zuhse<br />
E-Mail heike.zuhse@mieterbund.de<br />
Die Studie “<strong>Intelligente</strong> <strong>Heizungsregelungssysteme</strong> – Einfluss- und Erfolgsfaktoren” (Teil 1), wurde<br />
vom Deutschen <strong>Mieterbund</strong> e.V. im Rahmen des Projektes „Mieter für ein gutes Klima“ in Auftrag<br />
gegeben. Das DMB-Projekt ist Teil der Kampagne „für mich. für dich. fürs klima.“.<br />
„für mich. für dich. fürs klima.“ ist ein Bündnis des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv)<br />
mit den 16 Verbraucherzentralen der Bundesländer, dem Deutschen <strong>Mieterbund</strong> (DMB), der<br />
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), dem Verkehrsclub<br />
Deutschland (VCD), dem VerbraucherService (VS) im Katholischen Deutschen Frauenbund und<br />
Germanwatch.<br />
Die Allianz klärt mit bundesweiten Aktionen über die Chancen jeden Einzelnen beim CO2-Sparen<br />
auf. Gegenüber Politik und Wirtschaft vertritt sie die Interessen der Verbraucher für einen<br />
Klimaschutz ohne Hürden. Unlautere Werbung mit Klimaschutzargumenten stoppt sie mit<br />
juristischen Mitteln.<br />
www.verbraucherfuersklima.de<br />
Die Verbraucherallianz für den Klimaschutz:<br />
Gefördert durch:
Gliederung<br />
1.0 Einleitung 1<br />
2.0 Einflüsse auf das Raumklima 2<br />
2.1 Tatsächliche und empfundene Temperatur 2<br />
2.2 Physikalischer Einfluss 2<br />
2.2.1 Luftfeuchtigkeit 3<br />
2.2.2 Wärmedämmwerte 4<br />
2.2.3 Lüftung 5<br />
2.2.4 Lüftung durch technische Systeme 7<br />
2.3 Gebäudearten 8<br />
3.0 Erstellung von Szenarien für die Messungen 11<br />
3.1 Haus und Wohnung 11<br />
3.2 Heizungssysteme 14<br />
3.2.1 Heizkessel 17<br />
3.3 Verhalten des Mieters 19<br />
3.3.1 Lüftung 19<br />
3.3.2 Wärmezonen innerhalb der Wohnung 21<br />
3.3.3 Umgang mit technischen Systemen 22<br />
4.0 Mess- und Regelsysteme zur Heizungssteuerung 24<br />
4.1 Stand-alone-Systeme 24<br />
4.2 Systeme mit einer Zentrale 26<br />
4.3 Systeme mit Steuerung des Heizkessels 28<br />
5.0 Analyse unterstützender Systeme für die Erfassung 30<br />
des Energieverbrauchs beim Heizen<br />
5.1 Heizkostenverordnung 30<br />
5.1.1 Ausnahmen 32<br />
5.1.2 Geltung der neuen Heizkostenverordnung 32<br />
5.2 Datenerfassung durch Heizkostenverteiler 33<br />
5.3 Datenerfassung durch Wärmemengenzähler 36<br />
5.3.1 Funktionsbetrieb des Wärmemengenzählers 37<br />
I
5.4 Auswertung der Verbräuche 37<br />
5.4.1 Transparenz der Verbräuche bei Wärmemengenzählern 39<br />
5.4.2 Transparenz der Verbräuche bei Heizkostenverteilern 40<br />
5.4.3 Existierende Lösungen zur Visualisierung des Verbrauchs 39<br />
5.5 Produkte und Dienste zum Energiesparen 40<br />
5.6 Auswertungsmöglichkeiten für den Vermieter 43<br />
5.7 Industrielle Monitoringsysteme 45<br />
5.8 Monitoringsysteme für Strom 46<br />
6.0 Fazit 49<br />
7.0 Quellenverzeichnis 50<br />
II
1.0 Einleitung<br />
Um eine angenehme und komfortable Wohnumgebung zu schaffen, müssen Wohnungen<br />
in Mitteleuropa in der kalten Jahreszeit beheizt werden. Die Heizenergie wird in den nächsten<br />
Jahren zu einem der wichtigsten Themen werden, wenn es um Energieeinsparung<br />
und Vermeidung von CO2-Emission geht. Der Anteil des Energieverbrauchs in Gebäuden<br />
liegt EU-weit bei knapp 40% des Gesamtenergiebedarfs der Länder. Der Heizenergieverbrauch<br />
in privaten Wohnungen nimmt dreiviertel des Gesamtenergieverbrauchs einer<br />
Wohnung ein, wie in Abbildung 1 zu sehen ist. Damit bietet sich bei der Heizenergie auch<br />
das größte Potential für Energieeinsparungen.<br />
Abbildung 1: Anteil von Heizenergie in Haushalten Quelle: dena/Energiedaten BMWI<br />
Eine zusätzliche Notwendigkeit für Einsparungen bringt die Verschiebung in der Zahl und<br />
Struktur deutscher Haushalte mit sich. Laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes<br />
von 2008 ist die Bevölkerungszahl der Deutschen zwischen 1995 und 2006 nur geringfügig<br />
gestiegen. Die Anzahl der Haushalte hat sich aber um 6,4% erhöht. 1 Grund ist ein<br />
Anstieg von 1- und 2-Personenhaushalten gegenüber den Mehrpersonenhaushalten. In<br />
der oben genannten Zeitspanne hat sich der Anteil der Einpersonenhaushalte von 34,9%<br />
auf 37,9% erhöht. Gerechnet auf den Pro-Kopf-Verbrauch an Heizenergie verbraucht eine<br />
Person in einem 1-Personenhaushalt ca. 60% mehr als der restliche Durchschnitt. Daher<br />
ergab sich zwischen 1995 und 2006 ein Mehrbedarf an Heizenergie auf Grund des Mehrbedarfs<br />
an Wohnfläche um 13,8%. Gleichzeitig ist der Energiebedarf je Wohnfläche im<br />
gleichen Zeitraum um 14,4% gesunken, was sich sowohl auf verbesserte Gebäudestrukturen<br />
und modernere Heizungstechnik als auch auf eine Änderung des Verhaltens<br />
der Bewohner wegen der stark gestiegenen Energiekosten zurückführen lässt. [UBA 1]<br />
1 Weiterführende Informationen siehe [StBA]<br />
1
2. Einflüsse auf das Raumklima<br />
Zur Schaffung eines Raumklimas, in dem man sich wohlfühlt, ist das Heizen einer der<br />
wichtigsten Faktoren, für viele Menschen sogar der einzige, an den sie bewusst denken.<br />
Das Empfinden für ein angenehmes Raumklima ist grundsätzlich subjektiv und kann<br />
zwischen verschiedenen Personen sehr unterschiedlich sein. Trotzdem gibt es einige<br />
grundsätzliche Faktoren, die einen objektiven Einfluss auf das subjektiv empfundene<br />
Raumklima haben.<br />
2.1 Tatsächliche und empfundene Temperatur<br />
Wer kennt es nicht: Obwohl das Thermometer den gleichen Wert anzeigt, wird in der<br />
einen Wohnung die Temperatur als angenehm empfunden, in einer anderen nicht. Das<br />
Raumklima und damit auch das Temperaturempfinden hängen von verschiedenen Einflüssen<br />
ab.<br />
Persönliches Empfinden<br />
Ein Einfluss, den eine gesunde 2 Person selbst auf ihr Temperaturempfinden hat, ist die<br />
eigene Bewegung. Sitzt eine Person still in einem Raum (z.B. bei Büroarbeit in einem<br />
Arbeitszimmer), so muss die Temperatur dort höher sein, um eine Wohlfühlumgebung zu<br />
bieten, als wenn die Person sich bewegt. Daher sollten Räume auch nach der Art ihrer<br />
Nutzung unterschiedlich geheizt werden. Auch bei zunehmender Müdigkeit nimmt das<br />
Kälteempfinden zu.<br />
2.2 Physikalischer Einfluss<br />
Das Raumklima hängt aber noch von weiteren physikalischen Parametern ab, die – bei<br />
deren Kenntnis – aber ebenfalls beeinflussbar sind.<br />
Wesentlichen Einfluss auf das empfundene Raumklima haben die Temperaturen der<br />
Umschließungsflächen. Damit sind alle Flächen gemeint, die den Raum umschließen, in<br />
dem sich eine Person befindet, also Wände, Fenster, Decke und Fußboden. Die Tempe-<br />
ratur der Umschließungsflächen darf nicht mehr als 3 °C von der Lufttemperatur des<br />
Raumes abweichen, da sie sich sonst negativ auf das Raumklima auswirkt.<br />
Beträgt die Lufttemperatur in einem Raum beispielsweise 20 °C, darf die Temperatur der<br />
umgebenden Flächen nicht unter 17 °C liegen. In nicht ausreichend gedämmten Bauten<br />
kann im Winter die Temperatur der Fenster und Außenwände sogar unter 13 °C liegen.<br />
Die Folge ist, dass trotz einer Lufttemperatur von 20 °C die Heizung höher gestellt und die<br />
Temperatur erhöht werden muss, da die kalten Wände wie Zugluft empfunden werden.<br />
[SHH]<br />
Eine zu niedrige Temperatur der Umschließungsflächen kann verursacht sein durch<br />
2 Der Einfluss des Temperaturempfindens durch Krankheit soll hier ausgeschlossen werden.<br />
2
� eine unzureichende Dämmung des Gebäudes,<br />
� Fehlverhalten umliegender Bewohner oder<br />
� eigenes, unsachgemäßes Verhalten in der Wohnung.<br />
Auf den letzten Punkt wir noch weiter in Kapitel 3.3 eingegangen.<br />
2.2.1 Luftfeuchtigkeit<br />
Mitteleuropäer fühlen sich in einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% wohl. Gerade<br />
in der Heizperiode können die tatsächlichen Werte leicht außerhalb dieses empfohlenen<br />
Wertebereichs liegen.<br />
Wohnungen werden aus Wärmeschutzgründen immer mehr abgedichtet, so dass kein<br />
automatischer Luftaustausch erfolgen kann. Er kann nur über aktives Lüften geregelt<br />
werden. Durch Küchendämpfe, Zimmerpflanzen sowie die Atemluft und Haut der Bewohner<br />
selbst gelangt viel Feuchtigkeit in die Luft der Wohnung. Ein Mensch gibt allein durch<br />
die Haut und seine Atmung zwischen 900 ml und 1400 ml Feuchtigkeit pro Tag an die Luft<br />
ab. Bei fehlender Lüftung ist die Sättigung der Luft durch Feuchtigkeit so hoch, dass der<br />
Taupunkt 3 erreicht wird. Dadurch schlägt sich gerade an den kühleren Außenwänden und<br />
Fenstern Kondenswasser nieder, was schnell zu Schimmelbildung führen kann.<br />
Wie Temperatur, relative Luftfeuchte und der Taupunkt in Verbindung stehen, zeigt die<br />
folgende Tabelle.<br />
Temperatur in °C Rel. Luftfeuchte % Abs. Luftfeuchte (g/m3) Taupunkt in °C<br />
19 40 6,5 5,1<br />
19 60 9,8 11,1<br />
19 75 12,2 14,5<br />
20 40 6,9 6,0<br />
20 60 10,4 12<br />
20 75 13,0 15,4<br />
21 40 7,3 6,9<br />
21 60 11,0 12,9<br />
21 75 13,7 16,4<br />
22 40 7,8 7,8<br />
22 60 11,6 13,9<br />
22 75 14,6 17,4<br />
Tabelle 1: Zusammenhang zwischen Temperatur und Taupunkt Quelle: eigene, nach [VAI]<br />
Unter der oben gemachten Annahme, dass die Temperatur von Außenwänden und<br />
Fenstern im Winter unter 13 °C sinken kann, sind alle rot markierten Teile der Tabelle<br />
kritische Zustände und können zu Schimmelbildung führen.<br />
Ein konkretes Beispiel für ein Schlafzimmer soll das Problem noch weiter erläutern:<br />
3 Als Taupunkt bezeichnet man die Temperatur, bei der sich auf einem Gegenstand ein<br />
Gleichgewichtszustand von kondensierendem und verdunstendem Wasser einstellt, in anderen Worten die<br />
Kondensatbildung gerade einsetzt. [wiki 1]<br />
3
Ein Schlafzimmer mit 20 m 2 Grundfläche und einer Deckenhöhe von 2,70 m hat ein Luft-<br />
volumen von 54 m 3 . Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt 18 °C. Vor dem Schlafen<br />
wird das Zimmer noch einmal gut gelüftet, so dass die relative Luftfeuchte bei 40% liegt,<br />
was einer absoluten Feuchtigkeit von 6,1 g/m 3 entspricht.<br />
Weiterhin angenommen wird ein durchschnittlicher Wert von 1,2 l/Tag, die ein Mensch<br />
über Atmung und Haut an Wasser abgibt. Nehmen wir eine Verweildauer von 8 Stunden<br />
der Person im Schlafzimmer an, so verdunstet er in diesem Zeitraum 400 ml Wasser. Die<br />
absolute Luftfeuchte steigt also vom 6,1 g/m3 über Nacht um 400g/54m3 = 7,4 g/m3 in<br />
Summe auf 13,5 g/m3 im Schlafzimmer. Daraus lassen sich eine relative Luftfeuchte von<br />
88% und ein Taupunkt von 16,0 °C berechnen. Diese Berechnung bezieht sich nur auf<br />
eine schlafende Person in dem relativ großen Raum. Über Nacht ist hier auf jeden Fall mit<br />
Tauwasserbildung an den außen liegenden Wänden zu rechnen.<br />
Ähnliche Effekte können in Bädern beispielsweise durch Duschen oder in Küchen durch<br />
beim Kochen und Backen entstehenden Wasserdampf auftreten.<br />
2.2.2 Wärmedämmwerte<br />
Wie eben gesehen, hat die Dämmung besonders der Außenwände Einfluss auf die<br />
Abkühlung der Wände und damit auf das Raumklima und die Kondenswasserbildung. Um<br />
die Qualität einer Dämmung quantifizieren zu können, gibt es Wärmedämmwerte, auch<br />
Wärmedurchgangskoeffizienten oder U-Werte (früher k-Werte) genannt.<br />
Der Wärmedurchgangskoeffizient ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch ein<br />
Material (Wärmeverlust) infolge einer Temperaturdifferenz auf Außen- und Innenseite des<br />
Materials. Er gibt die Energiemenge in Joule an, die in einem m 2 Fläche pro Sekunde bei<br />
einer Temperaturdifferenz von einem K (Kelvin) abfließt.<br />
Der Wärmedurchgangskoeffizient beschreibt den Wärmeverlust unter stationären Bedingungen,<br />
berücksichtigt also keine Einflüsse wie Wind und Sonneneinstrahlung. Wärmedurchgangskoeffizienten<br />
sind daher zur Berechnung des tatsächlichen Energiebedarfs<br />
eines Gebäudes nur bedingt zu aussagekräftig. Sie können aber für den Zweck dieser<br />
Studie, die Effektivität von Heizungssteuerungssystemen zu ermitteln, ein durchaus wichtiger<br />
Teil für die Einschätzung und Berechnung der Umgebungsparameter in der Wohnumgebung<br />
sein. Daher ist in Tabelle 2 ein Überblick über die wichtigsten Baumaterialien<br />
und ihre jeweiligen U-Werte zu finden.<br />
4
Baustoff Wandstärke U-Wert in<br />
W/(m2K)<br />
Außenwand aus Beton keine Wärmedämmung 25,0 cm 3,3<br />
Außenwand aus Mauerziegeln 24,0 cm 1,5<br />
Außenwand aus Mauerziegeln 36,5 cm 0,8<br />
Außenwand aus Mauerziegeln mit Wärmedämmverbundsystem<br />
(PUR)<br />
Außenwand aus hochporösen Hohllochziegeln,<br />
unverputzt<br />
30,0 cm 0,32<br />
50,0 cm 0,17 – 0,23<br />
Außenwand Massivholz ohne Wärmedämmung 20,5 cm 0,5<br />
Innenwand aus Mauerziegeln 11,5 cm 3,0<br />
Innenwand aus Porenbeton 28,0 cm 0,6<br />
Außentür aus Holz oder Kunststoff - 3,5<br />
Einfachfenster 4,0 mm 5,9<br />
Doppelfenster - 3,0<br />
Fenster mit Isolierverglasung 2,4 cm 2,8 – 3,0<br />
Fenster mit Wärmeschutzverglasung 2,4 cm 1,1<br />
Tabelle 2: U-Werte der wichtigsten Baustoffe [wiki 2]<br />
2.2.3 Lüftung<br />
Gegen das Problem der Tauwasserbildung und der damit zusammenhängenden möglichen<br />
Schimmelbildung ist die Lüftung der Wohnumgebung eine der einfachsten und<br />
effektivsten Maßnahmen. Dabei ist die richtige Art zu lüften wichtig für die Effektivität des<br />
Luftaustauschs und die nach dem Lüften von der Heizung aufzubringende Energie für die<br />
Erwärmung der kalten Außenluft.<br />
Die mit Abstand effektivste Art der Lüftung ist die Stoß- und Querlüftung. Hierbei werden<br />
alle Fenster eines zu lüftenden Raumes weit geöffnet (Stoßlüftung). Für die Querlüftung<br />
werden die Fenster (möglichst) gegenüber liegender Räume sowie die dazwischen<br />
liegenden Verbindungstüren weit geöffnet. Wie schnell die gesamte Luft in den Zimmern<br />
ausgetauscht ist, hängt dabei auch von der momentanen Windgeschwindigkeit und Windrichtung<br />
ab. Grundsätzlich wird dazu geraten, auch und gerade im Winter dreimal täglich<br />
für mindestens 5 Minuten eine solche Querlüftung in der gesamten Wohnung durchzuführen.<br />
Tatsache ist, dass diese Art der Lüftung in den wenigsten Wohnungen tatsächlich so<br />
durchgeführt wird. Sehr oft werden Fenster über wesentlich längere Zeit gekippt, was<br />
energetisch weitaus ineffizienter ist. Problematisch ist dabei, dass das menschliche<br />
Empfinden für Kälte und die daraus resultierende Idee eines energieeffizienten Verhaltens<br />
nicht mit den physikalisch mess- und errechenbaren Werten übereinstimmt. Gekippte<br />
Fenster lassen wesentlich weniger Luft pro Zeiteinheit in ein Zimmer als ein ganz geöffnetes<br />
Fenster. Dadurch hat der Bewohner nicht das Gefühl der Kälte und nutzt diese Art<br />
des Lüftens oft als Dauer- oder Langzeitlüftung. Natürlich muss auch in diesem Fall die<br />
5
nachgeführte, kalte Luft erwärmt werden. Durch die lange dauernde Lüftung kühlen auch<br />
Wände, Decken und der Boden aus, die dann ebenfalls von der Heizung wieder erwärmt<br />
werden müssen. Wie energieintensiv das Aufheizen der Umschließungsflächen ist, zeigt<br />
das folgende Beispiel.<br />
Wird eine Wohnung bei 5 °C für 5 Minuten quergelüftet, so ist sie gefüllt mit dieser kalten<br />
Luft. In der kurzen Zeit der Lüftung kühlen sich aber die Umschließungsflächen, also die<br />
Wände, die Decken, der Boden oder auch die Möbel nicht ab. Nach schließen der Fenster<br />
geben Sie ihre Wärme an die kühle Luft ab. Nur die Differenz muss dann noch von der<br />
Heizung aufgebracht werden. Dabei handelt es sich um erstaunlich wenig Heizenergie,<br />
denn Luft lässt sich sehr effizient erwärmen. Dies wird sehr deutlich an einem Beispiel:<br />
Die spezifische Wärmekapazität ist das Maß für die Menge an Energie, die 1 kg eines<br />
Stoffes zugeführt werden muss, um ihn um 1 K (Kelvin 4 ) zu erwärmen. Sie wird in<br />
kJ/(kgK) gemessen. Es handelt sich also um die auf eine Masse bezogene Wärmekapazität.<br />
Luft, Ziegel und Beton haben etwa dieselbe spezifische Wärmekapazität, wie<br />
aus dem unten stehenden Bild zu entnehmen ist.<br />
Abbildung 2: Spezifische Wärmekapazitäten unterschiedlicher Stoffe [LEI]<br />
Da sich die spezifische Wärmekapazität aber auf die Masse eines Stoffes bezieht, hat die<br />
Luft einen klaren Vorteil. Sie hat bei 20 °C ein Gewicht von 1,2 kg/m 3 . Das Gewicht von<br />
Ziegel liegt bei 190 kg/m3, das von Beton bei 220 kg/m3.<br />
Wenn wir nun wieder den oben beschriebenen Raum mit einer Luftmasse von 54 m3<br />
betrachten und dabei die Wärmeabgabe durch die Umschließungsflächen der Einfachheit<br />
halber vernachlässigen, muss für die Erwärmung von 54 m3 Luft von 5 °C auf 20 °C<br />
folgende Energiemenge aufgewendet werden:<br />
54 m3 * 1,2 kg/m3 = 64,8 kg Luft befinden sich in dem Zimmer.<br />
4 1 K entspricht 1 °C<br />
6
1,0 kJ * 15 k * 64,8 kg = 972 kJ müssen aufgewendet werden, um die gesamte Luft in<br />
diesem Zimmer um 15 °C zu erwärmen.<br />
Gehen wir davon aus, dass der Boden durch den Bodenbelag zusätzlich gedämmt ist und<br />
nicht eingerechnet wird. Es bleiben dann<br />
� Die Zimmerdecke aus Beton mit einer Fläche von 4,0 m * 5,0 m = 20 m 2 und einer<br />
Dicke von 20 cm. Das entspricht 20 m 2 * 0,2 m = 4,0 m 3 Beton.<br />
� Eine Außenwand von 5,0 m * 2,70 m = 13,5 m 2 abzüglich eines Doppelfensters und<br />
einer Balkontür mit je 2 m 2 Fläche. Es bleiben 13,5 m 2 – 4 m 2 = 9,5 m 2 Außenwandfläche<br />
mit einer Wandstärke von 25 cm = 2,375 m 3 Ziegel.<br />
� Zwei Innenwände mit je 4,0 m * 2,7 m = 10,8 m 2 und einer Wandstärke von 12 cm<br />
haben ein Volumen von 2 * 10,8 m 2 * 0,12 m = 2,592 m 3 Ziegel.<br />
� Die letzte Innenwand hat eine Fläche von 5,0 m * 2,7 m = 13,5 m 2 und eine Wandstärke<br />
von 12 cm. Abzüglich einer Zimmertür von 2 m 2 ergeben sich (13,5 m 2 – 2 m 2 ) *<br />
0,12 m = 1,38 m 3 Ziegel.<br />
Da Beton und Ziegel nahezu die gleiche spezifische Wärmekapazität besitzen, werden sie<br />
hier nicht unterschieden. Es ergibt sich ein Volumen aus Beton/Ziegel von:<br />
4,0 m 3 + 2,375 m 3 * 2,595 m 3 * 1,38 m 3 = 10,35 m 3<br />
Gehen wir weiterhin davon aus, dass die Wände und Decke nicht auf 5 °C, sondern auf<br />
13 °C abkühlen, wird eine Energiemenge von<br />
1,0 kJ * 7 K * 200 kg/m 3 *10,35 m 3 = 14.490 kJ<br />
benötigt, um Wände und Decke wieder auf 20 °C aufzuheizen, wenn diese durch Dauerlüftung<br />
abgekühlt sind. Auch wenn diese Berechnung nur einen Richtwert darstellt, da zu<br />
viele Parameter nicht oder unzureichend berücksichtigt wurden, zeigt sich doch der<br />
enorme Unterschied in der benötigten Energiemenge. Um Wände und Decke nur um 7 °C<br />
aufzuheizen, wenn diese abgekühlt sind, wird über das 14-fache der Energie benötigt, als<br />
wenn die gesamte Luft in dem Zimmer um 15 °C erwärmt wird. Dies zeigt eindeutig, wie<br />
energieeffizient die Stoßlüftung ist, bei der zwar die gesamte Luft gegen kalte ausgetauscht<br />
wird, sich aber mit wenig Energieaufwand erwärmen lässt. Bei einer Dauerlüftung<br />
über gekippte Fenster kühlen die Umschließungsflächen aus, deren Erwärmung<br />
ein Vielfaches mehr an Energie kostet, obwohl es subjektiv zu keiner Zeit besonders kalt<br />
im Zimmer wird.<br />
2.2.4 Lüftung durch technische Systeme<br />
Die Art der Lüftung hat großen Einfluss auf die Energieeffizienz und die Feuchtigkeit<br />
innerhalb der Wohnung. In Nicht-Wohngebäuden werden Lüftungsprobleme durch Lüftungssysteme<br />
5 umgangen. Die Lüftungssysteme sind oft kombiniert mit Klimasystemen. In<br />
Wohngebäuden, vor allem im Mietwohnungsbau, werden diese Systeme kaum eingesetzt.<br />
Bei der Betrachtung von Wohngebäuden wird weiterhin unterschieden zwischen<br />
5 Unter Lüftungssystemen werden hier nur kombinierte Zu- und Abluftsysteme verstanden.<br />
7
� Neubau<br />
Beim Neubau von Eigenheimen werden Belüftungssysteme zunehmend angeboten,<br />
aber nur von einer geringen Anzahl hauptsächlich technisch interessierter Kunden<br />
eingebaut. Die Skepsis gegenüber Systemen, bei denen manuelles Lüften unnötig<br />
oder sogar unerwünscht ist, ist noch sehr groß. Bei allen diesen Systemen wird die<br />
Außenluft über Wärmetauscher erwärmt, ehe sie in die Wohnumgebung eingeleitet<br />
wird. Mit dem zunehmenden Einbau von Erd- oder Luftwärmepumpen als Heizung<br />
wird sich auch die Anzahl von Lüftungssystemen weiter erhöhen, da die beiden<br />
Systeme häufig gekoppelt sind. Im vermieteten Wohnungsbau sind Lüftungssysteme<br />
auch bei Neubauten sehr selten.<br />
� Bestandsbau<br />
Im Bestandsbau gibt es, unabhängig vom Alter der Gebäude, praktisch keine technischen<br />
Lüftungssysteme. Mittlerweile wurden nachrüstbare Lüftungssysteme für<br />
Wohnungen entwickelt, die über eine Kernbohrung in der Außenwand Luft ansaugen,<br />
über einen Wärmetauscher erwärmen und in die Wohnung abgeben. Diese Geräte<br />
sind nicht so effektiv wie die Systeme in Neubauten, dafür aber wartungsfrei.<br />
Abbildung 3: Kompaktlüftungssystem für kleine und mittelgroße Wohnungen<br />
Quelle: Zila-Elektronik GmbH<br />
In oben stehendem Bild ist ein Kompaktgerät für Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung<br />
zur Lüftung und Entfeuchtung von Wohnungen bis zu einer Größe von 100 m2 zu<br />
dargestellt.<br />
2.3 Gebäudearten<br />
Gebäude sind in ihrer Energieeffizienz enorm unterschiedlich. In den vorangegangenen<br />
Kapiteln wurden schon einige Parameter erwähnt, die einen Einfluss auf den Energieverbrauch<br />
von Gebäuden haben. So wird z.B. die spezifische Wärmekapazität von Materialien<br />
zur Berechnung der Energiebilanz im Gebäudeenergiepass herangezogen.<br />
8
Es gibt allerdings noch eine Vielzahl weiterer Faktoren, die Einfluss auf den Energieverbrauch<br />
eines Hauses oder einer Wohnung haben. So können beispielsweise zwei<br />
Gebäude, die rechnerisch dieselben spezifischen Wärmekapazitäten und Dämmwerte<br />
aufweisen, bei gleicher Nutzung dennoch sehr unterschiedliche Heizenergieverbräuche<br />
durch verschiedene Standorteinflüsse aufweisen. Ist eines diese Häuser fast ganztags<br />
verschattet und steht an einem sehr windigen Ort, dann wird es mehr Energie<br />
verbrauchen als ein Haus mit rechnerisch gleichen Werten, das Windgeschützt an einem<br />
Hang in Südlage gebaut wurde.<br />
An dieser Stelle muss mit Blick auf die Zielstellung dieser Studie ein Mittelweg gefunden<br />
werden zwischen einer möglichst einfachen Modellbildung und einer Genauigkeit, die<br />
valide und vergleichbare Messergebnisse bei der Erprobung der Heizungssteuerungssysteme<br />
liefert. Aufgrund der vielen Einflussparameter, die teilweise auch erst vor Ort für<br />
ein konkretes Gebäude geklärt werden können, sollen für diese Studie als Grundlage nur<br />
wenige verschiedene Gebäudetypen unterschieden werden.<br />
Da der Gebäudeenergiepass für alle Wohngebäude vorliegen muss, kann der darin<br />
errechnete Endenergiebedarf als ein Parameter zur Spezifikation der Gebäudetypen<br />
genutzt werden. Abbildung 4 zeigt einen Überblick über durchschnittliche Endenergiebedarfswerte<br />
verschiedener Haustypen.<br />
Abbildung 4: Durchschnittswerte Endenergiebedarf für verschiedene Haustypen in kWh/(m 2 a)<br />
Der Durchschnitt der Wohnungen in Deutschland verbraucht 180 kWh/(m 2 a) [Umweltministerium<br />
Baden-Württemberg]<br />
Dass der im Gebäudeenergieausweis vermerkte Endenergiebedarf eines Hauses auch<br />
nur ein Richtwert sein kann, bei dem es nicht zu unerheblichen Abweichungen kommen<br />
kann zeigt die folgende Grafik des ifeu Instituts. Diese Abweichungen sind hauptsächlich<br />
auf drei Faktoren zurückzuführen:<br />
� das unterschiedliche Mieterverhalten, auf das in Kapitel 3.3 noch genau eingegangen<br />
wird,<br />
� die Einbeziehung statischer Berechnungsgrundlagen (z.B. die spezifische Wärmekapazität),<br />
die Umgebungseinflüsse außer Acht lassen und<br />
� die Existenz von zwei verschiedenen Berechnungsverfahren für den Gebäudeenergieausweis.<br />
Der verbrauchsorientierte Ausweis wird nach den gemessenen,<br />
witterungsbereinigten Verbrauchswerten der letzten Jahre erstellt. Hierbei fließt das<br />
9
Nutzerverhalten mit ein. Der bedarfsorientierte Energiepass wird rechnerisch unter<br />
Normbedingungen erstellt.<br />
Abbildung 5: Abweichungen des tatsächlichen Energieverbrauchs zum errechneten Energiebedarf<br />
Quelle: ifeu Institut 2005<br />
Da es weiterhin Unterschiede zwischen Alt- und Neubau beispielsweise bei der Raumgröße<br />
und damit dem Luftvolumen, der Ausführung von Fenstern und Türen usw. gibt,<br />
sollen diese beiden Gebäudetypen unterschieden werden. Es ergeben sich dadurch vier<br />
Gebäudetypen, die in dieser Studie bei Messungen von <strong>Heizungsregelungssysteme</strong>n<br />
unterschieden werden sollen.<br />
� Altbau unsaniert<br />
Es handelt sich um einen Altbau, dessen Endenergiebedarf > 220 kWh(m 2 a) ist.<br />
� Altbau saniert<br />
Es handelt sich um einen Altbau, dessen Endenergiebedarf < 220 kWh(m 2 a) ist.<br />
� Neubau unsaniert<br />
Es handelt sich um einen Neubau, dessen Endenergiebedarf > 220 kWh(m 2 a) ist.<br />
� Neubau saniert<br />
Es handelt sich um einen Neubau, dessen Endenergiebedarf < 220 kWh(m 2 a) ist.<br />
10
3. Erstellung von Szenarien für die Messungen<br />
Ziel der Studie ist es, verschiedene Heizungssteuerungssysteme in unterschiedlichen<br />
Wohnumgebungen zu installieren und ihre Akzeptanz und Effektivität zu messen und zu<br />
bewerten. Um dies zu erreichen, ist eine Beschreibung der notwendigen und hinreichenden<br />
Einschränkungen und Parameter zu erarbeiten, die einen Einfluss auf die Ergebnisse<br />
der Messung haben. Nur so können vergleichbare Messungen mit unterschiedlichen<br />
Arten von Heizungssteuerungssystemen in verschiedenen Häusern und Wohnungen vorgenommen<br />
werden. So weit wie mit vertretbarem Nutzen möglich, sollen Einflüsse des<br />
Hauses selbst und seiner Systeme sowie Einflüsse, die aus dem Verhalten des Nutzers<br />
resultieren, erkannt und bei der Bewertung der Heizungssteuerungssysteme eliminiert<br />
werden.<br />
Folgend sollen mögliche Einflussgrößen auf eine Heizungssteuerungssystem erkannt und<br />
dargestellt werden. Die ungewollten Einflüsse, die auf ein Steuerungssystem für Heizungen<br />
in Wohnumgebungen einwirken, können von drei Quellen ausgehen:<br />
� von dem Haus und der Wohnung selbst,<br />
� von dem in dem Haus installierten Heizungssystem und<br />
� von dem Verhalten des Mieters.<br />
In allen drei oben genannten Bereichen gibt es Faktoren, die jeweils die Messungen so<br />
stark beeinflussen können, dass eine Vergleichbarkeit der eingesetzten Heizungssteuerungssysteme<br />
nicht mehr möglich ist. Daher müssen diese Einflussfaktoren wenn<br />
möglich vermieden, ansonsten erkannt und bei der vergleichenden Bewertung berücksichtigt<br />
werden.<br />
3.1 Haus und Wohnung<br />
Allein das Haus und die Wohnung, in der der Heizenergieverbrauch gemessen werden<br />
soll, unterliegen Einflüssen, die den Verbrauch erheblich variieren lassen.<br />
Lage des Hauses<br />
Wie in Kapitel 2.3 schon erwähnt spielt schon die Lage eines Hauses eine Rolle für<br />
seinen Energieverbrauch. Wurde ein Haus an einem verschatteten Platz gebaut und ist<br />
dort starkem Wind ausgesetzt, wird es mehr Heizenergie verbrauchen als das gleiche<br />
Haus, das an einem Hang windgeschützt und in Südlage steht.<br />
Da man hier davon ausgehen kann, dass die Häuser, in denen die Messungen der<br />
Heizungssteuerungssysteme stattfinden werden, alle in einer in etwa vergleichbaren<br />
urbanen Umgebung liegen, wird dieser Faktor bei der Studie vernachlässigt.<br />
Lage der Wohnung innerhalb des Hauses<br />
Die Lage und Ausrichtung der Wohnung innerhalb des Hauses beeinflusst den Heizenergieverbrauch<br />
nicht unwesentlich. Dabei müssen nochmals zwei Faktoren unterschieden<br />
werden:<br />
11
� Die Ausrichtung der Außenwände einer Wohnung hat Einfluss auf den Energiegewinn<br />
der Wohnung durch die Sonneneinstrahlung. Im Winter werden durch die niedrig<br />
stehende Sonne und den damit günstigen Winkel die Wände eines Hauses erwärmt.<br />
Auch die Einstrahlung der Sonne in die Fenster, sorgt für eine Wärmegewinnung.<br />
Der Faktor der Energiegewinnung über Sonneneinstrahlung kann je nach Dauer und<br />
Beschaffenheit der Bausubstanz (wärmespeicherndes Mauerwerk) wesentliche<br />
Auswirkungen auf den Heizenergieverbrauch einer Wohnung haben. Er sollte daher<br />
bei der Auswahl der Objekte berücksichtigt werden.<br />
Auch die Größe der Außenflächen im Vergleich zu den Gesamtflächen der Wohnung<br />
sollte Berücksichtigung finden. Haben Wohnungen Erker, sind terrassenförmig angelegt<br />
oder sind Eckwohnungen, haben Sie mehr Außenflächen, über die Energie abgegeben<br />
werden kann als dies bei einer eingebauten Wohnung der Fall ist.<br />
Da eine rechnerische Analyse der Objekte sehr aufwändig wäre und oft auch wegen<br />
fehlender Informationen über den Wandaufbau von Bestandsbauten nicht möglich ist,<br />
wird empfohlen, Wohnungen mit einer etwa gleichen Ausrichtung und Dauer der<br />
Sonneneinstrahlung als Vergleichsobjekte zu wählen. Weiterhin sollte darauf geachtet<br />
werden, dass das Verhältnis der Außenflächen zu den innen liegenden Wänden bei<br />
den Vergleichsobjekten nicht zu stark differiert.<br />
� Einen weiteren Einfluss auf den Heizenergieverbrauch einer Wohnung haben alle<br />
angrenzenden Wohnungen. Herrscht beispielsweise in der darüber liegenden<br />
Wohnung Leerstand oder wohnt dort ein sogenannter Nicht-Heizer, ist die Decke einer<br />
ständigen Abkühlung ausgesetzt, die einen Mehrverbrauch an Heizenergie zur Folge<br />
hat.<br />
Für die Studie wäre es wünschenswert, wenn das Heizverhalten zumindest der Mieter<br />
bekannt ist, die über und unter der zu messenden Wohnung liegen. Sehr einfach ist<br />
dies durch die Heizkostenabrechnungen des letzten Jahres zu ermitteln. Sind sie<br />
unauffällig, kann davon ausgegangen werden, dass der Energieverbrauch der zu<br />
messenden Wohnung nicht beeinflusst wird.<br />
Dämmung<br />
Wie schon in Kapitel 2.2.2 gesehen haben Wandaufbau und Dämmung einen ganz<br />
wesentlichen Einfluss auf den Heizenergieverbrauch einer Wohnung. Hier wird vermutlich<br />
einer der größten Unsicherheitsfaktoren der liegen. Es ist wahrscheinlich, dass in den<br />
vielen Bestandsbauten weder die U-Werte der Außenwände noch die genauen Wandaufbauten<br />
überall bekannt sind, so dass eine konkrete Berechnung nicht möglich sein<br />
wird.<br />
Der U-Wert ist außerdem ein statischer Wert, der auf der spezifischen Wärmekapazität<br />
basiert und z.B. die Speicherkapazität des Materials außer Acht lässt. Da dieser Wert<br />
aber auch zur Berechnung des verbrauchsorientierten Gebäudeenergieausweises herangezogen<br />
wird, sollte er auch in diese Studie mit einfließen. Wenn der U-Wert der Außenwände<br />
eines Gebäudes nicht bekannt ist, sollte eine Schätzung auf Basis des<br />
12
angenommenen oder bekannten Wandaufbaus erfolgen. Gleiches gilt für Fenster, für die<br />
der U-Wert entweder vorliegt oder sehr einfach bestimmt werden kann.<br />
Wenn möglich, sollte von jedem Haus, in dem Installationen vorgenommen werden, eine<br />
Aufnahme mit einer Wärmebildkamera erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, dass bei den<br />
Aufnahmen das Umfeld wie Temperatur und Sonneneinstrahlung etwa gleich ist.<br />
Außentemperatur<br />
Da es geplant ist, die Referenzmessungen des Heizenergieverbrauchs in verschiedenen<br />
Städten und Regionen vorzunehmen, an denen unterschiedliche Außentemperaturen<br />
herrschen, müssen die gemessenen Werte bereinigt werden.<br />
Die Temperaturbereinigung von Heizenergieverbräuchen stellt ist ein Standardverfahren,<br />
das auch bei der Berechnung von Gebäudeenergieausweisen Anwendung findet. Es<br />
sollte auch für diese Studie eingesetzt werden. Vom Institut Wohnen und Umwelt GmbH<br />
wird eine Excel-Anwendung zur Berechnung von Gradtagszahlen in Deutschland zur<br />
Verfügung gestellt [IWU], der auf den freu verfügbaren Daten des deutschen<br />
Wetterdienstes basiert.<br />
Abbildung 6: Berechnung der Heizgradtage zur Bereinigung des Heizenergieverbrauchs [IWU]<br />
13
Die oben stehenden Werte beziehen sich auf eine Station für Wetterdaten in Berlin<br />
Tempelhof. Unter der fiktiven Annahme, dort stehe ein Wohnhaus mit einer beheizten<br />
Fläche von 1850 m 2 , das im Jahr 2009 einen Verbrauch an Heizenergie von 352.488 kWh<br />
hatte, wird eine Bereinigung der Heizdaten (mit den Daten der IWU) wie folgt<br />
vorgenommen:<br />
352.488 kWh x 2326 Kd 6 / 2198 Kd = 373.015 kWh<br />
Damit ergibt sich ein bereinigter Heizungsverbrauch von<br />
373.015 kWh / 1850 m 2 = 202 kWh/m 2 a.<br />
Zur Berechnung im Gebäudeenergieausweis würde noch der Verbrauch an Warmwasser<br />
einfließen, der hier nicht von Belang ist.<br />
3.2 Heizungssysteme<br />
Heizungssysteme für Mietwohnungen haben eine recht lange Lebensdauer, so dass im<br />
Bestand sowohl ältere Systeme ohne jegliche technische Vorkehrungen für die Vermeidung<br />
von Verlusten im Betrieb sind als auch moderne Anlagen, mit einer weitaus höheren<br />
Effizienz.<br />
Heizkessel<br />
Abluft<br />
Abbildung 7: Schematische Darstellung eines Heizungssystems im Mehrfamilienhaus<br />
Abbildung 6 zeigt ein einfaches Heizungssystem ohne Wärmerückgewinnung in einem<br />
Mehrfamilienhaus. Der Heizkessel befindet sich im Keller. Über eine Pumpe wird das<br />
etwa 65 °C warme Wasser in den Vorlauf der Heizung geleitet. Das erkaltete Wasser<br />
fließt aus den Heizkörpern über den Rücklauf wieder in den Kessel zurück. Die meist<br />
6 Kd (eigentlich korrekt: Kd/a) = Kelvin x Tag (pro Jahr)<br />
14
angeschlossene Warmwasserbereitung wird aus Gründen der Vereinfachung hier nicht<br />
dargestellt. Dies ist eine Heizsituation, wie sie noch in vielen vermieteten Mehrfamilienhäusern<br />
anzutreffen ist. Bei diesem System werden weder Abgas- noch Bereitschafts-<br />
oder Verteilungsverluste minimiert (siehe Kapitel 3.2.1 und Abbildung 10).<br />
Einen wesentlichen Einfluss auf den Heizenergieverbrauch hat wie gesehen das<br />
Heizungssystem, das zur Wärmeerzeugung in der Liegenschaft verwendet wird, in der die<br />
zu analysierende Wohnung liegt. Um einen Überblick zu bekommen, welche Heizungssysteme<br />
im jetzigen Bestand relevant sind, ist zunächst eine Analyse des für die Heizenergie<br />
verwendeten Energieträgers interessant.<br />
Abbildung 8: Anteil der Energieträger bei Heizsystemen im Bestand<br />
Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., BDEW<br />
Aus Abbildung 7 ist zu erkennen, dass Gas und Heizöl mit Abstand die beiden wichtigsten<br />
Energielieferanten im Bestandsbau sind. Fernwärme liegt mit deutlichem Abstand auf<br />
dem dritten Platz, ist aber regional sehr unterschiedlich verbreitet. In einzelnen Gebieten<br />
ist Fernwärme die deutlich häufigste Art der Beheizung.<br />
Da Abbildung 7 sich auf den Wohnungsbestand aus dem Jahre 2007 bezieht und die<br />
meisten Häuser schon mehrere Jahrzehnte alt sind, gibt diese Statistik einen Aufschluss<br />
über die Nutzung von Energiearten über eine langen Zeitraum hinweg. Notwendig ist es<br />
aber auch, einen Überblick über die Entwicklung der genutzten Heizenergieträger zu<br />
bekommen, da eine Veränderung in den letzten 10 bis 15 Jahre durch die Preisentwicklung<br />
und veränderten gesetzlichen Vorgaben zu erwarten ist.<br />
15
Abbildung 9: Nutzung von Energieträgern für Heizung in den letzten 30 Jahren im Neubau<br />
Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., BDEW<br />
Erst in dieser zeitlich aufgeteilten Übersicht wird deutlich, dass der Anteil von Öl bei der<br />
Heizenergie stetig zurückgegangen ist, während die Nutzung von Gas angestiegen ist. In<br />
den letzten 5 Jahren ist der Anteil von Gasheizungen in etwa in dem Maße zurückgegangen,<br />
wie der Anteil von Wärmepumpen und sonstigen alternativen Energien zugenommen<br />
hat.<br />
Für die hier zu erstellende Studie ist es zwar interessant, dass der Anteil alternativer<br />
Energieformen für die Heizenergie steigt, allerdings hat sie quantitativ für den Bestand<br />
noch keine relevante Grenze erreicht, so dass sie hier noch nicht näher betrachtet<br />
werden. Zukünftig werden sie jedoch eine immer größere Rolle spielen. Für den jetzigen<br />
Bestand stellen vor allem Gasheizungen, immer mehr abnehmend auch noch Ölheizungen<br />
die hauptsächlich auftretende Heizenergieform dar. Der Aufbau von Gas- und Ölheizungssystemen<br />
ist recht ähnlich. Auch der Heizwert ist mit 11,8 kWh/kg für Heizöl und 9,7<br />
– 12,5 kWh/m3 für Erdgas vergleichbar. Die Schwankungen der Werte beim Erdgas ergeben<br />
sich aus der unterschiedlichen Zusammensetzung des Gases je nach Förderregion.<br />
Es werden daher hier nur Gasheizkessel betrachtet.<br />
16
3.2.1 Heizkessel<br />
Ein wichtiges Kriterium zur Bewertung von Heizkesseln ist der Nutzungsgrad. Der<br />
Nutzungsgrad bezeichnet das Verhältnis der durch eine Anlage nutzbar gemachten<br />
Energie im Vergleich zur zugeführten Energie.<br />
Wie auch in Abbildung 9 zu sehen, erreichen neuste Brennwertkessel bei einem Betrieb<br />
im Niedertemperaturbereich 40/30 C° (Vorlauf / Rücklauf) einen Normnutzungsgrad von<br />
108-109%, im Temperaturbereich 70/50 C° immer noch einen Normnutzungsgrad von gut<br />
100%. Nutzungsgrade über 100% werden erreicht, indem die Wärme der auskondensierenden<br />
Abgase zurückgewonnen und genutzt wird.<br />
Abbildung 10: Nutzungsgrad von Heiztechniken in Relation zur Außentemperatur<br />
Quelle: Energieagentur NRW<br />
Mit der gelben Kennlinie sind die alten Konstanttemperaturkessel gekennzeichnet, die nur<br />
bei sehr kalten Außentemperaturen einen hohen Nutzungsgrad aufweisen. Der Betriebs-<br />
schwerpunkt von Heizkesseln liegt bei einer Außenlufttemperatur von 1-5 C°. Die veral-<br />
tete Kesseltechnologie schafft hier nur einen Nutzungsgrad von ca. 75%. Da die ersten<br />
Brennwertkessel erst ab ca. 1980 eingebaut wurden, ist damit zu rechnen, in unsanierten<br />
Gebäuden auch noch Konstanttemperaturkessel anzutreffen. Wie in obigem Bild deutlich<br />
17
zu sehen, bieten nur Brennwertkessel einen sehr guten Nutzungsgrad, der fast<br />
unabhängig ist von der Temperatur der Außenluft.<br />
Für die Studie ist der Nutzungsgrad des Heizungssystems in so fern wichtig, dass nur<br />
Messungen in Objekten verglichen werden können, deren Heizsysteme in etwa denselben<br />
Nutzungsgrad aufweisen. Andernfalls müssen die Werte umgerechnet werden, um eine<br />
Vergleichbarkeit zu gewährleisen.<br />
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Wirkungsgrad der Heizung. Als Wirkungsgrad<br />
bezeichnet man das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand (zugeführte Leistung). Auf ein<br />
Heizungssystem bezogen ist das die Menge der in den Wohnungen zur Verfügung<br />
stehenden Heizleistung im Vergleich zu der im Kessel eigentlich erzeugten. Von der<br />
Erzeugung der Heizenergie bis zur Nutzung in den Wohnungen werden drei Arten von<br />
möglichen Verlusten unterschieden:<br />
� Bereitschaftsverluste, auch Kesselverluste genannt, die direkt im Kessel entstehen.<br />
Hier sind z.B. Verluste gemeint, die durch nicht abgenommene Wärme entstehen.<br />
� Abgasverluste sind alle Energieverluste durch Abgase. Brennwertkessel vermeiden<br />
diese Verluste durch Rückführung der kondensierten Abgase und Nutzung der Restwärme.<br />
� Verteilungs- oder Transportverluste werden die Verluste genannt, die nach Verlassen<br />
des Kessels bei der Verteilung der Heizenergie im Haus entstehen. Die größten<br />
Verteilungsverluste entstehen durch ungedämmte Rohrleitungen. Der Anteil dieser<br />
Rohrwärme an der Gesamtwärme wird meist unterschätzt. Besonders hoch ist die<br />
Rohrwärmeabgabe bei großen Rohrdurchmessern und hohen Vorlauftemperaturen.<br />
Abbildung 10 zeigt schematisch den Wirkungsgrad eines Heizsystems mit seinen drei<br />
Verlustbereichen in einem Sankey-Diagramm.<br />
Abbildung 11: Wirkungsgrad und Verluste in Heizungssystemen<br />
Quelle: Institut für wirtschaftliche Ölheiung (IWO)<br />
18
Auch die Wirkungsgrade zweier Heizungssysteme in gemessenen Wohnungen sollten<br />
verglichen werden, um große Abweichungen zu vermeiden. Bereitschaftsverluste sind oft<br />
nicht bekannt und schwierig zu ermitteln. Abgasverluste sollten durch die Art der Heizung<br />
(siehe Nutzungsgrad) tendenziell zu bestimmen sein. Verteilungsverluste besonders die<br />
Rohrwärme müssen aber Berücksichtigung finden, da hier mit einer starken Verfälschung<br />
der Messwerte gerechnet werden muss.<br />
Wird über ein Raumregelsystem mit Stellventilen an den Heizkörpern die Raumtemperatur<br />
geregelt und soll die Raumtemperatur abgesenkt werden, d.h. die Ventile werden<br />
weiter geschlossen, wird trotzdem noch signifikant über die Rohre geheizt. Der Effekt der<br />
Schließung der Ventile und damit der Absenkung der Raumtemperatur kann sogar<br />
konterkariert werden, weil durch die verminderte Abnahme von Heizenergie (vielleicht in<br />
mehreren Wohnungen) die Vorlauftemperatur an den Heizkörpern steigt. Dieser Effekt<br />
kann bei älteren Heizungsanlagen auftreten, die ihre Heizkurve nicht dynamisch der<br />
Wärmemengenabnahme anpassen.<br />
Weniger Einfluss sollte die Abkühlung der Temperatur der Rohre von den unteren Stockwerken<br />
zu den weiter oben liegenden haben, zumindest wenn es sich um eine Zweirohrheizung<br />
handelt. Bei alten Einrohrheizungen, bei denen alle Heizkörper in einem Kreis<br />
verbunden sind und der Rücklauf des einen Heizkörpers den Vorlauf des anderen bildet,<br />
kann der Unterschied der Vorlauftemperatur ersten Heizkörper des Kreises gegenüber<br />
den oben liegenden Stockwerken signifikant sein. Wenn möglich sollte zum Ausschluss<br />
einer Beeinflussung die Temperatur frei liegender Rohrleitungen gemessen werden.<br />
3.3 Verhalten des Mieters<br />
Das größte Einflusspotential auf den Heizenergieverbrauch hat das Verhalten des<br />
Bewohners einer Wohnung selbst. Dies gilt sowohl in Wohnumgebungen mit als auch<br />
ohne Heizungssteuerungssteuerungssystem. Im letzteren Fall kann das Mieterverhalten<br />
die Effektivität des Steuerungssystems bezüglich der Energieeinsparung massiv<br />
reduzieren. Ergänzend siehe auch [VZBV].<br />
Im letzten Jahrzehnt hat sich das Problem von Schimmelbildung in Gebäuden wesentlich<br />
verschärft. Die Gründe dafür finden sich zum einen in der Gebäudehülle, die aus Gründen<br />
der Energieeffizienz immer dichter wird. Hochdichte Fenster gehören heute in vielen<br />
Gebäuden zum Standard, auch hochdichte Wohnungstüren werden mehr und mehr<br />
eingeführt. Der zweite Grund für die vermehrte Schimmelbildung liegt im Bestreben der<br />
Mieter, Energie zu sparen. Oft werden Heizkörperventile tagsüber vor dem Verlassen der<br />
Wohnung auf Frostschutz gestellt, was zu einer Abkühlung besonders der außen liegenden<br />
Wände führt. In der relativ kurzen, abendlichen Zeit vor der allgemeinen Nachtabsenkung<br />
können sich die Wände nicht wieder genügend erwärmen. Im Winter sinkt daher<br />
die Temperatur der Wände langsam aber stetig. Wird dann noch unzureichend gelüftet,<br />
entsteht Kondenswasser an den Wänden, der über längere Zeit zu Schimmelbildung führt.<br />
3.3.1 Lüftung<br />
In Wohnräumen dient die Lüftung vor allem zur Regulierung der Raumfeuchte und CO2-<br />
Konzentration. Der Hauptemissionsfaktor für Kohlendioxid (CO2) in Wohnräumen ist der<br />
19
Mensch. Die DIN EN 1946-6 7 legt einen Grenzwert von 1500 ppm (Parts per Million) fest,<br />
was einem Außenluftvolumenstrom (die von außen zugeführte Luft) von 20 m 3 /h pro<br />
Person entspricht. Zum Vergleich: Die CO2-Konzentration der Außenluft liegt zwischen<br />
300 und 500 ppm. Der klassische, oft verwendete Leitwert, der sogenannte Pettenkofer-<br />
Wert nimmt sogar eine maximal zulässige Konzentration von nur 1000 ppm in Wohnräumen<br />
an.<br />
Für eine vierköpfige Familie liegt die Luftwechselrate (gibt das Raumvolumen an, dass pro<br />
Stunden als Frischluft zugeführt werden muss) liegt in Aufenthaltsräumen zwischen 0,5/h<br />
und 1/h. Daraus resultiert, dass alle 1-2 Stunden gelüftet werden muss (auch nachts) was<br />
mit einer Fensterlüftung nicht realisierbar ist. Studien zeigen, dass in der Realität bei<br />
gutem Lüftungsverhalten mit Fensterlüftung Luftwechselraten von etwa 0,2/h erreicht<br />
werden können.<br />
Mit dieser Wechselrate kann auch die anfallende Feuchtigkeit in den hauptsächlichen<br />
Heizmonaten November bis Februar nicht eliminiert werden, denn hierzu wird eine Luftwechselrate<br />
von 0,3/h bis 0,5/h gefordert. Im Schnitt wird für eine erwachsene Person<br />
eine Abgabe von Feuchtigkeit zwischen 10 und 14 Litern pro Tag an seine Umgebung<br />
angenommen. Dieser Wert setzt sich zum einen aus Abgaben über Haut und Atmung<br />
zum anderen aus Tätigkeiten wie Kochen und Wäsche waschen/trocken zusammen. Aus<br />
diesen Zahlen, der eigenen Anwesenheit und der Tabelle, die den Zusammenhang<br />
zwischen Temperatur und Taupunkt zeigt, können nun individuelle Berechnungen zur<br />
Luftwechselrate gemacht werden.<br />
Die folgende Tabelle fasst die oben beschriebenen Faktoren und den damit verbundenen<br />
Bedarf an Frischluft bezogen auf einen erwachsenen Menschen noch einmal zusammen.<br />
Erwachsener Mensch Ruhephase Büroarbeit Schwere Arbeit<br />
Abgabe Wasserdampf (g/h) 23-32 46-62 130-180<br />
Bedarf Sauerstoff (l/h) 12-16 24-32 65-90<br />
Abgabe Kohlendioxid (l/h) 10-13 19-26 55-75<br />
Bedarf Frischluft für max. 1000 ppm<br />
(m3/h)<br />
17-21 32-42 90-130<br />
Tabelle 3: Faktoren für Frischluftzufuhr<br />
Quelle: Dr.-Ing. Burkhard Schulze Darup<br />
Die Auswirkungen einer unzureichenden Lüftung sowie einer falschen Lüftungstechnik<br />
wurden schon in Kapitel 2.2.3 eingehend beschrieben. Die Notwendigkeit der Stoßlüftung<br />
ist hinlänglich bekannt, um den notwendigen Luftaustausch in einer Wohnung zu gewährleisten.<br />
Trotzdem wird die Stoßlüftung (vollständiges Öffnen von Fenstern und Türen)<br />
sowie Querlüftung (gleichzeitigen Stoßlüften in entgegengesetzten Räumen mit Öffnung<br />
dazwischen liegender Türen) eher selten angewendet.<br />
7 Regelung für die Lüftung von Wohngebäuden<br />
20
Grund dafür ist der subjektive Eindruck der starken Abkühlung der Wohnung. Durch eine<br />
kurze Querlüftung wird schnell viel Luftvolumen ausgetauscht, wodurch beim Bewohner<br />
der Eindruck einer starken Abkühlung seiner Wohnung entsteht, die gleichgesetzt wird mit<br />
viel Energieverlust. Natürlich ist durch den schnellen Luftaustausch die Luft in der<br />
Wohnung kalt. Wände und Einrichtung allerdings kühlen sich nicht ab und tragen so<br />
ebenfalls zur Erwärmung der Luft nach dem Schließen der Fenster bei.<br />
Eine bei Mietern immer noch sehr beliebte Art der Lüftung ist die Kipplüftung, weil sie<br />
subjektiv betrachtet nicht das Gefühl von Kälte in der Wohnung vermittelt. Energetisch<br />
und aus gesundheitlichen Aspekten gesehen ist die Kipplüftung allerdings keine Alternative<br />
zur Stoß- oder Querlüftung. Der Luftaustausch über ein gekipptes Fenster verläuft<br />
viel zu langsam. Da die Kipplüftung (nach Mieterangaben) auch im Winter oft längere Zeit<br />
(0,5 bis 1,5 Stunden) durchgeführt wird, kühlt sich die Umgebung des Fensters, also die<br />
umgebenden Wände, der Fußboden und die Möbel ebenfalls ab. Die Erwärmung der<br />
Wände nach Schließen des Fensters benötigt wie schon in Kapitel 2.2.3 beschrieben<br />
wesentlich mehr Energie als die Erwärmung von Luft.<br />
3.3.2 Wärmezonen innerhalb der Wohnung<br />
Ein weiteres, oft auftretendes Verhalten ist das Beheizen nur einzelner Räume einer<br />
Wohnung. Die meisten Mieter bevorzugen es, die Zimmertüren offen stehen zu lassen<br />
(meist bis auf die Ausnahmen Bad und Schlafzimmer). Durch das verstärkte Heizen nur<br />
eines oder zweier Räume werden die anderen Zimmer mit geheizt. Auch in diesem Fall<br />
tun die Bewohner dies, um energieeffizient zu handeln.<br />
Heizkörper sind in einem Zimmer so angebracht, dass sich eine möglichst optimale<br />
Verteilung der Wärme in diesem Zimmer ergibt. Beim Mit-Heizen anderer Zimmer findet<br />
meist eine Überheizung des beheizten Raums statt, damit auch die angrenzenden Räume<br />
warm werden. Die effektivste und energiesparendste Methode ist jedoch, jeden Raum<br />
durch seinen eigenen Heizkörper so zu heizen, wie es für diesen Raum notwendig ist und<br />
dabei unterschiedliche Wärmezonen zu schaffen, die sich kaum vermischen können, weil<br />
die Zimmertüren geschlossen sind.<br />
Bei Heizkörpern unterscheidet man die Wärmeabgabe durch Konvektion und Strahlung.<br />
Bei der Konvektion steigt die durch den Heizkörper erwärmte Luft nach oben und fällt<br />
während ihrer Abkühlung wieder nach unten. Dadurch entsteht wie in Abbildung 11 zu<br />
sehen eine Zirkulation der Luft innerhalb des Zimmers. Die wärmste Luftschicht befindet<br />
sich also unter der Decke, die kälteste am Fußboden. Der Temperaturunterschied beträgt<br />
dabei mehrere Grad Celsius.<br />
Bei der Wärmestrahlung erfolgt der Energietransport ohne Mitwirkung eines stofflichen<br />
Mediums durch elektromagnetische Wellen, die oberhalb des Bereichs des für einen<br />
Menschen sichtbaren Lichts liegen (Beispiel: Infrarot). Die Temperaturstrahlung breitet<br />
sich gradlinig in alle Richtungen aus, die Wärme wird also gleichmäßig im Zimmer verteilt.<br />
Strahlungswärme ist prinzipiell die effektivere Wärmeübertragung für den Wohnraum.<br />
Heizkörper geben allerdings nur einen geringen Teil ihrer Heizleistung über Strahlung ab<br />
21
(je nach Bauform und Material zwischen 22% und 38%), den weitaus größeren über<br />
Konvektion.<br />
Abbildung 12: Erwärmung des Raums durch Konvektion<br />
Quelle: Dena, © Stucke GmbH<br />
Abbildung 13: Erwärmung des Raums durch Strahlung<br />
Quelle: Dena, © Stucke GmbH<br />
Sowohl für die Wärmeabgabe durch Konvektion als auch durch Strahlung ist es notwendig,<br />
dass die Heizkörper nicht durch Möbel verstellt oder durch Vorhänge verdeckt<br />
sind. In diesen Fällen bildet sich ein Wärmestau am Heizkörper, der Rest des Zimmers<br />
kann nur mit erhöhtem Energieaufwand erwärmt werden.<br />
3.3.3 Umgang mit technischen Systemen<br />
Beim Umgang mit technischen Mess- und Regelsystemen können für den Mieter weitere<br />
Probleme auftreten. Zum einen können die Systeme so kompliziert zu bedienen sein,<br />
dass die Einstellung selbst für technikaffine Menschen schwierig ist und die Bedienungsanleitung<br />
bei jeder Änderung der Einstellungen herangezogen werden muss. Da die<br />
Systeme nicht ständig neu eingestellt werden müssen, liegen zum Teil lange Zeiträume<br />
22
zwischen den Bedienungsphasen. Zum anderen gibt es Menschen, für die die Bedienung<br />
technischer Regelsysteme Ihrer Wohnung grundsätzlich ein Hindernis darstellt.<br />
In jedem Fall sollten Heizungsregelsysteme so beschaffen sein, dass sie durch Fehlbedienung<br />
nicht in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Weiterhin ist zu beachten, dass<br />
für Menschen jedes Alters die Regelung der Heizung eine Notwendigkeit und kein<br />
Lifestile-Produkt ist, mit dem er gern bereit ist, sich zu beschäftigen. Bei der folgenden<br />
Betrachtung der verschiedenen technischen Systeme wird auch der Aspekt der Handhabung<br />
und Bedienbarkeit jeweils untersucht werden. 8<br />
8 Einen Überblick über Fragen der Usability und des Designs gibt z.B. [FfU]<br />
23
4. Mess- und Regelsysteme zur Heizungssteuerung<br />
Die heute verfügbaren Mess- und Regelsysteme zur Heizungssteuerung basieren alle auf<br />
der Idee, Energie durch Einzelraumregelung von Zimmern zu sparen. Räume sollen nur<br />
auf die gewünschte Komforttemperatur geheizt werden, wenn sie auch genutzt werden.<br />
Sind Räume für mehrere Stunden ungenutzt, wie z.B. Kinderzimmer, wenn die Kinder in<br />
der Schule sind, wird die Temperatur in den Räumen abgesenkt. Hierzu müssen für jeden<br />
Raum und für jeden Wochentag die Nutzungszeiten und die jeweils gewünschten<br />
Komfort- und Absenktemperaturen in den Systemen angegeben werden.<br />
Unterschieden werden für diese Studie drei grundsätzlich verschiedene Arten von<br />
<strong>Heizungsregelungssysteme</strong>n:<br />
� Stand-alone-Systeme, die als neuer Thermostatventilkopf direkt am Heizkörper<br />
montiert werden,<br />
� Systeme mit einer Zentrale, bei denen die elektronischen Thermostatventile über eine<br />
Zentrale programmiert und gesteuert werden,<br />
� Systeme mit einer Zentrale und der Rückmeldung an den Heizkessel zur Adaption der<br />
Heizkurve an die tatsächlich benötigte Wärmemenge.<br />
Problematisch für den Einsatz aller Systeme sind die in Deutschland vorgeschriebenen<br />
Abrechungsmodalitäten für die verbrauchte Heizenergie, die eine Aufteilung in Eigenanteil<br />
und Gemeinschaftsanteil von 50% zu 50% oder 70% zu 30% vorsieht. Spart eine Mietpartei<br />
durch ein installiertes Heizungssteuerungssystem Heizenergie ein, kommt ihr selbst<br />
das nur zu 50% bzw. 70% zu Gute. Damit verlängert sich die Amortisationszeit für alle<br />
Systeme wesentlich und der Anreiz für den Einsatz sinkt sowohl bei Mietern als auch<br />
Vermietern.<br />
Folgend sollen nun die drei genannten Typen von Systemen näher betrachtet werden.<br />
4.1 Stand-alone-Systeme<br />
Das Ventil des Heizkörpers, auch Thermostatventil genannt, ermöglicht die Regelung der<br />
Raumtemperatur. Es ist eine mechanische Temperaturregelung, durch die die Durchflussmenge<br />
des heißen Wassers durch den Heizkörper geregelt werden kann. Moderne<br />
Thermostatventile arbeiten mit einem sogenannten Dehnstoffelement, das sich bei<br />
Wärme ausdehnt und über einen Übertragungsstift so das Ventil schließt. Zieht sich das<br />
Dehnstoffelement wieder zusammen, sorgt der Druck einer Rückstellfeder dafür, dass<br />
sich das Ventil wieder mehr öffnet. Das Drehen des Ventilkopfes durch den Nutzer<br />
reguliert den grundsätzlichen Abstand des Übertragungsstifts zum Ventilgehäuse.<br />
Bei den meist üblichen Ventilen mit einer Beschriftung des Gehäuses von 1 bis 5 (zuzüglich<br />
Frostschutz) bewirkt jede Veränderung der Einstellung um einen Wert in etwa eine<br />
Veränderung der Temperatur um zwei Grad. Der Wert 3 sollte in etwa 20 C° entsprechen,<br />
was aber nur ein Richtwert ist, da die tatsächliche Temperatur noch von diversen anderen<br />
Faktoren abhängt. Durch die mechanische Regelung gibt es weiterhin Abweichungen, die<br />
je nach Qualität des Ventilkopfes bis zu 2 C° betragen können. Die korrekte Funktion aller<br />
24
Ventilköpfe kann nur gewährleistet werden, wenn sie frei von der Umgebungsluft<br />
umströmt werden und nicht eingebaut, durch Möbel verstellt oder hinter Gardinen versteckt<br />
sind.<br />
Bei diesen Systemen wird lediglich das Thermostatventil des Heizkörpers gegen ein<br />
programmierbares, elektronisches Ventil ausgetauscht. An diesem elektronischen Ventilkopf<br />
können Absenkzeiten und –temperaturen programmiert werden. Zu den angegebenen<br />
Absenkzeiten fährt der Ventilkopf ohne Zutun des Mieters das Ventil automatisch auf<br />
den angegebenen Temperaturwert zu bzw. öffnet den Ventilkopf, um das Zimmer wieder<br />
zu erwärmen. Da die elektronischen Ventilköpfe ihre Energie für die Stellvorgänge meist<br />
von Batterien beziehen, ist die Anzahl der möglichen Stellvorgänge pro Ventil und Tag oft<br />
begrenzt. Abbildung 13 zeigt beispielhaft einen solchen programmierbaren Ventilkopf.<br />
Abbildung 14: Programmierbares Thermostatventil Quelle: Honeywell<br />
Auf dem Markt sind Systeme verschiedener Anbieter erhältlich, die sowohl über Bau- und<br />
Elektronikmärkte als auch über Fachhändler vertrieben werden. Wegen ihres relativ günstigen<br />
Preises werden diese Stand-alone-Systeme gern von technikaffinen, interessierten<br />
Bewohnern eingesetzt, um Heizenergie zu sparen. Die programmierbaren Ventilköpfe<br />
sind ab ca. 30,- Euro erhältlich. Die meisten Systeme werden mit Adaptern für fast alle<br />
gängigen Heizkörper geliefert und sind so schnell und einfach zu installieren. Bei einem<br />
Umzug können die alten Thermostatköpfe wieder montiert und die elektronischen in die<br />
neue Wohnung mitgenommen werden.<br />
Ein Hindernis bei der Nutzung ist die Programmierung des Ventils auf dem relativ kleinen<br />
Display mit wenig Tasten. Sowohl Vor- als auch Nachteil kann die Möglichkeit zur<br />
manuellen Einstellung der Temperatur am Ventilkopf sein, die bei einigen Modellen<br />
weiterhin gegeben ist. Auf der einen Seite ist damit dem Mieter eine einfache Möglichkeit<br />
zur Nachjustierung gegeben, sollte ihm doch einmal zu kalt sein. Auf der anderen Seite<br />
kann bei ständiger Nutzung der manuellen Regelung der Vorteil der programmierten<br />
Profile und der damit verbundenen Energieeinsparung zu großen Teilen vom Bewohner<br />
25
umgangen werden. Auch an dieser Stelle ist der Nutzen und die Effektivität des Systems<br />
wieder stark vom Verhalten des Nutzers abhängig.<br />
Stand-alone-Systeme werden praktisch ausschließlich von interessierten Bewohnern<br />
selbst finanziert und installiert. Wegen des Gemeinkostenanteils bei Mietwohnungen<br />
werden Sie überproportional oft in Eigentumswohnungen bzw. Einfamilienhäusern eingesetzt.<br />
4.2 Systeme mit einer Zentrale<br />
Ähnlich den Stand-alone-Systemen setzen die Systeme mit einer Zentrale auch elektronische<br />
Thermostatventile ein, die jedoch über die zentrale Einheit programmiert werden.<br />
Die Ventile selbst haben keine Programmiermöglichkeit, können aber teilweise, je nach<br />
Anbieter, auch manuell an einem Stellrad geregelt werden. Die Zeit- und Temperaturprofile<br />
für jedes Zimmer werden an der Zentrale programmiert und können dort jederzeit<br />
geändert werden. Ein Vorteil gegenüber den Stand-alone-Systemen ist, dass die<br />
Programmierung für alle Räume an einem Gerät vorgenommen werden kann und an der<br />
Zentrale dafür ein größeres Display und mehr Tasten zur Verfügung steht. Auch Touchdisplays,<br />
auf dem Tasten kontextsensitiv am Bildschirm dargestellt werden können,<br />
werden für manche zentralen Steuerungen eingesetzt.<br />
Die Zentrale kommuniziert mit den Thermostatventilen über Kabel oder Funk und steuert<br />
diese auf Basis der hinterlegten Profile. Dabei eignet sich die kabelbasierte Variante eher<br />
für Neubauten oder Sanierungen, während Funk bei der Nachrüstung von Bestandswohnungen<br />
eingesetzt wird. Die verkabelte Variante hat den Vorteil, dass die Thermostatventile<br />
über die Steuerleitung auch gleichzeitig mit Strom versorgt werden können, die<br />
den Einsatz einer Batterie überflüssig macht. Damit ist keine Begrenzung der möglichen<br />
Stellzyklen pro Tag mehr notwendig. Funkgesteuerte Ventile arbeiten wie die Standalone-Systeme<br />
mit einer Batterie.<br />
Abbildung 15: Funktionsweise einer Heizungssteuerung mit Zentrale<br />
Quelle: Siemens<br />
26
Eine Zentrale kann – je nach Hersteller und System – in der Regel zwischen 12 und 64<br />
verschiedene Heizkörperventile steuern, was für private Wohneinheiten absolut ausreichend<br />
ist.<br />
Funkbasierte Systeme arbeiten in den ISM 9 -Bändern 433 MHz oder 868 MHz, die für<br />
mittlere Reichweiten bis 100 m festgelegt wurden. Der Bereich um 433 MHz 10 ist von<br />
seiner Spezifikation her kaum eingeschränkt oder gesichert, weshalb er beispielsweise für<br />
Kinderspielzeug jeglicher Art gern eingesetzt wird. Dabei ist Dauersenden erlaubt, es gibt<br />
keine Kollisionsvermeidung und keine eineindeutige Identifikation der Funkknoten. Lediglich<br />
eine maximale Sendeleistung von 10 mW wurde definiert. Soll eine sichere Kommunikation<br />
erreicht werden, können alle möglichen Sicherheitsmechanismen in einem eigenen<br />
Protokoll des Herstellers z.B. mittels Kanalkodierung realisiert werden. Wird das allerdings<br />
nicht getan, kann es auf den 433 MHz Frequenz leicht zu Störungen und Beeinflussungen<br />
mit anderen Geräten kommen, die dieselbe Frequenz benutzen.<br />
Die Vorschriften im neueren 868 MHz 11 Band sind wesentlich restriktiver definiert worden.<br />
Um Störungen möglichst zu vermeiden, wurden mehrere Unterbänder mit verschiedenen<br />
Beschränkungen definiert. Die Einschränkungen beziehen sich dabei auf die maximale<br />
Kanalbandbreite, die maximale Sendeleistung und eine Belegungsdauer für die Frequenz,<br />
die bezogen auf eine Stunde definiert und als sogenannter Duty Cycle bezeichnet wird.<br />
Unterschieden werden Very Low Duty Cycle (≤ 0,1% = 3,6 s/h), Low Duty Cycle (≤ 1% =<br />
36 s/h), High Duty Cycle (360 s/h) und Very High Duty Cycle (ohne Zeitbeschränkung).<br />
Frequenzbereich in Max. Kanalbreite in Max. Sendeleistung Rel.<br />
MHz<br />
KHz<br />
Belegungsdauer<br />
868,00 – 868,60 Keine<br />
Einschränkung<br />
25 mW ≤ 1%<br />
868,70 – 869,20 Keine<br />
Einschränkung<br />
25 mW ≤ 0,1%<br />
869,30 – 869,40 25 10 mW Keine<br />
Einschränkung<br />
869,40 – 869,65 25 500 mW ≤ 10%<br />
869,70 – 870,00 Keine<br />
5 mW Keine<br />
Einschränkung<br />
Einschränkung<br />
Tabelle 4: Frequenznutzungsparameter für 868 MHz Band<br />
Quelle: Bundesnetzagentur, Allgemeinzuteilung von Frequenzen für nichtöffentliche Funkanwendungen<br />
geringer Reichweite; Nonspecific Short Range Devices (SRD); VfG 30/2006 geändert mit Vfg.<br />
39/2009<br />
9 ISM = Industrial Science Medical; Funkfrequenzbänder, die in Industrie, Wissenschaft und Medizin aber<br />
auch im häuslichen Bereich lizenzfrei genutzt werden können. Sie werden von der ITU-R festgelegt.<br />
10 Genauer Frequenzbereich: 433,05 – 434,79 MHz<br />
11 Genauer Frequenzbereich: 868,00 – 870,00 MHz<br />
27
Die im Allgemeinen im Gebäude und auch für Regelsysteme eingesetzten Komponenten<br />
nutzen den Low Duty Cycle, dürfen also maximal 36 Sekunden pro Stunde mit einer<br />
maximalen Sendeleistung von 25 mW senden. Zum Vergleich: ein DECT-Telefon hat eine<br />
Sendeleistung von bis zu 250 mW, WLAN ist in Deutschland auf eine Sendeleistung von<br />
100 mW beschränkt, ist aber ein Dauersender. Die Belastung durch elektromagnetische<br />
Strahlung ist beim Einsatz von funkbasierten Thermostatventilen also sehr gering.<br />
Bei den meisten Systemen ist die Zentrale in der Lage, auch noch andere Sensoren und<br />
Aktoren der Gebäudeautomation zu verwalten und zu steuern. Dadurch erhöht sich die<br />
Komplexität der Oberfläche. Die installierte Basis der Systeme mit zentraler Steuerung<br />
teilt sich auf interessierte Bewohner auf der einen Seite aber auch einzelne Pilotprojekte<br />
der Wohnungswirtschaft auf der anderen Seite auf. Wegen des deutlich höheren Preises<br />
gegenüber den Stand-alone-Systemen ist in Mietwohnungen durch den Gemeinkostenanteil<br />
die Amortisationszeit recht lang. Daher werden bei Eigenfinanzierung die meisten<br />
Systeme von den Bewohnern von Eigenheimen und Eigentumswohnungen eingesetzt, da<br />
Ihnen die Ersparniss vollständig zu Gute kommt. Die funkbasierten Systeme mit Zentrale<br />
können wie die Stand-alone-Systeme bei einem Umzug abmontiert und in die neue<br />
Umgebung mitgenommen werden.<br />
Speziell bei den Projekten der Wohnungswirtschaft, bei denen nicht der Mieter über die<br />
Einführung eines Heizungssteuerungssystems entscheidet, ist zu beobachten, dass auch<br />
bei diesen Systemen die Anwender durch die Programmierung oft überfordert sind.<br />
Umfragen zeigen, dass Umstellungen bei eingestellten Zeitabläufen oder Temperaturen<br />
werden meist von Mitarbeitern der Wohnungswirtschaft vorgenommen werden. Gibt es<br />
die Möglichkeit, die Raumtemperatur auch manuell durch Drehregler an den Funkventilen<br />
einzustellen, besteht hier wieder die Möglichkeit, die voreingestellte Regelung und damit<br />
optimierte Heizungseinstellung zu umgehen.<br />
4.3 Systeme mit Steuerung des Heizkessels<br />
Die Systeme mit Rückmeldung und Steuerung des Heizkessels können als eine Erweiterung<br />
der Systeme mit Zentrale gesehen werden. Innerhalb der Wohnung ist der Aufbau<br />
sehr ähnlich. In einer zentralen Steuerung sind Profile zum Heizen jedes Raums für jeden<br />
Wochentag hinterlegt. Über Funk oder Kabel steuert die Zentrale die elektronischen<br />
Thermostatventile. Zusätzlich meldet jede Zentrale aus jeder Wohnung des Hauses die in<br />
nächster Zeit benötigte Wärmemenge, die auf Grund der programmierten Profile bekannt<br />
ist, an den Heizkessel. Auch diese Datenübertragung kann über Funk oder Kabel realisiert<br />
werden. Eine Logik wertet diesen Wärme-Forecast aus und reguliert die Heizkurve<br />
und damit die Vorlauftemperatur des Kessels.<br />
28
Abbildung 16: Schema einer Heizungssteuerung mit Rückmeldung an den Heizkessel<br />
Quelle: Honeywell<br />
Beispielsweise wird am Morgen aus vielen Wohnungen gemeldet, dass für die nächsten<br />
Stunden die Temperatur in den meisten Räumen abgesenkt wird, da die Bewohner zur<br />
Arbeit gehen. Daraufhin wird die Fahrkurve des Heizkessels adaptiert, so dass die<br />
Vorlauftemperatur für die nächsten Stunden abgesenkt wird, also auch keine überflüssige<br />
Wärme zur Verfügung gestellt wird. Dadurch werden sowohl Bereitstellungs- als auch<br />
Verteilungsverluste minimiert.<br />
Natürlich darf die Vorlauftemperatur nur so weit gesenkt werden, dass bei Mietern, die am<br />
Vormittag zu Hause sind, noch die programmierten Temperaturen erreicht werden können.<br />
Da über die Zentralen der Wohnungen alle benötigten Werte bereitgestellt werden,<br />
kann auch diese Anforderung sichergestellt werden. Da über die Profile auch bekannt ist,<br />
wann die Wohnungen wieder stärker beheizt werden müssen, wird die Fahrkurve wieder<br />
angepasst, so dass zu diesem Zeitpunkt genügend Wärme zur Verfügung steht.<br />
Diese Art der Heizungsoptimierung und –steuerung scheint die größten Einsparmöglichkeiten<br />
zu versprechen, da hierbei auf zwei voneinander unabhängige Potenziale<br />
Einfluss genommen werden kann, die einzelnen Wohnungen und die Fahrkurve des Heizkessels.<br />
Die installierte Basis dieser Systeme in Deutschland ist allerdings heute noch sehr gering,<br />
weil die Notwendigkeit besteht, alle an einem Heizkessel angeschlossenen Wohneinheiten<br />
mit Heizungssteuerungssystemen auszustatten. Die Investition, alle Wohnungen<br />
mit Heizungssteuerungen auszustatten und je nach Größe des Objekts Funkrepeater für<br />
die Datenverbindung zum Heizkessel einzusetzen oder Kabel dorthin zu verlegen, wird<br />
von den Vermietern noch gescheut.<br />
29
5. Analyse unterstützender Systeme für die Erfassung<br />
des Energieverbrauchs beim Heizen<br />
5.1 Heizkostenverordnung<br />
Gesetzliche Grundlage für die Heizkostenerfassung und der Heizkostenabrechnung bildet<br />
die 1981 in Kraft getretene Heizkostenverordnung (HeizKV). Zum 1. Januar 2009 ist die<br />
Novellierung der Heizkostenverordnung in Kraft getreten. Sie ist Teil des integrierten<br />
Klimaprogramms der Bundesregierung. Das Ziel: den Ausstoß von CO2 bis zum Jahr<br />
2020 um 40 Prozent zu senken. Da knapp 40 Prozent der verbrauchten Energie in<br />
Deutschland auf den Gebäudebereich entfallen, soll die neue Heizkostenverordnung<br />
durch eine noch genauere verbrauchsabhängige Abrechnung auf diesem Feld mehr<br />
Anreize zur Energieeinsparung jedes Einzelnen schaffen. Das betrifft unter anderem auch<br />
die Technik zur Erfassung der Heiz- und Warmwasserkosten.<br />
Die verursachungsgerechte Abrechnung ist eine Maßnahme, mit der ohne großen<br />
Investitionsaufwand durch eine Verhaltensänderung jedes einzelnen Mieters ein beachtliches<br />
Maß an Energieeinsparung erzielt werden kann. Nach einem vom Bundesminister<br />
für Wirtschaft eingeholten Gutachten wird im Immobilienbereich mit einem Einsparpotenzial<br />
von etwa 15% gerechnet, das auf die Einführung der verbrauchsgerechten<br />
Abrechnung zurückzuführen ist.<br />
Die Novellierung der Heizkostenverordnung:<br />
Die wichtigsten Änderungen für Mieter und Vermieter zum 1. Januar 2009: Zum 1. Januar<br />
2009 tritt die neue Heizkostenverordnung (HeizKV) in Kraft. Die Heizkostenverordnung ist<br />
für Gebäudeeigentümer und Vermieter die rechtliche Grundlage zur Durchführung der<br />
jährlichen Heiz- und Warmwasserkostenabrechnungen. Mit der neuen Heizkostenverordnung<br />
erhöht sich der verbrauchsabhängige Anteil bei der Abrechnung von Heiz-<br />
und Warmwasserkosten bei älteren Gebäuden von derzeit häufig 50% auf zukünftig 70%.<br />
So sollen die Bewohner zu einem sparsameren Verhalten bei der Beheizung ihrer Räume<br />
motiviert werden.<br />
Die Pflicht zur Verbrauchserfassung entfällt zukünftig, wenn ein Mehrfamilienhaus beim<br />
Bau oder bei der Sanierung den Passivhausstandard erreicht. Dies bietet zusätzliche<br />
Anreize für Bauherren und Vermieter, beim Bau oder bei der Sanierung von Gebäuden<br />
einen energetisch besseren Standard zu erreichen.<br />
Die Änderung der Heizkostenverordnung ist Bestandteil des Integrierten Energie- und<br />
Klimaprogramms (IEKP), das die Bundesregierung im August 2007 vereinbart hat. Die<br />
Neuerungen bei der Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten haben zum Ziel,<br />
Potenziale zur Energieeinsparung und damit auch zur Reduzierung von CO2-Emissionen<br />
im Gebäudebereich zu erschließen. Grundlage ist das Energieeinsparungsgesetz.<br />
Nachfolgend die wichtigsten Änderungen:<br />
30
Zeitnahe Information der Verbrauchswerte<br />
Den Nutzern soll das Ergebnis der Ablesung in der Regel innerhalb eines Monats mitgeteilt<br />
werden. Diese Regelung betrifft vor allem Heizkostenverteiler mit nur einer Verdunsterampulle<br />
und elektronische Geräte, die keine Werte speichern. Die Mitteilungspflicht<br />
entfällt, wenn das Ableseergebnis über einen längeren Zeitraum in den Räumen des<br />
Nutzers gespeichert wird und vom Nutzer abgerufen werden kann. Bei Heizkostenverteilern<br />
nach dem Verdunstungsprinzip wird die Vorjahresampulle im Gerät aufbewahrt,<br />
so dass der Ablesewert verfügbar bleibt. Die Warmwasserzähler sind von der Informationspflicht<br />
ausgenommen. (§ 6 Abs. 1 HeizKV)<br />
Vereinfachung der Änderung von Verteilungsschlüsseln<br />
Welcher prozentuale Anteil der Heizungs- und Warmwasserkosten nach Fläche und<br />
welcher nach Verbrauch umzulegen ist, wurde bisher vom Gebäudeeigentümer festgelegt<br />
und konnte nur innerhalb der ersten drei Jahre oder unter ganz bestimmten Voraussetzungen<br />
geändert werden.<br />
In Zukunft kann der Gebäudeeigentümer ggf. auch mehrfach den Verteilungsschlüssel<br />
ändern, wenn sachliche Gründe vorliegen, wie zum Beispiel eine neue Heizungsanlage<br />
oder verbesserte Wärmedämmung. Die Nutzer müssen vor Beginn einer Abrechnungsperiode<br />
über die Änderung des Verteilungsschlüssels informiert werden. (§ 6 Abs. 4<br />
HeizkV)<br />
Stärkung des Verbrauchsanteils<br />
Die oben erwähnte Wahlfreiheit für den Verteilungsschlüssel wird durch eine Neuerung<br />
eingeschränkt: Die bisher übliche Verteilung der Heiz- und Warmwasserkosten zu 50<br />
Prozent nach Wohnfläche und zu 50 Prozent nach Verbrauch ist zukünftig nur noch in<br />
bestimmten Fällen erlaubt.<br />
Wenn das Gebäude nicht die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung von 1994<br />
erfüllt, mit Öl- oder Gasheizung versorgt wird und freiliegende Leitungen der Wärmeverteilung<br />
überwiegend gedämmt sind, muss der Eigentümer bzw. Vermieter eine Verteilung<br />
der Heizkosten nach dem Abrechnungsmaßstab 30 Prozent Flächenanteil und 70<br />
Prozent Verbrauchsanteil vornehmen (§ 7 Abs. 1 HeizkV). Liegen diese Bedingungen<br />
beim Gebäude nicht vor, besteht weiterhin die Wahlfreiheit für den Gebäudeeigentümer.<br />
Kosten für Verbrauchsanalyse und Eichung können umgelegt werden<br />
In Zukunft darf der Eigentümer nicht nur die Kosten für das Messen und Abrechnen der<br />
Heiz- und Warmwasserkosten sondern auch die Kosten einer Verbrauchsanalyse auf die<br />
Mieter umlegen. Ebenso sind nun Eichkosten für die Wärmezähler ausdrücklich umlagefähig.<br />
(§ 7 Abs. 2 HeizKV)<br />
Austausch alter Verteiler<br />
Heizkostenverteiler, die vor dem 1. Juli 1981 und Warmwasserkostenverteiler, die vor<br />
dem 1. Juli 1987 eingebaut wurden, müssen bis spätestens zum 31. Dezember 2013<br />
ausgetauscht werden. (§ 12 Abs. 2 HeizKV)<br />
31
5.1.1 Ausnahmen<br />
Passiv- oder Niedrigenergiehäuser sind besonders energieeffiziente Gebäude, die einen<br />
Heizwärmebedarf von weniger als 15 kWh/m² im Jahr aufweisen. Diese Gebäude werden<br />
von der Pflicht zur verbrauchsabhängigen Abrechnung der Heizkosten ausgenommen.<br />
Eine verbrauchsabhängige Abrechnung der Heizkosten ist hier nicht mehr sinnvoll, da die<br />
Kosten für die Verbrauchserfassung in der Regel höher liegen als die nur noch sehr<br />
geringen Einsparmöglichkeiten durch die Nutzer. Da der Anteil dieser Häuser im Mietwohnungsbereich<br />
noch sehr niedrig ist, kann diese Regel vernachlässigt werden.<br />
5.1.2 Geltung der neuen Heizkostenverordnung<br />
Alle neuen Regelungen der Heizkostenverordnung 2009 müssen auf Abrechnungszeiträume<br />
angewendet werden, die ab dem 1. Januar 2009 beginnen. Für Abrechnungszeiträume,<br />
die vor dem 31. Dezember 2008 begonnen haben, sind die Regelungen der<br />
alten Heizkostenverordnung weiter anzuwenden. (§ 12 Abs. 6 HeizKV)<br />
Bislang gewährte der Gesetzgeber für Heizkostenverteiler, die vor 1989 montiert wurden,<br />
einen Bestandsschutz. Seit 1. Januar 2009 ist der Bestandsschutz für Heizkostenverteiler,<br />
die nicht den aktuell gültigen Regeln der Technik entsprechen, aufgehoben. In einigen<br />
Jahren müssen dann alle Heizkostenverteiler, die vor 1. Juli 1981 montiert wurden, ausgetauscht<br />
sein.<br />
Der verbrauchsabhängige Anteil bei der Heizkostenabrechnung wird von 50 auf 70<br />
Prozent erhöht. So werden zum Beispiel die Warmwasser- und Heizungskosten in<br />
gedämmten Häusern mit moderner und effizienter Heiztechnik mit 70 Prozent<br />
verbrauchsabhängig abgerechnet. Mieter dürfen nach dem Inkrafttreten der Novelle ihre<br />
Miete kürzen, wenn der Vermieter seiner Nachrüstungsverpflichtung beim Heizkessel<br />
nicht nachkommt.<br />
5.2 Datenerfassung durch Heizkostenverteiler<br />
Die 1981 in Kraft getretene Heizkostenverordnung hat den sparsamen Umgang mit<br />
Energie bei Heizung und Warmwasser zum Ziel. Sie schreibt zwingend eine verbrauchsabhängige<br />
Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten vor. Darüber hinaus verpflichtet<br />
sie den Vermieter in einem Mehrfamilienhaus, Erfassungsgeräte zur individuellen<br />
Verbrauchserfassung zu installieren, um die entstandenen Kosten für Heizung und<br />
Warmwasser, verbrauchsorientiert auf die Bewohner zu verteilen.<br />
Die gebräuchlichste Messmethode für die Erfassung der Wärmeabgabe eines einzelnen<br />
Heizungskörpers stellt der verbrauchserfassende Heizkostenverteiler dar. Alle Geräteausführungen<br />
beruhen auf dem gemeinsamen Prinzip der Erfassung des Wärmeverbrauchs<br />
entsprechend der Messung einer oder mehrerer Temperaturen.<br />
Ein Heizkostenverteiler (HKV) ist ein Gerät zur verbrauchsabhängigen Berechnung von<br />
Heizkosten. Er ist kein Messgerät, sondern ein Erfassungsgerät, weil er – anders als z. B.<br />
ein Wärmezähler – keine physikalische Größe misst, sondern lediglich dimensionslose<br />
Einheiten. Erst durch Verhältnisrechnung der Erfassungsergebnisse mehrerer gleich-<br />
32
artiger Heizkostenverteiler lassen sich in der Heizkostenabrechnung die individuellen<br />
Heizkosten der einzelnen Nutzer ermitteln.<br />
Obwohl in Deutschland ungeeichte bzw. nicht eichfähige Messgeräte grundsätzlich nicht<br />
für die mengenmäßige Messung von Waren verwendet werden dürfen, dürfen Heizkostenverteiler<br />
nach der Heizkostenverordnung zur Erfassung des Wärmeverbrauchs<br />
eingesetzt werden.<br />
5.2.1 Funktionsprinzip des Heizkostenverteilers<br />
Ein Heizkostenverteiler besteht in der Regel aus einem Rückenteil, das wärmeleitend mit<br />
dem Heizkörper verbunden wird, und einem Vorderteil, das die Messvorrichtung enthält<br />
und auf das Rückenteil aufgesteckt und verplombt wird.<br />
Durch die Erwärmung des Heizkörpers erwärmt sich auch das Rückenteil. Die Temperatur<br />
(bzw. die Temperaturdifferenz zur Raumtemperatur bei elektronischen Zweifühlergeräten)<br />
wird über die Heizperiode (ein Jahr laut Heizkostenverordnung) aufintegriert und bildet so<br />
den Messwert. Da die abgegebene Wärmemenge auch von der Größe und Bauart des<br />
Heizkörpers und vom Wärmeübergang zwischen Heizkörper und Heizkostenverteiler<br />
abhängt, wird der Messwert jedes Heizkörpers mit einem individuellen Faktor multipliziert.<br />
Man spricht in diesem Fall von einer Einheitsskala, weil jeder Heizkostenverteiler mit der<br />
gleichen Skala ausgestattet ist. Sind hingegen die Heizkostenverteiler an unterschiedlichen<br />
Heizkörpern mit unterschiedlichen Skalen, sogenannten Produktskalen ausgestattet,<br />
erfolgt keine Umrechnung, weil der Faktor durch die Wahl der Skala bereits<br />
berücksichtigt ist.<br />
Bei elektronischen Heizkostenverteilern erreicht man die Skalierung durch eine Programmierung.<br />
Die Bestimmung des Bewertungsfaktors findet im Rahmen der Montage des<br />
Heizkostenverteilers statt. Dazu wird der Hersteller und Typ des Heizkörpers − soweit<br />
möglich − bestimmt und ein Aufmaß genommen. Das führt zur Heizkörperleistung als<br />
erstem Teil des Bewertungsfaktors. Anschließend wird der Faktor noch durch den sogenannten<br />
Kc-Wert korrigiert, welcher den Wärmeübergang zwischen Heizmedium und<br />
Heizkostenverteiler beschreibt. Die Heizkörperbewertung setzt die Kenntnis genauer<br />
Daten über den eingesetzten Heizkostenverteiler und den Heizkörper voraus, die in<br />
umfangreichen Mess- und Versuchsreihen gewonnen werden.<br />
Neben der Einheits- oder Produktskala haben einige Heizkostenverteiler eine zusätzliche<br />
Kontrollskala. Diese dient dazu, Ablesefehler festzustellen.<br />
Die Heizkostenverteiler werden nach ihrer Funktionsweise in zwei große Gruppen unterteilt:<br />
Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip und elektronische Heizkostenverteiler.<br />
Heizkostenverteiler mit Verdunstungsprinzip<br />
Die Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip werden immer mehr von den<br />
elektronischen Heizkostenverteilern vom Markt verdrängt.<br />
33
Abbildung 17: Heizkostenverteiler OPTRONIC Quelle: Brunata-Metrona<br />
Beim Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip liegt ein mit einer Flüssigkeit<br />
gefülltes, oben offenes Glasröhrchen am Rückenteil an. Je nach Temperatur verdunstet<br />
die Messflüssigkeit schneller oder langsamer. Die Menge der verdunsteten Flüssigkeit<br />
bildet den Messwert. Auf dem Vorderteil des Heizkostenverteilers ist eine Skala angebracht,<br />
mit der man den Messwert durch ein Fenster ablesen kann. Durch die Kaltverdunstung<br />
12 kann es in seltenen Fällen zu Fehlmessungen kommen, wenn sie in den<br />
einzelnen Wohnungen bedingt durch andere Wärmequellen, z. B. Sonneneinstrahlung,<br />
große Unterschiede aufweist.<br />
Kapillarheizkostenverteiler haben rechts die Vorjahreskapillare, links die Verbrauchskapillare<br />
mit zwei Skalen. Die linke Skala ist die Kontrollskala, die rechte zeigt den<br />
Verbrauch. In ihrem oberen Teil (oberhalb des Nullpunkts) sieht man zwölf Striche.<br />
Bei der jährlichen Hauptablesung wird das Röhrchen durch ein neu befülltes ersetzt. Bei<br />
einigen Geräten kann das Röhrchen auch verschlossen und zur Beweissicherung im<br />
Heizkostenverteiler ein weiteres Jahr aufbewahrt werden. Ein Vergleich zwischen Vorjahr<br />
und laufendem Jahr ist damit aber nicht möglich, weil es sich nicht um physikalische<br />
Einheiten handelt und sich der Preis je Einheit erst bei der Heizkostenabrechnung ergibt.<br />
Zur besseren Unterscheidung wird die Messflüssigkeit in jedem Jahr mit einem anderen<br />
Farbstoff versehen.<br />
Für moderne Niedertemperaturheizungen mit mittleren Auslegungstemperaturen unter 60<br />
°C sind normale Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip (Klasse A nach EN<br />
835) nicht zugelassen, da ihre Messgenauigkeit dafür nicht ausreicht.<br />
12 Kaltverdunstung ist die Verdunstung, die ohne zusätzliche Wärmezufuhr erfolgt. [Wiki 3]<br />
34
Elektronische Heizkostenverteiler<br />
Bei elektronischen Heizkostenverteilern werden die Temperatur des Heizkörpers und die<br />
Temperatur der Raumluft durch zwei Sensoren erfasst. Die Temperaturdifferenz wird<br />
elektronisch berechnet und auf einem LC-Display oder elektromechanischem Zählwerk in<br />
Form von Zählschritten angezeigt.<br />
Abbildung 18: Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRIC Quelle: Brunata-Metrona<br />
Bei einfacheren Heizkostenverteilern kann der Raumtemperaturfühler auch fehlen<br />
(Einfühlergerät). In diesem Fall wird eine konstante Raumtemperatur angenommen.<br />
Ähnlich der Kaltverdunstung beim Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip<br />
kann es auch beim elektronischen Heizkostenverteiler trotz ausgestellten Heizkörpers zu<br />
Zählschritten kommen. Der Effekt tritt bei hoher Umgebungstemperatur auf, z. B. bei<br />
außergewöhnlich hohen Temperaturen im Sommer.<br />
Die Energieversorgung erfolgt durch eine Batterie. Bei älteren Geräten wird sie bei der<br />
jährlichen Hauptablesung durch den Ableser ausgetauscht. Aktuellere Geräte enthalten<br />
eine fest eingebaute Lithium-Batterie, die den Heizkostenverteiler bis zu zehn Jahre<br />
versorgen kann.<br />
Elektronische Heizkostenverteiler bieten gegenüber den Geräten nach dem Verdunstungsprinzip<br />
zusätzliche Funktionen, die je nach Hersteller noch variieren können.<br />
Stichtagablesung<br />
Der Heizkostenverteiler speichert zu einem Stichtag (z. B. 31.12.) den Ablesewert ab und<br />
beginnt wieder bei Null zu zählen. Die Ablesung kann zu einem beliebigen Zeitpunkt nach<br />
35
dem Stichtag stattfinden. Der Ablesewert bleibt zur Beweissicherung bis zum nächsten<br />
Stichtag gespeichert.<br />
Speichern der Monatswerte<br />
Der Heizkostenverteiler speichert den Ablesewert eines jeden Monats. Dadurch entfallen<br />
Zwischenablesungen bei Nutzerwechsel.<br />
Ablesen per Funk<br />
Die Stichtagswerte und meist auch alle Monatsendwerte werden per Funk zu einem oder<br />
mehreren Datensammlern außerhalb der Wohnung übertragen. Der Ableser muss die<br />
Wohnung nicht mehr betreten. Diese Daten können vor Ort ausgelesen werden oder per<br />
Internet, GSM oder UMTS vom Messdienst abgerufen werden.<br />
Prüfsummenbildung / Manipulationssicherheit<br />
Der Heizkostenverteiler berechnet aus diversen Daten eine Prüfsumme, aus der im<br />
Nachhinein Ablesefehler, Störungen oder Manipulationsversuche zu erkennen sind.<br />
5.3 Datenerfassung durch Wärmemengenzähler<br />
Wärmemengenzähler dienen wie Heizkostenverteiler der Ermittlung des Wärmeverbrauchs.<br />
Im Gegensatz zu Heizkostenverteilern messen sie jedoch den physikalischen<br />
Durchfluss von Energie. Die Wärmemenge, die einem Verbraucher über einen Heizkreislauf<br />
zugeführt wird, errechnet sich aus dem gemessenen Volumenstrom des Heizwassers<br />
und der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf des Heizkreislaufs. Die gemessene<br />
Heizenergie wird in Gigajoule (GJ) oder Megawattstunden (MWh) angegeben.<br />
Wärmemengenzähler können als Alternative zu Heizkostenverteilern eingesetzt werden.<br />
Sie kommen auf jeden Fall in Wohnungen zum Einsatz, wenn Heizkostenverteiler als<br />
Alternative nicht in Frage kommen, da sie nicht eingesetzt werden dürfen wie z. B. bei<br />
jeder Art von Niedertemperaturheizung.<br />
Abbildung 19: Beispiel eines Wärmemengenzählers Quelle: Siemens<br />
36
5.3.1 Funktionsprinzip des Wärmemengenzählers<br />
Wärmemengenzähler bestehen aus einem Messgerät für den Volumenstrom (Durchflussmesser,<br />
Wasserzähler), einem Temperaturfühlerpaar und einem elektronischen<br />
Rechenwerk. In Ultraschallmessgeräten wird anstelle des Volumenstromes die<br />
Strömungsgeschwindigkeit gemessen.<br />
Das Volumenmessteil ist entweder mechanisch drehend oder statisch nach dem Ultraschallprinzip<br />
ausgeführt. Als mechanische Messteile kommen z.B. Flügelradzähler zum<br />
Einsatz. Ultraschallzähler machen sich den Umstand zunutze, dass entgegenlaufende<br />
Schallwellen unterschiedliche Laufzeiten haben, womit sich eine Laufzeitdifferenz ermitteln<br />
lässt.<br />
Die Temperaturfühler zur Erfassung des Heizungsvor- und Rücklaufs sind zumeist Platin-<br />
Widerstandsthermometer, die im Zähler integriert sind, oder bei größeren Einheiten von<br />
außen über spezielle Anschlussstücke angebracht werden können.<br />
Ein Rechner verknüpft die ankommenden Signale vom Volumenmessteil und den<br />
Temperaturfühlern. Er berechnet die Wärmemenge, die auf dem Display in einer<br />
auszuwählenden Einheit (GJ oder MWh) angezeigt wird. Zusätzliche Informationen<br />
können auf Wunsch abgerufen werden, wie beispielsweise der aktuelle Durchfluss, die<br />
Wärmeleistung oder eine akkumulierte Wärmemenge innerhalb einzugebender Stichtage.<br />
Zusätzlich gibt es Wärmezähler mit Funkmodulen zur Fernübertragung, so dass der<br />
Mieter beim Auslesen nicht anwesend sein muss.<br />
Bei Wärmemengenzählern handelt es sich im Gegensatz zu Heizkostenverteilern um<br />
Messgeräte, d.h. sie unterliegen dem deutschen Eichgesetzt. Werden Wärmezähler zur<br />
Abrechnung von Heizkosten eingesetzt, müssen sie geeicht sein. Bei der Eichung werden<br />
die Temperaturfühler erst einzeln geprüft und dann Paare mit zueinander passender<br />
Fehlerkennlinie gebildet, die nicht mehr getrennt werden dürfen. Die Volumenmessteile<br />
werden unabhängig hiervon geprüft. Die Eichgültigkeit beträgt bei Wärmezählern fünf<br />
Jahre.<br />
5.4 Auswertung der Verbräuche<br />
Die Heizkostenabrechnung wird in der Regel nicht vom Betreiber der Heizungsanlage<br />
selbst durchgeführt, sondern in dessen Auftrag durch Wärmemessdienstfirmen. Diese<br />
statten die Liegenschaft mit den nötigen Erfassungsgeräten (oft auf Mietbasis) aus, führen<br />
die Ablesungen durch und erstellen die Heizkostenabrechnung im Auftrag des Hauseigentümers.<br />
Die Datenablesung erfolgt entweder durch Ablesen der Zähler in der Wohnung,<br />
Auslesen der Funk-Datenlogger außerhalb der Wohnungen oder per Funkfernablesung, je<br />
nach technologischer Ausstattung der Zähler.<br />
Der Hauseigentümer kann die Heizkostenabrechnung aber auch selbst mit eigener Software<br />
durchführen. Für die Mieter kann dies wegen der geringeren Kosten attraktiv sein.<br />
Für den Eigentümer der Immobile ergeben sich jedoch folgende Vorteile durch die Beauftragung<br />
eines Wärmemessdienstes:<br />
� Er trägt so nicht das Rechtsrisiko bei Abrechnungsfehlern<br />
37
� Die Heizkostenabrechnung wird von Profi erstellt, der jederzeit auf dem neusten Stand<br />
der der rechtlichen Bestimmungen sein muss<br />
� Nur so darf der Vermieter die Mietkosten der Messgeräte, die Kosten der Ablesung<br />
und der Heizkostenabrechnung auf die Mieter umlegen<br />
� Allgemeine Arbeitserleichterung und Zeitersparnis für den Vermieter/Eigentümer der<br />
Immobilie.<br />
Allgemein betrachtet sind momentan die Möglichkeiten des Mieters, seine Verbräuche an<br />
Heizenergie transparent und zeitnah dargestellt zu bekommen äußerst beschränkt. Hier<br />
bleibt zu hoffen, dass die Novellierung der Heizkostenverordnung mit dem auf 70 %<br />
erhöhten Verbrauchskostenanteil in der Heizkostenabrechnung einen Anreiz bietet,<br />
Entwicklungen in diese Richtung voranzutreiben.<br />
Die Möglichkeit, einige Heizkostenverteiler und Wärmemengenzähler inzwischen z.B. per<br />
Funk oder kabelbasiertem M-Bus zumindest monatlich auszulesen, schafft eine<br />
Grundlage, die Verbräuche des jeweiligen Mieters aktuell und gut aufbereitet zu<br />
visualisieren. Entsprechende Lösungen sind aber noch recht teuer.<br />
Die einmal jährlich ausgestellte Einzelabrechnung der Heizkosten gibt dem Mieter die<br />
Möglichkeit, seine eigenen Verbräuche im gewissen Maße einzusehen. Die Heizkostenabrechnung<br />
erhält der Mieter vom Vermieter. Die Formulierung „im gewissen Maße“<br />
deswegen, da sich die Heizkostenabrechnung wie schon öfter erwähnt aus dem Grundkostenanteil<br />
und aus dem Verbrauchskostenanteil (Eigenanteil) zusammensetzt.<br />
Abbildung 20: Beispiel einer Heizkostenberechnung Quelle: Brunata-Metrona<br />
38
5.4.1 Transparenz der Verbräuche bei Wärmemengenzählern<br />
Da Wärmemengenzähler direkt in das Rohrleitungssystem eingebaut werden, ermöglichen<br />
sie eine physikalische, exakte Wärmemessung, die auch dem Mieter ein Ablesen<br />
der genauen Verbrauchswerte möglich macht. Ist der Wärmemengenzähler für den Mieter<br />
zugänglich, sind folgende Werte auch als Mieter auslesbar (die Funktionalitäten variieren<br />
bei unterschiedlichen Herstellern).<br />
Abbildung 21: Anzeigen eines Wärmemengenzählers<br />
Quelle: Minol Messtechnik GmbH<br />
39
Verbräuche sind für den Mieter an den Geräten selbst ablesbar, wenn die Geräte an einer<br />
für den Mieter zugänglichen Stelle installiert sind. Die dargestellten Verbräuche geben<br />
allerdings keinen direkten Aufschluss über die zu erwartenden Kosten, da hier noch nicht<br />
der Grundkostenanteil und die umlagefähigen Kosten berücksichtigt sind.<br />
5.4.2 Transparenz der Verbräuche für den Mieter bei Heizkostenverteilern<br />
Schwieriger gestaltet sich die Transparenz der eigenen Verbräuche für den Mieter bei den<br />
Heizkostenverteilern, auch wenn es sich um elektronische Heizkostenverteiler handelt.<br />
Der Mieter kann zwar an dem ablesbaren Display seine individuellen Verbrauchseinheiten<br />
ablesen, jedoch gibt ihm dies keinen Rückschluss auf seine Heizkosten.<br />
Anders als die Wärmemesszähler zeigen die Heizkostenverteiler wie oben beschrieben<br />
den Wärmeverbrauch nicht in physikalischen Messgrößen, sondern lediglich in dimensionslosen<br />
Anzeige- und Verbrauchswerte ohne physikalische Einheiten.<br />
5.4.3 Existierende Lösungen zur Visualisierung des Verbrauchs<br />
Die Gebäudeheizung hat einen Anteil von ca. 70% am gesamten Energieverbrauch einer<br />
Privatwohnung. Auf Grund des hohen Kostenfaktors der Heizenergie und des Fehlens<br />
von Lösungen seitens der Hersteller der Heizungssysteme und der Vermieter, mit denen<br />
der Mieter zeitnah die eigenen Verbräuche einzusehen könnte, werden im Internet<br />
verschiedene Plattformen und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, um die eigenen<br />
Verbräuche zu visualisieren und zu vergleichen. Der Mieter muss hier per Hand seine<br />
abgelesenen Verbrauchswerte in regelmäßigen zeitlichen Abständen eingeben. Das setzt<br />
voraus, dass er freien Zugang zu seinen Zählern hat. Seitens des Mieters wird weiterhin<br />
ein hohes Maß an Initiative und Disziplin vorausgesetzt, um Verbrauchswerte über<br />
längere Zeiträume abzulesen und in das System einzugeben.<br />
40
Abbildung 22: Beispiel aus dem Portal des Bundes der Energieverbraucher<br />
Quelle: Bund der Energieverbraucher<br />
Auch bei diesen Ansätzen zur Schaffung von Transparenz wird nicht der Grundkostenanteil<br />
einer zentralen Heizung für mehrere Mietparteien berücksichtigt. Daher sind solche<br />
Lösungen eher für Bewohner von Einfamilienhäusern nützlich.<br />
5.5 Produkte und Dienste zum Energiesparen<br />
Die Internetpattform Co2online bietet mit ihrem „Energiesparkonto“, einer Onlinesoftware,<br />
dem Mieter aber auch dem Vermieter aktiv die Möglichkeit, seine Verbräuche für Strom,<br />
Wasser und Heizung durch die Eingabe der aktuellen Verbrauchsdaten, der Daten aus<br />
der Heizkostenabrechnung, des Typs des Heizkessels, der Raumgröße usw. ins Verhältnis<br />
zu den zu erwartenden Kosten zu setzen, sowie Kostensenkungen bei Einsparung der<br />
Verbräuche einzusehen. Deshalb ist das Energiesparkonto vor allem für die Nutzung in<br />
privaten Haushalten entwickelt worden, um sich einen umfassenden Überblick über den<br />
eigenen Energieverbrauch zu verschaffen.<br />
Den auf der Internetplattform Co2online veröffentlichten Statistiken bezüglich des<br />
Energiesparkontos ist zu entnehmen, dass es tatsächlich zum großen Teil von Mietern<br />
und privaten Hauseigentümer genutzt wird. Rund 14.000 Menschen nutzen das Konto<br />
bislang. Es ist allerdings nicht bekannt, wie viel Prozent aller Nutzer die Plattform<br />
regelmäßig und über längere Zeit nutzen.<br />
41
Abbildung 23: Nutzer der Co2online Plattform Quelle: Co2online<br />
Das Energiesparkonto bilanziert und visualisiert den Verbrauch der Energie für Strom,<br />
Wasser und Heizung, speichert die Daten und wertet sie aus. Außerdem errechnet es den<br />
individuellen Co2-Ausstoß und berät den Anwender beim Energiesparen.<br />
Des Weiteren werden kommunale Heizkostenspiegel, ein bundesweiter Heizkostenspiegel<br />
sowie Heizgutachten auf diversen Internetplattformen zur Verfügung gestellt<br />
(Heizspiegel. Co2online, usw.). Sie bieten dem Mieter Anhaltspunkte und Vergleichswerte<br />
um abzuschätzen, in welchem Rahmen er mit seinem Verbrauch an Heizenergie aus<br />
Heizöl, Erdgas oder Fernwärme im bundesweiten oder regionalen Durchschnitt liegt. Aus<br />
welchem Grund der Verbrauch des Mieters allerdings über oder unter dem Durchschnitt<br />
liegt, wird aus in diesem Vergleich nicht transparent.<br />
Da die eigene Heizkostenabrechnung für die Referenzwerte zu Grunde gelegt wird, bietet<br />
der Heizkostenspiegel bis jetzt auch nur einmal jährlich die Möglichkeit, an Hand der<br />
jährlich erstellten Heizkostenabrechnung die Verbräuche zu überprüfen bzw. mit dem<br />
bundesweiten Durchschnitt in Relation zu setzen.<br />
Heizkostenspiegel liefern einen groben Vergleichswert für die eigenen Verbrauchsdaten.<br />
Regionale Unterschiede der Außentemperatur, die sich auch auf den Heizenergieverbrauch<br />
auswirken, werden bei den Vergleichswerten beim bundesweiten Heizkostenspiegel<br />
nicht ausreichend berücksichtigt, regionale Vergleichswerte erhält man erst, wenn<br />
man ein kostenloses Heizgutachten erstellen lässt oder einen regionalen Spiegel heranzieht.<br />
42
Abbildung 24:Bundesweiter Heizkostenspiegel 2008<br />
Quelle: co2online gemeinnützige GmbH in Kooperation mit <strong>Deutscher</strong> <strong>Mieterbund</strong> e.V.<br />
5.6 Auswertungsmöglichkeiten für den Vermieter<br />
Sämtliche Heizkosten, Instandhaltungskosten für die Anlage usw. sind für den Vermieter<br />
auf den Mieter umlegbar und belasten ihn somit nicht. In letzter Zeit findet in der<br />
Wohnungswirtschaft jedoch ein Umdenken statt zu finden.<br />
Höhere Leerstände in den Immobilien führen zu dem Bestreben, die sogenannte „zweite<br />
Miete“, die Nebenkosten, zu senken und die Immobilie für den potentiellen Mieter attraktiver<br />
zu gestalten. Die Nebenkosten steigen überproportional stark gegenüber der<br />
Gesamtmiete, so dass der Spielraum für die Netto-Kaltmiete sehr gering ist. Zu den<br />
Maßnahmen, die Vermieter in Betracht ziehen, gehören auch eine stärkere Transparenz<br />
der Verbrauchswerte für den Mieter sowie der Einsatz von Technologie, um die Heizkosten<br />
insgesamt zu senken.<br />
Adapterm von Techem<br />
Adapterm ist ein System, das Heizenergie sparen und dem Vermieter Transparenz über<br />
die Verbräuche in einer Liegenschaft geben kann. Die Funkheizkostenverteiler senden die<br />
Daten über die momentane Wärme des jeweiligen Heizkörpers an einen Datensammler.<br />
Der Datensammler leitet die Daten aller Wohneinheiten an das adapterm-Modul weiter.<br />
Dies Modul ermittelt den aktuellen Wärmebedarf des gesamten Hauses auf Grund aller<br />
gesammelten Daten und passt die Vorlauftemperatur der Heizung dem momentanen<br />
Wärmebedarf an. Das adapterm-Modul sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur auf ein<br />
optimales Maß abgesenkt wird.<br />
Der Datensammler ist weiterhin in der Lage, die Verbrauchswerte und Liegenschaftsdaten<br />
an das adapterm-Cockpit zu übermitteln. Das Techem-Rechenzentrum bereitet die Daten<br />
für den Vermieter auf und stellt sie ihm tabellarisch und grafisch wieder zur Verfügung. Als<br />
besonderen Service wartet Techem das adapterm-System per Fernzugriff.<br />
43
Abbildung 25: Architektur des Systems adapterm Quelle: Techem<br />
Abbildung 26: adapterm Cockpit für den Vermieter Quelle: Techem<br />
44
Das System adapterm nutzt ein Energiesparpotential aus, das nicht in das Heizverhalten<br />
des Mieters eingreift und damit nicht seinem korrekten Verhalten oder Fehlverhalten<br />
unterliegt. Da das System direkt am Heizkessel ansetzt, werden auch Bereitsstellungs-<br />
und Verteilungsverluste vermieden.<br />
Da das System die Wärme und Verbräuche misst, wäre eine Rückmeldung an den Mieter<br />
und damit auch eine für Verhaltensänderungen notwendige Transparenz möglich.<br />
Momentan existiert aber nur eine Datenaufbereitung für Vermieter.<br />
5.7 Industrielle Monitoringsysteme<br />
Für den industriellen Bereich gibt es schon sehr komplexe Lösungen, um Heizkosten und<br />
andere Medien transparent und zeitnah zu erfassen und zu visualisieren. Es ist nicht<br />
verwunderlich, das Energiemonitoringsysteme in der Industrie eine weitere Verbreitung<br />
haben als im Wohnungsbau, weil<br />
� elektronische Zähler mit diversen Zusatzfunktionen wie der Möglichkeit von<br />
Grenzwertsetzung usw. seit einiger Zeit im industriellen Bereich schon eingesetzt<br />
werden und<br />
� das Einsparpotential in der Industrie von den Herstellern der Energiemonitoringsysteme<br />
höher eingeschätzt wurde als im Wohnungsbau.<br />
EMSys<br />
EMSys wurde als Gemeinschaftsprodukt der STAWAG (Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft)<br />
und der Adapton AG für die Industrie und die Wirtschaft entwickelt. EMSys<br />
steht für Energiemonitoringsystem und ist eine Softwarelösung zum Archivieren,<br />
Erfassen, Analysieren und Abrechnen von Energie- und Medienverbräuchen (Strom,<br />
Heizwasser, Gas, Dampf, Druckluft, etc.) in Anlagen und Liegenschaften. Verwalter oder<br />
Eigentümer von Liegenschaften und Anlagen haben so jederzeit den Energieverbrauch<br />
Ihrer Anlagen im Blick und können steuernd eingreifen.<br />
In dem System werden alle gemessenen Daten strukturiert erfasst und können über einen<br />
Webzugriff dargestellt werden. Mit der Energiemonitoring-Software werden die Verbräuche,<br />
Kosten und Emissionen von Wärme, Gasen und Druckluft in regelmäßigen Abständen<br />
aufgezeichnet und ausgewertet. So können Potenziale für Energieeinsparungen aufgedeckt<br />
werden. Die Erfassung und Darstellung aller relevanten Verbräuche macht den<br />
Energieverbrauch transparent und ermöglicht die Ausarbeitung von Energiesparkonzepten.<br />
Die Kenntnis der Energiesituation der jeweiligen Liegenschaft bis hin zu jeder<br />
einzelnen Anlage gestattet die langfristige Planung von Maßnahmen und Projekten.<br />
Über EMSys können Meldungen des integrierten Alarm- und Störmeldemanagements per<br />
SMS und/oder E-Mail verschickt werden, so dass sichergestellt wird, dass zu jeder Zeit<br />
schnell auf Unregelmäßigkeiten oder Ausfälle reagiert werden kann.<br />
Um die Anforderungen des Energiemonitorings auch vor dem Hintergrund der<br />
technischen Entwicklung zu erfüllen, wurde bei der Entwicklung von EMSys besonderer<br />
Wert auf die Nutzung offener Softwarestandards (Java und Frameworks) und<br />
45
Unterstützung von Datenbanken gemäß SQL 92 (z.B. PostgreSQL, Oracle) gelegt.<br />
EMSys läuft auf Windows- und Linux-Servern. Da EMSys eine Webapplikation ist, können<br />
alle Funktionen über das Internet aufgerufen werden. Der Nutzer hat somit von überall her<br />
zu jeder Zeit Zugriff auf alle Informationen, die ihm das System bereitstellt.<br />
Auch andere Hersteller bieten Systeme zur Messung und zum Monitoring aller Verbräuche<br />
in Industrieunternehmen an. Ein weiteres Beispiel ist die Firma Envidatec Energiedienstleistungen,<br />
die Hard- und Software-Systeme für die Erfassung, Visualisierung und<br />
das Controlling von Energie- und Betriebsdaten für Industrieunternehmen vertreibt.<br />
5.8 Monitoringsysteme für Strom<br />
In den vergangenen Kapiteln wurde deutlich, dass Monitoring und Transparenz von Heizenergie<br />
aus verschiedenen Gründen schwer zu realisieren ist.<br />
� Verbrauchskostenanteil (Eigenanteil) und Gemeinkostenanteil können erst nach<br />
Vorliegen aller Werte eines Gebäudes für einen Zeitraum berechnet werden.<br />
� Die meist im Wohnungsbau eingesetzten Heizkostenverteiler zeigen keine physikalische<br />
Messgröße an, sondern nicht genormte Einheiten. Aus dem Jahresvergleich<br />
dieser Einheiten kann ein Mieter zwar seinen ungefähren Verbrauch abschätzen<br />
(mehr oder weniger Verbrauch als im letzten Jahr zur gleichen Zeit), nicht aber die<br />
Kosten berechnen, die daraus resultieren.<br />
� Wärmemengenzähler geben einen besseren Aufschluss über die verbrauchte Wärmemenge,<br />
da sie geeichte Messgeräte sind, lassen aber ebenfalls wegen der im ersten<br />
Punkt genannten Problematik keine Berechnung der tatsächlich anfallenden Kosten<br />
zu.<br />
Wesentlich einfacher zu erreichen ist die Verbrauchstransparenz beispielsweise bei<br />
Strom. Hier zählt nur der eigene Verbrauch, einen Gemeinkostenanteil ähnlich der<br />
Heizung gibt es nicht. Zwar werden Stromkosten wie etwa die Beleuchtung des Hausflures<br />
auf alle Mieter umgelegt, sie gehen aber nicht in die Stromrechnung des Mieters,<br />
sondern in die allgemeinen Nebenkosten ein.<br />
Verbrauchstransparenz ist wie schon gesehen die Voraussetzung für einen verantwortungsvollen<br />
Umgang mit allen Rohstoffen. Auch beim Stromverbrauch hat ein Mieter<br />
heute noch nicht die Möglichkeit, Verbrauchswerte zeitnah einzusehen und so einen<br />
Zusammenhang zwischen Verhalten und Verbrauch zu erkennen. Bei einem Heizkörper<br />
ist es zumindest möglich zu fühlen, ob und wie warm er gerade ist. Den meisten<br />
Menschen ist der Verbrauch ihrer Elektrogeräte in den verschiedenen möglichen Stati<br />
(ausgeschaltet, Schein-aus 13 , Stand by, angeschaltet) aber völlig unbekannt. 14<br />
Die Voraussetzung für eine Transparenz sind elektronische Stromzähler und die Nutzung<br />
eines PC`s oder des Internets für die Visualisierung. Studien zufolge hat alleine die<br />
Transparenz beim Stromverbrauch eine Reduzierung von 7-10 % zur Folge. Besonders<br />
13 Schein-aus-Geräte haben einen Ausschalter, verbrauchen aber selbst in ausgeschaltetem Zustand noch<br />
Strom.<br />
14 Vergleichend siehe auch: [BUND]<br />
46
morgens und abends treten in privaten Haushalten extreme Stromspitzen auf. Da diese<br />
Spitzen bei allen Haushalten etwa zur selben Zeit auftreten, müssen in diesen Zeiten von<br />
den Versorgern Lastkraftwerke zugeschaltet werden, um die Versorgung sicherzustellen.<br />
Da aber einem Mieter im Allgemeinen nicht bekannt ist, welche seiner Geräte wie viel<br />
Strom verbrauchen, ist auch eine Reduzierung des Verbrauchs und eine Abschwächung<br />
der Stromspitzen nicht erreichbar.<br />
Um nun eine Transparenz des Stromverbrauchs für den Mieter zu ermöglichen, die ihm<br />
Rückschlüsse auf den Verbrauch einzelner Geräte erlaubt, muss entweder der Verbrauch<br />
jedes elektrischen Gerätes oder der Gesamtverbrauch in kurzen Zeitabständen dargestellt<br />
werden. Die letzte Variante ist relativ einfach mit einem elektronischen Zähler zu<br />
realisieren, von denen die meisten die Stromverbräuche in einem Intervall von 10 -15<br />
Minuten oder sogar fortlaufend aufzeichnen. Verschiedene Pilotprojekte zu diesem<br />
Thema laufen bereits in einigen Regionen Deutschlands. Da die meisten elektronischen<br />
Geräte mindestens 10 Minuten eingeschaltet sind, ist auch eine Auflösung von 15<br />
Minuten bei der Darstellung des Verbrauchs schon ausreichend, damit der Mieter aus der<br />
Visualisierung des Stromverbrauchs auf das verursachende Gerät schließen kann.<br />
In unten stehendem Bild ist die Verbrauchskurve einer Musterwohnung in Potsdam in der<br />
Zeit zwischen 9:00 und 11:30 Uhr mit einer Abstufung von 15 Minuten dargestellt. Bei<br />
dieser Pilotinstallation wurde ein Nebenzähler in der Wohnung eingebaut. Von einem in<br />
der Wohnung stehenden PC können die Verbrauchswerte der letzten 30 Tage in beliebig<br />
definierbaren Intervallen (Wochen, Tage, beliebige Zeiträume in Einheiten von 15<br />
Minuten) aus dem Zähler ausgelesen und dargestellt werden. Natürlich können die Daten<br />
auch dauerhaft auf dem PC gespeichert werden, um sich eine über Jahre gehende<br />
Datenreihe aufzubauen.<br />
Die Daten werden über Powerline Communication (PLC), d.h. Datenübertragung über das<br />
Stromkabel, vom Zähler an den PC in der Wohnung übertragen. Die Daten verlassen<br />
dabei nicht die Wohnung, das Internet wird in diesem Fall nicht benötigt.<br />
Der Mieter hat in diesem Programm – ähnlich wie bei Industriezählern - auch die Möglichkeit,<br />
sich einen Grenzwert zu setzten, der bei Überschreitung im Bild rot dargestellt wird.<br />
Wird der Grenzwert überschritten, können verschiedene Folgen daraus resultieren: Der<br />
Nutzer kann darüber per SMS oder E-Mail informiert werden, es kann aber auch ein Gerät<br />
automatisch abgeschaltet werden. Auf der rechten Seite des Bildschirms ist eine Tabelle<br />
mit den Verbrauchswerten und den daraus resultierenden Kosten zu sehen. Gerade die<br />
direkte Darstellung der Kosten für eine Gerätenutzung ermöglicht eine sofortige Rückkopplung<br />
auf das Nutzerverhalten.<br />
47
Abbildung 27: Darstellung des Stromverbrauchs über ein Energiemonitorprogramm<br />
Quelle: eigene<br />
Verschiedene europäische Länder wie Schweden und Italien haben bereits flächendeckend<br />
elektronische Zähler, meist beginnend mit Stromzählern, eingeführt oder sind<br />
dabei dies zu tun. Deutschland beginnt erst jetzt mit deren Einbau fernablesbarer,<br />
elektronischer Zähler. Zukünftig muss und wird es elektronische Zähler nicht nur für Strom<br />
sondern auch für Wärme, Gas oder Wasser geben.<br />
Wichtig im Sinne der Energieeffizienz ist, dass die Daten nicht nur den Versorgern zur<br />
Verfügung stehen, sondern zeitnah und in kleiner zeitlicher Auflösung an die Mieter<br />
weitergegeben werden, um eine Verbrauchstransparenz zu gewährleisten und damit die<br />
Basis für einen Verhaltensänderung zu schaffen.<br />
48
6. Fazit<br />
Wie in den vorangegangenen Kapiteln gesehen, hängt die Effizienz von Heizungssteuerungssystemen<br />
von verschiedensten Parametern ab. Der Parameter mit dem höchsten<br />
Einfluss ist dabei das Verhalten der Bewohner. Die von vielen Herstellern in Aussicht<br />
gestellten 25% bis 30% Einsparung werden nur erreicht, wenn der Mieter selbst sich vorbildlich<br />
verhält und das System optimal bedienen kann.<br />
Gerade die Bedienung aber stellt für viele Menschen noch ein Hindernis im Umgang mit<br />
den Systemen dar. Studien zeigen, dass die Programmierung der Systeme zu komplex<br />
ist. Systeme mit einer Zentrale verfügen zwar über eine größere Bedieneinheit, bieten<br />
aber so viele Funktionen für die Heizungssteuerung und oft noch weitere für die<br />
allgemeine Gebäudesteuerung wie Lichtsteuerung, Sicherheitsfunktionen usw., dass die<br />
Anwender nicht intuitiv damit umgehen können.<br />
Es kommt hinzu, dass es sich bei einer Heizungsteuerung nicht um ein Lifestile-Produkt<br />
handelt, mit der sich ein Nutzer gerne beschäftigt, sondern um eine Selbstverständlichkeit,<br />
bei der jeder Nutzer davon ausgeht, dass sie ohne Einarbeitung funktioniert.<br />
Gerade im Bezug auf Handhabbarkeit und Bedienbarkeit müssen Heizungssteuerungssysteme<br />
noch weiter optimiert werden.<br />
Zudem muss der Energietransparenz im Wohnumfeld zukünftig mehr Aufmerksamkeit<br />
geschenkt werden, weil nur auf diese Weise ein Umdenken der Nutzer angestoßen<br />
werden kann. Energieverbräuche auch für die Heizenergie müssen in kurzen Abständen<br />
erfasst und dem Mieter aufbereitet, einfach und informativ wieder zur Verfügung gestellt<br />
werden. Dies kann im einfachsten Fall z.B. über schriftliche, monatliche Abrechnungen<br />
bzw. Verbrauchsinformationen geschehen oder auch über elektronisch visualisierte<br />
Informationen, die als Mail verschickt werden oder über ein Portal abrufbar sind. Als<br />
Ausgabegeräte sind dabei der PC oder auch der Fernseher denkbar.<br />
Wichtig ist vor allem, dass nicht zu viele Informationen, sondern nur die für den Mieter<br />
verständlichen und nützlichen, weitergegeben werden. Unbedingt notwendig ist immer ein<br />
Überblick über die seit der letzten Information, wahlweise auch der letzten Abrechnung<br />
angefallenen Kosten für den Mieter.<br />
Heute sind die technischen Voraussetzungen gegeben, um effiziente, Energie sparende<br />
Heizungssteuerungssysteme zu installieren und auch die Transparenz der Verbräuche für<br />
den Mieter zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ist klar, dass die existierenden Systeme<br />
noch nicht die notwendige Akzeptanz bei Mietern und Vermietern finden. Das am<br />
häufigsten genannte Problem ist dabei die Handhabbarkeit und Bedienbarkeit, an zweiter<br />
Stelle liegt der Preis. Der nächste Schritt muss daher die Verbesserung der Usability der<br />
Systeme unter direkter Einbeziehung der Nutzer sein.<br />
49
7.0 Quellenverzeichnis<br />
[BUND] BUND für Umwelt und Naturschutz e.V. gefördert durch die Deutsche<br />
Bundesstiftung Umwelt; Publikation „Stromfresser Tintenstrahldrucker“;<br />
18.03.2008<br />
[FfU] Peter Hunkirchen; Sammlung von Veröffentlichungen und Artikeln „Fit für<br />
Usability“; http://www.fit-fuer-usability.de; 2004 - 2010<br />
[IWU] Institut Wohnen und Umwelt GmbH; „Gradtagszahlen in Deutschland“ (MS Excel-<br />
Anwendung); http://www.iwu.de/downloads/fachinfos/energiebilanzen; Version<br />
vom 20.01.2010<br />
[LEI] Physik-Web; Rupprecht-Gymnasium;<br />
http://www.leifiphysik.de/web_ph09/grundwissen/07spezwaerm/spezwaerme.htm<br />
[SHH] A. Gerlach, D. Kinkel; „Gutes Wohnklima, Feuchtigkeit – Lüften – Dämmen“;<br />
Druckschrift im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Senats der Freien und<br />
Hansestadt Hamburg; 2. überarbeitete Auflage Februar 2009<br />
[StBA] Statistisches Bundesamt; Energieverbrauch der privaten Haushalte / Wohnen,<br />
Mobilität, Konsum und Umwelt; Begleitmaterial zur Pressekonferenz 5.<br />
November 2008 in Berlin; Wiesbaden 2008<br />
[UBA 1] Umweltbundesamt: UBA-Hintergrundpapier „Wie private Haushalte die Umwelt<br />
nutzen – höherer Energieverbrauch trotz Effizienzsteigerung“;<br />
http://www.umweltbundesamt.de/uba-ino-presse/hintergrund/index.htm; Stand:<br />
16.04.2010<br />
[VAI] Vaisala Feuchterechner 2.2;<br />
http://www.vaisala.com/humiditycalculator/vaisala_humidity_calculator.html?lang<br />
=de<br />
[VZBV] Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.; Broschüre „Richtiges Heizen und<br />
Lüften“; 4. Auflage September 2008<br />
[wiki 1] http://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt; Stand 16.04.2010<br />
[wiki 2] http://de.wikipedia.org/wiki/U-Wert#cite_ref-<br />
.27.27Bausanierung.27.27_von_Guido_F._Moschig_5-0; Stand 16.04.2010<br />
[wiki 3] http://de.wikipedia.org/wiki/Kaltverdunstung; Stand 16.04.2010<br />
50