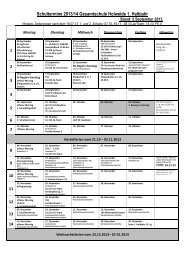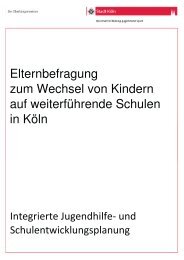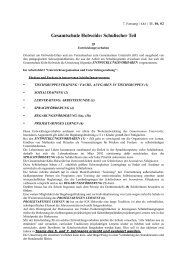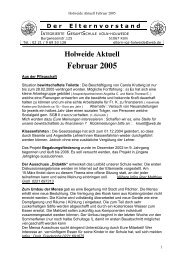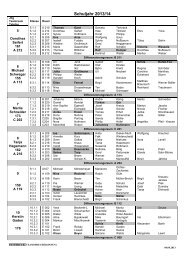Zum Memorandum - Integrierte Gesamtschule Holweide
Zum Memorandum - Integrierte Gesamtschule Holweide
Zum Memorandum - Integrierte Gesamtschule Holweide
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Memorandum</strong><br />
anlässlich der Fachtagung zum Gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I:<br />
„Im Gemeinsamen Unterricht hoch hinaus – Das macht Schule!“<br />
am 20. April 2002 in der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Gesamtschule</strong> Köln <strong>Holweide</strong><br />
Seite 1<br />
Das soziale Miteinander orientiert sich in unserer Gesellschaft in wachsendem Maße an dem, was<br />
ökonomisch gewinnbringend erscheint, auch wenn viele Fortschritte in der gesellschaftlichen<br />
Integration von Menschen mit Behinderungen erreicht worden sind. Dies erfüllt uns mit Sorge.<br />
Wir setzen uns entschieden für eine soziale und rechtsstaatliche Gesellschaftsordnung ein. Denn<br />
diese garantiert, dass Menschenwürde und Leistung nicht gegeneinander ausgespielt werden.<br />
Angesichts ihrer Angreifbarkeit und Verletzlichkeit muss die Würde des Menschen von jedem von<br />
uns täglich neu geschützt werden.<br />
Im gemeinsamen Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen bietet sich<br />
eine zentrale Chance für eine zukunftsfähige Gesellschaft, die ohne Diskriminierungen die Würde<br />
aller Menschen achtet.<br />
Gemeinsamer Unterricht unterstützt ethisch verantwortliches<br />
Handeln in der humanen Leistungsgesellschaft<br />
Gemeinsamer Unterricht ist nicht allein als besserer pädagogisch-didaktisch Ansatz zu verstehen. Er<br />
ist zentraler Bestandteil eines Lebensentwurfes, der den Menschen mit Beeinträchtigung in der Mitte<br />
und nicht in separierten Sonder- und Schutzräumen der Gesellschaft sieht. Dieses Verständnis ist<br />
auch die Triebfeder des Gleichstellungsgesetzes und der Grundgesetzergänzung in Artikel 3<br />
gewesen.<br />
Kinder und Jugendliche, die Menschen mit Beeinträchtigungen und / oder Behinderung alltäglich<br />
begegnen, entwickeln Verständnis füreinander. In Alltagssituationen vermittelt sich ihnen, was es<br />
bedeutet, ein Leben mit einer Beeinträchtigung körperlicher, geistiger oder seelischer Funktionen zu<br />
führen. Dieses Wissen von einem Leben mit Beeinträchtigung hilft ihnen, als Kinder und Jugendliche<br />
mit eigenen Schwierigkeiten besser umgehen zu können. Gleichzeitig bedeutet dies die Aufhebung<br />
eines einseitigen Leistungs- und Normalitätsdenkens. Ein solches wird nämlich weder behinderten<br />
noch nicht behinderten Menschen gerecht. Es bietet zudem die Chance in einer menschenwürdigen<br />
Leistungsgesellschaft ethisch verantwortlich zu handeln.<br />
Gemeinsamer Unterricht ist Teil eines Lebensentwurfs für Familien<br />
mit beeinträchtigten Kindern<br />
Seit über 30 Jahren werden in Deutschland vielfältige Formen des Gemeinsamen Unterrichts in<br />
Grundschulen und in weiterführenden Schulen praktiziert. Die guten Erfahrungen die Kinder und<br />
Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte im Gemeinsamen Unterricht gemacht haben, haben dazu geführt,<br />
dass im Vergleich mit den 1960-er und 1970-er Jahren in Deutschland ein neuer Lebensentwurf für<br />
viele Familien mit beeinträchtigten Kindern Gestalt angenommen hat. Dieser Lebensentwurf ist mit<br />
den folgenden Schlagworten zu beschreiben:<br />
• Leben mit Beeinträchtigungen in der Mitte der Gesellschaft<br />
• Gemeinsamkeit von Anfang an<br />
• Aufwachsen in der gesellschaftlichen Normalität – mit gleichen Rechten und Pflichten<br />
Gerade in einer Zeit, in der viel über Pränataldiagnostik und das Lebensrecht von Kindern mit<br />
Behinderung diskutiert wird, verfestigt sich bei den Eltern dieser Kinder das Gefühl, dass ihre<br />
Familien immer stärker als Außenseiter der Gesellschaft betrachtet werden. Eltern müssen das Recht<br />
haben, für ihr Kind den Gemeinsamen Unterricht in einer allgemeinen Schule zu wählen .
<strong>Memorandum</strong><br />
anlässlich der Fachtagung zum Gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I:<br />
„Im Gemeinsamen Unterricht hoch hinaus – Das macht Schule!“<br />
am 20. April 2002 in der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Gesamtschule</strong> Köln <strong>Holweide</strong><br />
Seite 2<br />
Gemeinsamer Unterricht erhält gute Noten in der PISA-Studie<br />
Die Pisa- Studie belegt, dass Schulstruktur, Lernkultur und<br />
Lernerfolg einander bedingen.<br />
Die Länder, die in der international vergleichenden Schulleistungsstudie PISA im oberen Drittel<br />
liegen, haben ein durchgehendes schulisches Integrationssystem mit einer guten<br />
Binnendifferenzierung. Sie haben eine Lernkultur, die sich an der Unterschiedlichkeit der<br />
Schülerinnen und Schüler ausrichtet.<br />
Hier zeigt sich, dass alle Schülerinnen und Schüler – ob mit oder ohne Beeinträchtigung – unter<br />
integrierenden Bedingungen insgesamt deutlich bessere Leistungen erbringen. Eine Unterrichtung<br />
lernstarker und lernschwacher Schülerinnen und Schüler in einer Lerngruppe führt dazu, dass die<br />
Leistungen jeder einzelnen Schülerin bzw. jedes einzelnen Schülers besser werden.<br />
Folglich ermöglicht der gemeinsame Unterricht auch eine erfolgreichere Förderung von sozial<br />
benachteiligten Kindern und Jugendlichen.<br />
Gemeinsamer Unterricht ist ein abgesichertes Konzept<br />
Die Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Beeinträchtigungen in<br />
gemeinsamen Lerngruppen ist eine pädagogisch abgesicherte Unterrichtsform. Eine solche<br />
gemeinsame Unterrichtung wird seit 1970 in Deutschland in vielfältigen Formen praktiziert.<br />
Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrungen und vieler pädagogischer Gutachten wissen wir, dass<br />
Gemeinsamer Unterricht in schulorganisatorischer, pädagogischer und finanzieller Hinsicht<br />
machbar ist.<br />
Der nordrhein-westfälische Schulversuch „Gemeinsamer Unterricht in der Sekundarstufe I“ läuft<br />
inzwischen im 17. Jahr. Er stellt das einzige verbindliche Angebot für Eltern beeinträchtigter bzw.<br />
behinderter Kinder dar, ihre Kinder in der Normalität einer allgemeinen Schule zieldifferent<br />
unterrichten zu lassen. Jedoch ist das Angebot zahlenmäßig so schmal, dass mehr als 98% aller<br />
infrage kommenden Schülerinnen und Schüler von dieser Unterrichtsform ausgeschlossen werden.<br />
Eine gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen bzw.<br />
Behinderungen kann auch im Rahmen einer sog. „sonderpädagogischen Fördergruppe“ an einer<br />
allgemeinen Schule verwirklicht werden. Voraussetzung dafür ist – neben einem pädagogischen<br />
Konzept – ein Bedarf von 4-8 Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.<br />
Mangels genauer gesetzlicher Bestimmungen erfolgt die Einrichtung solcher Fördergruppen aus<br />
Sicht der Eltern zufällig und willkürlich. Es ist für Eltern oft nicht zu erkennen, wo und wie sich die<br />
zuständigen Schulbehörden und Schulen bemühen, die sonderpädagogische Fördergruppe zu einem<br />
integrativen Schulangebot weiter zu entwickeln. Beim Versuch, sich trotz aller Hindernisse<br />
gleichwohl für die Einrichtung einer Fördergruppe einzusetzen, müssen die Eltern – oft völlig allein<br />
gelassen und ohne einklagbare Rechte – vor Ort in unwürdiger Weise die Klinken von Schulen und<br />
Schulverwaltung „putzen“.<br />
Im übrigen bestehen bei der Unverbindlichkeit der pädagogischen-qualitativen Vorgaben erhebliche<br />
fachliche Bedenken, inwieweit den individuellen Bedürfnissen der beeinträchtigten Kinder mit dem<br />
Konstrukt der Fördergruppe tatsächlich Rechnung getragen werden kann.<br />
Deshalb stellt diese Möglichkeit der integrativen Beschulung für viele Eltern keine wirkliche<br />
Alternative dar.
<strong>Memorandum</strong><br />
anlässlich der Fachtagung zum Gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I:<br />
„Im Gemeinsamen Unterricht hoch hinaus – Das macht Schule!“<br />
am 20. April 2002 in der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Gesamtschule</strong> Köln <strong>Holweide</strong><br />
Seite 3<br />
Kinder und Eltern werden in ihren Grundrechten verletzt, wenn sie<br />
vom Gemeinsamen Unterricht ausgeschlossen werden<br />
In Nordrhein-Westfalen besteht ein erhebliches Missverhältnis zwischen der Integrationsquote in<br />
Grundschulen und der in weiterführenden Schulen.<br />
• 10 % aller sonderpädagogisch förderbedürftigen Schülerinnen und Schüler besuchen<br />
Grundschulen.<br />
• Nur 1,65 % besuchen weiterführende Schulen.<br />
• Ergo: 98% aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf der Klassen 5-<br />
10 besuchen Sonderschulen.<br />
Diese Situation verletzt die Grundrechte der Kinder aus Art. 2 und 3 GG und die ihrer Eltern aus<br />
Art. 6 GG. Das Missverhältnis der Integrationsquoten führt dazu, dass in den allermeisten Fällen der<br />
eingeschlagene integrierte Lebensweg für Kinder mit Beeinträchtigungen abgebrochen werden<br />
muss. Dies benachteiligt die betroffenen Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und<br />
Bildungsbiographie.<br />
Das Recht und die Pflicht der Eltern aus Artikel 6 GG die Pflege und Erziehung ihrer Kinder<br />
vorrangig zu bestimmen, können diese mangels Wahlmöglichkeiten nicht ausüben. Diese Situation<br />
wird in dem von der Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen“ im<br />
November 2001 veröffentlichten Rechtsgutachten als verfassungswidriger Zustand bewertet.<br />
Kein Mensch darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden<br />
(Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG).<br />
Im Jahre 1994 ist das Benachteiligungsverbot Beeinträchtigter und Behinderter in Art. 3 des<br />
Grundgesetzes aufgenommen worden. Dieses Benachteiligungsverbot erzwingt seitdem ein<br />
Nachdenken darüber, wie Menschen mit Beeinträchtigungen in den verschiedenen Bereichen<br />
unserer Gesellschaft teilhaben können. Teilhabe an schulischer Bildung und schulischem Leben heißt<br />
Gemeinsamer Unterricht in Regelschulen. Diese Form kann und soll neben das Angebot von<br />
Sonderschulen treten.<br />
Gemeinsamer Unterricht sichert zudem aufgrund seiner Ausrichtung auf individuelles Lernen und<br />
innere Differenzierung gleiche Chancen auf Bildung für Kinder unterschiedlicher sozialer Herkunft.<br />
Gemeinsamer Unterricht wirkt sozialer Benachteiligung entgegen.<br />
Das Schulgesetz kennt kein sonderschulbedürftiges behindertes<br />
Kind<br />
Ebenfalls im Jahre 1994 hat die Kultusministerkonferenz eine neue Leitlinie für die<br />
sonderpädagogische Förderung in Schulen vereinbart. Seitdem gibt es kein sonderschulbedürftiges<br />
Kind mehr. Ein körperlich, geistig oder seelisch beeinträchtigtes Kind ist ein Kind mit<br />
sonderpädagogischem Förderbedarf. Hierdurch wird das Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten<br />
und Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt. Diese sind Grundlage für die Entscheidung über<br />
Förderschwerpunkte und Förderort. Die Kriterien für den richtigen Förderort haben sich erweitert:<br />
wohnortnahe Beschulung, Kontinuität von sozialen Erfahrungen, Elternwille und der Wille der<br />
Schülerinnen und Schüler sind wichtige Prüfsteine bei dieser Entscheidung. Die sonderpädagogische<br />
Förderung ist dabei Aufgabe aller Schulen. Es kann nicht sein, dass die Wahrnehmung dieser<br />
Aufgabe durch fehlende finanzielle, personelle und sächliche Voraussetzungen blockiert werden!
<strong>Memorandum</strong><br />
anlässlich der Fachtagung zum Gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I:<br />
„Im Gemeinsamen Unterricht hoch hinaus – Das macht Schule!“<br />
am 20. April 2002 in der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Gesamtschule</strong> Köln <strong>Holweide</strong><br />
Seite 4<br />
Forderungen an die Politikerinnen und Politiker des Landes NRW<br />
Wir fordern alle Landespolitiker auf, den Lebensentwurf des gleichberechtigten Zusammenlebens<br />
von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in der Mitte der Gesellschaft zu stärken. Mit der<br />
Ausrichtung aller Politikfelder auf dieses Ziel sollten<br />
• dem Benachteiligungsverbot Behinderter aus Art. 3 GG,<br />
• dem Leitbegriff „Teilhabe“ für Leistungen zur Unterstützung und Eingliederung Behinderter<br />
gem. SGB IX und<br />
• der Leitlinie der Kultusministerkonferenz 1994 zur Differenzierung der Formen<br />
sonderpädagogischer Förderung.<br />
Rechnung getragen werden.<br />
Für den Bereich der Schulpolitik kann auf die diesbezügliche Formulierung aus dem<br />
Koalitionsvertrag für die Periode 2000-2005 zurück gegriffen werden. Dort steht:<br />
„Mittelfristig wollen wir (innerhalb der laufenden Legislaturperiode – ergänzend zitiert durch die<br />
Verfasser) in jedem Kreis/ jeder kreisfreien Stadt zumindest ein qualifiziertes Integrationsangebot in<br />
allgemeinen Schulen der Sekundarstufe I schaffen.“ (Koalitionsvertrag S. 47)<br />
Die kommunale Schulentwicklungsplanung in den Städten und Kreisen kann schon heute<br />
Spielräume nutzen, um Maßnahmen zur sonderpädagogischen Förderung individueller auf die<br />
Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen abzustimmen. Das Nebeneinander der verschiedenen<br />
Formen von Regel- und Sonderschulen muss überdacht und neu geordnet werden. Dazu sind die<br />
Grundrechte beeinträchtigter Kinder, das Erziehungsrecht der Eltern und ihre Wünsche bzgl. des<br />
Ortes der Beschulung zur Planungsgrundlage für die Weiterentwicklung der Schullandschaft zu<br />
machen.<br />
Bei einer konstruktiven Gestaltung durch die Beteiligten sind die notwendigen personellen und<br />
sächlichen Voraussetzungen organisierbar, ohne dass die öffentlichen Kassen überfordert werden.<br />
Wichtig ist hier, dass im Rahmen einer vorausschauenden Planung angeboten und agiert und nicht,<br />
wie häufig, sehr spät re-agiert wird.<br />
In jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt muss noch in dieser<br />
Legislaturperiode mindestens ein Angebot zum gemeinsamen<br />
Unterricht in Schulen der Sekundarstufe eingerichtet werden.<br />
Wir fordern von den Landespolitikern die jeweiligen Gesetze und Verordnungen so zu verändern,<br />
dass<br />
• alle Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen gemeinsam mit solchen ohne<br />
Beeinträchtigungen allgemeine Schulen im Rahmen ihrer Pflichtschulzeit besuchen können,<br />
• Eltern das Recht erhalten, zwischen der Unterrichtung ihres beeinträchtigten Kindes in der<br />
Regelschule und in der Sonderschule auszuwählen,<br />
• die Schulen so ausgestattet werden, dass sie die notwendige sonderpädagogische Förderung und<br />
– wenn erforderlich – die lebenspraktische Unterstützung der beeinträchtigten Kinder leisten<br />
können,<br />
• Lehramtsstudierende (allgemeine Pädagogik und Sonderpädagogik) sowohl im Studium als<br />
auch im Referendariat auf den Gemeinsamen Unterricht vorbereitet werden,<br />
• die zuständige Schulaufsicht die Schulen im Gemeinsamen Unterricht durch wissenschaftlich<br />
qualifizierte Fortbildungsangebote in ihrer Entwicklung unterstützt; in diesem Zusammenhang
<strong>Memorandum</strong><br />
anlässlich der Fachtagung zum Gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I:<br />
„Im Gemeinsamen Unterricht hoch hinaus – Das macht Schule!“<br />
am 20. April 2002 in der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Gesamtschule</strong> Köln <strong>Holweide</strong><br />
Seite 5<br />
muss sichergestellt werden (ggf. im Rahmen einer neu festzulegenden<br />
Arbeitsplatzbeschreibung), dass diese verpflichtend wahrgenommen werden, und<br />
• die Evaluierung des Gemeinsamen Unterrichts als Bestandteil von Qualitätsentwicklung durch<br />
ausreichende personelle und sächliche Mittel sichergestellt wird.<br />
Dazu sind im einzelnen folgende Schritte zu gehen:<br />
Der Vorbehalt in § 7 (3) Schulpflichtgesetz, nach dem zieldifferenter gemeinsamer Unterricht in<br />
weiterführenden Schulen nur in Schulversuchen möglich ist, ist ersatzlos aufzuheben. Dazu sind die<br />
Schulversuche „Gemeinsamer Unterricht in der Sekundarstufe I“ und die Erfahrungen mit den<br />
sonderpädagogischen Fördergruppen auszuwerten.<br />
Die örtlich zuständigen Schulbehörden werden durch Ergänzung der VO-SF verpflichtet, allen<br />
Schülerinnen und Schülern, die den gemeinsamen Unterricht in der Grundschule durchlaufen ein<br />
Angebot zur Fortführung des gemeinsamen Unterrichts in einer weiterführenden Schule in der Stadt<br />
bzw. im Kreisgebiet zu machen.<br />
Die Rechte der Eltern in der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs<br />
(VO-SF) sind zu stärken, damit das Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung ihres Kindes<br />
verantwortlich zu gestalten, und das staatliche Recht zur Gestaltung des Schulwesens nicht nur<br />
formalrechtlich gleichrangig, sondern auch gleichgewichtig ausgeübt werden können. Eltern sollen<br />
im Feststellungsverfahren zwischen Regelschule und Sonderschule auswählen können.<br />
Dortmund und Köln, den 13.04.2002<br />
Herausgeber:<br />
Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen –<br />
Landesarbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen e. V.<br />
Tiefe Str. 50<br />
44145 Dortmund<br />
Auskunft erteilen: Bernd Kochanek Tel. 0231 / 46 23 13 (p) oder 0231 / 84 94-270 (d)<br />
(Landesvorsitzender)<br />
Ursula von Schönfeld Tel. 02131 / 2 32 93<br />
(Mitglied des erweiterten Vorstandes)<br />
<strong>Integrierte</strong> <strong>Gesamtschule</strong> <strong>Holweide</strong><br />
Burgwiesenstr. 125<br />
51067 Köln-<strong>Holweide</strong><br />
Auskunft erteilen:<br />
Herr Weigelt, Schulleiter Tel.: 0221 / 9 69 53-0 (d)<br />
(Schulleiter)<br />
Ulrike Niehues<br />
(Lehrerin)<br />
Tel.: 0221 / 9 69 53-120 (d) oder 0221 / 86 28 95 (p)