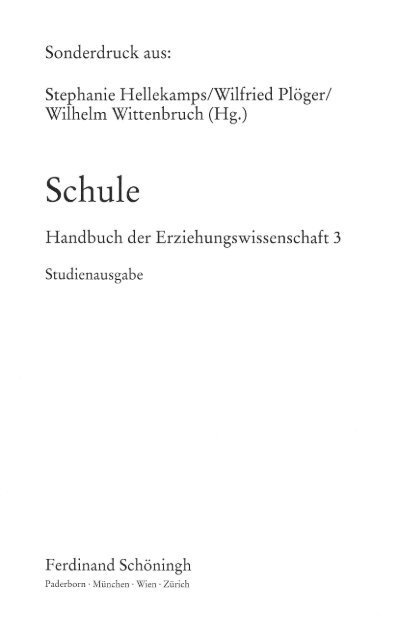Schule - Klaudia-schultheis.de
Schule - Klaudia-schultheis.de
Schule - Klaudia-schultheis.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Son<strong>de</strong>rdruck aus:<br />
Stephanie Hellekamps/\6lfried Plöger/<br />
\X/ilhelm Wittenbruch (H g.)<br />
<strong>Schule</strong><br />
Handbuch <strong>de</strong>r Erziehungswissenschaft 3<br />
Studienausgabe<br />
Ferdinand Schöningh<br />
Pa<strong>de</strong>rborn' München' \Wien' Zirich
KLAUDIA ScnulranTs<br />
Kapitel 4: Rhythmisierung und Ritualisierung im Schulalltag<br />
I. Einleitung: Zur aktuellen Diskussion und theoretischen Rahmung<br />
<strong>de</strong>r Begriffe<br />
Im Kontext von <strong>Schule</strong> beziehen sich die Begriffe <strong>de</strong>r Rhythmisierung und Ritualisierung<br />
auf die Zeitstruktur <strong>de</strong>s Lehren und Lemens. Die Organisation von Unterricht<br />
als zentrale Aufgabe <strong>de</strong>r <strong>Schule</strong> hat neben <strong>de</strong>r inhaltlichen, sozialen und räumlichen<br />
auch eine zeitliche Dimension, insofem <strong>de</strong>r Unterricht auch in seinem zeitlichen<br />
Ablauf geplant und gestaltet wer<strong>de</strong>n muss. Im Zusammenhang <strong>de</strong>r gegenwärtig<br />
neu entflammten Diskussion über die Ganztagsschule nehmen die bei<strong>de</strong>n Begriffe<br />
eine zentrale Rolle ein, da durch die erweiterle Unterrichtszeit <strong>Schule</strong>n auch<br />
Konzeptionen flir die zeitliche Choreographie von Schultag und Schulwoche entwickeln<br />
müssen.<br />
Wenn hier von <strong>de</strong>r Rhythmisierung <strong>de</strong>s Schultages die Re<strong>de</strong> ist, so ist zunächst die<br />
,,äufJere" Zeitstruktur <strong>de</strong>r <strong>Schule</strong> gemeint (f.). Die äußere Zeitstruktur ist dadurch<br />
bestimmt, dass es Schultage und Ferienzeiten gibt, Unterichtszeit, aber auch Freizeit,<br />
Schulstun<strong>de</strong>n und Pausen. Es gibt Halbtags- und Ganztagsschulen, Abend- und<br />
Sommerschulen, aber auch lntemate, in <strong>de</strong>nen die Schülerinnen und Schüler leben,<br />
o<strong>de</strong>r Volkshochschulen und Nachhilfeschulen, bei <strong>de</strong>nen man <strong>de</strong>n Unterricht nur<br />
stun<strong>de</strong>nweise besucht. Dies alles umfasst die Rahmenbedingungen, in <strong>de</strong>nen Unterricht<br />
zeitlich zu organisieren ist, damit die <strong>Schule</strong> als Institution ihre Aufgabe <strong>de</strong>r<br />
Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und Motiven erfüllen kann. Daneben gibt es<br />
auch eine ,,innere " Zeitstruktur <strong>de</strong>r <strong>Schule</strong>. So hat <strong>de</strong>r Unterricht selbst einen zeitlichen<br />
Verlauf und Rhythmus, <strong>de</strong>r auf das Lemen <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler bezogen<br />
ist. Traditionell wird dafür in <strong>de</strong>r Didaktik <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>r Artikulcttion verwen<strong>de</strong>t<br />
(lll.). Auch <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>r Ritualisierung lässt sich in <strong>de</strong>r aktuellen Diskussion<br />
über die äußere zeitliche Strukturierung <strong>de</strong>r <strong>Schule</strong> verorlen und wird im Zusammenhang<br />
<strong>de</strong>r zeitlichen Wie<strong>de</strong>rkehr bestimmter Abläufe, Ereignisse o<strong>de</strong>r auch<br />
Feste und Feiem im Wochen- o<strong>de</strong>r Jahresverlauf verwen<strong>de</strong>t. Ritualisierung wird im<br />
Kontext von <strong>Schule</strong> aber auch als Form <strong>de</strong>r Lernhilfe, die <strong>de</strong>r Ausbildung von Geu'ohnheiten<br />
dient, verstan<strong>de</strong>n (lV). Dabei wur<strong>de</strong>n Rituale und Ritualisierungen als<br />
leibnahe Form <strong>de</strong>r Erziehung in <strong>de</strong>r Pädagogik in <strong>de</strong>r Vergangenheit durchaus ambivalent<br />
gesehen und wer<strong>de</strong>n heute auch hinsichtlich ihrer mitgängigen Bildungsri'irkung<br />
untersucht (V).<br />
Der Beitrag greift im Folgen<strong>de</strong>n die genannten Aspekte auf und versucht, die Begriff-e<br />
<strong>de</strong>r Rhythmisierung und Ritualisierung in einen umfassen<strong>de</strong>ren pädagogischen<br />
Kontext zu stellen, um <strong>de</strong>n Anschluss an die pädagogische Theoriebildung<br />
und Tradition <strong>de</strong>utlich zu machen.
s60<br />
Teil lll: <strong>Schule</strong> als Lebensraum<br />
II. Rhythruisierung als zeitliche Strukturierung <strong>de</strong>s Schwltages<br />
Wenn in <strong>de</strong>r schulpädagogischen Diskussion von Rhythmisierung gesprochen wird,<br />
dann ist in erster Linie die zeitliche Strukturierung <strong>de</strong>s Schultages gemeint. Der<br />
Schultag soll so geplant wer<strong>de</strong>n, dass er in seinem Gesamtverlauf einen Wechsel<br />
von Phasen <strong>de</strong>r Anspannung und Erholung aufiveist: ,,'Rhythmisierung' be<strong>de</strong>utet,<br />
die Zeitplanung zunächst von <strong>de</strong>r Fächerglie<strong>de</strong>rung abzukoppeln und <strong>de</strong>n Schultag<br />
primär in wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong> Phasen von Anspannung und Entspannung zu glie<strong>de</strong>m,<br />
und zwar in Phasen von variabler Dauer, in die dann die gemeinsamen und die individuellen,<br />
die fachlichen und die fücherübergreifen<strong>de</strong>n Aktivitäten <strong>de</strong>r Schüler je<br />
nach <strong>de</strong>n konkreten (inhaltlichen) Bedürfnissen <strong>de</strong>s Tages und <strong>de</strong>r Klasse flexibel<br />
eingefügt wer<strong>de</strong>n können" QrJeumann/Ramseger 20013, S. 26).<br />
Das Bemühen um eine Rhythmisierung <strong>de</strong>s Tagesablaufs in <strong>de</strong>r <strong>Schule</strong> reicht bis<br />
zu <strong>de</strong>n reformpädagogischen Ansätzen am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. und zu Beginn <strong>de</strong>s 20.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rls zurück und war stets Ausdruck <strong>de</strong>s Strebens nach einer kindgemäßen<br />
<strong>Schule</strong>. Kaum empirisch erforscht ist allerdings, worin eine kindgemäße schulische<br />
Zeitstruktur besteht. So weiß man bisher wenig über entwicklungsbedingte biologische<br />
Rhythmen im Kin<strong>de</strong>s- und Jugendalter. Jedoch gilt als gesicheft, dass die Leistungsbereitschaft<br />
einem bestimmten biologischen Tagesrhythmus unterliegt und<br />
damit die Leistungsftihigkeit von <strong>de</strong>r Tageszeit abhängt. Studien zeigen, dass Leistungsabfall,<br />
eine generell niedrige Leistungsbereitschaft o<strong>de</strong>r ein übermäßig hoher<br />
Energieaufivand vorprogrammierl sind, wenn anhaltend gegen endogene Rhythmen<br />
verstoßen wird (vgl. Siepmann/Salzberg-Ludwig 2001).<br />
Eine begriffliche Differenzierung frihrl Karlheinz Burk (2005, S. 68) ein, in<strong>de</strong>m<br />
er zwischen ,,Takt" und ,,Rhythmisierung" unterschei<strong>de</strong>t. So bezieht sich <strong>de</strong>r ,,Takt"<br />
auf die an einer <strong>Schule</strong> einheitlich festgelegte zeitliche Strukturierung, z.B. die<br />
Dauer und die Abfolge von Blöcken und Pausen. Das betrifft u.a. die öffnungszeiten<br />
<strong>de</strong>r <strong>Schule</strong>, <strong>de</strong>n Zeitpunkt fiir das gemeinsame Frühstück o<strong>de</strong>r das Mittagessen,<br />
aber auch die Phasen, in <strong>de</strong>nen jahrgangsübergreifend o<strong>de</strong>r in Arbeitsgemeinschaften<br />
gelemt wird. Mit ,,Rhythmisierung" bezeichnet Burk die inteme<br />
Lernstruktur innerhalb <strong>de</strong>r durch <strong>de</strong>n Takt vorgegebenen Unterrichtsblöcke, die von<br />
<strong>de</strong>n Lehren<strong>de</strong>n bzw. <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r jeweiligen Lemgruppe gesteuert wird. Hier<br />
differenzierl er zwischen zwei Ebenen. Auf <strong>de</strong>r ersten Ebene , <strong>de</strong>r ciuJ3eren Rhythmisierung,<br />
gehe es um <strong>de</strong>n Wechsel <strong>de</strong>r Lehr- und Lemformen, z.B. zwischen Wochenplanunterricht,<br />
Stationenlernen und frontalem Lehrgang. Unter <strong>de</strong>r inneren<br />
Rhythmisierung als zweiter Ebene, versteht Burk hingegen die Steuerung <strong>de</strong>r Lemprozesse<br />
durch je<strong>de</strong>s Kind selbst, z.B. die Weisen, wie es Lernstrategien entwickelt,<br />
Lernhilfen wahrnimmt, Kontakte zu an<strong>de</strong>ren Kin<strong>de</strong>m aufnimmt o<strong>de</strong>r Entspannungsphasen<br />
bewusst gestaltet.<br />
Wie eingangs schon erwähnt, hat die Einführung von Ganztagsschulen (vgl. hierzu<br />
<strong>de</strong>n Beitrag zu,,Ganztagsschule" in diesem Band) zu einer neuen Diskussion ü-<br />
ber die Rhythmisierung <strong>de</strong>s schulischen Lernens geführ1, weil hier einer pädagogisch<br />
durchdachten Zeitstruktur beson<strong>de</strong>re Be<strong>de</strong>utung zukommt. Die erweiterle Unterrichtszeit<br />
insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r gebun<strong>de</strong>nen Form <strong>de</strong>r Ganztagsschule macht es<br />
notwendig, dass Phasen intensiver StofArermittlung und -aneignung durch entspannen<strong>de</strong><br />
o<strong>de</strong>r durch eine an<strong>de</strong>re At1 von Konzentration verlangen<strong>de</strong> musische o<strong>de</strong>r
III. 2. Kap. 4: Rhythn-risierung und Ritualisierung im Schulalltag<br />
561<br />
spofiliche Aktivitäten unterbrochen wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r dass Lernphasen, die nicht so<br />
betreuungsintensiv sind, eher in <strong>de</strong>n Nachmittag verlagert wer<strong>de</strong>n. Die Stun<strong>de</strong>nplangestaltungin<br />
Ganztagsschulen muss noch stärker als in <strong>de</strong>r Halbtagsschule <strong>de</strong>n<br />
leiblichen Bedürfnissen <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler Rechnung tragen und Zeiten<br />
für Bewegung, zLtm Ausruhen o<strong>de</strong>r Austoben, zum Essen, aber auch für selbständige<br />
Arbeit und Übung sowie für spielerische, sporlliche o<strong>de</strong>r kulturelle Aktivitäten,<br />
für För<strong>de</strong>rangebote o<strong>de</strong>r Neigungskurse einplanen.<br />
Die Rhythmisierung <strong>de</strong>s Schultags soll aber nicht nur eine Balance zwischen unterschiedlichen<br />
Aktivitäten bzw. Formen <strong>de</strong>r Arbeit und Anstrengung ermöglichen,<br />
son<strong>de</strong>rn auch größere zeitliche Einheiten flir Aktivitäten in und außerhalb <strong>de</strong>r <strong>Schule</strong><br />
schaffen, wie das folgen<strong>de</strong> Beispiel <strong>de</strong>utlich macht: ,,Der Schultag beginnt mit<br />
einem offenen Anfang von 8 bis 9 Uhr. Am Vormittag arbeiten die Schüler dann in<br />
Zeiteinheiten von min<strong>de</strong>stens 1,5 Stun<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Lembüros, Werkstätten o<strong>de</strong>r in<br />
Projekten. Unterbrochen wird diese Arbeit durch eine Frühstückspause. Mittags<br />
umfasst die Pause eine Stun<strong>de</strong>, in <strong>de</strong>r die Schüler essen und verschie<strong>de</strong>ne Offene<br />
Angebote wahmehmen können wie Vorlesen, Lesen o<strong>de</strong>r Stöbern in <strong>de</strong>r Schulbibliothek,<br />
Entspannungsgymnastik, Ausruhen etc. An vier Wochentagen folgen bis<br />
zum Schulschluss danach nochmals zwei Doppelstun<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>nen sie in <strong>de</strong>n Lernbüros,<br />
Werkstätten o<strong>de</strong>r Projekten arbeiten. ln einem Wochenabschluss am Freitag<br />
präsentieren Schüler Arbeitsergebnisse, führen Chor- o<strong>de</strong>r Orchesterstücke auf etc."<br />
(Kolbe/Rabenstein/Reh 2006, S. I 7).<br />
Die Diskussionen über die Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Zeitstrukturierung bei Ganztagsschulen<br />
zeigen, dass je<strong>de</strong> <strong>Schule</strong> gemäß ihrer pädagogischen Ztelsetzungen ihren<br />
ganz eigenen Rhythmus hinsichtlich <strong>de</strong>r zeitlichen Organisation von Unterricht,<br />
Pausen, Freizeit und die außerunterrichtlichen Angebote <strong>de</strong>s Unterrichtstages, <strong>de</strong>r<br />
Schulwoche, aber auch <strong>de</strong>s gesamten Schuljahres ausbil<strong>de</strong>n muss. An<strong>de</strong>rerseits<br />
hängen Rhyhmisierungskonzepte auch eng mit <strong>de</strong>r Entscheidung fi.ir eine bestimmte<br />
Unterrichtskonzeption zusammen. Die bisher üblichen und tradierlen Zeitraster<br />
und schulischen Vorgaben (2.8. Stun<strong>de</strong>ntafeln, 45-Minuten-Stun<strong>de</strong>n, Altershomogenität,<br />
Lehrpläne) wer<strong>de</strong>n beim Einsatz wechseln<strong>de</strong>r Unterrichtsformen wie Wochenplanarbeit,<br />
Freiarbeit o<strong>de</strong>r Lehrgangsunterricht als dysfunktional erfahren. Das<br />
gilt auch fiir handlungsorientiefte Lemformen, Projektarbeit, Stationentraining o<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>n Einbezug außerschulischer Lemorle. Es wird erfor<strong>de</strong>rlich, starre Zeitmuster zu<br />
flexibilisieren und die Unterrichtszeit durch einen gezielten Wechsel von Lemphasen,<br />
die in ihrer Länge und Qualität unterschiedlich sind, zu rhythmisieren. Eine<br />
flexible Zeiteinteilung ermöglicht es, längere Unterrichtseinheiten durchzuführen,<br />
die auch <strong>de</strong>n Schülerinnen und Schülem größere Handlungsspielräume geben, ihre<br />
Lernzeit eigenverantworllich einzuteilen und ihren Lern- und Arbeitsrhythmus mit<br />
zu bestimmen. So kann bei <strong>de</strong>n Schülerinnen und Schülem die Fähigkeit einer bewussten<br />
Zeitplanung angebahnt wer<strong>de</strong>n, und es besteht die Möglichkeit, individuelle<br />
Lerntempi und Lernstrategien zu unterstützen. Mit <strong>de</strong>m Verweis auf die Lernprozesse<br />
<strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler ist bereits die innere Zeitstruktur <strong>de</strong>s Unterrichts<br />
angesprochen.
562 Teil III: <strong>Schule</strong> als Lebensraum<br />
III. Artikulcttion als Rhythmisierung <strong>de</strong>s schulischen Lernens durch<br />
Unterricht<br />
Die Artikulation <strong>de</strong>s Unterrichts bestimmt, wie die Inhalte, die gelernt wer<strong>de</strong>n sollen,<br />
die Lemprozesse <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler sowie das Tun und Verhalten<br />
<strong>de</strong>s Lehren<strong>de</strong>n in zeitlicher Hinsicht integrierl wer<strong>de</strong>n (vgl. Prange 1983, S. 92ff.).<br />
Das betrifft die Ordnung und Reihenfolge, wie etwas präsentierl wird, die Metho<strong>de</strong>n<br />
und Forrrlen <strong>de</strong>s Lernens und Zeigens, die Wie<strong>de</strong>rholung und Übung von bereits<br />
Gelerntem zur Sicherung o<strong>de</strong>r auch die Anwendung von bereits Gewusstem<br />
und Gekonntem auf neue Zusammenhänge. Das be<strong>de</strong>utet, dass die Arlikulation <strong>de</strong>s<br />
Unterrichts als seine Form in <strong>de</strong>r Zeit einerseits mit <strong>de</strong>m Lemgegenstand, aber an<strong>de</strong>rseits<br />
auch mit <strong>de</strong>n spezifischen Lernbedingungen <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler<br />
abgestimmt und vermittelt wer<strong>de</strong>n muss. Dies erfor<strong>de</strong>rl nicht nur Wissen über die<br />
Sachstruktur <strong>de</strong>s Lerngegenstan<strong>de</strong>s, son<strong>de</strong>m auch eine Vorstellung davon, wie sich<br />
das Lemen <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler vollzieht.<br />
Dass Lemprozesse einem Rhl.thmus folgen, <strong>de</strong>n das Unterrichten aufgreifen<br />
muss, hat bereits Johann Friedrich Herbart (1776-1841) <strong>de</strong>utlich gemacht (vgl. zu<br />
Herbart und seinen Schülern die Beiträge zur ,,Unterrichtstheorie" von Hellekamps,<br />
Wittenbruch u.a. in diesem Band.;. Herbarl unterschei<strong>de</strong>t in seiner Allgemeinen Pädagogik<br />
von 1806 (vgl. Ders. 1983, S. 69ff.) zwischen zwei verschie<strong>de</strong>nen Lemhaltungen:<br />
Vorstellungen bil<strong>de</strong>n sich zunächst, in<strong>de</strong>m man sich in Einzelnes gründlich<br />
vertieft. Hier gibt es die ruhen<strong>de</strong> Verliefung, bei <strong>de</strong>r man die einzelnen Dinge klar<br />
vor sich sieht. Es gibt aber auch die fofischreiten<strong>de</strong> Vertiefung, die einzelne Vorstellungen<br />
miteinan<strong>de</strong>r assoziiefi. Das Vertiefen in E,inzelnes und seine Zusammenhänge<br />
geht schließlich über in eine reflektieren<strong>de</strong> Auseinan<strong>de</strong>rsetzung: die Besinnung.<br />
Dabei unterschei<strong>de</strong>t Herbart die ruhen<strong>de</strong> Besinnung, die Ordnungen schafft<br />
(System) und die forlschreiten<strong>de</strong> Besinnung als Metho<strong>de</strong>, die weiterführt zu Neuem,<br />
zum Vergleich und zur Anwendung. Den damit verbun<strong>de</strong>nen Lernprozess for<strong>de</strong>rl<br />
und unterstützt <strong>de</strong>r Lehren<strong>de</strong>, in<strong>de</strong>m er vielseitige Interessen beim Schüler<br />
weckt und so zur Bildung seines Gedankenkreises beitragt. Dieser Ansatz ist, sieht<br />
man einmal von <strong>de</strong>n zeitgenössischen psychologischen Grundlagen ab, vergleichsweise<br />
mo<strong>de</strong>m gedacht, nichtzüetzl weil er auf einen individualisiefien Unter:richt<br />
und damit eine individuelle Lemför<strong>de</strong>rung abhebt. Die Herbaftianer Tuiskon Zrller,<br />
Karl Volkmar Stoy und Wilhelm Rein entwickelten aus Herbarls offenem Ansatz<br />
die so genannte Formalstufentheorie, die einen genau abzuhalten<strong>de</strong>n Ablauf einer<br />
Unterrichtslektion vorgab. So umfasste Reins Schema die aufeinan<strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n<br />
Stufen <strong>de</strong>r Vorbereitung, Darbietung, Verknüpfung, Zusammenfassung und Anwendung.<br />
Dies führte einerseits zu einem stark lehrergesteuefien und gesinnungsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Unteruicht, ermöglichte aber auch die Lehrbarkeit <strong>de</strong>s Unterrichtens und<br />
legte damit <strong>de</strong>n Grund für die wissenschaftliche Beschäftigung mit <strong>de</strong>r Didaktik. In<br />
<strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Didaktik haben sich <strong>de</strong>shalb vor allem formale Stufen- und Phasenschemata<br />
herausgebil<strong>de</strong>t, die z.T. noch heute die Ausbildung in <strong>de</strong>n Studienseminaren<br />
prägen und oft wie Unterrichtsrezepte gehandhabt wer<strong>de</strong>n.<br />
Mit neuen Vorstellungen und Erkenntnissen über das Lernen verän<strong>de</strong>m sich auch<br />
die Auffassungen darüber, wie Unterricht zu arlikulieren ist. So wird ein Verständ-
lll. 2. Kap. 4: Rhythmisierung und Ritualisierung im Schulalltag<br />
563<br />
nis <strong>de</strong>s Lernens als autopoietischer Konstruktionsprozess <strong>de</strong>r Selbsttätigkeit, <strong>de</strong>m<br />
Fin<strong>de</strong>n eigener Lösungswege und Antwofien und <strong>de</strong>m kommunikativen Abgleich<br />
<strong>de</strong>r Lernerfahrungen Raum geben und <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>r Lemumgebung als Arrangement<br />
von Lernmöglichkeiten großer Wert beigemessen. Versteht man Lemen jedoch<br />
als Aneignung systematischen, fachlich-materialen und formalen Wissens,<br />
wird man um sicher zu gehen, dass genau das gelemt wird, was man möchte<br />
Lernziele, Lemwege und Lemmetho<strong>de</strong>n durch die Lehren<strong>de</strong>n vorgeben und <strong>de</strong>n<br />
Lemen<strong>de</strong>n Entscheidungen über die eigene Lernsteuerung abnehmen obwohl<br />
auch hier in <strong>de</strong>r Selbststeuerung <strong>de</strong>s Lernens letztlich ein langfristiges funktionales<br />
Ziel gesehen wird.<br />
Nach wie vor kommt jedoch <strong>de</strong>m frontalen, fragend-entwickeln<strong>de</strong>n Klassenunterricht<br />
immer noch eine vor:rangsstellung zu (vgl. hierzu <strong>de</strong>n Beitrag von vorsmann<br />
in diesem Band). Der Grund liegt darin, dass er Unterricht planbar und weitgehend<br />
vorhersehbar macht, weil er in seinen Zeitvorgaben klar ist und sich sein Erfolg<br />
in gewisser Weise überprüfen lässt. Dadurch erscheint lehrerzentrierter Unterricht<br />
in zeitlicher Hinsicht zunächst ökonomischer als ein Unterricht, <strong>de</strong>r sich <strong>de</strong>n<br />
Bewegungen <strong>de</strong>r Lernen<strong>de</strong>n öffnet und eigene Ansätze und umwege o<strong>de</strong>r Sackgassen<br />
im Lernprozess zulässt und die Initiierung, Begleitung, Diagnose und unterstützung<br />
von Lernprozessen in <strong>de</strong>n vor<strong>de</strong>rgrund rückt. Gleich welche Afiikulationsformen<br />
<strong>de</strong>s Unterrichts gewählt wer<strong>de</strong>n: Schulisches Lernen bleibt immer organisierles<br />
und komprimierles Lemen, weil es im vergleich dazu, wie Kin<strong>de</strong>r im<br />
Umgang und Alltagsleben Erfahrungen machen und lemen, einen Zeitgewinn bringen<br />
muss und weil wir in <strong>de</strong>r Regel auch genaue vorstellungen davon haben, was in<br />
<strong>de</strong>r <strong>Schule</strong> in einer festgelegten Zeit gelemI wer<strong>de</strong>n soll. So bedürfen auch offene<br />
unterrichtsfbrmen <strong>de</strong>r Arlikulation <strong>de</strong>s Lemens und Lehrens, weil das Lemen in<br />
<strong>de</strong>r <strong>Schule</strong> immer in eine bestimmte Form und damit auch in eine Zeitstruktur -<br />
gebracht wer<strong>de</strong>n muss (vgl. hierzu <strong>de</strong>n Beitrag von Frick in diesem Band).<br />
IV. Ritualisierung von Lernablciufen<br />
Lehrerinnen und Lehrer wissen um die strukturieren<strong>de</strong> Be<strong>de</strong>utung immer wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong>r<br />
Abläufe und Gewohnheiten im Schulalltag. Sie setzen sie in ihrem Unterricht<br />
haufig und bewusst ein, weil sie sich bewährt haben und <strong>de</strong>m Lehren und Lernen<br />
för<strong>de</strong>rlich sind. Von <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>s Unterrichtsbeginns in <strong>de</strong>r Grundschule<br />
mit <strong>de</strong>r Begrüßung und <strong>de</strong>m Morgenkreis, <strong>de</strong>m Feiem von Schülergebufistagen, <strong>de</strong>r<br />
,,stillen Minute" o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r wöchentlichen Märchenstun<strong>de</strong> bis hin zu Sportfesten und<br />
Schulfeiern fin<strong>de</strong>n sich vielftiltige Handlungsabläufe und Situationsmuster, die sich<br />
immer wie<strong>de</strong>rholen und an die sich die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer<br />
Schulzeit gewöhnen. Solche <strong>de</strong>n Schulalltag prägen<strong>de</strong>n und rhythmisieren<strong>de</strong>n<br />
Strukturen sind in <strong>de</strong>r Regel gemeint, wenn von schulischen ,,Ritualen" die Re<strong>de</strong><br />
ist. Natürlich gibt es an <strong>Schule</strong>n auch immer noch fragwürdige Rituale wie das tägliche<br />
Abfragen vor <strong>de</strong>r Klasse o<strong>de</strong>r die Rückgabe von Klassenarbeiten absteigend<br />
nach Noten.<br />
Rituale erfahren gegenwärtig in <strong>de</strong>r Pädagogik wie<strong>de</strong>r eine <strong>de</strong>utliche Aufmerksamkeit<br />
und Aufwerlung. Sie sind Thema von Erziehungsratgebem, aber auch von
564 Teil III: <strong>Schule</strong> als Lebensraum<br />
grundschulpädagogischen Publikationen, die sich mit <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung von Ritualen<br />
ftir die Pädagogik und die Lementwicklung <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s befassen (vgl. Bock 2001;<br />
Schultheis 1998b). Gera<strong>de</strong> Buchtitel wie z.B. ,,1000 Rituale flir die Grundschule"<br />
(Kaiser 2000) lassen allerdings vermuten, dass <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s Rituals überstrapaziert<br />
wird. In <strong>de</strong>r Tat wird gera<strong>de</strong> in schulpädagogischen Kontexten unter Ritual<br />
und Ritualisierung all das subsumierl, was Aktivitäten und Interaktionen einen regelmäßigen<br />
Charakter o<strong>de</strong>r bestimmte wie<strong>de</strong>rholbare Strukturen verleiht. Das flihrt<br />
dazu, dass die Begriffe verschwimmen und nicht mehr klar ist, was eigentlich <strong>de</strong>r<br />
Unterschied von einem Ritual o<strong>de</strong>r ritualisiertem Verhalten zu Regeln, Gewohnheiten,<br />
Bräuchen o<strong>de</strong>r gar <strong>de</strong>r Übung ist. Deutliche Unterscheidungen sind hier aber<br />
notwendig, da Rituale gera<strong>de</strong> aus pädagogischer Sicht ambivalent und kritisch zu<br />
betrachten sind (vgl. z.B. die füihen Studien von Wellendorf 19742).<br />
Im Schulalltag vennitteln ritualisierle Abläufe <strong>de</strong>n Schülerinnen und Schülem<br />
Zuverlässigkeit und ennöglichen Verhaltenssicherheit. Sie schaffen einen Rahmen<br />
für <strong>de</strong>n Umgang miteinan<strong>de</strong>r, in<strong>de</strong>m sie sinnvolle Verhaltens- und Handlungsmuster<br />
vorgeben. Damit lassen sich die sozialen Beziehungen ordnen und Konflikte<br />
reduzieren. Gera<strong>de</strong> in offenen Unterrichtsformen können Rituale entlasten und zu<br />
einer fruchtbaren Lernatmosphäre beitragen. Ritualisierl ablaufen<strong>de</strong> Anfangs- und<br />
Schlussphasen im Wochen- o<strong>de</strong>r Tagesverlauf, aber auch in selbst zu organisieren<strong>de</strong>n<br />
Freiarbeitsphasen helfen, das eigene Lemen zu strukturieren und sinnvolle<br />
Lemgewohnheiten auszubil<strong>de</strong>n.<br />
V. Die pädagogische Ambivqlenz von Ritualen<br />
Die pädagogische Ambivalenz von Ritualen liegt darin begrün<strong>de</strong>t, dass sie auf die<br />
Gefühle und das Erleben gerichtet sind. Das, was im rituellen Tun geschieht, ist<br />
kognitiv nur schwer einholbar. Die Situation wird von <strong>de</strong>n Beteiligten erlebt und<br />
mit vollzogen, aber nicht reflexiv o<strong>de</strong>r rational bearbeitet. Rituale bleiben <strong>de</strong>m Erlebnisbereich<br />
verhaftet und beziehen sich auf die leibliche Dimension <strong>de</strong>s Lemens<br />
(vgl. Schultheis 1 998a, 2004).<br />
Darin liegt begrtin<strong>de</strong>t, warum Rituale in <strong>de</strong>r Pädagogik keineswegs immer so positiv<br />
gesehen wur<strong>de</strong>n, wie es das gegenwär1ige lnteresse vermuten lässt. In <strong>de</strong>n späten<br />
1960er und <strong>de</strong>n 19l\er Jahren hatte sich sogar eine äußerst kritische Einstellung<br />
zu Ritualen in <strong>Schule</strong> und Unterricht herausgebil<strong>de</strong>t. Sie stand in Zusammenhang<br />
mit <strong>de</strong>r Diskussion über <strong>de</strong>n,,heimlichen Lehrplan" in <strong>de</strong>r <strong>Schule</strong>. Rituale galten als<br />
Relikt einer konservativen und autoritären Pädagogik, die die Schülerinnen und<br />
Schüler zur Anpassung nötigte, sie disziplinierte und manipulierle. Die <strong>Schule</strong> wür<strong>de</strong><br />
durch Rituale ,,heimlich", d.h. indirekt und unbemerkt Zwänge ausüben, gegen<br />
die man sich nicht wehren könne. Dies bezog sich beson<strong>de</strong>rs auf die Durchsetzung<br />
von Leistungsnornen in <strong>de</strong>r <strong>Schule</strong>. Statt zur Selbstbestimmung zu erziehen, wür<strong>de</strong><br />
die <strong>Schule</strong> mit Hilfe von Ritualen das Verhalten <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler steuern<br />
und damit nicht emanzipierte, son<strong>de</strong>rn unkritische Menschen hervorbringen. Im<br />
Hintergrund stand dabei die Erfahrung <strong>de</strong>s Nationalsozialismus, <strong>de</strong>r die beson<strong>de</strong>re<br />
Wirkung von Ritualen flir seine i<strong>de</strong>ologischen Zwecke eingesetzt hatte. Um die<br />
Schülerinnen und Schüler emotional zu vereinnahmen, wur<strong>de</strong> das Schulleben durch
III. 2. Kap. 4: Rhythmisierung und Ritualisierung im Schulalltag 565<br />
Rituale wie <strong>de</strong>n morgendlichen Fahnenappell o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Hitlergruß, <strong>de</strong>r ftir die <strong>Schule</strong>n<br />
verpflichtend war, aber auch Feiern, Aufmärsche, das Tragen von Uniformen<br />
u.v.m. bestimmt.<br />
Gera<strong>de</strong> Kin<strong>de</strong>r sind aber noch stark durch einen erlebnishaften und leiblichen<br />
Zugang zur Welt geprägt und lemen erst langsam, eine objektive, beobachten<strong>de</strong><br />
Haltung aufzubauen, die die Voraussetzung dafr.ir ist, sich kritisch und reflexiv mit<br />
etwas auseinan<strong>de</strong>rsetzen zu können. Für <strong>de</strong>n pädagogischen Umgang mit Ritualisierungen<br />
und vorgegebenen Zeitstrukturen in <strong>de</strong>r <strong>Schule</strong> gilt <strong>de</strong>shalb, dass unbedingt<br />
auch die kognitive Auseinan<strong>de</strong>rsetzung damit ermöglicht wer<strong>de</strong>n muss. Ritualisierungen<br />
und Rhythmisierungen sollten von <strong>de</strong>n Schülerinnen auch thematisiert,<br />
hinterfragt und mitgestaltet wer<strong>de</strong>n dürfen, <strong>de</strong>nn ihre leiblich-prägen<strong>de</strong>n Wirkungen<br />
lassen sich nur über reflexive Prozesse bewusst machen, um Missbrauch und Manipulation<br />
in <strong>de</strong>r Erziehung zu verhin<strong>de</strong>m (vgl. Schultheis 2007).<br />
Mit <strong>de</strong>r Entwicklung ethnographischer Forschung in <strong>de</strong>r Erziehungswissenschaft<br />
ist in jüngster Zeit auch ein neues lnteresse an <strong>de</strong>r Erforschung rituellen Han<strong>de</strong>lns<br />
im schulischen Alltag entstan<strong>de</strong>n (vgl. z.B. Wulf u.a. 2004). ln <strong>de</strong>n Blick kommt<br />
dabei die Bildungswirkung und Bildungsbe<strong>de</strong>utung von Ritualen und Ritualisierungen:<br />
,,Bildung fin<strong>de</strong>t in Ritualen dadurch statt, dass Kin<strong>de</strong>r, Jugendliche und<br />
Erwachsene unter Bezug auf kollektive, sich in <strong>de</strong>n rituellen Arrangements ausdnicken<strong>de</strong><br />
Bil<strong>de</strong>r und Handlungen geformt wer<strong>de</strong>n und ihrerseits an <strong>de</strong>ren Gestaltung<br />
mitwirken" (wuif u.a. 2004, s. 9). Es geht dabei zuvor<strong>de</strong>rst um die Entschlüsselung<br />
<strong>de</strong>s perfotmativen Charakters von Ritualen und Ritualisierungen. Er zeigt sich in<br />
institutionell vorgegebenen und initiierten Ritualen, mit <strong>de</strong>nen eine <strong>Schule</strong> ihre Orientierung<br />
an spezifischen Normen und We<strong>de</strong>n zum Ausdruck bringt und vermittelt,<br />
ebenso wie im ritualisierlen Verhalten <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler untereinan<strong>de</strong>r,<br />
mit <strong>de</strong>n Lehren<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r im Umgang mit <strong>de</strong>n schulischen Gegebenheiten. Thematisch<br />
wird auch hier die leibliche Dimension von Ritualen und ritualisiertem Verhalten.<br />
Denn gera<strong>de</strong> im leiblichen Mitvollzug von Schulfeiem, <strong>de</strong>r rituellen Gestaltung<br />
von Unterrichtsabläufen, in Pausenritualen, aber auch in <strong>de</strong>n regelmäßigen und<br />
wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong>n Handlungen, die die Kin<strong>de</strong>r und Jugendlichen im Kontext <strong>de</strong>r<br />
Peergroup vollziehen, wer<strong>de</strong>n symbolisch gemeinsame Vorstellungen und normative<br />
Orientierungen zum Ausdruck gebracht, Konflikte gelöst und letztlich eine gemeinsame<br />
Wirklichkeit erzeugt, die aus pädagogischer Perspektive immer auch reflexiv<br />
von <strong>de</strong>n Beteiligten eingeholt wer<strong>de</strong>n können sollte.<br />
Literatur<br />
Bock, L (2001): Rituale in <strong>de</strong>r Pädagogik. In: Brenk, M./Kurlh, U. (Hrsg.): SCHULe erLE-<br />
BEN. Festschrift für W. Wittenbruch. Frankfurt a. M. u.a.<br />
Burk, K.-H. (2005): Zeitstrukturmo<strong>de</strong>lle. In: Höhmann, K./Holtappels, H.-G./Kamski,<br />
I./Schnetzer, T.: Entwicklung und Organisation von Ganztagsschulen. Anregungen, Konzepte,<br />
Praxisbeispiele. Dortmund, S. 66-71.<br />
Herbarl, J. F. (1983): Allgemeine Pädagogik aus <strong>de</strong>m Zweck <strong>de</strong>r Erziehung abgeleitet. Erstmals<br />
1806. Bochum.<br />
Kaiser, A. (2000): 1000 Rituale tiir die Grundschule. Baltmannsweiler.
566 Teil III: <strong>Schule</strong> als Lebensraum<br />
Kolbe, F.-U./Rabenstein, K./Reh, S. (2006): Experlise ,,Rhythmisierung". Hinweise für die<br />
Planung von Forlbildungsmodulen für Mo<strong>de</strong>ratoren. Berlin und Bran<strong>de</strong>nburg. Berlin und<br />
Mainz. Unter: http ://www. lemku ltur-ganztagsschule. <strong>de</strong><br />
/html/downloads/Kolbe%20Rabenstein%2OReh%20Expertise%20Rhythmisierung.pdf<br />
(Zugriff am 9.02.07).<br />
Neumann, U./Ramseger, J. (20013): Ganztägige Erziehung in <strong>de</strong>r <strong>Schule</strong>. Eine Problemskizze.<br />
Friedrich Forum 5. Seelze.<br />
Prange, K. (1983): Bauformen <strong>de</strong>s Unterichts. Bad Heilbrunn.<br />
Schultheis, K. (1998a): Leiblichkeit Kultur Erziehung. Zur Theorie <strong>de</strong>r elementaren Erziehung.<br />
Weinheim.<br />
Schultheis, K. (1998b): Rituale als Lernhilfen. In: Grundschulmagazin 10, S. 4-9.<br />
Schultheis, K. (2004): Leiblichkeit als Dimension kindlicher Weltaneignung. Leibphänomenologische<br />
und erfahrungstheoretische Aspekte einer Anthropologie kindlichen Lemens.<br />
In: Duncker, L./Scheunpflug, A./Schultheis, K.: Schulkindheit. Anthropologie <strong>de</strong>s Lernens<br />
im Schulalter. Stuttgart 2004, S. 93-111.<br />
Schultheis, K. (2007): Die pathische Macht <strong>de</strong>r Erziehung. Zur Leiborientierung pädagogischen<br />
Han<strong>de</strong>lns. In: Konrad, F.-M./Sai1er, M. (2007): Homo educabilis. Studien ztr Allgemeinen<br />
Pädagogik, Pädagogischen Anthropologie und Bildungsforschung. Münster u.a.<br />
Siepmann, G./Salzberg-Ludwig, K. (2001): Chrono-psycho-biologische Rhythmik im Tagesverlauf<br />
behin<strong>de</strong>rler und nichtbehin<strong>de</strong>rter Schülerinnen und Schüler. In: Hofmann,<br />
Christiane u.a. (Hrsg.): Zeit und Eigenzeit als Dimensionen <strong>de</strong>r Son<strong>de</strong>rpädagogik. Luzern,<br />
s.131-r40.<br />
Wellendorf, F. (1974'): Schulische Sozialisation und I<strong>de</strong>ntität. Weinheim.<br />
Wulf, Ch. u.a. (2004): Bildung im Ritual. <strong>Schule</strong>, Familie, Jugend, Medien. Wiesba<strong>de</strong>n.