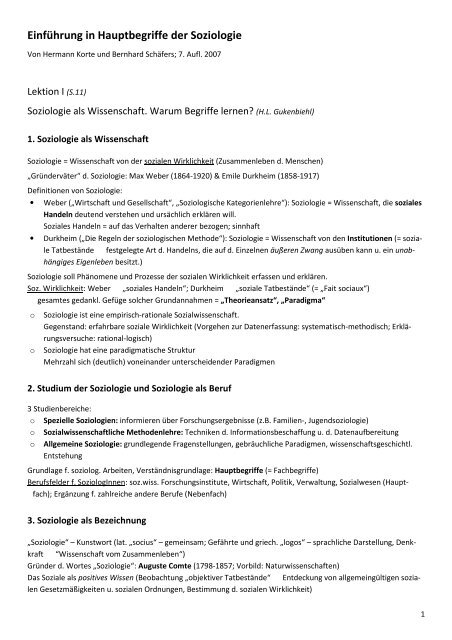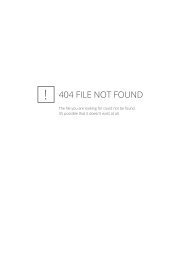Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie Zusammenfassung - bagru ...
Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie Zusammenfassung - bagru ...
Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie Zusammenfassung - bagru ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>E<strong>in</strong>führung</strong> <strong>in</strong> <strong>Hauptbegriffe</strong> <strong>der</strong> <strong>Soziologie</strong><br />
Von Hermann Korte und Bernhard Schäfers; 7. Aufl. 2007<br />
Lektion I (S.11)<br />
<strong>Soziologie</strong> als Wissenschaft. Warum Begriffe lernen? (H.L. Gukenbiehl)<br />
1. <strong>Soziologie</strong> als Wissenschaft<br />
<strong>Soziologie</strong> = Wissenschaft von <strong>der</strong> sozialen Wirklichkeit (Zusammenleben d. Menschen)<br />
„Grün<strong>der</strong>väter“ d. <strong>Soziologie</strong>: Max Weber (1864-1920) & Emile Durkheim (1858-1917)<br />
Def<strong>in</strong>itionen von <strong>Soziologie</strong>:<br />
• Weber („Wirtschaft und Gesellschaft“, „Soziologische Kategorienlehre“): <strong>Soziologie</strong> = Wissenschaft, die soziales<br />
Handeln deutend verstehen und ursächlich erklären will.<br />
Soziales Handeln = auf das Verhalten an<strong>der</strong>er bezogen; s<strong>in</strong>nhaft<br />
• Durkheim („Die Regeln <strong>der</strong> soziologischen Methode“): <strong>Soziologie</strong> = Wissenschaft von den Institutionen (= soziale<br />
Tatbestände festgelegte Art d. Handelns, die auf d. E<strong>in</strong>zelnen äußeren Zwang ausüben kann u. e<strong>in</strong> unabhängiges<br />
Eigenleben besitzt.)<br />
<strong>Soziologie</strong> soll Phänomene und Prozesse <strong>der</strong> sozialen Wirklichkeit erfassen und erklären.<br />
Soz. Wirklichkeit: Weber „soziales Handeln“; Durkheim „soziale Tatbestände“ (= „Fait sociaux“)<br />
gesamtes gedankl. Gefüge solcher Grundannahmen = „Theorieansatz“, „Paradigma“<br />
o <strong>Soziologie</strong> ist e<strong>in</strong>e empirisch-rationale Sozialwissenschaft.<br />
Gegenstand: erfahrbare soziale Wirklichkeit (Vorgehen zur Datenerfassung: systematisch-methodisch; Erklärungsversuche:<br />
rational-logisch)<br />
o <strong>Soziologie</strong> hat e<strong>in</strong>e paradigmatische Struktur<br />
Mehrzahl sich (deutlich) vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> unterscheiden<strong>der</strong> Paradigmen<br />
2. Studium <strong>der</strong> <strong>Soziologie</strong> und <strong>Soziologie</strong> als Beruf<br />
3 Studienbereiche:<br />
o Spezielle <strong>Soziologie</strong>n: <strong>in</strong>formieren über Forschungsergebnisse (z.B. Familien-, Jugendsoziologie)<br />
o Sozialwissenschaftliche Methodenlehre: Techniken d. Informationsbeschaffung u. d. Datenaufbereitung<br />
o Allgeme<strong>in</strong>e <strong>Soziologie</strong>: grundlegende Fragenstellungen, gebräuchliche Paradigmen, wissenschaftsgeschichtl.<br />
Entstehung<br />
Grundlage f. soziolog. Arbeiten, Verständnisgrundlage: <strong>Hauptbegriffe</strong> (= Fachbegriffe)<br />
Berufsfel<strong>der</strong> f. SoziologInnen: soz.wiss. Forschungs<strong>in</strong>stitute, Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Sozialwesen (Hauptfach);<br />
Ergänzung f. zahlreiche an<strong>der</strong>e Berufe (Nebenfach)<br />
3. <strong>Soziologie</strong> als Bezeichnung<br />
„<strong>Soziologie</strong>“ – Kunstwort (lat. „socius“ – geme<strong>in</strong>sam; Gefährte und griech. „logos“ – sprachliche Darstellung, Denkkraft<br />
“Wissenschaft vom Zusammenleben“)<br />
Grün<strong>der</strong> d. Wortes „<strong>Soziologie</strong>“: Auguste Comte (1798-1857; Vorbild: Naturwissenschaften)<br />
Das Soziale als positives Wissen (Beobachtung „objektiver Tatbestände“ Entdeckung von allgeme<strong>in</strong>gültigen sozialen<br />
Gesetzmäßigkeiten u. sozialen Ordnungen, Bestimmung d. sozialen Wirklichkeit)<br />
1
4. <strong>Soziologie</strong> als Wissenschaftsprogramm<br />
<strong>Soziologie</strong> = wissenschaftl. Programm (Theorieansatz, Paradigma; bestimmen über Gegenstand & Methode d. <strong>Soziologie</strong>)<br />
Man ist sich e<strong>in</strong>ig:<br />
o Forschungsgegenstand: soziale Wirklichkeit<br />
o <strong>Soziologie</strong> = Erfahrungswissenschaft (empirisch-rational) Trennung von re<strong>in</strong> formal-logischen (z.B. Mathe)<br />
und nicht-rationalen Wissenschaften (z.B. Religion)<br />
Grundannahmen über das Soziale:<br />
o Mensch als soziales Wesen und Person (auf Zusammenleben mit an<strong>der</strong>en angewiesen und davon bee<strong>in</strong>flusst;<br />
jeweils persönliche Identität)<br />
o Erste Welt: s<strong>in</strong>nlich wahrnehmbar, materiell. Menschen schaffen zweite Welt: Kultur<br />
1. + 2. Welt = Realität, gesellschaftl. Umwelt („Doppelleben“ möglich, weil Mensch Körper und Bewusstse<strong>in</strong> besitzt);<br />
än<strong>der</strong>t sich: <strong>in</strong>tendiert/nicht <strong>in</strong>tendiert<br />
Soziale Wirklichkeit verän<strong>der</strong>t sich durch: 1. biografische Wandlungen d. Personen<br />
2. geschichtliche Wandlungen d. gesellschaftl. Umwelt<br />
5. Analytische Begriffssysteme<br />
Zweck d. Beschaffung von Informationen u. Daten über soz. Wirklk.: Erfassen und fachl. Beschreiben auffälliger soz.<br />
Phänomene und <strong>der</strong>en vermutl. Entstehungsbed<strong>in</strong>gungen ( Aussagen über soz. Regelmäßigkeiten)<br />
Fachterm<strong>in</strong>i:<br />
o Doppelter Bezug: 1. Sie stehen <strong>in</strong> Beziehung zur soz. Wirklk.; bezeichnen sie und <strong>in</strong>formieren über sie<br />
2. Sie stehen <strong>in</strong> Zusammenhang mit theoretischen Modellen, fachlichen Gesamtvorstellungen<br />
über soz. Wirklk.<br />
Die theoretische Def<strong>in</strong>ition d. Fachbegriffe stellt den Zusammenhang zw. bestimmten theoretischen Modellen<br />
und dem jeweiligen Fachterm<strong>in</strong>us her.<br />
o S<strong>in</strong>nzusammenhang mit an<strong>der</strong>en, korrespondierenden Begriffen<br />
o Instrumenteller Charakter: Fachterm<strong>in</strong>i = vere<strong>in</strong>barte sprachliche Symbole. Zweck: sichere fachliche Kommunikation,<br />
Bestimmung und E<strong>in</strong>grenzung d. geme<strong>in</strong>ten Forschungsgegenstandes Fachterm<strong>in</strong>i s<strong>in</strong>d we<strong>der</strong> wahr<br />
noch falsch.<br />
Lektion II (S. 23)<br />
Soziales Handeln und se<strong>in</strong>e Grundlagen: Normen, Werte, S<strong>in</strong>n (B. Schäfers)<br />
1. Soziales Handeln – mehr als nur e<strong>in</strong> Hauptbegriff<br />
E<strong>in</strong> grundlegen<strong>der</strong> Bereich <strong>der</strong> von <strong>der</strong> <strong>Soziologie</strong> zu erklärenden Wissenschaft ist das soziale Handeln (sozial = zwischenmenschlich).<br />
Regelhaftigkeit d. Handelns – <strong>Soziologie</strong> fragt nach den Grundlagen d. wechselseitigen Orientierung d. Verhaltens u.<br />
den Bed<strong>in</strong>gungen se<strong>in</strong>er Kont<strong>in</strong>uität.<br />
Soziales Handeln = Gegenstandsbereich d. <strong>Soziologie</strong><br />
Bezogen auf Mikrobereich d. Sozialen (soz. Handeln <strong>in</strong> angebbaren soz. Situationen); Basis für Mesobereich (Institutionen<br />
& Organisationen) und Makrobereich (Gesellschaft & Weltgesellschaft)<br />
2
M. Weber: „Soziales Handeln aber soll e<strong>in</strong> solches Handeln heißen, welches se<strong>in</strong>em von dem o<strong>der</strong> den Handelnden<br />
geme<strong>in</strong>ten S<strong>in</strong>n nach auf das verhalten an<strong>der</strong>er bezogen wird und daran <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Ablauf orientiert ist.“ (1984: 19)<br />
2. Zur Anthropologie des sozialen Handelns<br />
2.1 „Natur“ und Sozialnatur des Menschen<br />
Aristoteles: Mensch = zoon politikon<br />
Thomas von Aqu<strong>in</strong>: Mensch = animal sociale<br />
Mensch ist fähig zum Geme<strong>in</strong>schaftshandeln und angewiesen auf das Soziale<br />
Poseidonius: „zweite Natur“ d. Menschen Wie verhält sich die erste (biologische) Natur d. Menschen zur zweiten<br />
(Mensch als Sozial- u. Kulturwesen)?<br />
Differenzierungen des homo sapiens sapiens:<br />
o Animal symbolicum (E. Cassirer 1990): Mensch ist auf Symbole angewiesen<br />
o Homo oeconomicus (Wirtschaftstheoretiker seit 18. Jhdt.): Anspruch auf universelle Gültigkeit<br />
o Homo sociologicus (Dahrendorf 1958): Mensch ist e<strong>in</strong> rollenspielendes, vergesellschaftetes Wesen<br />
2.2 <strong>Soziologie</strong> und Anthropologie<br />
Vertreter Anthropologie-fundierter <strong>Soziologie</strong>: Max Scheler (1874-1928), Helmut Plessner (1892-1985), Arnold Gehlen<br />
(1904-1976)<br />
Philosophische Anthropologie (Gehlen):<br />
o Mensch ist e<strong>in</strong> <strong>in</strong>st<strong>in</strong>ktverunsichertes und <strong>in</strong>st<strong>in</strong>ktreduziertes Wesen; Institutionen geben sichere Handlungsführung<br />
(„Was die Inst<strong>in</strong>kte beim Tier s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d die Institutionen beim Menschen“)<br />
o Triebüberschuss d. Menschen kann kulturschaffend se<strong>in</strong>, ohne Institutionen (Regeln) aber leicht <strong>in</strong> „aggressive<br />
Destruktivität“ (Gehlen) umschlagen<br />
o Hohe „Plastizität“ (Formbarkeit) <strong>der</strong> menschl. Antriebe<br />
o Zw. Handlungsantrieb (Reiz) und Handlung gibt es „Hiatus“ (Kluft): „Handlungshemmung“ durch Reflexion, Bes<strong>in</strong>nung<br />
etc.<br />
o Mensch ist „weltoffen“, e<strong>in</strong> Neugierwesen<br />
Notwendige Voraussetzungen, die Triebnatur d. Menschen zu „bändigen“: Funktionstüchtige Institutionen und e<strong>in</strong><br />
starker Staat. (pessimist. Anthropologie)<br />
Konsequenzen pessimistischer Anthropologie:<br />
o Se<strong>in</strong>saussagen über menschl. Natur können vorschnell <strong>in</strong> Sollaussagen umschlagen<br />
o Aussagen über „Natur“ d. Menschen werden zu Normaussagen über das daraus folgende notwendige Verhalten<br />
und die Beschaffenheit von Institutionen<br />
o Anthropologie hat ihren Euro- und Ethnozentrismus noch nicht überwunden<br />
2.3 Handlung – anthropologisch betrachtet<br />
Beson<strong>der</strong>heiten menschl. Handelns:<br />
o Immer aus gewisser Distanz, aus nie vollem E<strong>in</strong>gepasstse<strong>in</strong> (Plessner: exzentrische Positionalität)<br />
o Immer Verschränkung von Innen und Außen, von konkreter Situationsbewältigung und dem Innen d. Person<br />
(Überzeugungen, Wille, Wollen); Ergebnis: Harmonie o<strong>der</strong> Dissens, Abweichung<br />
o Strukturierungsleistung: nicht e<strong>in</strong>gepasste Motorik, reizüberflutete Wahrnehmung (Reflexions- u. Deutungsüberschuss),<br />
„Zerstreutheit d. Begierden“ (Gehlen) erfor<strong>der</strong>n bewusste Selektion u. gut tra<strong>in</strong>ierte Motorik (<br />
erlauben Regelhaftigkeit und Angepasstheit)<br />
Die Selektionsleistungen werden mit den Begriffen S<strong>in</strong>n, Norm und Wert erläutert.<br />
3
K. Marx (6. These über Feuerbach): „Das menschliche Wesen ist ke<strong>in</strong> dem e<strong>in</strong>zelnen Individuum <strong>in</strong>newohnendes<br />
Abstraktum. In se<strong>in</strong>er Wirklichkeit ist es das Ensemble <strong>der</strong> gesellschaftlichen Verhältnisse.“<br />
Novalis: „Je<strong>der</strong> Mensch ist e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Gesellschaft.“<br />
S. Freud: „Jede Gesellschaft ist e<strong>in</strong> umfangreicher Mensch.“<br />
3. Die Normativität des sozialen Handelns<br />
3.1 Der Normbegriff und se<strong>in</strong>e anthropologischen Grundlagen<br />
Norm: lat. Richtschnur, Regel, W<strong>in</strong>kelmaß<br />
Normen f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Ethik, Ästhetik, Logik, Technik, Alltagspragmatik …<br />
Wenn Normen sagen, wie etwas beschaffen se<strong>in</strong> soll: „normative Urteile“ (im Gegensatz zu Tatsachenurteilen); was<br />
e<strong>in</strong>er Norm entspricht: normal; wi<strong>der</strong>spricht: abnorm, anormal<br />
Soziale Normen = explizit gemachte Verhaltensregeln, die Standardisierungen ermöglichen<br />
Begriff „soziale Norm“ stellt gewissermaßen das „Urphänomen“ d. Sozialen dar. (R. König, 1906-92)<br />
Durkheim: Das Soziale besteht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geradezu d<strong>in</strong>ghaft feststellbaren Realität mit Basis <strong>in</strong> <strong>der</strong> Normativität des<br />
sozialen Handelns.<br />
S<strong>in</strong>n: vom Individuum her gedacht; Frage: Welchen S<strong>in</strong>n verb<strong>in</strong>det dieses Individuum mit se<strong>in</strong>er Handlung?<br />
Norm: Kategorie, die von außen an das Handeln herangebracht wird<br />
Normierung = Institutionalisierung verb<strong>in</strong>dlicher Regeln und Standards; Ausschluss an<strong>der</strong>er Möglichkeiten (Selektion<br />
– Grundpr<strong>in</strong>zip sozialer Strukturbildung)<br />
Normen repräsentieren das Allgeme<strong>in</strong>e, das „Typische“ von Handlungen.<br />
Soziale Normen = Standards/Regeln, die für e<strong>in</strong>e Mehrzahl von Individuen gelten; im Sozialisationsprozess erworben,<br />
ver<strong>in</strong>nerlicht (<strong>in</strong>ternalisiert) und <strong>in</strong> Prozessen <strong>der</strong> Institutionalisierung verb<strong>in</strong>dlich gemacht<br />
3.2 Zur Systematik <strong>der</strong> Normenvielfalt<br />
E<strong>in</strong>teilung von Normen:<br />
o Grad d. Bewusstse<strong>in</strong>s, „E<strong>in</strong>gelebtse<strong>in</strong>s“ (Weber) - am wenigsten bewusst: tägl. Gewohnheiten<br />
o Grad d. Verb<strong>in</strong>dlichkeit (Art d. Sanktionen):<br />
Muss-Normen (z.B. Gesetzte)<br />
Soll-Normen (z.B. Sitten)<br />
Kann-Normen (z.B. Bräuche, Gewohnheiten)<br />
o Adressat + Handlungszusammenhänge (personenbezogen, gruppenbezogen, gesellschaftsbezogen, sachbezogen<br />
usw.)<br />
o Subjektiv geme<strong>in</strong>ter S<strong>in</strong>n: Norm als Wert, aber auch als leidiges Muss<br />
3.3 Zur sozialwissenschaftlichen Differenzierung des Normbegriffs<br />
v Der „statistische“ Normbegriff des Behaviorismus<br />
„Statistisch“, weil die am häufigsten vorkommende Norm (= statistischer Durchschnitt) zur verb<strong>in</strong>dlichen Verhaltensregel<br />
erklärt wird. (K<strong>in</strong>sey – sexuelles Verhalten)<br />
v Der soziologische Normbegriff <strong>in</strong> <strong>der</strong> Handlungstheorie<br />
Weber: „[…]bestimmte Handlungsmaximen als irgendwie für das Handeln geltend: verb<strong>in</strong>dlich o<strong>der</strong> vorbildlich“.<br />
Handlungs- u. Rollentheorie (T. Parsons): „normative Übere<strong>in</strong>stimmung“ zw. Handlungsbereitem Individuum (Norm-<br />
u. Wertvorgaben <strong>in</strong>ternalisiert) u. auf Stabilität bedachtem sozialen System<br />
v Die Aufhebung des Normbegriffs <strong>in</strong> <strong>der</strong> ethnomethodologischen Kritik<br />
„Basisregeln“ konkreter Handlungssituationen;<br />
4
es gibt ke<strong>in</strong>e von <strong>der</strong> Situation ablösbaren allgeme<strong>in</strong>en Normen. Es gibt Verhaltenserwartungen und Durchsetzungsstrategien;<br />
im Handlungsvollzug selbst werden situationsspezifisch Regeln und Normen generiert und selektiv angewandt<br />
v Der ethische Normbegriff im rekonstruktivistischen Ansatz<br />
Entwicklungspsychologisch fundiert; versucht, „Entwicklungslogik“ d. stufenweisen Moralentwicklung zu rekonstruieren<br />
Theorien d. stufenweisen Entwicklung d. moralischen Bewusstse<strong>in</strong>s (J. Piaget, L. Kohlberg);<br />
Drei Hauptstadien:<br />
1. Präkonventionelle Moral (äußere Handlungsabfolgen: gut - belohnt, schlecht - bestraft)<br />
2. Konventionelle Moral (Bezugsgruppen: gut – was z.B. Familie für gut bef<strong>in</strong>det)<br />
3. Postkonventionelle Moral (abstrakte Pr<strong>in</strong>zipien Begründung u. Rechtfertigung v. Normen)<br />
3.4 Verstärkung von Normen durch Sanktionen<br />
Sanktion = Reaktion auf Verhalten, die Konformität erzeugen soll; regulierende + handlungsorientierte Funktion;<br />
Orientierungsfunktion + Ordnungsstruktur d. Normstruktur d. Handelns<br />
Positive Sanktion: Belobigung e<strong>in</strong>es als positiv angesehenen Verhaltens<br />
Negative Sanktionen: Missbilligung bis Gefängnisstrafe<br />
Sanktionen werden täglich empfangen und angewandt<br />
E<strong>in</strong>teilung von Sanktionen:<br />
o Erwartbarkeit<br />
o Verb<strong>in</strong>dlichkeit<br />
o Äußerungsform (mündl., schriftl., <strong>in</strong> Gesten, Mimik etc.)<br />
3.5 Verfestigung von Normbündeln zu sozialen Rollen<br />
Soziales Handeln ist immer auf das Erwartungsverhalten an<strong>der</strong>er gerichtet (Rollenkonformität)<br />
Soziale Rollen s<strong>in</strong>d:<br />
o Verfestigung e<strong>in</strong>er Reihe von Normen zu best. Verhaltenskomplexen<br />
o Summe d. Erwartungen, die alter an ego richtet<br />
Verlässlichkeit, Dauerhaftigkeit + Erwartbarkeit machen soziale Rollen zu e<strong>in</strong>em grundlegenden Element d. Sozialen,<br />
zu e<strong>in</strong>er Kategorie, die die Verschränkung von Individuum und Kultur anschaulich zum Ausdruck br<strong>in</strong>gt.<br />
Der rollenspielende Mensch: homo sociologicus (Dahrendorf): „Der E<strong>in</strong>zelne ist se<strong>in</strong>e Rollen, aber diese Rollen s<strong>in</strong>d<br />
ihrerseits die ärgerliche Tatsache <strong>der</strong> Gesellschaft“. E<strong>in</strong>zelner kann aber auch nur durch Gesellschaft zum Individuum<br />
werden!<br />
Differenzierung des Rollenkonzeptes:<br />
o Schnittpunkt: Soziale Differenzierung – soziale Normierung<br />
o Soziale Position legt fest, was wann wie zu tun ist statischer Aspekt; konkretes Rollenhandeln = dynamischer<br />
Aspekt d. soz. Handelns<br />
Zwei Ansätze <strong>der</strong> Rollentheorie:<br />
a) Ansprüche an e<strong>in</strong>e Rolle von den Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Gesellschaft aus formuliert<br />
b) Aus <strong>der</strong> Sicht d. handelnden Individuums (will aus Fremdrolle Eigenrolle machen, um se<strong>in</strong>e personale Identität<br />
gegenüber <strong>der</strong> rollenspezifischen sozialen Identität zu behaupten)<br />
L. Krappmann (1972): Die personale Identität verlangt, so zu se<strong>in</strong> wie ke<strong>in</strong> an<strong>der</strong>er; die soziale Identität verlangt,<br />
so zu se<strong>in</strong> wie alle an<strong>der</strong>en.<br />
Es gibt selbsttätig erworbene und zugeschriebene Rollen (R. L<strong>in</strong>ton).<br />
Zugeschriebene Rollen haben mit Herkunft, Alter, Geschlecht zu tun<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung: Bedeutung d. zugeschriebenen Rollen hat gegenüber <strong>der</strong> <strong>der</strong> selbst erworbenen abgenommen<br />
5
3.6 Handlungstypen und Orientierungsalternativen des Handelns<br />
o Differenzierung <strong>der</strong> Komplexität des Sozialen<br />
o Unterglie<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> Handlungstypen:<br />
F. Tönnies: Geme<strong>in</strong>schaftliches Handeln heißt: Die Interaktionen <strong>in</strong> Familie, Sippe, Stamm, Nachbarschaft basieren<br />
auf genauer Kenntnis des Gegenübers; impliziert e<strong>in</strong>e best. Sozialethik, e<strong>in</strong> Wir-Gefühl <strong>der</strong> Handelnden.<br />
Gesellschaftliches Handeln: Anonymisierung + Funktionalisierung d. Handelns; Rollenhaftigkeit und Rollendifferenzierung<br />
d. Handlungsstrukturen; radikale Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit<br />
Weiter differenzierte Typologie d. Handelns (Weber): Unterscheidung zw. Brauch, Sitte, Konvention und Recht<br />
Orientierungen (bzw. Motivlagen) d. Handelns: -zweckrational<br />
- wertrational<br />
- affektuell (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e emotional)<br />
- traditional (durch e<strong>in</strong>gelebte Gewohnheit)<br />
T. Parsons: pattern variables (Orientierungsalternativen)<br />
4. Werte und Wertbezogenheit des sozialen Handelns<br />
4.1 Normen und Werte<br />
Werte: Grundpr<strong>in</strong>zipien <strong>der</strong> Handlungsorientierung. Vorstellungen vom Wünschenswerten. Leitbil<strong>der</strong>. Grundgerüst<br />
<strong>der</strong> Kultur<br />
Normen als „Atome des sozialen Lebens“ funktionieren auf Dauer nur, wenn ihre Befolgung als ethisch wertvoll angestrebt<br />
wird.<br />
Werte s<strong>in</strong>d die ethischen Imperative, die das Handeln <strong>der</strong> Menschen leiten.<br />
Weber: wertrational handelt wer sich durch bewussten Glauben an den unbed<strong>in</strong>gten Eigenwert e<strong>in</strong>es best. Sachverhaltes<br />
und unabhängig vom Erfolg leiten lässt.<br />
4.2 Wertb<strong>in</strong>dung und Wertwandel<br />
Fragen nach Wertb<strong>in</strong>dung und Wertwandel s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Dauerthema des Alltagsgesprächs, <strong>der</strong> Medien und d. wissenschaftl.<br />
Analyse<br />
Pluralität d. Wertorientierung hat dort ihre Grenzen, wo Gruppenkonsens o<strong>der</strong> Integration d. Gesellschaft gefährdet<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Dimensionen d. Wertwandels:<br />
o Gewisse Grundwerte s<strong>in</strong>d f. Integration mo<strong>der</strong>ner Gesellschaften unverzichtbar<br />
o Mit dem sozialen und kulturellen Wandel ist immer auch e<strong>in</strong> Wandel von Werten und Orientierungsalternativen<br />
des Handelns (pattern variables) verbunden.<br />
o Werte bekommen e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en Stellenwert <strong>in</strong> <strong>der</strong> sozialen u. <strong>in</strong>dividuellen Werteordnung. Postmaterielle Werte<br />
treten h<strong>in</strong>zu: Naturerhaltung, Partizipation, Selbstf<strong>in</strong>dung usw.<br />
o Wertwandel führt zugleich zur Verän<strong>der</strong>ung von Institutionen, Normen und den Formen d. Zusammenlebens<br />
o Frage nach <strong>der</strong> S<strong>in</strong>nsuche, neue soziale u. religiöse Bewegungen, Thema d. Selbstf<strong>in</strong>dung<br />
Än<strong>der</strong>ungen d. Wertordnung Selektionen von S<strong>in</strong>n (Gründe f. Konflikte, die politisches, soziales, kulturelles Leben<br />
bestimmen; Voraussetzung f. „offiziellen“ Wandel best. Normen, Institutionen u. gesellschaftlicher Strukturen.)<br />
5. S<strong>in</strong>n<br />
5.1 Vielschichtigkeit des S<strong>in</strong>nbegriffs<br />
S<strong>in</strong>n (lat. sensus): Handeln läuft nach Motiven und Zwecken reflektiert und zielorientiert ab<br />
S<strong>in</strong>n als Basis des Verstehens<br />
SINN –körperliche Organe – Wahrnehmen von Reizen aus d. Außenwelt<br />
6
Äußere S<strong>in</strong>ne: Geruchs-, Tast-, Hörs<strong>in</strong>n<br />
Innere S<strong>in</strong>ne: Wahrnehmung<br />
Offenheit d. Zeithorizonts: Mensch kann bewusstse<strong>in</strong>smäßig zw. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft pendeln;<br />
Bewusstse<strong>in</strong> kann handlungs- u. situationsflüchtig se<strong>in</strong><br />
Leistungen d. S<strong>in</strong>nbegriffs:<br />
o Hilft, spezifische Form d. Wahrnehmung, die das Verhalten an<strong>der</strong>er deutbar u. verstehbar macht, zu kanalisieren<br />
o Macht über konkrete Handlungssituation h<strong>in</strong>aus die sie tragende Kultur (Zusammenhang d. Normen u. Werte)<br />
e<strong>in</strong>sehbar<br />
Annahmen zum S<strong>in</strong>nverstehen:<br />
o Jedes Individuum ist zum „S<strong>in</strong>nverstehen“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage<br />
o Individuen s<strong>in</strong>d bereits „vergesellschaftet“ (mit Normen + Werten ausgestattet)<br />
o Kultur ist e<strong>in</strong> zusammenhängendes, für den Menschen verstehbares und sie leitendes Normen- und Wertesystem<br />
o Menschen suchen nach S<strong>in</strong>n und den sie „leitenden“ Kulturwerten<br />
5.2. Doppelpoligkeit von S<strong>in</strong>n<br />
G. H. Mead: S<strong>in</strong>n ist zentraler Faktor <strong>der</strong> „gegenseitigen Anpassung <strong>der</strong> Handlungen verschiedener menschlicher Wesen“<br />
1. Handeln<strong>der</strong> will, dass se<strong>in</strong>e Handlung <strong>in</strong> best. Weise verstanden wird;<br />
S<strong>in</strong>n als Selektion aus sehr vielen Möglichkeiten d. Verstehens, die Festlegung auf etwas Bestimmtes erlaubt e<strong>in</strong>deutige<br />
Decodierung (= s<strong>in</strong>nverstehende Entschlüsselung d. Symbole)<br />
2. In <strong>der</strong> Handlung selbst wird S<strong>in</strong>n produziert und reproduziert. Dies ist e<strong>in</strong> Element des Kulturprozesses u. d. Identität<br />
e<strong>in</strong>er best. Kultur.<br />
Mead: Merkmale von „S<strong>in</strong>n“: Teilnahme und Mitteilbarkeit.<br />
Partizipation und Kommunikabilität s<strong>in</strong>d im S<strong>in</strong>n sowohl vorausgesetzt als auch durch ihn generiert (erzeugt).<br />
5.3 Die Selektionsleisung von S<strong>in</strong>n für die Orientierung<br />
N. Luhmann: Fähigkeit d. Individuen zur Selektion von S<strong>in</strong>n (aus <strong>der</strong> Vielzahl möglicher Handlungen die für sie „richtigen“<br />
zu wählen) ermöglicht Orientierung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er komplexen Welt.<br />
S<strong>in</strong>n als Mechanismus zur Reduktion <strong>der</strong> komplexen Welt: „Der S<strong>in</strong>nbegriff ist die Ordnungsform menschlichen Erlebens“<br />
(Luhmann)<br />
Vorstrukturierung d. Handlungsfeldes durch S<strong>in</strong>nsysteme: Alles s<strong>in</strong>nhafte Handeln gehört zum Kontext vorgegebener<br />
S<strong>in</strong>n-Systeme mit ihren je eigenen Werten und Normen und den zu „Rollen“ verfestigten Erwartungen <strong>der</strong> Mithandelnden.<br />
5.4 S<strong>in</strong>n <strong>in</strong> weiteren Ansätzen <strong>der</strong> soziologischen Theorie<br />
Phänomenologische Ansätze (= Weiterentwicklungen d. S<strong>in</strong>nbegriffs auf Grundlage von M. Weber,<br />
G. H. Mead und A. Schütz):<br />
„Symbolischer Interaktionalismus“ (Mead) und Ethnomethodologie haben geme<strong>in</strong>same Wurzeln:<br />
o Menschen handeln <strong>in</strong> best. Situationen auf Basis von „Bedeutungen“, die sie selbst (als S<strong>in</strong>n) <strong>in</strong> die Handlungssituation<br />
e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen<br />
o Je<strong>der</strong> Mensch geht mit e<strong>in</strong>em vor-strukturierten Alltagswissen <strong>in</strong> die e<strong>in</strong>zelnen Handlungssituationen; die Welt, <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> er handelt, ist bereits e<strong>in</strong>e kulturelle, <strong>in</strong>terpretierte Welt, die für ihr e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>dividuellen S<strong>in</strong>n hat<br />
o Soziales Handeln ist e<strong>in</strong> <strong>in</strong>terpretativer, mit dem/den Handlungspartner(n) jeweils neu ausgehandelter Prozess, <strong>in</strong><br />
dem s<strong>in</strong>ngebende Deutungen über Sprechakte, Gesten, Mimik etc. die Erwartungen strukturieren<br />
V. Pareto: Handlungen und ihre Deutungen durch das Individuum s<strong>in</strong>d zwei verschiedene D<strong>in</strong>ge. Es läuft sehr viel<br />
weniger bewusst gewollt und geplant ab, als „rationales Handeln“ vermuten lässt. E<strong>in</strong> Großteil <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen<br />
Handlungen unterliegt e<strong>in</strong>er nachträglichen Rationalisierung, Motivation und S<strong>in</strong>ngebung.<br />
7
Lektion III (S. 45)<br />
Sozialisation, Person, Individuum (Albert Scherr)<br />
1. E<strong>in</strong>leitung<br />
Sozialisation: <strong>in</strong>dividuelle Bedürfnisse, Eigenschaften, Fähigkeiten, Interessen, Selbstverständnis d. Individuums ist<br />
nicht genetisch verankert, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong> hohem Maß e<strong>in</strong>e Folge sozialer E<strong>in</strong>wirkungen<br />
Claessen: Sozialisation = „zweite, soziokulturelle Geburt“<br />
Zusammenhang zw. Gesellschaftsstrukturen und Persönlichkeitsentwicklung<br />
Durkheim: Sozialisation = „E<strong>in</strong>wirkungen <strong>der</strong> Erwachsenengeneration auf diejenigen, die noch nicht reif s<strong>in</strong>d für das<br />
Leben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft“ Sozialisation = gesellschaftliche E<strong>in</strong>flussnahme auf die <strong>in</strong>dividuelle Entwicklung<br />
Grundfragen d. älteren Sozialisationsforschung:<br />
- Wie werden Individuen zu Mitglie<strong>der</strong>n sozialer Gruppen und e<strong>in</strong>er Gesellschaft?<br />
- Wie gel<strong>in</strong>gt es Gesellschaften ihre Regeln, Werte und Normen an die nachwachsenden Generationen weiterzugeben?<br />
Neuere Sozialisationsforschung:<br />
- Sozialisation kann nicht h<strong>in</strong>reichend und angemessen als Prägung durch die Gesellschaft verstanden werden<br />
- Individuen übernehmen gesellschaftliche Vorgaben nicht e<strong>in</strong>fach, son<strong>der</strong>n eignen sich diese auf <strong>der</strong> Grundlage<br />
ihrer vorgängig entwickelten kognitiven und affektiven Strukturen aktiv an<br />
- Aktuelle Begriffsbestimmungen: S. = <strong>in</strong> sich wi<strong>der</strong>sprüchlicher Zusammenhang von gesellschaftl. E<strong>in</strong>wirkungen<br />
auf das Individuum und <strong>in</strong>dividueller Kompetenzentwicklung<br />
2. Grundlagen soziologischer Sozialisationsforschung<br />
Voraussetzung von Sozialisationsprozessen: Individuen s<strong>in</strong>d dazu befähigt und darauf angewiesen, sich an an<strong>der</strong>en<br />
zu orientieren: „dem Menschen ,angeboren´ Handlungsorientierung und Handlungsbefähigung“ (Grundmann)<br />
aktive Teilnahme an sozialen Handlungs- und Kommunikationszusammenhängen sowie dauerhafte u. emotional<br />
bedeutsame Sozialbeziehungen s<strong>in</strong>d für den Sozialisationsprozess von zentraler Bedeutung<br />
Soziologische Sozialisationsforschung setzt e<strong>in</strong> Wissen über gesellschaftliche Strukturen und Dynamiken voraus.<br />
Gesellschaftliche Vorgaben wirken sich auch auf die Struktur alltäglicher Beziehungen aus (Autoritätsverhältnisse,<br />
Geschlechterbeziehungen)<br />
A. Schütz/T. Luckmann: „Schon den frühesten Erfahrungen e<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>des ist die historische Sozialstruktur ,kausal´<br />
vorausgesetzt“ was s<strong>in</strong>d die gesellschaftlichen Bed<strong>in</strong>gungen von und die gesellschaftlichen E<strong>in</strong>flüsse auf Sozialisationsprozesse?<br />
Sozialisationsforschung muss auch psychologische Theorien und Forschungsergebnisse berücksichtigen<br />
Aufgabenstellung e<strong>in</strong>er eigenständigen <strong>Soziologie</strong> <strong>der</strong> Sozialisation:<br />
Soziale Interaktionen, Gruppen, Institutionen, Organisationen sowie gesellschaftliche Strukturen und Dynamiken als<br />
Kontexte zu untersuchen, <strong>in</strong> denen sich <strong>der</strong> Aufbau, die Entwicklung und Verän<strong>der</strong>ungen von Persönlichkeitseigenschaften<br />
vollziehen.<br />
2.1 Def<strong>in</strong>ition und grundlegende Aspekte von Sozialisation<br />
Dimensionen des Sozialisationsprozesses:<br />
• Personalität: gesellschaftliche Bestimmtheit d. E<strong>in</strong>zelnen durch Rollen, Werte, Normen, Erwartungen, Gewohnheiten<br />
usw.<br />
• Individualität: Beson<strong>der</strong>heit und E<strong>in</strong>zigartigkeit <strong>der</strong> Individuen<br />
8
• Subjektivität: allen Individuen geme<strong>in</strong>same Sprach-, Handlungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit<br />
W. Edelste<strong>in</strong>: „Das Subjekt muss auch im Kontext jener Strukturen begriffen werden, <strong>der</strong>en Gewalt auch gegen se<strong>in</strong>en<br />
Willen se<strong>in</strong>e Biografie bestimmt“ und „das System sozialer Ungleichheit markiert dem handelnden Subjekt auch<br />
dann die Spielräume und prägt die Struktur se<strong>in</strong>er Motive, wenn ihm das Verlassen se<strong>in</strong>er Herkunftsposition gel<strong>in</strong>gt<br />
Aspekte des Sozialisationsprozesses:<br />
• Soziabilisierung: „Prozess, <strong>in</strong> dem dem menschlichen Nachwuchs die Möglichkeit erschlossen wird, menschliche<br />
Eigenschaften zu entwickeln und <strong>in</strong> dem die Vermittlung von allgeme<strong>in</strong>en Kategorien des Weltvertrauens<br />
und des Weltverständnisses erfolgt“ (Edelste<strong>in</strong>); Aufbau e<strong>in</strong>er elementaren Ich-Identität (= Grundverständnis<br />
<strong>der</strong> eigenen Persönlichkeit im Unterschied zu an<strong>der</strong>en)<br />
• Enkulturation: Prozess <strong>der</strong> „soziokulturellen Prägung“ = Aneignung kulturspezifischer Regeln, Normen, Werte<br />
• „sekundäre soziale Fixierung“: Prozess <strong>der</strong> Vorbereitung des Individuums auf die Übernahme spezialisierter<br />
gesellschaftlicher Anfor<strong>der</strong>ungen und Positionen.<br />
Primäre Erfahrungen <strong>in</strong> Interaktion mit Bezugspersonen (Eltern, Geschwister) Soziabilisierung und Enkulturation<br />
im Rahmen <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Herkunftsfamilie gegebenen beson<strong>der</strong>en Bed<strong>in</strong>gungen<br />
Freuds Psychoanalyse: zentrale Bedeutung familialer Interaktionsstrukturen: frühk<strong>in</strong>dliche Beziehungserfahrungen<br />
führen zum Aufbau psychischer Tiefenstrukturen, die das Erleben weiterer sozialer Beziehungen bee<strong>in</strong>flussen<br />
J. Bowlbys B<strong>in</strong>dungsforschung: K<strong>in</strong><strong>der</strong> entwickeln auf <strong>der</strong> Grundlage ihrer Beziehungserfahrungen mir primären Bezugsgruppen<br />
„<strong>in</strong>nere Arbeitsmodelle“, die als Interpretationsschemata für alle späteren sozialen Beziehungen wirksam<br />
werden<br />
Strukturmerkmale familialer Kommunikation und Interaktion:<br />
Kommunikation ist nicht auf spezifische Themen e<strong>in</strong>geschränkt, sie schließt emotionale und körperliche Bedürfnisse<br />
e<strong>in</strong> und die Interaktionsdichte ist hoch. Individuen begegnen sich möglichst „als ganze Person mit dem Anspruch auf<br />
Anerkennung und Bestätigung ihrer E<strong>in</strong>zigartigkeit“ (Allert)<br />
Unterschied primäre – sekundäre Sozialisation (Berger/Luckmann):<br />
„Die primäre Sozialisation ist die erste Phase, durch die <strong>der</strong> Mensch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er K<strong>in</strong>dheit zum Mitglied <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
wird. Sekundäre Sozialisation ist jener spätere Vorgang, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>e bereits sozialisierte Person <strong>in</strong> neue Ausschnitte <strong>der</strong><br />
objektiven Welt ihrer Gesellschaft e<strong>in</strong>weist“.<br />
Berger/Luckmann: Sozialisation = „grundlegende und allseitige Eiführung des Individuums <strong>in</strong> die objektive Welt e<strong>in</strong>er<br />
Gesellschaft o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>es Teils <strong>der</strong> Gesellschaft“<br />
Hurrelmann: Sozialisation = „Prozess, <strong>in</strong> dessen Verlauf sich <strong>der</strong> mit e<strong>in</strong>er biologischen Ausstattung versehene Organismus<br />
zu e<strong>in</strong>er sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet, die sich über den Lebenslauf h<strong>in</strong>weg <strong>in</strong> Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung<br />
mit den Lebensbed<strong>in</strong>gungen weiterentwickelt“.<br />
Schwerpunkte <strong>der</strong> Sozialisationsforschung:<br />
• Stadien des Sozialisationsprozesses (K<strong>in</strong>des-, Jugend- und Erwachsenenalters)<br />
• Dimensionen <strong>der</strong> Sozialisation (Spracherwerb, moralische Entwicklung, Identitätsbildung)<br />
• Auswirkungen unterschiedlicher Sozialisationsbed<strong>in</strong>gungen (z.B. schichten- und milieuspezifische Sozialisation,<br />
unterschiedliche Erziehungsstile)<br />
• Sozialisations<strong>in</strong>stanzen (Familie, Freundschaften, Schule, peers, Massenmedien, …)<br />
2.2 Sozialisation als umfassen<strong>der</strong> Prozess<br />
Sozialisation ist ke<strong>in</strong> zeitlich und räumlich begrenzter, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong> lebenslanger Vorgang<br />
S. ≠ E<strong>in</strong>fügung des Individuums <strong>in</strong> die Gesellschaft, son<strong>der</strong>n Persönlichkeitsentwicklung <strong>in</strong> heterogenen und potentiell<br />
wi<strong>der</strong>sprüchlichen sozialen Kontexten.<br />
9
Sozialisationsforschung beruht auf e<strong>in</strong>er untersuchungsgeleiteten Fragestellung, die es ermöglicht und erfor<strong>der</strong>t,<br />
pr<strong>in</strong>zipiell alle sozialen Vorgänge als Sozialisationsvorgänge <strong>in</strong> den Blick zu nehmen<br />
2.3 Erziehung und Sozialisation<br />
Sozialisation geschieht überwiegend ungeplant und unbeabsichtigt.<br />
K<strong>in</strong>d beobachtet Verhalten Erwachsener und ahmt es nach – ob von Eltern beabsichtigt o<strong>der</strong> nicht<br />
Erziehung = bewusste „gesellschaftliche Reaktion auf die Entwicklungstatsache“ (Bernfeld)<br />
Durkheim: „socialisation méthodique“ – geplante und absichtsvolle Sozialisation<br />
Erziehung ist diejenige Teilmenge <strong>der</strong> Sozialisationsvorgänge, für die das Ziel grundlegend ist, Verän<strong>der</strong>ungen von<br />
Personen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen, zu bee<strong>in</strong>flussen.<br />
Grenzen <strong>der</strong> Erziehung:<br />
• Anteil <strong>der</strong> bewussten und gezielten Erziehungshandlungen ist relativ ger<strong>in</strong>g<br />
• Weitreichen<strong>der</strong> E<strong>in</strong>fluss <strong>der</strong> Selbstsozialisation <strong>in</strong> peer groups. Sozialisation „ist <strong>der</strong> Anpassungsprozess des<br />
eigenen Verhaltens an das <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> eigenen sozialen Kategorie“ (J. R. Harris) Nicht Erziehung, son<strong>der</strong>n<br />
Selbstsozialisation ist von ausschlaggeben<strong>der</strong> Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung (ebd.)<br />
• Versuch absichtsvoller Bee<strong>in</strong>flussung wird erkannt und abgelehnt: K<strong>in</strong><strong>der</strong>, Jugendliche und Erwachsene könne<br />
die Erwartung, sich erziehen zu lassen, als solche zurückweisen<br />
2.4 Sozialisation und Erziehung <strong>in</strong> Familien und öffentlichen Erziehungse<strong>in</strong>richtungen<br />
Erziehung zunächst <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Herkunftsfamilie; Schulpflicht Erziehung wird auch Sache d. Ges.<br />
Ziele schulischer Erziehung: alle Bürger d. Staates sollen<br />
• über geme<strong>in</strong>same Sprache und<br />
• geme<strong>in</strong>sames Grundwissen verfügen,<br />
• an überregionaler Kommunikation teilnehmen können und<br />
• e<strong>in</strong>e nationale Identität entwickeln<br />
Außerschulisch: staatlich geför<strong>der</strong>te + reglementierte K<strong>in</strong><strong>der</strong>- und Jugendpflege, K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten, Jugendarbeit, Heimerziehung<br />
(Anlass: Vernachlässigung, Kontrolle abweichenden Verhaltens)<br />
Art. 6 (2) Grundgesetz: „Pflege und Erziehung <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> s<strong>in</strong>d das natürliche Recht <strong>der</strong> Eltern und die zuvör<strong>der</strong>st ihnen<br />
obliegende Pflicht.“<br />
3. Gesellschaftlichkeit und Individualität<br />
<strong>Soziologie</strong> – Sozialisation von allgeme<strong>in</strong>er Bedeutung:<br />
• Bed<strong>in</strong>gungen, die zur Erfüllung gesellschaftlicher Erwartungen und Anfor<strong>der</strong>ungen befähigen<br />
• Gestaltung gesellschaftlicher Lebensbed<strong>in</strong>gungen, die <strong>der</strong> Entwicklung und Realisierung menschl. Fähigkeiten<br />
zu eigenverantwortlichem, rational begründetem, sozial kooperativem und moralisch rechtfertigbarem<br />
Handeln för<strong>der</strong>lich ist<br />
• Unterschied soziolog. Theorien <strong>in</strong> E<strong>in</strong>schätzung d. Stärke + Schwäche gesellsch. E<strong>in</strong>flussnahmen auf die <strong>in</strong>dividuelle<br />
Entwicklung (eher soziale Bestimmtheit o<strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuelle Selbstbestimmungsfähigkeit?)<br />
3.1 Sozialisation als komplexer Prozess<br />
Menschen …<br />
• s<strong>in</strong>d Individuen; Durkheim: <strong>der</strong> „verpflichtende Charakter <strong>der</strong> Regel, die uns befiehlt“, sich als je e<strong>in</strong>zigartiges<br />
Individuum dazustellen<br />
• s<strong>in</strong>d Träger sozialer Erwartungen soziale Rollen. Aspekt d. Sozialisationsprozesses: Erlernen soz. Rollen +<br />
Rollendistanz (taktischer od. spielerischer Umgang mit Rollen)<br />
10
• s<strong>in</strong>d Mitglie<strong>der</strong> sozialer Bezugsgruppen und Organisationen Wir-Gruppe, Organisation – geme<strong>in</strong>same<br />
Merkmale, die sie von an<strong>der</strong>en unterscheiden<br />
• haben grundlegende Geme<strong>in</strong>samkeiten, die sie von an<strong>der</strong>en Lebewesen unterscheiden (Sprach- + Selbstbewusstse<strong>in</strong>sfähigkeit,<br />
<strong>in</strong> Erleben und Handeln nur wenig durch angeborene Merkmale festgelegt)<br />
Habitus = selbstverständliche Gewohnheiten u. Rout<strong>in</strong>en d. Handelns<br />
Sozialer Habitus = „Gepräge, das [<strong>der</strong> Mensch] mit allen an<strong>der</strong>en Mitglie<strong>der</strong>n se<strong>in</strong>er Gesellschaft teilt" (N. Elias)<br />
Bourdieu akzentuiert die Körperlichkeit d. Habitus: „Die strengsten sozialen Befehle richten sich nicht an den Intellekt,<br />
son<strong>der</strong>n an den Körper“: Männlichkeit + Weiblichkeit werden den Körpern e<strong>in</strong>geprägt (Gehen, Sprechen, Blicken<br />
…)<br />
E. Goffman: Zuweisung e<strong>in</strong>er sozialen Identität (Personalität) = Praxis <strong>der</strong> Wahrnehmung und Beschreibung von Individuen<br />
als Angehörige e<strong>in</strong>er Personengruppe<br />
Individualität und Subjektivität werden gesellschaftlich sowohl ermöglicht als auch begrenzt. Nur <strong>in</strong> sozialen Zusammenhängen<br />
können sich Menschen zu selbstbestimmungsfähigen und beson<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>zelnen entwickeln. Gesellschaft<br />
ist „nicht nur das Gleichmachende und Typisierende, son<strong>der</strong>n auch das Individualisierende“ (Elias)<br />
3.2 Vorrang des Sozialen, Selbstbild <strong>der</strong> Identität<br />
Primat des Sozialen (G.H. Mead): <strong>der</strong> Mensch ist durch biologische Ausstattung nur wenig festgelegt<br />
Interaktion mit bedeutsamen An<strong>der</strong>en (significant others), Teilnahme an sprachlich vermittelten Interaktions- und<br />
Handlungsvollzügen: unverzichtbar f. Entwicklung d. Sprach- und Handlungsfähigkeit<br />
Teilnahme an sozialer Kommunikation ist Voraussetzung für sekundäre Sozialisation (= lebensgeschichtlich spätere<br />
E<strong>in</strong>übung <strong>in</strong> spezialisierte gesellschaftl. Rollen + Funktionen [Berufstätigkeiten, Mitgliedschaftsrollen])<br />
Emotionale Zuwendung für Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong><strong>der</strong> unverzichtbar<br />
Selbstbild d. Individuums (Bezugspersonen!!): „Der E<strong>in</strong>zelne (…) erfährt sich – nicht direkt, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong>direkt – aus <strong>der</strong><br />
beson<strong>der</strong>en Sicht an<strong>der</strong>er Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> gleichen Gruppe, (…) <strong>der</strong> er angehört“ (Mead)<br />
Selbstreflexion: „Für die Identität ist es notwendig, dass die Person auf sich selbst reagiert“ (ebd.)<br />
Identität = Leistung, sich selbst als eigenständiges und beson<strong>der</strong>es Individuum wahrzunehmen, dem es gel<strong>in</strong>gt, vielfältige<br />
Erlebnisse und Erfahrungen zu <strong>in</strong>tegrieren)<br />
Selbstbild beruht auf Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und Selbstreflexion<br />
Identität: Fähigkeit, die verschiedenen Aspekte d. Lebensgeschichte u. d. Lebenssituation <strong>in</strong> e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitliches und<br />
konsistentes Verständnis d. eigenen Person zusammenzufügen; bestimmte Form d. Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung mit sozialen<br />
Erfahrungen und mit sich selbst<br />
4. Sozialisation: e<strong>in</strong> Vorgang im Spannungsverhältnis von sozialen Bed<strong>in</strong>gungen und Bee<strong>in</strong>flussungen<br />
sowie <strong>in</strong>dividueller Eigenleistung<br />
4.1 We<strong>der</strong> Prägung noch primäre Asozialität<br />
Sozialisation ≠ soziale Prägung (e<strong>in</strong>seitige Bee<strong>in</strong>flussung d. E<strong>in</strong>zelnen durch Gesellschaft, Kultur und Erziehung, <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Individualität und Subjektivität vernachlässigt werden)<br />
Verwendung, wenn auffällige Verhaltensweisen erklärt werden sollen (E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>er, typisch männliche o. weibliche<br />
Eigenschaften)<br />
Primäre Asozialität – egoistische und asoziale Natur d. Menschen (T. Hobbes) – muss durch soziale Normen und<br />
Zwänge e<strong>in</strong>geschränkt werden, damit soziales Zusammenleben möglich ist<br />
11
4.2 Perspektivenübernahme und Kooperation<br />
Regeln, die sozial angemessenes Handeln ermöglichen, werden schon von kle<strong>in</strong>en K<strong>in</strong><strong>der</strong>n eigenständig hervorgebracht<br />
s<strong>in</strong>d nicht nur externe Zwänge, son<strong>der</strong>n entstehen auch spontan aus <strong>der</strong> Fähigkeit heraus, sich <strong>in</strong> an<strong>der</strong>e<br />
h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>zuversetzen<br />
Fähigkeit zur Perspektivenübernahme = grundlegende menschl. Kompetenz (Mead); Stufenweise Entfaltung:<br />
konkrete Bezugsperson – soziale Bezugsgruppe – abstrakte Regeln<br />
Frühe K<strong>in</strong>dheit: „Wunsch, das Rechte zu tun, weil es das Rechte ist“ und „moralisches Wissen“ (Nunner-W<strong>in</strong>kler)<br />
Freundschaften s<strong>in</strong>d begünstigende Faktoren f. Entwicklung moralischer Handlungsbereitschaft<br />
4.3 Sozialisation als Aneignung sozial geteilter Wirklichkeit<br />
Sozialisation als „Selbst-Sozialisation“ (Luhmann) – es gibt ke<strong>in</strong>e kausalen Ursache-Wirkungs-Mechanismen, es ist<br />
nicht determ<strong>in</strong>iert, wie soziale Erfahrungen kognitiv und emotional verarbeitet werden<br />
Bedeutung unterschiedlicher Sozialisationsbed<strong>in</strong>gungen: eröffnen o<strong>der</strong> verschließen <strong>in</strong>dividuelle Entwicklungschancen,<br />
lassen jeweilige Entwicklungen wahrsche<strong>in</strong>licher o<strong>der</strong> unwahrsche<strong>in</strong>licher ersche<strong>in</strong>en:<br />
• Teilnahme an „alltäglicher Lebenswelt“ (Schütz/Luckmann) <strong>der</strong> sozialen Gruppe – <strong>der</strong> sozialen Wirklichkeit.<br />
Aneignung subjektiv selbstverständlicher und fraglos gültiger Weltsicht (normal – außergewöhnlich, erwünscht<br />
– unerwünscht., schön – hässlich, …)<br />
• Erwerb grundlegen<strong>der</strong>, sozial geteilter Wahrnehmungs-, Deutungs-, Handlungs- und Bewertungsmuster: erlaubt<br />
Unterscheidung zw. angepasstem + abweichendem, angemessenem + unangemessenem Verhalten.<br />
Das <strong>in</strong>dividuelle Erleben, Denken und Handeln basiert auf e<strong>in</strong>em mit an<strong>der</strong>en geteilten Wissen.<br />
Verhaltensgenetische Studien: Grundlegende Persönlichkeitsmerkmale haben e<strong>in</strong>en relevanten genetischen Anteil –<br />
aber: ke<strong>in</strong>e generalisierenden Aussagen möglich<br />
Der relative E<strong>in</strong>fluss genetischer Merkmale hängt mit jeweiligen sozialen Kontextbed<strong>in</strong>gungen zusammen.<br />
5. Unterschiedliche und sozial ungleiche Sozialisationsbed<strong>in</strong>gungen<br />
Sozialisationskontexte, <strong>in</strong> denen Individuen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Wirklichkeit h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>wachsen, lassen sich <strong>in</strong> mo<strong>der</strong>nen<br />
Ges. nicht mehr angeben<br />
E<strong>in</strong> Teil d. <strong>in</strong>dividuell verfügbaren Wissens ist allen Angehörigen e<strong>in</strong>er Sprachgeme<strong>in</strong>schaft bzw. Kultur geme<strong>in</strong>sam;<br />
aber Unterschiede d. sozial typischen Erfahrungen + Erwartungen und d. <strong>in</strong>dividuellen Zugangs zum ges. Sprach-,<br />
Bildungs- und Wissensvorrat (sozial ungleiche Sozialisationsbed<strong>in</strong>gungen)<br />
Familiale Sozialisationsbed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d nicht e<strong>in</strong>deutig und umfassend durch die Zugehörigkeit zu sozialen Schichten<br />
festgelegt, son<strong>der</strong>n variieren auch <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Schichten erheblich.<br />
Geschlechtsspezifische Sozialisation: Differenzen bezügl. <strong>der</strong> sozial typischen Erfahrungen, Erwartungen und Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
6. Soziale Anerkennung und die Entwicklung von Sprach- und Handlungsfähigkeit<br />
6.1 Grundlegende Bed<strong>in</strong>gungen „gel<strong>in</strong>gen<strong>der</strong>“ Sozialisation<br />
Sozialisationsbed<strong>in</strong>gungen und -verläufe können zu Störungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> sozialen Entwicklung führen.<br />
Positive und negative Entwicklungsbed<strong>in</strong>gungen:<br />
• Bildung von Individualität und eigenverantwortl. Handlungsfähigkeit „<strong>in</strong> Verhältnissen wechselseitiger Anerkennung“<br />
(J. Habermas); Anerkennung – E<strong>in</strong>zelne betrachten sich wechselseitig als selbstbestimmungsfähige<br />
Individuen<br />
12
• Wechselseitige Anerkennung wird im Umgang mit Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong><strong>der</strong>n nötig (U. Oevermann) Entfaltung <strong>in</strong>dividueller<br />
Fähigkeiten<br />
• Bedeutsam f. frühk<strong>in</strong>dliche Sozialisation: familiale o. familienähnliche Beziehungen; Idealfall: Begegnung „als<br />
ganze Person mit e<strong>in</strong>em Anspruch auf Anerkennung und Bestätigung ihrer E<strong>in</strong>zigartigkeit“<br />
Jede Kommunikation enthält neben manifesten sprachlichen Inhalten zugleich auch e<strong>in</strong>e Mitteilung über die Beziehung<br />
zw. den Personen, die mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> kommunizieren. Wi<strong>der</strong>sprüche zw. diesen beiden Ebenen schwerwiegende<br />
Entwicklungsstörungen<br />
6.2 Sprache und Sozialisation<br />
Mead sieht Sprache „als e<strong>in</strong> gesellschaftliches Organisationspr<strong>in</strong>zip, das die spezifisch menschliche Gesellschaft ermöglicht<br />
hat“<br />
Grundannahmen zur Sprachentwicklung:<br />
• K<strong>in</strong><strong>der</strong> werden von Anfang an als Wesen behandelt, die zu sprachlicher Verständigung grundsätzlich <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Lage s<strong>in</strong>d<br />
• Sprechen über eigenes Erleben und Handeln und das des K<strong>in</strong>des sowie über Objekte liefern dem K<strong>in</strong>d<br />
sprachliche Deutungen und Beschreibungen Befähigung, Ereignisse, Personen + D<strong>in</strong>ge mit sprachl. Äußerungen<br />
zu verb<strong>in</strong>den<br />
• Reaktion auf Gesten + lautsprachl. Äußerungen d. K<strong>in</strong>des wie auf <strong>in</strong>tentionale + verständliche Mitteilungen;<br />
E<strong>in</strong>igung auf Bedeutung elementarer Äußerungen Aufbau e<strong>in</strong>facher sprachlicher Kommunikationsmuster<br />
Weiterentwicklung zu komplexeren Sprachäußerungen<br />
• Primäre Bezugspersonen wirken – nicht notwendigerweise absichtsvoll – auf Verfestigung + Ausbau sprachl.<br />
Fähigkeiten (z.B. sprachl. korrekte Äußerungen wie<strong>der</strong>holen o. unvollständige Sätze vervollständigen)<br />
L. Wittgenste<strong>in</strong>: Sprachen s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong> neutrales Instrument, über das Individuen zum Zweck <strong>der</strong> Mitteilung und Verständigung<br />
verfügen können. Sie enthalten grundlegende Muster d. Wahrnehmung, Deutung + Bewertung.<br />
Schütz/Luckmann: mit <strong>der</strong> Sprache wird „relativ-natürliche Weltanschauung“ e<strong>in</strong>es sozialen Zusammenhangs erworben<br />
7. Gesellschaftstheorie und Sozialforschung<br />
Gesamtgesellschaftl. Strukturen: Mit <strong>der</strong> politischen, technischen, ökonomischen und kulturellen Entwicklung verän<strong>der</strong>n<br />
sich nicht nur Rahmenbed<strong>in</strong>gungen d. Sozialisation, son<strong>der</strong>n auch die Erwartungen daran, welche Eigenschaften<br />
und Fähigkeiten Heranwachsende im Prozess <strong>der</strong> Sozialisation erwerben sollen.<br />
Wandel d. Bed<strong>in</strong>gungen familialer Sozialisation: Rückgang d. durchschn. K<strong>in</strong><strong>der</strong>anzahl; steigende Erwerbstätigkeit<br />
von Frauen<br />
Lektion IV (S. 69)<br />
Identität und Habitus (Kathar<strong>in</strong>a Liebsch)<br />
1. <strong>E<strong>in</strong>führung</strong><br />
„Identität“ und „Habitus“: Verhaltensdispositionen, die Menschen im Lauf des Lebens entwickeln. Individuen statten<br />
sich mit best. sozialen Merkmalen aus und ordnen sich sozialen Gruppen zu. Sie werden auch von an<strong>der</strong>en zugeordnet<br />
und typisiert.<br />
Typen und Beson<strong>der</strong>heiten von Menschen zu e<strong>in</strong>er best. Zeit werden als Identität und Habitus sicht-bar.<br />
Wandel: I. + H. variieren historisch und kulturell<br />
13
Entstehung aufgrund vermitteln<strong>der</strong> Prozesse zw. Kultur, Gesellschaft, Individuen; stehen <strong>in</strong> Bezug zu Strukturen +<br />
sozialen Normen und Regeln<br />
Verb<strong>in</strong>den mikrosoziologische Ebene des Handelns von Individuen mit makrosoziologischer Ebene <strong>der</strong> gesellschaftl.<br />
Strukturen<br />
2. Identität und Habitus: Konzepte und Lesarten<br />
2.1 Die Fähigkeit, mittels Vernunft und Sprache zu sich selbst Stellung zu nehmen<br />
Indem Menschen sich selbst thematisieren, reflektieren sie ihre eigenen Tätigkeiten und Erfahrungen mit An<strong>der</strong>en.<br />
Sie stellen e<strong>in</strong> Bild von sich selbst her, mit dem das eigene Handeln entwe<strong>der</strong> bestätigt/abgesichert o<strong>der</strong> korrigiert/verän<strong>der</strong>t<br />
wird.<br />
Ältere Idee d. Identität: „Innen“ ist abgetrennt vom „Außen“<br />
Idee d. Habitus: „Innen“ und „Außen“<br />
17., 18. Jh.: Person als abgegrenztes, eigenständiges Wesen, das mit e<strong>in</strong>er „Innerlichkeit“, „Persönlichkeit“ und e<strong>in</strong>er<br />
„Identität“ ausgestattet ist<br />
Verbreitung <strong>der</strong> Idee d. Identität: J.-J. Rousseau (Appelle: Ausbildung e<strong>in</strong>er tief empf<strong>in</strong>denden, sittsam lebenden<br />
Seele)<br />
Idee d. Identität ist geprägt durch<br />
(1) Betonung <strong>der</strong> Möglichkeit und Notwenigkeit e<strong>in</strong>es von Vernunft geleiteten Lebens<br />
(2) Vermögen, die eigene Person zum Gegenstand d. Nachdenkens zu machen<br />
Vernunft und Selbstreflexion als Voraussetzung für Identität als soziales Phänomen<br />
A. Hahn: Identitäten werden mithilfe von Institutionen gebildet<br />
2.2 Die Entwicklung <strong>der</strong> sozialen und sozialpsychologischen Identitätsbegriffs<br />
Mead: Entwicklung d. self beim K<strong>in</strong>d<br />
Self ≠ sich herausbildende Persönlichkeit, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>e Struktur <strong>der</strong> Selbstbeziehung <strong>der</strong> Person<br />
E. Erikson: Ich-Identität als Ereignis von Fähigkeiten bzw. als Leistung von E<strong>in</strong>zelpersonen<br />
Identitätsforschung will normierenden E<strong>in</strong>fluss <strong>der</strong> Gesellschaft beschreiben und analysieren<br />
Modelle von Prägung, Normierung, sozialer Konformität zur Erklärung d. vere<strong>in</strong>heitlichenden und konformierenden<br />
Wirkung gesellschaftlicher E<strong>in</strong>flüsse<br />
D. Riesman: verschiedene Gesellschaftsformationen unterschiedliche Persönlichkeitstypen; letzte 100 Jahre: traditioneller,<br />
<strong>in</strong>nengelenkter, außengelenkter „Sozialcharakter“<br />
Typisch für westl. Industriegesellschaft: außengelenkter Charakter (normierende E<strong>in</strong>flüsse von Massenmedien, gesellschaftl.<br />
Normen und Konventionen)<br />
A. Ehrenberg: das „erschöpfte Selbst“ (gestiegene ges. Erwartung an Eigenverantwortung, Selbstverwirklichung, Erfolg,<br />
Glück Überfor<strong>der</strong>ung d. Menschen <strong>in</strong>nere Leere, Depression, Antriebslosigkeit, Suchtverhalten<br />
Gestaltungsmöglichkeiten von Individuen: Kreativität, Entscheidungsfähigkeiten, Strategien<br />
Identität vollzieht sich <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er wie<strong>der</strong>holten Selbstbefragung nicht mehr e<strong>in</strong>e Identität, son<strong>der</strong>n zusammengesetztes<br />
Selbstbild aus mehreren Lebenserfahrungen „Bastelexistenzen“ (Hitzler/Honer), „Patchwork-Identität“<br />
(Keupp/Höfer), „multiple Selbste“ (Bilden)<br />
Partizipative/kollektive Identität: Thema <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>schaft, des sozialen Bandes, das Gruppen zusammen b<strong>in</strong>det<br />
Alltägliche Inszenierung und Präsentation von Identitäten<br />
14
Zusammenfassend: Identität ist e<strong>in</strong> Konzept zum Verständnis von Selbstbil<strong>der</strong>n. Sich ständig wandelnde Antworten<br />
auf die Frage „Wer b<strong>in</strong> ich?“. In e<strong>in</strong>em Wechselspiel von bestehenden sozialen Strukturen und verän<strong>der</strong>n<strong>der</strong> Aneignung<br />
gebildet. Transportieren sowohl Reaktionen auf Vorgegebenes wie auch selbstgestaltete Def<strong>in</strong>itionen.<br />
2.3 Die Entwicklung des Habitusbegriffs<br />
Habitus: Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft, Person und Struktur. Vielschichtiges System von Denk-,<br />
Wahrnehmungs- und Handlungsmustern. Ist begründet <strong>in</strong> <strong>der</strong> sozialen Lage, den kulturellen Milieu und <strong>der</strong> Biografie<br />
e<strong>in</strong>es Individuums. Art soziale Grammatik – <strong>in</strong> Körper und Verhaltensweisen <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelnen e<strong>in</strong>geschrieben.<br />
§ N. Elias: Habitus = „spezifisches Gepräge“ des E<strong>in</strong>zelnen, welches er mit allen an<strong>der</strong>en Angehörigen se<strong>in</strong>er Gesellschaft<br />
teilt; = Basis; allgeme<strong>in</strong>-gesellschaftlich und <strong>in</strong>dividuell-persönlich: Mensch trägt Eigentümlichkeiten e<strong>in</strong>er<br />
Gruppe <strong>in</strong> sich;<br />
Habitus s<strong>in</strong>d historisch gewachsene Muster und Reaktionen – durch Entstehungskontext bestimmt und bestimmen<br />
ihrerseits weitere und zukünftige Verhaltensweisen; Geschmacksempf<strong>in</strong>dungen, Moralvorstellungen, Formen<br />
d. Scham und d. Pe<strong>in</strong>lichkeit, d. Ekels, d. Stolzes.<br />
Habitus = habitualisierte Gewohnheiten und Handlungen<br />
Habitus = Fähigkeit, die eigenen sozialen Ordnungen zuzuordnen<br />
§ Gehlen: Handlungen, Gedanken, Entscheidungs- u. Urteilsgänge s<strong>in</strong>d automatisiert „Institutionalisierung“.<br />
Institutionalisierung + Habitualisierung des Verhaltens Entlastung<br />
Habitus hat e<strong>in</strong>e erzeugte und e<strong>in</strong>e selbst erzeugende Struktur: e<strong>in</strong>erseits rout<strong>in</strong>iert und verfestigt, an<strong>der</strong>erseits<br />
selbst produktiv und gestaltend<br />
§ Berger/Luckmann: „Gesetz <strong>der</strong> Gewöhnung“. Habitus ist nicht als Eigenschaft des Individuums zu sehen, son<strong>der</strong>n<br />
als e<strong>in</strong>e Struktur des Handelns ermöglicht Sicherheit und Rout<strong>in</strong>e<br />
§ Bourdieu: Habitus = „strukturierte und strukturierende Struktur“; = Fähigkeit zum Unterscheiden und Urteilen<br />
„praktischer S<strong>in</strong>n“<br />
Zusammenfassend:<br />
Habitus = habitualisierte Gewohnheiten + Handlungen von Personen;<br />
sozialisatorisch erworbenes Schema zur Erzeugung immer neuer Handlungen, das Grenzen und Spielräume sozialer<br />
Ordnungen reproduziert und verän<strong>der</strong>t; Struktur-Se<strong>in</strong> + strukturierende Funktion;<br />
gesellschaftliche Prägung + <strong>in</strong>dividuelle Gestaltungsmöglichkeiten<br />
3. Mechanismen <strong>der</strong> Herstellung von Identitäten und Habitus<br />
3.1 Identitätsarbeit/ Identitätspolitik<br />
Zeitliche und <strong>in</strong>haltliche Dimensionen von Identität<br />
Identitäten werden durch soziale Vorgaben strukturiert und <strong>in</strong> kommunikativen Handlungen zum Ausdruck gebracht<br />
Mead: „Der E<strong>in</strong>zelne erarbeitet sie sich, <strong>in</strong>dem er die Haltungen bestimmter an<strong>der</strong>er Individuen im H<strong>in</strong>blick auf ihre<br />
organisierten gesellschaftlichen Auswirkungen und Implikationen weiter organisiert und dann verallgeme<strong>in</strong>ert“<br />
I. s<strong>in</strong>d nie fest und statisch „Identitätsarbeit“, „Identitätspolitik“<br />
Identitätsarbeit: alltägliche Verfahren, mit denen Menschen sich ihrer selbst vergewissern und sich selbst def<strong>in</strong>ieren<br />
Mechanismen zur Identitätserneuerung und –erhaltung (Giddens):<br />
1. man muss Identität selbst konstruieren; sie ist e<strong>in</strong> reflexives Projekt<br />
2. I. wird <strong>in</strong> Bezug auf Lebenslauf konstruiert (Wissen aus verschiedenen Lebensphasen)<br />
3. Reflexion d. I. – ständige Selbstbefragung<br />
4. I. vollzieht sich als Interpretation d. eigenen Lebensgeschichte – erfor<strong>der</strong>t Kreativität<br />
5. Voraussetzung von I.: Kontrolle + Bewusstse<strong>in</strong> von Zeit<br />
6. Körperbewusstse<strong>in</strong> (Gefühle, bewusste Steuerung d. Körpers) vere<strong>in</strong>heitlicht I.<br />
7. Risiken + Chancen abwiegen! positiver Begriff von Risiko<br />
15
8. „Authentizität“ – „wahres“ vom „falschen“ Selbst unterscheiden<br />
9. Lebenslauf = Ablauf von Passagen Gestaltungsmöglichkeiten, Krisen, Schwierigkeiten<br />
10. I. heißt, Lebenserfahrung mit Lebens-Erzählung <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang zu br<strong>in</strong>gen<br />
Mittelpunkt: Körperbewusstse<strong>in</strong> bzw. <strong>in</strong>teraktive, narrative + rhetorische Strategien <strong>der</strong> Präsentation versch. Erfahrungen,<br />
Erlebnisse + Vorstellungen<br />
Identitätspolitik: Form positiver Stellungnahmen für marg<strong>in</strong>alisierte soziale Gruppen und Bewegungen; Ziel: Bewusstse<strong>in</strong><br />
für Merkmale + Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> jeweiligen Gruppe entwickeln<br />
I = <strong>in</strong>terpretierbare Form von Wissen; Selbstreflexion; kommunikatives Pr<strong>in</strong>zip<br />
3.2 Der <strong>in</strong>korporierte Habitus<br />
Bourdieu:<br />
Habitus = Ergebnis von „Inkorporierung“;<br />
- werden im Körper aufbewahrt, bleiben unbewusst erhalten und werden jedoch von an<strong>der</strong>en, neueren Erfahrungen,<br />
Erlebnissen und E<strong>in</strong>drücken überlagert.<br />
- Er wird im Alltag im Rahmen von Rout<strong>in</strong>en und s<strong>in</strong>nstiftenden kulturellen Praktiken erworben und vom Individuum<br />
erlernt (Beobachten, Nachahmen von Gesten, Zeichen + kulturellen Ausdrucksweisen);<br />
- Familie legt Rahmen fest bleibt als Grundstruktur e<strong>in</strong> Leben lang erhalten;<br />
- zweite Natur des Menschen;<br />
- selbstverständlich;<br />
- Individueller und persönlicher Stil ist „angeboren“;<br />
- Beispiel „männlicher Habitus“ (siehe S. 80);<br />
- Bildungs- und Formungsprozess = Modus des Festhaltens und Hervorrufens <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
- Körper = Produkt von sozialer Benennungs- und E<strong>in</strong>prägungsarbeit<br />
- umfassende gesellschaftl. Konstruktionsarbeit biologische Natur Habitus<br />
4. Kritische Diskussion <strong>der</strong> Konzepte<br />
4.1 Zur Kritik am Identitätsbegriff<br />
- Identitätstheoretische Konzepte seien implizit normativ<br />
- Abwertung an<strong>der</strong>er Selbstbil<strong>der</strong> ( Schizophrenie, Wahns<strong>in</strong>n, soziale Devianz)<br />
- Identität als historisch gewachsene Anweisung und Strategie zur Formung und Diszipl<strong>in</strong>ierung <strong>der</strong> eigenen Person<br />
gerate aus dem Blick<br />
- Zumutung und Zwang<br />
- Selten im H<strong>in</strong>blick auf ges. Lebenslauf entwickelt (z.B. Än<strong>der</strong>ung d. berufl. I.)<br />
- Selbst-Entwürfe von E<strong>in</strong>zelpersonen haben ger<strong>in</strong>ger werdenden Anspruch auf Dauerhaftigkeit + Verb<strong>in</strong>dlichkeit<br />
4.2 Zur Kritik am Habitusbegriff<br />
- E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>mal ausgebildeter Habitus sei e<strong>in</strong>e „weitgehend lern- und entwicklungsunfähige Entität“ (Miller), e<strong>in</strong>e determ<strong>in</strong>istisches<br />
System<br />
- Begriffliches Korsett – ke<strong>in</strong> Platz f. Verän<strong>der</strong>ungen und Auswege<br />
- Gesellschaftlicher Wandel kann nicht erklärt werden<br />
Bourdieu: Habitus = theoretisches Konstrukt, das nicht festgelegt, son<strong>der</strong>n theoretisch zweigleisig angelegt ist.<br />
Es sieht beide Möglichkeiten vor: Wandel + Erhalt von Strukturen<br />
5. Zwischen Individuum und Gesellschaft, Handlung und Struktur, Normierung und Wandel<br />
Habituskonzept zielt auf Benennung von wie<strong>der</strong>kehrenden und charakteristischen Verhaltensweisen, die leiblich<br />
gebunden und hauptsächlich unbewusst vollzogen werden.<br />
16
H. variiert mit soz. Lage, kulturellem Milieu, Biografie d. Individuums.<br />
Identitätskonzept ist konzentriert auf Prozesse d. Reflexion + Interaktion, mittels <strong>der</strong>er Individuen Selbstbil<strong>der</strong> und<br />
Gruppenbil<strong>der</strong> herstellen<br />
I. s<strong>in</strong>d kommunikatives Pr<strong>in</strong>zip, das <strong>in</strong> Abhängigkeit vom zeitlichen und kulturellen Wandel <strong>der</strong> Ges. und <strong>der</strong> Individuen<br />
wirksam wird.<br />
Die Begriffe Identität und Habitus zeigen, dass die soziale Welt nicht e<strong>in</strong>fach durch das Anlegen e<strong>in</strong>es Analyserasters<br />
o<strong>der</strong> die E<strong>in</strong>teilung <strong>in</strong> A und B zu verstehen ist. Sie machen deutlich, dass Menschen und die Bed<strong>in</strong>gungen und Ergebnisse<br />
ihres Handelns als soziale Formen und Strukturen und als soziale Prozesse beschrieben werden müssen. Sie<br />
s<strong>in</strong>d Ausdruck von sozialen Verhältnissen, Situationen und Beziehungen, die e<strong>in</strong>mal vorkonstruiert und e<strong>in</strong>mal selbst<br />
gestaltet worden s<strong>in</strong>d.<br />
Verhältnis von Individuum + Ges. ist wechselseitig, das von Struktur + Handlung prozesshaft, das von Normierung +<br />
Wandel dialektisch.<br />
Lektion VI (S. 107)<br />
Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle (Rüdiger Peuckert)<br />
1. E<strong>in</strong>leitung<br />
1.1 Def<strong>in</strong>ition zentraler Begriffe<br />
Soziale Abweichung (Devianz) als Normverstoß: ruft soziale Reaktionen hervor, die den Abweichler strafen/ isolieren/<br />
behandeln/ bessern sollen.<br />
Soziale Kontrolle: Strukturen, Prozesse, Mechanismen, die Menschen dazu br<strong>in</strong>gen, Normen Folge zu leisten. Zentraler<br />
Bestandteil d. Prozesse d. sozialen Integration<br />
Externe soziale Kontrolle: sozialer Druck <strong>der</strong> Umwelt (negative Sanktionierungen)<br />
Interne soziale Kontrolle: Persönlichkeitssystem/ Gewissen des E<strong>in</strong>zelnen (Freud: Über-Ich)<br />
Recht = Instrument d. Sozialkontrolle (e<strong>in</strong>schneidendste Mittel u. Möglichkeit d. Sanktionierung)<br />
<strong>Soziologie</strong> befasst sich beson<strong>der</strong>s mit Abweichungen von den gesamtgesellschaftlichen Normen und Werten: Krim<strong>in</strong>alität,<br />
Alkoholismus, illegaler Drogenkonsum, psychische Krankheit, Suizid, Homosexualität, Prostitution etc.<br />
e<strong>in</strong>ige Abweichler haben Mitleid zu erwarten, an<strong>der</strong>e verbreiten Angst o<strong>der</strong> werden verachtet<br />
Jede Art abweichenden Verhaltens ist Abweichung von gesamtgesellschaftlich dom<strong>in</strong>anten Normen Devianz =<br />
gesellschaftliche Störung; Verstoß gegen zentrale Normen, die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion regeln;<br />
Anzeichen dafür, dass die Übernahmen zentraler Rollen nicht mehr gewährleistet ist<br />
1.2 Der beson<strong>der</strong>e Stellenwert krim<strong>in</strong>ellen Verhaltens<br />
Krim<strong>in</strong>alität ist seit Beg<strong>in</strong>n d. 1990er Jahre rückläufig<br />
2005 war die Krim<strong>in</strong>alitätsbelastung am höchsten bei jungen (männlichen) Menschen; Aufklärungsquote variiert<br />
deliktspezifisch: ø 55% (höchster Wert seit 1964)<br />
Tatverdächtige Nichtdeutsche: 20% (seit 1993 rückläufig); tatsächliche Krim<strong>in</strong>alitätsbelastung schwer ermittelbar, da<br />
Nichtdeutsche überproportional häufig männlich, unter 30, Großstadtbewohner (auch bei Deutschen höheres Krim<strong>in</strong>alitätsrisiko)<br />
Unter Verdächtigten und gerichtlich Bestraften waren überproportional häufig Angehörige d. unteren Sozialschichten,<br />
wobei deliktspezifisch zu differenzieren ist:<br />
17
- Aggressionstaten, E<strong>in</strong>bruchs- u. KFZ-Diebstahl: Unterschichtdelikte<br />
- Unterschlagungen, schwerer Betrug: mittlere + höhere Schichten (bes. Selbstständige)<br />
- Ladendiebstahl, Verkehrsstrafen: gleich häufig<br />
tatsächliches Ausmaß krim<strong>in</strong>ellen Verhaltens (entdeckt + unentdeckt) gleichmäßiger verteilt, als Zahlen über Verdächtige<br />
+ Verurteilte vermuten lassen<br />
Relation von weiblichen zu männlichen Verdächtigen von 1:5 auf 1:4 erhöht (letzte 25 Jahre): 2005 knapp ¼ Frauen<br />
Ausfilterungsprozess (verdächtig – abgeurteilt – verurteilt – stationär sanktioniert – e<strong>in</strong>sitzend) bei Frauen wesentlich<br />
stärker ausgeprägt ger<strong>in</strong>gere Tatschwere und/o<strong>der</strong> mil<strong>der</strong>e Behandlung<br />
2. Abweichendes Verhalten als <strong>in</strong>tegraler Bestandteil gesellschaftlicher<br />
Organisation<br />
2.1 Die These von <strong>der</strong> Normalität des Verbrechens<br />
Durkheim: „E<strong>in</strong> Phänomen ist dann als normal anzusehen, wenn es sich <strong>in</strong> je<strong>der</strong> bekannten Gesellschaft f<strong>in</strong>det und<br />
mit den Existenzbed<strong>in</strong>gungen <strong>der</strong> Gesellschaft selbst untrennbar verbunden ist.“<br />
Abweichendes Verhalten ist allgegenwärtig und unvermeidbar.<br />
Würde man versuchen, Krim<strong>in</strong>alität abzuschaffen – durch Steigerung des „Niveaus kollektiver Sittlichkeit“ – würde<br />
die Krim<strong>in</strong>alität nicht verschw<strong>in</strong>den, son<strong>der</strong>n nur ihre Form än<strong>der</strong>n.<br />
Durkheim (2007): „Man stelle sich e<strong>in</strong>e Gesellschaft von Heiligen vor, e<strong>in</strong> vollkommenes Kloster von beispielhaften<br />
Individuen. Verbrechen, im eigentlichen S<strong>in</strong>ne, werden dort unbekannt se<strong>in</strong>; aber Vergehen, welche dem Laien verzeihlich<br />
ersche<strong>in</strong>en mögen, werden dort das gleiche Aufsehen erregen, wie die gewöhnliche Straftat im gewöhnlichen<br />
Bewusstse<strong>in</strong>.“<br />
Abweichendes Verhalten ergibt sich aus den Existenzbed<strong>in</strong>gungen <strong>der</strong> Gesellschaft und ist letztlich das Ergebnis<br />
<strong>der</strong> E<strong>in</strong>zigartigkeit des <strong>in</strong>dividuellen Bewusstse<strong>in</strong>s<br />
2.2 Funktionen und Dysfunktionen abweichenden Verhaltens<br />
Funktional = systemerhaltend/-för<strong>der</strong>nd<br />
Dysfunktional = systemzersetzend/-schädlich<br />
Dysfunktional: beschädigen die physische, psychische und soziale Identität von Opfer und Täter, m<strong>in</strong><strong>der</strong>n Lebensqualität<br />
und verursachen Schaden<br />
Funktional: Soziale Konflikte und Abweichungen leisten e<strong>in</strong>en Beitrag dazu, die Lebensfähigkeit e<strong>in</strong>es sozialen Systems<br />
aufrechtzuerhalten, evtl. zu stärken (G. Simmel, Durkheim);<br />
Integratives gesellschaftliches Element: Positives erhält erst durch die Existenz und Kenntnis des Negativen S<strong>in</strong>n.<br />
Funktion <strong>der</strong> Normverdeutlichung: Zentrale Verhaltensregeln müssen immer wie<strong>der</strong> von neuem aufgrund von Regelverletzungen<br />
und <strong>der</strong> Bestrafung des Normbrechers <strong>in</strong>s öffentliche Bewusstse<strong>in</strong> gerufen und bekräftigt werden<br />
Sanktionen tragen dazu bei, Inhalt <strong>der</strong> Norm und Grenzen ihres Geltungsbereiches deutlich zu machen. Bleiben sie<br />
aus, wird die Grenze d. Erlaubten ausgedehnt<br />
Im Fall e<strong>in</strong>er restlosen Aufdeckung aller Straftaten würde das System sozialer Kontrolle zusammenbrechen und das<br />
Vertrauen und die Verlässlichkeit <strong>der</strong> gesellschaftlichen Ordnung zwangsläufig erschüttert symbolische Bedeutung<br />
des Strafrechts („Majestät des Ganzen“, G. H. Mead)<br />
Die Paradoxie <strong>der</strong> sozialen Kontrolle besteht daraus, dass die Bestrafungen des Täters <strong>in</strong> den gesetzestreuen Mitglie<strong>der</strong>n<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft die Hemmungen erzeugt, die ihnen e<strong>in</strong>e Rebellion unmöglich machen, und gleichzeitig <strong>der</strong><br />
Straftäter zum Fe<strong>in</strong>d <strong>der</strong> Gesellschaft abgestempelt wird, was nicht ohne Folgen bleibt für se<strong>in</strong>e Identität und weitere<br />
moralische Entwicklung.<br />
18
Innovationsfunktion: Abweichungen können Verän<strong>der</strong>ungsbedürftigkeit gesellschaftlicher zustände <strong>in</strong>s öffentliche<br />
Bewusstse<strong>in</strong> heben und somit weiterh<strong>in</strong> <strong>der</strong> Erstarrung vorbeugen und wichtige Schrittmacherfunktionen für den<br />
sozialen Wandel leisten.<br />
Durkheim: Das Verbrechen ist oft „bloß e<strong>in</strong>e Antizipation <strong>der</strong> zukünftigen Moral, <strong>der</strong> erste Schritt zu dem, was se<strong>in</strong><br />
wird“<br />
Solidarisierungsfunktion: Moralische Entrüstung über den Normbrecher kann das Geme<strong>in</strong>schaftsgefühl, die Integration<br />
e<strong>in</strong>er Gruppe od. Gesellschaft för<strong>der</strong>n<br />
Durkheim: „Abweichendes Verhalten vere<strong>in</strong>igt die aufrechten Gemüter und lässt sie zusammenrücken“<br />
Ventilfunktion: Aufstauung von Unzufriedenheit kann verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t werden und Personen, die bestimmte Normen nicht<br />
befolgen können o<strong>der</strong> wollen, werden nicht als Außenseiter stigmatisiert<br />
Ungeklärt bleibt, wo das funktionale Optimum an Verhaltenssanktionierung bzw. Sanktionsverzicht liegt.<br />
3. Erklärungsversuche abweichenden Verhaltens I: <strong>der</strong> traditionelle Ansatz<br />
3.1 Das ätiologische Paradigma<br />
Ursachentheorien und <strong>in</strong>teraktionistische Devianzperspektive zur Erklärung abweichenden Verhaltens; grundlegendes<br />
Interesse <strong>der</strong> (älteren) ätiologischen (griech.: Lehre von den Ursachen) Ansatzes d. Devianzforschung: Welche<br />
Bed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d abweichendem Verhalten ursprünglich zuzurechnen?<br />
Kennzeichen des ätiologischen Ansatzes nach Keupp:<br />
• Absolutistische Perspektive: Es gibt allgeme<strong>in</strong>gültige, situationsübergreifende soziale Normen, die Urteilssicherheit<br />
verbürgen. Für e<strong>in</strong>en Außenstehenden ist e<strong>in</strong>deutig und objektiv feststellbar, ob im konkreten Fall<br />
abweichendes Verhalten vorliegt o<strong>der</strong> nicht<br />
• Täterzentriertheit: Ursachen/Bed<strong>in</strong>gungskomplex aufdecken, die den Normbrecher zum Normbruch veranlasst<br />
haben und ihn vom Konformen unterscheiden<br />
• Korrektur<strong>in</strong>teresse: Prävention, Behandlung, Korrektur, soziale Kontrolle abweichenden Verhaltens; Abweichler<br />
= behandlungsbedürftig; Manipulation d. Bed<strong>in</strong>gungen vermeiden o<strong>der</strong> abbauen unerwünschter<br />
Verhaltensweisen; Keckeisen: „Verwissenschaftlichung <strong>der</strong> sozialen Kontrolle“<br />
Grundannahme: Zwischen Abweichlern und Konformen besteht fundamentaler Unterschied man versucht, Faktoren<br />
aufzudecken, die abweichende Personen von konformen unterscheiden; diese s<strong>in</strong>d Ursachen <strong>der</strong> Abweichung<br />
3.2 Die Anomietheorie von Robert K. Merton<br />
Durkheim: Devianz (= Ausdruck von Anomie [Norm- o<strong>der</strong> Regellosigkeit]) als Folge übersteigerter Aspiration und<br />
Erwartungshaltungen <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
Merton: Versuch e<strong>in</strong>er sozialstrukturellen Erklärung <strong>der</strong> hohen Krim<strong>in</strong>alitätsbelastung <strong>der</strong> unteren Sozialschichten<br />
Merton will Frage beantworten, „auf welche Weise e<strong>in</strong>ige sozialstrukturelle Gegebenheiten bestimmte Personen <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Gesellschaft e<strong>in</strong>em Druck aussetzen, sich eher abweichend als konform zu verhalten“<br />
Kulturelle Struktur: erstes Element = kulturell festgelegte Ziele, Absichten, Interessen, „die allen o<strong>der</strong> unterschiedlich<br />
positionierten Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Gesellschaft als legitime Zielsetzungen dienen“ „erstrebenswerte“ D<strong>in</strong>ge<br />
zweites Element (= „regulative Normen“, „<strong>in</strong>stitutionalisierte Mittel“) bestimmt, reguliert, kontrolliert erlaubte Wege<br />
zum Erreichen dieser Ziele<br />
Anomie = Zusammenbruch d. kulturellen Struktur Zusammenhang bei<strong>der</strong> Elemente lockert sich, Ziele und regulative<br />
Normen werden unterschiedlich stark betont<br />
Soziale Struktur: Stellung d. E<strong>in</strong>zelnen im sozialen Ungleichheitsgefüge; „Abweichendes Verhalten kann als Symptom<br />
für das Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>klaffen von kulturell vorgegebenen Zielen und von sozial strukturierten Wegen, auf denen diese<br />
Ziele zu erreichen s<strong>in</strong>d, betrachtet werden.“ Unterschichtkrim<strong>in</strong>alität ist e<strong>in</strong>e ganz „normale“ Reaktion objektiv<br />
19
enachteiligter Individuen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesellschaft, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Reichtum und Erfolg ver<strong>in</strong>nerlichte Erfolgsziele s<strong>in</strong>d und <strong>der</strong><br />
Zugang zu legitimen Mitteln <strong>der</strong> Zielerreichung für große Gruppen <strong>der</strong> Bevölkerung beschränkt ist. Massenarbeitslosigkeit<br />
Anomiedruck steigt permanent an<br />
Reaktionsweisen auf Anomie (Skizze S. 116)<br />
• Konformität: man lebt mit anomischer Spannung, weil herrschende Ziele + <strong>in</strong>stitutionelle Normen stark ver<strong>in</strong>nerlicht<br />
• Innovation: Krim<strong>in</strong>alität (rechtswidrige Mittel zur Zielerreichung)<br />
• Ritualismus: eigenes Anspruchsniveau gesenkt; zwanghaftes Festhalten an <strong>in</strong>stitutionellen Normen<br />
• Rückzug (Des<strong>in</strong>teresse, Apathie): Ziele aufgegeben, Verhalten stimmt nicht mit <strong>in</strong>stitutionellen Normen<br />
übere<strong>in</strong> (Stadtstreicher, Alkoholiker, Süchtige)<br />
• Rebellion: Entfremdung von herrschenden Zielen und Normen; zielt auf <strong>E<strong>in</strong>führung</strong> e<strong>in</strong>er neuen Sozialstruktur<br />
ab: Erfolgsmaßstäbe stark umgeformt, engere Beziehung zw. Leistung und Belohnung<br />
3.3 Subkulturtheorien abweichenden Verhaltens<br />
Normen, Werte und Symbole haben nicht für alle Gesellschaftsmitglie<strong>der</strong> gleiche Geltung und Bedeutung. In Subsystemen<br />
(Homosexuelle, Gangs, …) gelten auch Normen + Werte, die <strong>in</strong> Wi<strong>der</strong>spruch zu den Normen + Werten <strong>der</strong><br />
dom<strong>in</strong>anten Kultur stehen.<br />
Subkulturen verleihen ihren Mitglie<strong>der</strong>n Status, den sie an<strong>der</strong>weitig nicht erreichen können. Sie rechtfertigen Fe<strong>in</strong>dschaften<br />
und Aggressionen gegen jene, <strong>der</strong>entwegen die Selbstachtung ihrer Mitglie<strong>der</strong> leidet und verm<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
Angst- und Schuldgefühle.<br />
Bei Bandendel<strong>in</strong>quenz (A. K. Cohen) handelt es sich nicht um e<strong>in</strong>e Reaktion auf aktuelle, sozialstrukturell <strong>in</strong>duzierte<br />
Frustrationen, son<strong>der</strong>n um mehr o<strong>der</strong> weniger zufällige Begleitersche<strong>in</strong>ungen von Handlungen, die <strong>der</strong> kulturellen<br />
Tradition <strong>der</strong> Unterschicht o<strong>der</strong> von Teilen <strong>der</strong> Unterschicht entsprechen.<br />
Kritik am ätiologischen Ansatz:<br />
- Übergang von Konformität zu Krim<strong>in</strong>alität wird nicht als Prozess son<strong>der</strong>n als Sprung gesehen<br />
- Eventueller Übergang von abweichendem Verhalten zu dauerhafter Konformität e<strong>in</strong>er Person nicht beachtet<br />
- Unbeachtet, dass abweichendes Verhalten Resultat e<strong>in</strong>es Prozesses ist, <strong>der</strong> sich als Interaktion vollzieht<br />
- Gel<strong>in</strong>gt nie, Faktoren zu f<strong>in</strong>den, die tatsächlich e<strong>in</strong>deutig zwischen abweichenden und konformen Personen<br />
differenzieren<br />
- Erklären mehr Abweichung, als tatsächlich zu registrieren ist<br />
20
4. Erklärungsversuche abweichenden Verhaltens II: die <strong>in</strong>teraktionistische Devianzperspektive<br />
4.1 Regelverletzungen, Devianzzuschreibungen und soziale Kontrolle<br />
Merkmale des label<strong>in</strong>g approach:<br />
- Es werden zahlreiche Dimensionen problematisiert, die früher den Status von Selbstverständlichkeiten hatten<br />
- Aufmerksamkeit auf bisher vernachlässigte Aspekte<br />
- Devianz = sich fortlaufend entwickelndes Ergebnis dynamischer Interaktionsprozesse<br />
- Prozesse des Def<strong>in</strong>ierens, Interagierens und Reagierens e<strong>in</strong>geschlossen<br />
E. M. Lemert: Abweichendes Verhalten ist we<strong>der</strong> durch die Merkmale des Handelns noch durch die Normen, gegen<br />
die es verstößt, e<strong>in</strong>deutig charakterisierbar, son<strong>der</strong>n von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung s<strong>in</strong>d soziale Zuschreibungsprozesse.<br />
Def<strong>in</strong>itionen und Reaktionen sozialer Umwelt im Vor<strong>der</strong>grund.<br />
H. S. Becker: „Ich me<strong>in</strong>e, dass gesellschaftliche Gruppen abweichendes Verhalten dadurch schaffen, dass sie Regeln<br />
aufstellen, <strong>der</strong>en Verletzung abweichendes Verhalten konstituiert, und dass sie diese Regeln auf bestimmte Menschen<br />
anwenden, die sie zu Außenseitern abstempeln.“ Abweichendes V. = Konsequenz d. Anwendung von Regeln<br />
und Sanktionen. „Abweichendes Verhalten ist Verhalten, das Menschen so bezeichnen.“<br />
Der Label<strong>in</strong>g-Ansatz berücksichtigt Akteur, soziales Publikum und den sozialen Kontext, <strong>in</strong> dem Verhalten stattf<strong>in</strong>det.<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Normen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>terpretationsbedürftig soziales Publikum entscheidet, ob e<strong>in</strong>er bestimmten Handlung<br />
o<strong>der</strong> Person das Etikett abweichend zugeschrieben wird o<strong>der</strong> nicht.<br />
Grundgedanke: Prozesse <strong>der</strong> Normsetzung und <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Normanwendung und sozialen Kontrolle erzeugen<br />
o<strong>der</strong> stabilisieren abweichendes Verhalten u. U. erst.<br />
4.2 Primäre und sekundäre Devianz (Lemert)<br />
Sekundäre Devianz = Folge gesellschaftlicher Reaktionen und Rollenzuschreibungen. Begriffse<strong>in</strong>führung, um auf Bedeutung<br />
d. gesellschaftlichen Reaktionen für die Erforschung <strong>der</strong> Ursachen und Formen des abweichenden Verhaltens<br />
und se<strong>in</strong>e Stabilisierungen zu abweichenden sozialen Rollen und Verhaltenssystemen aufmerksam zu machen.<br />
Handlungen, <strong>der</strong>en Bezugspunkte gewisse Rollen und Selbste<strong>in</strong>schätzungen s<strong>in</strong>d, machen sekundäre Devianz aus.<br />
Primäre Devianz: durch bestimmte Normen vordef<strong>in</strong>iert <strong>in</strong> d. Ges. weit verbreitet; unterschiedliche Ursachen; wirkt<br />
sich nur am Rande auf den Status und die psychische und physische Struktur <strong>der</strong> betreffenden Personen aus; kann<br />
se<strong>in</strong>, dass Neutralisierung nicht mehr möglich Person reagiert auf soziale Reaktionen mit weiteren Regelverletzungen<br />
Label<strong>in</strong>g-Ansatz ist eher e<strong>in</strong>e Theorie abweichen<strong>der</strong> Rollen als abweichenden Verhaltens:<br />
F. Sack: „Es f<strong>in</strong>det e<strong>in</strong> Transformationsprozess statt, <strong>der</strong> darauf abzielt, dass e<strong>in</strong> ‚gegebener Sachverhalt‘, e<strong>in</strong>e ‚Primärabweichung‘,<br />
sozial, symbolisch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Weise ‚verarbeitet‘ und verän<strong>der</strong>t wird, dass gleichsam e<strong>in</strong>e neue soziale<br />
Wirklichkeit e<strong>in</strong>steht, nämlich die ‚Rolle‘ des Krim<strong>in</strong>ellen etc. Dabei ist die Rolle als strukturiertes Bündel von Erwartungen,<br />
Eigenschaften, Rechten, Pflichten usw. e<strong>in</strong> Mehr und e<strong>in</strong> An<strong>der</strong>es als die schlichte Verletzung e<strong>in</strong>er<br />
Norm.“<br />
21
4.3 Abweichendes Verhalten als Prozess (H. S. Becker)<br />
Prozessualer Ansatz: Verhaltensmuster entwickeln sich <strong>in</strong> regelmäßiger Abfolge (abweichende Laufbahn, abweichende<br />
Karriere)<br />
Die Erklärung je<strong>der</strong> Stufe ist Teil <strong>der</strong> Erklärung für das gesamte Verhalten.<br />
Stufen e<strong>in</strong>er Abweichlerkarriere:<br />
1. Begehen e<strong>in</strong>er Regelverletzung (Warum geben konventionelle Menschen ihren abweichenden Impulsen<br />
nicht nach? Auf welche Art und Weise lassen Abweichler [herrschende Werte stark <strong>in</strong>ternalisiert!] Schuldgefühle<br />
erst gar nicht aufkommen o<strong>der</strong> rationalisieren sie nachträglich?)<br />
2. Öffentliche Zuschreibung des Etiketts „abweichend“ (Zuschreibung erfolgt höchst selektiv: gruppen-, situations-<br />
u. personenspezifisch; höhere Krim<strong>in</strong>alitätsrate d. Unterschicht, weil eher zu abweichendem Verhalten<br />
verdächtigt und abgeurteilt [höhere Schichten können sich eher wehren und begehen eher schwerer durchschaubare<br />
Formen von Devianz])<br />
3. Generalisierung (drastischer Wandel <strong>in</strong> <strong>der</strong> öffentlichen Beurteilung des Normbrechers; Merkmal „abweichend/auffällig“<br />
wird zu zentralem Kriterium [master status] automatische Zuschreibung an<strong>der</strong>er unerwünschter,<br />
angeblich mit diesem Merkmal verbundener Merkmale [Suche e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dung zu biografischer<br />
Vorgeschichte])<br />
4. Stigmatisierung (Ausschluss von konformen Aktivitäten; Becker: „… dass die Behandlung von Menschen mit<br />
abweichendem Verhalten ihnen die normalen, den meisten Menschen zugebilligten Mittel und Wege vorenthält,<br />
die nötig s<strong>in</strong>d, um Gewohnheitshandlungen des alltäglichen Lebens verrichten zu können“. Entsprechend<br />
muss <strong>der</strong> Mensch mit abweichendem Verhalten notgedrungen illegitime Gewohnheitshandlungen<br />
entwickeln.)<br />
5. Abweichende Identität (Sich-selbst-erfüllende Prophezeiung; Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit e<strong>in</strong>er weiteren Beteiligung<br />
an abweichendem Handeln steigt<br />
6. E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> Abweichlergruppe o<strong>der</strong> Subkultur (Stabilisierung abweichenden Verhaltens)<br />
Prozess ist abgeschlossen, wenn Person sich mit deviantem Status identifiziert und e<strong>in</strong>e deviante Lebensweise<br />
praktiziert.<br />
Kritik an Karrieremodellen:<br />
- Fraglich, ob abweichende Laufbahnen alle Stufen <strong>in</strong> genannter Reihenfolge durchlaufen müssen<br />
- Determ<strong>in</strong>istischer Charakter (Stigmatisierter ist als Opfer gesellschaftlicher Zuschreibungsprozesse <strong>in</strong><br />
unausweichliches Netzwerk verstrickt)<br />
- Man sollte auch Menschen e<strong>in</strong>beziehen, die nur e<strong>in</strong>en flüchtigen Kontakt mit abweichendem Verhalten hatten<br />
und zu konventionellen Lebensweisen zurückgefunden haben<br />
Neuere Ansätze: krim<strong>in</strong>alisierende Wirkung d. Instanzen sozialer Kontrolle.<br />
E<strong>in</strong>e angemessene Erklärung von Devianz sollte aber beide Aspekte – Regelverletzungen und Kontrollverhalten –<br />
berücksichtigen.<br />
70er + 80er Jahre: Formwandel sozialer Kontrolle: Entwicklung neuer „ambulanter“ Sanktionen + Privatsierung sozialer<br />
Kontrolle (als Alternativen zur Härte staatlichen Strafens)<br />
90er Jahre: Pendel wie<strong>der</strong> zurückgeschlagen: soziale Ausschließung zum zentralen Leitmotiv und verbesserte technische<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong> Überwachung („Lauschangriff“) und Sanktionierung („elektronisches Halsband“).<br />
22
Lektion VII (S. 129)<br />
Die soziale Gruppe (Bernhard Schäfers)<br />
1. Sozial- und Begriffsgeschichte <strong>der</strong> Gruppe<br />
1.1 Die Eigenständigkeit <strong>der</strong> Gruppe<br />
Son<strong>der</strong>stellung <strong>der</strong> Gruppe unter den sozialen Gebilden:<br />
• Anthropologie: Mensch = Gruppenwesen<br />
• Gruppe ist verbreitetstes soziales Gebilde<br />
• Gruppe verb<strong>in</strong>det Individualnatur e<strong>in</strong>es Menschen mit se<strong>in</strong>er Sozialnatur, das Individuum mit <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
Gruppe = „Paradigma <strong>der</strong> Vergeme<strong>in</strong>schaftung und Vergesellschaftung“ (Schwonke); das Soziale<br />
wird anschaulich und verstehbar<br />
1.2 Die Bedeutung <strong>der</strong> Gruppe im Vergesellschaftungsprozess<br />
Das Bewusstse<strong>in</strong> von <strong>der</strong> Gruppenbezogenheit des sozialen Handelns wurde <strong>in</strong> dem Maße verstärkt wie sonstige<br />
Lebens- und Handlungsbed<strong>in</strong>gungen immer mehr den Charakter des Organisierten, des Formalen, des Gesellschaftlichen<br />
und Kollektiven annahmen.<br />
Die Selbstverständlichkeit geme<strong>in</strong>schaftlicher Handlungs- und Sozialbeziehungen <strong>der</strong> vor<strong>in</strong>dustriellen Welt wurde<br />
mehr und mehr aufgehoben (Individualismus, Industrialisierung, Verstädterung, …; Mechanisierung und Automatisierung<br />
<strong>der</strong> Produktion).<br />
Entstehung immer neuer Gruppen als „Reflex auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen“ (Schäfers):<br />
• gang: Ersatz für „broken home“<br />
• <strong>in</strong>formelle Gruppe <strong>in</strong> formellen Organisationen und ihre Bedeutung für Individuum und Organisation<br />
• peers<br />
• Gruppe als „Bündel“ von Sympathie- und Antipathiebeziehungen und als Basis, die sozialen und psychischen<br />
Probleme <strong>der</strong> Zeit zu heilen<br />
• Gruppen im Bereich d. Selbsthilfe, <strong>der</strong> politischen und sozialen Identitätsf<strong>in</strong>dung und Selbstbehauptung, <strong>der</strong><br />
Alternativgruppen <strong>in</strong> den verschiedenen Projektbereichen<br />
Noch Ende <strong>der</strong> 60er Jahre war die Bildung neuer Gruppen e<strong>in</strong> Reflex auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen mit<br />
<strong>der</strong> Absicht, diese zu verän<strong>der</strong>n.<br />
Wandel Anfang 70er: Gruppe bzw. Gruppenbildung als Zufluchtsort des Individuums (gesellsch. Zwängen entgehen<br />
bzw. ihnen standhalten)<br />
1.3 Geschichte des Gruppenbegriffs<br />
Zunächst theoretisch und ideologisch überfrachtet: sowohl gegen <strong>in</strong>dividualistische, organizistische wie gegen klassentheorethische<br />
(marxistische) Theorie über das Soziale gerichtet.<br />
Größte Hemmnis <strong>der</strong> Verwendung des Gruppenbegriffs als sozialer Kategorie, weil er durch F. Tönnies´ „Geme<strong>in</strong>schaft<br />
und Gesellschaft“ bereits behandelt schien.<br />
Kle<strong>in</strong>gruppe (small group; v.a. <strong>in</strong> d. amerikanischen <strong>Soziologie</strong> entwickelt): G. Simmel, L. von Wiese<br />
23
Simmel:<br />
• Existenz bestimmter Gruppen ist nach Zahl, Größe und Struktur von <strong>der</strong> umgebenden Gesellschaft abhängig<br />
• Formen und Prozesse <strong>der</strong> Gruppenbildung <strong>in</strong> Gegenwartsgesellschaften s<strong>in</strong>d bee<strong>in</strong>flusst von den demokratischen<br />
Tendenzen <strong>in</strong> diesen Ges.<br />
• Ursprünge von Gruppenbildung s<strong>in</strong>d v.a. zu sehen <strong>in</strong> den Bed<strong>in</strong>gungen von K<strong>in</strong>dheit und Sozialisation, <strong>der</strong><br />
Arbeit und dem geme<strong>in</strong>samen Wohnplatz<br />
• „die Gruppen, zu denen <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelne gehört, bilden gleichsam e<strong>in</strong> Koord<strong>in</strong>ationssystem, <strong>der</strong>art, dass jede<br />
neu h<strong>in</strong>zukommende ihn genauer und unzweideutiger bestimmt“<br />
Von Wiese: „Merkmale des Idealtyps <strong>der</strong> Gruppe“:<br />
• Relative Dauer und relative Kont<strong>in</strong>uität<br />
• Organisiertheit, die auf Verteilung von Funktionen an ihre Mitglie<strong>der</strong> beruht<br />
• Vorstellungen von <strong>der</strong> Gruppe bei ihren Glie<strong>der</strong>n<br />
• Entstehung von Traditionen und Gewohnheiten bei längerer Dauer<br />
• Wechselbeziehungen zu an<strong>der</strong>en Gebilden<br />
• Das Richtmaß (v.a. bei sachlicheren, den großen Gruppen)<br />
Drei Gruppenarten: Paar, kle<strong>in</strong>e + große Gruppen<br />
Von Wiese hat dazu beigetragen, den Gruppenbegriff aus se<strong>in</strong>er Überfrachtung herauszulösen E<strong>in</strong>leitung des<br />
Gruppenbegriffs als analytische Kategorie<br />
1.4 Def<strong>in</strong>ition <strong>der</strong> Gruppe<br />
Def<strong>in</strong>itionselemente:<br />
• Jeweils bestimmte Zahl von Mitglie<strong>der</strong>n (bei Kle<strong>in</strong>gruppen ca. 3 – 25)<br />
• geme<strong>in</strong>sames Gruppenziel und Verhaltensmotiv für die Gruppe <strong>in</strong>sgesamt wie für jedes e<strong>in</strong>zelne Mitglied<br />
• „Wir-Gefühl“ <strong>der</strong> Gruppenzugehörigkeit und des Gruppenzusammenhalts ( Unterscheidung „Eigengruppe“<br />
+ „Fremdgruppe“)<br />
• System geme<strong>in</strong>samer Normen und Werte als Grundlage <strong>der</strong> Kommunikations- und Interaktionsprozesse<br />
• Geflecht aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong> bezogener sozialer Rollen (Rollendifferenzial), das auf das Gruppenziel bezogen ist und<br />
unter an<strong>der</strong>em sowohl die Zielerreichung als auch die Lösung von Konflikten gewährleistet<br />
(Schäfers Def<strong>in</strong>ition siehe Buch, S. 133)<br />
2. Die Primärgruppe als Kle<strong>in</strong>gruppe<br />
2.1 Die Konzeptualisierung <strong>der</strong> Primärgruppe durch Cooley<br />
- Primärgruppen = sehr enge unmittelbare persönliche Verb<strong>in</strong>dungen (face-to-face association);<br />
- fundamental an <strong>der</strong> Herausbildung <strong>der</strong> Sozialnatur und <strong>der</strong> sozialen Ideale <strong>der</strong> Individuen beteiligt;<br />
- das eigene Selbst ist zum<strong>in</strong>dest für viele Zwecke identisch mit dem geme<strong>in</strong>samen Leben und dem Ziel <strong>der</strong><br />
Gruppe;<br />
- Gruppe ist zu e<strong>in</strong>em „Wir“ geworden<br />
- Wichtigste Sphären: Familie, Spielgruppe d. K<strong>in</strong><strong>der</strong>, Nachbarschaft/Dorfgeme<strong>in</strong>de d. Erwachsenen – praktisch<br />
universal<br />
- Verän<strong>der</strong>t sich nicht im gleichen Maß wie komplexere Beziehungen. Bilden stetige Quelle, aus <strong>der</strong> diese Beziehungen<br />
entspr<strong>in</strong>gen<br />
- Quellpunkte des Lebens für das Individuum und die sozialen Institutionen; universale Natur<br />
2.2 Def<strong>in</strong>itionsmerkmale <strong>der</strong> Primärgruppe<br />
24
• Primärgruppen s<strong>in</strong>d primär u.a. <strong>in</strong> dem S<strong>in</strong>ne, dass sie zeitlich und <strong>in</strong>haltlich als erste an <strong>der</strong> Formung <strong>der</strong> Sozialnatur<br />
des Menschen beteiligt s<strong>in</strong>d;<br />
• Das soziale Selbst (e<strong>in</strong>e Individualität) entsteht im geme<strong>in</strong>samen Leben <strong>der</strong> Primärgruppe;<br />
• Basis und Voraussetzung <strong>der</strong> Selbst-Identifikation ist die Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme <strong>der</strong> Rollen<br />
(Motive, Zwecke, Verhaltensweisen, Normen etc.) an<strong>der</strong>er Primärgruppen-Mitglie<strong>der</strong> <strong>in</strong> das eigene Selbstbild;<br />
• Den Primärgruppen Familie, Spielgruppe und Nachbarschaft kommt zu allen Zeiten und auf allen Stufen <strong>der</strong><br />
gesellschaftlichen Entwicklung e<strong>in</strong>e herausragende Bedeutung zu bei <strong>der</strong> Formung <strong>der</strong> sozialen Persönlichkeit;<br />
• Primärgruppen s<strong>in</strong>d primär auch <strong>in</strong> dem S<strong>in</strong>n, dass sie nicht <strong>in</strong> gleichem Maße dem sozialen Wandel unterliegen<br />
wie komplexere soziale Gebilde (sekundäre Gruppen);<br />
• Primärgruppen können sich wegen <strong>der</strong> Unmittelbarkeit und Intimität des Gruppenlebens nicht zu weit und zu<br />
abstrakt von <strong>der</strong> Erfahrungsmöglichkeit des e<strong>in</strong>zelnen Mitglieds entfernen<br />
• Primärgruppen existieren und entstehen unter allen <strong>in</strong>stitutionellen und gesellschaftlichen Bed<strong>in</strong>gungen; ihre<br />
freie und unbeschränkte Existenz ist e<strong>in</strong> Kriterium für die Beurteilung <strong>der</strong> komplexeren sekundären Gruppen<br />
und letztlich <strong>der</strong> Gesellschaft;<br />
• Die Menschen gehören den Primärgruppen als Individuen an, nicht als Funktionsträger<br />
2.3 Weiterentwicklung des Primärgruppenkonzepts<br />
Primärgruppenkonzept soll e<strong>in</strong>en Schlüssel liefern<br />
• Zur menschlichen Sozialnatur und ihrer Entwicklung<br />
• Zur Identitätsbildung<br />
• Zu den erfor<strong>der</strong>lichen Konstanten im sozialen Wandel und <strong>der</strong> gesellschaftlichen Evolution<br />
30er + 40er Jahre: Kategorie <strong>der</strong> Primärgruppe differenziert und aufgespalten:<br />
• Informelle Gruppe<br />
• Bezugsgruppe<br />
• Orientierungsgruppe<br />
• Gruppe <strong>der</strong> peers<br />
• (Mitgliedschaftsgruppe)<br />
Def<strong>in</strong>itionselemente <strong>der</strong> Primärgruppe:<br />
• Face-to-face Assoziation<br />
• Unspezialisiertheit <strong>der</strong> Assoziation<br />
• Relative Dauer<br />
• Ger<strong>in</strong>ge Zahl <strong>der</strong> beteiligten Personen<br />
• Relative Intimität unter den Beteiligten<br />
25
Def<strong>in</strong>ition nach Dunphy:<br />
Primärgruppe = kle<strong>in</strong>e Gruppe, die<br />
- lange genug besteht, um feste emotionale B<strong>in</strong>dungen zw. ihren Mitglie<strong>der</strong>n zu entwickeln<br />
- funktional differenzierte Rollen + eigene Subkultur aufweist<br />
- Selbstbild d. Gruppe und <strong>in</strong>formelles normatives System enthält, das gruppenspezifische Aktivitäten <strong>der</strong><br />
Gruppenmitglie<strong>der</strong> kontrolliert<br />
Def<strong>in</strong>ition nach Schäfers:<br />
„Primäre Kle<strong>in</strong>gruppen s<strong>in</strong>d jene Kle<strong>in</strong>gruppen, denen Menschen zur Vermittlung primärer Sozialkontakte und zur<br />
Herausbildung ihres (sozialen) Ich angehören. Sie bieten über die Phase <strong>der</strong> primären Sozialisation und sozialen Integration<br />
h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Möglichkeit <strong>der</strong> Identitätsbehauptung, <strong>der</strong> <strong>in</strong>timen und spontanen Sozialbeziehungen<br />
und <strong>der</strong> Entlastung von den Anfor<strong>der</strong>ungen sekundärer Gruppen.“<br />
Axiome <strong>der</strong> Sozialisation:<br />
• Zur Herausbildung <strong>der</strong> menschlichen Sozialnatur bedarf es relativ kle<strong>in</strong>er Gruppen, <strong>in</strong> denen Intimität und Intensität<br />
des Erlebens und <strong>der</strong> Wert- und Normvermittlung gewährleistet s<strong>in</strong>d<br />
• Das sozialisierte Individuum ist darüber h<strong>in</strong>aus auf kle<strong>in</strong>e, überschaubare Intimgruppen angewiesen, <strong>in</strong> denen<br />
es se<strong>in</strong> Selbstbild überprüfen kann und „Schutz“ von bestimmten gesellschaftlichen Phänomenen f<strong>in</strong>det,<br />
wie Anonymität, Entfremdung, Rollen-Spezialisierung und Vere<strong>in</strong>zelung<br />
Gesamtgesellschaftliche Bedeutung <strong>der</strong> Primärgruppen:<br />
„Es ist nachdrücklich daran zu er<strong>in</strong>nern, dass ke<strong>in</strong> Versuch, Gesellschaft auf e<strong>in</strong>er nicht-primären Basis zu begründen,<br />
jemals auf Dauer erfolgreich gewesen ist. (Auch) unser eigenes Zivilisations-Experiment entgeht nicht den Schwierigkeiten,<br />
die unausweichlich jene Anstrengungen begleiten, große Sekundärgruppen (large secondary groups) wie<br />
Kooperationen, Städte, Nationen diejenigen Bedürfnisse <strong>der</strong> menschlichen Natur erfüllen zu lassen, die aus <strong>der</strong> Erfahrung<br />
von Primärgruppen stammen.“ (Cooley)<br />
3. Familie als Gruppe<br />
Familie (verwandtschaftliche Konstellation, <strong>in</strong> <strong>der</strong> sich Ältere um den Nachwuchs kümmern) = Urform des Gruppenlebens<br />
3.1 Familie als Son<strong>der</strong>form <strong>der</strong> Kle<strong>in</strong>gruppe<br />
Beson<strong>der</strong>heiten:<br />
• Familie ist <strong>in</strong> ihren Zwecken weitgehend vorkonstruiert<br />
• Familie als Gruppe ist i.d.R. zwei-geschlechtlich und – zumal im Falle <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Kle<strong>in</strong>familie – zweigenerativ.<br />
Alter, Geschlecht und Generationsabstand s<strong>in</strong>d für sie konstitutive Merkmale<br />
• Familie ist aufgrund des Familienzyklus´ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em dauerhaften Prozess <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung, <strong>der</strong> das familiale<br />
Normen- und Wertgefüge und das gruppenspezifische Rollendifferenzial wie alle damit verbundenen Strukturen<br />
und Prozesse berührt, e<strong>in</strong>schließlich <strong>der</strong> Zielsetzungen des familialen Gruppenlebens<br />
• Mitglie<strong>der</strong> schließen sich von <strong>der</strong> „Familienbasis“ aus an<strong>der</strong>en Gruppen an (Spielgruppen, peers). Familie ist<br />
gleichsam <strong>der</strong> Pol, von dem aus die Gruppenaktivitäten <strong>der</strong> Familienmitglie<strong>der</strong> gestartet werden<br />
Strukturmerkmale <strong>der</strong> Familie als Gruppe:<br />
• Struktur ist vorgegeben (zumal f. die K<strong>in</strong><strong>der</strong>) und wandelt sich mit dem Familienzyklus – was erhebliche<br />
Auswirkungen auf die jeweils vorherrschenden Ziele und familialen Gruppenprozesse hat<br />
• Mit <strong>der</strong> Struktur ist e<strong>in</strong> familiales Normen- und Wertsystem vorgegeben, das häufig über viele Generationen<br />
tradiert ist<br />
• Die Mitglie<strong>der</strong> und Mitgliedschaftsrollen s<strong>in</strong>d im H<strong>in</strong>blick auf E<strong>in</strong>- und Austritt und die Diffusität (Nichtfestgelegtse<strong>in</strong>)<br />
<strong>der</strong> Rollen an<strong>der</strong>s „geregelt“ als <strong>in</strong> sonstigen sozialen Gruppen<br />
26
• Bestimmte Strukturen – wie die <strong>der</strong> Autorität, <strong>der</strong> Kompetenz- und Anordnungsbefugnisse – s<strong>in</strong>d vorgegeben<br />
und entstehen nicht erst im Prozess <strong>der</strong> Herausbildung e<strong>in</strong>er spezifischen Gruppenstruktur und Gruppenidentität<br />
3.2 Zur B<strong>in</strong>nendifferenz <strong>der</strong> Familie<br />
Familiale Gruppenbildung: Vater (V); Mutter (M), K<strong>in</strong>d (K):<br />
1. K – M – V 2. K – M – (V) 3. K – V – (M) 4. M – V – (K)<br />
nicht e<strong>in</strong>mal Kernfamilie weist volle „Ausnutzung“ aller möglichen Beziehungsmuster auf und e<strong>in</strong>e „gleichmäßige<br />
Verteilung <strong>der</strong> Beziehung <strong>in</strong> diesen Familien-`Kle<strong>in</strong>´-Gruppen“ ist nicht möglich. (Claessens)<br />
J. L. Moreno: Harmonische Zusammensetzung sozialer Gruppen = wichtigste Voraussetzung für gesellschaftliche<br />
Harmonie. „Gesetz des soziodynamischen Effekts“ als „Grenze des emotionalen Ausdehnungsvermögens von Gruppenstrukturen“<br />
(„Gesetzmäßigkeit“ eher „vermutbare Regelmäßigkeit“, da bei Individuen sehr unterschiedlich)<br />
4. Formelle und <strong>in</strong>formelle Gruppe<br />
Strukturpr<strong>in</strong>zipien des Sozialen: formell und <strong>in</strong>formell<br />
Informell = Kürzel für jene Aspekte <strong>der</strong> sozialen Wirklichkeit, <strong>in</strong> denen das Menschliche im humanen S<strong>in</strong>n, das Persönliche<br />
und Spontane, das Freundschaftliche und Gefühlsmäßige zum Ausdruck gebracht werden können. Nähe<br />
zum Konzept <strong>der</strong> Primärgruppe<br />
Entwicklungslogik <strong>in</strong>formeller Gruppen:<br />
• Aus Grundbedürfnissen <strong>der</strong> Sozialnatur des Menschen (u.a. Bedürfnisse <strong>der</strong> Kommunikation und Interaktion,<br />
die nicht formalisiert s<strong>in</strong>d)<br />
• Als Gegenstruktur zu hochgradig formalisierten Formen <strong>der</strong> Interaktion (also z. B. <strong>in</strong> formalisierten Arbeitsprozessen;<br />
<strong>in</strong> Kompetenzhierarchien wie beim Militär; <strong>in</strong> allen geschlossenen Anstalten)<br />
5. Weitere Beson<strong>der</strong>heiten des Gruppenlebens<br />
5.1 Innere Gruppenprozesse<br />
• Abhängig von Außenweltbed<strong>in</strong>gungen <strong>der</strong> jeweiligen Gruppe<br />
• Abhängig davon, was die e<strong>in</strong>zelnen Gruppenmitglie<strong>der</strong> <strong>in</strong> das Gruppenleben e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen (z.B. Wissen, Bildung,<br />
Interesse, Engagement) und<br />
• ob es für sie Alternativen gibt, um gleiche soziale, emotionale und sonstige Qualitäten des Gruppenlebens zu<br />
erreichen<br />
Gruppen s<strong>in</strong>d unmittelbares Anschauungsfeld für soziale Interaktionen (normative Grenzen d. Selbstdarstellung!)<br />
„Gefühle als Steuerungsmedium“ (Neidhardt) nicht grenzenlos zugelassen:<br />
„Funktionen von Geheimnis und Diskretion selbst für die <strong>in</strong>timsten Gruppierungen von Freundschaft und Ehe“<br />
Moralisierung von Scham- und Taktgefühl: „Schamgefühl wäre die Ver<strong>in</strong>nerlichung von Schranken <strong>der</strong> Selbstdarstellung,<br />
Taktgefühl die Stilisierung <strong>der</strong> Technik, fehlerhafte <strong>in</strong>diskrete Selbstdarstellung als ungeschehen zu behandeln“<br />
(Neidhardt)<br />
5.2 Ebenen des Gruppenprozesses nach Homans. Ergebnisse <strong>der</strong> Kle<strong>in</strong>gruppenforschung<br />
Ebenen <strong>der</strong> Gruppenprozesses (<strong>in</strong>neres + äußeres System): Interaktion, Gefühl, Aktivität, Normen<br />
Entscheidende Frage f. Homans: Wie hängen diese Elemente (Ebenen) zusammen und wie bee<strong>in</strong>flusst e<strong>in</strong> Element<br />
das/mehrere an<strong>der</strong>e?<br />
27
Äußeres System = alles, was außerhalb des Interaktionssystems <strong>der</strong> Gruppe liegt<br />
Inneres System = eigentliches Interaktionssystem <strong>der</strong> Gruppe<br />
Wechselwirkungen zwischen <strong>in</strong>nerem und äußerem System:<br />
• Aktivitäten und Interaktionen verstärken Prozesse <strong>der</strong> Normbildung<br />
• Aktivität und Interaktion s<strong>in</strong>d über e<strong>in</strong> gruppenspezifisches Schema <strong>der</strong> Arbeitsteilung bzw. e<strong>in</strong> Rollendifferenzial<br />
verbunden<br />
• Standardisierte Gefühle und Tätigkeiten werden zu Normen (Erwartungshaltungen), aus denen sich wie<strong>der</strong>um<br />
Rangstufungen ergeben können<br />
• „mit <strong>der</strong> Abnahme <strong>der</strong> sozialen Interaktion werden die Normen immer unbestimmter und immer weniger<br />
konsequent vertreten, und auch <strong>der</strong> soziale Rang, <strong>der</strong> ja durch das Ausmaß erfüllt ist, <strong>in</strong> welchem e<strong>in</strong><br />
Mensch die soziale Gruppennorm erfüllt, etabliert sich immer weniger fest“ (Homans)<br />
• Mit e<strong>in</strong>er Zunahme an Interaktionen zeigen Gefühle die Tendenz, sich anzugleichen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Kle<strong>in</strong>gruppenforschung<br />
• Rang d. Individuums <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe ist umso höher, je vollständiger es sich die gruppenspezifischen Normen<br />
und Ziele zu eigen macht<br />
• Gruppen bee<strong>in</strong>flussen die Urteilsf<strong>in</strong>dung und die Konformität <strong>der</strong> Urteile<br />
• In Gruppen gibt es <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel zwei Führungstypen: organisatorisch-zielorientiert und „sozial“, emotionalausgleichend<br />
• Autoritärer Führungsstil: hohe Gruppenleistung nur <strong>in</strong> Anwesenheit d. Führers (ger<strong>in</strong>ge Harmonie); demokratischer<br />
Führungsstil: immer mittlere Leistung (großes Interesse); Laissez-faire Stil: niedrigste Arbeitsleistung<br />
(Entmutigung, Lustlosigkeit)<br />
• Die Bedeutung <strong>der</strong> Gruppen für Sozialisation, Therapie und allgeme<strong>in</strong> für die soziale Harmonie wächst <strong>in</strong><br />
dem Maße, wie die Gruppe Spielraum hat, sich auf <strong>der</strong> Basis von Sympathiebeziehungen ihrer Mitglie<strong>der</strong> zu<br />
organisieren (Moreno). Um dafür alle Voraussetzungen zu schaffen, entwickelte Moreno die Soziometrie als<br />
e<strong>in</strong> auf die Sympathiebeziehungen <strong>in</strong> Gruppen bezogenes Messverfahren<br />
• In allen kle<strong>in</strong>en Gruppen s<strong>in</strong>d Gleichgewichtsprobleme zu lösen, die sich nach den Untersuchungen von R. F.<br />
Bales <strong>in</strong> Probleme <strong>der</strong> Orientierung, <strong>der</strong> Bewegung und Kontrolle , <strong>der</strong> Entscheidung und <strong>der</strong> Integration aufteilen<br />
lassen<br />
6. Schlussbemerkungen. Abgrenzung zu sozialen Netzwerken<br />
Die soziale Gruppe ist e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>s geeigneter Tatbestand, um Grundphänomene des Sozialen zu verdeutlichen.<br />
Zweierbeziehung (Dyade) als Son<strong>der</strong>form (Von Wiese):<br />
„Das Paar ist das persönlichste unter allen Gebilden; <strong>in</strong> ihm wirkt Individuelles auf Individuelles“. „Typische Paare“:<br />
Liebespaar, Ehepaar, Freundespaar<br />
„Atypsiche Paare“: Lehrer – Schüler, Vorgesetzter – Untergebener<br />
Der Bezugsgruppe (reference group) gehört man nicht an, sie bee<strong>in</strong>flusst aber das eigene Verhalten<br />
Bedeutungszunahme sozialer Netzwerke <strong>in</strong> den letzten Jahren<br />
Entstehung und Struktur sozialer Netzwerke:<br />
Soziale Beziehungen lassen sich nicht auf gegebene soziale Gebilde begrenzen. Netzwerke können auf Basis von Verb<strong>in</strong>dungsl<strong>in</strong>ien<br />
entstehen; ihre Grenzen s<strong>in</strong>d fließend; Mitgliedschaft ist nicht erfor<strong>der</strong>lich; normative B<strong>in</strong>dungen s<strong>in</strong>d<br />
sekundär; soziale E<strong>in</strong>heiten s<strong>in</strong>d nicht auf e<strong>in</strong>zelne Personen beschränkt (auch Gruppen und Organisationen)<br />
Soziales Netzwerk = Geflecht von sozialen Beziehungen, <strong>in</strong> das <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelne, Gruppen, kollektive o<strong>der</strong> korporative<br />
Akteure e<strong>in</strong>gebettet s<strong>in</strong>d (Jansen)<br />
28
Soziale Gruppen haben ihre eigene Struktur und Dynamik, „die nicht aus <strong>in</strong>dividuellen Handlungsmotiven o<strong>der</strong> aus<br />
Makrostrukturen abgeleitet werden können“ (Fuhse)<br />
Netzwerkanalyse ist <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong> stark formalisierter und mathematisierter Forschungszweig, <strong>der</strong> die gruppenspezifischen<br />
Ansätze <strong>der</strong> Soziometrie auf völlig verän<strong>der</strong>ter Grundlage fortsetzt.<br />
Lektion VIII (S. 145)<br />
Institution und Organisation (Hermann L. Gukenbiehl)<br />
1. <strong>E<strong>in</strong>führung</strong><br />
Alltagssprachlich: Institution = öffentliche E<strong>in</strong>richtung (Schule, KH usw.)<br />
Organisation = Produktions- o. Dienstleistungsbetriebe (Fabrik, Kaufhaus)<br />
nicht e<strong>in</strong>deutig, da s zur Analyse ganz ähnlicher Ersche<strong>in</strong>ungen bestimmt (Geme<strong>in</strong>samer Kern: geregelte<br />
Kooperation von Menschen) s diese Gebilde nicht Institutionen<br />
bzw. Organisationen s<strong>in</strong>d, son<strong>der</strong>n sie haben Institutions-/Organisationscharakter (zunächst auf dem Wege<br />
d. Gewohnheitsbildung entstanden, dann zweckrational durch- o<strong>der</strong> umgeformt (Unis)<br />
o<strong>der</strong> nachträglich zweckrational gerechtfertigt (<strong>in</strong>formelle Betriebsstrukturen)<br />
Trotz <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>samkeiten unterschiedliche Aspekte und von versch. Wissenschaften mit untersch. Brauchbarkeitsansprüchen<br />
e<strong>in</strong>geführt<br />
2. Institutionen<br />
Institution = S<strong>in</strong>ne<strong>in</strong>heit von habitualisierten Formen des Handelns und <strong>der</strong> sozialen Interaktion, <strong>der</strong>en S<strong>in</strong>n und<br />
Rechtfertigung <strong>der</strong> jeweiligen Kultur entstammen und <strong>der</strong>en dauerhafte Beachtung die umgebende Gesellschaft<br />
sichert<br />
Durkheim: Institutionen = soziale Tatbestände<br />
2.1 Beispiele von Institutionen<br />
Allgegenwart. Formen geregelten Zusammenwirkens: Kommunikation, Arbeit, Handel, Nutzung + Verwaltung, Pflege<br />
+ Erziehung, Spiel, Feste, Feiern, geregelte Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzungen, umfassende Formen geme<strong>in</strong>samen Lebens (Familie,<br />
Kloster, Staat)<br />
Wandel d. Institutionen bzw. ihrer Grundidee: sie verschw<strong>in</strong>den (Zünfte), neue treten auf (Gewerkschaften), S<strong>in</strong>n<br />
än<strong>der</strong>t sich (Polterabend)<br />
Objekthaftigkeit: Institutionen haben den Charakter von „D<strong>in</strong>gen“, ohne eigentlich materieller Natur zu se<strong>in</strong> (Durkheim);<br />
Stellenwert des Selbstverständlichen än<strong>der</strong>t sich! (historische Studien, Reisen <strong>in</strong> fremde Län<strong>der</strong>)<br />
2.2 Strukturen von Institutionen<br />
Institution = E<strong>in</strong>heit aus 4 Elementen:<br />
• Idee, Verfassung, Leitidee <strong>der</strong> Institution: anerkannt und festgelegt<br />
• Personalbestand <strong>der</strong> Institution<br />
• Regeln o<strong>der</strong> Normen des Umgangs mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
• „materieller Apparat“ <strong>der</strong> Institution: Gegenstände + Räume<br />
Innerer Zusammenhang dieser Elemente = Struktur <strong>der</strong> Institution – gew<strong>in</strong>nt Leben, wenn man Menschen e<strong>in</strong>bezieht<br />
Struktur wird zur Grundlage e<strong>in</strong>es geregelten Kooperationsprozesses (<strong>in</strong>nere Dynamik, Verlebendigung und Umsetzung<br />
d. Struktur im Handeln)<br />
29
Struktur und <strong>in</strong>nere Dynamik zu erfassen und zu beschreiben ist Aufgabe <strong>der</strong> Institutionsanalyse.<br />
2.3 Heuristisches Modell zur Analyse von Institutionen<br />
Gesellschaftsaspekt: Institution = Bestandteil d. geistigen und materiellen Kultur e<strong>in</strong>er Gesellschaft<br />
Personenaspekt: Institution ist verankert <strong>in</strong> Bewusstse<strong>in</strong> und Organismus von Personen<br />
(Strukturmodell siehe S. 149, Abb. 1)<br />
Institutionentheorie:<br />
• Wie entstehen Institutionen?<br />
• Wie werden sie <strong>in</strong> den Personen und wie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesellschaft, <strong>in</strong> ihrer geistigen und materiellen Welt verankert?<br />
• Welche Bedeutung, Wirkung und Funktion haben Institutionen für e<strong>in</strong>e Gesellschaft <strong>in</strong>sgesamt und für die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Personen <strong>in</strong> dieser Gesellschaft?<br />
• Warum entstehen sie überhaupt und warum gerade dort und <strong>in</strong> dieser Form?<br />
• Warum verlieren sie an Bedeutung und verschw<strong>in</strong>den schließlich <strong>in</strong> den Archiven <strong>der</strong> Kultur- und Sozialgeschichte?<br />
• Was geschieht, wenn sich die Ankerpunkte <strong>der</strong> Institutionen im Laufe <strong>der</strong> Zeit verän<strong>der</strong>n?<br />
2.4 Funktionen von Institutionen<br />
Funktionale Analyse: Welche Funktion (Bedeutung, Leistung) haben Institutionen für e<strong>in</strong>e Gesellschaft o<strong>der</strong> Gruppe<br />
und für den E<strong>in</strong>zelnen, das Gesellschaftsmitglied?<br />
• Befriedigung existenzieller (biologischer) und abgeleiteter (kultureller) Bedürfnisse;<br />
• Schaffung von Sicherheit, Ordnung, Stabilität (macht I. „wertvoll“)<br />
• Bildung von Bezugspunkten f. geme<strong>in</strong>same Sicht <strong>der</strong> Welt und <strong>der</strong> Wirklichkeit und für die Zusammengehörigkeit<br />
von Menschen, für ihre kulturelle und soziale Identität<br />
• E<strong>in</strong>schränkung von Freiräumen und Begrenzung von Lebens- und Handlungsmöglichkeiten<br />
• För<strong>der</strong>ung sozialer Integration: I. bieten Möglichkeit, <strong>in</strong> best. Situationen mit best. Problemen s<strong>in</strong>nvoll, sicher<br />
und <strong>in</strong> üblicher Weise umzugehen und dabei mit an<strong>der</strong>en zusammenzuwirken; Voraussetzung: alle Beteiligten<br />
müssen sich an diese Vorgaben halten Entlastung (Improvisationen, Experimente, Entscheidungen,<br />
Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzungen, …)<br />
• Fixpunkte f. Identitätsbildung: Bestimmung + Entfaltung von personaler Identität<br />
• Wenig Platz für Spontanität + Kreativität, <strong>in</strong>dividualist. E<strong>in</strong>stellungen + Verhaltensweisen E<strong>in</strong>druck von Enge<br />
und Zwang<br />
2.5 Entstehung und Wandel von Institutionen<br />
2.5.1 Arten <strong>der</strong> Entstehung von Institutionen<br />
P. L. Berger + T. Luckmann: Entstehung <strong>der</strong> I. (Institutionalisierung) aus Handlungsgewohnheiten und Rout<strong>in</strong>en; <strong>in</strong>nere<br />
Ökonomie – Ausbildung von Gewohnheiten und Rout<strong>in</strong>en für den notwendigen Umgang mit Personen, D<strong>in</strong>gen<br />
und Situationen (Habitualisierung); künftige Handlungen: zeit- und energiesparen<strong>der</strong>, risikoloser (nicht mehr e<strong>in</strong>maliges,<br />
e<strong>in</strong>zigartiges Tun);<br />
auch die beteiligten Personen, D<strong>in</strong>ge + Situationen können „typisiert“ werden<br />
E<strong>in</strong> vom Menschen selbst geschaffener S<strong>in</strong>n- und Handlungszusammenhang ist zu e<strong>in</strong>em Teil <strong>der</strong> Welt geworden<br />
„objektive Wirklichkeit“ (Durkheim: „fait sociaux“), bee<strong>in</strong>flusst <strong>in</strong> Denken und Handeln; damit sie dauerhaft bleibt:<br />
<strong>in</strong>stitutionalisieren – Sicherung <strong>der</strong> Institutionalisierung durch Sanktionen<br />
M. Hauriou (Rechtswissenschaftler): Institutionalisierung = Prozess <strong>der</strong> Gründung o<strong>der</strong> Stiftung idée diréctrice als<br />
Ausgangspunkt<br />
30
E<strong>in</strong>e Idee vom Werk, e<strong>in</strong>e organisierte Anhängerschaft für die Verwirklichung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Idee s<strong>in</strong>d die<br />
Grundelemente für die Entstehung e<strong>in</strong>er Institution<br />
2.5.2 Ursachen <strong>der</strong> Entstehung von Institutionen<br />
Sorgfältige Unterscheidung zwischen Funktionen e<strong>in</strong>er I., Motiven, die zu Gebrauch + Erhaltung führen und Gründen,<br />
die zur Entstehung beigetragen haben<br />
• Ersetzen mangelhafte Inst<strong>in</strong>ktausstattung stabilisieren, steuern, kanalisieren das menschl. Verhalten<br />
• Universelle „Grundbedürfnisse“ o<strong>der</strong> spezifische „Kulturbedürfnisse“: „Grundprobleme“, zu <strong>der</strong>en Bewältigung<br />
I. erschaffen wurden und erhalten werden<br />
2.5.3 Wandel von Institutionen<br />
Soziale, kulturelle – personale – Ankerpunkte von I. verän<strong>der</strong>n sich<br />
E. Goffman: Gefängnis = „totale Institution“; Familie = „situierte Institution“<br />
A. Giddens: I.-Begriff zur Bezeichnung relativ weit verbreiteter, umfassen<strong>der</strong> + dauerhafter Praktiken<br />
Begriff „soziales System“ kann vieles, aber eben nicht alles aussagen, was <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> „Institution“ an Gedachtem<br />
und Gewusstem be<strong>in</strong>haltet.<br />
3. Organisationen<br />
= mo<strong>der</strong>ne, auf dem Boden <strong>der</strong> Realität gebliebene Formen geregelter Kooperation<br />
Organisieren ist e<strong>in</strong>e Form des Denkens und Handelns<br />
3.1 Beispiele von Organisationen<br />
Autokonzerne, Banken, Kaufhäuser, Geme<strong>in</strong>deverwaltungen, F<strong>in</strong>anzämter, Gewerkschaften, Parteien, Armeen, Kirchen,<br />
Schulen, …<br />
Unternehmen, Behörden, Verbände, Vere<strong>in</strong>e, die den Alltag entscheidend mitbestimmen<br />
Def<strong>in</strong>itionsmerkmale:<br />
• Bewusst und planvoll zur dauerhaften Erreichung e<strong>in</strong>es Zieles o<strong>der</strong> Zwecks gebildet worden<br />
• Besitzen e<strong>in</strong>e gedanklich geschaffene und allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich festgelegte Ordnung + Struktur<br />
• Mit ihrer Hilfe sollen die Aktivitäten <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> und die Mittel so koord<strong>in</strong>iert werden, dass die Erreichung<br />
e<strong>in</strong>es Zieles auf Dauer gewährleistet wird<br />
Charakter von Instrumenten, von konstruierten Formen geregelter Kooperation<br />
Voraussetzung: Glaube/Überzeugung, dass <strong>der</strong> menschliche Verstand die Dase<strong>in</strong>sbewältigung besser sichern könne<br />
als Religionen und Traditionen (Aufklärung)<br />
3.2 Organisationsforschung<br />
= Arbeitsgebiet verschiedener Wissenschaftsdiszipl<strong>in</strong>en<br />
Organisationssoziologie untersuchte bisher v.a.:<br />
• Ziele + Strukturen von O. sowie <strong>der</strong>en wechselseitigen Zusammenhang<br />
• Personen + Akteure <strong>in</strong> O.<br />
• E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung und Verankerung von O. <strong>in</strong> ihrer sozialen und materiellen Umwelt<br />
3.3 Ziele und Strukturen von Organisationen<br />
Organisationen s<strong>in</strong>d Instrumente zur Erreichung spezifischer Ziele o. Zwecke, die durch das bewusst geregelte Zusammenleben<br />
von Menschen und die Nutzung von Mitteln erreicht werden sollen. Diese Zustände und Ergebnisse<br />
s<strong>in</strong>d immer wie<strong>der</strong> notwendig und erfor<strong>der</strong>n dauerhafte, längerfristige Kooperation.<br />
31
Formelle und <strong>in</strong>formelle Ziele:<br />
- Dauerhafte Ziele = Organisationsziele. In Satzungen o<strong>der</strong> Handlungsregistern festgelegt.<br />
- Ziele <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> O.: Betrieb + Arbeitsplätze erhalten, Betriebsklima verbessern, Gew<strong>in</strong>n steigern, Kunden<br />
zufriedenstellen etc.<br />
Regelwerk als wichtigstes Instrumentarium: festgelegt, mit welchen Stellen welche Aufgaben, Befugnisse + Tätigkeiten<br />
verbunden s<strong>in</strong>d, wer wem was zu sagen hat, wie <strong>in</strong> best. Fällen vorzugehen ist.<br />
Informelle Strukturen haben für das tatsächliche Funktionieren e<strong>in</strong>er O. fast ebensogroße Bedeutung wie geplante<br />
und festgelegte formelle.<br />
3.4 Personen und Organisation<br />
Personen s<strong>in</strong>d nicht nur als „Arbeitskräfte“ tätig. Organisation stellt e<strong>in</strong>en wichtigen Teil ihrer Lebenswelt dar <strong>der</strong><br />
Zufriedenheit mit <strong>der</strong> Arbeit und <strong>der</strong> Identifikation mit dem Betrieb muss man sich ebenso widmen, wie <strong>der</strong> Effizienz<br />
e<strong>in</strong>es zweckmäßigen und ökonomischen E<strong>in</strong>satzes von Mitteln aller Art<br />
Person geht mit O. Vertrag e<strong>in</strong>, <strong>der</strong> „Persönliches“ ausklammert – ist aber <strong>in</strong> <strong>der</strong> Realität oft schwer möglich<br />
Personen s<strong>in</strong>d für O. lebenswichtig! Meist s<strong>in</strong>d es aber auch O. für Menschen (Arbeitsplätze)<br />
3.5 Organisation <strong>in</strong> physischer und sozialer Umwelt<br />
Organisationen s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e isolierten E<strong>in</strong>zelgebilde. Sie brauchen und verbrauchen, gestalten und verän<strong>der</strong>n durch ihr<br />
Wirken die physische Umwelt – bewusst o<strong>der</strong> unbewusst – <strong>in</strong> erheblichem Umfang.<br />
Organisation (S. 193) = Element komplexer sozialer Strukturen<br />
Organisationsgesellschaft – dichtes Netz rationaler Strukturen und Verflechtungen<br />
Lektion IX (S 163)<br />
Macht und Herrschaft (Peter Imbusch)<br />
1. Kontroverse Deutungen von Macht und Herrschaft<br />
Macht …<br />
… im Alltagsverständnis … im Wissenschaftliches Verständnis<br />
weith<strong>in</strong> negativ (Machthunger, Machtbesessenheit); neutral<br />
Verd<strong>in</strong>glichung spezifisches Vermögen bzw. Können<br />
attributionales Phänomen (Eigenschaft/Besitz)<br />
nicht gegenständlich – unsichtbare Eigenschaft<br />
sozialer Beziehungen<br />
Macht existiert nur <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit und zu an<strong>der</strong>en Menschen, bezeichnet stets e<strong>in</strong> soziales Verhältnis. Mächtig<br />
ist potentiell je<strong>der</strong>, weil Macht e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e menschliche Möglichkeit darstellt.<br />
M. Weber: Macht ist „soziologisch amorph“ – „alle denkbaren Qualitäten e<strong>in</strong>es Menschen und alle denkbaren Konstellationen<br />
können jemand <strong>in</strong> die Lage versetzen, se<strong>in</strong>en Willen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er gegebenen Situation durchzusetzen“<br />
„Macht bedeutet jede Chance, <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Wi<strong>der</strong>streben<br />
durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“<br />
Herrschaft …<br />
… e<strong>in</strong>erseits … an<strong>der</strong>erseits<br />
Soziales Verhältnis mit wechselseitigen, aber<br />
stark asymmetrischen Beziehungen<br />
Institutionalisierte Macht<br />
32
Macht = Herrschaft scharfe Unterscheidung aufgrund unterschiedl.<br />
Qualitäten<br />
umfassende soziale Zwänge + eigene Machtlo- positive, für das Zusammenleben notwendige<br />
sigkeit<br />
Aspekte<br />
Marx: Utopien von <strong>der</strong> herrschaftsfreien Gesell- nicht aufhebbare Konstante menschl. Gesellsch.<br />
schaft<br />
– Grundkategorie des Sozialen<br />
Weber: Unterscheidung von Herrschaft und Macht, da erstere auf Legitimität beruht<br />
„Herrschaft soll heißen die Chance, für e<strong>in</strong>en Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu f<strong>in</strong>den“,<br />
„nicht also jede Chance, ,Macht‘ und ,E<strong>in</strong>fluss‘ auf an<strong>der</strong>e Menschen auszuüben“<br />
Anhaltende Aktualität: „Macht“ + „Herrschaft“ waren immer Teil größerer soziologischer Debatten<br />
M. + H. s<strong>in</strong>d mit <strong>der</strong> ungleichen Verteilung von gesellschaftlich relevanten Ressourcen verknüpft<br />
2. Macht als soziale Figuration<br />
„E<strong>in</strong>e Machtfiguration ist e<strong>in</strong> komplexes Geflecht asymmetrischer und wechselseitiger Beziehungen, <strong>in</strong> dem mehrere<br />
Personen, Gruppen o<strong>der</strong> Parteien mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verknüpft s<strong>in</strong>d und <strong>in</strong> dem Verän<strong>der</strong>ungen e<strong>in</strong>er Relation auch die<br />
an<strong>der</strong>en Relationen än<strong>der</strong>n“ (W. Sofsky/R: Paris <strong>in</strong> Anlehnung an G. Simmel + N. Elias)<br />
2.1 Sozialanthropologische Grundlagen <strong>der</strong> Macht<br />
Vier Grundtypen <strong>der</strong> Macht (H. Popitz):<br />
1. Aktionsmacht (als Verletzungsmacht): kreatürliche Verletzlichkeit d. menschl. Körpers und ökonomische Verletzlichkeit;<br />
typisches daraus resultierendes Machtverhältnis: pure Gewalt<br />
2. Instrumentelle Macht (als Unterwerfungsmacht): konventionelle, geläufigste Form. Basiert auf Geben- und<br />
Nehmen-Können, Belohnen und Strafen. Macht des Entwe<strong>der</strong>-O<strong>der</strong>. Typisches Resultat: soziale Erpressung,<br />
Konformität erzeugende Angst und Hoffnung<br />
3. Autoritative Macht (als Verhalten und E<strong>in</strong>stellung steuernde Macht): erzeugt e<strong>in</strong>willigende Folgebereitschaft.<br />
Wirkt auch dort, wo Handlungen nicht direkt kontrolliert werden können. Resultat: fraglose Autorität<br />
4. Datensetzende Macht (als objektvermittelte Macht technischen Handelns): technische Artefakte, mittels <strong>der</strong>er<br />
Hersteller Macht über an<strong>der</strong>e Menschen ausüben können. Auch Rückwirkung d. technischen Beherrschung d.<br />
Natur durch den Menschen. Resultat: technische Dom<strong>in</strong>anz<br />
Differenzierungen zum Machtbegriff:<br />
• potenziell – aktuell vierstufiger Machtbegriff:<br />
- Möglichkeit zur Machtausübung,<br />
- Fähigkeit <strong>der</strong> Machtausübung,<br />
- latent wirkende Macht,<br />
- manifest wirksame Macht<br />
• legitim – illegitim<br />
• Formen: politisch, ökonomisch, ideologisch, symbolisch etc.<br />
2.2 Prozesse <strong>der</strong> Machtbildung<br />
Popitz: Ausgangpunkt von Machtbildungsprozessen: jemand def<strong>in</strong>iert und nimmt e<strong>in</strong> Privileg wahr o<strong>der</strong> kann sich<br />
ges. Ressourcen aneignen, die e<strong>in</strong>e gewisse Überlegenheit verbürgen<br />
• Solidarität: wichtiger Schritt zur Verfestigung d. Macht – um Wi<strong>der</strong>stände zu m<strong>in</strong>imalisieren, solidarisieren sich<br />
die Privilegierten<br />
• Institutionen und Organisationen: geben Struktur, <strong>in</strong>dem Mächtige zwischen sich und an<strong>der</strong>en differenzieren;<br />
sie bestimmen, wer wie nah o<strong>der</strong> fern zur Macht steht<br />
• Stabilisierung <strong>der</strong> Macht über soziale Schließungsprozesse und gestufte Partizipation an ihr;<br />
33
• schließlich Zustimmung <strong>der</strong> „Machtlosen“, weil das die ger<strong>in</strong>gsten Nachteile bei <strong>der</strong> Wahrnehmung ihrer verbliebenen<br />
Lebenschancen verbürgt<br />
2.3 Dimensionen <strong>der</strong> Macht<br />
Machtquellen: unmittelbare Gründe für die Macht<br />
• Physische Stärke/Überlegenheit<br />
• Persönlichkeit und Charisma: persönliche Beson<strong>der</strong>heiten (Ausstrahlung, Geist, Intellekt) – können zur S<strong>in</strong>ngebung<br />
e<strong>in</strong>gesetzt werden o<strong>der</strong> vermögen Situationsdef<strong>in</strong>itionen erfolgreich durchzusetzen. Zusammenhang<br />
mit Formen konditioneller Macht (Fähigkeit, Überzeugungen/Motivationen zu schaffen) Charisma und Autorität<br />
• Eigentum + Besitz: property rights. Auch Resultat <strong>der</strong> Monopolisierung gesellschaftlich bedeutsamer Ressourcen.<br />
Können E<strong>in</strong>druck von Autorität und Entschlusskraft vermitteln<br />
• Organisationen: zielgerichteter Zusammenschluss, Bündelung von Kräften. Macht entsteht aus Kooperation<br />
und Zentralisierung (bürokratische Strukturen)<br />
Machtmittel: konkrete Medien <strong>der</strong> Machtausübung. Entscheiden Ausgang von Machtkämpfen und Herrschaftskonflikten<br />
• Kapital: ökonomisches, kulturelles, soziales K. (Bourdieu)<br />
o Ökonomisches Kapital: universelles Tauschmedium<br />
o Soziales Kapital: <strong>in</strong>stitutionalisierte Beziehungen (mit Ressourcen verbunden)<br />
o Kulturelles Kapital: auf symbolischer Ebene<br />
§ Inkorporierter Zustand (Bildung, Wissen, Begabung): dauerhafte, habituell verfestigte Disposition<br />
des Organismus<br />
§ Objektivierter Zustand: Produktion kultureller Güter<br />
§ Institutionalisierter Zustand: schulische, akademische Titel<br />
• Organisationen:<br />
o <strong>in</strong>terne Macht über Positionen,<br />
o externe Macht: strukturell verfestigt, häufig normsetzend, weil gesellschaftlich relevante Entscheidungen<br />
gefällt und umgesetzt werden<br />
kompensatorische und konditionierende Macht<br />
• Sanktionsgewalt: v.a. konditionierte + repressive Macht; Bürokratie als rationale Verwaltung<br />
• Information: „Wissen ist Macht“. Informationen und Wissen werden manipuliert, gesteuert o<strong>der</strong> selektiv<br />
e<strong>in</strong>gesetzt. Medien: Informationsbedürfnisse von Menschen und Manipulationsmöglichkeiten von Nachrichten<br />
– „Me<strong>in</strong>ungsmache“<br />
Formen <strong>der</strong> Machtausübung: diskreteste Formen: E<strong>in</strong>fluss, Überzeugung, Motivation (kommunikati- ve Macht)<br />
• E<strong>in</strong>fluss: auf Grundlage allgeme<strong>in</strong> akzeptierter Regeln<br />
• Überzeugung: sich aus Wissen und Information speisende Autorität und geistige Überlegenheit<br />
• Motivation: Verdeckte Form sozialer Macht. Soll an<strong>der</strong>e dazu veranlassen, etwas überhaupt erst zu wollen<br />
o<strong>der</strong> nicht zu wollen<br />
• Autorität: zwei Formen:<br />
o Amts- und Befehlsgewalt: rechtmäßig anerkannter E<strong>in</strong>fluss e<strong>in</strong>er sozialen Instanz<br />
o Persönliche Autorität: Macht <strong>der</strong> Persönlichkeit; häufig <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit Charisma „natürliche“ Autorität<br />
Verschmelzen die beiden Formen mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> hohes soziales Prestige<br />
• Kontrolle: unterschiedliche Reichweite; bezogen auf Entscheidungssituationen und sog. Nicht-<br />
Entscheidungen (P. Bachrach/M. S. Baratz: „zweites Gesicht <strong>der</strong> Macht“)<br />
• Zwang: Druck über das Gewähren bzw. Zurückhalten best. Ressourcen<br />
o Sanfte Formen: Nutzenaspekt (Vorteile)<br />
o Brachiale Formen: Schadensaspekt (Gewalt/Strafen)<br />
34
o Staatliches Gewaltmonopol (Spezialfall) = Essenz mo<strong>der</strong>ner Staatlichkeit (Weber): „ Gewaltsamkeit ist<br />
natürlich nicht etwa das normale o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zige Mittel des Staates – davon ist ke<strong>in</strong>e Rede -, wohl aber:<br />
das ihm spezifische“. Elias: Gewaltsamkeit = wesentliches Mittel langfristiger Pazifizierung; Zwangsmittel<br />
gehen von relativ harmloser Bestrafung bis zur Verfügung über Leben und Tod<br />
• Gewalt<br />
Wirkungsmechanismen <strong>der</strong> Macht: J.K. Galbraith: repressive, kompensatorische und konditionierte Macht<br />
• Negative Sanktionen<br />
• Positive Sanktionen (Kompensation): Individuum bekommt etwas für sich selbst Wichtiges zum Ausgleich<br />
• Manipulation: Unterwerfung entspricht sche<strong>in</strong>bar dem selbstgewählten Kurs; kann auch durch Unterordnung<br />
unter geliebte Menschen, durch Identifikation mit e<strong>in</strong>er charismatischen Persönlichkeit o<strong>der</strong> Autoritätsperson<br />
entstehen<br />
2.4 Effekte <strong>der</strong> Macht<br />
• Reichweite: personell + territorial<br />
• Geltungsgrad: Zuverlässigkeit <strong>der</strong> zu erwartenden Konformität. Abhängig von demokratischer Legalität o<strong>der</strong><br />
sonstigen Legitimitätsquellen<br />
• Wirkungs<strong>in</strong>tensität: Durchsetzungskraft/-fähigkeit, Innovationskraft von Bedeutung<br />
3. Herrschaft als <strong>in</strong>stitutionalisierte Macht<br />
Herrschaft ist Macht, die sich verfestigt, verdichtet, verstetigt und akkumuliert hat; hat e<strong>in</strong>e gewisse Dauerhaftigkeit;<br />
wäre ohne e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>destmaß an Gehorsam und Anerkennung nicht möglich. Hat stärkere Legitimität als Macht.<br />
3.1 Der Institutionalisierungsprozess von Herrschaft<br />
Popitz: Drei Elemente <strong>der</strong> Institutionalisierung von Macht <strong>in</strong> Richtung Herrschaft:<br />
• zunehmende Entpersonalisierung<br />
• zunehmende Formalisierung<br />
• Integration von Macht <strong>in</strong> übergreifende Ordnungsgefüge<br />
5. Staatliche Herrschaft<br />
(als Veralltäglichung zentrierter Herrschaft)<br />
4. Entstehung von Positionsgefügen <strong>der</strong> Herrschaft<br />
(Verfestigung d. Arbeitsteilung Austauschbarkeit d. Herrschers<br />
Herausbildung von Herrschaftsapparaten)<br />
3. Positionalisierung von Macht <strong>in</strong> Richtung Herrschaft<br />
(Verdichtung normieren<strong>der</strong> Machtfunktionen zu überpersönlichen<br />
Machtstellungen)<br />
2. Normierende Macht<br />
(Durchsetzung von Verhaltensregelmäßigkeiten und Fügsamkeit<br />
durch Sanktionen)<br />
1. Sporadische Macht<br />
(Machtausübung im E<strong>in</strong>zelfall)<br />
35
3.2 Drei Typen legitimer Herrschaft<br />
Nur legitime Macht darf dauerhaft mit Akzeptanz rechnen<br />
Grundsätze <strong>der</strong> Legitimität (Weber):<br />
• Tradition: Geltung des immer Gewesenen<br />
• Affektueller Glaube: Geltung des neu Offenbarten o<strong>der</strong> des Vorbildlichen<br />
• Wertrationaler Glaube: Geltung des absolut gültig und richtig Erkannten<br />
• Positive Satzung: Glauben an <strong>der</strong>en Rechtmäßigkeit und Legitimität<br />
Drei Typen legitimer Herrschaft:<br />
• Traditionelle Herrschaft: legitimiert sich über dauerhafte Anerkennung ihrer Faktizität; patriarchalische, patrimoniale<br />
+ ständische Herrschaft<br />
• Charismatische Herrschaft: beruht auf außeralltäglichen Eigenschaften und als außergewöhnlich anerkannten<br />
Qualitäten <strong>der</strong> Persönlichkeit; Propheten, Kriegshelden, große Demagogen und Führer; stabilisiert sich<br />
durch Bildung e<strong>in</strong>er Schar von „Jüngern“; risikoreichste Art <strong>der</strong> Legitimation von Herrschaft<br />
• Legale Herrschaft: rationalste Herrschaftsform, weil sie auf e<strong>in</strong>em festgelegten Satz von Regeln und berechenbaren<br />
Verhaltensweisen beruht, die für jeden e<strong>in</strong>sichtig s<strong>in</strong>d und verlässlich funktionieren; gekennzeichnet<br />
durch Rationalität, Rechenhaftigkeit, Handeln nach formal abstrakten Normen, Fachqualifikationen<br />
(Wissen) sowie Hierarchie und Amtsdiszipl<strong>in</strong><br />
3.3 Typen illegitimer Herrschaft<br />
H. Haferkamp thematisierte Macht und Herrschaft „<strong>in</strong> ihrer Zweideutigkeit“<br />
Illegitim: Autokratien, Oligarchien, Diktaturen, autoritäre + totalitäre Regime – legitimierten ihre Herrschaft entwe<strong>der</strong><br />
mit Ideologien <strong>der</strong> Ungleichheit <strong>der</strong> Menschen, argumentierten mit Sachzwängen o<strong>der</strong> griffen gleich auf Gewalt<br />
zurück.<br />
Herrschaft ohne Legitimation schließt das Funktionieren e<strong>in</strong>es Systems nicht aus<br />
Weber: bürokratische Herrschaft ist e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> rationalsten und effizientesten Formen <strong>der</strong> Verwaltung. Aber birgt Gefahr<br />
<strong>der</strong> Entmenschlichung<br />
Frankfurter Schule (M. Horkheimer, T. W. Adorno, H. Mercuse): generell herrschaftskritische Position (Herrschaft<br />
trägt immer etwas Furchtbares <strong>in</strong> sich); bestritt Legitimität ( soziale Folgen: Verstetigung sozialer Ungleichheit,<br />
Vergrößerung von Besitz- und Wohlstandsdifferenzen ungleiche Lebenschancen)<br />
Aufklärung (18.Jh.): pr<strong>in</strong>zipieller Zweifel an Berechtigung von Herrschaft. Infragestellung <strong>der</strong> Herrschaft d. Menschen<br />
über den Menschen hatte zugleich Folgen für Anerkennung ihrer Geltungsgründe: H. hatte sich fortan permanent zu<br />
legitimieren und war zur ständigen Ablösung disponiert.<br />
4. Abschließende Bemerkungen<br />
Differenzierung von Theorien <strong>der</strong> Macht:<br />
- unterschiedliche Legitimationsstandards,<br />
power to power over<br />
positive Bewertungen negative Bewertungen<br />
H. = allgeme<strong>in</strong>er menschlicher Handlungsmodus<br />
(Möglichkeitsspielräume)<br />
weiter Machtbegriff: alle Bereiche des ges. Lebens<br />
s<strong>in</strong>d von Macht durchdrungen<br />
Überwältigungsaspekte: ungleich verteilte Machtressourcen<br />
und –mittel Ungleichgewichte<br />
enger Machtbegriff: Macht ist auf best. soziale Tatbestände<br />
begrenzt<br />
dezisionistischer Machtbegriff kommunikativer Machtbegriff<br />
Überw<strong>in</strong>dung von Wi<strong>der</strong>stand und Konfliktivität von<br />
Gesellschaften<br />
primär Kommunikationsmedium, Grundlage für geme<strong>in</strong>schaftliches<br />
Handeln<br />
36
handlungstheoretisch struktur- o<strong>der</strong> systemtheoretisch<br />
Herrschaftsproblematik: 3 unterschiedliche Umgangsweisen:<br />
• <strong>in</strong>dividualistisch orientierte Theorien/ rationale Akteursmodelle<br />
• allgeme<strong>in</strong>e soziale Regelungs- und Beziehungsform<br />
• kritisch, teils marxistisch: Herrschaft als Macht- o<strong>der</strong> Konfliktregelungsmechanismus: wollen H. <strong>in</strong>sgesamt<br />
möglichst m<strong>in</strong>imieren – steht demokratischer Konstruktion d. Ges. entgegen. Skepsis gegenüber Legitimierbarkeit<br />
Vielgestaltige Ursachen und Gründe, viele Dimensionen, positive und negative Aspekte müssen bedacht werden.<br />
Macht und Herrschaft müssen dabei von e<strong>in</strong>er Vielzahl diffuser sozialer Zwänge im Alltagsleben ebenso geschieden<br />
werden wie def<strong>in</strong>itorisch von E<strong>in</strong>fluss, Zwang und Gewalt. Sie sollten nicht verteufelt, aber auch nicht umstandslos<br />
für harmlos gehalten werden. Kritikwürdig bleiben sie dort, wo sie mit dem demokratisch-egalitären Selbstbild <strong>der</strong><br />
Mo<strong>der</strong>ne kollidieren und natürlich da, wo sie nicht auf Chancengleichheit, freier Wahl o<strong>der</strong> Legitimität beruhen.<br />
Lektion X (S. 185)<br />
Kaste, Stand, Klasse (Frank Thieme)<br />
1. <strong>E<strong>in</strong>führung</strong><br />
„Kaste“, „Stand“, „Klasse“ (auch soziale Schichtung, soziale Lage, soziales Milieu) s<strong>in</strong>d Fachterm<strong>in</strong>i soziologischer<br />
Ungleichheitsforschung;<br />
soziale Ungleichheit = Oberbegriff<br />
Fraglich, ob „Kaste“, „Stand“, „Klasse“ auch „aktuell“ s<strong>in</strong>d.<br />
1.1 „Natürliche“ und soziale Ungleichheit<br />
Verschiedenheit <strong>der</strong> Menschen als Ausgangspunkt<br />
Äußere Unterscheidungsmerkmale s<strong>in</strong>d vorwiegend natürlich – biologisch – bed<strong>in</strong>gt natürliche Ungleichheit; sie<br />
s<strong>in</strong>d erkennbar, also objektiv feststellbar (?? Mensch als Kulturwesen)<br />
Persönliche Eigenschaften werden durch Sozialisation entfaltet.<br />
Natürliche gesellschaftliche Großgruppen: Frauen – Männer, Schwarze – Weiße, Junge – Alte, Große – Kle<strong>in</strong>e usw.<br />
Soziale Ungleichheit: <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesellschaft s<strong>in</strong>d die Chancen <strong>der</strong> gesellschaftlichen Teilhabe unterschiedlich verteilt,<br />
d.h. die Möglichkeiten des Zugangs zu wichtigen Ressourcen s<strong>in</strong>d unterschiedlich – meist unabhängig vom Willen<br />
und Können d. E<strong>in</strong>zelnen<br />
S. U. ist gesellschaftlich konstruiert, aber nur schwer verän<strong>der</strong>bar<br />
Durch S. U. entstehen für die e<strong>in</strong>en Vor- für die an<strong>der</strong>en Nachteile<br />
Natürliche und soziale U. s<strong>in</strong>d mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verquickt. Oft ist nicht mehr feststellbar, wo <strong>der</strong> Ursprung best. Merkmale<br />
liegt (z.B. Geschlechtsrollen); es bleibt e<strong>in</strong> bewährtes Mittel <strong>der</strong> Rechtfertigung, soziale U. mit natürlichen zu begründen<br />
Ideologien (Wahrheit beanspruchende, aber sich <strong>der</strong> Überprüfung entziehende Gedankengebäude zur Erklärung d.<br />
Wirklichkeit) zur Rechtfertigung sozialer Ungleichheit<br />
Merkmale sozialer U.: Beruf, Bildungsabschluss, E<strong>in</strong>kommen, Prestige, Wohnsituation, Quantität und Qualität von<br />
Konsum und Freizeit etc.<br />
S.U. ist auch e<strong>in</strong> wichtiges Thema <strong>in</strong> <strong>der</strong> Politik – E<strong>in</strong>greifen durch Bildungs- u. Sozialpolitik, Umverteilung von Gel<strong>der</strong>n<br />
usw.<br />
37
1.2 Formen sozialer Ungleichheit<br />
Sozialer Wandel Wandel von Ungleichheitsstrukturen unterschiedl. Formen von Ungleichheit<br />
Soziale Mobilität: E<strong>in</strong>zelne steigen sozial auf o. s<strong>in</strong>ken ab, verlassen die „angestammte“ Großgruppe<br />
Intragenerationenmobilität: Person seigt im Laufe ihres Lebens auf o<strong>der</strong> ab<br />
Intergenerationenmobilität: entsprechende Verän<strong>der</strong>ung im Vergleich zur Elterngeneration<br />
Gesellschaftl. Bed<strong>in</strong>gungen bestimmten Auf- u. Abstiegsprozesse mit (z.B. Vererbung von Positionen); Mo<strong>der</strong>ne Ges.<br />
gelten als offen: geregelte Prozesse bestimmten den Weg „nach oben“ (Wissen, Leistung, Bildungsabschluss <strong>in</strong> zentraler<br />
Rolle)<br />
2. Kaste<br />
2.1 Def<strong>in</strong>ition<br />
Kaste (portug.: casta = unvermischt, re<strong>in</strong>): Angehörige haben zugeschriebene Merkmale, die als angeboren und unverän<strong>der</strong>bar<br />
gelten; Abstammungspr<strong>in</strong>zip; Heirat nur <strong>in</strong>nerhalb d. Kaste (Endogamie Exogamie); Name, Beruf,<br />
Kleidung, Wohnort verraten Zugehörigkeit; Zugehörigkeit sowie soziale U. gelten als unüberw<strong>in</strong>dbar<br />
2.2 Legitimation starrer Hierarchien<br />
Glaube an Legitimität – H<strong>in</strong>duismus: Zugehörigkeit zu e<strong>in</strong>er Kaste ist Ausdruck d. persönl. Leiblichen Wie<strong>der</strong>geburt,<br />
die sich nach Verdiensten/Unwert d. vorausgegangenen Lebens richtet (Karma)<br />
Beisp. Indien: Offiziell ke<strong>in</strong>e Kastengesellschaft mehr, zahlreiche Strukturen bestehen fort:<br />
Handlungsreglementierungen schließen Rechte und Pflichten zur Ausübung von Herrschaft e<strong>in</strong> und schreiben den<br />
Beruf vor;<br />
Priesterkaste (Brahmanen) – Krieger- und Herrscherkaste (Kschatrija o. Rajanja) – Händler-, Bauern- u. Handwerkerkaste<br />
(Waischja) – Dienerkaste (Schundra). In ca. 3000 Unterkasten geteilt. Außerhalb d. Kasten: „Unberührbare“<br />
(Outcasts, h<strong>in</strong>d.: Parias) – nicht <strong>in</strong> Ges. <strong>in</strong>tegriert, praktisch recht- u. schutzlos<br />
Rascher Wandel: Kastenstruktur z.T. durchbrochen (Gesetz: Parias können zu Volksvertretern gewählt werden);<br />
Islam verän<strong>der</strong>te Formen von Ungleichheit; Nebene<strong>in</strong>an<strong>der</strong> von Tradition + Mo<strong>der</strong>ne führte zum Fortbestand<br />
und zu weiterer Differenzierung d. Kastensystems<br />
2.3 Eignung des Begriffs für die soziologische Ungleichheitsforschung<br />
– wird bezweifelt: Merkmale wie Abstammungspr<strong>in</strong>zip, Legitimation durch Glauben, starre vertikale Differenzierung<br />
d. Kasten ü. Reglementierung aller Lebensbereiche s<strong>in</strong>d mo<strong>der</strong>nen westl. Zivilisationen nicht gegeben; Begriff kann<br />
sich als angemessen erweisen, wenn untergegangene Kulturen untersucht werden<br />
Allgeme<strong>in</strong> wird „Kaste“ manchmal als polemische Bezeichnung verwendet für hochprivilegierte Personen, die sich<br />
weniger um das Allgeme<strong>in</strong>wohl als um sich selbst kümmern.<br />
3. Stand<br />
3.1 Def<strong>in</strong>ition<br />
Stand ist durch soziale Herkunft bestimmt – Abstammungspr<strong>in</strong>zip; Verlassen/H<strong>in</strong>e<strong>in</strong>kommen ist nicht unmöglich<br />
aber Ausnahme.<br />
Stammeszugehörigkeit leitet sich ab und ist legitimiert durch e<strong>in</strong> „Es-ist-immer-schon-so-gewesen“<br />
Def<strong>in</strong>itionsmerkmale:<br />
3. Großgruppe;<br />
4. Angehörige s<strong>in</strong>d durch Beruf, Rechte, Pflichten, gesamte Lebensumstände strengen sozialen, rechtlich abgesicherten<br />
Regeln unterworfen<br />
38
5. Privilegien, Standesethos, spezifische Mentalität;<br />
6. „standesmäßige“ Kleidung, Wohnung, Feste etc.<br />
7. Zugehörigkeit ist leicht erkennbar<br />
3.2 Ger<strong>in</strong>ge soziale Mobilität<br />
Abstammungspr<strong>in</strong>zip schließt Mobilität normalerweise aus.<br />
Devianz negative Sanktionen, Degradierung Ausschluss a. d. Ständeordnung; unterständische Gruppen (<br />
„unehrenhafte Berufe“: z.B. Henker, Abdecker, Geldverleiher; Mitglie<strong>der</strong> frem<strong>der</strong> Religionsgeme<strong>in</strong>schaften: z.B. Juden)<br />
völlige Entrechtung („vogelfrei“)<br />
Persönl. Berufung (Kooptation) kann <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen zur Aufnahme <strong>in</strong> höheren Stand führen: z.B. König beruft treue<br />
Krieger <strong>in</strong> den Ritterstand; „Nobilitierung“ <strong>in</strong> den Adel (England!); Klerus (Zölibat nie<strong>der</strong>er Klerus holte Nachfolger<br />
aus bäuerl. Stand, hoher K. aus Adel)<br />
3.3 Legitimation <strong>der</strong> Ständeordnung<br />
Grundlage: Glaube + Tradition<br />
Thomas von Aqu<strong>in</strong> (Scholastiker): se<strong>in</strong>e Auslegung d. Christentums lieferte wesentlich die Legitimation für die feudale<br />
Ständegesellschaft (Wilhelm II, letzter deutscher Kaiser: „von Gottes Gnaden“ e<strong>in</strong>gesetzt); Ständeordnung bis <strong>in</strong>s<br />
20. Jh. – endgültige Auflösung erst Ende d. WK I; Reste <strong>in</strong> konstitutionellen Monarchien<br />
3.4 Mittelalterliche Ständegesellschaft <strong>in</strong> Europa (siehe Abbildungen S. 193)<br />
Stände waren typisch für West- u. Mitteleuropa – bis zum Beg<strong>in</strong>n d. Industrialisierung<br />
Aufteilung: Freie + Unfreie (später differenziert); führende Stände: Adel + Klerus; Mehrheit: Leibeigene (unfreie<br />
Bauern)<br />
v Feudale Agrargesellschaft<br />
80 – 90% d. Bevölkerung lebte + arbeitete auf dem Land große Bedeutung des Bodens; Bodenbesitzer: Adel, Klerus,<br />
zunächst freie Bauern;<br />
Recht auf Boden (Feudum) durch Lehen vergeben; später: Geburtspr<strong>in</strong>zip (Lehen vererbt)<br />
Freie Bauern verloren im Verlauf d. Entwicklung die Verfügung über den Boden Masse d. Leibeigenen vergrößerte<br />
sich.<br />
E<strong>in</strong>zelne Unterglie<strong>der</strong>ungen d. Adels wurden mit <strong>E<strong>in</strong>führung</strong> von Söldnerheeren zu „Höfl<strong>in</strong>gen“ o<strong>der</strong> „Raubrittern“<br />
v Ständegesellschaft <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt<br />
Impulse zum längerfristigen Wandel g<strong>in</strong>gen von Städten aus; Keime d. späteren bürgerl. Ges.; zumeist Gründungen<br />
d. hohen Adels o. Klerus, aber Bedeutung d. Bodens ger<strong>in</strong>g Fachhandelskaufleute gelangten zu Reichtum und<br />
pol. Macht.<br />
Patriziat (zunächst M<strong>in</strong>istrale) wurde vom aufstrebenden Bürgertum e<strong>in</strong>genommen Zuwachs an Macht, Ansehen,<br />
Reichtum<br />
Ökonomischer Erfolg war neben Geburtspr<strong>in</strong>zip e<strong>in</strong> zusätzliches Regulativ<br />
Stand d. Leibeigenen gab es nicht – „Stadtluft macht frei“<br />
Nach und nach wurde Erblichkeit d. sozialen Stellung bei Patriziern zu regulärem Pr<strong>in</strong>zip<br />
Bürger spalteten sich <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>ere Kaufleute (Krämer, Händler) und Handwerker (Mehrheit); regional bedeutsam:<br />
Ackerbürger<br />
Berufsständische Organisationen: Gilden (reiche Kaufleute) und Zünfte (Handwerker) (<strong>in</strong> D bis <strong>in</strong>s 19. Jh.) – Vermittlung<br />
+ Überwachung von Normen und Werten Regulierungen (Heiratsverbote + -gebote, angemessenes Feiern<br />
von Festtagen, Klei<strong>der</strong>ordnungen, Sitzordnungen <strong>in</strong> d. Kirche, Mahlzeiten)<br />
39
3.5 Stand nach Max Weber<br />
Mensch lebt immer <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>schaften; diese s<strong>in</strong>d von best. Geme<strong>in</strong>samkeiten geprägt „gefühlte Geme<strong>in</strong>schaft“<br />
Anspruch auf Exklusivität Versuch, Zugang zu best. Privilegien zu monopolisieren – Nichtangehörige auszuschließen<br />
Ständische Lagen s<strong>in</strong>d bed<strong>in</strong>gt „durch e<strong>in</strong>e spezifische, positive o<strong>der</strong> negative, soziale E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Ehre (…), die<br />
sich an irgende<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Eigenschaft vieler knüpft“;<br />
monopolisieren die Marktchancen von Menschen<br />
„Geme<strong>in</strong>same Eigenschaft“ – Gleichheit man fühlt sich zusammengehörig und an<strong>der</strong>en überlegen<br />
Klassenlage = gleiche ökonomische Lage<br />
Interessenlagen ergeben sich aus Klassenlage + ständischer Lage<br />
„Ständische Schließung“ – man bleibt unter sich („ständisches Konnubium“ – standesgemäße Heirat sorgt für ständische<br />
Schließung)<br />
Vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> abweichende Bildungsbeteiligung unterschiedlicher Berufsgruppen: Beamtenhaushalte – höchste Quote<br />
an Studierenden; dann Selbstständige; „kle<strong>in</strong>e“ Angestellte und v.a. Arbeiter sehr unterrepräsentiert<br />
Zugehörigkeit zum Stand erfor<strong>der</strong>t „ehrenhaftes Verhalten“ – an<strong>der</strong>nfalls Ausschluss<br />
3.6 Ständische Lagen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gegenwart<br />
Weberscher Ansatz – <strong>E<strong>in</strong>führung</strong> e<strong>in</strong>er „zweiten Dimension“ – von Bedeutung<br />
P. Bourdieu: Lebensstile = Ausdrucksform sozialer Ungleichheit; Klassenzugehörigkeit ist erkennbar am Habitus;<br />
„fe<strong>in</strong>e Unterschiede“ verfestigen soziale Ungleichheiten; Habitus d. herrschenden Klassen wird „vererbt“<br />
D: Wie<strong>der</strong>kehr sozialer Schließung als Folge von Individualisierungs- und Enttraditionalisierungsprozessen; Eliteforschung:<br />
Besetzung d. höchsten Positionen <strong>in</strong> Politik, Wirtschaft, Verwaltung usw. wie<strong>der</strong> geschlossener – Aufstiege<br />
aus entfernten Großgruppen nur selten; Bildungsforschung: Auslän<strong>der</strong> bekommen nur schwer Zugang zu höheren<br />
Bildungsabschlüssen<br />
Art d. politischen Interessenswahrnehmung – berufsständische Vertretungen (z.B. Ärztekammern) – zwar Aufnahme<br />
durch Beruf, nicht durch Abstammung, aber geme<strong>in</strong>schaftl. Gefühl und daraus abgeleitetes Recht d. Interessenswahrnehmung<br />
Theoriediskussion <strong>in</strong> USA: Stand Status (R. L<strong>in</strong>ton) = Aspekt d. „spezifischen sozialen E<strong>in</strong>schätzung“<br />
amerik. <strong>Soziologie</strong>: Stand = Status; deutsche Soz.: zu je<strong>der</strong> sozialen Position gehört e<strong>in</strong> Status. Zugehörigkeit zu ständischer<br />
Lage muss aber nicht se<strong>in</strong><br />
4. Klasse<br />
4.1 Def<strong>in</strong>ition<br />
Angehörige e<strong>in</strong>er Klasse haben ökonomische Merkmale geme<strong>in</strong>sam Klassenzugehörigkeit def<strong>in</strong>iert sich durch die<br />
Stellung im Produktionsprozess<br />
Klassenlagen unterscheiden sich deutlich vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
Soziale Abstiegsmobilität ist häufig, Aufstiegsmobilität nur schwer realisierbar (Chancen zu best. Ressourcen zu gelangen<br />
s<strong>in</strong>d von Zugehörigkeit zur Klasse bestimmt)<br />
4.2 Klassengesellschaften. Geschichte<br />
Zwischen ökonomisch best. Klassen herrschen große soziale Unterschiede und unversöhnliche Wi<strong>der</strong>sprüche<br />
Klassengesellschaft; kaum Chancen zum Aufstieg, Gefahr des Abstiegs sehr groß; Klassenschicksale werden „vererbt“<br />
40
Von sozialen Konflikten geprägt. Wi<strong>der</strong>sprüche zw. sozialer Lage und Interessenlage politische Kämpfe (Aufstände,<br />
Revolutionen) Tendenz zum sozialen Wandel<br />
Bürgerl. Klassenges. entstand mit Ende d. feudalen Ständeges. <strong>in</strong> Europa Mobilitätsschub<br />
„dreifache Befreiung“ aus <strong>der</strong> Leibeigenschaft:<br />
- vom feudalen + ständischen Zwang <strong>der</strong> Fronarbeit<br />
- vom Boden als Existenzgrundlage<br />
- von Schutz und Fürsorge des Feudalherren<br />
allgeme<strong>in</strong>e Arbeitssuche – große Konkurrenz (auch mittelständische Handwerker und Kaufleute konnten sich<br />
gegen den kapitalistischen Unternehmer nicht durchsetzen)<br />
Bevölkerung wuchs rasant Heer <strong>der</strong> „proletarischen Reservearmee“ (Marx) vergrößerte sich<br />
gewaltige regionale und soziale Mobilität: „doppelte Entwurzelung“ (ca. �<br />
d. Bevölkerung verließ Wohnort/soziale<br />
Umwelt)<br />
Entstehung d. Klasse des Arbeiterproletariats<br />
2 soziale Großgruppen: Bürgertum (kapitalistischer Unternehmer, Bildungsbürgertum; profitierte von <strong>der</strong> Entwicklung)<br />
und Arbeiterklasse (Armut, Krankheit, Krim<strong>in</strong>alität wuchsen)<br />
Entstehung <strong>der</strong> Arbeiterbewegung und von gesellschaftsphilosophischen Theorien zur Aufhebung dieser Zustände:<br />
v.a. Historischer Materialismus (Marx, Engels)<br />
4.3 Begriffsgeschichte: Klassen bei Karl Marx, Friedrich Engels und Max Weber<br />
v Vorläufer<br />
Physiokraten (nationalökonom. Denker im 18. Jh.) verwendeten Begriff „Klasse“ (wie Naturwissenschaftler) zur<br />
funktionalen Klassifikation d. e<strong>in</strong>zelnen gesellschaftl. Großgruppen, also h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Nützlichkeit für die Gesellschaft<br />
• „produktive Klasse“: Bauern, Pächter – Erzeuger <strong>der</strong> Grundnahrung<br />
• „sterile Klasse“: Arbeiter, Kapitalisten<br />
• „disponible Klasse“: König, Grundeigentümer, Kirche, Leibeigene<br />
Claude-Henri de Rouvroy Sa<strong>in</strong>t-Simon (Lehrer A. Comtes) unterschied zwischen „produktiver“ (alle Arbeitenden,<br />
auch geistig Tätige) und „müßiggehen<strong>der</strong>“ Klasse (Adel, Klerus, Beamte)<br />
v Geschichte als Klassenkampf: Klassen bei Karl Marx und Friedrich Engels<br />
Marx und Engels: Begrün<strong>der</strong> des „wissenschaftlichen Sozialismus“<br />
„Kommunistisches Manifest“: „die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen“<br />
– Klassenantagonismus (seit Verlassen d. Urgeme<strong>in</strong>schaft 2 fe<strong>in</strong>dliche, gegensätzliche Klassen): die e<strong>in</strong>e Klasse<br />
besitzt Produktionsmittel – die an<strong>der</strong>en werden ausgebeutet<br />
Gesellschaft ist zweigeteilt (dichotomisch): Bourgeoisie/Kapitalisten und Proletariat<br />
Konflikte Revolution zuvor unterdrückte Klasse gelangt <strong>in</strong> Besitz d. Produktionsmittel/an die Macht<br />
Entscheidende Kraft des historischen Wandels: wi<strong>der</strong>sprüchliche Entwicklung von Produktionskräften (materielle +<br />
personelle Ressourcen: menschl. Arbeitskraft und technische/organisatorische Nutzung <strong>der</strong> Naturkräfte) und Produktionsverhältnissen<br />
(gesellschaftl. Bed<strong>in</strong>gungen, v.a. Eigentumsverhältnisse. Besitz wachsen<strong>der</strong> Reichtum;<br />
Nicht-Besitz Elend)<br />
Produktionsverhältnisse = Wi<strong>der</strong>spiegelung <strong>der</strong> Klassengesellschaft Bourgeoisie will bestehende Bed<strong>in</strong>gungen<br />
erhalten<br />
Produktionsverhältnisse entwickeln sich zu „Fessel“ für fortschrittliche Entwicklung. Sieg d. unterdrückten Klasse<br />
Durchbruch e<strong>in</strong>er fortschrittl. Produktionsweise<br />
Unterdrückte Klasse wird zur unterdrückenden Klasse<br />
�<br />
41
3 Entwicklungsstufen (Sklavenhaltergesellschaft, Feudalgesellschaft, bürgerl. Gesellschaft) ausgebeutete Klasse<br />
(Proletariat) siegreiche Revolution Ende aller Klassengesellschaften<br />
Zum Klassenkampf kommt es erst, wenn aus <strong>der</strong> „Klasse an sich“ die „Klasse für sich“ wird (Menschen müssen<br />
Klassenbewusstse<strong>in</strong> entwickeln)<br />
Gesellschaftsformation<br />
Herrschende<br />
Klasse<br />
Ausgebeutete<br />
Klasse<br />
Urgeme<strong>in</strong>schaft<br />
v Klassen bei Max Weber<br />
Sklavenhaltergesellschaft <br />
Feudalgesellschaft<br />
Entwicklungsrichtung zur klassenlosen Gesellschaft<br />
Bürgerliche<br />
Gesellschaft<br />
Sozialismus<br />
Kommunismus<br />
ke<strong>in</strong>e Sklavenhalter Adel/Klerus Bourgeoisie ke<strong>in</strong>e<br />
ke<strong>in</strong>e Sklaven Leibeigene Proletariat ke<strong>in</strong>e<br />
Weber hält den ökonomischen Determ<strong>in</strong>ismus von Marx/Engels für falsch. Die Vorstellung, die gesellschaftl. Entwicklung<br />
laufe auf e<strong>in</strong>e proletarische Revolution h<strong>in</strong>aus, sei historisch wi<strong>der</strong>legt.<br />
Webers Def<strong>in</strong>ition von Klasse:<br />
„Wir wollen von e<strong>in</strong>er Klasse reden, wo 1. e<strong>in</strong>er Mehrzahl von Menschen e<strong>in</strong>e spezifische ursächliche Komponente<br />
ihrer Lebenschancen geme<strong>in</strong>sam ist, soweit 2. diese Komponente lediglich durch ökonomische Güterbesitz- und<br />
Erwerbsklassen und zwar 3. unter <strong>der</strong> Bed<strong>in</strong>gung des (…) Markts dargestellt wird“.<br />
Alle Menschen leben <strong>in</strong> Klassenlagen. „allerelementarste Tatsache“, dass daraus „schon für sich alle<strong>in</strong> spezifische<br />
Lebenschancen“ geschaffen s<strong>in</strong>d. „Besitz und Besitzlosigkeit s<strong>in</strong>d daher die Grundlagen aller Klassenlagen“.<br />
Erwerbsklassen: müssen arbeiten, um leben zu können;<br />
Besitzklassen: haben genügend Besitz, um davon leben zu können (Mobilität grundsätzlich möglich)<br />
Lebenschancen d. Menschen s<strong>in</strong>d auch <strong>in</strong> Erwerbsklassen vielfältig: Möglichkeit, sich <strong>in</strong>dividuell zu qualifizieren –<br />
Mitbestimmung d. Marktchancen<br />
Klassenlage und ständische Lage bee<strong>in</strong>flussen Marktchancen<br />
3 Hauptklassen: – Arbeiterklasse<br />
– Besitzlose Mittelklasse („besitzlose Intelligenz- u. Fachgeschultheit“)<br />
– Besitzende Oberklasse<br />
Zukunft: Durchsetzung d. „bürokratischen Herrschaft“<br />
An e<strong>in</strong> „Reich <strong>der</strong> Freiheit“ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er klassenlosen Gesellschaft glaubt Weber nicht.<br />
4.4 Neuere Theorieansätze unter Berücksichtigung von Stand und Klasse<br />
§ 1930er. T. Geiger: „Klassengesellschaft im Schmelztiegel“; breitgelagerte Qualifikationsprozesse + Entstehung<br />
neuer Berufsgruppen künftig „Schichten“ und „soziale Lagen“ anstelle von „Klassen“<br />
§ 1950/60er. Weitere Abwendung von Klassenbegriff.<br />
H. Schelsky: These von <strong>der</strong> „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ – Klassen und Schichten tentieren zur Auflösung;<br />
breite Masse <strong>der</strong> „unteren Mitte“<br />
§ 1950er-70er. Schichten/Schichtung <strong>in</strong> mo<strong>der</strong>nen offenen Gesellschaften: Vertikaler Aufbau von Großgruppen –<br />
durch wichtige Merkmale unterschieden, aber Grenzen überw<strong>in</strong>dbar (Mobilität ist typisch)<br />
§ 1977. R. Dahrendorf: Arbeiter s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e Klasse mehr (ke<strong>in</strong> entsprechendes Bewusstse<strong>in</strong>), stattdessen „neue<br />
Dienstklasse“. „Falscher Mittelstand“: mittelständische Mentalität, aber soziale Lage d. Arbeiter. Eigentlicher Mittelstand:<br />
Selbstständige, Freiberufler, Bauern<br />
42
§ 1970er. Neomarxistische Ansätze: 3% Bourgeoisie – Produktionsmittelbesitzer �<br />
� Mittelk-<br />
lasse – lohnunabhängig + Kle<strong>in</strong>bourgeoisie �<br />
�Arbeiterklasse – Kle<strong>in</strong>unternehmer, lohnabh. Mittelklasse<br />
§ 1980er. Wandel sozialer Ungleichheitsstrukturen: Industriegesellschaft mo<strong>der</strong>ne Dienstleistungsges.; enormer<br />
Umfang d. Bildungspartizipation, Individualisierung, Enttraditionalisierung Zuordnung zu Ständen und Schichten<br />
mehr und mehr unbrauchbar<br />
§ Fortbestand von Klassen: Berger/Hradil – „strukturierte Klassengesellschaft“, Kreckel – „Klassenverhältnisse ohne<br />
Klassen); Bourdieu: ökonomisches, kulturelles + soziales Kapital Klassenverhältnisse entstehen aus <strong>der</strong>en unterschiedl.<br />
Verfügbarkeit; Lebensstile. Zu vertikaler Struktur von sozialer Ungleichheit kommt horizontale Lagerung.<br />
Schicht, Standes- o<strong>der</strong> Klassenzugehörigkeit entkoppeln sich vom Lebensstil; soziale Milieus – Webers ständischen<br />
Lagen ähnlich –„gefühlte Geme<strong>in</strong>schaften“ (geme<strong>in</strong>same Wertorientierung)<br />
§ Giddens. Festhalten am Klassenbegriff. Gegenseitige Wirkung von Struktur und Handeln. „mittelbare Strukturierung“<br />
(Stellung im Produktionsprozess, berufl. Qualifikation) und „unmittelbare Strukturierung“ (techn. Arbeitsteilung<br />
im Betrieb, dortige Herrschaftsverhältnisse);<br />
fehlendes Klassenbewusstse<strong>in</strong> Ende d. Klassengesellschaft; Giddens schlägt Begriff „Klassenbewusstheit“ statt<br />
„Klassenbewusstse<strong>in</strong>“ vor: K.bewusstheit sei auch bei fehlendem K.bewusstse<strong>in</strong> beobachtbar (z.B. bei Leugnung<br />
d. Klassenzugehörigkeit)<br />
§ Dienstklassen <strong>der</strong> Gegenwartsgesellschaft:<br />
o Obere Dienstklasse: Freiberufler, Selbständige (> 10 Mitarb.), Beamte, Richter, Angestellte im höheren<br />
Dienst<br />
o Untere Dienstklasse: Kle<strong>in</strong>e Selbstständige, Beamte im gehobenen und mittleren Dienst, Berufssoldaten,<br />
Angestellte mit schwierigen Aufgaben u. eigenverantwortl. Tätigkeit<br />
o Nichtdienstklasse: Nichterwerbstätige, selbstständige Landwirte, kl. Selbstständige, alle Arbeiter, Beamte<br />
im e<strong>in</strong>fachen Dienst, Industrie- u. Werkmeister, Angestellte mit e<strong>in</strong>facher Tätigkeit<br />
Dienstklassenansatz bevorzugt für Untersuchung mo<strong>der</strong>ner Gesellschaften, die sich als Dienstleistungsgesellschaften<br />
charakterisieren lassen.<br />
Begriffe Stand und Klasse bis heute brauchbar, aber nicht ausreichend f. Darstellung u. Analyse sozialer Ungleichheitsstrukturen.<br />
Lektion XI (S. 221)<br />
Soziale Ungleichheit, soziale Schichtung und Mobilität (Stefan Hradil)<br />
1. Phänomen und Begriff sozialer Ungleichheit<br />
Beisp. sozialer Ungleichheit: Sklaven – freie Bürger (Antike), entmutigende Armut – luxuriöser Reichtum (Industrieges.),<br />
„Normalbürger“ – Asylwerber, sichere Anstellung – Arbeitslosigkeit, Frauen – Männer, Ostdeutschland –<br />
Westdeutschland, …<br />
Menschen leben und arbeiten <strong>in</strong> recht beständigen sozialen Beziehungen und nehmen Positionen e<strong>in</strong>. Diese s<strong>in</strong>d mit<br />
Lebens- und Handlungsbed<strong>in</strong>gungen verbunden. Unterschiedliche Positionen unterschiedliche Bed<strong>in</strong>gungen<br />
Vor- und Nachteile im Vergleich zu an<strong>der</strong>en – Ungleichheit<br />
Soziale Ungleichheit = (1) wertvolle, (2) nicht absolut gleich und (3) systematisch aufgrund von Positionen <strong>in</strong> gesellschaftlichen<br />
Beziehungsgefügen verteilte, vorteilhafte bzw. nachteilige Lebensbed<strong>in</strong>gungen von Menschen<br />
(1) gesellschaftlicher „Wert“ – knappes und begehrtes „Gut“ (Bildung, Geld; Vieh)<br />
(2) ungleiche Verteilung <strong>der</strong> „Güter“; ke<strong>in</strong>e begriffl. Vorentscheidung über „(Un-)Gerechtigkeit“<br />
43
(3) Vorstellungen/Vermutungen über Verteilungsmechanismen. Zufällige (Lottogew<strong>in</strong>n), <strong>in</strong>dividuelle (Charakter)<br />
o<strong>der</strong> natürliche (Krankheit) Lebensbed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d nicht „soziale Ungl.“<br />
Um von „sozialer Ungleichheit“ sprechen zu können, müsste sich erst die Idee durchsetzen, dass …<br />
- … gesellschaftliche Verhältnisse von Menschen gemacht se<strong>in</strong> können<br />
- … alle Menschen pr<strong>in</strong>zipiell gleich s<strong>in</strong>d (Aufklärung!!)<br />
Strukturebenen sozialer Ungleichheit:<br />
• Ursachen sozialer U. (z.B. wirtschaftl. Ausbeutung, soziale Vorurteile etc)<br />
• Determ<strong>in</strong>anten sozialer U. (z.B. Geschlecht, Beruf, Alter, Wohnort etc.)<br />
• Dimensionen sozialer U.: wichtigste Arten soz. Vor- u. Nachteile (klassisch: Wirtschaft, Ansehen, Macht; post<strong>in</strong>dustriell:<br />
Bildung, Freizeitbed<strong>in</strong>gungen, soz. Sicherheit, ungleiche Behandlung etc.)<br />
• Auswirkungen sozialer U.: äußere Lebensverhältnisse (Luxus/Kargheit, Reisemöglichk. etc.); Mentalität, alltägl.<br />
Lebensverh. (Optimismus/Pessimismus, Kontaktfähigkeit/Isolation, sprachl. Fertigkeiten/Defizite,<br />
Fremdheit/Vertrautheit mit Kultur, …)<br />
Gefüge sozialer Ungleichheit lässt sich durch e<strong>in</strong>e best. historische Ausgestaltung d. vier Strukturebenen kennzeichnen.<br />
(Geld – Wei<strong>der</strong>echte, Beruf – Körpergröße etc.)<br />
2. Die historische Abfolge von Gefügen sozialer Ungleichheit<br />
2.1 Die vor<strong>in</strong>dustrielle Ständegesellschaft<br />
Wichtigste Determ<strong>in</strong>ante: Geburt (Anfang Mittelalter bis zu Revolutionen d. 18. + 19. Jh.)<br />
Adels-, Bürger-, Bauernstand. Ungleichheiten <strong>in</strong> Besteuerung, Wahlrecht, Erwerbsmöglichkeiten, Arbeitspflichten,<br />
Klei<strong>der</strong>vorschriften, Sitzordnung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kirche, …<br />
2.2 Die früh<strong>in</strong>dustrielle Klassengesellschaft<br />
Ab Mitte d. 19. Jh. (Gewerbefreiheit, Bauernbefreiung) Aufhebung d. ständischen Schranken.<br />
Determ<strong>in</strong>ante Besitz<br />
Fabriken, Masch<strong>in</strong>en, Kapital Reichtum, Macht, E<strong>in</strong>fluss<br />
Lohn <strong>der</strong> Besitzlosen reichte kaum zum Überleben<br />
Schaffte Trennung <strong>der</strong> „Welten“<br />
2.3 Die <strong>in</strong>dustriegesellschaftliche Schichtgesellschaft<br />
Im Laufe d. 20. Jh. wuchs die Zahl <strong>der</strong> Besitzlosen und es wurden deutlichere Ungleichheiten unter ihnen bemerkbar<br />
Berufshierarchie Determ<strong>in</strong>ante Beruf<br />
Verteilung dieser Vor- u. Nachteile = Schichtungsgefüge. Es überlagerte Klassen- u. Standesgefüge, ohne sie völlig zu<br />
verdrängen Industrieges. = geschichtete Gesellschaft<br />
3. Grundzüge sozialer Schichtung und Grundbegriffe <strong>der</strong> Schichtungssoziologie<br />
Klassenges. = gespaltene Ges.<br />
Schichtgesellschaft = ungleich abgestufte Ges. <strong>in</strong> allmählichen Übergängen<br />
Wichtigste Dimensionen: graduell verteilte „Güter“<br />
„Rückgrat“: Berufliche Hierarchie, immer mehr Qualifikationen<br />
Anspruch, „offene Gesellschaften“ zu se<strong>in</strong><br />
Status = Stellung e<strong>in</strong>es (Berufs-)Positions<strong>in</strong>habers auf den Abstufungen von Qualifikation, Erwerbstätigkeit, E<strong>in</strong>kommen,<br />
Prestige o<strong>der</strong> Macht<br />
Gesamtstatus = Summe <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelstatus <strong>in</strong>nerhalb d. e<strong>in</strong>zelnen Dimensionen<br />
44
Statuskonsistenz: ähnlich hoher Status auf allen Dimensionen Status<strong>in</strong>konsistenz<br />
Statusaufbau: unterschiedlich starke Besetzung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Statuslagen<br />
Statusgruppen: ähnlich hoher/zusammengesetzter Satus<br />
Soziale Schicht: durch best. Grenzen von höher o. tiefer Stehenden getrennte Statusgruppen<br />
4. Das Gefüge sozialer Schichtung <strong>in</strong> Deutschland. Empirische Befunde<br />
4.1 Bildung<br />
Bildungsexpansion <strong>in</strong> mo<strong>der</strong>nen Ges. seit 1960er Jahren – verstärkte Nutzung von weiterführenden Schulen und<br />
Ausbildungsgängen<br />
Chancengleichheit = Ziel <strong>der</strong> Schichtungsgesellschaft (Bildungse<strong>in</strong>richtungen [Leistungsmessung] und Bildungsgrade<br />
als wichtigste Instrumente <strong>der</strong> Statuszuweisung)<br />
§ „Gew<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>nen“ <strong>der</strong> Bildungsexpansion: Frauen<br />
§ Bleibende Benachteiligung unterer Statusgruppen<br />
§ Bildungschancen ausländischer K<strong>in</strong><strong>der</strong> + Jugendlicher weit h<strong>in</strong>ter denen <strong>der</strong> deutschen, ABER<br />
§ Unterschiede zw. ausländ. K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und K<strong>in</strong><strong>der</strong>n von Arbeitern ger<strong>in</strong>g<br />
§ Bildungsabstände zw. Ausl. + Deutschen verr<strong>in</strong>gerten sich im allgeme<strong>in</strong>bildenden Schulwesen, aber nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Berufsausbildung<br />
4.2 Beschäftigung<br />
Erwerbsstatus und –chancen s<strong>in</strong>d wichtige Bereiche sozialer Schichtung: Vollzeiterwerbstätigkeit verschafft „eigenes<br />
Geld“, Unabhängigkeit, Kontakte, Selbstvertrauen, Identität usw. Arbeitslosigkeit bedroht all das.<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit:<br />
(1) Zeit des Wie<strong>der</strong>aufbaus + Wirtschaftswun<strong>der</strong>s von Gründung d. Republik bis Ende 1950er: Senkung d. Arbeitslosigkeit<br />
bis zur Vollbeschäftigung<br />
(2) Phase d. Vollbeschäftigung (1960 -1973): Arbeitslosenquote unter 2%<br />
(3) Dann treppenförmiger Anstieg d. Arbeitslosigkeit, obwohl Angebot stieg<br />
Chancen, (wie<strong>der</strong>) Arbeit zu bekommen, s<strong>in</strong>d unter den Schichten sehr unterschiedlich.<br />
4.3 E<strong>in</strong>kommen<br />
Wichtigste E<strong>in</strong>kommen: eigene Erwerbstätigkeit, staatliche Transferzahlungen, private Versorgung, Vermögenserträge<br />
E<strong>in</strong>kommensverteilung hat sich vom Beg<strong>in</strong>n d. 20. Jh. bis <strong>in</strong> die 70er Jahre langsam angeglichen.<br />
Seither wird sie langsam ungleicher.<br />
Armut hat <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nachkriegszeit abgenommen. Seit 70er deutliche Zunahme – seit Jahrtausendwende auf hohem<br />
Niveau.<br />
„neue Armut“ entstand durch Arbeitslosigkeit und unzureichende Erwerbschancen von Alle<strong>in</strong>erziehenden. Auch<br />
große Familien ( K<strong>in</strong><strong>der</strong>!) und Auslän<strong>der</strong> s<strong>in</strong>d stark armutsgefährdet.<br />
An <strong>der</strong> Spitze <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenshierarchie wächst jedoch <strong>der</strong> Reichtum.<br />
4.4 Prestige<br />
= typischen Ansehen sozialer Gruppierungen.<br />
Gruppenmerkmale werden von Mitmenschen bewertet höheres o<strong>der</strong> ger<strong>in</strong>geres Ansehen<br />
Prestige wird v.a. an Bildungsstatus und Berufsposition geknüpft Berufsprestige als „harter Kern“ <strong>der</strong> Prestigestruktur<br />
mo<strong>der</strong>ner Gesellschaften<br />
Prestige kann sich wandeln<br />
45
4.5 Macht<br />
M. Weber: Macht zu haben bedeutet „jede Chance, den eigenen Willen <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er gegebenen sozialen Beziehung<br />
auch gegen Wi<strong>der</strong>streben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“<br />
Institutionalisierte und legitimierte Macht = Herrschaft<br />
Inhaber von Spitzen-Herrschaftspositionen (Auswirkung auf ganze Ges.) = Machteliten<br />
4.6 Schichtung und Schichten<br />
Ostdeutschland Westdeutschland<br />
Mehrheit „Arbeiterschicht“ (Vergangenheit<br />
Ostdeutschlands als „Arbeiter- und Bauernstaat“)<br />
Mehrheit „Mittelschicht“ (nach persönlicher<br />
E<strong>in</strong>schätzung!)<br />
mehr Produktionsunternehmen mehr Dienstleistungsunternehmen<br />
auf dem Weg von Industriegesellschaft zu post<strong>in</strong>dustrieller<br />
Dienstleistungsges.<br />
Prosperität + Wachstum d. „neuen Mittelstandes“<br />
geht zu Ende<br />
Westd.: Dienstleistungsgesellschaft („neuer Mittelstand“): fast Hälfte d. Bevölkerung Selbstständige<br />
(„alter Mittelstand“): Zehntel d. Bev. (Fach-)Arbeiter: Drittel d. Bev.<br />
5. Sozialer Auf- und Abstieg im Schichtungsgefüge<br />
Wichtig ist, wie lang jemand <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er best. Schicht bleibt und wie das Auf und Ab se<strong>in</strong>es Lebensweges verläuft. Statuslage<br />
prägt das Denken und Verhalten.<br />
Soziale Mobilität: Bewegungen von e<strong>in</strong>er Position zur an<strong>der</strong>en<br />
Vertikale Mobilität: Strukturverän<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>in</strong>ter- und <strong>in</strong>tragenerationelle Mobilität<br />
Trennung zw. strukturell „erzwungenen“ Auf- und Abstiegen (Strukturelle Mobilität) und solchen, die auf das <strong>in</strong>dividuelle<br />
Verhalten zurückzuführen s<strong>in</strong>d.<br />
Legitimität d. Schichtungsgefüges: als „gerecht“ werden Abstufungen empfunden, wenn man dar<strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Leistungen<br />
entsprechend auf- o<strong>der</strong> absteigen kann.<br />
6. Das Ungleichheitsgefüge post<strong>in</strong>dustrieller Gesellschaften<br />
6.1 Die typische Schichtungsstruktur <strong>in</strong>dustrieller Gesellschaften<br />
Merkmale:<br />
• Industriegesellschaften: wichtigste Ursachen soz. Ungleichheit im wirschaftl. Bereich<br />
• Wichtigste Determ<strong>in</strong>ante d. Statuszuweisung: Beruf (für K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Hausfrauen: Familienzugehörigkeit)<br />
• Vertikale Struktur ungleicher Lebensbed<strong>in</strong>gungen „objektive“ Vor- u. Nachteile<br />
• Folgen: schichtspezifische …<br />
o Gesellschaftsbil<strong>der</strong>: - US: zweigeteilte Gesellschaft mit unübersteigbarer Barriere - MS: abgestufte<br />
+ durchlässige Gesellschaft<br />
o Arten <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung: - US: positions-, regel- u. anpassungsorientiert - MS:<br />
<strong>in</strong>dividuell, persönlichkeits- u. leistungsorientiert<br />
o Konsumgewohnheiten: - US: nach Nutzen und Preis - MS:<br />
nach Prestige - OS: nach Geschmack<br />
o Politische Interessen und Wahlentscheidungen: - US: sozialdemokr./wohlfahrtsstaatlich<br />
- MS: konservativ - OS: liberal<br />
46
6.2 „Neue“ soziale Ungleichheiten <strong>in</strong> post<strong>in</strong>dustriellen Gesellschaften<br />
Steigerung d. Wohlstands, Ausbau wohlfahrtsstaatlicher Leistungen, „Wertewandel“<br />
§ „Neue“ Ursachen: Wohlfahrtsstaat und soziokulturelle Faktoren (z.B. Vorurteile gegen Auslän<strong>der</strong>)<br />
§ „Neue“ Determ<strong>in</strong>anten (seit 1960ern): Mann – Frau, große – kle<strong>in</strong>e Familien, Westdeutschland – Ostdeutschland,<br />
Deutsche – Auslän<strong>der</strong> horizontale Ungleichheiten (weil teilweise „quer“ zu beruflichen/vertikalen)<br />
§ „Neue“ Dimensionen: Freizeit-, Arbeits-, Gesundheits-, Wohn-, Wohnumfeldbed<strong>in</strong>gungen, soziale Sicherheit, Ungleichbehandlung<br />
Abnehmende Dom<strong>in</strong>anz <strong>der</strong> vertikalen Schichtung<br />
Für Ungleichheitsgefüge d. post<strong>in</strong>dustriellen Ges. ist „Lebenslagen“ (jeweilige Konstellation vorteilhafter und nachteiliger<br />
Lebensbed<strong>in</strong>gungen; auch Nicht-Berufstätige können e<strong>in</strong>geordnet werden) besser als „soziale Schichten“<br />
Unteres Segment: Anhäufung von Nachteilen. Es droht Ausgrenzung versch. Problem- und Randgruppen (sie s<strong>in</strong>d<br />
jetzt „Unterschicht“, nicht mehr Arbeiter)<br />
M<strong>in</strong><strong>der</strong>heiten haben sich weiter von <strong>der</strong> Bevölkerungsmehrheit entfernt<br />
Soziale Lage bestimmt sich danach, welche Determ<strong>in</strong>ante die (un)vorteilhaften Lebensbed<strong>in</strong>gungen hauptsächlich<br />
bestimmt.<br />
6.3 „Neue“ Lebensweisen<br />
Menschliche Denk- und Verhaltensweisen können Folge, aber auch Bestimmungsgründe ungleicher Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
se<strong>in</strong> – milieuspezifische Strukturen des Denkens und Verhaltens.<br />
Milieu: „Gruppe Gleichges<strong>in</strong>nter“ – typischerweise zusammentreffende Werthaltungen, E<strong>in</strong>stellungen + Me<strong>in</strong>ungen<br />
Lebensstil: typische Regelmäßigkeiten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gestaltung des Alltags<br />
Pluralisierung von Milieus und Lebensstielen:<br />
• Verknüpfung zw. schichtspezifischen Lebensbed<strong>in</strong>gungen und milieu- bzw. lebensstilspezifischen Lebensweisen<br />
hat sich gelockert: Milieus und Lebensstile stellen meist <strong>in</strong>terne Differenzierungen sozialer Schichten dar<br />
• Vielfalt an Lebensweisen nimmt zu. Zugehörigkeit zu kle<strong>in</strong>en Gruppierungen hat oft ähnlich große Bedeutung<br />
wie Zugehörigkeit zu Großgruppen<br />
• Zugehörigkeit zu Lebensweisegruppierungen prägt sowohl gesellschaftl. Standortbestimmung als auch viele<br />
tägliche Verhaltensweisen (K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung, politische Beteiligung, Lebensplanung etc.). Was Menschen<br />
„s<strong>in</strong>d“ ist jetzt auch e<strong>in</strong>e Frage <strong>der</strong> Grunde<strong>in</strong>stellung und Lebensweise<br />
47