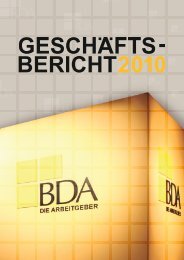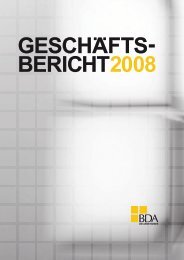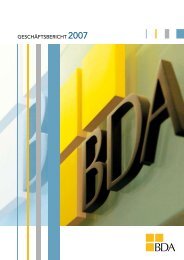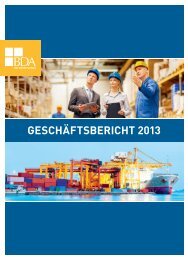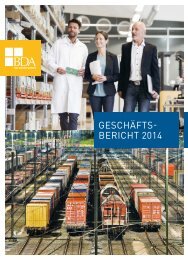Euro-Info Nr. 01/2015
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gemeinsamer Parlamentarischer Abend von BDA und DGB<br />
Arbeitgeberpräsident Kramer und DGB-Vorsitzender Hoffmann diskutierten über aktuelle<br />
Herausforderungen der Sozialpartner in <strong>Euro</strong>pa<br />
BDA und DGB empfingen am 28. Januar 2<strong>01</strong>5 zum ersten gemeinsamen<br />
Parlamentarischen Abend in Brüssel um die 200<br />
Gäste aus Politik und Wirtschaft. Höhepunkt der Veranstaltung<br />
war ein moderiertes Streitgespräch zum Thema „Perspektive<br />
<strong>Euro</strong>pa – Herausforderungen der Sozialpartner“ zwischen Arbeitgeberpräsident<br />
Ingo Kramer und DGB-Vorsitzendem Reiner<br />
Hoffmann.<br />
Zum Einstieg stand die aktuelle politische und wirtschaftliche<br />
Situation Griechenlands zur Debatte. Arbeitgeberpräsident<br />
Kramer bekräftigte, dass Griechenlands Platz im Zentrum der<br />
Wirtschafts- und Währungsunion sei. Bereits umgesetzte Reformen<br />
hätten zu ersten Erfolgen in Griechenland geführt. Neben<br />
dem erzielten Primärüberschuss zeige die griechische<br />
Wirtschaft zusätzlich erste Zeichen der Erholung. Auch wenn<br />
Herausforderungen insbesondere bei der Bekämpfung der hohen<br />
Arbeitslosigkeit bestünden, müsse am erfolgreich eingeschlagenen<br />
Reformweg festgehalten werden. Dies schließe die<br />
Einhaltung der Vereinbarungen mit den internationalen Geldgebern<br />
mit ein. Kramer zeigte sich zuversichtlich, dass Griechenland<br />
die noch anstehenden Reformen meistern werde.<br />
Auch der DGB-Vorsitzende Hoffmann sprach sich klar gegen<br />
einen Austritt Griechenlands aus der <strong>Euro</strong>zone aus. Allerdings<br />
gab er zu bedenken, dass das Wahlergebnis eine klare Ansage<br />
für <strong>Euro</strong>pa sei: Der politische Kurswechsel der EU, weg von<br />
einer Fokussierung auf Austeritätspolitik, hin zu Investitionen,<br />
müsse jetzt eingeleitet werden.<br />
Neben Griechenland wurde ebenfalls über die aktuelle wirtschaftspolitische<br />
Lage Frankreichs diskutiert. Laut Kramer zeige<br />
Frankreich deutlich seine Entschlossenheit den Reformkurs<br />
aufrechtzuerhalten und die notwendigen Strukturreformen<br />
durchzuführen. Für alle EU-Mitgliedstaaten gelte es, die Reformagenda<br />
fortzuführen, um gemeinsam den Weg aus der Krise<br />
zu meistern. Eine erfolgreiche Sozialpartnerschaft könne dabei<br />
eine entscheidende Rolle spielen: Nicht trotz Sozialpartnerschaft,<br />
sondern weil es die Sozialpartnerschaft gebe, habe man<br />
in Deutschland schwierige Zeiten besser überwinden können.<br />
Zu der Frage, ob das Modell der deutschen Sozialpartnerschaft<br />
auf die europäische Ebene übertragbar sei, sahen Kramer und<br />
Hoffmann eher die Möglichkeit einer potentiellen Übertragbarkeit<br />
der Grundprinzipien, nach denen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter<br />
gemeinsam nach Lösungen suchen. Die<br />
<strong>Nr</strong>. <strong>01</strong> | 30. Januar 2<strong>01</strong>5<br />
Parlamentarischer Abend von BDA und DGB<br />
Lettische EU-Ratspräsidentschaft: Für ein wettbewerbsfähiges,<br />
digitales und engagiertes <strong>Euro</strong>pa<br />
TTIP: Investitionsschutz und Schiedsverfahren modernisieren<br />
Deutsche G7-Präsidentschaft macht „Nachhaltige Lieferketten“<br />
zu Schwerpunktthema<br />
EU-Kommission plant Haushaltsregeln in Zukunft flexibler<br />
auszulegen<br />
EU-Kommission legt Rechtsgrundlage für <strong>Euro</strong>päischen<br />
Investitionsfonds vor<br />
Ergebnisse der öffentlichen Konsultation der EU-<br />
Kommission zu CSR wenig aussagekräftig<br />
Online-Konsultation der EU-Kommission zur Überarbeitung<br />
der Arbeitszeitrichtlinie gestartet<br />
Leitfaden zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft<br />
und Menschenrechte<br />
Impressum<br />
BDA | Bundesvereinigung der<br />
Deutschen Arbeitgeberverbände<br />
Mitglied von BUSINESSEUROPE<br />
Breite Straße 29 | 1<strong>01</strong>78 Berlin<br />
T +49 30 2033-1908<br />
F +49 30 2033-1905<br />
europa@arbeitgeber.de<br />
Verantwortlich: Renate Hornung-Draus<br />
Redaktion: Martin Kumstel<br />
Satz: Konstanze Wilgusch<br />
Offizielle Stellungnahmen der Bundesvereinigung der Deutschen<br />
Arbeitgeberverbände sind als solche gekennzeichnet<br />
BDA | euro-info <strong>Nr</strong>. <strong>01</strong> | 30. Januar 2<strong>01</strong>5
Zukunft der <strong>Euro</strong>päischen Sozialpartnerschaft in Richtung Reform-Partnerschaft<br />
sehe der Arbeitgeberpräsident darin, dass<br />
das der europäische Soziale Dialog zu konkreten Ergebnissen<br />
führen müsse, die für Unternehmen und Arbeitnehmer einen<br />
Mehrwert bringen.<br />
Des Weiteren wurde über die Bedeutung der transatlantischen<br />
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) diskutiert. Kramer<br />
wies in diesem Zusammenhang auf die einmalige Chance<br />
hin, gemeinsam Regeln für freien und fairen Handel zwischen<br />
den beiden mit Abstand größten Wirtschaftsräumen der Welt<br />
mit den höchsten Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards<br />
zu entwickeln. Die zum Teil ablehnende Grundhaltung, die zu<br />
TTIP entstanden ist, obwohl dessen vertragliche Grundlagen<br />
noch nicht einmal ausverhandelt worden seien, könne Kramer<br />
kaum nachvollziehen. TTIP biete die Chance für die gesamte<br />
globale Wirtschaft, Maßstäbe auf hohem Niveau zu setzen.<br />
Diese Möglichkeit dürfe nicht vergeben werden.<br />
Lettische EU-Ratspräsidentschaft<br />
Séverine Féraud / Martin Kumstel<br />
Für ein wettbewerbsfähiges, digitales und<br />
engagiertes <strong>Euro</strong>pa<br />
Am 1. Januar 2<strong>01</strong>5 hat Lettland zum ersten Mal seit dem EU-<br />
Beitritt des Landes im Jahr 2004 die EU-Ratspräsidentschaft<br />
übernommen. Zum Auftakt der neuen Präsidentschaft hat die<br />
Hauptgeschäftsführung der BDA, vertreten durch Herrn Peter<br />
Clever, am 26. Januar 2<strong>01</strong>5 in Riga Gespräche mit hochrangigen<br />
Entscheidungsträgern geführt und die Erwartungen der<br />
deutschen Arbeitgeber dargelegt. Auf dem Programm standen<br />
u. a. Gespräche mit dem lettischen Arbeitsminister Uldis Augulis<br />
sowie der für die Koordinierung der Ratspräsidentschaft zuständigen<br />
Staatssekretärin im Außenministerium Zanda Kalniņa-Lukaševica.<br />
Außerdem fand ein intensiver Austausch mit<br />
dem Präsidenten des lettischen Verbandes LDDK, Vitalijs Gavrilos,<br />
statt.<br />
Lettland will sich für ein wettbewerbsfähiges, digitales und außenpolitisch<br />
engagiertes <strong>Euro</strong>pa einsetzen. Entsprechend setzt<br />
die lettische Präsidentschaft in ihrem Arbeitsprogramm für die<br />
kommenden sechs Monate folgende drei Schwerpunkte:<br />
• eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen<br />
Volkswirtschaften als Grundlage für Wachstum und nachhaltigen<br />
Beschäftigungsaufbau;<br />
• ein gemeinsamer digitaler europäischer Binnenmarkt mit<br />
hohen Datenschutz- und Sicherheitsstandards;<br />
• eine aktivere Rolle der EU als außenpolitischer Akteur, vor<br />
allem durch Stärkung der <strong>Euro</strong>päischen Nachbarschaftspolitik.<br />
Bei den Gesprächen wurde deutlich, dass Lettland seine Präsidentschaft<br />
eng an den von EU-Kommissionspräsident Juncker<br />
vorgegebenen "Politischen Leitlinien" ausrichten möchte. Im<br />
Mittelpunkt steht dabei die erfolgreiche Umsetzung des Investitionsplans,<br />
den Juncker im November 2<strong>01</strong>4 vorgestellt hatte.<br />
Das entsprechende Legislativverfahren soll bis Juni abgeschlossen<br />
werden. Auch im Bereich Digitalisierung möchte die<br />
Präsidentschaft eng mit der EU-Kommission zusammenarbeiten,<br />
die im Mai eine umfassende Strategie für den digitalen<br />
Binnenmarkt vorlegen will. Zur Datenschutzgrundverordnung<br />
wird abgestrebt, dass der Rat bis spätestens Mitte des Jahres<br />
Verhandlungen mit dem <strong>Euro</strong>päischen Parlament aufnehmen<br />
kann.<br />
Vor dem Hintergrund seiner eigenen positiven Erfahrungen mit<br />
tiefgreifenden Strukturreformen in Folge der Krise möchte die<br />
lettische Präsidentschaft die Mitgliedstaaten dazu ermuntern,<br />
notwendige Reformen zur Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit<br />
weiter voranzutreiben. Hierzu stellt die Präsidentschaft<br />
fest, dass eine wettbewerbsfähige Wirtschaft die Voraussetzung<br />
für nachhaltigen Beschäftigungsaufbau und damit auch<br />
für die soziale Kohäsion in der EU ist. Aufgrund der eigenen<br />
Erfahrungen sei man sich bewusst, dass dies nur durch Strukturreformen<br />
und wachstumsfördernde Investitionen möglich ist.<br />
Jedoch müsse jeder Mitgliedstaat seinen eigenen Reformweg<br />
im Einklang mit den jeweiligen nationalen Besonderheiten gehen.<br />
Der EU komme die Aufgabe zu, die nationalen Reformanstrengungen<br />
wirksam zu unterstützen und zu koordinieren.<br />
Auf dem Gebiet der Beschäftigungspolitik möchte sich Lettland<br />
für eine bessere Arbeitsmarktbeteiligung von jugendlichen Arbeitslosen,<br />
Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderung<br />
einsetzen. Vorantreiben möchte Lettland auch die Verhandlungen<br />
über eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft<br />
(TTIP).<br />
Das Arbeitsprogramm der lettischen EU-Ratspräsidentschaft ist<br />
unter folgendem Link abrufbar:<br />
http://goo.gl/elglr1<br />
Max Conzemius<br />
Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft<br />
(TTIP)<br />
Investitionsschutz und Schiedsverfahren<br />
modernisieren<br />
Die seit Mitte 2<strong>01</strong>3 stattfindenden Verhandlungen zwischen den<br />
USA und der EU zu einer Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft<br />
(TTIP) verfolgen das Ziel, Handels- und<br />
Investitionsbarrieren im transatlantischen Markt abzubauen und<br />
so beide Wirtschaftsräume noch stärker miteinander zu verknüpfen.<br />
Gerade für die exportorientierte deutsche Wirtschaft<br />
ist der Schutz von Investitionen – also der Schutz vor direkter<br />
und indirekter Enteignung, vor Diskriminierung und unfairer Behandlung<br />
– unverzichtbar. Investitionsschutzverträge und Investor-Staat-Schiedsverfahren<br />
(ISDS) sind seit Jahrzehnten<br />
BDA | euro-info <strong>Nr</strong>. <strong>01</strong> | 30. Januar 2<strong>01</strong>5 2
ewährte Instrumente für deutsche Unternehmen, um ihre Investitionen<br />
im Ausland abzusichern.<br />
Die EU-Kommission hat – bemüht um Transparenz und Argumentationsaustausch<br />
– vom 27. März bis Mitte Juli 2<strong>01</strong>4 eine<br />
öffentliche Konsultation zum Investitionsschutz und Schiedsverfahren<br />
durchgeführt. Es wurden fast 150.000 Eingaben eingereicht,<br />
allerdings bestanden hiervon 97 % aus vorformulierten,<br />
wortgleichen Antworten. Individuelle Antworten kamen lediglich<br />
von gut 3.000 Personen und rd. 450 Organisationen. Auch hat<br />
nur ein kleiner Teil der Eingaben ausführlich und konstruktiv zu<br />
den zwölf Fragen der Konsultation Stellung bezogen. Die Ergebnisse<br />
der Konsultation stellte die EU-Kommission am 13.<br />
Januar 2<strong>01</strong>5 vor. Auf der Basis der ausführlichen Stellungnahmen<br />
sind vor allem vier Themenbereiche aus Sicht der EU-<br />
Kommission von besonderer Bedeutung, die näher untersucht<br />
werden sollen: Bei den Bereichen handelt es sich um (1) den<br />
Schutz der Regulierungsautonomie des Staates (right to regulate),<br />
(2) die Zusammensetzung, Arbeitsweise und Neutralität der<br />
Schiedsgerichte, (3) das Verhältnis nationaler Rechtssysteme<br />
zu Investor-Staat-Schiedsverfahren und (4) die Einführung eines<br />
Berufungsmechanismus bei Schiedsverfahren. Die<br />
EU-Kommission will die Ergebnisse der Konsultation dazu nutzen,<br />
sich mit Rat und EU-Parlament über die europäische Position<br />
in den TTIP-Verhandlungen zu Investitionsschutz und ISDS<br />
intensiv zu beraten und eine gemeinsame Vorgehensweise zu<br />
entwickeln.<br />
Das transatlantische Abkommen bietet die Chance, die offenkundigen<br />
Mängel bestehender Investor-Staat-Schiedsverfahren<br />
zu beseitigen. Die EU-Konsultation hat hierzu wichtige Beiträge<br />
geliefert. Nun kommt es darauf an, im Rahmen der Verhandlungen<br />
zum transatlantischen Abkommen ein modernisiertes<br />
Investitionsschutzkapitel zu etablieren. Ziel sollte sein, staatliche<br />
Souveränität und Regulierungshoheit effektiv zu schützen,<br />
die Effektivität der Streitbeilegung und Mechanismen zum<br />
Schutz vor ungerechtfertigten oder unseriösen Klagen von Investoren<br />
sowie die Transparenz der Schiedsgerichtsverfahren<br />
zu verbessern. Zudem sollte ein Berufungsmechanismus beim<br />
Schiedsgerichtsverfahren vorgesehen werden. Zu Recht weist<br />
EU-Handelskommissarin Malmström auf die Notwendigkeit<br />
moderner Bestimmungen hin, da ansonsten für EU-Staaten die<br />
veralteten Schutzklauseln in Kraft bleiben würden. Ein moderner<br />
Investitionsschutz mit den Vereinigten Staaten kann dagegen<br />
einen globalen Standard setzen und als Blaupause für<br />
künftige neue Investitionsschutzabkommen dienen.<br />
Global Governance<br />
Dr. Oliver Perschau<br />
Deutsche G7-Präsidentschaft macht „Nachhaltige<br />
Lieferketten“ zu Schwerpunktthema<br />
Deutschland hat im Juni 2<strong>01</strong>4 die Präsidentschaft der G7<br />
(Gruppe der Sieben) übernommen und richtet damit das nächste<br />
Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs aus. Der diesjährige<br />
G7-Gipfel findet am 7./8. Juni 2<strong>01</strong>5 in Schloss Elmau<br />
(Bayern) statt. Die G7 ist ein informeller Zusammenschluss der<br />
sieben weltwirtschaftlich bedeutendsten Industriestaaten<br />
(Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, USA, Vereinigtes<br />
Königreich). Neben den klassischen wirtschafts- und<br />
handelspolitischen Schwerpunkten hat die deutsche Präsidentschaft<br />
erstmals auch sozialpolitische Themen auf die Agenda<br />
gesetzt. Hierzu gehören vor allem die Themen "Standards in<br />
Handels- und Lieferketten" sowie "Stärkung von Frauen bei<br />
Selbständigkeit und beruflicher Bildung".<br />
Die Bundesregierung will im Rahmen der deutschen<br />
G7-Präsidentschaft einen umfassenden Dialog mit der Zivilgesellschaft<br />
führen. Im Rahmen dieses Outreach-Prozesses ist<br />
auch ein Austausch mit hochrangigen Vertretern der Wirtschafts-<br />
und Arbeitgeberverbände aus den G7-Staaten geplant.<br />
Die Wirtschaft wird ihre Empfehlungen an die Staats- und Regierungschefs<br />
im Rahmen des sogenannten B7 (Business 7)<br />
Prozesses erarbeiten. Die BDA wird sich aktiv an diesem Prozess<br />
beteiligen.<br />
Ebenfalls im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft richten<br />
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie das Bundesministerium<br />
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung<br />
am 10./11. März 2<strong>01</strong>5 in Berlin eine hochrangige Stakeholderkonferenz<br />
aus, die sich mit dem Thema "Gute Arbeit<br />
weltweit durch nachhaltige Lieferketten fördern" befassen wird.<br />
Die BDA wird die deutschen Arbeitgeber bei dieser Konferenz<br />
vertreten.<br />
Offizielle Internetseite der deutschen G7-Präsidentschaft:<br />
http://www.g7germany.de/<br />
Stabilitäts- und Wachstumspakt<br />
Max Conzemius<br />
EU-Kommission plant Haushaltsregeln in<br />
Zukunft flexibler auszulegen<br />
Am 13. Januar 2<strong>01</strong>5 hat die EU-Kommission eine Mitteilung zur<br />
besten Nutzung der Flexibilität in den vorhandenen Regeln des<br />
Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) veröffentlicht. Damit<br />
kommt die EU-Kommission der Aufforderung des <strong>Euro</strong>päischen<br />
Rats vom Juni 2<strong>01</strong>4 nach, Bericht über die Anwendung und<br />
Flexibilitätsspielräume des SWP zu erstatten.<br />
Die EU-Kommission kündigt in der Mitteilung an, den „positiven<br />
haushaltspolitischen Auswirkungen von Strukturreformen“ in<br />
Zukunft stärker Rechnung tragen zu wollen. Sowohl bei der Eröffnung<br />
eines Defizitverfahrens als auch bei einem bereits laufenden<br />
Verfahren kann eine längere Frist zur Defizitkorrektur<br />
vorgeschlagen werden. Um einen Aufschub zu erhalten, soll<br />
der entsprechende Mitgliedstaat einen Strukturreformplan vorlegen.<br />
Dieser muss einen glaubwürdigen Zeitplan zur konkreten<br />
BDA | euro-info <strong>Nr</strong>. <strong>01</strong> | 30. Januar 2<strong>01</strong>5 3
Annahme und Durchführung der Reformen beinhalten. Die Reformen<br />
müssen zudem breit angelegt sein, zur Steigerung des<br />
potenziellen Wachstums des Mitgliedstaats beitragen und langfristig<br />
positive Auswirkungen auf den Haushalt haben.<br />
Neben Strukturreformen sollen auch öffentliche Investitionen im<br />
Rahmen des SWP zukünftig begünstigt behandelt werden. Einzahlungen<br />
in den geplanten <strong>Euro</strong>päischen Fonds für Strategische<br />
Investitionen (EFSI) werden bei der Festlegung der haushaltspolitischen<br />
Anpassung eines Mitgliedstaats nicht mitgerechnet<br />
werden. Sollte ein Mitgliedstaat lediglich aufgrund seiner<br />
gezahlten Beträge in den EFSI ein Haushaltsdefizit von<br />
über 3 % aufweisen, kann von der Einleitung eines Defizitverfahrens<br />
abgesehen werden. Auch andere öffentliche Investitionsausgaben<br />
– unabhängig vom EFSI – sollen stärker berücksichtigt<br />
werden. Mitgliedstaaten, die nicht gegen die<br />
3 %-Defizitgrenze verstoßen, dürfen vorübergehend vom vereinbarten<br />
Konsolidierungskurs abweichen, wenn ihr Wirtschaftswachstum<br />
negativ ist oder weit hinter seinem Potenzial<br />
zurückbleibt.<br />
Die deutsche Wirtschaft begrüßt den Ansatz der neuen<br />
EU-Kommission, Investitionen, Wachstum und Jobs höchste<br />
Priorität einzuräumen. Die Ankündigung, nationale Beiträge<br />
zum EFSI bei der Bewertung der Haushaltslage eines Mitgliedstaats<br />
nicht zu berücksichtigen und unter bestimmten Voraussetzungen<br />
Pläne für Strukturreformen als ausreichend für Fristenverlängerungen<br />
zu bewerten, kommt jedoch einer Aufweichung<br />
der Stabilitätskriterien gleich. Die EU-Kommission sollte<br />
nun auf eine stärkere Verbindlichkeit bei den Reformzusagen<br />
der Mitgliedstaaten pochen, damit der SWP nicht weiter verwässert<br />
wird.<br />
<strong>Euro</strong>päisches Investitionspaket<br />
Martin Kumstel<br />
EU-Kommission legt Rechtsgrundlage für<br />
<strong>Euro</strong>päischen Investitionsfonds vor<br />
Die EU-Kommission hat am 13. Januar 2<strong>01</strong>5 die Details für das<br />
im vergangenen November angekündigte Investitionspaket in<br />
Höhe von 315 Mrd. € vorgestellt. Im Zentrum des Pakets steht<br />
die Errichtung eines <strong>Euro</strong>päischen Fonds für strategische Investitionen<br />
(EFSI), für den die EU-Kommission nun einen Verordnungsvorschlag<br />
vorgelegt hat. Der Vorschlag umfasst außerdem<br />
den Aufbau einer <strong>Euro</strong>päischen Plattform für Investitionsberatung<br />
(<strong>Euro</strong>pean Investment Advisory Hub - EIAH) sowie<br />
eines europäischen Investitionsprojektverzeichnisses. Damit<br />
soll die Ermittlung und Durchführung von Projekten erleichtert<br />
werden, das <strong>Info</strong>rmationsangebot für potentielle Investoren<br />
soll verbessert werden.<br />
Der Fonds wird innerhalb der <strong>Euro</strong>päischen Investitionsbank<br />
(EIB) errichtet und soll zur Förderung strategischer Investitionen,<br />
z. B. in Energie- und Breitbandnetze sowie von Unternehmen<br />
mit weniger als 3 000 Beschäftigten eingesetzt werden.<br />
Die EU stellt dafür 16 Mrd. € in Form von Garantien aus dem<br />
EU-Haushalt zur Verfügung, weitere 5 Mrd. € kommen von der<br />
EIB. Mit dem 21 Mrd. € schweren Fonds soll mittels Hebelwirkung<br />
15-mal so viel Privatkapital bis Ende 2<strong>01</strong>7 für Investitionen<br />
mobilisiert werden. Dafür soll der Fonds Bürgschaften<br />
übernehmen können, einen Teil des Verlustrisikos bei Investitionsprojekten<br />
absichern oder Kredite vergeben können. Die<br />
Mitgliedstaaten können sich ebenfalls am Fonds beteiligen,<br />
ebenso nationale Förderbanken und der private Sektor in und<br />
außerhalb der EU.<br />
Um die Beteiligung der Mitgliedstaaten am Fonds zu fördern,<br />
werden nationale Beiträge bei der Bewertung der Haushaltskonsolidierung<br />
im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts<br />
(SWP) nicht gezählt. Dies hat die EU-Kommission in ihrer<br />
Mitteilung zu den Anwendungen der SWP-Regelungen zeitgleich<br />
präzisiert. Zudem bekommen Staaten, die einen Beitrag<br />
zum EFSI geleistet haben, ein stärkeres Mitspracherecht bei<br />
der Verteilung der Mittel. Solange noch kein Mitgliedstaat zum<br />
Fonds beiträgt, entscheidet ein Lenkungsrat aus<br />
EU-Kommission und EIB-Repräsentanten über die Mittelverwendung<br />
sowie über die allgemeine Ausrichtung und das Risikoprofil<br />
des Fonds. Die Prüfung der einzelnen Projekte übernimmt<br />
ein Investitionsausschuss aus sechs unabhängigen<br />
Wirtschaftsfachleuten und einem von der EU-Kommission und<br />
der EIB ernannten geschäftsführenden Direktor.<br />
Der Vorschlag der EU-Kommission muss vom Rat und vom <strong>Euro</strong>päischen<br />
Parlament angenommen werden. Eine Einigung soll<br />
bis Juni 2<strong>01</strong>5 erzielt werden, damit die ersten Investitionsprojekte<br />
bereits Mitte 2<strong>01</strong>5 gestartet werden können.<br />
Mit ihrem Investitionspaket legt die Kommission wichtige Weichen<br />
für die Stärkung der Investitionstätigkeit in der EU insgesamt,<br />
setzt dabei jedoch zu Recht den Schwerpunkt auf die<br />
Mobilisierung privater Investitionen. Die BDA begrüßt das ambitionierte<br />
zeitliche Vorgehen der EU-Kommission ebenso wie ihr<br />
Bestreben, für maximale Transparenz mithilfe eines Verzeichnisses<br />
für Investitionsprojekte zu sorgen.<br />
Problematisch ist dagegen die Entscheidung der<br />
EU-Kommission, nationale Beiträge der Mitgliedstaaten zum<br />
EFSI im Rahmen des SWP wohlwollend zu berücksichtigen.<br />
Der dadurch kurzfristig gewonnene Freiraum steht dem nachhaltig<br />
wirkenden Risiko einer Aufweichung des Stabilitäts- und<br />
Wachstumspakts entgegen. Wichtiger ist eine Stärkung der<br />
Rahmenbedingungen für private Investitionen auf nationaler<br />
und europäischer Ebene sowie die haushaltsneutrale Stärkung<br />
der öffentlichen Investitionen in den Mitgliedstaaten. Ebenfalls<br />
kritisch ist die vorgesehene Anpassung der Stimmverteilung im<br />
Lenkungsrat entsprechend der Beiträge zum Fonds. Dies birgt<br />
das Risiko einer politisierten Entscheidungsfindung über die<br />
Mittelvergabe nach dem Motto "I want my money back".<br />
Elisaveta Gomann<br />
BDA | euro-info <strong>Nr</strong>. <strong>01</strong> | 30. Januar 2<strong>01</strong>5 4
Corporate Social Responsibility (CSR)<br />
Ergebnisse der öffentlichen Konsultation<br />
der EU-Kommission zu CSR wenig aussagekräftig<br />
Die EU-Kommission hat die Ergebnisse ihrer öffentlichen Konsultation<br />
zur CSR-Strategie 2<strong>01</strong>1-2<strong>01</strong>4 veröffentlicht. Insgesamt<br />
hat sie 525 ausgefüllte Online-Fragebögen sowie 45 eigenständige<br />
Stellungnahmen erhalten. Dabei kamen weniger<br />
als die Hälfte der Antworten aus der Wirtschaft (44 %). 56 %<br />
der Antworten stammen von Nichtregierungsorganisationen,<br />
EU-Bürgern sowie internationalen und nationalen Organisationen.<br />
Auch die BDA hatte sich im Rahmen einer gemeinsamen<br />
Stellungnahme der vier Spitzenverbände BDA/BDI/DIHK/ZDH<br />
an der Konsultation beteiligt.<br />
Die acht Arbeitsfelder der CSR-Strategie 2<strong>01</strong>1-2<strong>01</strong>4 wurden<br />
hinsichtlich der Merkmale "Wichtigkeit" und "Erfolg" wie folgt<br />
bewertet:<br />
1. CSR ins Blickfeld rücken und<br />
bewährte Verfahren verbreiten<br />
(<strong>Euro</strong>pean CSR-Awards, EU-<br />
Stakeholder-Plattformen)<br />
2. Das den Unternehmen entgegengebrachte<br />
Vertrauen verbessern<br />
und dokumentieren<br />
3. Selbst- und Koregulierungsprozesse<br />
verbessern<br />
4. Stärkere Marktanreize für CSR<br />
schaffen<br />
a. Verbrauch<br />
b. Öffentliches Auftragswesen<br />
c. Investitionen<br />
5. Die Offenlegung von sozialen<br />
und umweltbezogenen <strong>Info</strong>rmationen<br />
durch die Unternehmen verbessern<br />
6. CSR stärker in Ausbildung,<br />
Weiterbildung und Forschung integrieren<br />
7. Die Bedeutung von CSR-<br />
Strategien auf nationaler und subnationaler<br />
Ebene hervorheben<br />
8. <strong>Euro</strong>päische und globale CSR-<br />
Konzepte besser aufeinander abstimmen<br />
a. Schwerpunkt auf international<br />
anerkannte CSR-Grundsätze und<br />
–Leitlinien<br />
b. Umsetzung der Leitprinzipien<br />
der Vereinten Nationen für Unternehmen<br />
und Menschenrechte<br />
c. Bedeutung von CSR für die Beziehungen<br />
mit anderen Ländern<br />
und Regionen der Welt<br />
Wichtigkeit<br />
in %<br />
Erfolg<br />
in %<br />
77 63<br />
77 35<br />
71 39<br />
77<br />
83<br />
84<br />
33<br />
47<br />
34<br />
76 70<br />
83 38<br />
77 53<br />
85<br />
81<br />
79<br />
54<br />
55<br />
40<br />
Bei den "Schwachstellen oder fehlender Maßnahmen" in der<br />
CSR-Strategie gaben 49 % der Antwortenden an, dass es diese<br />
gegeben hat. 17 % sahen keine Schwachstellen, 31 % der<br />
Antwortenden gaben "ich weiß nicht" an. Als Defizite wurden<br />
der fehlende Fokus auf KMUs, die Entwicklung von nationalen<br />
Aktionsplänen zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft<br />
und Menschenrechte und die Befassung mit internationalen<br />
Lieferketten benannt. Zur Gesamtwirkung der CSR-<br />
Strategie gaben 68 % an, dass diese nützlich gewesen sei.<br />
25 % gaben an, dass die CSR-Strategie nicht nützlich war (7 %<br />
neutral). Hinsichtlich der Frage der zukünftigen Rolle der<br />
EU-Kommission gaben 83 % an, dass die EU-Kommission<br />
künftig im Rahmen einer CSR-Strategie aktiv tätig werden sollte.<br />
Die EU-Kommission leitet aus diesen Ergebnissen eine generelle<br />
Zustimmung zu ihren durchgeführten Maßnahmen in Höhe<br />
von 71 % - 86 % ab. Sie schlussfolgert, dass CSR von erheblichem<br />
Interesse für die Stakeholder sei und sie die Aufforderung<br />
erhalten habe, zukünftig in diesem Bereich tätig zu werden. Die<br />
Stakeholder hätten drei zukünftige Arbeitsschwerpunkte für die<br />
EU-Kommission identifiziert:<br />
• Verbesserung der Transparenz (Berichterstattung, nachhaltiges<br />
und verantwortungsbewusstes Investieren etc.)<br />
• Arbeiten zu internationalen Fragen (multilaterale Arbeit,<br />
Drittstaaten-Diplomatie, globales "level playing field")<br />
• Bewusstseinsschaffung für CSR<br />
Die BDA bewertet die von der EU-Kommission dargestellten<br />
Ergebnisse zur öffentlichen Konsultation als wenig aussagekräftig.<br />
Sie gehen im Kern an der CSR-Debatte vorbei. Bereits<br />
die im Rahmen der öffentlichen Konsultation gestellten Fragen<br />
waren teilweise unklar und unpräzise, weshalb es durch das<br />
Ausfüllen des Fragenkatalogs allein nicht möglich war, die eigenen<br />
Positionen und Vorstellungen von CSR deutlich zu machen.<br />
Die EU-Kommission erkennt dies ausdrücklich an und<br />
stellt klar, dass durch den Online-Fragebogen die wesentlichen<br />
Prinzipien der CSR-Politik der EU-Kommission, wie beispielsweise<br />
die CSR-Definition, nicht erfasst wurden. Die zusätzlich<br />
abgegebenen 45 Stellungnahmen zeigen, dass bei vielen Stakeholdern<br />
die Notwendigkeit gesehen wurde, eine eigene Darstellung<br />
ihres CSR-Verständnisses deutlich zu machen, was<br />
über den Online-Fragebogen nicht möglich war. Des Weiteren<br />
wurden bei der Auswertung unzulässige Schlussfolgerungen<br />
gezogen. So wurde aus der überwiegenden Bejahung der<br />
"Wichtigkeit" einer Maßnahme eine generelle Zustimmung zu<br />
dieser abgeleitet, was nicht schlüssig ist.<br />
Die EU-Kommission wird am 3./4. Februar 2<strong>01</strong>5 in Brüssel ein<br />
"<strong>Euro</strong>pean Multi-Stakeholder Forum on CSR" durchführen, um<br />
die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation vorzustellen. Dabei<br />
will sie den Stakeholdern die Möglichkeit geben, Eingaben<br />
zur neuen CSR-Strategie 2<strong>01</strong>5-2020 der EU-Kommission zu<br />
machen und diese zu diskutieren.<br />
Paul Noll<br />
BDA | euro-info <strong>Nr</strong>. <strong>01</strong> | 30. Januar 2<strong>01</strong>5 5
EU-Arbeitszeitrichtlinie<br />
Online-Konsultation der EU-Kommission zur<br />
Überarbeitung der Richtlinie gestartet<br />
Die EU-Kommission hat am 1. Dezember 2<strong>01</strong>4 eine bis<br />
15. März 2<strong>01</strong>5 laufende öffentliche Online-Konsultation zur<br />
Überarbeitung der Arbeitszeitrichtlinie eingeleitet. Die Beiträge<br />
zur Online-Konsultation sollen in die laufende Überprüfung und<br />
Folgenabschätzung zur Zukunft der Arbeitszeitrichtlinie einfließen.<br />
Die BDA wird sich an der Konsultation beteiligen und wie<br />
bereits in den Ende 2<strong>01</strong>2 gescheiterten Sozialpartnerverhandlungen<br />
eine partielle Richtlinienüberarbeitung anmahnen, v. a.<br />
mit Blick auf die notwendige Korrektur der EuGH-<br />
Rechtsprechung zum Bereitschaftsdienst/Arbeitsbereitschaft<br />
bzw. Urlaub. Insgesamt bedarf es zudem einer größeren Flexibilität<br />
bei der Arbeitszeitgestaltung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.<br />
Damit die Arbeitgebervorstellungen angemessen Gehör<br />
finden, hat die BDA für eine hohe Beteiligung bei ihren Mitgliedern<br />
geworben.<br />
nicht über diese hinausgehen dürfen. In einem Annex zum Leitfaden<br />
werden umfangreiche Empfehlungen zur Umsetzung der<br />
UN-Leitprinzipien abgegeben, welche die Regierungen berücksichtigen<br />
sollen.<br />
Positiv zu bewerten sind die Aufforderungen, dass die Staaten<br />
die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beachten<br />
sowie die Unternehmen durch konkrete <strong>Info</strong>rmationen zu Menschenrechten<br />
und Leitfäden unterstützen sollen. Auch wird im<br />
Leitfaden richtigerweise festgestellt, dass es keinen "one-sizefits-all"-Ansatz<br />
geben kann und dass der Prozess zur Entwicklung<br />
von NAPs und deren Inhalt nicht vorgeschrieben werden<br />
darf. Viele Empfehlungen sind jedoch viel zu detailliert und<br />
weitgehend und gehen damit über die UN-Leitprinzipien hinaus,<br />
wie z. B. die Vorschläge zur weitergehenden<br />
CSR-Berichterstattungspflichten oder Haftungsfragen.<br />
Paul Noll<br />
Der Online-Fragebogen und weitere <strong>Info</strong>rmationen zur Konsultation<br />
sind unter http://goo.gl/lNaVOa abrufbar.<br />
Christina Breit<br />
Wirtschaft und Menschenrechte<br />
Leitfaden zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien<br />
für Wirtschaft und Menschenrechte<br />
Die “UN Working Group on Business and Human Rights” hat<br />
den Leitfaden "Guidance on National Action Plans on Business<br />
and Human Rights, Version 1.0" veröffentlicht. Die BDA hatte<br />
sich an der öffentlichen Konsultation zur Erstellung dieses Leitfadens<br />
intensiv beteiligt. In dem UN-Leitfaden wird zunächst<br />
klargestellt, dass es sich um Empfehlungen der UN Working<br />
Group zur Erstellung, Implementierung und Aktualisierung von<br />
Nationalen Aktionsplänen zu Wirtschaft und Menschenrechten<br />
(NAP) handelt. Auch wird betont, dass es keinen "one-size-fitsall"-Ansatz<br />
geben kann und die jeweiligen Besonderheiten und<br />
Herausforderungen in den Staaten berücksichtigt werden müssen.<br />
Weder werde der Prozess zur Erstellung eines NAP noch<br />
deren Inhalt konkret vorgeschrieben. Nichtregierungsorganisationen<br />
sollten jedoch ihre Regierungen auffordern, den NAP in<br />
Übereinstimmung mit dem Leitfaden zu erstellen. Der Leitfaden<br />
sei als "living document" zu verstehen, der in regelmäßigen Abständen<br />
aktualisiert werde.<br />
In dem Leitfaden werden Nationale Aktionspläne definiert als<br />
"an evolving policy strategy developed by a State to protect<br />
against adverse human rights impacts by business enterprises<br />
in conformity with the UN Guiding Principles on Business and<br />
Human Rights." Damit wird klargestellt, dass es Aufgabe des<br />
Staates ist, einen NAP zu erstellen und dass Maßnahmen in<br />
Übereinstimmung mit den UN-Leitprinzipien sein sollen, also<br />
BDA | euro-info <strong>Nr</strong>. <strong>01</strong> | 30. Januar 2<strong>01</strong>5 6