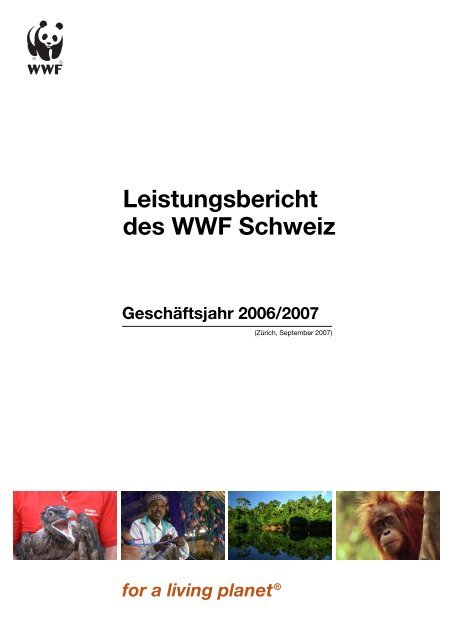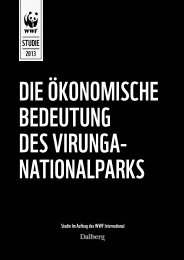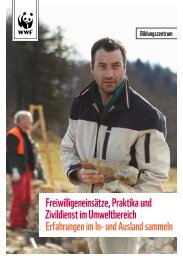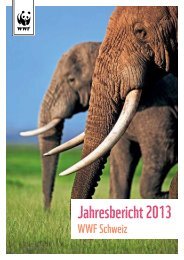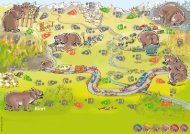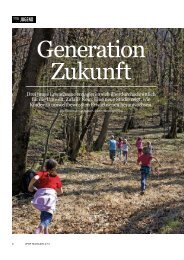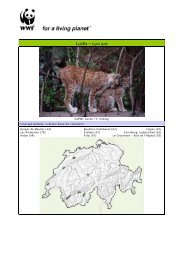Leistungsbericht des WWF Schweiz
Leistungsbericht des WWF Schweiz
Leistungsbericht des WWF Schweiz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Leistungsbericht</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Geschäftsjahr 2006/2007<br />
for a living planet ®<br />
(Zürich, September 2007)<br />
®
Inhalt<br />
Vorwort 3<br />
Teil I – Einleitung<br />
Der <strong>WWF</strong> 4<br />
Die Arbeitsweise <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> 5<br />
Themen und Regionen 5<br />
Der <strong>Leistungsbericht</strong> <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> 6<br />
Leistungsmessung beim <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> 6<br />
Die Elemente <strong>des</strong> <strong>Leistungsbericht</strong>s 6<br />
Teil II – Programm<br />
Unsere Themen 8<br />
Wald 8<br />
Wasser 9<br />
Klima 10<br />
Wo wir arbeiten 12<br />
Fokusregionen Europa und Mittlerer Osten 12<br />
Fokusregionen in Südamerika 13<br />
Fokusregionen in Afrika 14<br />
Fokusregionen in Asien 15<br />
Wie wir arbeiten 18<br />
Konsum & Wirtschaft 18<br />
Jugend & Bildung 19<br />
Politik 20<br />
Regionalprogramm 22<br />
Teil III<br />
Umweltschutz in der Organisation <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> 23<br />
Fotos © Seite 1: <strong>WWF</strong>-CH/A. Matthias, <strong>WWF</strong>-Canon/J. Rubens, <strong>WWF</strong>/Z. Koch, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Terrettaz; Seite 7: <strong>WWF</strong>/Z. Koch, <strong>WWF</strong>/Z. Koch, <strong>WWF</strong>-Canon/A. Della Bella,<br />
<strong>WWF</strong>/Z. Koch, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Dépraz, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Terrettaz, <strong>WWF</strong>-Canon/N. Racheter, <strong>WWF</strong>-Canon/J. Rubens, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Gunther, <strong>WWF</strong>-CH/A. Matthias,<br />
<strong>WWF</strong>-Canon/A. Compost, <strong>WWF</strong>-Canon/J. Rubens, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Dépraz, B. Stirton/Getty Images/<strong>WWF</strong>-UK, <strong>WWF</strong>-Canon/J. Rubens, <strong>WWF</strong>-Canon/J. Rubens, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Dépraz,<br />
<strong>WWF</strong>/Z. Koch; Seite 11: <strong>WWF</strong>/M. Würtenberg, Riverwatch/P. Müller, <strong>WWF</strong>-Canon/H. Jungius; Seite 13: <strong>WWF</strong>-Canon/M. Gunther; Seite 14: <strong>WWF</strong>-Canon/M. Gawler, <strong>WWF</strong>-Canon/E. Parker;<br />
Seite 15: <strong>WWF</strong>-Canon/E. Kemf, <strong>WWF</strong> Indonesia; Seite 16: <strong>WWF</strong>-CH/A. Matthias, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Gunther; Seite 17: <strong>WWF</strong>-Canon/M. Gawler, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Terrettaz;<br />
Seite 21: <strong>WWF</strong>-Canon/H. Petit, <strong>WWF</strong>-CH/A. Billeter, D. Adair/ex-press; Seite 22: <strong>WWF</strong>-CH/K. Eichenberger.<br />
2
Vorwort<br />
Sehr geehrte Damen und Herren<br />
Liebe Freundinnen und Freunde <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />
Die Sorge um den Klimawandel beschäftigt mittlerweile<br />
eine breite Öffentlichkeit. Das zeigte sich nicht zuletzt im<br />
Vorfeld der Nationalrats- und Ständeratswahlen. Selten<br />
ist ein Umweltthema in den letzten Jahren auch auf dem<br />
politischen Parkett so intensiv diskutiert worden.<br />
Das ist zweifellos auch ein Verdienst <strong>des</strong> <strong>WWF</strong>. Wir haben<br />
im Bereich Klima sehr viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit<br />
geleistet, sei dies auf dem politischen Parkett, wo<br />
wir für eine Reduktion <strong>des</strong> CO2-Ausstosses und die Förderung<br />
erneuerbarer Energien kämpfen, oder sei dies im Konsumbereich,<br />
wo wir Aktionen zur Reduktion der Standby-<br />
Verluste machen und uns für den Verkauf energiesparender<br />
Geräte einsetzen. Aber auch im «klassischen» Umweltschutz<br />
dürfen wir auf schöne Erfolge zurückblicken – etwa im<br />
Atlantikwald in Südamerika, wo wir ein weiteres Schrumpfen<br />
dieses für die Artenvielfalt enorm wichtigen Gebietes<br />
verhindern konnten. Was wir wo erreicht haben – darüber<br />
möchten wir Sie mit diesem <strong>Leistungsbericht</strong> informieren.<br />
Der <strong>WWF</strong> ist in der <strong>Schweiz</strong> sehr gut verankert. Stärke<br />
nährt sich aus Glaubwürdigkeit, Fachkompetenz und Erfahrung.<br />
Unser Wissen erneuern wir ständig, dazu kommt die<br />
Erfahrung aus über 40 Jahren Engagement für die Umwelt.<br />
Und Glaubwürdigkeit erreichen wir mit einer offenen Kommunikation<br />
sowie der permanenten kritischen Beurteilung<br />
unserer Arbeit.<br />
Wir werden alles daran setzen, auch in Zukunft überall dort<br />
tätig zu sein, wo der <strong>WWF</strong> am dringendsten gebraucht wird.<br />
Sei es in der Politik, in Konsum und Wirtschaft, in der Bildung<br />
oder in Feldprojekten. Und wir werden auch weiterhin<br />
dafür sorgen, dass bei all unserem Tun ein Ziel im Zentrum<br />
steht: Möglichst viel Umweltwirkung pro gespendeten Franken<br />
zu erreichen.<br />
Mit freundlichen Grüssen<br />
Hans-Peter Fricker<br />
Geschäftsleiter <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
3
Der <strong>WWF</strong><br />
Die Mission <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />
Der <strong>WWF</strong> will der weltweiten Naturzerstörung Einhalt gebieten<br />
und eine Zukunft gestalten, in der die Menschen im Einklang<br />
mit der Natur leben.<br />
Der <strong>WWF</strong> setzt sich weltweit ein für:<br />
• die Erhaltung der biologischen Vielfalt.<br />
• die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen.<br />
• die Eindämmung von Umweltverschmutzung<br />
und schädlichem Konsumverhalten.<br />
Der <strong>WWF</strong> weltweit<br />
Der <strong>WWF</strong> ist eine in der <strong>Schweiz</strong> registrierte Stiftung. Sie<br />
wird von einem Stiftungsrat unter einem internationalen Präsidenten<br />
geleitet. 1961 gegründet, ist der <strong>WWF</strong> in über 100<br />
Ländern aktiv, unterstützt rund 2000 Umweltprojekte und<br />
beschäftigt beinahe 4000 Menschen. Das Sekretariat <strong>des</strong><br />
weltweiten <strong>WWF</strong>-Netzwerkes, <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> International, befindet<br />
sich in Gland VD. Von dort aus werden die <strong>WWF</strong>-Länderorganisationen<br />
und Projektbüros unterstützt.<br />
Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Die Länderorganisation <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ist eine Stiftung mit<br />
Hauptsitz in Zürich und zwei Zweigstellen in Genf und Bellinzona<br />
sowie dem Bildungszentrum in Bern. 23 kantonale Sektionen,<br />
als eigenständige Vereine organisiert, unterstützen<br />
den <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> in seiner Tätigkeit. 218000 Mitglieder,<br />
weitere 93000 Förderer und über 1000 Freiwillige ermöglichen<br />
die Arbeit von insgesamt 179 Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeitern.<br />
Organe <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Dem <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> steht ein Stiftungsrat mit insgesamt neun<br />
Stiftungsräten vor. Die Mitglieder <strong>des</strong> Stiftungsrats werden<br />
für eine Amtsperiode von drei Jahren gewählt. Die Anzahl<br />
Amtsperioden ist auf drei pro Mitglied limitiert. Die Geschäftsleitung<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> besteht aus sechs Personen.<br />
Zusammen mit den Leitenden der Zweigstellen und <strong>des</strong><br />
Bildungszentrums bildet sie die erweiterte Geschäftsleitung.<br />
Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ist Lizenznehmer <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> International<br />
und vergibt wiederum an 23 <strong>WWF</strong>-Sektionen eine Lizenz.<br />
CEO<br />
Assistenz Medien<br />
Hans-Peter Fricker<br />
Barbara Gröbli<br />
Fredi Lüthin<br />
Zweigstelle Zweigstelle<br />
Bellinzona Vernier<br />
Rudy Bächtold<br />
Christiane Maillefer<br />
Stiftungsrat<br />
Robert Schenker<br />
Departement Departement<br />
Departement<br />
Departement<br />
Programm<br />
Regionalarbeit<br />
Marketing<br />
Finanzen & Dienste<br />
Thomas Vellacott<br />
Catherine Martinson<br />
Gian-Reto Raselli<br />
Markus Schwingruber<br />
Erweiterte Direktion <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong>.<br />
Ein detailliertes Organigramm <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> finden Sie unter<br />
www.wwf.ch/de/derwwf/ueberwwf/organisation/.<br />
Finanzen<br />
Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ist in einem hohen Masse privat finanziert.<br />
97,1% seiner Gelder stammen von privaten Geldgebern,<br />
Stiftungen und Unternehmen aus der Privatwirtschaft. Im<br />
Geschäftsjahr 2006 erzielte der <strong>WWF</strong> einen Leistungsertrag<br />
von 40,7 Mio CHF, dazu kommen noch 1,2 Mio CHF aus<br />
Kapitalerträgen.<br />
Warenertrag<br />
6182 15,2%<br />
Beiträge der<br />
öffentlichen Hand<br />
1181 2,9%<br />
Sponsoring- &<br />
Lizenzerträge<br />
2986 7,3%<br />
Legate & Erbschaften<br />
2020 5,0%<br />
Spenden,<br />
Grossgönner & Stiftungen<br />
3514 8,6%<br />
Demgegenüber stehen Ausgaben von 38,4 Mio CHF,<br />
der Ertragsüberschuss wird für Projekte im GJ 07/08<br />
verwendet.<br />
Administration 4255 11,1% Wald 3631 9,5%<br />
Kommunikation &<br />
Marketing<br />
(Fundraising)<br />
9453 24,6%<br />
Dienstleistungen<br />
1158 2,8%<br />
Leistungserträge im Geschäftsjahr 2006/07 (in tausend Franken).<br />
Warenhandel<br />
6326 16,5%<br />
Ausgaben im Geschäftsjahr 2006/07 (in tausend Franken).<br />
Eine detaillierte Jahresrechnung ist im Internet unter<br />
www.wwf.ch/jahresbericht/ verfügbar.<br />
Bildungszentrum<br />
Bern<br />
Ueli Bernhard<br />
Sonstige Erträge<br />
60 0,1%<br />
4<br />
Mitgliederbeiträge<br />
15201 37,3%<br />
Spenden auf Aussendungen<br />
8474 20,8%<br />
Wasser 1745 4,5%<br />
Klima 525 1,4%<br />
Alpen 935 2,4%<br />
Konsum & Wirtschaft<br />
905 2,4%<br />
Jugend & Umwelt<br />
2235 5,8%<br />
Bildungszentrum<br />
900 2,3%<br />
Projektinformation<br />
1582 4,1%<br />
Regionalarbeit<br />
2750 7,2%<br />
<strong>WWF</strong> International<br />
3118 8,2%
Die Arbeitsweise <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Themen und Regionen<br />
Unsere Arbeitsweise<br />
Der Erhalt der Artenvielfalt ist für die Umsetzung der Mission<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> von zentraler Bedeutung. Um dies zu erreichen,<br />
arbeitet der <strong>WWF</strong> auf verschiedenen strategischen Ebenen:<br />
• Arten können nicht erhalten werden, ohne dass ihre<br />
Lebensräume langfristig gesichert sind.<br />
• Lebensräume können nur dann langfristig gesichert<br />
werden, wenn die Bedrohungen und der Druck auf die<br />
Lebensräume reduziert werden.<br />
• Globale Bedrohungen lassen sich nur mit Hilfe von<br />
starken Partnern in Politik, Wirtschaft, Bildung und<br />
Medien angehen.<br />
Von diesen Ebenen leiten sich direkt die Wirkungsfelder <strong>des</strong><br />
<strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ab:<br />
Strategische Ebenen und die thematischen Schwerpunkte, die sich<br />
daraus ableiten.<br />
* Projekte im Kontext der betreffenden Lebensräume.<br />
** Inhaltliche Mitgestaltung und finanzielle Unterstützung.<br />
Die Lebensräume Wald, Süss- und Meerwasser beherbergen<br />
zusammen weltweit die grösste Vielfalt an Organismen. Deshalb<br />
konzentriert sich die Arbeit <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> auf diese<br />
Biome.<br />
Mittlerweile herrscht in der Wissenschaft ein breiter Konsens,<br />
dass der Klimawandel und seine Folgen heute die grösste<br />
Gefährdung für die globale Biodiversität darstellen. Der<br />
<strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> teilt diese Ansicht und engagiert sich <strong>des</strong>halb<br />
stark in der Klima- und Energiethematik.<br />
Umweltprobleme lassen sich nur lösen, wenn es dem <strong>WWF</strong><br />
gelingt, auf unterschiedlichen Handlungsebenen Erfolge zu<br />
erzielen. Die Politik setzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen,<br />
in denen Umweltschutz erfolgen kann. Durch den<br />
Mechanismus von Angebot und Nachfrage steuern Konsumentinnen<br />
und Konsumenten sowie die Wirtschaft den Verbrauch<br />
von umweltfreundlichen Produkten und damit den<br />
Umgang mit beschränkten Ressourcen. Und erst mit Jugendund<br />
Bildungsarbeit wird das notwendige Wissen um Umweltprobleme<br />
und die Akzeptanz für Lösungen auch in der<br />
Zukunft geschaffen.<br />
Unsere Fokusregionen<br />
Das weltweite <strong>WWF</strong>-Netzwerk ist mit seinen Länder- und Programmorganisationen<br />
in über 100 Ländern tätig. Innerhalb<br />
dieses weltweiten Engagements konzentriert sich der <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> mit seinen thematischen Schwerpunkten auf zehn<br />
sorgfältig ausgewählte Fokusregionen, welche ein besonders<br />
grosses Potential für – oder einen grossen Bedarf an – Umweltschutz<br />
aufweisen und zu denen der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> eine<br />
langjährige Beziehung pflegt.<br />
Die zehn Fokusregionen <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong>.<br />
Eine besondere Rolle nimmt dabei die Alpenregion ein, für<br />
die der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> durch seine geografische Lage eine<br />
besondere Verantwortung hat.<br />
5
Der <strong>Leistungsbericht</strong> <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Leistungsmessung beim <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Im Juli 2004 hat der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> seine Strategie für die<br />
nächsten fünf Jahre festgelegt und in einem internen Dokument<br />
festgehalten. Darin wurden für alle Bereiche <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> verbindliche Langfristziele festgehalten sowie Massnahmen<br />
und Handlungsebenen zur Zielerreichung aufgeführt.<br />
Aus dieser längerfristigen Planung leiten sich die jährlichen<br />
Inhalte und Zielvorgaben für die einzelnen Projekte <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> ab. Per Ende Geschäftsjahr 2006/07 wird die Strategie<br />
2004 durch eine überarbeitete Version abgelöst, welche<br />
dem <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> mehr operative Freiheit und Flexibilität<br />
verschafft, ohne auf eine verbindliche Zielsetzung zu verzichten.<br />
Vor jedem Geschäftsjahr werden für die vom <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
durchgeführten Projekte messbare Ziele, Indikatoren und<br />
Verantwortlichkeiten festgehalten. Am Ende <strong>des</strong> Geschäftsjahres<br />
wird der Zielerreichungsgrad anhand der Indikatoren<br />
überprüft, festgehalten und daraus der Fortschritt gegenüber<br />
den Langfristzielen ermittelt.<br />
Ergeben sich Abweichungen von den Zielvorgaben, so werden<br />
die Gründe analysiert und festgehalten, damit Korrekturmassnahmen,<br />
aber auch Ansätze, die sich bewährt haben,<br />
in die nächste Jahresplanung einfliessen können.<br />
Die Elemente <strong>des</strong> <strong>Leistungsbericht</strong>s<br />
Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ist in über 100 Projekten aktiv. Sie lassen<br />
sich in Handlungsfelder gruppieren, auf die im Folgenden<br />
einzeln eingegangen wird. Alle Kurzportraits setzen sich aus<br />
den gleichen sechs Elementen zusammen.<br />
• Ausgangslage: Skizziert die gegenwärtige Situation und<br />
legt dar, warum sich der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> respektive das<br />
<strong>WWF</strong>-Netzwerk mit dem betreffenden Thema befasst.<br />
• Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Hier werden die wichtigsten<br />
Massnahmen und Vorgehensweisen aufgeführt, mit denen<br />
der <strong>WWF</strong> auf die erwähnte Ausgangslage reagiert.<br />
• Ziele bis ins Jahr 2009: Listet Ziele für die Handlungsfelder<br />
aus der Strategie <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> oder aus Projektvereinbarungen<br />
mit anderen <strong>WWF</strong>-Organisationen auf.<br />
Bei internationalen Projekten, die vom <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> mitfinanziert,<br />
aber von anderen <strong>WWF</strong>-Länder- oder Projektorganisationen<br />
umgesetzt werden, vereinbart der <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> Ziele und Indikatoren mit den ausführenden Organisationen.<br />
Den Fortschritt dieser Projekte beurteilt der <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> anhand von halbjährlichen Berichten, in denen die<br />
Empfänger dazu verpflichtet sind, über den Stand gegenüber<br />
den Projektzielen und die Verwendung der Gelder Auskunft<br />
zu geben, sowie anhand von Projektbesuchen durch Mitarbeitende<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong>. Fallen die Berichte unbefriedigend<br />
aus, arbeitet der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> mit den betroffenen<br />
Länderorganisationen einen Massnahmenplan aus, um die<br />
Proble-me zu beheben. Falls sich die Situation nicht verbessert,<br />
behält sich der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> die Möglichkeit vor, die<br />
Finanzierung einzustellen.<br />
Bei den nationalen Projekten erreicht der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> eine<br />
hohe Genauigkeit der Leistungsmessung. Auf internationaler<br />
Ebene finanziert der <strong>WWF</strong> zunehmend ganze Programme anstatt<br />
einzelne Projekte. Dadurch wird der individuelle Beitrag<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> im internationalen Bereich schwieriger erfassbar.<br />
• Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07: Zeigt einerseits<br />
den Soll-Verlauf gegenüber den Langfristzielen (blaue Kurve)<br />
und andererseits die effektive Entwicklung auf, wie sie<br />
anhand der erwähnten Indikatoren gemessen wurde (rote<br />
Kurve).<br />
• Wichtigste Indikatoren: Führt die wichtigsten Messgrössen<br />
auf, nach denen der bisherige Fortschritt beurteilt<br />
wurde.<br />
• Erfolge im Jahr 2006/07 und Herausforderungen im<br />
Jahr 2007/08: Greifen einzelne Beispiele von Erfolgen im<br />
vergangenen Geschäftsjahr sowie einige Herausforderungen<br />
für das laufende Jahr heraus.<br />
6
Unsere Themen<br />
Wald<br />
Zerstörung von Tropenwäldern stoppen<br />
Ausgangslage: Unser Bedarf an Fetten, Ölen<br />
und Futtermitteln steigt laufend. Der Grossteil<br />
der Rohstoffe für diese Güter wird in Plantagen<br />
in tropischen und subtropischen Regionen<br />
in Lateinamerika und Südostasien<br />
produziert. Jährlich fallen der Expansion von<br />
Palmöl- und Sojaproduktion Tausende von<br />
Hektaren Tropenwald zum Opfer. In den<br />
nächsten Jahrzehnten wird die Anbaufläche<br />
für diese Produkte weiterhin stark zunehmen.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> will die Produktion der wichtigen<br />
Rohstoffe Palmöl und Soja in nachhaltige<br />
Bahnen lenken. Dazu will er:<br />
• zusammen mit Produzenten, Händlern<br />
und Grossverteilern Kriterien für den nachhaltigen<br />
Anbau von Palmöl und Soja erarbeiten<br />
und umsetzen.<br />
• Produzenten, Händler, Verkäufer und<br />
KonsumentInnen für das Thema sensibilisieren<br />
und die Nachfrage nach nachhaltig<br />
produziertem Palmöl und Soja steigern.<br />
• besonders erhaltenswerte Wälder identifizieren<br />
und deren Umwandlung in Plantagen<br />
verhindern.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• 10% der weltweit gehandelten Palmölund<br />
Sojamengen werden nachhaltig<br />
Ausgangslage: Wälder liefern eine Vielzahl<br />
von Rohstoffen, allen voran Holz. Der <strong>WWF</strong><br />
setzt sich für eine nachhaltige Nutzung der<br />
Wälder ein, die dem Raubbau entgegentritt<br />
und die Funktion <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> als lokale Einkommensquelle,<br />
Erholungsraum und Biosphäre<br />
bewahrt.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Holz, das unter<br />
dem Label <strong>des</strong> Forest Stewardship Council<br />
(FSC) produziert und verkauft wird, erfüllt die<br />
Kriterien <strong>des</strong> <strong>WWF</strong>. Deshalb fördert er die Bekanntheit<br />
und die Nachfrage nach FSC-Holz.<br />
Dazu will er:<br />
• eine Plattform (<strong>WWF</strong> Wood Group) für<br />
ökologisch verantwortungsbewusste<br />
Unternehmen unterhalten, die ihr Sortiment<br />
an Holzprodukten schrittweise auf<br />
FSC-zertifizierte Quellen umstellen.<br />
• die Verwendung von FSC-Holz in der<br />
Bau- und Möbelindustrie und im Heimwerkerbereich<br />
fördern.<br />
• den Anteil von FSC-zertifiziertem Wald<br />
in der <strong>Schweiz</strong> erhöhen.<br />
• den ökologischen Standard in der schweizerischen<br />
Waldgesetzgebung bewahren.<br />
produziert. Die 40 grössten Produzenten<br />
unterstützen die <strong>WWF</strong>-Kriterien.<br />
• Zwei Drittel <strong>des</strong> Palmöls in Produkten,<br />
die in der <strong>Schweiz</strong> verkauft werden,<br />
wurden nach Kriterien produziert, die<br />
der <strong>WWF</strong> unterstützt.<br />
• In min<strong>des</strong>tens drei Fokusregionen <strong>des</strong><br />
<strong>WWF</strong> findet keine Umwandlung von<br />
besonders erhaltenswerten Wäldern in<br />
Palmöl- oder Sojakulturen mehr statt.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Anzahl Partner beim Erarbeiten der Nachhaltigkeitskriterien,<br />
Anteil von nachhaltig produziertem<br />
Palmöl im <strong>Schweiz</strong>er Markt, Anzahl<br />
durchgeführter Pilotstudien zum nachhaltigen<br />
Anbau.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Der Umsatz von FSC-Produkten in<br />
der <strong>WWF</strong> Wood Group steigt auf<br />
200 Mio CHF.<br />
• Der Marktanteil von FSC-Holz in der<br />
<strong>Schweiz</strong> beträgt 25% in der Baubranche<br />
und 20% bei Holzmöbeln.<br />
• Die FSC-zertifizierte Waldfläche in der<br />
<strong>Schweiz</strong> erhöht sich auf 50%.<br />
• Revisionen der nationalen und kantonalen<br />
Gesetzgebungen bewirken keine<br />
Verschlechterung der Öko-Standards.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Umsatz der <strong>WWF</strong> Wood Group, Marktanteile<br />
FSC-Holz, Anteil FSC-zertifizierte Waldfläche<br />
in der <strong>Schweiz</strong>, öffentliche Bauten mit FSC-<br />
Holz.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Der vom <strong>WWF</strong> mitbegründete Round<br />
Table on Responsible Soy (RTRS) bringt<br />
Sojaproduzenten, Verbraucher und<br />
Umweltorganisationen an einen Tisch. In<br />
weniger als 6 Monaten seit der Gründung<br />
ist es gelungen, 20% <strong>des</strong> globalen Sojahandels<br />
in die Diskussion um nachhaltiges<br />
Soja einzubinden.<br />
�Die Regierung Paraguays hat sich dazu<br />
entschieden, ein Moratorium der Waldumwandlung<br />
um weitere zwei Jahre zu<br />
verlängern. Durch das Moratorium ist die<br />
Entwaldungsrate in Paraguay um 85%<br />
gesunken!<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Der Round Table on Responsible Soy<br />
muss sich nun auf global anwendbare<br />
Kriterien für nachhaltig produziertes<br />
Soja einigen, um sie möglichst bald als<br />
Marktstandard einzuführen.<br />
�Der Anteil an nachhaltigem Palmöl in<br />
der <strong>Schweiz</strong> soll weiter steigen. Dafür<br />
arbeitet der <strong>WWF</strong> eng mit Importeuren<br />
und Retailern zusammen.<br />
Wälder nachhaltig bewirtschaften Erfolge im Jahre 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
8<br />
�Die <strong>WWF</strong> Wood Group konnte ihren<br />
Umsatz auf 179 Mio CHF steigern und so<br />
den Marktanteil von Holz aus umwelt- und<br />
sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern<br />
signifikant steigern.<br />
�Die stetige Bewusstseinsarbeit <strong>des</strong><br />
<strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> zahlt sich aus. Der Bekanntheitsgrad<br />
der Marke FSC konnte gegenüber<br />
dem Vorjahr nochmals gesteigert<br />
werden. 57% der <strong>Schweiz</strong>erinnen und<br />
<strong>Schweiz</strong>er kennen das Qualitätslabel und<br />
achten beim Holzkauf darauf.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Obwohl sich der Umsatz mit FSC-Produkten<br />
in den letzten Jahren sehr erfreulich<br />
entwickelt hat, gibt es vor allem im<br />
Papierbereich noch Potential. Der <strong>WWF</strong><br />
bearbeitet diesen Sektor gezielt, um den<br />
Anteil von FSC-Holz im Neufaserpapier<br />
weiter zu steigern.<br />
�2005 reichte der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> eine<br />
Petition mit 53000 Unterschriften mit der<br />
Forderung nach einer Deklarationspflicht<br />
für Tropenholz ein. Dieser hat der Nationalrat<br />
jetzt zugestimmt. Nach diesem<br />
grossen Erfolg für den <strong>WWF</strong> geht es jetzt<br />
darum, dafür zu sorgen, dass der entsprechende<br />
Gesetzestext auch eine effektive<br />
Deklaration erzwingt.
Wasser<br />
Wasserverbrauch der Landwirtschaft reduzieren<br />
Ausgangslage: Die Welt steuert auf eine globale<br />
Wasserkrise zu. Das starke Bevölkerungswachstum<br />
und eine damit einhergehende<br />
Intensivierung der Landwirtschaft lassen<br />
den Wasserbedarf in den kommenden Jahrzehnten<br />
weiter ansteigen. Die begrenzten<br />
Süsswasservorräte werden weiterhin übernutzt<br />
und verschmutzt. Seit 1970 wurde<br />
dadurch bereits ein Drittel der aquatischen<br />
Arten ausgerottet.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Den grössten<br />
Anteil am globalen Wasserverbrauch trägt die<br />
Landwirtschaft (rund 69%). Die Kultivierung<br />
von besonders durstigen Pflanzen wie Baumwolle,<br />
die häufig mit ineffizienten Methoden<br />
bewässert werden, spielen dabei eine zentrale<br />
Rolle. Der <strong>WWF</strong> will daher:<br />
• Modellprojekte zum umweltgerechten<br />
und wasserschonenden Baumwollanbau<br />
durchführen und damit die Vorteile von<br />
ökologischen Anbaumethoden aufzeigen.<br />
• Zusammen mit Partnern aus Produktion<br />
und Handel Kriterien für umweltgerecht<br />
produzierte Baumwolle definieren<br />
und umsetzen.<br />
• Anbieter von Baumwollprodukten dazu<br />
bewegen, nur noch umweltgerecht produzierte<br />
Baumwolle zu beziehen.<br />
Fliessgewässer revitalisieren<br />
Ausgangslage: In der <strong>Schweiz</strong> haben Fliessgewässer<br />
ihre natürliche Funktion als artenreiche<br />
Lebensräume durch Verbauung,<br />
Eindolung und Wasserkraftnutzung weitgehend<br />
eingebüsst. In keinem anderen Lebensraum<br />
ist die Artenvielfalt in den letzten Jahrzehnten<br />
so stark zurückgegangen. Neben der<br />
Zerstörung von wertvollem Lebensraum verhindert<br />
die weitgehende Verbauung von<br />
Fliessgewässern einen natürlichen Hochwasserschutz.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong> setzt<br />
sich aktiv dafür ein, dass Fliessgewässer wieder<br />
in grösserem Umfang renaturiert werden<br />
und dass Wasserkraft umweltverträglich genutzt<br />
wird. Dazu will der <strong>WWF</strong>:<br />
• naturnahe Bach- und Flussabschnitte<br />
erhalten.<br />
• die Revitalisierung von Fliessgewässern<br />
initiieren und vorantreiben.<br />
• die bestehende Gewässerschutzgesetzgebung<br />
erhalten und neue Ansätze für<br />
nachhaltige Wasserkraftnutzung in nationalen<br />
und kantonalen Gesetzgebungen<br />
verankern.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Der <strong>WWF</strong> hat in drei der wichtigsten<br />
Anbaugebiete von Baumwolle eine<br />
Modellstudie zum umweltverträglichen<br />
Anbau durchgeführt.<br />
• Zehn der global wichtigsten Anbieter<br />
von Baumwollprodukten haben sich<br />
dazu verpflichtet, auf umweltgerechte<br />
Baumwolle umzusteigen.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Anzahl und Stand der Modellprojekte, Anzahl<br />
Partner im Prozess zur Entwicklung von Kriterien<br />
für umweltgerechte Baumwolle, Anzahl<br />
globale Anbieter mit ausschliesslich umweltgerecht<br />
produzierten Baumwollprodukten.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• 300 km Fliessgewässer werden revitalisiert<br />
oder die Gelder dafür sind bereitgestellt<br />
worden. Die <strong>Schweiz</strong>er Restwasservorschriften<br />
werden nicht abgeschwächt.<br />
• Beschluss von substanziellen ökologischen<br />
Verbesserungen in drei <strong>Schweiz</strong>er<br />
Gewässerbau-Grossprojekten.<br />
• Bun<strong>des</strong>gesetz mit neuen Ansätzen für<br />
nachhaltiges Gewässermanagement<br />
(Schwall-Sunk, Finanzierung von Revitalisierungen,<br />
Geschiebebetrieb).<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Anzahl Kilometer revitalisierte Flussläufe, Zustand<br />
Gewässerschutzgesetzgebung, ökologische<br />
Ziele in Wasserbauprojekten an Rhone,<br />
Alpenrhein und Linth.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Aufgrund der erfolgversprechenden<br />
Resultate der Programme für einen nachhaltigeren<br />
und wassersparenden Baumwollanbau<br />
in Pakistan wird der gleiche<br />
Ansatz nun auch in Indien, einem der<br />
weltweit grössten Baumwollanbaustaaten,<br />
angewendet.<br />
�Die vom <strong>WWF</strong> initiierte Better Cotton<br />
Initiative ist weltweit auf grosses Interesse<br />
gestossen und wird von verschiedenen<br />
global bedeutenden Firmen und staatlichen<br />
Entwicklungsorganisationen unterstützt.<br />
Die von der Better Cotton Initiative entwickelten<br />
Prinzipien für den Anbau von<br />
nachhaltiger Baumwolle werden nun in<br />
den wichtigsten Anbaugebieten auf vier<br />
Kontinenten getestet.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Die Better Cotton Initiative konkurrenziert<br />
weder Bio- noch Fairtrade-Baumwolle,<br />
sondern ergänzt diese Angebote<br />
sinnvoll, indem sie auf den Massenmarkt<br />
abzielt. Dieses Verständnis muss den<br />
KonsumentInnen sowie den am Baumwollmarkt<br />
beteiligten Firmen und Organisationen<br />
nachvollziehbar kommuniziert<br />
werden.<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Zwei Revitalisierungsprojekte konnten<br />
aufgrund der Initiative von <strong>WWF</strong>-Riverwatchern<br />
angestossen werden, min<strong>des</strong>tens<br />
15 weitere werden folgen.<br />
�Revitalisierungs-Fonds als Möglichkeit<br />
zur Sicherstellung der Finanzierung von<br />
Revitalisierungsvorhaben konnten in fünf<br />
Kantonen in die politische Diskussion eingebracht<br />
werden. Auch in der Volksinitiative<br />
«Lebendiges Wasser» ist ein solches<br />
Instrument auf eidgenössischer Ebene<br />
vorgesehen.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Die Klimadiskussion verstärkt den<br />
Druck zur möglichst vollständigen Nutzung<br />
der Wasserkraft. Konkret werden die<br />
geltenden Vorschriften für die minimalen<br />
Restwassermengen in Frage gestellt und<br />
ein weiterer Ausbau der Wasserkraft<br />
gefordert. Der <strong>WWF</strong> ist gefordert, Wege<br />
aufzuzeigen, wie die Klimaziele erreicht<br />
werden können, ohne die Gewässer weiter<br />
zu schädigen.<br />
�Die von den Speicherkraftwerken verursachte<br />
Schwall/Sunk-Problematik mindert<br />
den ökologischen Nutzen von Revitalisierungen.<br />
Die Schwall/Sunk-Effekte müssen<br />
<strong>des</strong>halb reduziert werden.<br />
9
Klima<br />
CO2-Ausstoss reduzieren<br />
Ausgangslage: Der Klimawandel und seine<br />
Folgen stellen heute die grösste Gefährdung<br />
für die Biodiversität dar. Soll die globale Durchschnittstemperatur<br />
um nicht mehr als 2 Grad<br />
gegenüber vorindustriellen Zeiten steigen, so<br />
müssen die Industrieländer ihren CO2-Austoss<br />
in den nächsten 50 Jahren um rund 90%<br />
reduzieren. Im <strong>Schweiz</strong>er CO2-Gesetz sind<br />
10% bis 2010 vorgesehen.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Mit freiwilligen<br />
Sparmassnahmen alleine werden die CO2-<br />
Reduktionsziele weit verfehlt. Es braucht<br />
eine wirksame Lenkungsabgabe auf Brennund<br />
Treibstoffen sowie gesetzliche Regelungen<br />
zur Energieeffizienz und zur Förderung<br />
von erneuerbaren Energien. Der <strong>WWF</strong><br />
will daher:<br />
• eine konsequente Umsetzung <strong>des</strong><br />
CO2-Gesetzes erwirken.<br />
• den Bund zur Formulierung eines Langzeitzieles<br />
für 2050 zur Emissionsreduktion<br />
bewegen.<br />
• sich für Gesetze zur Förderung von<br />
nachhaltiger Energie und zur Steigerung<br />
der Energieeffizienz einsetzen.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Das CO2-Gesetz ist umgesetzt und seine<br />
Zielvorgaben werden eingehalten. 60%<br />
Ausgangslage: Ein effektiver Klimaschutz<br />
muss über das gesetzliche Minimum hinausgehen.<br />
Energieproduzenten, Grosskonsumenten<br />
und öffentliche Körperschaften brauchen<br />
zusätzlich marktwirtschaftliche Anreize<br />
für erneuerbare Energie und energieeffiziente<br />
Geräte, damit sie auf freiwilliger Basis<br />
einen Beitrag zu einer nachhaltigen Klimaund<br />
Energiepolitik leisten können.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> verfügt über ein grosses Know-how<br />
bezüglich Lancierung und Aufbau von marktwirtschaftlichen<br />
Plattformen sowie in den Bereichen<br />
erneuerbare Energien und Energieeffizienz.<br />
Der <strong>WWF</strong> fördert Energieeffizienz und<br />
erneuerbare Energien, indem er:<br />
• die Nachfrage nach ökologisch produziertem<br />
Strom gemäss den Kriterien<br />
<strong>des</strong> Labels naturemade star fördert.<br />
• eine Plattform mit Grossverteilern<br />
und Grosskonsumenten aufbaut, die<br />
sich gemeinsam mit dem <strong>WWF</strong> für die<br />
Förderung effizienter Geräte einsetzen.<br />
• Instrumente zur Steigerung der Energieeffizienz<br />
in Gebäuden einführt.<br />
der CO2-Reduktion erfolgt innerhalb der<br />
<strong>Schweiz</strong>.<br />
• In min<strong>des</strong>tens zwei Kantonen sind Gesetze<br />
eingeführt, welche die erneuerbaren<br />
Energien fördern und die Energieeffizienz<br />
steigern.<br />
• Auf nationaler Ebene ist ein Gesetz für<br />
den Strommarkt in Kraft, welches klare<br />
Ziele für Energieeffizienz und erneuerbare<br />
Energie beinhaltet.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Stand der CO2-Reduktion, Anteil der Reduktion,<br />
der innerhalb der <strong>Schweiz</strong> erzielt wird,<br />
Stand Gesetzgebung mit Zielen zur Förderung<br />
der Energieeffizienz und zu den erneuerbaren<br />
Energien.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Erneuerbare Energien fördern und Verbrauch reduzieren<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Der Energieverbrauch in der <strong>Schweiz</strong> ist<br />
gegenüber 03/04 um 5% reduziert.<br />
• Der Marktanteil von naturemade star-<br />
Strom beträgt min<strong>des</strong>tens 10%.<br />
• Der Anteil der erneuerbaren Energien<br />
am Endverbrauch ist gegenüber 2003/04<br />
verdoppelt.<br />
• Min<strong>des</strong>tens 20 Unternehmen beteiligen<br />
sich an der Plattform für effiziente Geräte.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Energieverbrauch in der <strong>Schweiz</strong>, Anteil erneuerbare<br />
Energie, Marktanteil naturemade<br />
star-Strom, Anzahl beteiligte Unternehmen an<br />
der Plattform.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
10<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Dank intensivem Lobbying seitens <strong>des</strong><br />
<strong>WWF</strong> und anderer Organisationen hat das<br />
Parlament eine CO2-Lenkungsabgabe auf<br />
Brennstoffe verabschiedet. Diese tritt per<br />
1.1.2008 in Kraft.<br />
�Die vom <strong>WWF</strong> mitinitiierte Allianz für<br />
eine verantwortungsvolle Klimapolitik<br />
(53 Organisationen) hat mit dem Klima-<br />
Masterplan aufgezeigt, wie die <strong>Schweiz</strong><br />
bis 2020 und 2050 handeln muss.<br />
�Die vom <strong>WWF</strong> koordinierte Volksinitiative<br />
für ein gesun<strong>des</strong> Klima wurde mit<br />
einer breiter Trägerschaft lanciert. Diese<br />
verlangt, die Treibhausgasemissionen von<br />
1990 bis 2020 um 30% zu reduzieren.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�In diesem Jahr werden massgebliche<br />
Entscheide zum Klimaziel 2020 der<br />
<strong>Schweiz</strong> getroffen. Hier hat der <strong>WWF</strong><br />
durch zahlreiche Lobbying-Aktivitäten,<br />
aber auch durch die Klima-Initiative gute<br />
Chancen, einen Unterschied zu machen.<br />
�Erfüllung CO2-Gesetz und Kyoto-<br />
Verpflichtung sind in weite Ferne gerückt.<br />
Es müssen dringend zusätzliche Massnahmen<br />
wie die CO2-Abgabe auf Treibstoffe<br />
ergriffen werden. Der <strong>WWF</strong> sorgt<br />
dafür, dass der Druck hoch bleibt, bringt<br />
Vorschläge ein und sucht Verbündete.<br />
Erfolge im Jahre 2006/07:<br />
�Das Stromversorgungsgesetz und<br />
insbesondere die Einspeisevergütung für<br />
Strom aus erneuerbaren Energien werden<br />
vom Parlament verabschiedet und treten<br />
per 1.10.2008 in Kraft. Der <strong>WWF</strong> hat<br />
massgeblich dazu beigetragen.<br />
�Der Absatz von naturemade star-Strom<br />
nahm 2006 um stolze 56% zu, und das<br />
Interesse an einer naturemade-Ausweitung<br />
auf Gas und Wärme zeigt den Erfolg dieser<br />
Marke, die der <strong>WWF</strong> mitaufgebaut hat.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Eine breite Effizienzpolitik muss dringend<br />
losgetreten werden. Die Aktionspläne<br />
für Energieeffizienz bieten hier eine<br />
günstige Gelegenheit. Der <strong>WWF</strong> ist an<br />
vorderster Stelle mit dabei.<br />
�Wärme aus erneuerbarer Energie statt<br />
Öl! Der <strong>WWF</strong> will, dass der neue Aktionsplan<br />
für erneuerbare Energien und die<br />
Revision der kantonalen Gesetze im Gebäudebereich<br />
den Kurs auch in der Wärmeerzeugung<br />
auf «erneuerbar» stellen.<br />
�Der Druck, AKWs zu bauen, wächst auf<br />
Grund der aggressiven Kampagnenarbeit<br />
der Stromwirtschaft. Der <strong>WWF</strong> setzt auf<br />
Stromeffizienz statt Grosskraftwerke.
Wald FSC-Holz in den <strong>Schweiz</strong>er Baumärkten – eine Erfolgsgeschichte für die <strong>WWF</strong> Wood Group. Heute stammt ein Grossteil<br />
<strong>des</strong> Holzes in diesem Sektor aus umwelt- und sozialverträglicher Waldbewirtschaftung.<br />
Wasser Hier kommt kein Fisch mehr durch, und die Restwasserstrecke liegt völlig trocken. Der <strong>WWF</strong> setzt sich für eine nachhaltige<br />
Wasserkraftnutzung mit ausreichend Restwasser und Fischwanderhilfen ein.<br />
Klima Der <strong>WWF</strong> setzt auf erneuerbare Energie und Stromeffizienz anstelle von neuen Grosskraftwerken.<br />
11
Wo wir arbeiten<br />
Fokusregionen Europa und Mittlerer Osten<br />
Alpen<br />
Ausgangslage: Das grösste und höchste Gebirge<br />
im Herzen Europas weist die höchste<br />
Artenvielfalt auf dem ganzen Kontinent auf.<br />
Diese Vielfalt kann nur erhalten bleiben, wenn<br />
die ökologisch wertvollsten Gebiete der Alpen<br />
unter Schutz gestellt werden. Intensiv-Landwirtschaft,<br />
Freizeit- und Transitverkehr, touristische<br />
Infrastrukturbauten sowie die Beeinträchtigung<br />
der Gewässer bedrohen deren<br />
fragile Lebensräume. Die bestehenden gesetzlichen<br />
Regelungen zur Nutzung <strong>des</strong> Alpenraumes<br />
bieten keinen vollständigen Schutz, und<br />
teilweise verläuft ihre Umsetzung zögerlich.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Schützenswerte<br />
Habitate von europäischer Bedeutung werden<br />
in den Netzwerken Natura 2000 (EU) und<br />
Smaragd zusammengefasst. Der <strong>WWF</strong> ermittelt<br />
geeignete Gebiete und unterbreitet<br />
dem Bund Vorschläge. Zusätzlich identifiziert<br />
der <strong>WWF</strong> die schutzwürdigsten Gebiete der<br />
Alpen (priority conservation areas). Der <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> setzt sich für eine biologische, gentechfreie<br />
Landwirtschaft, naturverträgliche<br />
Freizeitaktivitäten, nachhaltige Nutzung der<br />
Wasserkraft und für Verbesserung und Einhaltung<br />
der Rechtsgrundlagen ein. Konkret<br />
bedeutet das:<br />
• endemische Tier- und Pflanzenarten <strong>des</strong><br />
Alpenraumes erfassen und lokalisieren.<br />
• den Schutz ihrer Habitate durch Eingliederung<br />
ins Natura-2000-/Smaragd-Netzwerk<br />
sicherstellen.<br />
• Biodiversitätsziele sowie Managementund<br />
Aktionspläne für die priority conservation<br />
areas der Alpen erstellen und ihre<br />
Umsetzung kontrollieren.<br />
• das ökologische Niveau der Landwirtschaft<br />
erhöhen und die <strong>Schweiz</strong>er Landwirtschaft<br />
gentechfrei halten.<br />
• mit Modellprojekten Alternativen in Tourismus<br />
und Verkehr aufzeigen und Wild-<br />
Ausgangslage: Am Übergang zwischen Europa<br />
und Asien gelegen, umspannt die Kaukasus-Region<br />
eine Vielzahl von Klimata,<br />
Höhenstufen und Landschaften. Sie bietet<br />
Heimat für viele endemische Tierarten, zum<br />
Beispiel die stark bedrohten kaukasischen<br />
Leoparden, Rothirsche und Bezoar-Ziegen.<br />
Die Hälfte <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> ist bereits durch<br />
menschliche Aktivitäten wie Holzfällen, Überweidung,<br />
Wildern, Überfischung und Verbauung<br />
stark beeinträchtigt.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> unterstützt den <strong>WWF</strong> Kaukasus<br />
finanziell und ermöglicht die Errichtung von<br />
grenzübergreifenden Schutzparks und die<br />
Durchführung von Projekten zum Schutz von<br />
Leopard, Rothirsch, Bezoar-Ziege und Stör.<br />
wuchs in diesen Bereichen mit rechtlichen<br />
Mitteln bekämpfen.<br />
• politische Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit<br />
für die Verbesserung der Gesetzgebungen<br />
in Landwirtschaft, Naturschutz<br />
und Raumplanung.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• In der <strong>Schweiz</strong> sind min<strong>des</strong>tens 90 Smaragdgebiete<br />
bezeichnet, und für zwei Drittel<br />
davon existiert ein verbindlicher Managementplan.<br />
• Für min<strong>des</strong>tens 16 der 23 priority conservation<br />
areas liegt ein Plan zum Erhalt der<br />
Biodiversität vor, und 12 davon werden<br />
bereits umgesetzt.<br />
• 30% der Landwirtschaftsflächen im<br />
Alpenraum werden gemäss low input<br />
systems (zum Beispiel Biolandbau)<br />
bewirtschaftet. Es werden keine gentechnisch<br />
veränderten Organismen zu kommerziellen<br />
Zwecken freigesetzt.<br />
• Alle Skigebietserweiterungen oder Erschliessungen<br />
mit schwerer Beeinträchtigung<br />
der Natur sind gestoppt.<br />
• Die Alpenkonvention und ihre Protokolle<br />
sind in allen Alpenstaaten ratifiziert. Ziele<br />
zum Erhalt der Biodiversität halten in der<br />
EU-Landwirtschaftspolitik und in kantonalen<br />
Richtplänen Einzug.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Die Lebensgrundlagen <strong>des</strong> Leoparden<br />
in Turkmenistan sind gesichert, und die<br />
Population nimmt auf min<strong>des</strong>tens 120<br />
Tiere zu (1996: 80 bis 90 Tiere). Auch in<br />
Armenien und Aserbaidschan soll das<br />
Überleben der Grosskatze langfristig<br />
gesichert werden.<br />
• Die Bezoar-Ziege wird dank Aussetzungen<br />
in Georgien wieder heimisch.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Populationsgrössen, Fläche und Status der<br />
Schutzparks. Akzeptanz für den Leopard in<br />
der Bevölkerung.<br />
12<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Anzahl bezeichnete Smaragdgebiete, vorhandene<br />
Managementpläne, Anteil low input-<br />
Landwirtschaftsflächen, abgewendete Skigebietserweiterungen,<br />
Zustand Alpenkonventions-Ratifizierung.<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Die langjährige Aufbauarbeit <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />
zeigt Früchte. Nach 29 Jahren Investition<br />
brüten die Bartgeier in der <strong>Schweiz</strong> erstmals<br />
wieder in Freiheit. Nun besteht auch<br />
wieder eine alpenweite, stabile Population.<br />
�Der <strong>WWF</strong> hat massgeblich dazu beigetragen,<br />
dass der hohe Schutz <strong>des</strong> Wolfes<br />
aufrechterhalten werden konnte, trotz<br />
eines <strong>Schweiz</strong>er Antrags auf Abwertung<br />
<strong>des</strong> Schutzstatus in Strassburg.<br />
�Der Bund hat auf Intervention <strong>des</strong><br />
<strong>WWF</strong> und seiner Partner weitere Smaragdgebiete<br />
im Alpenraum bezeichnet.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Bis heute fehlt der <strong>Schweiz</strong> eine verbindliche<br />
Biodiversitätsstrategie. Diese<br />
Lücke soll nun endlich geschlossen<br />
werden. Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> lobbyiert für<br />
eine rasche Umsetzung.<br />
�Die Smaragdgebiete müssen wieder<br />
eine höhere Priorität auf der politischen<br />
Agenda <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> einnehmen, damit<br />
das europaweite Netz der Schutzgebiete<br />
vervollständigt werden kann. Naturschutz<br />
darf nicht an der <strong>Schweiz</strong>er Grenze haltmachen.<br />
�Der <strong>WWF</strong> will vermehrt direkt mit den<br />
lokal Betroffenen zusammenarbeiten,<br />
um Konflikte mit Grossraubtieren zu entschärfen.<br />
Kaukasus Erfolge im Jahre 2006/07:<br />
�Der <strong>WWF</strong> hat die Strategieentwicklung<br />
zum Schutz <strong>des</strong> kaukasischen Leoparden<br />
koordiniert, die alle betroffenen Länder involviert.<br />
Damit ist nun die Grundlage zum<br />
Schutz der kleinen und verstreuten Populationen<br />
geschaffen.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Die Umsetzung der Schutzstrategie für<br />
den Leoparden muss begonnen werden.<br />
Der <strong>WWF</strong> will weitere Schutzgebiete<br />
im Kaukasus einrichten; höchste Priorität<br />
haben dabei grenzüberschreitende<br />
Projekte.<br />
�Die Restbestände <strong>des</strong> Störs im Kaspischen<br />
Meer brauchen dringend einen<br />
besseren Schutz damit sich die von<br />
der Kaviargewinnung arg dezimierten<br />
Bestände stabilisieren können.
Fokusregionen in Südamerika<br />
Amazonas und Pantanal<br />
Ausgangslage: Einige der artenreichsten Tiergemeinschaften<br />
leben in den grossen Flusssystemen,<br />
ihren umliegenden Schwemmflächen<br />
und in den Regenwäldern Südamerikas.<br />
Alleine im Amazonas und seinen Zuflüssen<br />
leben über 3000 Fischarten. Überschwemmte<br />
Wälder und Graslandschaften<br />
bieten nicht nur Fischen Laichgründe, sondern<br />
auch vielen Amphibien, Reptilien und Vögeln<br />
Nahrung und Versteckmöglichkeiten. Die<br />
Abholzung der Wälder, Einträge von Giften<br />
aus der Metall- und Ölgewinnung, ungeklärte<br />
Abwässer und der Bau von Strassen und<br />
Dämmen sind die grössten Gefahren für diese<br />
einzigartigen Biotope.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong> unterstützt<br />
lokale Behörden und Nichtregierungsorganisationen<br />
bei der Erstellung<br />
von Schutzkonzepten und der Überwachung<br />
der Projekte. Bedrohungen wie Sojaanbau,<br />
Dammbauten, Flussumleitungen und Abholzungen<br />
werden vom <strong>WWF</strong> kritisch beobachtet<br />
und abgewendet. Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> unterstützt<br />
unter anderem folgende Projekte:<br />
• Erhalt <strong>des</strong> intakten Orinoco-Flusssystems<br />
und der Wälder in <strong>des</strong>sen Einzugsgebiet.<br />
• Nachhaltige Nutzung und Schutz <strong>des</strong><br />
Pantanals, dem weltweit grössten Feuchtgebiet.<br />
Ausgangslage: Tropische und subtropische<br />
Wälder beherbergen mehr Lebensformen als<br />
alle anderen terrestrischen Ökosysteme. Der<br />
Atlantikwald an der Küste von Brasilien, in<br />
Argentinien und Paraguay ist eine der vielfältigsten<br />
und bedrohtesten dieser Waldregionen.<br />
Nur noch 7% der ursprünglichen Fläche<br />
verbleiben von der Heimat <strong>des</strong> Goldkopflöwenäffchens<br />
und anderer seltenen Tiere,<br />
in der man fast 500 Pflanzenarten pro Hektare<br />
findet.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> setzt sich auf verschiedenen Ebenen<br />
für den Erhalt <strong>des</strong> Atlantikwal<strong>des</strong> ein. Neben<br />
dem im Kapitel Wald erwähnten Einsatz für<br />
einen Sojaanbau ohne Vernichtung von Regenwald<br />
führt der <strong>WWF</strong> lokal weitere Projekte<br />
durch:<br />
• Schutz <strong>des</strong> relativ grossen, aber unzulänglich<br />
geschützten Atlantikwal<strong>des</strong><br />
am Oberen Paraná im Grenzgebiet<br />
zwischen Paraguay und Argentinien.<br />
• Umweltverträgliche Bewirtschaftung<br />
der verbleibenden Flächen in Argentinien<br />
durch Einführung und Promotion <strong>des</strong><br />
FSC-Standards.<br />
• Erhalt und Überwachung der Flutregenwald-Schutzgebiete<br />
Abanico del Pastaza<br />
und Pacaya Samiria in Peru.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Die wichtigen ökologischen und hydrologischen<br />
Prozesse im Einzugsgebiet <strong>des</strong><br />
Orinoco sind identifiziert, und ein entsprechen<strong>des</strong><br />
Netz von Schutzzonen ist<br />
etabliert.<br />
• Rinderzucht und Fischerei im Pantanal<br />
sind nachhaltig ausgerichtet. Die Schutzgebiete<br />
werden effektiv geführt, und es<br />
bestehen Nutzungsrichtlinien für die ganze<br />
Region.<br />
• Die negativen Auswirkungen menschlicher<br />
Aktivitäten im Amazonas, insbesondere<br />
der Ölförderung, werden bis 2009 wesentlich<br />
reduziert.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Vorhandensein und Zustand von Managementplänen,<br />
Sicherheit der Finanzierung, verwendete<br />
Fischerei- und Rinderzuchtmethoden,<br />
Reduktion der Verschmutzung durch Öl<br />
und Abwässer.<br />
Atlantikwald Erfolge im Jahre 2006/07:<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Das Holzschlagmoratorium in Paraguay<br />
wird verlängert und hat bis über 2009<br />
hinaus Bestand.<br />
• Bestehende Schutzgebiete werden<br />
vernetzt und durch neue Schutzgebiete<br />
ergänzt.<br />
• Die Populationen <strong>des</strong> Jaguars im Atlantikwald<br />
werden geschützt durch die<br />
Erforschung seiner Ansprüche an den<br />
Lebensraum, durch verbessertes Schutzgebietsmanagement<br />
und die Förderung<br />
der Akzeptanz in der Bevölkerung.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Anzahl km 2 geschützte Waldflächen, Flächenverlust<br />
durch Waldumwandlung, Fläche von<br />
FSC-zertifiziertem Wald, Anzahl Jaguare.<br />
13<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Mit 7 Expeditionen in 5 Ländern führte<br />
der <strong>WWF</strong> gemeinsam mit wissenschaftlichen<br />
Partnern die bisher umfassendste<br />
Populationszählung der stark bedrohten<br />
Flussdelfine durch. Der <strong>WWF</strong> konnte in<br />
den Flüssen der Amazonas- und Orinoco-<br />
Einzugsgebiete rund 2750 Tiere nachweisen<br />
und hat so unerlässliche Erkenntnisse<br />
für eine umfassende Schutzstrategie<br />
gewonnen.<br />
�Die derzeit einzige von Indigenen geführte<br />
FSC-zertifizierte Forstorganisation<br />
in Bolivien wurde wesentlich vom <strong>WWF</strong><br />
mitunterstützt. Dadurch wird für die lokale<br />
Bevölkerung eine neue Einkommensquelle<br />
erschlossen und gleichzeitig ein Beitrag<br />
zum langfristigen Erhalt <strong>des</strong> Regenwal<strong>des</strong><br />
geleistet.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Der <strong>WWF</strong> arbeitet daran, aus den bei<br />
den Flussdelfinzählungen gewonnenen<br />
Erkenntnissen eine umfassende Schutzstrategie<br />
zu erarbeiten.<br />
�Im Pantanal wird mit Beteiligung der<br />
lokalen Verwaltungen und Behörden ein<br />
Umweltbildungszentrum entstehen.<br />
Dort wird das Bewusstsein der Leute für<br />
die Bedeutung dieses weltweit grössten<br />
Feuchtgebietes gefördert.<br />
�In Paraguay wurde ein finanzielles Anreizsystem<br />
geschaffen, damit private Waldbesitzer<br />
ihre Waldflächen intakt stehen lassen.<br />
So kann eine weitere Fragmentierung<br />
<strong>des</strong> stark geschrumpften Atlantikwal<strong>des</strong><br />
verhindert werden.<br />
�Der argentinische Partner <strong>des</strong> <strong>WWF</strong>,<br />
Fundación Vida Silvestre, hat mit einer<br />
intensiven Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
die Sensibilität in der Bevölkerung<br />
über die Gefährdung <strong>des</strong> Jaguars erhöht<br />
und so die nötige Akzeptanz für den<br />
länderübergreifenden Schutz dieser Raubkatze<br />
geschaffen.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Der <strong>WWF</strong> will einen besseren Einblick<br />
in die Lebensgewohnheiten der Jaguare<br />
bekommen und stattet erstmals in dieser<br />
Region Tiere mit einem Funkhalsband aus.<br />
Mit den gewonnenen Erkenntnissen kann<br />
die Planung von Schutzgebieten und<br />
Schutzmassnahmen auf die Bedürfnisse<br />
der Jaguare optimiert werden.<br />
�Das grösste zusammenhängend verbliebene<br />
Waldgebiet in Paraguay, das San-<br />
Rafael-Reservat, soll ein Zentrum erhalten,<br />
in dem alle Aktivitäten zum Schutz, zur<br />
Umweltbildung und Forschung koordiniert<br />
werden.
Fokusregionen in Afrika<br />
Ostafrika<br />
Ausgangslage: Ostafrika ist nicht nur Heimat<br />
von bekannten Grosswildtieren wie Elefanten,<br />
Nashörnern, Flusspferden, Büffeln und Grosskatzen.<br />
Auch die Küsten Ostafrikas zeichnen<br />
sich durch ausgedehnte Mangrovenwälder<br />
und vorgelagerte Korallenriffe aus, welche Heimat<br />
für unzählige Tiere und Pflanzen bieten.<br />
Der <strong>WWF</strong> engagiert sich seit rund 40 Jahren in<br />
Ostafrika, aber politische Unruhen und ökonomische<br />
Krisen mit ihren Begleiterscheinungen<br />
gefährden immer wieder bestehende<br />
Schutzgebiete.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Das <strong>WWF</strong>-<br />
Netzwerk unterstützt Behörden, lokale Organisationen<br />
und die Bevölkerung beim Errichten<br />
und beim Management von Naturschutzparks<br />
und Meeresschutzgebieten. Es<br />
fördert nachhaltige Nutzungsmethoden und<br />
alternative Einkommensquellen für die lokale<br />
Bevölkerung. Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> unterstützt:<br />
• das Kipengere Game Reserve im Hochland<br />
von Tansania.<br />
• den Wiederaufbau <strong>des</strong> Gorongosa-<br />
Nationalparks, der im Bürgerkrieg in<br />
Moçambique beinahe zerstört wurde.<br />
• die Errichtung und das Management von<br />
marinen Schutzzonen in Moçambique<br />
(Bazaruto-Archipel), und Kenia (Kiunga<br />
Marine Reserve).<br />
Madagaskar<br />
Ausgangslage: Nur noch wenige, spärliche<br />
Restflächen in unzugänglichen Gebieten sind<br />
vom einst vollständig bewaldeten Osten Madagaskars<br />
übrig geblieben. Vielerorts wurde<br />
der Wald gerodet, um Felder anzulegen. Aber<br />
nicht nur die Wälder Madagaskars leiden unter<br />
dem Druck, auch die reichen Fischgründe<br />
vor den Küsten müssen vor Übernutzung geschützt<br />
werden.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />
schützt in Madagaskar Waldgebiete und auch<br />
Küstenregionen. In beiden Fällen geht es<br />
darum, zusammen mit der lokalen Bevölkerung<br />
naturschonende Einkommensquellen<br />
zu schaffen und sie über Zusammenhänge<br />
zwischen Lebensraumzerstörung und Nahrungsmangel<br />
aufzuklären. Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
schützt:<br />
• Teile <strong>des</strong> 120 km langen Waldkorridors<br />
im Manambolo-Tal, einer wichtigen<br />
Lebensader zwischen den Nationalparks<br />
Andringitra und Ranomafana. Ohne<br />
ihn sind mehrere Lemurenarten vom<br />
Aussterben bedroht.<br />
• den Masoala Marine Park, die grösste<br />
Schutzzone in Madagaskar. Sie umfasst<br />
tropische Regenwälder, drei Küstenwälder<br />
und drei Meeresparks. Der <strong>WWF</strong> hilft beim<br />
Aufbau von Managementstrukturen und<br />
der lokalen Schulung.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Kipengere: Die Umstellung auf Bienenzucht<br />
bietet der lokalen Bevölkerung genug<br />
Einkommen, um Raubbau am Schutzgebiet<br />
zu verhindern.<br />
• Gorongosa: Das Schulungszentrum<br />
für Wildhüter ist staatlich akkreditiert und<br />
finanziell unabhängig.<br />
• Bazaruto-Nationalpark: Ein Managementplan<br />
für den Park ist verabschiedet.<br />
Projekte mit touristischer Übernutzung<br />
sind gestoppt.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Managementpläne und ihre Umsetzung, Sicherheit<br />
der Finanzierung, Populationsgrössen,<br />
verwendete Fischereimethoden, Reduktion<br />
unerwünschter Beifänge wie Schildkröten<br />
und Meerkühe.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• In Manambolo hat die Selbstverwaltung<br />
<strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> durch die Gemeinde Erfolge<br />
gebracht. Dieses Modell soll auf alle Gemeinden<br />
entlang <strong>des</strong> Waldkorridors angewendet<br />
werden.<br />
• Der Tourismus im Masoala Marine Park<br />
ist umweltfreundlich, der Fischfang wird<br />
reguliert. Managementsysteme und Infrastrukturen<br />
für den zukünftigen Betrieb<br />
sind eingerichtet.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Schutz und Zustand der Waldfläche, Fläche<br />
der Meeresschutzzonen, Umsetzung der Managementpläne.<br />
14<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Das Gorongosa-Schulungszentrum<br />
feiert im Jahr 2007 sein 10-jähriges Bestehen.<br />
Die Regierung von Moçambique hat<br />
erstmals einen Beitrag von rund 35'000<br />
Franken geleistet. In einem Pilotkurs<br />
wurden Mensch-Wildtier-Konflikte thematisiert.<br />
Dieser Kurs soll im nächsten Jahr<br />
ins Programm aufgenommen werden.<br />
Kipengere: Durch den Aufbau eines Mikro-<br />
Kreditsystems und die Ausbildung in der<br />
Produktion von Bienenhonig und -wachs,<br />
dem Betrieb von Baumschulen sowie der<br />
Herstellung von Seife und Batikprodukten<br />
konnten die Einkommen der lokalen<br />
Bevölkerung gesteigert werden. Die Fälle<br />
von Wilderei im Schutzgebiet sind um<br />
rund 55% zurückgegangen, und auch die<br />
illegalen Sammeltätigkeiten nahmen stark<br />
ab.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Die Strandkontrollen in den Meeresprojekten<br />
entlang der Küste werden verbessert,<br />
damit die Wilderei von Schildkrötengelegen<br />
weiter zurückgeht und mehr<br />
junge Schildkröten schlüpfen.<br />
�Die Trinkwasserversorgung im Bazaruto-Nationalpark<br />
soll verbessert werden<br />
Erfolge im Jahre 2006/07:<br />
�Auf Patrouillen durch die Primärwälder<br />
im verbliebenen Waldkorridor wurden im<br />
Berichtsjahr keine neuen Rodungen gefunden.<br />
Neue Rodungen in Sekundärwäldern<br />
wurden zwar entdeckt, aber in geringerer<br />
Zahl als früher.<br />
�Der Kampf gegen den internationalen<br />
Tierhandel aus Madagaskar zeigt Wirkung:<br />
die Exporte sind von 90000 Tieren und<br />
Pflanzen (2004) auf 12000 (2006) zurückgegangen.<br />
Zudem wurden am Zoll zwei<br />
Schmuggler mit insgesamt 500 lebenden<br />
Reptilien und Amphibien erwischt.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Die Erhöhung von alternativen Einkommen<br />
für die ländliche Bevölkerung soll den<br />
Druck auf die Wälder Madagaskars weiter<br />
verringern.<br />
�Ausarbeitung eines neuen Programms<br />
«Energie» im <strong>WWF</strong> Madagaskar.
Fokusregionen in Asien<br />
Indus und Mekong<br />
Ausgangslage: Asiens Bevölkerungs- und<br />
Wirtschaftswachstum bewirkt Raubbau an<br />
den Naturschätzen der Region. Wälder,<br />
Feuchtgebiete und die grossen Flusssysteme<br />
Asiens werden in Industrieanlagen, Landwirtschaftsgebiete<br />
und Siedlungen umgewandelt<br />
und verbaut. Dem Indus wird wegen <strong>des</strong> enormen<br />
Wasserbedarfs der Baumwollplantagen<br />
zu viel Wasser entnommen. Zudem gelangen<br />
mit dem Abwasser aus Landwirtschaft und<br />
Industrie tonnenweise Gifte in den Fluss. Die<br />
zum Teil noch unerforschten tropischen Wälder<br />
Indochinas sind Heimat von einigen der<br />
seltensten Tierarten der Erde, wie <strong>des</strong> Java-<br />
Nashorns. Auch diese Wälder sind durch Umwandlung<br />
in andere Nutzungsformen stark<br />
bedroht.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> unterstützt diese Projekte:<br />
• Indus-Flussdelfine: Erarbeiten von Methoden<br />
im Baumwollanbau zum sparsamen<br />
Einsatz von Wasser und Pflanzenschutzmitteln<br />
im pakistanischen Punjab und<br />
gezielte Schutzmassnahmen, damit der<br />
seltene Flussdelfin wieder eine Überlebenschance<br />
hat.<br />
• Umweltverträgliche Waldnutzung in Vietnam,<br />
Laos und Kambodscha: Der <strong>WWF</strong><br />
Ausgangslage: Schnell wachsende Plantagen<br />
für Papierholz und riesige Ölpalmplantagen<br />
verdrängen den ursprünglichen Wald auf<br />
Sumatra und Borneo. Und die verbliebenen<br />
Waldstücke werden durch illegalen Holzschlag<br />
immer mehr geschädigt. Tiger, Tapire<br />
und Gibbons verlieren ihre angestammten<br />
Lebensräume. Besonders dramatisch ist die<br />
Situation für die Sumatra-Elefanten in Tesso<br />
Nilo: Sie brauchen ausgedehnte und ungestörte<br />
Waldgebiete. Verlassen sie die immer<br />
kleiner werdenden Wälder, drohen ihnen Tod<br />
oder Gefangenschaft.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Indonesisches<br />
Palmöl, Papier und Möbel aus indonesischem<br />
Holz werden in Europa in grossen Mengen<br />
umgesetzt. Der <strong>WWF</strong> setzt sich dafür ein,<br />
dass diese Produkte umweltverträglich produziert<br />
werden und die biologisch wertvollsten<br />
Waldgebiete erhalten bleiben. Dazu<br />
braucht es:<br />
• Management- und Nutzungspläne für die<br />
verbleibenden Regenwaldgebiete, damit<br />
ihre Nutzung umweltverträglich erfolgt.<br />
• ein Netz von unberührten Schutzgebieten,<br />
verbunden durch Waldkorridore, die<br />
hilft privaten und staatlichen Holzunternehmen<br />
bei der Erarbeitung von nachhaltigen<br />
Bewirtschaftungsmethoden, damit<br />
der Wald trotz wirtschaftlichem Druck<br />
erhalten bleibt.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Die Flussdelfin-Population im Indus wird<br />
regelmässig überwacht, und gezielte<br />
Schutzmassnahmen sind eingeleitet.<br />
• Nachhaltiges Waldmanagement ist in<br />
Kambodscha und Laos eingeführt.<br />
• In Vietnam besteht ein Handelsnetz für<br />
zertifiziertes Holz aus einheimischer<br />
Produktion.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Populationsgrösse und -entwicklung <strong>des</strong><br />
Flussdelfins, zertifizierte Waldfläche, Verfügbarkeit<br />
von zertifiziertem Holz.<br />
Elefanten, Tigern und anderen Tieren<br />
Wanderungen zwischen den Schutzgebieten<br />
erlauben.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Die wichtigsten Holz- und Palmölproduzenten<br />
setzen auf nachhaltige Bewirtschaftung.<br />
Die Wilderei wird massgeblich<br />
reduziert.<br />
• In Kalimantan und Riau wurden regionale<br />
Landnutzungspläne gemäss den Richtlinien<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> erstellt und befinden sich<br />
in der Umsetzung.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Zertifizierte Waldfläche, Anteil von zertifiziertem<br />
Holz und Palmöl an der Gesamtproduktion,<br />
Anzahl und Fläche der Schutzgebiete<br />
mit Waldumwandlungs-Verbot.<br />
15<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Die <strong>WWF</strong>-Büros der Mekongländer<br />
Thailand, Vietnam, Laos und Kambodscha<br />
haben ihre wichtigsten Programmkomponenten<br />
unter einem Dach, dem Greater<br />
Mekong Programme, zusammengefasst<br />
und konnten dadurch ihre Effizienz und<br />
ihren Einfluss gegenüber wichtigen öffentlichen<br />
und privaten Akteuren in der Region<br />
stärken.<br />
�In Kambodscha gab es im letzten Jahr<br />
am wenigsten tote Flussdelfine seit der Erfassung<br />
der Delfinmortalität im Jahr 2003.<br />
Bloss drei verstorbene Tiere wurden gezählt.<br />
Neu ist ein Veterinär zum Team gestossen,<br />
der die To<strong>des</strong>ursachen in einem<br />
einfachen Feldlabor untersuchen kann.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Der <strong>WWF</strong> hat sich in Vietnam stark für<br />
den Waldbau nach FSC-Kriterien eingesetzt.<br />
Jetzt muss ein Ausbau <strong>des</strong> vietnamesischen<br />
Holz-Handelsnetzes erfolgen,<br />
damit das FSC-Holz auch abgesetzt werden<br />
kann.<br />
�Mit der Förderung <strong>des</strong> Ökotourismus<br />
und der Sensibilisierung der Bevölkerung<br />
an den Flüssen Indus und Mekong soll<br />
dazu beigetragen werden, dass diese<br />
wichtigen Lebensadern Asiens ihren Wert<br />
für die Biodiversität auch in Zukunft behalten.<br />
Sumatra und Borneo Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Brunei, Indonesien und Malaysia haben<br />
einen Vertrag unterzeichnet, der das «Heart<br />
of Borneo», eines der weltweit wichtigsten<br />
Zentren der Biodiversität schützen soll.<br />
220000 km 2 tropischer Wald – fast ein<br />
Drittel der Fläche Borneos – werden nun<br />
erhalten oder der nachhaltigen Nutzung<br />
zugeführt.<br />
�Zum ersten Mal in der Geschichte ist<br />
es einem Team <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> gelungen, das<br />
extrem seltene Borneo-Nashorn auf Film<br />
zu bannen. Nur gerade noch 25–50 Exemplare<br />
gibt es von diesen scheuen Tieren.<br />
Nun werden zusätzliche Waldflächen aufgekauft<br />
und geschützt, damit sich die<br />
Nashörner ungehindert bewegen können.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Auf Sumatra haben Kleinbauern immer<br />
wieder unter von wilden Elefanten verursachten<br />
Ernteschäden zu leiden. Der <strong>WWF</strong><br />
hat als Gegenmassnahme Patroullien mit<br />
zahmen Elefanten eingeführt, welche ihre<br />
wilden Artgenossen vom Eindringen in die<br />
Plantagen abhalten sollen. Dieses Konzept<br />
hat so gut funktioniert, dass der <strong>WWF</strong> nun<br />
zusätzliche Vereinbarungen mit Palmöl-<br />
Plantagenbesitzern zum Aufbau weiterer<br />
Elefantenpatrouillen treffen will.
Fokusregionen in Europa und im Mittleren Osten Die Alpen sind eines der am intensivsten genutzten<br />
Gebirgsökosysteme der Welt und gehören zugleich zu den wichtigsten Zentren der Biodiversität in Europa.<br />
Fokusregionen in Südamerika Südamerika – Heimat <strong>des</strong> grössten Flusssystems und <strong>des</strong> grössten Feuchtgebiets der Welt. Der<br />
<strong>WWF</strong> arbeitet für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen von Amazonas, Orinoco und Pantanal.<br />
16
Fokusregionen in Afrika Die Küstengewässer Ostafrikas sind besonders reich an Fischen und liefern die Lebensgrundlagen für die<br />
lokale Bevölkerung. Der <strong>WWF</strong> errichtet ein Netz von Marine-Parks, um diesen Reichtum zu erhalten.<br />
Fokusregionen in Asien Die Lebensräume der Orang-Utans auf Borneo verschwinden in alarmierendem Ausmass. Riesige Palmöl-<br />
Plantagen machen sich breit, wo früher unberührter Tropenwald stand. Den Orang-Utans bleibt nichts anderes übrig, als auf kultiviertes Land<br />
auszuweichen, wo sie von den Farmern gefangen oder erschossen werden.<br />
17
Wie wir arbeiten<br />
Konsum & Wirtschaft<br />
Umweltverträglicher Lebensstil<br />
Ausgangslage: Die <strong>Schweiz</strong> verbraucht<br />
heute 2,5-mal so viel Ressourcen, wie ihr<br />
für eine nachhaltige Entwicklung zustehen<br />
würden. Dieser hohe Ressourcenverschleiss<br />
liesse sich einerseits durch ein vernünftiges<br />
Konsumverhalten der Endverbraucher und<br />
andererseits durch ein Angebot von ressourcenoptimierten<br />
Produkten der Hersteller<br />
verringern.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong> informiert<br />
KonsumentInnen primär in Drittmedien,<br />
aber auch in eigenen Publikationen<br />
über Möglichkeiten, das eigene Konsumverhalten<br />
umweltverträglicher zu gestalten.<br />
Ergänzend dazu erstellt er Marktüberblicke<br />
und Entscheidungshilfen. Der <strong>WWF</strong> will:<br />
• energieeffiziente Geräte fördern durch<br />
Produktvergleiche und Informationen<br />
auf Plattformen wie www.topten.ch/.<br />
• Qualitätslabel für Umweltverträglichkeit<br />
im Konsumbereich mitgestalten und deren<br />
Bekanntheitsgrad durch Labelbroschüren<br />
und Ähnliches erhöhen.<br />
• Zusammenschlüsse von nachhaltig<br />
handelnden Produzenten oder Dienstleistern<br />
wie naturemade (Ökostrom),<br />
Ökologischer wirtschaften<br />
Ausgangslage: Grossverteiler und die Bauund<br />
Immobilienbranche sind aufgrund der<br />
Globalisierung der Märkte einer wachsenden<br />
Konkurrenz ausgesetzt. Nachhaltig produzierte<br />
Güter und umweltverträgliche Produkte<br />
können in dieser Situation einen Wettbewerbs-<br />
und Imagevorteil schaffen und<br />
gleichzeitig die Umweltbelastung durch diese<br />
Bereiche senken.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> unterhält strategische Partnerschaften<br />
mit führenden Unternehmen zur Lancierung<br />
von ökologisch sinnvollen Produkten<br />
und fördert die Einhaltung von Energie-Standards<br />
sowie die Verwendung von FSC-Holz<br />
im Bau- und Immobilienbereich durch:<br />
• Zusammenarbeit mit Unternehmen zur<br />
Förderung von nachhaltiger Baumwolle,<br />
nachhaltigem Palm- und Sojaöl, von<br />
FSC-Holz, MSC-Meeresfrüchten, energieeffizienten<br />
Geräten, etc.<br />
• Verpflichtung von Immobilienunternehmen,<br />
ihren CO2-Ausstoss zu reduzieren.<br />
• Promotion der Verwendung von FSC-Holz<br />
im Bau.<br />
natureplus (Baumaterialien) oder Goût<br />
Mieux (Gastronomie) unterstützen und<br />
propagieren.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• 500000 KonsumentInnen pro Jahr<br />
informieren sich auf www.topten.ch<br />
über ökologische Produkte.<br />
• Publikation von Ratgebern, Produktund<br />
Unternehmensvergleichen in den<br />
Medien.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Anzahl und Leserreichweite der Ratgeber,<br />
Anzeigenäquivalenzwerte der Artikel in Drittmedien,<br />
Besucherzahlen auf den Konsumwebseiten<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong>.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Der <strong>WWF</strong> unterhält mit min<strong>des</strong>tens zwei<br />
grossen Unternehmen eine Kooperation für<br />
Verkauf und Herstellung von nachhaltigen<br />
Produkten.<br />
• Immobilienunternehmen mit zusammen<br />
min<strong>des</strong>tens 50000 Wohnungen haben<br />
sich verpflichtet, ihren CO2-Austoss in<br />
fünf Jahren um 20% zu senken.<br />
• Ein Viertel <strong>des</strong> in der <strong>Schweiz</strong> verbauten<br />
Holzes ist FSC-zertifiziert.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Anzahl Kooperationen, Anzahl Produkte,<br />
Wohnungen mit CO2-Reduktionsverpflichtung,<br />
Anteil FSC-Bauholz.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
18<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Der Anteil der verkauften Sparlampen<br />
hat sich letztes Jahr rund verdoppelt.<br />
Alleine während der <strong>WWF</strong>-Klimakampagne<br />
zum Thema Licht sind die Umsätze der<br />
Grossverteiler um 10 bis 30% gestiegen.<br />
Die Studie zur Effizienz der öffentlichen<br />
Beleuchtung hat ein grosses Echo in der<br />
Öffentlichkeit ausgelöst und viele Gemeinden<br />
zur Überprüfung der Situation motiviert.<br />
�Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> hat die Nachhaltigkeit<br />
der Baumärkte in der <strong>Schweiz</strong> bewertet.<br />
Diese Studie stiess auf grosses Echo<br />
bei den Medien und der Öffentlichkeit und<br />
motiviert Baumärkte, ihre Umweltperformance<br />
zu verbessern.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Ineffiziente und energiefressende<br />
Geräte vernichten gewaltige Mengen an<br />
Energie. Dazu zählt insbesondere der<br />
sinnlose Standby-Verbrauch. Der <strong>WWF</strong><br />
weist auf Mängel hin, zeigt Alternativen<br />
auf und bereitet das Feld für eine Auszeichnung<br />
guter Geräte vor.<br />
�Weltweit sind über drei Viertel der<br />
kommerziell genutzten Fische bedroht.<br />
Zuchtfische werden oft umweltbelastend<br />
produziert. Der <strong>WWF</strong> stellt in der Öffentlichkeit<br />
die Problematik dar und zeigt<br />
KonsumentInnen gemeinsam mit Unternehmen<br />
Lösungen auf.<br />
Erfolge im Jahre 2006/07:<br />
�Drei neue Partner sind der <strong>WWF</strong><br />
Climate Group beigetreten. ZKB, KWT,<br />
Migros haben sich nicht nur verpflichtet,<br />
ihren CO2-Ausstoss um rund 15% zu<br />
senken, sondern auch energieeffiziente<br />
und damit klimafreundliche Produkte<br />
anzubieten.<br />
�Der <strong>WWF</strong> konnte die erfolgreiche umfassende<br />
Umweltpartnerschaft mit Coop<br />
fortsetzen und Coop als ersten Partner<br />
der <strong>WWF</strong> Seafood Group gewinnen und<br />
hat damit eine weitere Unternehmensplattform<br />
lanciert. Ziel dabei ist die Förderung<br />
von nachhaltigem Fisch sowie den Ausschluss<br />
von stark gefährdeten Arten.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Der <strong>WWF</strong> verpflichtet weitere bedeutende<br />
Unternehmen in der <strong>WWF</strong> Climate<br />
Group und <strong>WWF</strong> Seafood Group und<br />
engagiert sich in diesem Rahmen für<br />
den Klimaschutz und die nachhaltige<br />
Fischerei.
Jugend & Bildung<br />
Kinder und Jugendliche für die Umwelt begeistern<br />
Ausgangslage: Kindheit und Jugend sind<br />
prägende Lebensphasen für unser Konsumund<br />
Umweltverhalten. Daher ist es besonders<br />
wichtig, Kindern und Jugendlichen die Botschaft<br />
zu vermitteln, dass sie einen wertvollen<br />
Beitrag zur Verminderung der lokalen und<br />
globalen Umweltprobleme leisten können.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Erfolgreiche<br />
Umweltbildung geht über die reine Wissensvermittlung<br />
hinaus und zeigt Lösungs- und<br />
Handlungsansätze auf. Deshalb bietet der<br />
<strong>WWF</strong> Kindern und Jugendlichen in Form<br />
von Mitmach-Aktionen die Möglichkeit, sich<br />
aktiv für die Umwelt einzusetzen. Ergänzend<br />
dazu führt der <strong>WWF</strong> ein attraktives Angebot<br />
im schulischen Bereich, um LehrerInnen bei<br />
der Umweltbildung zu unterstützen. Der <strong>WWF</strong><br />
will:<br />
• Kinder und Jugendliche mittels eines<br />
integrierten Angebots mit Print- und<br />
Online-Elementen ansprechen.<br />
• Kinder und Jugendliche in <strong>WWF</strong>-Lagern<br />
und über Anlässe wie pandACTION<br />
Snowdays oder Aktionen an Festivals<br />
für Umweltthemen sensibilisieren.<br />
• Ein Angebot an schulischen Aktivitäten<br />
(Aktionsideen, Exkursionsvorschläge,<br />
Schulbesuche, Lektionsvorschläge, etc.)<br />
unterhalten, das für LehrerInnen jederzeit<br />
anwendbar ist.<br />
Ausgangslage: Umweltmärkte wachsen in<br />
der <strong>Schweiz</strong> stärker als der Rest der Wirtschaft.<br />
Sie erwirtschaften heute einen Umsatz<br />
von 21 Mia CHF. Will die <strong>Schweiz</strong> in diesem<br />
Zukunftsmarkt auch weiterhin mithalten,<br />
braucht sie ein entsprechen<strong>des</strong> Aus- und<br />
Weiterbildungsangebot und ökologische Ziele<br />
im Bildungssystem auf allen Stufen.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Das Bildungszentrum<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> offeriert ein breites<br />
Weiterbildungsangebot im Umweltbereich,<br />
engagiert sich in der Bildungspolitik<br />
und unterstützt Menschen in der Berufswelt<br />
mit Umweltqualifikationen (inklusive Eidgenössische<br />
Berufsprüfung). Das Bildungszentrum<br />
will:<br />
• ein breites Kursangebot in ökologischer<br />
Weiterbildung anbieten, die sich in der<br />
Berufswelt und im persönlichen Umfeld<br />
einsetzen lässt.<br />
• mit Projekten, Studien und Dokumentationen<br />
ökologische Berufsperspektiven<br />
aufbauen.<br />
• als bildungspolitischer Akteur in den<br />
Bildungsdebatten mitwirken und die Ziele<br />
der nachhaltigen Entwicklung in den<br />
Bildungsreformen von Universitäten,<br />
Fachhochschulen und Berufsschulen<br />
verankern.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> erhöht die Anzahl<br />
Kinder, die er mit seinem Print- und<br />
Onlineangebot erreicht, um 20% gegenüber<br />
2004/05.<br />
• Die Besucherzahl der Internet-Plattform<br />
(www.pandaction.ch) wird um 50%<br />
gesteigert.<br />
• 15 Sektionen bieten, koordiniert durch<br />
den <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong>, Schulbesuche an.<br />
Zu allen Schulkampagnen <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> gibt es thematische Schulbesuche.<br />
Pro Jahr werden 4000 SchülerInnen<br />
mit Schulbesuchen erreicht.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Reichweite <strong>des</strong> Angebots, Medienecho der<br />
Snowdays, Anzahl Schulbesuche, Auslas-<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Bildungszentrum <strong>WWF</strong>: Umwelt in Beruf und Ausbildung<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Der <strong>WWF</strong> bildet Erwachsene im Umfang<br />
von jährlich min<strong>des</strong>tens 1200 Personenkurstagen<br />
aus.<br />
• Ökologisch orientierte Qualitätsstandards,<br />
Akkreditierungsverfahren und Studienund<br />
Lehrangebote sind vorhanden und<br />
werden umgesetzt.<br />
• Ökologische Ziele sind in neuen Bildungsgesetzgebungen<br />
wie Fachhochschul-,<br />
Hochschulförderungs- und Forschungsgesetz<br />
integriert.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Anzahl Erwachsenenkurstage, Umfang <strong>des</strong><br />
ökologisch orientierten Lehrangebots, Vorhandensein<br />
von ökologischen Zielen in der<br />
Bildungsgesetzgebung.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
19<br />
tung Kinderlager, Präsenz an pädagogischen<br />
Hochschulen.<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Über 1000 Kinder und Jugendliche und<br />
mehr als 200 freiwillige LeiterInnen konnten<br />
in den gut 60 <strong>WWF</strong>-Lagern für die unterschiedlichsten<br />
Umweltthemen sensibilisiert<br />
werden.<br />
�Die Kinderhomepage www.pandaclub.ch<br />
wurde weiter ausgebaut. Die Besucherzahlen<br />
konnten dadurch von 120 auf 166<br />
pro Tag gesteigert werden.<br />
�Der <strong>WWF</strong> war wiederum an zwei grossen<br />
Openairs präsent (Gurtenfestival Bern,<br />
Paléo Nyon mit insgesamt gegen 300000<br />
BesucherInnen). Mit über 15000 Jugendlichen<br />
konnte so im Direktkontakt über<br />
Klima- und Footprintthemen diskutiert<br />
werden.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Es gilt, Umweltbildungsmassnahmen<br />
in den Kernprojekten <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
zu verankern.<br />
�Die Zielgruppenstrategien der Bereiche<br />
Umweltbildung und Mitgliederwerbung<br />
und -bindung werden enger abgeglichen.<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Die Nachfrage nach Umweltbildung ist<br />
ungebrochen. Die modularen Ausbildungsgänge<br />
in Umweltberatung und -kommunikation<br />
<strong>des</strong> Bildungszentrums <strong>WWF</strong> in der<br />
Deutsch- und Westschweiz waren 2006/07<br />
wiederum total ausgebucht.<br />
�Erfolgreiche Verhandlungen <strong>des</strong> Bildungszentrums<br />
<strong>WWF</strong> haben zur Folge,<br />
dass ökologische Inhalte in die Bildungspläne<br />
von klimarelevanten Berufen wie<br />
FahrlehrerInnen, NetzelektrikerInnen,<br />
Sanitärberufe und Polybau aufgenommen<br />
wurden.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�2007 hat das Bun<strong>des</strong>amt für Berufsbildung<br />
(BBT) das Bildungszentrum <strong>WWF</strong><br />
beauftragt, zusammen mit zwei anderen<br />
Bildungsträgern (sanu in Biel und BZ Wald<br />
in Lyss) Berufsbilder für höhere Berufsprüfungen<br />
im Umweltbereich zu definieren.<br />
�Zusätzlich zur beruflichen Aus- und<br />
Weiterbildung für Erwachsene in der<br />
<strong>Schweiz</strong> arbeitet der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> am<br />
Aufbau eines internationalen Bildungsauftrages<br />
in Zusammenarbeit mit federführenden<br />
Bildungs- und Bun<strong>des</strong>ämtern.
Politik<br />
Für eine fortschrittliche Gesetzgebung im Umweltschutz<br />
Ausgangslage: Umweltschutz ist in der<br />
<strong>Schweiz</strong> Verfassungsauftrag. Bund und Kantone<br />
spielen als Ausführende <strong>des</strong> Umweltrechts<br />
eine wichtige Rolle, stehen aber bei der<br />
Umsetzung <strong>des</strong> Verfassungsauftrags zunehmend<br />
unter politischem Druck, und ihre Mittel<br />
werden laufend gekürzt. Schwächungen <strong>des</strong><br />
Umweltrechts wie im Gewässer- und Waldschutz,<br />
aber auch die Angriffe auf das Verbandsbeschwerderecht<br />
betreffen Themen, die<br />
für den <strong>WWF</strong> von zentraler Bedeutung sind.<br />
Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Neue umweltpolitische<br />
Herausforderungen und Chancen<br />
müssen frühzeitig erkannt, mit gut abgestützten<br />
Koalitionen angegangen und von der<br />
Öffentlichkeit unterstützt werden. Der <strong>WWF</strong><br />
erreicht dies durch:<br />
• regelmässige Kontakte zu min<strong>des</strong>tens<br />
einem Drittel der National- und Ständeräte<br />
und Briefing von Parlamentariern<br />
und Behörden.<br />
• Bildung von umweltpolitischen Koalitionen<br />
mit staatlichen Institutionen und<br />
NGOs.<br />
• Information der Bevölkerung via eigene<br />
Kanäle und Medien zu umweltpolitischen<br />
Problemen und Aufbau eines Netzes von<br />
Aktivisten.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
• Die Mehrheit der Parteien in der <strong>Schweiz</strong><br />
verfügt über ein Umweltprogramm, das in<br />
wesentlichen Teilen den Anliegen <strong>des</strong><br />
<strong>WWF</strong> entspricht.<br />
• Der ökologische Standard wird bei Revisionen<br />
der Umweltgesetze (Waldgesetz,<br />
Restwasservorschriften, Gesetze im<br />
Energiebereich) erhalten oder verbessert.<br />
• Zwei Drittel der vom <strong>WWF</strong> mitgetragenen<br />
Initiativen und Referenden werden angenommen,<br />
und 50% der Bevölkerung sind<br />
der umweltpolitischen Strategie <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />
gegenüber positiv eingestellt.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Umwelt-Programminhalte der Parteien, Zustand<br />
der Umweltschutzgesetzgebung, Erfolgsrate<br />
bei Vorstössen, Initiativen und Referenden.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
20<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Der <strong>WWF</strong> verschafft sich weiter Gehör<br />
auf höchster politischer Ebene. Vier<br />
Mitglieder <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>rates suchten das<br />
direkte Gespräch mit dem <strong>WWF</strong> sowie<br />
die Parteispitzen von SP, Grüne, CVP<br />
und FDP.<br />
�Nicht nur Linke und Grüne, auch zahlreiche<br />
bürgerliche Nationalrätinnen und<br />
Nationalräte stimmten in den letzten vier<br />
Jahren für einen besseren Klimaschutz.<br />
Das zeigt eine aktuelle <strong>WWF</strong>-Analyse. Die<br />
konstruktive und sachorientierte Lobbyingarbeit<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> findet zunehmend<br />
auch bei bürgerlichen ParlamentarierInnen<br />
Gehör.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�160000 Leute haben die Initiative<br />
«Lebendiges Wasser» unterschrieben, die<br />
vom Bund einen verbesserten Gewässerschutz<br />
fordert. Der Bun<strong>des</strong>rat hat die<br />
Initiative ohne Gegenvorschlag abgelehnt.<br />
So bearbeitet der <strong>WWF</strong> nun das Parlament,<br />
den Entscheid <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>rats zu korrigieren,<br />
die Initiative anzunehmen oder zumin<strong>des</strong>t<br />
einen vernünftigen Gegenvorschlag<br />
auszuarbeiten.<br />
�Zusammen mit Partnern aus der Politik<br />
und anderen Umweltverbänden hat der<br />
<strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> die Klimainitiative ins Leben<br />
gerufen, eine eidgenössische Volksinitiative,<br />
die fordert, dass sich die <strong>Schweiz</strong> ihrer<br />
Verantwortung für den Klimaschutz stellt<br />
und ihre Treibhausgas-Emissionen bis<br />
zum Jahr 2020 im Vergleich zum Stand<br />
von 1990 um 30 Prozent reduziert. Jetzt<br />
geht es darum, die nötigen Unterschriften<br />
so rasch wie möglich zusammenzubringen<br />
und parallel mit politischen Vorstössen auf<br />
dasselbe politische Ziel hinzuarbeiten.<br />
�Das Verbandsbeschwerderecht steht<br />
unter Druck. Die FDP will dieses wichtige<br />
Rechtsmittel für den Umweltschutz mit<br />
einer Initiative weiter beschneiden.<br />
Der Bun<strong>des</strong>rat hat sich dem Druck der<br />
Wirtschaftslobby gebeugt und sie zur<br />
Annahme empfohlen. Jetzt setzt der <strong>WWF</strong><br />
einerseits auf das Parlament und bereitet<br />
sich andererseits auf einen Abstimmungskampf<br />
vor.
Konsum & Wirtschaft Die gegenwärtigen Fischereimethoden sind alles andere als nachhaltig. Sie generieren gewaltige Mengen an<br />
ungenutztem Beifang und gefährden zahlreiche Arten. Die <strong>WWF</strong> SEAFOOD GROUP setzt sich für nachaltigen Fisch und den Ausschluss von<br />
stark gefährdeten Arten ein.<br />
Jugend & Bildung Jährlich rund 60 <strong>WWF</strong>-Lager in der ganzen <strong>Schweiz</strong> bieten Raum und Gelegenheit für Kinder und Jugendliche,<br />
um die Natur zu erfahren und eine Beziehung zur Umwelt aufzubauen.<br />
Politik Der <strong>WWF</strong> unterhält regelmässige Kontakte zu National- und StänderätInnen und beteiligt sich an umweltpolitischen Koalitionen.<br />
So wird sichergestellt, dass Bund und Kantone ihren Verfassungsauftrag zum Umweltschutz wahrnehmen.<br />
21
Regionalprogramm<br />
Beiträge der <strong>WWF</strong>-Sektionen an die Ziele <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Ausgangslage: Die 24 kantonalen Sektionen<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> sind eigenständige Vereine, tragen<br />
aber mit ihrer Arbeit zu den überregionalen<br />
Zielen <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> bei. Im Geschäftsjahr<br />
2004/05 wurden diese Beiträge erstmals<br />
als Leistungsauftrag mit verbindlichen<br />
inhaltlichen Zielen formuliert. Dadurch sind<br />
die <strong>WWF</strong>-Sektionen mitverantwortlich für<br />
den Erfolg <strong>des</strong> Gesamtprogramms <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong>.<br />
Was unternehmen die <strong>WWF</strong>-Sektionen?<br />
Die Sektionen leisten Beiträge zu den meisten<br />
Programmthemen <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong>. Ihre<br />
Aktivitäten umfassen unter anderem:<br />
• die Beeinflussung von Wasserbauprojekten<br />
an Linth und Rhein sowie der Wasserkraftnutzung<br />
in den Regionen, damit sie<br />
den Richtlinien <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> entsprechen.<br />
• Lobbyieren bei kantonalen EntscheidungsträgerInnen<br />
für ein ökologisches<br />
eidgenössisches Waldgesetz.<br />
• Information und Einsatz für eine gentechfreie<br />
Landwirtschaft.<br />
• Vermitteln von Umweltschutzthemen<br />
durch Schulbesuche.<br />
• Flussrevitalisierungen fördern durch den<br />
Einsatz von Freiwilligen.<br />
• Skigebietserweiterungen verhindern, oder<br />
falls nicht möglich, ökologisch optimieren,<br />
sowie umweltverträgliche touristische<br />
Alternativen im Alpenraum aufzeigen.<br />
• Mithilfe beim Bezeichnen von schützenswerten<br />
Habitaten im Alpenraum und beim<br />
Erarbeiten von Managementplänen für<br />
diese Gebiete.<br />
Ziele bis ins Jahr 2009:<br />
Die <strong>WWF</strong>-Sektionen tragen mit ihrer Tätigkeit<br />
zu den langjährigen Zielen bei, wie sie für die<br />
verschiedenen Themenbereiche in den vorhergehenden<br />
Abschnitten formuliert wurden.<br />
Die institutionalisierte programmatische Zusammenarbeit<br />
zwischen den <strong>WWF</strong>-Sektionen<br />
und dem <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> befindet sich in<br />
einer Test- und Aufbauphase. Die Erfolgsrate<br />
der gemeinsamen Projekte soll kontinuierlich<br />
gesteigert werden:<br />
• während bis Mitte 2005 70% der<br />
gemeinsam gefassten Ziele erreicht wurden,<br />
sollen es im Jahre 2009 100% sein.<br />
Wichtigste Indikatoren:<br />
Für die gesamte Zusammenarbeit: Anteil der<br />
erreichten Jahresziele. Ob die Jahresziele erreicht<br />
wurden oder nicht, wird anhand projektspezifischer<br />
Indikatoren gemessen.<br />
Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
22<br />
Erfolge im Jahr 2006/07:<br />
�Die Sektionen <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> erreichen<br />
ein breites Publikum und nehmen<br />
dadurch eine wichtige Rolle in der Öffentlichkeitsarbeit<br />
wahr: 4000 Personen nahmen<br />
an Exkursionen <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> teil. Schulbesuche<br />
in 146 Klassen brachten Kinder<br />
mit dem Thema Umwelt in Kontakt, und<br />
in der Westschweiz engagieren sich 1000<br />
Kinder in Kindergruppen <strong>des</strong> <strong>WWF</strong>.<br />
�Die Sektionen führen regelmässig Sponsorenläufe<br />
durch. Im Jahre 2006 kamen<br />
so 300000 Franken für Projekte <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />
zusammen.<br />
�Die Sektionen sind auch auf regionaler<br />
Ebene erfolgreich: der Tessiner Naturwanderweg<br />
«Sentiero Smeraldo» wird in die<br />
Kantone Wallis und Graubünden verlängert,<br />
die Schnellstrasse durch die Magadino-<br />
Ebene konnte verhindert werden, in den<br />
Wäldern <strong>des</strong> Neuenburger Juras wurden<br />
Flächen ausgedünnt, um neue Lebensräume<br />
für das Auerhuhn zu schaffen, in Genf<br />
werden neue Öko-Quartiere geplant und<br />
in Glarus, Graubünden und Wallis laufen<br />
Flussrevitalisierungsprojekte weiter.<br />
Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />
�Ab dem Geschäftsjahr 2007/08 werden<br />
die Sektionen eine massgeblichen Rolle im<br />
Inland-Programm <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> übernehmen.<br />
In vier Kernregionen (Sottoceneri,<br />
Engadin, Einzugsgebiet der Aare und Wallis)<br />
werden Projekte entwickelt und umgesetzt.<br />
Im Bereich Klimapolitik übernehmen<br />
die Sektionen das kantonale Lobbying.<br />
�Mehr Leben in den Fliessgewässern!<br />
Mit Rhein, Rhone und Linth stehen gleich<br />
drei bedeutende Flüsse an einem Wendepunkt:<br />
Geplante Umstrukturierungen erfordern<br />
eine aktive Einflussnahme der <strong>WWF</strong>-<br />
Sektionen, damit sich die ökologische<br />
Situation gegenüber dem aktuellen Stand<br />
der Planung verbessert.
Umweltschutz in der Organisation <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Umweltmanagement beim <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> setzt sich umfassend für den Umweltschutz<br />
ein. Das schliesst die Tätigkeit im eigenen Haus mit<br />
ein: Der <strong>WWF</strong> überprüft laufend, wie sich die Ökobilanz in<br />
unseren Projekten, im Verhalten der Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter und bei unserer Haustechnik verbessern lässt.<br />
Dass wir damit erfolgreich bleiben, stellt eine externe Zertifizierung<br />
sicher. Im Sommer 2007 wurde das Umweltmanagement-System<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> für weitere 3 Jahre nach der<br />
Norm ISO 14001:2004 zertifiziert.<br />
Ökobilanz <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Im Geschäftsjahr 2006/07 konnte sich der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> in<br />
fast allen umweltrelevanten betrieblichen Kennzahlen gegenüber<br />
dem bereits sehr guten Niveau der Vorjahre nochmals<br />
verbessern. Für den Bahnreiseverkehr und den Arbeitsweg<br />
wurden die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 05/06 verwendet,<br />
da sich der <strong>WWF</strong> nach Absprache mit der Zertifizierungsgesellschaft<br />
dazu entschlossen hat, diese Zahlen nur noch alle<br />
2 Jahre zu erheben, um den damit verbundenen Aufwand in<br />
vernünftigen Grenzen zu halten.<br />
Erfreulicherweise ist es uns gelungen, den Flug-Geschäftsreiseverkehr<br />
<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> auf tiefem Niveau stabil zu<br />
halten. Ein international koordiniertes Sitzungsregime und der<br />
Einsatz von alternativen Methoden zur Meetinggestaltung<br />
machen sich hier bezahlt. Die CO2-Belastung durch die verbliebene<br />
Flugreisetätigkeit wurde mit der finanziellen Unterstützung<br />
von Klimaschutzprojekten kompensiert, die dem<br />
strengen «Gold Standard» genügen.<br />
Auch der Papierverbrauch pro Mitglied, Gönner und Kunde<br />
(siehe Grafik) konnte weiter gesenkt werden. Dies ist besonders<br />
wichtig, da der externe Papierverbrauch den Löwenanteil<br />
an der Umweltbelastung durch den <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ausmacht.<br />
Betriebliche Kennzahlen <strong>WWF</strong> im Zeitvergleich<br />
Wärmeverbrauch<br />
kWh pro MitarbeiterIn (klimabereinigt)<br />
7'000<br />
6'000<br />
5'000<br />
4'000<br />
3'000<br />
2'000<br />
1'000<br />
3'506<br />
3'164 3'101<br />
2'729<br />
03/04 04/05 05/06 06/07<br />
Abfallmenge<br />
kg pro MitarbeiterIn<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
43 54 45<br />
261 257 250<br />
42<br />
196<br />
03/04 04/05 05/06 06/07<br />
Papier<br />
Kehricht<br />
Kehricht<br />
Stromverbrauch<br />
kWh pro MitarbeiterIn<br />
Die Entwicklung der betrieblichen Umwelt-Kennzahlen in den letzten vier Jahren.*<br />
1'600<br />
1'200<br />
800<br />
400<br />
323<br />
671<br />
339<br />
741<br />
72<br />
1'120 1'061<br />
Zusammensetzung der Umweltbelastung durch den <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong>.*<br />
23<br />
Umweltbelastung durch den <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Rund drei Viertel der Umweltbelastung durch den <strong>WWF</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> werden durch die Printprodukte zur Mitglieder- und<br />
Gönnerinformation und durch den Reiseverkehr verursacht.<br />
Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> veröffentlicht seine Publikationen zunehmend<br />
auf dem Internet, um zusätzlichen Informationsbedarf<br />
umweltschonend abzudecken. Der Geschäftsreiseverkehr<br />
wird mit internen Regelungen, internationalen Weisungen und<br />
der Durchführung von Telefon- und Videokonferenzen auf<br />
möglichst tiefem Niveau gehalten.<br />
* Zahlen zum Zeitpunkt der Verfassung teilweise provisorisch.<br />
74<br />
03/04 04/05 05/06 06/07<br />
Geschäftsreisen<br />
km pro MitarbeiterIn<br />
8'000<br />
7'000<br />
6'000<br />
5'000<br />
4'000<br />
3'000<br />
2'000<br />
1'000<br />
3'621<br />
2'950<br />
195 168<br />
3'919 3'009 2'986<br />
3'224<br />
3'808<br />
172<br />
3'872<br />
178<br />
03/04 04/05 05/06 06/07<br />
Papier und<br />
PE extern (Versand)<br />
57,6%<br />
Konv.<br />
Erneuerbar<br />
Flug<br />
Bahn<br />
Auto<br />
Papierverbrauch (extern+intern)<br />
kg pro Mitglied/Gönner/Kunde<br />
1.80<br />
1.60<br />
1.40<br />
1.20<br />
1.00<br />
0.80<br />
0.60<br />
0.40<br />
0.20<br />
0.00<br />
0.02<br />
1.55<br />
0.01<br />
1.17<br />
0.01<br />
0.00<br />
1.09 1.02<br />
03/04 04/05 05/06 06/07<br />
Arbeitsweg<br />
km pro MitarbeiterIn<br />
8'000<br />
6'000<br />
4'000<br />
2'000<br />
352<br />
160<br />
5'799<br />
Papier intern<br />
(Kopierer, Drucker)<br />
0,7%<br />
400<br />
235<br />
6'270<br />
449<br />
190<br />
6'900<br />
Neufaser-<br />
Papier<br />
Recycling-<br />
Papier<br />
449<br />
190<br />
6'900<br />
03/04 04/05 05/06 06/07<br />
Wärmeverbrauch<br />
(Heizung, Warmwasser)<br />
13,4%<br />
Stromverbrauch<br />
2,8%<br />
Abwasser und<br />
Kehricht<br />
2,4%<br />
Geschäftsreisen<br />
23,1%<br />
Velo/<br />
Velo/<br />
Fuss<br />
Velo/ Fuss<br />
Fuss Auto/<br />
AM Motor-<br />
Auto/ Töff<br />
fahrrad<br />
ÖV
Der <strong>WWF</strong> will der weltweiten Naturzerstörung Einhalt gebieten und eine<br />
Zukunft gestalten, in der die Menschen im Einklang mit der Natur leben.<br />
Der <strong>WWF</strong> setzt sich weltweit ein für:<br />
• die Erhaltung der biologischen Vielfalt,<br />
• die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen,<br />
• die Eindämmung von Umweltverschmutzung und schädlichem<br />
<strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Hohlstrasse 110<br />
Postfach<br />
8010 Zürich<br />
Tel. 044 297 21 21<br />
Fax 044 297 21 00<br />
service@wwf.ch<br />
www.wwf.ch<br />
Spenden: PC 80-470-3<br />
Konsumverhalten. ©<br />
<strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> 2007, © 1986 Panda-Symbol <strong>WWF</strong>, ® «<strong>WWF</strong>» und «living planet» sind vom <strong>WWF</strong> eingetragene Marken • Kom 278/07