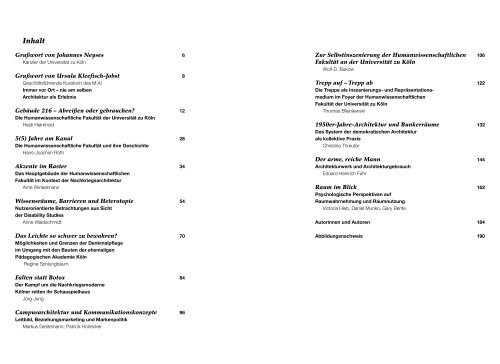Abreißen oder Gebrauchen?
978-3-86859-126-2
978-3-86859-126-2
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhalt<br />
Grußwort von Johannes Neyses 6<br />
Kanzler der Universität zu Köln<br />
Grußwort von Ursula Kleefisch-Jobst 8<br />
Geschäftsführende Kuratorin des M:AI<br />
Immer vor Ort – nie am selben<br />
Architektur als Erlebnis<br />
Gebäude 216 – <strong>Abreißen</strong> <strong>oder</strong> gebrauchen? 12<br />
Die Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln<br />
Heidi Helmhold<br />
5(5) Jahre am Kanal 28<br />
Die Humanwissenschaftliche Fakultät und ihre Geschichte<br />
Hans-Joachim Roth<br />
Akzente im Raster 34<br />
Das Hauptgebäude der Humanwissenschaftlichen<br />
Fakultät im Kontext der Nachkriegsarchitektur<br />
Arne Winkelmann<br />
Wissensräume, Barrieren und Heterotopie 54<br />
Nutzerorientierte Betrachtungen aus Sicht<br />
der Disability Studies<br />
Anne Waldschmidt<br />
Das Leichte so schwer zu bewahren? 70<br />
Möglichkeiten und Grenzen der Denkmalpflege<br />
im Umgang mit den Bauten der ehemaligen<br />
Pädagogischen Akademie Köln<br />
Regine Schlungbaum<br />
Zur Selbstinszenierung der Humanwissenschaftlichen 106<br />
Fakultät an der Universität zu Köln<br />
Wolf-D. Bukow<br />
Trepp auf – Trepp ab 122<br />
Die Treppe als Inszenierungs- und Repräsentations -<br />
medium im Foyer der Humanwissenschaftlichen<br />
Fakultät der Universität zu Köln<br />
Thomas Blisniewski<br />
1950er-Jahre-Architektur und Bunkerräume 132<br />
Das System der demokratischen Architektur<br />
als kollektive Praxis<br />
Christina Threuter<br />
Der arme, reiche Mann 144<br />
Architekturwerk und Architekturgebrauch<br />
Eduard Heinrich Führ<br />
Raum im Blick 162<br />
Psychologische Perspektiven auf<br />
Raumwahrnehmung und Raumnutzung<br />
Victoria Hieb, Daniel Munko, Gary Bente<br />
Autorinnen und Autoren 184<br />
Abbildungsnachweis 190<br />
Falten statt Botox 84<br />
Der Kampf um die Nachkriegsm<strong>oder</strong>ne<br />
Kölner retten ihr Schauspielhaus<br />
Jörg Jung<br />
Campusarchitektur und Kommunikationskonzepte 96<br />
Leitbild, Beziehungsmarketing und Markenpolitik<br />
Markus Greitemann, Patrick Honecker
6 7<br />
Grußwort von Johannes Neyses<br />
Kanzler der Universität zu Köln<br />
Wie sollen universitäre Gebäude in der Zukunft aussehen und was brauchen<br />
Menschen, um darin erfolgreich lehren, lernen, forschen und arbeiten zu<br />
können? Diesen Fragen widmete sich das 2009 von Prof. Heidi Helmhold<br />
initiierte Projekt Zurück auf Los am Beispiel des Hauptgebäudes der Humanwissenschaftlichen<br />
Fakultät der Universität zu Köln.<br />
Prof. Heidi Helmhold ist es zu verdanken, dass über rein bau- und sanierungstechnische<br />
Aspekte hinaus, die bedingt durch das Alter des Gebäudes<br />
und seine starke Beanspruchung in den zurückliegenden Jahren unvermeidlich<br />
in den Vordergrund getreten sind, sowohl der architektonische Wert des<br />
Gebäudes als auch die Frage nach den Bedürfnissen der Nutzer wieder<br />
stärker ins Bewusstsein gerückt sind. Mithilfe einer Zeitreise hat das Projekt<br />
den über Jahrzehnte verstellten Blick auf das Gebäude des Architekten<br />
Hans Schumacher und die architektonischen Besonderheiten der 1950er<br />
Jahre wieder freigegeben. Mit dem Ziel, Ideen zur künftigen Gestaltung von<br />
universitären Lehr- und Lernräumen zu gewinnen, wurden mit Zurück auf<br />
Los und dem 2010 durchgeführten Projekt Mobilität und Freiraum zugleich<br />
unsere heutigen Nutzungsgewohnheiten hinterfragt und die Sicht verschiedener<br />
wissenschaftlicher Disziplinen wie Kunst, Soziologie und Psychologie<br />
in die Frage nach den Bedürfnissen der Nutzer eingebunden.<br />
Dieser Fokus auf die Bedürfnisse der Nutzer macht einmal mehr offensichtlich,<br />
dass sich bauliche Gestaltung nicht allein an funktionalen Aspekten<br />
orientieren darf. Die Identität der Menschen, die auch durch den Zustand<br />
der Gebäude, die technischen Möglichkeiten und die Architektur beeinflusst<br />
wird, ist ein nicht zu unterschätzender Faktor – gerade für einen so differenzierten<br />
Arbeitsplatz wie die Universität. Das Bau- und Liegenschaftsmanagement<br />
einer Universität erfordert daher einen ganzheitlichen Ansatz, der<br />
Bau und Betrieb eines Gebäudes in eine Hand legt und kurzsichtige Einzelmaßnahmen<br />
durch ein Denken in Lebenszyklusmodellen ersetzt.<br />
Seit 2008 eröffnet der von der Landesregierung und der Universität zu Köln<br />
ins Leben gerufene Modellversuch zum Dezentralen Liegenschaftsmanagement<br />
der Universität zu Köln eine weitgehende Autonomie im Gebäude- und<br />
Liegenschaftsmanagement. Aufgrund des Modellversuchs, in dessen Rahmen<br />
deutlich verbesserte Lösungen für die Organisation, das Management<br />
und die Finanzierung der Planungs-, Bau- und Bauunterhaltungsaufgaben<br />
im Hochschulbereich gefunden werden sollen, ist die Universität nunmehr<br />
in der Lage, ihre Gebäude nicht nur den Bedürfnissen des Lehr- und Forschungsbetriebes<br />
an einer der größten deutschen Hochschulen entsprechend<br />
selbst zu errichten, sondern diese auch über den gesamten Lebenszyklus<br />
eigenständig und nutzerorientiert zu betreiben.<br />
Die somit größere Nähe von Bauenden und Nutzern erlaubt es, neben rein<br />
funktionalen Erwägungen, die eine nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur<br />
für Lehre und Forschung zum Ziel haben, verstärkt auch vermeintlich<br />
„weiche“ Faktoren wie die farbliche Gestaltung <strong>oder</strong> die Wahl bestimmter<br />
Materialien in die Planungsarbeit einfließen zu lassen. Das 2010 fertiggestellte<br />
Seminargebäude, das 2011 von der Bundesarchitektenkammer als<br />
einer von 20 deutschen Beiträgen für die Architekturbiennale in São Paulo<br />
ausgewählt wurde, kann sicherlich als zukunftsweisendes Beispiel für diese<br />
nachhaltigen Veränderungen gelten.<br />
Vor diesem Hintergrund ist es mehr als ein glücklicher Zufall, dass die vorliegende<br />
Publikation das facettenreiche Zusammenspiel von Bauen und<br />
Nutzen aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven gerade am Beispiel<br />
eines der zentralen Gebäude der Kölner Universität beleuchtet. Mein<br />
besonderer und herzlicher Dank gilt daher allen Autorinnen und Autoren,<br />
die mit ihren Beiträgen neue Perspektiven zu diesem Thema eröffnen, und<br />
selbstverständlich den beiden Herausgeberinnen Prof. Heidi Helmhold und<br />
Prof. Christina Threuter, die das vorliegende Buch möglich gemacht haben.
8 9<br />
Grußwort von Ursula Kleefisch-Jobst<br />
Geschäftsführende Kuratorin des M:AI<br />
Immer vor Ort – nie am selben<br />
Architektur als Erlebnis<br />
„Wir tasten das organische Raumgefüge nicht nur mit dem Auge – das es<br />
in Bilder zerlegt –, sondern durch die Bewegung mit unserer ganzen Körperlichkeit<br />
ab. Dadurch leben wir in dem Organismus, wir werden gleichsam<br />
ein Teil von ihm. Es sind doppelt sinnliche Eindrücke, die wir erleben, eine<br />
bereichernde Verbindung, die in dieser Art nur der Architektur eigen ist.“ So<br />
beschrieb Fritz Schumacher in seinem Architektonischen Handbuch 1926<br />
treffend „das bauliche Gestalten“und damit die Eigenart von Architektur. 1<br />
Ob wir einen Raum als weit <strong>oder</strong> eng, hoch <strong>oder</strong> niedrig empfinden, erfahren<br />
wir erst durch das Verhältnis zu unserer eigenen Körpergröße. Fotografien<br />
von Räumen <strong>oder</strong> Außenansichten von Bauwerken sind in diesem Punkt<br />
oft sehr verfälschend. Keine noch so brillante Fotografie, kein detailgetreuer<br />
Stich, auch nicht Raffaels wundervolle Zeichnung vom Inneren des römischen<br />
Pantheons 2 werden je die Größe und einzigartige Wirkung dieses<br />
Innenraumes vermitteln. Nähert sich der Rombesucher dem Bau von der<br />
Piazza della Rotonda aus, so erscheint das berühmte Bauwerk im Stadtgefüge<br />
nicht besonders mächtig. Betritt er jedoch durch die schmalen hohen<br />
Türen das Innere, so ist er überwältigt von der Größe. Der kreisrunde Raum<br />
hat einen Durchmesser in Tiefe und Höhe von jeweils 43,30 Metern. Was<br />
jedoch den Besucher in Staunen versetzt, ist nicht die absolute Größe, sondern<br />
die perfekte Harmonie des Gesamtraumes. Unweigerlich wandert der<br />
Blick des Betrachters hinauf zu der kreisrunden Öffnung im Kuppelscheitel,<br />
die als einzige Lichtquelle den ansonsten dunklen Raum erhellt: Die Architektur<br />
lenkt den Blick.<br />
Vor einigen Jahren hörte ich im großen Kuppelsaal des Bode-Museums zu<br />
Berlin ein kleines Mädchen zu seiner Mutter sagen: „Hier wohnt der liebe<br />
Gott.“ Die Assoziation an einen Kirchenraum drängt sich jedem Besucher<br />
trotz des mächtigen Reiterstandbildes des Großen Kurfürsten unweigerlich<br />
auf, auch wenn der Museumsbesucher wie das kleine Mädchen nicht erklären<br />
kann, welche architektonischen Elemente diesen Eindruck hervorrufen.<br />
Erhabenheit, Wohlbefinden, Ruhe, Gelassenheit, Heiterkeit, Staunen, aber<br />
auch Unwohlsein, Unbehagen, Erniedrigung, Irritation sind Empfindungen,<br />
die Gebäude beim Betrachten <strong>oder</strong> Betreten in uns auslösen. Selten sind<br />
wir uns im Alltag darüber bewusst, wie sehr unsere gebaute Umwelt unser<br />
Wohlbefinden <strong>oder</strong> Unwohlsein mitbestimmt. Dabei ist die Architektur doch<br />
unsere dritte Haut, in der wir unser ganzes Leben verbringen, von der Wiege<br />
bis zur Bahre und vom Morgen bis zum Abend.<br />
Die Studierenden der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität<br />
Köln waren sich einig, dass sie sich weder auf ihrem Campus noch in den<br />
einzelnen Räumen – dem Foyer, der Cafeteria, den Hörsälen und Arbeitsräumen<br />
– wohl fühlten. Den Lehrenden erging es nicht besser, sodass<br />
schon die negative Bezeichnung vom Balkan die Runde machte. Balkan<br />
bezeichnete nicht nur die als entlegen empfundene Lage im Verhältnis zum<br />
zentralen Campus der Universität, sondern diese Kennzeichnung brachte<br />
auch etwas Altertümliches, Zurückgebliebenes und scheinbar Unterentwickeltes<br />
zum Ausdruck. Als Schuldige für diese negativen Empfindungen<br />
wurde vor allem die Architektur der Gebäude aus den 1950er Jahren empfunden,<br />
die nicht nur als nicht mehr zeitgemäß, sondern auch als schlecht<br />
beurteilt wurde.<br />
Der Architekt der ehemaligen Pädagogischen Hochschule, Hans Schumacher,<br />
war allerdings ein im Schulbau profilierter Baumeister und sein<br />
eingereichter Wettbewerbsentwurf zeugte von einer durchdachten, klaren<br />
und gestalterisch qualitätvollen Lösung – ganz auf der Höhe seiner Zeit. Die<br />
während der Bauausführung vorgenommenen Änderungen, insbesondere<br />
jene, die auf Wunsch des damaligen Direktors ausgeführt wurden, haben<br />
den ursprüngliche Ansatz verunklärt, ihn auch teilweise seiner pointierten<br />
gestalterischen Kraft beraubt durch den Verzicht auf einige skulpturale Einzelgebäude.<br />
Dennoch ist Schumacher vor allem mit dem Hauptgebäude<br />
ein transparenter, heiterer und für die Nachkriegsarchitektur charakteristischer<br />
Bau gelungen. Was bei Studierenden und Lehrenden die negative<br />
Beurteilung auslöste, war nicht eine schlechte architektonische Gestaltung,<br />
sondern eine komplette Vernutzung der Gebäude, die den Blick auf das<br />
Ursprüngliche verstellte. Hinzu kam aber auch die Ungeübtheit der Nutzer,<br />
die positiven Charakteristika der ursprünglichen Architektur hinter riesigen<br />
Blumenkübeln, Getränkeautomaten, blinden Scheiben und verplakatierten<br />
Wänden zu sehen und ihren Zeitgeist zu verstehen.<br />
Die Aktion Zurück auf Los unter der Leitung von Helmholdt, die das Foyer<br />
von allen späteren Hinzufügungen befreite, erlaubte nach Jahrzehnten wieder<br />
einen unverstellten Blick auf die ursprüngliche Gestalt des Foyers: auf<br />
die große Transparenz des Eingangsbereichs, bewirkt durch die breite Glasfront,<br />
die gleichsam das Grün des Campus in das Gebäude holt; auf die verschiedenen<br />
Materialien und Oberflächen, die nicht nur die unterschiedlichen<br />
Funktionsbereiche des Gesamtgebäudes im Foyer bereits veranschaulichen,<br />
sondern dem Raum eine heitere und fröhliche Atmosphäre verleihen; auf die<br />
breite, mit filigranem Stabgeländer versehene, frei schwebende Treppe. Mit<br />
einem Male gewann das Foyer eine heitere, repräsentative Würde wieder,<br />
wie sie wohl kaum jemand in seinem vermüllten Zustand vermutet hatte.<br />
Damit trat auch die ursprüngliche Intention des Architekten wieder deutlich<br />
zutage: Einem öffentlichen Gebäude einen offenen, transparenten und damit<br />
– vor allem nach der Erfahrung mit der martialischen Architektur der NS-Zeit
12 13<br />
Gebäude 216 – <strong>Abreißen</strong> <strong>oder</strong> gebrauchen?<br />
Die Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln<br />
Heidi Helmhold<br />
1 Hans Schumacher,<br />
Foyer der Pädagogischen<br />
Akademie<br />
(Hauptgebäude), 1958<br />
2 Zurück auf Los: temporäre<br />
Rückversetzung<br />
des Foyers der Humanwissenschaftlichen<br />
Fakultät<br />
der Universität zu<br />
Köln in den architektonischen<br />
Erstzustand,<br />
2009<br />
Wie versteht man Architektur? Bei historischen Gebäuden mag das einfach<br />
sein, Architekturführer helfen hier weiter. Bei spektakulären Bauten sogenannter<br />
Stararchitekten gibt es Rezensionen für die Community. Aber wie<br />
versteht man eine Architektur in der man lebt und arbeitet? Das Bauen und<br />
die Nutzung von Architektur liegen selten in einer Person. Bauherren schildern<br />
ihren Architekten die Bauaufgabe, letztlich aber liegt die gestalterische<br />
Hoheit beim Architekten. Nach Fertigstellung eines Baues ziehen Architekten<br />
weiter, zum nächsten Auftrag und zum nächsten Bau. Ob eine Architektur<br />
funktioniert <strong>oder</strong> ob sie nicht funktioniert, wie man sie optimieren <strong>oder</strong> grundsätzlich:<br />
Wie man sie verstehen kann - räumlich, körperlich, sozial, ästhetisch,<br />
funktional - ist den Nutzerinnen und Nutzern überlassen. Die werden<br />
im Laufe der Zeit zu Expertinnen und Experten, selten jedoch kann dieses<br />
Wissen ihnen selbst <strong>oder</strong> anderen zum Instrument werden.<br />
Für das Gelingen <strong>oder</strong> Scheitern einer Baunutzung sind komplexe Prozesse<br />
verantwortlich. Viel zu wenig wird dabei eben dieses Expertenwissen von<br />
Nutzerinnen und Nutzern beachtet, das dem Expertenwissen von Architekten<br />
nicht nachstehen muss und dementsprechend zurecht gefragt werden<br />
kann, wer eigentlich der Autor bzw. der Produzent einer Architektur ist. 1 Im<br />
Grunde kommt jede Nutzung von Architektur einer Evaluierung gleich, nur<br />
gibt es dafür keine Kommunikationsstrukturen, keine Rückkoppelung und<br />
keine Auswertung.<br />
Im Falle einer Fakultät, um die es in diesem vorliegenden Band gehen wird,<br />
kann dies bedeuten, dass sich die Lehrenden und die Studierenden jahrelang<br />
in einem hässlichen und peinlichen Bau wähnen, ohne die spezifische<br />
(Nicht-)Beziehung der NutzerInnen zu ihrem Bau in den Blick zu nehmen.<br />
Diese Un-Beziehung war neben anderen Faktoren auch dafür verantwortlich,<br />
dass die Optik dieses Gebäudes über Jahre hinweg vermüllte und verkramte,<br />
dass erweiterte Körper/Raumkonzepte nicht integriert wurden, dass die<br />
funktionale und ästhetische Infrastruktur nicht mehr zu erkennen war. Das<br />
Potenzial an M<strong>oder</strong>nität konnte weder in Erscheinung treten, noch wissenschaftspolitisch<br />
kommuniziert werden - in Zeiten von Exzellenzinitiativen eine<br />
nicht unwesentliche universitäre Aufgabe.<br />
Das vorliegende Buch versammelt Perspektiven auf eine NutzerInnen-<br />
Architekturbeziehung am Beispiel der Humanwissenschaftlichen Fakultät<br />
der Universität zu Köln. Sie befindet sich am nördlichen Rand des Universi-
20 21<br />
Die Beiträge<br />
Einige Beiträge des vorliegendes Bandes sind während des dreimonatigen<br />
Foyerprojektes in ihren Fragestellungen überhaupt erst generiert worden:<br />
Körper und Raum, Aspekte der Denkmalpflege, architekturhistorische Bezüge,<br />
Positionierung in der Wissensgesellschaft, der erfolgreiche Kampf gegen<br />
den Abriss des Kölner Schauspielhauses sowie eine kritische Gegenlesung<br />
zum Begriff der demokratischen Architektur. Zusammen mit den universitätsinternen<br />
Beiträgen, wie dem des Dezernats für Bauen und Entwicklung,<br />
dem derzeit amtierenden Dekan Hans-Joachim Roth und des Teams um<br />
den Kollegen Gary Bente aus der Psychologie, ergibt sich ein dichtes Volumen<br />
von Positionen und Perspektiven mit einem großen Potenzial für<br />
Anschlussfragestellungen. Für die Offenheit von Kanzler Dr. Neyses und des<br />
damaligen Dekans Herrn Prof. Dr. Kaul, den Kolleginnen und Kollegen, den<br />
Studierenden und dem Gebäudemanagement möchte ich an dieser Stelle<br />
ausdrücklich danken. Mein Dank geht auch an Frau Dr. Kleefisch-Jobst vom<br />
M:AI, die das Projekt nicht nur finanziell sondern konzeptionell beraten und<br />
gefördert hat. Und besonderen Dank den Autorinnen und Autoren der Beiträge,<br />
die sich auf einen Bau eingelassen haben, den abzureißen man 2008<br />
immerhin noch diskutieren wollte.<br />
Hans Joachim Roth zeichnet die Entwicklung und Struktur der heutigen<br />
Humanwissenschaftlichen Fakultät aus ihren institutionellen Anfängen der<br />
Pädagogischen Akademie nach. Diese war eine vom damaligen Bildungsministerium<br />
eng geführte Ausbildungsstätte für Grund- und Volksschullehrer,<br />
die als Bildnerhochschule bewusst auf wissenschaftliche und forschungsbasierte<br />
Lehre verzichtete. Mitte der 1950er Jahre erst wurde den DozentInnen<br />
der Pädagogischen Akademien Lehrfreiheit zugestanden. 1962 wurden die<br />
Pädagogischen Hochschulen eingerichtet und erhielten 1964 die Anerkennung<br />
des Forschungsauftrages.<br />
1968 erteilte das Ministerium für die Pädagogische Hochschule Rheinland<br />
das Habilitationsrecht und 1970 das Promotionsrecht. Die Studierendenzahlen<br />
entwickelten sich stark, die Einstellung des wissenschaftlichen Personals<br />
hingegen erfolgte disproportional. Dieses Missverhältnis hat sich auch nach<br />
der Integrierung der PH in die Universität nicht geändert und führte zu einer<br />
fakultätsspezifischen Streik- und Protestkultur der Studierenden – so war<br />
der erste Streik kurz nach der Gründung der PH im Jahre 1962, der bisher<br />
letzte im Rahmen des Bildungsstreiks im Jahre 2008.<br />
Arne Winkelmann erläutert den Wettbewerbsentwurf der Pädagogischen<br />
Akademie von Hans Schumacher, der Ende Juli 1954 unter 16 eingereichten<br />
Entwürfen den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Einige<br />
Merkmale dieses Entwurfes – Rotunden, gläserne Verbindungsgänge, Rasterfassaden,<br />
Loggien, die Gestaltung von Dachlandschaften und eine lockere<br />
Bebauung, die im Gegensatz zur Blockbebauung der Vorkriegszeit stand<br />
– ließen die Handschrift einer architektonischen M<strong>oder</strong>ne erkennen, wie sie<br />
zum Beispiel von Le Corbusier <strong>oder</strong> der US-amerikanischen Ingenieurbaukunst<br />
vorgeprägt worden war. Schumacher konnte nicht alle Entwurfselemente<br />
umsetzen, hat allerdings in den 1960er Jahren weitere Gebäude für<br />
den Campus entworfen und gebaut. Der Einsatz von Materialien und Farben<br />
– insbesondere im Foyer wie aber auch an den Außenfassaden – stand im<br />
Kontext von Innovationen in der damaligen Baukeramik und im Produktdesign;<br />
im Foyer allein sind insgesamt 17 Farben und Materialien verbaut<br />
worden. Zu den wichtigsten bautechnologischen Innovationen der 1950er<br />
Jahre zählen Glasbausteine, die auch in dieser Fakultät zum Einsatz kamen<br />
und die für eine Durchlichtung der Gänge hätten sorgen können, wären<br />
sie nicht im Laufe der Jahre büroseitig durch Regale verstellt worden. Arne<br />
Winkelmann würdigt den Bau als einen typischen Bau der 1950er Jahre und<br />
stellt die Leistung Schumachers in Beziehung zu anderen Kölner Architekten<br />
seiner Zeit.<br />
Anne Waldschmidt analysiert den universitären Wissensraum der<br />
ehemaligen Heilpädagogischen Fakultät – das heutige Gebäude 213, ebenfalls<br />
von Schumacher gebaut und heute der Humanwissenschaftlichen<br />
Fakultät zugeordnet – als einen Raum der Spezialdiskurse innerhalb einer<br />
wissenschaftlichen Leitkultur, die jedoch an ihren Rändern immer auch<br />
Heterotopien produziert. Heterotopien sind anderen Orte, an denen nach<br />
Foucault auch anderes Wissen produziert wird, das aus Sicht der Spezialdiskurse<br />
ein unzureichendes und darin zu disqualifizierendes Wissen<br />
darstellt. Das kritische Potenzial des heterotopischen Wissens wird mit den<br />
Instrumenten der Spezialdiskurse niedergehalten und darin gewissermaßen<br />
den herrschenden Wissensdiskursen unterworfen. Anne Waldschmidt liest<br />
das Gebäude 213 aus eben der Perspektive des anderen Wissens, das in<br />
diesem Fall einen anderen Raum mit anderen Körpern produziert. So konfrontiert<br />
sie potentielle NutzerInnen des Gebäudes mit der Frage, wie ein<br />
Mensch mit Behinderung die Stufen zum Gebäude 213 überwinden soll,<br />
ist diese doch auf einen Normkörper ausgelegt und gibt keinerlei Hinweise,<br />
wie NutzerInnen mit Rollstuhl <strong>oder</strong> Gehhilfen in das Gebäude gelangen<br />
können. Unter dem Aspekt, dass in diesem Gebäude das Department für<br />
Heilpädagogik untergebracht ist, erscheint das Fehlen von Barrierefreiheit<br />
besonders markant und wird von Anne Waldschmidt aus der Sicht der<br />
Disability Studies befragt und diskutiert.<br />
Regine Schlungbaum hält ein Plädoyer für den Bau der Fakultät aus<br />
Sicht der Denkmalpflege. Architekturen zu erhalten hat grundsätzlich seine<br />
Voraussetzungen darin, dass diese Zeugen gesellschaftlicher Wünsche und<br />
Konditionen der Zeit sind, in der sie gebaut worden sind. Ein öffentliches<br />
Gebäude erzählt dabei von politischen Zielen, die sich in der jeweiligen<br />
Baukultur zum Ausdruck bringen. Der Fakultätsbau erfüllte dabei eine charakteristische<br />
Bauaufgabe der 1950er Jahre, die im Zuge der Neuordnung
28 29 5(5) Jahre am Kanal<br />
5(5) Jahre am Kanal<br />
Die Humanwissenschaftliche Fakultät<br />
und ihre Geschichte<br />
Joachim Roth<br />
Die Humanwissenschaftliche Fakultät wurde 2007 im Zuge einer Fakultätsumbildung<br />
gegründet. Die Erziehungswissenschaftliche Fakultät wurde mit<br />
der Heilpädagogischen Fakultät zusammengelegt, verbunden mit einem<br />
Austauschprozess mit den anderen lehrerbildenden Fakultäten: Die Fachdidaktiken<br />
wanderten in die jeweils fachlich zuständige Fakultät, das heißt in<br />
die Mathematisch-Naturwissenschaftliche und die Philosophische Fakultät.<br />
Im Gegenzug wurden die pädagogischen und psychologischen Institute<br />
in der neuen Humanwissenschaftlichen Fakultät zusammengeführt. Eine<br />
Reihe von Integrationsprozessen sind abgeschlossen, die begleitenden<br />
Probleme beseitigt – nach wie vor aber sitzen die meisten der Lehrenden in<br />
den Gebäuden der alten Zugehörigkeiten. Die Neuorientierung von Bauten<br />
braucht anscheinend länger als die von Menschen.<br />
Die heutige Humanwissenschaftliche Fakultät bzw. ihre Gebäude haben<br />
eine Geschichte, über die sich die Geschichte der LehrerInnenausbildung<br />
seit Ende des Zweiten Weltkriegs nachverfolgen lässt. Am 10. November<br />
1946 wurde eine Pädagogische Akademie gegründet – zunächst untergebracht<br />
in einem Schulgebäude in Köln-Vogelsang. Es wurde im ersten Jahr<br />
lediglich ein einjähriger Notlehrgang angeboten, zu dem bei 15 Lehrenden<br />
196 Studierende zugelassen wurden, bei zahlenmäßig gleicher Verteilung<br />
der Geschlechter: 99 Männer und 97 Frauen. Ab dem folgenden Jahr erstreckte<br />
sich der Ausbildungsgang auf vier Semester – von Studium im<br />
üblichen Sinne ließ sich noch längere Zeit nicht sprechen. Damals gab es<br />
noch keine juristisch limitierenden Probleme in der Steuerung der Zulassung<br />
wie heute. Solche Dinge wurden schlichtweg im Ministerium entschieden.<br />
Einen Numerus Clausus gab es auch schon ab dem Beginn der regulären<br />
Ausbildung. Er betraf allerdings die weiblichen Bewerberinnen, was<br />
zeigt, dass der Beruf der Lehrerin – im Fall der Pädagogischen Akademie<br />
für Grund- und Hauptschulen – bereits stark „feminisiert“ war. 1<br />
Die Studierenden entstammten weitgehend Familien der unteren und mittleren<br />
Beamten- bzw. Angestelltenschicht <strong>oder</strong> Bauern- und Handwerkerfamilien;<br />
nur 7,7 Prozent der Studierenden kamen aus der oberen Mittelschicht. 2<br />
Das Abitur war keine Voraussetzung: Mehr als ein Drittel der Studierenden<br />
verfügte über eine Mittlere Reife bzw. einen Volksschulabschluss.<br />
Der konzeptionelle Hintergrund der damals neuen Ausbildung von Lehrerinnen<br />
und Lehrern hängt eng mit dem Gedankengut der Reformpädagogik<br />
zusammen: Eine Bildnerhochschule sollte die Akademie sein, keine wissenschaftliche<br />
Institution. In Verkennung des Akademieverständnisses Friedrich<br />
Schleiermachers, der bei der Akademie als der Begegnungsstätte der<br />
„Meister unter sich“ eher an die Akademie Platons in Athen dachte als an<br />
eine durch ein Ministerium streng geführte Ausbildungsstätte für Grund- und<br />
Volksschullehrkräfte, und ohne Berücksichtigung der durchaus engen Verbindung<br />
von Teilen des reformpädagogischen Gedankenguts mit dem der<br />
nationalsozialistischen Pädagogik 3 bezog man sich auf ein Verständnis von<br />
Bildung, das aus der direkten personalen Begegnung von Erzieher und Zögling<br />
hergeleitet wurde, wie es seit Herman Nohls Fassung des „pädagogischen<br />
Bezugs“ kanonisch geworden ist. Eingebettet in einen emphatischen<br />
Begriff des Lebens knüpfte man geradewegs an Vorstellungen der Jugendbewegung<br />
an, wonach Erziehung und Bildung in Gemeinschaft und Heimat<br />
erfolgt und mit den angeblich natürlichen Äußerungsformen des Volkes in<br />
Lied, Tanz und Spiel das Rückgrat der Menschenbildung darstellt. In der<br />
Kölner Akademie war das Verständnis einer ganzheitlichen und individuellen<br />
Bildung der Lernenden zudem strikt katholisch gebunden.<br />
Unterrichtet wurden Pädagogik, Psychologie und Methodik; letzteres war<br />
auf die Unterrichtsfächer bezogen und wurde später durch (Fach-)Didaktik<br />
ersetzt. Die Akademie hatte „Anstaltscharakter“ 4 , die Gesinnung hatte<br />
Vorrang vor dem Wissen: So wurden zum Beispiel Studierende nur bei<br />
„sittlichem Verhalten“ zur Prüfung zugelassen; dieses war über ein positives<br />
Gutachten einer Dozentin <strong>oder</strong> eines Dozenten nachzuweisen. 5<br />
Nach dem Nationalsozialismus blieben die Akademie und die dortige Ausbildung,<br />
fest im Griff des Ministeriums, zwischen 1947 und 1954 in Person<br />
der resoluten Kultusministerin Christine Teusch. Dozentinnen und Dozenten<br />
wurden von dort eingesetzt. Sie mussten ihre Vorlesungsmanuskripte einreichen<br />
und prüfen lassen und zwölf bis 15 Wochenstunden unterrichten. Als<br />
Prüfungsordnung wurde eine preußische Fassung von 1928 reaktiviert. Trotz<br />
aller Bemühungen scheiterte der Versuch einer entnazifizierten Lehrerausbildungsstätte:<br />
mangels Masse ließ man im Laufe der Jahre Dozentinnen und<br />
Dozenten zu, deren Beteiligung an der nationalsozialistischen Pädagogik<br />
bekannt war, zum Teil auch erst später aufgedeckt wurde.<br />
Nach dem Amtswechsel im Kultusministerium wurde 1954 zu einem Datum,<br />
das einige Veränderungen mit sich brachte: Zwar erhielten die Akademien<br />
(noch) keinen Status als wissenschaftliche Institution, wurden aber immer-
34 35 Akzente im Raster<br />
Akzente im Raster<br />
Das Hauptgebäude der<br />
Humanwissenschaftlichen Fakultät im<br />
Kontext der Nachkriegsarchitektur<br />
Arne Winkelmann<br />
Das Gebäudeensemble der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität<br />
Köln wurde von 1955–1957 nach den Plänen des Kölner Architekten Hans<br />
Schumacher errichtet. Das heutige Hauptgebäude beherbergte damals die<br />
Pädagogische Akademie, während das derzeitige IBW-Gebäude (Institut für<br />
Berufs- und Wirtschaftspädagogik) ursprünglich das Berufspädagogische<br />
Institut aufnahm. 1<br />
Zur Vorgeschichte: Die Pädagogische Akademie Köln war bereits im November<br />
1946 gegründet worden, um dem großen Mangel an ausgebildeten<br />
Volksschullehrern, der sich durch die Verluste des Krieges ergeben<br />
hatte, entgegenzuwirken. Zunächst musste die Akademie provisorisch in<br />
Räumen der Schule am Vogelsanger Markt untergebracht werden. Bereits<br />
1949 wurden mit dem zuständigen Oberpräsidium der Nordrheinprovinz<br />
Verhandlungen über die Errichtung eines Neubaus geführt. Nachdem<br />
die Landesregierung hierzu ihre Bereitschaft bekundet hatte, wurde seitens<br />
des Direktoriums ein umfassendes Raumprogramm erstellt. Da das<br />
Berufspädagogische Institut gleichfalls einen Neubau beantragt hatte,<br />
wurde entschieden, die beiden Einrichtungen zusammenzulegen. 2 Für die<br />
Pädagogische Akademie und das Berufspädagogische Institut wurde ein<br />
Gesamtgeländebedarf von 39.000 Quadratmetern ermittelt, wobei die Errichtung<br />
künftig notwendiger Erweiterungsbauten möglich sein sollte. Das<br />
Raumprogramm war an jeder Einrichtung für 400 Studierende ausgelegt. 3<br />
Auf dieser Grundlage suchte die Landesregierung nach einem geeigneten<br />
Grundstück, für das die Stadt Köln das heutige Grundstück zwischen<br />
Aachener und Dürener Straße kostenfrei anbot. 1952 stellte die Landesregierung<br />
die erforderlichen Mittel für die Planung und Realisierung eines<br />
Neubaus zur Verfügung und lobte im Februar 1954 einen entsprechenden<br />
1 Hans Schumacher:<br />
Lageplan<br />
Architektenwettbewerb für eine Pädagogische Akademie und ein Berufspädagogisches<br />
Institut aus. 4<br />
Insgesamt hatten 16 überwiegend Kölner Architekturbüros Entwürfe zum<br />
Wettbewerb eingereicht. 5 Ende Juli 1954 konnte Hans Schumacher mit seinem<br />
Entwurf den Wettbewerb für sich entscheiden. 6<br />
Der Wettbewerbsentwurf<br />
Das Ensemble des Wettbewerbsentwurfes bestand aus sechs Gebäuden,<br />
die, bis auf das L-förmige Gebäude des Studentenwohnheims (G), durch<br />
einen langen Glasgang miteinander verbunden werden sollten. Zwischen<br />
den dominierenden Gebäuderiegeln der beiden Institute (A und E) schlossen<br />
sich an den Glasgang eine Mensa (B), eine Aula (C) und eine kleine Bibliothek<br />
mit Lesesaal (D) an. Westlich der Pädagogischen Akademie mündete<br />
der Glasgang in eine Turnhalle (F). Die Orientierung der Gebäude war durch<br />
die Aufgabenstellung vorherbestimmt, die vorsah, alle Unterrichts- und Seminarräume<br />
nach Osten <strong>oder</strong> Westen auszurichten. 7 Der Glasgang fungierte<br />
als Erschließungsachse, als architektonisches Rückgrat der Anlage (Abb. 1).<br />
Zentrale Elemente des Entwurfs waren die beiden Riegel für das Berufspädagogische<br />
Institut und die Pädagogische Akademie. Diese vier Stockwer-
54 55 Wissensräume, Barrieren und Heterotopie<br />
Wissensräume, Barrieren<br />
und Heterotopie<br />
Nutzerorientierte Betrachtungen<br />
aus Sicht der Disability Studies<br />
1 Gebäude 213, Department<br />
Heilpädagogik<br />
und Rehabilitation,<br />
Humanwissenschaftliche<br />
Fakultät der Universität<br />
zu Köln, 2011<br />
Anne Waldschmidt<br />
Gebäude 213 – eine Annäherung 1<br />
Nähert man sich auf dem Campus der Humanwissenschaftlichen Fakultät<br />
der Kölner Universität dem – mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden<br />
– Gebäude 213, so fällt zunächst das Kastenförmige ins Auge: Man sieht<br />
inmitten von Grünanlagen einen fast quadratischen, zweistöckigen Baukörper<br />
mit Flachdach, weiß gekachelten Außenwänden und einer zweireihigen<br />
Front von Panoramafenstern, unverkennbar aus den 1950er Jahren stammend,<br />
an die Konzepte der m<strong>oder</strong>nen, rationalen Architektur der Weimarer<br />
Republik anknüpfend. Ursprünglich errichtet als Teil eines Gebäudeensembles<br />
für die damalige Pädagogische Hochschule, hat der Bau mehr als 25<br />
Jahre lang die Heilpädagogische Fakultät 2 der Universität beherbergt, bevor<br />
er im Zuge universitärer Umstrukturierungen 3 ab 2007 zum Gebäude des<br />
Departments Heilpädagogik und Rehabilitation wurde.<br />
Gebäude 213 zeigt sich auf den ersten Blick eher zurückhaltend und bescheiden,<br />
ja unscheinbar und schmucklos. Tatsächlich hat das Bauwerk<br />
aber ein Merkmal, das umso prominenter ins Auge fällt, je näher man dem<br />
Eingang kommt: Eine zweiläufige Freitreppe mit Zwischenabsatz, umrahmt<br />
und geteilt von Metallgeländern, bildet den Zugang zu einem Vorbau, dessen<br />
Glastüren Offenheit und Zugänglichkeit signalisieren.<br />
Indes lässt sich, will man der Aufforderung folgen, der Zutritt zum Gebäude<br />
nicht so ohne Weiteres bewerkstelligen: Die Außentreppe macht einen<br />
erhöhten Kraftaufwand, das Steigen von Stufen nötig; als Gestaltungsmerkmal,<br />
dem weder optisch noch funktional ausgewichen werden kann,<br />
signalisiert sie den Nutzerinnen und Nutzern, dass es sich bei Gebäude<br />
213 eben nicht um ein unbedeutendes Bauwerk handelt.<br />
Mag es auch pragmatische Gründe für die Wahl eines treppenförmigen<br />
Eingangs gegeben haben, dafür spricht das Hochparterre des Bauwerks,<br />
so hat sich doch der Architekt zugleich auch einer „Würdeformel“ 4 bedient<br />
und damit die repräsentative Funktion des Gebäudes unterstrichen. Für<br />
die Treppe allgemein gilt, dass sie mitnichten eine banale architektonische<br />
Bauform ist, lediglich dafür konstruiert, um Höhenunterschiede zu überwinden;<br />
vielmehr übt sie „als Seh-Form und natürlich auch Geh-Form (…)<br />
eminent symbolische Funktionen aus“, kurz, sie ist immer auch ein „Symbol<br />
der Macht. Treppen sind ideal geeignet, Hierarchien zu verdeutlichen und<br />
Rangunterschiede zum Ausdruck zu bringen.“ 5 (Abb. 1)<br />
Bescheidenheit und Repräsentativität: Ganz offensichtlich haben diese beiden<br />
Aspekte die Formensprache von Gebäude 213 geprägt und zu einer<br />
Doppelbödigkeit seiner Anmutung geführt. Einerseits an Rationalität und<br />
Zweckmäßigkeit orientiert, andererseits auf das traditionelle Treppenmotiv<br />
als „Inszenierungs- und Repräsentationsmedium “6 zurückgreifend, schafft<br />
die Architektur einen Ort, der seinen Nutzerinnen und Nutzern Teilhabemöglichkeiten<br />
und somit Inklusion verspricht wie gleichzeitig auch Exklusivität,<br />
den Zugang 7 zu einem besonderen Raum, dem der Universität.<br />
Wissensraum Universität<br />
In anderen Worten: Gebäude 213 materialisiert und markiert eine „Topie “8<br />
des Wissens. Ob geografische Räume wie etwa Europa, das im Zuge der<br />
Bildungs- und Forschungspolitik der Europäischen Union seit der Bologna-<br />
Erklärung 1999 mehr und mehr zu einem deutlich konturierten Wissensraum<br />
geworden ist, ob Museen als öffentlich zugängliche Orte der Sammlung und<br />
Zurschaustellung von Wissensobjekten, ob Bibliotheken als Einrichtungen<br />
zur Sammlung, Aufbewahrung und Nutzung von Schriftgut, ob das Internet,<br />
das der Weltgesellschaft als virtueller Raum nicht nur der Kommunikation,<br />
sondern auch der Wissensproduktion und -distribution dient, <strong>oder</strong> nicht zuletzt<br />
die Universität, die als Wissenseinrichtung schlechthin gilt und die Aufgabe<br />
hat, mittels Forschung und Lehre der wissenschaftlichen Erkenntnis zu<br />
dienen: Sowohl Produktion und Vermittlung als auch Aneignung von Wissen
70 71 Das Leichte so schwer zu bewahren?<br />
Das Leichte so schwer<br />
zu bewahren?<br />
Möglichkeiten und Grenzen der Denkmalpflege<br />
im Umgang mit den Bauten der ehemaligen<br />
Pädagogischen Akademie Köln<br />
Regine Schlungbaum<br />
Architektur erzählt. Wenn wir es uns zur Aufgabe machen, ihre Sprache<br />
verstehen zu lernen, berichtet sie uns von Auffassungen und Bedingungen<br />
ihrer Entstehungszeit, über Entwicklungen, Entscheidungen, Verwerfungen.<br />
Sie erzählt Geschichte an einem bestimmten Ort, von einer bestimmten Zeit<br />
und deren typischen Aufgaben sowie von den jeweils handelnden Personen.<br />
Als Raum nehmendes und Raum gebendes Behältnis für spezielle Zwecke<br />
der menschlichen Gesellschaft besitzt sie Aussagekraft über Wünsche,<br />
Ziele und Bedingungen, über gesellschaftliche Verfassung und politisches<br />
Verständnis, über Kontinuitäten und Brüche. Sie ist Materie gewordene<br />
Idee, wie eine gesellschaftliche <strong>oder</strong> individuelle Aufgabe zu ihrer Erfüllung<br />
dreidimensional gefasst wird. Dabei spielen Auftraggeber (Bauherrin/Bauherr),<br />
Auftragnehmer (Architektin/Architekt) sowie der Stand der Technik, die<br />
gesetzlichen Vorschriften und der finanzielle Rahmen wesentliche Rollen.<br />
Dies alles ist in dem gebauten Werk enthalten. Hieraus erwächst in späterer<br />
Zeit das Interesse, sich mit diesen Eigenschaften auseinanderzusetzen und<br />
dabei zunächst oft verkannte und bei näherem Hinschauen aus historischer<br />
Distanz deutlich wahrnehmbare Strukturen und Qualitäten zu entdecken. 1<br />
Das Bauwerk lässt sich in geschichtliche Zusammenhänge einordnen. Dies<br />
ist der erste Schritt. Der zweite liegt darin, das Erkannte zu vermitteln und<br />
damit die Voraussetzung zu schaffen, es zu bewahren. Mit dieser Aufgabe<br />
sind Denkmalschutz und Denkmalpflege betraut. In der vertiefenden Auseinandersetzung<br />
mit dem baulichen Erbe klärt sich dann, welche Werke die<br />
Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfüllen. 2<br />
Der Baukomplex der ehemaligen Pädagogischen Akademie wurde mit der<br />
zwischen den Bauten liegenden Freifläche am 19. Oktober 2004 in die<br />
Denkmalliste der Stadt Köln eingetragen und damit unter Schutz gestellt.<br />
Dem vorausgegangen waren die eingehende Prüfung des Denkmalwertes<br />
sowie die Erstellung eines Gutachtens. 3 Die Bauten wurden auch in die zeitlich<br />
parallel laufende Neubearbeitung des DEHIO-Handbuchs der deutschen<br />
Kunstdenkmäler aufgenommen. 4<br />
Als baukulturelles Erbe der Aufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentieren<br />
die Bauten der ehemaligen Pädagogischen Akademie Köln eine<br />
charakteristische Bauaufgabe der jungen Bundesrepublik Deutschland 5<br />
sowie deren zeittypische architektonische Lösung. Dabei zeigt der nach<br />
Entwürfen des Kölner Architekten Hans Schumacher (1891–1982) in mehreren<br />
Bauphasen errichtete Komplex architekturgeschichtliche Entwicklungsstufen<br />
von den Wettbewerbsplänen aus der ersten Hälfte der 1950er<br />
Jahre bis in die späten 1960er Jahre an (vgl. Abbildungen im Beitrag von<br />
Arne Winkelmann).<br />
Betritt man den Campus, so lassen sich zwei Arten von Baukörpern erkennen:<br />
Zum einen die in Rasterbauweise errichteten, lang gestreckten Bauten,<br />
die die Grünfläche nach Osten und Westen begrenzen. Ihre Konstruktionsweise<br />
ist am Außenbau offen ablesbar; tragende (Stützen, Decken) und<br />
nicht tragende (Brüstungen, Fenster) Elemente wurden sichtbar definiert.<br />
Zum anderen die beiden geschlossen wirkenden Baukuben mit keramisch<br />
verkleideten Wänden und bündig eingebauten großen Fenstern.<br />
Bei der erstgenannten Kategorie, den Institutsgebäuden der ehemaligen<br />
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät (EWF, heute Gebäude 216 Bauteil<br />
A) und des Instituts für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (IBW, heute Gebäude<br />
211), die aus dem Wettbewerbsbeitrag hervorgegangen waren, zeigt<br />
sich durch die Offenheit der Konstruktion eine gewisse plastische Ausbildung<br />
der Außenhaut: Die im Rastermaß von sechs Metern gereihten Stützen<br />
bilden zusammen mit den Geschossdecken hervorstehende Rahmen<br />
für die zurückgesetzten Felder, die aus mit Fliesen verkleideten Brüstungen<br />
und darauf sitzenden großen, mehrteiligen Fenstern bestehen. Die quer<br />
gestellten Hörsäle, als aufgeständerte Baukörper mit ansteigenden Fensteröffnungen<br />
(IBW) und mit konvexer Abschlusswand (EWF) ausgeführt, geben<br />
den Rasterbauten einen dynamischen Impuls. 6<br />
Von anderer Art sind die in den 1960er Jahren ausgeführten Gebäude. Bei<br />
der südlich der Langbauten in der Achse der großen Grünfläche errichteten<br />
Heilpädagogischen Fakultät sowie dem durch einen verglasten Gang mit<br />
dem EWF-Gebäude verbundenen Aula- und Bibliotheksgebäude werden die<br />
Seiten des Rechteckkubus jeweils in ihrer Flächigkeit betont.<br />
Der weitgehend originale Erhalt der Architektur sowohl in ihren Großformen<br />
der beschriebenen Strukturmerkmale als auch die bauzeittypischen<br />
Ausstattungen begründen die Denkmaleigenschaft. Wie es um die Möglichkeiten<br />
steht, die Bauten zu schützen und sie als Dokumente der Nachkriegsm<strong>oder</strong>ne<br />
an nachfolgende Generationen weiterzugeben, wird im<br />
Folgenden erläutert.<br />
Das gesetzlich verankerte Schutzziel für Baudenkmäler 7 steht in der Praxis<br />
im Spannungsfeld eines Geflechts von Forderungen anderer Rechtsvor-
76 77 Das Leichte so schwer zu bewahren?<br />
4 Treppe im ehemaligen<br />
IBW-Gebäude, noch<br />
ohne sicherheitstechnische<br />
Zutaten, 2011<br />
5 Nordseite des ehemaligen<br />
IBW-Gebäudes:<br />
partieller Austausch von<br />
Fliesen, 2011<br />
stellt sich in Baudenkmälern häufig als nicht zum Ziel führend (Brandschutz<br />
im Baudenkmal) dar: Dies gelänge oft nur durch erhebliche Substanzeingriffe.<br />
Dabei könnten solche Bauteile <strong>oder</strong> Strukturen zerstört werden, die<br />
den Denkmalwert mit konstituieren. In solchen Fällen werden Maßnahmen<br />
zur Kompensation durchgeführt: Es geht darum, die Brandausbreitung zu<br />
verhindern und dies kann durch Früherkennung mit einer flächendeckenden<br />
Brandmeldeanlage ebenso erreicht werden. Je nach Deckengestaltung sind<br />
die Brandmelder mehr <strong>oder</strong> weniger störend, auf jeden Fall aber das kleinere<br />
Übel im Vergleich zu größeren baulichen Abschottungen. Bei den Gebäuden<br />
der Humanwissenschaftlichen Fakultät wird eine solche Abweichung<br />
sowohl vom Brandschutz als auch vom Denkmalschutz für sinnvoll erachtet<br />
und umgesetzt.<br />
Ein weiteres Charakteristikum der architektonischen Gestaltung der<br />
1950er Jahre ist der Bauteil Treppe (Abb. 4). Dieses bauzeittypische<br />
Architekturelement unterliegt nach geltender Gesetzgebung der arbeitsschutzrechtlichen<br />
Gefährdungsprüfung. Da es um Sicherheit von<br />
Personen geht, sieht das Arbeitsschutzgesetz bei Missachtung nicht nur<br />
ordnungsrechtliche Schritte vor, sondern unter bestimmten Voraussetzungen<br />
auch strafrechtliche. Damit ist klar, dass sich der Denkmalschutz<br />
nicht grundsätzlich gegen Forderungen des Arbeitsschutzes wehren<br />
kann. Vielmehr ist er aufgefordert, zusammen mit den anderen am Baugeschehen<br />
beteiligten und verantwortlichen Personen sowie den für den<br />
Arbeitsschutz zuständigen Stellen des Landes gestalterische Lösungen<br />
zu finden, die denkmalverträglich sind und den Anforderungen des Arbeitsschutzes<br />
genügen.<br />
Neben einer Vielzahl von Regelungen sind in den Verordnungen zum Arbeitsschutz<br />
auch die Höhen von Brüstungen und Geländern sowie die maximalen<br />
Zwischenräume festgelegt. Für die Treppe im IBW-Gebäude bedeutet<br />
dies, die Abstände der originalen Flachstäbe durch Montage dreier zusätzlicher<br />
Kniestangen zu verringern.<br />
Da die horizontale Betonung nicht durch Vertikalelemente gestört werden<br />
darf, der Arbeitsschutz aber eigentlich Senkrechtstäbe vorsieht, bedurfte<br />
diese Alternative der gesonderten Anerkennung durch die Landesunfallkasse.<br />
Eine weitere Forderung besteht darin, das Geländer zu erhöhen, um es<br />
möglichst ungeeignet für ein Überklettern zu machen. Hierzu werden die<br />
Pfosten nach oben verlängert und ein zusätzlicher Obergurt in Form eines<br />
Flachstahls aufgelegt. Die originale Treppe bleibt erhalten, die charakteristische<br />
Horizontallagerung mit dem typischen Handlauf aus einem starken<br />
Holzbrett erfährt eine Ergänzung durch neue Stäbe. Damit handelt es sich<br />
um eine reversible Veränderung, die bei anderer Rechtslage zurückgebaut<br />
werden kann. Bei den Seitentreppen werden diese zusätzlichen Sicherungen<br />
mittels gespannter Seilzüge hergestellt.<br />
Nach all den eingrenzenden Bedingungen für die Denkmalpflege und damit<br />
ihren eingeschränkten Möglichkeiten seien noch Maßnahmen genannt, bei<br />
denen die Denkmalpflege keine anderen Bestimmungen zu berücksichtigen<br />
hatte als die Grundsätze ihrer eigenen Disziplin. Beide Hörsaaltrakte von<br />
Gebäude 211 erhielten nach Befund ihre ursprüngliche Farbigkeit in einem<br />
mittleren Blauviolett (wurde im Frühjahr 2011 ausgeführt). Auch das Betonraster<br />
wurde dem Originalzustand entsprechend wieder in Anthrazit gefasst.<br />
Die bauzeitlichen weißen Strukturfliesen waren insgesamt in gutem Zustand,<br />
kleinere Flächen auf der Nordseite wurden partiell mit nach originalem Vorbild<br />
angefertigten neuen Fliesen ausgetauscht und Fehlstellen ergänzt (Abb. 5).<br />
Der starke Kontrast zwischen tragenden und nicht tragenden Bauteilen kommt<br />
– wie auf bauzeitlichen Fotos deutlich erkennbar – wieder besser zur Geltung,<br />
nachdem er über Jahrzehnte immer stärker ausgeblichen war.
80 81 Das Leichte so schwer zu bewahren?<br />
8/9 Freie Sicht durch<br />
Zurück auf Los, 2009<br />
verständlich eine Sondersituation, die für den universitären Betrieb in der<br />
konsequenten Haltung des frei geräumten Zustandes dauerhaft wohl kaum<br />
aufrecht zu halten ist, aber gut geeignet war, wesentliche Eigenschaften<br />
der Architektur bewusst zu machen. Denn diese sind potenziell gefährdet<br />
durch bauliche Maßnahmen <strong>oder</strong> Nutzungsaktivitäten.<br />
Auch wenn in dem aufgezeigten, differenzierten Abstimmungsprozess<br />
schrittweise vorgegangen wird, Varianten von Möglichkeiten für eine Maßnahme<br />
entwickelt und geprüft werden, um die fürs Baudenkmal geeignete<br />
Lösung zu finden, ist nicht zu verkennen, dass alle nach bestem Wissen<br />
herbeigeführten Entscheidungen die Schmälerung des historischen Gehalts<br />
bewirken. Die gewalzten Stahlrahmen der Schwingflügel der Fenster<br />
(heute noch im ehemaligen EWF-Gebäude vorhanden) liefern Informationen<br />
über den damaligen technischen Entwicklungsstand und darüber, auf welche<br />
Art das architektonische Verständnis zum Ausdruck gebracht wurde.<br />
Sie besitzen damit in jedem Detail eine spezifische geschichtliche Aussagekraft.<br />
Die thermisch getrennten Stahlprofile der neuen Drehflügel transportieren<br />
lediglich drei grundsätzliche Aspekte: den des Materials, der<br />
Farbe sowie den der im einzelnen Fenster asymmetrischen Teilung, die<br />
durch Spiegelung auf die Rasterachse bezogen symmetrisch wird.<br />
Inwieweit die Denkmalpflege hier selbst mitwirkt, die Aussagekraft der<br />
Denkmäler zu schwächen, kann wiederum nur aus historischer Distanz<br />
beurteilt werden. Dass sie einerseits geschmälert wird, steht mit jeder<br />
Veränderung fest. Doch gibt es auch die andere Seite: durch instand<br />
setzende Maßnahmen zu ermöglichen, dass das Baudenkmal als Zeugnis<br />
der Architekturgeschichte mit Hilfe von individuell auf das jeweilige<br />
Objekt abgestimmten Sanierungsmethoden unter der Maßgabe der<br />
jeweiligen zeitgebundenen Bedingungen bewahrt wird. An der Veränderung<br />
von Baudenkmälern mitzuwirken ist eine Gratwanderung.<br />
Sollen die Bauten der ehemaligen Pädagogischen Akademie als Dokumente<br />
der Nachkriegsm<strong>oder</strong>ne in Köln auch weiterhin darüber<br />
berichten, auf welche Weise die Konstruktionsprinzipien und Strukturmerkmale<br />
der Klassischen M<strong>oder</strong>ne nach der durch die NS-Diktatur erzwungenen<br />
Exilsituation in weiterentwickelter Form wieder in Deutschland<br />
angekommen waren und bei Nachkriegsbauten angewendet<br />
wurden und welche Entwurfslösungen der Architekt Hans Schumacher<br />
für die spezielle Bauaufgabe gefunden hatte, so kann dies nur über<br />
einen achtsamen Umgang mit dem Bestand geschehen. Auch wenn<br />
im Detail manches verloren geht, wie die oben erwähnten typischen,<br />
filigran ausgewalzten Stahlprofile, ist es umso wichtiger, die Gestaltung<br />
dort im Originalen zu bewahren, wo es geht und das Leichte seinen<br />
Ausdruck findet: in Form des Spielerischen, Aufgelockerten der inneren<br />
Ausstattung.<br />
Die charakteristischen Merkmale zeigen die Grundhaltung, die hinter<br />
dem Gebauten stehenden Prinzipien, wie zum Bespiel im Gebäude der<br />
ehemaligen EWF an der orthogonal in das weitläufige Foyer gestellten<br />
Treppe sichtbar wird: Sie ist als geometrischer Raumkörper konzipiert,<br />
zeigt also eine skulpturale Auffassung 17 , die bis ins kleinste Detail gestaltet<br />
ist. Zu sehen ist dies an den Schraubköpfen an den Unterseiten<br />
der Trittstufe, an dem in V-Form räumlich versetzten Stabwerk des<br />
Geländers mit Mipolamhandlauf und dem Zuschnitt der Kunststeinstufen,<br />
die an den Seiten offen über ihre Träger herauskragen und so<br />
die Transparenz der Treppenhalle verstärken. Die Achsen, in denen die<br />
Treppe die Verbindung zwischen den Etagen schafft, haben innerhalb<br />
des insgesamt neunachsenlangen Gesamtraumes nach außen besondere<br />
Betonung erfahren: Hier sind raumhohe Glasscheiben eingestellt<br />
und auf diese Weise wurden Offenheit und Leichtigkeit baulich umgesetzt.<br />
Die quer zur Laufrichtung ansteigende Raumdecke bewirkt eine<br />
optische Irritation: Der Ausschnitt gibt rechts und links eine unterschiedliche<br />
Anzahl von Stufen frei. An solchen Gestaltungsdetails macht sich<br />
– neben dem durchgängigen Thema Transparenz – auch das Leichte
84 85 Falten statt Botox<br />
Falten statt Botox<br />
Der Kampf um die Nachkriegsm<strong>oder</strong>ne<br />
Kölner retten ihr Schauspielhaus<br />
Jörg Jung<br />
1/2 Wilhelm Riphahn,<br />
Oper und Schauspielhaus,<br />
Köln<br />
Am 13. April 2010 entschließt sich der Rat der Stadt Köln zur Sanierung des<br />
1962 fertiggestellten Schauspielhauses von Wilhelm Riphahn. Damit korrigiert<br />
der Rat einen Ratsbeschluss vom Dezember 2009, der den Abriss des<br />
denkmalgeschützten Gebäudes vorsah, um dem Neubau eines Schauspielhauses<br />
Platz zu machen. Dieser Entscheidung ging eine heftige Debatte um<br />
Abriss <strong>oder</strong> Erhaltung des Baudenkmals in der Bürgerschaft voraus, die in<br />
einem Bürgerbegehren gegen den Abriss endete, für das mehr als 50.000<br />
Kölner votierten. Zum daran anzuschließenden Bürgerentscheid kam es<br />
nicht mehr, weil die Mehrheit der Ratsfraktionen dem Bürgerbegehren beitrat<br />
– zu stark waren die Argumente für den Erhalt des Schauspielhauses.<br />
Das Schauspielhaus von Wilhelm Riphahn ist Bestandteil eines der größten<br />
und geschlossensten Ensembles der Nachkriegsm<strong>oder</strong>ne. Schon direkt<br />
nach dem Krieg begannen die Kölner mit der Planung eines großen Kulturzentrums<br />
mit der Oper in seiner Mitte. (Abb. 1 und 2)<br />
Das war gerade vor dem Hintergrund des total zerstörten Kölns ein klares<br />
Bekenntnis zur inneren Notwendigkeit von Kultur in einer Stadtgesellschaft.<br />
Denn ohne Kultur kann nichts gedeihen. In Zeiten der Not war das den<br />
Kölnern noch bewusst. Obwohl man meinen könnte, dass es drängendere<br />
Bauaufgaben gegeben hätte, als enorme Summen in den Bau eines Kulturzentrums<br />
zu stecken, hatten sich die Kölner dennoch und gerade für die<br />
Kultur entschieden. Und es war dieser Geist, der Köln schließlich zu einer<br />
Kulturhauptstadt machen sollte, mit epochemachenden Impulsen in Musik,<br />
Kunst und darstellenden Künsten. Es ging darum, ein Symbol zu schaffen<br />
für den Lebenswillen einer vom Krieg traumatisierten Generation. Wilhelm<br />
Riphahn äußerte sich 1946 dazu: „Wenn auch alle Voraussetzungen für einen<br />
Wiederaufbau fehlen, muss doch schnellstens und von allen hierzu be-<br />
rufenen schöpferischen Kräften mit Mut und Optimismus am Wiederaufbau<br />
gearbeitet werden.“ 1<br />
Die Kölner zeigten Mut. Die Oper am Rudolfplatz, von Carl Moritz geplant<br />
und 1902 fertiggestellt, wurde bewusst aufgegeben. Die Kriegszerstörungen<br />
hätten durchaus eine Sanierung des im klassischen Formenkanon<br />
gebildeten Opernbaus erlaubt. Aber die Kölner sehnten sich, wie so viele<br />
Deutsche nach „Drittem Reich“ und Krieg, nach einem Neuanfang und<br />
wollten sich dessen auch in der Sprache ihrer Bauten versichern. Wann,<br />
wenn nicht jetzt, ging es darum, alles neu und besser zu machen. Rudolf<br />
Schwarz legte ein neues Stadtplanungskonzept für Köln vor, und Wilhelm<br />
Riphahn freute sich als Architekt auf die kommenden Herausforderungen.<br />
Rücksicht auf die Vergangenheit? Warum? In einem Interview, das<br />
der junge Hans-Joachim Friedrichs für den WDR führte, sagte Wilhelm<br />
Riphahn auf die Frage, was ihn bewogen habe, das neue Haus an diese<br />
Stelle der Altstadt zwischen Dom und Neumarkt zu bauen: „Sie sagen<br />
Altstadt. Altstadt existiert ja gar nicht mehr. Und was an der Altstadt wieder<br />
neu aufgebaut worden ist, das ist alles in m<strong>oder</strong>nem Sinne aufgebaut.<br />
Es bestand also gar keine Veranlassung, irgendwelche Rücksichten auf<br />
die alte Stadt zu nehmen.“ 2<br />
Wilhelm Riphahn, der Denkmalschreck. Für viele Befürworter eines Theaterneubaus<br />
in Köln, war allein das Argument genug, den Anspruch auf Denkmalschutz<br />
bei Wilhelm Riphahn infrage zu stellen. Warum sollte Köln heute<br />
nicht dasselbe Recht haben, sich neu zu erfinden? Alan Posener fordert<br />
im Kontext der Bauerhaltungsbestrebungen in der Wutbürgergesellschaft:
96 97 CampusArchitektur und Kommunikationskonzepte<br />
Campusarchitektur und<br />
Komunikationskonzepte<br />
Leitbild, Beziehungsmarketing<br />
und Markenpolitik<br />
Markus Greitemann und Patrick Honecker<br />
Betrachtet man Campusarchitektur als Kommunikationsinstrument, ist zu<br />
berücksichtigen, dass diese Bauten im Wissenschaftsraum gesellschaftsrelevante<br />
Aussagen machen. Die Gebäude vermitteln den Betrachterinnen<br />
und Betrachtern, den Nutzerinnen und Nutzern einen ersten Eindruck von<br />
dem jeweiligen Wissenschaftsraum. Darüber hinaus sagen sie etwas über<br />
das Selbstverständnis der BetreiberInnen aus. Bestehende Gebäude müssen<br />
daher genauso in ein strategisches Kommunikationskonzept aufgenommen<br />
werden wie aktuelle <strong>oder</strong> auch künftige Bauten. Der folgende Beitrag<br />
geht der Frage nach, wie das Bauen auf dem Campus in das Beziehungsmarketing<br />
integriert werden kann und welche Phasen in der Kommunikation<br />
neuer Gebäude begleitet werden müssen.<br />
Modellversuch Dezentrales<br />
Liegenschaftsmanagement an der Universität zu<br />
Köln<br />
Im Rahmen des Modellversuches Dezentrales Liegenschaftsmanagement<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen verwaltet und betreibt die Universität zu<br />
Köln eigenverantwortlich ihr gesamtes Immobilienportfolio. Dieses Modellprojekt<br />
löste einen weitreichenden Reorganisationsprozess des Gebäude-<br />
und Liegenschaftsdezernats der Universität zu Köln aus, der den Fortschritt<br />
in Bezug auf Schnelligkeit, Flexibilität und ökonomisches Handeln<br />
inklusive der Thematik des Gebäude- <strong>oder</strong> Facilitymarketings maßgeblich<br />
positiv beeinflusst.<br />
Der Modellversuch Dezentrales Liegenschaftsmanagement hat daneben<br />
auch der infrastrukturellen Entwicklung der Universität zu Köln einen enor-<br />
men Schub gegeben. Allgegenwärtig zeugen Baukräne von den Baumaßnahmen<br />
auf dem Campus. Als signifikante Vorteile sind zum jetzigen Zeitpunkt<br />
bereits vor allem die Schnelligkeit und Flexibilität in der Behandlung<br />
der Kundenwünsche speziell in Berufungsmaßnahmen sowie der hohe Identifikationsgrad<br />
der MitarbeiterInnen des Gebäudemanagements mit ihren<br />
Gebäuden zu verzeichnen.<br />
Reform des Hochschulbaus<br />
Eine Reform des Hochschulbaus kann nur einhergehen mit einem veränderten<br />
Verhältnis von Hochschule und Gesellschaft. Einen besonders weitreichenden<br />
Reformprozess hat in diesem Zusammenhang beispielsweise<br />
die Universität Leuphana durchlaufen. Die Neugründung entstand aus einer<br />
Fusion der Universität Lüneburg und der Fachhochschule Nordostniedersachsen.<br />
Universitätspräsident Sascha Spoun setzte sich dafür ein, dass<br />
die Campusarchitektur als Kommunikationsinstrument verstanden wird. Auf<br />
ihren Webseiten erklärt die Universität die dahinterliegenden Gedanken:<br />
„Die Universitäten und Hochschulen Deutschlands reagierten auf das anschwellende<br />
Wachstum ihrer Studierendenzahlen in den siebziger Jahren<br />
angesichts knapper Budgets vielerorts mit funktionalen Zweckbauten. Der<br />
schlechte Ruf von Sichtbeton und Brutalismus haben so einer vielversprechenden<br />
Entwicklung m<strong>oder</strong>ner Universitätsbauten in Deutschland einen<br />
schlechten Leumund beschert. Erst in jüngster Vergangenheit haben auch<br />
deutsche Universitäten wieder Mut gefasst, in ihren Bauvorhaben die M<strong>oder</strong>ne<br />
neu zu interpretieren. Die von Daniel Libeskind in Lüneburg entwickelte<br />
Vision setzt diesen Ansatz konsequent um für eine Universität, die in der<br />
Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts allen ihren Mitgliedern und<br />
ihrem Umfeld Gelegenheit zu lebenslangem Lernen geben soll. Der Renaissance<br />
des Bildungsgedankens wird im Zeitalter von Netzwerken, Virtualisierung<br />
und Fernkommunikation ein neuer, physischer Raum gegeben für das<br />
gemeinsame Lösen von Problemen.“ 1<br />
Inwieweit eigenständig Markenpolitik über Hochschulbau ausgedrückt werden<br />
kann, hängt auch damit zusammen, in welcher Rechtsform Universitäten<br />
und andere Hochschulen in einem Bundesland organisiert sind. In der<br />
Regel sind Hochschulen in Deutschland Körperschaften des öffentlichen<br />
Rechts und gleichzeitig staatliche Einrichtungen, deren Bauprojekte von<br />
übergeordneten Ministerien und eigens geschaffenen Landesbehörden gesteuert<br />
werden.<br />
Neben dem eigenverantwortlich durchgeführten Gebäude- und Liegenschaftsmanagement<br />
der Universität zu Köln gibt es allerdings weitere positive<br />
Ausnahmen: Dies ist zum Beispiel die Universität Göttingen, die als<br />
Stiftungsuniversität alle Dienstleistungen zu den Themen Gebäude und<br />
Grundstücke aus einer Hand anbietet. Beide Hochschulen haben dabei einen<br />
entscheidenden Vorteil: Sie sind näher an den Kundinnen und Kunden.<br />
Die Nähe zur Kundin und zum Kunden ist insbesondere deswegen wichtig,
106 107 Zur Selbstinszenierung<br />
Zur Selbstinszenierung der<br />
Humanwissenschaftlichen<br />
Fakultät an der Universität<br />
zu Köln<br />
Wolf-D. Bukow<br />
Vorbemerkung<br />
Die Universität zu Köln tut sich nach wie vor sehr schwer mit dem Erbe der<br />
Pädagogischen Hochschule Rheinland, obwohl sie heute die mit Abstand<br />
größte pädagogische Bildungs- und Ausbildungsstätte Europas beherbergt.<br />
Das mag unterschiedliche Gründe haben. Ein ganz wichtiger Grund ist jedoch<br />
der, dass man in der Universität allgemein, aber vor allem auch in den<br />
Humanwissenschaften, davor zurückscheut, sich den hohen gesellschaftlichen<br />
Erwartungen entsprechend selbstbewusst zu präsentieren und als Ort<br />
des Wissens und der Wissensvermittlung aufzutreten. Diese Zurückhaltung<br />
ist folgenreich. Da man sich einem hier auch noch sehr hochgesteckten<br />
gesellschaftlichen Auftrag nicht entziehen kann, sich also nicht nicht-selbstinszenieren<br />
kann, gibt man faktisch auf diese Weise eine negative Antwort.<br />
Man dekonstruiert sich, dekonstruiert damit seinen gesellschaftlichen Auftrag<br />
und beschädigt damit letztlich die Bedeutung von Wissen und Wissensvermittlung<br />
generell.<br />
Die aktuelle Debatte belegt, dass dieses Problem allmählich ins Blickfeld gerät.<br />
Sie belegt aber auch, dass die Selbstinszenierung einer Fakultät ein nicht<br />
nur komplexes, sondern auch schwieriges Unterfangen darstellt, weil man<br />
nicht einfach Anleihen aus vergangenen Zeiten übernehmen kann. Versuche<br />
in dieser Richtung haben schon die Universitäten Bonn und Frankfurt/Oder<br />
gestartet. Diese Versuche, mit überholten Ritualen und historischem Spektakel<br />
so etwas wie eine Selbstinszenierung zu erzeugen, machen die Dinge<br />
jedoch noch schlimmer. Es werden Antworten heraufbeschworen, die schon<br />
damals, als sie noch üblich waren, politisch problematisch waren. 1 Entscheidend<br />
ist, einen Platz innerhalb der aktuellen gesellschaftlichen Situation, die<br />
zunehmend vom Übergang in eine postm<strong>oder</strong>ne Zivilgesellschaft geprägt<br />
wird, einzunehmen und sich von dorther zu definieren. Es bedarf dabei nicht<br />
einmal einer mühsamen Rückbesinnung auf Jean-François Lyotards Vorstellungen<br />
über das postm<strong>oder</strong>ne Wissen, sondern nur einer von praktischer<br />
Vernunft 2 geleiteten Besinnung auf die eigenen alltäglichen, urbanen Erfahrungen.<br />
Das ist alles. Von dort aus ist der weitere Weg längst vorgezeichnet.<br />
Selbstinszenierung als gesellschaftspolitisches<br />
Format<br />
Es ist sicherlich eine triviale und zugleich auch eine selbstverständliche Sache,<br />
dass Institutionen, die zur Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Aufgabe gegründet,<br />
finanziert und betrieben werden, dafür Sorge tragen müssen, in der<br />
Öffentlichkeit angemessen wahrgenommen zu werden. Gesellschaften haben<br />
in diesem Fall jedenfalls schon immer auf auftragsgemäße, eindeutige, unmissverständliche,<br />
kompetente und dem Zeitgeist entsprechende Repräsentation<br />
auf allen relevanten Ebenen und bei allen entsprechenden Stellen Wert gelegt.<br />
Bei einer solchen Dynamik bilden sich zwangsläufig bestimmte Formate der<br />
Selbstinszenierung aus. Nur so kann es den involvierten Institutionen gelingen,<br />
dem Erwartungsdruck langfristig gerecht zu werden. Wenn hier also<br />
von Formaten der Selbstinszenierung gesprochen wird, ist gemeint, dass eine<br />
Institution mit ihrer Selbstdarstellung zwangsläufig auf gesellschaftliche Erwartungen<br />
reagiert und diese Reaktionen entsprechend vorhandenen Formaten<br />
der Selbstdarstellung in Szene setzt. Eine solche Institution kann weder auf<br />
eine Selbstdarstellung verzichten noch kann sie beliebig wählen. Sie muss sich<br />
vielmehr an den ihr gegenüber formulierten Erwartungen ausrichten und muss<br />
dabei die für solche Zwecke vorhandenen Formate verwenden.<br />
Es ist auch selbstverständlich, dass solche gesellschaftlich gewollten Selbstinszenierungen<br />
immer bestimmte gesellschaftspolitische Konnotationen<br />
aufweisen. Das gilt ganz besonders, wenn sie einen zentralen gesellschaftlichen<br />
Auftrag erfüllen, denn gerade dann haben sie immer auch eine gesellschaftspolitische<br />
Botschaft zu vermitteln. 3 Es wird von einer entsprechenden<br />
Selbstinszenierung einfach erwartet, dass sie demonstriert, von welcher<br />
Bedeutung die zugewiesene Aufgabenstellung ist. Das kann man bereits an<br />
antiken Institutionen wie dem Theater, dem Tempel, dem Forum, dem Circus,<br />
dem Praetorium usw. erkennen. Und daran hat sich im Prinzip bis heute<br />
nicht viel geändert. Die entwickelten Formate sind also keineswegs rein formal<br />
ausgerichtet, sondern enthalten immer auch gesellschaftspolitische Bekundungen.<br />
Sie zeigen nicht nur an, dass eine Institution in der Gesellschaft<br />
eine Rolle spielt, sie sollen auch mitteilen, dass und wie sie ihre gesellschaftliche<br />
Rolle wahrnimmt. Insofern handelt es sich bei solchen Formaten stets<br />
auch um gesellschaftspolitisch aufgeladene Selbstinszenierungen.<br />
Diese gesellschaftspolitische Aufladung wird am einfachsten plastisch, wenn<br />
man sich konkrete Beispiele vergegenwärtigt. Werfen wir einen Blick auf<br />
Köln. Man denke nur an die Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, an die von
116 117 Zur Selbstinszenierung<br />
Campus sollte also bewirken, Wissen über Bildung zu entwickeln und dieses<br />
Wissen zugleich empirisch zu reflektieren. Genau dieses Format ist unter<br />
den aktuellen Bedingungen einer Fakultät, welche die Humanwissenschaften<br />
innerhalb der regionalen Bildungslandschaft thematisiert, immer noch<br />
aktuell. Es muss nur entsprechend neu inszeniert werden.<br />
Übernimmt man die skizzierte doppelte Intention als Impuls für die Humanwissenschaftliche<br />
Fakultät, so muss man den nach wie vor relativ<br />
geschlossenen Campus zum einen mit der Universität und darüber hinaus<br />
mit der Kölner Bildungslandschaft insgesamt in Relation setzen und zum<br />
anderen empirisch in reflexiver Differenz zur Stadtgesellschaft positionieren.<br />
Systemtheoretisch formuliert geht es darum, die Fakultät nunmehr erstens<br />
als Bestandteil einer eigenständigen und in sich konsistenten Bildungslandschaft<br />
zu erfassen und in spezifischer Weise, das heißt reflexiv gegenüber<br />
der Stadtgesellschaft, zu öffnen. Zweitens sollte sie als lebendes Teilsystem<br />
neben weiteren universitären Einrichtungen und neben den Fachhochschulen<br />
usw. konzipiert werden. Und wenn man dabei, wie eingangs ausgeführt,<br />
in Rechnung stellt, dass solche Formate der Selbstinszenierung in ihrer<br />
Selbstdarstellung zwangsläufig auf gesellschaftliche Erwartungen reagieren<br />
müssen und diese Reaktionen entsprechend vorhandenen Formaten der<br />
Selbstdarstellung in Szene zu setzen haben, dann ist dabei die aktuelle Situation<br />
der Postm<strong>oder</strong>ne mit im Blick behalten. 12<br />
Zum ersten: Distanz und Engagement als<br />
Fakultätsformat<br />
Um dieser doppelten Intention zeitlich angemessen im Rahmen eines gesellschaftspolitischen<br />
Formates gerecht werden zu können, sind die Erwartungen,<br />
die heute den Humanwissenschaften und dabei insbesondere dem<br />
Bildungswissen und dessen empirischer Relevanz entgegengebracht werden,<br />
besonders zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht sind hier im Übergang<br />
zur Postm<strong>oder</strong>ne vor allem zwei Herausforderungen zentral:<br />
a) Einerseits geht es darum, Wissen für alle und nicht nur für eine gesellschaftliche<br />
Elite <strong>oder</strong> im Dienst spezifischer, zum Beispiel ökonomischer,<br />
Interessen zu entwickeln und es entsprechend, nämlich sozial gerecht<br />
zu gestalten. Ein gesellschaftspolitisches Format, das auf dieser Basis<br />
Wissen über Bildung für alle darstellt, muss die gesellschaftliche Vielfalt<br />
aufgreifen und interpretativ, beispielsweise räumlich, darstellen, so Jerome<br />
Krase. 13 Krase hat das an seiner Universität in New York freilich nur<br />
indirekt versucht, indem er eine Lehreinheit zu dem Thema „The World<br />
in the class, the class in the city“ veranstaltet und dort die räumliche<br />
Realität eines glokalen Alltagslebens aufgegriffen hat. 14 Hier geht es um<br />
mehr. Man kann die urbane Vielfalt interpretativ aufgreifen und in der<br />
räumlichen bzw. baulichen Struktur der Fakultät abbilden. Damit würde<br />
man dem postm<strong>oder</strong>nen Baustil nahekommen. Man kann das Beispiel<br />
6 Brache in Berlin<br />
Prenzlauer Berg<br />
7 Logo der Universitätsschule,<br />
Universität<br />
zu Köln<br />
aber genauso gut auf die personelle Zusammensetzung der Lehrenden<br />
wie der Studierenden (zurück-)übersetzen. Man kann das Beispiel auch<br />
exemplarisch betrachten und in Kunstprojekte übersetzen. Ein relativ triviales<br />
Beispiel für eine künstlerische Gestaltung findet sich dazu auf einer<br />
ehemaligen Brache in Berlin Prenzlauer Berg, die jetzt zu einem Spielgelände<br />
geworden ist (Abb.6).<br />
b) Andererseits geht es darum, dies verantwortungsvoll und nicht ausschließlich<br />
an einem Nationalstaat bzw. den von einem solchen Staat<br />
definierten Mitgliedern auszurichten, sondern stattdessen nachhaltig,<br />
empirisch kontrolliert und zukunftsfähig zu gestalten. Knüpft man an die<br />
Idee der alten Lehrklasse bzw. des fakultätsinternen Kindergartens an,<br />
so liegt der Vorschlag einer Universitätsschule nahe (Abb. 7). Tatsächlich<br />
gibt es den Vorschlag schon. Er wäre hier nur noch in das gesellschaftspolitische<br />
Format der Fakultät zu integrieren und strategisch so zu<br />
konzipieren, dass tatsächlich ein exemplarisch-empirisch ausgerichteter<br />
Reflexionsbogen zur Stadtgesellschaft entsteht. Im Schulkonzept heißt<br />
es: „Wir wollen eine Schule gründen, die den wissenschaftlichen Einsichten<br />
und den internationalen Erfahrungen entspricht. Es wird eine Schule
122 123 Trepp auf – trepp ab<br />
Trepp auf – Trepp ab<br />
Die Treppe als Inszenierungs- und<br />
Repräsentationsmedium im Foyer der<br />
Humanwissenschaftlichen Fakultät der<br />
Universität zu Köln<br />
1 Hans Schumacher,<br />
Treppe im Foyer der<br />
Humanwissenschaftlichen<br />
Fakultät, Universität<br />
zu Köln, 2011<br />
Thomas Blisniewski<br />
„Treppe, die, Stiege: Verbindung von zwei auf verschiedenen Höhen liegenden<br />
Ebenen.“ 1 So definiert Günther Binding architektonisch und funktional<br />
die Treppe. Sie ist also ein Instrument, mit dem Höhenunterschiede überwunden<br />
werden können. In ihrer Funktion ist sie darin eng mit der Leiter<br />
verwandt.<br />
Treppen ermöglichen es dem Menschen, vertikal seine Position im Raum zu<br />
ändern. 2 Ist der normale Gang des Menschen auf die Horizontale bezogen,<br />
kann er mittels Treppe in die Vertikale aufsteigen bzw. in ihr absteigen. Die<br />
Treppe ist somit ein Instrument zur Richtungsänderung im Raum, wenn<br />
auch jede einzelne Trittstufe horizontal ausgerichtet ist. 3 Wichtig ist, daran zu<br />
denken, dass die anderen Positionen im Raum, also rechts und links, vorne<br />
und hinten, stets gewandelt werden. Dreht sich der Mensch, so wechseln<br />
auch die variablen Bezugspunkte. Oben und unten aber bleiben stabil, welche<br />
Position im mathematischen Raum auch immer eingenommen werden<br />
mag. 4 Oben und unten sind zudem durch die Schwerkraft, die alles nach<br />
unten zieht, definiert.<br />
Als im Sommer 2009, während des Projektes Zurück auf Los, das Foyer der<br />
Humanwissenschaftlichen Fakultät für kurze Zeit von allen Einbauten und<br />
den wenig attraktiven Zutaten bereinigt war, ist die Eleganz, Schönheit und<br />
Weiträumigkeit dieses Raumes wieder erfahrbar geworden. Hans Schumacher,<br />
der Kölner Architekt der ehemaligen Pädagogischen Akademie, schuf<br />
an der Ostseite des Foyers eine vom Boden bis zur Decke reichende Glasfront.<br />
5 Durch die großen Fensterflächen wirkt der Raum hell und weit und<br />
gewährt einen Ausblick auf den parkartigen Campus. Der Foyerraum wird<br />
zu einem fast unbegrenzten Innenraum, da keine Wände und Mauerteile die<br />
Sicht stören. 6 Ausblick bedeutet auch vice versa immer Einblick. So ist das<br />
Foyer auch von außen gut einsehbar und schafft so eine Atmosphäre des<br />
Austauschs und der Offenheit, was im Falle einer Hochschule auch geistigen<br />
Austausch und geistige Offenheit bedeutet.<br />
Betritt der Besucher das helle Foyer – in dem die Vielfalt der verwendeten<br />
Baumaterialien erstaunt – durch den Haupteingang und wendet sich nach<br />
rechts, wird die Treppe zum Blickfang im Foyer und gleichsam zu einer abstrakten<br />
Figur <strong>oder</strong> Plastik im Raum (Abb. 1).<br />
Die Treppe ist mit keiner der Gebäudewände verbunden und führt frei durch<br />
den Foyerraum nach oben. So erschließt sie auf geradem und direktem Wege,<br />
ohne Richtungswechsel <strong>oder</strong> Podeste gestört, die Obergeschosse des<br />
Gebäudes. Dies sei als eine durch den Architekten gelenkte Hodologie 7<br />
bezeichnet, da der Benutzer der Fakultät genau diesen Weg nehmen muss,<br />
um in die Obergeschosse zu gelangen, wenn er keinen größeren Umweg<br />
machen möchte. Der so „ausgezeichnete Weg“ (Kurt Lewin) ist nahezu identisch<br />
mit dem geometrischen Abstand der Geschosse, denn die Treppe wird<br />
gerade und nicht in Bögen <strong>oder</strong> auf Umwegen nach oben geführt. 8 Nur eine<br />
Leiter würde noch direkter und auf noch kürzerem Wege hinaufführen.<br />
Da die einzelnen Stufen der Treppe seitlich unterschnitten sind und nur in<br />
der Mitte die Setzstufen den Blick in den Raum hinter die Treppe verstellen,<br />
wirkt ihre Konstruktion sehr leicht und schwebend. Die Treppenanlage wird<br />
nicht durch gemauerte, massive Wangen eingefasst, statt solcher sind seitlich<br />
stählerne Stäbe in die Stufen eingelassen, die fast filigran wirken. Leicht<br />
schräg gestellt, bilden die gelb lackierten Stäbe ein luftiges Gitter, das den<br />
blauen Handlauf trägt. Damit ist der Treppe jegliche Wucht und Schwere
132 133 1950er-Jahre-Architektur und Bunkerräume<br />
1950er-Jahre-Architektur<br />
und Bunkerräume<br />
Das System der demokratischen<br />
Architektur als kollektive Praxis<br />
Christina Threuter<br />
Leichtigkeit und Grazie, Bewegung und Dynamik, Offenheit und Transparenz<br />
gelten gemeinhin als charakteristische Eigenschaften der westdeutschen<br />
m<strong>oder</strong>nen Architektur der 1950er Jahre: Diese Bauten zeichnen<br />
sich vor allem durch ihre kubischen Baukörper mit Flachdach aus und ihre<br />
Fassaden weisen zumeist ein einheitliches Raster von geöffneten und geschlossenen<br />
Flächen auf. Ferner ist das konstruktive Gerüst häufig durch<br />
eine orthogonale Horizontal-Vertikal-Gliederung und durch das freistehende<br />
Stützensystem im Erdgeschoss kenntlich gemacht. Auf die Verwendung<br />
vielfältiger Materialien mit einer bemerkenswerten strukturellen und farblichen<br />
Ästhetik im Innenraum und am Außenbau wurde großer Wert gelegt.<br />
Überdies verleiht die besondere plastische Hervorhebung einzelner architektonischer<br />
Elemente, wie zum Beispiel Treppen <strong>oder</strong> auch Eingangssituationen,<br />
diesen Bauten ihre so typische Dynamik.<br />
Nicht nur durch seine vehemente Präsenz in zahlreichen Stadtzentren<br />
hat sich dieses Bild der m<strong>oder</strong>nen Nachkriegsarchitektur tief ins kollektive<br />
Gedächtnis der Westdeutschen eingebrannt, sondern es wird allgemein<br />
auch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in den 1950er Jahren<br />
verbunden. Vielfach überlagert in der kollektiven Erinnerung der mystifizierende<br />
Begriff vom Wirtschaftswunder sogar die in der unmittelbaren<br />
Nachkriegszeit schwerwiegende Wohnungsnot, das Flüchtlingselend,<br />
den Hunger und den allgemeinen Versorgungsmangel sowie die zu<br />
bewältigenden NS- und Kriegstraumata wie Verfolgung, Verlust und<br />
Gefangenschaft. Daher sind auch die Signifikanten des prosperierenden<br />
Mittelstands immer noch sehr präsent im Nachkriegsgedächtnis der<br />
Westdeutschen vorhanden, wie zum Beispiel das Nierentischdesign und<br />
bunte Kunststoffmaterialien, Capriurlaub und Bikinimode, Rock ’n’ Roll<br />
1 Wohnraum der<br />
1950er Jahre, 1957<br />
und Motorisierung, Jugendkultur und Milchbar <strong>oder</strong> auch das Schöne<br />
Heim (Abb. 1).<br />
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung etablierte sich in Westdeutschland<br />
die m<strong>oder</strong>ne Konsum- und Warengesellschaft. Hier wurden insbesondere<br />
die Frauen als bevorzugte Zielgruppe und Konsumentinnen dieser neuen,<br />
industriell hergestellten und daher erschwinglichen Waren angesprochen<br />
(Abb. 2). Dabei begünstigten die konservativ-restaurativen Diskurse zu gesellschaftlicher<br />
und ästhetischer Moral nicht nur die Rückbindung der Frau<br />
als fürsorgliche Haus- und Ehefrau 1 an den privaten Raum, sondern sie<br />
schlugen sich etwa auch in der Warenästhetik in dem Begriff von der Guten<br />
Form nieder.<br />
Zahlreiche Großstädte Westdeutschlands, wie zum Beispiel Kiel, Hannover,<br />
Aachen <strong>oder</strong> auch Frankfurt/Main, sind vom Wiederaufbau der 1950er Jahre<br />
geprägt. Ganze Innenstadtbereiche, die nach den alliierten Fliegerangriffen<br />
im Zweiten Weltkrieg als Ruinenlandschaften daniederlagen 2 , mussten<br />
nach mühevoller Beseitigung der Trümmer neu errichtet werden. Mittlerweile<br />
sind die meisten dieser Gebäude in die Jahre gekommen und stellen eine<br />
anspruchsvolle Aufgabe für die Denkmalpflege dar; häufig steht diese unter
134 135 1950er-Jahre-Architektur und Bunkerräume<br />
einem Rechtfertigungsdruck für die Denkmalwürdigkeit dieser Bauten<br />
des Wiederaufbaus.<br />
Wie in kaum einer anderen Stadt Deutschlands war die Kölner Innenstadt<br />
von den Bombardements im Zweiten Weltkrieg betroffen.<br />
Bis zu 95 Prozent der Bauten waren in der Innenstadt zerstört worden,<br />
darunter die zahlreichen bedeutenden historischen Kirchengebäude<br />
mit Ausnahme des Domes (Abb. 3).<br />
Über den Wiederaufbau der Stadt wurde unmittelbar nach Kriegsende<br />
stark debattiert: Unvereinbare Positionen, die von der Rekonstruktion<br />
der historischen Stadt bis hin zur absoluten Neugestaltung<br />
reichten, standen sich gegenüber. Schließlich wurde der Architekt<br />
Rudolf Schwarz als Stadtplaner und Leiter der Kölner Wiederaufbaugesellschaft<br />
eingesetzt. Sein Wiederaufbaukonzept der Stadtlandschaft, das den<br />
Vorstellungen von einer gegliederten und aufgelockerten Stadt folgte, prägt<br />
auch das Campusgelände der Universität zu Köln, das mitten im Stadtgebiet<br />
liegt. 3 Durch den rasanten Anstieg der Studierendenzahlen – von 2300 in<br />
der NS-Zeit auf 5000 im Jahr 1950 und auf 14.000 Studierende bis 1960 4<br />
– waren in kurzer Zeit bauliche Erweiterungen auf dem Campusgelände erforderlich.<br />
Diese erfolgten in den 1950er und 1960er Jahren entsprechend der<br />
allgemeinen Planungsleitgedanken in aufgelockerter Bauweise. 5<br />
Aus dieser Zeit stammt auch der Baukomplex der ehemaligen Pädagogischen<br />
Akademie und heutigen Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität<br />
zu Köln. Errichtet wurde er von dem Architekten Hans Schumacher<br />
in der Zeit zwischen 1955 und 1957. 6 2004 wurde er in die Denkmalliste der<br />
Stadt Köln eingetragen. Er gilt damit „als baukulturelles Erbe der Aufbauzeit<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg“ und dokumentiert „eine charakteristische<br />
3 Köln in Trümmern,<br />
1945<br />
2 Persilwerbung aus<br />
den 1950er Jahren<br />
Bauaufgabe der jungen Bundesrepublik Deutschland sowie deren zeittypische<br />
architektonische Lösung“. 7 Den Baukomplex prägt dementsprechend<br />
das dynamische Formenvokabular der 1950er Jahre als Zeichen des (fast)<br />
schwerelosen (ungebremsten) Aufbruchs in eine neue demokratische Ära<br />
des westdeutschen Selbstverständnisses im Kontext der Westintegration<br />
(vgl. die Abbildungen in dem Beitrag von Arne Winkelmann).<br />
Die Stunde Null als Mythos der Nachkriegszeit<br />
Auch für die Architektur und nicht nur für die Politik ging mit der Gründung<br />
der Bundesrepublik 1949 und der entschiedenen Westorientierung der<br />
Adenauerregierung die verstärkte Rehabilitierung der m<strong>oder</strong>nen deutschen<br />
– der gewissermaßen guten, weil nazifreien – Vergangenheit einher: In Abgrenzung<br />
zum Bauen im nationalsozialistischen Deutschland rief man sich<br />
das Neue Bauen des besseren Deutschland der Weimarer Republik in Erinnerung.<br />
Im Gegensatz zu den Architekten und Planern, die ihre NS-Tätigkeit<br />
in der Nachkriegszeit ungebrochen fortführten, konnten die emigrierten<br />
Architekten im Rahmen des Wiederaufbaus gegenüber dem Ausland und in<br />
Abgrenzung zum sowjetischen Leitbild des Ostsektors, der späteren DDR,<br />
personell für das kollektive gute bzw. demokratische Deutschland einstehen.<br />
Prominentestes Beispiel hierfür ist der Architekt und Bauhausgründer<br />
Walter Gropius, der gewissermaßen als offizieller Kulturbotschafter der USA<br />
im westlichen Nachkriegsdeutschland als Apollo der Demokratie 8 für die Rehabilitierung<br />
seiner Idee der Bauhausm<strong>oder</strong>ne warb.<br />
Für diese Funktion wurde er allerdings nicht nur in der Öffentlichkeit aufgebaut,<br />
sondern er arbeitete selbst aktiv an seinem Image mit. Der Kulturhistoriker<br />
Paul Betts verweist darauf, dass die Rekonstruktion des Bauhausimages<br />
weitgehend außerhalb der deutschen Architektenschaft erfolgte: Sie<br />
vollzog sich dabei im Rückgriff auf bereits vor dem Kalten Krieg publizierte<br />
Chroniken zur m<strong>oder</strong>nen Architektur 9 , deren gemeinsames Ziel darin bestand,<br />
die sachliche M<strong>oder</strong>ne in der Architektur als internationale M<strong>oder</strong>ne<br />
zu etablieren. Betts hebt hervor, dass diese Architekturgeschichtsschreibung<br />
in der Nachkriegszeit dazu diente, die scheinbar unpolitische Architekturgeschichte<br />
in die Kultur des Kalten Krieges einzupassen. 10 Das westliche<br />
Bündnis strebte danach, seine jeweilige kulturelle Identität auf der Basis von<br />
Liberalismus und Internationalem Stil aufzubauen: „Die Bauhaus-Geschichte<br />
wurde nicht nur als Zeugnis für amerikanische und westdeutsche M<strong>oder</strong>nität<br />
in Anspruch genommen, sondern wurde zu einem wichtigen Element der<br />
positiv konnotierten M<strong>oder</strong>nisierungstheorie des Kalten Krieges.“ 11<br />
Doch stießen diese allgemeinen Bemühungen, in der Nachkriegszeit unmittelbar<br />
an die rationale Architektur des Neuen Bauens der 1920er Jahre<br />
anzuknüpfen, nicht nur bei den traditionalistisch orientierten Architekten,<br />
sondern auch bei Mitstreitern des m<strong>oder</strong>nen Bauens auf Widerstand und<br />
führten zu heftigen Diskussionen 12 : Zu nennen sind hier allen voran das<br />
Darmstädter Gespräch: Mensch und Raum von 1951 sowie der Düsseldor-
144 145 Der Arme, Reiche Mann<br />
Der arme, reiche Mann<br />
Architekturwerk und<br />
Architekturgebrauch<br />
Eduard Heinrich Führ<br />
Seit mehr als 100 Jahren wird in der Architektur ein Streit geführt zwischen<br />
den Architekten, für die Architektur ein Kunstwerk und als solches das<br />
glückliche Ende eines Entwurfsprozesses ist, und den Nutzern, für die die<br />
Architektur ein Werkzeug und Anfang des <strong>Gebrauchen</strong>s ist.<br />
Adolf Loos hat das in seinem im Wiener Tagblatt am 26. April 1900 veröffentlichten<br />
Aufsatz „von einem armen, reichen manne“ 1 thematisiert und,<br />
obwohl selber Architekt, sich auf die Seite der Nutzer gestellt.<br />
In dem Text geht es um einen Mann, der, zu Wohlstand gekommen, sich nun<br />
endlich ein wunderbares Haus bauen lassen will, sich dazu einen Jugendstilarchitekten<br />
engagiert, nach dem Einzug aber merkt, dass er an dem Haus<br />
und seiner Einrichtung nichts verändern darf, da er sonst das Kunstwerk<br />
zerstört: „… für ihn wurde nichts mehr erzeugt. Keiner seiner lieben durfte<br />
ihm sein bild schenken, für ihn gab es keine maler mehr, keine künstler, keine<br />
handwerker. Er war ausgeschaltet aus dem künftigen leben und streben,<br />
werden und wünschen. Er fühlte: ‚Jetzt heißt es lernen, mit seinem eigenen<br />
leichnam herumzugehen. Jawohl! Er ist fertig! Er ist komplett!‘.“ 2<br />
Mit Recht kommen einem die Tränen, wenn man den Text von Adolf Loos<br />
liest, vor allem, da er auch noch eine Kindergartenarbeit seines Enkerls ins<br />
Gespräch bringt, die er nirgends aufhängen darf; und man verdammt die<br />
eitlen, menschen- und lebensfeindlichen Architekten. Die Tränen kommen<br />
einem aber auch, wenn man den Umbau des Hauses Steiner (Adolf Loos<br />
1910) in den 1950er Jahren sieht, und man verdammt die Respektlosigkeit<br />
der Nutzer.<br />
In der Diskussion der Nutzer (Abb. 1 und 2) um den Gebrauch geht es im<br />
Grunde um das Verhältnis von Architektur und Leben, um das grundsätzliche<br />
Verständnis von Architektur, besonders um die Frage der Architektur als<br />
Produkt, als Werk und als Zeug, als Ding <strong>oder</strong> als Handlungsfeld, sowie um<br />
die Frage, wer eigentlich Autor ist, der Produzent, das Werk in seiner Autorität<br />
<strong>oder</strong> der Interpret und Nutzer.<br />
Architektur und das Leben<br />
Nutzen und Nachteil<br />
Ich will den Vergleich nicht zu weit treiben, aber man kann Nietzsches Gedanken<br />
zum Nutzen und Nachtheil der Geschichte für das Leben (Nietzsche<br />
1874) und seine Unterscheidung in eine monumentalische, eine antiquarische<br />
und eine kritische 3 Art der Historie durchaus auch auf die Architektur<br />
übertragen:<br />
Die monumentalische Architektur geht auf das Große, um den „Begriff<br />
Mensch weiter auszuspannen und schöner zu erfüllen. Es ist das Monogramm<br />
des eigensten Wesens der Autoren, ein Werk, eine Tat, eine seltene<br />
Erleuchtung, eine Schöpfung.“ Die monumentalen Werke werden eine Kette<br />
bilden, „daß in ihnen ein Höhenzug der Menschheit durch Jahrtausende<br />
hin sich verbinde, daß für mich das Höchste eines solchen längstvergangenen<br />
Momentes noch lebendig, hell und groß sei – das ist der Grundgedanke<br />
im Glauben an die Humanität, der sich in der Forderung einer monumentalischen“<br />
Architektur ausspricht. Im monumentalischen Verständnis<br />
wird Architektur als die Herstellung eines einzigartigen Bauwerkes mit<br />
höchstem geistigen Anspruch durch einen genialen Urheber definiert; dabei<br />
ist sie auf Disidentität mit den anderen gerichtet. Deshalb ist sie Entwurf<br />
im eigentlichen Sinne. Sie ist Architektur ohne Nutzer. Die Werke stehen<br />
wie Leuchttürme in Raum und Zeit und gliedern sich zu einer Kette. Sie<br />
sind ideale Vorbilder.<br />
Ihr Nachteil ist, dass man die Werke nicht wiederholen kann, sie „so ins<br />
Schöne umgedeutet und somit der freien Erdichtung angenähert“ und damit<br />
dem Leben entzogen werden.<br />
Die antiquarische Architektur „wirkt aus starker rauher deutscher Seele“ und<br />
erwirkt ein „Lust- und Zufriedenheits-Gefühl. Wie könnte die Architektur dem<br />
Leben besser dienen als dadurch, daß sie auch die minder begünstigten<br />
Geschlechter und Bevölkerung an ihre Heimat und Heimatsitte anknüpft<br />
und seßhaft macht?“ Die antiquarische Architektur zielt auf das aus der Vergangenheit<br />
überlieferte Leben und bewirkt so eine Identität mit den anderen<br />
Menschen. Sie wird nicht entworfen, sondern her- und zusammengestellt.<br />
Ihr Nutzen ist das Bewusstwerden eigener Identität, das „Wohlgefühl des<br />
Baumes an seinen Wurzeln, das Einswerden mit einem ‚Wir‘“.<br />
Der Nachteil ist, dass die Menschen ins „Kleine, Morsche und Veraltete“<br />
übersiedeln und sich „darin ein heimisches Nest bereiten. Der antiquarische<br />
Sinn eines Menschen (…) hat immer ein höchst beschränktes Gesichtsfeld<br />
(…) das Wenige, was er sieht, sieht er viel zu nahe und isoliert.“<br />
In der kritischen Architektur geht es mehr um das Wohnen als Aktivität der<br />
Zukunft, denn um Übernahme in der Vergangenheit entstandener Werke.
146 147 Der Arme, Reiche Mann<br />
Sie gibt den Menschen die Macht, „sich von der Kette“ der großen Werke<br />
zu „lösen“, mit den „Messern an ihre Wurzeln“ zu gehen, richtet sich also<br />
gegen die monumentalische und gegen die antiquarische Haltung. Ziel ist<br />
es, sich in einer neuen Identität selbst zu entwerfen. Die Gefahr für das Leben<br />
ist, seine alte Identität aufzugeben, ohne es zu einer neuen geschafft<br />
zu haben.<br />
Schauen wir uns diese drei Weisen des Verständnisses von Architektur<br />
noch ein wenig genauer an. Bei allen dreien geht es darum, einen Zusammenhang<br />
von Leben und Architektur zu formulieren. Allerdings wird der Zusammenhang<br />
jeweils anders gesehen. Es gibt zudem ein unterschiedliches<br />
Verständnis von Leben. Der monumentalischen Architektur geht es um das<br />
Werk und dessen Urheber, den Architekten, die Architektin <strong>oder</strong> deren Büro.<br />
In der antiquarischen Architektur geht es um das Schöpfen eines Werkes<br />
aus einem Urgrund. Obwohl es auch hier Architekten gibt, spielen diese<br />
doch keine schöpferische Rolle für das Werk; es handelt sich um eine Architektur<br />
ohne Architekten, um ein Buch von Bernhard Rudofsky von 1964 zu<br />
zitieren. Diese beiden Lesarten gehen zwar implizit davon aus, dass die architektonischen<br />
Werke auch genutzt werden. Das Leben aber kommt durch<br />
die Architekten – als Autoren <strong>oder</strong> als Vermittler – in die Architektur. Die Nutzer<br />
können nichts anderes tun als sich dem Werk zu öffnen.<br />
Bei der kritischen Architektur kommt das Leben durch die Nutzer in die Architektur.<br />
Die Werke sind irgendwie vorhanden, wobei es keine Rolle spielt,<br />
wer sie entworfen <strong>oder</strong> vermittelt hat <strong>oder</strong> wodurch sie entstanden sind<br />
und was möglicherweise mit ihnen artikuliert werden sollte. Hier kommt es<br />
darauf an, sie im Gebrauch als Material zur Genese eines eigenen Lebens<br />
zu nehmen.<br />
Was nützt diese Analogie? So schräg sie vielleicht sein mag, sie hebt<br />
die strikte Gegenüberstellung solitärer Baukunstwerke zur antiquarischheimatlichen<br />
Architektur und zur Architektur als gebrauchtes Zeug grundsätzlich<br />
auf, indem sie allen dreien eine spezifische Beziehung zum Leben<br />
unterstellt. Sie erlaubt damit auch die Frage nach dem Nutzen und Nachteil<br />
des Baukunstwerkes für das Leben, also nach seinem adäquaten<br />
Gebrauch.<br />
1 Adolf Loos, Haus<br />
Steiner (Wien 1910),<br />
nach dem Umbau Mitte<br />
der 1950er Jahre<br />
2 Adolf Loos, Haus<br />
Steiner (Wien 1910),<br />
nach der Rekonstruktion<br />
in den ursprünglichen<br />
Zustand<br />
Kunst und ZweckmäSSigkeit<br />
In die Diskussion über den Zusammenhang von Architektur und Leben hinein<br />
spielt seit Jahrhunderten die Frage, ob Architektur Kunst ist <strong>oder</strong> Zeug.<br />
Was mit dem Leben zu tun hat, könne nicht Kunst sein, was nichts mit dem<br />
Leben zu tun hat, könne nicht Architektur sein.<br />
Besonders im 19. Jahrhundert gab es vielfältige Versuche, Architektur<br />
entweder wegen ihrer Zweckmäßigkeit den Kunstcharakter (Georg<br />
Wilhelm Friedrich Hegel in seinen Vorlesungen zur Ästhetik 1817–1829,<br />
veröffentlicht 1832–45) <strong>oder</strong> aber ihr ihre Zweckmäßigkeit und ihren Praxisbezug<br />
abzusprechen. Der Grund wird in der Zweckmäßigkeit selbst<br />
gesehen, das heißt in der dieser innewohnenden grundsätzlichen Abhängigkeit<br />
von einem anderen, dem eigentlichen Gegenstande fremden Sein,<br />
also in ihrer Unvollendetheit und Unvollkommenheit (Karl Philipp Moritz<br />
1788, Friedrich W. J. Schelling in seinen Vorlesungen über die Philosophie<br />
der Kunst 1802/1803 <strong>oder</strong> in seinen Ästhetikvorlesungen). Nur eine innere<br />
Zweckmäßigkeit, eine In‐sich-Vollendetheit, könne Kunst sein (Moritz<br />
ebenda) <strong>oder</strong> eine Zweckmäßigkeit, die mit ihrem Begriff verschmelze<br />
und so zu einem Bild der Vernunft werde (Schelling ebenda). Architektur<br />
ist in diesem Falle ge- und verfasster Geist; sie ist ausschließlich monu-
162 163 Raum im Blick<br />
Raum im Blick<br />
Psychologische Perspektiven auf<br />
Raumwahrnehmung und Raumnutzung<br />
Gary Bente, Victoria Hieb, Daniel Munko<br />
„Yet we treat space somewhat as we treat sex.<br />
It is there but we don’t talk about it.” 1<br />
Treffender als der Anthropologe Edward T. Hall (1914–2009) hätte man<br />
es nicht ausdrücken können: Einflüsse des Raumes auf unser Handeln<br />
und Denken begleiten uns tagtäglich, doch sind wir uns derer nur selten<br />
bewusst und können sie nur schwer in Worte fassen. In diesem Beitrag<br />
wollen wir uns einigen Alltagsphänomenen zuwenden, die beim Umgang<br />
der Menschen mit Raum und Architektur zu beobachten sind. Wir möchten<br />
Phänomene des Raumverhaltens, der Raumwahrnehmung, der Wegsuche,<br />
der Orientierung im Raum und der Nutzung von Architektur aus<br />
psychologischer Perspektive beleuchten.<br />
Hierauf aufbauend werden wir einige Befunde aus einer Pilotstudie vorstellen,<br />
die wir im Rahmen des Projektes Zurück auf Los durchführen<br />
konnten. Das Foyer des Hauptgebäudes der Humanwissenschaftlichen<br />
Fakultät der Universität zu Köln wurde in diesem Projekt in den Ausgangszustand<br />
zurückversetzt und von Plakaten, Aufstellern, Automaten<br />
und anderen raumfremden Objekten befreit. Auf diese Weise konnte der<br />
Blick auf die basale Architektur freigegeben werden. Mithilfe spezieller<br />
psychologischer Messverfahren wollten wir der Frage nachgehen, welchen<br />
Einfluss solche Eingriffe in die Raumgestaltung auf die Wahrnehmung<br />
des Raumes und die Bewegung im Raum haben.<br />
Zwischenraum – Interpersonelles Distanzverhalten<br />
Ob in einer Warteschlange, in einem überfüllten Bus <strong>oder</strong> in einem Gespräch<br />
– wir merken, wenn uns jemand zu sehr auf den Leib rückt und<br />
müssen gegebenenfalls Gegenmaßnahmen ergreifen. Aber warum weichen<br />
wir zurück, wenn der Sitznachbar im Bus seine Zeitung fast auf unserem<br />
Schoß ausbreitet <strong>oder</strong> wir das Mittagessen des Kollegen anhand der Reste<br />
in seinen Zähnen erkennen können, weil dieser zehn Zentimeter vor unserer<br />
Nase über seinen letzten Urlaub plaudert? Diese Menschen unterschreiten<br />
die Distanz, die wir in der jeweiligen Situation als angemessen empfunden<br />
hätten. Sie betreten unseren persönlichen Raum. Es ist etwas völlig anderes,<br />
ob uns die beste Freundin ins Ohr flüstert, dass ihr Partner ihr einen<br />
Heiratsantrag gemacht hat, <strong>oder</strong> ob dies der Zugschaffner mit den Fahrkartenpreisen<br />
tun würde. Bestimmte Distanzen sind bestimmten Personen und<br />
auch Situationen vorbehalten. Edward T. Hall hat sich in seinen kulturanthropologischen<br />
Betrachtungen intensiv mit Phänomenen der Distanz und deren<br />
Regulierung beschäftigt. Er unterscheidet vier Distanzzonen: die intime, die<br />
personale, die soziale und die öffentliche Distanz.<br />
Von intimer Distanz sprechen wir bei einem Abstand von 0–45 Zentimetern.<br />
So nah darf uns ein anderer Mensch nur dann kommen, wenn wir uns zum<br />
Beispiel in einem Judoturnier befinden <strong>oder</strong> es sich um intimen körperlichen<br />
Kontakt handelt. Wird diese Distanz von Unbefugten unterschritten, wie<br />
beispielsweise im Aufzug <strong>oder</strong> in öffentlichen Verkehrsmitteln, und ist ein<br />
Zurückweichen nicht möglich, müssen Gegenmaßnahmen ergriffen werden.<br />
Möglichkeiten sind etwa das Abwenden von Körper und Blick <strong>oder</strong> das Vertiefen<br />
in einen Roman.<br />
Für Kontakte mit sehr engen Freunden und alltägliche Interaktionen mit<br />
uns bekannten Menschen ist die personale Distanz angemessen, die zwischen<br />
45 und 120 Zentimetern liegt. Die Frage, wie Menschen zueinander<br />
stehen, bekommt dadurch eine ganz neue Bedeutung, denn Hall erklärt,<br />
dass man am Distanzverhalten zweier Menschen deren Beziehung zueinander<br />
erkennen kann. Demnach sei es für die Ehefrau völlig normal, sich<br />
innerhalb der personalen Distanz ihres Mannes aufzuhalten. Bei fremden<br />
Frauen sei dies eine ganz andere Geschichte – vor allem aus der Sicht<br />
der Ehefrau! Wird diese Grenze ungewollt überschritten, reagieren wir mit<br />
Zurückweichen <strong>oder</strong>, falls dies nicht möglich ist, vermeiden wir zumindest<br />
den Blickkontakt.<br />
Bei unpersönlichem <strong>oder</strong> beruflichem Kontakt vergrößert sich die gewöhnlich<br />
eingehaltene Distanz auf 1,20 bis 3,50 Meter, wir sprechen dann von<br />
sozialer Distanz. Der Mensch bedient sich zahlreicher Hilfsmittel, um die<br />
Wahrung dieses Abstandes zu gewährleisten. So hält beispielsweise eine<br />
gewisse Schreibtischgröße in Büros mit Publikumsverkehr den Besucher auf<br />
Abstand. Ein Schreibtisch zwischen den Personen kann auch als wirksame<br />
Barriere dienen, wenn das Zimmer zu klein ist, um diese Mindestdistanz zu<br />
ermöglichen.
178 179 Raum im Blick<br />
6 Die ersten und letzten<br />
Blickbewegungen<br />
beim Betrachten des<br />
Gebäudes<br />
in der Betrachtung, zum Beispiel das Abtasten der Objekte entlang vertikaler<br />
und horizontaler Achsen (Abb. 6). Beeindruckend ist auch der Befund, dass<br />
das menschliche Auge offenbar Ungleichgewichten im Wahrnehmungsfeld<br />
aktiv entgegensteuert. Solche Prozesse verlaufen zumeist unbewusst, erfordern<br />
aber dennoch kognitive Ressourcen. Es ist zu fragen, inwieweit wahrnehmungspsychologisch<br />
ungeschickte Bauformen <strong>oder</strong> Raumgestaltungen<br />
zu Belastungen des Menschen führen und andere kognitive Leistungen, wie<br />
etwa das Lernen, beeinträchtigen <strong>oder</strong> gar Stress verursachen.<br />
Trotz der interessanten Befunde fehlen noch weitgehend systematische Erkundungen<br />
der Raumwahrnehmung mittels Blickregistrierung. Auch sind die<br />
7 Probandin mit MobilEye-System<br />
im Foyer<br />
des Hauptgebäudes der<br />
Humanwissenschaftlichen<br />
Fakultät<br />
8 Aufzeichnung der<br />
Personenbewegungen<br />
eines Werktages im Foyer.<br />
Oben: Leeres Foyer<br />
zum Vergleich<br />
Unten: Überlagerte<br />
Filmeinzelbilder zeigen<br />
die Hauptströme.<br />
vorhandenen Studien in ihrer Aussagekraft zum Teil stark eingeschränkt, da<br />
sie zumeist statisches Bildmaterial in Form von Fotografien von Gebäuden<br />
und Räumen verwenden. Bewegungen im realen Raum sind nicht möglich,<br />
Affordanzen, die sich aus der Raumanordnung für die Lokomotion und<br />
Blickzuwendung ergeben, sind reduziert.<br />
Diese Einschränkungen konnten in unserer Pilotstudie überwunden werden.<br />
Einerseits stand ein mobiles Blickregistrierungssystem zur Verfügung, das<br />
den ProbandInnen eine freie Bewegung im Raum ermöglichte (Abb. 7). Zum<br />
anderen verwendeten wir in Kombination damit ein spezielles Zeitraffervideoaufzeichnungsverfahren,<br />
das die Bewegungen der Menschen im Raum<br />
kontinuierlich erfasste und die Aggregation von Bewegungsmustern ermöglichte<br />
(Abb. 8). Blickspuren bei der visuellen Erfassung des Raumes sowie<br />
Bewegungsspuren beim Durchschreiten des Raumes konnten so en détail<br />
analysiert werden (Abb. 9).<br />
Unsere Studie fand im Rahmen des Projektes Zurück auf Los im Sommer<br />
2009 statt. Im Rahmen des Projektes wurde das Foyer des Hauptgebäudes<br />
der Humanwissenschaftlichen Fakultät ausgeräumt. Stellwände, Getränke-
184 185<br />
Autorinnen und Autoren<br />
Gary Bente<br />
Professor für Sozial- und Medienpsychologie an der Universität zu Köln;<br />
Studium der Psychologie an der Universität Regensburg und an der Universität<br />
des Saarlandes, 1985 Promotion; 1990 Habilitation. Forschung und<br />
Lehre in den Bereichen nonverbale Kommunikation und Personenwahrnehmung,<br />
Computersimulation menschlichen Kommunikationsverhaltens,<br />
sozio-emotionale Faktoren in der Mediennutzung, computervermittelte<br />
Kommunikation und Methodenentwicklung, vor allem in den Bereichen<br />
der Erfassung physiologischer Erregung während der Mediennutzung und<br />
video-basierter Blickregistrierungsverfahren.<br />
Thomas Blisniewski<br />
Studium der Kunstgeschichte, klassischen und christlichen Archäologie<br />
sowie Philosophie in Köln und Bonn. Magister: 1990. Promotion zu einem<br />
Thema der Mythenrezeption: 1992. Danach Anstellungen beim Stadtkonservator<br />
Köln und am Wallraf-Richartz-Museum Köln. Lehraufträge an<br />
verschiedenen Universitäten. Seit 2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am<br />
Institut für Kunst und Kunsttheorie der Universität zu Köln. Zahlreiche Publikationen<br />
zu kunst- und kulturhistorischen Themen.<br />
Wolf-Dietrich Bukow<br />
Studium der Ev. Theologie, Soziologie, Psychologie und Ethnologie in<br />
Bochum und Heidelberg; Promotion im Jahr 1974 in Soziologie, Theologie<br />
und Psychologie an der Universität Heidelberg und Habilitation in Soziologie<br />
im Jahr 1989 an der Universität zu Köln; Emeritus am Institut für<br />
vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften an der Universität<br />
zu Köln; Gründer der Forschungsstelle für Interkulturelle Studien<br />
(FiSt) sowie des Center for diversity studies (cedis); Forschungspreis der<br />
Reuter-Stiftung im Stiftungsverband der Deutschen Wissenschaft. Jüngste<br />
Buchveröffentlichung: Neue Vielfalt in der urbanen Stadtgesellschaft,<br />
Wiesbaden 2011.<br />
Eduard Heinrich Führ<br />
Nach dem Abitur Lehre und Berufstätigkeit als Kaufmann, anschließend Studium<br />
der Kunstgeschichte, Philosophie und Soziologie. 1979 Promotion zum<br />
Dr. phil., 1989 Habilitation zum Dr. Ing. habil. Nach kürzeren Vertretungsprofessuren<br />
bis zur Emeritierung (2010) Inhaber des Lehrstuhls „Theorie der<br />
Architektur“ an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus.<br />
Gastprofessur an der University of New Orleans. 1996 Gründung und<br />
seitdem Herausgabe der Internetzeitschrift Wolkenkuckucksheim – Cloud-<br />
Cuckoo-Land – Воздушный замок.Neben Publikationen zur Architektur-,<br />
Stadt- und Planungsgeschichte und zu wissenschaftstheoretischen Fragen<br />
der Architektur Forschungen zur Geschichte des Wohnens und zum Wohnbegriff.<br />
Planungs- und Beratungstätigkeit im Wohnungs- und Städtebau.<br />
Markus Greitemann<br />
Seit 2010 verantwortlich für das Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement<br />
der Universität zu Köln. Der diplomierte Architekt hat zuvor das<br />
Gebäudemanagement eines großen deutschen mittelständischen Unternehmens<br />
aufgebaut und über zehn Jahre geleitet.<br />
Heidi Helmhold<br />
Professorin am Institut für Kunst und Kunsttheorie an der Universität zu Köln.<br />
Habilitation 1999 an der Universität Dortmund zum Verhältnis von Philosophie,<br />
Kunst und Architektur. Seit 1992 künstlerische Interventionen im Raum.<br />
2010 in Kooperation mit dem Baudezernat der Universität zu Köln Erhebung<br />
über Mobilitätsverhalten von Studierenden auf dem Universitätscampus, Teilprojekt<br />
der Masterplanfortschreibungen für die Universität zu Köln.<br />
Arbeitsschwerpunkte in Lehre und Forschung: Raum und Körper, Materielle<br />
Kultur, NutzerInnenkonzepte von Raum. Initiierte zusammen mit Christina<br />
Threuter „UPPS – Uses of Private and Public Space“ als Plattform für<br />
Nutzungsperspektiven von Raum in interdisziplinären Fragestellungen.<br />
Laufendes Projekt: Raum als Instrument im Strafvollzug. Jüngste Veröffentlichung:<br />
Affektpolitik von Raum, Köln 2012. http://hf.uni-koeln.de/blog/<br />
mcspace/<br />
Victoria Hieb<br />
Studium der Psychologie an der Universität zu Köln, Abschluss 2012. Studentische<br />
Hilfskraft am Lehrstuhl für Sozial- und Medienpsychologie. Zu<br />
ihren Interessenschwerpunkten gehören neben der Medien- und Kommunikationspsychologie<br />
ebenfalls architekturpsychologische Phänomene. Ihr<br />
Forschungsinteresse gilt insbesondere der Untersuchung des Einflusses der<br />
Raumgestaltung auf Erleben und Verhalten des Menschen. Zu diesem Thema<br />
ist ein Dissertationsprojekt in Planung.
186 187<br />
Patrick Honecker<br />
Dr. phil., MBA, leitet die Stabsstelle Presse und Kommunikation der Universität<br />
zu Köln. Bevor er die Stabsstelle aufbaute, war er mit der Leitung eines<br />
Referats bei der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung<br />
beauftragt. Er ist Fellow Wissenschaftsmanagement des<br />
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft und Sprecher der Initiative<br />
„Qualität in der Hochschulkommunikation“.<br />
Jörg Jung<br />
Studium der Kunstgeschichte, Soziologie und Psychologie in Köln; Mitarbeiter<br />
in den Galerien von Rudolf Kicken und Monika Sprüth; zeitweise Leitung<br />
der Studiogalerie am Museum Morsbroich in Leverkusen; seit 1986 als freier<br />
Kulturjournalist tätig; seit 1994 Kunst- und Kulturberichte in verschiedenen<br />
Redaktionen des WDR.<br />
Ursula Kleefisch-Jobst<br />
Studium der Kunstgeschichte, Archäologie und Germanistik in Bonn, München<br />
und Rom; Promotion; 1985–88 Forschungsprojekt an der Biblioteca<br />
Hertziana in Rom; 1989–90 Mitarbeiterin am Landesdenkmalamt in Berlin;<br />
seit 1990 freie Architekturkritikerin; 2001–07 Kuratorin am Deutschen<br />
Architekturmuseum in Frankfurt am Main; seit 2008 Geschäftsführende<br />
Kuratorin am M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst des Landes<br />
Nordrhein-Westfalen; zahlreiche Publikationen zur m<strong>oder</strong>nen und zeitgenössischen<br />
Architektur.<br />
Daniel Munko<br />
Studium der Psychologie an der Universität zu Köln, Abschluss 2012. Studentische<br />
Hilfskraft am Lehrstuhl für Sozial- und Medienpsychologie. Seine<br />
Interessenschwerpunkte liegen im Bereich der Medienpsychologie und der<br />
Klinischen Psychologie, speziell in der Untersuchung der Effekte (violenter)<br />
digitaler Videospiele und deren Suchtgefährdungspotenzial. In eigenen Forschungsarbeiten<br />
kommen insbesondere psychophysiologische Erhebungsverfahren<br />
und implizite Maße zum Einsatz.<br />
Hans-Joachim Roth<br />
Dr. phil., Dekan der Humanwissenschaftlichen Fakultät an der Universität<br />
zu Köln, seit 2005 Professor für Erziehungswissenschaft mit dem<br />
Schwerpunkt Interkulturelle Pädagogik. Seine Forschungsschwerpunkte<br />
der letzten Jahre bezogen sich insbesondere auf Fragen bilingualer<br />
Bildung und Zweisprachigkeitsentwicklung in Bildungskontexten. Er ist<br />
u.a. Vorsitzender der Kommission Interkulturelle Bildung der Deutschen<br />
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und Mitglied des Programmträgers<br />
des BLK-Modellversuchsprogramms „Förderung von Kindern und<br />
Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ (FörMig). <br />
Regine Schlungbaum<br />
Studium der Kunstgeschichte, Geschichte und des Städtebaus in Bonn;<br />
1980–85 studentische Mitarbeiterin beim Stadtkonservator Köln; 1985-88<br />
Forschungsauftrag des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz<br />
zur Dokumentation der Kriegszerstörungen in Köln; 1989–92 wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin beim Stadtkonservator Köln; 1992 zum Land<br />
NRW gewechselt, seitdem bei der Bezirksregierung Köln in der staatlichen<br />
Denkmalpflege tätig. Publikationen zu baugeschichtlichen und denkmalpflegerischen<br />
Themen.<br />
Christina Threuter<br />
Professorin für Kunst-, Design- und Kulturgeschichte im Fachbereich Gestaltung<br />
an der FH Trier; Studium der Kunstgeschichte, Ethnologie und<br />
Pädagogik an der Johannes Gutenberg Universität Mainz; 1993 Promotion,<br />
2006 Habilitation an der Universität Trier. Lehre und Forschung an<br />
verschiedenen Hochschulen und Universitäten (Trier, Gießen, Saarbrücken,<br />
Oldenburg und München). Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
zahlreicher Ausstellungen; Forschungsschwerpunkte liegen in der visuellen<br />
und materiellen Kultur, unter anderem zu Architektur und Raumkonzepten,<br />
Mode und Körperkonzepten, Geschlecht und Differenz, Erinnerung und Gedächtnis.<br />
Initiierte zusammen mit Heidi Helmhold „UPPS – Uses of Private<br />
and Public Space“ als Plattform für Nutzungsperspektiven von Raum in<br />
interdisziplinären Fragestellungen. Jüngste Publikation: Westwall. Bild und<br />
Mythos. Petersberg 2009.<br />
Johannes Neyses<br />
Dr. jur., Kanzler der Universität zu Köln, Mitglied des Kuratoriums der Demokratiestiftung.
188<br />
Anne Waldschmidt<br />
Univ.-Professorin für Soziologie und Politik der Rehabilitation; Disability Studies<br />
an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, Leitung der<br />
Internationalen Forschungsstelle Disability Studies (iDiS), zuvor Professorin für<br />
Sozialwissenschaft an der Evang. Fachhochschule Nürnberg (2000–2002);<br />
Postdoc in der DFG-Forschungsgruppe „Flexibler Normalismus“ an der Universität<br />
Dortmund (1997–2000); Vertretungsprofessur und wiss. Mitarbeit an<br />
der Universität Siegen (1992–1997); Promotion an der Universität Bremen<br />
(1995); Studium der Sozialwissenschaften in Bremen und Edinburgh (UK). Forschungsschwerpunkte<br />
u.a.: Wissenssoziologie, Körpersoziologie, Politische<br />
Soziologie, Bioethik/Biopolitik, Normalität und Abweichung, Europäische Behindertenpolitik,<br />
Disability Studies, Diskurstheorie und -analyse.<br />
Arne Winkelmann<br />
Studium der Architektur in Weimar und Krakau; 2004 Promotion an der<br />
Bauhaus-Universität Weimar am Lehrstuhl für Denkmalpflege zur Architektur<br />
der „sozialistischen M<strong>oder</strong>ne“; 2006 Promotion an der Humboldt-Universität<br />
zu Berlin am Kulturwissenschaftlichen Seminar zum Thema „Kulturfabriken“;2000–06<br />
Redakteur bei BauNetz Online-Dienst für Architekten, Berlin;<br />
2006–07 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Architekturmuseum,<br />
Frankfurt; 2007–08 Lehraufträge an der Hochschule Mannheim; Architekturhistoriker<br />
und -publizist in Frankfurt.