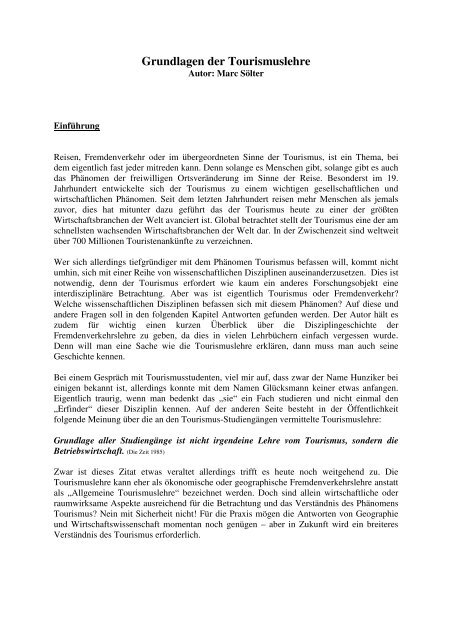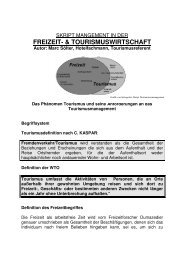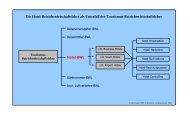Grundlagen der Tourismuslehre - Sie suchen einen Dozenten?
Grundlagen der Tourismuslehre - Sie suchen einen Dozenten?
Grundlagen der Tourismuslehre - Sie suchen einen Dozenten?
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einführung<br />
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Tourismuslehre</strong><br />
Autor: Marc Sölter<br />
Reisen, Fremdenverkehr o<strong>der</strong> im übergeordneten Sinne <strong>der</strong> Tourismus, ist ein Thema, bei<br />
dem eigentlich fast je<strong>der</strong> mitreden kann. Denn solange es Menschen gibt, solange gibt es auch<br />
das Phänomen <strong>der</strong> freiwilligen Ortsverän<strong>der</strong>ung im Sinne <strong>der</strong> Reise. Beson<strong>der</strong>st im 19.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t entwickelte sich <strong>der</strong> Tourismus zu einem wichtigen gesellschaftlichen und<br />
wirtschaftlichen Phänomen. Seit dem letzten Jahrhun<strong>der</strong>t reisen mehr Menschen als jemals<br />
zuvor, dies hat mitunter dazu geführt das <strong>der</strong> Tourismus heute zu einer <strong>der</strong> größten<br />
Wirtschaftsbranchen <strong>der</strong> Welt avanciert ist. Global betrachtet stellt <strong>der</strong> Tourismus eine <strong>der</strong> am<br />
schnellsten wachsenden Wirtschaftsbranchen <strong>der</strong> Welt dar. In <strong>der</strong> Zwischenzeit sind weltweit<br />
über 700 Millionen Touristenankünfte zu verzeichnen.<br />
Wer sich allerdings tiefgründiger mit dem Phänomen Tourismus befassen will, kommt nicht<br />
umhin, sich mit einer Reihe von wissenschaftlichen Disziplinen auseinan<strong>der</strong>zusetzen. Dies ist<br />
notwendig, denn <strong>der</strong> Tourismus erfor<strong>der</strong>t wie kaum ein an<strong>der</strong>es Forschungsobjekt eine<br />
interdisziplinäre Betrachtung. Aber was ist eigentlich Tourismus o<strong>der</strong> Fremdenverkehr?<br />
Welche wissenschaftlichen Disziplinen befassen sich mit diesem Phänomen? Auf diese und<br />
an<strong>der</strong>e Fragen soll in den folgenden Kapitel Antworten gefunden werden. Der Autor hält es<br />
zudem für wichtig <strong>einen</strong> kurzen Überblick über die Disziplingeschichte <strong>der</strong><br />
Fremdenverkehrslehre zu geben, da dies in vielen Lehrbüchern einfach vergessen wurde.<br />
Denn will man eine Sache wie die <strong>Tourismuslehre</strong> erklären, dann muss man auch seine<br />
Geschichte kennen.<br />
Bei einem Gespräch mit Tourismusstudenten, viel mir auf, dass zwar <strong>der</strong> Name Hunziker bei<br />
einigen bekannt ist, allerdings konnte mit dem Namen Glücksmann keiner etwas anfangen.<br />
Eigentlich traurig, wenn man bedenkt das „sie“ ein Fach studieren und nicht einmal den<br />
„Erfin<strong>der</strong>“ dieser Disziplin kennen. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite besteht in <strong>der</strong> Öffentlichkeit<br />
folgende Meinung über die an den Tourismus-Studiengängen vermittelte <strong>Tourismuslehre</strong>:<br />
Grundlage aller Studiengänge ist nicht irgendeine Lehre vom Tourismus, son<strong>der</strong>n die<br />
Betriebswirtschaft. (Die Zeit 1985)<br />
Zwar ist dieses Zitat etwas veraltet allerdings trifft es heute noch weitgehend zu. Die<br />
<strong>Tourismuslehre</strong> kann eher als ökonomische o<strong>der</strong> geographische Fremdenverkehrslehre anstatt<br />
als „Allgemeine <strong>Tourismuslehre</strong>“ bezeichnet werden. Doch sind allein wirtschaftliche o<strong>der</strong><br />
raumwirksame Aspekte ausreichend für die Betrachtung und das Verständnis des Phänomens<br />
Tourismus? Nein mit Sicherheit nicht! Für die Praxis mögen die Antworten von Geographie<br />
und Wirtschaftswissenschaft momentan noch genügen – aber in Zukunft wird ein breiteres<br />
Verständnis des Tourismus erfor<strong>der</strong>lich.
1. Vom Reisen zum Tourismus – Bedürfnis nach einem Tourismusbegriff<br />
Der Tourismus im 20 Jahrhun<strong>der</strong>t hat eine <strong>der</strong>artige Bedeutung erlangt, das er aus dem<br />
heutigen Leben kaum mehr wegzudenken ist. Die Bedeutungs- und Problemvielfalt des<br />
Fremdenverkehrs <strong>der</strong> damaligen Zeit, machte es notwendig den Begriff „Fremdenverkehr“<br />
wissenschaftlich zu klären. Denn was ist eigentlich Tourismus bzw. was umfasst ihn? Die<br />
folgen Stichpunkte sollen schon einmal Anregungen geben:<br />
Tourismus =<br />
• kein einheitliches Phänomen<br />
• komplexes Gefüge aus Handlungen<br />
und Konzepten<br />
• ein wesentliches Aspekt von<br />
Globalisierung<br />
• betrifft weltweit große Gruppen von<br />
Menschen und Institutionen<br />
• Phänomen das Raum und Zeit<br />
benötigt<br />
Tourismus =<br />
• Konstruktion von Fremd- und<br />
Selbstbil<strong>der</strong>n<br />
• Vermarktung von Kultur- und<br />
Konsumgütern<br />
• Inszenierungen von lokalen<br />
Identitäten<br />
1.1.1. Begriffe als Werkzeug <strong>der</strong> Theorie<br />
Tourismus =<br />
• eine <strong>der</strong> größten Wirtschaftsbranchen<br />
<strong>der</strong> Welt<br />
• global verbreitet, jedoch meist<br />
Konzentration auf bestimmte<br />
Destinationen und Orte<br />
• Makro-Ebene: globale ökonomische<br />
Prozess<br />
• Micro-Ebene: stark lokalisiertes<br />
Phänomen<br />
Tourismus =<br />
• Interkulturelle Prozesse<br />
• Interaktion zwischen Touristen und<br />
Bereisten<br />
• Beeinflusst verschiedene Bereiche<br />
<strong>der</strong> Lebenswelt lokaler Kulturen<br />
Die Theorie als rein wissenschaftliche Betrachtungsweise bzw. als System allgemeiner Sätze<br />
zur Erklärung bestimmter Tatsachen ist auf präzise definierte Begriffe angewiesen (Krippendorf<br />
1970). Klare Begriffe bilden die Grundlage klarer Systeme. Dies trifft auch auf den<br />
Fremdenverkehr / Tourismus zu. Aus einer einwandfreien Fassung seiner Grundbegriffe muss<br />
darnach auch eine haltbare Fremdenverkehrs- / <strong>Tourismuslehre</strong> und damit auch das logische<br />
System einer solchen erwachen (Hunziker 1973). Denn tatsächlich stünde eine eigenständige<br />
<strong>Tourismuslehre</strong> / Tourismuswissenschaft auf schwachen Füssen, wenn sie nicht auf ein<br />
einwandfreies umrissenes, mit Eigenleben erfülltes Erkenntnisobjekt zu stützen vermöchte (vgl.<br />
Hunziker 1954).<br />
Die Klärung <strong>der</strong> grundlegenden „Begriffe“ sowie die Präzisierung <strong>der</strong> Methoden gehören zu<br />
den Aufgaben einer Wissenschaft. Für die Entwicklung <strong>der</strong> <strong>Tourismuslehre</strong><br />
/Tourismuswissenschaft ist es also notwendig, genau zu bestimmen, welcher Tatbestand mit<br />
den Worten Fremdenverkehr / Tourismus umgrenzt werden soll. Zwar bestehen heute auf<br />
abstrakter Ebene weitgehend gemeinsame Auffassungen und Modelle für die Definition <strong>der</strong><br />
Begriffe Fremdenverkehr o<strong>der</strong> Tourismus, sobald es allerdings um eine konkrete Abgrenzung<br />
<strong>der</strong> Begriffe z.B. für ein Forschungsobjekt geht, fehlen allerdings breit akzeptierte, konkrete<br />
und vor allem operationalisierbare Kriterien.
1.1.2 Begriffe als Werkzeuge <strong>der</strong> Praxis<br />
Noch mehr in <strong>der</strong> Praxis als in <strong>der</strong> Wissenschaft ist nicht klar was Fremdenverkehr und<br />
Tourismus bedeutet, bzw. was diese Erscheinungen umfasst. Während z.B. in <strong>der</strong><br />
Wissenschaft weitgehend Einigkeit darüber besteht, dass die Begriffe Fremdenverkehr und<br />
Tourismus gleichzusetzen sind, so sind nach Sicht <strong>der</strong> Praxis beide Begriffe unterschiedlich.<br />
Um Missverständnissen vorzubeugen, muss auch hier festgelegt sein, welche Erscheinungen<br />
und Formen im Einzelnen dem Tourismus / Fremdenverkehr zuzurechnen sind (vgl. Krippendorf<br />
1970). Anwendungsbeispiele:<br />
• statistische Zwecke (Ankünfte, Übernachtungen, Beherbergungsstatistik)<br />
• rechtliche und administrative Zwecke (Gesetze, Verordnungen, Steuern)<br />
• rein praktische Zwecke (Marktuntersuchungen, Produktgestaltung)<br />
Mit exakt definierten Begriffen lassen sich in <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> sachliche Geltungsbereich und<br />
die fachliche Zuständigkeit besser festlegen.<br />
1.2.1 Definitionsmöglichkeiten des Fremdenverkehrs / Tourismus<br />
Aus <strong>der</strong> großen Anzahl <strong>der</strong> bisherigen Versuche den Fremdenverkehr zu definieren, lassen<br />
sich nach Bernecker die Definitionsbemühungen auf drei grundsätzliche Einstellungen zur<br />
Erscheinung Fremdenverkehr zurückführen. Erstens auf die Auffassung, die für die<br />
Definitionsbildung ihre Stütze in <strong>der</strong> nominalen Analyse sucht, zweitens auf die<br />
ausschließliche o<strong>der</strong> überwiegend wirtschaftliche Einstellung zum Fremdenverkehr und<br />
drittens auf die Erkenntnis, das eine Definition alle jene empfangenden und ausstrahlenden<br />
Funktionen des Fremdenverkehrs enthalten muss, die ihn zu einem komplexen Gebilde von<br />
geistigseelischen und materiellen Elementen machen (Bernecker 1957).<br />
1.2.1.1 Nominaldefinitionen<br />
Nominaldefinitionen beschreiben mehr o<strong>der</strong> weniger unabhängig vom Sprachgebrauch die<br />
ursprüngliche Bedeutung eines Begriffes. Die Nominaldefinitionen, also jene, die den Begriff<br />
aus dem Wort ableiten, nahmen zunächst eine Teilung des Wortes in „Verkehr“ und „fremd“<br />
vor (Bernecker 1957). Anhand dieser Ableitung erfolgte eine Einordnung des Fremdenverkehrs in<br />
den Oberbegriff „Verkehr“. Beson<strong>der</strong>s in den frühen Fremdenverkehrslehren wie z.B. von<br />
Boorman „Die Lehre vom Fremdenverkehr“ 1931 o<strong>der</strong> Glücksmanns<br />
„Fremdenverkehrskunde“ 1935 dient <strong>der</strong> Verkehrsvorgang als Definition für den<br />
Fremdenverkehr.<br />
1.2.1.2. Realdefinitionen<br />
Realdefinitionen ver<strong>suchen</strong> den wesentlichen Kern einer Sache o<strong>der</strong> eines Sachverhaltes<br />
darzulegen. <strong>Sie</strong> arbeiteten beson<strong>der</strong>e Merkmale des Fremdenverkehrs heraus und betonen<br />
spezifische Eigenheiten. Die meisten Realdefinitionen betrachten als Sachverhalt des<br />
Fremdenverkehrs vorwiegend die wirtschaftlichen Auswirkungen. Dies lässt sich dadurch<br />
erklären, dass die ersten wissenschaftlichen Arbeiten zum Fremdenverkehr vorwiegend den<br />
Fremdenverkehr als volkswirtschaftliche Erscheinung behandelten. So versuchte z.B. Josef
Stradner bereits im Jahr 1905/1917 eine Art Volkswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs zu<br />
entwickeln. Die wirtschaftlichen Vorgänge des Fremdenverkehrs standen zur damaligen Zeit<br />
hauptsächlich im Blickfeld, <strong>der</strong> sich entwickelnden Fremdenverkehrsforschung.<br />
1.2.1.3 Universaldefinitionen<br />
Die Erkenntnis <strong>der</strong> Tatsache, dass <strong>der</strong> Fremdenverkehr ein komplexes Gebilde ist und zu fast<br />
allen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens in Wechselbeziehungen steht, hatte die<br />
damalige Fremdenverkehrswissenschaft dazu veranlasst, eine Definition zu <strong>suchen</strong>, in <strong>der</strong> die<br />
Komplexität des Phänomens Fremdenverkehr zum Ausdruck kommt (Bernecker 1961). Als eine<br />
solche Definition kann die Definition <strong>der</strong> Fremdenverkehrswissenschaftler Hunziker und<br />
Krapf verstanden werden. Diese Definition versteht den Fremdenverkehr nicht lediglich als<br />
Verkehrsvorgang, son<strong>der</strong>n als <strong>einen</strong> weit reichenden Beziehungs- und Erscheinungskomplex,<br />
außerdem schaltet sie Kategorien von Ortsfremden als nicht zum Tourismus gehörig aus, für<br />
die wohl, rein äußerlich betrachtet, die Komponenten <strong>der</strong> Reise und des Aufenthalts Geltung<br />
besitzen, denen aber <strong>der</strong> Charakter eines lediglich vorübergehenden Wirkens zu<br />
ausschließlich konsumtiven Zwecken abgeht, weshalb sie auch <strong>der</strong> „man in the street“ nicht<br />
als Touristen ansieht (Hunziker 1954). In den Universaldefinitionen wird versucht alle mit dem<br />
Begriff Fremdenverkehr in Zusammenfassung stehenden Arten, Erscheinungsformen und<br />
Merkmale durch Verallgemeinerungen zu erfassen (vgl. Eisenstein 1995).<br />
1.2.2. Fremdenverkehrs- und Tourismusdefinitionen im Wandel <strong>der</strong> Zeit<br />
Obwohl die Begriffe Fremdenverkehr und Tourismus allgemein bekannte Begriffe sind, so ist<br />
es dennoch schwer eine allseits befriedigende Definition dafür zu finden. Denn das Phänomen<br />
des Reisens ist enorm vielgestaltig: Es reicht von einem Tagesausflug in ein Freilichtmuseum<br />
in <strong>der</strong> näheren Umgebung über die Teilnahme an einem Kongress o<strong>der</strong> den<br />
Wochenendbesuch bei Fremden in <strong>der</strong> nächsten Großstadt bis hin zu einem Badenaufenthalt<br />
o<strong>der</strong> einer Studienreise am Mittelmehr (Steinecke 2006). In <strong>der</strong> Vergangenheit sind zahlreiche<br />
Versuche unternommen worden, die Erscheinungen und Formen des Fremdenverkehrs und<br />
Tourismus in exakten und klaren Begriffsbestimmungen zu erfassen. Zwar gibt es<br />
Definitionen <strong>der</strong> Begriffe „Fremdenverkehr“ und „Tourismus“ in nahezu gleicher Zahl als es<br />
Autoren zu diesem Thema gibt, aber je mehr Praktiker und Wissenschaftler sich damit<br />
befassten, desto offenkundiger wurde <strong>der</strong> Umfang und die Reichweite <strong>der</strong> Phänomene<br />
Fremdenverkehr bzw. Tourismus und desto ungenügen<strong>der</strong> und unbefriedigen<strong>der</strong> dessen<br />
bisherige begriffliche Bestimmungen (vgl. Bernecker 1957). Als <strong>einen</strong> Mangel sieht z.B. Gierske das<br />
bei den bisherigen Betrachtungen zum Tourismus, die historische Perspektive fehlt. Während<br />
<strong>der</strong> eine "Tourismus" sagt und damit die neuen Formen des Verreisens meint, versteht ein<br />
an<strong>der</strong>er darunter "Reisen überhaupt", womit er sich durchaus auf den Brockhaus berufen<br />
kann. Begriffliche Klärungen ohne <strong>einen</strong> hinreichenden historischen Hintergrund bleiben hier<br />
problematisch und erwecken den Anschein <strong>der</strong> Willkür (Gierske 1965).<br />
Der Umstand, das es bisher keine allgemeingültige Definition des Tourismus gibt, führen<br />
Tourismusforscher wie z.B. Leiper 1979 und Heeley 1980 darauf zurück, das es von<br />
Regierungsstellen, Verbänden etc. zu viele und teilweise zu sehr durch eigene Interessen und<br />
Perspektiven getriebene Definitionen gibt (vgl. Smith 1988).<br />
Die Vielfalt <strong>der</strong> Erscheinungsformen des Reisens und <strong>der</strong> Reisemotive ist schwer in einer<br />
kurzen Begriffsbestimmung zu fassen. Die Definitionsversuche stehen dabei im Spannungsfeld
zwischen dem Anspruch auf Operationalisierbarkeit ihrer Begriffe, d.h. ihrer konkreten<br />
Anwendungsmöglichkeit (z.B. für statistische Zwecke), einerseits und dem Anspruch, die<br />
historisch-gesellschaftlichen Tendenzen einzufangen, die im Untersuchungsgegenstand<br />
aufbewahrt sind und sich dort brechen (Prahl/Steinecke 1981, 9).<br />
Die zahllosen Versuche, Tourismus, Fremdenverkehr und Freizeit zu definieren, sind immer<br />
wie<strong>der</strong> in Übersichten und Synopsen zusammengestellt worden (Grünthal 1930; Benscheidt<br />
1932/33, Bernecker 1952/53, Kaspar/Schmidhauser 1971, Schadlbauer 1973, Boeckmann<br />
1975, Potke 1978, Arndt 1978/79). Die vorliegenden Definitionen sind in dem Bestreben<br />
gescheitert, sämtliche Formen des Phänomens Reisen in einer Begriffsbestimmung fassen zu<br />
können; auch differenzierte und umfangreiche Definitionsversuche haben dieses Problem<br />
nicht bewältigen können (Steinecke/Kulinat 1984). An<strong>der</strong>e Autoren wie z.B. Pöschel, glauben das sich<br />
eine so komplexe Erscheinung wie <strong>der</strong> Fremdenverkehr überhaupt einer sinnvollen<br />
Definition, die immer zwischen Tautologie und Ungenauigkeit schwanken wird entzieht. Wie<br />
problematisch terminologische Fragen sind, zeigt auch Newig 1975 mit seinem<br />
Strukturschema des Freizeitverkehrs. In seinem Strukturschema des Freizeitverkehrs, den er<br />
mit „Tourismus“ gleichsetzt und in „Reiseverkehr“ und „Freizeitkonsum“ aufspaltet, ist eine<br />
Liste von 25 Definitionen und ergänzenden Erläuterungen beigefügt (Benthien 1997). Die<br />
Wirklichkeit des Tourismus ist so facettenreich, dass sie unsere terminologischen Systeme zu<br />
zersprengen droht, deshalb sei es notwendig, so Benthien (1997), „Mut zur terminologischen<br />
Mitte“ zu beweisen. Da aber Wissenschaft und Praxis auf genaue, klare Begriffe angewiesen<br />
sind, soll hier kurz eine Übersicht aus über 100 Jahren Bemühungen den Fremdenverkehr zu<br />
definieren, wie<strong>der</strong>gegeben werden.<br />
Guyer-Freuler, „Fremdenverkehr und Hotelwesen“ Bern 1905:<br />
Fremdenverkehr im mo<strong>der</strong>nen Sinne ist eine Erscheinung <strong>der</strong> Neuzeit, beruhend auf dem vermehrten<br />
Bedürfnis nach Erholung und Luftverän<strong>der</strong>ung, dem erwachten und gepflegten Sinn für landschaftliche<br />
Schönheit, <strong>der</strong> Freude und dem Genuss <strong>der</strong> freien Natur, insbeson<strong>der</strong>e aber bedingt durch die vermehrten<br />
Mischungen <strong>der</strong> verschiedenen Völker und Kreise <strong>der</strong> menschlichen Gesellschaft, infolge <strong>der</strong> Entwicklung von<br />
Handel, Industrie und Gewerbe und <strong>der</strong> Vervollkommnung <strong>der</strong> Transportmittel.<br />
Schullern zu Schrattenhofen „Artikel Fremdenverkehr“ 1911:<br />
Fremdenverkehr ist <strong>der</strong> Begriff aller jener und in erster Reihe aller wirtschaftlichen Vorgänge, die sich im<br />
Zuströmen, Verweilen und Abströmen Frem<strong>der</strong> nach, in und aus eine bestimmte Gemeinde, einem Lande,<br />
einem Staate betätigen und damit unmittelbar verbunden sind.<br />
Wilhelm Morgenroth, „Artikel Fremdenverkehr“ 1927:<br />
Fremdenverkehr im engsten Sinn ist <strong>der</strong> Verkehr von Personen.., die sich vorübergehend von ihrem<br />
Dauerwohnsitz entfernen, um zur Befriedigung von Lebens- und Kulturbedürfnissen o<strong>der</strong> persönlichen<br />
Wünschen verschiedenster Art an<strong>der</strong>wärts, lediglich als Verbraucher von Wirtschafts- und Kulturgütern zu<br />
verweilen.<br />
Arthur, Boormann, „Die Lehre vom Fremdenverkehr“:<br />
Fremdenverkehr ist <strong>der</strong> Inbegriff <strong>der</strong> Reisen, die zum Zwecke <strong>der</strong> Erholung, des Vergnügens, geschäftlicher<br />
o<strong>der</strong> beruflicher Betätigung o<strong>der</strong> aus sonstigen Gründen, in vielen Fällen aus Anlass beson<strong>der</strong>er<br />
Veranstaltungen o<strong>der</strong> Ereignisse, vorgenommen werden und bei denen die Abwesenheit vom ständigen<br />
Wohnsitz nur vorübergehend, im Berufsverkehr jedoch nicht bloß durch die regelmäßige Fahrt zur<br />
Arbeitsstätte bedingt ist.<br />
Robert Glücksmann: „Die wissenschaftliche Behandlung des Fremdenverkehrs“ 1930:<br />
Fremdenverkehr = Überwindung des Raums durch Menschen, die zu einem Ort hinstreben, an dem sie k<strong>einen</strong><br />
ständigen Wohnsitz haben.
Fortsetzung<br />
Robert Glücksmann: „Fremdenverkehrskunde“ 1935:<br />
Fremdenverkehr = Summe <strong>der</strong> Beziehungen zwischen einem am Ort seines Aufenthalts nur vorübergehend<br />
befindlichen Menschen und Menschen an diesem Ort.<br />
Walter Hunziker, Kurt Kraf, „Fremdenverkehrslehre“ 1942<br />
Fremdenverkehr ist somit <strong>der</strong> Inbegriff <strong>der</strong> Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus dem Aufenthalt<br />
Ortsfrem<strong>der</strong> ergeben, sofern durch den Aufenthalt keine Nie<strong>der</strong>lassung zur Ausübung einer dauernden o<strong>der</strong><br />
zeitweiligen hauptsächlichen Erwerbstätigkeit begründet wird.<br />
AIEST 1954<br />
Fremdenverkehr ist <strong>der</strong> Inbegriff <strong>der</strong> Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus <strong>der</strong> Reise und dem<br />
Aufenthalt Ortsfrem<strong>der</strong> ergeben, sofern durch den Aufenthalt keine Nie<strong>der</strong>lassung zur Ausübung einer<br />
dauernden o<strong>der</strong> zeitweiligen hauptsächlichen Erwerbstätigkeit begründet wird.<br />
Paul Bernecker, „Die Stellung des Fremdenverkehrs im Leistungssystem <strong>der</strong> Wirtschaft“ 1955:<br />
Fremdenverkehr ist die Erstellung wirtschaftlicher Leistungen zur Befriedigung des zeitweiligen<br />
Ortsverän<strong>der</strong>ungsbedürfnisses und <strong>der</strong> unmittelbar aus diesem entstehenden an<strong>der</strong>weitigen Bedürfnisse.<br />
Paul Bernecker, „<strong>Grundlagen</strong>lehre des Fremdenverkehrs“ 1962<br />
Als Fremdenverkehr bezeichnen wir die mit dem Tatbestand <strong>der</strong> vorübergehenden und freiwilligen<br />
Ortsverän<strong>der</strong>ung aus nichtgeschäftlichen o<strong>der</strong> beruflichen Gründen verbundenen Beziehungen und<br />
Leistungen.<br />
Claude Kaspar, „Die Fremdenverkehrslehre im Grundriss“ 1975<br />
Fremdenverkehr o<strong>der</strong> Tourismus wird definiert als Gesamtheit <strong>der</strong> Beziehungen und Erscheinungen, die sich<br />
aus <strong>der</strong> Reise und dem Aufenthalt von Personen ergeben, für die <strong>der</strong> Aufenthaltsort we<strong>der</strong> hauptsächliche und<br />
dauern<strong>der</strong> Wohn und Arbeitsort ist.<br />
Gerhardt Armanski, „Die kostbarsten Tage des Jahres –Tourismus – Ursachen, Formen, Folgen<br />
1986<br />
Unter Tourismus verstehe ich jenen Vorgang, <strong>der</strong> das Urlaubsreisen mit dem vorwiegenden Zweck <strong>der</strong><br />
Erholung und des Erlebens umfasst.<br />
WTO 1991<br />
Aktivitäten von Personen, die an Orte außerhalb ihrer gewohnten Umgebung reisen und sich dort zu Freizeit-,<br />
Geschäfts- o<strong>der</strong> bestimmten an<strong>der</strong>en Zwecken (außer einer Tätigkeit, die vom besuchten Ort bezahlt wird) nicht<br />
länger als ein Jahr ohne Unterbrechung aufhalten.<br />
Walter Freyer, „Tourismus – Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie“ 1996<br />
„Tourismus umfasst alle Erscheinungen, die mit dem Verlassen des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und dem<br />
Aufenthalt am an<strong>der</strong>en Ort verbunden sind“ (weiter Tourismusbegriff).
Die beträchtliche Anzahl <strong>der</strong> Tourismusdefinition mag erschrecken, dabei sind die möglichen<br />
Definitionen selbstverständlich we<strong>der</strong> willkürlich noch nach Schönheit gewählt, son<strong>der</strong>n nach<br />
pragmatischen Zwecken (etwa danach, wie „Touristen“ tatsächlich beim<br />
grenzüberschreitendem Verkehr gezählt werden) und nach dem theoretischen Problemrahmen<br />
in dem eine Untersuchung stattfindet (vgl. Fischer 1984). Die oben genannten<br />
Tourismusdefinitionen weisen unterschiedliche Schwerpunkte auf. So stehen z.B. einmal<br />
strukturelle Voraussetzungen o<strong>der</strong> z.B. die Motivationen im Mittelpunkt. Eine einfache aber<br />
leicht verständliche Umschreibung des Tourismus ist, ihn als Schnittmenge aus horizontaler<br />
Mobilität bzw. aus Freizeit und Reisen zu umschreiben. Ähnlich simpel ist auch die<br />
Definition von Fischer (1984) die auf den Grundpfeilern „Frem<strong>der</strong>“, „Reisen<strong>der</strong>“ und „Freizeit“<br />
basiert, Touristen wären somit: „Fremde Reisende in ihrer Freizeit“.<br />
1.2.3 Angebots- und nachfrageseitige Definitionen des Tourismus<br />
Betrachtet man den Tourismus aus ökonomischer Sicht, so kann <strong>der</strong> Tourismus selbst als<br />
Markt bzw. Tourismusmarkt mit den typischen Ausprägungen von Angebot und Nachrage<br />
verstanden werden. Daraus lassen sich auch zwei grundsätzliche Ansätze für die Definition<br />
des Tourismus ableiten: <strong>einen</strong> angebotsorientierten und <strong>einen</strong> nachfrageorientierten.<br />
Angebotsorientierte Tourismusdefinitionen setzen zur Abgrenzung bei den Eigenheiten <strong>der</strong><br />
Anbieter auf dem touristischen Markt an. Nach Leiper 1979 kann demnach <strong>der</strong> Tourismus<br />
definiert werden als Industrie, die aus den Unternehmen besteht, welche Leistungen für die<br />
Bedürfnisse und Anliegen von Touristen erbringen. Angebotsseitige Definitionen des<br />
Tourismus sind von Bedeutung bei <strong>der</strong> Abgrenzung des Sektors im Zusammenhang mit <strong>der</strong><br />
Erfassung seiner wirtschaftlichen Effekte und für die Diskussion wirtschaftspolitischer<br />
Maßnahmen (Bieger 2004). Es erfolgt also eine Abgrenzung als Wirtschaftsfaktor bzw. Industrie<br />
die Leistungen für die Bedürfnisse und Anliegen von Tourismus erbringen<br />
“Tourism is an activity involving a complex mixture of material and psychological elements.<br />
The material ones are accommodation, transportation, the attractions and the entertainments<br />
available. The psychological factors include a wide spectrum of attitudes and expectations.”<br />
(Quelle: Foster 1985)<br />
Nachfrageseitige Definitionen setzen bei <strong>der</strong> Frage an, wer ein Tourist ist. Der Tourist ist<br />
eine Person, welcher eine Reise außerhalb seines gewohnten Arbeits- und Lebensumfelds<br />
unternimmt (Jafari 1977 zit. in Bieger 2004).<br />
• UN (United Nations)„... die ein Land be<strong>suchen</strong>, das nicht ihr normales Herkunftsland<br />
ist.“ (Gee/Makens/Choy 1997: 11)<br />
• WTO (World Tourism Organisation) unterscheidet zwischen Touristen (> 1<br />
Übernachtung) und Ausflügler
1.2.4 Weitere Unterscheidungsmöglichkeiten <strong>der</strong> Tourismusdefinitionen<br />
In seinem Aufsatz „Zur Soziologie des Fremdenverkehrs“ hat Gleichmann den Versuch<br />
unternommen die jeweils gebräuchlichsten Tourismusdefinitionen einer Disziplin bzw.<br />
Wissenschaft zuzuordnen. Als gebräuchlichste Definitionen nennt er:<br />
1. die fremdenverkehrswissenschaftliche, ferner<br />
2. wirtschaftswissenschaftliche und<br />
3. betriebswirtschaftlich orientierte,<br />
4. eine kommunalwissenschaftliche,<br />
5. eine geographische,<br />
6. eine verkehrswissenschaftliche<br />
Mit einigem Willen zur genauen Unterscheidung lassen sich dann noch einige Versuche<br />
ausmachen, wenigstens den Touristen zu definieren:<br />
7. zu statistischen Zwecken evtl. unter<br />
8. soziologischem Aspekt<br />
Schon diese Aufzählung an Definitionen, lässt erkennen wie Umfang- und Facettenreich die<br />
Phänomene Fremdenverkehr bzw. Tourismus sind. So interessiert sich z.B. die Geographie<br />
primär für die raumwirksamen Aspekte des Fremdenverkehrs. Daher hängt die jeweilige<br />
Begriffswahl für die Definition von Fremdenverkehr und Tourismus, jeweils von dem<br />
vorherrschenden Forschungsinteresse ab, so dass eine völlige Vereinheitlichung gar nicht zu<br />
erwarten ist (vgl. Kemper 1975). Denn die in <strong>der</strong> Tourismusforschung involvierten<br />
Wissenschaftsdisziplinen bzw. dessen Forscher neigen oft dazu, spezielle Elemente und<br />
Perspektiven <strong>der</strong> jeweiligen Mutterwissenschaft in die touristische Forschung einfließen zu<br />
lassen. Da die Resultate tourismuswissenschaftlicher Untersuchungen häufig von<br />
Interessengruppen bei <strong>der</strong> Lobbyarbeit o<strong>der</strong> von politischen Entscheidungsträgern zur<br />
Begründung von För<strong>der</strong>maßnahmen eingesetzt werden, können definitorischen Unterschiede<br />
rasch eine erhebliche politische bzw. ökonomische Bedeutung erlangen (Steinecke 2006).<br />
Wer sich einmal tiefer mit den vorliegenden Forschungsarbeiten aus den Bereichen Freizeit,<br />
Fremdenverkehr und Naherholung beschäftigt, <strong>der</strong> wird z.B. feststellen das z.B. die<br />
Geographen primär die Fremdenverkehrsdefinition von Poser o<strong>der</strong> Ruppert für ihre<br />
fremdenverkehrsgeographischen Arbeiten bevorzugten. Hingegen wird bei<br />
Gesamtdarstellungen über den Fremdenverkehr bzw. Lehrbüchern / Fremdenverkehrlehren<br />
die Definition von Hunziker / Krapf bzw. von Claude Kaspar verwendet. Ohne <strong>der</strong> eigenen<br />
Disziplin <strong>einen</strong> bestimmten Vorrang geben zu wollen, weißt Claude Kaspar darauf hin, dass<br />
es ökonomische Gegebenheiten sind, welche die Ortsverän<strong>der</strong>ung zum Zwecke eines<br />
Aufenthalts außerhalb des Wohn- o<strong>der</strong> Arbeitsortes erst ermöglichen, d.h. aus einem<br />
Bedürfnis nach Reisen, Erholung usw. eine effektive marktwirksame Nachfrage entstehen<br />
lassen (Kaspar 1978). Da die meisten Tourismus-Studienangebote in Deutschland primär an<br />
Fachhochschulen im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre angeordnet sind, macht es wohl<br />
auch Sinn Tourismusdefinitionen von (Tourismus-) Ökonomen den Vorrang in den<br />
Lehrbüchern zu geben.
1.2.5 Begriffsnotwendige Merkmale<br />
Fasst man die wesentlichen Elemente <strong>der</strong> bisherigen Fremdenverkehrsdefinitionen zusammen,<br />
so erhält man folgende Kriterien die den Touristen bestimmen:<br />
• Personenverkehr, temporärer Ortswechsel: zeitlich begrenzte regionale Mobilität<br />
• Beziehung und Beziehungslosigkeit mit den „Einheimischen“<br />
• Auftreten in reiner Konsumfunktion mit Mitteln, die am Heimatort verdient wurden<br />
(Knebel 1960)<br />
Nach übereinstimmen<strong>der</strong> Auffassung <strong>der</strong> Welttourismusorganisation (WTO), <strong>der</strong><br />
Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie des<br />
Statistischen Amtes <strong>der</strong> Europäischen Gemeinschaft (SAEG) ist <strong>der</strong> Tourismusbegriff an zwei<br />
Grundvoraussetzungen gebunden (Opaschowski 2002):<br />
1. Der Besuch eines Ortes außerhalb des gewöhnlichen Aufenthaltsortes ist nur<br />
vorübergehende.<br />
2. Am Zielort ausgeübte Tätigkeiten werden nicht von dort entlohnt.<br />
Praktiker und Wissenschaftler, die im Bereich Tourismus tätig sind, beschäftigen sich<br />
vorwiegend mit drei konstitutiven Elementen des Reisens:<br />
• mit dem Ortswechsel von Personen, <strong>der</strong> über den normalen Aufenthaltsort hinausgeht<br />
und an <strong>einen</strong> „fremden“ Ort führt, dieser Ortswechsel erfolgt mit verschiedenen<br />
Transportmitteln<br />
• mit dem Aufenthalt am fremden Ort, <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Regel in Hotels o<strong>der</strong> <strong>der</strong> so genannten<br />
Parahotellerie, zum Teil in Privatunterkünften bei Freunden und Bekannten erfolgt.<br />
Dieser Aufenthalt ist vorübergehend, <strong>der</strong> Reisende hat die Absicht, nach Stunden,<br />
Tagen, Wochen o<strong>der</strong> Monaten zurückzukommen.<br />
• Mit den Motiven des Ortswechsels, also <strong>der</strong> Frage, warum gereist wird. (Freyer 1996)<br />
Eigene Anmerkungen: Abgesehen vom Geschäftsreiseverkehr, sind zudem kennzeichnend für<br />
den Tourismus:<br />
• Die Freisetzung von Arbeit in Form von Ferien und Freisetzung als vorübergehende<br />
Herauslösung aus normalen sozialen Bezügen in <strong>der</strong> Form <strong>der</strong> Ortsverän<strong>der</strong>ung<br />
• Der Tourist fügt sich an seinem vorübergehenden Aufenthaltsort nicht in das dortige<br />
Leben ein, son<strong>der</strong>n erwartet meist Betreuung durch <strong>einen</strong> beson<strong>der</strong>en Zweig von<br />
Dienstleistungen, <strong>der</strong> ihm die Beschwerlichkeiten eines Einfügens in <strong>einen</strong> an<strong>der</strong>en<br />
sozialen Zusammenhang erspart. (Scheuch 1977)
1.2.4 Etymologie <strong>der</strong> Begriffe Fremdenverkehr / Tourismus<br />
Fremdenverkehr<br />
Unter dem Begriff „fremd“ wurde im Deutschen das, was einem nicht nahe steht, also<br />
unbekannt ist, womit man nicht befreundet o<strong>der</strong> vertraut ist bezeichnet (vgl. Opaschwoski 1989). Das<br />
mittelhochdeutsche Wort „vremede“ entstammte dem germanische fram und bedeutete<br />
Entfernung, Trennung, Feindschaft, fremdes Land (Prahl/Steinecke 1981). Als Fremden<br />
(althochdeutsch fremedi) beschrieb man früher <strong>einen</strong>, <strong>der</strong> „fram“ (Grundbedeutung „weg,<br />
entfernt“,) „exterus“ (ex terra = aus dem Land), fern von seinem Heimatland war, also den<br />
Nichteinheimischen, den Auslän<strong>der</strong>. Der Begriff leitet sich aus dem gotischen „fram“ ab und<br />
bedeutet fern, weg von (E. Spatt 1974). Als „fremd“, konnte also im übertragenen Sinn die jenige<br />
Person bezeichnet werden, die aus <strong>der</strong> Ferne kam.<br />
Das Wort „Fremdenverkehr“ leitete sich aber ebenfalls, aus dem althochdeutschen Begriff<br />
„eli-lenti“ ab, worunter man so viel verstand wie „im fremden Lande“ (vgl. E. Spatt 1974). Jedoch<br />
hat sich dieses Wort über das mittelhochdeutschen „elende“, was soviel bedeutete wie<br />
„jammervoll“, „unglücklich“ und als Hauptwort etwa mit den Begriffen „Not“, „Verbannung“<br />
o<strong>der</strong> „Ausland“ zu übersetzen wäre, zu dem heutigen Wort „Elend“ entwickelt. Die Begriffe<br />
„eli-lenti“ und „elende“ waren mit <strong>der</strong> Vorstellung verknüpft, das die Menschen, welche aus<br />
an<strong>der</strong>en Gegenden und Län<strong>der</strong>n kamen, sich in einer bedauernswerten Lage befanden. Im<br />
Laufe <strong>der</strong> sprachlichen Entwicklung hat sich dann das Wort „fremd“ durchgesetzt (E. Spatt 1974).<br />
Der Fremde war zugleich <strong>der</strong> Feind, er galt als rechtlos und hatte kein Anrecht auf Schutz und<br />
Frieden. Teilweise, waren die Fremden den Schikanen <strong>der</strong> Einheimischen ausgesetzt und<br />
wurden ihrem Schicksal selbst überlassen.<br />
Neuere Forschungen kamen zu dem Ergebnis, das <strong>der</strong> Begriff „Fremdenverkehr“ vermutlich<br />
1850 zum ersten mal, in einer im Auftrag des Ministers von Ladenberg verfassten Denkschrift<br />
eines Arztes, zu Fragen <strong>der</strong> Prostitution in Berlin auftauchte. Der Arzt Fr. J. Behrend wies<br />
nach, dass es – trotz des beschleunigten Wachstums <strong>der</strong> Bevölkerung <strong>der</strong> Stadt Berlin und <strong>der</strong><br />
gleichzeitigen Zunahme des Fremdenverkehrs „in hohem Grade“ – <strong>der</strong> Polizei gelungen sei,<br />
die Prostitution in Berlin erheblich einzuschränken (Opaschowski 1989).<br />
Eigene Forschungen ergaben allerdings,<br />
• In einem <strong>der</strong> Heidelberger Jahrbücher <strong>der</strong> Literatur - Seite 1049 von 1808 findet sich<br />
<strong>der</strong> Begriff „Fremdenverkehr“ in folgendem Satz „..auch das gelbe Fieber bricht los in<br />
volken Orten mit viel Fremdenverkehr aus …“<br />
• In dem 1830 erschienen Buch von Heinr Plath „Geschichte des östlichen Asiens“ wird<br />
<strong>der</strong> Begriff „Fremdenverkehr“ im Inhaltverzeichnis genannt: Miscellanea. a)<br />
Auswan<strong>der</strong>ungen – Fremdenverkehr usw. Not d. Volkes – Auswan<strong>der</strong>ungen verboten<br />
– warum? nach Norden erlaubt – Zutritt dem Fremden verwehrt – Fremdenverkehr –<br />
Versuch <strong>der</strong> Russen in Canton <strong>einen</strong> Handel zu eröffnen scheitert- …<br />
• dass <strong>der</strong> Begriff Fremdenverkehr zudem bereits 1844 in einem Vortrag von E. Curtius<br />
„Die Akropolis von Athen“ genannt wurde. Dort heißt es (Seite 22): „Zudem war<br />
Ägypten in dieser späten Epoche gegen allen Fremdenverkehr vollkommen<br />
abgeschlossen.
• Zudem lässt sich in dem 1857 veröffentlichten Buch von E. Curtius „Griechische<br />
Geschichte“ <strong>der</strong> Begriff Fremdenverkehr ebenfalls literarisch nachweisen. Dort steht<br />
auf Seite 344 „So waren die Verhältnisse unter <strong>der</strong> Dynastie <strong>der</strong> Aethiopen; <strong>der</strong><br />
Verkehr bestand nur unter drückendem Zwange einheimischer Polizei, etwa wie<br />
neuerdings <strong>der</strong> Fremdenverkehr in Städten wie Canton und Nangasaki, …<br />
Auch in einem öffentlichen Vortrag über den „Weltuntergang <strong>der</strong> griechischen Cultur“, den<br />
E. Curtius im Jahre 1858 an <strong>der</strong> Universität Göttingen gehalten hat, ist diese Formulierung zu<br />
finden: „ Nachdem sich das Land (gemeint ist Ägypten) einmal dem Fremdenverkehr geöffnet<br />
hatte, dauerte es nicht lange, bis das die Stärke des Pharaonenreiches auf den Griechen<br />
beruhte“ (E. Spatt 1974). Nach Spatt wird Begriff Fremdenverkehr in etwa 1866 literarisch<br />
nachweisbar – er bezieht sich hier wohl auf Hartsch (1968) nachdem <strong>der</strong> Begriff<br />
Fremdenverkehr erstmals in dem 1866 in Hamburg erschienen Buch „Recht <strong>der</strong> Frauen auf<br />
Erwerb“ von Louise Otto-Peters, <strong>der</strong> bürgerlichen Vorkämpferin für die Gleichberechtigung<br />
<strong>der</strong> Frauen, in Verbindung mit Dresden als einer <strong>der</strong> „Städte mit starkem Fremdenverkehr“<br />
auftaucht - dies konnte durch eigene Forschungen wi<strong>der</strong>legt werden. Allgemein literarisch<br />
nachweisbar ist <strong>der</strong> Begriff somit seit 1808 bzw. 1830<br />
Neu und bisher noch in keiner Publikation zur <strong>Tourismuslehre</strong> erfasst, ist also:<br />
• Der Begriff „Fremdenverkehr“ taucht bereits 1808 auf und ist auch seit diesem<br />
Datum – spätestens allerdings seit 1830 literarisch nachweisbar.<br />
Tourismus<br />
Tour bezeichnete im Griechischen ein zirkelähnliches Werkzeug. Kennzeichnend für die<br />
gesamte Wortgruppe (vgl. auch mittellatein. „tornum“) war <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> Rundung, <strong>der</strong> eine<br />
zum Ausgangspunkt zurückkehrende Wendung beinhaltete (Opaschowski 1989). Eine Tour ist<br />
demnach ein „Wohin und zurück“, eine Reise weg vom normalen Wohnort hin zu einem<br />
an<strong>der</strong>en Ort, an dem man für eine Zeit verweilt, um dann wie<strong>der</strong> zum Ausgangspunkt<br />
zurückzukehren; ein Tourist ist jemand, <strong>der</strong> eine solche Tour macht (Mundt 1998) Entsprechend<br />
wird auch <strong>der</strong> Aspekt <strong>der</strong> "Rückkehr" o<strong>der</strong> des nur zeitweiligen o<strong>der</strong> vorübergehenden<br />
Aufenthaltes an einem an<strong>der</strong>en Ort meist mit" Tourismus" verbunden (Freyer 1998). Beim<br />
Tourismus ist die Rückkehr fester Bestandteil <strong>der</strong> Reise, es steht schon im Voraus fest und ist<br />
meist auch gewiss (außer z.B. bei Tod) das man wie<strong>der</strong> an den Ausgangspunkt <strong>der</strong> Reise<br />
(Heimat) zurückkehren wird.<br />
Das Wort Tourismus stammt eigentlich aus dem griechischen und war Bezeichnung für ein<br />
zirkelähnliches Werkzeug und gelangte über das lateinische tornare ins Englische und<br />
Deutsche (vgl. Mundt 1998). Das Wort Tour wurde schließlich auf Dinge übertragen, die sich<br />
drehten o<strong>der</strong> gedreht wurden, wie zum Beispiel die Umdrehung einer Walze, einer Welle,<br />
eines Motors (vgl. Tourenzahl) (Opaschowski in Prahl/Steinecke 1981).
• tornare lateinisch = runden<br />
• tornum mittelllatein. = Rundung<br />
• tornos (griechisch) = Turnus, Wie<strong>der</strong>holung, Rundung<br />
• tornus (lateinisch) = Turnus, Wie<strong>der</strong>holung, Rundung<br />
• tour französisch = Rundgang, Umlauf<br />
• Tourist = Person, die eine solche Tour macht<br />
Im 17. Jahrhun<strong>der</strong>t bedeutete das Wort „Tour“ soviel wie Umgang, Rundgang, Spaziergang<br />
und war als geruhsamer Rundgang um den eigenen Besitz am Abend (tour de propriétaire)<br />
üblich (Prahl / Steinecke 1981). In Adelskreisen unterschied man schon bald zwischen <strong>der</strong> „kl<strong>einen</strong><br />
Tour“ und <strong>der</strong> „großen Tour“ (Opaschowski 1989). Beson<strong>der</strong>s in Adelskreisen gehörte die „grand<br />
tour“ des jungen Adligen zur Ausbildung <strong>der</strong> Führungselite. Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> ab ca.<br />
1870 aufkommenden Bergtouristik, tauchte das Wort „Tour“ als Bedeutung für alpine<br />
Bergbesteigung auf. Nach Beendigung des deutsch-französischen Kriegs, wurde das Wort<br />
„Tour“ im neuen deutschen Reich zunehmend verpönt und durch Begriffe wie Reise o<strong>der</strong><br />
Wan<strong>der</strong>ung ersetzt.<br />
Das Wort „Tourist“ ist erstmals um 1800 im Englischen belegt (z.B. Oxford English<br />
Dictionary 1811). 1918 taucht es im Französischen auf. Im Deutschen wird es nach 1830<br />
unmittelbar aus dem Englischen übernommen (Opaschowski 1989). Mit <strong>der</strong> beginnenden<br />
Popularisierung einzelner früher Fremdenverkehrsformen und ihrer räumlichen Ausbreitung<br />
mehren sich Wortbildungen mit dem Prä- o<strong>der</strong> Suffixen „tour“ und „tourist“<br />
(Vergnügungstour, Radtour, Tourenleiter, Touristenkarte, Touristenproviant) und zeigen ein<br />
Übergreifen des Fremdenverkehrs auf breite soziale Schichten an (Uthoff 1988).
Tourismus als Oberbegriff<br />
„alle Reisen, unabhängig von ihren Zielen und Zwecken, die den zeitweisen Aufenthalt an<br />
einem an<strong>der</strong>en als dem Wohnort einschließen und bei denen die Rückfahrt Bestandteil <strong>der</strong><br />
Reise ist“<br />
1.2.5 Unterscheidung Fremdenverkehr / Tourismus<br />
In <strong>der</strong> Praxis und <strong>der</strong> Wissenschaft herrschen unterschiedliche Auffassungen über die Begriffe<br />
Fremdenverkehr und Tourismus. Zwar verliert <strong>der</strong> ältere – rein deutsche Begriff –<br />
„Fremdenverkehr“ zunehmend an Bedeutung, allerdings sollen hier trotzdem kurz, wichtige<br />
Tendenzen und Begrifflichkeiten erläutert werden.<br />
Während sich die Wissenschaftsgemeinde weitgehend einig ist, dass beide Begriffe identisch<br />
und somit gleichzusetzen sind; herrscht in <strong>der</strong> Praxis gerade die entgegen gesetzte Meinung –<br />
Fremdenverkehr und Tourismus sind nicht identisch. Die Praktiker wenden ein, dass es mehr<br />
als nur Nuancen sind, wodurch sich die Begriffe unterscheiden.<br />
Mit beginn des Wirtschaftswun<strong>der</strong>s in den 50er Jahren, als es für eine wachsende Zahl von<br />
Bundesbürgern finanziell möglich wurde, in Urlaub zu reisen, sprach man allgemein von<br />
Fremdenverkehr und verstand darunter die traditionelle Urlaubsreise (Feldmann 1997). Durch seine<br />
Betonung <strong>der</strong> verkehrsseitigen Komponente könnte <strong>der</strong> Fremdenverkehrsbegriff gerade im<br />
Rahmen verkehrsökonomischer o<strong>der</strong> tourismusgeographischer Betrachtungen von Vorteil<br />
sein, doch die „dem Fremden“ latent anhaftenden negativen Wertigkeiten geben den<br />
Ausschlag für eine Vernachlässigung dieses Terminus (vgl. Preisinger 1995).<br />
Schon allein das Wort „Fremdenverkehr“ zeigt den Standort an, von dem aus die<br />
gesellschaftliche Reisetätigkeit und die Reisenden als Akteure betrachtet werden. Der<br />
Reisende ist hier als <strong>der</strong> Fremde, auch wenn er vielleicht Landsmann aus <strong>der</strong> Nachbarschaft<br />
ist (Bendixen 1997). Wenn jemand von Fremdenverkehr sprechen kann, dann wird es vermutlich<br />
<strong>der</strong> Gastgeber sein. Denn er bietet „Fremden“ Beherbergung, Verpflegung sowie<br />
Informations- und Betreuungsdienste. Der Reisende bzw. Tourist würde sich nie als<br />
„Fremden“ bezeichnen, er ist Gast o<strong>der</strong> versteht sich selbst als Besucher eines bestimmten<br />
Zielgebietes. Lei<strong>der</strong> ist bereits <strong>der</strong> Wortteil „fremd“ unglücklich gewählt. Denn <strong>der</strong> Ferien –<br />
o<strong>der</strong> Urlaubsgast wie auch <strong>der</strong> durchreisende Gast sollen sich eben nicht als „Fremde“ fühlen<br />
müssen, son<strong>der</strong>n als „Gastfreunde“ aufgenommen werden (Zedek 1970). So sind in den letzten<br />
Jahrzehnten wie<strong>der</strong>holt Preisausschreiben ausgesetzt worden mit dem Ziel, für das Wort<br />
Fremdenverkehr <strong>einen</strong> neuen Ausdruck zu gewinnen (vgl. Spatt 1975). Allerdings sind neue<br />
Wortkreationen wie Gäste-, Urlaubs- o<strong>der</strong> Freizeitverkehr ebenso wenig aussagekräftig. Als<br />
Ersatz für Fremdenverkehr wird deshalb häufig die international geläufige Bezeichnung<br />
„Tourismus“ verwendet, obwohl auch diese Bezeichnung nicht ganz ohne Problematik ist. Zu<br />
<strong>einen</strong>, so <strong>der</strong> Einwand ist <strong>der</strong> Begriff „Tourismus“ dem Begriff Touristik zu nahe, <strong>der</strong> doch<br />
nur eine <strong>der</strong> vielen Arten des Fremdenverkehrs bezeichnet. Doch sind Fremdenverkehr und<br />
Tourismus wirklich identisch und können problemlos gleich gesetzt werden?<br />
Unter den Praktikern bestehen verschiedene Auffassungen darüber was Fremdenverkehr<br />
bedeutet bzw. was diesen umfasst.
• Fremdenverkehr reflektiert mehr die Sicht <strong>der</strong> Gastgeber, insbeson<strong>der</strong>e mit Bezug auf<br />
Auslän<strong>der</strong> (Incomingtourismus / Inlandsreiseverkehr), im Gegensatz dazu umfasst<br />
Tourismus den Auslandsreiseverkehr, also Reisen von Inlän<strong>der</strong>n in Ausland<br />
• Fremdenverkehr umfasst alle Aspekte rund um Ferien und Freizeit<br />
• Organisation <strong>der</strong> Reisevorbereitung<br />
• er umfasst sowohl nationalen und internationalen Reiseverkehr<br />
• beinhaltet auch das Interesse an dem Phänomen <strong>der</strong> Mobilität aber auch des Kontaktes<br />
(mit Fremden verkehren)<br />
• wirkt allerdings wenig sympathisch (ängstlich, ablehnend)<br />
Üblich ist auch das Fremdenverkehr = Als Gesamtheit aus Reiseverkehr und damit<br />
verbundenen Aufenthalten an fremden Orten zum Zwecke <strong>der</strong> Erholung, Gesundheitspflege,<br />
<strong>der</strong> Geselligkeit, des Sports, wegen politischer, beruflicher, wissenschaftlicher o<strong>der</strong><br />
persönlicher Kontakte – verstanden wird.<br />
Der Fremdenverkehrsbegriff taucht in <strong>der</strong> Praxis hauptsächlich im Sinne von Incoming<br />
Tourismus auf und bezieht sich hierbei auf alle Akteure die an <strong>der</strong> Aufnahme von Gästen<br />
bzw. Ortsfremden beteiligt sind. Im Gegensatz dazu versteht man unter „Tourismus“ dann das<br />
zeitweilige Verlassen des Wohnortes für eine – meist in das Ausland gehende - Reise (Mundt<br />
1998). Eine an<strong>der</strong>e Sicht ist, das Fremdenverkehr alle Reisen umfasst, Tourismus lediglich die<br />
Urlaubsreisen.<br />
Die Sicht <strong>der</strong> Tourismusbranche: Begriffe sind nicht identisch<br />
• Tourismus ist umfassen<strong>der</strong> als Fremdenverkehr (<strong>der</strong> internationale Begriff<br />
„Tourismus“ umfasst alle Aspekte des Reisens, Fremdenverkehr umfasst hingegen nur<br />
den Son<strong>der</strong>fall nationaler Reisen.)<br />
• Fremdenverkehr ist umfassen<strong>der</strong> als Tourismus (engere Definition des Tourismus,<br />
umfasst nur die Motive Erholungs- o<strong>der</strong> Urlaubsreiseverkehr, während<br />
Fremdenverkehr z.B. auch Geschäftsreisen einschließt.<br />
• Tourismus und Fremdenverkehr stehen nebeneinan<strong>der</strong>. (Der Begriff „Tourismus“<br />
bezieht sich dabei vor allem auf Outgoing und <strong>der</strong> Begriff „Fremdenverkehr“ auf<br />
Incominggeschäfte) (Freyer 1998)<br />
Tourismus<br />
Fremdenverkehr<br />
Fremdenverkehr<br />
Die Sicht <strong>der</strong> Tourismuswissenschaft: Beide Begriffe sind gleichzusetzen<br />
Tourismus<br />
(Eigene Darstellung nach Freyer 1998)
• Beide Begriffe sind identisch; je<strong>der</strong> Versuch, unterschiedliche Begriffsinhalte zu<br />
definieren, scheitert spätestens bei <strong>der</strong> Übersetzung in an<strong>der</strong>e Sprachen<br />
• Das auswärtige Übernachten, stellt kein Definitionskriterium dar, denn es gibt auch<br />
Tagestourismus<br />
• Reisen, die keinem äußerem Zwang unterliegen, die aus rein intrinsischen Motiven<br />
unternommen werden
Als Ergebnis <strong>der</strong> Diskussion kann festgehalten werden, dass es heute durchaus angebracht ist,<br />
die Begriffe „Fremdenverkehr“ und „Tourismus“ gleichzusetzen bzw. sie synonym zu<br />
verwenden.<br />
Wissenschaftlich strittig:<br />
Weiter Tourismusbegriff:<br />
Tourismus umfasst alle Erscheinungen, die mit dem Verlassen des gewöhnlichen<br />
Aufenthaltsortes und dem Aufenthaltsort am an<strong>der</strong>en Ort verbunden sind = alle<br />
Ortsverän<strong>der</strong>ungen<br />
Engere Tourismusbegriffe:<br />
<strong>Sie</strong> grenzen Tourismus vor allem hinsichtlich <strong>der</strong> Zeit/Reisedauer, des Ortes/<strong>der</strong> Entfernung<br />
und <strong>der</strong> Motive des Ortswechsels und <strong>der</strong> wissenschaftlichen Schwerpunktsetzung ein.<br />
Touristischer Kernbereich:<br />
Bei allen Tourismusdefinitionen ist die –mindestens – mehrtägige Urlaubs- o<strong>der</strong><br />
Erholungsreise enthalten (touristischer Kernbereich). Uneinigkeit besteht vor allem,<br />
ob z.B. Geschäftsreisen (Motiv), Tagesreisen (Zeit), Ausflugsverkehr (Entfernung), Studien-<br />
und Arbeitsaufenthalte (nicht vorübergehend) usw. zum Tourismus zu rechnen.<br />
Schrö<strong>der</strong> (Lexikon <strong>der</strong> Tourismuswirtschaft)<br />
(Quelle: Freyer 1998)<br />
Tourismus im weiteren Sinne<br />
... beschreibt als Oberbegriff sowohl den Aus- und Einreiseverkehr eines Landes mit den<br />
Besuchszielen, die sich auf Freizeit mit Erholung, Urlaub, Gesundheit, Studium, Religion und<br />
Sport sowie geschäftliche Tätigkeit, Familie, Mission und Versammlung gründen als auch das<br />
Binnenreisegeschäft <strong>der</strong> Bewohner eines Landes.<br />
Tourismus im engeren Sinne<br />
... kennzeichnet daneben im Wesentlichen den grenzüberschreitenden Ferien- und<br />
Reiseverkehr mit Besuchern, die wenigstens eine Nacht und weniger als ein Jahr im<br />
Besuchsland verbringen.<br />
Fremdenverkehr gehört nach dieser Definition zum Binnenmarkt und in die Region.<br />
Reiseverkehr bezieht sich auf die Art <strong>der</strong> Beför<strong>der</strong>ung und die Verwendung <strong>der</strong><br />
verschiedenen Verkehrsmittel.<br />
1.2.5 Zusammenfassung <strong>der</strong> Merkmale des Tourismus (Ableitung aus den Definitionen)<br />
• Tourismus und Reisen ist mit einer Ortsverän<strong>der</strong>ung verbunden<br />
• Die Ortsverän<strong>der</strong>ung ist nur vorübergehend bzw. zeitlich befristet<br />
• Die Rückkehr zum Heimatort ist Bestandteil des Tourismus
• Tourismus und Fremdenverkehr erfasst bzw. umfasst nicht nur die Angebote und<br />
Nachfrager, son<strong>der</strong>n auch die gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen,<br />
ökologischen und technischen Folgen<br />
• Tourismus umfasst sowohl den Freizeitreiseverkehr sowie den Geschäftsreiseverkehr<br />
• Auch <strong>der</strong> Tourismus kann als Markt betrachtet werden – bei dem die Nachfrage das<br />
Angebot regelt<br />
• Mischung aus statisches (Aufenthalt) und dynamisches (Ortswechsel) Element<br />
• Massenhaftigkeit des Phänomens Tourismus<br />
• Wechselbeziehung zwischen den Reisenden und den Einheimischen<br />
• Herauslösung <strong>der</strong> Reisenden aus den normalen sozialen Beziehungen (des<br />
Heimatortes)<br />
• Die Erwerbstätigkeit wird in vielen Definitionen des Tourismus ausgeschlossen<br />
• Tourismus ist somit sowohl ein Wirtschaftsbereich aber auch ein „beson<strong>der</strong>er“<br />
Lebensbereich in dem <strong>der</strong> Reisende am Zielort meist als Gast aufgenommen wird<br />
Eine <strong>der</strong> grundlegenden determinierenden Merkmale <strong>der</strong> Tourismusdefinitionen, ist die<br />
räumliche Abwesenheit vom normalen Wohn- / Aufenthaltsort, die auf <strong>der</strong> <strong>einen</strong> Seite eine<br />
Mindestzeitdauer überschreiten muss (24 Stunden), auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite allerdings eine<br />
Höchstzeitdauer (1 Jahr) nicht überschreiten darf. Das Problem einer treffenden und<br />
allgemein akzeptierten Tourismusdefinition, ist <strong>der</strong> Aspekt dass <strong>der</strong> Tourismus auf<br />
verschiedenen Ebenen betrachtet werden kann bzw. auch muss. Betrachtet man den<br />
Tourismus z.B. aus ökonomischer Sicht, so fungiert er z.B. in <strong>einen</strong> bestimmten<br />
geographischen Raum als Arbeitgeber, sowie z.B. als wichtiger Devisenbringer. In<br />
Destinationen wie Mallorca sind z.B. über 50% <strong>der</strong> Bevölkerung direkt vom Tourismus<br />
betroffen und somit auch von ihm abhängig. In <strong>der</strong> Stadt Luxor in Ägypten gibt es ca. 65000<br />
Einwohner 85 % dieser Einwohner sind Beschäftigte im Tourismus. So unterscheidet z.B.<br />
Kaspar (1996) fünf wirtschaftliche Funktionen des Tourismus, dies sind: die Produktions-,<br />
Beschäftigungs-, Einkommens-, Ausgleichs- und Zahlungsbilanzfunktion. Zum an<strong>der</strong>en
müssen je nach Forschungsinteresse die ökologischen, gesellschaftlichen, technologischen<br />
o<strong>der</strong> politischen Funktionen des Tourismus näher betrachtet o<strong>der</strong> umschrieben werden. Es<br />
gibt zwei wesentliche Gründe weshalb eine ganze Reihe <strong>der</strong> gängigen Definitionsversuche<br />
nur bedingt für die theoretische und empirische Forschung geeignet sind:<br />
1. Zu breiter Bezugsrahmen: Oftmals wird versucht, möglicht alle Formen und<br />
Erscheinungen in den Tourismusbegriff „hineinzupacken“ (vgl. Steinbach 2003). Definition<br />
wie z.B. von Kaspar ver<strong>suchen</strong> das gesamte Spektrum <strong>der</strong> Tourismusarten und –<br />
formen in einer Definition zu umfassen. Es werden also unterschiedliche Reiseformen<br />
zusammengefasst, denen weitgehend divergierende Motivationsstrukturen zugrunde<br />
liegen und die auch durch sehr verschiedene Verhaltensmuster gekennzeichnet sind<br />
(vgl. Steinbach 2003). Beson<strong>der</strong>st in Motivationsuntersuchungen o<strong>der</strong><br />
verhaltenswissenschaftlichen Studien über den Touristen, ist man gezwungen die in<br />
diesem generellen Tourismusbegriff erfassten „Touristengruppen“ isoliert und<br />
nacheinan<strong>der</strong> zu behandeln.<br />
2. Zu enger Bezugsrahmen: Währende als bei den Motivations- und Verhaltenstypen<br />
<strong>der</strong> Definitionsrahmen für „Tourismus“ zu weit gezogen wird, trifft für die zeitliche<br />
Komponente oft das Gegenteil zu (Steinbach 2003). Während eine Unterscheidung<br />
zwischen Tagestouristen (ohne Übernachtung) und Übernachtungstouristen<br />
(mindestens eine außerhäusliche Übernachtung) noch recht unproblematisch ist, so<br />
fällt die Bestimmung von Naherholung schon schwieriger aus. Denn wegen <strong>der</strong><br />
fortgeschrittenen Entwicklung er Verkehrstechnologie und <strong>der</strong> enormen Verbilligung<br />
entsprechen<strong>der</strong> Angebote, ist es aber heute nicht mehr ohne weiteres möglich,<br />
raumbezogene außerhäusliche Freizeitformen ohne Übernachtung als „Naherholung“<br />
zu bezeichnen (Steinecke 1993).<br />
Tourismus zu definieren bzw. zu erfassen ist teilweise äußerst kompliziert. Wahrscheinlich<br />
verhält es sich mit dem Tourismus wie mit <strong>der</strong> Pornographie: Sehr schwierig zu definieren,<br />
aber leicht zu erkennen und in beiden Fällen ist den Nachfragern die Definition eigentlich<br />
auch egal (vgl. Lohmann 1990). Während sich viele Autoren noch um eine generelle Klärung des<br />
Tourismusbegriffs bemühen, schlägt Bieger (2004) indes eine Erweiterung des ursprünglichen<br />
Tourismusbegriffes vor.
Mit dieser Definition wird <strong>der</strong> Tourismus als Erscheinungsform über das Verhalten <strong>der</strong><br />
Menschen an Hand <strong>der</strong> Tourismusnachfrage definiert. Aufgrund dieser eher breiten,<br />
systemorientierten Definition können auch nicht einfach Tourismusbranchen abgeleitet<br />
werden (Bieger 2004). Es können aber Branchen mit einer größeren o<strong>der</strong> kleineren Abhängigkeit<br />
vom Tourismus (d.h. von <strong>der</strong> Tourismusnachfrage) abgegrenzt werden (Bieger 2004).<br />
1.2.6. Statistische Definitionen des Tourismus<br />
Mit einer möglichen Definition des Tourismus beschäftigte sich im lauf <strong>der</strong> letzten Jahrzehnte<br />
auch mehrmals die WTO. Das vorrangige Ziel <strong>der</strong> Definitionsbemühungen war es, die<br />
Statistiken <strong>der</strong> verschiedenen Län<strong>der</strong> zu vereinheitlichen. Im Juni 1991 führt die WTO in<br />
Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> kanadischen Regierung in Ottawa eine internationale Konferenz über<br />
Reise- und Tourismusstatistik durch, auf <strong>der</strong> eine Reihe von Empfehlungen zur<br />
Tourismusstatistik beschlossen wurden, die im März 1993 auch von <strong>der</strong> Statistikkommission<br />
<strong>der</strong> Vereinten Nationen angenommen wurden (Spörel 1998).<br />
Rechtliche <strong>Grundlagen</strong> für die Tourismusstatistik sind:<br />
• Richtlinie 95/57/EG des Rates vom 23. November 1995 über die Erhebung<br />
statistischer Daten im Bereich des Tourismus<br />
• Entscheidung <strong>der</strong> Kommission vom 9. Dezember 1998 zur Umsetzung <strong>der</strong> Rats-<br />
Richtlinie 95/57/EG<br />
• Aktualisierungen in den Jahren 2004 and 2006, vor allem im Zusammenhang mit <strong>der</strong><br />
Erweiterung <strong>der</strong> EU (Spörel 2007)<br />
Der Tourismus ist ein Querschnittsbereich, zudem verschiedene Wirtschaftsbereiche<br />
Leistungen erbringen – dies kommt auch in <strong>der</strong> Definition <strong>der</strong> WTO zum Ausdruck. Daher<br />
kann <strong>der</strong> Tourismus auch nicht befriedigend von <strong>der</strong> Angebotsseite her definiert werden.<br />
Zudem besteht auch keine universelle Auffassung für die Definition <strong>der</strong> Tourismusindustrie<br />
bzw. Tourismuswirtschaft (vgl. Pen<strong>der</strong> / Sharpley 2005). Es ist überhaupt fraglich, ob man den<br />
Tourismus als Industrie bezeichnen kann. Bei <strong>der</strong> Tourismusdefinition des statistischen<br />
Bundesamtes bzw. <strong>der</strong> WTO, handelt es sich deshalb, um ein weit gefasstes Konzept des<br />
Tourismus das deutlich von dem umgangssprachlichen und wissenschaftlichen Gebrauch des<br />
Begriffs abweicht:<br />
Der Tourismus umfasst nach dieser Definition „die Aktivitäten von Personen, die an Orte<br />
außerhalb ihrer gewohnten Umgebung reisen und sich dort zu Freizeit-, Geschäfts- o<strong>der</strong><br />
bestimmten an<strong>der</strong>en Zwecken nicht länger als ein Jahr ohne Unterbrechung aufhalten<br />
The WTO`s definition of tourism is now the one that is most widley accepted arround the<br />
world (Pen<strong>der</strong> / Sharpley 2005)
(WTO)<br />
Unerheblich ist zudem ob die Reise als Tages- o<strong>der</strong> „Übernachtungsreise“ getätigt wird – die<br />
zentrale Bezugsgröße ist immer <strong>der</strong> Besucher.<br />
In folge <strong>der</strong> Glie<strong>der</strong>ung nach Reisezwecken, umfasst die statistische Tourismusdefinition:<br />
• Urlaubs- und Erholungsreisen<br />
• Besuche von Freunden und Verwandten<br />
• Dienst- und Geschäftsreisen<br />
• Sonstige private Reisen<br />
• Tagesreisen (Reisen ohne Übernachtung)<br />
Eingeschlossen sind sowohl <strong>der</strong> Freizeit- und Geschäftsreiseverkehr sowie Reisende mit<br />
sowie auch ohne Übernachtung. Ausgeschlossen werden hingegen:<br />
• Pendler<br />
• Saisonarbeiter<br />
• Einwan<strong>der</strong>er<br />
• Angehörige von Streitkräften (Armee, Militär)<br />
• Diplomaten<br />
• u.a.<br />
Anhand <strong>der</strong> statistischen Tourismusdefinition lassen sich drei Arten von Reiseströmen bzw.<br />
drei Grundformen des Tourismus in Bezug auf Reiseströme ableiten:<br />
1. Binnenreiseverkehr (domestic tourism) = bezieht sich auf Inlän<strong>der</strong> eines gegebenen<br />
Landes, soweit sie nur innerhalb des Landes reisen – Reisetätigkeit von Inlän<strong>der</strong>n<br />
welche nur im eigenen Land jedoch außerhalb ihres gewöhnlichen Lebensumfeldes<br />
reisen und sich dort aufhalten
2. Einreiseverkehr (inbound tourism) = bezieht sich auf Auslän<strong>der</strong>, die in dem<br />
gegebenen Land reisen - Reisetätigkeit von Nichtinlän<strong>der</strong>n, die in einem Land<br />
außerhalb ihres gewöhnlichen Lebensumfeldes reisen und sich dort aufhalten<br />
3. Ausreiseverkehr (outbound tourism) = bezieht sich auf Inlän<strong>der</strong>, die in einem<br />
an<strong>der</strong>en Land reisen - Reisetätigkeit von Nichtinlän<strong>der</strong>n , Reisetätigkeit von<br />
Inlän<strong>der</strong>n, die in ein an<strong>der</strong>es Land reisen und sich dort (außerhalb ihres gewöhnliches<br />
Lebensumfeldes) aufhalten<br />
(Quelle: WTO sowie Europäische Kommission (DG XXIII, Eurostat), 1998.)<br />
Die unterschiedliche Kombination <strong>der</strong> drei Grundformen des Tourismus ergeben die<br />
folgenden Tourismuskategorien:<br />
Inlandstourismus (internal tourism): Umfasst den Binnenreiseverkehr und den<br />
Einreiseverkehr<br />
Nationaler Tourismus (national tourism): Umfasst den Binnenreiseverkehr und den<br />
Ausreiseverkehr<br />
Internationaler Tourismus (international tourism): Umfasst den Einreiseverkehr sowie<br />
den Ausreiseverkehr<br />
Sämtliche Arten <strong>der</strong> im Tourismus erfassten Reisenden werden als Besucher bezeichnet (STB<br />
2003). Der Begriff Besucher / Visitor stellt somit das grundlegende Konzept <strong>der</strong><br />
Tourismusstatistik dar.
Nach <strong>der</strong> Definition <strong>der</strong> WTO und des Statistischen Bundesamtes, ist ein Besucher:<br />
(Spörel 2005)<br />
“Jede Person, die für die Dauer von nicht mehr als 12 Monaten ihre gewohnte Umgebung<br />
verlässt und <strong>der</strong>en hauptsächlicher Reisezweck ein an<strong>der</strong>er ist als die Ausübung einer<br />
Tätigkeit, die von dem besuchten Ort aus entgolten wird”<br />
.<br />
Ein Besucher <strong>der</strong> nicht übernachtet wird als Tagesbesucher bezeichnet. Übernachtet <strong>der</strong><br />
Besucher allerdings, so wird er im Sinne <strong>der</strong> Statistik als Tourist bezeichnet bzw. erfasst. Um<br />
als Tourist zu zählen, muss <strong>der</strong> Besucher laut Definition mindestens einmal bzw. eine Nacht<br />
in einem Beherbergungsbetrieb o<strong>der</strong> einer Privatunterkunft übernachten.<br />
Tagesbesucher könnten z.B. Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes sein die morgens in einem<br />
bestimmten Land ankommen allerdings abends zurückkehren um an Bord zu übernachten –<br />
selbst dann wenn das Schiff mehrere Tage im Hafen des besuchten Landes liegt. Hierzu<br />
zählen auch Gruppenreisende die mit dem Zug unterwegs sind, o<strong>der</strong> Besitzer von Schiffen<br />
sowie Yachten. Durch das zeitliche Kriterium in <strong>der</strong> WTO Definition, grenzt sie den<br />
touristischen Besuch von dauerhaften Wan<strong>der</strong>bewegungen ab. Berufspendler werden bedingt<br />
durch das Entgeldkriterium ganz aus <strong>der</strong> Definition ausgeschlossen.<br />
Für die Definition des Besuchers / Vistiors können drei grundlegende Kriterien identifiziert<br />
werden, welche den Besucher /Vistior von an<strong>der</strong>en Reisenden abgrenzen:<br />
1. Der Besucher verlässt sein gewohntes Umfeld (Mindestentfernung, Mindestdauer),<br />
2. Die Abwesenheit aus dem gewohnten Umfeld darf höchstens 12 Monate betragen –<br />
sonst Wechsel des Wohnsitzes<br />
3. Der Besucher darf nicht aus dem besuchten Land entlohnt werden
Für statistische Zwecke werden zwei Untergruppen <strong>der</strong> Besucher gebildet:<br />
• Internationale Besucher = Jede Person, die für die Dauer von nicht mehr als 12<br />
Monaten ihre gewohnte Umgebung verlässt und in ein an<strong>der</strong>es als dasjenige Land<br />
reist, in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz hat, und <strong>der</strong>en hauptsächlicher<br />
Reisezweck ein an<strong>der</strong>er ist als die Ausübung einer Tätigkeit, die von dem besuchten<br />
Land aus entgolten wird.<br />
• Inländische Besucher = Jede Person, die in dem gegebenen Land ihren Wohnsitz hat<br />
und für die Dauer von nicht mehr als 12 Monaten ihre gewohnte Umgebung verlässt,<br />
um an einem an<strong>der</strong>en Ort, innerhalb dieses Landes zu reisen, und <strong>der</strong>en<br />
hauptsächlicher Reisezweck ein an<strong>der</strong>er ist als die Ausübung einer Tätigkeit, die von<br />
dem besuchten Ort aus entgolten wird<br />
BESUCHER /<br />
VISITOR<br />
Internationaler Besucher<br />
Inländischer Besucher<br />
Touristen<br />
Tagesbesucher<br />
Touristen<br />
Tagesbesucher<br />
(Abb. „Untergruppen <strong>der</strong> Besucher“ eigene Darstellung)<br />
In <strong>der</strong> einschlägigen Tourismusliteratur wird für „Tagesbesucher“ oftmals auch die<br />
Bezeichnung „Ausflügler“ verwendet. Ausflügler sind also: alle vorübergehenden Besucher<br />
die nicht mindestens eine Übernachtung im be<strong>suchen</strong> Land verbringen obwohl sie das Land<br />
ggf. an einem o<strong>der</strong> mehreren Tagen be<strong>suchen</strong> und zum Schlafen auf ihr Schiff o<strong>der</strong> in ihren<br />
Zug zurückkehren. Ausflügler / Tagesbesucher be<strong>suchen</strong> <strong>einen</strong> Ort und halten sich dort nur<br />
recht kurzfristig auf – ohne an diesem Ort zu übernachten.
Als Klassifizierungsmerkmale für die touristische Nachfrage können verwendet werden:<br />
• Aufenthaltsdauer <strong>der</strong> Touristen<br />
• das Herkunftsland <strong>der</strong> Touristen<br />
• das Reiseziel<br />
• die benutzten Transportmittel<br />
• die Beherbergungsform<br />
Aber auch die Definition <strong>der</strong> WTO ist nicht frei von Wi<strong>der</strong>sprüchen. Theoretisch und streng<br />
genommen müssten weite Teile des Dienst- und Geschäftsreiseverkehrs ausgeschlossen<br />
werden, da ja laut Definition das Kriterium <strong>der</strong> Vergütung vor Ort ausgeschlossen wurde.<br />
Schließlich sind mit dieser Definition wichtige, sozialproduktsrelevante Aspekte des<br />
touristischen Angebots - nämlich Investitionstätigkeiten wie die Errichtung von Hotels o<strong>der</strong><br />
Uferanlagen - nicht abgedeckt, die neben den unmittelbar an Touristen abgegebenen<br />
Leistungen ebenfalls dem Angebot für touristische Zwecke zugerechnet werden sollten<br />
(Köhn/Hopf/Kloas o.J.).<br />
Die Definition <strong>der</strong> WTO umfasst ein sehr weites Tourismusverständnis, dass allerdings nicht<br />
immer von Tourismuspraxis und Tourismuswissenschaft geteilt wird. Für Forschungsaufträge<br />
und wissenschaftliche Arbeiten, ist es teilweise notwendig eine eigene Definition dafür zu<br />
finden, was eine Person zum potentiellen Touristen werden lässt. Folgende Aspekte sollten<br />
bei eigenen Definitionsver<strong>suchen</strong> berücksichtig werden:
• Motivation (Reisemotive)<br />
• Erholung<br />
• weg von vs. hin zu<br />
• Dauer - zeitliche Komponente<br />
• Übernachtung, Beherbergung<br />
In einigen Tourismusdefinition (z.B. Armanski 1978) wird die Grenzüberschreitung als<br />
Bestandteil <strong>der</strong> Tourismusdefinition genannt. Dies erscheint jedoch wenig sinnvoll. Ein<br />
Reisen<strong>der</strong> von Hamburg nach München wäre so also kein Tourist, er würde diesen Status erst<br />
erfüllen wenn er z.B. nach Mallorca reist. Die Tatsache, dass es einerseits die<br />
Definitionsbemühungen durch internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und<br />
die Welt-Tourismus-Organisation WTO gibt, aber auch eigene Bestimmungen von<br />
betroffenen Län<strong>der</strong>n wie den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und<br />
Deutschland, welche davon zum Teil beträchtlich abweichen, sowie, darüber hinaus, eigene<br />
Klassifikationen mancher dazugehöriger Regionen, müsste zu denken geben (Mundt 1998).<br />
An<strong>der</strong>s gesagt: Es ist durchaus sinnvoll, auf Normierung zu bestehen, aber es sollte hinterfragt<br />
werden, welchen Zielen sie dient (Lauterbach 2006).<br />
Weitere Unterteilung des Tourismus<br />
Eine weitere wichtige Unterscheidung anhand <strong>der</strong> Reisedauer, ist die Unterscheidung in:<br />
Kurzzeittourismus: 1 – 4 Übernachtungen = Aufenthalt von 2-5 Tagen<br />
Erholungstourismus: 5 / 6 – 30 / 45 Übernachtungen = Aufenthalt von 6 / 7 – 30 /45 Tagen<br />
Langzeittourismus: höchstes 1 Jahr = Aufenthalt von über 30 / 45 Tagen<br />
Daueraufenthalt: über ein Jahr<br />
Der Tourist<br />
(Gross 2004 in Anlehnung an Freyer 2001)<br />
Die OECD definiert Touristen als „Personen, die sich mindesten 24 Stunden außerhalb ihres<br />
Wohnortes aufhalten zu beruflichen, vergnüglichen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Zwecken (außer Arbeit,<br />
Studium und Daueraufenthalt).“ In dieser Definition wird als Mindestkriterium für<br />
Tourismus eine zeitliche Dauer von mindestens 24 Stunden bestimmt. Diese Definition kann<br />
in <strong>der</strong> heutigen Zeit als sehr problematisch und nicht mehr adäquat bezeichnet werden. Denn<br />
zum <strong>einen</strong> vernachlässigt sie den Ausflugs- und Dienstreiseverkehr - zum an<strong>der</strong>en ist eine<br />
Vierundzwanzig-Stunden-Zeitspanne heute nicht mehr zeitgemäß. So würden z.B. die sog.<br />
„Partytouren“ nach Mallorca – morgens mit dem Flugzeug hin und abends wie<strong>der</strong> zurück in<br />
die Heimat – nicht zum Tourismus zählen. Auch lassen die einzelnen Begriffsmerkmale eine<br />
starke Betonung des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs, also des Auslän<strong>der</strong>reiseverkehrs,<br />
erkennen (Spatt 1975).<br />
Wie kann <strong>der</strong> Begriff „Tourist“ definiert werden?
Nach dem Zweck <strong>der</strong> Reise<br />
• berufsbedingt, Zweck <strong>der</strong> Reise ist ein geschäftlicher. Anlass = Geschäftsreise<br />
• die Reise dient <strong>der</strong> Erholung, Entspannung = Urlaubs- und Erholungstourismus<br />
• Reisen zu Freunden, Verwandten = sog. (VFR)<br />
• Aus- und Weiterbildung = sog. Bildungstourismus<br />
Beispiel:<br />
“Jede Person, die für die Dauer von nicht mehr als 12 Monaten ihre gewohnte Umgebung<br />
verlässt und <strong>der</strong>en hauptsächlicher Reisezweck ein an<strong>der</strong>er ist als die Ausübung einer<br />
Tätigkeit, die von dem besuchten Ort aus entgolten wird” (WTO)<br />
In dieser Definition muss <strong>der</strong> Reisezweck ein an<strong>der</strong>er sein, als die Ausübung einer Tätigkeit.<br />
Die Reisen müssen entwe<strong>der</strong> geschäftlichen Zwecken, dem Besuch von Tagungen und<br />
Kongressen, <strong>der</strong> Freizeitgestaltung o<strong>der</strong> dem Besuch von Freunden und Verwandten dienen.<br />
Nach <strong>der</strong> zeitlichen Dauer<br />
• mehr als 24 Stunden<br />
• weniger als ein Jahr<br />
Beispiel:<br />
Touristen sind Personen, die sich für mindestens 24 Stunden außerhalb ihres Wohnortes<br />
aufhalten zu beruflichen, vergnüglichen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Zwecken (außer Arbeit, Studium und<br />
Daueraufenthalt) aufhalten (OECD)<br />
Nach <strong>der</strong> Entfernung<br />
• außerhalb des Wohnortes / Wohnumfeldes<br />
Nach <strong>der</strong> Übernachtungsmöglichkeit<br />
• Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb<br />
Beispiel hierfür ist z.B. die Definition <strong>der</strong> Europäischen Kommission (1998):<br />
Touristen sind Besucher, die am (im) besuchten Ort(Land) wenigstens einmal in einem<br />
Beherbergungsbetrieb o<strong>der</strong> einer Privatunterkunft übernachten.<br />
(Quelle: Europäische Kommission (DG XXIII, Eurostat) 1998)<br />
Tagesbesucher, Tages-Ausflügler<br />
• streng genommen sind dies keine Touristen, jedoch sind sie maßgeblich an z.B. <strong>der</strong><br />
touristischen Aktivität eines Ortes beteiligt und nutzen sowohl das ursprüngliche<br />
sowie das abgeleitete touristische Angebot
• zwar benutzen Tagesbesucher, Ausflügler touristische Einrichtungen, jedoch mit dem<br />
Unterschied, das sie keine Unterkunft benötigen und am Zielort nicht übernachten<br />
Auch für den Begriff „Tourist“ finden sich mannigfaltige Definitionen. So wird <strong>der</strong> Tourist<br />
z.B. als jene Person bezeichnet, die Reisen als Freizeitbeschäftigung betreiben o<strong>der</strong> als eine<br />
Person die <strong>einen</strong> Ort durchläuft ohne zu beabsichtigen, dort permanent zu bleiben (vgl. Schmith<br />
1989/Berghe 1980).<br />
Der Einbezug <strong>der</strong> Motivation in die touristische Definition ist einleuchtend, da nur <strong>der</strong><br />
Tourist selbst sicher behaupten mag, `Ja, ich reise!“ (Lüdtke 2002)<br />
Trotz definitorischer Probleme, besteht in <strong>der</strong> Wissenschaft Konsens bezüglich drei zentraler<br />
Merkmale des Touristen:<br />
• Touristen sind Ortsfremde: Die Reise / Tourismus ist steht mit einem Ortswechsel<br />
von Wohnort zum Zielort verbunden (und mit <strong>der</strong> Rückkehr zum Wohnort; dabei wird<br />
üblicherweise das Überschreiten <strong>der</strong> Gemeindegrenze als Ortswechsel verstanden. Der<br />
Ortswechsel erfolgt zudem meist mit verschiedenen Transportmitteln<br />
• Touristen sind temporäre Bewohner: Die Aufenthaltsdauer am Zielort ist zeitlich<br />
begrenz, Meist nutz <strong>der</strong> Reisende touristische Einrichtungen wie z.B. Hotellerie und<br />
Parahotellerie, z. T. aber auch Privatunterkünfte bei Freunden. Als Obergrenze für den<br />
vorübergehenden Aufenthalt gelten üblicherweise 12 Monate, die Mindestdauer ist<br />
hingegen umstritten.<br />
• Touristen sind Konsumenten: Mit dem Aufenthalt am Zielort ist keine dauerhafte<br />
berufliche Tätigkeit in einer Arbeitsstädte verbunden (auch Geschäftsreisende, die sich<br />
zu Verkaufs- Akquisitions- bzw. Kontaktgesprächen am Zielort aufhalten, treten dort<br />
vorrangig als Konsumenten auf. (vgl. Steinecke 2006)<br />
Der Tourist in <strong>der</strong> Alltagssprache<br />
Zwar bemühen sich Wissenschaft und Praxis um eine genaue Klärung des Touristenbegriffs,<br />
doch die Reisenden schert dies wenig. Aber auch „Touristen“ sind nicht frei von Kritik.<br />
Beson<strong>der</strong>st <strong>der</strong> Begriff „Tourist“ hat im allgem<strong>einen</strong> Sprachgebrauch eine zunehmend<br />
negative Wortbedeutung erfahren. Touristen sind immer die an<strong>der</strong>en: Beson<strong>der</strong>st die Gruppe<br />
<strong>der</strong> sog. „Alternativreisenden“ verwendet diese Aussage recht häufig. Aber mal ehrlich gsagt,<br />
wer will schon gerne Tourist sein? Der Tourist ein gehöriger Untertan <strong>der</strong> dem Reiseleiter<br />
blind folgt, <strong>der</strong> Idiot <strong>der</strong> Reise (Urbain 1991), <strong>der</strong> Landschaftsfresser, <strong>der</strong> Zerstörer und<br />
Verantwortliche für Prostitution und mo<strong>der</strong>ne Versklavung? Krippendorf (1984) stellt diesen<br />
Umstand in folgen<strong>der</strong> Tabelle recht anschaulich dar:
Egal wie sich auch Tourismuskritiker o<strong>der</strong> sog. Alternativreisende im Urlaub zu an<strong>der</strong>en<br />
Reisenden äußern, in den Augen <strong>der</strong> Einheimischen und nach Definition <strong>der</strong> WTO sind auch<br />
sie Touristen.<br />
„Reisen sind verbunden mit Abenteuer, authentischer Erfahrung, Geschmack, Individualität<br />
und Selbsterfahrung, wogegen Tourismus vorgefertigt, vorbezahlt, bequem und vorhersagbar<br />
ist. Reisende treffen ihre eigene Wahl; Touristen lassen sich ihre Entscheidungen von<br />
an<strong>der</strong>en treffen“ (Sharpley Übersetzung Mundt in Einführung in den Tourismus 1998)<br />
Exkurs: Tourismus – Klassifikation eines Wirtschaftszweiges<br />
(Krippendorf 1984 S. 94 f.)<br />
Sowohl die Klassifikation <strong>der</strong> Wirtschaftszweige 2003 (WZ 2003), die statistische Systematik<br />
<strong>der</strong> Wirtschaftszweige in <strong>der</strong> Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 1.1) als auch die<br />
Internationale Systematik <strong>der</strong> Wirtschaftszweige (ISIC Rev. 4) enthalten k<strong>einen</strong> exakt<br />
abgegrenzten Wirtschaftsbereich „Tourismus“. In <strong>der</strong> tätigkeitsbezogenen WZ 2003 werden<br />
Einheiten mit gleichen wirtschaftlichen Tätigkeiten zusammengefasst, unabhängig davon, ob<br />
die Tätigkeiten für Touristen bzw. Einheimische erbracht werden (Janisch 1/2007). Ahlert (2003)<br />
unterschied in <strong>der</strong> Systematisierung für das Tourismussatellitensystem für Deutschland zwölf<br />
direkt bzw. indirekt am Tourismus partizipierende Wirtschaftszweige und weitere mit dem<br />
Tourismus verbundene Aktivitäten
Anhand dieser Systematik, lässt sich deutlich erkennen dass <strong>der</strong> Tourismus ein Musterbeispiel<br />
für <strong>einen</strong> Querschnittsbereich ist. Problematisch ist allerdings, dass viele <strong>der</strong> genannten<br />
Wirtschaftseinheiten nicht direkt <strong>der</strong> Tourismuswirtschaft bzw. dem Tourismus zugerechnet<br />
werden können. Während Beherbergungsbetriebe, Reiseveranstalter o<strong>der</strong> Reisebüros ohne<br />
Schwierigkeit direkt dem Tourismus zugeordnet werden können, so ist dies bereits schon bei<br />
<strong>der</strong> Gastronomie erheblich schwieriger. Denn in Betrieben <strong>der</strong> Gastronomie speisen sowohl<br />
Touristen als auch Einheimische. Eine genaue Zuteilung <strong>der</strong> Betriebe zur Tourismuswirtschaft<br />
erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln – hier soll nur kurz angemerkt werden das in <strong>der</strong><br />
obigen Tabelle nicht alle Wirtschaftseinheiten als direkt dem Tourismus zugerechnet werden<br />
können.
International übliche Klassifizierung <strong>der</strong> Tourismusdefinitionen<br />
Beson<strong>der</strong>st im angloamerikanischen Bereich ist es üblich die Tourismusdefinitionen wie folgt<br />
zu unterscheiden.<br />
Holistische Definitionen<br />
Unter diese Klassifikation fallen Tourismusdefinitionen, die sich zum <strong>einen</strong> mit <strong>der</strong> Industrie<br />
und mit den Auswirkungen des Tourismus befassen, zusammengefasst.<br />
Tourism is the study of man away from his usual Tourism is the study of man away from his<br />
usual habitat, of the industry which responds to his habitat, of the industry which responds to<br />
his needs, and of the impacts that both he and the needs, and of the impacts that both he and the<br />
industry have on the host’s socio industry have on the host’s socio cultural, cultural, economic<br />
and physical environments.” economic and physical environments.” (Jafari 1977)<br />
Konzeptionelle Definitionen<br />
<strong>Sie</strong> beschreiben das Wesen des Tourismus als Aktivität.<br />
Tourism is travel and temporary stay, involving at least one nig Tourism is travel and<br />
temporary stay, involving at least one night away ht away from the region of a persons’ usual<br />
domicile which is un<strong>der</strong>takenfrom the region of a persons’ usual domicile which is<br />
un<strong>der</strong>takenwith the with the major expectation of satisfying leisure, pleasure, or recreation<br />
major expectation of satisfying leisure, pleasure, or recreational needs al needs which are<br />
perceived as being better able to be satisfied outside which are perceived as being better able<br />
to be satisfied outside the region the region of their domicile.” of their domicile.” (Stear 1998)<br />
Technische Definitionen<br />
Durch diese Definitionen ist es möglich den Tourismus statistisch zu erfassen<br />
Tourism is the aggregate of all businesses that directly Tourism is the aggregate of all<br />
businesses that directly provide goods or services to facilitate business, pleasure, provide<br />
goods or services to facilitate business, pleasure, and leisure activities away from the home<br />
environment and leisure activities away from the home environment” (Smith 1998)<br />
1.2.7 Der Tourismusbegriff als konstitutives Element <strong>der</strong> <strong>Tourismuslehre</strong><br />
Erst nachdem eine „einwandfreie Definition“ für den Fremdenverkehr gefunden wurde,<br />
konnte sich allmählich eine Fremdenverkehrs- / <strong>Tourismuslehre</strong> und damit auch das logische<br />
System einer solchen Lehre entwickeln. Fremdenverkehr ist zum Gegenstand einer eigenen<br />
Wissenschaft, <strong>der</strong> Fremdenverkehrslehre bzw. Fremdenverkehrswissenschaft geworden, die<br />
1942 von den Schweizern Walter Hunziker und Kurt Krapf mit folgen<strong>der</strong> Definition<br />
begründet wurde: „Fremdenverkehr ist <strong>der</strong> Inbegriff <strong>der</strong> Beziehungen und Erscheinungen,<br />
die sich aus dem Aufenthalt Ortsfrem<strong>der</strong> ergeben, sofern daraus keine dauernde<br />
Nie<strong>der</strong>lassung entsteht und damit keine Erwerbstätigkeit verbunden ist (Opaschowski 2002). In<br />
negativer Umschreibung ergibt sich aus <strong>der</strong> Begriffsbestimmung des Fremdenverkehrs, dass<br />
die Fremdenverkehrslehre nicht den Wirtschaftswissenschaften zugerechnet werden kann, da
sie Begriffs- und Erscheinungskomplexe umfasst, die außerwirtschaftlicher Natur sind und<br />
aus <strong>der</strong> Wirtschaftstheorie und <strong>der</strong> wirtschaftlichen Betrachtungsweise heraus allein nicht<br />
erklärt und nicht verstanden zu werden vermögen (Hunziker 1942). Der Verweis auf die<br />
"Gesamtheit <strong>der</strong> Beziehungen und Erscheinungen" deutet die Entwicklung zu komplexeren<br />
Strukturen aber auch <strong>einen</strong> umfaßen<strong>der</strong>enden wissenschaftlichen Zugang zum<br />
Fremdenverkehr an. Zum Fremdenverkehr zählen Hunziker und Krapf den freiwilligen<br />
Reiseverkehr mit konsumtivem Charakter, <strong>der</strong> Geschäftsreiseverkehr allerdings - bei dem<br />
eher das produktive Moment dominiert - zählt nicht zum Fremdenverkehr. Hunziker baute<br />
auf <strong>der</strong> Definition von ihm und Krapf seine Fremdenverkehrslehre auf und versuchte sogar im<br />
Jahr 1943 die Fremdenverkehrslehre als theoriegeleitete Kulturwissenschaft zu begründen.<br />
Die Fremdenverkehrsdefinition von Hunziker/Krapf wurde 1954 leicht modifiziert von <strong>der</strong><br />
AIEST – Der Internationalen Vereinigung von wissenschaftlichen Fremdenverkehrsexperten<br />
übernommen. Die Definition lautet von nun:<br />
Fremdenverkehr ist <strong>der</strong> Inbegriff <strong>der</strong> Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus <strong>der</strong><br />
Reise und dem Aufenthalt Ortsfrem<strong>der</strong> ergeben, sofern daraus keine dauernde<br />
Nie<strong>der</strong>lassung entsteht und damit keine Erwerbstätigkeit verbunden ist<br />
Die AIEST legte darauf Wert das die Definition um den Begriff <strong>der</strong> „Reise“ erweitert wurde,<br />
dies verwun<strong>der</strong>t allerdings etwas, denn allein schon die Bezeichnung „Inbegriff <strong>der</strong><br />
Beziehungen und Erscheinung dies sich aus dem Aufenthalt Ortsfrem<strong>der</strong> ergeben“ weist<br />
eigentlich schon auf eine Reise hin. Denn wie sollen denn sonst die „Ortsfremden“ an den<br />
Aufenthaltsort gelangt sein? Allerdings streicht diese Definition im beson<strong>der</strong>en die reine<br />
Konsumorientiertheit als Charakteristikum des Fremdenverkehr heraus, <strong>der</strong><br />
Geschäftreiseverkehr wird allerdings komplett ausgeklammert. Eine etwas unglücklich<br />
gewählt Formulierung ist zudem die Bezeichnung „Ortsfrem<strong>der</strong>“, zudem gab und gibt es bis<br />
heute keine exakte Bestimmung, wie lange ein Person als „ortsfremd“ gilt.<br />
So wies schlussendlich selbst <strong>der</strong> eigentliche Erfin<strong>der</strong> <strong>der</strong> Definition im Jahr 1970 darauf hin,<br />
das die Definition des Fremdenverkehrs zu überdenken und eine Formel zu finden sei, die<br />
auch den Geschäfttourismus berücksichtigt. Eine akzeptable und interdisziplinäre Definition<br />
lieferte <strong>der</strong> Tourismus-Professor Claude Kaspar:<br />
Fremdenverkehr o<strong>der</strong> Tourismus stellt die Gesamtheit <strong>der</strong> Beziehungen und<br />
Erscheinungen dar, die sich (aus <strong>der</strong> Reise) aus <strong>der</strong> Ortsverän<strong>der</strong>ung und dem Aufenthalt<br />
von Personen ergeben, für die <strong>der</strong> Aufenthaltsort we<strong>der</strong> hauptsächlicher und dauern<strong>der</strong><br />
Wohn- noch (Arbeits-) Aufenthaltsort ist (Kaspar 1978/1995)<br />
Diese Definition prägte die Fremdenverkehrswissenschaft bis in die heutige Zeit. Kaspar<br />
baute auf dieser Universaldefinition seine „<strong>Tourismuslehre</strong> im Grundriss“ auf und erweiterte<br />
die Fremdenverkehrslehre durch Übertragung <strong>der</strong> Systemtheorie auf den Tourismus. Hierzu<br />
merkt Kaspar an: Allein die begriffliche Umschreibung des Phänomens Fremdenverkehr o<strong>der</strong><br />
Tourismus als die Gesamtheit <strong>der</strong> Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus <strong>der</strong> Reise und<br />
dem Aufenthalt von Personen ergeben, für die <strong>der</strong> Aufenthaltsort we<strong>der</strong> hauptsächlicher und<br />
dauern<strong>der</strong> Wohn- noch Arbeitsort ist, weist auf ein vielschichtiges System von Beziehungen<br />
hin (vgl. Kaspar 1978). Ihm ist es auch wohl zu verdanken das die <strong>Tourismuslehre</strong> als angewandte<br />
Wissenschaft verstanden werden kann, die sich zur Abgrenzung von Forschungsobjekten und<br />
zur Erfassung <strong>der</strong> Wechselwirkungen <strong>der</strong> Systemtheorie bedient (vgl. Bieger 1994).<br />
Als wesentliche Definition zur Begründung einer „wissenschaftlichen <strong>Tourismuslehre</strong>“<br />
können also die Definition von:
• Walter Hunziker / Kurt Krapf, Fremdenverkehrslehre 1942<br />
• <strong>der</strong> wissenschaftlichen Vereinigung von Fremdenverkehrsexperten 1954<br />
• und Claude Kaspar, Die Fremdenverkehrslehre im Grundriss 1975<br />
genannt werden.<br />
Erst die Definition von Kaspar wurde <strong>der</strong> Vielfältigkeit und Multidisziplinarität des<br />
Phänomens Fremdenverkehr / Tourismus gerecht.<br />
1.2.8. Wichtige Begriffe <strong>der</strong> <strong>Tourismuslehre</strong><br />
Touristik<br />
Der Begriff „Touristik“ ist eine Wortschöpfung die im internationalen Vergleich keine<br />
Entsprechung findet. Das Wort tauchte erst Ende des 19th Jahrhun<strong>der</strong>ts auf, und bezog sich<br />
primär auf das Hochgebirge, Berge und die Entdeckung <strong>der</strong> alpinen Welt – Touristik und<br />
Touren waren Berg- und Klettertouren, Gletschertouren und im weitesten Sinn wurde damit<br />
die Bergtouristik umschrieben. Der Begriff übertrug sich bald ganz allgemein auf alle Reisen<br />
nicht geschäftlicher Art, und auch die sich bildenden Vereine und sonstigen Organisationen<br />
benutzten diesen Ausdruck (Opaschowski 1981). Nach Ende des zweiten Weltkrieges wurde die<br />
Bezeichnung Touristik vorwiegend im Zusammenhang mit Reisegestaltungsbetrieben wie<br />
Reisemittler und Reiseveranstalter verwendet. Somit kann Touristik als die geschäftsmäßige<br />
Beschäftigung mit Reisen verstanden werden, als Synonym für „Tourismusbetriebe“ und<br />
„Tourismuswirtschaft“, insbeson<strong>der</strong>e für Reiseveranstalter und –mittler (vgl. Freyer 1996).<br />
Schroe<strong>der</strong> definiert den Begriff „Touristik“ so:<br />
„…gebräuchlich als Grund- und Bestimmungsort, z.B. in Flug-, See-, Schienen- und<br />
Straßentouristik o<strong>der</strong> Touristikbranche (z.B. Touristik-Experte, Touristik-Unternehmen). Der<br />
Begriff ist weitgehend gleichgesetzt mit Tourismus- und Fremdenverkehrsgewerbe.“<br />
(Schroe<strong>der</strong>: Lexikon <strong>der</strong> Tourismuswirtschaft)<br />
Touristik =<br />
1. Gesamtheit <strong>der</strong> touristischen Einrichtungen und Veranstaltungen;<br />
Reisewesen. (Langenscheidt Fremdwörterlexikon)<br />
2. Im Reisebüro: Abteilung Touristik --> Urlaubs- und Pauschalreisen Business-<br />
Travel --> Geschäftsreisen Touristik
Die Touristik ist somit ein enger Tourismusbegriff. In <strong>der</strong> heutigen Zeit wird unter diesen<br />
Begriff, vorwiegend die geschäftsmäßige Beschäftigung mit Reisen verstanden. Die<br />
„Touristik“ ist somit eine Teil- o<strong>der</strong> Untermenge des gesamten Wirtschaftsbereich Tourismus,<br />
<strong>der</strong> hauptsächlich durch Betriebe <strong>der</strong> Reisegestaltung geprägt ist.<br />
Reiseverkehr<br />
Der Begriff Reiseverkehr ist in <strong>der</strong> heutigen Zeit nicht mehr so sehr verbreitet wie früher. In<br />
den ersten fremdenverkehrswissenschaftlichen Arbeiten hingegen, tauchte <strong>der</strong> Begriff<br />
allerdings recht häufig auf. So bemühte sich z.B. Stradner (1905) den Fremdenverkehr<br />
begrifflich vom Reiseverkehr abzugrenzen (vgl. Sölter 2005). Der Reiseverkehr weist einige<br />
Ähnlichkeiten zum Tourismus auf, so ist z.B. <strong>der</strong> Reiseverkehr definiert durch Ortswechsel<br />
und Aufenthalt. Wer allerdings als Reisen<strong>der</strong> den Begriff Tourismus anstelle des Begriffs<br />
Reiseverkehr verwendet, bezieht mit Sicherheit sein Reisemotiv auf die aufenthaltsbezogene<br />
Attraktivität eines Zielortes / Zielgebiet (Luft 2005).
Als eine allgemeine umsetzbare Definition für Reiseverkehr nennt Roth (2004):<br />
Reiseverkehr umfasst alle Reisen und unterscheidet:<br />
• Privatreisen (Urlaubsreisen, VFR-Reisen, Kur- und Bä<strong>der</strong>reisen)<br />
• Geschäftliche Reisen aller Art
Zum Reiseverkehr gehören<br />
• Alle Beziehungen zwischen dauernden Wohn/Arbeitsort (permanenter Aufenthalt) und<br />
nicht dauerndem Wohnort (nicht permanenter Aufenthalt)<br />
• Und alle daraus resultierenden Beziehungen, Strukturen und Entwicklungen (wie z.B.<br />
Verkehr, Überfremdung, Krankheiten, Umweltprobleme, Erholung, Glück, Reichtum,<br />
Kapital- und Warenströme usw.)<br />
Meist wird <strong>der</strong> Reiseverkehr ab einer bis zu drei Monaten Übernachtung statistisch erfasst.<br />
Denn im internationalen Reiseverkehr ist es üblich, das sich <strong>der</strong> Begriff „Tourist“ auf eine<br />
Person bezieht, die sich für maximal drei Monate in einem an<strong>der</strong>en Land aufhält ohne eine<br />
Beschäftigung zu haben die von diesem Land aus entgolten wird.<br />
Reiseverkehr umfasst alles Verlassen des eigentlichen bzw. ursprünglichen Wohnortes<br />
(auch Umzug o<strong>der</strong> Auswan<strong>der</strong>n) sowie alle Formen und Arten des Reisens unabhängig<br />
von Motiv, Zeit, und Ort.<br />
Im Gegensatz hierzu, bezieht sich <strong>der</strong> Reiseverkehr in <strong>der</strong> Definition von Schrö<strong>der</strong> nur, auf<br />
die Art <strong>der</strong> Beför<strong>der</strong>ung und die Verwendung von Verkehrsmitteln.<br />
Nach Luft (1995) erweist es sich als durchaus angemessen die Glie<strong>der</strong>ung des Reiseverkehrs<br />
und die entsprechenden Zusammenhänge auf die übergeordneten Kriterien abzustellen<br />
• Erholung (physische Regeneration = Erholungsreiseverkehr)<br />
• Berufs- bzw. erwerbsorientierte Bildung und Information (Messe-, Kongress-,<br />
Tagungs-, Konferenz-, Seminar- und Schulungsreisen = Messe-, Kongress- und<br />
Tagungsreiseverkehr<br />
• Erledigung von dienstlichen bzw. geschäftlichen Aufgaben (= Geschäfts- und<br />
Dienstreiseverkehr)<br />
Nach Freyer (1996) stimmen Reiseverkehr und Tourismus nur in einem Schnittbereicht, dem<br />
touristischen Reiseverkehr überein.
Darüber hinaus umfasst:<br />
• Reiseverkehr weitere Aspekte als nur den touristischen Reiseverkehr: Hier werden<br />
alle Formen und Arten des Reisens, unabhängig von Motiv, Zeit, Ort betrachtet. Es ist<br />
für die Abgrenzung des Gebietes „Reiseverkehr“ unerheblich, warum eine Reise<br />
unternommen wird, wie lange sie dauert, wie weit sie geht und ob <strong>der</strong> Reisende wie<strong>der</strong><br />
zurückkommt. Alles sind Reisen und damit Aufgabe einer „Reiseverkehrswissenschaft“<br />
o<strong>der</strong> einer „-lehre“. Lediglich ein sehr weiter Tourismusbegriff könnte<br />
Reiseverkehr als Teil mit beinhalten. Reiseverkehr ist darüber hinaus eng mit<br />
allgem<strong>einen</strong> Verkehrsfragen und damit auch mit Transportproblemen verbunden.<br />
Dabei bleibt an dieser Stelle offen, inwieweit sich „Reiseverkehr“ auf<br />
Personentransport und –verkehr beschränkt o<strong>der</strong> auch Güterverkehr mit umfasst. (Quelle<br />
Freyer 1996). Die Rückkehr zum Heimatort ist im Gegensatz zum Tourismus kein<br />
Kriterium <strong>der</strong> Reiseverkehrs.<br />
International ist es üblich von „travel and tourism“ zu sprechen. Die Formulierung „travel“<br />
kann mit dem deutschen Wort „Reiseverkehr“ gleichgesetzt werden. Es bietet sich <strong>der</strong><br />
Einfachheit halber an, diese internationale Bezeichnung zu wählen und unter Betrachtung <strong>der</strong><br />
jeweiligen Akzente und Nuancen die verschiedenen Begriffe gleichzusetzen. Wer sich<br />
allerdings intensiv mit dem Gegenstand <strong>der</strong> Tourismuswissenschaft beschäftigen will, <strong>der</strong><br />
wird nicht darum herumkommen die Begriffe inhaltlich zu unterscheiden, abzugrenzen und zu<br />
differenzieren.<br />
In Anlehnung an die internationale Betrachtung ist „Tourismus und Reiseverkehr“ die evtl.<br />
präziseste bzw. umfassendste Bezeichnung für den Forschungsgegenstand <strong>der</strong><br />
Tourismuswissenschaft (Freyer 1996).<br />
Beson<strong>der</strong>s innerhalb <strong>der</strong> Tourismus-Statistiken wird oft vom Reiseverkehr gesprochen bzw.<br />
dieser statistisch erfasst. Laut statistischer Definition umfasst <strong>der</strong> Reiseverkehr:<br />
die Waren und Dienstleistungen, die in einem Wirtschaftsgebiet von Reisenden erworben<br />
werden, die sich dort für weniger als ein Jahr aufhalten. Ausgenommen ist die<br />
internationale Beför<strong>der</strong>ung von Reisenden, die als Personenbeför<strong>der</strong>ungsleistungen unter<br />
die Transportleistungen fällt (HUSSAIN/BYLINSKI 85/2007)<br />
Freizeit<br />
Ein weiter sehr wichtiger Begriff im Zusammenhang mit Tourismus, ist <strong>der</strong> Begriff<br />
„Freizeit“. Die Freizeit als arbeitsfreie Zeit wird vom Freizeitforscher Dumazedier genauer<br />
umschrieben als Gesamtheit <strong>der</strong> Beschäftigungen, denen sich das Individuum nach freiem<br />
Belieben hingeben kann, sei es, um sich zu erholen, zu vergnügen, seine frei gewählte<br />
Ausbildung und Information im Sinne seiner sozialen Beteiligung zu verbessern, und zwar<br />
nach seiner Befreiung von beruflichen, familiären und sozialen Pflichten.
Der Begriff „Freizeit“ fand vor allem Anfang <strong>der</strong> 60er Jahre zunehmende Verwendung in <strong>der</strong><br />
geographischen Tourismusforschung. So wurden im Laufe <strong>der</strong> Zeit die drei Begriffe<br />
Fremdenverkehr / Tourismus, Erholung und Freizeit zu begrifflichen Ausgangsbasen <strong>der</strong><br />
fremdenverkehrswissenschaftlichen / geographischen Tourismusforschung (vgl. Matznetter 1975). Im<br />
Blickfeld standen die räumlichen Auswirkungen des Freizeitverhaltens in Zusammenhang mit<br />
Studien über den Fremdenverkehr. So entwickelte sich aus <strong>der</strong> anfänglichen<br />
Fremdenverkehrsgeographie Mitte er 60er Jahre die Geographie <strong>der</strong> Freizeit und des<br />
Freizeitverhaltens. Durch die Verbreitung des Fremdenverkehrs zur Massenerscheinung,<br />
sowie bedingt durch die Entstehung neuer Freizeitaktivitäten wurde dann sehr bald deutlich,<br />
das <strong>der</strong> Terminus „Fremdenverkehr“ in seiner gängigen Interpretation immer fragwürdiger<br />
wurde, da er nur <strong>einen</strong> Teilaspekt des Freizeitverhaltensweisen abdeckte (vgl. Ruppert 1975).
Freizeit – Freizeitverkehr – Fremdenverkehr / Tourismus<br />
Komplex 1: Freizeit in Haus und Garten Ferien auf Balkonien<br />
Komplex 2: Freizeitverkehr im Wohnumfeld und am Wohnsitz (Ort, Gemeinde, Stadt)<br />
Spaziergang vom Wohnsitz aus; ein Bier beim Wirt um’s Eck; Tennis o<strong>der</strong><br />
Schwimmen in <strong>der</strong> Wohnsitzgemeinde<br />
Komplex 3: Freizeit- bzw. Fremdenverkehr ohne Übernachtung Tages- o<strong>der</strong><br />
Halbtagesausflüge über die Grenzen des Aufenthaltsortes; Schitagesfahrten<br />
Komplex 4: Fremdenverkehr mit 1 - 4 Übernachtungen Durchreisetourismus; Städteflüge;<br />
Naherholung<br />
Komplex 5: Fremdenverkehr mit mindestens 5 Übernachtungen klassische Urlaubsreisen;<br />
aber auch längere Aufenthalte am Zweitwohnsitz o<strong>der</strong> bei Bekannten,<br />
Freunden und Verwandten<br />
Komplex 6: Fremdenverkehr mit Freizeitteilkomponente(n) Kururlaube; Seminar- und<br />
Kongresstourismus<br />
Komplex 7: Fremdenverkehr ohne Freizeitkomponente(n) Berufs- und<br />
Geschäftsreiseverkehr mit Übernachtungen<br />
Freizeitverkehr = Komplexe 2-5<br />
Fremdenverkehr = Komplexe 3-7<br />
In <strong>der</strong> Abbildung von Monheim stehen „Freizeitverkehr“ und „Fremdenverkehr“ einerseits<br />
gleichberechtigt nebeneinan<strong>der</strong>, zum an<strong>der</strong>en zeigt die Abbildung aber auch, dass sich<br />
Schnittstellen zwischen „Freizeitverkehr“ und „Fremdenverkehr“ übergeben.<br />
(Müller 2002)<br />
• Freizeit = im weitesten arbeitsfreie Zeit<br />
• Freizeit = im engeren Sinn Zeitquantum außerhalb <strong>der</strong> Arbeitszeit, das dem<br />
Arbeitnehmer zur freien Verfügung steht<br />
Freizeit und Tourismus sind oftmals untrennbar miteinan<strong>der</strong> verbunden. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Seite jedoch sind Reisen und Tourismus nur eine von vielen Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
Freizeitbeschäftigungen. Zum Verhältnis von Freizeit und Tourismus, kann man sagen:<br />
Tourismus ist nur ein Teilbereich <strong>der</strong> Freizeit, eine von vielen Möglichkeiten die freie Zeit zu<br />
verbringen. Freizeit ist allerdings für den Tourismus beson<strong>der</strong>s in Bezug auf Freizeitreisen,<br />
ein konstitutives Element damit überhaupt gereist werden kann. Die folgende Abbildung von<br />
Steingrube zeigt ein möglich Typisierung von Freizeit und Tourismus.
In <strong>der</strong> soziologischen Freizeitforschung wird Tourismus als „mobile Freizeit“ verstanden und<br />
in <strong>der</strong> Erklärung von touristischen Erscheinungen oft von einem „industriegesellschaftlichen<br />
Lebensmodell“ ausgegangen, das auf den Komponenten Arbeit, Wohnen, Freizeit und Reisen<br />
beruht (Kaspar 1996). Auf dieses Modell wird in den folgenden Kapiteln ebenfalls kurz<br />
eingegangen.<br />
Freizeittrends mit Einflüssen auf das Tourismusverhalten nach Matthias Horx<br />
• stagnierende Bevölkerung bei zunehmen<strong>der</strong> Überalterung<br />
• verän<strong>der</strong>te Formen des Zusammenlebens<br />
• gesteigertes Bildungsniveau<br />
• fortschreitende Verstädterung<br />
• Zunahme <strong>der</strong> Zweit-Wohnsitze<br />
• steigen<strong>der</strong> Motorisierungsgrad<br />
• Wirtschaftswachstum bei zunehmen<strong>der</strong> Arbeitsproduktivität unter Freisetzung von<br />
Arbeitskräften<br />
• Auflösung traditioneller Arbeitszeitstrukturen<br />
• wachsende Bedeutung <strong>der</strong> Eigenarbeit<br />
• Neubewertung von Arbeit und Freizeit<br />
• verän<strong>der</strong>tes Geschlechterbild<br />
• zunehmende Umweltsensibilisierung<br />
Freizeit wird heute als Bestimmungsgröße <strong>der</strong> Tourismusnachfrage betrachtet. Man kann z.B.<br />
davon ausgehen dass wenn z.B. <strong>der</strong> gesetzliche Urlaub. auf eine Gesamturlaubszeit von 40<br />
Tagen steigen würde, das die z.B. auch positive Auswirkungen auf die Nachfrage nach<br />
touristischen Leistungen haben würde.
Naherholung<br />
Auch <strong>der</strong> Begriff „Naherholung“ führte bereits zu definitorische Streitigkeiten zwischen den<br />
Tourismusforschern. Im Gegensatz zur „Tourismusdebatte“ wird weniger die räumliche<br />
Entfernung – die durch die fortschreitende Verkehrserschließung und die wachsende<br />
Motorisierung an Gewicht verloren hat, herangezogen, son<strong>der</strong>n vielmehr die zeitliche<br />
Limitierung <strong>der</strong> Freizeit (vgl. Ruppert / Maier 1970). Die Naherholung umfasst „die inner- und<br />
außerstädtischen Erholungsarten von <strong>der</strong> stundenweisen Erholung… bis hin zur Wochenend-<br />
und teilweise zur Feiertagserholung (Ruppert/Maier 1969). Der zeitliche Rahmen <strong>der</strong> Naherholung<br />
variiert von mehreren Stunden bis zu einem Tag. Diese Erholungsform ist ähnlich dem<br />
Tourismus durch den Orts- und Zeitaspekt bestimmt. Das zeitliche Limit für die<br />
Erholungsaktivitäten beträgt <strong>einen</strong> Tag = 24 Stunden. In <strong>der</strong> Regel wird für das Erreichen des<br />
Naherholungsgebietes ein zeitlicher Rahmen von 60-90 Minuten mit öffentlichen o<strong>der</strong><br />
privaten Verkehrsmitteln nicht überschritten. Die Entfernung zum Zielgebiet beträgt in <strong>der</strong><br />
Regel nicht mehr 100 km. Im Durchschnitt unternimmt je<strong>der</strong> Bundesbürger alle 14 Tage<br />
<strong>einen</strong> Tagesausflug.<br />
Naherholung ist die Gesamtheit <strong>der</strong> Ausflüge, die innerhalb <strong>der</strong> Tagesfreizeit an<br />
Wochenenden, an Feiertagen und an sonstigen freien Tagen in die außerstädtischen<br />
Freizeiträume führen (Buchwald 1998)<br />
Früher war es üblich, beson<strong>der</strong>st raumbezogene Freizeitaktivitäten ohne Übernachtung als<br />
Naherholung zu bezeichnen. Hingegen versteht Kemper (1977) unter „Naherholungsaktivitäten“<br />
alle diejenigen Freizeitaktivitäten, die sich im Freien abspielen und eine zeitliche Dauer von<br />
maximal 2-3 Tagen in Anspruch nehmen. In dieser sehr weit gefassten Definition von<br />
Kemper sind somit sowohl Ausflüge als auch Aktivitäten im engeren und weiteren<br />
Wohnumfeld eingeschlossen. Diese Naherholungsdefinition hat allerdings mehrere<br />
Schwachstellen. Zum <strong>einen</strong> ist die Beschränkung auf den Faktor „im Freien“ sehr<br />
problematisch, da sich z.B. Museumsbesichtigungen, <strong>der</strong> Besuch von Schlösser und Burgen<br />
sich nicht nur im Freien abspielt, zum an<strong>der</strong>en ist die zeitliche Dauer von 2-3 Tagen zu weit<br />
gefasst (Kurzzeittourismus)<br />
Steinbach schlägt hingegen vor, das eintägige Nacherholungsreisen durch ein zusätzliches<br />
Distanzkriterium wie z.B. den 100 km-Radius um den Wohnortstandort, definiert werden<br />
müssen (vgl. Steinbach 2003).<br />
Urlaub<br />
Ursprünglich bedeutete das althochdeutsche urloup die Erlaubnis schlechthin, im<br />
Mittelhochdeutschen wurde daraus spezifischer „die Erlaubnis wegzugehen die ein<br />
Höherstehen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> eine Dame dem Ritter zu geben hatte (Drosdowski &Gerbe 1963 zit im Mund 1998)<br />
Die Bezeichnung Urlaub wird umgangssprachlich heute meist in zweierlei Hinsichten<br />
verstanden:<br />
1. Urlaub als Freisetzung von Arbeit, <strong>der</strong> Arbeitnehmer muss nicht in <strong>der</strong> Arbeitsstätte<br />
ersch<strong>einen</strong>, erhält aber trotzdem s<strong>einen</strong> Lohn. Auch wenn diese arbeitsfreie Phase<br />
ursprünglich dafür gedacht war, das sich <strong>der</strong> Arbeitnehmer erholen bzw. regenerieren<br />
kann, so liegt die Zweckbestimmung für diese Zeit allein beim Arbeitnehmer. Er kann
allein entscheiden wie er s<strong>einen</strong> „Urlaub“ verbringt, ob er nun verreist o<strong>der</strong> den<br />
ganzen Tag auf <strong>der</strong> Couch sitzt und ließt, dass bleibt allein ihm überlassen.<br />
Unabhängig vom Lebensalter des Arbeitnehmers, ist in Deutschland gesetzlich ein<br />
Mindesturlaub von 24 Werktagen im Kalen<strong>der</strong>jahr festgelegt.<br />
2. Urlaub wird zudem als Synonym für eine mehrtägige Reise verwendet. Hierbei ist es<br />
nicht von Bedeutung welcher Personenkreis in den Urlaub fährt, egal ob Rentner o<strong>der</strong><br />
noch im Arbeitsprozess stehende Menschen.<br />
Wie die obige Abbildung verdeutlicht gehört Urlaub zum Bereich <strong>der</strong> Freizeit. Allerdings<br />
zeigt sie auch das dass Reisen bzw. <strong>der</strong> Tourismus nur eine von vielen Möglichkeiten<br />
innerhalb <strong>der</strong> Freizeit ist.<br />
Im Zusammenhang mit Urlaub wird <strong>der</strong> Kurzurlaub, im Sinne von mindestens eine maximal<br />
drei auswärtige Übernachtungen o<strong>der</strong> z.B. <strong>der</strong> Wochenendurlaub = Kurzurlaub unter Einfluss<br />
eines Wochenendes unterschieden. Im Sinne <strong>der</strong> Reiseanalyse ist die Bezeichnung „Urlaub“<br />
an mindestens vier Übernachtungen in einem Beherbergungsbetrieb o<strong>der</strong> einer<br />
Privatunterkunft gebunden. Der Ausreiseverkehr hat in Deutschland <strong>einen</strong> hohen Stellenwert,<br />
nicht umsonst werden die „Deutschen“ oft als Reiseweltmeister bezeichnet.
Der Anspruch auf Jahresurlaub hat sich in den letzten hun<strong>der</strong>t Jahren mehr als verachtfacht.<br />
Im Jahr 1903 hatten einige Arbeitnehmer aus Industrie und Brauerein das Privileg auf drei<br />
Tage bezahlten Jahresurlaub. Nach Ende des Krieges wurde ein gesetzlicher Mindesturlaub<br />
von 12 Tagen für Arbeitnehmer bestimmt. Ein halbes Jahrhun<strong>der</strong>t später, hat sich die Anzahl<br />
<strong>der</strong> beschäftigungsfreien Tage verdoppelt und ein Arbeitnehmer hat Anspruch insgesamt in<br />
einer Zeitspanne von mindestens 24 Tagen <strong>der</strong> Arbeit fern zu bleiben.<br />
Reise<br />
Die deutsche Sprache fügt 115 Wortverbindungen mit „Reise“ zusammen (Deutsches<br />
Wörterbuch 1995) sicher ein Zeichen dafür, dass die Deutschen viel von Mobilität halten<br />
(Schmidt 1999) bzw. selber gern reisen. Das Wort „Reise“ ist in <strong>der</strong> deutschen Sprache so geläufig,<br />
aber dennoch schwierig genau zu erklären. So steht z.B. im Wörterbuch <strong>der</strong> Gebrü<strong>der</strong> Grimm,<br />
dass „Reise“ die Handlung des Reisens selbst (als Bewegung zwischen verschiedenen Orten<br />
o<strong>der</strong> Räumen), die Erlebnisse während <strong>der</strong> Reise, den Erfolg <strong>der</strong> Reise und die Angaben zum<br />
Ort <strong>der</strong> Reise bezeichnet. Eigentlich kann nur <strong>der</strong> Reisende von sich selbst behaupten: „Ja ich<br />
reise!“ In diesem Sinn würde <strong>der</strong> Begriff „Reise“ <strong>einen</strong> subjektiv erlebten Zustand, eine vom<br />
Reisenden wahrgenomme Situation, die sich für ihn über bestimmte Einstellungen, Gefühle,<br />
und Verhaltensweisen zusammensetzt, beschreiben (vgl. Lüdtke 2002). Grundlegend für eine<br />
Definition von „Reise“ ist die Ortsverän<strong>der</strong>ung.<br />
Eine mögliche Definition hierfür ist:<br />
Fahrt nach Orten außerhalb des ständigen Wohnsitzes zwecks Erholung, Erlebnis, Sport,<br />
Bildung, Kultur, Vergnügen, geschäftlicher o<strong>der</strong> beruflicher Betätigung o<strong>der</strong> aus Anlass<br />
familiärer Ereignisse (Verwandtenbesuche) (Opaschowski 2002)<br />
Mit <strong>der</strong> Reise ist das Verlassen eines Ortes gemeint. Man bricht auf unternimmt eine Fahrt<br />
wie z.B. die Bahnreise, man kann unablässig reisen, von <strong>der</strong> Reise wie<strong>der</strong> zurückkommen<br />
o<strong>der</strong> für immer am Reiseziel bleiben. Der Aspekt <strong>der</strong> „Rückkehr“ ist im Gegensatz zum<br />
Tourismus kein notwendiger Bestandteil einer Reise.<br />
Bei den Reisen werden vorwiegend die Urlaubsreisen und beruflich bedingte Reisen<br />
unterschieden. Bei den beruflich bedingten Reisen ist die eigentliche Reise nur ein Mittel zum<br />
Zweck (Besuch eines Meetings, Weiterbildungsveranstaltung), bei <strong>der</strong> Urlaubsreise ist die<br />
Reise <strong>der</strong> eigentliche Zweck. Die Motive <strong>der</strong> Urlaubsreise sind meist die Erholung,<br />
Regeneration, Kultur, Bildung und Entspannung.<br />
Gegenstand <strong>der</strong> <strong>Tourismuslehre</strong> ist die Ortsverän<strong>der</strong>ung von Menschen und alle damit<br />
zusammenhängenden Phänomene( Freyer 1997). Das wichtigste Element <strong>der</strong> <strong>Tourismuslehre</strong><br />
ist somit die Reise. Um zu reisen, verlassen Menschen ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort (ihr<br />
Zuhause) und halten sich vorübergehend an an<strong>der</strong>en Orten (in <strong>der</strong> Fremde) auf. Bestandteil<br />
<strong>der</strong> Reise ist immer die Überwindung einer räumlichen Distanz. Um diese Distanz zwischen<br />
Heimatort und Zielort zu überwinden, werden verschiedene Transportmittel wie z.B. Auto,<br />
Bus, Bahn o<strong>der</strong> Flugzeug genutzt. Eine Modellhafte Darstellung dieses Vorgangs ist bei<br />
Freyer zu finden (Freyer 8. Aufl.)
Touristische Reisen unterscheiden sich hinsichtlich an<strong>der</strong>er Formen <strong>der</strong> Ortsverän<strong>der</strong>ung vor<br />
allem hinsichtlich:<br />
• ihrer Dauer („Zeit“) und Zeiterlebens<br />
• des Reiseziels („Ort“ / „Raum“ / „Entfernung“) und des Raumerlebens<br />
• <strong>der</strong> Reisemotivation o<strong>der</strong> des Motiverlebnis (Freyer 1997)<br />
• <strong>der</strong> Entfernung<br />
• <strong>der</strong> benutzten Verkehrsmittel<br />
Der Begriff „Reise“ kann zudem auch produktpolitisch verwendet werden. So stellt die Reise<br />
als Leistungsbündel das eigentliche Grundprodukt des Tourismus dar. Als typisches Produkt<br />
<strong>der</strong> Touristik-Unternehmen kann vor allem die Pauschalreise betrachtet werden. Die<br />
Pauschalreise als Produkt spielt sich wie jede Reise in drei spezifischen Räumen ab: Heimtort,<br />
Unterwegs und Zielort.<br />
Wann ist <strong>der</strong> Reisende ein Tourist?<br />
Der Tourist ist kein Reisen<strong>der</strong>. Zu den Reisenden zählen <strong>der</strong> Pilger, <strong>der</strong> bildungsreisende<br />
Scholar, <strong>der</strong> Künstler und <strong>der</strong> Händler, <strong>der</strong> Söldner und nicht zuletzt <strong>der</strong> Landstreicher.<br />
Unterwegs, ist dieser Reisende gleichwohl zu Hause: Er hat keine feste Bleibe und ist den<br />
An<strong>der</strong>en ein Unbekannter, aber er bewohnt die Welt. Der Tourist ist erst recht kein<br />
Flüchtling, Migrant o<strong>der</strong> entlaufener Sträfling. Er ist nicht einmal ein Urlauber: "Urlaub"<br />
beinhaltet die Erlaubnis, fortzugehen - <strong>der</strong> Ritter erhielt sie von seinem Herrn o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Dame<br />
seines Herzens, <strong>der</strong> heutige Arbeitnehmer bekommt sie von seinem Arbeitgeber. Das heißt, er<br />
erlangt die Freiheit, nichts zu tun. Der Tourist aber ist nicht frei, er muss sich touristisch<br />
betätigen. Das ist Ziel und Zweck des Tourismus.<br />
In <strong>der</strong> einschlägigen Literatur erfolgt oftmals eine Trennung zwischen Reisenden und dem<br />
Tourist. Der Reisende verbringt s<strong>einen</strong> Urlaub richtig, <strong>der</strong> Tourist hingegen wird meist als<br />
Übel dargestellt. Während etymologisch im Wort „Reise“ <strong>der</strong> Impuls des Aufbrechens<br />
(englisch „to rise“) noch erkennbar ist, liegt <strong>der</strong> Akzent <strong>der</strong> Wortbedeutung bei „Tourismus“<br />
auf <strong>der</strong> Rundfahrt (französisch „Tourneé), also dem Reiseverlauf, <strong>der</strong> sich wie<strong>der</strong> zur<br />
Rückkehr wendet, selbst (Grendt 2001). Nach Boorstin ist <strong>der</strong> Unterschied zwischen den einstigen<br />
Reisenden und den neueren Touristen, dass diese „passiv geworden“ sind. „Der Reisende war<br />
aktiv; er suchte ernsthaft nach Menschen, Abenteuern und Erfahrungen, <strong>der</strong> Tourist erwarte<br />
hingegen dass etwas mit ihm geschieht (Boorstin zit. in Bausinger 1991). Egal wie auch immer teilweise<br />
sogar sehr willkürlich in <strong>der</strong> Literatur zwischen Reisenden und Touristen unterschieden wird,<br />
Fakt ist, dass jede Person die nach o.g. Definition eine Reise unternimmt, ein Reisen<strong>der</strong> ist.<br />
Der Tourist ist somit stets auch immer ein Reisen<strong>der</strong>, denn er verlässt sein gewohntes Umfeld<br />
aus verschiedenen Reisezwecken.<br />
Arten und Formen des Tourismus<br />
In <strong>der</strong> älteren Literatur zum Fremdenverkehr, wurde die Begriffe Arten und Formen des<br />
Fremdenverkehrs / Tourismus vermengt und es erfolgte kaum eine logische Trennung <strong>der</strong><br />
beiden Begriffe. Zwar bemühten sich einige Wissenschaftler wie z.B. Wegner (1929) um die<br />
Ableitung von Fremdenverkehrsarten (Anhand <strong>der</strong> verschiedenen Grundbedürfnisse) doch es<br />
entstand keine allgemeingültige Unterscheidung. Die Vielfalt <strong>der</strong> Motive und die<br />
unterschiedlichen Perspektiven erschweren die Einordnung in Tourismusarten und –formen.<br />
Neben <strong>der</strong> standardisierten Pauschalreise, werden heute von den Reiseveranstaltern zahlreiche
Möglichkeiten angeboten die „Schönsten Wochen des Jahres“ zu verbringen. Der normale<br />
„Standardurlaub“ verliert immer mehr an Bedeutung. In <strong>der</strong> heutigen Zeit kann <strong>der</strong><br />
Reisewillige innerhalb weniger Minuten s<strong>einen</strong> Traumurlaub im Internet zusammenstellen<br />
und buchen. Dabei steht nicht immer nur ein Motiv im Vor<strong>der</strong>grund. So wird z.B. eine<br />
Bergtour in den Alpen (sportorientierter Tourismus) mit einem einwöchigen Bade- und<br />
Erholungsurlaub kombiniert (erholungsorientierter Tourismus). Der Reisende übernachtet<br />
dabei sowohl in Beherbergungsbetrieben <strong>der</strong> Parahotellerie (Berghütte) sowie auch in<br />
Betrieben <strong>der</strong> Hotellerie wie z.B. in einem First Class Hotel.<br />
Die heute gängige Unterscheidung in Tourismusarten und – formen geht zurück auf Paul<br />
Bernecker, dieser bemühte sich in seiner <strong>Grundlagen</strong>lehre des Fremdenverkehrs um eine<br />
logische Trennung. Als Glie<strong>der</strong>ungskriterium für die Arten des Fremdenverkehrs handelt es<br />
sich im allgem<strong>einen</strong> um eine das innere Wesen des Fremdenverkehrs betreffende<br />
Unterscheidung. Die geistige Konzeption, die dem Fremdenverkehr in s<strong>einen</strong> verschiedenen<br />
Arten zugrunde liegt, wird hierbei den Maßstab bilden, während das äußere Geschehen des<br />
Ablaufs sich in den verschiedensten, sich ständig wandelnden und neu begründeten Formen<br />
des Fremdenverkehrs abspielt (Bernecker 1961). Allerdings wird es kaum möglich sein die Arten<br />
des Tourismus erschöpfend zu glie<strong>der</strong>n, denn die Entwicklung schläft nicht, beson<strong>der</strong>st durch<br />
die sich stetig wandelnden Motive, werden auch in Zukunft neue Arten des Tourismus<br />
entstehen. Anhand <strong>der</strong> Glie<strong>der</strong>ung nach <strong>der</strong> Motivation, aus <strong>der</strong> Sicht des Nachfragers nennt<br />
Kaspar (1996) sechs Tourismusarten:<br />
• Erholungstourismus<br />
• kulturorientierter Tourismus<br />
• gesellschaftsorientierter Tourismus<br />
• Sporttourismus<br />
• wirtschaftsorientierter Tourismus<br />
• politikorientierter Tourismus<br />
Die Motive für den Fremdenverkehr bzw. den Tourismus können meist nicht nur einseitig<br />
betrachtet werden. In <strong>der</strong> Praxis kommen meist mehrere Motivkombinationen vor, so dass<br />
eine strikte Trennung / Unterscheidung nicht immer exakt möglich ist. Als Anmerkung sei<br />
hier erwähnt dass einige <strong>der</strong> dominanten Typen <strong>der</strong> Tourismusarten gewissen Typen <strong>der</strong><br />
Tourismusorte entsprechen.<br />
Erholungstourismus: Unter Erholungstourismus versteht man die Nah- und die<br />
Ferienaufenthalte zur physischen psychischen Regeneration. Außerdem gehört die<br />
Kurerholung zum Erholungstourismus. Bei <strong>der</strong> Kur werden natürliche Heilmittel des Bodens,<br />
des Klimas und des Meeres zur Heilung o<strong>der</strong> zur Vorbeugung eingesetzt.<br />
Kulturorientierter Tourismus: Der kulturorientierte Tourismus lässt sich in<br />
Bildungstourismus und in Wallfahrtstourismus unterscheiden. Der Bildungstourismus umfasst<br />
den Besuch historisch, kulturell o<strong>der</strong> geographisch sehenswerter Stätten. Bildungsreisende<br />
interessieren sich meistens auch für die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse im<br />
Zielland. Ziele des Wallfahrtstourismus (Pilgertourismus) sind Orte mit beson<strong>der</strong>er religiöser<br />
Bedeutung.<br />
Gesellschaftsorientierter Tourismus: Der gesellschaftsorientierte Tourismus trifft als<br />
Verwandtentourismus o<strong>der</strong> als Clubtourismus auf. Der Verwandtentourismus umfasst auch
den Besuch bei Freunden und Bekannten. Er wird international als visiting friends and<br />
relatives (VFR) bezeichnet. Der Clubtourismus zeichnet sich dadurch aus, dass die Reisenden<br />
bewusst in die Gruppe integriert werden. Dies geschieht unter an<strong>der</strong>em durch ein<br />
ausgeprägtes Animations- und Sportprogramm.<br />
Sportorientierte Tourismus: Zum sportorientierten Tourismus gehören Reisen zur aktiven<br />
sportlichen Betätigung und Reisen zur passiven Teilnahme an Sportveranstaltungen.<br />
Wirtschaftsorientierter Tourismus: Der wirtschaftsorientierte Tourismus umfasst im<br />
weitesten Sinne Reisen, die aus beruflichen Gründen durchgeführt werden. Zu den<br />
wirtschaftsorientierten Tourismusarten zählen <strong>der</strong> Geschäftstourismus, <strong>der</strong><br />
Kongresstourismus, <strong>der</strong> Ausstellungs- und Messetourismus sowie <strong>der</strong> Incentivetourismus.<br />
Politikorientierter Tourismus: Der politikorientierte Tourismus glie<strong>der</strong>t sich in zwei<br />
Ausprägungen: in den Diplomaten- und Konferenztourismus sowie in Tourismus in<br />
Zusammenhang mit politischen Veranstaltungen.<br />
(Quelle: Kaspar / Forisch-Will 1994)<br />
Eine abweichende Glie<strong>der</strong>ung nach Tourismusarten findet sich bei Luft (2005). Er geht bei<br />
seiner „Klassifizierung des Reiseverkehrs“ von <strong>der</strong> Motivsituation aus, da sich im<br />
Reiseverhalten das zugrunde liegende Motiv <strong>der</strong> Ortsverän<strong>der</strong>ung ausdrückt. In seinem<br />
Schema gibt es drei „übergeordnete“ Kriterien:<br />
1. Erholung<br />
2. Berufs- bzw. erwerbsorientierte Bildung bzw. Information<br />
3. Erledigung von geschäftlichen und dienstlichen Aufgaben<br />
Glie<strong>der</strong>ungsmerkmale für die Tourismusarten sind die von <strong>der</strong> touristischen Nachfrage<br />
ausgehenden grundlegenden Reise- und Aufenthaltsmotive / -erwartungen. Danach können<br />
z.B. folgende Tourismusarten benannt werden:<br />
• Erholungstourismus<br />
• Sporttourismus<br />
• Kulturtourismus<br />
• Kurtourismus / Gesundheitstourismus<br />
• Veranstaltungstourismus<br />
Auch die Bezeichnung „Tourismusart“ bzw. „Tourismusarten“ ist nicht frei von Kritik. Im<br />
Lexikon <strong>der</strong> Geographie (2001) ist folgendes zu lesen:<br />
Tourismusart, (veralteter) Begriff zur Glie<strong>der</strong>ung des Tourismus nach <strong>der</strong> Motivation<br />
des Nachfragers, z.B. Erholungstourismus, Gesundheitstourismus, Messetourismus. Nur<br />
bei eindeutiger Motivationslage und Überschneidungsfreiheit mit an<strong>der</strong>en<br />
Glie<strong>der</strong>ungskriterien sollte dieser Begriff verwendet werden. (Spektrum – Lexikon <strong>der</strong> Geographie,<br />
2001)<br />
Im Gegensatz zu den Tourismusarten, bei denen die Motivation eine Rolle spielt, erfolgt die<br />
Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Tourismusformen nach äußeren Ursachen und Einwirkungen. Unter den
Formen des Tourismus sollen daher die nach äußeren Ursachen und Einwirkungen<br />
verschieden bezeichneten Fremdenverkehrs- / Tourismusabläufe bezeichnet werden (vgl.<br />
Bernecker 1962).<br />
Tourismusform (touristische Erscheinungsform), greift auf sichtbare, äußere Erscheinungen<br />
o<strong>der</strong> auf nur zum Teil sichtbare Verhaltensweisen sowie auf die nicht sichtbare<br />
Reisemotivation zurück, um die Vielfalt <strong>der</strong> touristischen Nachfrage zu glie<strong>der</strong>n. Die jeweils<br />
definierten touristischen Erscheinungsformen erweisen sich in ihrer Vielfalt als beinahe<br />
beliebig. Die verwendeten Kriterien sind<br />
• frei wählbar,<br />
• nicht immer überschneidungsfrei,<br />
• sie müssen nicht die Gesamtheit aller Touristen erfassen und<br />
• sie müssen einan<strong>der</strong> nicht ausschließen, son<strong>der</strong>n können auch miteinan<strong>der</strong> kombiniert<br />
werden. (Spektrum – Lexikon <strong>der</strong> Geographie, 2001)<br />
Wenn Reisen nach einem äußeren Kriterium wie <strong>der</strong> Beherbergungsform o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Art des<br />
verwendeten Verkehrsmittel unterschieden werden, so sagt man, das diese Reisen zu<br />
unterschiedlichen Tourismusformen gehören. Denkbar sind theoretisch viele Möglichkeiten,<br />
um Tourismusformen nach äußeren Kriterien abzugrenzen. Die heute gebräuchlichsten<br />
Unterscheidungen <strong>der</strong> Tourismusformen sind heute (Kaspar / Frisch-Will 1994 und Kaspar 1996:<br />
• die Herkunft <strong>der</strong> Reisenden<br />
• <strong>der</strong> Organisationsform<br />
• <strong>der</strong> Aufenthaltsdauer<br />
• dem Alter <strong>der</strong> Reisenden<br />
• dem Verkehrsmittel<br />
• <strong>der</strong> Jahres bzw. Saisonzeit<br />
• <strong>der</strong> Beherbergungsform<br />
• die Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz<br />
• die Art <strong>der</strong> Finanzierung<br />
• <strong>der</strong> soziologischer Inhalt<br />
• die Reiseform (Art <strong>der</strong> Organisation <strong>der</strong> Reise)<br />
• das Reiseverhalten<br />
Tourismusformen nach <strong>der</strong> Herkunft <strong>der</strong> Reisenden: Nach <strong>der</strong> Herkunft <strong>der</strong> Reisenden<br />
glie<strong>der</strong>t man den Tourismus in Binnen und Auslandstourismus Das Wort „Herkunft“ bezieht<br />
sich als nicht auf die Nationalität o<strong>der</strong> die Abstammung <strong>der</strong> Tourismussubjekte, son<strong>der</strong>n<br />
darauf, wie die Reisenden normalerweise leben und arbeiten. Man spricht auch von Inlands-<br />
und Auslandsreisen<br />
Tourismusformen nach dem Organisationsform: Nach <strong>der</strong> Organisationsform<br />
unterscheidet man Pauschaltourismus und Individualtourismus. Die Pauschalreise ist ein<br />
standardisiertes, vororganisiertes Bündel von Reiseleistungen, das komplett gekauft wird. Die<br />
Individualreise ist dadurch gekennzeichnet, dass man sie selbst organisiert und abwickelt. <strong>Sie</strong><br />
wird gelegentlich auch als Einzelreise bezeichnet. Das hießt aber nicht, dass man alleine<br />
verreisen müsste: auch eine Reise mit <strong>der</strong> ganzen Familie, die man selbst plant und
durchführt, ist eine Einzelreise. Der Begriff Individualtourismus wird außerdem häufig als<br />
Gegenbegriff zu dem des Massentourismus benutzt. Massentourismus bedeutet ursprünglich<br />
dass viele Menschen am Tourismus teilnehmen (können).<br />
Tourismusformen nach dem Aufenthaltsdauer: Eine sehr wichtige Unterscheidung von<br />
Tourismusformen ist die nach <strong>der</strong> Aufenthaltsdauer. Unterscheidet man Tourismusformen<br />
nach <strong>der</strong> Dauer des Aufenthalts, fallen Urlaubsreisen unter den langfristigen Tourismus. In<br />
diese Kategorie gehört außerdem <strong>der</strong> Kulturtourismus.<br />
Der langfristige Tourismus wird ergänzt durch den kurzfristigen Tourismus. Der kurzfristige<br />
Tourismus glie<strong>der</strong>t sich in Durchreise- und Passantentourismus, Tagesausflugstourismus und<br />
eigentlichen Kurzzeittourismus (Kurzreise). Unter Durchreise- und Passantentourismus<br />
versteht man, dass die Reisenden nicht zum Aufenthaltsort zurückkehren. Mit<br />
Tagesausflugstourismus sind Touren gemeint, bei denen man nicht übernachtet.<br />
langfristiger<br />
Tourismus<br />
Urlaubsreise<br />
Kurtourismus<br />
Tourismusformen nach <strong>der</strong><br />
Aufenthaltsdauer<br />
langfristiger<br />
Tourismus<br />
Durchreise- und<br />
Passantentourismus<br />
Tagesausflugstourismus<br />
Kurzreise<br />
(Kaspar / Forisch-Will 1994)<br />
Tourismusformen nach dem Alter <strong>der</strong> Reisenden:<br />
Auch das Alter <strong>der</strong> Reisenden wird herangezogen, um Tourismusformen zu unterscheiden,<br />
Dabei spielen vor allem die Personengruppen am unteren und am oberen Ende <strong>der</strong> Altersskala<br />
terminologisch eine Rolle; man spricht zwar vom Jugendtourismus und vom<br />
Seniorentourismus, aber die Altersgruppe dazwischen hat keine eigene Bezeichnung. Unter<br />
Jugendtourismus versteht man den Reiseverkehr von Leuten, die nicht mehr mit ihren Eltern<br />
und noch nicht mit ihrer eigenen (potentiellen) Familie in Urlaub fahren. Im wesentlichen<br />
fallen darunter als Reisende zwischen 15 und 24 Jahren. Seniorentourismus ist <strong>der</strong><br />
Reiseverkehr von Personen, die nicht mehr aktiv erwerbstätig sind.
Tourismusformen nach dem Verkehrsmittel: Eine weitere Einteilung <strong>der</strong><br />
Tourismusformen betrifft das Verkehrsmittel, dass für die Ortsverän<strong>der</strong>ung benutzt wird. Man<br />
unterscheidet Flugtourismus, Bustourismus, Bahntourismus, Autotourismus und<br />
Schiffstourismus.<br />
Tourismusform nach <strong>der</strong> Jahres- bzw. Saisonzeit: Nach den Jahreszeiten unterscheidet<br />
man zwischen Sommertourismus und Wintertourismus. Die Einteilung nach <strong>der</strong> Saisonzeit<br />
bezieht sich darauf, dass die Nachfrage nach Reiseleistungen über das Jahr hinweg variiert.<br />
Der Zeitraum, in dem die meisten Menschen reisen, heißt Hochsaison, die übrige Zeit wird in<br />
mehrere Neben- bzw. Zwischensaisons eingeteilt. Die Hochsaisontermine sind nicht für alle<br />
Zielgebiete identisch.<br />
(Quelle bis hier: Kaspar / Frisch-Will 1994)<br />
Tourismusformen nach <strong>der</strong> Beherbergungsform: Nach <strong>der</strong> Form <strong>der</strong> Beherbergung<br />
können primär die Hotellerie und die touristische Parahotellerie unterschieden werden. Zudem<br />
bevorzugen es einige den sog. Camping- und Wohnwagentourismus. Aber auch Chlet- und<br />
Appartementtourismus o<strong>der</strong> Zweitwohnungstourismus sind als denkbare Tourismusformen<br />
möglich.<br />
Tourismusformen anhand <strong>der</strong> Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz: Bei den<br />
Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz sind <strong>der</strong> aktive und <strong>der</strong> passive Tourismus zu<br />
unterscheiden. Aktiver Tourismus und somit auch Einwirkung auf die Zahlungsbilanz des<br />
Landes hat <strong>der</strong> Incomingtourismus - <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>tourismus im Inland. Keine Auswirkungen<br />
auf die Zahlungsbilanz bzw. passiver Tourismus entsteht durch den Outgoingtourismus -<br />
Fremdenverkehr <strong>der</strong> Inlän<strong>der</strong> im Ausland.<br />
Tourismusformen nach <strong>der</strong> Finanzierungsart:<br />
• Sozialtourismus (Beteiligung kaufkraftschwacher Bevölkerungsschichten am<br />
Tourismus, wobei dieser durch beson<strong>der</strong>e Vorkehrungen ermöglicht und erleichtert<br />
wirt)<br />
• Tourismus durch Vor- und Nachfinanzierung (Kreditkarten) (Kaspar 1996)<br />
Wichtiges Kriterium ist hier also ob eine Eigen- o<strong>der</strong> Fremdfinanzierung vorliegt.<br />
Tourismusformen nach soziologischem Inhalt:<br />
• Luxus- und Exklusivtourismus<br />
• Traditioneller Tourismus (entsprechend <strong>der</strong> touristischen Ausprägung von<br />
Individualreise und –aufenthalt im Hotel in den Anfangsjahren des mo<strong>der</strong>nen<br />
Tourismus.<br />
• Jugendtourismus<br />
• Seniorentourismus<br />
• Sozialtourismus<br />
• Sanfter Tourismus<br />
Tourismusformen nach dem Reiseverhalten: Anhand dieser Tourismusform lässt sich gut<br />
<strong>der</strong> Wandel und das Entstehen von neuen Tourismusformen aufzeigen. Beson<strong>der</strong>st in <strong>der</strong> 80er<br />
Jahren wurde <strong>der</strong> Ruf laut nach einem Tourismus im Einklang mit Mensch und Natur. Hieraus<br />
entwickelte sich allmählich <strong>der</strong> „sanfte Tourismus“. Kaspar unterscheidet in dieser Gruppe:
• Intelligenter Tourismus<br />
• Neigungsorientierter Tourismus<br />
Die Einteilung von Reisen in Tourismusformen geht von äußeren Ursachen aus, nicht von <strong>der</strong><br />
Motivation des Reisens. <strong>Sie</strong> unterscheidet sich dadurch von <strong>der</strong> Einteilung nach<br />
Tourismusarten. Zu Präzisierungszwecken lassen sich wie<strong>der</strong>um die meisten <strong>der</strong> erwähnten<br />
Tourismusformen miteinan<strong>der</strong> kombinieren. Beispiele hiefür sind: langfristiger<br />
Hoteltourismus, intelligenter Kurzzeittourismus usw.<br />
Die genannte Aufzählung von Tourismusarten und –formen erhebt nicht den Anspruch auf<br />
Vollständigkeit. Der allgegenwärtige Wandel in <strong>der</strong> Tourismuswirtschaft lässt immer neue<br />
Arten und Formen des Tourismus aufkommen, zudem gibt es zahlreiche Mischformen die<br />
nicht eindeutig einer Tourismusart o<strong>der</strong> Tourismusform zugeteilt werden kann. So finden sich
z.B. auch Klassifikationen von sog. „Fremdenverkehrsarten“ die nach fünf Kriterien<br />
vorgenommen werden:<br />
1. Temporales Kriterium (Dauer <strong>der</strong> Reise) Naherholungsverkehr, Passantenverkehr<br />
2. Kausales Kriterium: (Motiv <strong>der</strong> Reise) Freizeitverkehr, Geschäftsreise<br />
3. Modales Kriterium: (Art <strong>der</strong> Unterkunft und des Verkehrsmittels) Hotellerie,<br />
Parahotellerie, Bustourismus<br />
4. Saisonales Kriterium: (Jahreszeitliche Verteilung) Wintersaison, Sommersaison<br />
5. Organisatorisches Kriterium (Organisationsform) Gesellschaftsreise, Individualreise<br />
Allerdings handelt es sich bei diesen „Fremdenverkehrsarten“ – wenn man die vorher<br />
erörterte Einteilung von Kaspar heranzieht – um eine Mischung aus Tourismusarten und<br />
Tourismusformen. In <strong>der</strong> heutigen „Tourismuswissenschaft“ gibt es bisher keine klaren<br />
und allgemein akzeptierte Abgrenzungen für Tourismusarten und –formen.<br />
Überschneidungen und Ergänzungen sind quasi unbegrenzt möglich.<br />
Das System Tourismus<br />
Die Erscheinung „Fremdenverkehr“ o<strong>der</strong> „Tourismus“ als mehrdimensionales System zu<br />
erklären, versuchte erstmals (im deutschsprachigen Raum) 1975 <strong>der</strong> Tourismusökonom<br />
Claude Kaspar. Nach Kaspar`s Ansicht weißt allein schon die Beschreibung des Phänomens<br />
Fremdenverkehr o<strong>der</strong> Tourismus als die Gesamtheit <strong>der</strong> Beziehungen und Erscheinungen, die<br />
sich aus <strong>der</strong> Reise und dem Aufenthalt von Personen ergeben, für die <strong>der</strong> Aufenthaltsort<br />
we<strong>der</strong> hauptsächlicher und dauern<strong>der</strong> Wohn- noch Arbeitsort ist, auf ein vielschichtiges<br />
System von Beziehungen hin (vgl. Kaspar 1978). Der Tourismus ist heutzutage ein eigenständiger<br />
Bereich (System) unserer alltäglichen Lebensumwelt geworden. Zu diesem Lebensbereich<br />
„Tourismus“ bestehen starke interdisziplinäre Verflechtungen zu an<strong>der</strong>en Bereichen.<br />
Definition System / Systemtheorie<br />
Systeme sind eine „geordnete Gesamtheit von Elemente, zwischen denen irgendwelche<br />
Beziehungen bestehen o<strong>der</strong> hergestellt werden können“ (Ulrich 1968)<br />
Ulrich bezeichnete die allgemeine Systemtheorie als „die formale Wissenschaft von <strong>der</strong><br />
Struktur, den Verknüpfungen und dem Verhalten irgendwelcher Systeme.<br />
Jedes System zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:<br />
• Es muss aus mehreren Teilen bestehen<br />
• Die Teile müssen voneinan<strong>der</strong> verschieden sein<br />
• Die Teile dürfen nicht wahllos nebeneinan<strong>der</strong> liegen, son<strong>der</strong> sind in einem bestimmten<br />
Aufbau miteinan<strong>der</strong> vernetzt. Das „Netz“ muss nicht unbedingt sichtbar sein, son<strong>der</strong>n<br />
kann auch durch Wirkungen bestehen, die durch <strong>einen</strong> Informationsaustausch<br />
zustande kommen (vgl. Vester 1982)<br />
Bereits Kaspar war schon früh bewusst, dass <strong>der</strong> Fremdenverkehr / Tourismus nicht einseitig<br />
betrachtet werden darf. Zu dieser Multidisziplinarität führt die Tatsache, dass <strong>der</strong><br />
Fremdenverkehr / Tourismus zahlreichen Einflussfaktoren ausgesetzt ist, aber selbst auf viele<br />
Erscheinungen Einfluss nimmt (Kaspar 1978). Der Tourismus entzieht sich einer eindimensionalen
Betrachtung, um ihn zu verstehen, ist es notwendig nicht nur seine Kernbereiche zu<br />
betrachten, son<strong>der</strong>n auch seine sozio-kulturellen, ökonomischen, ökologischen,<br />
technologischen und politischen Rahmenbedingungen zu erfassen. Aufgrund dieser<br />
vielfältigen transversalen und heterogenen Beziehungen zwischen dem Tourismus und s<strong>einen</strong><br />
Umwelten ist eine systematische Betrachtungsweise angebracht (Palomeque 2005). In <strong>der</strong> Sprache<br />
<strong>der</strong> Systemtheorie übersetzt, ist das System Tourismus ein offenes und dynamisches System,<br />
das in Form von Inputs seitens <strong>der</strong> übergeordneten Systeme verän<strong>der</strong>t wird bzw. durch sog<br />
Outputs auf an<strong>der</strong>e Systeme Einfluss nimmt (Kaspar 1978). Die Intensität <strong>der</strong> In- bzw. Outputs<br />
kann über die Einflussstärke <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en gleich- o<strong>der</strong> übergelagerten Systeme auf den<br />
Tourismus bzw. über die Einflusskraft des Systems Tourismus auf an<strong>der</strong>e Systeme aussagen<br />
(Kaspar 1998).<br />
Das System Tourismus kann somit als eine geordnete Gesamtheit von Elementen definiert<br />
werden, zwischen denen irgendwelche Beziehungen stehen. Das System Tourismus von<br />
Kaspar ist auf Grund seiner Verbindungen zur Umwelt ein sog. offenes System, d.h. es steht<br />
in Wechselbeziehungen / Verbindung zum gesellschaftlichen Umfeld, welches durch fünf<br />
übergeordnete Systeme (ökonomische, soziale, politische, ökologische und technologische<br />
Umwelt) vertreten ist. Zudem ist es aber auch ein dynamisches System, Prozessabläufe und<br />
Einflüsse können Elemente und Strukturen des Systems Tourismus beeinflussen, so dass sich<br />
dieses System ständig verän<strong>der</strong>t. Der Systemansatz von Kaspar ist geprägt durch <strong>einen</strong><br />
makroanalytischen Blickwinkel, <strong>der</strong> den Bezugsrahmen <strong>der</strong> Tourismusunternehmungen und –<br />
organisationen darstellt (vgl. Reeh / Faust 2005).
Aus <strong>der</strong> Struktur des Systems Tourismus lässt sich folgendes ableiten:<br />
• ständige Verän<strong>der</strong>ungen mit Wechselwirkung auf Gesellschaft und umgekehrt<br />
• For<strong>der</strong>ungen von Umwelt und Gesundheit<br />
• Systemcharakter<br />
• Einglie<strong>der</strong>ung in das Suprasystem Wirtschaft, Umwelt, Politik, Technik und<br />
Gesellschaft.<br />
Im Zentrum <strong>der</strong> Abbildung steht das eigentliche System Tourismus. Aus Gründen <strong>der</strong><br />
Übersichtlicht- und <strong>der</strong> Eindeutigkeit beschränkte sich Kaspar auf die Betrachtung des<br />
Subjekt-Objekt-Verhältnis d.h. des Verhältnis zwischen Nachfrage und Angebot. Das<br />
eigentliche System Tourismus glie<strong>der</strong>t sich deshalb in die beiden Subsysteme<br />
Tourismussubjekt und das sog. institutionelle Subsystem Tourismusobjekt.<br />
Als über- und nebengeordnete Systeme nennt Kaspar fünf Bereiche unseres Lebensraums<br />
bzw. gesellschaftlichen Umfelds, die stark mit dem „System Tourismus“ verflochten sind:<br />
• ökonomische Umwelt<br />
• sozio-kulturelle Umwelt<br />
• politische Umwelt<br />
• technologische Umwelt<br />
• ökologische Umwelt
Untersysteme / Subsysteme des Systems Tourismus<br />
Tourismussubjekt = Nachfrager von Tourismusleistungen<br />
(Mensch <strong>der</strong> die Tourismusleistungen in Anspruch nimmt)<br />
Das Tourismussubjekt ist <strong>der</strong> Mensch <strong>der</strong> erst touristische Leistungen nachfragt und diese<br />
später auch in Anspruch nimmt.<br />
• Tourismussubjekte haben vielfältige teilweise wi<strong>der</strong>sprüchliche Motive und<br />
Bedürfnisse,<br />
• Tourismussubjekte werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst<br />
• Tourismussubjekte lassen sich anhand von bestimmten Kriterien – wie z.B. <strong>der</strong><br />
Motivation o<strong>der</strong> äußeren Ursachen unterscheiden und klassifizieren<br />
• Tourismussubjekte und ihre Verhaltensweisen werden statistisch erfasst und bewertet<br />
Das Tourismussubjekt o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Tourist versucht seine Bedürfnisse nach spezifischen<br />
touristischen Leistungen zu befriedigen. Die Leistungen werden von den Tourismusobjekten<br />
angeboten (Kaspar 1995). Somit ist jedes Element im System Tourismus, welches die<br />
Bedürfnisbefriedigung des Tourismussubjektes ermöglicht, dem Subsystem Tourismusobjekt<br />
zuzuordnen.<br />
Tourismusobjekt = Angebot<br />
(Alles was in Natur, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft zum<br />
Ziel touristischer Ortsverän<strong>der</strong>ung werden kann (Kaspar 1995))<br />
Das sog. Tourismusobjekt umfasst die Institutionen des Tourismus. Diese Institutionen bilden<br />
den 3-Klang aus dem Tourismusort, Tourismusbetriebe bzw. –unternehmungen (touristische<br />
Leistungsträger) und den Tourismusorganisationen (öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche<br />
Organisationsstrukturen (vgl. Kaspar 1996).<br />
Tourismusort<br />
Tourismussubjekt<br />
System Tourismus<br />
Tourismusobjekt<br />
Im Tourismusort spielt sich <strong>der</strong> Großteil des touristischen Geschehens ab. Das Angebot eines<br />
Tourismusortes besteht meist aus dem sog. ursprünglichen und abgeleiteten touristischen<br />
Angebot.
Tourismusbetriebe- und unternehmungen<br />
Tourismusunternehmungen Wirtschaftseinheiten welche durch die Verbindung von<br />
Produktionsmitteln (Arbeit, Kapital und Boden) den Absatz, die Erzeugung und die<br />
Vorbereitung von (Dienst-) Leistungen, im Rahmen des Tourismus bezwecken<br />
wollen.<br />
Objektbezogene Tourismusunternehmen<br />
• Beherbergungsbetriebe<br />
• Kur- und Heilbä<strong>der</strong><br />
• sonstige (Sporteinrichtungen usw.)<br />
= auf den Tourismusort bezogene Tourismusunternehmen<br />
Subjektbezogene Tourismusunternehmen:<br />
• Reiseversicherungen<br />
• Reisefinanzierung (Reisekredite, Reisechecks)<br />
• Tourismuswerbebetriebe<br />
= auf den Reisenden / Tourist bezogene Tourismusunternehmen<br />
Beziehungsbildende Tourismusunternehmen:<br />
• Reiseveranstalter<br />
• Reisevermittler<br />
• Transportunternehmen<br />
• örtliche, regionale und staatliche Tourismusorganisationen<br />
= Tourismusunternehmen die eine Beziehung zwischen Tourismussubjekt und Tourismusobjekt<br />
herstellen<br />
Tourismusorganisationen<br />
Tourismusorganisationen koordinieren die Teilfunktionen von Tourismusunternehmungen<br />
und Tourismusorten (Kaspar 1996)<br />
• politische Organisationen (Gemeinde, Land, Bund)<br />
• privatrechtliche Tourismusorganisationen (Kur- und Verkehrsvereine, Regionalverbände<br />
usw.
Übergeordnete Systeme<br />
1. Politische Umwelt: Politik und Tourismus stehen in Wechselseitigen Beziehungen.<br />
Die Politik kann direkt Einfluss auf die touristische Entwicklung nehmen. Bedeutend<br />
sind vor allem die Wirtschaftspolitik, die Verkehrspolitik, die Sozialpolitik, die<br />
Raumordnungspolitik, die Kulturpolitik o<strong>der</strong> die Freizeitpolitik. Diese können direkt<br />
o<strong>der</strong> auch indirekt auf den Tourismus wirken. Der Tourismus ist in einem bestimmten<br />
Land im großen Maße abhängig von <strong>der</strong> jeweiligen Staats- und Regierungsform.<br />
Stabile Strukturen in <strong>der</strong> Politik wirken dabei meist auch positiv auf das System<br />
Tourismus, Instabilität kann sich vernichtend auf das Tourismussystem auswirken.<br />
Tourismuspolitik ist beson<strong>der</strong>st dann notwendig, wenn <strong>der</strong> Tourismus den Rang eines<br />
Wirtschaftssystems einnimmt. Direkt auf den Tourismus wirken z.B. die<br />
Verabschiedung von Tourismusgesetzen o<strong>der</strong> Abgaben wie z.B. Kurtaxen. Indirekt<br />
wirken Tätigkeiten die zwar ursprünglich keine primären Ziele im Tourismus haben<br />
aber sich dennoch auf ihn auswirken wie z.B. die Verkehrspolitik (z.B. Bau einer<br />
Autobahnanbindung).<br />
2. Ökonomische Umwelt: Wirtschaft und Tourismus sind recht eng miteinan<strong>der</strong><br />
verbunden. Die allgemeine Wirtschaftslage wie z.B. Aufschwung o<strong>der</strong> Rezession<br />
zeigen meist unmittelbar Einwirkung auf den Tourismus. Der Tourismus nimmt über<br />
fünf Funktionen Einfluss auf die Wirtschaft. Diese Funktionen sind die<br />
Produktionsfunktion, die Beschäftigungsfunktion, die Einkommensfunktion, die<br />
Ausgleichsfunktion und die Zahlungsbilanzfunktion. Bei <strong>der</strong> Beschäftigungsfunktion<br />
unterscheidet man außerdem zwischen dem direkten und dem indirekten<br />
Beschäftigungseffekt,, bei <strong>der</strong> Einkommensfunktion zwischen direktem und<br />
indirektem Einkommen (Multiplikatoreffekt) (Kaspar 1994). In wirtschaftlichen<br />
Krisenphasen und bei konjunkturellen Abschwung, geben die Menschen weniger Geld<br />
für Reisen aus, welche die größten Einkommenselastizität des Konsums ausweisen.<br />
3. Ökologische Umwelt: Eine intakte Umwelt ist von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung für den<br />
Tourismus. Luftverschmutzung o<strong>der</strong> z.B. die Abwassereinleitung ins Meer wie z.B. in<br />
<strong>der</strong> Türkei geschehen beeinflussen die Reiseentscheidung des Touristen. Die<br />
Verletzung des Systems Umwelt ist stets mit erheblichen Folgen verbunden. Die<br />
Tourismuswirtschaft und auch die Wissenschaft hat hierauf reagiert und es wurden<br />
Konzepte wie z.B. Sanfter Tourismus, Tourismus mit Einsicht o<strong>der</strong> nachhaltiger<br />
Tourismus erarbeitet. Problematisch bei <strong>der</strong> Durchsetzung dieser Konzepte ist jedoch<br />
stets die oftmals nicht vorhandene Preisbereitschaft bei den Touristen. Der Tourismus<br />
soll zwar nachhaltig für Natur und Bevölkerung des bereisten Landes sein, jedoch ist<br />
<strong>der</strong> Tourist kaum bereit hierfür tiefer in die Tasche zu greifen.<br />
4. Sozio-kulturelle Umwelt: Der Tourismus hat seinerseits Auswirkungen auf die<br />
soziale Umwelt. Eine Folge des Tourismus ist die Akkulturation. Dieses Phänomen<br />
umschreibt das sich in <strong>der</strong> Regel zwei verschiedene Kulturen (Kultur des Reisenden<br />
und des Bereisten) aneinan<strong>der</strong> angleichen sobald sie in Kontakt zueinan<strong>der</strong> treten.<br />
Beson<strong>der</strong>st in sog. Dritt-Welt-Län<strong>der</strong>n ist dies häufig zu beobachten. Krippendorf<br />
vertritt die Ansicht, dass die mo<strong>der</strong>nen Reisebedürfnisse entscheidend von Alltag und<br />
Gesellschaft und eher im geringeren Ausmaß von individuellen Antrieb geprägt ist (vgl.<br />
Krippendorf 1987). Entscheidende Faktoren sind hierbei Wertevorstellungen, Normen,<br />
Traditionen und Politik. Gesellschaftliche Einflüsse wie <strong>der</strong> Wandel von <strong>der</strong> Arbeits-<br />
zur Freizeitorientierung, lassen Freizeit nicht mehr als bloße Restgröße ersch<strong>einen</strong>.
Die Freizeit muss aktiv gestaltet werden und Urlaub und Reisen werden somit zu einer<br />
gesellschaftlichen Notwendigkeit.<br />
5. Technologische Umwelt: Die Technik hat die Welt und auch den Tourismus<br />
evolutionär verän<strong>der</strong>t. So hat z.B. die Verkehrstechnik die Personenbeför<strong>der</strong>ung<br />
immer schneller einfacher und komfortabler werden lassen. Die Beherbergungs- und<br />
Verpflegungstechnik hat viele <strong>der</strong> Standardarbeiten im Gastgewerbe vereinfacht.<br />
Durch mo<strong>der</strong>ne Informations- und Kommunikationstechnik wurde es z.B. möglich<br />
sich weit entfernte Reiseziele via Google Earth schon vor Reisebeginn anzusehen.<br />
Beson<strong>der</strong>st starke Auswirkungen auf den Tourismus hatten technologische<br />
Entwicklungen im Bereich <strong>der</strong> Luftfahrt und <strong>der</strong> Kommunikationstechnik (CRS /<br />
GDS). Technologische Entwicklungen haben enorm dazu beigetragen das sich <strong>der</strong><br />
Tourismus in seiner heutigen Form zu einem massenhaften Phänomen entwickeln<br />
konnte. Die neusten technischen Errungenschaften, lassen auch die kühnsten Träume<br />
wahr werden – Reisen in den Weltraum, sind nun auch für nicht Astronauten möglich<br />
geworden, die Zeit des Weltraumtourismus hat gerade begonnen.<br />
Exkurs: Leiper`s Tourism System<br />
Das Tourismusmodell von Leiper besteht aus drei Grundelementen welche das eigentliche<br />
Tourismus-System bilden:<br />
1. Der Tourist (er ist <strong>der</strong> eigentliche Akteur im System)<br />
2. Die Tourismusindustrie (Tourismusangebot = Unternehmungen und Organisationen)<br />
3. Geographische Elemente<br />
a. Traveller-generating region; (Touristen-erzeugende Regionen)<br />
b. Tourist destination region; (Touristen-erhaltende Regionen)<br />
c. Transit route region (Transit Routen)
1. Der Tourist<br />
Er ist <strong>der</strong> eigentliche Nachfrager und Konsument von touristischen Leistungen. Erst wenn bei<br />
ihm das Bedürfnis zu reisen besteht, kann die Tourismusindustrie für ihn tätig werden und<br />
ver<strong>suchen</strong> seine Bedürfnisse durch spezifische Angebote zu befriedigen.<br />
2. Die Tourismusindustrie<br />
In einem sehr weit gefassten Verständnis, können hierunter alle Unternehmungen und<br />
Organisationen subsumiert werden, die bei <strong>der</strong> Erstellung des Tourismusproduktes involviert<br />
sind.
3. Geographische Elemente<br />
a) Traveller-generation region<br />
Diese Region präsentiert den Tourismusmarkt im Herkunftsgebiet des Touristen. Hier treffen<br />
sich Angebot und Nachfrage von Leistungen Rund um das Thema Reisen. Die örtliche<br />
„Tourismusindustrie“ in Form von beziehungsbildenden Tourismusunternehmen<br />
(Reiseveranstalter / Reisevermittler) versucht mit ihrem Angebot die touristische Nachfrage<br />
zu befriedigen und neue Bedürfnisse zu wecken. Die eigentlichen Nachfrager bzw.<br />
zukünftigen Touristen, holen in dieser Region Informationen und Angebote zu ihrer geplanten<br />
Reise ein, tätigen ihre Buchung und beginnen von hier aus den Start in die „Schönsten<br />
Wochen des Jahres“. Für diese Region typisch ist also die Nachfrage, nicht das Angebot.<br />
Denn erst durch eine latent vorhandene Nachfrage wird im Regelfall ein touristisches<br />
Angebot geschaffen.<br />
b) Tourist destination region; (Touristen-erhaltende Regionen)<br />
Diese Zielgebiete / Destinationen, beinhalten Attraktionen, Merkmale und Angebote die<br />
Besucher zu einem zeitlich begrenzten Aufenthalt bewegen. Diese Region ist das eigentliche<br />
Angebotselement im System Tourismus. Faktoren des ursprünglichen und abgeleiteten<br />
touristischen Angebots führen dazu, dass überhaupt erst die Motivation aufkommt ein<br />
bestimmtes Zielgebiet o<strong>der</strong> eine Destination zu bereisen. Diese Region ist also verantwortlich<br />
für die Erzeugung von Nachfrage in <strong>der</strong> Traveller-generation region. Die Tourismusindustrie<br />
in dieser Region sollte daher über ausreichende Beherbergungs- und Verpflegungsbetriebe<br />
(am besten verschiedenster Qualitätsstufen), Servicestellen und Tourismusinformationen<br />
verfügen.<br />
c) Transit route region (Transit Routen)<br />
Die Transitrouten können als Schlüsselelement im System Tourismus bezeichnet werden,<br />
denn sie sorgen für eine optimale Verkehrsverbindung von Traveller-generation region zur<br />
Tourist destination region und zurück. Effektivität und Charakteristik dieser Routen<br />
bestimmen und formen die Größe und Richtung <strong>der</strong> Tourismusströme. Als Transitroute wird<br />
zwar primär die Verbindung zwischen Quell- und Zielgebiet beschrieben, aber zur ihr zählen<br />
auch Zwischenstopps und Orte die während dessen z.B. besucht werden können. Im<br />
eigentlichen Sinn stellen Transit Routen jedoch lediglich <strong>einen</strong> gewissen Raum dar, <strong>der</strong> vom<br />
Tourist überquert werden muss um an sein Zielgebiet / seine Destination zu gelangen.<br />
4. Umgebung des Tourismussystems<br />
Als Umgebung o<strong>der</strong> Umfel<strong>der</strong> des Tourismussystems nennt Leiper: menschliche, soziokulturelle,<br />
ökonomische, technologische, physische, politische, gesetzliche, usw. <strong>der</strong><br />
Tourismus wird von diesen externen Rahmenbedingungen beeinflusst, sowie auch sie von<br />
ihm beeinflusst werden können.
Von <strong>der</strong> Fremdenverkehrslehre zur Tourismuswissenschaft<br />
In dem folgenden Kapitel, soll es nicht darum gehen die gesamte Fremdenverkehrs- /<br />
Tourismusforschung wie<strong>der</strong>zugeben. Vielmehr wird <strong>der</strong> Versuch unternommen wichtige<br />
Ereignisse und Forschungsergebnisse wie<strong>der</strong>zugeben die zu einer Begründung <strong>der</strong><br />
Fremdenverkehrs- bzw. <strong>der</strong> heute in Konturen erkennbaren Tourismuswissenschaft<br />
beigetragen haben. Bei solch einem Unterfangen ist es notwendig die teilweise breit verstreute<br />
und oftmals schwierig zu findende Literatur <strong>der</strong> frühen Fremdenverkehrsforschung zu sichten<br />
– eine 100% exakte Wie<strong>der</strong>gabe <strong>der</strong> Fremdenverkehrswissenschaft ist deshalb nur begrenzt<br />
möglich. Allerdings wurde versucht, im Rahmen einer breiten Literaturanalyse die<br />
Disziplingeschichte <strong>der</strong> Fremdenverkehrswissenschaft bestmöglich zu ergründen.<br />
Die wissenschaftliche Beschäftigung und Erfassung des Phänomens Fremdenverkehr kann auf<br />
den Beginn des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts datiert werden. Bei diesen frühen<br />
fremdenverkehrswissenschaftlichen Arbeiten standen vor allem statistische und ökonomische<br />
Fragestellungen des Fremdenverkehrs im Vor<strong>der</strong>grund. Eines <strong>der</strong> ersten Werke mit<br />
wissenschaftlichem Anspruch, stammt von dem Österreicher Josef Stradner (1905). In<br />
Anlehnung an das System von Peshine Smith und Thünes Lehre unternahm Stradner den<br />
ersten geschlossenen Versuch eine Art „Volkswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs“ zu<br />
entwickeln. So untersuchte Stradner z.B. die Folgen des Fremdenverkehrs für die<br />
Zahlungsbilanz, Probleme <strong>der</strong> Fremdenverkehrsstatistik und er bemühte sich, den<br />
Fremdenverkehr begrifflich vom Reiseverkehr abzugrenzen. Sein Blick galt zudem <strong>der</strong><br />
Konsumfunktion und den damit verbundenen Geldströmen. Im Gegensatz zu vielen an<strong>der</strong>en<br />
„Ökonomen“ erkannte Stradner bereits die ökonomische Bedeutung des Fremdenverkehrs als<br />
Absatzmarkt. Erstaunlich ist, dass die Arbeit von Stradner immer wie<strong>der</strong> im Zusammenhang<br />
mit <strong>der</strong> Disziplingeschichte <strong>der</strong> Fremdenverkehrswissenschaft, aber zudem auch im<br />
Zusammenhang mit <strong>der</strong> Disziplingeschichte <strong>der</strong> Fremdenverkehrsgeographie erwähnt wird.<br />
Dies liegt wohl daran, dass in <strong>der</strong> Arbeit von Stradner, zum ersten Mal <strong>der</strong> Begriff<br />
„Fremdenverkehrsgeographie“ genannt wurde.<br />
Ein weiterer Nationalökonom, <strong>der</strong> ebenfalls die Notwendigkeit erkannte, sich mit den<br />
Erscheinungen des Fremdenverkehrs näher zu befassen, ist <strong>der</strong> Innbrucker Volkswirt, Prof.<br />
Hermann von Schullern zu Schrattenhofen (Aufsatz „Fremdenverkehr und Volkswirtschaft“<br />
1911). Schullern beginnt seine Untersuchung mit <strong>der</strong> richtigen Fragestellung, dass es (bis zu<br />
seinem Aufsatz) noch kaum <strong>einen</strong> ernsthaften Versuch gegeben habe, „zu einer<br />
volkswirtschaftlichen Beurteilung des Fremdenverkehrs auf Grundlage einer Überprüfung<br />
aller maßgebenden tatsächlichen Verhältnisse zu gelangen; am allerwenigsten hat man <strong>einen</strong><br />
solchen Versuch voraussetzungslos durchgeführt; es waren meist nur einzelne, recht<br />
sinnenfällig in die Augen springende Beobachtungen, die man für ausreichend hielt, um über<br />
<strong>einen</strong> Gegenstand von so großer Wichtigkeit und Tragweite eine vermeintlich<br />
allgemeingültige Sentenz zu füllen“ (Pöschel). Schullern zu Schattenhofen war in seiner Arbeit<br />
auf Begriffsklarheit und damit auch auf Begriffsbestimmungen angewiesen, die er sich selbst<br />
schaffen musste. Es lag somit <strong>der</strong> erste Versuch einer gesamthaften<br />
Fremdenverkehrsforschung vor, <strong>der</strong> weit über die Betrachtungsweisen <strong>der</strong> damaligen<br />
Geisteswelt hinausging (Bernecker 1984).<br />
In den zwanziger Jahren entstand, von Italien und <strong>der</strong> Schweiz ausgehend, auch in<br />
Deutschland die Wissenschaft vom Fremdenverkehr als eine <strong>der</strong> Betriebs- und<br />
Volkswirtschaft nahe stehende Disziplin, die sich die wissenschaftliche Erforschung des<br />
Fremdenverkehrs zur Aufgabe gemacht hat (Knebel 1960). In Italien entstand das erste<br />
zusammenfassende Werk über den Fremdenverkehr „Lezioni di Economia turistica“ im Jahr
1928. Verfasst wurde diese „Fremdenverkehrslehre“ von Mariotti dem damaligen<br />
Generaldirektor des Ente Nazionale per le Industrie Turistiche und Professor <strong>der</strong><br />
Fremdenverkehrswissenschaft an <strong>der</strong> Universität Rom (vgl. Bormann 1931). Zuvor (1925) war<br />
bereits ein regelmäßiger Lehrgang für Fremdenverkehrswirtschaft an <strong>der</strong> Universität Rom<br />
unter Leitung von Mariotti eingerichtet worden (vgl. Bernecker 1984). Während heute Freizeit und<br />
Tourismus fast untrennbar miteinan<strong>der</strong> verbunden sind, interessierte sich hingegen die frühe<br />
Fremdenverkehrsforschung fast überhaupt nicht für das soziale Phänomen „Freizeit in <strong>der</strong><br />
Industriegesellschaft“. Zu erwähnen ist hier dennoch Fritz Klatt, er interessierte sich<br />
vorwiegend für das Phänomen Freizeit aus Sicht <strong>der</strong> Pädagogik. Anlass für wissenschaftliche<br />
Reflexionen waren Probleme <strong>der</strong> „Freizeitgestaltung“ <strong>der</strong> berufstätigen Bevölkerung<br />
(Opaschowski 2006). Klatt erkannte die Notwendigkeit, die Theorie und Methodik einer zukünftigen<br />
Freizeitpädagogik zu finden bzw. zu erarbeiten. Da es allerdings we<strong>der</strong> Universitäten o<strong>der</strong><br />
sonstige Lehrstätten für <strong>einen</strong> <strong>der</strong>artigen Berufszweig gab, for<strong>der</strong>te Klatt (1929) die Gründung<br />
einer „Freizeithochschule“. Lei<strong>der</strong> konnte eine solche „Freizeithochschule“ nicht realisiert<br />
werden.<br />
Die eigentlichen Motivationen für den Fremdenverkehr blieben in <strong>der</strong> frühen<br />
Fremdenverkehrsforschung fast völlig unberücksichtig, sie wurden meist auf die reine<br />
Bedürfnisbefriedigung, welcher Art auch immer reduziert. Die Definitionskriterien<br />
beschränken sich auf den Personenverkehr, auf die daraus resultierenden notwendigen<br />
Institutionen und auf den Faktor des Konsums mit Mitteln, die nicht am Ort verdient wurden<br />
(Hömberg 1977). In fast allen <strong>der</strong> frühen Fremdenverkehrsdefinitionen wurde die beruflich<br />
motivierte Mobilität außerhalb <strong>der</strong> Freizeit vom Fremdenverkehr / Tourismus gänzlich<br />
ausgeschlossen. Auswirkungen des Fremdenverkehrs auf die Zahlungsbilanz, wurden in<br />
einigen monographischen Einzeldarstellungen, zu jener Zeit zudem vorwiegend behandelt.<br />
Im einflussreichen Handwörterbuch <strong>der</strong> Sozialwissenschaften erschien im Jahr 1927 <strong>der</strong><br />
Artikel „Fremdenverkehr“ von Wilhelm Morgenroth. In diesem Artikel entwickelte<br />
Morgenroth bereits wesentliche Elemente des Fremdenverkehrsbegriffs: den vorübergehenden<br />
Aufenthalt <strong>der</strong> Teilnehmer am Zielort, die Rolle <strong>der</strong> Verbraucher von Wirtschafts- und<br />
Kulturgütern und das Verkehrselement im Fremdenverkehr (vgl. Kulinat/Steinecke 1984). Als<br />
Charakteristikum für den Fremdenverkehr betonnte Morgenroth die Eigentümlichkeit <strong>der</strong><br />
nicht dauernden, son<strong>der</strong>n nur vorübergehenden, zeitweiligen Än<strong>der</strong>ung des Wohnsitzes o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>lassung (vgl. Morgenroth 1927). Morgenroth klassifizierte - bereits in diesen frühen<br />
Anfängen <strong>der</strong> wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Fremdenverkehr - Arten des<br />
Fremdenverkehrs. Führ ihn gibt es die Arten des Fern- und Nahverkehrs, des internationalen,<br />
des Auslän<strong>der</strong>fremdenverkehr, des Verkehrs innerhalb <strong>der</strong> Grenzen des eigenen Staats, <strong>der</strong><br />
gleichen Gegend, <strong>der</strong> Nachbarorte usw. (vgl. Sölter 2005).<br />
Im engsten Sinn ist Fremdenverkehr als <strong>der</strong> Verkehr <strong>der</strong> Personen zu begreifen, die sich<br />
vorübergehend von ihrem Dauerwohnsitz entfernen, um zur Befriedigung von Lebens- und<br />
Kulturbedürfnissen o<strong>der</strong> persönlichen Wünschen verschiedenster Art an<strong>der</strong>wärts, lediglich als<br />
Verbraucher von Wirtschafts- und Kulturgütern, zu verweilen (Morgenroth 1927).<br />
Erst nach Beendigung des Ersten Weltkrieges, wurde es möglich, dem Fremdenverkehr die<br />
erste wissenschaftliche Heimstätte in Deutschland zu schaffen. Dies war die „Hochschule für<br />
Hotel- und Verkehrswesen“ in Düsseldorf, die aber bereits ein Jahr später (1921) bedingt<br />
durch die Inflation wie<strong>der</strong> geschlossen werden musste. Schließlich wurde von 1929-1934 ein<br />
Forschungsinstitut für den Fremdenverkehr unterhalten, das als selbstständige Anstalt <strong>der</strong><br />
Berliner Handelhochschule angeglie<strong>der</strong>t wurde und dem Professor Robert Glücksmann<br />
vorstand. (Böttger 1958). Das Institut erblickte seine Aufgaben in erster Linie darin, die Ursachen,<br />
Mittel und Wirkungen des Fremdenverkehrs zu erforschen. Die Grundlage für die
wissenschaftliche Tätigkeit wurde gebildet durch die Schaffung einer Zentralbibliothek, eines<br />
Zentralarchivs und einer Monographiensammlung sowie durch systematische Aufstellung von<br />
Statistiken (vgl. Huscher / Klafkowski 1929). Zu Beginn hatte dieses Institut mit erheblichen<br />
Schwierigkeiten zu kämpfen, zum einem musste die Finanzierung sichergestellt werden und<br />
auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite musste <strong>der</strong> Institutsleiter um die Anerkennung <strong>der</strong><br />
Fremdenverkehrsforschung und –lehre als hochschulfähigen Gegenstand kämpfen. Diese<br />
Forschungseinrichtung hat allerdings für die verhältnismäßig kurze Zeit ihres Bestehens,<br />
bahnbrechend gewirkt und ein umfassendes Programm in die Tat umgesetzt, das sowohl die<br />
Sammlung wie die Forschung und die Lehre betraf (vgl. Hunziker 1942). Der Vorsteher des Instituts,<br />
Robert Glücksmann gab eine Zeitung – die Vierteljahrszeitschrift - „Archiv für den<br />
Fremdenverkehr“ heraus, die durchaus wissenschaftliche Reife trug. Die Forschung am<br />
Institut bestand aus zwei Zweigen:<br />
1. Einmal, um allgemeine Kenntnisse des Fremdenverkehrs, seiner <strong>Grundlagen</strong>,<br />
Zusammenhänge und Wirkungen zu gewinnen,<br />
2. zum an<strong>der</strong>en, von <strong>der</strong> Praxis gestellte Aufgaben zu lösen (Grünthal 1962)<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Fremdenverkehrsforschung wurden in die Vorlesungen integriert und vor<br />
allem durch die Veröffentlichung des „Archiv für den Fremdenverkehr“ auch <strong>der</strong><br />
Allgemeinheit vorgestellt. Die Erörterung grundsätzlicher Fragen des Phänomens<br />
Fremdenverkehr war allerdings von beson<strong>der</strong>er Bedeutung, da <strong>der</strong> Aufgabenkreis des<br />
Forschungsgegenstandes abgegrenzt werden musste (vgl. Grünthal 1962). Zur Grundlegung einer<br />
Wissenschaft vom Fremdenverkehr hätte allerdings die Ausarbeitung einer ihr eigenen<br />
Methodologie gehört, hierüber machten sich Glücksmann und seine Assistenten allerdings<br />
keine Gedanken. Der Fremdenverkehr wurde wie heute fast immer noch mit den Methoden<br />
verschiedener Wissenschaften bearbeitet, ohne das sich ein einheitliches System herausbildete<br />
(vgl. Grüntal 1962).<br />
Der Begriff „Fremdenverkehr“ hatte allerdings im Zusammenhang mit dem Wirken<br />
Glücksmanns eine inhaltliche Erweiterung erfahren und war jetzt Oberbegriff eines neuen<br />
sozialen Phänomens, dessen massenhafter Charakter Ende <strong>der</strong> 20er Jahre in ersten Anzeichen<br />
sichtbar wurde (vgl. DSF 1987). Vormals mit dem Gastgewerbe identifiziert und als Teilbereich<br />
<strong>der</strong> Verkehrswissenschaften behandelt, sollte er jetzt als ein komplexes sozio-ökonomisches<br />
Phänomen in den Mittelpunkt von Forschung und Lehre des neu gegründeten Instituts rücken<br />
(vgl. DSF 1987). Für Glücksmann allerdings, ist <strong>der</strong> Fremdenverkehr keine Wissenschaft, son<strong>der</strong>n<br />
ein komplexes soziales Phänomen, dessen „Ursachen, Mittel und Wirkungen“ mit<br />
wissenschaftlichen Methoden diverser Fachdisziplinen erforscht werden müssen. Folgende<br />
wichtige Impulse gab Glücksmann für die Fremdenverkehrsforschung / -wissenschaft:<br />
• Fremdenverkehr ist keine Wissenschaft – er muss mit wissenschaftlichen Methoden<br />
verschiedener Fachdisziplinen erforscht werden,<br />
• ein interdisziplinärer Ansatz, ist somit in <strong>der</strong> Fremdenverkehrsforschung nötig<br />
• Herausgabe des Archiv für den Fremdenverkehr – es stellt auch heute noch eine<br />
Fundgrube für jeden, <strong>der</strong> sich wissenschaftlich mit Fremdenverkehr beschäftigen will,<br />
dar<br />
• wichtige Lehrbücher: Privatwirtschaftslehre des Hotels, das Gaststättenwesen,<br />
Betriebslehre <strong>der</strong> Gaststätte, Fremdenverkehrskunde<br />
• Überwindung des anfänglichen Misstrauens, das man den akademischen<br />
Qualifikationen des Forschungsgegenstandes entgegenbrachte<br />
• Drei Doktor-Dissertationen konnten am Institut ermöglicht werden.
Der Mitarbeiter am Forschungsinstitut Willi Benscheid, äußerte sich wie folgt zum<br />
Fremdenverkehr und zur Fremdenverkehrswissenschaft:<br />
Der Fremdenverkehr ist sicher Wirtschaft, aber er ist es nicht nur, son<strong>der</strong>n deckt auch<br />
an<strong>der</strong>e, nicht wissenschaftliche Gebiete. Die Fremdenverkehrswissenschaft steht auf einer<br />
an<strong>der</strong>en wissenschaftlichen Warte als die Nationalökonomie; sie sieht von ihrem Stande<br />
wohl weite Teile <strong>der</strong> Nationalökonomie, soweit sie im Bereich des Fremdenverkehrs liegen,<br />
aber nicht alle. Nach <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite aber sieht sie weiter, wodurch sie in <strong>der</strong> Lage ist,<br />
Fragen zu behandeln, die <strong>der</strong> Nationalökonomie nicht zustehen (Bescheid 1932/1933). Eine<br />
Fremdenverkehrswissenschaft darf sich nicht auf die Abstraktion beschränken, da sie sonst<br />
nichts an<strong>der</strong>es sein würde als „blasse Theorie“ (Benscheid 1934)<br />
Schon damals haben die „Fremdenverkehrswissenschaftler“ erkannt, das die<br />
Fremdenverkehrslehre mehr als nur die Wirtschaftswissenschaft umfasst, allerdings wurde es<br />
üblich die Fremdenverkehrslehre als eine <strong>der</strong> Wirtschaftswissenschaft nahe stehende Disziplin<br />
anzuordnen. Denn die Wirtschaftswissenschaft, insbeson<strong>der</strong>e die Betriebswirtschaftslehre war<br />
im Stande, mannigfache Aufgaben für den Fremdenverkehr zu lösen. In <strong>der</strong> Anfangszeit<br />
dieser neuen Wissenschaft, bemühte man sich vorwiegend erst einmal darum den Begriff<br />
„Fremdenverkehr“ abzugrenzen und zu definieren. In einem <strong>der</strong> ersten Bücher zur<br />
Fremdenverkehrslehre – Arthur Boormann: Die Lehre vom Fremdenverkehr 1931 – wird<br />
Fremdenverkehr wie folgt definiert:<br />
„Inbegriff <strong>der</strong> Reisen, die zum Zwecke <strong>der</strong> Erholung, des Vergnügens, geschäftlicher o<strong>der</strong><br />
beruflicher Betätigung o<strong>der</strong> aus sonstigen Gründen, in vielen Fällen aus Anlass beson<strong>der</strong>er<br />
Veranstaltungen o<strong>der</strong> Ereignisse vorgenommen werden und bei denen die Abwesenheit vom<br />
ständigen Wohnort nur vorübergehend, im Berufsverkehr jedoch nicht bloß durch die<br />
regelmäßige Fahrt zur Arbeitsstätte bedingt ist (Bormann 1931).<br />
Boormann setzt Personenverkehr mit Fremdenverkehr gleich, die Gründe die allerdings zum<br />
Fremdenverkehr führen, sind für ihn irrelevant. Als bisherige Exponenten <strong>der</strong> allgem<strong>einen</strong><br />
Fremdenverkehrswissenschaft bezeichnet Boormann die Wissenschaftler Mariotti und<br />
Glücksmann, <strong>der</strong>en Auffassungen zum Inhalt des Begriffs „Fremdenverkehr“ jedoch<br />
grundsätzlich verschieden sind (vgl. Bernecker 1984). Wissenschaftsgebiete wie Geographie,<br />
Balneologie, Klimatologie, Medizin, Psychologie, Nationalökonomie, Soziologie o<strong>der</strong><br />
Betriebswirtschaftslehre haben nach Boorman ihre Bedeutung für den Fremdenverkehr und<br />
die Fremdenverkehrswissenschaft, bzw. umgekehrt <strong>der</strong> Fremdenverkehr für sie, aber sie<br />
haben nicht alle die gleiche Bedeutung. Im Beson<strong>der</strong>en allerdings, ist die<br />
Fremdenverkehrswissenschaft <strong>der</strong> Verkehrslehre zuzuordnen (vgl. Bernecker). Zwar ist mit dem<br />
Fremdenverkehr ein Verkehrsvorgang verbunden, ihn allerdings deswegen <strong>der</strong><br />
Verkehrswissenschaft zuzuschreiben ist nur bedingt nachvollziehbar. Zudem sei es nach<br />
Boorman zudem wenig zweckmäßig auch die Psychologie in dem von Glücksmann<br />
gegebenen Sinne im Rahmen <strong>der</strong> Fremdenverkehrswissenschaft, zu behandeln. Wenn als die<br />
Ursachen des Fremdenverkehrs Zwang und freier Wille bezeichnet werden, so kann<br />
demgegenüber eingewendet werden, dass ja schließlich alles, was <strong>der</strong> Mensch unternimmt,<br />
auf seinem freien Willen o<strong>der</strong> auf Zwang beruhe. Es handelt sich hierbei also nicht um<br />
Fragen von spezieller verkehrswissenschaftlicher Bedeutung (Boorman 1931).<br />
Lautet heute eine <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen qualitativer Tourismusforschung, die Urlaubswelt so<br />
lebensnah zu erforschen und zu beschreiben, dass man das Urlaubserleben sinnlich<br />
wahrnehmen, ja „buchstäblich sehen und hören kann“ (vgl. Glaser/Strauss 1979) so interessierten im<br />
Gegensatz in <strong>der</strong> damaligen Fremdenverkehrsforschung das Reiseverhalten, Reiseerleben<br />
o<strong>der</strong> Motivationen und Antriebe <strong>der</strong> Reisenden überhaupt nicht.
Zwar gab bereits Leopold von Wiese <strong>der</strong> Fremdenverkehrswissenschaft die Anregung, den<br />
Fremdenverkehr unter beziehungswissenschaftlichen Aspekten zu sehen und zu beschreiben<br />
(vgl. Knebel) doch dieser soziologische Vorstoß blieb eine <strong>der</strong> rühmlichen Ausnahmen. Die<br />
Arbeit wurde von den Forschern zwar zur Kenntnis genommen, aber anfangs nicht weiter<br />
ausgeführt. In den späteren fremdenverkehrswissenschaftlichen Arbeiten tauchten allerdings<br />
die eindeutig auf L. von Wiese und G. Simmel zurückgehenden Begriffe immer wie<strong>der</strong> auf<br />
(vgl. Gleichmann 1969). Der in vielen Fremdenverkehrdefinitionen benutzte Begriff „Beziehungen“<br />
geht auf den Aufsatz von Wiese über „Fremdenverkehr als zwischenmenschliche Beziehung“<br />
von 1930 zurück, gemeint sind allerdings allein die sozialen Beziehungen.<br />
Mitte <strong>der</strong> 1930er Jahre stellte sich in Mitteleuropa die Fremdenverkehrswissenschaft, wenn<br />
auch randständig und ungefestigt, als Fachdisziplin dar und es entstand das Genre <strong>der</strong><br />
Fremdenverkehrslehren. (vgl. Spode 1998). So kann an dieser Stelle z.B. <strong>der</strong> Aufbau <strong>der</strong><br />
Fremdenverkehrslehre von Boorman wie<strong>der</strong>gegeben werden:<br />
1. Begriff und Zusammensetzung des Fremdenverkehrs<br />
2. Bestimmungsfaktoren des Fremdenverkehrs<br />
3. Statistik des Fremdenverkehrs<br />
4. Einrichtungen des Fremdenverkehrs<br />
5. Allgemeine Fremdenverkehrspolitik<br />
Die Fremdenverkehrslehre von Boorman ist sehr auf die – wie man heute sagen würde – Sicht<br />
des Incoming Tourismus ausgerichtet.<br />
Wesentliche Impulse wurden in diesem Jahrzehnt auch für die sich allmählich entwickelnde<br />
Fremdenverkehrsgeographie gegeben. Von Bedeutung ist die Arbeit von Poser (1939) <strong>der</strong> in<br />
seiner Studie über das Riesengebirge sowohl die naturgeographischen <strong>Grundlagen</strong> des<br />
Fremdenverkehrs als auch den Umfang und die Arten des Fremdenverkehrs sowie schließlich<br />
die Gestaltung und Typisierung von Fremdenverkehrsorten / -räumen gleichermaßen<br />
berücksichtigt.<br />
1941 wurde an <strong>der</strong> Heidelberger Universität ein Institut (für Betriebswirtschaft des<br />
Fremdenverkehrs) gegründet, das als gemeinsame Einrichtung des Gewerbes und <strong>der</strong><br />
Universität gedacht war und Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis in Lehre und<br />
Forschung auf dem Spezialgebiet des Fremdenverkehrs näher bringen sollte (Bottger). Das<br />
Institut konnte allerdings nur wenig Profil entwickeln und ist 1948 untergegangen. Aus <strong>der</strong><br />
1949 gegründeten Arbeitsgruppe Fremdenverkehr, wurde an <strong>der</strong> Universität München 1951<br />
das „Deutsche Wirtschaftliche Institut für Fremdenverkehr“ gegründet. Das Institut entfernte<br />
sich allerdings recht bald von <strong>der</strong> universitären Basis und pflegte (bis heute) eine enge<br />
wirtschaftliche Praxisorientierung. Das DWIF tritt beson<strong>der</strong>s durch die veröffentlichten<br />
Betriebsvergleiche für Kurortunternehmungen und Hotelbetriebe hervor (vgl. Tietz 1980). Wichtige<br />
Daten die vom DWIF für die Tourismuswissenschaft und –praxis veröffentlicht werden sind<br />
z.B. dwif - Tagesreisen, dwif –Ausgabenstruktur, dwif – Wirtschaftsfaktor, dwif –<br />
Betriebsvergleiche und das Sparkassen – Tourismusbarometer.<br />
Nur ein Jahr später (1952) erfolgte an <strong>der</strong> Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt<br />
am Main die Gründung des „Instituts für Fremdenverkehr“. Lei<strong>der</strong> war auch diesem Institut<br />
kein sehr langes akademisches Leben beschieden (Bernecker 1984), auch die Gedanken von<br />
Glücksmann (einer interdisziplinären Fremdenverkehrslehre) wurden dort nicht wie<strong>der</strong>
aufgenommen, vielmehr war dort das primäre Ziel – die För<strong>der</strong>ung des Fremdenverkehrs (vgl.<br />
Sölter 2005).<br />
Von <strong>der</strong> deutschen Seite her wurde die Fremdenverkehrswissenschaft in <strong>der</strong> Kriegs- und<br />
Nachkriegszeit kaum vorangetrieben. Oftmals wird zwar behauptet das während <strong>der</strong><br />
Kriegszeit <strong>der</strong> Tourismus völlig zum erliegen kam, aber dies stimmt nur bedingt. Denn im<br />
gleichen Maß wie <strong>der</strong> Krieg Reisen unterbindet, initiiert er auch neue Reiseformen, wird zum<br />
Motor <strong>der</strong> Mobilität (vgl. Smith 1998). Wichtige Impulse zu jener Zeit, kamen aus Österreich und<br />
<strong>der</strong> Schweiz. In Österreich wurde im Februar 1934 das Institut für Fremdenverkehrsforschung<br />
gegründet. Anfänglich widmete sich dieses Institut primär <strong>der</strong> Lehre, so wurde z.B. 1940 <strong>der</strong><br />
„Reichhochschulkurs für Fremdenverkehr“ eingerichtet – dieser besteht heute immer noch an<br />
<strong>der</strong> WU Wien allerdings als Universitätslehrgang für Tourismuswirtschaft. In Österreich<br />
besteht somit heute das älteste Forschungsinstitut für Fremdenverkehr / Tourismus im<br />
deutschsprachigen Raum.<br />
Die Bibel <strong>der</strong> heutigen Tourismusforschung – die Allgemeine Fremdenverkehrslehre - wurde<br />
allerdings von den zwei Schweizer Professoren Walter Hunziker und Kurt Krapf verfasst.<br />
Dieses an ein breites Fachpublikum gerichtete Werk, wirkte paradigmatisch hinsichtlich<br />
Definition, Systematik und Justierung <strong>der</strong> Disziplin "Fremdenverkehr" (vgl. Spode 1998a) In St.<br />
Gallen wurde <strong>der</strong>zeit die Studien und Diplomrichtung Fremdenverkehr bzw. das "Seminar für<br />
Fremdenverkehr" an <strong>der</strong> Handelshochschule St. Gallen 1941 ins Leben gerufen, welches mit<br />
W. Hunziker als Seminarleiter besetzt wurde. Im gleichen Jahr, noch vor St. Gallen, wurde in<br />
Bern das "Forschungsinstitut für Fremdenverkehr" gegründet, dessen Leiter wurde K. Krapf<br />
(Sölter 2006). Im Mittelpunkt <strong>der</strong> Fremdenverkehrslehre von Hunziker und Krapf steht <strong>der</strong><br />
Mensch, somit kann die Fremdenverkehrslehre auch nicht den Wirtschaftswissenschaften<br />
zugerechnet werden, da sie Begriffs- und Erscheinungskomplexe umfasst, die<br />
außerwirtschaftlicher Natur sind. Ebenfalls ist die Fremdenverkehrslehre keine<br />
Beziehungslehre, aber immerhin steht sie <strong>der</strong> Soziologie näher als den<br />
Wirtschaftswissenschaften (vgl. Hunziker/Krapf 1942). In den Augen <strong>der</strong> beiden Professoren kann <strong>der</strong><br />
Fremdenverkehr z.B. ebenso gut Gegenstand <strong>der</strong> angewandten Volkswirtschaftslehre wie<br />
auch <strong>der</strong> angewandeten Soziologie sein. <strong>Sie</strong> haben sich aber trotzdem für die<br />
wirtschaftswissenschaftliche Erforschung <strong>der</strong> touristischen Phänomene entschieden, nicht<br />
zuletzt aus praktischen Erwägungen, da die Lösung wirtschaftlicher Probleme des damals<br />
darnie<strong>der</strong>liegenden Tourismus am dringlichsten erschien (vgl. Leugger 1966).<br />
Die Fremdenverkehrslehre wird als eigenständiges, aber aus „praktischen Erwägungen“ <strong>der</strong><br />
Wirtschaftswissenschaft zugeordnetes Gebiet bestimmt. Ihr „Hauptgewicht liegt auf <strong>der</strong><br />
Funktionenlehre“. <strong>Sie</strong> unterteilt sich in „<strong>Grundlagen</strong>“ (Fremdenverkehrsbegriff,<br />
Fremdenverkehrssubjekt und Fremdenverkehrsinstitutionen) und so genannte „Funktionen“<br />
(Gesundheit, Technik, Kultur, Soziale Frage, Politik und Ökonomie). Obschon es heißt: „Im<br />
Mittelpunkt steht <strong>der</strong> Mensch“, fehlen soziologische und psychologische Aspekte weitgehend,<br />
ebenso geographische (Spode 1998).<br />
Fremdenverkehrslehre als Wissenschaft<br />
Der Schweizer Walter Hunziker versuchte in seiner Publikation „System und Hauptprobleme<br />
einer wissenschaftlichen Fremdenverkehrslehre“ die Fremdenverkehrslehre als Wissenschaft<br />
zu begründen. Hunziker beginnt seine Ausführung mit <strong>der</strong> Definition des Erkenntnisobjektes.<br />
Der Fremdenverkehr wird mit <strong>der</strong> Definition - das Fremdenverkehr <strong>der</strong> Inbegriff <strong>der</strong><br />
Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus dem Aufenthalt Ortsfrem<strong>der</strong> ergeben, sofern
durch den Aufenthalt keine Nie<strong>der</strong>lassung zur Ausübung einer dauernden o<strong>der</strong> zeitweilig<br />
hauptsächlichen Erwerbstätigkeit begründet wird – als Erkenntnisobjekt definiert.<br />
Nach Hunziker wird eine Fremdenverkehrslehre offenbar wissenschaftlich am ehesten<br />
bestehen, wenn sie einem so strengen bzw. engen Maßstab gerecht wird, wie ihn vor allem<br />
Max Weber an den Begriff Wissenschaft legt (vgl. Hunziker 1943). Nach Ansicht von Weber<br />
bezweckt die Wissenschaft die denkende Ordnung <strong>der</strong> empirischen Wirklichkeit. Nicht die<br />
schlichten Zusammenhänge <strong>der</strong> Dinge, son<strong>der</strong>n die gedanklichen Zusammenhänge <strong>der</strong><br />
Probleme liegen den Arbeitsgebieten <strong>der</strong> Wissenschaft zugrunde: wo mit neuer Methode<br />
einem neuen Problem nachgegangen wird und dadurch Wahrheiten entdeckt werden, welche<br />
neue bedeutsame Gesichtspunkte eröffnen, da entsteht ein neue, Wissenschaft (Weber 1904). Der<br />
Fremdenverkehr wird von Hunziker als Kulturerscheinung begriffen, da Weber als<br />
Kulturwissenschaften solche Disziplinen bezeichnet, welche die Lebenserscheinungen in ihrer<br />
Kulturbedeutung zu erkennen streben, steht für Hunziker außer Frage, das die<br />
Fremdenverkehrslehre zweifelsohne unter die Kategorie <strong>der</strong> Kulturwissenschaften fällt.<br />
Abschließend ergibt sich somit, dass eine wissenschaftliche Fremdenverkehrslehre möglich<br />
ist; als solche hat sie die Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus dem Aufenthalt<br />
Ortsfrem<strong>der</strong> ergeben, sofern durch den Aufenthalt keine Nie<strong>der</strong>lassung zur Ausübung einer<br />
dauernden o<strong>der</strong> zeitweilig hauptsächlichen Erwerbstätigkeitbegründet wird, nach dem<br />
Maßstabe ihrer kulturellen Bedeutung zu unter<strong>suchen</strong> (Hunziker 1943).<br />
Der Fremdenverkehrslehre wird aber auch die Möglichkeit zugebilligt, sich mit Technik zu<br />
befassen. Aus praktisch pädagogischen Zwecken wird die Fremdenverkehrslehre nicht darum<br />
herumkommen, sich im betriebswirtschaftlichen Sektor mit Fragen <strong>der</strong> Technik zu befassen –<br />
obwohl man sich vor Augen halten muss, das damit die Warte <strong>der</strong> Wissenschaft verlassen -<br />
und das Gebiet <strong>der</strong> Kunstlehre betreten wird (vgl. Hunziker 1943). Wichtig für die akademische<br />
Ausbildung, war dass Hunziker ein Aufbauschema <strong>der</strong> Fremdenverkehrslehre entwickelte, das<br />
wie folgt geglie<strong>der</strong>t war:<br />
1. Allgemeine Fremdenverkehrslehre<br />
1.1 Institutionenlehre<br />
1.2 Funktionenlehre<br />
2. Beson<strong>der</strong>e Fremdenverkehrslehren<br />
2.1 Fremdenverkehrsgeschichte<br />
2.2 Fremdenverkehrsstatistik<br />
2.3 Beson<strong>der</strong>e Funktionen des Fremdenverkehrs, worunter vor allem<br />
2.3.1 Der Fremdenverkehr als wirtschaftliche Kategorie<br />
2.311 Die Fremdenverkehrswirtschaft<br />
2.312 Die Wirtschaft <strong>der</strong> Fremdenverkehrsbetriebe<br />
(Betriebswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs)<br />
2.32 Sonstige Funktionen des Fremdenverkehrs<br />
Dieses Aufbauschema <strong>der</strong> Fremdenverkehrslehre prägte über mehrere Jahre die akademische<br />
Fremdenverkehrsausbildung. Erst 1973 setzt sich beim Verfasser die Erkenntnis <strong>der</strong><br />
Notwendigkeit durch, Än<strong>der</strong>ungen im grundsätzlichen wie im einzelnen am erstellten<br />
Aufbauschema vorzunehmen (vgl. Hunziker 1973). So konnte z.B. die bisherige Trennung in<br />
allgemeine und beson<strong>der</strong>e Fremdenverkehrslehre nicht mehr aufrechterhalten werden, ebenso<br />
wenig haltbar war die spezielle Ausglie<strong>der</strong>ung einer Institutionenlehre. Von nun an, tritt die<br />
Funktionslehre an die Stelle <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Fremdenverkehrslehre. Ebenfalls sollen<br />
Wissenschaftsgebiete wie die Soziologie und das Recht, sowie die Benutzung von Methoden
<strong>der</strong> Ökonometrie in die Fremdenverkehrslehre integriert werden (Sölter 2005). Als neues<br />
Aufbauschema präsentierte Hunziker (1973):<br />
1. Der Fremdenverkehr in Lehre, Forschung und Ausbildung<br />
1.1 Die Fremdenverkehrslehre<br />
1.2 Die Fremdenverkehrsforschung<br />
1.3 Die Fremdenverkehrsausbildung<br />
2 Der Fremdenverkehr als Gegenstand außerökonomischer Disziplinen<br />
2.1 Die Fremdenverkehrsgeschichte<br />
2.2 Die Fremdenverkehrsgeographie<br />
2.3 Die Fremdenverkehrssoziologie<br />
2.4 Das Fremdenverkehrsrecht<br />
3 Wirtschaftliche Aspekte des Fremdenverkehrs<br />
3.1 Überblick<br />
3.2 Die Fremdenverkehrswirtschaft<br />
3.3 Die Wirtschaft <strong>der</strong> Fremdenverkehrsbetriebe<br />
3.4 Das Marketing als beson<strong>der</strong>es Wirtschaftsproblem<br />
Diesem Schema kann man eine größere Logik als dem vorigen Schema zusprechen. Bis auf<br />
Hunziker haben sich nur wenige Wissenschaftler um den Aufbau eines Schemas für die<br />
Fremdenverkehrslehre / -wissenschaft bemüht. Eine Ausnahme bildet hier Walter Thoms er<br />
versuchte schon vor Hunikers Revidierung des bisherigen Schemas, im Jahr 1952 die<br />
Wissenschaft des Fremdenverkehrs zu glie<strong>der</strong>n.<br />
Für Walter Thoms bestand für die Entwicklung <strong>der</strong> Wissenschaft vom Fremdenverkehr die<br />
Notwendigkeit, genau zu bestimmen, welcher Tatbestand mit dem Wort „Fremdenverkehr“<br />
umgrenzt werden soll. Für ihn ist <strong>der</strong> Fremdenverkehr ein soziologischer Tatbestand aus dem<br />
Wesen des Menschen (z.B. Reiselust) und aus dem Gemeinschaftsleben <strong>der</strong> Menschen und<br />
ihrer arbeitswilligen Lebensordnung (z.B. Reiszwang) (vgl. Thoms 1952). Zudem betont Thoms die<br />
unterschiedlichen Motivationen für die Reise und weist darauf hin, dass <strong>der</strong> Reisende am<br />
Zielort nicht nur Frem<strong>der</strong>, son<strong>der</strong>n willkommener „Gast“ ist. Diese Andeutung betont die<br />
Gastgeberfunktion <strong>der</strong> touristischen (Aufenthalts-) Betriebe und weist auf unterschiedliche<br />
Beziehungen zwischen Gast (Frem<strong>der</strong>) und Gastgeber hin, die er im weitesten Sinne als<br />
Gastlichkeit bezeichnet. Für Thoms ist Gastfreundschaft ein wesentlicher, unerlässlicher und<br />
notwendiger Bestandteil <strong>der</strong> Kultur – dies rechtfertigt nach seiner Ansicht den Begriff<br />
„Fremdenverkehr“ und „Gastverkehr“ synonym zu verwenden. Als wichtig für die<br />
wissenschaftliche Klarheit, erachtet er in Anlehnung an Benscheid (1951) die Zweiteilung in:<br />
• unterwegs: Der reisende Mensch ist auf dem Weg zu einem Reiseziel; dabei kann ihm<br />
das Reisen selbst schon ein permanentes Reiseziel bedeuten. Der Reisende ist Gast;<br />
man spricht ja auch vom Reisegast <strong>der</strong> Bahn Post, Schifffahrts-, Omnibus- und<br />
Fluggesellschaft.<br />
• am Reiseziel: Der Gast will hier nicht dauernd bleiben, son<strong>der</strong>n er will einmal zurück<br />
„nach Hause“ auch am Reiseziel will er nur <strong>einen</strong> vorübergehenden Aufenthalt<br />
nehmen.<br />
Bei dieser Zweiteilung stehen die Motive und Bedürfnisse des Gastes (erstmals?) im Blickfeld<br />
<strong>der</strong> Fremdenverkehrsforschung. Die gemeinsamen Gäste, ob sie unterwegs sind o<strong>der</strong> am<br />
Reiseziel, sind vom einem bestimmten Zusammengehörigkeitsgefühl beseelt, eine gemeinsame<br />
seelische und intellektuelle Übereinstimmung ist vorhanden.. (vgl. Thoms 1952). Diese Solidarität<br />
<strong>der</strong> Gäste, nennt Thoms als ein soziologisch und psychologisch wichtiges und interessantes
Phänomen. Im Vergleich zu an<strong>der</strong>en „Fremdenverkehrswissenschaftlern“ erkennt Thoms<br />
bereits die hohe kulturelle, soziologische, psychologische, wirtschaftliche und politische<br />
Bedeutung des Fremdenverkehrs. Indirekt deutet er auch die Notwendigkeit <strong>der</strong><br />
Interdisziplinarität <strong>der</strong> Fremdenverkehrsforschung an, wenn er schreibt: Grundlegen<strong>der</strong><br />
Irrtum würde eintreten, wollte man annehmen, dass die Betriebslehre o<strong>der</strong> gar die<br />
Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft allein mit dieser umfassenden Problematik fertig<br />
werden (Thoms 1952).<br />
Nach seiner Ansicht könnten alle Zweige <strong>der</strong> Grundwissenschaft den Fremdenverkehr zum<br />
Gegenstand von Forschung und Lehre machen, um zusammenfassend eine vollständige Lehre<br />
des Fremdenverkehrs zu gewinnen, diese könnte dann auch, als „logisch richtige“<br />
Bezeichnung Gastverkehrs- o<strong>der</strong> Gastlehre genannt werden.<br />
Weil wir in den Anfängen zu einer umfassenden Fremdenverkehrslehre stehen, sollen die<br />
Glie<strong>der</strong> hier nicht aus reiner Systematik, son<strong>der</strong>n vielmehr aus den konkreten Gegebenheiten,<br />
wie die Ansätze und Entwicklung sie bereits zweigen, entwickelt werden (Thoms 1952):<br />
1 Fremdenverkehrsgeographie<br />
2 Wirtschaftslehre des Fremdenverkehrs<br />
3 Rechtslehre des Fremdenverkehrs<br />
4 Fremdenverkehrssoziologie<br />
5 Fremdenverkehrspsychologie<br />
6 Geschichte des Fremdenverkehrs<br />
7 Technik des Fremdenverkehrs<br />
8 Werbelehre des Fremdenverkehrs<br />
9 Balneologie und Bä<strong>der</strong>wirtschaft<br />
10 Philosophie des Fremdenverkehrs<br />
(Abb. „Die Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wissenschaft des Fremdenverkehrs“ eigne Darstellung nach Thoms 1952)
In den 50er Jahren verschaffte sich beson<strong>der</strong>st <strong>der</strong> Österreicher Paul Bernecker, von dem<br />
bereits oben erwähnten Institut für Fremdenverkehrsforschung, mit s<strong>einen</strong> Publikationen<br />
gehör. In dem 1957 erschienen Lehrbuch „Die Stellung des Fremdenverkehrs im<br />
Leistungssystem <strong>der</strong> Wirtschaft“ nimmt Bernecker wie folgt zur<br />
Fremdenverkehrswissenschaft Stellung:<br />
Die Fremdenverkehrswissenschaft aber in ihrer Gesamtheit ist:<br />
1 eine Erfahrungswissenschaft<br />
2 eine Kulturwissenschaft, da sie zu jenen Wissenschaften gehört, die zum Gegenstand<br />
irgendwelche Bestandteile des menschlichen Kulturbereiches haben und die dann also den<br />
Gegensatz zu den Naturwissenschaften bildet,<br />
3 eine Gesellschaftswissenschaft, weil sie wie Wirtschaft, Recht, Staat, Politik, den<br />
Fremdenverkehr als gesellschaftliche Erscheinung betrachtet. Dabei sind nicht nur die<br />
„Beziehungen und Verhältnisse“ zwischen den Subjekten des Fremdenverkehrs zu<br />
unter<strong>suchen</strong>, son<strong>der</strong>n auch jene, die sich zwischen den Subjekten und Objekten (Natur<br />
und Kultur) ergeben (Bernecker 1957)<br />
Die <strong>Tourismuslehre</strong> als Wissenschaft – Tourismuswissenschaft<br />
Bevor wir uns mit dem eigentlichen Thema „Tourismuswissenschaft“ befassen, ist es erst<br />
einmal notwenig zu klären was eigentlich Wissenschaft bedeutet. Als Ausgangspunkt und<br />
erste Annährung an den Begriff „Wissenschaft“ soll die Definition aus dem Nachschlagewerk<br />
Brockhaus dienen. Der Brockhaus definiert Wissenschaft als „Inbegriff dessen, was<br />
überlieferter Bestand des Wissens einer Zeit ist, sowie v.a. <strong>der</strong> Prozess methodisch<br />
betriebener Forschung und Lehre als Darstellung <strong>der</strong> Ergebnisse und Methoden <strong>der</strong> Forschung<br />
[…]“. (Brockhaus o. J). Der erste Teil <strong>der</strong> Definition, sagt also, dass mit Wissenschaft die Summe<br />
des Wissens vergangener Zeit bzw. „<strong>der</strong> Stand des Wissens“ gemeint ist. Die Summe des<br />
Wissens <strong>der</strong> Fremdenverkehrs- bzw. Tourismusforschung <strong>der</strong> vergangen Zeit wurde im<br />
vorigen Kapitel kurz zusammengefasst. Im zweiten Teil <strong>der</strong> Definition wird ausgesagt, woher<br />
dieses Wissen gesammelt wurde bzw. wie es entstanden ist (durch Forschung). Durch<br />
methodisch betriebene Forschung erfolgt <strong>der</strong> Erwerb von Wissen, die gewonnen Ergebnisse<br />
<strong>der</strong> Forschung spiegeln den aktuellen Stand des Wissens wie<strong>der</strong>. In <strong>der</strong> Lehre werden die<br />
Ergebnisse und die Methoden <strong>der</strong> Forschung dem Studierenden vorgestellt.<br />
Eine an<strong>der</strong>e Definition von Wissenschaft stammt von Richard Feymann, nach ihm kann<br />
Wissenschaft eine Methode des Forschens, die Anwendung von Wissen o<strong>der</strong> eine<br />
Kombination <strong>der</strong> selben darstellen. Wissenschaft wird also betrieben um Erkenntnisse zu<br />
gewinnen, Tourismusforschung wird auch betrieben um Erkenntnisse – meist jedoch um<br />
direkt anwendbare Handlungsempfehlungen für die Praxis– zu gewinnen.