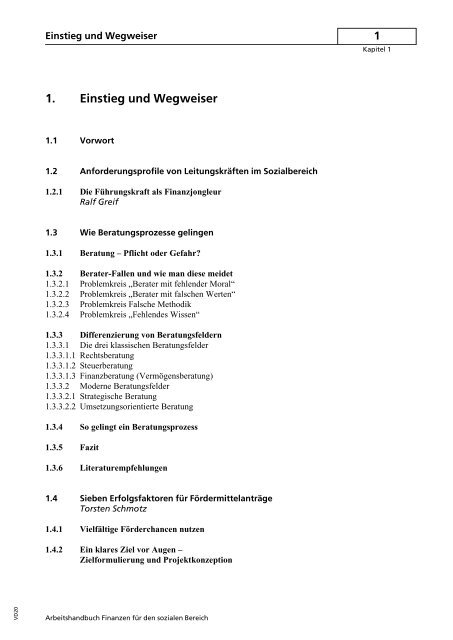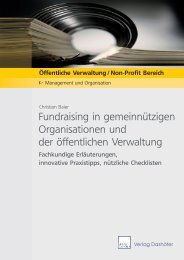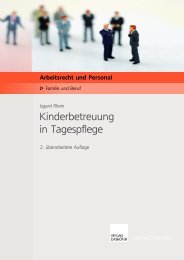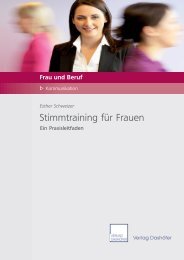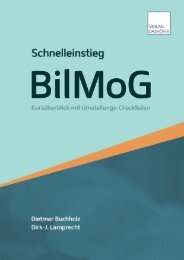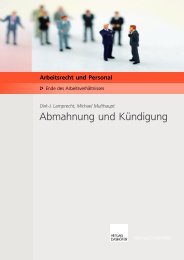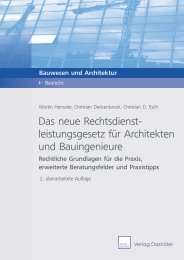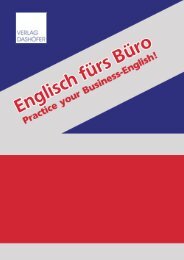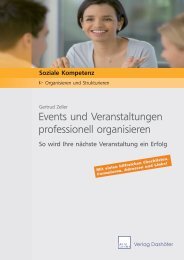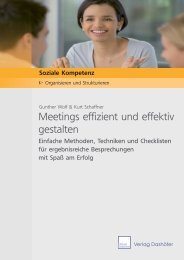1. Einstieg und Wegweiser
1. Einstieg und Wegweiser
1. Einstieg und Wegweiser
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
<strong>1.</strong> <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
<strong>1.</strong>1 Vorwort<br />
<strong>1.</strong>2 Anforderungsprofile von Leitungskräften im Sozialbereich<br />
<strong>1.</strong>2.1 Die Führungskraft als Finanzjongleur<br />
Ralf Greif<br />
<strong>1.</strong>3 Wie Beratungsprozesse gelingen<br />
<strong>1.</strong>3.1 Beratung – Pflicht oder Gefahr?<br />
<strong>1.</strong>3.2 Berater-Fallen <strong>und</strong> wie man diese meidet<br />
<strong>1.</strong>3.2.1 Problemkreis „Berater mit fehlender Moral“<br />
<strong>1.</strong>3.2.2 Problemkreis „Berater mit falschen Werten“<br />
<strong>1.</strong>3.2.3 Problemkreis Falsche Methodik<br />
<strong>1.</strong>3.2.4 Problemkreis „Fehlendes Wissen“<br />
<strong>1.</strong>3.3 Differenzierung von Beratungsfeldern<br />
<strong>1.</strong>3.3.1 Die drei klassischen Beratungsfelder<br />
<strong>1.</strong>3.3.<strong>1.</strong>1 Rechtsberatung<br />
<strong>1.</strong>3.3.<strong>1.</strong>2 Steuerberatung<br />
<strong>1.</strong>3.3.<strong>1.</strong>3 Finanzberatung (Vermögensberatung)<br />
<strong>1.</strong>3.3.2 Moderne Beratungsfelder<br />
<strong>1.</strong>3.3.2.1 Strategische Beratung<br />
<strong>1.</strong>3.3.2.2 Umsetzungsorientierte Beratung<br />
<strong>1.</strong>3.4 So gelingt ein Beratungsprozess<br />
<strong>1.</strong>3.5 Fazit<br />
<strong>1.</strong>3.6 Literaturempfehlungen<br />
<strong>1.</strong>4 Sieben Erfolgsfaktoren für Fçrdermittelanträge<br />
Torsten Schmotz<br />
<strong>1.</strong>4.1 Vielfältige Förderchancen nutzen<br />
<strong>1.</strong>4.2 Ein klares Ziel vor Augen –<br />
Zielformulierung <strong>und</strong> Projektkonzeption<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 1
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 1<br />
<strong>1.</strong>4.3 Nicht im Trüben fischen –<br />
Effektive Suchstrategien<br />
<strong>1.</strong>4.4 Das erste Nadelöhr – Formale Vorgaben<br />
<strong>1.</strong>4.5 Selbstdarstellung erwünscht –<br />
Strukturierte <strong>und</strong> verständliche Antragsformulierung<br />
<strong>1.</strong>4.6 Über Geld spricht man –<br />
Der transparente Budgetplan<br />
<strong>1.</strong>4.7 Zum Schluss nicht ins stolpern kommen –<br />
Sichere Abgabe des Antrags<br />
<strong>1.</strong>4.8 Den nächsten Antrag im Blick –<br />
Professioneller Umgang mit Zu- <strong>und</strong> Absagen<br />
<strong>1.</strong>5 Fçrdermçglichkeiten für internationale<br />
Kooperationsprojekte<br />
Torsten Schmotz<br />
<strong>1.</strong>5.1 Internationalisierung als strategische Herausforderung für<br />
Unternehmen der Sozialwirtschaft<br />
<strong>1.</strong>5.2 Förderung der internationalen Zusammenarbeit als Ziel von<br />
Förderorganisationen<br />
<strong>1.</strong>5.3 Ausgangspunkt für die Suche nach dem passenden<br />
Förderprogramm: Organisationsformen für internationale<br />
Aktivitäten<br />
<strong>1.</strong>5.4 Die Förderlandschaft für internationales Aktivitäten<br />
<strong>1.</strong>5.4.1 Förderschwerpunkte der Europäischen Union<br />
<strong>1.</strong>5.4.2 Förderprogramme von öffentlichen <strong>und</strong> privaten Stiftungen<br />
<strong>1.</strong>5.4.3 Förderung durch öffentliche Stellen <strong>und</strong> die binationalen Jugendwerke<br />
<strong>1.</strong>5.4.4 Auslandsförderung der Aktion Mensch<br />
<strong>1.</strong>5.5 Schlussbetrachtung
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
<strong>1.</strong>6 Fçrdermittelrecherche im Internet<br />
Torsten Schmotz<br />
<strong>1.</strong>6.1 Das Internet eröffnet neue Möglichkeiten bei der<br />
Fördermittelrecherche<br />
<strong>1.</strong>6.2 Klar definierte Suchkriterien als Schlüssel einer effizienten Suche<br />
<strong>1.</strong>6.3 Förderdatenbanken der öffentlichen Hand<br />
<strong>1.</strong>6.3.1 Förderdatenbank des B<strong>und</strong>es<br />
<strong>1.</strong>6.3.2 Förderdatenbanken der Länder<br />
<strong>1.</strong>6.4 Stiftungsverzeichnisse<br />
<strong>1.</strong>6.4.1 Stiftungsverzeichnisse der B<strong>und</strong>esländer in Deutschland:<br />
<strong>1.</strong>6.4.2 Nationale Stiftungsverzeichnisse<br />
<strong>1.</strong>6.4.3 Thematische Stiftungsverzeichnisse<br />
<strong>1.</strong>6.5 Kommerzielle Fördermitteldatenbanken<br />
<strong>1.</strong>6.6 Förderinformationen über die Programme der<br />
Europäischen Union<br />
<strong>1.</strong>6.6.1 Die zentralen Internetseiten der Kommission<br />
<strong>1.</strong>6.6.2 Die Internetseiten der dezentral koordinierten Aktionsprogramme<br />
<strong>1.</strong>6.6.3 Informationsquellen über die Strukturfonds auf B<strong>und</strong>esebene<br />
<strong>1.</strong>6.6.4 Internetseiten über die Strukturfonds auf Landesebene<br />
<strong>1.</strong>6.7 Förderinformationen über Lotteriemittel<br />
<strong>1.</strong>6.7.1 Föderale Verteilung der Lotto- <strong>und</strong> Toto-Mittel<br />
<strong>1.</strong>6.7.2 Internetseiten der Soziallotterien<br />
<strong>1.</strong>6.8 Grenzen der Online Recherche<br />
<strong>1.</strong>6.9 Onlinesuche in der Praxis<br />
<strong>1.</strong>7 Chancen- <strong>und</strong> Risikomanagement – am Beispiel des<br />
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes<br />
Claus Helmert / Steffi Bachmann<br />
<strong>1.</strong>7.1 Einleitung<br />
<strong>1.</strong>7.<strong>1.</strong>1 Aufgaben des Paritätischen Gesamtverbandes<br />
<strong>1.</strong>7.<strong>1.</strong>2 Bedeutung des Chancen- <strong>und</strong> Risikomanagements<br />
<strong>1.</strong>7.<strong>1.</strong>3 Die Rolle eines Kennzahlensystems im Rahmen des Risikomanagements<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 1
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 1<br />
<strong>1.</strong>7.2 Implementierung eines Steuerungs- <strong>und</strong> Kennzahlensystems<br />
<strong>1.</strong>7.2.1 Interner Diskussions- <strong>und</strong> Entscheidungsprozess<br />
<strong>1.</strong>7.2.2 Kennzahlensystem<br />
<strong>1.</strong>7.2.3 Auswertung der Kennzahlen<br />
<strong>1.</strong>7.2.4 Leitfaden zum Chancen- <strong>und</strong> Risikomanagement<br />
<strong>1.</strong>7.3 Ausblick / Fazit<br />
<strong>1.</strong>8 Die Herausgeber<br />
<strong>1.</strong>9 Die Autorinnen <strong>und</strong> Autoren<br />
<strong>1.</strong>9.1 Neue Autoren <strong>und</strong> Autorinnen 2011<br />
<strong>1.</strong>10 Stichwortverzeichnis<br />
<strong>1.</strong>11 Abkürzungsverzeichnis
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
2. Aktuelles <strong>und</strong> Trends<br />
2.1 Aktuelle Praxisbeispiele<br />
2.<strong>1.</strong>1 Stressfreie Planung für 2011 –<br />
Tipps <strong>und</strong> Tricks für eine realistische Jahresplanung<br />
Kerstin Ratzeburg<br />
2.<strong>1.</strong>2 Eine höchst lebendige Medienszene:<br />
Verbandsmagazine <strong>und</strong> Mitgliederzeitschriften – Ein wichtiges<br />
Instrument zur Mitgliederbindung <strong>und</strong> Spendenakquise<br />
Ulrike Bauer<br />
2.2 Trends aus dem In- <strong>und</strong> Ausland<br />
2.2.2 Co-Branding Kreditkarten als Instrument der Mitgliederbindung<br />
<strong>und</strong> des F<strong>und</strong>raising<br />
Georg Schürmann<br />
2.2.2 Venture Philanthropy <strong>und</strong> Soziales Venture Capital<br />
Xaver Diermayr / Erwin Stahl<br />
2.2.3 „Social-Dating“ (SoDa) Eine neue <strong>und</strong> flexible Methode für<br />
Kooperationen <strong>und</strong> Engagementpartnerschaften zwischen<br />
Unternehmen <strong>und</strong> Organisationen<br />
Hugo W. Pettendrup<br />
2.2.4 Der Europäische Zahlungsverkehr – die unmögliche Umstellung<br />
auf SEPA<br />
Bernd Bauer<br />
2.2.5 Der Ruf nach dem neutralen Kontrolleur<br />
Ehrenfried Conta Gromberg<br />
2.2.6 Transparenz im Dritten Sektor:<br />
Aktuelle Trends <strong>und</strong> bestehende Notwendigkeiten<br />
Friedrich Haunert / Almuth Wenta<br />
2.2.7 Vier Monate nach „The Giving Pledge“ – Die große Welle der<br />
Philanthropie in den USA <strong>und</strong> ihre Ausläufer in Deutschland<br />
B<strong>und</strong>esverband Deutscher Stiftungen<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 2
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 2<br />
2.3 Nachhaltigkeit<br />
Gçtz Feeser<br />
2.3.1 Nachhaltigkeit <strong>und</strong> Geld: Geht das zusammen?<br />
2.4 Aktuelle Rechtsentwicklung<br />
2.4.1 Aktuelle Entscheidungen <strong>und</strong> Urteile<br />
Isabella Lçw / Isgard Rhein<br />
2.4.2 Arbeitsrecht<br />
Isgard Rhein<br />
2.4.3 Sozialrecht (zurzeit nicht besetzt)<br />
2.4.4 Haftungsrecht (zurzeit nicht besetzt)<br />
2.4.5 Umsatzsteuer auf Postdienstleistungen<br />
Kai Fischer<br />
2.4.6 Vergaberecht (zurzeit nicht besetzt)<br />
2.4.7 Bilanzrecht (zurzeit nicht besetzt)<br />
2.4.8 Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements<br />
Ulla Engler<br />
2.4.9 Eine Einschätzung des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes<br />
Dr. Rudolf Martens<br />
2.5 Aktuelle Entwicklungen an den Finanz- <strong>und</strong> Kapitalmärkten<br />
Markus Schçn<br />
2.5.1 Die Verschuldungsproblematik <strong>und</strong> ihre Auswirkungen auf<br />
tägliche Anlageentscheidungen<br />
2.6 Daten <strong>und</strong> Statistiken<br />
PARIT¾TISCHER Gesamtverband<br />
2.6.1 Vom Kostenfaktor zum Wachstumsfaktor: Volkswirtschaftliche<br />
Wirkungen eines bedarfsdeckenden Existenzminimums<br />
Dr. Rudolf Martens
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
2.6.2 Demographische Alterung <strong>und</strong> ihre Folgen: Deutsche Probleme,<br />
europäische Modelle <strong>und</strong> Bewältigungschancen<br />
Juliane Roloff<br />
2.6.3 Armut <strong>und</strong> Regionen in Deutschland: Extreme Unterschiede im<br />
Raum <strong>und</strong> extreme Unterschiede bei den Haushaltsformen<br />
Dr. Rudolf Martens<br />
2.7 News aus dem Paritätischen<br />
Ulrike Bauer<br />
2.7.1 Unzureichende Finanzierung bedroht Arbeit der Frauenhäuser<br />
2.8 Die Kolumne: Neues aus der Nonprofit-Welt<br />
Martin Beck<br />
2.L Literatur<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 2
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 2
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
3. Gr<strong>und</strong>lagen des Marketing für den<br />
sozialen Bereich<br />
3.1 Marketing für den sozialen Bereich<br />
Dieter Schçffmann, Thomas Rçhr<br />
3.<strong>1.</strong>1 Einführung<br />
Dieter Schçffmann<br />
3.<strong>1.</strong>2 Was ist Marketing?<br />
Dieter Schçffmann<br />
3.<strong>1.</strong>3 Der Wert der K<strong>und</strong>en<br />
Thomas Rçhr<br />
3.<strong>1.</strong>4 Von der Analyse zum Erfolg<br />
Dieter Schçffmann<br />
3.<strong>1.</strong>5 Wesentliche Schritte für ein erfolgreiches Marketing<br />
Dieter Schçffmann<br />
3.2 Positionierung <strong>und</strong> Profilierung von NPO’s durch<br />
Kommunikation<br />
Karin Siegm<strong>und</strong><br />
3.2.1 Einführung<br />
3.2.2 Empfehlungen<br />
3.3 Markenrelevanz <strong>und</strong> -führung im Nonprofit-Sektor<br />
Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider, Jana Heinze<br />
3.3.1 Relevanz von Marken im Nonprofit-Sektor<br />
3.3.2 Identitätsorientierte Führung von Marken<br />
3.3.3 Fazit <strong>und</strong> Ausblick<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 3
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 3<br />
3.4 Zielgruppen im Marketing<br />
3.4.1 Stakeholder-Analyse im Nonprofit-Marketing<br />
Karin Siegm<strong>und</strong><br />
3.5 Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
Eva Hepper<br />
3.5.1 Einführung<br />
3.5.2 Wie die Medien ticken – „Nichts ist älter als die Zeitung von<br />
gestern“<br />
3.5.3 Die Medien erreichen<br />
3.5.4 Der souveräne Auftritt in den Medien<br />
3.5.5 Literatur<br />
3.P Praxisbeispiele<br />
3.P.1 Aufbau des Marketings für eine soziale Organisation<br />
Ehrenfried Conta Gromberg<br />
3.P.<strong>1.</strong>1 Was leistet Marketing?<br />
3.P.<strong>1.</strong>2 Die Neuschöpfung im Marketing<br />
3.P.<strong>1.</strong>3 Checkliste – Wie fit sind Sie im Marketing?<br />
3.P.<strong>1.</strong>4 Literatur<br />
3.P.2 Markenaufbau für Nonprofit-Organisationen am Beispiel der<br />
Johanniter<br />
Claudia Jabir<br />
3.P.3 Strategischer Positionierungsprozess <strong>und</strong> Markenprofilierung am<br />
Beispiel der Welthungerhilfe<br />
Christina Plaßmann<br />
3.L Literatur
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
4. Erwirtschaftung von Eigenmitteln<br />
4.1 Einführung<br />
Søren Link<br />
4.<strong>1.</strong>1 Auswahl eines geeigneten Geschäftsfeldes<br />
4.<strong>1.</strong>2 Abwägen der Chancen <strong>und</strong> Risiken<br />
4.<strong>1.</strong>3 Entscheidungsprozess<br />
4.<strong>1.</strong>4 Organisation <strong>und</strong> Leitung<br />
4.2 Der Businessplan<br />
Søren Link<br />
4.2.1 Was gehört in Ihren Businessplan?<br />
4.2.2 Zahlen-Daten-Fakten<br />
4.3 Juristische Konstruktion <strong>und</strong> Steuerung von<br />
Geschäftsbetrieben<br />
Andreas Knoth<br />
4.3.1 Eingegliederter Geschäftsbetrieb<br />
4.3.2 Ausgelagerter Geschäftsbetrieb<br />
4.3.3 Argumente pro <strong>und</strong> contra Auslagerung<br />
4.3.4 Verb<strong>und</strong>lösungen<br />
4.4 Strategisches Management der Eigenmittelerwirtschaftung<br />
in der Praxis<br />
Anke Steinbach<br />
4.4.1 Spektrum der Eigenmittelerwirtschaftung<br />
4.4.2 Typische Herausforderungen in der Praxis <strong>und</strong> aktuelle Trends<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 4
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 4<br />
4.4.3 Strategisches Management der Eigenmittelerwirtschaftung:<br />
Praxisbeispiele<br />
4.P Praxisbeispiele<br />
4.P.1 Bürger- <strong>und</strong> Kulturzentrum Rohrmeisterei<br />
Andreas Knoth<br />
4.L Literatur
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
5. Klassische <strong>und</strong> neue Wege der<br />
Finanzierung über Banken<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 5
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 5
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
6. F<strong>und</strong>raising <strong>und</strong> Spendenwerbung<br />
6.1 Einführung ins F<strong>und</strong>raising<br />
6.<strong>1.</strong>1 Begriffsbestimmung <strong>und</strong> Geschichte<br />
Dr. Friedrich Haunert<br />
6.<strong>1.</strong>2 F<strong>und</strong>raising-Quellen<br />
6.<strong>1.</strong>3 Zahlen <strong>und</strong> Trends<br />
6.<strong>1.</strong>4 Ansatzpunkte, Zielgruppen, Vorgehen<br />
6.<strong>1.</strong>5 Rahmenbedingungen aus dem Gemeinnützigkeitsrecht<br />
Bettina C. Praetorius, Andreas Schramm<br />
6.2 Basiswissen Database-F<strong>und</strong>raising<br />
Helga Schneider<br />
6.2.1 Einführung: Database-F<strong>und</strong>raising ist eine Strategie<br />
6.2.2 Die Dimensionen der Database<br />
6.2.3 Daten<br />
6.2.4 Datenschutz<br />
6.2.5 F<strong>und</strong>raisingsoftware<br />
6.2.6 Fazit<br />
6.3 Kommunikationsinstrumente im Einzelnen <strong>und</strong> der<br />
Kommunikations-Mix / Integrierte Kommunikation<br />
Detlef Luthe<br />
6.3.1 F<strong>und</strong>raising ist Kommunikation<br />
6.3.2 Instrumente der Kommunikation<br />
6.3.3 Kommunikationsmittel<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 6
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 6<br />
6.3.4 Entwicklung des optimalen Kommunikations-Mix<br />
6.3.5 Integrierte Kommunikation als Erfolgsfaktor<br />
6.4 Relationship F<strong>und</strong>raising: Spenderbindung durch<br />
Beziehungsaufbau<br />
6.4.1 Zielgruppenanalyse als Gr<strong>und</strong>lage für erfolgreiches Relationship<br />
F<strong>und</strong>raising<br />
Doris Felbinger / Clara West<br />
6.4.2 Beziehungsmanagement anhand von Spenderprofilen<br />
6.5 Sehr geehrte Frau Mustermann! Das Mailing – eine<br />
Einführung<br />
Petra Klüners<br />
6.5.1 Auch die Großen haben einmal klein angefangen …<br />
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Direkt-Mailing<br />
6.5.2 Regeln, die Spenden bringen<br />
6.5.3 Vetrauen ist gut … Das Controlling<br />
6.5.4 Kampagnen <strong>und</strong> ihre Bedeutung für den Versand von<br />
Spendenmailings<br />
Susanne von Gersdorff, Stephanie Neumann<br />
6.6 Online-F<strong>und</strong>raising<br />
6.6.1 Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Kai Fischer<br />
6.6.2 Erfolgsfaktoren für das Online-F<strong>und</strong>raising<br />
Kai Fischer<br />
6.6.3 Bausteine der Online-Werbung<br />
Frauke Klemm, Dr. Aurelia Berke
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
6.7 Großspenden- <strong>und</strong> Erbschafts-F<strong>und</strong>raising<br />
6.7.1 Gewinnung von Großspendern<br />
Dr. Marita Haibach<br />
6.7.2 Erbschaftsf<strong>und</strong>raising<br />
Bettina C. Praetorius<br />
6.8 Das Telefon als Spenderakquise oder Spenderbindung<br />
Johannes Bausch<br />
6.8.1 Bedeutung des Telefons für das F<strong>und</strong>raising<br />
6.8.2 Erscheinungsformen beim Telefonmarketing (Exkurs)<br />
6.8.3 Beziehungspflege oder Spendermotivation<br />
6.9 Die Sozialaktie als F<strong>und</strong>raising-Instrument – eine gute<br />
Mischung aus Offline- <strong>und</strong> Onlinespenden<br />
Reinhard Greulich<br />
6.10 Geldauflagenmarketing – So schaffen Sie den <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong><br />
sichern sich langfristige Einnahmen<br />
Mathias Krçselberg<br />
6.10.1 Zahlen, Daten, Fakten bzw. wo das Geld herkommt<br />
6.11 Peer to Peer F<strong>und</strong>raising<br />
6.1<strong>1.</strong>1 zzt. nicht besetzt<br />
6.1<strong>1.</strong>2 Erfolgreicher Einsatz von prominenten Testimonials im<br />
F<strong>und</strong>raising<br />
Emilia Foremna-Kohlsdorf, Bettina Hohn<br />
6.1<strong>1.</strong>3 Spender als F<strong>und</strong>raiser<br />
Jan Uekermann<br />
6.1<strong>1.</strong>4 Anlass-Spende<br />
Walter Jungbauer<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 6
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 6<br />
6.12 F<strong>und</strong>raising <strong>und</strong> Organisation<br />
6.12.1 Institutional Readiness – Voraussetzungen für das F<strong>und</strong>raising in<br />
Nonprofit-Organisationen<br />
Kai Kulschewski<br />
6.12.2 F<strong>und</strong>raising regionaler Organisationen – Langfristig Beziehungen<br />
schaffen <strong>und</strong> gemeinsam vor Ort die Welt verändern<br />
Kai Fischer, Annette Krause<br />
6.12.3 Die Macht des Dankens im Spendenwesen<br />
Joachim Dettmann<br />
6.P Praxisbeispiele<br />
6.P.1 Minuten <strong>und</strong> Moneten – Beispiel zweier F<strong>und</strong>raisingaktionen für<br />
eine Kirchengemeinde<br />
Friedrich Brandi-Hinnrichs<br />
6.P.2 Sammeln von Restdevisen<br />
Uwe Seils<br />
6.P.3 72 St<strong>und</strong>en – ohne Kompromiss Die Sozialaktion des BDKJ im<br />
Südwesten Deutschlands<br />
Marc Boos, Oliver Schopp<br />
6.P.4 „Der Stellenwert der Zeitspende wird weiter wachsen.“<br />
Was macht ein gelungenes F<strong>und</strong>raising-Konzept aus? Frau<br />
Fischbach, die Geschäftsführerin von Hamburg Leuchtfeuer im<br />
Interview<br />
Petra Fischbach<br />
6.I zzt. nicht besetzt<br />
6.L Literatur
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
7. Unternehmenskooperationen<br />
7.1 Corporate Social Responsibility – Herausforderung nicht nur<br />
für Unternehmen<br />
Dr. Heiner Widdig<br />
7.<strong>1.</strong>1 Einführung<br />
7.<strong>1.</strong>2 CSR Engagement von Unternehmen<br />
7.<strong>1.</strong>3 CSR <strong>und</strong> Kommunikation<br />
7.<strong>1.</strong>4 CSR als Bewertungskriterium<br />
7.<strong>1.</strong>5 CSR <strong>und</strong> soziale Organisationen<br />
7.2 Ein Gewinn für alle – Mçglichkeiten <strong>und</strong> Schritte zu einer<br />
erfolgreichen Unternehmenskooperation<br />
Veronika Steinrücke<br />
7.3 Die Ansprache von Unternehmen in der Praxis oder „Der<br />
Wurm muss dem Fisch schmecken …“<br />
Helene Reuther<br />
7.3.1 Motive <strong>und</strong> Ziele von Unternehmen<br />
7.3.2 Die gezielte Suche nach Firmenpartnern<br />
7.3.3 Der Kontaktaufbau zu Unternehmen<br />
7.3.4 Der Verhandlungsprozess<br />
7.3.5 Fazit<br />
7.3.6 Checklisten zur Ansprache von Unternehmen<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 7
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 7<br />
7.4 Unternehmensengagement mit Kompetenz <strong>und</strong> Personal –<br />
Chancen für neue Partnerschaften<br />
Dieter Schçffmann<br />
7.4.1 Wenn F<strong>und</strong>raiser/innen an Unternehmen denken …<br />
7.4.2 Corporate Volunteering ist angesagt<br />
7.4.3 Corporate Volunteering macht für Gemeinwohlorganisationen<br />
Sinn<br />
7.4.4 Unternehmenspartner finden<br />
7.P Praxisbeispiele<br />
7.P.1 Pro-Bono-Kampagnen: Wissen, was man will<br />
Hildegard Denninger<br />
7.P.2 Unternehmenskooperationen am Beispiel von UNICEF<br />
Joachim Tomesch<br />
7.P.3 Das Engagement der Generali Deutschland Holding AG im<br />
Bereich Ehrenamt<br />
Loring Sittler
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
8. Stiftungen<br />
8.0 Die Anschriften der Stiftungsaufsichtsbehçrden<br />
8.0.1 Staatliche Aufsicht<br />
8.0.2 Kirchliche Aufsicht<br />
8.1 Einführung: Stiftungen<br />
Prof. Dr. Bettina Hohn<br />
8.2 Was fçrdern Stiftungen im Sozialen?<br />
Matthias Wilkes<br />
8.2.1 Einführung<br />
8.2.2 Hoher Anteil an Sozialstiftungen in Deutschland<br />
8.2.3 Unternehmer werden Stifter<br />
8.2.4 Stiftungen als Partner<br />
8.2.5 Sozialstiftungen als Impulsgeber<br />
8.3 Stiftungen als Partner gewinnen – Zehn Schritte<br />
Dr. Diethelm Damm<br />
8.3.1 Einführung<br />
8.3.2 Der Umgang mit Stiftungen<br />
8.4 Bürgerstiftungen als Partner sozialer Organisationen<br />
Bernadette Hellmann<br />
8.4.1 Einführung: Was ist eine Bürgerstiftung?<br />
8.4.2 Bürgerstiftungen als Partner sozialer Organisationen: Spielregeln<br />
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit<br />
8.4.3 Arten der Kooperation<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 8
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 8<br />
8.4.4 Fazit<br />
8.4.5 Praxisbeispiele<br />
8.5 Die Verb<strong>und</strong>stiftung: ein Instrument zur Mittelbeschaffung<br />
Dr. Christoph Mecking<br />
8.5.1 Tatsächliche <strong>und</strong> rechtliche Rahmenbedingungen<br />
8.5.2 Rechtliche <strong>und</strong> steuerliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
8.5.3 Gründung einer Verb<strong>und</strong>stiftung durch die soziale Einrichtung<br />
8.5.4 Fazit<br />
8.6 Die Gründung eines Stifterkreises<br />
Thomas Schiffelmann<br />
8.6.1 Definition <strong>und</strong> Ansatz eines Stifterkreises<br />
8.6.2 Zielgruppe eines Stifterkreises<br />
8.6.3 Angebote eines Stifterkreises<br />
8.6.4 Aufbau eines Stifterkreises<br />
8.6.5 Praxisbeispiel: Stifterkreis Christophorus Hospiz München<br />
8.P Praxisbeispiele<br />
8.P.1 Sucht- <strong>und</strong> Gewaltprävention an Gr<strong>und</strong>schulen – Das<br />
erfolgreiche Stiftungsf<strong>und</strong>raising des Evangelischen<br />
Johannesstifts Berlin<br />
Andrea Spennes-leutges<br />
8.P.2 Die Gründung der Caritas-Gemeinschafts Stiftung im Erzbistum<br />
Berlin<br />
Peter Wagener<br />
8.P.3 Die Stiftung Nächstenliebe – Erfolgsfaktoren einer<br />
Stiftungsgründung<br />
Joachim Dettmann
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
8.P.4 Etikette im Umgang mit Förderstiftungen<br />
Christiane Eichner<br />
8.L Literatur<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 8
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 8
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
9. Öffentliche Fçrdermittel von B<strong>und</strong>,<br />
Ländern <strong>und</strong> Kommunen<br />
9.1 Gr<strong>und</strong>lagen çffentlicher Fçrdermittel<br />
Christian Baier<br />
9.<strong>1.</strong>1 Gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
9.<strong>1.</strong>2 Voraussetzungen<br />
9.<strong>1.</strong>3 Antragsfristen – Beispiel B<strong>und</strong>eshaushalt<br />
9.<strong>1.</strong>4 Förderarten<br />
9.<strong>1.</strong>5 Finanzierungsarten<br />
9.<strong>1.</strong>6 Zuständigkeiten<br />
9.<strong>1.</strong>7 Verfahren<br />
9.<strong>1.</strong>8 Antragsgestaltung<br />
9.<strong>1.</strong>9 Begleitende Netzwerkarbeit<br />
9.2 Fçrderung auf B<strong>und</strong>esebene<br />
Christian Baier / Robert Kircher-Reineke<br />
9.2.1 B<strong>und</strong>esministerium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend<br />
(BMFSFJ)<br />
9.2.2 B<strong>und</strong>esministerium für Arbeit <strong>und</strong> Soziales (BMAS)<br />
9.2.3 B<strong>und</strong>esministerium des Innern (BMI)<br />
9.2.4 B<strong>und</strong>esministerium für Bildung <strong>und</strong> Forschung (BMBF)<br />
9.2.5 B<strong>und</strong>esministerium für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung<br />
(BMVBS)<br />
9.2.6 B<strong>und</strong>esministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit <strong>und</strong><br />
Entwicklung (BMZ)<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 9
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 9<br />
9.3 Fçrderung der Länder<br />
Christian Baier / Robert Kircher-Reineke<br />
9.3.1 Baden-Württemberg<br />
9.3.2 Sachsen<br />
9.3.3 Bayern<br />
9.3.4 Hessen<br />
9.3.5 Schleswig-Holstein<br />
9.3.6 Bremen<br />
9.3.7 Thüringen<br />
9.3.8 Nordrhein-Westfalen<br />
9.3.9 Freie <strong>und</strong> Hansestadt Hamburg<br />
9.3.10 Brandenburg<br />
9.3.11 Sachsen-Anhalt<br />
9.3.12 Niedersachsen<br />
9.3.13 Berlin<br />
9.3.14 Mecklenburg-Vorpommern<br />
9.3.15 Rheinland-Pfalz<br />
9.3.16 Saarland<br />
9.L Literatur
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
10. EU-Fçrderung<br />
10.1 Die Europäische Union im Überblick<br />
Susanne Bauer, Tilo Liewald<br />
10.<strong>1.</strong>1 Entwicklung der europäischen Integration<br />
10.<strong>1.</strong>2 Die Organe der Europäischen Union<br />
10.<strong>1.</strong>3 Ziele <strong>und</strong> Aufgaben der Europäischen Union<br />
10.<strong>1.</strong>4 Der Zusammenhang von EU-Förderung <strong>und</strong> EU-Politik<br />
10.<strong>1.</strong>5 Wie entsteht ein EU-Förderprogramm?<br />
10.<strong>1.</strong>6 Einführung in die neue Förderperiode 2007 bis 2013 der<br />
Europäischen Union<br />
Holger Seifert<br />
10.2 Die wichtigsten EU-Fçrderinstrumente für den sozialen<br />
Sektor<br />
Tilo Liewald<br />
10.2.1 Europäischer Sozialfonds (ESF)<br />
10.2.2 Programm „Lebenslanges Lernen“<br />
10.2.3 Programm „Jugend in Aktion“<br />
10.2.4 Programm „PROGRESS“<br />
10.2.5 Die EU als globaler Partner (DCI, IPA, ENPI)<br />
10.2.6 Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der Ges<strong>und</strong>heit<br />
2008–2013<br />
10.2.7 Programm DAPHNE III<br />
10.2.8 Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011<br />
(Vorankündigung)<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 10
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 10<br />
10.3 Gr<strong>und</strong>züge der EU-Fçrderung<br />
Helle Becker, Susanne Bauer, Dietrich Rometsch, Tilo Liewald<br />
10.3.1 Verfahren zur Umsetzung der EU-Förderung<br />
10.3.2 Förderkriterien bei der Vergabe von EU-Mitteln<br />
10.4 Projektplanung bei der EU-Fçrderung<br />
10.4.1 Projektphasen<br />
10.4.2 Antragsvorbereitung<br />
10.4.3 Antragstellung – Allgemeine Hinweise<br />
10.5 Beihilfen <strong>und</strong> Fçrderungen der Europäischen Union: Häufig<br />
gestellte Fragen<br />
Dr. Helle Becker<br />
10.L Literatur
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
1<strong>1.</strong> Controlling <strong>und</strong> Finanzmanagement<br />
Christian Koch, Siegfried Rutz, Dietmar Wolbrecht<br />
1<strong>1.</strong>1 Einführung in das Controlling: Ziele bestimmen,<br />
Abweichungen analysieren, Handeln optimieren<br />
Christian Koch<br />
1<strong>1.</strong><strong>1.</strong>1 Das Überleben sichern mit Controlling<br />
1<strong>1.</strong><strong>1.</strong>2 Gr<strong>und</strong>verständis<br />
1<strong>1.</strong><strong>1.</strong>3 Informationsverdichtung <strong>und</strong> Regelkreis als Basismodelle<br />
1<strong>1.</strong><strong>1.</strong>4 Strategisches <strong>und</strong> operatives Controlling<br />
1<strong>1.</strong><strong>1.</strong>5 Einbettung in die Unternehmensführung<br />
1<strong>1.</strong><strong>1.</strong>6 Controlling für soziale Organisationen<br />
1<strong>1.</strong>2 Strategisches Controlling<br />
Christian Koch<br />
1<strong>1.</strong>2.1 Langfristige Existenzsicherung durch strategisches Controlling<br />
1<strong>1.</strong>2.2 Substanzerhaltung <strong>und</strong> angemessene Kapitalausstattung<br />
1<strong>1.</strong>3 Das Rechnungswesen verstehen <strong>und</strong> nutzen<br />
Christian Koch<br />
1<strong>1.</strong>3.1 Finanzbuchhaltung, Bilanz & GuV<br />
1<strong>1.</strong>3.2 Kostenrechnung<br />
1<strong>1.</strong>3.3 Anforderungen an die Rechnungslegung gemeinnütziger<br />
Organisationen<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 11
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 11<br />
1<strong>1.</strong>4 Operatives Controlling<br />
Christian Koch<br />
1<strong>1.</strong>4.1 Vom Budget zum operativen Controlling – Den Mitteleinsatz<br />
optimieren<br />
1<strong>1.</strong>4.2 Wichtige Instrumente des operativen Controllings<br />
1<strong>1.</strong>4.3 Kosten- <strong>und</strong> Erlösmanagement – Optimierung des laufenden<br />
Betriebes<br />
1<strong>1.</strong>5 Besonderheiten sozialer Organisationen<br />
Christian Koch<br />
1<strong>1.</strong>5.1 Risiken der Quersubventionierung<br />
1<strong>1.</strong>6 Investitionen <strong>und</strong> Finanzplanung<br />
Christian Koch<br />
1<strong>1.</strong>6.1 Mehrjährige Finanzplanung<br />
1<strong>1.</strong>7 Zeitnahe Mittelverwendung <strong>und</strong> die Rücklagenbildung<br />
Siegfried Rutz<br />
1<strong>1.</strong>7.1 Einführung<br />
1<strong>1.</strong>7.2 Der Begriff der „Mittel“<br />
1<strong>1.</strong>7.3 Anlagevermögen <strong>und</strong> Mittelverwendung<br />
1<strong>1.</strong>7.4 Anlagevermögen <strong>und</strong> zeitnahe Mittelverwendung<br />
1<strong>1.</strong>7.5 Nutzungsgeb<strong>und</strong>enes Anlagevermögen<br />
1<strong>1.</strong>7.6 Nutzungsgeb<strong>und</strong>enes Kapital als Gewinnrücklage<br />
1<strong>1.</strong>7.7 Gewinnvortrag<br />
1<strong>1.</strong>7.8 Keine Rücklagen im Sinne der Abgabenordnung<br />
1<strong>1.</strong>7.9 Die rechtsgeschichtliche Entwicklung der freien Rücklage nach<br />
§ 58 Nr. 7.a) AO
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
1<strong>1.</strong>7.10 Die freie Rücklage in der Praxis<br />
1<strong>1.</strong>7.11 Die Nützlichkeit der freien Rücklage<br />
1<strong>1.</strong>7.12 Rücklagen nach § 58 Nr. 6 AO<br />
1<strong>1.</strong>7.13 Sanktionen bei Verstoß gegen das Gebot der zeitnahen<br />
Mittelverwendung<br />
1<strong>1.</strong>7.14 Literaturverzeichnis<br />
1<strong>1.</strong>7.15 Mittelverwendungsrechnung<br />
1<strong>1.</strong>8 Betriebsprüfungen <strong>und</strong> Finanzamt<br />
Dietmar Wolbrecht<br />
1<strong>1.</strong>8.1 Betriebsprüfung aktuell<br />
1<strong>1.</strong>8.2 Aktuelles zur Umsatzsteuer <strong>und</strong> Umsatzsteuersonderprüfung<br />
1<strong>1.</strong>8.3 Die Lohnsteueraußenprüfung<br />
1<strong>1.</strong>9 Zur Angemessenheit von Geschäftsführer-Vergütungen<br />
Tal Pery / Siegfried Rutz<br />
1<strong>1.</strong>9.1 Einleitung<br />
1<strong>1.</strong>9.2 Anforderungen aus dem Selbstlosigkeitsgebot des Steuerrechts<br />
1<strong>1.</strong>9.3 Anforderungen aus dem Treuepflichtgebot des Strafrechts<br />
1<strong>1.</strong>9.4 Rechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen das<br />
Selbstlosigkeitsgebot <strong>und</strong> das Treuepflichtgebot<br />
1<strong>1.</strong>9.5 Positionsbestimmungen zur Angemessenheit von<br />
Geschäftsführer-Vergütungen<br />
1<strong>1.</strong>9.6 Aspekte <strong>und</strong> Kriterien zur Beurteilung der Angemessenheit von<br />
Geschäftsführer-Vergütungen<br />
1<strong>1.</strong>9.7 Zusammenfassung <strong>und</strong> Ausblick<br />
1<strong>1.</strong>L Literatur<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 11
1 <strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong><br />
Kapitel 11
VD20<br />
<strong>Einstieg</strong> <strong>und</strong> <strong>Wegweiser</strong> 1<br />
12. Lotteriemittel<br />
12.1 Einnahmen aus Lotterien – Eine Einführung<br />
Joachim Hagelskamp<br />
12.<strong>1.</strong>1 Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Definition<br />
12.<strong>1.</strong>2 Überblick über die großen Soziallotterien <strong>und</strong> ihre Förderung<br />
Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich<br />
Kapitel 12