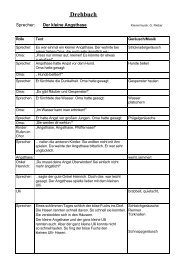Virtuelle Gewalt: Modell oder Spiegel ... - Mediaculture online
Virtuelle Gewalt: Modell oder Spiegel ... - Mediaculture online
Virtuelle Gewalt: Modell oder Spiegel ... - Mediaculture online
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Autoren: Fritz, Jürgen / Fehr, Wolfgang.<br />
Titel: <strong>Virtuelle</strong> <strong>Gewalt</strong>: <strong>Modell</strong> <strong>oder</strong> <strong>Spiegel</strong>? Computerspiele aus Sicht der<br />
Medienwirkungsforschung.<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Quelle: Computerspiele. <strong>Virtuelle</strong> Spiel- und Lernwelten. Bonn 2003. S. 49-60.<br />
Verlag: Bundeszentrale für politische Bildung.<br />
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlags.<br />
Jürgen Fritz und Wolfgang Fehr<br />
<strong>Virtuelle</strong> <strong>Gewalt</strong>: <strong>Modell</strong> <strong>oder</strong> <strong>Spiegel</strong>?<br />
Zusammenfassung<br />
Computerspiele aus Sicht der<br />
Medienwirkungsforschung<br />
Nach medial vermittelter <strong>Gewalt</strong> zu fragen, heißt auch, nach realer <strong>Gewalt</strong> zu fragen und<br />
dem Verhältnis der beiden zueinander. Der Artikel nimmt sich dieses Zusammenhanges<br />
an und stellt heraus, dass gilt, was bereits in der Diskussion über Fernsehgewalt erkannt<br />
worden war: Monokausale Erklärungen funktionieren nicht. Auch konnte bislang nicht<br />
festgestellt werden, dass virtuelle <strong>Gewalt</strong> ihre Welt verlassen hätte, denn mediale <strong>Gewalt</strong><br />
ist nicht das <strong>Modell</strong> für die gesellschaftliche, eher ihr <strong>Spiegel</strong>.<br />
Beschäftigung mit Computerspielen hat ihren Grund oft in Langeweile, die der Spieler<br />
durch angenehm empfundene Anregung und Erregung zu ersetzen trachtet. <strong>Virtuelle</strong><br />
<strong>Gewalt</strong> verschafft dabei die Möglichkeit, ein Erregungsniveau aufrechtzuerhalten. Das ist<br />
nicht etwa problematisch, weil dadurch reale <strong>Gewalt</strong> auslöst werden könnte, wohl aber,<br />
weil die Entwicklung von Empathie gebremst wird und die angemessene<br />
Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher <strong>Gewalt</strong> behindert wird.<br />
Die Autoren diskutieren die Erkenntnisse und praktischen Möglichkeiten der<br />
Wirkungsforschung, wägen die Möglichkeiten einer moralischen Beurteilung ab und<br />
gehen schließlich auf Belange und Möglichkeiten des Jugendmedienschutzes ein. Der<br />
1
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Blick auf künftige Entwicklungen und Chancen staatlicher und politischer Einflussnahme<br />
schließen ihren Gedankengang ab.<br />
1 Von der realen zur virtuellen <strong>Gewalt</strong><br />
Schauen wir uns zunächst ein Spiel an, bei dem es um das zu gehen scheint, was wir<br />
virtuelle <strong>Gewalt</strong> nennen. Bei Virtual Fighter 2 stehen die Spieler vor der Aufgabe, Gegner<br />
mit asiatischen Kampftechniken zu besiegen. Dazu wählt der Spieler eine aus acht<br />
verschiedenen Spielfiguren. Mit diesem elektronischen Stellvertreter kann er nun Fußtritte<br />
und Faustschläge austeilen, die den Karate- und Kung-Fu-Elementen entsprechen. Ziel<br />
des Spiels ist es, alle Gegner zu besiegen, um der Beste zu werden.<br />
Ist diese sportliche Aktivität, die sich in der virtuellen Welt abspielt, gewaltvolles Handeln?<br />
Bereits beim Begriff „<strong>Gewalt</strong>“ setzen die Probleme an:<br />
Im Prinzip kann jeder unter <strong>Gewalt</strong> verstehen, was er will: Der eine nur offensichtliche<br />
Phänomene wie Töten und Schlagen, der andere verbale Phänomene wie Beleidigen, der dritte<br />
subtile Phänomene wie Missachtung und Manipulation, der vierte schließlich gesellschaftliche<br />
Phänomene wie ungleiche Bildungschancen. Die Konsequenz: man redet und denkt aneinander<br />
vorbei, da der Begriff <strong>Gewalt</strong> so vielfältige Phänomene bezeichnen kann, dass ohne weitere<br />
Konkretisierung eine gemeinsame Ausgangslage nicht zu erreichen ist. 1<br />
Der Begriff „<strong>Gewalt</strong>“ ist im Sprachgebrauch negativ besetzt. In unserer Gesellschaft gilt<br />
es, <strong>Gewalt</strong> zu vermeiden. Es gibt jedoch Situationen, in denen <strong>Gewalt</strong> gesellschaftlich<br />
akzeptiert wird, z. B. die ausgeübte Polizeigewalt gegen <strong>Gewalt</strong>verbrecher. Die<br />
gesellschaftliche Bewertung von <strong>Gewalt</strong> unterliegt kulturellen Veränderungen. So belegt<br />
Rathmayr anhand zahlreicher Beispiele, wie stark die gesellschaftliche Einschätzung der<br />
<strong>Gewalt</strong> von der jeweiligen Zeit und der gesellschaftlichen Struktur abhängig ist. 2 Folgt man<br />
Zivilisationstheoretikern wie Elias und Foucault, dann veränderte sich mit dem Beginn der<br />
Neuzeit die gesellschaftliche Organisation der <strong>Gewalt</strong>ausübung grundlegend. „Es<br />
entstand jene Grundform der Psychisierung gesellschaftlicher <strong>Gewalt</strong>organisation, der die<br />
m<strong>oder</strong>nen Medien ihren Erfolg verdanken.“ 3 Was bislang als <strong>Gewalt</strong>ausübung in der<br />
realen Welt üblich war und toleriert wurde, durfte sich ab jetzt nur noch in der Phantasie<br />
<strong>oder</strong> in der medialen Welt abspielen: in Bildern und Texten.<br />
1 Theunert, Helga (1996): <strong>Gewalt</strong> in den Medien – <strong>Gewalt</strong> in der Realität, S. 43. München: KoPäd.<br />
2 Rathmayr, Bernhard (1996): Die Rückkehr der <strong>Gewalt</strong>, S. 39ff. Wiesbaden: Quelle und Meyer.<br />
3 a.a.O. S. 39.<br />
2
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Der Begriff „<strong>Gewalt</strong>“ geht eng mit „stark sein“ und „beherrschen“ einher. <strong>Gewalt</strong> hat etwas<br />
mit Machtausübung und Herrschaft zu tun. Damit geht einher, dass Macht bzw. Herrschaft<br />
sich auf Einzelne <strong>oder</strong> Gruppen negativ auswirkt. Diese Merkmale gelten ausschließlich<br />
für die reale Welt: Es muss sich um reale Macht handeln, und die negativen Wirkungen<br />
müssen sich real an anderen Menschen zeigen.<br />
Virtual Fighter 2 spielt sich jedoch nicht in der realen Welt ab, sondern in der virtuellen.<br />
Die Ausübung von Macht durch Erlernen und Anwenden von Kampftechniken verbleibt im<br />
<strong>Virtuelle</strong>n. Und auch die Wirkungen im Rahmen des Spiels sind keinesfalls Elemente der<br />
realen Welt, sondern gehören einer anderen Welt an. Insofern geht es bei Virtual Fighter<br />
nicht um <strong>Gewalt</strong>, sondern, wie der Name des Spiels es schon sagt, um etwas, das man<br />
vielleicht virtuelle <strong>Gewalt</strong> nennen könnte. Es besteht eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen<br />
der realen <strong>Gewalt</strong> im Kampfsport und dem Geschehen auf dem Bildschirm, in das der<br />
Spieler handelnd einbezogen ist. Die Ähnlichkeit ist hergestellt; sie ist eine<br />
Konstruktionsleistung des menschlichen Gehirns, das in der Lage ist, zu ergänzen und<br />
hinzuzudenken, was der virtuellen Welt im Vergleich zur realen fehlt, um so in der<br />
Virtualität ein emotionales Erleben zu erreichen, das der Spieler wünscht: Das Gefühl von<br />
Macht durch virtuelle Entfaltung aggressiver Impulse.<br />
Die Verlagerung der <strong>Gewalt</strong>impulse von der realen Welt in die virtuelle ist gesellschaftlich<br />
erwünscht. So sind auch Formen der <strong>Gewalt</strong>darstellung in den Computerspielen Ausdruck<br />
des gesellschaftlichen Bemühens, individuelle und insbesondere unkontrollierbare<br />
<strong>Gewalt</strong>aspekte aus der realen Welt auszugliedern und sie als ungefährliche Ware zu<br />
präsentieren, an die sich die Phantasien und aggressiven Impulse der Käufer heften<br />
können. Dabei werden in der Regel <strong>Gewalt</strong>szenarien gewählt, die von ihrer inhaltlichen<br />
Bestimmung nicht allzu deutlich die gesellschaftlichen <strong>Gewalt</strong>tabus verletzen. Bei Virtual<br />
Fighter wird eine in dieser Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen legitime Form von<br />
<strong>Gewalt</strong>ausübung, nämlich die des Kampfsports, gezeigt. Insofern ist diese virtuelle Welt<br />
noch in Ordnung, im Einklang mit unserer gesellschaftlichen Ordnung.<br />
Die Probleme fangen dort an, wo in Computerspielen Formen der <strong>Gewalt</strong> erscheinen, die<br />
nicht in Ordnung sind, die nicht im Einklang stehen mit dem, was unsere<br />
gesellschaftlichen Normen und Werte ausmachen: besonders abstoßende Formen von<br />
<strong>Gewalt</strong>, hemmungslose Vernichtungsorgien, <strong>Gewalt</strong> um ihrer selbst willen. Dies gilt<br />
verstärkt, wenn die Spielinhalte dem realen Handeln von Menschen allzu deutlich<br />
3
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
nachempfunden werden. Die technologische Entwicklung der Computerspiele ermöglicht<br />
es, eine Bildqualität zu erreichen, die der von Film und Fernsehen vergleichbar ist. Wenn<br />
sich dann das Spielgeschehen aus der Sicht der subjektiven Kamera entfaltet, wird die<br />
sichtbare Distanz zur realen Welt geringer, und es erfordert vom Spieler größere kognitive<br />
Anstrengungen, zwischen virtueller und realer Welt zu differenzieren.<br />
Spätestens an dieser Stelle entsteht die Frage, ob nicht etwas, das seinen Ort in der<br />
virtuellen Welt hat, transferiert werden könnte in die reale Welt. Mit anderen Worten: Mit<br />
der Annäherung der Computerspiele an die grafischen Standards von Film und Fernsehen<br />
wird die Frage nach den Wirkungen virtueller Welten dringlicher. Und damit steigt auch<br />
das Bedenken, ob durch Computerspiele und ihre aggressiven Themen nicht Einfluss<br />
genommen wird auf <strong>Gewalt</strong> und Aggression in der realen Welt. Damit würde sich der<br />
Prozess der Psychisierung gesellschaftlicher <strong>Gewalt</strong>organisation umkehren. Die in<br />
Medialität und Virtualität hineinsozialisierten, gewaltorientierten und aggressiven Impulse<br />
würden in verstärktem Maße in die reale Welt zurückkehren.<br />
Gibt es Anzeichen dafür? Kann Forschung Belege für diese Befürchtungen erbringen?<br />
Gibt es bestimmte Formen der <strong>Gewalt</strong> in Computerspielen, die diese Effekte in<br />
besonderer Weise hervorrufen?<br />
2 Wie virtuelle <strong>Gewalt</strong> wirkt<br />
Seit Beginn der Entwicklung der Computerspiele gibt es auch eine Forschungstätigkeit,<br />
die sich darum bemüht, Aussagen über die Wirkungen dieses neue Medium zu treffen. 4 In<br />
Hinblick auf die gewaltorientierten Inhalte vieler Computerspiele entstand sehr bald die<br />
Frage, welche Wirkungen von aggressiven Spielen ausgehen. Sacher kommt nach<br />
Auswertung der ihm vorliegenden empirischen Untersuchungen zum Ergebnis, „dass<br />
gerade in den methodisch sorgfältigeren Untersuchungen keine Aggression fördernden<br />
Wirkungen aggressiver Spiele nachgewiesen werden konnten.“ 5 Zumindest muss<br />
konstatiert werden, dass die verschiedenen Forschungsergebnisse inkonsistent sind. Das<br />
liegt zum Teil sicher an forschungsmethodischen Unterschieden. Es ist unklar, nach<br />
welchen Kriterien man ein Computerspiel als aggressiv <strong>oder</strong> gewaltorientiert<br />
4 Zusammenfassungen der wichtigsten Forschungsergebnisse finden sich z. B. bei Löschenkohl, Erich und<br />
Bleyer, Michaela (1995): Faszination Computerspiel. Eine psychologische Bewertung. S. 23ff. Wien: ÖBV<br />
Pädagogischer Verlag.<br />
5 Sacher, Werner (1993): Jugendgefährdung durch Video- und Computerspiele?; Zeitschrift für Pädagogik<br />
2, S. 322.<br />
4
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
einzuschätzen hat. Weitere Ursachen für widersprüchliche Forschungsergebnisse<br />
könnten durch die Beobachtungsebene bedingt sein, also durch das Kriterium, an dem<br />
man Veränderung in Aggressivität und gewaltorientiertem Handeln feststellen will.<br />
Erschließt man beispielsweise aggressives Verhalten in einer Freispielsituation, kann dies<br />
zu anderen Ergebnissen führen, als wenn man indirekte Verfahren z. B. wie<br />
Einschätzungsskalen wählt. Die in den Untersuchungssituationen auftretenden Effekte<br />
gelten dann für die Forscher als mehr <strong>oder</strong> weniger stichhaltige „Indizien“, die für eine<br />
Zunahme gewaltorientierten Handelns in der realen Welt sprechen – <strong>oder</strong> auch nicht.<br />
Dabei muss man sich klar darüber sein, dass hinter all diesen Forschungsbemühungen<br />
die meist unausgesprochene Vorstellung steht, dass Handlungsbereitschaften, die in der<br />
virtuellen Welt aktiviert werden, nicht dort bleiben, sondern in die Spielwelt <strong>oder</strong> gar in die<br />
reale Welt transferiert werden. Solche monokausalen Vorstellungen über die Wirkungen<br />
der virtuellen Welt sind sicher nicht angemessen. Wenn man überhaupt von Wirkungen<br />
sprechen will, die deutlich über die virtuelle Welt hinausreichen, so sind diese<br />
eingebunden in ein dynamisches Wechselverhältnis von Angebot des Spiels und<br />
Erwartung des Spielers. Mit anderen Worten: Der Spieler wählt das Spiel, das zu ihm<br />
passt und ihm in seinen Wünschen, Handlungsbereitschaften und Vorstellungen weit<br />
gehend entgegenkommt. Eine solche dynamische und prozessorientierte Forschung zur<br />
virtuellen Welt steht im Gegensatz zu einer traditionellen Wirkungsforschung, „die so tut,<br />
als seien die Kinder und Jugendlichen nur passive Auftreff- Flächen für Medien.“ 6 Die<br />
Suche nach simplifizierenden monokausalen Erklärungsmodellen wird, das zeigen die<br />
Untersuchungen zum Thema „Fernsehgewalt“, keinen wesentlichen Erkenntnisgewinn<br />
bringen. 7 Auf erkenntnistheoretischer Ebene besteht unter den Wissenschaftlern weithin<br />
Einigkeit, dass es in Hinblick auf die mediale Welt keine direkten Wirkungen von dieser<br />
auf die reale Welt gibt, egal ob die Inhalte gewaltorientiert sind <strong>oder</strong> nicht.<br />
6 a.a.O. 324.<br />
7 „Wirkungen sind also fast nie monokausal zu verstehen, sondern als Wechselwirkungen zwischen den<br />
jeweiligen Bedingungen.“ (Groebel, Jo (1993): Worauf wirken <strong>Gewalt</strong>darstellungen? Woher kommt reale<br />
<strong>Gewalt</strong>? medien praktisch 2, S. 22). Dies lässt sich z. B. am Fernsehverhalten von Jugendlichen gut<br />
zeigen. Rogge resümiert dazu, „ dass es je spezifische Bedeutungszuweisungen von Jugendlichen an je<br />
spezifische Medienhelden gibt. Solche Medisymbolisieren und verkörpern das aktuelle Thema des<br />
Jugendlichen, sie geben seiner inneren Realität eine äußere Form.“ (Rogge, Jan-Uwe (1993): Wirkung<br />
medialer <strong>Gewalt</strong> II. medien praktisch 2, S. 20.<br />
5
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Die Wirkungsdimensionen der medialen und virtuellen Welten sind vielmehr „eingebunden<br />
in komplexe Prozesse, in ein Wechselspiel zwischen Medium und Rezipient. Die<br />
Ergebnisse dieses Wechselspiels werden auf beiden Seiten von einer Vielzahl von<br />
Faktoren m<strong>oder</strong>iert.“ 8 Nicht unerheblich ist es z. B., welche Art von <strong>Gewalt</strong> präsentiert wird<br />
(physisch, psychisch <strong>oder</strong> strukturell) und in welcher Form dies geschieht (von angedeutet<br />
über distanziert und ironisch bis zu offen brutal und reißerisch). Von Belang sind auch die<br />
Kontexte, in denen diese <strong>Gewalt</strong> einbettet ist. Geht es um ein realitätsorientiertes<br />
Geschehen, um historische Sachverhalte <strong>oder</strong> um <strong>Gewalt</strong> in futuristischen bzw. fiktiven<br />
Welten? Die Faktoren auf der Seite des Rezipienten sind ebenso vielfältig. Alter,<br />
Geschlecht, Bildung, berufliche Tätigkeit, Vorerfahrungen, Interessen, Vorlieben und<br />
vieles andere beeinflussen die Zuwendung zu gewaltorientierten medialen und virtuellen<br />
Welten und wirken auf die Intensität der Nutzung ebenso ein wie auf die Möglichkeiten der<br />
Distanzierung, der Verarbeitung und der subjektiven Bedeutungszumessung.<br />
Im Rahmen dieser Wechselwirkungsprozesse sind mediale und virtuelle Welten<br />
Sozialisationsfaktoren, die „in erster Linie Verstärkungseffekte haben, also bereits<br />
existente Dispositionen unterstützen, nicht aber neue generieren können.“ 9 Dabei spielen<br />
die Langfristigkeit der Nutzung vielfältiger Medien ebenso eine Rolle wie die<br />
Verstärkungseffekte, die durch die Kumulation verschiedener Medien im Rahmen eines<br />
„Medienverbundsystems“ entstehen können. Notwendig sind daher Fragestellungen, die<br />
der Komplexität der Wechselwirkungsprozesse Rechnung tragen. Eine solche in Hinblick<br />
auf unser Thema wichtige Frage ist, warum virtuelle <strong>Gewalt</strong> auf viele Spieler so<br />
faszinierend wirkt. Wir wollen dieser Frage nun anhand eines Beispiels aufgreifen und,<br />
daran anschließend, durch eine theoretische Untersuchung zu beantworten versuchen.<br />
3 Zur Faszinationskraft virtueller <strong>Gewalt</strong><br />
Schaut man sich die Hitlisten der beliebtesten und umsatzstärksten Computerspiele an,<br />
stößt man auf Titel wie Warcraft II, Duke Nukem 3D, Virtual Fighter 2, Rebel Assault 2,<br />
Wing Commander IV und Command & Conquer, Empire Earth, Sudden Strike. Was ist das<br />
gemeinsame Merkmal aller dieser Spitzentitel? Dominierendes Thema aller dieser Spiele<br />
ist <strong>Gewalt</strong>, Aggression und Krieg. Lediglich in der Inszenierung von <strong>Gewalt</strong> gibt es<br />
8 a.a.O. [1] S. 17.<br />
9 a.a.O. [1] S. 18.<br />
6
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Unterschiede. Mal geht es um Duell-Fighter, also duellartige Kampfszenen mit<br />
gleichwertigen Gegnern, das andere Mal um Space-Shooter, Kampfspiele im Weltraum,<br />
die an Spielfilme angelehnt sind. Besonders beliebt in der Gunst der Käufer sind Action-<br />
Strategy-Games, also Spiele, in denen in Realzeit strategisch angelegte Kämpfe und<br />
Kriege ausgetragen werden. Command & Conquer ist ein solches Spiel, das exemplarisch<br />
ist für ein besonders umsatzstarkes Genre.<br />
3.1 Zum Computerspiel Command & Conquer<br />
Um was geht es bei dem Spiel? – Zwei globale Mächtegruppen stehen sich gegenüber<br />
und haben das Ziel, sich mit militärischen Mitteln bis zur Vernichtung zu bekämpfen, um in<br />
der Welt die Vormachtstellung zu erringen. Der Spieler wählt eine dieser beiden Seiten<br />
und muss verschiedene Missionen steigenden Schwierigkeitsgrades durchführen.<br />
Zwischen den einzelnen Levels werden filmartige Sequenzen gezeigt, die die<br />
Rahmenhandlung bilden. Diese Sequenzen ähneln tagespolitischen Fernsehnachrichten<br />
und politischen Magazinen, die bei Kriegsberichterstattungen üblich sind. Des weiteren<br />
werden Filmelemente verwendet, die aus einschlägigen Kriegsfilmen bekannt sind, z. B.<br />
die Einsatzbesprechung vor der militärischen Aktion.<br />
In der Regel muss der Spieler mit einer zunächst kleinen Gruppe militärischer Einheiten<br />
(z. B. Infanterie, Panzer) eine Basis aufbauen und sie gegen gegnerische Angriffe<br />
verteidigen. Dies bietet die Grundlage für eigene Angriffe gegen die feindliche Basis, die<br />
es zu erobern gilt. Um Waffeneinheiten und Gebäude produzieren zu können, die für den<br />
Ausgang der Kämpfe entscheidend sind, muss der Spieler über Finanzmittel verfügen.<br />
Diese werden dadurch erlangt, dass der Spieler den Rohstoff Tiberium erntet, der in der<br />
Nähe der Militärgebäude wächst. Deshalb ist die militärische Auseinandersetzung auch<br />
ein Kampf um die Tiberiumfelder.<br />
Der vom Computer gesteuerte Gegner versucht von Anfang an, die Einheiten der Spieler<br />
zu vernichten. Dieser Bedrohung kann prinzipiell nur aggressiv entgegengewirkt werden:<br />
Die Angreifer müssen vernichtet werden. Das bedeutet, dass der Spieler bereit sein muss,<br />
sich auf eine kriegerisch-aggressive Auseinandersetzung einzustellen. Es geht um das<br />
Prinzip „Alles <strong>oder</strong> Nichts“; eine friedliche Konfliktlösung ist nicht vorgesehen. Dafür sind<br />
strategisches und taktisches Denken unverzichtbar. Dieses Denken vollzieht sich im<br />
Rahmen einer problematischen Hightech-Mentalität. In den höheren Levels spielen die<br />
7
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
einfachen Fußsoldaten (Infanterie) im Grunde keine Rolle mehr. Es kommt vielmehr<br />
darauf an, das neueste und wirkungsvollste Kriegsgerät zu besitzen und es gezielt<br />
einzusetzen.<br />
Moralische, auf Empathie gerichtete Werte werden im Spiel negiert. Gegnerische<br />
Kampfeinheiten müssen auf jeden Fall zerstört werden. Der Gegner muss vollkommen<br />
besiegt werden. Dabei spielt es auch keine Rolle, wie viele eigene Einheiten<br />
„draufgehen“. Sie sind austauschbar und grundsätzlich in jeder gewünschten Anzahl<br />
produzierbar, wenn das entsprechende Geld vorhanden ist. Menschliches Leid ist nicht<br />
der Gegenstand des Spiels. Schmerzen und Verletzungen kommen nur in funktionaler<br />
Weise zum Ausdruck. Jede Einheit hat einen „Lebensbalken“, der von grün über gelb zu<br />
rot die verbleibende Lebenskraft anzeigt.<br />
Warum geht von diesem Spiel ein besonderes Maß an Faszination aus? – Die<br />
Faszination verdankt sich zum einen der hohen Spielqualität. Das Spiel ist nicht nur<br />
technisch gelungen, sondern überzeugt auch in spielerischer Hinsicht: Es ist gut<br />
verständlich, die Handhabung ist übersichtlich. Die Spielanforderungen steigen von<br />
Mission zu Mission. Gespielt wird im Realzeit-Modus, d.h. alle Befehle werden unmittelbar<br />
umgesetzt; der Spieler bekommt eine Rückmeldung über die Wirkungen seiner<br />
Entscheidungen. Der Umfang der Handlungsmöglichkeiten (Bau von Gebäuden und<br />
militärischen Einheiten; Bewegen der Einheiten und Einleiten von Kampfsequenzen) ist<br />
optimal auf das Spiel abgestimmt. Durch den Missions-Charakter bleibt das Spiel bis zum<br />
Ende spannend und abwechslungsreich.<br />
Grafik und Sound, also die äußeren Merkmale des Spiels, erreichen ein ähnlich hohes<br />
Qualitätsniveau. Die Spieloberfläche ist naturgetreu gestaltet. Die Graphik ist detailliert.<br />
Die Einheiten sind gut animiert. Explosionen hinterlassen bleibende Spuren. Die<br />
Landschaften sind abwechslungsreich und vielfältig. Das Geschehen auf dem Bildschirm<br />
wird angemessen mit Soundeffekten unterstützt. Zur Auflockerung des militärischen<br />
Geschehens gibt es die Einheit Commandobot mit coolen Sprüchen, die aus der<br />
Waschküche einer Militärklamotte stammen könnten.<br />
Damit ein Spiel als faszinierend empfunden werden kann, reicht die Spielqualität allein<br />
nicht aus. Angebot des Computerspiels und Erwartung des Computerspielers müssen<br />
zueinander passen, miteinander verschränkt werden. Mit anderen Worten: Es muss zu<br />
8
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
einer „strukturellen Koppelung“ kommen. 10 Welche Bereiche der strukturellen Koppelung<br />
sind bei Command & Conquer zu erwarten?<br />
• Command & Conquer ist in die mediale Welt, wie sie Kindern und Jugendlichen bekannt<br />
ist, eingebettet. Bereits zu Beginn des Spiels präsentieren sich Formen unserer<br />
Fernsehwelt. So besteht das Intro aus einem Zusammenschnitt unterschiedlicher<br />
Fernsehprogramme der Zukunft, die „zap“-artig präsentiert werden. Auch der Abspann<br />
und die Filmsequenzen zwischen den jeweiligen Missionen sind deutlich der Film- und<br />
Fernsehwelt entnommen. Diese Elemente machen es den Nutzern einfach, ihre<br />
eigenen Fernseh- und Filmerfahrungen mit dem Spiel in Verbindung zu bringen.<br />
Dadurch besitzt Commnd & Conquer einen hohen medialen Wiedererkennungswert.<br />
Dadurch bedingt wächst in den Spielern der Impuls, die präsentierte Welt, die der<br />
bekannten Medienlandschaft doch so ähnlich zu sein scheint, durch eigenes Handeln<br />
zu beeinflussen.<br />
• Unterhalb der Spieloberfläche, die durch Krieg und <strong>Gewalt</strong> gekennzeichnet ist, geht es<br />
bei diesem Spiel ganz allgemein um das Erfordernis, in einer bedrohlichen virtuellen<br />
Welt Macht, Kontrolle und Herrschaft zu entwickeln. Dazu stellt das Spiel bestimmte<br />
spieldynamische Muster bereit, auf die der Spieler sich einlassen muss. Im Mittelpunkt<br />
stehen neben der Erledigung der zahlreichen Feinde die Ausweitung des eigenen<br />
Macht- und Herrschaftsbereichs, die Bereicherung mit Wirtschaftsgütern und<br />
Geldmitteln und die Armierung, also die Verstärkung der militärischen Machtmittel in<br />
Hinblick auf Anzahl und Wirksamkeit. Eingebunden sind diese Muster in eine generelle<br />
Bewährungssituation, die angeordneten Missionen erfolgreich zu absolvieren. Nur<br />
durch die Bewährung erfolgen Belobigungen, Beförderungen und neue, noch<br />
schwieriger zu erfüllende Aufträge. Zentrales Element der Bewährungssituationen ist<br />
die vollständige Vernichtung des Gegners.<br />
Dieser Mix aus recht unterschiedlichen spieldynamischen Mustern ist für sehr viele<br />
Spieler deswegen faszinierend, weil sie ihre Lebenssituation darin wiederfinden können.<br />
So ist es im Leben der meisten Spieler erforderlich, in einer möglicherweise bedrohlich<br />
erscheinenden Welt, Aufträge angemessen zu erledigen, den eigenen Lebensbereich zu<br />
kontrollieren und auszudehnen, sich vielfältig zu bereichern und die eigenen<br />
Handlungsmöglichkeiten zu vergrößern. Insofern kann Command & Conquer zu einer<br />
Folie für die Lebenswünsche der Spieler werden. Mit anderen Worten: Command &<br />
Conquer bietet auf einer metaphorischen Ebene strukturelle Handlungsangebote, die mit<br />
den Erwartungen spezieller Spieler verschränkt werden können. Diese<br />
Spielerpersönlichkeiten verbinden aggressiv-kämpferische Vorgehen mit strategisch-<br />
taktischem Denken und Handeln.<br />
10 Näheres zur „strukturellen Koppelung“ bei Computerspielen findet sich in: Fritz, Jürgen & Fehr, Wolfgang:<br />
Computerspiele als Fortsetzung des Alltags. Wie sich Spielwelten und Lebenswelten verschränken. Auf<br />
dieser CD.<br />
9
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Die Faszinationskraft des Militärischen liegt in seinen Effekten. Ein Spiel wie Command &<br />
Conquer führt die Wirkungsmächtigkeit eigenen Handelns effektvoll in Bild und Ton vor.<br />
Feindliche Einheiten können durch Waffengewalt vernichtet werden. Die Wünsche nach<br />
Macht und Kontrolle werden dadurch in besonders intensiver Weise erfüllt. Die Wirkungen<br />
des Militärischen werden so präsentiert, dass sie für den Spieler akzeptabel erscheinen.<br />
Sie bewegen sich in den üblichen Formen der in der Film- und Fernsehwelt präsentierten<br />
<strong>Gewalt</strong>ästhetik . Man sieht bedrohliche Aufmärsche, Explosionen, vernichtete<br />
Militäreinheiten. Das direkte Leid der beteiligten Akteure wird hingegen nicht sichtbar.<br />
Dies würde die Faszinationskraft des Spiels mindern und den Spaß am spielerischen<br />
Handeln wesentlich beeinträchtigen.<br />
Ein weiterer Aspekt der Faszinationskraft des Militärischen bei Command & Conquer liegt<br />
in der Möglichkeit des Spielers, über immer besseres, teureres und wirkungsvolleres<br />
Kriegsgerät zu verfügen. Im Kriegsgerät verdinglicht sich so Macht und Kontrolle, sodass<br />
der Besitz des virtuellen Kriegsgeräts an sich schon faszinierend sein kann. Ausgehend<br />
von diesem Beispiel wollen wir nun etwas grundsätzlicher der Frage nachgehen, warum<br />
virtuelle <strong>Gewalt</strong> im Rahmen der komplexen Wechselwirkungsprozesse so faszinierend<br />
wirken kann. Aufgrund unserer Untersuchungen lassen sich verschiedene, miteinander<br />
verwobene Aspekte zusammentragen, die diese Faszinationskraft erklären können.<br />
3.2 Aspekte zur Beurteilung virtueller <strong>Gewalt</strong><br />
Schlüssel zum Verständnis virtueller <strong>Gewalt</strong> sind die in den Spielern gesellschaftlich<br />
erzeugten Wunschpotentiale. Diese Wünsche, die mit virtuellen Welten verwoben sind,<br />
sind der Kern der Wirkungen dieser Welten. „Medienwirkungsforschung ist so zu aller erst<br />
Medienverursachungsforschung, Suche nach den Gründen für jene Faszinierbarkeit<br />
großer Publikumsgruppen, die den Ermöglichungsgrund für die Existenz der Medien und<br />
damit für jegliche Medienwirkung darstellt.“ 11<br />
Die Umsatzzahlen bestimmter Computerspiele und die lange Verweildauer vieler Spieler<br />
gerade bei diesen Spielen belegen unabweislich die große Faszination, die nicht nur von<br />
Computerspielen generell, sondern insbesondere von den Spielen ausgeht, in denen<br />
<strong>Gewalt</strong>darstellungen den Mittelpunkt des Handlungsgeschehens bilden. Es ist<br />
offenkundig, dass sich das Ausmaß <strong>Gewalt</strong> bestimmter Computerspiele auf eine nahezu<br />
11 a.a.O. [2] S. 13.<br />
10
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
unerschöpfliche Nachfrage nach gerade solchen Spielen gründet. In der weltweiten<br />
Verbreitung der Wünsche nach virtueller <strong>Gewalt</strong> sind sich die Spieler offensichtlich<br />
ähnlicher als in den Wirkungen, die von dieser virtuellen <strong>Gewalt</strong> auf sie ausgeht. Deshalb<br />
ist die Frage von wesentlichem Interesse, was die Faszinationskraft der Computerspiele<br />
und speziell der gewaltorientierten ausmacht. 12 Man muss sich mit der Tatsache vertraut<br />
machen, dass Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene tagtäglich in hunderten von<br />
virtuellen Welten <strong>Gewalt</strong>handlungen vollziehen: prügeln, schießen, zerfetzen, vernichten –<br />
und offenbar Spaß daran haben.<br />
Dass diese Millionen von virtuellen „<strong>Gewalt</strong>tätern“ diese Handlungsimpulse in die reale<br />
Welt umsetzen, ist alles andere als wahrscheinlich. Ein solcher Nachweis ist durch<br />
Forschung nicht zu erbringen. Daher sollten sich die Forschungsbemühungen aus einer<br />
allzu einseitigen Verklammerung mit der Hypothese über die Wirkungen virtueller <strong>Gewalt</strong><br />
lösen und den Blick auf ein viel näher liegendes Problem richten. „Die Fixierung auf den<br />
eindeutigen Nachweis eines tatsächlichen Zusammenhangs zwischen Mediengewalt und<br />
realer <strong>Gewalt</strong>tätigkeit hat die Medienforschung von der viel grundsätzlicheren Frage nach<br />
den Voraussetzungen der Mediengewalt abgelenkt. (...) Die Frage nach den Ursachen<br />
medialer <strong>Gewalt</strong>produktion ist der Frage nach ihren Wirkungen voranzustellen. Ehe man<br />
sinnvoll fragen kann, was Medien bewirken, muss man fragen, wodurch ihre<br />
Anziehungskraft beim Publikum verursacht wird. Die Frage nach den Hintergründen<br />
massenhafter Faszination durch visuelle <strong>Gewalt</strong> ist der Ansatzpunkt einer neuen Medien<br />
(be)wirkungsforschung.“ 13<br />
Welche Aspekte machen die Faszinationskraft der virtuellen <strong>Gewalt</strong> aus? Welche<br />
gesellschaftlich erzeugten Wunschpotentiale können sich über gewaltorientierte<br />
Computerspiele realisieren?<br />
3.2.1 <strong>Gewalt</strong> vertreibt Langeweile<br />
Allen Untersuchungen zufolge ist Langeweile der wesentliche Anlass, sich in virtuelle<br />
Welten zu begeben. Offensichtlich gehört ein mittleres Erregungsniveau zu dem, was für<br />
Menschen gute Gefühle sind. Computerspiele sind offensichtlich in der Lage, zu einer<br />
12 Erste Antworten, die sich auf empirische Untersuchungen stützen, finden sich in Fritz, Jürgen (Hrsg.)<br />
(1995), Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München: Juventa.<br />
13 Rathmayr, a.a.O. 37.<br />
11
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Erregungsschwelle beizutragen, die als angenehm empfunden wird. Spannende<br />
Computerspiele sind in der Lage, den Spieler zu fesseln und seine Aufmerksamkeit an<br />
das Spielgeschehen zu binden. Deshalb sind sie abwechslungsreich, besitzen vielfältige<br />
Spielforderungen und stellen dem Spieler angemessene Handlungsmöglichkeiten bereit.<br />
Aber das allein reicht nicht aus. Die schematischen Spielabläufe und die Wiederkehr des<br />
immer Gleichen bewirken relativ schnell, dass das mit dem Spiel erzeugte<br />
Erregungsniveau nach einiger Zeit absinkt, sodass Aufmerksamkeit und Interesse<br />
nachlassen und die Langeweile zurückkehrt.<br />
Durch Bedrohung mit virtueller <strong>Gewalt</strong> kann das Abflachen des Erregungsniveaus<br />
wirkungsvoll aufgehalten halten. Der Spieler sieht sich in seiner virtuellen Existenz<br />
gefährdet und muss alle Kraft und Fähigkeit aufbieten, um nicht vom Bildschirm getilgt zu<br />
werden. Er kann es sich nicht erlauben, abzuschweifen und unkonzentriert zu sein. Dies<br />
hätte unweigerlich den Bildschirmtod zur Folge. Andererseits ist die existentielle<br />
Bedrohung nur virtuell. Das Erregungsniveau bleibt in gewissen Grenzen und wird nach<br />
Erledigung der Spielaufgabe abgebaut. Lediglich bei ungeübten Spielern, die mit dem<br />
Spiel nach mehreren Versuchen nicht klarkommen, kann das Erregungsniveau sehr stark<br />
ansteigen und Wutreaktionen auslösen.<br />
Die Bedrohung mit virtueller <strong>Gewalt</strong> mag zwar Langeweile vertreiben, garantiert aber<br />
nicht, dass dies auch permanent so bleibt. Was im Zusammenhang mit virtueller <strong>Gewalt</strong><br />
als anregend und was als langweilig empfunden wird, hängt sehr von den Spielern und<br />
ihren Spielerfahrungen ab. Hier treten im Laufe der Computerspiel-Sozialisation<br />
Gewöhnungseffekte auf. Die Stimulierung mit schlichter <strong>Gewalt</strong> reicht nicht mehr aus,<br />
Langeweile zu vertreiben. Notwendig ist vielmehr, die <strong>Gewalt</strong>handlungen grafisch und<br />
spieldynamisch besonders effektvoll aufzubereiten, zu präsentieren und in das<br />
spielerische Handeln einzuweben.<br />
Ein sichtbarer Ausdruck dafür sind die aktuellen gewaltorientierten Spiele, die die<br />
vordersten Plätze in den Hitlisten belegen. <strong>Gewalt</strong> ist hier ständig präsent; in jedem<br />
Augenblick kann sich die latente Bedrohung als manifeste <strong>Gewalt</strong> zeigen. Selbst in den<br />
„kühlen“ Strategiespielen zeigt sich mittlerweile die Unmittelbarkeit und Unvermitteltheit<br />
von <strong>Gewalt</strong>. Bei den Action-Strategy-Games (wie z. B. Command & Conquer und Warcraft<br />
II, Sudden Strike und Age of Empire) muss der Spieler in Realzeit handeln. In dem<br />
12
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Ausmaß, in dem die Bedrohung gesteigert wird, z. B. durch immer gefährlichere und<br />
schrecklichere Feinde, steigern sich auch Art, Umfang und Wirkkraft des eigenen<br />
gewaltvollen Handelns. Dies gilt insbesondere für die neueren Egoshooter wie z. B.<br />
Nukem 3D. Hier hat sich das Bestiarium der Gegner (und ihrer Taten) zu einer<br />
schauerlichen Schrecklichkeit ausgeweitet, zu deren Bekämpfung immer effektvollere<br />
Waffen notwendig werden.<br />
Diese <strong>Gewalt</strong>spirale, die durch Gewöhnung an virtuelle <strong>Gewalt</strong> und das Bedürfnis nach<br />
stärkeren Reizen in Gang gehalten wird, ist das Oberflächenphänomen einer tieferen<br />
Bedürfnisdisposition, die eng mit <strong>Gewalt</strong> verschränkt ist: Macht, Herrschaft und Kontrolle<br />
zu erlangen und lustvoll auszuüben.<br />
3.2.2 Macht, Herrschaft und Kontrolle 14<br />
Die Leistungsanforderungen von Computerspielen schließen das Bestreben ein, Macht zu<br />
entfalten und das Spiel zu kontrollieren. Es gilt mehr <strong>oder</strong> weniger für alle Computerspiele,<br />
dass die Spieler sich machtvoll behaupten, Herrschaft ausbilden und Kontrolle ausüben<br />
müssen. Eben darin liegt der besondere Reiz und der Grund für die Faszinationskraft<br />
dieser Spiele. Mit ihrer Kontrollierbarkeit stehen sie in deutlichem Kontrast zur Lebenswelt<br />
der Spieler.<br />
Um das Spiel zu gewinnen und zu diesem guten Gefühl zu gelangen, muss der Spieler<br />
zeigen, dass er Macht, Herrschaft und Kontrolle ausüben kann. Doch wie zeigt sich das<br />
klar und eindeutig? Die wirkungsvollste und sofort sichtbare Form der Realisierung von<br />
Macht, Herrschaft und Kontrolle ist in der Regel die <strong>Gewalt</strong>: „Ein zentrales<br />
Bestimmungskriterium der Definition von <strong>Gewalt</strong> ist mit den Begriffen ‚Macht’ und<br />
‚Herrschaft‘ gekoppelt: Die Manifestation von Macht und/<strong>oder</strong> Herrschaft gilt dann als<br />
<strong>Gewalt</strong>, wenn sie schädigende Folgen zeitigt.“ 15<br />
Insofern Macht, Herrschaft und Kontrolle bestimmende Kriterien aller Computerspiele<br />
sind, müssen sie dem Spieler wirkungsvolle, deutlich sichtbare Formen zu ihrer<br />
Realisierung anbieten – und das ist in der Regel die <strong>Gewalt</strong>: die schädigende Einwirkung<br />
auf den Gegner, die in ihren Folgen sofort sichtbar wird. Das muss nicht so sein. Es gibt<br />
14 Vgl. dazu den Beitrag von Fritz, Jürgen (2002): Warum eigentlich spielen Leute Computerspiele? Macht,<br />
Herrschaft und Kontrolle faszinieren und motivieren; auf dieser CD.<br />
15 a.a.O. [1] S. 62.<br />
13
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Computerspiele, in denen sich Macht, Herrschaft und Kontrolle ohne <strong>Gewalt</strong> <strong>oder</strong> deutlich<br />
gewaltvermindert zeigt, z. B. in bestimmten Adventures, bei denen die Kontrolle des<br />
Spiels darin besteht, bestimmte Rätsel und Denkaufgaben zu lösen, was nicht mit dem<br />
Besiegen virtueller Gegner verbunden ist. Diese Spiele sind jedoch der Ausnahmefall und<br />
dürften in der Regel auch nicht in den Hitlisten der Computerspiele zu finden sein.<br />
Offensichtlich wird in den Computerspielen eine sehr drastische und eindringliche Form<br />
der Ausübung von Macht, Herrschaft und Kontrolle gesucht: die <strong>Gewalt</strong>. Wenn man<br />
Computerspiele nutzt, um Macht, Herrschaft und Kontrolle auszuüben, dann wählt man<br />
zugleich auch die <strong>Gewalt</strong>, und man wählt sie je nach Geschmack und medialen<br />
Gewohnheiten: von m<strong>oder</strong>aten, kindgerechten und witzigen Formen der <strong>Gewalt</strong> über<br />
distanzierende strategische Inszenierungen bis hin zu <strong>Gewalt</strong>orgien und blutigen<br />
Abschlachtungen.<br />
3.2.3 Die gesellschaftlichen <strong>Gewalt</strong>kontexte<br />
Zur Faszinationskraft virtueller <strong>Gewalt</strong> tragen auch gesellschaftliche <strong>Gewalt</strong>kontexte<br />
Wesentliches bei. <strong>Virtuelle</strong> <strong>Gewalt</strong>inszenierungen verschränken sich nicht nur mit<br />
alltäglichen Ohnmachtsgefühlen, indem sie die mit Macht, Herrschaft und Kontrolle<br />
verbundenen <strong>Gewalt</strong>phantasien aufgreifen und ausbauen. Sie setzen auch fort, was durch<br />
den „Prozess der Zivilisation“ an realen kollektiven und individuellen <strong>Gewalt</strong>bedürfnissen<br />
in die mentale und mediale Welt „übergeleitet“ wurde. Damit erfüllen sie in mehrfacher<br />
Weise die gesellschaftliche Funktion der <strong>Modell</strong>ierung emotionaler Impulse: „Sie besorgen<br />
auf diese Weise einerseits die Besänftigung, Kontrolle und Kanalisierung solcher<br />
<strong>Gewalt</strong>phantasien im Sinne der gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen und lenken<br />
individuelle <strong>Gewalt</strong>bedürfnisse in die Richtung gesellschaftlich erwünschter<br />
<strong>Gewalt</strong>verhältnisse. Andererseits stellen sie eine ästhetisierte, erfahrungslose Form von<br />
<strong>Gewalt</strong>wahrnehmung zur Verfügung, die, im Unterschied zu realer <strong>Gewalt</strong> und gerade weil<br />
sie unwirklich ist, von einem faszinierten Publikum lustvoll genossen werden kann.“ 16<br />
Gesellschaftliche <strong>Gewalt</strong>verhältnisse und reale Bedrohungssituationen werden<br />
ausgeblendet und der Aufmerksamkeit des Publikums entzogen. An ihre Stelle treten<br />
virtuelle <strong>Gewalt</strong>inszenierungen, die nicht mehr real erlebt werden müssen, sondern in<br />
einem folgenlosen Computerspiel konsumiert werden können. Was nicht mehr den Tod<br />
16 a.a.O. [2] S. 114.<br />
14
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
bringende reale Welt ist, sondern als Virtualität inszeniert wird, erzeugt nicht mehr Angst,<br />
sondern Lust. <strong>Gewalt</strong> wird zur spannenden Unterhaltung, die in ihrer Verschränkung mit<br />
virtueller Macht, Herrschaft und Kontrolle gute Gefühle machen kann. Die Ausübung<br />
virtueller <strong>Gewalt</strong> kann als Gefühl machtvoller Kompetenz und Überlegenheit erlebt<br />
werden. Ob damit die Gefahr besteht, reale <strong>Gewalt</strong> wie virtuelle wahrzunehmen, bleibt<br />
hingegen eine offene Forschungsfrage. Sicher ist nur, dass mit virtueller <strong>Gewalt</strong> die<br />
„<strong>Gewalt</strong>kreisläufe“ verstärkt werden, die das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage in<br />
Gang halten und steigern: More blood, more money.<br />
Die wesentlichen Ursachen für <strong>Gewalt</strong>kreisläufe liegen jedoch nicht in den Medien selbst.<br />
Diese profitieren lediglich davon. „<strong>Gewalt</strong>potentiale im gesellschaftlichen Leben, die ihre<br />
Wurzeln in Bedingungen familialer Beziehungsstörungen, in institutionellen und kulturellen<br />
Unterdrückungs- und Verdrängungsmechanismen, politisch motivierten Täuschungs- und<br />
Propagandastrategien haben, sind die wahren Ursachen der Verführbarkeit der Menschen<br />
durch <strong>Gewalt</strong>. Die m<strong>oder</strong>ne Zivilisation nimmt ihre Mitglieder immer spürbarer in die<br />
schmerzliche Zange zwischen offiziellem <strong>Gewalt</strong>verbot und offiziösen Appellen an eine<br />
Art von <strong>Gewalt</strong>tätigkeit, die nicht als solche ausgegeben werden darf: rigides Einhalten<br />
von Vorschriften, hartes Durchsetzungsvermögen, rücksichtslose Konkurrenz, eiserne<br />
Konsequenz. Da <strong>Gewalt</strong> nicht sein darf, aber dennoch tagtäglich getan <strong>oder</strong> zumindest<br />
toleriert werden muss, verlangt ein immer größeres Publikum nach der Inszenierung der<br />
verdrängten, verbotenen Normalität.“ 17<br />
<strong>Virtuelle</strong> <strong>Gewalt</strong> bietet „Lösungen“ für diese gesellschaftlichen Widersprüche im Umgang<br />
mit realer <strong>Gewalt</strong> an. Sie schafft „gute Gefühle“ und beeinträchtigt zugleich die Potentiale,<br />
die sich zum Abbau dieser Widersprüche entwickeln könnten. Kinder, Jugendliche und<br />
Erwachsene werden durch virtuelle <strong>Gewalt</strong> nicht gewalttätiger als sie sind, wohl aber<br />
werden sie daran gehindert, Fähigkeiten im Umgang mit ihren aggressiven Impulsen zu<br />
erlernen und sozial angemessene Formen in Bezug auf individuelle und gesellschaftliche<br />
<strong>Gewalt</strong> zu entwickeln. Denn: Die virtuelle <strong>Gewalt</strong> ist allenfalls die Kehrseite, nicht jedoch<br />
das <strong>Modell</strong> für den sozialen Umgang mit <strong>Gewalt</strong> und sie erlangt ihre Faszinationskraft<br />
gerade aus diesem Umstand.<br />
17 a.a.O. [2] S. 139.<br />
15
3.2.4 Die Faszinationskraft virtueller <strong>Gewalt</strong><br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Die Faszinationskraft virtueller <strong>Gewalt</strong> entwickelt sich im Rahmen der skizzierten<br />
Wechselwirkungsprozesse nur durch eine akzeptierbare <strong>Gewalt</strong>präsentation. Die nackte<br />
Realität der <strong>Gewalt</strong> ist unerträglich und damit inakzeptabel. Um angenommen zu werden,<br />
muss die <strong>Gewalt</strong> in einer dem sich entwickelnden Publikumsgeschmack entsprechenden<br />
Weise „aufbereitet“ sein. Mit anderen Worten: Die <strong>Gewalt</strong>darstellung muss eine<br />
akzeptierbare Warenform annehmen. Die Präsentation der virtuellen <strong>Gewalt</strong> folgt<br />
medialen Vorbildern. Sie muss sowohl Aspekte der realen Welt aufnehmen, um die<br />
Erlebnisdichte zu erhöhen als auch die <strong>Gewalt</strong> so ästhetisieren, dass sie nicht schmutzig<br />
und abstoßend wirkt. Allemal problematisch sind virtuelle <strong>Gewalt</strong>darstellungen, die zu nah<br />
an der selbst erfahrenen realen Welt orientiert sind. 18<br />
Die Warenform der inszenierten <strong>Gewalt</strong> zeigt sich auch in den ästhetisierten Objekten, mit<br />
denen sich <strong>Gewalt</strong> in der virtuellen Welt realisiert: Waffen, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe.<br />
In diesen virtuellen Objekten verdinglicht sich die <strong>Gewalt</strong> in einer akzeptablen Form:<br />
<strong>Gewalt</strong>orientierte Machtmittel erscheinen als schön und begehrenswert. Ihr virtuelles<br />
Gebrauchswertversprechen erfüllt sich durch eine wirkungsvolle und saubere<br />
<strong>Gewalt</strong>anwendung. Ihr Besitz verleiht Macht und es lohnt sich, sich dafür in der virtuellen<br />
Welt anzustrengen. Die Parallelen zum realen Warenbesitz in unserer<br />
Konsumgesellschaft bieten sich geradezu an.<br />
Die akzeptable <strong>Gewalt</strong>präsentation in der virtuellen Welt zielt auf intensive Erfahrungen,<br />
ohne mit ihnen hautnah in Berührung zu kommen. Gewünscht ist die Intensität des<br />
Eindrucks, die Dichte des Erlebens ohne das Risiko mit den problematischen Aspekten<br />
der eigenen Person <strong>oder</strong> gar der realen Welt konfrontiert zu werden: Total immersion<br />
without total involvement. Insofern ist die virtuelle <strong>Gewalt</strong>wahrnehmung nicht nur<br />
folgenlos, sondern im Grunde auch erfahrungslos. Die Faszination an der unwirklichen<br />
18 Zur <strong>Gewalt</strong>schwelle von Kindern vgl. Theunert, a.a.O. [1] S. 20f. Der Begriff „<strong>Gewalt</strong>schwelle“ gilt als<br />
Maßstab dafür, welche Darstellungen Kinder tolerieren und auf welche sie mit Ablehnung und Angst<br />
reagieren. Die <strong>Gewalt</strong>schwelle der meisten Kinder wird nicht überschritten, wenn „saubere“ <strong>Gewalt</strong><br />
gezeigt wird, also die Folgen von <strong>Gewalt</strong>tätigkeit ausgeblendet <strong>oder</strong> verharmlost werden und wenn die<br />
<strong>Gewalt</strong>anwendung in die gängigen Klischees von Gut und Böse eingebettet ist. Überschritten wird<br />
hingegen die <strong>Gewalt</strong>schwelle fast ausnahmslos, wenn die Leiden der Opfer drastisch und blutig in Szene<br />
gesetzt sind. Mit Ablehnung und Angst reagieren Kinder in der Regel auf <strong>Gewalt</strong>, die realitätsnah<br />
inszeniert wurde <strong>oder</strong> der Realität entstammt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kinder die <strong>Gewalt</strong> in<br />
ihrer eigenen Wirklichkeit feststellen.<br />
16
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
virtuellen <strong>Gewalt</strong> hat den Verlust des Mitleidens zumindest in dieser virtuellen Welt zur<br />
Folge.<br />
3.2.5 Dispens von Empathie<br />
In der virtuellen Welt des Computerspiels ist Empathie unangemessen. Das vom<br />
Computer generierte „Gegenüber“ lässt sich nicht empathisch erschließen, sondern nur<br />
einschätzen hinsichtlich seiner programmierten Reaktionsmuster. Nicht Empathie wird<br />
verlangt, sondern strategisch-taktisches Verhalten im Rahmen eines festgelegten<br />
Regelsystems, das für die jeweilige virtuelle Welt Gültigkeit hat. Die Figuren im<br />
Computerspiel sind nur Handlungsträger in funktional bestimmten Abläufen und<br />
keinesfalls Objekte, denen man emotional getönte Empathie entgegenbringen müsste –<br />
obwohl es bei Jüngeren dazu kommen kann, dass sie bestimmte Comic-Figuren im<br />
Computerspiel süß und niedlich finden und auf Beeinträchtigungen dieser Figuren<br />
empathisch reagieren. Ein virtuelles Gegenüber kann nur Objekt im Rahmen funktionaler<br />
Denk- und Handlungsprozesse sein, nie Subjekt.<br />
Deshalb haben moralische Erwägungen im Handlungsvollzug des Computerspiels keinen<br />
Ort. Für die Entfaltung von Macht, Herrschaft und Kontrolle ist die Handlungsebene<br />
entscheidend. Die Inhaltsebene des Computerspiels dient nur zur anfänglichen Motivation<br />
und als Orientierungshilfe für die Entwicklung angemessener Handlungsmuster. Dies gilt<br />
prinzipiell auch für gewaltorientierte Spielhandlungen. Unter permanentem<br />
Handlungsdruck bleibt ohnehin nicht die Zeit, das Gegenüber empathisch zu erschließen,<br />
ihm Achtung zu erweisen <strong>oder</strong> moralische Erwägungen anzustellen: Erst kommt das<br />
„Überleben“ und dann die „Moral“.<br />
Entlastung findet dieser Dispens von Empathie durch eine „Spielmoral“ nach bekannter<br />
Schwarz-Weiß-Manier: Hier sind die Guten, dort die Bösen, und gegen die Bösen ist jedes<br />
Mittel recht – auch und gerade die <strong>Gewalt</strong>. Die Bösen haben in der virtuellen Welt<br />
geradezu die Funktion, dem Spieler zu gestatten, sich von empathischen Ansprüchen zu<br />
entlasten und stattdessen „voll drauf halten“ zu dürfen. Dies macht für viele Spieler einen<br />
nicht unbeträchtlichen Reiz am Spiel aus. Die Faszination an ausgeübter virtueller <strong>Gewalt</strong><br />
ist verschränkt mit einem Rückzug an empathischen Fähigkeiten und prosozialen<br />
Einstellungen – zumindest in der virtuellen Welt. Wenn die Wurzeln der Moral in der<br />
Empathie zu suchen sind, dann bleiben Computerspiele, zumal solche mit deutlicher<br />
17
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
<strong>Gewalt</strong>orientierung, in ihrem Wesenskern davon unberührt. Computer kennen keine<br />
Empathie. Ihnen gegenüber wird weder Empathie gefordert noch ist sie dort notwendig<br />
und sinnvoll. Die moralischen Bedenken, die gegenüber gewaltorientierten Spielinhalten<br />
ins Spiel gebracht werden, greifen im Grunde zu kurz. Die virtuelle Welt ist eine Welt ohne<br />
Empathie. Und selbst die wenigen Ansätze von empathischen Angeboten und<br />
moralischen Verkleidungen in einigen vereinzelten Computerspielen können nicht darüber<br />
hinwegtäuschen, dass dies alles im Grunde Staffage ist: vordergründige und<br />
austauschbare Elemente in einem Handlungsgeschehen, das nicht der Empathie<br />
verpflichtet ist, sondern dem strategischtaktischen Kalkül, dem Durchschauen<br />
programmierter Geschehensabläufe und dem Entwickeln darauf bezogener<br />
angemessener Handlungsmuster.<br />
Erst außerhalb der virtuellen Welt kann man versuchen, aus der Außenperspektive eines<br />
Betrachters und nicht aus der Innenperspektive des Spielers, das virtuelle Geschehen<br />
nach moralischen Gesichtspunkten einzuschätzen. Dabei sollte klar sein, dass es nicht<br />
um das Spiel „an sich“ gehen kann, sondern um seine moralische Überformung, d.h. um<br />
das Geschick der Spieldesigner, trotz Fehlen von Empathie den Schein einer Moralität im<br />
Spiel mehr <strong>oder</strong> weniger glaubhaft und spielwirksam zu erzeugen.<br />
4 Von der Wirkungsforschung zur Normen- und Wertentscheidung<br />
Wir stehen jetzt vor der schwierigen Frage, ob von (gewaltorientierten) Computerspielen,<br />
die Empathie grundsätzlich aussparen, das ausgehen kann, was wir Gefährdung nennen.<br />
Der Gefährdungsbegriff, so wie wir ihn in der Medienwirkungsforschung gebrauchen, geht<br />
von der Annahme aus, dass etwas in der virtuellen Welt den Spieler so stark beeindruckt,<br />
dass er dadurch etwas in die mentale und reale Welt so transferiert, dass es nicht<br />
folgenlos bleibt. Und um diese Folgen geht es: Gefährden sie den Spieler in seinem<br />
Handeln, Denken und Fühlen? Treten Beeinträchtigungen und Fehlentwicklungen ein, die<br />
sich negativ auf das Umfeld des Spielers auswirken können?<br />
4.1 Ansätze der Medienwirkungsforschung<br />
Die Medienwirkungsforschung kennt auf diese Fragen keine generellen Antworten.<br />
Allenfalls kann sie belegen, dass unter bestimmten Bedingungen bei bestimmten<br />
Personen mit speziellen sozialen Hintergründen unerwünschte Effekte auftreten können.<br />
18
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Mit anderen Worten: Sie beantwortet die Fragen mit einem „Es kommt darauf an.“ Befragt<br />
man die Spieler direkt, und das zeigen alle unsere Untersuchungen, wird eine nachhaltige<br />
Auswirkung der virtuellen auf die reale Welt eindeutig bestritten. Wohl aber, und darin sind<br />
sich viele ältere Spieler einig, könnte dies bei Jüngeren der Fall sein.<br />
Wenn sich die Frage nach der Gefährdung durch Computerspiele unter Rückgriff auf die<br />
möglichen Wirkungen nicht beantworten lässt, so kann man sich zumindest fragen, was<br />
Computerspiele in Hinblick auf den Gefährdungsaspekt nicht bewirken. Und hier wird man<br />
rasch fündig: Sie bewirken keine Empathie. Das Gegenüber im Computerspiel fordert<br />
nicht zum Mitgefühl heraus. <strong>Virtuelle</strong> Gegner kennen keine Gefühle, sie besitzen keine<br />
Empathie. Ihr Handeln folgt ausschließlich programmierten Algorithmen. Computerspieler<br />
müssen sich darauf einstellen, wenn sie gewinnen wollen. Und sie tun es auch, denn ihr<br />
gutes Gefühl, das sie im Spiel und danach haben wollen, hängt davon ab, keine Empathie<br />
zu entwickeln. Sie müssen lernen, dass Gefühle und Empathie in der virtuellen Welt nichts<br />
zu suchen haben. Und je „gewalttätiger“ und „brutaler“ die Spiele sind, umso deutlicher<br />
wird dies.<br />
Erfahrene Computerspieler zeigen sich daher auch irritiert und verwundert, wenn man ihre<br />
Spiele und damit ihre virtuellen Aufenthaltsorte nach Kriterien der Menschlichkeit und<br />
Moralität kritisiert. Sie wollen gewinnen und keine Belege für ihre moralische Integrität<br />
schaffen. Darauf weist auch Leu hin, indem er betont, dass Kindern und Jugendlichen die<br />
Vorstellung, „bestimmte Darstellungsformen als Ausdruck von Leiden bzw. von ‚gut‘ <strong>oder</strong><br />
‚böse‘ in einem moralischen Sinne wahrzunehmen, fremd ist.“ 19 Die vom Computerspiel<br />
ausgehenden Anforderungen, die es zu beherrschen gilt, stehen im Bewusstsein der<br />
Spieler im Mittelpunkt, nicht jedoch die Spielinhalte. Für die Spieler ist eigentlich klar, dass<br />
gewaltorientierte Spiele nicht gut sind. Dies ist für viele jedoch kein Grund, sich diesen<br />
Spielen nicht zuzuwenden. Computerspiel und reale Welt erscheinen auch in ihrer<br />
Moralität als zwei völlig verschiedene Welten.<br />
4.2 Empathie als Kriterium<br />
Unbestritten ist die Notwendigkeit, Werte und Normen zu vermitteln. Eine moralische<br />
Einstellung ohne Mitgefühl für das lebendige Gegenüber ist schlechterdings unmöglich.<br />
19 Leu, Hans Rudolf (1993): Wie Kinder mit Computern umgehen, S. 72f. München: Verlag Deutsches<br />
Jugendinstitut.<br />
19
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Die gängigen, und das heißt vor allem die gewaltorientierten Computerspiele sind gewiss<br />
keine Lernfelder für die Ausbildung von Empathie. Hier erhalten Kinder und Jugendliche<br />
keinen Anreiz, einen durch Empathie gekennzeichneten Umgang mit der <strong>Gewalt</strong> zu<br />
lernen. Das Leiden von Opfern bleibt im Computerspiel ausgespart, weil es keine Opfer<br />
gibt, denen man Mitgefühl entgegenbringen müsste, sondern lediglich computergenerierte<br />
Grafiken, die „abzuarbeiten“ sind. Alles andere ist Illusion: Überformungen, an die sich<br />
gefühlsmächtige Assoziationen der Spieler heften können.<br />
Empathie ist nur in der realen Welt des menschlichen Miteinanders erlernbar (und<br />
verlernbar) und nicht in der virtuellen Welt des Computerspiels. Immer längere Aufenthalte<br />
in der virtuellen Welt können schädigen, weil sich dadurch die Zeit vermindert, in der sich<br />
diese Empathie ausbilden könnte. Sie schädigen auch deshalb, weil sich Muster für<br />
emotionale Befriedigungen herausbilden können, die ohne Empathie auskommen und<br />
daher von der Notwendigkeit ablenken, eine empathische Form der<br />
Zwischenmenschlichkeit auszubilden, die auf <strong>Gewalt</strong> weit gehend verzichten kann und die<br />
durch ihre besondere emotionale Qualität Befriedigung schenkt.<br />
Die virtuelle Welt des Computerspiels „kennt“ zwar keine empathischen Gebote, wohl<br />
aber der Spieler. Eine Spieloberfläche mit ihren Spielfiguren, Spielhandlungen und<br />
Spielinhalten, auf der die Abwesenheit von Empathie grafisch und szenisch deutlich<br />
umgesetzt ist, stößt bei manchen Spielern auf erhebliche Ablehnung. Sie fühlen sich von<br />
dem Spiel abgestoßen, weil es zu gewalttätig und zu brutal daherkommt. Das Problem<br />
besteht im Grunde darin, dass die inhaltliche Einkleidung des Spiels die fehlende<br />
Empathie nicht verhüllt, sondern dieses Fehlen erschreckend deutlich zum Ausdruck<br />
bringt, dies durch ungebrochene <strong>Gewalt</strong>orientierung stimuluswirksam und damit<br />
verkaufsträchtig zuspitzt, um so drastisch vor Augen zu führen, was es heißen kann, in<br />
einer (virtuellen) Welt ohne Moral und Empathie leben zu müssen – und d.h.: kämpfen zu<br />
müssen, um leben zu können.<br />
Viele Designer von Computerspielen gehen geschickte Kompromisse ein, um nicht an<br />
moralischen Vorbehalten (<strong>oder</strong> Indizierungen) zu scheitern. Sie überformen die<br />
Abwesenheit von Empathie mit einer Spieloberfläche, auf der sich der Spieler mit der von<br />
ihm akzeptierten Moral wiederfinden kann: <strong>Gewalt</strong> nur zur Abwehr eines aggressiven<br />
Feindes; keine Vernichtung von Menschen, sondern von Robotern, Bestien und Aliens;<br />
20
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Kampf des Guten gegen das Böse; bei menschlichen Figuren keine aggressiven<br />
<strong>Gewalt</strong>handlungen, sondern „sportlicher“ Wettkampf; Schlachten und Kriege im Stil eines<br />
animierten Schachspiels – auf jeden Fall weit gehende emotionale Distanz und Abstinenz<br />
zur vorfindlichen realen Welt. Die Spieldesigner wissen sehr wohl, dass vom<br />
Computerspiel eine moralische Aussage erwartet wird, schließlich sind die Spieler<br />
Menschen und Menschen orientieren sich in ihrem Handeln an moralischen Vorgaben<br />
und können empathische Reaktionen zeigen, auch wenn nichts da ist, auf das sich diese<br />
Reaktionen beziehen könnten.<br />
Komplexe und gut durchdachte Spiele wie Civilization 2 und 3 und Ascendency tragen<br />
dem Umstand Rechnung, dass sich Menschen auch in der virtuellen Welt moralisch<br />
entscheiden möchten. So bieten diese Spiele die Möglichkeit, zwischen Krieg und<br />
Frieden, Kampfhandlungen und Handelsbeziehungen, Besiedlung und Eroberung,<br />
Vermehrung des Wohlstandes <strong>oder</strong> Kriegsrüstung zu wählen. Aber auch diese<br />
moralischen Entscheidungen stehen unter dem Kalkül der Effektivität: Erst kommt der<br />
Sieg im Spiel und dann die Moral, die dazu passt. Und mit dieser Einstellung verkünden<br />
Spieleprofis in den Spielezeitschriften: Die Gewinn bringende Strategie bei Civilization 1<br />
und 2 ist der Friede. 20 Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wäre sicher<br />
zufrieden damit, gäbe es nicht einen ganz üblen Pferdefuß: Man kann in einer der beiden<br />
zusätzlichen Missionen auch als Hitler die Welt erobern und sich nach getaner Arbeit mit<br />
grandiosen Attributen von seinem Volk feiern und bejubeln lassen. In der gleichen Mission<br />
ist es aber auch möglich, in die Rolle eines neutralen Staates zu schlüpfen und bereits im<br />
ersten Spielzug seinem eigenen Untergang mit Bomben und Granaten in Amsterdam<br />
entgegenzusehen. Sollte man ein solches Spiel indizieren, weil ein 16-jähriger<br />
möglicherweise Hitler spielen möchte, weil er nur mit dieser Moral die Mission erfolgreich<br />
abschließen kann?<br />
4.3 Computerspiele und Jugendmedienschutz<br />
Wo also liegt das Problem des Jugendmedienschutzes, der Gefährdungseinschätzung<br />
und Indizierung von Computerspielen? Und wie könnte man es lösen? Die<br />
Wirkungsforschung kann zur Legitimierung der staatlichen Eingriffe wenig beitragen: Zu<br />
20 Bei intensiver Auseinandersetzung mit dem Spiel gilt dieser Satz nur mit erheblichen Einschränkungen.<br />
Ist man mit der „Friedensstrategie“ sehr erfolgreich, riskiert man Angriffe seiner aggressiven Gegner,<br />
sodass man schließlich doch zu virtueller <strong>Gewalt</strong> greifen muss.<br />
21
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
inkonsistent und relativierend präsentieren sich ihre Ergebnisse. Jugendliche nutzen die<br />
virtuellen Welten in ihrem Sinne, und sie können sehr wohl zwischen der virtuellen und<br />
der realen Welt unterscheiden. Vielleicht wenden sie sich der virtuellen Welt gerade<br />
deshalb zu, weil sie wissen, wie schmerzhaft die reale Welt in ihrer verdeckten<br />
<strong>Gewalt</strong>orientierung sein kann. Jugendliche haben ihre eigenen Bewertungsmuster für<br />
reale und für virtuelle <strong>Gewalt</strong>, solche, die ihrer Lebenssituation angemessen sind und die<br />
viel deutlicher als die der älteren Erwachsenen zwischen beiden Welten trennen.<br />
Während sie in Hinblick auf die reale Welt den moralischen Normen im Grundsatz nicht<br />
widersprechen, beharren sie darauf, dass sie sich im Computerspiel in einem wertfreien<br />
Raum befinden, der anderen Prinzipien als denen der realen Welt folgt. Insofern sehen<br />
sie diese Welt realistischer als viele Erwachsene. In der Tat: Die virtuelle Welt ist eine<br />
eigene Welt.<br />
Wenn es so ist, und die Entwicklungslinien dieser virtuellen Welten machen es nach<br />
jedem Innovationssprung deutlicher, dann müssen die Menschen, die diese Welten<br />
schaffen, auch die Normen festlegen, die in diesen Welten Gültigkeit haben sollen. In<br />
dieser Festlegung unterliegen die „Spielmacher“ dem demokratischen Grundkonsens<br />
ebenso wie Jugendschützer. Diese urteilen „nach moralischen Kriterien, und das muss so<br />
sein. Wichtig ist allerdings, dass nicht persönliche Grundhaltungen zum Maß der<br />
Beurteilung werden, sondern dass man sich auf die Werte bezieht, die das Grundgesetz<br />
als Konsens vorgibt.“ 21 Empathie als die grundlegende emotionale Fähigkeit für<br />
moralische Entscheidungen kann ein „Grenzpfeiler“ sein für das Maß an <strong>Gewalt</strong>, das<br />
Kindern und Jugendlichen in der virtuellen Welt zugemutet werden darf. Wie könnte das in<br />
Hinblick auf eine Indizierung möglicherweise aussehen?<br />
• Brutale, ungehemmte, menschenverachtende und -vernichtende <strong>Gewalt</strong> als einzig<br />
mögliche Spielhandlung überschreitet eindeutig die Grenze dessen, was Kindern und<br />
Jugendlichen zugemutet werden darf – unabhängig davon, ob eine solche<br />
<strong>Gewalt</strong>darstellung schädigende Wirkungen hat <strong>oder</strong> sozialethisch desorientierend<br />
wirken kann. Dies gilt insbesondere, wenn die <strong>Gewalt</strong>handlungen des Spielers aus der<br />
Perspektive der subjektiven Kamera erfolgen und Waffengebrauch jeglicher Art<br />
einschließen. 22 Eine solche virtuelle Welt stünde in eklatantem Widerspruch zu<br />
empathischen <strong>oder</strong> Empathie zulassenden Einstellungen.<br />
21 Gottberg, Joachim v. (1992): Moral <strong>oder</strong> Wirkung: Wonach urteilen die Jugendschützer, Film & Fakten 18,<br />
S. 19.<br />
22 In dieser Hinsicht sind vor allem die neueren Maze-Shooter problematisch, die ungehemmten<br />
Waffengebrauch in 3D-Labyrinthen als wesentliche Spielhandlung realisieren, so z. B. Duke Nukem 3 D.<br />
22
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
• Eine Spieloberfläche, gekennzeichnet von Rassen diskriminierender <strong>oder</strong> Frauen<br />
verachtender Ideologie verschärft die Tendenz der Computerspiele, die Empathie der<br />
Spieler zu vermindern, so erheblich, dass ein unüberbrückbarer Widerspruch zu<br />
wichtigen moralischen Werten unserer Gesellschaft entsteht.<br />
• Schwieriger wird die Entscheidung bei Spielen, die sich dem Thema Krieg zuwenden.<br />
<strong>Virtuelle</strong> Kriege zu führen hat naturgemäß wenig mit Empathie zu tun. Der Blick vom<br />
Feldherrenhügel, auf die strategische Karte <strong>oder</strong> aus dem Cockpit eines<br />
Kampfflugzeugs erfasst nicht das menschliche Leid, das in der realen Welt mit Krieg<br />
verbunden ist. Wird durch die eingegrenzte Perspektive der virtuelle Krieg bereits<br />
verharmlost <strong>oder</strong> verherrlicht? Werden virtuelle Kriege problematischer, je näher sie an<br />
reale Ereignisse der jüngsten Vergangenheit rücken und daher als Simulation einer<br />
historischen Gegebenheit erscheinen können? Um ein Nein zu Kriegsspielen moralisch<br />
zu rechtfertigen, müssen die Kriegshandlungen auf der Spieloberfläche in einer<br />
speziellen Weise ideologisch <strong>oder</strong> emotional befrachtet sein, sodass sich ein nicht zu<br />
übersehender Widerspruch zu empathischen Einstellungen auftut. Beispielsweise<br />
müsste der virtuelle Krieg, der sich durch entsprechende Spielhandlungen auch<br />
realisiert, als ein witziges Unternehmen erscheinen, bei dem man sich prächtig<br />
unterhalten kann. 23<br />
Das Problem ist nicht, dass <strong>Gewalt</strong> in der virtuellen Welt verharmlost <strong>oder</strong> verherrlicht<br />
werden könnte, sondern als das angemessene und notwendige Mittel erscheint, Macht<br />
und Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Dabei treten Erscheinungsformen von <strong>Gewalt</strong><br />
auf, die ästhetisch akzeptiert sind und die es nahe legen, sich von empathischen<br />
Gefühlen zu dispensieren. Dies liegt jedoch in der Struktur der Computerspiele begründet,<br />
die allesamt auf Macht, Kontrolle und Herrschaft ausgelegt sind und – in der realen Welt –<br />
ein möglichst breites Publikum zu finden.<br />
Gleichwohl sollten Normen formuliert und durchgesetzt werden, die im Umgang mit<br />
virtuellen Welten deutliche Grenzen markieren. Spieloberflächen, die in eklatantem<br />
Widerspruch stehen zu empathischem Verhalten, setzen Sozialisationsimpulse, die unter<br />
moralischen Gesichtspunkten nicht zu billigen sind. Die Notwendigkeit, deutlicher als<br />
bisher die Normen- und Wertefrage bei virtuellen Welten zu stellen, erwächst auch aus<br />
der ungebremsten Weiterentwicklung dieser Welten und ihrer zunehmenden Nutzung<br />
durch Kinder, Jugendliche und Erwachsene.<br />
4.4 Künftige Herausforderungen<br />
Drei Tendenzen kennzeichnen die gegenwärtige Entwicklung der Computerspiele:<br />
23 Ein solches Spiel ist das von der BPjS indizierte Cannonfodder; vgl. Fehr, Wolfgang & Fritz, Jürgen:<br />
Computerspiele auf dem Prüfstand; Comic im Computerspiel, Nr. 32/94, Bundeszentrale für politische<br />
Bildung, Bonn, 1994.<br />
23
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
• Integration virtueller Welten in die medialen Welten von Film und Fernsehen;<br />
• Ausweitung der Interaktion innerhalb virtueller Welten durch zunehmende Vernetzung;<br />
• Erhöhung der Intensität des Spielerlebens durch neue Schnittstellen (Interfaces) wie<br />
Mounted-Displays (Datensichthelme) und Datenhandschuhe. 24<br />
Das Ineinandergreifen dieser drei Entwicklungen verschärft die Problematik von <strong>Gewalt</strong>,<br />
Aggression und Krieg in virtuellen Welten. Durch die Verschränkung virtueller<br />
Spielhandlungen mit medialen Inhalten, die zudem wie bei einem Adventure ineinander<br />
gefügt sind, kann der Spieler, so z. B. beim Spiel Vollgas, auf verschiedenen Ebenen<br />
Beziehungen zum Geschehen herstellen. Er hat zunächst ein filmisches Geschehen vor<br />
sich, auf das er keine Einwirkungsmöglichkeiten hat und das die <strong>Gewalt</strong>thematik nach<br />
dem Muster eines Spielfilms präsentiert. Der Adventure-Teil ermöglicht es dem Spieler,<br />
<strong>Gewalt</strong>handlungen durch Befehle an seine Spielfigur mittelbar auszulösen und deren<br />
Wirkungen an seiner Spielfigur und an der Spielumgebung zu verfolgen. Im Action-Teil<br />
schließlich übernimmt der Spieler die unmittelbare Kontrolle über seine Spielfigur und führt<br />
mit ihr direkt die aggressiven Handlungen aus. Im Erleben des Spielers verschmelzen<br />
diese drei Ebenen zu einem gewaltorientierten Gesamtgeschehen. Die Integration der<br />
Elemente bewirkt, dass der Spieler aggressive Spielhandlungen zeigen muss, um das<br />
filmische Geschehen voranzubringen. Um weiterzukommen muss er beispielsweise den<br />
Wirt recht rüde an seinen Nasenring fassen und mit einem Ruck seinen Kopf auf die<br />
Theke schlagen. Das bei einem Spielfilm an dieser Stelle noch mögliche Mitgefühl, wäre<br />
hier völlig dysfunktional und weicht daher dem guten Gefühl, Erfolg gehabt zu haben, im<br />
Spiel vorangekommen zu sein.<br />
Welche emotionalen und sozialen Wirkungen aggressive Spielhandlungen auf die<br />
miteinander vernetzten Spieler haben können, wird Gegenstand weiterer Forschungen<br />
sein. Nach den bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen steigert sich in der Regel<br />
die Faszinationskraft des Spiels. Der menschliche Gegner ist allemal reizvoller als der<br />
Computer. Das liegt daran, dass Menschen lernfähig sind und überraschender und<br />
durchdachter handeln können als Computer. Die Emotionen der am Spiel beteiligten<br />
Menschen haben nur einen nachgeordneten Stellenwert. Es gilt, das Spiel zu gewinnen,<br />
und dazu sind Reaktionsschnelligkeit und taktisch-strategisches Geschick vonnöten.<br />
24 Vgl. Fritz, Jürgen (2002): Aktion, Kognition, Narration. Der Versuch einer Systematisierung der<br />
Computerspiele in praktischer Hinsicht; auf dieser CD.<br />
24
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich, wie bei Warcraft 2, die Spieler während<br />
des Spielverlaufs Botschaften über den Computer schicken können.<br />
Die Intensivierung des gefühlsmäßigen Erlebens durch die neuen Interfaces verstärkt die<br />
Orientierung an Regeln der virtuellen Welt und vermindert die empathischen Fähigkeiten.<br />
Alle Gedanken, alle Aufmerksamkeit, alles Handeln ist darauf gerichtet, in der virtuellen<br />
Welt zu bestehen. Ablenkungsmöglichkeiten werden weit gehender als bisher<br />
ausgeschlossen. Auch das gemeinsame Zusammenspiel am Bildschirm, das häufig ein<br />
menschliches Miteinander beim Bewältigen der Probleme sein kann, gehört bei<br />
Benutzung eines Datenhelms der Vergangenheit an.<br />
4.5 Möglichkeiten der politischen Einflussnahme<br />
Die Möglichkeiten des Staates gegenüber dieser Entwicklung sind begrenzt. Der Rekurs<br />
auf Werte und Normen, sofern er sich auf Altersfreigaben und Indizierungen begrenzt, ist<br />
der Versuch, Grenzpfähle gegen das Maßlose zu setzen. Allzu leicht könnte sich die<br />
Problematik der <strong>Gewalt</strong> in der virtuellen Welt auf die Frage verkürzen, wie weit die<br />
Hersteller gehen dürfen, um nicht zu weit gegangen zu sein – in Verfolgung ihres<br />
Wunsches, auf einem heiß umkämpften, milliardenschweren Markt ansehnliche Profite zu<br />
machen. Denn allzu deutlich spiegelt sich in den gewaltorientierten Spielhandlungen die<br />
Aggressivität des Software-Marktes wieder, eines Marktes, auf dem Verkaufsschlachten<br />
sicher nicht mit Empathie gewonnen werden.<br />
Der Rekurs auf Normen und Werte müsste zur Verpflichtung werden, Computerspiele zu<br />
entwickeln, die dem Gebot nach Empathie entsprechen und ihm nicht diametral<br />
entgegenstehen. Der österreichische Weg einer „positiven Prädikatisierung“ der<br />
Computerspiele wäre auch für Deutschland ein gangbarer Weg. Was spräche dagegen,<br />
wenn die Politik Preise für solche virtuelle Welten vergeben würde, in denen Aufenthalte<br />
von Kindern wünschenswert sind? Die technischen Möglichkeiten, Spiele dieser Art<br />
herzustellen sind vorhanden. Es ist durchaus möglich, grafisch ansprechende<br />
Spieloberflächen herzustellen, die die Spieler vor die Aufgabe stellen, nicht nur durch<br />
Denkvermögen, Findigkeit und Einfallsreichtum, sondern auch durch Empathie und<br />
Kooperation Spielziele zu erreichen. Anstatt alle Fähigkeiten einzuspannen, um die<br />
Erlebnisdichte unter jedem Preis, auch dem der ungebrochenen <strong>Gewalt</strong>, zu steigern,<br />
25
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
bietet die fortgeschrittene Computertechnik auch die Möglichkeit, virtuelle Welten zur<br />
Bildung von Toleranz, Verständnis und Verminderung von <strong>Gewalt</strong> zu entwickeln.<br />
Entscheidend aber wird etwas anderes sein: die Einbettung der virtuellen Welt in einen<br />
angemessenen sozialen Kontext. Gemeint damit ist das gemeinsame Spiel, das<br />
Gespräch über die Spielerfahrungen und Spielinteressen, die Erörterungen über den Wert<br />
bestimmter Spiele. Im Kontext der virtuellen Welt, in der Realität unseres alltäglichen<br />
Lebens in Familie und Freundeskreis, müsste Raum für Empathie geschaffen werden:<br />
gegenüber anderen Vorstellungen, unterschiedlichen Meinungen, einander<br />
widerstrebenden Wertvorstellungen. Denn der Rekurs auf Werte und Normen setzt genau<br />
dies voraus.<br />
Etwas Vergleichbares gilt auch im Hinblick auf die Medienpädagogik in Jugendarbeit und<br />
Schule. Die Problematik der <strong>Gewalt</strong> in der virtuellen Welt ist eine Herausforderung, die<br />
Pädagogen mit Einfallsreichtum, Kompetenz und Empathie für die Interessen, Wünsche<br />
und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen annehmen sollten. 1.Seite Index 1<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung<br />
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des<br />
Rechteinhabers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in<br />
elektronischen Systemen.<br />
26