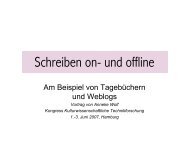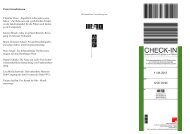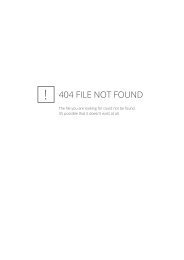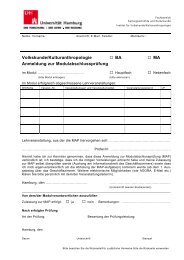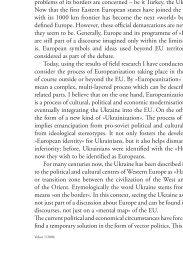Abschlussbericht - kultur.uni-hamburg.de - Universität Hamburg
Abschlussbericht - kultur.uni-hamburg.de - Universität Hamburg
Abschlussbericht - kultur.uni-hamburg.de - Universität Hamburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
Projekt:<br />
Verbraucher und Konsum(kontroll)technologien - Nutzereinstellungen, Wissen<br />
und Technikaneignung (2008-2010)<br />
Autor: Dr. Nils Zurawski,<br />
Institut für Volkskun<strong>de</strong>/Kulturanthropologie<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Hamburg</strong><br />
Februar 2011<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
1
Allgemeine Angaben<br />
Antragsteller: Prof. Dr. Thomas Hengartner & Dr. Klaus Schönberger<br />
Bearbeiter: Dr. Nils Zurawski<br />
Institut/Lehrstuhl: Institut für Volkskun<strong>de</strong>/ Kulturanthropologie<br />
Thema <strong>de</strong>s Projekts: Verbraucher und Konsum(kontroll)technologien - Nutzereinstellungen, Wissen und<br />
Technikaneignung<br />
Berichtszeitraum, För<strong>de</strong>rungszeitraum insgesamt: April 2008 - März 2010<br />
Liste <strong>de</strong>r wichtigsten Publikationen aus diesem Projekt<br />
Zurawski; Nils (2011): Local practice and global data. Loyalty cards, social practices and consumer<br />
surveillance, in: Sociological Quarterly, (im Erscheinen).<br />
Zurawski; Nils (2011): "Budni ist doch Ehrensache". Kun<strong>de</strong>nkarten als Kontrollinstrument und die<br />
Alltäglichkeit <strong>de</strong>s Einkaufens, in Zurawski, Nils (Hg.), in -> siehe nächster Titel.<br />
Zurawski, Nils (Hg. 2011) „Überwachungspraxen – Praktiken <strong>de</strong>r Überwachung. Analysen zum<br />
Verhältnis von Alltag, Technik und Kontrolle. Opla<strong>de</strong>n, 2011 (Budrich UniPress).<br />
Zurawski; Nils (2011): Kontrolltechnologien, in: Thomas Hengartner: Kulturwissenschaftliche<br />
Technikforschung, (im Erscheinen 2011).<br />
Zurawski; Nils (2011): Verbraucher und Konsum(kontroll)technologie - Nutzereinstellungen,<br />
Wissen und Technikaneignung, in: Thomas Hengartner: Kulturwissenschaftliche<br />
Technikforschung, (im Erscheinen 2011).<br />
Working paper<br />
Zurawski; Nils (2010): Loyalty Cards, Shopping Practices, Consumer Surveillance and issues of<br />
Data Protection, -> erhältlich online: http://www.<strong>kultur</strong>.<strong>uni</strong>-<strong>hamburg</strong>.<strong>de</strong>/technikforschung/<br />
konsum/HE2998_6-1_workingpaper_1.pdf<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
Vorträge zum Thema Kun<strong>de</strong>nkarten auf folgen<strong>de</strong>n Konferenzen und auf Einladung (alle N. Zurawski):<br />
• Society for the Social Studies of Science (4S), Vancouver, 1-5. Nov. 2006.<br />
• ISA Forum, Barcelona, 5-8. Sept. 2008.<br />
• Prosumer revisited. Zur Aktualität <strong>de</strong>r Prosumer Debatte, 26/27. März 2009, <strong>Universität</strong><br />
Frankfurt.<br />
• Kultur-Technik-Überwachung, Tagung am Institut für Volkskun<strong>de</strong>, Uni <strong>Hamburg</strong>, 9/10. Okt.<br />
2009 (wur<strong>de</strong> vom Projekt organisiert).<br />
• Vortrag am Institut für Technikgeschichte <strong>de</strong>r TU München, 13. Jan. 2010. (Einladung).<br />
• Surveillance Studies Network /LiSS conference, London 9-13. April 2010.<br />
• ISA World Congress, Göteborg, 11-17. Juli 2010.<br />
2
2. Zusammenfassung<br />
Ausgehend von <strong>de</strong>r Annahme, dass die weit verbreiteten, zumeist als „Kun<strong>de</strong>n- o<strong>de</strong>r Bonuskarten“<br />
bezeichneten Kun<strong>de</strong>nbindungssysteme, <strong>de</strong>r Überwachung und Kontrolle von Konsumenten dienen, stand<br />
in diesem Forschungsprojekt <strong>de</strong>r Umgang mit <strong>de</strong>n Karten selbst im Mittelpunkt. Kritik an diesen als<br />
Kontrolltechnologien zu bezeichnen<strong>de</strong>n Artefakten wur<strong>de</strong> und wird zumeist von Daten- und<br />
Konsumentenschützern geäußert, die dabei verschie<strong>de</strong>ne Dimensionen von Technik unberücksichtigt<br />
lassen und sich allein auf eher ökonomistische Kosten-Nutzen bzw. rechtliche Argumente konzentrieren.<br />
Ziel <strong>de</strong>s Projektes war daher die Technik (Kun<strong>de</strong>nkarten) sowie <strong>de</strong>n sie bestimmen<strong>de</strong>n Kontext<br />
(Einkaufen/Shopping) zu untersuchen, um die Sichtweise und Argumente <strong>de</strong>r Konsumenten<br />
nachvollziehbar zu machen, die letztendlich mit dieser Technik umgehen, diese neu interpretieren o<strong>de</strong>r<br />
verwerfen. Theoretisch wur<strong>de</strong> davon ausgegangen, dass es sich dabei um eine in Alltagspraxen integrierte<br />
Technik han<strong>de</strong>lt, die <strong>de</strong>shalb im Rahmen zumeist unreflektierter Handlungen angewen<strong>de</strong>t wird. Ziel <strong>de</strong>r<br />
multi-methodischen Studie - Ethnographie von Einkaufsorten, qualitative Interviews, (Diskurs-)Analyse<br />
von Werbung - war es, die tieferen Sinnzusammenhängen dieser Handlungen und Erzählungen zu<br />
rekonstruieren.<br />
Die wichtigsten Ergebnisse <strong>de</strong>r qualitativen Studie dabei waren:<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
- Kun<strong>de</strong>nkarten sind eine ambivalente Technik, die fest als Teil <strong>de</strong>r Alltagspraktik Einkaufen angesehen<br />
wer<strong>de</strong>n kann.<br />
- Der soziale und <strong>kultur</strong>elle Kontext von Kun<strong>de</strong>nkarten ist vielseitig und bisher wenig beachtet wor<strong>de</strong>n.<br />
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit <strong>de</strong>m Thema beschränkt sich bislang entwe<strong>de</strong>r auf<br />
Marketing-Aspekte o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Daten- und Verbraucherschutz.<br />
- Einkaufen, Rabatte und damit verbun<strong>de</strong>ne <strong>kultur</strong>elle Praktiken sind ein wichtiger Aspekt <strong>de</strong>r<br />
Erforschung <strong>de</strong>s Nutzens, <strong>de</strong>r Gefahren o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Potentials von Kun<strong>de</strong>nkarten - Aspekte, die<br />
selten Eingang in ihre Kritik fin<strong>de</strong>n.<br />
- Begründungen <strong>de</strong>r Konsumenten für o<strong>de</strong>r wi<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Besitz von Kun<strong>de</strong>nkarten haben in <strong>de</strong>r Regel wenig<br />
mit <strong>de</strong>n Be<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r Daten- und Verbraucherschützer zu tun - weshalb eine Komm<strong>uni</strong>kation, die<br />
auf die Sicherheit o<strong>de</strong>r Effektivität <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nkarten setzt, ihr Ziel verfehlt.<br />
- Die Einbettung in die Alltagspraxis „Einkaufen“ macht es fast unmöglich, dass Warnungen und Kritik<br />
von Daten- und Verbraucherschützern bei <strong>de</strong>n Konsumenten ankommt - obwohl auf einer an<strong>de</strong>ren<br />
Ebene ein dafür sensibles Bewusstsein sehr wohl vorhan<strong>de</strong>n ist.<br />
- Kun<strong>de</strong>nkarten sind als Vehikel <strong>de</strong>r Forschung nützlich, um über sie an<strong>de</strong>re Phänomene wie Vertrauen,<br />
Loyalität, soziale Beziehungen, Alltagserzählungen und die unterschiedlichsten gesellschaftlichen<br />
Diskurse - z.B. Gen<strong>de</strong>r, Alter, Armut/Reichtum, Umweltbewusstsein - zu erörtern.<br />
- Hinsichtlich <strong>de</strong>s Themas Überwachung hat sich am Beispiel <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nkarten gezeigt, dass es sinnvoll<br />
ist zum einen <strong>de</strong>n Begriff genauer zu fassen, damit er analytisch scharf genug bleibt: im<br />
vorliegen<strong>de</strong>n Fall wäre dann viel eher von einem Monitoring o<strong>de</strong>r Profiling zu sprechen, welches<br />
Teilaspekte <strong>de</strong>s übergeordneten Diskurses Überwachung darstellen; zum an<strong>de</strong>ren hat sich<br />
herauskristallisiert, dass Überwachung nicht nur einfach „ist“, son<strong>de</strong>rn getan wer<strong>de</strong>n muss, also<br />
sich entwe<strong>de</strong>r in Praktiken ausdrückt, o<strong>de</strong>r an an<strong>de</strong>re Praktiken anschließen lässt. Im Fall <strong>de</strong>r<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten sind dieses alltägliche Einkaufspraxen, hinter <strong>de</strong>nen die ursächlichen Ziele <strong>de</strong>r<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten - das Sammeln von Konsumenten-Daten - ver<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n bzw. einfach nicht in<br />
<strong>de</strong>n Hintergrund treten.<br />
- Aufbauend auf <strong>de</strong>m gewählten Beispiel lässt sich ein allgemeiner analytischer Ansatz formulieren, <strong>de</strong>r<br />
Überwachung als soziale Praxis begreift und <strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>n Tätigkeiten, <strong>de</strong>n (alltags-)praktischen<br />
und <strong>kultur</strong>ellen Bedingungen für Phänomene fragt, die weit gefasst als Teil von Überwachungs-<br />
und Kontrollstrategien bezeichnet wer<strong>de</strong>n können.<br />
3
3. Arbeits- und Ergebnisbericht<br />
Ausgangsfragen und Zielsetzung <strong>de</strong>s Projekts<br />
Im Mittelpunkt <strong>de</strong>s Projekts stand das Phänomen Konsum als <strong>kultur</strong>elle Alltagspraxis im Allgemeinen<br />
sowie die historisch gewachsenen Muster und Alltagsformen, die eine solche <strong>kultur</strong>elle Praxis möglich<br />
machen, steuern und mit Erfahrungen und Hintergrundwissen versorgen. Dabei spielten auch das<br />
vorhan<strong>de</strong>ne Wissen um die hier als Technik bzw. Technologien zu bezeichne<strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>nkarten und die<br />
sie begleiten<strong>de</strong>n Diskurse eine zentrale Rolle. Es sollte grundsätzlich <strong>de</strong>r Frage nachgegangen wer<strong>de</strong>n,<br />
wie sich die zum Konsum erfor<strong>de</strong>rliche Technik angeeignet und in bestehen<strong>de</strong> Konsum- und<br />
Alltagsmuster eingebaut wird.<br />
Das Projekt beschäftigte sich mit <strong>de</strong>m Umgang mit Kun<strong>de</strong>nkarten als Kontrollinstrument <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ls<br />
und <strong>de</strong>r Frage, warum dieses trotz <strong>de</strong>s offensichtlichen Potentials (und <strong>de</strong>r tatsächlichen Praxis) Kun<strong>de</strong>n<br />
auszuspähen, so erfolgreich eingesetzt wird. Als Marketingstrategie sind solche Karten seit Jahrzehnten<br />
Teil einer Kultur <strong>de</strong>s Einkaufens und <strong>de</strong>r dort verhan<strong>de</strong>lten und angewandten Praktiken. An konkreter<br />
Forschung gibt es außer in <strong>de</strong>r betriebswirtschaftlichen Marketingliteratur nur wenige Arbeiten, in <strong>de</strong>nen<br />
zumeist die Technologie als ein Teil <strong>de</strong>r Ökonomie personenbezogener Daten aus soziologischer<br />
Perspektive untersucht wird. Für die hier vorliegen<strong>de</strong> Forschung ergaben sich aus <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Literatur und <strong>de</strong>m gewählten Ansatz mehrere Perspektiven, <strong>de</strong>nen in unterschiedlicher Gewichtung und<br />
mit beson<strong>de</strong>rem Interesse und Fragestellungen in <strong>de</strong>r geför<strong>de</strong>rten Projekt nachgegangen wur<strong>de</strong>:<br />
Datenschutz und Verbraucherrechte / Verbraucherkontrolle vs. Kun<strong>de</strong>nbindung<br />
Diskussionen zu Kun<strong>de</strong>nkarten und ihren kontrollieren<strong>de</strong>n Effekten fin<strong>de</strong>n zu einem überwiegen<strong>de</strong>n Teil<br />
unter <strong>de</strong>m Thema Daten- und Verbraucherschutz statt und beschreiben letztlich eine juristische<br />
Diskussion, die an die bürgerrechtliche Selbstbestimmung von Persönlichkeitsdaten anschließt und Teil<br />
einer weiter gefassten Debatte zu Informationsgesellschaft und Schutz <strong>de</strong>r Privatsphäre ist.<br />
Eine solche Perspektive ist nicht interessiert an <strong>de</strong>n han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n Subjekten, an Technikverständnis und<br />
<strong>de</strong>m möglicherweise Sinn-stiften<strong>de</strong>n Potential <strong>de</strong>rartiger Praktiken, in <strong>de</strong>nen Kun<strong>de</strong>nkarten verortet<br />
wer<strong>de</strong>n können.<br />
Gleichwohl ist das Thema Datenschutz, das Wissen darum und <strong>de</strong>r Umgang mit Techniken, die eng mit<br />
<strong>de</strong>n Problemen von Persönlichkeitsrechten verbun<strong>de</strong>n sind interessant und hat einen Platz in <strong>de</strong>r<br />
Forschung - nur eben nicht unter rechtlichen Aspekten, son<strong>de</strong>rn als Ansatzpunkt für eine Diskussion über<br />
Wissen, Wi<strong>de</strong>rsprüche und Subjekthan<strong>de</strong>ln.<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten als technologische Praxis / als techno-soziales System <strong>de</strong>r Wirtschaft - surveillant<br />
assemblage<br />
Aus dieser Perspektive wird <strong>de</strong>r Rolle von Technologien <strong>de</strong>r Kontrolle nachgegangen. Kun<strong>de</strong>nkarten sind<br />
eine solche Kontroll-Technologie, dazu gedacht, auf die eine o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rer Weise menschliches Han<strong>de</strong>ln<br />
zu überwachen, welches so ebenfalls in <strong>de</strong>n Aufmerksamkeitsbereich rückt. Wenngleich kein zentrales<br />
Thema, so muss es hier im Sinne eines Objektes <strong>de</strong>r Überwachung und Kontrolle gesehen wer<strong>de</strong>n.<br />
Eine (maßgeblich soziologische) Analyse wür<strong>de</strong> die Konsequenzen von Technologien und ihrem Umgang<br />
für die Menschen, für soziales Han<strong>de</strong>ln sowie für die Macht- und Herrschaftsbeziehungen innerhalb einer<br />
Informationsökonomie persönlicher Daten im Blick haben.<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
4
Hinsichtlich <strong>de</strong>s Konsums wären hier vor allem das System <strong>de</strong>s Konsums als Vergesellschaftungsform<br />
interessant, welches auch für die hier vorgestellte Untersuchung <strong>de</strong>n soziologischen Hintergrund<br />
bereitstellt.<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten als soziale Praxis<br />
Diese Perspektive lenkt die Aufmerksamkeit auf die Praktiken, die die Kun<strong>de</strong>nkarten umgeben bzw. die<br />
über sie o<strong>de</strong>r von Ihnen ausgehend initiiert wer<strong>de</strong>n können. Sieht man Kun<strong>de</strong>nkarten als Teil einer Kultur<br />
<strong>de</strong>s Konsums o<strong>de</strong>r konkreter einer Einkaufspraxis an, dann ist <strong>de</strong>r Umgang mit dieser Technik/Praktik<br />
von großem Interesse. Denn es ist anzunehmen, dass <strong>de</strong>r Umgang mit und die Wahrnehmung von<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten möglicherweise an Einkaufspraktiken anschließen, die jenseits ökonomischer<br />
Rationalitäten liegen.<br />
Angesichts <strong>de</strong>r Datenschutzproblematik von Kun<strong>de</strong>nkarten und <strong>de</strong>n vielfältigen Möglichkeiten <strong>de</strong>r<br />
Überwachung und Kontrolle von Personen über persönliche Daten, sind sie ein überraschend<br />
erfolgreiches Mittel <strong>de</strong>s Marketing von Unternehmen. Dieser Erfolg muss daher auf einer<br />
Handlungsebene liegen, die nicht in rechtlichen o<strong>de</strong>r soziologischen Kategorien zu fassen, son<strong>de</strong>rn eng<br />
mit <strong>de</strong>n Praktiken <strong>de</strong>s Einkaufens verbun<strong>de</strong>n ist. In diesem Kontext spielen Datenschutz und <strong>de</strong>r<br />
Kontrolleffekt häufig ein ganz an<strong>de</strong>re Rolle bzw. wer<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rs bewertet und hergeleitet als dieses<br />
an<strong>de</strong>rswo (z.B. in Datenschutz-Diskursen) angenommen wird.<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten sind Teil einer sozialen und <strong>kultur</strong>ellen Praxis, <strong>de</strong>s Einkaufens/Shoppings, innerhalb <strong>de</strong>rer<br />
Datenschutz, rechtliche Aspekte persönlicher Daten sowie Praktiken <strong>de</strong>r Überwachung keine zentrale<br />
Rolle spielen. Kun<strong>de</strong>nkarten schließen innerhalb einer solchen socialen/<strong>kultur</strong>ellen Praxis an bereits<br />
etablierte Rabattsysteme und Gewohnheiten an, mithin an Diskurse um billiges Einkaufen, Schnäppchen,<br />
Gelegenheiten, cleveres Einkaufen u.a.. Darüber hinaus sind die Art und Weise <strong>de</strong>r unternehmerischen<br />
Diskurse anschlussfähig an Aspekte <strong>de</strong>s Einkaufens, die sie als soziale Praxis, als Schauplatz von<br />
Distinktionsgewinn und als Tauschplatz von Objekten, Be<strong>de</strong>utungen und Beziehungen nicht nur im<br />
ökonomischen Sinn ausweisen.<br />
Diesen Ausführungen folgend ergibt sich für eine Untersuchung <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utungen von Kun<strong>de</strong>nkarten,<br />
dass es die soziale und <strong>kultur</strong>elle Praxis <strong>de</strong>s Einkaufens ist, über welche <strong>de</strong>r Zugang zum Feld und damit<br />
zu <strong>de</strong>m Phänomen „Kun<strong>de</strong>nkarte“ erreicht wer<strong>de</strong>n kann. Insbeson<strong>de</strong>re auf <strong>de</strong>r dieser Perspektive lag <strong>de</strong>r<br />
Schwerpunkt <strong>de</strong>s Forschungsprojektes, was sich auch in <strong>de</strong>r Analyse und Bewertung wi<strong>de</strong>rspiegelt.<br />
Metho<strong>de</strong>n, Arbeit und Durchführung<br />
Die Studie stützt sich bei <strong>de</strong>r empirischen Erhebung auf folgen<strong>de</strong> qualitative Metho<strong>de</strong>n:<br />
- ethnographische orientierte Erkundungen <strong>de</strong>s Fel<strong>de</strong>s<br />
- qualitative Interviews<br />
- Protokollierungen <strong>de</strong>s Alltages ausgesuchter Untersuchungsteilnehmer<br />
- Experteninterviews<br />
- Analyse <strong>de</strong>s Werbematerials für Kun<strong>de</strong>nkarten<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
5
Die Fel<strong>de</strong>rkundungen, zu <strong>de</strong>nen wir einige Wochen lang gezielte und fokussierte Beobachtungen in<br />
Shopping Malls, Supermärkten und Einkaufsstraßen durchgeführt haben, dienten in erster Linie als<br />
Hintergrund für die Interviews. Bei <strong>de</strong>n Beobachtungen zeichneten sich bereits erste Hinweise darauf ab,<br />
dass Einkaufen weit mehr be<strong>de</strong>utet als bloße ökonomisch rationalen Grundsätzen folgen<strong>de</strong> Handlungen.<br />
Die Beobachtungen zielten <strong>de</strong>shalb auch nach ersten Reflexionen darauf ab die zeitlichen, räumlichen<br />
Bedingungen und Strukturen von „Einkaufen“ zu Erfassen. Ein weiterer Schwerpunkt <strong>de</strong>r Erkundungen<br />
lag auf <strong>de</strong>n möglichen beobachtbaren sozialen Beziehungen, die zumin<strong>de</strong>st anzunehmen<strong>de</strong>r Weise im<br />
Zusammenhang mit Einkaufspraxen stan<strong>de</strong>n.<br />
Der Hauptteil <strong>de</strong>r Studie besteht aus <strong>de</strong>n qualitativen Interviews und <strong>de</strong>n Protokollierungen, wobei vor<br />
allem mit letzteren interessante und tiefergehen<strong>de</strong> Fallstudien einzelner Konsumenten aufgezeichnet<br />
wer<strong>de</strong>n konnten. Der ursprüngliche Plan Einzelinterviews durchzuführen wur<strong>de</strong> nach ersten eigenen<br />
Überlegungen sowie einem Experiment im Forschungskolleg Kulturwissenschaftliche Technikforschung<br />
mit Kollegen zugunsten von Gruppeninterviews verworfen. Der Grund hierfür lag im Thema selbst und<br />
an <strong>de</strong>r Möglichkeit mit Gruppeninterviews intensivere und interaktive Gespräche zu generieren. Das<br />
vermeintlich „harmlose“ und alltägliche Thema „Einkaufen“ hat Wege eröffnet die<br />
Untersuchungsteilnehmer zu interessanten und dynamischen Diskussion über ihren Alltag und seinen in<br />
<strong>de</strong>n Erzählungen transportierten Deutungen zu animieren. Insgesamt wur<strong>de</strong>n 17 Interviews mit 50<br />
Teilnehmern durchgeführt, wobei die Anzahl <strong>de</strong>r Teilnehmer je Interview variierte. Auch wur<strong>de</strong>n einige<br />
Gesprächsrun<strong>de</strong>n speziell wegen beson<strong>de</strong>rer <strong>de</strong>mographischer (z.B. zwei Gruppen von Schülerinnen bzw.<br />
Schülern) o<strong>de</strong>r forschungspraktischer Grün<strong>de</strong> (die Interviews in einer Obdachlosentageseinrichtung)<br />
ausgewählt bzw. zusammengestellt. Grundsätzlich wur<strong>de</strong>n die Run<strong>de</strong>n aber entsprechend<br />
zeitökonomischer und terminlicher Grün<strong>de</strong> gebil<strong>de</strong>t.<br />
Einige <strong>de</strong>r 50 Teilnehmer wur<strong>de</strong>n gefragt, ob sie an einer weiteren Phase <strong>de</strong>r Studie mitarbeiten wollen.<br />
Mit 7 wur<strong>de</strong>n daher im Anschluss so genannte Alltagsprotokollierungen durchgeführt - mit weiteren 3<br />
kam <strong>de</strong>r Prozess nicht mehr zustan<strong>de</strong>. Die Teilnehmer wur<strong>de</strong>n gebeten über einen Zeitraum von zwei<br />
Wochen ihren Alltag bezüglich Einkaufen, Nutzung von Kun<strong>de</strong>nkarten sowie an<strong>de</strong>rer Techniken (Handy,<br />
Kreditkarten, Internet, EC-Karten) und hinsichtlich ihrer dabei gemachten sozialen Kontakte festzuhalten.<br />
Dafür gab es ein vorgegebenes Raster und Formular. Im Anschluss daran wur<strong>de</strong> ein weiteres<br />
Einzelinterview mit 6 von ihnen geführt. Das siebte Interview kam aufgrund persönlicher Grün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Teilnehmers lei<strong>de</strong>r nicht mehr zustan<strong>de</strong>. Die dadurch entstan<strong>de</strong>nen Einzelstudien haben sich als sehr<br />
wertvolle Vertiefung verschie<strong>de</strong>ner Thesen und Aspekte erwiesen, die sich in <strong>de</strong>n vorherigen<br />
Gruppeninterviews ange<strong>de</strong>utet haben, bzw. dort angerissen wur<strong>de</strong>n, aber nicht weiter ausgeführt wor<strong>de</strong>n<br />
sind. Unter an<strong>de</strong>ren hat sich hier wie<strong>de</strong>rholt die Wi<strong>de</strong>rsprüchlichkeit offenbart, die in Bezug auf das<br />
Thema Datenschutz und Kun<strong>de</strong>nkarten prägend ist und die eine für die hier gemachte und zukünftige<br />
Analysen zentrale Erkenntnis <strong>de</strong>r Untersuchung darstellt.<br />
Mit vier leiten<strong>de</strong>n Mitarbeitern von Unternehmen, wur<strong>de</strong>n Experteninterviews zum Thema<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten, Kun<strong>de</strong>nbindungssysteme und Marketing sowie Datenschutz und Kontrolle geführt. Diese<br />
Interviews dienten hauptsächlich dazu Hintergrundinformationen zum Vergleich für die Analyse <strong>de</strong>r<br />
Interviews zu generieren. An manchen Stellen bieten sich diese Interviews durchaus auch als zusätzliches<br />
Analysematerial an, da es interessante Bezüge zu Aussagen und Ergebnisse <strong>de</strong>r Auswertung <strong>de</strong>r<br />
qualitativen Interviews gibt.<br />
6
Die Analyse von Werbebroschüren und einiger Webseiten von Kun<strong>de</strong>nkartenanbietern war nicht<br />
ursprünglich geplant, hat sich aber als wertvolle Ergänzung im Rahmen <strong>de</strong>r Studie erwiesen. Die<br />
Broschüren fielen im Rahmen <strong>de</strong>r Fel<strong>de</strong>rkundungen quasi automatisch mit an, so dass ich, als die<br />
Sammlung eine kritische Größe überschritten hatte, gezielt und systematisch weiteres Material gesammelt<br />
habe. Die Beschäftigung mit <strong>de</strong>m Material bil<strong>de</strong>t einen wichtigen Aspekt <strong>de</strong>r Analyse, als dass sich<br />
interessante Parallelen zwischen <strong>de</strong>n Aussagen und Alltagserzählungen <strong>de</strong>r Studien-Teilnehmer und <strong>de</strong>n<br />
Botschaften <strong>de</strong>r Unternehmen ergaben. Außer auf die Botschaften wur<strong>de</strong> bei diesem Material auch auf<br />
<strong>de</strong>n Informationswert hinsichtlich Datenschutz bzw. die Qualität <strong>de</strong>r eingefor<strong>de</strong>rten Daten geschaut. Eine<br />
vollständige, eigene Analyse <strong>de</strong>s Materials steht noch aus - als Ergänzung und Hintergrund zu <strong>de</strong>n<br />
Analysen <strong>de</strong>r Interviews spielen sich jedoch auch jetzt schon eine Rolle.<br />
Kurzdarstellung <strong>de</strong>r Ergebnisse<br />
„Budni, eine Frage <strong>de</strong>r Ehre!“(Aussage eines Interviewpartners zu <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>nkarten <strong>de</strong>r<br />
Drogeriekette Bundikowsky in <strong>Hamburg</strong>)<br />
Das Hauptaugenmerk <strong>de</strong>r Studie lag, wie bereits ausgeführt auf <strong>de</strong>n narrativen Argumentationslinien<br />
hinsichtlich von Kun<strong>de</strong>nkarten als Teil einer Alltagspraxis <strong>de</strong>s Einkaufens. Um zu verstehen, welche<br />
Erzählungen möglich sind bzw. welche für <strong>de</strong>n Kontext relevant und bestimmend sind, war das Thema<br />
Einkaufen/Shopping in <strong>de</strong>n Interviews ein zentraler Aspekt, mit <strong>de</strong>m die offen gehaltenen, narrativen<br />
Interviews in <strong>de</strong>r Regel begonnen wur<strong>de</strong>n<br />
Einkaufen/ Shopping<br />
Erzählungen zum Einkaufen, mit <strong>de</strong>nen ein Licht auf die Praktiken <strong>de</strong>s Einkaufens/Shoppings geworfen<br />
wer<strong>de</strong>n kann, sind vielfältig. Auch Antworten auf einfache Fragen, wie „Erzählen sie von ihrem letzten<br />
Einkaufserlebnis“ o<strong>de</strong>r „Was war ihr bestes Schnäppchen“ (bei<strong>de</strong>s Einstiegsfragen für<br />
Gruppeninterviews) lösen häufig dichte, vielfältige und komplexe Antworten aus, in <strong>de</strong>nen<br />
unterschiedliche Aspekte <strong>de</strong>s Alltages in Bezug zum Einkaufen, aber vor allem im Bezug zum sonstigen<br />
sozialen, alltagspraktischen und <strong>kultur</strong>ellen Beziehungen zum Ausdruck gebracht wur<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n<br />
Erzählungen über Einkaufen wur<strong>de</strong> auch immer <strong>de</strong>r Alltag abseits <strong>de</strong>r eigentlichen Praktik verhan<strong>de</strong>lt, mit<br />
o<strong>de</strong>r neu erzählt. An zwei Beispielen soll exemplarisch diese Komplexität ver<strong>de</strong>utlicht wer<strong>de</strong>n.<br />
Transkript: Interview 8 - Person B - Zeile 103<br />
Für mich geht es gar nicht. Mit meinen Mann shoppen geht gar nicht. Was heißt shoppen mit meinen<br />
Mann, in ein Geschäft gehen geht gar nicht. (alle Frauen lachen) Und nur mal ganz kurz gucken geht<br />
gar nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass bei mir es einfach dann Vergnügen ist,<br />
zusammen mit Freundinnen zu gucken. Und ich will mal generell sagen, dass es selten, dass es etwas<br />
hoch-Notwendiges ist, was ich brauche. Ich mag auch nicht gerne Sachen zum Anziehen einkaufen,<br />
wenn ich es brauche. Weil es mich unter Druck setzt.<br />
Transkript: Interview 2 - Person B - Zeile 13<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
Ja ich hab, wann war das, ich glaube letzten Samstag hab ich mir zwei Bücher gekauft, unter an<strong>de</strong>rem<br />
eins war für ein Geburtstagsgeschenk. Und dann hab ich mir noch ein an<strong>de</strong>res gekauft, weil das also<br />
daneben stand und ich von <strong>de</strong>m gehört hab und das ist auch ganz gut gewesen muss ich sagen das hab<br />
ich jetzt schon durch. Und das war im Thalia-Buchhan<strong>de</strong>l Spitalerstraße. Da gibt es auch noch, kann<br />
7
ich nur weiter empfehlen, noch so ganz kleine Bücher von einem an<strong>de</strong>rn Autor, die für <strong>de</strong>n Welt-<br />
Buchtag, die kriegt man da nämlich umsonst. Muss man nur nachfragen. Das fand ich gut.<br />
In <strong>de</strong>r ersten Aussage wer<strong>de</strong>n zunächst Geschlechterrollen thematisiert - allein die lachen<strong>de</strong> Zustimmung<br />
<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Interviewpartnerinnen zeigt, dass hier ein bekanntes Thema benannt wird. Darüber hinaus<br />
kann Shoppen-gehen auch als soziale Beziehung verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, nämlich mit <strong>de</strong>n Freundinnen,<br />
welches gleichzeitig ein Vergnügen, somit angenehm und positiv aufgela<strong>de</strong>n ist. Gleichzeitig be<strong>de</strong>utet es<br />
eine Belastung, da bestimmte Tätigkeiten unter Druck setzen können. Außer<strong>de</strong>m wird eine qualitative<br />
Unterscheidung von Shopping und Einkaufen gemacht, die später auf die direkte Frage danach von vielen<br />
Personen ähnlich beantwortet wird - „... selten etwas Notwendiges, was ich brauche“.<br />
Im zweiten Beispiel geht es um ein Geburtstagsgeschenk, einen Einkauf für jeman<strong>de</strong>n. Dann wird von<br />
<strong>de</strong>n Leseerlebnissen in Ansätzen erzählt, von einem Ort, vom Weltbuchtag - alles Aussagen, die unter<br />
Erfahrung, aber auch unter Lernen fallen könnten, sowie von Rabatten („die kriegt man umsonst“). Der<br />
Akt <strong>de</strong>s Einkaufens selbst rückt in <strong>de</strong>n Hintergrund und ist in bei<strong>de</strong>n Fällen ein Vehikel für an<strong>de</strong>re<br />
Erzählungen. Letztlich ist <strong>de</strong>r Akt selbst immer kurz - wichtiger sind <strong>de</strong>shalb die Dinge die er auslöst, wie<br />
er kontextualisiert wird und welche narrativen Stränge hervorgebracht wer<strong>de</strong>n. Diese und weitere solcher<br />
narrativen Stränge lassen sich in vielen Aussagen so und ähnlich fin<strong>de</strong>n.<br />
Die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Frage, um die narrativen Figuren <strong>de</strong>s Shopping mit <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nkarten zu<br />
verbin<strong>de</strong>n ist, ob sich diese Narrative auch im Re<strong>de</strong>n über diese Technik und ihre Nutzung wie<strong>de</strong>rfin<strong>de</strong>n<br />
lassen.<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten<br />
In <strong>de</strong>r Analyse <strong>de</strong>r Aussagen zu Kun<strong>de</strong>nkarten <strong>de</strong>r 50 interviewten Personen haben sich verschie<strong>de</strong>ne<br />
Typen von Argumentationslinien/argumentativen Strängen herauskristallisiert, mit <strong>de</strong>nen man die<br />
Erzählungen über und von Kun<strong>de</strong>nkarten strukturieren und übergeordneten Narrativen zuordnen kann.<br />
Letzteres ist beson<strong>de</strong>rs von Interesse, wenn es darum geht, diese Aussagen und das Phänomen<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten an an<strong>de</strong>re Diskurse und theoretische Diskussionen anzuschließen (zu weiteren<br />
Forschungsperspektiven s.u.), die in <strong>de</strong>n Einkaufsnarrativen begrün<strong>de</strong>t sind, aber ebenso darüber hinaus<br />
gehen. Die i<strong>de</strong>ntifizierten Typen von Argumentationen für o<strong>de</strong>r wi<strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nkarten sind:<br />
- Rabatte: Hierunter fallen alle Argumente, die explizit die angebotenen Boni thematisieren o<strong>de</strong>r sich<br />
darauf beziehen - sowohl positiv als auch negativ. Die von <strong>de</strong>n Unternehmen beworbenen<br />
Qualitäten wer<strong>de</strong>n hier beson<strong>de</strong>rs von <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>n betont und stellen tatsächlich <strong>de</strong>n zentralen<br />
Anreiz dar. Die Erzählung ist eine <strong>de</strong>r prominenteren in <strong>de</strong>n Interviews.<br />
- Geschäft: Dieser Strang schließt an <strong>de</strong>n vorherigen an, stellt aber <strong>de</strong>n „lohnen<strong>de</strong>n“ rationalökonomischen<br />
Charakter noch weiter in <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rgrund, bis hin zu Aussagen, die beanspruchen<br />
mit Kun<strong>de</strong>nkarten „Geld zu verdienen“. Die Kun<strong>de</strong>nkarte wird über <strong>de</strong>n Rabatt hinaus zu einem<br />
ökonomischen Instrument. Wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Rabatt o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Bonus noch als Geschenk betrachtet, so<br />
fin<strong>de</strong>t hierin <strong>de</strong>ssen Kommodifizierung statt.<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
- Vertrauen: Das Verhältnis zu einem Unternehmen o<strong>de</strong>r zu Personen in <strong>de</strong>m Unternehmen wird betont<br />
und (zumeist) als positives Argument verwen<strong>de</strong>t. Vertrauen zu einem Unternehmen drückt sich<br />
aus in <strong>de</strong>n positiven Bil<strong>de</strong>rn, Einstellungen und Emotionen, die in Verbindung mit bestimmten<br />
Geschäften, Ketten o<strong>de</strong>r ganzen Unternehmen geäußert wer<strong>de</strong>n. Der Mangel an Misstrauen in<br />
puncto Datenschutz in Verbindung mit Kun<strong>de</strong>nkarten bzw. das scheinbar mangeln<strong>de</strong> Bewusstsein<br />
8
gegenüber <strong>de</strong>n Gefahren dieser Technologie beruht auch auf <strong>de</strong>m hierin ausgedrückten<br />
Vertrauensverhältnis, welches - so könnte man es annehmen - mit einer Kun<strong>de</strong>nkarte besiegelt<br />
wird. Dieser Strang beschreibt das zentrale Argument hinsichtlich Kun<strong>de</strong>nkarten und liefert einen<br />
Anhaltspunkt für die am Anfang geäußerte Komm<strong>uni</strong>kationsblocka<strong>de</strong> zwischen Daten-<br />
Verbraucherschützern und Konsumenten.<br />
- Kaufverhalten: Dieser Strang ist eng mit <strong>de</strong>m vorherigen verwoben und bezieht sich auf das ohnehin<br />
vorhan<strong>de</strong>ne Kaufverhalten als Argument. Es beinhaltet etwas rationales („bin ohnehin immer<br />
da“), aber beschreibt auch eine gewisse Nähe und ist eine Bedingung von Vertrauensbildung.<br />
Dieser Strang ist wichtig für die Bewertung von Kun<strong>de</strong>nkarten, da die meisten Interviewpartner<br />
angaben, dass sie Kun<strong>de</strong>nkarten hauptsächlich von solchen Unternehmen haben, die sie ohnehin<br />
oft und gewohnheitsmäßig - aus welchen Detailgrün<strong>de</strong>n auch immer - aufsuchen.<br />
- Verpflichtung: Äußerungen, die eine Verpflichtung o<strong>de</strong>r gar einen empfun<strong>de</strong>nen Zwang durch<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten hervor hoben, waren fast ausschließlich ablehnend. Damit wird auf eine Obligation<br />
durch die Karte verwiesen, die zwar für eine Benutzung <strong>de</strong>r Karte nicht Bedingung ist, aber als<br />
solche empfun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>. Positiv gewen<strong>de</strong>t könnte man davon sprechen, dass sich hieran die<br />
nicht-ökonomischen Qualitäten <strong>de</strong>r Karte zeigen, die nicht auf Rabatte o<strong>de</strong>r ein Geschäft<br />
verweisen, son<strong>de</strong>rn auf eine soziale Beziehung, wie sie sich beispielsweise in Tauschbeziehungen<br />
manifestieren. Dieser Strang ergänzt die Erzählungen um das Vertrauensverhältnis um eine<br />
weitere Qualität und ist wohl auch ein Grund dafür, warum Datenschutzbe<strong>de</strong>nken bei <strong>de</strong>n<br />
Konsumenten im Akt <strong>de</strong>s Kaufens allerhöchstens im Hintergrund eine Rolle spielen, wenn<br />
überhaupt.<br />
- Familie: Hier kommen Personen in <strong>de</strong>n Narrativ, die entwe<strong>de</strong>r weitere Nutznießer <strong>de</strong>r Boni sind,<br />
weitere Nutzer <strong>de</strong>r Karte (z.B. Familienmitglie<strong>de</strong>r auch ohne explizite Familienfunktion <strong>de</strong>r<br />
Karte) o<strong>de</strong>r die im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Nutzung stehen bzw. dabei eine Rolle spielen. Was<br />
hier zum Ausdruck kommt, sind die über <strong>de</strong>n Konsum (o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Akt <strong>de</strong>s Einkaufens) selbst<br />
hinausgehen<strong>de</strong> bzw. durch diesen vermittelte soziale Beziehungen. Einkaufen ist damit kein<br />
egoistischer Akt, son<strong>de</strong>rn oftmals auch auf an<strong>de</strong>re hin ausgerichtet. Konsum vermittelt soziale<br />
Beziehungen bzw. diese fin<strong>de</strong>n ihren Ausdruck zunehmend in Konsumpraxen. Daran<br />
anschließend ließe sich formulieren, dass soziale Beziehungen eine Form <strong>de</strong>s Konsums sind -<br />
wenn man davon ausgeht, dass eine Konsumgesellschaft alle Aspekte <strong>de</strong>s sozialen vereinnahmt<br />
und formt. Einkaufen als Feld sozialer Beziehungen schließt auch an an<strong>de</strong>re Forschungen und<br />
Erkenntnisse in diesem Bereich an.<br />
- Spaß: Begeisterung für die Karte o<strong>de</strong>r für das Einkaufen mit <strong>de</strong>r Karte, die Sammellei<strong>de</strong>nschaft o<strong>de</strong>r die<br />
Freu<strong>de</strong> über die Zuwendung, die einem durch die Karte zuteil wird versammelt dieser narrative<br />
Strang. Dieser ist eher ein Sub-Strang, da er eng mit <strong>de</strong>n Rabatten und ihrer positiven Bewertung<br />
zusammenhängt.<br />
- Datenschutz: Dieser für das Projekt wichtige Strang vereint Argumente <strong>de</strong>r Ablehnung wie auch <strong>de</strong>s<br />
Wissens um Datenschutzproblematiken hinsichtlich Kun<strong>de</strong>nkarten. Die Aussagen sind heterogen<br />
und müssten weiter unterteilt wer<strong>de</strong>n bzw. sind Hintergrund für an<strong>de</strong>re Narrative. Datenschutz ist<br />
ein zentrales Thema, zu <strong>de</strong>m die Interviewten eine vielfach informierte und differenzierte<br />
Meinung hatten. Im direkten Zusammenhang mit Kun<strong>de</strong>nkarten jedoch, wur<strong>de</strong>n diese Argumente<br />
nur wenig genannt. Zu <strong>de</strong>n Fragen zum Thema Datenschutz, die im Verlaufe <strong>de</strong>r Gespräche im<br />
Anschluss an das Schwerpunkt Kun<strong>de</strong>nkarten, wur<strong>de</strong> dann wie<strong>de</strong>r angeregt und informiert<br />
diskutiert. Das Thema ist also wichtig - nur nicht im direkten Zusammenhang von Kun<strong>de</strong>nkarten<br />
und <strong>de</strong>n sie umgeben<strong>de</strong>n Einkaufspraktiken.<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
9
- Ablehnung: Kein wirklich homogener Narrativ, eher eine Sammlung von Ablehnungsgrün<strong>de</strong>n, die<br />
überArgumente <strong>de</strong>s Datenschutzes o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Verpflichtung hisausgehen. Vielfach schien hier ein<br />
Desinteresse o<strong>de</strong>r eine insgesamt negative Einstellung zu Konsum o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r eigenen Lebenslage<br />
darin zum Ausdruck zu kommen.<br />
- Materialität: Verschie<strong>de</strong>ntlich wird die Karte selbst zum Thema gemacht, tritt also als materielles<br />
Artefakt in Erscheinung - diese Nennungen sind hierunter versammelt. Vor allem die Menge an<br />
Karten im Portemonnaie wird angeführt, weiterhin ihr Aussehen o<strong>de</strong>r einzelne Funktionen.<br />
Interessant ist, dass diese Argumente nur am Ran<strong>de</strong> vorkommen und Kun<strong>de</strong>nkarten damit eher zu<br />
einer Praktik, einer Verfahrensweise, einer <strong>de</strong>m Konsum inhärenten Qualität machen, <strong>de</strong>nn diese<br />
als Artefakte hervortreten lässt.<br />
Technik ist erstaunlicherweise kein eigener Narrativ. Aussagen zum Umgang mit <strong>de</strong>r Karte, sowie <strong>de</strong>n<br />
möglichen Schwierigkeiten, haben eher darauf hingewiesen, dass die Kun<strong>de</strong>nkarten nicht als Technik per<br />
se wahrgenommen wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn eher in <strong>de</strong>r Sphäre <strong>de</strong>s Einkaufens, <strong>de</strong>r Rabatte und als Technik im<br />
Sinne einer Fertigkeit o<strong>de</strong>r eines Han<strong>de</strong>lns gesehen wer<strong>de</strong>n. Das be<strong>de</strong>utet auch und bestätigt damit<br />
vorherige Annahmen <strong>de</strong>r <strong>kultur</strong>wissenschaftlichen Technikforschung, dass eine Forschung über Technik<br />
ihre Beschränkung nicht im Blick auf die Artefakte haben darf, son<strong>de</strong>rn diese als ein in die Praktiken<br />
verwobenen Aspekt sehen sollte.<br />
Eine Anmerkung zum Begriff <strong>de</strong>r Technik ist an dieser Stelle wichtig. Es war im Verlaufe <strong>de</strong>s<br />
Projektes nicht immer festgelegt, was unter Technik und was mit Technologie verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n soll.<br />
Vielfach wur<strong>de</strong> es synonym verwen<strong>de</strong>t, dann wie<strong>de</strong>r in Abgrenzung zueinan<strong>de</strong>r. Grob kann man sagen,<br />
dass Technik zunächst das einzelne technische Artefakt, als auch typische Ensembles und Aggregate von<br />
Artefakten einschließlich <strong>de</strong>r in Artefakten materialisierten Verfahrensweisen beschreibt. Der Begriff<br />
Technologie betont dann eher <strong>de</strong>n systematischen Charakter von Techniken, ihre Einbindung in größere<br />
Zusammenhänge als auch <strong>de</strong>n Korpus technischen Wissens und technischer Regelwerke. Der<br />
Aushandlungsprozess dieses Begriffes war ein elementarer Bestandteil <strong>de</strong>s Projektes, vor allem innerhalb<br />
<strong>de</strong>s Forschungskollegs Kulturwissenschaftliche Technikforschung. Für die Kun<strong>de</strong>nkarten als solche<br />
spielte es eine untergeordnete Rolle, da die Technik als solche in <strong>de</strong>r Studie nicht so in <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rgrund<br />
geriet, wie erwartet wur<strong>de</strong>. Insgesamt ist hier aber eher von einer Technik als von einer Technologie zu<br />
sprechen. Dem Problem wur<strong>de</strong> sich in einer <strong>de</strong>r Publikationen angenommen.<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
Mit <strong>de</strong>n hier heraus<strong>de</strong>stillierten Argumentationslinien können die Erzählungen über Kun<strong>de</strong>nkarten für die<br />
Analyse geordnet wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n Interviews wird nur selten ein einziger Strang allein verwen<strong>de</strong>t, son<strong>de</strong>rn<br />
eine Erzählung setzt sich zusammen aus verschie<strong>de</strong>nen dieser Motive. Dabei kommt es durchaus auch zu<br />
heftigen Wi<strong>de</strong>rsprüchen in <strong>de</strong>n Aussagen einzelner Personen im Verlauf <strong>de</strong>s Interviews - was um so<br />
interessanter ist, <strong>de</strong>nn daran lassen sich die Kontexte argumentativer Strategien nachvollziehen, die je<br />
nach praktischer Situation o<strong>de</strong>r Erzählkontext variieren. Die Vielschichtigkeit bezieht sich dabei durchaus<br />
auch auf die einzelnen Argumentationslinien selbst. So sind Aspekte <strong>de</strong>s Tausches (im Anschluss an<br />
Marcel Mauss), nicht nur von Gütern, son<strong>de</strong>rn von sozialen Beziehungen eng mit Kun<strong>de</strong>nkarten<br />
verbun<strong>de</strong>n, teilweise auf Ebenen, die weit über die eigentlichen Funktionen <strong>de</strong>r Karten hinausgehen.<br />
Vertrauen, Datenschutz und <strong>de</strong>r häufig geäußerte Wunsch nach Nähe („es ist wie ein Dorf hier“) lassen<br />
vermuten, dass <strong>de</strong>r scheinbar unmündige o<strong>de</strong>r sorglose Umgang mit <strong>de</strong>n Daten, die für das Monitoring<br />
<strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>naktivitäten nötig sind, nicht lax und unvorsichtig ist, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>m Verhältnis zwischen<br />
10
Tauschpartnern entspringt, <strong>de</strong>ren soziale und ökonomische Beziehung vielfältig ist und über <strong>de</strong>n<br />
geldvermittelten Warenkonsum hinausgeht.<br />
Kun<strong>de</strong>nkarten, so eine Folgerung aus <strong>de</strong>r Analyse, besiegeln ein bestehen<strong>de</strong>s Vertrauensverhältnis,<br />
welches für Einkaufspraktiken elementar wichtig ist. Sie sind Teil dieser Praktiken und schließen<br />
innerhalb dieser an bestimmte erlernte, gewohnte, tradierte und institutionalisierte soziale und <strong>kultur</strong>elle<br />
Praktiken an, die oftmals über das Einkaufen selbst hinausgehen.<br />
Weitere Aussagen zur <strong>kultur</strong>ellen und sozialen Einbettung von Kun<strong>de</strong>nkarten in eine Konsumpraktik und<br />
die Be<strong>de</strong>utung von dieser Praktiken für <strong>de</strong>n Umgang mit diesen Konsum(kontroll)technologien basieren<br />
alle auf <strong>de</strong>n gemachten Kategorien sowie ihrer Einbettung in weitergreifen<strong>de</strong> Diskurse <strong>de</strong>s Konsums, <strong>de</strong>r<br />
Konsumgesellschaft, einer Anthropologie <strong>de</strong>s Shopping, <strong>de</strong>r materiellen Kultur und <strong>de</strong>r Technik.<br />
Überwachung, so das entschei<strong>de</strong>ne Meta-Ergebnis dieser Studie, muss als soziale Praxis selbst o<strong>de</strong>r<br />
zumin<strong>de</strong>st als Teil von sozialen und <strong>kultur</strong>ellen Alltagspraktiken verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Ohne diese<br />
Wendung, bleiben viele Analysen, auch gera<strong>de</strong> solche, die sich auf in Überwachungsprozessen<br />
verwen<strong>de</strong>te Technologien fokussieren, beschränkt und laufen Gefahr primär Technik-<strong>de</strong>terministisch zu<br />
argumentieren. Dadurch wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Blick auf die ermächtigen<strong>de</strong>n Möglichkeiten von Technik und die<br />
damit verbun<strong>de</strong>nen o<strong>de</strong>r durch sie evozierten Handlungen entfallen. Mit <strong>de</strong>r Öffnung <strong>de</strong>r Analyse auf die<br />
praktischen Dimensionen von Überwachung - wobei <strong>de</strong>r Begriff selbst hier notwendigerweise unscharf<br />
bleiben muss - wird die Forschung zu diesem Thema <strong>de</strong>utlich erweitert und weggeführt von bisher<br />
dominanten Rechts- o<strong>de</strong>r Machtdiskursen, die zu viele blin<strong>de</strong> Flecken aufgewiesen haben. Insbeson<strong>de</strong>re<br />
kann mit dieser Perspektive <strong>de</strong>r Fokus auf die Alltäglichkeit <strong>de</strong>r Kontrolle gelenkt wer<strong>de</strong>n und in <strong>de</strong>r<br />
Erforschung auch genau dort ansetzen. Populäre Analyse von Kun<strong>de</strong>nkarten sehen <strong>de</strong>ren Erfolg bei <strong>de</strong>n<br />
Kun<strong>de</strong>n als das Aussetzen <strong>de</strong>r Vernunft angesichts von Schnäppchen. Dabei wird übersehen, dass ihre<br />
Nutzung zu allererst eingebettet in eine Alltagspraxis ist. Das schließt keineswegs ein kritisches o<strong>de</strong>r<br />
skeptisches Nach<strong>de</strong>nken über die Technologie selbst aus. An<strong>de</strong>rsherum wer<strong>de</strong>n durch die<br />
alltagspraktischen Verankerungen aufkommen<strong>de</strong> Wi<strong>de</strong>rsprüche zumin<strong>de</strong>st temporär ausgeblen<strong>de</strong>t. Die<br />
durchaus wichtigen Dimensionen von Datensammlungen als Teil eines kapitalistischen Konsum- und<br />
Verwertungssystems spielen in einer solchen Alltagspraxis nur eine ungeordnete Rolle. Nur wäre es naiv<br />
zu <strong>de</strong>nken, die bloße Warnung und die Ächtung <strong>de</strong>r Karten durch Verbraucherschützer könnte die<br />
gewünschte Aufklärung zum Thema Datenschutz bringen.<br />
Eine Kontrolle von Vorlieben, Verbraucherverhalten u.a. wie es mit Kun<strong>de</strong>nkarten möglich ist, ist in <strong>de</strong>m<br />
bekannten Ausmaß nur möglich, weil das Instrument <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nbindung in Form einer Technik in einer<br />
Alltagspraxis verankert ist, über die Alltag verhan<strong>de</strong>lt wird und die soziale Beziehungen symbolisiert,<br />
ganz und gar gewöhnlich ist und <strong>de</strong>shalb nur selten reflektiert wird. Kun<strong>de</strong>nkarten als Technik haben über<br />
das Einkaufen eine Veralltäglichung erfahren, mit <strong>de</strong>r sie zu einem unbemerkten Aspekt von<br />
Einkaufspraktiken wur<strong>de</strong>n. Gleichzeitig wer<strong>de</strong>n nun viele Aspekte <strong>de</strong>r Praxis über die Karte transportiert<br />
- z. B. Zugehörigkeit, Vertrauen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re soziale Beziehungen.<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
Eine Untersuchung <strong>de</strong>r Kontrolle bzw. <strong>de</strong>s Monitoring von Verbrauchern muss eine Analyse <strong>de</strong>r<br />
Konsumpraktiken, <strong>de</strong>r Alltäglichkeit <strong>de</strong>r Aktivität, die für die Praxis <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nkarten konstitutiv ist, mit<br />
einbeziehen. Es sind die vielen kleinen, fast unbemerkten Akte und die Vielzahl an Praktiken, die ein<br />
Verbraucher als Konsument vollzieht und die über <strong>de</strong>n Kauf eines Guts weit hinaus gehen. Darum gehen<br />
auch die Be<strong>de</strong>utungen <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nkarten weit über die Kun<strong>de</strong>nbindung und die mögliche Kontrolle von<br />
11
Verhalten hinaus. Kontrolle passiert in vielen Schritten, ständig, in Situationen und durch Beziehungen,<br />
die nicht außerhalb <strong>de</strong>s Alltages stehen, son<strong>de</strong>rn gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Alltag selbst sind. Konsumentenkontrolle<br />
über Kun<strong>de</strong>nkarten ist eine Form <strong>de</strong>s Monitoring, welches zugespitzt zum Konsum dazugehören kann,<br />
wenn man davon ausgeht, dass das Wissen, welches <strong>de</strong>r Kaufmann über seine Kun<strong>de</strong>n hat auch letzterem<br />
selbst zu gute kommt. Gera<strong>de</strong> die Alltäglichkeit macht also Kontrolle möglich und nachvollziehbar. Es<br />
han<strong>de</strong>lt sich nicht länger um ein unbekanntes und unüberschaubares Feld, son<strong>de</strong>rn kann auf konkrete<br />
Praktiken und Zusammenhänge zurückgeführt wer<strong>de</strong>n. Eine dringend nötige Ergänzung zur<br />
Untersuchung von Verbraucherkontrolle ist die Analyse von Praktiken. Das Monitoring <strong>de</strong>r Verbraucher<br />
soll dadurch nicht relativiert o<strong>de</strong>r verharmlost wer<strong>de</strong>n - im Gegenteil: es wird vielmehr gezeigt wo die<br />
Ansatzpunkte <strong>de</strong>r Kontrollmöglichkeiten liegen und legt die Praktiken, auf die Überwachung aufbauen<br />
kann, offen, Damit verliert eine Überwachungsgesellschaft ihre oft ausgerufene Bedrohlichkeit, die durch<br />
ihre Beschreibung als monströse und nicht fassbare Entwicklung ausgelöst wird.<br />
Kontrolle passiert. Und es lässt sich zeigen wo, wie, wann und warum. Sie ist kein abstraktes Phänomen<br />
und wird besser verstehbar, wenn man sich diese Mechanismen genauer anschaut. Und wenn man dann<br />
versteht, wieso Kun<strong>de</strong>nkarten auch etwas mit Ehre zu tun haben können, dann sind auch Schritte zur<br />
Aufklärung über die Konsequenzen von Datensammlungen besser planbar und verpuffen nicht im<br />
Niemandsland von Alltagspraktiken, die dafür keinen Raum bieten.<br />
Forschungs- und Arbeitsperspektiven<br />
Die Studie hat außer <strong>de</strong>n konkreten oben dargestellten Ergebnissen noch eine Reihe von Perspektiven<br />
eröffnet, <strong>de</strong>nen sich mit Hilfe <strong>de</strong>s Materials in Anschluss an die Projektzeit gewidmet wird. Die<br />
Umsetzung wird in Form von Publikationen geschehen, in <strong>de</strong>nen dann sowohl Einzelaspekte als auch<br />
diesen übergeordnete Diskussionen zu Punkten im Mittelpunkt stehen wer<strong>de</strong>n, die durch die Forschung<br />
an Relevanz gewonnen haben. Zu diesen neuen Perspektiven bzw. Forschungsthemen gehören u.a., aber<br />
nicht abschließend:<br />
- Kun<strong>de</strong>nkarten und die Funktionen <strong>de</strong>s (Gaben-)Tausches als Aspekt sozialer Beziehungen in<br />
Konsumgesellschaften.<br />
->An <strong>de</strong>r Publikation wird <strong>de</strong>rzeit gearbeitet<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
- Narrative <strong>de</strong>s Raums, <strong>de</strong>r Nähe, <strong>de</strong>s Vertrauens. Es hat sich gezeigt, dass die Verräumlichung von<br />
Einkaufen wichtig ist, wenn es darum geht, diesen Akt selbst als soziale Beziehung zu <strong>de</strong>finieren.<br />
Das „Dorf“, das „Lokale“ wur<strong>de</strong> immer wie<strong>de</strong>r hervorgehoben, wenn es um vertrauenswürdige<br />
Konsumbeziehungen zu Geschäften, sogar La<strong>de</strong>nketten ging. Die Verräumlichung und<br />
Lokalisierung <strong>de</strong>s Konsums einer globalen Konsumgesellschaft sind ein wichtiger Aspekt<br />
weiterer Analysen <strong>de</strong>s Materials und haben auch darüber hinaus Be<strong>de</strong>utung für die Diskussion.<br />
-> Eine Publikation ist in Planung.<br />
- Kritisches Marketing und Datenschutz. Eine kritische Beschäftigung von Marketing-Theorien im<br />
Zusammenhang mit Kun<strong>de</strong>nbindungssystemen gibt es bisher kaum, schon gar nicht in <strong>de</strong>r<br />
Disziplin selbst. Die vorhan<strong>de</strong>nen Analysen sind eher affirmativ. Die Studie bietet jedoch eine<br />
Reihe von Anschlusspunkten, um Marketingansätze kritisch zu betrachten, u.a. um zu zeigen<br />
wieso eine Datenschutzkritik so machtlos gegen die Logiken <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nbindungssysteme ist,<br />
warum eine Komm<strong>uni</strong>kation von Datenschutzanliegen mit Kun<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>m Feld <strong>de</strong>s Konsums so<br />
wenig erfolgreich ist. Dabei geht es nicht zu zeigen, wie Marketing besser wer<strong>de</strong>n kann, son<strong>de</strong>rn<br />
Möglichkeiten aufzuzeigen, diese Komm<strong>uni</strong>kation zu verbessern bzw. im Sinne <strong>de</strong>r<br />
12
Vertrauensbildung in die Kun<strong>de</strong>nbindungssysteme selbst einzubauen.<br />
-> Eine Publikation ist in Planung, ein Working Paper dazu existiert bereits.<br />
- ‚Überwachung als Konsum‘ unter <strong>de</strong>n Bedingungen einer Konsumgesellschaft, wie sie gegenwärtig die<br />
dominante Form gesellschaftlicher Integration und <strong>kultur</strong>ellen Ausdrucksformen darstellt. Hier<br />
sollen die Ergebnisse <strong>de</strong>r Studie in einen größeren <strong>kultur</strong>wissenschaftlichen sowie soziologischen<br />
Zusammenhang von Konsum, Gesellschaft, consumerism, und Alltagspraktiken unter <strong>de</strong>n<br />
Bedingungen kommodifizierter Strukturen von Alltag und Gesellschaft betrachtet wer<strong>de</strong>n.<br />
Zielsetzung ist es, Überwachung und Kontrolle als Bestandteil von Konsumgesellschaften zu<br />
analysieren, Bezug nehmend auf die Beobachtungen, dass die Maßnahmen <strong>de</strong>r Kontrolle darin<br />
immer weiter verschwin<strong>de</strong>n, sich auflösen o<strong>de</strong>r in die Logiken <strong>de</strong>s Konsums integrieren.<br />
-> Eine längere, grundsätzliche Publikation dazu (eine Monographie o<strong>de</strong>r längerer Essayband)<br />
ist in Planung. An dieses Thema lassen sich auf Überlegungen zu weiterer Forschung und damit<br />
neuen Forschungsanträgen knüpfen. Erste Überlegungen dazu gibt es bereits.<br />
Kooperationen, Aktivitäten<br />
Während <strong>de</strong>r Projektlaufzeit war die Studie Teil <strong>de</strong>s Forschungskollegs Kulturwissenschaftliche<br />
Technikforschung, geleitet von Prof. Dr. Hengartner, angesie<strong>de</strong>lt am Institut für Volkskun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Hamburg</strong>. Hier fand vor allem ein gedanklicher Austausch mit Kollegen/innen statt, <strong>de</strong>r in<br />
verschie<strong>de</strong>nen Aspekten auch fruchtbar für die Forschung war. Eine ausdauerner Austausch mit Prof. Dr.<br />
Thomas Hengartner (inzw. Uni Zürich) sowie mit PD. Dr. Klaus Schönberger (inzw. ZHdK Zürich) bleibt<br />
nach wie vor bestehen.<br />
Im Oktober 2009 wur<strong>de</strong> ausgehend vom Projekt eine Konferenz zum Thema „Praktiken <strong>de</strong>r<br />
Überwachung“ veranstaltet, an <strong>de</strong>r rund 50 Personen teilnahmen. Die <strong>Universität</strong> <strong>Hamburg</strong> hat die<br />
Konferenz unterstützt. Daraus ist ein Sammelband entstan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r einen <strong>de</strong>r zentralen Erkenntnispunkte<br />
<strong>de</strong>r Studie aufgegriffen hat: Überwachung als soziale Praxis.<br />
Im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Tagung fand vorher ein Arbeitstreffen <strong>de</strong>s EU-COST-Netzwerkes „Living in<br />
Surveillance Societies“ (LiSS) statt. Einige <strong>de</strong>r Teilnehmer blieben zu <strong>de</strong>r Tagung, so dass hier ein<br />
Austausch und die Möglichkeiten für weiter Kooperationen gegeben waren.<br />
International gab es keine formalen Kooperationen mit Kollegen/innen, jedoch stand dieses<br />
Forschungsprojekt über die Aktivitäten von Dr. Nils Zurawski im internationalen Surveillance Studies<br />
Netzwerk im steten wissenschaftlichen Austausch mit an<strong>de</strong>ren ähnlichen Projekten aus <strong>de</strong>m Bereich<br />
Konsum, Überwachung und anthropologischer Technikforschung.<br />
Die Teilnahme an diversen Konferenzen sowie Einladungen zu Vorträgen boten die Möglichkeit das<br />
Thema einem breiterem Kreis vorzustellen. Eine Verwertung <strong>de</strong>r Ergebnisse in <strong>de</strong>r Presse wird im<br />
Anschluss an die Publikation <strong>de</strong>s <strong>Abschlussbericht</strong>es sowie <strong>de</strong>s Sammelban<strong>de</strong>s geschehen, so dass auch<br />
eine interessierte Öffentlichkeit Zugang zu <strong>de</strong>n Ergebnissen haben wird. Angesichts <strong>de</strong>r Brisanz <strong>de</strong>s<br />
Themen Kun<strong>de</strong>nkarten, Datenschutz, Überwachungsgesellschaft usw. dürften die Ergebnisse dabei auf<br />
einiges Interesse stoßen.<br />
<strong>Abschlussbericht</strong>: HE 2998/6-1<br />
13