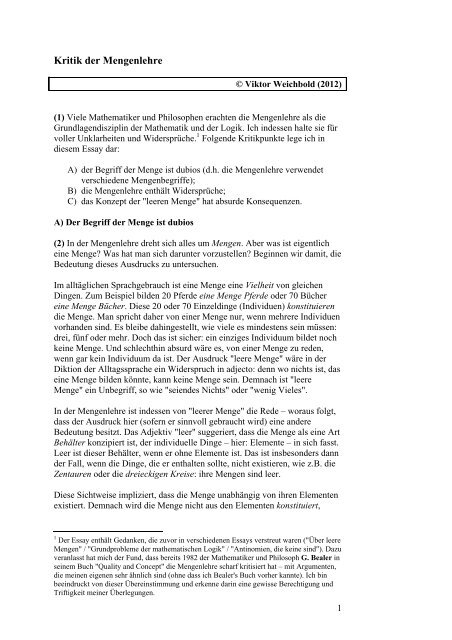Kritik der Mengenlehre - Viktor Wolfgang Weichbold
Kritik der Mengenlehre - Viktor Wolfgang Weichbold
Kritik der Mengenlehre - Viktor Wolfgang Weichbold
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
(4) Die Formulierung (a) führt also zu einem Wi<strong>der</strong>spruch, wenn <strong>der</strong>Mengenbegriff im mengentheoretischen Sinn aufgefasst wird. Lässt sich <strong>der</strong>Wi<strong>der</strong>spruch vermeiden, wenn "Menge" im alltagssprachlichen Sinninterpretiert wird? – Nein, denn dann ist es gar nicht möglich, von "leerenMengen" zu reden, wie wir oben gezeigt haben. Da dieser Ausdruck in <strong>der</strong>Diktion <strong>der</strong> Alltagssprache in sich wi<strong>der</strong>sprüchlich ist, wäre die Formulierung"zwei leere Mengen sind identisch" eine pure Absurdität.(5) Ein weiterer Wi<strong>der</strong>spruch, den die <strong>Mengenlehre</strong> in sich trägt, ist seit altersbekannt: er führt u.a. zur Antinomie <strong>der</strong> Allklasse. Diese lässt sich am Beispieldes Universums schön veranschaulichen:Das Universum ist die Gesamtheit aller Dinge: es enthält alles, was es gibt.Jedoch: das Universum ist selber in <strong>der</strong> Menge <strong>der</strong> Universen enthalten. Alsoenthält es nicht alles, was es gibt (denn es kann nicht sich selbst enthalten 3 ).Das Universum, das alles enthält – aber selber in <strong>der</strong> Menge <strong>der</strong> Universenenthalten ist: wie soll man sich das vorstellen? Wohl so, wie den Ort, auf dem<strong>der</strong> Hl. Christophorus einst stand, als er die ganze Welt trug.Es ist erstaunlich, dass die Mengentheoretiker auf diesen Wi<strong>der</strong>spruch nichtreagieren, indem sie das Konzept <strong>der</strong> Menge als verfehlt erkennen undverwerfen. Stattdessen erlassen sie – völlig willkürliche – Regelungen, damit<strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>spruch nicht in Erscheinung tritt. Darin gleichen sie schlechtenTheologen, die einen festbefohlenen Glauben retten wolle, indem sie dort, woProbleme auftreten, sich eine schönrednerische Diktion verordnen.(6) Apropos Glaube: auch bezüglich Gott erzeugt <strong>der</strong> mengentheoretischeMengenbegriff merkwürdige Konsequenzen. Gott gilt <strong>der</strong> Urgrund allerDinge, d.h. er ist <strong>der</strong> Grund dafür, dass die Welt existiert. Das gilt aber nichtfür die Menge <strong>der</strong> Götter: sie existiert unabhängig von ihm, denn sonst könntesie – im Falle seiner Nichtexistenz – nicht leer sein. Da die Göttermengeunabhängig von Gott existiert, folgt daraus, dass Gott nicht <strong>der</strong> Urgrund allerDinge ist.C) Das Konzept <strong>der</strong> leeren Menge hat absurde Konsequenzen(7) Wie oben gesagt: die Annahme, dass Mengen unabhängig von ihrenElementen bestehen (existieren), ist eine notwendige Voraussetzung, umsinnvoll von "leeren Mengen" reden zu können. Doch diese Annahmegeneriert eine Reihe von absurden Konsequenzen.Eine davon ist, dass unendlich viele leere Mengen existieren müssen – ja, dassdas Universum heillos überfüllt ist mit allen erdenklichen undunausdenklichen Mengen.3 Die geläufige Phrase "eine Menge enthält sich selbst (als Element)" ist irrational: wie kannein Behälter sich selbst enthalten? Wer so redet, missachtet elementare Rationalitätsanfor<strong>der</strong>ungenan die Sprache und kann ebenso gut behaupten, dass Münchhausen sich ameigenen Schopf aus dem Sumpf zieht, o<strong>der</strong> dass Gott die Ursache seiner selbst ist.3
Warum? Ursache ist, dass es kein Existenzkriterium für leere Mengen gibt. Dadie (mengentheoretischen) Mengen nicht aus ihren Elementen konstituiertwerden, son<strong>der</strong>n unabhängig von ihnen bestehen, bestehen automatisch füralle (möglichen und unmöglichen!) nicht-existenten Dinge leeren Mengen.Das heißt: es gibt zwar keine Einhörner, wohl aber die leere Menge <strong>der</strong>Einhörner. Gleichfalls existieren keine Zyklopen, Nymphen, Sirenen,Zentauren, Kobolde, usw., wohl aber ihre leeren Mengen. Selbiges gilt für alleerdenklichen Fiktionen: es gibt zwar keine Menschen mit zwei, drei, vier, etc.Köpfen, doch es gibt die leeren Mengen <strong>der</strong> solcherart Missgebildeten. Undebenso verhält es sich mit den unmöglichen Fiktionen: zwar gibt es keine drei-, vier-, fünfeckigen Kreise usw., jedoch die leere Menge dieser son<strong>der</strong>barenGebilde, usw.(8) Die Welt <strong>der</strong> <strong>Mengenlehre</strong> ist also vollgestopft mit Mengen. Dazu trägtauch bei, dass für sämtliche Zustände, Ereignisse, Befindlichkeiten, etc., dievon Dingen <strong>der</strong> Welt ausgesagt werden, die Behauptung <strong>der</strong> Existenz einerMenge erfor<strong>der</strong>lich ist. – Betrachten wir bspw. die folgenden Sätze:a) Peter ist Lehrerb) Peter ist müdec) Peter ist Bartträgerd) Peter ist in Gefahre) Peter ist in Italien.Wir erfassen intuitiv, dass in diesen Sätzen das Prädikat vom Subjekt (Peter)in unterschiedlicher Weise ausgesagt wird: Peter ist nicht in gleicher WeiseLehrer wie er müde ist; er ist nicht in gleicher Weise Bartträger wie er inGefahr ist; er ist nicht in gleicher Weise in Italien wie er müde ist, usw.Hierbei handelt es sich um die sog. Seinsanalogie (analogia entis): die Kopula"ist" hat verschiedene (analoge) Bedeutungen.Die Ontologie <strong>der</strong> Alltagssprache (und <strong>der</strong> wissenschaftlichen Sprache)begegnet dem Problem <strong>der</strong> Seinsanalogie u.a. mit <strong>der</strong> Kategorienlehre: mit <strong>der</strong>Lehre, dass das Sein auf verschiedene Weise ausgesagt wird. 4 Dadurch werdenontologische Strukturierungen vorgenommen, die es nicht nötig machen, dassfür alles, was ausgesagt wird, eigene Entitäten angenommen werden.Ganz an<strong>der</strong>s die Ontologie <strong>der</strong> <strong>Mengenlehre</strong>: sie kennt nur Dinge und Mengenund zwischen ihnen die – unverän<strong>der</strong>liche – Beziehung <strong>der</strong> Elementschaft.Dadurch kann sie kategoriale Differenzen (wie oben) nur durch dieZugehörigkeit zu unterschiedlichen Mengen ausdrücken:(a') Peter ist Element <strong>der</strong> Menge <strong>der</strong> Lehrer.(b') Peter ist Element <strong>der</strong> Menge <strong>der</strong>er, die müde sind.(c') Peter ist Element <strong>der</strong> Menge <strong>der</strong> Bartträger(d') Peter ist Element <strong>der</strong> Menge <strong>der</strong>er, die in Gefahr sind.(e') Peter ist Element <strong>der</strong> Menge <strong>der</strong>er, die in Italien sind.4 Mit "Sein" ist die Kopula gemeint, in ihren verschiedene Formen: ist, sind, hat, haben, etc.4
Was immer über Peter ausgesagt wird: es erfor<strong>der</strong>t die Behauptung <strong>der</strong>Existenz einer Menge: <strong>der</strong> Menge <strong>der</strong> Verheirateten, <strong>der</strong> Hungrigen, <strong>der</strong>Fahrradfahrer, <strong>der</strong> Hundeliebhaber, <strong>der</strong> Bankkunden, <strong>der</strong> Bücherleser, <strong>der</strong>ermit einem Loch im Strumpf, usw. usw. usw. Wie<strong>der</strong> kommt es zu einergeradezu tumorösen Überfüllung <strong>der</strong> Welt mit Mengen bzw. Entitäten.5