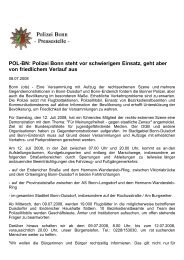Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
damit vollständig von der Entwicklung dieses<br />
Übertragungsweges abhängig. Mit fortschreiten-<br />
der Digitalisierung besteht daher die Notwen-<br />
digkeit, die lokalen Angebote ebenso wie die<br />
bundesweiten in analoger und digitaler Form<br />
im Kabel zu verbreiten. Die Umsetzung reali-<br />
sieren die Kabelnetzbetreiber nur zögerlich, da<br />
sie zumeist zentrale Aufbereitungszentren (Play-<br />
outs) für die neuen digitalen Angebote geschaf-<br />
fen haben und regionale Angebote nicht über<br />
Satellit verfügbar sind. Landesmedienanstal-<br />
ten und Netzbetreiber suchen gemeinsam nach<br />
technischen Lösungen, die angesichts der Tat-<br />
sache, dass es hier meist um sehr kleine Veran-<br />
stalter geht, auch wirtschaftlich realistisch sind.<br />
Bestimmt wird der Kabelmarkt derzeit<br />
durch drei große Unternehmen: Die in Baden-<br />
Württemberg tätige Kabel BW, die in Hessen<br />
und NRW tätige Unitymedia sowie die Kabel<br />
Deutschland (KDG). Kabel BW und Unitymedia<br />
haben zwischenzeitlich Ringnetze errichtet und<br />
verbreiten regionale und lokale Angebote auch<br />
digital. Ein Ringnetz ermöglicht den lokalen Ver-<br />
anstaltern, ihr Programm an einem beliebigen<br />
nahe gelegenen Einspeisepunkt zu übergeben,<br />
statt es direkt zum zentralen Play-out mittels<br />
teurer Zuführungsleitungen bringen zu müssen.<br />
Kabel Deutschland verfügt noch über kein<br />
Ringnetz und hat die geplante Errichtung zeit-<br />
lich verschoben. Zwar bietet die KDG eine Lö-<br />
sung für die digitale Einspeisung für lokale Pro-<br />
gramme vor Ort an, deren Kosten überschreiten<br />
aber die Möglichkeiten der meisten Lokalver-<br />
anstalter. Schwierigkeiten bereiten auch noch<br />
die programmbegleitenden Informationen (sog.<br />
SI-Daten), die beim digitalen Fernsehen für die<br />
richtige Darstellung und Auffi ndbarkeit des Pro-<br />
grammnamens sowie die Programminformati-<br />
onen im Navigator erforderlich sind. Gemein-<br />
sam mit den Kabelnetzbetreibern haben die<br />
Landesmedienanstalten nach Lösungen gesucht<br />
und getestet. Inzwischen werden die 16 bay-<br />
erischen Lokalprogramme digital in die KDG-<br />
Netze eingespeist.<br />
In Rheinland-Pfalz hat die Landeszentrale<br />
für Medien und Kommunikation (LMK) ein Pi-<br />
lotprojekt für die digitale Ver breitung lokaler<br />
TV-Programme in Kabelnetzen gestartet. Es zielt<br />
auf eine Optimierung der gesamten digitalen<br />
Übertragungsstrecke vom Studio bis zum Ka-<br />
belnetz ab. Dabei wird auch nach geeigneten<br />
Lösun gen für die Übertragung der programm-<br />
begleitenden Informationen und die damit<br />
verbun dene Darstellung in elektronischen Pro-<br />
grammführern (EPGs) gesucht.<br />
2.7 Digitale Dividende<br />
Als »digitale Dividende« wird der Teil des Fre-<br />
quenzspektrums bezeichnet, der dadurch frei<br />
wird, dass die bisher in analoger Technik ver-<br />
breiteten terrestrischen Fernsehprogramme nun<br />
digital übertragen werden. Einen Großteil dieser<br />
digitalen Dividende nutzt bereits das Fernsehen<br />
und hier insbesondere der öffentlich-rechtliche<br />
Rundfunk. Dieser übertrug früher über analoge<br />
terrestrische Sender fl ächendeckend drei Fern-<br />
sehprogramme. Seit Ende <strong>2008</strong> verbreiten ARD<br />
und ZDF in praktisch ganz Deutschland zwölf<br />
digitale Fernsehprogramme.<br />
Auch für private Anbieter sah die Planung<br />
Frequenzen zur fl ächendeckenden Verbreitung<br />
von zwölf Programmen vor. Die privaten Fern-<br />
sehveranstalter haben DVB-T-Netze jedoch nur<br />
in Ballungsräumen beauftragt. Im Jahr 2009<br />
wird der Aufbau von privaten DVB-T-Sendern in<br />
weiteren Ballungsräumen erwartet. Ein fl ächen-<br />
deckender Ausbau der privaten Netze ist jedoch<br />
aus wirtschaftlichen Gründen weder kurz- noch<br />
langfristig in Sicht.<br />
Die digitale Dividende hat jedoch auch<br />
Begehrlichkeiten bei Gruppen außerhalb der<br />
Rundfunkveranstalter geweckt. Insbesondere<br />
Mobilfunkunternehmen sehen in diesem Fre-<br />
quenzbereich die Möglichkeit, »Mobile Services«<br />
kostengünstig zu verbreiten. Der Empfang in<br />
Gebäuden ist in diesem Frequenzbereich deut-<br />
lich einfacher zu erreichen als bei den ande-<br />
ren vom Mobilfunk genutzten Frequenzen. Auf<br />
Druck von weltweit tätigen Mobilfunkunterneh-<br />
men hat die World Radio Conference (WRC 07)<br />
Ende 2007 entschieden, dass der obere Teil<br />
des Fernsehfrequenzbandes (K61–K69) zukünf-<br />
tig auch für »Mobile Services« genutzt werden<br />
darf. Das Bundeswirtschaftministerium möchte<br />
dies zügig umsetzen und hat deswegen im<br />
Jahr <strong>2008</strong> das Verfahren zur Änderung der Fre-<br />
quenzbereichszuweisungsplanverordnung (Freq-<br />
BZPV) in Gang gesetzt. Das Verfahren ist der -<br />
zeit noch nicht abgeschlossen. Rundfunkveran-<br />
stalter und Länder befürchten Störungen des<br />
Fernsehempfangs und sehen die Entwicklungs-<br />
möglichkeiten des Fernsehens gefährdet. Fern-<br />
sehproduzenten, Bühnen und Theater nutzen<br />
gegenwärtig sehr intensiv die Kanäle 61–69<br />
für drahtlose Mikrofonanlagen. Soll dieser Be-<br />
reich für Mobile Services genutzt werden, so<br />
müssen diese weichen und »umziehen«, was<br />
auch mit fi nanziellem Aufwand verbunden ist.<br />
Es zeichnet sich derzeit ab, dass eine ent-<br />
sprechende Änderung der FreqBZPV in Deutsch-<br />
land umgesetzt wird. Das bedeutet für die Fern-<br />
sehversorgung, dass die drei öffentlich-recht-<br />
lichen Multiplexe auch in Zukunft fl ächende-<br />
ckend empfangen werden können. Von den<br />
drei privaten Bedeckungen werden zwei von<br />
einer fl ächendeckenden Versorgung auf die<br />
Versorgung von etwa 80 Prozent der deutschen<br />
Bevölkerung reduziert. Die dritte private Bede-<br />
ckung steht dann nur noch in Ballungsräumen<br />
zur Verfügung. Da die privaten Netze derzeit<br />
nur Ballungsräume versorgen, wird dies am<br />
tatsächlichen Empfang auch der privaten Pro-<br />
gramme nichts Wesentliches ändern. Die Bede-<br />
ckung, welche für DVB-H eingeplant ist, bleibt<br />
in ihrer Flächendeckung unangetastet.<br />
Breitbandanschlüsse im ländlichen Raum ■<br />
Die Länder drängen darauf, dass die Mobile<br />
Services in den Kanälen 61–69 vordringlich<br />
für die Versorgung des ländlichen Raumes mit<br />
3 4 ALM <strong>Jahrbuch</strong> <strong>2008</strong> ALM <strong>Jahrbuch</strong> <strong>2008</strong> 35<br />
7 MHz<br />
5<br />
Abb.<br />
7<br />
8 MHz<br />
DAB/DMB 1<br />
u. DVB-T<br />
Rundfunkspektrum<br />
Band III Band IV<br />
Band V<br />
12 21<br />
37 38 61 69<br />
VHF<br />
DVB-T/-H DVB-T, IMT/Mobile Dienste<br />
teilw. militär. Nutzung<br />
174 230 470 862 MHz<br />
UHF<br />
1 Bei DAB/DMB Teilung der Kanäle in jeweils 4 Blöcke (a – d) à 1,75 MHz<br />
M E D I E N P O L I T I K U N D R E G U L I E R U N G D I G I T A L I S I E R U N G