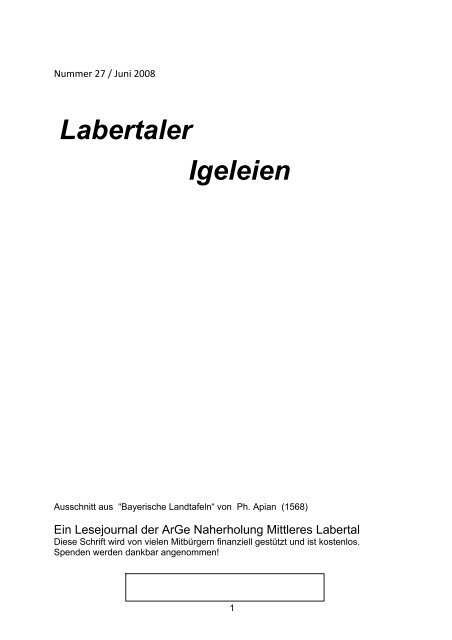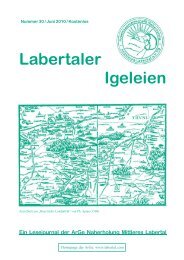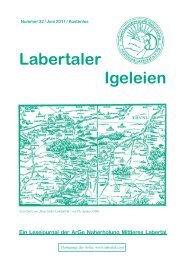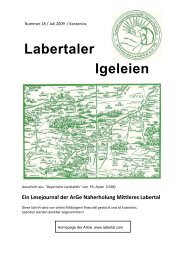Labertaler Igeleien - Mittleres Labertal
Labertaler Igeleien - Mittleres Labertal
Labertaler Igeleien - Mittleres Labertal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nummer 27 / Juni 2008<br />
<strong><strong>Labertal</strong>er</strong><br />
<strong>Igeleien</strong><br />
Ausschnitt aus “Bayerische Landtafeln“ von Ph. Apian (1568)<br />
Ein Lesejournal der ArGe Naherholung <strong>Mittleres</strong> <strong>Labertal</strong><br />
Diese Schrift wird von vielen Mitbürgern finanziell gestützt und ist kostenlos.<br />
Spenden werden dankbar angenommen!<br />
1
Homepage der ArGe: www.labertal.com<br />
Sebastian Huber, ein Nachruf für einen Freund<br />
Am Montag, 26.Mai 2008 standen wir am offenen Grab von Sebastian Huber und nahmen Abschied.<br />
Ich lernte Wastl, wie wir Ihn liebevoll nannten, vor genau 40 Jahren kennen und schätzen: unsere<br />
Lebenswege liefen parallel, es war eine besondere Art von Symbiose, sei es im MC <strong>Labertal</strong>, in der<br />
Gebietsverkehrswacht und vor allem in der ArGe.<br />
Sebastian Huber war ein sehr engagierter Mann, der sich vorbildlich und ehrenamtlich, als Mensch und<br />
Staatsbürger, vom Beginn des demokratischen Bayerns an, für die Gemeinschaft eingesetzt hat.<br />
Der Ministerpräsident verlieh ihm in Anerkennung seiner vielfältigen Aktivitäten die bayerische<br />
Verdienstmedaille für besonderes Engagement im Ehrenamt.<br />
Ich will an dieser Stelle seinen hervorragenden Einsatz für die Menschen im <strong>Labertal</strong> im Aufgabenbereich<br />
der ArGe aufzeigen: „Kultur und Natur“, Ökologie und kulturelle Initiativen als andauernde geistige<br />
Herausforderung und damit der Erhalt von traditionellen Werten in einer sich wandelnden Gesellschaft,<br />
die der individuellen Selbstverwirklichung, dem Egoismus zugeneigt ist, verbunden mit bindungs-<br />
feindlicher Beliebigkeit und wachsendem Anspruchsdenken.<br />
Sebastian Huber war seit der Gründung im Jahre 1973 25 Jahre lang Stellvertreter des 1.Vorsitzenden<br />
der Arbeitsgemeinschaft Naherholung „<strong>Mittleres</strong> <strong>Labertal</strong>“ – unvergessen meine Vorgänger im Amt, Josef<br />
Schreiner und Gustav Schmidt. Im Jahr 1999 erfolgte die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden der ArGe<br />
und die Mitgliedschaft in der Vorstandschaft auf Lebenszeit. Er war stolz auf seinen „<strong><strong>Labertal</strong>er</strong><br />
Igel“!<br />
Die Partnerschaft mit dem Förderverein "Naturschutz" in Vimperk/Winterberg und der<br />
Nationalparkverwaltung Šumava/Böhmerwald, Südböhmen besteht seit 1991 und ist bis heute lebendig<br />
und effektiv. Aus vielen Begegnungen und gemeinsamen Exkursionen sind herzliche Freundschaften<br />
entstanden. In dieser Partnerschaft war Wastl eine Institution; er war gern im Böhmerwald und der<br />
Kontakt zu unseren tschechischen Freunden war ihm immer ein besonderes Anliegen.<br />
Wastl lebte nach seinem Motto: „Willst Du einen Freund haben, dann sei selber einer!“<br />
Wir erleben Ihn als einen Freund, der uns lange begleitet hat, zuverlässig, immer zur Stelle, immer<br />
angenehm, einen Partner, den man heute nur selten findet.<br />
Er war ein wertkonservativer Mensch mit Herzensbildung, Humor und Selbstironie.<br />
Er war kein Freund großer Reden; seine Argumentation war sachlich, zielgerichtet und präzise, er konnte<br />
leise laut werden. Große Auftritte scheute er eher.<br />
Wir danken Sebastian Huber für seine Freundschaft und vermittelte Menschlichkeit, seine Treue und<br />
Zuverlässigkeit, seine unverwechselbare positive altbayerische Lebensart.<br />
Sebastian ist nicht zu ersetzen, er hinterlässt eine große Lücke, er war immer ein Teil meines Lebens.<br />
Unsere besondere Anteilnahme und Mitgefühl gilt seiner tapferen Ehefrau Rosamunde.<br />
2
Schließen will ich zum Abschied mit der 3. Strophe des alten Studentenliedes „Gaudeamus igitur“, das<br />
Wastl als engagierter Sänger liebte:<br />
Vita nostra brevis est, brevi finietur.Venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur!“<br />
Klaus Storm, Hans Bachmaier, Andreas Stöttner, Ludwig Karl, Josef Braun, Hermann Albertskirchinger<br />
Kommunalwahl 2008: Die Bürgermeister und ihr Programm „Zukunft im <strong>Labertal</strong>“!<br />
Die Wählerinnen und Wähler in Geiselhöring haben mir im März das Vertrauen<br />
gegeben, mit dem Stadtrat unsere Stadt in den nächsten 6 Jahren zu lenken. Ich<br />
werde meine umfangreiche berufliche, politische und meine ehrenamtlichen<br />
Erfahrungen mit einbringen und das Amt so ausfüllen, damit die Arbeit am Bürger<br />
und an der Sache orientiert ist.<br />
Die Arbeit soll am Bürger, am Bedarf, an der Notwendigkeit und nach<br />
wirtschaftlichen Gesichtspunkten gemacht und nicht nach parteipolitischen<br />
Gesichtspunkten ausgerichtet werden. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, um<br />
Geiselhöring weiter nach vorne zu bringen und dazu haben wir alle Möglichkeiten und sehr gute<br />
Voraussetzungen. Unsere Stadt hat in den letzten Jahrzehnten große Schritte gemacht und hier wollen<br />
wir anknüpfen.<br />
Ich will ein modernes Kommunalmanagement weiterführen und ausbauen. Die Verwaltung soll einen<br />
guten Bürgerservice bieten. Wichtig müssen uns die Kinder- und auch die Seniorenbetreuung sein. Die<br />
veränderten Familienstrukturen, die veränderte Arbeitswelt, die politischen Rahmenbedingungen und die<br />
demographische Entwicklung müssen von uns immer wieder überprüft und am Bedarf angepasst werden.<br />
Der Kindergarten und die Schule werden sicher im Focus stehen müssen. Auch die Seniorenbetreuung<br />
muss denselben Stellenwert erhalten. Die altersbedingte Entwicklung wird uns in der Seniorenarbeit noch<br />
besonders fordern.<br />
Der Kreislauf Arbeitsplätze, Wohnen und Freizeit darf nicht zum Stillstand kommen. Dabei ist das Feld der<br />
Arbeitsplätze vor Ort am wichtigsten. Arbeitsplätze halten und ausbauen muss eine hohe Priorität<br />
erhalten.<br />
Wir brauchen auch weitere Begegnungsmöglichkeiten in unserer Stadt. Das kann in gemütlichen<br />
Gaststätten, an geeigneten Plätzen, in Vereinen oder bei den verschiedensten Veranstaltungen sein.<br />
Kommunikation untereinander ist die beste Voraussetzung eines erfolgreichen Miteinanders.<br />
Ein großes Anliegen ist mir der Erhalt unserer schönen Landschaft um Geiselhöring herum. Das <strong>Labertal</strong><br />
muss geschützt werden. Fauna und Flora gilt es zu pflegen. Wir müssen diesen Vorteil einer intakten<br />
Landschaft gegenüber den Ballungszentren herausstellen. Hier haben wir ganz klar einen großen Vorteil<br />
gegenüber den größeren Städten.<br />
Klimaschutz ist mehr denn je eine wichtige Aufgabe, auch für die Kommune.<br />
Ich will Geiselhöring als Sportstadt weiter ausbauen. Bewegung in den verschiedensten Formen wird zur<br />
Prävention in Zukunft sehr wichtig werden.<br />
Einen hohen Stellenwert haben auch die Hilfsorganisationen. Die ärztliche Versorgung, die schnelle Hilfe<br />
bei einer plötzlichen Krankheit und die Feuerwehren müssen erhalten und am Bedarf ausgebaut werden.<br />
3
Es stehen aber für unsere Bürger nicht nur die großen Aufgaben im Mittelpunkt. Oft sind es kleine und<br />
persönliche Dinge, die für den einzelnen aber ein großes Problem darstellen. Auch hier müssen die<br />
Mitarbeiter im Rathaus und der Bürgermeister ein offenes Ohr haben und da helfen, wo es möglich ist.<br />
Ich werde mein Bestes geben, Bernhard Krempl, 1. Bürgermeister<br />
Gemeinde Laberweinting<br />
Landkreis Straubing Bogen<br />
Seit 1.Mai 1990 ist nun bereits Xaver Eggl Erster Bürgermeister der Gemeinde Laberweinting.<br />
im Amt.<br />
1990 hatte er als knapp 41-Jähriger überraschend die Bürgermeisterwahl gewonnen.<br />
Während er sich als Vater von vier Kindern in den beiden ersten Amtsperioden auch noch mit<br />
seiner Ehefrau Maria um die Bewirtschaftung seines landwirtschaftlichen Betriebs kümmerte,<br />
steckt er jetzt seine ganz Arbeitskraft in die Gemeinde.<br />
Auszug aus der Rede zu Beginn der Amtszeit 2008/14:<br />
„ Sowohl vor achtzehn als auch vor sechs Jahren habe ich das Ziel meiner und unserer Arbeit<br />
darin gesehen, in sachlicher Arbeit zu einer möglichst breiten Übereinstimmung zu kommen,<br />
um damit die anstehenden Probleme unserer Gemeinde zur Zufriedenheit möglichst vieler<br />
Bürgerinnen und Bürger und zum Wohl der gesamten Gemeinde zu lösen.<br />
Mehrheitsverhältnisse waren deshalb in den zurückliegenden Amtsperioden mit wenigen<br />
Ausnahmen kein Thema und ich hoffe, dass dies auch in den nächsten Jahren so sein wird.<br />
Sachliche Gesichtpunkte, die persönliche Lebens- und Berufserfahrung des Einzelnen<br />
sollen die Entscheidungen prägen.<br />
..Die Arbeit in den nächsten Jahren wird geprägt sein von einer sparsamen und wirtschaftlichen<br />
Haushaltsführung, zu der wir aufgrund der knapper werdenden Finanzmittel gezwungen sind.<br />
Uns ist dies trotz riesiger Investitionen in den zurückliegenden Jahren gelungen. Mit Augenmaß<br />
und oft auch mit dem Mut zu unpopulären Entscheidungen müssen wir die Handlungsfähigkeit<br />
unserer Gemeinde erhalten.<br />
Als Bürgermeister bin ich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Gemeinderatsmitgliedern<br />
angewiesen, ebenso wie auf eine gute Mannschaft im Rathaus, Bauhof und Kläranlage.<br />
Und so will ich unsere Arbeit verstanden wissen:<br />
Im Zusammenwirken von Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung wird der Erfolg unserer<br />
Arbeit in den nächsten Jahren liegen:<br />
Für dieses Jahr sind die wichtigsten Entscheidungen für die investiven Maßnahmen bereits<br />
gefallen, die sich im Wesentlichen auf den Bau der Kanalisation in Asbach, Leitersdorf,<br />
Ödwiesen und die Straßenbaumaßnahme Haader-Weichs und Haader-Franken konzentrieren<br />
werden.<br />
Gehen wir diese gemeinsame Arbeit an, dafür haben wir den Auftrag unserer<br />
Gemeindebürgerinnen und Bürger.“<br />
Als weitere Bürgermeister wählte der Gemeinderat den Landwirt Alfons Zehentbauer aus<br />
Haader, der dieses Amt bereits zum zweiten Malle ausübt.<br />
Neu in das Amt des dritten Bürgermeisters wurde der Polizeibeamte Ludwig Peintner aus<br />
Grafentraubach gewählt.<br />
Beide weiteren Bürgermeister mussten schon zu Beginn der Amtsperiode den ersten<br />
Bürgermeister vertreten, weil dieser einen Unfall erlitten hatte.<br />
4
Die Unfallfolgen sind ausgeheilt und viele Aufgaben warten darauf erledigt zu werden, um die<br />
Gemeinde voranzubringen.<br />
Das haben wir in Mallersdorf-Pfaffenberg vor<br />
In einer Kommune wie Mallersdorf-Pfaffenberg mit fast 7.000 Einwohnern, fast 500 Betrieben, einer<br />
Ausdehnung von 73 qkm, einem Straßennetz von 75 km, einer Kanallänge von 82 km und mehreren<br />
überörtlichen Einrichtungen stehen jedes Jahr vielseitige Maßnahmen an, den Ort attraktiv zu gestalten<br />
und weiter zu entwickeln. Dank einer positiven finanziellen Entwicklung in den letzten Jahren ist es derzeit<br />
auch möglich, diese geplanten Maßnahmen umzusetzen. Mit der Unterstützung verschiedener staatlicher<br />
Förderungen können diese Vorhaben noch effektiver verwirklicht werden.<br />
Ein wichtiges Ziel ist es daher, diese Finanzkraft weiter zu verbessern. Die gestiegenen Einnahmen aus<br />
Gewerbe- und Einkommensteuer verdeutlichen, dass der Markt die Betriebe und den Arbeitsmarkt auch<br />
weiterhin fördern muss, damit viele Einwohner genügend Arbeitsplätze vor Ort haben. Eine große<br />
Herausforderung der nächsten Jahre sind die Projekte im Rahmen von „Stadtumbau West“, womit wir vor<br />
allem die Innerortsbereiche attraktiv und lebendig gestalten wollen. Neben verschiedenen Straßen und<br />
Platzerneuerungen wird vor allem die Umgestaltung der Resista-Halle in ein „Haus der Generationen“<br />
eine hoch interessante Aufgabe in verschiedener Hinsicht werden. Im Obergeschoss soll eine<br />
multifunktionale Bürgerhalle entstehen und das Untergeschoss ist für die Begegnung der Kinder, der<br />
Jugendlichen, der Senioren und der Vereine vorgesehen. Mit Hilfe eines Wettbewerbs soll hier die<br />
optimalste Lösung gefunden werden.<br />
Ein breites Spektrum wird auch die Betreuung von Jung und Alt einnehmen, wobei sowohl eine Krippe für<br />
die Kleinsten, ein neuer Jugendtreff im „Haus der Generationen“ als auch die Erweiterung der Angebote<br />
für Senioren geplant ist. Im Bereich der Bildung hat der Markt schon immer viel Geld investiert und wir<br />
werden auch künftig die Volksschule wieder zeitgemäß ausstatten, um die optimale Voraussetzung für<br />
5
unsere Kinder zu erhalten. Die Hauptschule ist für die nächsten Jahre noch gesichert, Kooperationen mit<br />
Nachbargemeinden werden aber vermutlich notwendig werden.<br />
Ein sehr wichtiger Bereich sind auch die Ehrenamtlichen und die Vereine, die jede Gemeinde lebendig<br />
und individuell erhalten. In über 80 Vereinen sind tausende von freiwilligen Frauen und Männern<br />
uneigennützig tätig und die jährlich rund 150 bis 200 Tausend Euro freiwillige Leistungen sind hier<br />
bestens angelegt. Dieses Engagement wollen wir auch künftig fördern. Auch an den Einrichtungen der<br />
Gemeinde nagt der Zahn der Zeit und infolge der hohen Energiepreise ist es unbedingt erforderlich,<br />
wärmetechnische Verbesserungen vorzunehmen und nachhaltige Energieträger einzusetzen. Mit der<br />
Hackschnitzelheizung für Schule und Bäder wurde hier schon der richtige Schritt unternommen, die<br />
Isolierung einzelner Gebäude wird folgen.<br />
Ein schwieriges Thema wird sicher die geplante Umgehungsstraße werden, für die es Gegner und<br />
Befürworter gibt. Erfreulich ist, dass jetzt alle die Einsicht gewonnen haben, dass wir eine<br />
Umgehungsstraße brauchen. Konträr ist die Frage wohin. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Diskussion<br />
entwickelt, wobei zu wünschen ist, dass sich die Emotionen in Grenzen halten und das Abwägen von<br />
realistischen Fakten im Vordergrund steht. Die schlechteste Lösung wäre keine Umgehung, weil dadurch<br />
Mallersdorf-Pfaffenberg in den nächsten Jahren den Anschluss gegenüber den Nachbargemeinden<br />
deutlich verliert und die Menschen an den Durchgangsstraßen nicht entlastet werden.<br />
Ein historischer und gesellschaftlicher Höhepunkt wird sicherlich die 900-Jahr-Feier des Kloster<br />
Mallersdorf im Jahre 2009 werden. In einem umfangreichen Programm mit vielen interessanten<br />
Veranstaltungen und Vorträgen wird über Monate hinweg die große Bedeutung des Klosters für den Ort<br />
und die Umgebung sowie das segensreiche Wirken der Schwestern herausgestellt. Zu dieser großen<br />
Feier – das Festwochenende findet vom 17. bis 19. Juli 2009 statt – darf ich Sie heute schon sehr<br />
herzlich einladen. An dieser Stelle darf ich auch der ArGe Naherholung Danke sagen, dass sie einerseits<br />
bei diesem Klosterjubiläum mitwirkt aber auch andererseits sich über Jahrzehnte hinweg für die<br />
Menschen und die Natur in unserm Bereich einsetzt. Auf weiterhin gute Zusammenarbeit.<br />
Karl Wellenhofer Erster Bürgermeister Markt Mallersdorf-Pfaffenberg<br />
10. Ökogespräch in Winterberg / Vimperk im<br />
Böhmerwald<br />
Grußwort des 1. Bürgermeisters von Mallersdorf-Pfaffenberg,<br />
Karl Wellenhofer,<br />
zum 10. Ökogespräch vom 18. - 20. April 2008 in Vimperk<br />
Sehr geehrte Damen und Herren des „Vereins zum Schutz der Natur im Böhmerwald”,<br />
liebe Freunde der Arbeitsgemeinschaft „Naherholung <strong>Mittleres</strong> <strong>Labertal</strong>”!<br />
In diesen Tagen können Sie gleich ein Dreifach-Jubiläum feiern.<br />
25 Jahre Naturschutz in Vimperk und zudem „15 Jahre Partnerschaft zwischen der ArGe<br />
Naherholung und dem Verein zum Schutz der Natur im Böhmerwald” sind wahrlich beachtliche<br />
Jubiläen.<br />
Dazu kommt noch, dass Sie heuer auf das zehnte Jahr bei den vielbeachteten Ökogesprächen<br />
zurückblicken.<br />
Als Bürgermeister von Mallersdorf-Pfaffenberg, dem Sitz der Arbeitsgemeinschaft „Naherholung<br />
<strong>Mittleres</strong> <strong>Labertal</strong>”, entbiete ich zu allen drei Jubiläen meine herzlichsten Glückwünsche.<br />
Ihre beiden Organisationen haben es geschafft, wovon manche Politiker auf höherer Ebene träumen.<br />
6
Sie haben seit vielen Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet und<br />
zudem in Ihren Bemühungen nicht nachgelassen „Natur und Landschaft über die bestehenden<br />
Grenzen hinweg zu erhalten und zu bewahren”. Ökologie kennt keine Grenzen haben Sie mal in<br />
einer Einladung geschrieben und dieses Motto haben Sie vorzüglich umgesetzt.<br />
Viele Freundschaften sind seit den Anfängen Ihrer Partnerschaft entstanden und ich hoffe, dass<br />
diese engen Verbindungen noch lange bestehen bleiben.<br />
Beim Verfassen dieser Zeilen fallen mir die Worte des früheren Landtagspräsidenten Johann Böhm<br />
ein, der einmal bei einer Festrede in Mallersdorf-Pfaffenberg gesagt hat:<br />
„Das Zusammenwachsen eines freiheitlich-demokratischen Europas ist für unseren Kontinent eine<br />
Frage des Überlebens im internationalen Wettbewerb”.<br />
Für dieses Zusammenwachsen leisten der Verein „zum Schutz der Natur im Böhmerwald” und auch<br />
die Arbeitsgemeinschaft „Naherholung <strong>Mittleres</strong> <strong>Labertal</strong>” im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen<br />
wichtigen Beitrag.<br />
Für diesen ehrenamtlichen Einsatz meinen aufrichtigsten Dank!<br />
Den Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum wünsche ich einen guten Verlauf und die Vertiefung der<br />
vielen Freundschaften.<br />
Mögen diese drei Tage zu einem weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte zwischen dem<br />
böhmischen Naturschutzverein und der ArGe Naherholung werden.<br />
Karl Wellenhofer, Erster Bürgermeister<br />
Liebe Freunde !<br />
Grußwort des 1. Vorsitzenden der ArGe zum 10. Ökogespräch<br />
Die 18 Jahre bestehende Partnerschaft mit unseren tschechischen Freunden im<br />
Böhmerwald / Šumava ist ein erfreulicher und erfolgreicher Versuch,<br />
Grenzen in Europa zu überwinden und sich gemeinsamen Aufgaben zu stellen.<br />
Die traditionellen "Ökogespräche", heute ist die 10.Veranstaltung,<br />
also ein kleines Jubiläum, sind ein Beispiel dieser Zusammenarbeit.<br />
Wir boten gemeinsam eine breite Palette an Themen an, ein anspruchsvolles Programm, Probleme<br />
anzusprechen und das gegenseitige Verständnis zu wecken;<br />
auch bei Ansätzen, deren Inhalte politisch nicht einfach sind und zeitgeschichtliche Tabus<br />
berühren.<br />
Wir haben miteinander „das Fenster geöffnet“, der Nachbar ist willkommen.<br />
Zunehmend verflechten sich Veranstaltungen und Aktionen der beiden Vereine und führen zu einer<br />
lebendigen Partnerschaft.<br />
7
Wir sind eine Familie, auch wenn der Zahn der Zeit an uns nagt,<br />
- mehr oder weniger!<br />
Freunde haben uns für immer verlassen und hinterlassen eine nicht zu schließende Lücke: sie sind<br />
in unseren Herzen unvergesslich verankert!<br />
Wir trauern um unsere Toten, stellvertretend nenne ich Emanuel Srnad,<br />
Vaclav Hruby, Jana Steger, Volkhard Nixdorf.<br />
Unsere Treffen sind immer ein frohes Ereignis;<br />
wir freuen uns, wenn wir Euch sehen.<br />
Freundschaft und Vertrauen sind eine solide Basis.<br />
Die Vorsitzenden Frantiček Kadoch (außer Dienst) und Dušan Žampach (amtierend) möchte ich<br />
an dieser Stelle für alle engagierten Menschen dankbar nennen.<br />
Das gemeinsame Erlebnis von Kultur und Natur haben diese herzlichen Freundschaften entstehen<br />
lassen und viel zum gegenseitigen Verständnis beigetragen.<br />
Das Thema „Klimawandel“ in diesem Jahr ist von herausfordernder Aktualität in aller Welt.<br />
Wir <strong><strong>Labertal</strong>er</strong> freuen uns auf das Wochenende in Eurer Gesellschaft.<br />
Klaus Storm<br />
10. Ökogespräch in Vimperk/Winterberg 2008<br />
Liebe Freunde der Natur!<br />
Wälder im Klimawandel<br />
Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft dar.<br />
Die UNO-Berichte in den letzten Monaten sprechen eine deutliche Sprache.<br />
Die Zeichen des Klimawandels sind nicht mehr zu leugnen:<br />
Zugvögel ziehen später weg und kommen früher zurück oder bleiben gleich bei uns,<br />
Pflanzen blühen früher, die Artenvielfalt verändert sich, ein Landschaft prägender Wandel der<br />
Baumartenzusammensetzung steht bevor........<br />
Aussterbens-Szenarien für rund ein Drittel unserer einheimischen Tier- und Pflanzenwelt<br />
werden projiziert.<br />
Welche Folgen hat der Klimawandel?<br />
Wir erleben derzeit ein Wechselbad der Gefühle:<br />
Einerseits erlebt die Landbewirtschaftung weltweit eine Renaissance.<br />
Die wachsende Bevölkerung und veränderte Ernährungsgewohnheiten steigern den Hunger<br />
nach Lebensmitteln.<br />
Das wirtschaftliche Wachstum, die Verknappung und Verteuerung der fossilen Energieträger<br />
8
steigern den Hunger nach Nachwachsenden Rohstoffen, insbesondere auch nach Holz.<br />
Andererseits bedroht der Klimawandel dieses zarte Pflänzchen<br />
buchstäblich verdorren zu lassen, denn das Problem am Klimawandel sind die extremen<br />
Wetterlagen:<br />
Kaum ein Jahr endet ohne Berichte über erhebliche Wetterkapriolen – oft sind es Katastrophen.<br />
Der milde Winter brachte nicht die dringend benötigten Niederschläge für die Kulturen und<br />
Wälder.<br />
Stürme können in einer Nacht Millionen Bäume umreißen.<br />
Durch Hitze, Trockenheit und Dürre leiden Pflanzen und Vieh.<br />
Extremniederschläge, Hochwasser oder wochenlanger Regen machen Ernteerwartungen<br />
zunichte.<br />
Vor allen Dingen aber wird der Weg frei für Schädlinge wie die Fichtenborkenkäfer.<br />
Auf unsere Wälder wird sich der Klimawandel massiv auswirken.<br />
Besonders trifft es die flach wurzelnde Fichte.<br />
Auf über eine Million Hektar ist sie bisher der „Brotbaum“ der bayerischen Waldbesitzer.<br />
Häufigere Stürme und großflächige Borkenkäferschäden machen dem Wald zu schaffen.<br />
Nach ersten Erhebungen müssen rund 260.000 Hektar allein im Privat- und Körperschaftswald<br />
dringend in Mischbestände umgebaut werden.<br />
Noch dramatischer sieht es im Gebirge aus:<br />
Hier geht es um den Erhalt, die Pflege und, wo nötig, die Sanierung der lebenswichtigen<br />
Schutzwälder. Wenn es nicht gelingt, die Schutzfähigkeit der Bergwälder zu gewährleisten,<br />
sind die Folgen für die Bevölkerung unkalkulierbar, bis weit ins Alpenvorland.<br />
Die alarmierenden Hinweise der Klimaforscher zwingen zum schnellen Handeln.<br />
Vielfach wurden bereits Konzepte und Handlungsempfehlungen vor Ort entwickelt.<br />
Ein Beispiel ist das Borkenkäfer-Warnsystem, das jedem Waldbesitzer per Internet aktuelle<br />
Informationen zur Gefährdungssituation und zu Gegenmaßnahmen liefert.<br />
Mit dem Waldumbau und mit der Schutzwaldsanierung im Gebirge muss zukunftsweisend<br />
reagiert werden:<br />
Das waldbauliche Handeln darf nicht den Stürmen und dem Borkenkäfer überlassen werden.<br />
Für uns Naturschützer muss der Erhalt der Biodiversität der Wälder in einem Netz von<br />
Schutzgebieten Vorrang haben:<br />
Das bayerische Umweltministerium entwickelt „Ziele und Schwerpunkte für die Strategie zum<br />
Erhalt der biologischen Vielfalt in Bayern“.<br />
Die deutsche Bundesregierung hat im November 2007 eine „Nationale Strategie der<br />
Biologischen Vielfalt“ beschlossen.<br />
Eine Erfolgsgeschichte sind die Nachwachsenden Rohstoffe und die Bioenergien, die<br />
längst aus der Nischenrolle herausgewachsen sind.<br />
9
Im Jahr 2003 wurden umgerechnet 2,5 Milliarden Liter Heizöl durch Biomasse ersetzt und<br />
damit der Ausstoß von 6,6 Millionen Tonnen COB2B vermieden.<br />
Mit dem Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing haben wir in Bayern<br />
eine europaweit einmalige Bündelung von Forschung, Entwicklung, Technologie und<br />
Wirtschaft.<br />
Hier liegt nicht nur ein Schlüssel für angewandten Klimaschutz, sondern vor allem neue<br />
Perspektiven unseres Landes.<br />
An der wirksamen Reduktion der Emissionen und tatkräftigen Anpassung führt kein Weg vorbei.<br />
Unser Lebensraum - im wahrsten Sinne des Wortes der Raum, in dem wir leben – wird von<br />
Land- und Forstwirtschaft geprägt.<br />
Sein Wert wird in Zukunft entscheidend davon abhängen, ob und wie diese beiden Bereiche die<br />
Herausforderungen des Klimawandels bewältigen.<br />
Die wichtigsten Ziele sind,<br />
► Schäden durch den Klimawandel abzuwenden,<br />
► Risiken für die Gesellschaft zu minimieren und Chancen zu nutzen.<br />
Klimaschutz und Anpassung werden viel Geld kosten.<br />
Die Folgen, wenn man nicht oder zu spät handelt, werden jedoch unbezahlbar sein.<br />
Klaus Storm<br />
Kloster Mallersdorf feiert<br />
900-jähriges Bestehen<br />
Im Jahre 1109 gründete Pater Burkhart zusammen mit vier weiteren Benediktinermönchen aus<br />
der Abtei Michelsberg in Bamberg das Kloster in Mallersdorf. Im nächsten Jahr kann somit auf<br />
eine 900-jährige Geschichte und erfolgreiche Entwicklung des Klosters zurückgeblickt werden.<br />
Grund genug, im Jubiläumsjahr verschiedene Feierlichkeiten durchzuführen. Die Planungen<br />
hierzu haben bereits vor geraumer Zeit begonnen. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des<br />
Klosters, des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg und des Landkreises Straubing-Bogen ist daran,<br />
ein attraktives und vielseitiges Programm auf die Beine zu stellen.<br />
Von März bis Oktober 2009 finden verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte, Vorträge und<br />
Ausstellungen statt, die unter anderem die Geschichte des Klosters deutlich machen sollen. Alle<br />
Bürgerinnen und Bürger aus Mallersdorf-Pfaffenberg und Umgebung sind schon heute herzlich<br />
eingeladen, dieses Jubiläum mitzufeiern und die unterschiedlichen Veranstaltungen zu<br />
besuchen.<br />
Den Auftakt bildet ein Festgottesdienst mit anschließendem Festakt am Sonntag, 08. März<br />
2009. Der Beginn der Feierlichkeiten im März wurde gewählt, da Pfarrer Paul Josef Nardini am<br />
2. März 1855 die Gemeinschaft der Armen Franziskanerinnen in Pirmasens gegründet hat. Im<br />
Laufe der Jubiläumsmonate werden mehrere Vorträge abgehalten. Von den Anfängen der<br />
10
Besiedelung im Mallersdorfer Raum über die Geschichte des Klosters von der Gründung bis zur<br />
Säkularisation bzw. dem Einzug der Franziskanerinnen werden die Besucher hören. Untermalt<br />
werden alle Vorträge durch musikalische Beiträge oder Schauspielszenen. Um der Bürgerschaft<br />
einen Einblick in das Klosterleben zu geben, werden beim „Tag des offenen Denkmals“<br />
Führungen durch das Kloster sowie Führungen in der Pfarrkirche angeboten.<br />
Das eigentliche Festwochenende findet vom 17. bis 19. Juli 2009 statt und beginnt am<br />
Freitagabend mit einer Klosterserenade, an der sich die örtlichen Schulen beteiligen. Am<br />
Samstag soll dann ein großer Handwerkermarkt im Klosterhof abgehalten werden und für den<br />
Sonntag ist nach dem Festgottesdienst, der von Bischof Ludwig Müller aus Regensburg<br />
zelebriert wird, ein Klostermarkt geplant. Zu diesem Markt werden verschiedene Klöster aus<br />
dem Umkreis und natürlich auch das Kloster Mallersdorf selbst, ihre Produkte anbieten.<br />
Zum Jubiläum wurde auch ein eigenes Theaterstück geschrieben, das zwischenzeitlich bereits<br />
fertig gestellt ist und beim Festwochenende zur Aufführung gelangt. Die örtlichen Schulen und<br />
Vereine wurden in die Vorbereitungen bereits eingebunden und werden mit den<br />
verschiedensten Beiträgen zum Gelingen des Festes beitragen. Im Mai wird ein fröhliches<br />
Konzert der örtlichen Musikgruppen zu hören sein und im Oktober findet ein Konzertabend mit<br />
Musik aus ostbayerischen Klöstern statt.<br />
Für Jung und Alt und alle Interessensgruppen ist somit beim Jubiläumsjahr etwas geboten. Den<br />
Abschluss des Festjahres bildet ein großer Festgottesdienst mit Festakt am 25. Oktober 2009.<br />
Doch auch nach dem offiziellen Abschluss wird anlässlich des Jubiläums das<br />
Weihnachtskonzert der Regensburger Domspatzen am 1. Adventsonntag einen besonderen<br />
Höhepunkt bilden.<br />
Das Jubiläum wird begleitet von einem eigens<br />
kreierten Logo, das im Rahmen eines Wettbewerbs<br />
unter den Schulen erarbeitet wurde und schon vorab<br />
auf die Feierlichkeiten einstimmen soll.<br />
Markt Mallersdorf-Pfaffenberg - Elisabeth Keck<br />
Aufnahme zwischen 1919 und 1936 Die Pfarrkirche St. Johannes heute<br />
11
Alois Lederer<br />
Gemeinden als Grundlagen des Staates<br />
- Ein Blick zurück in die Geschichte der Kommunen –<br />
Die zurückliegenden Kommunalwahlen am 2. März sowie die in diesem Heft abgedruckten<br />
politischen Vorstellungen der drei Bürgermeister in unseren <strong>Labertal</strong>gemeinden Geiselhöring,<br />
Laberweinting und Mallersdorf-Pfaffenberg sind ein passender Anlass, einmal an dieser Stelle<br />
einen Blick zurückzuwerfen, wie die Kommunen eigentlich entstanden sind.<br />
Als ursprüngliche Organisationsform –<br />
natürlich mit der heutigen Einrichtung der<br />
Gemeinde mit ihrem sehr ausgeprägten<br />
Selbstverwaltungsrecht nicht zu vergleichen<br />
– hat es die Einrichtung „Gemeinde“ schon<br />
immer gegeben. Man kann auch mit Fug<br />
und Recht behaupten „Die Gemeinden sind<br />
älter als der Staat“. Noch bevor der Staat<br />
nämlich seine Verwaltung installiert hat, gab<br />
es die Gemeinden. Die Gemeindeverbände<br />
„Landkreis“ und „Bezirk“ dagegen wurden<br />
erst später geschaffen.<br />
Die heutigen kreisangehörigen Gemeinden<br />
in Bayern haben eine lange geschichtliche<br />
Entwicklung durchlaufen.<br />
Es waren einst stolze Reichsstädte, wie<br />
zum Beispiel Dinkelsbühl, Bischofsstädte<br />
oder einfache Dorfgemeinden. Andere sind<br />
erst aus den Gebietsreformen der Jahre<br />
1808, 1818 und 1971 bis 1978 hervorgegangen.<br />
Das Rathaus des<br />
Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg<br />
In früheren Zeiten hatten die „Dorfgmainen“ oder Ortschaften nur genossenschaftlichen<br />
Charakter, soweit es sich um land- oder forstwirtschaftliche Bearbeitung der gemeinsamen<br />
Nutzung vorbehaltenen Wald- und Weideflächen (Almende) gehandelt hat.<br />
In Bayern haben sich um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts im kommunalen Leben<br />
größere Umstellungen ergeben. Sie haben aber einen anderen Ausgangspunkt als die<br />
Reformen im norddeutschen Raum.<br />
War es dort der Gedanke der nationalen Wiedergeburt, der auch das kommunale Leben mit<br />
umfasste, so war es in Bayern vor allem die Rechtszersplitterung, die zu neuen Ordnungen<br />
Anlass gab. Im Zuge der Mediatisierung und<br />
Säkularisation wurden dem bayerischen<br />
Kurfürstentum und späteren Königtum<br />
zahlreiche Territorien, geistlichte und weltliche<br />
Besitzungen, Reichsstädte und Reichsdörfer<br />
einverleibt, die zunächst ihr privates und<br />
öffentliches Recht beibehielten.<br />
So war die Verfassung und Verwaltung der<br />
bayerischen Gemeinden zu dieser Zeit von<br />
einer großen Buntscheckigkeit. Der<br />
Rechtsgelehrte Freiherr von Kreittmayr<br />
beklagte schon in seinem Gesetzgebungswerk<br />
Codex Maximilianeus Bavaricus Civillis (1756),<br />
und zwar in den Anmerkungen, die<br />
Rechtszersplitterung in Bayern auf dem<br />
Das Rathaus der Gemeinde Laberweinting<br />
Gebiete des kommunalen Lebens.<br />
12
Der von Kurfürst Maximilian nach seiner Thronbesteigung als König Max I. (1806) ins Amt<br />
berufene Staatsmann Freiherr von Montgelas versuchte durch das „ Organische Edikt über die<br />
Bildung von Gemeinden“ aus dem Jahre 1808 aus den über 40.000 damals bestehenden<br />
Gemeinden, Ortschaften und Weilern rund 7000 neue Gemeinden zu bilden.<br />
Dabei wurde eine Mindestgröße von „250 Seelen“ und eine Höchstgrenze von „1000 Seelen“<br />
angenommen.<br />
Durch das Gemeindeedikt vom 24. September 1808 wurden die Gemeinden jedoch unter<br />
vollständige staatliche „Kuratel“ gestellt. Die Gemeinden standen also unter der Vormundschaft<br />
des Staates. Sie konnten mehr oder weniger nur unter der Mitwirkung des Staates handeln.<br />
Nachdem der allmächtige Minister Montgelas 1817 abtreten musste, bahnte sich in dem<br />
Revidierten Gemeindeedikt vom 17. 5. 1818 auch in Bayern allmählich eine Entwicklung an, die<br />
den Gemeinden eine bessere Rechtsstellung einräumte.<br />
Das eben erwähnte Edikt vom 17. Mai 1818 brachte zwar insbesondere die freie Wahl der<br />
gemeindlichen Vertretungsorgane und einen größeren Spielraum in der gemeindlichen<br />
Vermögensverwaltung, behielt aber die staatliche Kuratel wie bisher bei. Durch das<br />
Selbstverwaltungsgesetz aus dem Jahre 1919 – nachdem die Bayerische Gemeindeordnung<br />
1869 eigentlich schon das Selbstverwaltungsrecht eher zurückhaltend zuerkannt hatte, begann<br />
für die Einrichtung „Gemeinde“ mit dem Durchbruch des Selbstverwaltungsrechtes die<br />
„Neuzeit“.<br />
Die Gemeindeordnung vom 17. Oktober 1927 stärkte das Selbstverwaltungsrecht, das auch<br />
verwaltungsgerichtlich geschützt wird. Die staatliche Einflussnahme wurde reduziert.<br />
Die verstärkte Stellung des ersten Bürgermeisters führt zur Durchbrechung des monistischen<br />
Prinzips.<br />
„Der Führergedanke des Dritten Reiches lässt keinen Raum mehr für eine einfache kommunale<br />
Interessensvertretung, und zwar schon deshalb nicht, weil es überhaupt keine kommunalen<br />
Interessen gibt, die denen des Reiches entgegengesetzt wären. Reich und Gemeinden sind<br />
schicksalverbunden und bilden eine Einheit“.<br />
Mit diesen Worten verdeutlichte 1934 der Innenminister des Reiches, Wilhelm Frick, die Folgen<br />
der nationalsozialistischen „Gleichschaltung“ für die Kommunen. Die kommunale<br />
Selbstverwaltung hatte im „Führerstaat“ keinen Platz. Damit endete eine Phase, in der die<br />
Kommunen von der Monarchie bis zur Republik Stück für Stück mehr Freiheiten erhalten hatten.<br />
Die Leitung der Gemeinden fällt 1935 in die Hände von NSDAP-Beauftragten. Einen Schutz der<br />
Gemeinden durch die Verwaltungsgerichte gibt es nicht mehr. Auch die Bezirke und Kreise<br />
verlieren ihre Funktion als Selbstverwaltungskörperschaften.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg knüpften die<br />
Kommunen im Zuge der Demokratisierung an<br />
die Traditionen der Weimarer Republik an.<br />
Der Neubeginn im Trümmerfeld orientierte<br />
sich an den früheren demokratischen<br />
Strukturen. Damit fand eine Rückbesinnung<br />
auf das Selbstbewusstsein der Städte und<br />
Gemeinden statt.<br />
Der Wiederaufbau der Bundesrepublik und<br />
die Wandlung Bayerns zum Industriestaat<br />
hatten für die kommunale Ebene gravierende<br />
Folgen. Es ging um den Aufbau einer<br />
modernen Infrastruktur mit Straßen, Wasser,<br />
Abwasser und Schulen sowie um eine<br />
Etablierung des Verwaltungsstaates. Das historische Rathaus<br />
der Stadt Geiselhöring<br />
13
Die Verhältnisse auf dem Land wurden komplizierter, die Verrechtlichung des Lebens machte<br />
auch vor den „Bauerndörfern“ nicht halt.<br />
Die Gemeindeverwaltungen mussten Zug um Zug professioneller werden.<br />
Mit einem Gemeindeschreiber und einem ehrenamtlichen Bürgermeister, der tagsüber auf dem<br />
Feld arbeitete und nur kurzzeitig in der Gemeindekanzlei anwesend war, ging es nicht mehr.<br />
In der Bayerischen Verfassung wurde den Kommunen eine wichtige Rolle für den Aufbau der<br />
Demokratie von unten zugesprochen.<br />
So heißt es in der Bayerischen Verfassung, konkret im Artikel 11 Abs. 4 : „Die Selbstverwaltung<br />
der Gemeinden dient dem Aufbau der Demokratie in Bayern von unten nach oben“.<br />
Eine umfassende Neuregelung des Rechts der Gemeinden brachte dann die Gemeindeordnung<br />
für den Freistaat Bayern vom 25. 1. 1952. Sie wurde inzwischen zwar mehrfach geändert, hat<br />
sich aber im Wesentlichen bewährt.<br />
Die Gemeindeordnung, eine der wichtigsten gesetzlichen Lektüren in meinem Berufsleben,<br />
enthält in Art. 1 den Passus, dass die Gemeinden die Grundlagen des Staates und des<br />
demokratischen Lebens bilden.<br />
Diese Passage sagt viel aus. Es fällt damit den Gemeinden die Aufgabe zu, alle<br />
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich wahrzunehmen.<br />
Die Kommunen, so schreibt ein anerkannter Professor vom Kommunalwissenschaftlichen<br />
Forschungszentrum Würzburg „sind unverzichtbarer Bestandteil auch des politischen<br />
Ordnungssystems der Bundesrepublik Deutschland, gewährleisten sie doch neben dem Prinzip<br />
des Föderalismus ein in verschiedene Ebenen gegliedertes demokratisches Gemeinwesen“.<br />
Somit ist die kommunale Selbstverwaltung, die die Gewaltenteilung zwischen Bund, Ländern<br />
und Gemeinden stärkt, ein „freiheitsicherndes Organisationsprinzip“.<br />
Blickt man in der Geschichte der Kommunen zurück, dann kommt man automatisch auf das<br />
Jahr 1972. Durch die am 1. Juli 1972 in Kraft getretene Kreisgebietsreform wurde die Zahl der<br />
kreisfreien Städte von 48 auf 25 und die Zahl der Landkreise von 143 auf 71 verringert.<br />
Aus den 7025 bayerischen Gemeinden wurden in den Jahren bis 1978 etwas über 2000.<br />
Drei davon sind im kleinen <strong>Labertal</strong>, nämlich Geiselhöring, Laberweinting und Mallersdorf-<br />
Pfaffenberg.<br />
Sie präsentieren sich seit vielen Jahren als leistungsfähige Körperschaften, die sich neueren<br />
Entwicklungen nicht verschließen und viele wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllen.<br />
Am Rande sei erwähnt, dass zum Stichtag 30. 6. 2007 die Stadt Geiselhöring 6725 Einwohner<br />
hatte, der Markt Mallersdorf-Pfaffenberg 6514 und die Gemeinde Laberweinting 3467.<br />
Interessant ist noch ein weiterer Blick in die amtlichen Statistiken.<br />
Demnach ist die Stadt Geiselhöring immerhin 99,97 km² groß. Es folgen Laberweinting mit<br />
76,29 km² und Mallersdorf-Pfaffenberg mit 73 km².<br />
Unter Würdigung aller Aufgaben der Selbstverwaltung kann festgestellt werden, dass die<br />
Gemeinden als ursprüngliche Gebietskörperschaften mit dem Recht der Selbstverwaltung dem<br />
Aufbau der Demokratie in Bayern von unten nach oben dienen, so wie es auch in der<br />
Verfassung steht.<br />
14
Kirchen und Kapellen der Heimat<br />
Filialkirche St. Stephanus Paindlkofen<br />
Paindlkofen gehört zur Gemeinde Ergoldsbach und<br />
liegt im Quellgebiet des Bayerbachs zwischen<br />
Feuchten und Martinshaun. Der Ort ‚Painelchoven’<br />
wird bereits 1269 urkundlich erwähnt. Kirchlich ist<br />
Paindlkofen der Pfarrei Moosthann-Postau<br />
angegliedert.<br />
Die Rokokokirche St. Stephanus aus dem Jahr 1772 bildet räumlich und optisch den Mittelpunkt<br />
der ehemaligen Hofmark. Seit der letzten Renovierung erstrahlen Gotteshaus und Turm wieder in<br />
der gelben Kirchenfarbe mit weißen Lisenen. Der hohe Chor mit zwei Fensterachsen ist wenig<br />
eingezogen und rund geschlossen. Das Langhaus hat drei Joche und ist am Übergang zum<br />
Presbyterium gerundet. Über den rundbogigen Fenstern mit gefaster Leibung ist jeweils ein<br />
Kleeblattfenster angeordnet. Die Sakristei befindet sich nördlich am Chor. Der Eingang führt durch<br />
das Erdgeschoss des westlich ausspringenden, quadratischen Sattelturms, der mit sechs<br />
Stockwerken das Dorf überragt. Die Glockenstube mit acht Schallfenstern ist leicht eingezogen.<br />
Zwei Zifferblätter in den Giebeln zeigen nach Osten und Westen die Zeit an. Tonnengewölbe in<br />
Chor und Langhaus mit Stichkappen. Am Gewölbeansatz umlaufendes, geschweiftes, mehrfach<br />
abgestuftes Kranzgesims. Durch die kleeblattförmigen Fenster in den Stichkappen werden der<br />
Innenraum und die mit Stuckaturen gerahmten Deckenfresken hell ausgeleuchtet. Im gedrückten<br />
Chorbogen befindet sich in einem goldenen Rokokorahmen mit Rocaillen und Voluten in zwei<br />
Medaillons das Ehewappen Hirnreiß-Harscher mit Helmzier.<br />
15
Das Deckengemälde im Chor zeigt St. Stephanus und Engel in<br />
den Wolken; darunter die Ansicht von Paindlkofen. Im Langhaus<br />
großes Deckenbild der Steinigung des Stephanus.<br />
Der Hochaltar mit zwei Säulen und vier Pilastern entstand um<br />
1700 und ist eine Mischung aus barocken, rokoko- und<br />
klassizistischen Bestandteilen. Am Gesims befindet sich das<br />
Ehewappen Gumppenberg-Ruffini. Das Altarblatt zeigt Mater<br />
Dolorosa, die schmerzhafte Muttergottes. Im Hintergrund<br />
Szenen aus der Passion. Die lebensgroßen Seitenfiguren stellen<br />
links St. Georg und rechts St. Florian dar. Dem aufmerksamen<br />
Betrachter fällt auf, dass beide Figuren die völlig gleichen<br />
Gesichtszüge aufweisen. Im Auszug zwischen zwei Säulen<br />
ovales Bild der Krönung Mariens, flankiert von zwei Engeln auf<br />
Voluten. Darüber befindet sich eine<br />
kleine spätgotische Holzfigur des Kirchenpatrons Stephanus<br />
aus dem späten 15. Jahrhundert.<br />
Auf der Altarmensa zwei halbhohe Figuren St. Barbara und St. Margaretha mit einem Drachen an<br />
der Kette. Über der Sakristeitür steht auf einer geschweiften Wandkonsole die Figurengruppe<br />
Anna-Selbdritt, eine anachronistische Darstellung von Mutter Anna und der kindlichen Maria und<br />
dem Jesuskind aus der Barockzeit. Westlich im Langhaus erhebt sich auf zwei runden Säulen die<br />
geschweifte Empore mit barockem<br />
Orgelgehäuse mit seitlichen<br />
Akanthusranken. Die Stuhlwangen<br />
im Langhaus sind mit reichlich<br />
geschnitztem Rokokomuschelwerk<br />
verziert.<br />
Weitere Bilder und Informationen zur Kirche Paindlkofen und zu anderen 600 Kirchen und Kapellen<br />
aus dem Altlandkreis Mallersdorf und angrenzenden Gebieten finden Sie auf der Internetseite der<br />
ArGe Naherholung unter HTUwww.labertal.comUTH - Richard Stadler<br />
Quelle: Die Kunstdenkmäler von Bayern – Bezirksamt Landshut 1914 von Anton Eckardt<br />
16
Das <strong>Labertal</strong> und seine Biber<br />
Anatomie des Bibers:<br />
Biber sind das zweitgrößte Nagetier<br />
der WeltErwacerWeibchegeringfgalMännchen.Biber sialso ein ganzes Stück gr<br />
aber auch schwerer als ein Reh.<br />
Das auffälligste Merkmal des Bibers ist wohl seine Kelle, der bis zu 35 cm lange, und breit<br />
abgeflachte und beschuppte Schwanz.<br />
Die Kelle ist ein wahres Multifunktionsorgan. Sie dient<br />
beim schwimmen der Steuerung und unterstützt den<br />
Vortrieb, sie dient als Fettspeicher für die karge<br />
Winterszeit, sie ist Stütze für den sitzenden Biber und<br />
dient der Alarmierung von Familiengenossen und bei der<br />
Wärmeregulation.<br />
Diese ist für den Biber wegen seines massigen Körpers<br />
o<br />
und des dichten Pelzes besonders wichtig. Bei Temperaturen über 20 P<br />
P C können Biber leicht<br />
überhitzen.<br />
Die Fortbewegung im Wasser besorgen hauptsächlich die großen, mit Schwimmhäuten<br />
versehenen Hinterfüße. Die Biberkelle hat lediglich unterstützende Wirkung. An den Füßen<br />
befinden sich kräftige Krallen, die beim Graben eingesetzt werden. An den<br />
Hinterfüßen ist eine dieser Krallen als Doppelkralle ausgebildet: diese<br />
Putzkralle benutzt der Biber als Kamm bei der Fellpflege. Die kleinen<br />
Vorderfüße sind als geschickte Greifhände ausgebildet, mit denen der<br />
Biber Stecken zum abnagen festhalten kann.<br />
Beim Tauchen werden die Vorderfüße eng an den Körper angelegt.<br />
Nase, Augen und die kleinen Ohrmuscheln liegen hoch am Kopf. So kann der Biber bei Gefahr fast<br />
vollständig abtauchen und nur den oberen Teil des Kopfes zum sichern über Wasser halten.<br />
Beim Tauchen werden jedoch Nase und Ohren verschlossen.<br />
Hör- und Geruchsinn sind beim Biber an besten Ausgebildet, das Sehvermögen hingegen ist nur<br />
schwach entwickelt. Biber sehen im Nahbereich nur in Grauschattierungen. Die Sinneszellen für<br />
das Sehen von Farben fehlen im Biberauge. Tasthaare an der Schnauze ermöglichen dem Biber<br />
die Orientierung selbst im trüben Wasser und beim Eintauchen in den Bau.<br />
Biber sind mit einem typischen Nagergebiss mit insgesamt 20 Zähnen ausgestattet. Im Ober- und<br />
Unterkiefer sitzen die kräftigen, tief im Kiefer verankerten Schneidezähne. Sie sind Wurzellos und<br />
wachsen ständig nach. Die Vorderseite der Schneidezähne besteht aus einer schmalen härteren<br />
Schmelzschicht, der breitere hintere Teil aus weicherem Dentin. Wegen ihrer unterschiedlichen<br />
Härte nutzen sich die beiden Schichten verschieden stark ab. Dadurch sind diese zweischichtigen<br />
Schneidezähne ständig scharf.<br />
Die für das Fällen von Bäumen notwendige Beißkraft liefert die stark ausgeprägte<br />
Kiefermuskulatur.<br />
17
Auf jeder Seite sitzen oben und unten im Kiefer je 4 Backenzähne die zum Zerkleinern der<br />
Nahrung dienen. Die durch die fehlenden Zähne entstandene Lücke zwischen Schneidezähnen<br />
und den Backenzähnen werden als „Diastema“ bezeichnet. In diese Lücke können die Biber ihre<br />
Lippen zurückziehen und so den Mundraum vollständig verschließen. Dies verhindert, dass beim<br />
nagen Späne oder beim Tauchen Wasser in den Mundraum kommen. Es erlaubt Bibern auch unter<br />
Wasser zu nagen.<br />
Biber sind hervorragende Taucher. In der Regel tauchen sie nur etwa 2-5 Minuten, können bei<br />
Gefahr aber auch bis zu 20 min unter Wasser bleiben. Bei langen Tauchgängen wird der<br />
Blutkreislauf so gesteuert, dass nur das Gehirn mit Sauerstoff aus dem Blut versorgt wird, der<br />
restliche Körper wird mit dem im Muskelgewebe gespeicherten Sauerstoff versorgt.<br />
Die Ausscheidungsorgane und die Öffnung der Geschlechtsorgane sind beim Biber in einer Kloake<br />
zusammengefasst. Beim Männchen liegen Penis und Hoden im Körper.<br />
Bericht:<br />
Biberberater Hans Inkoferer<br />
Lebst !?<br />
Lebst - Lebst<br />
Lebst net - lebst a´<br />
Drum leb - daß´t lebst! Bubu<br />
18
Botanische Einordnung<br />
Apfelbeere<br />
Die Apfelbeere gehört zu den Rosengewächsen (Rosaceae). Gegenwärtig ist noch unklar,<br />
welcher Art die heute verbreiteten Kultursorten der Apfelbeere zugerechnet werden können.<br />
Meist wird in diesem Zusammenhang die Art Aronia melanocarpa (Aronie, Schwarzfrüchtige<br />
Eberesche oder Schwarze Eberesche) genannt, russische Forscher bezeichnen sie auch als<br />
A. michurinii ssp. nova. Weitere Synonyme sind Aronia nigra, Sorbus melanocarpa, Pyrus<br />
melanocarpa und Mespilus arbutifolia var. melanocarpa (Friedrich, Schuricht 1985). Es<br />
existieren zwei Gattungshybriden mit der Gattung Sorbus, nämlich x Sorbaronia dippelii<br />
(Aronia melanocarpa x Sorbus aria; schwärzlichrote Früchte) und x Sorbaronia sorbifolia (A.<br />
melanocarpa x Sorbus americana; dunkelbraunrote Früchte) (Bundessortenamt 1999).<br />
Die Aroniabeere wird auch schwarze Eberesche genannt.<br />
Früher in manchen Gebieten Deutschlands und in Osteuropa häufiger kultiviert und verwendet,<br />
rückt diese Beere durch ihren hohen Vitalstoffgehalt jetzt wieder verstärkt ins Blickfeld<br />
gesundheitsbewusster Konsumenten. Zusehens befasst sich aus dem Grund aber auch die<br />
Wissenschaft mit diesem eher unscheinbaren Gewächs.<br />
Die Aroniabeere hat einen enorm hohen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, insbesondere<br />
Anthocyanen. Anthocyane, meist Bestandteil der Farbstoffe in bestimmten Pflanzen oder Früchten<br />
sind ernährungswissenschaftlich durch ihr hohes antioxidatives und schützendes Potenzial<br />
bekannt.<br />
Diesbezüglich reiht sich der Aroniasaft ein in die Riege anderer Vitalsäfte wie Granatapfelsaft oder<br />
Cranberrysaft.<br />
Verwendung:<br />
Zur Optimierung Ihrer täglichen Versorgung mit Antioxidanten reichen bereits 100ml einfach pur,<br />
als durstlöschender Schorle oder als fruchtiger Zusatz zu einer Tasse Tee.<br />
Seiner Verwendung sind praktisch keine Grenzen gesetzt.<br />
Klaus Storm, Fachapotheker<br />
19
D’ Hauptsorg’<br />
Af aran groß’n Bauernhof hot’s brennt,<br />
alle san zum Lösch’n g’rennt.<br />
De oid Bairin ob’m am Fenster steht<br />
und schaut wias unt im Hof zuageht.<br />
Sie schreit de Leit, was tuan solln, zua.<br />
Grod netig hot ses, gibt koa Ruah.<br />
Sie sorgt se um die Küah und Fackel,<br />
um an groaß’n Hund und um an kloan Dackel.<br />
Aber des war die allergrößte Sorg vo ihr:<br />
„Hot a d’Feuerwehr gnua Bier?“<br />
Ausg’schmiert – wer – wen ?<br />
A Weinvertreter fragt telefonisch o,<br />
ob er nomittag zum Hausbesuch kema ko.<br />
„Mei“, sagt d’ Frau, „warum denn net,“<br />
weils moant, wenn’s nix kaffan, dass er glei wieder geht.<br />
„Ja, du bist guat“, donnert draf los der Mo,<br />
„wenn der amoi do is, bringst net glei wieder o.“<br />
„Woast“, sagt d’ Frau, „wos ma tan,<br />
an d’ Haustür häng ma an Zettl dran,<br />
das mia hei(n)t dahoam net san.<br />
Wenn er den Zettl siegt hänga durt,<br />
dann fahrt er bestimmt glei wieder furt.“<br />
Der Vertreter kimmt, sie hoit’n se staad,<br />
dass ausschaugt, wia wenn neamad do sei tat.<br />
Sie wartn ungefähr a hoibe Stund hin,<br />
dawei sitzt da Vertreter in seim Auto drin.<br />
Wias a weitere Stund mit’m Staadhoitn ham vollbracht,<br />
seng’s wia er im Auto Brotzeit macht.<br />
Endlich nach ara weitern Stund hots klappt,<br />
und da Vertreter haut mit seim Auto ab.<br />
Erleichtert fragt do da Mo:<br />
„Wos steht eigentlich auf dem Zettl dro,<br />
dass so lang g’wart hot der Vertretermo?“<br />
„Mei“, sagt d’ Frau und schaut drei bieder<br />
„am Zettl steht:<br />
Ich komme gleich wieder.“<br />
20<br />
Karl Lippert
Johannes Mondschein – ein bedeutender Pfaffenberger<br />
Vor knapp 100 Jahren verstarb in Straubing am 02. Mai 1909 Johannes Mondschein,<br />
königlicher Studienrat und Rektor der Realschule Straubing und Vorstand des Historischen<br />
Vereins Straubing.<br />
Mondschein wurde am 27. Dezember 1852 in Pfaffenberg geboren als Sohn des<br />
bürgerlichen Rotgerbers Alois Mondschein und dessen Gattin Elisabeth, geborene<br />
Dirnaichner aus Geiselhöring.<br />
Nach dem Besuch der deutschen Schule erhielt er ein Jahr lang Vorunterricht in Latein von<br />
dem Frühmesser Georg Schenk in Mallersdorf.<br />
Er besuchte dann Lateinschule und Gymnasium in Landshut, wo er 1872 sein Abitur<br />
machte.<br />
Er ging dann an die Universität München, wo er neben den sogenannten Realfächern<br />
Deutsch, Geschichte und Geographie auch Vorlesungen über neuere Sprachen belegte.<br />
Das doppelte Staatsexamen bestand er mit Auszeichnung.<br />
Seine erste Anstellung erhielt er an der Realschule in Straubing, wo er bereits im Alter von<br />
28 Jahren Rektor dieser Schule wurde.<br />
Mondschein war zweimal verheiratet. Er verlor seine erste Gattin 1888 nach kinderloser<br />
Ehe. Zehn Jahre später vermählte er sich wieder. Aus dieser Ehe entsprossen 3 Töchter.<br />
Am 02. Mai 1909 starb Mondschein an einem langwierigen Magenleiden.<br />
Mondschein war ein schlichter anspruchsloser Mann von lauterstem Charakter und ein<br />
tüchtiger und gewissenhafter Lehrer. Sein Lieblingsfach war die Geschichte, vor allem die<br />
Lokalgeschichte.<br />
Einige seiner wichtigsten Arbeiten sind folgende:<br />
- Abhandlung über Ulrich Schmidl<br />
- Die Straubinger Donaumaut im 16. Jahrhundert<br />
- Fürstenurkunden zur Geschichte der Stadt Straubing<br />
- Ortsnamen der Straubinger Gegend<br />
Quelle: Jahresbericht des Historischen Vereins von 1909 von Straubing<br />
Karl Lippert<br />
21
Zwei Welten<br />
(Ausgewählt von Volker Anders)<br />
Tennis-Star Serena Williams spielte ihr erstes Spiel in einem Mini-Faltenrock aus Jeans-Stoff und schwarzen<br />
Tennisschuhen, die sie auch zu glatt anliegenden Stiefeln umwandeln kann. Diesem unauslöschlichen<br />
Anblick folgte zwei Tage später ein noch schockierenderes Ensemble aus einem schwarzen Lycrahöschen,<br />
nicht viel größer als ein Bikiniunterteil, und einem nietenbeschlagenen Sport-BH – eine Kombination, die man<br />
vielleicht tragen sollte, wenn man gezwungen wäre, auf dem Sitz einer Harley-Davidson Wasserball zu<br />
spielen.<br />
Die Welt braucht ihre Bewunderung von Miss Williams' Anatomie nicht mehr auf ihren prächtigen Bizeps zu<br />
beschränken. Unser Auge kann jetzt auch auf ihrem Nabel verweilen, der von einem hantelförmigen Piercing<br />
geschmückt wird.<br />
“Miss Williams' modisches Arsenal” aus The New York Times<br />
�<br />
Ihre hohe, schöne Gestalt war nicht mit dem hier in der Gegend üblichen, sondern mit dem jenseits<br />
der Grenze getragenen Festtagsgewand bekleidet. Der kurze rot und weiß gestreifte Rock ließ<br />
einen hübsch gebauten Fuß frei; um die Hüfte war eine seidene Schürze gebunden, deren<br />
zierlicher Schnitt es verriet, dass sie nicht für den gewöhnlichen Gebrauch gefertigt war; unter dem<br />
dunklen Jäckchen blickte das samtene Mieder hervor, dessen Ausschnitt nach der Landessitte das<br />
feingefaltete, blütenweiße Hemd freigab, das sich in schmaler Krause um den schönen Hals legte.<br />
Von dem unbedeckten Kopf hingen die mit einer einfachen blauen Knopfblume geschmückten<br />
Haare in zwei langen, dicken Zöpfen bis über die Hüften herab, und die Hände, die jetzt das<br />
Gesangbuch umschlossen, schienen sich noch nie mit gröberer Hausarbeit beschäftigt zu haben.<br />
Aus Karl May: Der Waldschwarze<br />
Opa, kennst du dich mit Englisch aus?<br />
Klar, Englisch kann doch jeder.<br />
Nachhilfe<br />
In unserem Workbook ist da eine Übung mit this und that und these und those. Da blick ich nicht<br />
durch.<br />
Zeig mal her. Wer hat denn dein Workbook verfasst? Aha, ein Dr. ist dabei und einer, der hinten<br />
M.A. hat. Das klingt schon mal gut.<br />
In der Schule haben wir das hier eingetragen: UThisU dog here is nice, but UthatU dog isn't.<br />
Ist doch logisch, Susi, der eine ist lieb, der andere böse. Übrigens, tolles Beispiel!<br />
Ja, aber Opa, warum beim einen this und beim anderen that?<br />
Einfach, Susi. Elementary, my dear Susi: Du merkst dir: nice und this und bös und that. Und hier<br />
eine kleine Eselsbrücke für dich: nice mit i und this mit i.<br />
Aber Opa, wie ist es dann mit Beispiel Nr. 9? Wir haben ausgefüllt: UThisU is my mum and UthatU is my<br />
dad. Ich hab's falsch gemacht. Ich hab geschrieben: UThatU is my mum and UthisU is my dad.<br />
Wieder einmal eine Frage der Logik, Susi. Wer von beiden ist jünger, wer ist älter?<br />
22
Ah, jetzt hab ich's verstanden: mum und this, dad und that! Und schau mal, wieder eine<br />
Eselsbrücke: dad und that!<br />
Super, na also. Und jetzt wollen wir das Ganze systematisch anpacken mit einer kleinen Tabelle:<br />
this that<br />
nice bös<br />
mum dad<br />
Weißt du, am besten ist immer noch, wenn wir eigene Beispiele bilden: _______ is my new father<br />
and _______ is my old mother. Versuch's mal.<br />
Mal sehen . . . meine alte Mutter ist mir lieber als ein neuer Vater. Deshalb: UThatU is my new<br />
father and UthisU is my old mother.<br />
Ausgezeichnet. Du musst nur mitdenken, dann klappt's. Und zur Kontrolle darfst du jetzt einen<br />
eigenen Satz machen.<br />
Hm . . .' Is UthisU our house? No, UthatU is our Maths teacher.' Weil, Opa, unser<br />
Haus und nice, dann aber Maths und bös mit Eselsbrücke a für that. Könnten wir auch in unsere<br />
Tabelle eintragen.<br />
Prima, Susi! Geht doch.<br />
Vielen Dank, Opa!<br />
Volker Anders<br />
Im Fachmarkt<br />
Neulich war ich mit meiner Frau im Fachmarkt. Während andere Männer zielsicher durch die Abteilungen<br />
schritten, entfuhr mir immer wieder der Seufzer:<br />
“Ach, wenn ich doch nur ein bisschen etwas von einem Heimwerker hätte!“<br />
Direkt neidisch konnte man werden, wie da Bohrmaschinen begutachtet, Schrauben ausgewählt und Latten<br />
untersucht wurden.<br />
Ich erinnere mich nicht mehr, was wir eigentlich kaufen wollten, doch dann fiel mein Blick auf<br />
Schneeschaufeln und gleich im Ständer daneben, vernünftigerweise dort, auf diese Schaber, mit denen man<br />
das Eis auf den Gehwegen zerhackt.<br />
Ich überzeugte meine Frau, dass jenes Stoßding unsere winterlichen Sicherheitsverpflichtungen ganz neu<br />
definieren würde und ebenso die Garagenauffahrt zur Hölle machen könnte, wenn wir keins haben. Nun ist<br />
es eine Tatsache, dass wir in einer Welt leben, in der man sich zurechtfinden und verständigen will. Da reicht<br />
es eben nicht, wenn man Gegenstände mit Dingsda und Dingsbums bezeichnet. Außerdem schadet es dem<br />
rhetorischen Selbstverständnis, ganz zu schweigen von dem Bild, das man nach außen abgibt.<br />
Also wie heißt das Trumm! Das Preisschild enthält keinen Hinweis. Aber der Strichcode, gescannt an der<br />
Kasse, muss Ross und Reiter auf dem Kassenzettel nennen. Da schaun wir mal. Richtig gespannt war ich.<br />
STOSS-SCHARRE – 13,99 €. Das stand drauf . . . Unglaublich – ein kräftiges deutsches Wort, urdeutsch,<br />
klipp und klar STOSS-SCHARRE; ein Wort, das es bisher noch nicht gegeben hat, erfunden von einem<br />
kreativen Deutschen, der sich nicht scheute, seine Muttersprache für einen Gebrauchsartikel zu benutzen.<br />
Dazu gehört Mut.<br />
Ehrlich gesagt, ich hätte so etwas wie CRUSH 'N' SCRATCHER erwartet, aber nein: STOSS-SCHARRE.<br />
Wie wohltuend!<br />
In der Folge nahm ich mir vor, und das ist auch richtig so, unterstützend zu wirken. Ich ließ gelegentlich in<br />
Konversationen einfließen: "Ich muss euch unbedingt meine neue STOSS-SCHARRE zeigen." oder: "So<br />
23
eine STOSS-SCHARRE ist eine feine Sache, halbe Arbeit, kann ich euch sagen." auch: "Wie ich das bisher<br />
ohne STOSS-SCHARRE geschafft habe, ist mir ein Rätsel."<br />
Ziemlich einsam steht sie noch da, meine STOSS-SCHARRE, blond und blauäugig, mit kess umgehängtem<br />
Bärenfell, das Methorn halb geleert, umgeben von welschen Gesellen, denen man nicht über den Weg<br />
trauen kann, den POWER JUICERS, den AIRWALKERS, der wilden CAPPUCCINO TOUCH PLUS NEW<br />
EDITION, den CYBER BIKES, den SOUNDMASTERS, gefolgt von der restlichen transatlantischen Horde.<br />
Da heißt es tapfer sein, meine hübsche kleine STOSS-SCHARRE.<br />
Volker Anders<br />
Betreuter Fahrdienst<br />
- Tuuuuuut . . . tuuuuuut . . . Betreuter Fahrdienst, Zentrale, Meisnitzer am Apparat . . .<br />
- Ja, hier Krönecker aus Mallersdorf. Ich müsste nächsten Donnerstag zu meinem Zahnarzt nach<br />
Schierling . . .<br />
- Donnerstag . . . Donnerstag, der 14. ? Und um wie viel Uhr?<br />
- Ich sollt um 10 Uhr dreißig dort sein.<br />
- Ja, das geht. Da haben wir noch einen Termin frei. Wenn Sie mir noch Ihre Adresse sagen, dann holt<br />
unser Fahrer Sie pünktlich ab.<br />
- Es kommt nur einer? Ich dachte, das wäre ein betreuter Fahrdienst . . .<br />
- Wieso? Natürlich nur einer. Unser Personal ist bestens geschult.<br />
- Nun, wenn es ein betreuter Fahrdienst ist, dann stelle ich mir vor, dass einer fährt und der andere ihn<br />
dabei betreut.<br />
- Nein, also das haben Sie falsch verstanden. Der fährt allein.<br />
- Wie? Ohne seinen Betreuer? Ist das nicht ein bisschen leichtsinnig?<br />
- Unser Mitarbeiter wird ja Sie persönlich betreuen.<br />
- Wieso mich? Ich will ja gar nicht fahren. Ich hätt auch keinen Führerschein.<br />
- Das ist so: Er fährt und betreut Sie.<br />
- Geht denn das? Der soll lieber auf den Straßenverkehr achten. Ich kann schon auf mich selber<br />
aufpassen, wenn ich erst mal sitze.<br />
- Also, wie ist es, soll ich jetzt den Termin vormerken oder nicht?<br />
- Ist denn das auch sicher? Ich meine, wenn Sie ihn so losschicken, ganz ohne seinen Betreuer . . .<br />
Stellen Sie sich vor, er kommt in eine Polizeikontrolle: "Aha, Betreuter Fahrdienst und wieder mal ohne<br />
Betreuer. Das haben wir gern . . ."<br />
- Also, wollen Sie jetzt oder nicht?<br />
- Wissen Sie, das muss ich mir erst noch überlegen. Ich schau mich noch etwas um, vielleicht finde ich in<br />
der Zwischenzeit einen Betreuenden Fahrdienst.<br />
Volker Anders<br />
24
Dachziegel<br />
Ein historischer Baustoff, als Wegbegleiter der menschlichen Behausung über die<br />
Jahrhunderte.<br />
Eine kurze Zusammenfassung mit Auszügen aus Schriftstücken zur Entwicklungsgeschichte.<br />
Dachziegel, das sind aus Lehm- und Tongemisch gebrannte<br />
wasserundurchlässige, flache oder gebogene Platten zur<br />
Eindeckung geneigter<br />
Dachflächen.<br />
Das Wort stammt vom<br />
lateinischen „tegula“, dem<br />
römischen Leistenziegel<br />
ab und ist damit<br />
unterschieden vom „later“,<br />
dem Backstein. Tegula<br />
führte im Englischen zu „tile“, französisch„tuile“, holländisch<br />
„tegel“, althochdeutsch „ziegal“ (zigel, Ziegel).<br />
Unterschieden werden vier Gruppen: Leisten-, Hohl-, Flach- und Falzziegel, die noch weiter differenziert sein<br />
können.<br />
Das Dach ist nicht nur ein wichtiges Funktionselemement jedes Hauses, es ist auch die charakteristische<br />
Kopfbedeckung unserer Dörfer und Städte. Die Gestaltung ist ein Ausdruck der regionalen, funktionellen,<br />
klimatischen und historischen Gegebenheiten sowie der vorhandenen Baumaterialien. Bereits im alten<br />
Griechenland wurden Dachdeckungen aus gebranntem Ton verwendet. Wann der Dachziegel erfunden<br />
wurde und von wem, ist nicht überliefert.<br />
Die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Gruppen lässt sich in ein grobes historisches Schema<br />
bringen:<br />
Leistenziegel:<br />
Der seit der Antike im Mittelmeerraum verwendete Leistenziegel verbreitete sich im Zuge der römischen<br />
Expansion um die Zeitenwende auch nördlich der Alpen. Der Leistenziegel ist eine beidseitig aufgebogene<br />
Platte, deren vertikale Stoßfugen von einem Hohlziegel (lat. imbrex) überdeckt wurde. Seine Herstellung<br />
erfolgte in truppeneigenen Ziegeleien innerhalb der Militärlager. Es wurden sowohl Dachziegel als auch<br />
Mauerziegel hergestellt. Die Ziegelform war im ganzen Imperium relativ einheitlich.<br />
Die einheimische Bevölkerung übernahm noch unter römischer Besatzung diese Technik und passte in der<br />
folgenden Zeit den Dachziegel dem vorherrschenden Klima unserer Region an.<br />
Ein gewisses Fortbestehen fand der Leistenziegel in Form des Krempziegels, in ihm verschmilzt ein<br />
Leistenziegel mit dem überdeckenden Hohlziegel.<br />
Hohlziegel (Halbschalen):<br />
Da die Hohlziegel das Dach in einzelne Rinnen gliedern, die vom First zur Traufe führen und so einen<br />
schnelleren Wasserabfluss gewährleisten, waren sie für das Klima nördlich der Alpen besser geeignet. Es<br />
gibt nur spärliche Informationen zur Bedachung im Mittelalter, z. B. folgende: Karl der Große schrieb auf der<br />
Frankfurter Synode um 794 für seine Wirtschaftshöfe Tondachziegel als allgemeine Dachdeckung fest. Um<br />
830 schrieb Rabanus Maurus: Für ihre Dächer verwendeten sie Hohlziegel (imbriculae) und Flachziegel<br />
(tegulae).<br />
Die Klosterdeckung (Mönch und Nonne) ist seit dem 12. Jahrhundert nachgewiesen und war bis zum 16.<br />
Jahrhundert besonders in Süddeutschland die verbreitetste Deckungsart.<br />
25
Flachziegel (Biberschwänze):<br />
Für die Herkunft des Flachziegel werden zwei Wurzeln angenommen, zum einen die Holzschindeln, mit<br />
deren Verbreitungsgebiet sie sich weitgehend decken, zum anderen die Leistenziegel über eine mögliche<br />
Übergangsform aus einfachen in Mörtel verlegten Platten.<br />
Im nachantiken Europa war die Ried-, Stroh- und Holzschindel-Dachdeckung allgemein üblich. Aus dem<br />
Jahre 713 hat sich eine Gesetzesvorschrift eines Langobardenkönigs über Dachziegelarbeiten erhalten:<br />
Zitat, „Und wisse, wo ein Dachziegel (tegula) hingelegt wird, gehen 15 Schindeln hin, weil 150 Dachziegel<br />
2250 Schindeln ersetzen.“<br />
Die frühesten Funde in Deutschland datieren im 11. bis 12.<br />
Jahrhundert und stammen aus dem Raum um Sindelfingen. Ab diesem<br />
Zeitraum wurde der Dachziegel nicht mehr nur für den<br />
Eigenbedarf hergestellt, sondern auch auf Vorrat produziert und<br />
verkauft.<br />
Erst im 14./15. Jahrhundert wurde in den engen Städten wegen des<br />
Brandschutzes häufiger mit Ziegeldächer gebaut. Zur Herstellung<br />
wurden Holzmodel verwendet, in die der Lehm eingeformt und<br />
mit einem Brett abgezogen wurde. Die Abmessungen waren ca. 50 mal 24 cm. Die Befestigung erfolgte<br />
durch Nagelung oder Aufhängung an einer Nase. Die heute allgemein als Biberschwänze bezeichneten<br />
Flachziegel sind flache Platten mit unterschiedlich geformten Stirnkanten (gerade, bogen- oder<br />
segmentförmig, Sechseck oder spitzbogiger Gotikschnitt).<br />
Besonders im Spätmittelalter wurden farbige Flachziegeldächer prägend für Städtebilder.<br />
Normierungsversuche blieben weitgehend vergeblich. 1888 wurde in Preußen die Norm von 36,5 x 15,5 x<br />
1,2 cm verfügt.<br />
Falzziegel:<br />
Falzziegel können von sehr unterschiedlicher Form sein, gemeinsam sind ihnen die Falze an den<br />
Längsseiten und am Kopf, deren Ineinandergreifen eine hohe Dichtigkeit gewährt.<br />
Die vielen Typen und Benennungen hat ihre Ursache in patentrechtlicher Regelung, die verlangte, dass sich<br />
jeder neuentworfene Ziegel von seinem patentierten Vorgänger unterscheidet. Die<br />
Benennung erfolgte nach dem Erfinder oder Produzenten (Gilardoni-, Ludowiciziegel), dem<br />
Ort ihrer Erfindung oder Produktion (Altkirchner-, Marseillerziegel), dem<br />
historischen Vorbild (Biberschwanz, Klosterpfanne), dem Zuschnitt und Profil<br />
(Mulden-, Herz-, Rautenfalzziegel) oder nach dem Produktionsverfahren (Strangfalzziegel).<br />
Es gab wahrscheinlich seit dem Mittelalter Bestrebungen Ziegel mit ähnlichen Vorzügen<br />
herzustellen, jedoch war eine Herstellung zu aufwendig und unrationell. Erst Anfang des 19.<br />
Jh. wurde konzentriert nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht.<br />
Technische Innovationen ab ca. 1840, wie die Erfindung der Strangfalzpresse und die Erfindung der<br />
Revolverpresse, die die zuvor gebräuchlichen Schraubenspindelpressen ablösten, waren für die<br />
Falzziegelherstellung von besonderer Bedeutung, denn sie erlaubte eine serielle Fertigung von Falzziegel,<br />
deren Vorzüge so überzeugend waren, das sie die herkömmlichen Ziegel weitgehend ablösten.<br />
Ludowici meldet 1881 sein Patent für den Falzziegel „ Z1 „ an. Es sind nicht viele dokumentierte Belege oder<br />
Fotos aus dem Zeitraum der letzten 150 Jahre erhalten, da die Herstellung in vielen kleinen Betrieben<br />
erfolgte. Ca. 1850 bis 1920 wurden in europäischen Ländern unzählige, technisch zunehmend<br />
vervollkommnete Modelle produziert. Ab den 20er Jahren des 20. Jh. setzte eine weitere Phase der<br />
Falzziegelproduktion ein, die eine weitere Perfektion der älteren Modelle ermöglichte, was besonders für<br />
geringe Dachneigungen wünschenswert wurde. Die Entwicklung neuer Modellreihen mit immer<br />
ausgefeilterem Design und filigraner Verfalzung setzt sich bis in unsere Zeit fort.<br />
Auch in unserer engeren Heimat wurden Dachziegel hergestellt, die noch heute auf älteren Gebäuden ihre<br />
Funktion erfüllen. In Greißing wurde 1896 ein Dachziegelwerk gegründet, der Standort war außerhalb des<br />
Dorfes Richtung Großaich und im Ziegelwerk in Grafentraubach wurden ebenfalls Dachziegel bis in die 60er<br />
Jahre des vorigen Jahrhunderts produziert.<br />
Johann Eschlbeck<br />
26
Geschrieben von<br />
Martha Hendlmeier, Sallach<br />
Straßenpoker<br />
Im <strong>Labertal</strong> grassiert a Epidemie.<br />
(A Gripp’ is’ net, dös wissat i!)<br />
Im Kopf der Bewohner tuat a Virus sitzn<br />
und bringt gar viele a zum Schwitzn.<br />
Sie könnan nimma denga und redn se ei,<br />
dass a Umgehungsstrass’ kannt die Lösung sei.<br />
„Der Verkehr wird mehr, es ist nimma schö“,<br />
a Kind konn’ üba d’Straß’ fast net geh’.<br />
Mia wolln wieda unsa Ruah“,<br />
so wird gschimpft in aller Fruah.<br />
Ein High-light sei auf jeden Fall<br />
eine Ortsumgehung im <strong>Labertal</strong>!<br />
Dann waar dö Aufregung glei verschwunden<br />
und man häd’ wieder ruhige Stunden.<br />
Es wird gestrittn und geschriebn,<br />
doch dös Ergebnis is stets dös Gleiche bliebn.<br />
Schilder stehn am Straßenrand:<br />
„Mia san für Haindling-Süd, alle miteinand!“<br />
Andre sagn: „Dö regionale Trasse,<br />
ist für uns ganz einfach Klasse!”<br />
Doch immer hört man dös gleiche Lied,<br />
denn gewaltig ist der Preisunterschied.<br />
Da Haindling-Süd höhere Kosten macht,<br />
gibt’s so manche Redeschlacht.<br />
A paar Bauern fürchtn um eahnan Grund,<br />
denn des Land is scho lang nimma gsund.<br />
An Anwalt ham sie glei ei’schalt,<br />
dass der mit eah dö Stellung halt’,<br />
denn man braucht a jedes Feld,<br />
drum ist dö Stilllegung jetzt abbestellt.<br />
Der Staat hat dös scho lang kapiert,<br />
dass dö Nutzfläche immer knapper wird.<br />
Es hoaßt jetzt Teller vor Tank!<br />
Doch viele ham dös no net g’spannt,<br />
sie wolln net ei’sehgn, wia ernst is dö Lag’<br />
und mosern weida alle Tag:<br />
„Wenn mia dös Geld net nehma für dö Strass’,<br />
dann kriagns andre, dös is koa Spaß!<br />
Dann werdn’s im oberen <strong>Labertal</strong> a Umgehung bau’n<br />
und mia könn ma nachischaun“.<br />
So wird argumentiert,<br />
obwohl dös Öl immer teierer wird.<br />
Wer woaß, wie lang<br />
mia so an Verkehr no ham?<br />
Dass dö Eisenbahn a no verkehrt,<br />
waar vielleicht a Übalegung wert.<br />
A Bürgerentscheid war no zum Schluss<br />
nach vui Ärger und Verdruss,<br />
doch ob’s guat wird oda geht danem,<br />
dös werdn vui vo uns gar net erlem.<br />
27
Neues von der Kreisarchäologie Straubing-Bogen - Überblick über Grabungen<br />
der Jahre 2006 und 2007<br />
Mit dem Tod des 1. Kreisarchäologen des Landkreises Straubing-Bogen Karl Böhm im Juni<br />
2005 schien vorerst eine intensive, 20jährige Spurensuche und Erforschung der frühesten<br />
Besiedlung in unserem Landkreis zu enden. Doch nach einer etwas mehr als ein Jahr<br />
dauernden Vakanz der Kreisarchäologenstelle, während der die Belange der<br />
Bodendenkmalpflege von der Außenstelle des Landesamtes für Denkmalpflege in Landshut<br />
soweit es möglich war mitbetreut wurden, wurde erfreulicherweise auf politischer Ebene die<br />
Entscheidung getroffen, zum 1. 9. 2006 die Straubinger Kreisarchäologie wieder zu besetzen;<br />
vorerst in der Form einer Halbtagstätigkeit und aufgrund der umfangreichen<br />
bodendenkmalpflegerischen Aktivitäten und anfallenden Aufgaben zum 1. 5. 2008 wieder als<br />
Vollzeitstelle. Es ist damit auch das erste Mal, dass eine der in der Mitte der 1980er Jahre<br />
geschaffenen Kommunalarchäologenstellen nicht gestrichen wurde sondern nach besetzt<br />
wurde.<br />
In den vergangenen eineinhalb Jahren, die seit der Neubesetzung ins „archäologische“ Land<br />
gegangen sind, wurden eine Vielzahl von bodendenkmalpflegerischen Maßnahmen im<br />
Landkreis betreut, von denen hier jedoch nur die wichtigsten kurz angesprochen werden können<br />
(Abb. 1). Die bereits im Sommer 2006 begonnenen Ausgrabungen im Neubaugebiet „Am<br />
Pfingstberg“ in Salching konnten aufgrund der milden Witterung bis Anfang Dezember<br />
durchgeführt und fast zum Abschluss gebracht werden. Die Ergebnisse waren recht<br />
ansprechend und erbrachten die Reste einer großen urnenfelderzeitlichen Siedlung, mit einigen<br />
Grundrissen urnenfelderzeitlicher Häuser, Siedlungsgruben und Reste von Öfen aus der Zeit<br />
zwischen etwa 900 bis 700 v. Chr.<br />
Ebenfalls ab Herbst 2006 und nach einer relativ kurzen Winterpause bis in den September 2007<br />
beschäftigte das große Neubaugebiet „Am Kirchfeld I“ der Gäubodengemeinde Aiterhofen die<br />
Kreisarchäologie Straubing-Bogen ganz intensiv. In der ca. 30.000 m² großen Fläche, die von<br />
einer Grabungsfirma und einer zweiten Mannschaft mit HARTZ IV Kräften mit Beteiligung des<br />
Landesamts für Denkmalpflege untersucht wurde, konnten eine Reihe von aufsehenerregenden<br />
Funden gemacht werden. Spektakulär und auch in der Presse vorgestellt wurde der Fund einer<br />
jungsteinzeitlichen, aufwendig verzierten Prunkaxt (Abb. 2). Dieser Axttyp, der bislang nur als<br />
Lesefunde vor allem aus dem oberösterreichischen Raum bekannt war, kann nun aufgrund der<br />
Vergesellschaftung mit besonderer Keramik erstmals auch zeitlich genauer in die Zeit um 3.300<br />
v. Chr. eingeordnet werden kann.<br />
Große Aufmerksamkeit erzielte eine spätbronzezeitliche Sonderbestattung einer jungen Frau,<br />
die etwa um 1.300 v. Chr. im heutigen Aiterhofener Kirchfeld lebte und neben zwei bronzenen,<br />
28
verzierten Spiralohrringen noch einen Bronzehalsschmuck mit einer Bernsteinperle und sieben<br />
winzig kleine Glasperlen getragen hatte (Abb. 3).<br />
Die spektakulärste Grabung des vergangenen Jahres, ein Projekt das die Kreisarchäologie noch<br />
die nächsten Jahre intensiv beschäftigen wird, fand in Riedling zwischen Oberschneiding und<br />
Oberpiebing statt. Auf einer für den Lehmabbau notwendigen Fläche, konnten große Teile einer<br />
bisher unbekannten Grabenanlage aus der sogenannten Münchshöfener Zeit, etwa um 4.300 v.<br />
Chr., aufgedeckt werden. Das Besondere an diesem großen Erdwerk ist, dass in den Gräben<br />
und auch in den daneben liegenden Gruben zahlreiche Skelette freigelegt wurden, die<br />
stellenweise mit sehr vielen Gefäßresten, zum Teil sogar mit zur Gänze erhaltenen Gefäßen<br />
niedergelegt wurden (Abb. 4). Dieses Grabenwerk, dass aus zwei langovalen Grabenzügen<br />
besteht, hat eine enorme Ausdehnung von mehr als 180 m in der O-W Richtung und 110 m in<br />
der N –S Richtung.<br />
Das Riedlinger Erdwerk, das eigentlich aus zahlreichen eng aneinander gereihten schmalen<br />
Gruben besteht, ist in seiner Größe und seiner besonderen Art, nämlich Verstorbene in die<br />
Gräben zu legen und Gefäßkonzentrationen anzulegen, bislang einzigartig in ganz<br />
Süddeutschland. Einzelne Funde kommen aus weit entfernten, anderen Kulturräumen wie aus<br />
dem Böhmisch-Mährischen Raum, aus Niederösterreich oder gar aus der ungarischen<br />
Theissebene. Funde dieser Art zeigen ganz deutlich, wie weiträumig die Verbindungen unserer<br />
jungsteinzeitlichen Vorfahren vor über 6.000 Jahren schon damals waren, wobei einer der<br />
wichtigsten Verkehrswege in den Osten wohl die Donau war.<br />
Von den zahlreichen kleineren Untersuchungen sei lediglich auf die Untersuchung einer<br />
Bauparzelle in Irlbach hingewiesen, wo die einzige mittelneolithische Kreisgrabenanlage aus der<br />
Zeit etwa um 4.800 v. Chr. nördlich der Isar zum Teil ausgegraben werden konnte.<br />
Betrachtet man sich die Karte mit den Einsatzorten, an denen im vergangenen Jahr<br />
archäologische Untersuchungen durchgeführt wurden, zeigen sich der Gäuboden und auch das<br />
<strong>Labertal</strong> stark vertreten. Einzelne Maßnahmen wurden jedoch auch im Vorwald und im<br />
Bayerischen Wald wie z. B. in Wiesenfelden oder Stallwang durchgeführt.<br />
Auch im Jahr 2008 sind bereits eine Reihe von archäologischen Ausgrabungen im Landkreis<br />
durchgeführt worden, z. B. in Aiterhofen, in Leiblfing, Feldkirchen oder Parkstetten und es ist zu<br />
erwarten, dass wie im vergangenen Jahr zahlreiche Funde und neue Erkenntnisse über die<br />
früheste Besiedlung des Landkreises Straubing-Bogen gewonnen werden können.<br />
Dr. Ludwig Husty<br />
Kreisarchäologie Straubing-Bogen, Klosterhof 1, 94327 Bogen<br />
29
Abb. 1: Einsatzorte der Kreisarchäologie<br />
Straubing-Bogen im Jahr 2007<br />
Abb. 3 Spätbronzezeitliches Frauengrab aus<br />
Aiterhofen, um 1.300 v. Chr.<br />
30<br />
Abb. 2: Steinernes verziertes Prunkbeil aus Aiterhofen,<br />
Länge ca. 14 cm um 3.300 v. Chr.<br />
Abb. 4 Münchshöfener Erdwerk, um 4.300 v.<br />
Chr. mit Lage der Skelette und<br />
Fundkonzentrationen
Buntes Allerlei<br />
von Gudrun Nixdorf<br />
Warum gibt es Schmetterlinge in so vielen Farben?<br />
Heute gibt es rund 150.000 Schmetterlingsarten und sie alle tragen besondere Farben. Die<br />
Flügel haben dazu Millionen feinster Schuppen. Bei einigen Arten enthalten sie Farbpigmente;<br />
bei anderen bricht sich darin das Licht und es wird reflektiert, wobei die verschiedensten Farben<br />
vorgetäuscht werden. Auffällige Muster in Signalfarben wie Gelb oder Rot warnen Fressfeinde:<br />
Vorsicht, ich bin giftig! Muster, die wie Augen aussehen, lassen die Schmetterlinge für ihre<br />
Feinde größer erscheinen. Wieder andere Muster schützen die Tiere, indem sie als Tarnung<br />
dienen.<br />
Warum heißt das Sandwich so?<br />
John Montagu, der 4. Earl of Sandwich hatte eine Leidenschaft: das<br />
Kartenspielen. Dabei wollte er aber nicht aufs Essen verzichten. Eine<br />
blendende Idee rettete ihn aus dieser Zwickmühle: das belegte Brot. Er ließ<br />
sich zusammengeklappte Scheiben mit Lammfleisch servieren. So konnte er<br />
beim Spielen auch noch essen. 1762 schaffte der Dauerzocker einen Rekord:<br />
er saß 24 Stunden ohne Pause am Spieltisch. Aus dieser Idee entwickelte sich das heute<br />
allseits beliebte Sandwich. Jeder Brite isst mindestens ein Sandwich pro Woche. Besonders<br />
beliebt ist hier das Tea-Time-Sandwich: Weißbrot mit Butter, Ei und kleinen Gurken.<br />
Böhmische Liwanzen (Plinsen)<br />
20 g Hefe, 30g Zucker, 500 ml (1/2 l) Milch, 250-300g Weizenmehl, 1 Ei, 1 Prise Salz, Fett<br />
Hefe mit Zucker, 4 El lauwarmer Milch und 2El Mehl zum Vorteig<br />
verrühren und an einem warmen Ort gehen lassen. Dann Ei und Salz<br />
zugeben. Alles mit dem Schneebesen schlagen, dann Mehl und Milch<br />
abwechselnd hinzufügen. Den Teig an einem warmen Ort gehen lassen,<br />
bis sich sein Volumen verdoppelt. Dann den Teig mit dem Schöpflöffel in<br />
die gefettete Liwanzenpfanne (Spiegeleipfanne) gießen und von beiden<br />
Seiten goldbraun backen. Die warmen Liwanzen mit dem Fett bestreichen und mit Zimtzucker<br />
bestreuen oder mit Powidl (Zwetschgenmus) bestreichen. Man kann sie auch mit zerdrückten<br />
Waldbeeren oder Himbeeren servieren.<br />
Frühling,<br />
Dein frisches Grün so jung und ohne Staub-<br />
So zart und doch voll Kraft Dein Laub –<br />
Nicht satt sehen kann ich mich!<br />
Möcht dich behüten und nicht lassen!<br />
Kein Herbst, kein Winter soll dich fassen,<br />
Wenn ich es hindern kann –<br />
Doch kann ich’s nicht-<br />
So muss ich mich bescheiden,<br />
Nach dir die Zeit durchleiden<br />
Und warten auf dein`<br />
Wiederkehr . ..<br />
Gudrun Nixdorf<br />
31
Heilpflanzen im <strong>Labertal</strong><br />
Ausbreitungswillige Pflanze bekämpft manches Zipperlein.<br />
Der Giersch zeigt nährstoffreiche Böden an.<br />
Die jungen Blätter würzen Suppen und Salate.<br />
Pflanzen mit dem höchsten Gehalt an ätherischen Ölen und somit dem breitesten Einsatzspektrum in der<br />
Heilkunde. Neben dieser Gruppe an Inhaltsstoffen zeichnet sich der Giersch (Aegopodium podagraria)<br />
zusätzlich durch seinen Gehalt an Kaffeesäure aus. Er enthält hohe Mengen Vitamin C und Mineralstoffe. Als<br />
Heilpflanze ist der Giersch schon seit dem Mittelalter in Verwendung, wozu er eigens in Klostergärten kultiviert<br />
wurde. Der Pflanze wird eine entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben, Deshalb findet sie zerquetscht<br />
äußerlich bei Insektenstichen und Rheuma Anwendung. In früherer Zeit war der Giersch zudem als Volksheilmittel<br />
gegen Gicht bekannt, wie der Name podagraria, was soviel wie „Zehengicht” bedeutet, oder die volkstümliche<br />
Bezeichnung „Zipperleinskraut” verdeutlichen. Eine andere Herleitung des Namens führt ihn auf die Wortgruppe<br />
podos agragia zurück, was soviel heißt wie „der Fuß im Acker”.<br />
Die Pflanzen besitzen einfache oder doppelt dreiteilige Blätter mit hohlem Stiel. Sie entstehen an Erdsprossen<br />
oder sitzen am kahlen, hohlen Stängel. Von der Blattform leitet sich vermutlich die Gattungsbezeichnung<br />
Aegopodium - aus dem Griechischen für Geißfuß - ab. Weiße, nektarführende Scheibenblumen bilden die meist<br />
in Dreizahl an den Pflanzen stehenden Doppeldolden. Der Giersch blüht in der Regel von Juni bis August. Die<br />
Bestäubung erfolgt zufällig durch herumlaufende oder sich sonnende Insekten. Jedoch bewertet man die Blüten<br />
als ausgesprochene Nektarweide für Schwebfliegen. Der Giersch liefert ein beliebtes Viehfutter, insbesondere<br />
Ziegen und Hühner bevorzugen das Kraut. Vielerorts wächst die Pflanze als Bodendecker und verhindert die<br />
Entwicklung anderer Pflanzenarten. Sein tief eindringendes Rhizom stabilisiert den Boden. Deshalb eignet sich<br />
die Pflanze ausgezeichnet zur Begrünung offener Hangflächen und Uferbereiche, um einer Erosion vorzubeugen.<br />
Die Entstehung vieler Tochterindividuen wird durch eine reiche vegetative Vermehrung über ausgedehnt und tief<br />
kriechende, weiße und brüchige Rhizom-Ausläufer gesichert. Sie erreichen Längen von über<br />
10 Metern. Werden diese unterirdischen Organe mechanisch zerteilt, wachsen aus jedem Teilstück erneut ganze<br />
Pflanzen heran. Diesen invasiven Eigenschaften kann nur durch massive Barrieren im Boden begegnet werden.<br />
Selbst im Kompost überdauert der Giersch.<br />
Die Früchte der Pflanze ähneln denen des verwandten Kümmels, weisen jedoch wie die gesamte Pflanze einen<br />
möhrenartigen Geruch auf. Aufgrund der Ähnlichkeit wurde früher Kümmel durch Gierschfrüchte verfälscht. Im<br />
Boden bleiben die Samen über viele Jahre keimfähig.<br />
Ursprünglich war der Giersch im gesamten Europa heimisch. Durch den Menschen wurde er jedoch nach<br />
Nordamerika und in die gemäßigten Klimazonen Kleinasiens verschleppt und ist dort von der Ebene bis in die<br />
Gebirge verbreitet. Das Kraut bevorzugt als Standort grundwasserfeuchten, nährstoff-, vor allem stickstoffreichen<br />
und tiefgründigen Boden. Allgemein ist es aber als ziemlich anspruchslos einzustufen und gedeiht sogar in altem<br />
Mauerwerk. Ihre optimale Wuchshöhe von über 90 Zentimetern erreicht die Pflanze an geschützten Stellen in<br />
Gärten und Parks, wo sie zum Teil dichte Rasen bildet. In diesen Lebensräumen besiedelt das Kraut<br />
vorwiegend schattige Bereiche wie Gebüsche oder den Bereich der Kronentraufe von Obstbäumen, toleriert aber<br />
auch sonnige Standorte. Außerhalb menschlicher Siedlungen kommen Gierschpflanzen in feuchten Wäldern,<br />
32
an Säumen und auf Schlägen vor. Am Rande von Wegen sowie an Waldrändern zeigt er oft<br />
Gartenmülldeponien an.<br />
Reiche Verwendungsmöglichkeiten ergeben sich aber vor allem in der Küche. Er galt<br />
lange Zeit als das Gemüse der armen Leute. Die jungen Blätter werden vor der Blüte gesammelt<br />
und gelangen als würzige Beigabe in Salate, Suppen und Eintöpfe. Die Stiele verfeinern Mischgemüsegerichte.<br />
Ebenso können die Blätter wie Spinat zubereitet werden und ersetzen im<br />
ausgewachsenen Zustand als Gewürz die Petersilie. Besonders in Kartoffelgerichten, aber auch in<br />
Kräuterjoghurt, kommt er als Zutat zum Einsatz. Bei der Wildsammlung sind Verwechslungen<br />
mit zum Teil sehr ähnlichen Arten zu vermeiden, da manche Doldenblütler für den menschlichen<br />
Organismus sehr starke Gifte enthalten. Ein Beispiel ist der Schierling (Conium maculatum),<br />
der im Vergleich zum Giersch stärker gefiederte Blätter sowie Hochblätter an der Dolde besitzt und vor allem an<br />
feuchten Stellen vorkommt.<br />
33
Die Volksschule von Upfkofen<br />
Im Jahre 1910 beschlossen Upfkofens Bürger, eine eigene Schule zu bauen, mussten doch die Kinder<br />
jeden Tag nach Inkofen einen Kilometer zu Fuß zur Schule gehen. Im Westen gelegen war der Grund, auf<br />
dem unter Regie von Baumeister Attenkofer aus Mallersdorf ein stattliches Gebäude mit einem<br />
Schulsaal, einem Werkraum und Toiletten und eine Lehrerwohnung erbaut wurde. Am 14. September<br />
1911 wurde die neue Schule eingeweiht und die Klassen eins bis sieben unterrichtet. Überliefert ist, dass<br />
erst Lehrer Mai bis 1915, von 1916 bis 1917 Lehrerin Therese Diestl und dann mehrere Generationen<br />
Lehrer Hollnberger von 1918 bis 1954 unterrichtete. Ihm folgte bis 1961 Lehrer Winfried Solf und<br />
anschließend war Lehrer Hans Kammermaier an der Schule. Als dieser aus familiären Gründen seine<br />
Lehrtätigkeit aufgab, übernahm ab 31. Januar 1963 Lehrer Hans Bäumel die Leitung der nun schon<br />
achtklassigen Volksschule. Bereits 1965 kam man mit der Gemeinde Inkofen überein, freiwillig in Inkofen<br />
die Grundstufe mit den Klassen eins bis vier beider Dörfer durch Lehrer Pohl und in Upfkofen die<br />
Oberstufe mit den Klassen fünf bis acht durch Lehrer Bäumel zu unterrichten und es gelang zur Freude<br />
aller bestens.<br />
Das Schulamt Mallersdorf stimmte dieser Regelung gerne zu und sah diesen Austausch als Vorstufe der<br />
später folgenden Schulneugliederung: 1969 Eingliederung der Volksschule Upfkofen zunächst in den<br />
Schulverband Eggmühl‐Schierling und später Umsprengelung in den Schulverband Mallersdorf‐<br />
Pfaffenberg, wo Lehrer Hans Bäumel, Upfkofens letzter Lehrer, ab September 1969 als Klasslehrer in die<br />
neu geschaffene neunte Klasse der Hauptschule Mallersdorf versetzt wurde und er 13 Jahre als<br />
Neuntklasslehrer Schüler auch aus dem Raum Bayerbach unterrichtete. Nach Konrektorenzeit in<br />
Laberweinting von 1984 bis 1987 und anschließender Schulleiterzeit der St.‐Martin‐Hauptschule<br />
Mallersdorf‐Pfaffenberg ging er 1994 in den Ruhestand, blieb aber seinem ehemaligen Schulort<br />
Upfkofen als Wohnort treu.<br />
Durch die Schulreform wurde das einst als „Prachtbau“ bezeichnete Schulhaus von Upfkofen als solches<br />
nicht mehr benötigt und wurde durch die ehemals selbständige Gemeinde Upfkofen noch vor der<br />
Gebietsreform an den Fliesenlegermeister Otto Beutlhauser verkauft und noch heute ist es im Besitz der<br />
Familie.<br />
Das ehemalige Upfkofener Schulhaus, an das sich viele Erinnerungen knüpfen.<br />
34
Die Frühsommer - Exkursion der ArGe Naherholung führte die Teilnehmer nach<br />
Haid<br />
Wissenswertes zum Ökosystem Bruchwald<br />
Zu einer Kräuterwanderung hatte die ArGe Naherholung am vergangenen Samstag<br />
eingeladen. Apotheker Klaus Storm und Kräuterpädagogin i. A. Angela Marmor führten<br />
die Gruppe fachkundig durch das Ökosystem Bruchwald. Klaus Storm erläuterte<br />
zunächst die wesentlichen Kennzeichen dieser Landschaft und ging sowohl auf die<br />
Geschichte wie auch die Problematik bei der Erhaltung von Artenreichtum in land- und<br />
forstwirtschaftlich genutzten Flächen ein. Dass Erle, Esche und Eiche markante Bäume<br />
in Au- und Bruchwald sind, wusste Angela Marmor anschaulich zu berichten. Die<br />
Teilnehmer erfuhren u. a., dass man früher aus Erlenzapfen eine dauerhafte schwarze<br />
Tinte herstellte und die Borke, wochenlang mit rostigen Eisenteilen in Wasser eingelegt,<br />
als Färbemittel Einsatz fand. Dass der Baum auch mit dunklen Mächten wie Hexerei in<br />
Verbindung gebracht wurde, sage ein alter Spruch „Erlenholz und rotes Haar sind aus<br />
gutem Grunde rar“ aus.<br />
Beim nächsten Haltepunkt hörten die interessierten Teilnehmer, dass die<br />
Knoblauchsrauke, auch Lauchhederich genannt, im Mittelalter eine bei der ärmeren<br />
Bevölkerung häufig verwendete Gewürzpflanze war und jeder konnte sich von dem<br />
Knoblauchduft der Blätter vor Ort überzeugen. Das gleich daneben vorkommende<br />
Schöllkraut hat zur Ausbreitung eine besondere Taktik. Die Samen tragen Elaiosomen,<br />
auch „Ameisenbrötchen“ genannt, und werden u. a. von Ameisen beim Transport dieser<br />
Leckerbissen verbreitet. Über den Einsatz als Mittel gegen Warzen informierte<br />
Apotheker Storm die Anwesenden. Brennnessel und Giersch fanden schon früher<br />
Einsatz nicht nur in Küche und Garten. Als Vorsitzende des Gartenbauvereins wusste<br />
Angela Marmor auch dazu Tipps und Anregungen.<br />
Vor teilweise äußerst giftigen „Doppelgängern“ warnten die Kursleiter beim Bärlauch.<br />
Hier sollten die Blätter am besten immer einzeln gepflückt werden, das schone<br />
außerdem auch die Bestände. Die Teilnehmer konnten sich vor Ort überzeugen, dass<br />
Maiglöckchen, Herbstzeitlose wie auch Aronstab sehr wohl in Bärlauchbeständen<br />
vorhanden sein können. Untrügliches Kennzeichen für den Bärlauch sei der kräftige<br />
Knoblauchgeruch, der den genannten Giftpflanzen fehle. Dennoch sei Vorsicht hier<br />
oberstes Gebot. Seidelbast, Vielblütige Weißwurz, Einbeere und Gelber Eisenhut sind<br />
ebenfalls Giftpflanzen, die in Au- und Bruchwäldern vorkommen. Die stärkehaltigen<br />
Rhizome des Knoten-Beinwell, eine Boden deckende, gelb blühende Beinwell-Art,<br />
wurden in Notzeiten gemahlen zum Brot backen verwendet, geröstet stellte man auch<br />
Kaffee-Ersatz daraus her. Wer diese Pflanze im Garten ansiedle, werde sich über den<br />
Ausbreitungsdrang nicht unbedingt freuen. Auch aus Eicheln wurde früher nach dem<br />
Entbittern Mehl und Kaffee hergestellt. Den Baumwert sah man vor Beginn der<br />
Forstwirtschaft mehr in den Früchten denn im Holz. Daher der Ausspruch: Aus den<br />
Eichen wachsen die besten Schinken! Man trieb die Schweine zur Mast in den Wald. Mit<br />
Sumpfdotterblume, Bachnelkenwurz und Roter Heckenkirsche endete die sehr<br />
informative Exkursion und man tauschte sich bei Kaffee und Brotzeit anschließend noch<br />
angeregt über das Erlebte aus.<br />
Die nächste Kräuterwanderung wird in der Presse rechtzeitig angekündigt.<br />
Von Angela Marmor<br />
35
Bläserklasse, Schulsanitäter und modernes Schulmanagement<br />
Neues aus dem Burkhart-Gymnasium<br />
Das Gymnasium wird weiterentwickelt; das gilt nicht nur für das bayerische Gymnasium<br />
schlechthin, es gilt auch für das Burkhart-Gymnasium. Noch im Schuljahr 2006/2007 wurde von<br />
Vertretern des Sachaufwandsträgers, Eltern- und Schülervertretern und den Lehrkräften nach<br />
Wegen gesucht, die Ergebnisse der Externen Evaluation umzusetzen. Das jetzt zu Ende<br />
gehende Schuljahr stand ganz im Zeichen der Weiterentwicklung der Stärken der Schule sowie<br />
der Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen. In den Fachschaften wurde diskutiert, was im<br />
Rahmen der gültigen Lehrpläne künftig als Grundwissen von jeder Schülerin und jedem Schüler<br />
jederzeit verfügbar sein müsse. Bereits existierende Grundwissenskataloge wurden gesichtet<br />
und überarbeitet, neue entstanden, so dass jetzt für viele Fächer klar ist, worauf es auch in<br />
Zukunft ankommen wird. Dabei wurde in den Fachsitzungen schon vorhandenes<br />
Freiarbeitsmaterial vorgestellt, neues arbeitet – beides mit dem Ziel, die Schülerinnen und<br />
Schüler im Fachunterricht sowie in Vertretungsstunden zu selbstständigem und<br />
eigenverantwortlichem Lernen anzuhalten und dabei Grundwissen zu sichern oder<br />
Übungsanreize zu schaffen. Ein gewaltiger Schritt für die Lehrkräfte, aber auch für die Schüler<br />
war die Umsetzung der Zfu-Stunden, in denen die Schülerinnen und Schüler lernen, miteinander<br />
zu kommunizieren, in der sie schulische oder allgemein interessierende Themen oder aktuelle<br />
Probleme besprechen, soziales Lernen einüben, die Klassensprecher wählen oder Wandertage<br />
und Fahrten planen usw.<br />
Eine Neuerung in Jahrgangsstufe 5 war die Einführung der Bläserklasse. Dieses Projekt, das es<br />
auch schon an vielen anderen bayerischen Gymnasien gibt, ermöglicht es den Schülerinnen<br />
und Schülern, im Rahmen eines erweiterten Musikunterrichts ein Instrument zu lernen – und<br />
das fast zum Nulltarif. Wer die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a, die von dieser<br />
Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, über das Schuljahr beobachtet hat, konnte erkennen, mit<br />
wie viel Begeisterung, aber auch Disziplin diese bei der Sache waren und welche Fortschritte<br />
sie mit „ihrem“ Instrument gemacht haben. Für die gesamte Schule ist die Bläserklasse ein<br />
großer Gewinn, sorgt dieses Modellprojekt doch dafür, dass es auch künftig genug Nachwuchs<br />
im Schulorchester geben wird – keine Selbstverständlichkeit mehr im achtjährigen Gymnasium.<br />
Im Schuljahr 2007/2008 wurde in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Mallersdorf-<br />
Pfaffenberg ein Schulsanitätsdienst eingeführt. Schülerinnen und Schüler aus den<br />
Jahrgangsstufen 9 bis 12, die beim Roten Kreuz ausgebildet wurden, können nun als Ersthelfer<br />
im Unterrichtsalltag und bei Sportveranstaltungen schnell und sicher eingreifen.<br />
Veränderungen stehen auch für die gymnasiale Oberstufe an. Schon im kommenden Schuljahr<br />
werden sich die Schülerinnen und Schüler der diesjährigen 9. Klassen entscheiden, welche<br />
Seminare sie in der neuen Oberstufe belegen wollen. Künftig wird es ein Fünf-Fächer-Abitur<br />
geben (verpflichtend: Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache; zwei Fächer nach Wahl,<br />
darunter ein gesellschaftswissenschaftliches Fach); trotzdem sind die Wahlmöglichkeiten groß,<br />
weshalb es umso wichtiger ist, dass alle gut über ihre Möglichkeiten informiert sind. Dies hat<br />
viele Lehrkräfte unserer Schule schon in diesem Schuljahr beschäftigt: Viele haben sich durch<br />
entsprechende Fortbildungen selbst kundig gemacht, andere waren als Referenten in solchen<br />
Fortbildungsveranstaltungen tätig, alle sind inzwischen für die Einführung der neuen Oberstufe<br />
im Schuljahr 2009/10 gut gerüstet.<br />
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer zeitgemäßen Schule war die Einführung eines<br />
36
modernen Schulmanagements: Wichtige Entscheidungen werden soweit wie möglich<br />
partnerschaftlich abgesprochen und getroffen. So haben z. B. die bayerischen Gymnasien zum<br />
kommenden Schuljahr die Möglichkeit erhalten, Nachmittagsunterricht in Abstimmung zwischen<br />
der Lehrerschaft sowie den Eltern- und Schülervertretern den Gegebenheiten vor Ort<br />
anzupassen. Am Burkhart-Gymnasium wurde im Einvernehmen mit diesen Gremien deshalb<br />
entschieden, dass von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, die Schülerinnen und<br />
Schüler der Jahrgangsstufe 5 in den Kernfächern besonders zu fördern und für alle<br />
Schülerinnen und Schüler Intensivierungsstunden in geteilten Klassen in den Fächern Deutsch,<br />
Englisch und Mathematik anzubieten. Diese sind besonders wirkungsvoll, weil sie von den in<br />
der Klasse unterrichtenden Fachlehrern in Kleingruppen am Vormittag abgehalten werden und<br />
so Lücken geschlossen oder der aktuelle Stoff geübt und vertieft werden kann. Daraus ergibt<br />
sich, dass die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen an einem Nachmittag Unterricht haben,<br />
der möglicherweise im 14-tägigen Wechsel stattfindet oder durch einen Wahlkurs so ergänzt<br />
wird, dass die um 15 Uhr verkehrenden Buslinien erreicht werden können.<br />
Auch in Konferenzen wird auf sachbezogene und zielgerichtete Gespräche Wert gelegt; sie<br />
laufen inzwischen weitgehend unter Beteiligung des Elternbeirats ab, wobei<br />
Tagesordnungspunkte, die eine Abstimmung erfordern, schriftlich vorbereitet und zur<br />
Meinungsbildung aller vorab veröffentlicht werden.<br />
Der Transparenz und dem Informationsfluss dient auch, dass die Schulleitung stets ansprechbar<br />
ist (Prinzip der „offenen Tür“); dadurch kann auf anstehende Probleme schnell reagiert werden.<br />
Die Information des Kollegiums über aktuelle Themen erfolgt außerhalb der Konferenzen und<br />
neben den Aushängen am schwarzen Brett in der sogenannten „Montagsinfo“, das ist eine<br />
kurze Zusammenkunft der Lehrkräfte jeweils montags in der 2. Pause; der Schulleiter und<br />
verschiedene Kollegen informieren über alle wichtigen Termine und Themen; die Inhalte der<br />
Montagsinfo werden unmittelbar danach auch ausgehängt.<br />
Der intensiven Pflege der Kommunikation mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft dient der<br />
eingerichtete Jour fixe mit<br />
• Direktorat: einmal wöchentlich und bei Bedarf<br />
• Personalrat: mindestens einmal monatlich, bei Bedarf auch wöchentlich; der<br />
Schulleiter und sein Stellvertreter sowie die<br />
Gleichstellungsbeauftragte und die Mitglieder des örtlichen<br />
Personalrats haben hierfür eine gemeinsame Freistunde<br />
• Elternbeirat: einmal im Monat; der Schulleiter nimmt auf Einladung auch an<br />
den Sitzungen des Elternbeirats teil<br />
• SMV: nach Bedarf<br />
Darüber hinaus nimmt der Schulleiter an den Fachsitzungen aller Fachschaften teil.<br />
Wie es schon Tradition geworden ist, präsentierte sich das Burkhart-Gymnasium auch im<br />
Schuljahr 2007/2008 nach außen mit vielfältigen Aktivitäten u. a. am „Weihnachtsbasar“ und am<br />
„Tag der offenen Tür“. Darüber hinaus gab es im zu Ende gehenden Schuljahr wiederum eine<br />
ganze Reihe von Erfolgen bei verschiedenen Wettbewerben aus den Bereichen Sport, Kunst,<br />
Wirtschaft, Deutsch und Mathematik. Außerdem wurde das Burkhart-Gymnasium in den –<br />
kleinen – Kreis der bayerischen Gymnasien aufgenommen, die den Titel „Kompetenzzentrum<br />
Film“ führen dürfen. Dies alles ist nur möglich wegen des kontinuierlich hohen Einsatzes der<br />
Lehrkräfte, denen die ganzheitliche Entwicklung der ihnen anvertrauten Schülerinnen und<br />
Schüler am Herzen liegt<br />
Vor diesem Hintergrund freut es uns natürlich, dass das Burkhart-Gymnasium das Vertrauen<br />
der Eltern am Ort und in der Region genießt, wie die wieder ansteigende Zahl der<br />
Neuanmeldungen zeigt: Im kommenden Schuljahr 2008/2009 können aus 130 neu<br />
angemeldeten Schülerinnen und Schülern 5 5. Klassen gebildet werden. In den letzten Monaten<br />
erreichten die Schulleitung zudem viele Bewerbungen von Lehrkräften, die dauerhaft am<br />
Burkhart-Gymnasium unterrichten wollen. Leider können dabei keine festen Zusagen gemacht<br />
werden, da die endgültige Zuweisung von Lehrkräften zentral von Bayerischen<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorgenommen wird.<br />
37
Hilfreich sind aber die zahlreichen Bewerbungen von Aushilfslehrkräften, die es uns, wie schon<br />
in diesem Schuljahr, ermöglichen, Unterrichtsausfall zu vermeiden, z. B. bei längerfristigen<br />
Erkrankungen von Stammlehrkräften. Damit, so denke ich, werden wir auch beim derzeitigen<br />
landesweiten Lehrermangel künftig den Unterricht für alle Klassen im vollen Umfang<br />
sicherstellen können.<br />
Insgesamt wird deutlich: Unsere Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort<br />
der Entfaltung von Kreativität, ein Ort individueller Respektierung und Verwirklichung, ein Ort<br />
des gemeinschaftlichen Erlebens und Arbeitens und ein Ort, an dem viele – Schüler, Eltern und<br />
Lehrkräfte - herausragendes Engagement zeigen und wesentlich mehr leisten, als man<br />
normalerweise erwarten kann.<br />
Herzlich danken möchte ich an dieser Stelle Familie Pritscher, die die Versorgung unserer<br />
Schülerinnen und Schüler mit schmackhaftem und gesundem Mittagessen kurzfristig zum<br />
Schuljahr 2007/2008 übernommen hat.<br />
Ein herzlicher Dank gebührt außerdem allen, die sich in diesem Schuljahr wieder mit großem<br />
Engagement für unsere Schule eingesetzt haben und uns tatkräftig und finanziell unterstützt<br />
haben: den Vertretern von Staat, Kommunen, Kirchen, Vereinen und Wirtschaft, dem<br />
Elternbeirat, dem Freundeskreis und der SMV und nicht zuletzt der ArGe Naherholung, die es<br />
mir ermöglicht hat, mit diesen Zeilen von der aktuellen Situation am Burkhart-Gymnasium zu<br />
berichten.<br />
Claus Gigl, Studiendirektor<br />
Schulleiter des Burkhart-Gymnasiums<br />
Gymnasialpreis Nachwachsende Rohstoffe 2008<br />
Prämierung herausragender Facharbeiten zum Thema Nachwachsende Rohstoffe<br />
Großer Erfolg für einen Schüler des Burkhart-Gymnasiums:<br />
Straubing, 13. Juni 2008<br />
Seit 2006 prämiert die Stiftung Nachwachsende Rohstoffe, gegründet von C.A.R.M.E.N. e.V.,<br />
jedes Jahr herausragende Facharbeiten zum Thema Nachwachsende Rohstoffe, die an<br />
regionalen Gymnasien verfasst wurden.<br />
Am Freitag, den 20. Juni 2008 werden um 14.30 Uhr sieben Abiturienten in den Räumen der<br />
Volksbank Straubing ausgezeichnet.<br />
Insgesamt 1.500 Euro Preisgeld stellt die Volksbank Straubing jährlich über die Stiftung<br />
Nachwachsende Rohstoffe zur Verfügung, um die wissenschaftliche Arbeit der Preisträger auf<br />
dem Gebiet der Nachwachsenden Rohstoffe zu würdigen.<br />
Volksbankdirektor Dietmar Küsters, Ministerialdirigent a.D. Reinhold Erlbeck,<br />
Vorstandsvorsitzender von C.A.R.M.E.N. e.V. und Mitglied des Stiftungsrates sowie<br />
Oberbürgermeister a.D. Reinhold Perlak, Vorstand der Stiftung Nachwachsende Rohstoffe<br />
nehmen die Ehrungen vor.<br />
Michael Meindl, Schüler im Burkhart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg, der in seiner<br />
Arbeit aus dem Fachbereich Wirtschaft und Recht die Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen am<br />
Beispiel der Firma Meigas in Laberweinting aufzeigt, wurde der erste Preis verliehen.<br />
Er konnte mit seinen Investitionsberechnungen und deren schlüssiger Interpretation die Jury<br />
überzeugen.<br />
Wir von der ArGe sind stolz auf die hervorragende Leistung von Michael Meindl,<br />
der beweist, dass an unserem „<strong>Labertal</strong>-Gymnasium“ gute Arbeit geleistet wird.<br />
38
Ein europäisches Schicksal<br />
Das Leben des Friedrich Zeck,<br />
geboren in Selnitz/Böhmen, gestorben in Mallersdorf/ Bayern<br />
Vor einigen Wochen überreichte mir Dr. Raimund Paleczek seine Dissertation „Modernisierung<br />
des Großgrundbesitzes des Fürsten Johann Adolph zu Schwarzenberg in Südböhmen während<br />
des Neoabsolutismus“. Dabei ergab sich fast zwangsläufig ein Gespräch über das<br />
Schwarzenbergische Forstpersonal und dessen besondere Verbundenheit mit seiner<br />
Herrschaft Schwarzenberg und sein Zusammengehörigkeitsgefühl auch nach der Vertreibung.<br />
Dabei erwähnte ich beiläufig den Namen Zeck, des langjährigen Schriftführers der<br />
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Ortsgruppe Pfaffenberg. Mein Vater Roderich Erlbeck<br />
war in dieser Zeit Ortsobmann. Herr Dr. Paleczek wusste sofort den vollständigen Namen und<br />
einige Stationen der dienstlichen Verwendung von Herrn Zeck. Er beschäftigt sich nämlich<br />
intensiv mit dem ehemaligen Personal der Herrschaft Schwarzenberg, da auch seine Vorfahren<br />
dort angestellt waren. Wenige Tage später übergab er mir seine Aufzeichnungen über Friedrich<br />
Zeck.<br />
Als österreichischer Staatsbürger geboren.<br />
Friedrich Zeck wurde am 18. September 1896 in Selnitz, einem Ort mit rund 800<br />
Einwohnern im Bezirk Dux, Gerichtsbezirk Bilin geboren. Zu dieser Zeit gehörte Böhmen zur<br />
k.u.k. Monarchie und Friedrich Zeck war bis 1919 österreichischer Staatsbürger.<br />
Sein Vater Franz Zeck war seit 1888 Schwarzenbergischer Heger in Hořany, einem kleinen Ort<br />
mit damals 250 Einwohnern bei Laun. Ab 1904 versah er seinen Dienst in Domauschitz<br />
(Domoušice). Beide Dienststellen gehörten zur Schwarzenberg- ischen Herrschaft Citoliby, an<br />
der Eisenbahnstrecke Laun-Prag, wenige Kilometer südlich von Laun.<br />
Seine Mutter, Antonia Hrdina stammte aus Žehrovice, der damaligen Schwarzen-bergischen<br />
Herrschaft Kornhaus. Sie war die Tochter des ebenfalls Schwarzen-bergischen Hegers Josef<br />
Hrdina und dessen Ehefrau Anna. Die Familie der Mutter lebte in Senkov bei Citoliby und war<br />
tschechischer Nationalität. Friedrich Zeck sprach auch deutsch und tschechisch, „böhmisch“<br />
hieß es damals im Personalbogen.<br />
Friedrich Zeck besuchte die deutsche Bürgerschule in Turn, einem Ort mit rund 15.000<br />
Einwohnern im Bezirk Teplitz-Schönau. Bis 1913 besuchte er die Kommunal-Handelsschule in<br />
Saaz, dem bekannten Hopfenbauort an der Eger.<br />
Am 01.01.1914 nahm er selbst seinen Dienst in der Schwarzenbergischen Zentralbuchhaltung<br />
in Budweis in Südböhmen als Kanzleigehilfe auf. Schon vorher hatte er dort – wie damals üblich<br />
- gegen Tageslohn gearbeitet.<br />
Für Österreich-Ungarn freiwillig Soldat, ab 1919 unfreiwillig tschechoslowakischer<br />
Staatsbürger.<br />
39
Am 28.02.1915 rückte Friedrich Zeck freiwillig zum Präsenzdienst bei der k.u.k Armee ein. Er<br />
kehrte am 30.10.1918 aus dem I. Weltkrieg zurück. Durch die Einbeziehung seiner Heimat in die<br />
Tschechoslowakei wurde er jetzt tschecho-slowakischer Staatsbürger.<br />
Ab 01.01.1919 war er dann in der Lokalrevision (Buchhaltung) der Herrschaft Postelberg tätig.<br />
Dort wurde er am 01.01.1921 zum Schwarzenbergischen Beamten befördert. Am 1. Januar<br />
1924 erhielt Friedrich Zeck den Titel “Offizial“. Am 15. April 1925 wurde er zu den<br />
Sauerbrunnen, einer Mineralwasserfirma des Fürsten Schwarzenberg in Weberschan bei Saaz<br />
versetzt. Aber schon ein Monat später wurde er wieder an das Rentamt der Herrschaft in<br />
Postelberg versetzt. Ab 1. April 1927 war Zeck am Rentamt Kornhaus tätig. Im März heiratete er<br />
Wilhelmine Pichl, geb. am 8 Mai 1899 in Postelberg. Für die Eheschließung musste er – das<br />
war Vorschrift – die „Hohe Bewilligung zur Eheschließung“ bei seinem Arbeitgeber einholen.<br />
Schon zum 1. April 1928 wurde er Rechnungsführer im Rentamt Postelberg. Zum 1. April 1933<br />
wurde Zeck an das Rentamt Lobositz versetzt und dort wurde er als Rechnungsführer in die<br />
Industrieverwaltung der Herrschaft in Lobositz übernommen.<br />
Von 1938 bis 1945 deutscher Staatsbürger, dann staatenlos.<br />
In diese Zeit fiel auch das Münchner Abkommen von 1938. Das deutsch besiedelte Sudetenland<br />
wurde gemäß Beschluss Italiens, Frankreichs und Englands an Deutschland abgetreten.<br />
Friedrich Zeck wurde nun Bürger des Deutschen Reiches. Zum 1 Januar 1942 wurde er zum<br />
Verwalter ernannt.<br />
Mit dem Ende des II. Weltkrieges fiel das 1938 an das Deutsche Reich abgetretene<br />
Sudetenland wieder an die Tschechoslowakei. Wie alle Sudetendeutschen war Zeck jetzt aber<br />
staatenlos. Nach Kriegsende, vom 3. bis zum 6. Juni 1945 verübten tschechische Milizen im<br />
Heimatort seiner Frau, in Postelberg, vom 3. bis 6. Juni ein Massaker an Sudetendeutschen,<br />
dem hunderte, darunter auch zahlreiche Jugendliche zum Opfer fielen. Am 1. August 1945, also<br />
3 Monate nach Ende des II. Weltkrieges, wurde Friedrich Zeck als Verwalter des<br />
Schwarzenbergischen Sägewerkes nach Unzmarkt in der Steiermark/ Österreich versetzt.<br />
1946 vertrieben, ab 1946 deutscher Staatsbürger.<br />
Im Schwarzenbergischen Jahrbuch von 1950 wird er aber bereits unter den Pensionisten<br />
aufgeführt. Als damaliger Wohnsitz wird Neufahrn/Ndb. Rottenburger Straße 21 angegeben. Die<br />
Familie seiner Frau, das Ehepaar Pichl lebte ja nach der Vertreibung in Pfaffenberg.<br />
In Pfaffenberg arbeitete Zeck zunächst in der damaligen Nährmittelfabrik „BeGu“, nach deren<br />
Stilllegung bis zu seiner Pensionierung bei der Firma Ertl im Regensburger Hafen.<br />
Friedrich Zeck gehörte als Schriftführer jahrelang der Vorstandschaft der Sudetendeutschen<br />
Landsmannschaft an. Er war sehr hilfsbereit und konnte zahlreichen Landsleuten bei ihrem<br />
Schriftverkehr, insbesondere bei Beschäftigungsnachweisen, in den Nachkriegsjahren behilflich<br />
sein.<br />
Er verstarb am 12. September 1990 in Mallersdorf und ist zusammen mit seiner Frau am neuen<br />
Friedhof in Pfaffenberg beerdigt.<br />
Lebenslange Verbundenheit mit seinem Arbeitgeber Fürst Schwearzenberg und seiner<br />
Heimat Böhmen.<br />
Zeitlebens war er seinem Arbeitgeber innerlich verbunden und las begierig Nachrichten in der<br />
forstlichen Fachpresse über seien ehemalige Verwaltung. Ich überbrachte ihm in den sechziger<br />
Jahren auch einmal Grüße meines Studienkollegen Fürst Karl von Schwarzenberg, jetzt<br />
Außenminister der tschechischen Republik, worüber er sich sehr freute.<br />
Friedrich Zeck lebte in zwei Jahrhunderten, erlebte den Zerfall des Vielvölkerstaates, der<br />
Österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, und die Entstehung eines neuen<br />
Vielvölkerstaates der Tschechoslowakei mit tschechischen, deutschen, slowakischen,<br />
jüdischen, ruthenischen Mitbürgern. Trotz seiner tschechischen Mutter und seiner<br />
Sprachkenntnisse wurde er 1945 vertrieben. Mit Tatkraft ging er an den Aufbau einer neuen<br />
Existenz in Bayern. Hilfsbereit stellte er sich seinen Landsleuten zur Verfügung und half<br />
manches Schicksal lindern. Innerlich war er seiner schönen Heimat Böhmen stets verbunden.<br />
Reinhold Erlbeck<br />
40
Die Echte (auch Frühblühende) Traubenkirsche (Prunus padus)<br />
Die Traubenkirsche ist eine häufig anzutreffende Gehölzart.<br />
Betörend, fast schon aufdringlich ist der Duft ihrer Blüten, wenn sie Mitte Mai erscheinen.<br />
Gelegentlich ist an ihr das massenhafte Auftreten der Raupen der Traubenkirschgespinstmotte<br />
zu beobachten, die die Bäume regelrecht kahl fressen.<br />
Der Vitalität ist dies jedoch keineswegs abträglich, weshalb von einem Einsatz der „chemischen<br />
Keule“ im Garten großzügig abgesehen werden kann.<br />
Auf ihre uralte, heute weitgehend vergessene Nutzung durch den Menschen lassen regionale<br />
Bezeichnungen wie Aletschbeere, Aalkirsche oder Ahlweide schließen.<br />
Herkunft und Verbreitung<br />
Die Traubenkirsche gehört wie auch unsere Süß- und Sauerkirsche zu den Rosengewächsen.<br />
Sie kommt von Westeuropa bis Japan, wie auch von Skandinavien bis Norditalien und in den<br />
Alpen vor. Dort erklimmt sie teilweise Höhen bis 1800 m.<br />
Sie besiedelt gerne nährstoffreiche und feuchte Böden. In lichten Stellen von Au- und<br />
Bruchwäldern ist sie deshalb fast immer anzutreffen. Aber auch in Gärten oder Parkanlagen<br />
gedeiht sie selbst im Halbschatten gut, wenn ihr ein tiefgründiger, feuchter Lehm- oder<br />
Tonboden zur Verfügung steht.<br />
Pflanzenmerkmale<br />
Als kleiner Baum oder meist mehrstämmiger Großstrauch erreicht sie eine Höhe von bis zu 10-<br />
15 m mit einer oval bis rundlichen Krone.<br />
Die Blätter sind verkehrt eiförmig, oberseits dunkelgrün, oft etwas runzelig, unterseits heller<br />
blaugrün und höchstens schwach behaart. Sie können bis zu 10 cm lang werden.<br />
Die weißen, stark duftenden Blütentrauben bestehen aus 10-20 kleinen Einzelblüten,<br />
erscheinen meist in großer Fülle von April bis Mai und sind selbstfruchtbar.<br />
Der süßliche, regelrecht aufdringliche Duft der Blüten ist ein markantes Merkmal der<br />
Traubenkirsche.<br />
Frucht<br />
Bei den Früchten handelt es sich um rundliche, schwarze, glänzende Steinfrüchte mit grubig<br />
gefurchten Steinkernen. Sie erreichen einen Durchmesser von lediglich 6-8 mm und reifen von<br />
Juli bis August. Bezüglich der Genießbarkeit der Früchte findet man in der Literatur mitunter<br />
unterschiedliche Angaben. Die Früchte haben einen bittersüßen Geschmack.<br />
Die Samen (Steinkerne) enthalten u.a. das giftige Blausäureglykosid „Amygdalin“, das auch in<br />
Rinde, Blättern und Blüten zu finden ist, während das Fruchtfleisch frei von diesen Giftstoffen<br />
ist. Von Vögeln werden die Früchte sehr gerne angenommen.<br />
Verwendung<br />
Man weiß, dass die Traubenkirschen bereits in der Stein- und Bronzezeit verzehrt wurden.<br />
Vorausgesetzt man entfernt die Steinkerne, ist eine Verarbeitung zu Saft, Mischmarmeladen<br />
oder Likör möglich.<br />
Der Geschmack wird aber nicht jeden begeistern, weshalb hier eine Verwertung nicht<br />
empfohlen wird. Es gibt zahlreiche andere Wildobstarten, die uns risikolosen und aromatischen<br />
Genuss bescheren.<br />
Früher wurde die bittere, mandelartig riechende Rinde als Abführmittel sowie gegen Rheuma<br />
und Gicht verwendet.<br />
Ein weiterer Inhaltsstoff wirkt Hustenreiz lindernd und gegen Kopfschmerzen und Herzleiden<br />
kommt die Traubenkirsche in der Homöopathie zum Einsatz.<br />
In früheren Zeiten genoss die Traubenkirsche eine mystische Wertschätzung.<br />
So half sie zur Abwehr gegen Blitz und Donner, Feinde und Neider, auch zum Fang und<br />
Vertreiben von Hexen aber auch zum Anlocken guter Geister.<br />
Ein nicht gerade feinfühliger Brauch war es im Markgräfler Land Mädchen „von schlechtem<br />
Rufe“ hinterrücks nachts einen „Faulbaum“ vor das Haus zu setzen.<br />
41
Diese und ähnliche, negativ belegte Bezeichnungen wie Stinkholer, Stinkwiede u.a. zielen auf<br />
den als unangenehm, faulig empfundenen Bittermandel-Geruch der Rinde und des frischen<br />
Holzes.<br />
Das weiche Holz ist gut polierbar und findet Einsatz bei Drechsel- und Einlegearbeiten. Die<br />
Holzkohle der Traubenkirsche taugt wie die des (echten) Faulbaums zur<br />
Schießpulverherstellung („Pulverholz“).<br />
Die zähen jungen und die einjährigen Ruten fanden früher Verwendung zum Binden und für<br />
Flechtarbeiten.<br />
Die stärkeren Ruten dienten als Stiele und Stangen für Werkzeuge sowie speziell an den<br />
bäuerlichen Leiterwagen als „Luixen“ (zum Einhängen und Abstützen der „Leiter“ zur<br />
Außenachse hin).<br />
Die Traubenkirsche ist sowohl frosthart wie auch wärmeverträglich.<br />
Als industriefestes Pioniergehölz hilft sie bei der Bodenbefestigung an abschwemmungsgefährdeten<br />
Böschungen, an Bächen und im Dünenbereich. Schnittmaßnahmen sind zwar nicht<br />
erforderlich, werden aber vertragen; das Gehölz regeneriert sich nach einem Rückschnitt sehr<br />
schnell.<br />
Als wichtiges Insekten- und Vogelnährgehölz ist, die Traubenkirsche ökologisch sehr<br />
wertvoll.<br />
Sorten und Auslesen<br />
Bezüglich der Früchte gibt es<br />
von der Traubenkirsche keine<br />
Auslesen. Einige Sorten werden als<br />
Ziergehölze veredelt.<br />
Aus Nordamerika stammt die<br />
Spätblühende Traubenkirsche<br />
(Prunus serotina), die in Europa<br />
teilweise eingebürgert ist. Für eine<br />
Pflanzung im Garten solle der<br />
einheimischen Art der Vorzug<br />
gegeben werden.<br />
Von Angela Marmor<br />
Quellenverweise: Wildobst im eigenen Garten, Helmut Pirc / Stocker Verlag, Welcher Baum ist das?, Aichele/Schwegler/ kosmos,<br />
Sträucher in Wald und Flur, Bayerischer Forstverein (Hrsg.)<br />
42
Aus der alten Heimat: Böhmerwald<br />
44<br />
Aus der alten Heimat: Erzgebirge
Frühsommerschmankerl<br />
Frischer Salat mit Erdbeeren<br />
Frische Salate (Kopfsalat, Friseesalat (grün und rot) usw.)<br />
waschen, in mundgerechte Stücke pflücken. Dazu<br />
Gurkenscheiben, Cocktailtomaten mischen. Auf großen Tellern<br />
anrichten und mit Balsamico-Öl-Senf – Dressing marinieren.<br />
Dazu frische Erdbeerviertel legen, mit rosa Pfeffer bestreuen<br />
und übergrillten Feta-Käse dazulegen. Mit frischen Kräutern<br />
bestreuen.<br />
Dazu passt frisches Baguette.<br />
Erdbeer-Mascarpone-Torte<br />
Biskuit von 4 Eiern, 100 g Zucker, 1 Vanillezucker, 90 g Mehl<br />
und 30 g Schokopudding-Pulver zubereiten und<br />
bei 180 Grad ca. 20 Min. backen.<br />
Füllung:<br />
250 g Mascarpone mit 1 Päckchen Vanillezucker und 60 g Zucker glatt rühren.<br />
4 Blatt Gelatine nach Anleitung zubereiten und dazugeben.<br />
400 g geschlagene Sahne unterheben.<br />
400 g Erdbeeren klein schneiden und unter die Sahnemasse heben.<br />
Erkalteten Biskuit einmal durchschneiden, mit Masse füllen und mit etwas Sahne und frischen<br />
Erdbeeren garnieren.<br />
eingereicht von Barbara Bauer<br />
Erdbeertraum (Obstkuchen vom Blech)<br />
Boden: 4 Eier, 2 Tassen Zucker, 1 P. Vanillezucker, 1 Tasse Mineralwasser – spritzig, 1<br />
P. Orange Finesse od. Orange Back (geriebene. Orangenschale), 1 Tasse<br />
Distelöl, 3 Tassen Mehl, 1 P. Backpulver<br />
(als Maß dient eine normale Kaffeetasse)<br />
Eier und Zucker schaumig rühren, restliche Zutaten nach und nach dazugeben und zu einem<br />
lockeren Teig verarbeiten. Gleichmäßig auf gefettetes Backblech streichen.<br />
160 °C, Umluft, ca. 20 Minuten backen, gut auskühlen lassen<br />
Belag: 600 ml Schlagsahne<br />
3 P. Sahnesteif<br />
1 P. Vanillezucker<br />
3 Becher Schmand<br />
500 g frische Erdbeeren (geviertelt)<br />
einige Blätter Zitronenmelisse und ein paar ganze Erdbeeren<br />
Sahne mit Sahnesteif steif schlagen, cremig gerührten Schmand und Zucker darunter rühren,<br />
zum Schluss vorsichtig die Erdbeeren unterheben. Masse auf dem Kuchenboden verteilen und<br />
mit Erdbeeren und Melisseblättchen verzieren.<br />
eingereicht von Angela Marmor<br />
45
Kennen Sie eigentlichen einen Problemfasan?<br />
Seit vielen Jahren schon sind wir es gewohnt, dass<br />
jedes Jahr im April ein Fasan uns die „Ehre“ seines<br />
Besuches gibt. In der Regel zwei bis drei Wochen im<br />
April machte er lautstark auf sich aufmerksam und das<br />
zumeist zwischen 5 und 6 Uhr in der Früh.<br />
Was sich heuer jedoch abspielt am Ende der Albrecht-<br />
Dürer-Straße in Geiselhöring sucht seinesgleichen. Im<br />
April kam ein Fasan mit seiner Henne und streifte<br />
täglich in den frühen Morgenstunden durch unseren<br />
Garten und brachte sich zuweilen auch vor der<br />
abendlichen Dämmerung in Erinnerung. Wir ahnten<br />
noch nichts Schlimmes, schließlich hatten wir ja die<br />
„Gewissheit“, dass der Spuk nur im April vor sich geht.<br />
Als ich diese Zeilen schreibe, haben wir aber schon<br />
den 31. Mai und ein Ende der lärmenden Besuche ist<br />
nicht in Sicht. Das ohrenbetäubende „Krk, Krk“ ist jeden Morgen zu hören, zu einer Stunde, wo man<br />
bekanntlich noch gemütlich vor sich hinschlummert.<br />
Neulich wurde es mir zu bunt. Ich ging auf den Balkon und wollte ihn mit einem nicht zu lauten „Tsch,<br />
Tsch“ verscheuchen. Der Fasan hatte jedoch nur ein „müdes Lächeln“ für mich übrigen.<br />
„Dich krieg ich aber heute“ dachte ich mir und griff urplötzlich zur Selbsthilfe. In den Balkonkästen lagen<br />
noch eine Menge Unterlegkeile vom letzten Jahr, mit denen ich die Blumenkästen immer etwas erhöht<br />
habe. Mit dem ersten Wurf lag ich noch ziemlich daneben (kein Wunder um 5 Uhr früh). Mit dem zweiten<br />
„Geschoss“ wollte ich ihm schließlich einen auf den „Pelz“ brennen. Wieder nichts, der Fasan<br />
begutachtete lediglich die kleine Holzplatte und weiter ging es mit seinem Geplärr.<br />
Wenige Tage später dann die absolute Frechheit unseres „geliebten Federviehs“. Er geht zwei<br />
Terrassentüren ab und pickt mit seinem Schnabel an das Holz nach dem Motto „Mach das ja nie wieder“.<br />
Als zusätzliche Rache für meine Wurfgeschosse hinterließ er zugleich drei „schöne und gut riechende<br />
Häufchen“ direkt von der Wohnzimmertüre.<br />
Was tun? Die Nachbarschaft zuckt ebenso hilflos mit den Schultern und beklagt den allmorgendlichen<br />
Radau. Der Sepp meinte schließlich lapidar „Wenn der so weitermacht, ist des unser nächster<br />
Sonntagsbraten“. Ob dies freilich so einfach geht? Die deutschen Waffengesetze sind streng und ob sich<br />
der Jagdpächter die Mühe macht, unserem „Freund“ in aller Herrgottsfrüh den Garaus zu machen?<br />
Bisher haben wir ihn noch nicht gefragt.<br />
Irgendwie haben wir uns fast schon an ihn gewöhnt. Als ich neulich im Garten in der Laberzeitung<br />
blätterte, stand er lediglich 1 bis 2 m neben mir. Sein blödes „Krk, Krk“ ertönte nur wenn ich umgeblättert<br />
habe. Wahrscheinlich ging ihm dies zu schnell. Von meinem Freund Klaus Storm hat unser Sohn Martin<br />
vor Jahren mal einen Tier- und Pflanzenführer geschenkt bekommen. Dort heißt es über den Fasan:<br />
„Vom Fluss Phasis in Kolchis (Kleinasien) sollen die Argonauten den Fasan nach Griechenland<br />
mitgebracht haben“.<br />
Wer auch immer die Argonauten waren; hätten die doch diesen „Vogel“ zuhause gelassen, denke ich mir<br />
oft.<br />
Im Sommer 2006 machte der Braunbär Bruno als „Problembär“ Schlagzeilen. Einen „Problemfasan“ gibt<br />
es in den Medien noch nicht. Wir in der Albrecht-Dürer-Straße haben ihn aber. Einen Namen haben wir<br />
unseren „Problemfasan“ noch nicht gegeben. Vielleicht kommt das noch und wir können ihn zurufen<br />
„Bruno schleich dich endlich“. Aber halt, dass passt nicht so ganz, schließlich heißt unser anderer<br />
Nachbar ebenfalls Bruno. Stellen Sie sich vor, ich ruf frühmorgens um 5 „Bruno schleich dich“ vom<br />
Balkon..........<br />
P.S.: Der nächste „Problemvogel“ ist bereits im „Anflug“. Ein „Starl“ macht es sich seit Tagen auf unserem<br />
Kirschbaum bequem und vertilgt die noch nicht mal reifen Kirschen mit einer Wonne, die mich auf die<br />
„Palme“ bringt. Wahrscheinlich organisiert er demnächst seine „gefiederten Freunde“ und für uns bleibt<br />
dann nur mehr ein kümmerlicher Rest.<br />
Alois Lederer<br />
46
Berlin – einfach bärenstark!<br />
Auf Einladung von MdB Ernst Hinsken machten sich Ende April über 50 Reiselustige und<br />
Informationshungrige aus Mallersdorf-Pfaffenberg auf den Weg in die Bundeshauptstadt Berlin.<br />
Die Fahrt war nicht beschränkt auf Mitglieder des CSU-Ortsverbandes, sondern offen auch für<br />
Nichtmitglieder.<br />
Die Reiseleitung hatte Hermann Salzberger jun. inne, der sich über drei Tage hinweg nicht nur<br />
als profunder Kenner von Berlin erwies, sondern dafür sorgte, dass alles „wie am Schnürchen“<br />
klappte. Gewöhnungsbedürftig war nur die frühe Abfahrt um 4 Uhr in der Früh. Wie sich aber<br />
später herausstellte, war dies<br />
keine Minute zu früh. In Berlin<br />
saß nämlich MdB Ernst<br />
Hinsken schon wie „auf<br />
Kohlen“. Im Paul-Löbe-Haus,<br />
welches 1997 bis 2001 nach<br />
den Plänen des Architekten<br />
Stephan Braunfels erbaut<br />
wurde, erwartete der<br />
„Stimmenkönig“ aus Haibach<br />
die Gäste aus dem <strong>Labertal</strong>.<br />
In diesem sehr modernen,<br />
lichten und langgestreckten<br />
Haus beraten die Ausschüsse<br />
des Deutschen Bundestages<br />
und Ernst Hinsken „tagte“ mit<br />
der Delegation aus<br />
Mallersdorf-Pfaffenberg im<br />
Saal, in dem normalerweise<br />
der Tourismusausschuss<br />
zusammenkommt.<br />
Im Bundesministerium für<br />
Wirtschaft und Technologie, in dem Hinsken als Tourismusbeauftragter der Bundesregierung<br />
sein Büro hat, machte dieser seinen Namen als „Bayerwaldturbo“ wieder mal alle Ehre. Im<br />
Schnellverfahren – am gleichen Nachmittag musste er in Straubing bei einer wichtigen Sitzung<br />
sein - jagte er die Reisegruppe durch dieses Amt mit seinen rund 150 Referaten und rund 1500<br />
Mitarbeitern. Rund 500 davon sitzen aber in Bonn. Hinsken erläuterte uns den Aufbau des<br />
Ministeriums und gegen 13 Uhr waren wir alle sichtlich froh, etwas für den gestressten Magen<br />
zu bekommen. Das Mittagessen, gesponsert vom Abgeordneten aus Haibach in der „Kantine“<br />
des Ministeriums, schmeckte wirklich nicht schlecht.<br />
Die <strong><strong>Labertal</strong>er</strong> mit MdB Ernst Hinsken im<br />
Paul-Löbe-Haus<br />
Ein wirkliches Highlight war anschließend der Besuch des Berliner Domes. Das Kaiserliche<br />
Treppenhaus schmücken neun Wandbilder zum Leben Jesu Christi sowie vier Deckengemälde<br />
mit Gleichnissen aus dem Neuen Testament. Neben der großen Predigtkirche konnten wir auch<br />
einen Blick in die Tauf- und Traukirche werfen und beinahe etwas erholen vom „Hinsken-<br />
Marathon“. Die Hohenzollerngruft durfte bei unserem geführten Rundgang natürlich ebenfalls<br />
nicht fehlen. Sie stellt mit ihren Särgen und Sarkophagen vom 16. bis zum beginnenden 20.<br />
Jahrhundert ein seltenes und kostbares Kunst- und Kulturgut dar.<br />
Der Abend am ersten Tag stand zur freien Verfügung und die meisten nutzten ihn für einen<br />
Besuch des Musicals „Mamma Mia“. Das Theater am Potsdamer Platz lag nur wenige<br />
Gehminuten vom Hotel entfernt.<br />
Der Samstag war reich an Höhepunkten. Der Deutsche Bundestag ist das Herz unserer<br />
Demokratie. Dies empfanden nahezu alle der Reiseteilnehmer. „Dem Deutschen Volke“ steht<br />
über dem Westportal des Reichstagsgebäudes und ganze Menschenschlangen stehen an, um<br />
einmal auf die Reichstagskuppel zu gelangen. Wir waren beeindruckt von diesem Gebäude und<br />
es stimmt wirklich „Ein modernes Parlament im historischen Mantel“. Im Plenarsaal machten wir<br />
es uns bequem und die Schilderungen eines Mitarbeiters des Besucherdienstes des<br />
47
Bundestages waren beeindruckend und<br />
informativ zugleich und so konnte man es<br />
auch verschmerzen, dass an diesem Tag<br />
keine Plenarsitzung war.<br />
Anschließend bot sich uns von der Kuppel<br />
des Reichstages ein fantastischer Rundblick.<br />
Zu erkennen waren nicht nur das Hochhaus<br />
der Charite, sondern auch der Bahnhof<br />
Friedrichstraße, das Rote Rathaus, das<br />
Brandenburger Tor und vieles mehr. Zu Fuß<br />
gelangte man über eine sanft ansteigende<br />
Rampe und auf 47 Metern Höhe konnte man<br />
Im Plenarsaal<br />
Berlin bei bestem Wetter genießen. Die<br />
Glaskuppel misst einen Durchmesser von 40<br />
Metern. Vom Kuppelfuß kann man auch in<br />
den Plenarsaal hinuntersehen.<br />
Keine Wünsche offen blieben am<br />
Nachmittag bei der Stadtrundfahrt. Die „Dame am Mikro“ redete unaufhörlich. Das positive<br />
dabei: Es war alles im höchsten Maße interessant. Während der Busrundfahrt wurde eines<br />
offenbar: Berlin ist eine Stadt der Kontraste. Man findet elegante Boulevards und alternative<br />
Szeneviertel, königliche Palais und kaputte Fassaden. Eine Stadt mit Tempo, Temperament und<br />
Turbulenzen. Auch Reste der Berliner Mauer wurden uns gezeigt und erinnerten uns an die<br />
dunkle Vergangenheit.<br />
Die Fahrt auf den Fernsehturm am Alexanderplatz unterbrach die Rundfahrt und was sich uns<br />
dort bot, war erneut grandios und zeigte die Weitläufigkeit dieser Metropole. Die verglaste<br />
Kugel, in der wir rundum gingen, weist einen Durchmesser von 32 m auf. Hier befanden wir uns<br />
auf 207 m. Weiter ging es über den „Tiergarten“ zu Schloss Bellevue, dem Sitz des<br />
Bundespräsidenten. Auf dem „Kuhdamm“ waren an diesem Samstag wahre Menschenmassen<br />
unterwegs. Das Botschafterviertel unterstrich, dass die Bauwirtschaft in Berlin in den letzten<br />
Jahren wahrscheinlich nicht zu klagen hatte.<br />
Am Sonntag, dem letzten Reisetag, stand schließlich die Besichtigung der Gedenkstätte<br />
Hohenschönhausen, besser bekannt als Stasigefängnis, auf dem Programm. Allesamt, die nach<br />
dem Rundgang herauskamen, waren tief beeindruckt. Unglaublich was sich hier in den<br />
zurückliegenden Jahrzehnten an grausamer Folter abspielte. Die Infos bekam man sozusagen<br />
aus „erster Hand“, weil zwei früher unschuldig eingesperrte Insassen uns durch dieses Lager<br />
führten.<br />
Im Ratskeller von Köpenick konnten wir nochmals so richtige Berliner Gastfreundschaft erleben.<br />
2. Bürgermeister Hans Trepesch dankte bei der Heimfahrt dem Organisator Hermann<br />
Salzberger für dessen perfekte Reiseleitung. Letzterer hatte zudem noch eine Überraschung im<br />
Bus parat. Ein spezielles Berlin-Quiz sorgte für Kurzweil. Als Sieger ging Siegfried Limmer aus<br />
Oberroning hervor. Als Belohnung gab es eine „russische Kopfbedeckung“.<br />
Das Fazit am Ende war kurz und prägnant: Berlin, diese Metropole von europäischem Rang,<br />
war wirklich eine Reise wert.<br />
„Berlin ist mehr ein Weltteil als eine Stadt“, so sprach der Dichter Jean Paul. Er musste auch<br />
wissen, lebte er doch von 1800 bis 1801 in Berlin ?!?!<br />
Alois Lederer<br />
48
Impressum<br />
Herausgeber: ArGe Naherholung <strong>Mittleres</strong> <strong>Labertal</strong> e.V.<br />
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg<br />
Bankverbindungen:<br />
Sparkasse Mallersdorf Kto.-Nr.5001137 (BLZ 743500000) „<strong><strong>Labertal</strong>er</strong> <strong>Igeleien</strong>“<br />
1. Vorsitzender: Klaus Storm (08772/224) – E-Mail: Klaus.Storm@t-online.de<br />
2. Vorsitzender: Johann Bachmeier (09423/2434)<br />
Beiratsvorsitzender: Andreas Stöttner (08772/96080)<br />
Geschäftsführer: Ludwig Karl (08772/96120)<br />
Schatzmeister: Josef Braun (08772/1237)<br />
Arbeitsgruppe: Hermann Albertskirchinger (08772/5690<br />
Redaktion: Klaus Storm, Mallersdorf-Pfaffenberg<br />
Schlussredaktion: Richard Stadler, Hofkirchen<br />
Druck: Fischer Geiselhöring<br />
Auflagenhöhe: 800 (Juni 2008)<br />
Wir danken unseren Sponsoren:<br />
000<br />
Stadt Geiselhöring; Markt Mallersdorf-Pfaffenberg; Gemeinde Laberweinting; Kloster<br />
Mallersdorf; Sparkasse Mallersdorf; Volksbank Straubing / Pfaffenberg; Familie Bittner;<br />
Damenrunde Mallersdorf; Mallersdorf; , Mallersdorf; Druckerei Fischer, Geiselhöring;<br />
Lilo Fromm, Dingolfing; Waltraud Gerlich, Pfaffenberg; Dr. Eduard Goß, Laberweinting;<br />
Rosamunde Huber, Laberweinting; Huber-Mühle, Oberlindhart; Karl Lippert,<br />
Pfaffenberg; Ingrid Michel, Bärenapotheke Straubing; Manfred Morhard, Pfaffenberg;<br />
Dr. Hermann Pickl, Mallersdorf; Brauerei Stöttner, Pfaffenberg; Therapiezentrum Stoll,<br />
Pfaffenberg; Hilde Weigl, Mallersdorf; Familie Wisznewski, Habelsbach;<br />
000<br />
Das Lesejournal der ArGe Naherholung kann und will keine Konkurrenz zur<br />
Tagespresse sein. Es ist vielmehr eine Möglichkeit, in der Zusammenstellung,<br />
Reihenfolge, persönlichen Gestaltung, im Umfang und vom Inhalt der Beiträge her eine<br />
Nachlese anzubieten und Zusatzinformationen zu geben. Es will ein “Buntes Allerlei“<br />
darstellen, das aus dem Bereich der ArGe Naherholung und ihrer Aktivitäten wie auch<br />
über Interessantes aus dem Mittleren <strong>Labertal</strong> und den benachbarten Gebieten<br />
berichtet. Auch einmal über den Zaun hinauszuschauen soll nicht verwehrt sein.<br />
Die “<strong><strong>Labertal</strong>er</strong> <strong>Igeleien</strong>“ erscheinen zweimal im Jahr, und zwar im Frühjahr und im<br />
Herbst. Ansprechende und im Umfang passende Beiträge werden gerne angenommen.<br />
Sie sollten etwa jeweils bis Ende März bzw. September bei der Redaktion vorliegen.<br />
Beiträge sind an den Vorsitzenden oder den Geschäftsführer zu richten. Jeder Beitrag<br />
soll insgesamt (mit schon platziertem Bildmaterial) ein bis zwei DIN A4 Seiten (2cm<br />
Rand) umfassen und muss druckfertig als Winword Datei auf CD-Datenträger<br />
vorliegen. Das Bildmaterial geht in den Besitz der ArGe über. Die Beiträge geben die<br />
Meinung der Verfasser wieder.<br />
000<br />
49