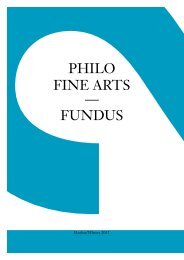Die Lust am Unseriösen - Philo Fine Arts
Die Lust am Unseriösen - Philo Fine Arts
Die Lust am Unseriösen - Philo Fine Arts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FUNDUS 20<br />
Wolfgang Müller<br />
Subkultur West-Berlin 1979–1989<br />
Freizeit<br />
250 Seiten, Abbildungen<br />
Gebunden mit Lesebändchen, € 14<br />
ISBN 978 865726711<br />
Wolfgang Müller<br />
Subkultur<br />
West-Berlin<br />
1979–1989<br />
Freizeit<br />
4 5<br />
WestBerlin war preiswert, trashig, muffig, marode: voll kreativer Freiräume für<br />
Lebensexperimente jenseits ökonomischen Drucks. Angeschoben von den Impulsen<br />
des Punk, entwickelt sich dort Ende der Siebziger eine vielfältiglustvolle<br />
Subkultur. Illegale Bars und Clubs werden eröffnet, Fanzines kopiert, Super<br />
8Kinos, Bands und Minilabels in besetzten Häusern gegründet. Das SO 6 in<br />
Kreuzberg wird neben Punkclubs wie Risiko oder der NewWaveDisko Dschungel<br />
zum Treffpunkt der »Antiberliner«: Punks, Alternative, Industrial und Elektronikfans,<br />
Politanarchos, Lesben, Schwule, Queers und DoityourselfKünstler.<br />
In diesem »diasporischen« Umfeld verkehren auch Heidi Paris und Peter<br />
Gente, in deren Merve Verlag 1982 das Manifest des subkulturellen WestBerlin,<br />
Geniale Dilletanten, erscheint – benannt nach der »Großen Untergangsshow« im<br />
Tempodrom. Es treten u.a. auf: Gudrun Gut, <strong>Die</strong> Tödliche Doris und <strong>Die</strong> Einstürzenden<br />
Neubauten, aber auch das »Mädchen vom Bahnhof Zoo« Christiane<br />
F. und die späteren TechnoAkteure Westb<strong>am</strong> und Dr. Motte. Herausgeber des<br />
MerveBändchens Nr. 101 ist Wolfgang Müller (<strong>Die</strong> Tödliche Doris). Seine Band<br />
spielt sowohl in besetzten Häusern als auch in Kunstkontexten, etwa bei Harald<br />
Szeemanns Ausstellung Der Hang zum Ges<strong>am</strong>tkunstwerk oder auf der documenta 8.<br />
Müllers Geschichte der Westberliner Subkultur simuliert keine distanzierte Objektivität,<br />
ist aber weit mehr als Akteursbericht. Er wendet sich den Umschlagplätzen<br />
zu, den Materiallagern, den Flohmärkten, erinnert an illegale Kulturstätten<br />
wie den Kuckuck und portraitiert Szeneakteure wie RattenJenny, die 1978 Martin<br />
Kippenberger attackierte. D<strong>am</strong>it präsentiert er WestBerlin als Produktionsraum,<br />
in dem sich Bewegungen kristallisierten, atomisierten und erst später zu breit<br />
wahrnehmbar bis heute wirkenden Gebilden formten.<br />
Wolfgang Müller, 1957 geboren, lebt als<br />
Künstler, Musiker und Autor in Berlin.<br />
Er war Mitglied der Gruppe <strong>Die</strong> Tödliche<br />
Doris und Herausgeber des (nicht allein<br />
wegen des Rechtschreibfehlers im Titel)<br />
legendären MerveBändchens Geniale<br />
Dilletanten (1982). Er hat zahlreiche Ausstellungen,<br />
Hörspiele und Platten gemacht,<br />
und ist Autor u.a. der Bücher Hormone des<br />
Mannes (1995), Neue Nord-Welt (2005),<br />
Neues von der Elfenfront (2007) und Valeska<br />
Gert. Ästhetik der Präsenzen (2010).<br />
Philipp Felsch<br />
Merve oder<br />
Was war Theorie?<br />
Wer kennt sie nicht – die kleinen Bücher mit der Raute, die sich spätestens beim<br />
zweiten Mal lesen selbst zerstören? In den siebziger und achtziger Jahren gehörten<br />
sie als unverzichtbares LifestyleAccessoire in jede Manteltasche. Es war die Zeit<br />
der apokalyptischen Meisterdenker, der gl<strong>am</strong>ourösen Unverständlichkeit und<br />
der umstürzenden Lektüreerlebnisse. Der Merve Verlag versorgte die Frontstadt<br />
WestBerlin mit Theorie. Von den Nachzüglern der Studentenbewegung über<br />
Spontis und Punks bis zum Kunstbetrieb bek<strong>am</strong>en sie alle ihr gefährliches Denken:<br />
italienischen Marxismus, französischen Poststrukturalismus, eine Prise Carl<br />
Schmitt und zu guter Letzt Luhmanns ultimativ ausgenüchterte Systemtheorie.<br />
Heute, in der einbrechenden Theoriedämmerung, ist es Zeit, dieses Abenteuer zu<br />
erzählen. Dabei geht es nicht darum, sich klassisch ideengeschichtlich noch einmal<br />
im Dschungel der Typoskripte zu verlaufen. <strong>Die</strong> Geschichte des Merve Verlags<br />
lenkt den Blick auf die schillernden Oberflächen, die Rituale und Produktionsverhältnisse<br />
der Theorie. Warum wurden Leser zu Fans und Autoren zu Denkstilikonen?<br />
Hat Theorie von der historischen Delegitimierung der Poesie profitiert?<br />
Warum wanderte sie von der Politik in die Kunst? Welche Rolle spielte Adorno?<br />
Und warum fingen irgendwann alle wieder mehr zu trinken an? Das Buch folgt<br />
den verschlungenen Pfaden einer (Sub)Kultur, der die Welt zum Text wurde.<br />
FUNDUS 204<br />
Philipp Felsch<br />
Merve oder Was war Theorie?<br />
220 Seiten<br />
Gebunden mit Lesebändchen, € 14<br />
ISBN 978 865726728<br />
Philipp Felsch, 1972 geboren, ist<br />
Wissenschafts und Kulturhistoriker,<br />
selbst MerveLeser und lebt in Berlin.<br />
Er ist Autor der Bücher Laborlandschaften.<br />
Physiologische Alpenreisen im 19. Jahrhundert<br />
(2007) und Wie August Petermann den<br />
Nordpol erfand (2010).