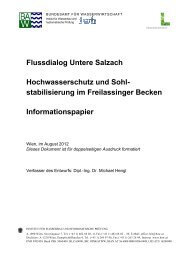Wasserwirtschaftliche Rahmenuntersuchung Salzach
Wasserwirtschaftliche Rahmenuntersuchung Salzach
Wasserwirtschaftliche Rahmenuntersuchung Salzach
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorwort<br />
Die <strong>Salzach</strong> befindet sich flussabwärts der Saalachmündung in einem Erosionszustand, der sowohl aus<br />
wasserwirtschaftlicher als auch aus ökologischer und naturschutzfachlicher Sicht eine Sanierung des<br />
Flusses unbedingt erforderlich macht. Der unbefriedigende Zustand der <strong>Salzach</strong>, insbesondere die starken<br />
Eintiefungstendenzen, führen von Jahr zu Jahr zu weiteren Verschlechterungen. Ein großes Hochwasser<br />
kann schwere Schäden verursachen, die voraussichtlich nur mit hohem technischen und finanziellen<br />
Aufwand behebbar wären.<br />
Die Ständige Gewässerkommission, eingerichtet auf der Basis des Regensburger Vertrags zwischen<br />
Deutschland und Österreich, veranlasste deshalb Anfang der 90er Jahre die "<strong>Wasserwirtschaftliche</strong> <strong>Rahmenuntersuchung</strong><br />
<strong>Salzach</strong> (WRS)" mit der Zielsetzung, Maßnahmen zur Sanierung der <strong>Salzach</strong> im Bereich<br />
von der Saalachmündung bis zur Mündung in den Inn zu entwickeln.<br />
Der Auftrag dazu erging an die Sachverständigen-Arbeitsgruppe "Wassermengenwirtschaft, Wasserbau".<br />
Die Durchführung der Untersuchung wurde einer ad-hoc Arbeitsgruppe übertragen. Die komplexe Aufgabenstellung<br />
für die nahezu 60 km lange Flussstrecke erforderte eine Vielzahl von Detailuntersuchungen<br />
bis hin zum Einsatz modernster, teilweise erst zu entwickelnder mathematischer und physikalischer Methoden<br />
und Modelle.<br />
Um die Fülle der Ergebnisse der <strong>Rahmenuntersuchung</strong> der interessierten Öffentlichkeit und der Fachwelt<br />
zugänglich zu machen, dient eine eigene Schriftenreihe bestehend aus einem Zusammenfassenden Bericht<br />
und zwölf Fachberichten. Der Zusammenfassende Bericht vermittelt einen Überblick über die flussmorphologischen<br />
und gewässerökologischen Probleme der <strong>Salzach</strong>, die Konzeption und Durchführung der<br />
Planung sowie die erarbeiteten Lösungen. Die übrigen Berichte informieren vor allem über die Erhebung<br />
und Verwertung der Grundlagen, die Entwicklung und Anwendung der eingesetzten Methoden und Instrumente<br />
sowie die Bewertung der Varianten und Lösungen. Die Fachberichte, ihre Verfasser und die<br />
Bezugsquellen sind in der folgenden Tabelle angegeben.<br />
Die Sprecher der Sachverständigen-Arbeitgruppe "Wassermengenwirtschaft, Wasserbau":<br />
Wien, im Dezember 2000 München, im Dezember 2000<br />
Franz König Jens Jedlitschka<br />
Ministerialrat Ministerialrat
3 Datengrundlage und Modelleichung<br />
3.1 Geländedaten<br />
Die Modellierung des Geländes im 2d-Berechnungsnetz wurde für die Flussläufe der <strong>Salzach</strong>, Saalach<br />
und der kleineren Nebenflüsse Sur und Götzinger Achen getrennt von der Modellierung der Vorländer<br />
vorgenommen. Während für die Vorländer ein umfangreiches Digitales Geländemodell (DGM) erstellt<br />
wurde, werden Flussläufe aus terrestrisch aufgenommenen Flussquerprofilen konstruiert.<br />
3.1.1 Digitales Geländemodell der <strong>Salzach</strong>auen<br />
3.1.1.1 Beschreibung des Digitalen Geländemodells<br />
Im Frühjahr 1991 wurde ein Bildflug im Maßstab 1:15.000 durchgeführt, der das gesamte <strong>Salzach</strong>tal<br />
von der Saalachmündung bis zur Mündung in den Inn abdeckt. Aus den hierbei entstandenen Luftbildern<br />
wurde die photogrammetrische Auswertung und DGM-Erstellung durchgeführt. Die Projektvergabe<br />
und die Kontrolle der Ergebnisse erfolgte durch das Bayer. Landesvermessungsamt. Die Leistungen<br />
umfassten die Messung eines regelmäßigen Gitters mit der Maschenweite 20 m in X- und Y-<br />
Richtung (Raster-DGM) sowie die Messung von markanten Einzelpunkten, Geländekanten, Geripplinien,<br />
Böschungen und sonstigen Linienelementen (Struktur-DGM). Tabelle 3.1 zeigt die aufgenommenen<br />
Strukturobjekte. Bedingt durch die beiden Auftraggeber Bayern und Österreich erfolgte die<br />
DGM-Erstellung in drei Teilabschnitten. Einen Eindruck von der erfassten Datenmenge gibt Tabelle<br />
3.2. Aufgelistet wird die Anzahl der Rasterpunkte sowie die Anzahl der Strukturobjekte, getrennt<br />
nach den Abschnitten Freilassing-Laufen, Laufen-Burghausen und Mündungsbereich. Dem DGM<br />
liegen unterschiedliche Koordinatensysteme zugrunde. Während sich das System Deutschlands auf den<br />
Null-Meridian bei Greenwich bezieht, liegt der Bezugsmeridian Österreichs am westlichsten Punkt<br />
Europas, der kanarischen Insel Hierro. Auch das Höhensystem der Länder ist unterschiedlich: Deutschland<br />
bezieht sich zur Bestimmung des Normal-Null-Niveaus auf den Pegel Amsterdam, während sich<br />
das österreichische Netz auf den Pegel Triest bezieht. Die Höhendifferenz beträgt im <strong>Salzach</strong>gebiet ca.<br />
27 cm. Um jeweils den an der <strong>Wasserwirtschaftliche</strong>n <strong>Rahmenuntersuchung</strong> <strong>Salzach</strong> beteiligten österreichischen<br />
und bayerischen Behörden für ihre Arbeiten ein einheitliches DGM zur Verfügung zu stellen,<br />
übernahm das Bayer. Landesvermessungsamt die Koordinatentransformation. Die Höhengenauigkeit<br />
des DGM beträgt im Mittel ca. 25 cm, der Toleranzwert wird mit 50 cm angegeben.<br />
Tabelle 3.1 Strukturobjekte des <strong>Salzach</strong>-DGM<br />
Gewässer See<br />
Weiher<br />
Uferlinie Fluss<br />
Uferlinie Bach > 3 m<br />
Achse Bach < 3 m<br />
Morphologie Markante Höhenpunkte (Mulde, Sattel, Kuppe)<br />
Natürliche Böschung (Ober- und Unterkante)<br />
Künstliche Böschung (Ober- und Unterkante)<br />
Geländekante bei Neigungswechsel<br />
Mulde<br />
Rücken<br />
Bauwerke Wehr<br />
Stauanlage<br />
Brückenpfeiler<br />
Stützmauer<br />
Deich<br />
Buhne<br />
14
(1) Fließgewässer<br />
Erste Ergebniskontrollen der 2d-Berechnung an der <strong>Salzach</strong> erbrachten, dass beim absteigenden Ast<br />
einer Hochwasserwelle große Flächen trotz Anschluss an ein Fließgewässer nicht wieder trocken fallen.<br />
In der Folge wurden die Hauptgewässerlinien analysiert, und fehlende Verbindungen der Abschnitte<br />
wurden hergestellt. An 13 Bachabschnitten im Gebiet Freilassing-Laufen und an 17 Bachabschnitten<br />
im Gebiet Laufen-Burghausen wurde eine Glättung des Längsschnitts vorgenommen, indem<br />
mit Hilfe des Programms EXCEL vorwiegend Polynome 3. Grades als Trendlinie angepasst wurden.<br />
Ein Beispiel zeigt Abbildung 3.1.<br />
(2) Stehende Gewässer<br />
Alle Seeflächen, deren Uferlinien sowie Rasterwerte mit zum Teil bis zu 0,5 m unterschiedlichen Höhen<br />
gemessen wurden, wurden auf ein jeweils einheitliches mittleres Höhenniveau korrigiert. Die geänderten<br />
Daten gehen über das 10-m-Raster-DGM in das Netz des Abflussmodells ein.<br />
(3) Deiche<br />
Im Vergleich mit terrestrischen Messdaten wurden zum Teil große Höhenabweichungen festgestellt.<br />
Die Höhengenauigkeit von 50 cm konnte bei der DGM-Erstellung nicht generell eingehalten werden.<br />
Im DGM-Raster wurden daher die Deiche eliminiert. Die terrestrisch gemessenen Höhen der<br />
Deichkronenlinien wurden als DGM-Strukturlinien umformatiert und in das Berechnungsnetz übernommen.<br />
Die Änderungen betreffen die Deichanlagen Triebenbach im Gebiet Freilassing-Laufen sowie<br />
Geisenfelden, Tittmoning und Ettenau im Gebiet Laufen-Burghausen. Zu den Deichanlagen im<br />
Mündungsgebiet der <strong>Salzach</strong> waren keine terrestrischen Messdaten verfügbar - die DGM-Daten wurden<br />
beibehalten. Hierzu ist festzustellen, dass der Deich Haiming genügend genau vermessen wurde; er<br />
wird bei der Abfluss-Simulation nicht überströmt. Die Deichanlagen am Inn werden von der Simulation<br />
nicht mehr berührt.<br />
3.1.2 Flussquerprofile<br />
Die Flussprofile der <strong>Salzach</strong> und Saalach lagen zu Beginn der WRS lediglich seit dem Jahr 1981 digital<br />
aufbereitet vor. Die Profile wurden im 200-m-Abstand gemessen. Da für die Abfluss-Simulation<br />
sowie für die Geschiebebilanzierung auch ältere Aufnahmen benötigt wurden, sind umfangreiche Digitalisierarbeiten<br />
vorgenommen worden. Die Profile sind teilweise bis in das Jahr 1919 zurückreichend.<br />
Vom Amt der Salzburger Landesregierung (ASLR) wurden Flussprofilaufnahmen der Jahre 1985 und<br />
1992 zwischen Fkm 59,3 und 96,68 digital zur Verfügung gestellt. Die Modelleichung erfolgte für das<br />
Hochwasserereignis von 1991 mit dem entsprechenden Profildatensatz von 1991/1992, das Ereignis<br />
von 1959 wurde mit dem entsprechenden Datensatz von 1959 durchgeführt. Der Berechnung des Istzustands<br />
liegen die Profile aus dem Aufnahmejahr 1995 zugrunde.<br />
Die bedeutendsten Zuflüsse der <strong>Salzach</strong> sind auf bayerischem Gebiet die Sur und die Götzinger Achen,<br />
welche die Überschwemmungsflächen in den Auebereichen wesentlich beeinflussen. Da für die Götzinger<br />
Achen erst im Verlauf des Projekts Querprofilaufnahmen im 100-m-Abstand verfügbar wurden,<br />
ist die Modelleichung noch ohne diesen Zufluss durchgeführt worden. Die Berechnung des Istzustands<br />
und der Planungsvarianten erfolgte dann einschließlich beider Zuflüsse. Eine Zusammenstellung der<br />
digital verfügbaren Querprofildaten ist Tabelle 3.4 zu entnehmen.<br />
16
ge des Deiches Ettenau während des Hochwasserereignisses vom Juni 1995 verglichen. Bei annähernd<br />
gleichem Abfluss (Scheitelwert Q am Pegel Laufen: 2230 m³/s) wurden auch ähnliche Wasserspiegellagen<br />
erzielt (Abbildung 3.5).<br />
23
tet. Das Längsprofil der <strong>Salzach</strong> bei Variante 2/3 ist in den Abbildungen 4.4 und 4.5 dargestellt, der<br />
Grundriss der <strong>Salzach</strong> kann z.B. der Karte 6 im Anhang entnommen werden.<br />
Tabelle 4.2 Flussbettbreiten und Lage von Rampen und Rollierungsstreifen bei Variante 2/3<br />
Abschnitt Flusskilometer<br />
[Fkm]<br />
Sohlbreite [m] Bemerkung<br />
Freilassinger Becken 59,3-56,4 130<br />
(Fkm 59,3-49,0) 56,2-55,4 130 bis 140 Rampe bei 55,4<br />
Kronenhöhe: 398,0; Höhe ca. 1,70 m<br />
55,2-51,9 140 Rampe bei 51,9<br />
Kronenhöhe: 394,2; Höhe ca. 2,40 m<br />
51,8-49,6 130<br />
49,4-48,6 110 bis Istbreite Rollierung<br />
Laufener Enge 48,4-46,0 Istbreite<br />
(Fkm 49,0-44,0) 45,8-44,8 Istbreite Rollierung<br />
44,6-44,2 Istbreite bis 120<br />
Tittmoninger Becken 44,2-43,8 120<br />
(Fkm 44,0-22,0) 43,6-43,0 120-140<br />
42,8-39,4 140 Rampe bei 39,4<br />
Kronenhöhe: 380,7; Höhe ca. 2,40 m<br />
39,2-37,6 150<br />
37,4-30,2 140 Rampe bei 33,8<br />
Kronenhöhe: 374,8; Höhe ca. 2,50 m<br />
30,0-29,0 120 Rollierung<br />
28,8-26,8 140<br />
26,6-25,6 120 Rollierung<br />
25,4-23,2 140<br />
23,0-21,6 120 bis Istbreite Rollierung<br />
Nonnreiter Enge und 21,4-0,0 Istbreite Rollierungen von 18,0-16,0 und von<br />
Mündungsbereich<br />
14,0 bis 11,0<br />
4.1.3 Allgemeine Planungsmerkmale<br />
Als wesentliche Planungsmerkmale der Varianten 2 und 2/3 wurden in den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.2<br />
die unterschiedlichen Sohlbreiten, Sohlhöhen mit Verweis auf die Längsprofildarstellungen und Sohlfixierungen<br />
in Form von Rollierungen und Rampen genannt.<br />
Beiden Varianten gemeinsam ist die Anbindung mehrerer Augewässer an die <strong>Salzach</strong>, die zum Teil<br />
dauerhaft von der <strong>Salzach</strong> dotiert werden, zum Teil als Flutmulden ab dem 1-jährlichen Hochwasser<br />
anspringen. Die Anbindung der Augewässer trägt wesentlich zur Überflutung der Aue bei.<br />
Die neuen Uferhöhen der <strong>Salzach</strong> liegen durch die Aufweitungen zum Teil tiefer als im Istzustand, da<br />
das Gelände der <strong>Salzach</strong>auen vom Fluss ins Vorland hin abfällt (siehe z.B. Querprofildarstellung in<br />
Abbildung 4.6). Stellen, an denen Uferhöhen durch den Verschnitt mit dem Gelände tiefer als der<br />
Wasserspiegel des 1-jährlichen Hochwassers zu liegen kommen, wurden großteils auf diese Höhe angehoben.<br />
Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass im Freilassinger Becken jeweils zwei unterschiedliche<br />
Versionen der beiden Varianten weiterverfolgt wurden. Der Hauptunterschied der Versionen besteht<br />
in der Gestaltung der Uferhöhen im Freilassinger Becken. Das Ziel eines frühzeitigen Ausuferns,<br />
verbunden mit einer erhöhten Stabilität der Flusssohle bzw. von Rampenbauwerken in der Planungsvariante<br />
2/3 sowie einer Erweiterung der Überschwemmungsflächen und Retentionsräume, wurde konträr<br />
zum Ziel des Hochwasserschutzes (Lokalbahn im Land Salzburg, Sicherung des Haunsbergfußes) diskutiert.<br />
Demzufolge gestalten sich die Uferhöhen wie folgt:<br />
25