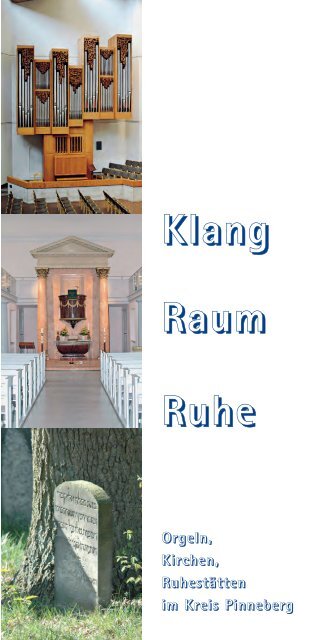KKlllaaannngg RRaaauuumm RRuuuhhhee - Kreiskulturverband ...
KKlllaaannngg RRaaauuumm RRuuuhhhee - Kreiskulturverband ...
KKlllaaannngg RRaaauuumm RRuuuhhhee - Kreiskulturverband ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Klang<br />
Raum<br />
Ruhe<br />
Orgeln,<br />
Kirchen,<br />
Ruhestätten<br />
im Kreis Pinneberg
Inhalt<br />
3 Grußworte<br />
4 Einleitung<br />
5 Heilig-Geist-Kirche · Barmstedt<br />
6 ev. Kirche · Brande-Hörnerkirchen<br />
7 Sankt-Ansgar-Kirche · Elmshorn<br />
7 Luther-Kirche · Elmshorn<br />
8 Sankt-Nikolai-Kirche · Elmshorn<br />
9 Stiftskirche · Elmshorn<br />
9 Thomaskirche · Elmshorn<br />
10 Sankt Mariä Himmelfahrt · Elmshorn<br />
11 Jüdischer Friedhof · Elmshorn<br />
12 Erlöserkirche · Halstenbek<br />
12 Herz-Jesu-Kirche · Halstenbek<br />
13 Heilige-Dreikönigs-Kirche · Haselau<br />
14 Sankt Gabriel · Haseldorf<br />
15 Sankt Nicolai · Helgoland<br />
16 Bugenhagenkirche · Klein Nordende<br />
17 Osterkirche · Kummerfeld<br />
18 Sankt-Michael-Kirche · Moorrege<br />
19 Christuskirche · Pinneberg<br />
20 Heilig-Geist-Kirche · Pinneberg<br />
21 Lutherkirche · Pinneberg<br />
22 Sankt-Michaels-Kirche · Pinneberg<br />
23 Sankt-Pius-Kirche · Pinneberg<br />
24 Marienkirche · Quickborn<br />
25 Maria Hilfe der Christen · Quickborn<br />
26 Friedhof Rellingen · Rellingen<br />
27 Rellinger Kirche · Rellingen<br />
28 Paulskirche · Schenefeld<br />
29 Sankt-Johannes-Kirche · Seester<br />
30 Tornescher Kirche · Tornesch<br />
31 Cäcilie-Bleeker-Park · Uetersen<br />
32 Erlöserkirche · Uetersen<br />
33 Kirche am Kloster · Uetersen<br />
34 Christuskirche · Wedel<br />
35 Unbeflecktes Herz Mariens · Wedel<br />
36 Kirche am Roland · Wedel<br />
37 Orgelbau Lobback · Neuendeich<br />
38 Glossar<br />
40 Impressum
Grußworte<br />
Kirchen, Orgeln und Ruhestätten im Kreis Pinneberg sind<br />
das Thema dieses neuen Kulturführers, herausgegeben<br />
vom <strong>Kreiskulturverband</strong>.<br />
Als Kirchenmusikerin freue ich mich ganz besonders über<br />
diese gelungene Zusammenstellung, die allen Kunst-,<br />
Musik- und historisch Interessierten ein Wegweiser zu<br />
bekannten und verborgenen Plätzen und kirchlichen<br />
Schätzen in unserer Umgebung sein soll.<br />
Wie schon der Museumsführer wurde auch dieser zweite<br />
Kulturführer durch Mittel der Stiftung der Sparkasse<br />
Südholstein ermöglicht.<br />
Allen, die dieses Projekt unterstützt und durch ihre<br />
Mitarbeit gefördert haben, danke ich herzlich.<br />
Waltraut Buchholz<br />
Vorsitzende des <strong>Kreiskulturverband</strong>es<br />
Der <strong>Kreiskulturverband</strong> Pinneberg hat mit der Herausgabe<br />
dieser Broschüre einmal mehr die Kulturszene im Kreis<br />
Pinneberg bereichert. Neben „Museen und Sammlungen“<br />
ist nun der zweite Führer mit einer ganz besonderen<br />
Thematik entstanden: Klang – Raum – Ruhe · Orgeln,<br />
Kirchen, Ruhestätten im Kreis Pinneberg möchte der<br />
<strong>Kreiskulturverband</strong> den interessierten Leserinnen und<br />
Lesern näher bringen.<br />
Beide Ausgaben zusammen bilden eine bemerkenswerte<br />
Einheit und informieren in vielfältiger Weise über das<br />
Kulturgut im Kreis Pinneberg. Dem großen Engagement<br />
aller ehrenamtlich Tätigen, die zum Gelingen dieses<br />
Heftes beigetragen haben, gilt meine besondere<br />
Anerkennung. Im Namen des Kreises Pinneberg sage ich<br />
dafür herzlich Dank.<br />
Burkhard E. Tiemann<br />
Kreispräsident des Kreises Pinneberg<br />
3
4<br />
Ein 36 Seiten starkes Heft über Orgeln, sakrale Räume und Ruhestätten im<br />
Kreis Pinneberg zu schreiben kann nur bedeuten, dass dies ein ganz subjektives<br />
Heft wird. Wir haben zu dritt, manchmal zu viert den Kreis durchstreift, mit<br />
Geistlichen, Musikern, Orgelbauern und Architekten gesprochen. Alle<br />
Religionen, Konfessionen und Glaubensrichtungen, Sekten ausgenommen,<br />
sollten aufgenommen werden. Die einzige Religion, die außer dem<br />
Christentum aufgenommen wurde, ist das Judentum und auch nur durch<br />
einen alten Friedhof. Wir haben zwar zwei Synagogen im Kreis Pinneberg, und<br />
die Muslime haben einige Moscheen, jedoch sind sie bauhistorisch genauso<br />
wenig interessant wie die sakralen Räume anderer Konfessionen in unserem<br />
Kreis. Auch Friedhofs- und Krankenhauskapellen haben wir nicht aufgenommen,<br />
da dort Menschen, die in Not sind, Ruhe finden wollen. Eine<br />
Schwierigkeit ist, dass der politische Kreis Pinneberg aus 5 evangelischen<br />
Kirchenkreisen, unter anderem Süderdithmarschen (Helgoland), besteht. Das<br />
wird sich ändern. Es wurde abgewägt, abgestrichen, hinzugefügt, verworfen,<br />
diskutiert. Heraus kam dieses Heft, das Sie jetzt in Händen halten.<br />
Die ältesten Kirchen unseres Kreises sind aus vorreformatorischer Zeit, also im<br />
Grunde katholische Kirchen. In der Mitte des 18. Jahrhunderts änderte sich<br />
das, die evangelischen Gemeinden hatten Bedarf an neuen Kirchen und auch<br />
das Geld, neue Gotteshäuser zu bauen. Das war die große Zeit des Baumeisters<br />
Cai Dose. Er nahm die Worte Luthers ernst und baute seine Kirchen so, dass die<br />
Gläubigen nah am „Wort“ saßen und dass das Wort aus dem Altar kam. Die<br />
achteckigen Bauten in Brande-Hörnerkirchen und Rellingen entstanden. Es<br />
klingt paradox: Diese lutherischen Bauten wurden bald als undeutsch betrachtet,<br />
und die Gotik, die ihre Blütezeit in England und Frankreich hatte, wurde<br />
als deutsch angesehen, so entstanden die neugotischen Kirchen. Eine Lücke<br />
zwischen Barock- und Neugotikkirche füllt die klassizistische Marienkirche des<br />
dänischen Baumeisters Christian Frederik Hansen in Quickborn.<br />
Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Kirchen gebaut. In Pinneberg<br />
wurde unter heute nicht nachvollziehbaren Umständen die erste katholische<br />
Kirche im Kreis errichtet. Bis zu Beginn der 50er Jahre stagnierte dann die<br />
Bautätigkeit.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als durch den Zustrom von Flüchtlingen die<br />
Städte und Gemeinden wuchsen, begannen die Kirchengemeinden wieder zu<br />
bauen und zu renovieren. Der Aufbau hat uns einige spannende Kirchen<br />
geschenkt. Die damaligen Renovierungen an Orgeln und Kirchen haben uns<br />
jetzt nach erneuter Renovierung bzw. Neubauten von Orgeln wieder sehensund<br />
hörenswerte Häuser bzw. Instrumente beschert.<br />
Wenn Sie nach der Lektüre dieses Heftes Lust bekommen, den sakralen Raum<br />
des Kreises zu erkunden, erfragen Sie die Öffnungszeiten unter den angegebenen<br />
Rufnummern oder schauen Sie im Internet nach. Die katholischen<br />
Kirchen sind meist offen, aber auch da gibt es schon einige, die nur zu<br />
bestimmten Zeiten geöffnet haben. Viele Gemeinden bieten am<br />
Sonntagnachmittag „offene Kirchen“, da haben Sie auch einen<br />
Ansprechpartner, der Ihnen Erklärungen gibt. Oder Sie gehen einfach einmal<br />
in einen Gottesdienst, dann hören Sie auch die Orgeln.<br />
Ich bedanke mich bei allen, die mir geholfen haben, dieses Heft zu erstellen.<br />
Hanfried Kimstädt
� Heiligen-Geist-Kirche<br />
Chemnitzstraße 28 | 25355 Barmstedt<br />
www.kirche-barmstedt.de | Tel.: 04123 – 31 39<br />
Die evangelische Kirche der Stadt Barmstedt wurde<br />
in den Jahren 1717/18 vom Hamburger Architekten<br />
Johann Lorenz Nerger erbaut. Pfingsten 1718 wurde<br />
sie geweiht. Es handelt sich um eine backsteinerne<br />
barocke Saalkirche im Typus der Gemeindekirchen<br />
des 17./18. Jahrhunderts. Der runde Feldsteinturm<br />
mit hohem Spitzhelm ist romanischen Ursprungs.<br />
Er wurde 1841–43 mit Backstein ummauert und<br />
erneut 1951/52 verstärkt.<br />
Der Innenausbau stammt vorwiegend aus dem<br />
Spätbarock. Die Emporen ruhen auf Vierkantstützen<br />
und tragen 32 Emporenbilder mit Darstellungen des<br />
Lebens Christi. Eine Patronatsloge an der Südwand<br />
trägt an der Brüstung sechs Bilder mit Wappen<br />
und Allegorien. Im Schiff hängen zwei Messingkronleuchter,<br />
die im Jahre 1732 gestiftet wurden.<br />
Das Deckengemälde malte H. H. Morthorst. Das<br />
Gestühl aus dem Jahre 1895 trägt die Wangenköpfe<br />
von 1717/18.<br />
Die Kirche besitzt zwei Glocken. Die kleine ist aus<br />
Bronze und wurde 1741 von J. A. Bieber in Hamburg<br />
gegossen. Die große ist aus Stahl und wurde 1953 in<br />
Bochum gegossen.<br />
Die Orgel aus den Jahren 1719/20 wurde von<br />
Johann Hinrich Klapmeyer aus Glückstadt gebaut.<br />
Der stattliche Prospekt ist nach Art der Arp-<br />
Schnitger-Orgeln mit Mittel-, spitzwinkligen<br />
Zwischen- und tief ansetzenden Seiten-Türmen,<br />
Akanthuswerk und Engelsköpfen als Bekrönung<br />
versehen. 2196 Pfeifen verteilt auf 31 Register werden<br />
über 2 Manuale und 2 Pedale gespielt. Die gute<br />
Akustik der Kirche bringt den Klang der Orgel voll<br />
zur Entfaltung. 1990 wurde sie von Orgelbau Führer<br />
aus Wilhelmshaven in den historischen Zustand<br />
zurückversetzt.<br />
Von einem ehemaligen Kirchhof sind nur noch<br />
wenige Grabsteine ehemaliger Pastoren an der<br />
Kirchenmauer geblieben.<br />
5
6<br />
� Brande-Hörnerkirchen<br />
Kirchenstraße 2 | 25364 Brande-Hörnerkirchen<br />
www.hoernerkirche.de | Tel.: 04127 – 3 78<br />
Die barocke Kirche aus dem Jahr 1751 war wohl die<br />
zweite achteckige Kirche des Baumeisters Cai Dose.<br />
Die erste baute er 1734 in Kopenhagen. Es war die<br />
Zeit, in der die Lutheraner begannen, eigene<br />
Kirchen bauen zu lassen. Bis dahin hatten sie<br />
katholischen Bauten übernommen. So sind die<br />
Kirchen von Cai Dose schon von der Konzeption her<br />
lutherisch. Dose baute einen Zentralbau. Alles ist<br />
auf die Predigt ausgerichtet. Die Kanzel ist in Altar<br />
und Orgel eingefügt.<br />
Die Kirche brannte 1934 vollständig aus. Allein das<br />
Taufbecken ist gerettet worden. 1936 wurde sie vom<br />
Kieler Architekten Otto Schnittger im Stil der damaligen<br />
Zeit, entgegen aller barocken Lebendigkeit,<br />
wieder aufgebaut.<br />
Die Glocken hängen in einem eigenen Glockenstuhl<br />
von 1781, der wie ein Tor vor der Kirche steht.<br />
Die Orgel stammt aus dem Jahre 1936 und wurde<br />
von Orgelbau Sauer in Frankfurt/Oder gebaut. Sie<br />
ist ein elektropneumatisches Instrument und lässt<br />
über zwei Manuale und ein Pedal 20 Register<br />
erklingen.<br />
Wie es früher üblich war, wurde um die Kirche<br />
herum der Kirchhof angelegt. Gut erhaltene<br />
Grabplatten aus der Gründungszeit um 1850 dokumentieren<br />
das. Die letzten noch erhaltenen Gräber<br />
sind die des Pastors Wiedemann und seiner Frau<br />
von 1890. 1896 wurde außerhalb der Ortschaft in<br />
Brande ein neuer Friedhof mit eigener Kapelle<br />
angelegt.
� Sankt-Ansgar-Kirche<br />
Ansgarstraße 54 | 25336 Elmshorn<br />
www.ansgar-elmshorn.de | Tel.: 04121 – 6 12 28<br />
Der Stahlbetonbau in Zeltform des Architekten Otto<br />
Andersen aus Hamburg wurde in den Jahren<br />
1960/61 gebaut und am 3. Advent 1961 geweiht. Die<br />
Fenster stammen von Ernst-Günther Hansing aus<br />
Flensburg. Den Altar mit drei großen Bronze-<br />
Relieftafeln, die die drei großen christlichen Feste<br />
darstellen, sowie Taufe und Kruzifix hat Fritz Fleer<br />
aus Hamburg geschaffen. Der Altarraum wird durch<br />
eine Plexiglaskuppel im Dach beleuchtet, wodurch<br />
die Struktur der Wand besonders zur Geltung<br />
kommt.<br />
Im Dachreiter befindet sich ein aus fünf Glocken<br />
bestehendes Zimbelgeläut (kleine aufeinander<br />
abgestimmte Glocken) der Gießerei Schilling aus<br />
Heidelberg.<br />
Eine sehr gute Akustik lässt die Orgel der Firma<br />
Beckerath aus Hamburg vollkommen klingen. 1750<br />
Pfeifen sind auf 25 Register verteilt und mit zwei<br />
Manualen und einem Pedal zu spielen.<br />
� Luther-Kirche<br />
Lange Straße 32 | 25337 Elmshorn<br />
www.kirche-elmshorn.de | Tel.: 04121 – 7 18 77<br />
Nach den Plänen des Hamburger Architekten Puls<br />
errichtet, wurde der Stahlbetonbau mit dem freistehenden<br />
Glockenturm 1966 geweiht. Das alles<br />
dominierende Glasmosaik des gekreuzigten<br />
Christus hinter dem Altar gestaltete die Künstlerin<br />
Gräfin A. Hohenthal. Die kräftigen Rot- und<br />
Blautöne leuchten besonders in den Morgenstunden,<br />
wenn die aufgehende Sonne sie durchflutet.<br />
Die vier Glocken läuteten zum ersten Mal<br />
Weihnachten 1966.<br />
Im Jahre 1970 wurde eine Orgel des Orgelbauers<br />
Führer eingeweiht. Mit 21 Registern und zwei<br />
Manualen und einem Pedal passt sie ausgezeichnet<br />
in diesen Kirchenraum.<br />
7
8<br />
� Sankt-Nikolai-Kirche<br />
Kirchenstraße 3 | 25336 Elmshorn | Tel.: 04121 – 2 98 26<br />
www.offene-kirche-st-nikolai-elmshorn.de<br />
Sankt Nikolai ist eine geräumige Backstein-<br />
Saalkirche – im Kern noch gotisch – wohl aus der<br />
Mitte des 14. Jahrhunderts mit einem spätbarocken<br />
Südanbau von 1733 mit Korbbogenfenstern und<br />
Walmdach. Der Turm ist neugotisch und wurde<br />
1881 angebaut. 1912 gab es Anbauten im Osten,<br />
und es erfolgte die Erneuerung des Außenmauerwerks.<br />
Den Innenraum überspannt ein hölzernes<br />
Tonnengewölbe, den Südanbau eine flache Decke.<br />
Die Ausmalung und die Fenster gestaltete A. H.<br />
Oetken aus Berlin im Jahre 1913. Die Emporen im<br />
Hauptschiff sind umlaufend mit Felderteilung und<br />
tragen 71 Emporenbilder. Der Altar hat einen<br />
barocken Aufsatz mit gedrehten Säulen, Reliefs des<br />
Abendmahls (unten), der Kreuzigung (Mitte) und<br />
der Ölbergszene und Figuren der 4 Evangelisten und<br />
des Salvators. Das Ganze wurde im Knorpelwerkstil<br />
um 1660 nach dem Brand erstellt. Zu dem Altar<br />
gehören zwei ornamentgezierte Abendmahlsbänke.<br />
Die drei Glocken sind auf h, d und f gestimmt.<br />
Im Jahre 1971 wurde eine Orgel des Orgelbauers<br />
Weigle eingeweiht. Mit 2328 Pfeifen auf 33<br />
Registern und 3 Werken ist sie groß genug, um diesen<br />
Kirchenraum zu beschallen, kann sich aber auf<br />
Grund der ungünstigen Akustik nur schlecht durchsetzen.
� Stiftskirche<br />
An der Ost-West-Brücke 25 | 25335 Elmshorn<br />
Tel.: 04121 – 8 15 61<br />
Die neugotische Stiftskirche wurde 1891 erbaut und<br />
ist die Kirche des Gräflich Rantzauschen<br />
Präbendenstiftes. 1976 wurde sie renoviert und präsentiert<br />
sich nun sehr schlicht. Die Kanzel stammt<br />
wahrscheinlich aus einem Kanzelaltar. Zwei<br />
Wandbehänge, die 1984 angeschafft wurden, sorgen<br />
für ein wenig Belebung.<br />
Die Stiftskirche war zuerst nur mit einer Glocke ausgestattet.<br />
1980 erhielt sie ein Dreier-Geläut aus<br />
Bronze in den Tönen fis, a und b. Die Glocken bekamen<br />
die Namen Glaube, Liebe und Frieden.<br />
Erwähnenswert ist die gute Akustik, durch die eine<br />
Beckerath-Orgel von 1963 gut zum Klingen kommt.<br />
Die Orgel besitzt 12 Register und hat ein Manual<br />
und ein Pedal.<br />
� Thomaskirche<br />
Breslauer Straße 3 | 25335 Elmshorn<br />
www.thomaskirche-elmshorn.de | Tel.: 04121 – 8 39 00<br />
Am 4. Dezember 1964 wurde die von Werner Thee<br />
aus Elmshorn gebaute Thomaskirche geweiht. Das<br />
Altarfenster wurde von Prof. Godel entworfen und<br />
von der Franz Mayerschen Hofkunstanstalt<br />
München gefertigt.<br />
4 Bronzeglocken ertönen aus dem 41 m hohen freistehenden<br />
Glockenturm. Sie sind abgestimmt auf<br />
die ersten Töne des Adventsliedes „O Heiland, reiß<br />
die Himmel auf“.<br />
Die große elektromechanische Orgel von Beckerath<br />
hat 2226 Pfeifen auf 31 Register verteilt und ist über<br />
zwei Manuale und ein Pedal zu spielen. Die Kirche<br />
wird wegen ihrer großen Empore, des geräumigen<br />
Altarraumes und ihrer ausgezeichneten Akustik<br />
besonders für Konzerte geschätzt.<br />
9
10<br />
� Sankt Mariä Himmelfahrt<br />
Feldstraße 26 | 25335 Elmshorn<br />
Tel.: 04121 – 2 62 79 00<br />
Am 28. August 1952 wurde die von Architekt<br />
Hüttenmüller aus Osnabrück gebaute Hallenkirche<br />
geweiht. Die nahe zu den Außenwänden stehenden<br />
Säulenreihen tragen ein Holzgewölbe. Durch diese<br />
Säulenreihen wird der Charakter einer Basilika vorgetäuscht,<br />
und es entsteht der Eindruck einer<br />
Prozessionskirche. Der Blick wird nach vorne auf<br />
den Altar gerichtet, und die Menschen, welche die<br />
Kirche betreten, gehen zum Altar (lat.: processio:<br />
voranschreiten).<br />
Die Kirche besitzt drei Glocken.<br />
Die am 21. Mai 2000 eingeweihte Orgel ist von dem<br />
Orgelbauer Jehmlich in Dresden. Sie verfügt über<br />
1732 Pfeifen verteilt auf 31 Register und ist über<br />
zwei Manuale und ein Pedal mechanisch zu spielen.<br />
Eine Besonderheit der Orgel ist der in den Prospekt<br />
eingebaute Zimbelstern mit acht Glöckchen, die<br />
läuten, wenn der Stern sich dreht. Sie sind auf<br />
C-Dur gestimmt und trotz ihres zarten Klanges<br />
selbst bei vollem Werk zu hören.<br />
Zimbelsterne lassen sich seit dem 15. Jahrhundert<br />
nachweisen. Besonders häufig finden sie sich in<br />
Barockorgeln. Es sind auch Instrumente mit zwei<br />
oder drei Zimbelsternen anzutreffen.
� Jüdischer Friedhof<br />
Feldstraße 30 | 25335 Elmshorn | Tel.: 04121 – 26 88 70<br />
www.industriemuseum-elmshorn.de<br />
Der jüdische Friedhof mit der Friedhofshalle blieb<br />
als einziges originales Zeugnis der im Jahre 1941<br />
erloschenen jüdischen Glaubensgemeinde im<br />
Elmshorner Stadtbild erhalten. Graf Detlev zu<br />
Rantzau sicherte Berend Levi den Begräbnisplatz<br />
bereits 1685 bei der Gründung der Gemeinde zu. Die<br />
Gemeinde pachtete das Gelände zunächst, erst 1828<br />
fand der Kauf statt. Die heutige Friedhofshalle ist ein<br />
Neubau aus dem Jahr 1906, der das alte baufällige<br />
Gebäude ersetzte. Nur gläubige Juden durften auf<br />
diesem Friedhof rituell bestattet werden. Der Tote<br />
wurde gewaschen, in ein weißes Kleid oder<br />
Leichentuch gehüllt und in einen schlichten Sarg<br />
gebettet. Immer wurde ein Säckchen mit Erde aus<br />
dem Land der Väter (Israel) beigegeben, damit der<br />
Verstorbene zumindest symbolisch in der Erde des<br />
Heiligen Landes ruhen konnte. In der Friedhofshalle<br />
wurde eine kurze Trauerrede gehalten, dann begab<br />
sich die Trauergemeinde zur Grabstelle. Am offenen<br />
Grab wurde gebetet, dann senkten Mitglieder des<br />
jüdischen Beerdigungsvereins den Sarg in das Grab<br />
mit den Worten: „Gehe hin, bis das Ende kommt,<br />
und ruhe, bis du auferstehst zu Deinem Erbteil am<br />
Ende der Tage.“ Durch den zweiten Ausgang verließen<br />
die Trauernden, zu denen oft auch Christen<br />
zählten, den Friedhof. Bis 1811 durften die Juden in<br />
Schleswig-Holstein ihrer Tradition nach die Toten<br />
noch am Sterbetag beerdigen. Nach der<br />
Machtergreifung der Nationalsozialisten sollte der<br />
jüdische Friedhof beseitigt werden – warum er überdauert<br />
hat, ist ungeklärt. Die letzte Beerdigung fand<br />
1939 statt.<br />
Heute befinden sich hier noch etwa 130 Grabsteine.<br />
Seit 1960 untersteht der Friedhof der Jüdischen<br />
Gemeinde in Hamburg. Nach dem jüdischen<br />
Glauben sind die Gräber für die Ewigkeit – sie müssen<br />
unangetastet bleiben.<br />
11
12<br />
�� Erlöserkirche<br />
Friedrichstraße 22 | 25469 Halstenbek<br />
www.kirchehalstenbek.de | Tel.: 04101 – 4 73 56 50<br />
Am 25. April 1954 wurde der Grundstein für die<br />
Erlöserkirche gelegt. Nach Plänen des Architekten<br />
Klaus Groth wurde die Kirche gebaut und am<br />
23. Oktober 1955 geweiht. Der damalige Bundespräsident<br />
Heuss stiftete die Altarbibel. Die Erlöserkirche<br />
ist eine – im Positiven – schnörkellose Hallenkirche,<br />
die ganz darauf ausgerichtet ist, zu dienen.<br />
Sie ist eine zeitgenössische Kirche des Wiederaufbaus,<br />
und das prägt das Erscheinungsbild.<br />
2005 erhielt die Erlöserkirche eine neue Orgel des<br />
Orgelbauers Beckerath aus Hamburg. Diese mechanische<br />
Orgel verfügt über 1300 Pfeifen verteilt auf<br />
22 Register und ist über 2 Manuale und ein Pedal zu<br />
spielen. Die gute Akustik macht es möglich, die<br />
Kirche auch für Konzerte zu nutzen.<br />
�� Herz-Jesu-Kirche<br />
Friedrichshulder Weg 1 | 25469 Halstenbek<br />
www.kirchehalstenbek.de | Tel.: 04101 – 47 32 42<br />
Die Herz-Jesu-Kirche wurde nach dem Vorbild einer<br />
Siebenbürgener Wehrkirche vom Architekten<br />
Karlheinz Bargholz aus Hamburg 1955 gebaut.<br />
Bargholz wollte mit seiner romantisch anmutenden<br />
Bauweise den Zufluchtsort Kirche hervorheben –<br />
einen Zufluchtsort, der für alle offen steht und<br />
Schutz und Geborgenheit vermittelt. Auch diese<br />
Kirche ist ein Kind des Wiederaufbaus und bis auf<br />
das große Altarbild schmucklos.<br />
Was der akustisch guten Kirche fehlt, ist eine Orgel.
�� Heilige-Dreikönigs-Kirche<br />
Dorfstraße 18 | 25489 Haselau<br />
www.kirche-haselau.de | Tel.: 04122 – 80 11<br />
Die Haselauer Kirche ist die einzige Kirche, die alle<br />
Qualitäten besitzt, die in diesem Heft im<br />
Zusammenhang mit anderen Kirchen erwähnt werden.<br />
Sie ist eine bemerkenswerte Kirche, hat eine<br />
wunderbare Orgel und ist umgeben von einem<br />
Kirchhof. Außerdem erfüllt sie die Ansprüche, die an<br />
eine Kirche allgemein gestellt werden. Sie ist das<br />
größte, das höchste und das schönste Haus im Ort.<br />
Vor gut 600 Jahren bezeugen historisch sichere<br />
Quellen ihre Existenz. Es können mehrere Baustile<br />
erkannt werden, Gotik und Barock sind die hauptsächlichsten.<br />
Den Altar schuf Christian Precht aus<br />
Hamburg. Es ist ein zweigeschossiger barocker<br />
Aufbau mit gedrehten Säulen, Pilastern, Gemälden<br />
der Kreuzigung (Mitte) und der Auferstehung<br />
(oben) von Suhr. Die Bilder der Altarempore und der<br />
Mittelbilder des Altars sind von Heinrich Stuhr, der<br />
1685 auch das Deckengemälde malte: die Vision des<br />
Johannes. Die Kanzel von 1641 ist nach Art der<br />
Emporenkanzeln gestaltet. Der Korb ruht auf einer<br />
ionischen Holzsäule mit Säulen und den<br />
Nischenfiguren Christi und der vier Apostel. Dazu<br />
gehört ein sechsseitiger Schalldeckel mit<br />
Knorpelwerkaufsätzen, Volutenkrone und Salvator.<br />
Die letzte Renovierung fand zwischen 1955 und<br />
1960 statt.<br />
Im Turm hängen sieben Glocken, mit sechs davon<br />
sind Choralanfänge spielbar. Die siebente ist die<br />
Stundenglocke von 1250 und wohl eine der ältesten<br />
Glocken Norddeutschlands.<br />
1864 erhielt die Kirche eine Marcussen-Orgel. Nach<br />
einem missglückten Neubau 1961 wurde im Jahre<br />
2002 der Orgelbauer Christian Lobback beauftragt,<br />
eine neue Orgel zu bauen. Diese Aufgabe löste er<br />
bravourös. Aufgrund ihrer guten Akustik bietet sich<br />
die Kirche auch für Konzerte an.<br />
Man erreicht die Kirche nur über den Kirchhof,<br />
so dass vor oder nach dem Gottesdienst der<br />
Verstorbenen gedacht werden kann.<br />
13
14<br />
�� Sankt Gabriel<br />
Marktplatz 4 | 25489 Haseldorf<br />
www.kirche-haseldorf.de | Tel.: 04129 – 2 41<br />
Sankt Gabriel ist der bedeutendste spätromanische<br />
Kirchenbau der Elbmarschen und stammt aus dem<br />
Jahre 1195 – neben Neukirchen der einzige erhaltene<br />
Bau dieser Zeit. An der 1599 durch Anbau einer<br />
Gruftkapelle verlängerten Ostseite prangt ein<br />
Sandsteinepitaph mit pilasterflankierter und übergiebelter<br />
Reliefdarstellung der Auferstehung über<br />
zwei Sockelzonen mit Pilasterteilung, Wappen und<br />
Inschriften. Das Dach ziert ein Dachreiter.<br />
Als Altaraufsatz dient ein Akanthusbarock-<br />
Epithaphrahmen der Zeit gleich nach 1700.<br />
Laubwerk und zwei Engel umgeben ein etwas älteres<br />
auf eine ehemalige Grufttür gemaltes Auferstehungsbild.<br />
Altarschranken mit Balustern stammen<br />
aus dem 17. Jahrhundert und werden heute als<br />
Chorschranken benutzt. Erwähnenswert ist eine<br />
kleine Nische in der Südwand, die jetzt von außen<br />
zugemauert ist. In frühen Zeiten war diese Nische<br />
offen, um den Pestkranken vor der Kirche die<br />
Möglichkeit zu geben, am Gottesdienst teilzunehmen.<br />
Der Orgelprospekt entstand um 1700 mit hohem<br />
Unterbau und einer Barockfront mit höheren<br />
Mittel- und spitzwinkligen Seitentürmen und<br />
Akanthuswerk. Fünf Freifiguren und vier<br />
Relieffiguren in Akanthuslaubwerk stellen die<br />
Musen dar. Die Orgel wurde 1986 durch die Firma<br />
Paschen aus Kiel erneuert. Über zwei Manuale und<br />
ein Pedal können 16 Register angespielt werden.<br />
Durch die gute Akustik der Kirche gibt es sehr schöne<br />
Konzerte in dieser Kirche zu hören.
�� Sankt Nicolai<br />
Schulweg 648 | 27498 Helgoland<br />
www.kirche-helgoland.de | Tel.: 04725 – 3 01<br />
Die Backsteinkirche von 1685 wurde am 18. April<br />
1945 durch Bomben zerstört. 1959 wurde ein<br />
Neubau eingeweiht, der dem Seeklima nicht lange<br />
standhielt. In ihrer jetzigen Gestalt stammt die<br />
Kirche aus dem Jahr 1969. Sie ist eine Hallenkirche<br />
mit hölzerner Dachkonstruktion.<br />
Das Bronzeportal und der Taufkessel wurden von<br />
dem Hamburger Künstler Fritz Fleer geschaffen. Ein<br />
doppelringförmiger Leuchter symbolisiert das<br />
himmlische Jerusalem.<br />
Die Kirche hat zwei Orgeln, eine große von Orgelbau<br />
Führer, die 1970 aufgestellt wurde, und eine kleine<br />
von Orgelbau Paschen aus dem Jahre 1972 im<br />
Altarraum. In der besonderen Atmosphäre der<br />
Kirche finden von Mai bis September ein bis zwei<br />
Konzerte in der Woche statt.<br />
Die Taufschale ist aus dem Jahr 1715. Mit dem 1811<br />
von König Gustav Adolf gestifteten silbernen<br />
Kerzenleuchter und einem Abendmahlskelch gehört<br />
sie zu den wenigen übrig gebliebenen Inventarstücken<br />
der alten Kirche.<br />
Die Stahlglocke wurde 1952 zur Wiederbesiedlung<br />
Helgolands gestiftet. Im Jahre 1959 wurden fünf<br />
Bronzeglocken geweiht.<br />
Unter der Kirche befindet sich eine Beinkammer, in<br />
der die Gebeine alter Helgoländer ruhen, die mit den<br />
Bomben vom alten Friedhof geräumt wurden. In<br />
einem Gedenkbuch vor der Gebeinkammer sind die<br />
Namen aller aufgeschrieben, die auf dem Friedhof<br />
beerdigt waren.<br />
Der Friedhof ist um die Kirche angelegt. In die<br />
Friedhofsmauer hat man alte Grabsteine eingelassen,<br />
die die Sprengung überstanden haben.<br />
15
16<br />
�� Bugenhagenkirche<br />
Wasserstraße 7 | 25336 Klein Nordende<br />
Tel.: 04121 – 9 35 95<br />
Die jüngste Kirche im Kirchenkreis Rantzau ist die<br />
Bugenhagenkirche in Klein Nordende. 1985 wurde<br />
sie von Bischof Wilckens geweiht. Wegen ihrer<br />
eigenartigen Form musste sie sich manche Kritik<br />
aus der Dorfbevölkerung gefallen lassen.<br />
Das Kirchendach ragt in einer übergreifenden<br />
Konstruktion über die gegenläufige Dachneigung<br />
des angrenzenden Gemeindehauses hinweg und<br />
verschmilzt so mit Gemeindehaus und Pastorat. Ein<br />
Glockenträger, der nicht die Höhe dieser Kirche<br />
erreicht, steht wie ein Eingangstor vor der Kirche.<br />
Die Kirche allein fasst 100 Stühle, kann jedoch für<br />
250 Personen erweitert werden, indem die Wand<br />
zum Gemeindesaal geöffnet wird. Es entsteht dann<br />
ein holzgedeckter hoher Raum, der durch viele<br />
Glasfenster erhellt wird.<br />
1988 bekam die Kirche eine große Orgel des<br />
Orgelbauers Noeske aus Berlin. Mit 14 klingenden<br />
Registern über zwei Manuale und ein Pedal gespielt,<br />
bringt sie den Raum zum Klingen.
�� Osterkirche<br />
Langenbargen 2 | 25495 Kummerfeld<br />
www.kirche-kummerfeld.de | Tel.: 04101 – 7 96 00<br />
Der Backsteinbau orientiert sich in Höhe und Form<br />
am 1962 gebauten Glockenturm. In ihm hängen<br />
drei Glocken der Gießerei Bachert mit den<br />
Schlagtönen a“, c“, d“. Am Turm ist eine<br />
Bronzeplatte angebracht, die „op Platt“ auf die<br />
Bedeutung der Glocken hinweist.<br />
Das zeltartige Kirchendach überwölbt ein unregelmäßig<br />
sechseckiges Kirchenschiff.<br />
Altar, Taufbecken, Kanzel und Gestühl sind beweglich.<br />
Dies bietet vielerlei Möglichkeiten der<br />
Gottesdienstgestaltung.<br />
Im September 1972 wurde die mechanische Orgel<br />
der Firma Weigle eingeweiht. Über zwei Manuale<br />
und ein Pedal werden 13 Register zum Klingen<br />
gebracht.<br />
1981 erhielt die Orgel ein Gegenüber in einem<br />
Altarkreuz des Ahrenloher Bildhauers Hermann<br />
Stehr. Aus mattem Aluminium gegossen, spannt es<br />
um den Gekreuzigten einen Bogen von der Geburt<br />
bis zur Himmelfahrt Christi. An den Wänden ergänzen<br />
acht Leuchter aus gleichem Material das Kreuz.<br />
Direkt hinter der Kirche liegt der Friedhof der drei<br />
Kirchdörfer Borstel-Hohenraden, Kummerfeld und<br />
Prisdorf.<br />
17
18<br />
�� Sankt-Michael-Kirche<br />
Kirchenstraße 56 | 25436 Moorrege<br />
www.kirche-moorrege-heist.de | Tel.: 04122 – 8 11 11<br />
Nach dem Entwurf der Architekten Groth und Meyer<br />
gebaut, wurde St. Michael am 4. Advent 1960<br />
eingeweiht. Sie liegt inmitten eines kleinen<br />
Waldfriedhofs.<br />
Im Altarraum steht ein großer siebenarmiger<br />
Leuchter, der an die Menora, den Leuchter im<br />
Tempel in Jerusalem, erinnert. Gefertigt wurde er<br />
von Hermann Voß aus Moorrege.<br />
Die Taufschale wird durch die vier Symbole der<br />
Evangelisten getragen.<br />
In der Altarwand befinden sich zwei Holzreliefs mit<br />
Darstellungen aus dem Leben Christi. Taufbecken<br />
und Reliefs wurden von dem Segeberger Künstler<br />
Otto Flath hergestellt.<br />
2004 erwarb die Gemeinde das von Ingeborg Witt<br />
geschaffene Kunstwerk „Die Liebe Gottes“.<br />
Wenn die Sonne im Süden steht, wird dem<br />
Altarraum durch ein farbig gestaltetes Betonglasfenster<br />
eine ganz besondere Atmosphäre vermittelt.<br />
Das Werk der Hamburger Künstlerin<br />
Katharina Duwe stellt das „neue Jerusalem“ dar, die<br />
himmlische Überhöhung der irdischen Stadt.
�� Christuskirche<br />
Bahnhofstraße 2 | 25421 Pinneberg<br />
www.christuskirche-pinneberg.de | Tel.: 04101 – 2 22 57<br />
Am 31. März 1895 wurde das Kirchweihfest für die<br />
von dem Architekten Hugo Groothoff erbaute neugotische<br />
Kirche gefeiert. 1941 erhielt die Kirche den<br />
Namen Christuskirche.<br />
In den 60er Jahren erfolgte eine radikale<br />
Neugestaltung des Kircheninnenraumes. Die Kirche<br />
wurde zwar heller, jedoch wurde die in die Höhe<br />
strebende Neugotik stark in der Wirkung eingeschränkt.<br />
Im Jahre 2003 wurde nach langen<br />
Vorbereitungen und Beratungen die notwendige<br />
Bausanierung mit einer Neugestaltung verbunden.<br />
Es sollte einerseits der neugotischen Baustruktur<br />
und andererseits den Absichten der 67er<br />
Renovierung Rechnung getragen werden. Im<br />
Rahmen dieser erneuten Renovierung unter<br />
Leitung des Architekten Gunnar Seidel sind die<br />
verbliebenen Teile der ursprünglichen Kircheneinrichtung<br />
(Altaraufsatz, Evangelistentafeln der<br />
alten Kanzel, hölzerne Taufe) in die Kirche zurückgeführt<br />
worden.<br />
Über die mehr als hundert Jahre lässt sich in der<br />
Gestaltung des Kircheninnenraumes der jeweilige<br />
theologische wie auch architektonische Zeitgeist<br />
wiederfinden, so dass die Christuskirche in dieser<br />
Hinsicht auch als Spiegelbild der jeweiligen<br />
Zeitläufe wahrgenommen werden kann.<br />
Die Orgel muss dringend erneuert werden, ihr<br />
wurde, wie so vielen anderen Kirchen im Kreis<br />
Pinneberg in den 50er Jahren, durch Einsatz falschen<br />
Materials schwerer Schaden zugefügt. So eignet<br />
sie sich wegen ihrer begrenzten Möglichkeiten<br />
nur noch zur Begleitung des Gottesdienstes.<br />
19
20<br />
�� Heilig-Geist-Kirche<br />
Ulmenallee 9 | 25421 Pinneberg<br />
Tel.: 04101 – 7 31 06<br />
Die Kirche ist am Pfingstsonntag, dem 2. Juni 1963,<br />
eingeweiht worden. Zum Bau des geplanten Turmes<br />
mit einer Höhe von fast 50 Metern kam es nicht.<br />
Deshalb stehen bis heute vier Glocken der Firma<br />
Bachert im Vorraum der Kirche. Die Rhombenform<br />
gibt dieser Kirche ihr besonderes Aussehen. Die weißen<br />
Wände, der Schieferboden und die Holzdecke<br />
schaffen einen hellen und klaren Raum.<br />
Der Bildhauer Hans Fleer schuf den Kruzifixus über<br />
dem Altar, das Taufbecken mit der Darstellung des<br />
Pfingstwunders und die Bronzeplatten der Kanzel.<br />
Der schwere Altar ist aus einem Stück gearbeitet.<br />
Ernst-Günter Hansing hat das Eckfenster im<br />
Altarraum und die zwölf Buntglasfenster im rückwärtigen<br />
Teil der Kirche entworfen.<br />
Die Orgel mit 26 Registern wurde von E. Kemper<br />
1966 geschaffen. Eine hervorragende Akustik<br />
macht musikalische Veranstaltungen zu einem<br />
Klangerlebnis.
�� Luther-Kirche<br />
Kirchhofsweg 53 a | 25421 Pinneberg<br />
Tel.: 04101 – 2 65 00<br />
1954 wurde die Kirche, die nach den Plänen des<br />
Architekten Klaus Groth gebaut wurde, durch Propst<br />
Hasselmann feierlich eingeweiht. Das Kirchenschiff<br />
liegt in 12 Meter Abstand parallel zum Kirchhofsweg<br />
in Südwest-Nordost-Richtung. Der 23 Meter hohe<br />
Turm trägt drei Glocken. Sie wurden 1956 geweiht.<br />
Das Fünfeck des Altarraumes ist ganz verglast. Je<br />
nach Sonnenlichteinfall strahlen die Fenster in den<br />
unterschiedlichsten Farben. Von den eingearbeiteten<br />
Symbolen ist besonders das Alpha und das Omega<br />
als Christuszeichen erkennbar.<br />
Die Holzarbeiten – Kanzel, Lesepult und Türanlage<br />
– stammen von der Firma Heydorn. Das von einem<br />
Salzburger Künstler geschaffene Taufbecken zeigt<br />
die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Acht<br />
Messingleuchter geben mit dem warmen Schein der<br />
Kerzen dem Kirchenraum einen festlichen Glanz.<br />
Seit 1982 erklingt in der Kirche eine neue Orgel von<br />
Beckerath. Sie ist auf besondere Art gestimmt und<br />
erfreut in Gottesdiensten und Konzerten.<br />
Das grüne Parament wurde durch die Pinneberger<br />
Künstlerin Gisela Meyer-Hahn in Seide gestaltet. Ein<br />
weißes Parament wurde durch eine großzügige<br />
Spende ermöglicht und von der Ratzeburger<br />
Paramentenwerkstatt angefertigt.<br />
Besonders freut sich die Gemeinde über die<br />
Anschaffung einer wunderschön klingenden<br />
Truhenorgel des niederländischen Orgelbauers<br />
Henk Klop, für die viele Jahre gespendet wurde. Sie<br />
hat ihren Platz vor der Sakristei gefunden.<br />
21
22<br />
�� Sankt-Michaels-Kirche<br />
Fahltskamp 14 | 25421 Pinneberg<br />
www.kkpi.de | Tel.: 04101 – 2 20 78<br />
Unter den in heutiger Zeit undenkbarsten<br />
Umständen baute die katholische Kirchengemeinde<br />
Pinneberg 1906 ihre Kirche. Ein Strohmann kaufte<br />
das Grundstück, und der Bischof aus Osnabrück<br />
empfahl dem Pfarrer, nachmittags an einem<br />
Wochentag den Grundstein zu legen. Es war nicht<br />
leicht für Katholiken, im evangelischen Norden in<br />
dieser Zeit eine eigene Kirche zu bauen. Geduldet<br />
waren sie nur, wenn sie ihre Gottesdienste in<br />
Hinterzimmern abhielten, aber eine eigene Kirche:<br />
niemals! Die Gemeinde hatte jedoch ihren Glauben,<br />
ihre Zuversicht und ihre Freunde. Unter der Leitung<br />
und nach den Plänen des Architekten Franz<br />
Hellenkamp erwuchs die Kirche und wurde am<br />
2. Weihnachtstag 1906 geweiht. Im Jahre 1985<br />
gestaltete der Kölner Künstler Egino Weinert das<br />
liturgische Material neu.<br />
1917 bekam sie ihre auf f gestimmte erste Glocke<br />
und 1956 die zweite, auf as gestimmt. Beide Glocken<br />
kamen aus der Glockengießerei Petit & Gebr.<br />
Edelbrock in Gescher/Westfalen.<br />
Die erste Renovierung der Kirche fand 1985/86<br />
statt, und die nächste steht an. Die Kirche muss vergrößert<br />
werden.<br />
1914 bekam die St.-Michaels-Kirche ihre erste Orgel<br />
von der Firma Rother. Sie besitzt 10 Register und<br />
wird über 3 Werke gespielt. Im Jahr 1954 wurde die<br />
Firma Kemper aus Lübeck mit der Renovierung<br />
beauftragt. Trotz guter Akustik ist die Orgel, genau<br />
wie die in der evangelischen Christuskirche, nicht<br />
für Konzerte geeignet.
�� Sankt-Pius-Kirche<br />
Feldstraße 39 | 25421 Pinneberg<br />
www.kkpi.de | Tel.: 04101 – 2 55 91<br />
Nach einer Bauzeit von zwei Jahren wurde die<br />
katholische St. Pius Kirche 1961 geweiht. Der<br />
Entwurf stammt von den Architekten H. + J.<br />
Feldwisch-Drentrup. Es ist eine moderne<br />
Hallenkirche, die 1967 einen einzeln stehenden<br />
Turm erhielt, in den 1974 vier Glocken der Firma<br />
Petit & Edelbrock aus Gescher/Westfalen gehängt<br />
wurden.<br />
1994 wurde eine neue Altarrückwand eingebaut<br />
und das alte Militärkreuz durch ein neues Kreuz<br />
ersetzt. Zwischen Kirche und Turm wurde eine<br />
Werktagskapelle eingerichtet. 1991 wurde der Turm<br />
saniert.<br />
Die Orgel stammt von der Firma Furtwängler und<br />
Hammer und wurde 1936/37 für die evangelische<br />
Kirche in Rissen gebaut. Sie besaß 11 Register, zwei<br />
Manuale und ein Pedal. 1953/54 wurde sie von der<br />
Firma Emil Hammer aus Hannover umgebaut. Sie<br />
erhielt zusätzliche 11 Register und den jetzigen<br />
Prospekt. 1961 wurde sie für St. Pius gekauft.<br />
Ab dem nächsten Jahr wird die Kirche als Ausweichkirche<br />
für St. Michael dienen, da dort umfangreiche<br />
Um- und Ausbaumaßnahmen anstehen.<br />
Was danach mit St. Pius geschieht ist ungewiss.<br />
23
24<br />
�� Marienkirche<br />
Ellerauer Straße 2 | 25451 Quickborn<br />
www.kirche-quickborn.de | Tel.: 04106 – 42 12<br />
Ein total in Vergessenheit geratenes Kleinod beherbergt<br />
die Stadt Quickborn. Am 6. Mai 2007 wurde<br />
die renovierte Marienkirche wieder der Öffenlichkeit<br />
übergeben. Ein architektonisches Juwel des<br />
Klassizismus war fast wiederhergestellt worden –<br />
zurück zum Konzept des königlich-dänischen<br />
Landesbaumeisters Christian Frederik Hansen<br />
(1756–1845). Einige Abweichungen von seinen<br />
Plänen mussten bleiben. So hatte Hansen nie einen<br />
Turm geplant, der wurde erst im Jahre 1863 – 54<br />
Jahre nach der Einweihung – auf Wunsch des<br />
Kirchenvorstandes im neoromanischem Stil gebaut.<br />
Hansen war schon Ende des 18. Jahrhunderts in<br />
Quickborn vorstellig geworden; die Bürger wollten<br />
jedoch keinen Neubau, also wartete der Baumeister,<br />
bis die alte Kirche zusammenbrach und war dann<br />
sofort präsent. Er schuf seinen ersten Sakralbau,<br />
wenn man ihn sich heute anschaut, ist er wunderschön<br />
– ein schlichter, schmuckloser, einschiffiger<br />
Saalbau. Die hölzerne Empore wird von 12<br />
dorischen Säulen getragen. Der Blick wird beim<br />
Eintritt sofort zum Kanzelaltar innerhalb einer<br />
Aedikula gelenkt, hinter der das Licht der<br />
Verheißung strahlt. Jetzt in den ursprünglichen<br />
hellen Farben wirkt der Bau ein-ladend. Kanzel und<br />
Altar sind aus Mahagoni gefertigt. Der Taufständer<br />
ist kunstvoll gearbeitet und trägt eine Zinnschale.<br />
Die Orgel vom Orgelbau Peter in Köln wurde 1984<br />
auf der Empore eingebaut. Sie ist eine mechanische<br />
Orgel mit 20 Registern, 3 Werken und 1450 Pfeifen,<br />
die in dieser herrlichen Kirche wohltönend klingen.<br />
Die drei Glocken aus der Karlsruher Glockengießerei<br />
stammen aus dem Jahre 1972.
�� Maria Hilfe der Christen<br />
Kurzer Kamp 2 | 25451 Quickborn<br />
www.st-marien-quickborn.de | Tel.: 04106 – 24 22<br />
Wenn Sie meinen, Sie könnten nach dem architektonischen<br />
Juwel des Klassizismus in Quickborn nach<br />
Hause fahren, so haben Sie sich getäuscht. Ein weiterer<br />
Edelstein wartet hier auf Ihre Aufmerksamkeit.<br />
Die große katholische Gemeinde im Ort hatte 1998<br />
keinen Platz mehr in der alten Kirche von 1953. Es<br />
wurde beraten, was zu tun sei – Umgestaltung und<br />
Anbau oder Abriss und Neubau. Man entschied sich<br />
für den zweiten Weg und entnervte so über vier Jahre<br />
Woche für Woche die Architekten um Prof.<br />
Grundmann aus Hamburg. In Abwandlung des<br />
Bibelwortes könnte ich mir vorstellen: „...und die<br />
Gemeinde sprach, es werde Licht, und die<br />
Architekten taten ihr Bestes“. Ein absolut wunderbarer<br />
Kirchenneubau entstand in einer Zeit, in der<br />
andere über Kirchenschließungen nachdenken.<br />
Lichtdurchflutet ist die Halle. Im Halbrund sitzen<br />
die Gläubigen um den Altar. Eine gute Akustik lässt<br />
auch im hintersten Winkel das Wort Gottes vernehmen.<br />
Das von Prof. Schreiter aus Langen gestaltete<br />
eindrucksvolle Altarfenster hinter dem<br />
Kruzifix symbolisiert von oben die Schöpfung aus<br />
Licht und Wasser und zeigt von unten den<br />
Menschen mit seinen Brüchen auf dem Weg zum<br />
Heiland. Die Bronzekunst wurde vom Künstler Klaus<br />
Pohl aus Duisburg gestaltet. Die aus der alten Kirche<br />
übernommenen Holzskulpturen stammen aus den<br />
Starnberger Kunstwerkstätten. Die Fenster in der<br />
Marienkapelle und der Sakristei stammen von Prof.<br />
Franz Griesenbrock aus Vaals/Niederlande.<br />
Die drei Glocken sind auf die der älteren evangelischen<br />
Marienkirche abgestimmt und wurden von<br />
Bachert in Heilbronn gegossen. Eine vierte Glocke<br />
dient als Schlagwerk der Uhr.<br />
Eine Orgel gibt es auch, es ist eine Computerorgel.<br />
Die muss nun 25 Jahre ihren Dienst tun, bis man an<br />
den Kauf einer „richtigen“ Orgel denken kann.<br />
Tun Sie sich einen Gefallen. Setzen Sie sich irgendwann<br />
einmal an einem hellen sonnigen Tag in<br />
diese Kirche, denken Sie an nichts ... das Richtige<br />
kommt dann schon.<br />
25
26<br />
�� Rellinger Friedhof<br />
Hamburger Straße 34 | 25462 Rellingen<br />
www.gartenrouten-sh.de<br />
Der Friedhof der Landdrosten.<br />
Jahrhunderte lang wurden die Toten Rellingens und<br />
der Nachbarorte rund um die Rellinger Kirche<br />
bestattet. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts suchte<br />
man nach Erweiterungsflächen auf der anderen<br />
Seite der Landstraße. 1855 gab es 260 Grabstätten<br />
auf dem Kirchhof. Ungefähr ab 1875 wurden<br />
Bestattungen auf dem Kirchhof untersagt. Man löste<br />
die alten Grabstätten auf und bettete sie auf den<br />
neuen Friedhof um.<br />
Die ältesten Steine findet man heute im Schatten<br />
des Lindenrondells beim Haupteingang. Eine<br />
Lindenallee führt durch den ältesten Teil des<br />
Friedhofs. In vielen Grabstätten spiegelt sich in den<br />
Namen der hier Bestatteten die Entwicklung der<br />
Baumschulen im Kreis Pinneberg wider.<br />
Bis 1890 gehörte Pinneberg zum Kirchspiel<br />
Rellingen, und so findet man unter den alten<br />
Grabsteinen auch die der ehemaligen Landdrosten.<br />
Der Friedhof hat einen reichen und interessanten<br />
alten Baumbestand. Am bemerkenswertesten ist eine<br />
wohl über 200 Jahre alte Hängeblutbuche an der<br />
alten Kapelle.<br />
In ihrer Nähe findet man interessante alte Steine<br />
und Kreuze, die nach Ablauf der Ruhefristen abgeräumt<br />
werden mussten.
�� Rellinger Kirche<br />
Hauptstraße 27 | 25462 Rellingen<br />
Tel.: 04101 – 84 04 04<br />
In Rellingen schuf der dem Leser bereits aus<br />
Brande-Hörnerkirchen bekannte Baumeister Cai<br />
Dose von 1754–56 sein Meisterwerk. Aufgrund seiner<br />
hohen künstlerischen Bedeutung gehört der<br />
achtseitige Zentralbau zu den Hauptwerken des<br />
spätbarocken Kirchenbaus in Norddeutschland und<br />
gilt als die vollkommenste Leistung Cai Doses.<br />
Um möglichst vielen Gottesdienstbesuchern gleich<br />
gutes Hören und Sehen während der Predigt zu<br />
ermöglichen, wählte Dose auch hier einen oktogonalen<br />
Grundriss, diesmal gekrönt von einer<br />
imposanten Laterne, die das Licht von oben in den<br />
Kirchenraum fließen lässt. Die Plätze im Raum sind<br />
auch bei den beiden Emporen streng auf die Kanzel<br />
ausgerichtet. Die gute Akustik ist bis heute Grund<br />
für die Beliebtheit der Kirche bei Konzerten.<br />
Der Backstein-Zentralbau mit Pilastern, Rokoko-<br />
Portalen und hohen Rundbogenfenstern trägt ein<br />
Mansardenkuppeldach, das von einer hohen<br />
Laterne gekrönt wird. Im Westen steht ein im Kern<br />
romanischer Rundturm aus Feldsteinen und<br />
Ziegeln mit nachträglich angesetzten Stützpfeilern<br />
und mit barockisiertem gotischem Spitzhelm.<br />
In dem von Adelslogen umgebenen Innenraum<br />
steht ein einheitliches Gestühl in vier Blöcken.<br />
Der 1755/56 von Meltzo und Schmidt geschaffene<br />
Kanzelaltar wird von der Orgel gekrönt. Das Ganze<br />
ist ein spätbarockes Meisterwerk. Die drei Altarbilder<br />
von Martini zeigen Abendmahl, Auferstehung und<br />
Himmelfahrt. Ebenfalls von Martini ist die<br />
Ausmalung der Laterne. Sie zeigt drei Propheten,<br />
vier Evangelisten und David und oben im Dach<br />
einen Wolkenhimmel mit dem Auge Gottes und<br />
musizierenden Engeln und Putten.<br />
Die Orgel des Glückstädter Orgelbaumeisters<br />
Matthias Schreiber besitzt 31 Register.<br />
Zur Einweihung komponierte Georg Friedrich<br />
Telemann, damals Musikdirektor der Hamburger<br />
Hauptkirchen, die festliche Einweihungsmusik<br />
„Singet Gott“, die 1981 wiederentdeckt wurde.<br />
27
28<br />
�� Paulskirche<br />
Gorch-Fock-Straße 90 | 22869 Schenefeld<br />
www.paulskirche-schenefeld.de | Tel.: 040 – 8 30 51 27<br />
Im Jahre 1938 wurde in Schenefeld-Siedlung ein<br />
Gemeindesaal gebaut. 1952 wurde er durch ein<br />
Querschiff erweitert und erhielt 1954 einen Turm<br />
mit den Glocken „Friede, Freude, Ewigkeit“. 1960<br />
wurde neben der alten Kirche mit dem Bau der<br />
jetzigen Paulskirche begonnen. 1962 wurde die<br />
Kirche geweiht. Die künstlerische Gestaltung der<br />
Hallenkirche übernahm Siegfried Assman. Beeindruckend<br />
ist die Altarwand aus Handstrichziegeln,<br />
die die Maurer nach einem Pappmodell des<br />
Künstlers aufmauerten. Sie zeigt unten das irdische,<br />
oben das himmlische Jerusalem und die drei Kreuze<br />
von Golgatha. 1966 erhielt die Kirche eine Orgel von<br />
der schwäbischen Firma Weigle. 1777 Pfeifen sind<br />
auf 24 Register verteilt und über zwei Manuale und<br />
ein Pedal zu spielen. Die gute Akustik lässt auch<br />
große Konzerte zu.
�� Sankt-Johannes-Kirche<br />
Dorfstraße 37 | 25370 Seester<br />
www.kirche-seester.de | Tel.: 04125 – 307<br />
Die Backsteinsaalkirche aus dem frühen 15. Jahrhundert<br />
mit spätgotischer Westerweiterung wurde<br />
1889 neu ummantelt und dabei erneuerte man<br />
auch alle Öffnungen und den Dachreiter. An der<br />
Nordseite befindet sich die ehemalige Von-Ahlefeldt-<br />
Gruft von 1716. Der hölzerne Altaraufsatz stammt<br />
von 1631 und zeigt auf sechs Relieftafeln<br />
Darstellungen aus dem Leben Christi. Er wird von<br />
einer Aedikula im Stil der Spätrenaissance<br />
umschlossen und durch eine freiplastische<br />
Kreuzgruppe und Figuren von Moses und Johannes<br />
dem Täufer bekrönt.<br />
Eine Holzbalkendecke bildet den Abschluss über<br />
zwei Emporen. Die barocke Westempore steht auf<br />
Stützen mit geschweiften Kopfbändern und hat eine<br />
in Felder geteilte Brüstung. Die Ostempore wurde<br />
1844 erneuert und ist eher schlicht. Unter ihr befinden<br />
sich eine geschlossene Logenreihe und die<br />
Gutsloge.<br />
Aus der gleichen Zeit wie der Altar, dem Übergang<br />
von der Renaissance zum Barock stammt die<br />
Kanzel.<br />
Erwähnenswert ist auch der Opferstock aus dem<br />
Jahre 1613, der von einer Lazarus-Figur getragen<br />
wird.<br />
Die beiden Glocken hängen in einem überdachten<br />
Dreiständerstuhl.<br />
St. Johannes besitzt zwei Orgeln, von denen jedoch<br />
nur eine bespielbar ist. Sie wurde 1968 von<br />
Marcussen gebaut, hat 17 Register und wird über<br />
zwei Manuale und ein Pedal gespielt. Die<br />
Barockorgel stammt von Stilher.<br />
29
30<br />
�� Tornescher Kirche<br />
An der Kirche 1 | 25436 Tornesch<br />
www.kirchengemeinde-tornesch.de | Tel.: 04122 – 5 14 23<br />
Die Tornescher Kirche gehört zu den zahlreichen<br />
modernen Gotteshäusern, die Ende der 1950er/<br />
Anfang der 1960er Jahre im Kreis Pinneberg errichtet<br />
worden sind. In der näheren Umgebung war<br />
die Tornescher Kirche neben der Erlöserkirche in<br />
Uetersen und der St.-Michael-Kirche in Moorrege<br />
die erste von drei Kirchen, die zu dieser Zeit gebaut<br />
wurden. Die Bauarbeiten in Tornesch begannen<br />
1959 nach Plänen des Architekten Günter Franck.<br />
Dem Besucher fällt schon von weitem der rund<br />
anderthalb Meter große Hahn aus Kupfer auf der<br />
Spitze des Kirchturms ins Auge. Den Hahn bauten<br />
die Tornescher Klempner Ernst Huckfeldt und Horst<br />
Schröttke nach Entwürfen eines Pinneberger<br />
Künstlers.<br />
Für die Gestaltung des sehr offenen und hohen<br />
Innenraums zeichneten die beiden Hamburger<br />
Künstler Siegfried Assmann und Carl von Frühling<br />
verantwortlich. Bemerkenswert ist dabei in erster<br />
Linie das große Altarbild, das die gesamte Höhe des<br />
Kirchenschiffs für sich beansprucht. Es stellt, in<br />
Beton und Glas geformt, zum einen die<br />
Dreifaltigkeit aus Gott, Christus und Heiligem Geist<br />
und zum anderen die vier Evangelisten Matthäus,<br />
Markus, Lukas und Johannes in Form der ihnen<br />
zugeordneten Symbole Engel, Löwe, Stier und Adler<br />
dar.<br />
Die ursprüngliche Orgel von 1960 wurde 1993<br />
durch ein Instrument des dänischen Orgelbauers<br />
Bruhn aus Apenrade ersetzt. Es verfügt über zwei<br />
Manuale und ein Pedal, hat 20 Register und insgesamt<br />
1284 Pfeifen, von denen 183 aus der alten<br />
Orgel übernommen wurden.<br />
Vor dem Bau der Tornescher Kirche an ihrem heutigen<br />
Standort wurden die Gottesdienste seit 1906 im<br />
Kirchensaal der heutigen Johannes-Schwennesen-<br />
Schule im Ortsteil Esingen gefeiert. Dieser Saal ist<br />
renoviert worden und kann während der<br />
Schulzeiten besichtigt werden.
�� Cäcilie-Bleeker-Park<br />
zwischen Bleeker- und Seminarstraße<br />
25436 Uetersen<br />
Der Cäcilie-Bleeker-Park ist der alte Uetersener<br />
Friedhof. Er wurde 1835 inmitten eines großen<br />
Roggenfeldes entlang der heutigen Seminarstraße<br />
angelegt. Der Friedhof diente als Ersatz für den<br />
ursprünglichen Kirchhof an der Klosterkirche, der<br />
zu klein geworden war.<br />
Unweit des Friedhofes befand sich die klösterliche<br />
Windmühle. Um ihr nicht den Wind zu nehmen,<br />
durften auf dem Friedhof keine Bäume gepflanzt<br />
werden. Daher finden sich nur vergleichsweise<br />
wenige große Exemplare auf dem Gelände, dafür<br />
aber eine Vielzahl interessanter Immergrüne und<br />
kleinwüchsige Koniferen.<br />
1965 wurde die letzte Beerdigung auf dem Friedhof<br />
vorgenommen. Die Kirchengemeinde verkaufte die<br />
Fläche 1994 an die Stadt, die auf dem Gelände einen<br />
Park anlegte. Dabei sind leider viele Grabsteine zerstört<br />
worden. Doch noch heute finden sich im Park<br />
die Grabmale bedeutender Uetersener Familien.<br />
Als einziges vollständiges Grab ist das der<br />
Namensgeberin Cäcilie Bleeker erhalten. Sie war<br />
Uetersener Ehrenbürgerin und stiftete der Stadt das<br />
an den Bleeker-Park angrenzende ehemalige<br />
Krankenhaus und die Mädchenschule in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft zur Klosterkirche.<br />
31
32<br />
�� Erlöserkirche<br />
Ossenpadd 62 | 25436 Uetersen<br />
Tel.: 04122 – 30 10<br />
Die Erlöserkirche wurde 1961 nach dem Entwurf des<br />
Architekten Otto Andersen fertiggestellt.<br />
Wenn Sie die Erlöserkirche betreten, sind Sie auf<br />
gleicher Höhe mit der Straße geblieben, an der das<br />
Gotteshaus liegt. Die Straße führt also gleichsam bis<br />
in die Kirche hinein, und keine Stufe soll den<br />
Eintritt hindern.<br />
Der Griff der Eingangstür hat die Gestalt eines<br />
Fisches – ein uraltes christliches Symbol. Die<br />
Buchstaben des griechischen Wortes für Fisch sind<br />
die Anfangsbuchstaben der Wörter: Jesus Christus,<br />
Gottes Sohn, Erlöser.<br />
Im Kirchenraum wird der Blick nach vorn gezogen,<br />
gelenkt durch den Mittelgang, der auf den Altar<br />
zuläuft, durch die Erweiterung des Raumes, die sich<br />
aus der Kreuzform des Grundrisses ergibt, und<br />
durch das Licht, das aus dem Deckenfenster als<br />
helles Tageslicht auf den Altar fällt.<br />
Die farbigen Betonglasfenster an den Seiten, von<br />
Ernst Hansing entworfen, wirken gleichzeitig durchsichtig<br />
und begrenzend. Das zeltförmige Dach birgt<br />
und schützt.<br />
Altar, Taufstein und Kanzel sind aus dem gleichen<br />
Material geformt (Travertin-Marmor). Fast auf<br />
gleicher Höhe betonen sie die Gleichwertigkeit von<br />
Wort und Sakrament.<br />
Ein Konzentrationspunkt ist die große Christusfigur<br />
des Bildhauers Rolf Goerler. Christus als der<br />
Leidende und der Auferstandene breitet in einer<br />
Segensgeste die Arme aus. Aber an Gesicht, Händen<br />
und Füßen ist zu erkennen, dass er gelitten hat.<br />
Wendet sich der Besucher dem Ausgang zu, fällt sein<br />
Blick auf die Orgel, von der Firma Walker 1963<br />
gebaut, mit 21 Registern über zwei Manuale und ein<br />
Pedal zu spielen. Der Orgelprospekt ist ebenfalls ein<br />
Entwurf von Otto Andersen.
�� Kirche am Kloster<br />
Kirchenstraße 9 | 25436 Uetersen<br />
www.klosterkirche-uetersen.de | Tel.: 04122 – 21 22<br />
1748 wurde der Grundstein der Kirche am Kloster<br />
gelegt, und bereits am 2. Adventssonntag des Jahres<br />
1749 konnte das neue Gotteshaus geweiht werden.<br />
Es war im spätbarocken Stil, und nach Plänen und<br />
unter Leitung des Baumeisters Jasper Carstens<br />
wurde der Neubau errichtet – ein Rechteckbau mit<br />
eingezogenem östlichem Turm, der nur wenig<br />
höher als das abgewalmte Mansardendach ist. Ein<br />
Merkmal von Zisterzienserkirchen – der Dachreiter<br />
mit den Klosterglocken – wurde auch auf diese<br />
Kirche gesetzt. Um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit<br />
zu schützen, ruht der ganze Bau auf Granitquadersockeln,<br />
die aus einem großen Hünengrab bei<br />
Glinde gewonnen wurden.<br />
Der Innenraum ist reich ausgeschmückt durch<br />
Marmorierung, Rocaillen-Malerei, Stuck, Schnitzwerk<br />
und Vergoldung. Der Blick des Betrachters wird<br />
durch den Aufbau des Kanzelaltars über die Orgel<br />
zur Decke erhoben, die mit einem Fresko mit der<br />
Verherrlichung der Dreieinigkeit, dem himmlischen<br />
Gottesdienst, geschmückt ist. Die Gestaltung des<br />
Kanzelaltars nach einem Entwurf des Landesbaumeisters<br />
Major Müller stammt aus der Werkstatt<br />
des Hamburger Meisters Johann Georg Engert.<br />
Im Hauptturm läuten seit 1964 vier Bronzeglocken<br />
der Firma Burchert aus Karlsruhe. Im Dachreiter<br />
hängen noch die von Johann Andreas Biber aus<br />
Hamburg gegossenen Glocken von 1740 und 1749.<br />
Sie werden aber heute kaum noch geläutet.<br />
Die Musik des Gottesdienstes wird von einer Orgel<br />
geführt, die der Orgelbauer Johann Dietrich Busch<br />
aus Itzehoe 1749 baute und die von der Firma<br />
Beckerath aus Hamburg 1978 restauriert und technisch<br />
neu aufgebaut wurde. Der historische<br />
Prospekt ist vollständig erhalten, ebenso einige<br />
Originalpfeifen und ein Zimbelstern. 30 Register auf<br />
drei Werken werden über zwei Manuale und ein<br />
Pedal zum Klingen gebracht.<br />
Auf dem stillgelegten Kirchhof befinden sich Gräber<br />
ehemaliger Klosterfrauen.<br />
Sehenswert ist auch das bauliche Ensemble um die<br />
Kirche.<br />
33
34<br />
�� Christuskirche<br />
Feldstraße 32–36 | 22880 Wedel<br />
www.christuskirche-schulau.de | Tel.: 04103 – 91 83 71<br />
Von 1970–71 wurde der von Architekt Asmus Werner<br />
entworfene hochmoderne Bau errichtet. Am 6. Juni<br />
1971 wurde die Kirche geweiht. Der Bildhauer Klaus<br />
Luckey schuf das riesige abstrakte Kreuz über dem<br />
Altar. Im Sommer 2002 kamen Paramente der<br />
Künstlerin Hauke Glaser hinzu.<br />
Ein hölzerner Glockenstuhl neben der Kirche beherbergt<br />
zwei Glocken der Gießerei Rincker.<br />
1979 wurde der Orgelbauer Christian Lobback aus<br />
Neuendeich mit dem Bau einer Orgel beauftragt. Er<br />
schuf eine wunderschöne mechanische Orgel in<br />
einem Gehäuse aus Oregonpinie. Zwei Manuale und<br />
ein Pedal lassen 23 Register erklingen.
�� Unbeflecktes Herz Mariens<br />
Feldstraße 15 | 22880 Wedel<br />
Tel.: 04103 – 1 21 14 44<br />
Von 1953 bis 1954 wurde die Kirche nach Plänen des<br />
Architekten Breuer gebaut, und am 9. August konnte<br />
die neue Kirche „Unbeflecktes Herz Mariens“<br />
geweiht werden. In dem hohen Turm hängen vier<br />
Glocken, die Marien-, die Richard-, die Clara- und<br />
die Isidorglocke. Sie wurden in Münster von<br />
Feldmann und Marschel gegossen. Neben einer<br />
Muttergottesstatue aus dem Jahre 1852 beherbergt<br />
die Kirche einige Kunstwerke, die der Wedeler<br />
Fabrikant Wischebrinck gestiftet hat.<br />
1995 bekam der Bau eine neue Orgel, die von dem<br />
Geesthachter Orgelbaumeister Claus Sebastian<br />
gebaut wurde. Die 1068 Pfeifen bilden 19 Register<br />
und werden über zwei Manuale und ein Pedal<br />
gespielt. Es handelt sich um eine elektromechanische<br />
Brüstungsorgel, eine Orgel deren Prospekt in<br />
die Brüstung der Empore gebaut wurde und<br />
dadurch eine hervorragende Klangabstrahlung in<br />
den akustisch idealen Kirchenraum hat.<br />
35
36<br />
�� Kirche am Roland<br />
Küsterstraße 4 | 22880 Wedel<br />
Tel.: 04103 – 21 43<br />
Die Kirche am Roland in Wedel hat eine wechselvolle<br />
Geschichte hinter sich. Am 3. März 1943 fiel<br />
sie einem Fliegerangriff zum Opfer. Nur die<br />
Außenmauern und der Turmstumpf blieben stehen.<br />
In schlichter Form wurde sie wiederhergestellt. Das<br />
ursprüngliche Tonnengewölbe wurde durch eine<br />
flache Kassettendecke ersetzt, und der Turm erhielt<br />
statt des schlanken Turmhelms ein Satteldach. 1975<br />
wurde der gesamte Innenbereich neu gestaltet. Es<br />
wurde vielfältig nutzbarer Raum geschaffen, in dem<br />
etwas geschehen sollte: Die Kirche soll „gebraucht“<br />
werden. Die Farbgestaltung soll meditativ stimmen.<br />
Von einem tiefen Blau der Decke zu einem lichten<br />
Weiß im Altarraum rundet sich der Raum. Altar,<br />
Kanzel, Taufe und Fußboden sind ziegelrot, Gestühl<br />
und Fensterrahmen tiefschwarz. Die künstlerische<br />
Ausgestaltung stammt von dem Maler und<br />
Bildhauer Siegfried Assmann.<br />
Der Turm wird jetzt wieder einen schlanken Helm<br />
erhalten. In ihm klingen vier Glocken, die auf die<br />
Töne f‘, g‘, b‘ und c“ gestimmt sind. Die ersten beiden<br />
genannten sind Stahlglocken aus Bochum, die<br />
beiden letztgenannten sind aus Bronze. Die auf c“<br />
gestimmte Glocke stammt aus dem Jahre 1660 und<br />
wurde in Königsberg gegossen.<br />
Die neobarocke Orgel stammt aus dem Jahre 1954<br />
und war die erste Orgel der Firma Schuke aus<br />
Berlin, die für den „Westen“ gebaut wurde. Über<br />
zwei Manuale und ein Pedal werden 21 Register<br />
gespielt. Die Akustik der Kirche ist sehr gut und lässt<br />
das klangschöne Instrument sehr gut zur Geltung<br />
kommen.
�� Orgelbau Lobback<br />
Rosengarten 4 | 25436 Neuendeich<br />
www.orgelaspekte.de | Tel.: 04122 – 37 25<br />
Wenn über Orgeln berichtet wird, darf die<br />
Orgelbauwerkstatt, die im Kreis Pinneberg besteht<br />
und die dem hervorragenden Orgelbaumeister<br />
Christian Lobback gehört, nicht unerwähnt bleiben,<br />
schon deswegen nicht, weil man hier nach vorheriger<br />
Anmeldung sehen kann, wie Orgeln gebaut werden.<br />
Christian Lobback hat gerade seine 200. Orgel<br />
übergeben. Im Kreis Pinneberg stehen drei Orgeln<br />
von ihm.<br />
Christian Lobback wurde in Hamburg geboren.<br />
Nach einem Geigenstudium am Klaerschen<br />
Konservatorium Blankenese absolvierte er ein<br />
kunstgeschichtliches Studium in Hamburg. Danach<br />
machte er eine Lehre zum Orgelbauer bei Emanuel<br />
Kemper in Lübeck. Nach Abschluss der Lehre arbeitete<br />
er freiberuflich für Walcker in Ludwigsburg und<br />
Kleuker in Brackwede/Westfalen. Er absolvierte die<br />
Meisterprüfung in München und gründete 1964<br />
seine erste Werkstatt in Wedel. 1981 verlegte er<br />
seinen Betrieb nach Neuendeich und pflegt dort nun<br />
ein harmonikales Klang- und Gestaltungskonzept<br />
unter Vermeidung von kopierten Stilmitteln.<br />
1985 gründete er den Arbeitskreis Harmonikaler<br />
Orgelbau (AHO). In seiner Werkstatt beschäftigt er<br />
durchschnittlich zehn Mitarbeiter.<br />
Neben den Orgelneubauten renovierte er zahlreiche<br />
früh- und spätromantische Instrumente pneumatischer<br />
und mechanischer Konstruktion. Besonders<br />
zu erwähnen ist die Restaurierung und<br />
Bestandssicherung von Orgeln des Hamburger<br />
Orgelreformers Hans Henny Jahnn sowie<br />
Veröffentlichungen von Texten zum Thema Orgel<br />
und Orgelbau.<br />
37
38<br />
Glossar<br />
Aedikula ursprünglich ein umrahmender Aufbau einer Statue in<br />
Form einer Tempelfront, mit Säulen, Gebälk und<br />
Giebel.<br />
Arp Schnitger norddeutscher Orgelbauer 1648–1719.<br />
Akanthuswerk Schnitzwerk in Form von Akanthusblättern (Disteln).<br />
Baluster niedrige Einzelsäule einer Balustrade.<br />
Barock Stilepoche von 1575–1770.<br />
Dachreiter ein kleiner Turm, der auf das Gebäude aufgesetzt ist.<br />
Epitaph Grabinschrift oder Monument zum Gedenken an<br />
einen Verstorbenen.<br />
Fresko in den noch feuchten Putz gemaltes Motiv.<br />
Kassettendecke weist an ihrer Unterseite in regelmäßiger Anordnung<br />
kastenförmige Vertiefungen (Kassetten) auf.<br />
Klassizismus Epoche von etwa 1770–1830.<br />
Knorpelwerk symmetrische Ornamentform mit knorpelartigen<br />
Verdickungen; Ohrmuschelformen und C-förmige<br />
Schwünge spielen eine wichtige Rolle.<br />
Korbbogen eine Weiterentwicklung des Segmentbogens, bei dem<br />
sich der Krümmungsradius über den Bogenverlauf<br />
verändert, der Rundbogen wird flacher.<br />
Manual die von den Händen gespielte Klaviatur der Orgel.<br />
Zu jedem Werk gehört eine Klaviatur.<br />
mechanisch die herkömmliche und bewährteste Art, über verschiedene<br />
Mechaniken Taste und Ventil zu steuern.<br />
Oktogon Achteck.<br />
Parament die im Kirchenraum und in der Liturgie verwendeten<br />
Textilien.<br />
Patronatsloge für den weltlichen Beschützer der Kirche und seine<br />
Familie von der Gemeinde abgesonderte Loge.<br />
Pedal die mit den Füßen zu spielende Klaviatur, meist für<br />
die Bass-Stimme.<br />
Pilaster ein in den Mauerverbund eingearbeiteter Halbpfeiler.
Präbenden Unterhalt beziehende Kirchenmitarbeiter im Mittelalter.<br />
Prospekt die Schauseite einer Orgel.<br />
Register Pfeifenreihe einheitlicher Bauform und Klangcharakteristik,<br />
enthält für jede Taste einer Klaviatur eine, bei<br />
Mixturen auch mehrere Pfeifen. Jedes Register kann<br />
einzeln ein- und ausgeschaltet und mit anderen<br />
Registern kombiniert werden.<br />
Rocaillen muschelförmige Ornamente.<br />
Rokoko eine Weiterentwicklung des Barock in den Jahren<br />
1735–1770/1790. Kunsthistorisch besser: Spätbarock.<br />
Romanik Stilepoche von etwa 1000–1200.<br />
Salvator Salvator Mundi (lat.: Heiler der Welt), Christusfigur.<br />
Säule dorisch gedrungene Säule, sich nach oben deutlich verjüngend.<br />
Säule ionisch schlanke Säule, sich nach oben nur leicht verjüngend.<br />
Truhenorgel kleine, meist transportable Orgel ohne Pedal.<br />
Volutenkrone obendraufsitzende Verzierung in Spiral- oder<br />
Schneckenform.<br />
Werk Gruppe von Registern, die von einem bestimmten<br />
Manual oder vom Pedal aus angespielt werden können.<br />
Sie werden nach ihrer Funktion Haupt-, Pedal-,<br />
Schwellwerk benannt.<br />
Zentralbau ein Bauwerk, dessen Hauptachsen gleich lang sind:<br />
kreisförmig, oval, quadratisch, kreuzförmig, oktogonal<br />
(achteckig) oder höher polygonal (vieleckig).<br />
Zimbelstern ein mechanisches Spielwerk an Orgeln, das aus einem<br />
Stern im Prospekt mit (nicht sichtbaren) kleinen<br />
Glöckchen besteht. Diese Konstruktion wird meistens<br />
durch einen Luftstrom angetrieben: Der Stern rotiert,<br />
während gleichzeitig ein Klingeln ertönt. Zimbelsterne<br />
finden sich häufig in Barockorgeln. Der Einsatz des<br />
Zimbelsterns verleiht einer triumphalen Orgelmusik<br />
einen weiteren Überhöhungseffekt. Klassischer Einsatzbereich<br />
ist beispielsweise die letzte Strophe des<br />
Weihnachtsliedes „O du fröhliche“.<br />
Zisterzienser Mönchsorden in der römisch-katholischen Kirche.<br />
39
Impressum<br />
Herausgeber: <strong>Kreiskulturverband</strong> Pinneberg e.V. | Pinnauring 33 | 25436 Tornesch<br />
www.kreiskulturverband-pinneberg.de | Tel.: 04122 – 96 11 23<br />
Unterstützt durch: Stiftung der Sparkasse Südholstein<br />
Recherche: Hanfried und Sebastian Kimstädt,<br />
Dr. Klaus Mühlfried<br />
Textredaktion: Hanfried und Sebastian Kimstädt<br />
Wissenschaftliche Beratung: Dr. Klaus Mühlfried<br />
Fotografien: Hanfried und Sebastian Kimstädt,<br />
Ursula Palm-Simonsen (Helgoland)<br />
Gestaltung: Pixel & Punkt, Hanfried Kimstädt<br />
Druck: Braun & Behrmann, Offsetdruck GmbH<br />
Auflage: 10.000<br />
Stand: Juli 2007<br />
Haftungsausschluss: der <strong>Kreiskulturverband</strong> übernimmt keine<br />
Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.<br />
Rechte: © Hanfried Kimstädt<br />
Abdruck, auch auszugsweise,<br />
nur nach Genehmigung durch den<br />
<strong>Kreiskulturverband</strong> Pinneberg e.V.