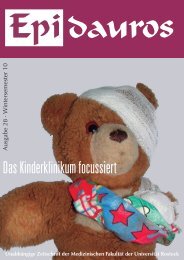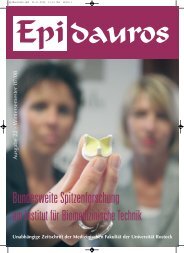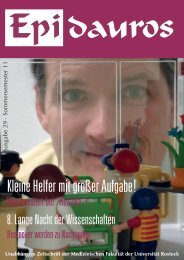Feierliche Zeugnisübergabe - der Fachschaft - Universität Rostock
Feierliche Zeugnisübergabe - der Fachschaft - Universität Rostock
Feierliche Zeugnisübergabe - der Fachschaft - Universität Rostock
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ausgabe 24 · Wintersemester 08<br />
<strong>Feierliche</strong> <strong>Zeugnisübergabe</strong><br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong> verabschiedet ihre Absolventen<br />
Unabhängige Zeitschrift <strong>der</strong> Medizinischen Fakultät <strong>der</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong>
Kürzlich ging es in einer großen Veranstaltung am Klinikum darum, für den<br />
Beruf des Algemeinmediziners zu werben. Uniklinikum und Medizinische<br />
Fakultät hatten zusammen mit dem Sozialministerium von Mecklenburg-Vorpommern,<br />
<strong>der</strong> Ärztekammer, <strong>der</strong> Kassenärztlichen Vereinigung und<br />
<strong>der</strong> Krankenhausgesellschaft dazu eingeladen, sich über Möglichkeiten und Perspektiven<br />
des Daseins als Allgemeinmediziner zu informieren. Die Voraussetzungen,<br />
das wurde auf <strong>der</strong> mittlerweile dritten Veranstaltung dieser Art klar, sind<br />
bestens. Ganz an<strong>der</strong>s als in vielen an<strong>der</strong>en Berufen stehen für frisch ausgebildete<br />
Ärzte die Türen weit offen. Sind das nicht gute Nachrichten? Mal ehrlich, ich selber<br />
stamme ja auch aus einem Algemeinmedizinerhaushalt. Wenn ich nicht Journalist<br />
geworden wäre, ich hätte Medizin studiert und mich als Hausarzt nie<strong>der</strong>gelassen.<br />
Kaum eine Arbeit dürfte so abwechslungsreich sein. Und kaum eine Arbeit<br />
so reich an Geschichten. Was man als Allgemeinmediziner an Storys erlebt<br />
o<strong>der</strong> an Charakterstudien anstellen kann – das füllt Bände. Und das haben schon<br />
etliche Literaten für sich ausgenutzt. Der Amerikaner William Carlo Williams zum<br />
Beispiel, <strong>der</strong> als Landarzt in New Jersey arbeitete und sich während <strong>der</strong> Arbeit<br />
immer Notizen machte. Herausgekommen sind hinreißende Gedichte und Romane,<br />
die ihn zum Wegbereiter <strong>der</strong> Beat-Poeten machten. Und das alles zwischen<br />
Sprechstunde und Hausbesuch. Um in <strong>der</strong> Literatur zu bleiben. Wer „Saturday“<br />
von Ian McEwan gelesen hat, wird ganz im Gegenteil eine Affinität zum hoch spezialisierten<br />
Mediziner entwickeln, in diesem Fall zum Neurochirurgen. Auch darin<br />
liegt natürlich ein Reiz: Auf <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> Forschung zu stehen, neueste Entwicklungen<br />
anzuwenden, Ideen, die dem Forschergeist entspringen, Wirklichkeit werden<br />
zu lassen. In diesem Sinne sind in <strong>der</strong> aktuellen Ausgabe des „Epidauros“<br />
wie<strong>der</strong> Themen aus <strong>der</strong> klinischen Behandlung, aus Forschung und Lehre gleichermaßen<br />
vertreten. Erfolgreiche Herzkatheterbehandlungen und Ablationen,<br />
Operation am Kunstknochen, wissenschaftliche Veranstaltungen zum Einsatz von<br />
Herzklappen, Forschungsleistungen wie die Luftdusche für Asthmatiker die in <strong>Rostock</strong><br />
getestet wird o<strong>der</strong> die wissenschaftliche Untersuchung von Hänseleien in <strong>der</strong><br />
Schule. Vertreten ist natürlich auch das Thema „Hausarzt in MV“, um den Kreis zu<br />
schließen. Möglichkeiten gibt es viele. Vielleicht hilft <strong>der</strong> „Epidauros“ dabei, die<br />
richtige Entscheidung zu treffen.<br />
Mathias Schümann<br />
Liebe Leserin,<br />
lieber Leser<br />
editorial<br />
3
forschung<br />
Medizinische Forschung in <strong>Rostock</strong> vorgestellt<br />
Hänseleien werden wissenschaftlich untersucht<br />
Doping für die Haut, Heilung für die Muskeln<br />
Luftdusche soll Asthmatiker nachts vor Feinstaub schützen<br />
focus<br />
Klappensymposium 2008<br />
Medizinische Herausfor<strong>der</strong>ung - Fallot’sche Tetralogie<br />
Leichtathletik fürs Gehirn<br />
Jubiläum mit Kin<strong>der</strong>fest und Fachtagung<br />
3.041 <strong>Rostock</strong>er Kin<strong>der</strong> zeigten ihre Zähne<br />
Ein Mahnmal für die Opfer <strong>der</strong> Euthanasie<br />
Verbrechen an psychisch kranken und behin<strong>der</strong>ten Menschen<br />
studium und lehre<br />
Der Hasuarzt in MV - Eine vom Aussterben bedrohte Spezies?<br />
Hautnah dabei<br />
Operation am Kunstknochen<br />
Notfallmedizin einmal an<strong>der</strong>s!<br />
Tag <strong>der</strong> <strong>Universität</strong><br />
klinikum<br />
Stromimpulse gegen stolpernde Herzen<br />
Mädchen aus Afghanistan erfolgreich in <strong>Rostock</strong> operiert<br />
Maritime Unternehmen spenden für Uni-Kin<strong>der</strong>klinik<br />
wissenswert<br />
inhalt<br />
Rezension Fachwortschatz Medizin Englisch<br />
Rezension Checkliste Arzneimittel A-Z<br />
Rezension Checkliste Neonatologie<br />
Rezension 1. ÄP Physikum | 1. ÄP Set<br />
Rezension 2. ÄP - Hammerexamen | Examen Herbst 2006 Examen Frühjahr 2007<br />
Rezension 2.ÄP - Hammerexamen | Examen Herbst 2007<br />
Rezension Taschenatlas <strong>der</strong> Anästhesie<br />
5<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
Impressum<br />
Titelbild:<br />
Medienzentrum <strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong><br />
Redaktionsleitung: Matthias Schümann<br />
Redaktionsassistenz: Marian Löffler<br />
Redaktion: Christian Klein, Torsten<br />
Schulz, Regina Baukholt, Paul Schwanitz,<br />
Maria Bretschnei<strong>der</strong>, Thomas Nisters,<br />
Kerstin Grünzel, Sphinx ET<br />
Idee und Grafik:<br />
Sphinx ET – Agentur für<br />
Zeitgeisentwicklung<br />
Große Goldstraße 7<br />
18055 <strong>Rostock</strong><br />
Fon: 0381. 128 93 92<br />
Fax: 0381. 128 94 79<br />
Druck: Klatschmohn Verlag<br />
Auflage: 1.500 Stück<br />
Herausgeber:<br />
Alumni Med <strong>Rostock</strong> e.V.<br />
c/o Studiendekanat <strong>der</strong><br />
Medizinischen Fakultät<br />
Rembrantstraße 16/17<br />
18057 <strong>Rostock</strong><br />
in Kooperation mit <strong>der</strong> <strong>Fachschaft</strong><br />
Medizin <strong>der</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong><br />
24. JANUAR 2009 | 18.00 - 22.00 UHR | ÖSTLICHE ALTSTADT<br />
24. Ausgabe 2008
Geknackte Zellcodes, nachwachsendesHerzmuskelgewebe<br />
o<strong>der</strong> die Entschlüsselung<br />
von Entzündungserkrankungen:<br />
<strong>Rostock</strong>er Wissenschafler haben im<br />
Bereich <strong>der</strong> medizinischen Forschung<br />
Erfolge auf Weltniveau vorzuweisen.<br />
Am 25. September 2008 präsentierten<br />
die Wissenschaftler des Klinikums und<br />
<strong>der</strong> Medizinischen Fakultät <strong>der</strong> <strong>Universität</strong><br />
<strong>Rostock</strong> ihre Arbeiten auf<br />
einem Symposium. Ver treten waren<br />
dabei Mediziner, die sich <strong>der</strong> Krebs forschung,<br />
<strong>der</strong> Erforschung entzündlicher<br />
Erkrankungen und <strong>der</strong> Regene ration<br />
<strong>der</strong> Knochen und des Herzen widmen.<br />
Auf dem Gebiet <strong>der</strong> Tumorforschung<br />
konnte beispielsweise die Forscher -<br />
gruppe von Professor Dr. Brigitte Pützer,<br />
Leiterin <strong>der</strong> Arbeitsgruppe für<br />
Vektorologie und Gentransfer, ein Protein<br />
in <strong>der</strong> Zelle identifizieren, das für<br />
die beson<strong>der</strong>e Wi<strong>der</strong>standsfähig keit<br />
von Tumorzellen gegenüber Chemotherapie<br />
von Bedeutung ist. Daraus ergeben<br />
sich ganz neue An sätze für die<br />
Behandlung von Krebs.<br />
In <strong>der</strong> Erforschung <strong>der</strong> entzündlichen<br />
Erkrankungen ist es den Forschern um<br />
Professor Dr. Johann C. Virchow, Leiter<br />
<strong>der</strong> Abteilung für Pneumologie, gelungen,<br />
die Bedeutung von so genannten<br />
dendritischen Zellen – das sind Zellen<br />
des Immunsystems – für entzündliche<br />
Erkrankungen <strong>der</strong> Lunge aufzudecken.<br />
Der Forschergruppe gelang es erstmals,<br />
eine Methode zu entwickeln, mit<br />
<strong>der</strong> diese Zellen aus <strong>der</strong> Lungenspül-<br />
24. Ausgabe 2008<br />
forschung<br />
Medizinsche Forschung in <strong>Rostock</strong> vorgestellt<br />
Krebs, Entzündungserkrankungen und Organregeneration im Mittelpunkt<br />
Foto: Die Medizinische Fakultät <strong>der</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong> entwickelte sich zu einem anerkannten Forschungsstandort<br />
in Deutschland. (Quelle: © Michael Bührke / PIXELIO)<br />
flüssigkeit analysiert werden können.<br />
Bei <strong>der</strong> Erforschung <strong>der</strong> Regeneration<br />
von Organen stehen Knochen und<br />
Herz im Vor<strong>der</strong>grund. Dabei arbeiten<br />
die Wissenschaftler eng mit Unter -<br />
nehmen <strong>der</strong> Region zusammen – etwa<br />
<strong>der</strong> DOT GmbH, <strong>der</strong> Artoss GmbH<br />
o<strong>der</strong> Miltenyi Biotec. Das WirtschaftsministeriumMecklenburg-Vorpommern<br />
unterstützt diese Forschungstätig -<br />
keit mit drei Millionen Euro. Weit über<br />
die Landesgrenzen hinaus bekannt<br />
wurde die Stammzell therapie zur Regeneration<br />
des Herzen durch die Arbeitsgruppe<br />
um den Herzchirurgen<br />
Professor Dr. Gustav Steinhoff. Die<br />
Forschergruppe bekam unlängst die<br />
Bewilligung des Bundes forschungs -<br />
ministeriums, den Einsatz <strong>der</strong> Stammzelltherapie<br />
am Menschen zu<br />
üb e r prüfen. Die Bundesregierung un-<br />
6<br />
ter stützt dieses Vorhaben mit mehreren<br />
Millionen Euro.<br />
Drei Forschergruppen des Zentrums für<br />
Medizinische Forschung sind außerdem<br />
beteiligt am Son<strong>der</strong> for schungs -<br />
bereich <strong>der</strong> Deutschen Forschungsgemeinschaft,<br />
<strong>der</strong> zusammen mit den renommierten<br />
Stand orten Hannover und<br />
Aachen an <strong>der</strong> Rekonstruktion biologischer<br />
Funk tionen durch Mikro- und<br />
Nano systeme forscht.<br />
Die Medizinische Fakultät hat sich mit<br />
ihrer Forschung zu einem beachteten<br />
Standort in Deutschland entwickelt<br />
und ist international konkurrenzfähig<br />
geworden.<br />
Matthias Schümann<br />
Eine <strong>Rostock</strong>er Studie widmet<br />
sich den Hänseleien unter Kin<strong>der</strong>n.<br />
„Hänseleien im Voschulund<br />
Grundschulalter“ lautet ihr Titel,<br />
durchgeführt wird sie von Psycho -<br />
logen des Instituts für Medizinische<br />
Psychologie an <strong>der</strong> Medizinischen Fakultät<br />
<strong>der</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong>. Untersucht<br />
werden <strong>Rostock</strong>er Kin<strong>der</strong> im<br />
Vorschul- und Grundschulalter, die<br />
den Forschern von ihren Erfahr ungen<br />
mit Hänseleien und Mobbing berichten.<br />
Ziel <strong>der</strong> Studie ist es, den bislang<br />
fast unerforschten Bereich des Mobbings<br />
insbeson<strong>der</strong>e bei kleineren Kin<strong>der</strong>n<br />
zu untersuchen. Dabei stehen im<br />
Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses:<br />
die Art des Hänselns, die Häufigkeit<br />
und auch ob sich das kindliche<br />
Mobbing verän<strong>der</strong>t, beispielweise<br />
durch die Einschulung und den damit<br />
forschung<br />
Hänseleien werden wissenschaftlich untersucht<br />
<strong>Rostock</strong>er Forschungsprojekt hat Mobbing unter kleinen Kin<strong>der</strong>n als Thema<br />
einhergehenden Umstel lungen. Die<br />
Untersuchungen begannen im August<br />
und sollen bis zum Herbst 2008 andauern.<br />
„Mobbing im Vorschul- und frühen<br />
Grundschulalter ist ein nahezu unerforschtes<br />
Thema in Deutschland“, sagt<br />
die Diplom-Psychologin Sabine Koep -<br />
sell von Institut für Medizinische Psychologie<br />
am <strong>Universität</strong>sklinikum<br />
<strong>Rostock</strong>. „Dabei berichten Kin<strong>der</strong> -<br />
gärtnerinnen und auch Kin<strong>der</strong>ärzte,<br />
dass Kin<strong>der</strong> erste Mobbing-Erfahr -<br />
ungen schon ab dem Alter von vier bis<br />
sechs Jahren machen.“ Bisherige Untersuchungen<br />
setzen erst ab <strong>der</strong> 3.<br />
o<strong>der</strong> 4. Klassenstufe ein. Das Forsch -<br />
ungsprojekt „Hänseleien im Vorschulund<br />
Grundschulalter“ soll Aufschluss<br />
darüber bringen, was die Art, <strong>der</strong> Um-<br />
Foto: Kin<strong>der</strong> machen erste Mobbing-Erfahrungen bereits ab dem Alter von vier bis sechs Jahren.<br />
(Quelle: © Stephanie Hofschlaeger / PIXELIO)<br />
7<br />
fang und natürlich auch die Inhalte<br />
des Mobbings sind. Ein wichtiges<br />
Thema hat Sabine Koepsell schon im<br />
Vorfeld ausgemacht: Übergewicht sei<br />
oft Anlass für Hänseleien, und selbst<br />
übergewichtige Kin<strong>der</strong> wollen keinen<br />
übergewichtigen Freund o<strong>der</strong> übergewichtige<br />
Freundin haben. Ein brisantes<br />
Thema in Mecklenburg-Vorpommern,<br />
wo Übergewicht gerade unter Kin<strong>der</strong>n<br />
immer mehr zum Problem wird, so die<br />
Psychologin.<br />
Untersucht werden 200 <strong>Rostock</strong>er<br />
Kin<strong>der</strong> – zum einen 100 Vorschul -<br />
kin<strong>der</strong>, die ab 01. September 2008<br />
eingeschult wurden sowie zum an<strong>der</strong>en<br />
100 Kin<strong>der</strong>, die nach den diesjährigen<br />
Sommerferien die zweite Klasse<br />
besuchen. Die Untersuchung erfolgt in<br />
einem 45-minütigem Gespräch mit<br />
dem teilnehmenden Kind, zeitgleich<br />
werden die Eltern separat kurz be fragt.<br />
Langfristiges Ziel des Projektes soll die<br />
Erstellung eines effektiven Screenings<br />
für Mobbing-Opfer sein, das Ärzte, als<br />
auch pädagogische so wie klinische<br />
Einrichtungen nutzen können. Als<br />
Dankeschön erhalten alle Kin<strong>der</strong> ein<br />
„Zaubergeschenk“ sowie einen Kinogutschein<br />
für sich und ein Elternteil,<br />
verspricht Sabine Koepsell.<br />
Informationen zur Studie unter:<br />
www.haenselei-rostock.de.<br />
Matthias Schümann<br />
24. Ausgabe 2008
Zwei junge <strong>Rostock</strong>er Wissen -<br />
schaftler haben mit ihren Arbeitsgruppen<br />
wichtige europäische<br />
Forschungspreise gewonnen.<br />
Der Mediziner Dr. med. Heiko Sorg erhielt<br />
den Walter-Brendel-Preis für seine<br />
Untersuchungsergebnisse, die be legen,<br />
dass niedrige Gaben des als Dopingmittel<br />
bekannt gewordenen Hormons<br />
Epo positiv auf die Heilung verletzter<br />
Haut wirken. Ioannis Stra tos, ebenfalls<br />
Mediziner, erhielt den B. Braun-Preis<br />
für seine Analyse <strong>der</strong> Vorgänge bei <strong>der</strong><br />
Heilung von Mus kelgewebe. Stratos<br />
fand heraus, dass dabei nicht nur neue<br />
Zellen gebildet werden, son<strong>der</strong>n auch<br />
Zellen gezielt absterben. Seine Erkenntnis<br />
hat Kon sequenzen für die<br />
medizinische Be gleitung des Heilungsprozesses<br />
von Muskeln. Beide<br />
Mediziner arbeiten am <strong>Universität</strong>sklinikum<br />
<strong>Rostock</strong>. Die Preise sind mit<br />
1500 bzw. 1000 Euro dotiert.<br />
Doping für die Haut: Das Hormon<br />
Erythropoietin (Epo) wirkt sich positiv<br />
auf die Regeneration von Hautgewebe<br />
aus. Zu dieser Erkenntnis kam <strong>der</strong> <strong>Rostock</strong>er<br />
Mediziner Dr. med. Heiko<br />
Sorg vom Institut für Experimentelle<br />
Chirurgie (Direktorin: Professor Dr.<br />
med. Brigitte Vollmar) <strong>der</strong> Medizi -<br />
nischen Fakultät <strong>der</strong> <strong>Universität</strong> Ros -<br />
tock, wo das als Doping-Mittel bekannt<br />
gewordene Epo systematisch untersucht<br />
wird. Tests ergaben, dass hohe<br />
Gaben von Epo sich eher negativ auf<br />
den Heilungsprozess auswirken, wohingegen<br />
niedrige Dosen an Epo positiv<br />
auf die Hautregeneration wirken. „Wir<br />
24. Ausgabe 2008<br />
forschung<br />
Doping für die Haut, Heilung für die Muskeln<br />
<strong>Rostock</strong>er Wissenschaftler gewinnen wichtige europäische Forschungspreise<br />
konnten nachweisen, dass sich durch<br />
die Gabe von Epo die Neu bildung von<br />
Gefäßen in verletzten Hautarealen geför<strong>der</strong>t<br />
wurde und dass die funktionelle<br />
Regeneration auf diese Weise<br />
beschleunigt werden konnte“, so Dr.<br />
Sorg. Der <strong>Rostock</strong>er Wissenschaftler<br />
erhielt für seine Untersuchungen den<br />
mit 1500 Euro dotierten Walter-Brendel-Preis<br />
<strong>der</strong> Europäischen Gesellschaft<br />
für Chirurgische Forschung.<br />
Foto: Das Hormon Erythropoietin ist Doping für<br />
die Haut. (Quelle: Stephanie Hofschlaeger / PI-<br />
XELIO)<br />
Heilung für die Muskeln: Ebenfalls auf<br />
dem Gebiet <strong>der</strong> Regenerativen Medizin<br />
forscht <strong>der</strong> <strong>Rostock</strong>er Arzt Ioannis<br />
Stratos. Der junge Mediziner untersuchte<br />
im Rahmen seiner Dok torarbeit<br />
am Institut für Experimen telle Chirurgie<br />
den Heilungsprozess von zum Beispiel<br />
bei einem Unfall verletztem<br />
Muskelgewebe. Er gelangte zu <strong>der</strong> Erkenntnis,<br />
dass es bei <strong>der</strong> Heilung des<br />
Gewebes nicht nur zur Neubildung<br />
von Muskelgewebe durch lokale<br />
Stammzellen kommt, son<strong>der</strong>n auch<br />
8<br />
zum systematischen Abräumen des<br />
zerstörten Muskelgewebes. Dabei<br />
komme es zu Prozessen wie Apoptose<br />
(programmierter Zelltod) o<strong>der</strong> Nekrose<br />
(nicht programmierter Zelluntergang),<br />
so Stratos. Seine Er kenntnisse haben<br />
Einfluss auf die Behandlung von<br />
Weichteil-Verletzungen.<br />
Demnach müsse nicht nur die Neubildung<br />
von Zellen, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong><br />
Abtransport des zerstörten Gewebes<br />
gezielt geför<strong>der</strong>t werden, um eine rasche<br />
und suffiziente Muskelregeneration<br />
zu be wirken. Für seine Erkenntnis<br />
bekam Stratos den B. Braun-Award für<br />
die „Beste Klinik-relevante wissenschaftliche<br />
Arbeit“. Der mit 1000 Euro<br />
dotierte Preis wird von <strong>der</strong> Firma B.<br />
Braun Melsungen vergeben. Ioannis<br />
Stratos arbeitet an <strong>der</strong> Abteilung für<br />
Unfall- und Wie<strong>der</strong>herstellungschirurgie<br />
des Uniklinikums <strong>Rostock</strong>.<br />
Matthias Schümann<br />
Foto: (Quelle: © S. Hofschlaeger / PIXELIO)<br />
forschung<br />
Luftdusche soll Asthmatiker nachts vor Feinstaub schützen<br />
Uniklinikum <strong>Rostock</strong> suchte Probanden für europaweite Studie<br />
Eine Luftdusche könnte Asthma-<br />
Patienten nachts vor Feinstaub<br />
schützen. Diese Partikel, die sich<br />
ständig in <strong>der</strong> Atemluft befinden und<br />
bei Asthmatikern häufig einen Anfall<br />
auslösen, werden durch ein neu entwickeltes<br />
Gerät aus <strong>der</strong> Luft herausgefil -<br />
tert. Weil <strong>der</strong> positive Effekt des Geräts<br />
bisher erst bei wenigen Patienten<br />
nachgewiesen wurde, sollte jetzt eine<br />
europaweit durchgeführte Studie Aufschluss<br />
über die Wirksamkeit <strong>der</strong> Methode<br />
bringen. Das <strong>Universität</strong>sklinikum<br />
<strong>Rostock</strong> beteiligte sich daran und suchte<br />
Probanden, die das Gerät testeten. Bewerben<br />
konnten sich Menschen, die<br />
unter Asthma leiden und trotz Einsatz<br />
von Medikamenten nicht beschwerdefrei<br />
sind. Wenn sich die Therapie als<br />
erfolgreich erweist, erhoffen sich die<br />
Mediziner langfristig eine Lin<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Krankheitssymptome bei sinkenden<br />
o<strong>der</strong> sogar ohne Medikamentengaben.<br />
Die Entstehung von Asthma ist bis<br />
heute nicht zweifelsfrei geklärt. Rund<br />
10 Prozent <strong>der</strong> Bevölkerung leiden inzwischen<br />
daran. Fest steht, dass Heuschnupfen<br />
und an<strong>der</strong>e Allergien auf<br />
lange Sicht zu Asthma führen können.<br />
Aus diesem Grund wurde ein neues<br />
Gerät entwickelt, das die Partikel <strong>der</strong><br />
Luft, die Allergien auslösen können,<br />
herausfiltert. Das Gerät hat einen<br />
schwenkbaren Arm mit einer Art<br />
Duschkopf, <strong>der</strong> nachts über dem<br />
Schlafenden hängt und gereinigte Luft<br />
abgibt. „Die Idee ist genial“, sagt Professor<br />
Dr. med. J. Christian Virchow,<br />
Leiter <strong>der</strong> Abteilung für Pneumologie<br />
am <strong>Universität</strong>sklinikum <strong>Rostock</strong>. „Die<br />
Luft wird angesaugt, gefiltert und dann<br />
über die Luftdusche wie<strong>der</strong> abgegeben.<br />
Da sie beim Filtern etwas abkühlt<br />
und deshalb schwerer ist als die wärmere<br />
Umgebungsluft, senkt sie sich<br />
wie eine Glocke über den Kopf des<br />
Schlafenden, <strong>der</strong> dann absolut saubere<br />
Luft atmet und wenigstens nachts vor<br />
Allergien auslösendem Feinstaub<br />
Ruhe hat.“<br />
Normalerweise befinden sich in jedem<br />
Kubikmeter Luft etwa 22.000 Feinstaub-Partikel.<br />
Beson<strong>der</strong>s im Frühjahr<br />
sind viele Pollen darunter. „Die Luft,<br />
die <strong>der</strong> Schlafende mit Hilfe des Gerätes<br />
atmet, ist zu 100 Prozent partikelfrei“,<br />
so Professor Virchow. Wenn<br />
diese Art <strong>der</strong> Therapie Asthmakranken<br />
wirklich hilft, versprechen sich die<br />
Mediziner nicht nur nächtliche Lin<strong>der</strong>ung<br />
von den Beschwerden, son<strong>der</strong>n<br />
langfristig auch eine Verringerung des<br />
Bedarfs an Medikamenten – vor allem<br />
<strong>der</strong> Präparate mit dem Wirkstoff Cortison.<br />
Dafür musste das Gerät aber erst getestet<br />
werden. Schwedische Ärzte erzielten<br />
bereits gute Ergebnisse. Jetzt<br />
sollte die Neuentwicklung in einer europaweit<br />
durchgeführten Studie, an<br />
<strong>der</strong> mehr als 20 Zentren beteiligt<br />
waren, erprobt werden. Eines von drei<br />
deutschen Zentren ist das <strong>Universität</strong>sklinikum<br />
<strong>Rostock</strong>, das Probanden<br />
suchte: erwachsene Menschen mit<br />
Asthma, die nicht rauchen und aller-<br />
9<br />
gisch auf Hausstaub milben und Tierallergene<br />
reagieren, und die trotz Therapie<br />
nicht be schwerde frei sind. Sie<br />
erhielten zunächst einen kostenlosen<br />
Gesund heitsscheck, und wenn sie für<br />
die Studie geeignet waren, eines <strong>der</strong><br />
Geräte zur Erprobung mit nach Hause.<br />
Matthias Schümann<br />
Foto: Dr. Peter Julius justiert die Luftdusche.<br />
(Quelle: UKR)<br />
24. Ausgabe 2008
Herzklappenerkrankungen<br />
nehmen immer weiter zu.<br />
Der Grund: Die Lebenserwartung<br />
steigt und Klappenfehler treten<br />
im Alter gehäuft auf. Auch die Zahl<br />
<strong>der</strong> Herzklappenoperationen nimmt<br />
zu. Wurden im Jahr 1997 in <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
13.482 Patienten wegen<br />
einer erkrankten Herzklappe operiert,<br />
so waren es zehn Jahre später 21.160.<br />
Beson<strong>der</strong>s oft waren dabei verengte<br />
Aortenklappen bei älteren Menschen<br />
herzchirurgisch zu versorgen.<br />
Die Medizin hat auf dem Gebiet <strong>der</strong><br />
Rekonstruktion und des biologischen<br />
Ersatzes von Herzklappen große Fortschritte<br />
gemacht. Neue Möglichkeiten,<br />
Herzklappenerkrankungen zu behandeln,<br />
wie <strong>der</strong> Ersatz von Herzklappen<br />
24. Ausgabe 2008<br />
focus<br />
Klappensymposium 2008<br />
Neue Behandlungsmöglichkeiten von Herzklappenerkrankungen<br />
am <strong>Universität</strong>sklinikum <strong>Rostock</strong><br />
mit Hilfe von Kathetertechnik, werden<br />
gegenwärtig klinisch erprobt. Daneben<br />
haben sich operative Techniken<br />
grundlegend verbessert, so dass heute<br />
nur noch bei einem Teil <strong>der</strong> Patienten<br />
<strong>der</strong> Brustkorb eröffnet werden muss.<br />
Schlüsselloch-Operationen und Mini-<br />
Herz-Lungen-Maschine erlauben auch<br />
bei älteren Patienten eine gefahrlose<br />
operative Versorgung.<br />
Im Rahmen des diesjährigen Herzmonats<br />
informiert das <strong>Universität</strong>sklinikum<br />
<strong>Rostock</strong> über neue Techniken<br />
und interdisziplinäre Aktivitäten von<br />
Kardiologie und Herzchirurgie.<br />
Freitag, 21. November 2008, Biomedizinisches<br />
Forschungszentrum, Schillingallee<br />
69:<br />
Foto: Professor Steinhoff (l.) und Professor Liebold während einer Herzklappenoperation. (Quelle :UKR)<br />
10<br />
10:00 Uhr Begrüßung<br />
Professor Dr. med. P. Schuff-Werner<br />
Ärztlicher Direktor des <strong>Universität</strong>sklinikums<br />
<strong>Rostock</strong><br />
10:05 Uhr Vorträge mit<br />
Patientenvorstellung<br />
Vorsitz: Professor Dr. G. Steinhoff,<br />
Direktor, Klinik für Herzchirurgie<br />
Professor Dr. C. Nienaber,<br />
Direktor, Abteilung Kardiologie<br />
Transkutaner Aortenklappenersatz –<br />
Wer profitiert, wer kommt in Frage?<br />
Professor Dr. med. H. Ince<br />
Stellvertreten<strong>der</strong>. Direktor,<br />
Abteilung Kardiologie<br />
Schonende Herzklappenkorrektur<br />
in minimal-invasiver Technik<br />
Professor Dr. med. A. Liebold<br />
Stellvertreten<strong>der</strong> Direktor,<br />
Klinik für Herzchirurgie<br />
11:15 Uhr Pressegespräch<br />
Panel: Professor Steinhoff,<br />
Professor Nienaber,<br />
Professor Liebold, Professor Ince<br />
12:00 Uhr Imbiss<br />
Mo<strong>der</strong>ation: Volker Böhning, Semper<br />
Avanti<br />
UNIVERSITÄT ROSTOCK<br />
Medizinische Fakultät<br />
Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie<br />
Auf <strong>der</strong> „Baltic Summer -<br />
academy 2008“ diskutierten<br />
am 29. und 30. August Mediziner<br />
aus dem In- und Ausland neue<br />
Behandlungsmöglichkeiten <strong>der</strong> Fallot´schen<br />
Tetralogie(TOF). Dabei handelt<br />
es sich um einen schweren<br />
angeborenen Mehrfach-Herzfehler, mit<br />
dem in Deutschland jährlich rund 800<br />
Babys zur Welt kommen. Ins gesamt leiden<br />
deutschlandweit mehr als 30.000<br />
Menschen an dieser Fehlbildung.<br />
Die Fallot’sche Tetralogie, benannt<br />
nach dem französischen Arzt Etienne<br />
Fallot, bezeichnet einen Herzfehler<br />
mit gleich vier Anomalien: einem<br />
Loch in <strong>der</strong> Herzscheidewand, über<br />
das das Blut aus <strong>der</strong> linken Herzkam -<br />
mer teilweise zurück in die rechte<br />
fließt, einer Fehlstellung <strong>der</strong> Haupt-<br />
schlaga<strong>der</strong>, einer Verengung <strong>der</strong> Lungenschlaga<strong>der</strong>klappe<br />
sowie einer Verdickung<br />
<strong>der</strong> Muskulatur <strong>der</strong> rechten<br />
Herzkammer, die aus <strong>der</strong> vermehrten<br />
focus<br />
Medizinische Herausfor<strong>der</strong>ung – Fallot’sche Tetralogie<br />
Internationale Forscher diskutierten in <strong>Rostock</strong> neue Behandlungskonzepte<br />
Foto: Professor An<strong>der</strong>son (London) erläutert die<br />
Morphologie von TOF für den Kliniker. (Quelle:<br />
Sphinx ET)<br />
Foto: Professor Peuster beschreibt die Behand -<br />
lung erwachsener Patienten nach <strong>der</strong> Operation.<br />
(Quelle: Sphinx ET)<br />
Arbeit herrührt, die die rechte Kammer<br />
leisten muss. Die Folge ist permanenter<br />
Sauerstoffmangel im Blut, was zu<br />
Schweratmigkeit und typisch blauer<br />
Hautfärbung führt. Der Körper versucht<br />
<strong>der</strong> Sauerstoffarmut durch vermehrte<br />
Bildung von roten Blutkörper- chen zu<br />
begegnen, was wie<strong>der</strong>um die Thrombosegefahr<br />
er höht. Früher waren Kin<strong>der</strong><br />
mit diesem Herzfehler nicht<br />
lebensfähig. Erst seit den 70er Jahren<br />
kann <strong>der</strong> Defekt operativ behandelt<br />
werden.<br />
Die erfor<strong>der</strong>lichen langfristigen Be-<br />
handlungskonzepte sind am Univer -<br />
sitätsklinikum <strong>Rostock</strong> dank <strong>der</strong><br />
interdisziplinären Kooperation von<br />
Kin<strong>der</strong>kardiologen unter <strong>der</strong> Leitung<br />
von Professor Dr. Matthias Peuster und<br />
<strong>der</strong> Herzchirurgen unter Profes sor Dr.<br />
Gustav Steinhoff und dem Perinatalzentrum<br />
<strong>Rostock</strong> etabliert. „Da ständig<br />
neue Möglichkeiten <strong>der</strong> Katheterbehandlung<br />
und Operation von Herz-<br />
11<br />
Foto: Professor Steinhoff während <strong>der</strong> Eröffnung<br />
<strong>der</strong> „Baltic Summeracademy 2008“. (Quelle:<br />
Sphinx ET)<br />
fehlern entwickelt werden, verschiebt<br />
sich auch die Grenze des Machbaren<br />
immer weiter“, sagt Professor Dr. Gustav<br />
Steinhoff, Direk tor <strong>der</strong> Klinik und<br />
Poliklinik für Herzchirurgie am Uniklinikum<br />
Ros tock. An <strong>der</strong> Fachkonferenz<br />
in Ros tock nahmen rund ein-<br />
hun<strong>der</strong>t nationale und internationale<br />
Teilnehmer teil: neben Spezialisten<br />
aus Deutsch land auch Mediziner<br />
unter an<strong>der</strong>em aus England, <strong>der</strong><br />
Schweiz und den USA.<br />
Informationen unter:<br />
www.baltic-summeracademy.com<br />
Matthias Schümann<br />
24. Ausgabe 2008
Der <strong>Rostock</strong>er Psychiater und<br />
Spezialist für Demenzerkrankungen,<br />
Professor Dr. Stefan<br />
Teipel, tritt für eine verstärkte Früherkennung<br />
von Demenzkrankheiten ein.<br />
In den meisten Fällen werden Krankheiten<br />
wie Alzheimer erst sehr spät diagnostisiert,<br />
so dass vorbeugende Maßnahmen<br />
nicht mehr ergriffen werden<br />
können. Die Früherken nung dagegen<br />
ermöglicht die längere Integration <strong>der</strong><br />
Betroffenen ins Alltagsleben. In diesem<br />
Sinne wird an <strong>der</strong> Psychiatrischen Klinik<br />
<strong>der</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong> <strong>der</strong> Ausbau<br />
<strong>der</strong> Gedächtnissprechstunde zu einer<br />
„Memory Clinic“ vorangetrieben. Außerdem<br />
soll eine Tagesklinik für Demenzpatienten<br />
aufgebaut werden.<br />
In Deutschland leiden rund 1,5 Millionen<br />
Menschen an Demenzerkrankungen,<br />
die meisten Betroffenen haben<br />
Alzheimer. Die Prognosen stehen<br />
schlecht: In den kommenden zehn<br />
Jahren wird die Zahl <strong>der</strong> Demenzpatienten<br />
um weitere 60 Prozent steigen.<br />
Das Problem: „Das Netz zur Betreuung<br />
von Patienten mit Demenzerkrankungen<br />
ist noch nicht eng genug“,<br />
konstatiert Professor Dr. Stefan Teipel<br />
von <strong>der</strong> Klinik und Poliklinik für Psychiatrie<br />
und Psychotherapie am Uniklinikum<br />
<strong>Rostock</strong>. Bereits heute fließen in<br />
<strong>der</strong> Bundesrepublik jährlich rund 20<br />
Milliarden Euro in die direkte Betreuung<br />
von Demenzkranken. Zugleich<br />
bringen die Familien <strong>der</strong> Betroffenen<br />
etwa 80 Milli arden Euro jährlich auf,<br />
um die Versorgung ihrer demenzkranken<br />
Angehörigen zu sichern.<br />
focus<br />
Leichtathletik fürs Gehirn<br />
Professor Teipel: Früherkennung von Demenz dringend notwendig<br />
24. Ausgabe 2008<br />
Foto: Professor Dr. Stefan Teipel. (Quelle: UKR)<br />
Aber nicht nur finanziell sind die Familien<br />
durch die Demenzerkrankung<br />
belastet. „Wenn die Erkrankung zu<br />
spät erkannt wird, kommt es zu Verhaltensstörungen<br />
wie Schlaflosigkeit,<br />
nächtlichem Umherwan<strong>der</strong>n und<br />
schweren Verstimmungszuständen,<br />
die die pflegenden Angehörigen sehr<br />
belasten“, so Professor Teipel. Durch<br />
rechtzeitige Diagnose, Behandlung<br />
und Unterstützung <strong>der</strong> Angehörigen<br />
kann dieser Entwicklung vorgebeugt<br />
werden. Dabei gilt: „Dem Patienten<br />
mit Demenz kann es nicht gut gehen,<br />
wenn es dem pflegenden Angehörigen<br />
schlecht geht.“ Dabei könnte die Betreuung<br />
<strong>der</strong> Betroffenen deutlich verbessert<br />
werden – durch die Früh-<br />
erkennung <strong>der</strong> Erkrankung. „Demenzkrankheiten<br />
wie Alzheimer werden<br />
heute in <strong>der</strong> Regel erst diagnostiziert,<br />
wenn die Betroffenen so schwer krank<br />
sind, dass sie ins Heim müssen“, so<br />
Professor Teipel. Heilbar sind diese<br />
Krankheiten zwar noch nicht, aber<br />
durch rechtzeitige Erkennung können<br />
ihre fatalen Folgen über Jahre aufge-<br />
12<br />
schoben, die Symptome deutlich gemil<strong>der</strong>t<br />
werden, sagt <strong>der</strong> Mediziner.<br />
Ziel sei es, die Betroffenen so lange<br />
wie möglich in ihrer heimischen Umgebung<br />
zu lassen und sie ins Alltagsleben<br />
zu integrieren. Möglich werde<br />
dies durch die Zusammenarbeit von<br />
Ärzten, Pflegern, Angehörigen und Sozialverbänden.<br />
Voraussetzung ist allerdings eine frühzeitige<br />
Untersuchung, durch die bereits<br />
Jahre vor dem akuten Ausbruch<br />
<strong>der</strong> Krankheit die drohende Demenz<br />
festgestellt werden kann. Dies erfolgt<br />
durch Gedächtnistests, eine gründliche<br />
psychiatrische und neurologisch<br />
Untersuchung und durch Untersuchung<br />
des Gehirns mit bildgebenden<br />
Verfahren wie <strong>der</strong> Magnetfeldbasierten<br />
MRT. Am Uniklinikum <strong>Rostock</strong><br />
wird <strong>der</strong>zeit die bereits vorhandene<br />
Gedächtnissprechstunde zur „Memory<br />
Clinic“ ausgebaut, in <strong>der</strong> Betroffene<br />
und Angehörige fit für den täglichen<br />
Umgang mit <strong>der</strong> Demenz gemacht<br />
werden. Außerdem befindet sich eine<br />
Tagesklinik für Demenzpatienten im<br />
Aufbau.<br />
Professor Dr. Teipel bekleidet seit kurzem<br />
die Professur für klinisch-experimentelle<br />
Psychiatrie mit dem Schwerpunkt<br />
Demenz in <strong>der</strong> Klinik und Poliklinik<br />
für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
am <strong>Universität</strong>sklinikum <strong>Rostock</strong>.<br />
Matthias Schümann<br />
Mit großem Kin<strong>der</strong>fest und<br />
einem Fachsymposium<br />
beging die <strong>Rostock</strong>er Kin<strong>der</strong>chirurgie<br />
ihr 50-jähriges Jubiläum.<br />
Im August 1958 wurde sie als eigenständige<br />
Abteilung am Uniklinikum<br />
<strong>Rostock</strong> etabliert. Im kommenden Jahr<br />
steht <strong>der</strong> Umzug in neue, mo<strong>der</strong>ne<br />
Räume bevor. Am 18. September<br />
luden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
noch einmal in die alte „Kin<strong>der</strong>villa“<br />
ein, wie sie von den Mitarbeitern<br />
liebevoll genannt wird. Zum Tag <strong>der</strong><br />
offenen Tür boten sie Informationen<br />
sowie Spiel und Spaß für Kin<strong>der</strong> und<br />
Eltern. Am 26. und 27. September reisten<br />
Fachleute aus ganz Deutschland<br />
nach <strong>Rostock</strong>, um auf <strong>der</strong> Jubiläumsfachtagung<br />
aktuelle Tendenzen <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>chirurgie zu diskutieren.<br />
Voraussichtlich im kommenden Sommer<br />
wird die Kin<strong>der</strong>chirurgie neue,<br />
mo<strong>der</strong>ne Räume im Gebäude <strong>der</strong> <strong>Universität</strong>s-Kin<strong>der</strong>-<br />
und Jugendklinik beziehen.<br />
Aus diesem Grund war das<br />
Kin<strong>der</strong>fest auch gleichzeitig <strong>der</strong> Abschied<br />
von <strong>der</strong> „Kin<strong>der</strong>villa“ auf dem<br />
Campus Schillingallee. Das Haus wird<br />
Neubauten weichen, die gemeinsam<br />
mit mo<strong>der</strong>nisierten Klinikgebäuden bis<br />
2015 das Uniklinikum <strong>Rostock</strong> zu<br />
einer <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nsten Kliniken Norddeutschlands<br />
machen werden. Mit<br />
Spiel und Unterhaltung wollten die<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter <strong>der</strong><br />
Abteilung für Kin<strong>der</strong>chirurgie Einblick<br />
in ihre Arbeit gewähren. Für die Besucher<br />
gab es dabei allerhand zu erleben:<br />
Auf <strong>der</strong> Kuscheltierstation wur- den<br />
focus<br />
Jubiläum mit Kin<strong>der</strong>fest und Fachtagung<br />
Abschied von <strong>der</strong> „Kin<strong>der</strong>villa“ mit Kuscheltiersprechstunde und Trampolin<br />
Teddys und Puppen behandelt, beim<br />
Glücksrad gab es Preise zu gewinnen,<br />
Trampolin, Kin<strong>der</strong>schminken, Sportspiele<br />
und an<strong>der</strong>e Überraschungen begeisterten<br />
die Kin<strong>der</strong> und ihre Eltern.<br />
Professor Dr. Gerhard Stuhldreier, Leiter<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>chirurgischen Abteilung,<br />
freute sich, dass das von ihm organisierte<br />
Jubiläumssymposium auf den<br />
Tag genau 50 Jahre nach jener großen<br />
Fachtagung stattfand, die zur Gründungsveranstaltung<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>chirurgie<br />
in <strong>Rostock</strong> wurde: Am 26. und 27.<br />
September 1958 trafen sich unter <strong>der</strong><br />
Leitung von Professor Schmitt Fachleute<br />
in <strong>Rostock</strong>, um eine <strong>der</strong> ersten<br />
Abteilungen für Kin<strong>der</strong>chirurgie in <strong>der</strong><br />
DDR ins Leben zu rufen. „Für das Programm<br />
<strong>der</strong> Tagung am 26. und 27.<br />
September 2008 wählten wir einige<br />
<strong>der</strong> Themen, die vor 50 Jahren auf <strong>der</strong><br />
Tagesordnung standen: Von beson<strong>der</strong>er<br />
Bedeutung sind dabei aktuelle Tendenzen<br />
in <strong>der</strong> Neugeborenenchirurgie<br />
und <strong>der</strong> Unfall- und Plastischen Chir-<br />
Foto: Spiel und Spass in <strong>der</strong> „Kin<strong>der</strong>villa“.<br />
(Quelle: UKR)<br />
13<br />
urgie, <strong>der</strong> Urologie (Harnwegschirurgie)<br />
und <strong>der</strong> Tumorchirurgie bei Kin-<br />
<strong>der</strong>n“, betont Professor Stuhldreier.<br />
50 Jahre sind ein Zeitraum, in dem<br />
sich gerade auf dem Gebiet <strong>der</strong> Medizin<br />
sehr viel verän<strong>der</strong>t hat. „Vor allem<br />
die minimal-invasive Chirurgie hat unsere<br />
Möglichkeiten erheblich verbessert“,<br />
sagt Professor Stuhldreier. Als<br />
Beispiel die Operation einer so genannten<br />
Trichterbrust: früher ein großer<br />
Eingriff, bei dem alle Rippen vom<br />
deformierten Brustbein getrennt werden<br />
mussten; heute erfolgt <strong>der</strong> Eingriff<br />
minimal-invasiv. Weitgehend unverän<strong>der</strong>t<br />
geblieben seien allerdings die<br />
Verletzungen, mit denen es Kin<strong>der</strong>chirurgen<br />
zu tun bekommen, so Professor<br />
Stuhldreier: zu 90 Prozent sind<br />
es Folgen alterstypischer Unfälle.<br />
Matthias Schümann<br />
Foto: Professor Stuhldreier während <strong>der</strong> Eröff -<br />
nung des Kin<strong>der</strong>festes. (Quelle: UKR)<br />
24. Ausgabe 2008
3.041 <strong>Rostock</strong>er Kin<strong>der</strong> zeigten ihre Zähne<br />
Medizinerin warnt vor Vernachlässigung <strong>der</strong> kieferorthopädischen Vorsorge<br />
Der Anblick ist allgegenwärtig<br />
und gilt fast schon als schick:<br />
Jugendliche mit Zahnspangen,<br />
von himmelblau bis glitzerbunt.<br />
Nach oft mehrjähriger Prozedur sind<br />
das Ergebnis meist makellos ebenmäßige<br />
Zahnreihen. Doch die mechanische<br />
Regulierung von Kieferanomalien<br />
ist teuer. Und nicht immer sagt die<br />
„schöne“ Zahnreihe die Wahrheit über<br />
den Erfolg kieferorthopädischer Korrekturen.<br />
„Wir können heute nachträglich<br />
mechanisch viel erreichen“,<br />
sagt Professor Rosemarie Grabowski,<br />
Direktorin <strong>der</strong> Kieferorthopädie des<br />
<strong>Universität</strong>sklinikums <strong>Rostock</strong>. Doch<br />
ebenso wichtig seien präventive Maßnahmen,<br />
um nicht nur ein schönes,<br />
son<strong>der</strong>n ein funktionell einwandfreies<br />
Ergebnis zu haben, das Zähne lebenslänglich<br />
gesund erhält.<br />
„Während in <strong>der</strong> Zahnheilkunde <strong>der</strong><br />
Wechsel hin zur Prävention weitgehend<br />
vollzogen ist, trifft dies für kieferorthopädische<br />
Versorgung nicht<br />
zu“, kritisiert Professor Grabowski. Ein<br />
Grund dafür sei die Politik <strong>der</strong> Krankenkassen,<br />
die die Kosten für Zahnspangen<br />
weitgehend erst am Ende des<br />
Zahnwechsels o<strong>der</strong> später übernehmen.<br />
Dann sind die Anomalien „ausgereift“.<br />
Für die Krankenkassen gelten<br />
metrisch erfassbare Abweichungen als<br />
Maß <strong>der</strong> Schwere und damit <strong>der</strong> Kostenübernahme.<br />
Das bedeutet, dass<br />
präventive Maßnahmen o<strong>der</strong> Frühbehandlungen<br />
nur ausnahmsweise erfolgen<br />
können. Da kein Kind mit einer<br />
„ausgewachsenen“ kieferorthopädi-<br />
24. Ausgabe 2008<br />
focus<br />
schen Anomalie geboren wird, bleiben<br />
im Milchgebiss und während des<br />
Schneidezahnwechsels die Anomalien<br />
meist unter den metrischen Grenzwerten.<br />
Die Prognose <strong>der</strong> Entwicklung,<br />
das sind die verstärkenden Einflüsse,<br />
spielen kaum eine Rolle. Für Prävention<br />
und Frühbehandlung sich erst entwickeln<strong>der</strong><br />
Anomalien ist <strong>der</strong> Leistungs<br />
katalog <strong>der</strong> gesetzlichen Kran kenkassen<br />
extrem eingeschränkt. Dabei<br />
können beide eine eventuell später<br />
notwendige mechanische Therapie<br />
vereinfachen und das Behandlungsergebnis<br />
stabiler werden lassen.<br />
Um die Notwendigkeit <strong>der</strong> Vorsorge<br />
zu untermauern, hat die Medizinerin<br />
für eine Studie 3.041 <strong>Rostock</strong>er Kin<strong>der</strong><br />
im Vorschul- und frühen Schulalter untersuchen<br />
lassen. Sie fand heraus, dass<br />
Fehlfunktionen in <strong>der</strong> Zeit des Wechsels<br />
vom Milch- zum Wechselgebiss<br />
signifikant ansteigen. „Wenn wir in<br />
diesem frühen Stadium eingreifen<br />
könnten, wäre viel gewonnen“, ist die<br />
Kieferorthopädin sicher. Zahnfehlstellungen<br />
sind keine Schönheitsfehler.<br />
Eine Zahnfehlstellung ist häufig das<br />
sichtbare Bild vielschichtiger Funktionsstörungen.<br />
Das heißt viele Erkrankungen<br />
nehmen vom Mund aus ihren<br />
Ursprung. Die Haltungsschwäche zum<br />
Beispiel die <strong>der</strong> Kieferorthopäde an<br />
dem offen stehenden Mund des Kindes<br />
erkennt, belastet nicht nur die Gebissentwicklung.<br />
Erkrankungen <strong>der</strong> oberen<br />
Atemwege, die vergrößerte<br />
Rachen mandel, Schlafstörungen, die<br />
Beeinträchtigung beim Hören und<br />
14<br />
Sprechen bei Kin<strong>der</strong>n sind untrennbar<br />
mit <strong>der</strong> Gebisssituation verbunden.<br />
Solche fehlerhaft ablaufenden Funktionen<br />
sind nicht die Folge, son<strong>der</strong>n<br />
häufig die Ursache <strong>der</strong> Zahnfehlstellungen.<br />
Je früher solche mundmotorischen<br />
Probleme erkannt und behoben<br />
werden, umso leichter gelingt ihre<br />
Überwindung. Hier gilt das Sprichwort<br />
„was Hänschen nicht lernt, lernt Hans<br />
nimmermehr“.<br />
Dass sich das alles während des Zahnwechsels<br />
„gibt“, konnte die aufwändige<br />
Untersuchung in <strong>Rostock</strong>er<br />
Kin<strong>der</strong>einrichtungen und Schulen wi<strong>der</strong>legen.<br />
Frau Professor Grabowski<br />
appelliert deshalb an die politisch Ver-<br />
antwortlichen, die allein metrische Erfassung<br />
zur Erkennung von behandlungswürdigen<br />
Anomalien zugunsten<br />
<strong>der</strong> Entscheidungskraft <strong>der</strong> Behandler<br />
aufzugeben. „Sie erkennen, wann<br />
auch kleineren Abweichungen schwerwiegende<br />
Entwicklungsstörungen folgen<br />
können“. Frei nach <strong>der</strong> Devise:<br />
Mach ich mir mit kleinen Kin<strong>der</strong>n<br />
große Sorgen, habe ich mit großen<br />
Kin<strong>der</strong>n kleine Sorgen.<br />
Thomas Nisters<br />
Die Opfer <strong>der</strong> nationalsozialistischen<br />
so genannten Euthanasieaktion<br />
werden am<br />
27. Januar 2009 im Mittelpunkt von<br />
Gedenkfeiern stehen, so auch am <strong>Rostock</strong>er<br />
Zentrum für Nervenheil kunde.<br />
Auch von <strong>Rostock</strong> aus wurden während<br />
<strong>der</strong> Nazi-Diktatur psychisch<br />
kranke Menschen in den Tod geschickt.<br />
Daran zu erinnern und zu<br />
mahnen, dass solches nie wie<strong>der</strong> geschieht,<br />
das haben sich die Initiatoren<br />
einer Gedenkstätte für den Eingangsbereich<br />
des Zentrums für Nervenheil-<br />
Mehr als 60 Jahre nach dem<br />
Ende des National sozia lis -<br />
mus sind noch nicht alle<br />
Verbrechen <strong>der</strong> faschistischen Diktatur<br />
auf- geklärt. Eine Ar beits gruppe aus<br />
Medizinern und Histo rikern <strong>der</strong> <strong>Universität</strong><br />
<strong>Rostock</strong> beschäftigt sich <strong>der</strong>zeit<br />
mit <strong>der</strong> Auf arbeitung <strong>der</strong> so genannten<br />
Eutha na sie in Mecklenburg-Vorpom -<br />
mern, speziell mit <strong>der</strong> Beteiligung <strong>der</strong><br />
<strong>Rostock</strong>er Nervenklinik an <strong>der</strong> systematischen<br />
Tötung von Patienten zwischen<br />
1933 und 1945. „Die Zeit des<br />
Nationalsozialismus lastet noch im mer<br />
auf <strong>der</strong> deutschen Psychiatrie“, sagt Dr.<br />
Ekkehardt Kumbier von <strong>der</strong> Klinik und<br />
focus<br />
Ein Mahnmal für die Opfer <strong>der</strong> Euthanasie<br />
Künstler Christian Cordes gestaltet Gedenkstätte im <strong>Rostock</strong>er Zentrum für Nervenheilkunde<br />
kunde zum Ziel gesetzt. Der Entwurf<br />
hierfür wurde jetzt von einem Gremium<br />
aus Medizinern und Personen<br />
des öffentlichen Lebens ausgewählt. Er<br />
kommt von dem in Berlin lebenden<br />
Künstler Christian Cordes. Das Mahnmal<br />
in <strong>Rostock</strong>-Gehlsdorf soll die Erinnerung<br />
an die systematische Sterilisation<br />
und Tötung seelisch Kranker<br />
o<strong>der</strong> geistig behin<strong>der</strong>ter Men schen und<br />
vor allem an die Opfer wach halten.<br />
„Für die Errich tung des Memorials sind<br />
wir auf Spen den angewiesen“, sagt<br />
Frau Pro fessor Herpertz, die um die<br />
15<br />
Unterstützung <strong>der</strong> Menschen aus<br />
Mecklenburg-Vorpommern bittet.<br />
Spenden für das Mahnmal können auf<br />
folgendes Konto überwiesen werden:<br />
Kontoinhaber:<br />
<strong>Universität</strong>sklinikum <strong>Rostock</strong> (AöR)<br />
Kreditinstitut: Deutsche Kreditbank AG<br />
Kontonummer: 10109999<br />
BLZ: 120 300 00<br />
Verwendungszweck: 992050<br />
Matthias Schümann<br />
Verbrechen an psychisch kranken und behin<strong>der</strong>ten Menschen<br />
<strong>Rostock</strong>er Forschungsgruppe arbeitet die so genannte Euthanasie <strong>der</strong> Nazis<br />
in Mecklenburg-Vorpommern auf<br />
Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
am Uniklinikum <strong>Rostock</strong>. Der<br />
Mediziner befasst sich seit Jahren mit<br />
<strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> <strong>Rostock</strong>er Psychiatrie<br />
– insbeson<strong>der</strong>e mit <strong>der</strong> so genannten<br />
Euthanasie in <strong>der</strong> Hitlerdiktatur. In<br />
jener Zeit wurden in Deutschland mehr<br />
als 400.000 Menschen zwangssterilisiert,<br />
zwischen 1940 und 1945 wurden<br />
70.000 psychisch kranke und behin<strong>der</strong>te<br />
Menschen systematisch getötet.<br />
Auch aus <strong>der</strong> <strong>Rostock</strong>er Nervenklinik<br />
wurden Patienten abtransportiert. Wie<br />
viele von ihnen umgebracht wurden,<br />
muss noch untersucht werden. „Wir<br />
wissen von 20 Fällen, in denen Men-<br />
schen von <strong>Rostock</strong> nach Sachsen berg<br />
bei Schwerin verlegt und weiter zur Tötung<br />
in ein Lager nach Bernburg gebracht<br />
wurden“, sagt Dr. Kumbier. Das<br />
Problem <strong>der</strong> <strong>Rostock</strong>er Forscher ist die<br />
schlechte Aktenlage: „Die Krankenakten<br />
aus dieser Zeit wurden vernichtet“,<br />
so Kumbier. Als Quelle dienen in erster<br />
Linie Akten, die im Archiv <strong>der</strong> Staatssicherheit<br />
<strong>der</strong> DDR gefunden wurden<br />
und in denen Hinweise auf die Tötung<br />
von Patienten aus <strong>Rostock</strong> gefunden<br />
wurden. Für Hinweise aus <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
sind die Forscher deshalb dankbar.<br />
Matthias Schümann<br />
24. Ausgabe 2008
Bisher war die Ausbildung zum<br />
Facharzt für Allgemein medi zin<br />
schwierig. Junge Ärzte mussten<br />
sich selbst auf freie Stellen in <strong>der</strong><br />
Chirurgie, <strong>der</strong> Inneren Medizin und<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>heilkunde bewerben, um<br />
die im Weiterbildungskatalog gefor<strong>der</strong>ten<br />
Ausbildungszeiten zu sam men<br />
zu bekommen. Proble ma tisch war,<br />
dass dadurch oft Lücken entstanden.<br />
Ein werden<strong>der</strong> Hausarzt, <strong>der</strong> seine<br />
Ausbildung in <strong>der</strong> Klinik für Innere<br />
Medizin gerade beendet hat, bekam<br />
beispielsweise oft nicht direkt im Anschluss<br />
eine Stelle in <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> klinik.<br />
So entstand ein Leerlauf, in <strong>der</strong> die eigene<br />
Ausbildung nicht vorangetrieben<br />
werden konnte und in <strong>der</strong> <strong>der</strong> junge<br />
Arzt auch kein Geld bekam – in Zeiten,<br />
in denen junge Kollegen mit <strong>der</strong><br />
Familiengründung beschäftigt sind<br />
eine Katastrophe!<br />
Erschwerend bei <strong>der</strong> Suche nach<br />
freien Stellen war, dass die Kliniken<br />
ihre Stellen lieber mit Assistenzärzten<br />
besetzten, die in <strong>der</strong> eigenen Fach richtung<br />
weiterarbeiten wollten, als mit<br />
Allgemeinmedizinern, die nur eine<br />
begrenzte Zeit auf <strong>der</strong> Station waren.<br />
Die Folge war, dass <strong>der</strong> Wechsel zwischen<br />
den einzelnen Kliniken für die<br />
Hausärzte oft nicht reibungslos klappte<br />
24. Ausgabe 2008<br />
studium und lehre<br />
Der Hausarzt in MV - eine vom Aussterben bedrohte Spezies?<br />
In Mecklenburg-Vorpommern erreicht je<strong>der</strong> vierte Hausarzt in den nächsten fünf<br />
Jahren das Rentenalter. Viele Praxen finden keinen Nachfolger mehr und den Patienten<br />
fehlt <strong>der</strong> wichtigste Ansprechpartner für Gesundheitsthemen. Um dem<br />
drohenden Versorgungsmangel entgegenzuwirken, beschreiten die <strong>Universität</strong><br />
und die Kassenärtzliche Vereinigung Mecklenburg Vorpommern (KVMV) jetzt<br />
neue Wege.<br />
und viele junge Ärzte Leerzeiten hatten<br />
o<strong>der</strong> aber sehr flexibel sein mussten<br />
und zwischen Neubranden burg,<br />
Greifs wald und <strong>Rostock</strong> hin- und herwechseln<br />
mussten.<br />
Durch einen Kooperationsvertrag zwischen<br />
<strong>der</strong> KVMV und <strong>der</strong> Uni versi -<br />
tätsklinik <strong>Rostock</strong> soll sich die Situ-<br />
ation jetzt drastisch verbessern. So<br />
wurden fünf neue bewegliche Planstellen<br />
geschaffen, die eine lückenlose<br />
Ausbildung an einem Stand ort ermöglichen<br />
sollen. Das Beson <strong>der</strong>e dabei ist,<br />
dass <strong>der</strong> werdende Allgemeinmedizi-<br />
16<br />
ner mit einer eigenen Ausbildungsstelle<br />
ausgestattet wird, die er beim<br />
Wechsel zwischen den Abteilungen<br />
mitnimmt. Damit ist er nicht auf freie<br />
Stellen an den einzelnen Kliniken angewiesen,<br />
son<strong>der</strong>n kommt mit einer<br />
eigenen Stelle zu sätzlich an die Klinik.<br />
Ein flexibler Wechsel zwischen den<br />
einzelnen Abteilungen <strong>der</strong> Klinik wird<br />
so ermöglicht.<br />
Während <strong>der</strong> Ausbildung zum Fach arzt<br />
für Allgemeinmedizin durch laufen die<br />
jungen Ärzte vier Abtei lungen <strong>der</strong> Inneren<br />
Medizin (Endo krinologie, Gastroenterologie,<br />
Kardio logie und Pulmologie).<br />
Hinzu kommen 6 Monate in <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>- und Jugendmedizin und ein frei<br />
wählbares Fach in <strong>der</strong> Inneren Medizin.<br />
Auch für die anschließende 24 monatige<br />
Weiterbildung in <strong>der</strong> ambulanten<br />
hausärztlichen Versorgung (Chirurgie<br />
Foto: Professor Dr. med. E. Reisinger, Dipl.-Kfm. B. Irmscher, Professor Dr. med. P. Schuff-Werner,<br />
Dr. med. W. Eckert bei <strong>der</strong> Verkündung des Kooperationsvertrages. (Quelle: Christian Klein)<br />
und Hausarztpraxis) ist <strong>der</strong> junge Kollege<br />
nun finanziell abgesichert.<br />
Bisher war es so, dass die jungen Ärzte<br />
oft nur wenig Gehalt von ihrer Ausbildungspraxis<br />
bekommen haben, weil<br />
diese nicht mehr zahlen konnte o<strong>der</strong><br />
wollte. Da die Weiterbildung in <strong>der</strong><br />
Praxis in <strong>der</strong> Regel jedoch erst nach <strong>der</strong><br />
Ausbildungszeit in <strong>der</strong> Klinik erfolgte,<br />
arbeiteten die Ärzte, die bis dahin<br />
meist schon eine Familie zu versorgen<br />
hatten und die in den ersten drei Jahren<br />
<strong>der</strong> Ausbildung einigermaßen gut<br />
verdient hatten, meist für wenige hun<strong>der</strong>t<br />
Euro im Monat. Inzwischen er halten<br />
nie<strong>der</strong>gelassene Ärzte für die<br />
Unterstützung des jungen Kollegen in<br />
<strong>der</strong> Weiterbildung einen monatlichen<br />
Gehaltszuschuss von 2040 Euro von<br />
<strong>der</strong> KVMV.<br />
Damit haben angehende Allgemein -<br />
mediziner eine Planungssicherheit, da<br />
Zeiten <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit und <strong>der</strong><br />
sehr schlechten Bezahlung vermieden<br />
werden.<br />
Im Anschluss an die fünfjährige Ausbildung<br />
wird den frischgebackenen<br />
Allgemeinmedizinern ein freier Kassenarztsitz<br />
im Land angeboten.<br />
Wie wichtig es ist, junge Mediziner<br />
zur Nie<strong>der</strong>lassung in Mecklenburg-<br />
Vorpommern zu motivieren, zeigt ein<br />
Blick auf die Versorgungssituation im<br />
Land. Gerade in ländlichen Be rei chen<br />
ist die Lage dramatisch. Viele Kassen -<br />
arztsitze sind schon jetzt un besetzt. Ein<br />
Großteil <strong>der</strong> All ge mein mediziner steht<br />
kurz vor dem Er reichen des Rentenalters<br />
und findet keine Nach folger -<br />
selbst wenn sie Praxen, für die sie frü-<br />
studium und lehre<br />
her viel Geld bezahlen mussten, heute<br />
verschenken.<br />
Die jungen Mediziner zieht es raus<br />
aus Mecklenburg-Vorpommern, wo<br />
immer älter werdende Patienten mit<br />
einem immer größeren Behandlungs -<br />
aufwand warten. In einer Umfrage vor<br />
zwei Jahren hat die Medizinische Fakultät<br />
<strong>der</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong> die Medizinstudenten<br />
nach ihrem Berufs ziel<br />
gefragt. Zum Ende des Studiums wollten<br />
nur wenige junge Mediziner Hausarzt<br />
in Mecklenburg-Vorpom mern<br />
werden. Die Umfrage hat auch ergeben,<br />
dass sich mehr Studenten für diesen<br />
Berufsweg motivieren könn ten,<br />
wenn sie einen besseren Ver dienst,<br />
weniger bürokratischen Auf wand und<br />
eine Arbeitsstelle für den Partner/die<br />
Partnerin erwarten könnten - For<strong>der</strong>ungen,<br />
die gerade in den strukturschwachen<br />
Gebieten problematisch<br />
sind.<br />
Da viele Kommunen den Ärztemangel<br />
inzwischen als Standortdefizit erkannt<br />
haben, unterstützen sie Praxisübernahmen<br />
o<strong>der</strong> –neugründungen finanziell.<br />
In beson<strong>der</strong>s versorgungsgefährdeten<br />
Regionen kann von <strong>der</strong><br />
KVMV sogar eine Umsatz garantie<br />
o<strong>der</strong> ein Finanzkosten zuschuss gewährt<br />
werden.<br />
Auch im Studium gibt es bereits eine<br />
breite Unterstützung für die Aus bildung<br />
von Medizinstudenten. Über die<br />
Gewährung eines monatlichen Famulaturzuschusses<br />
von 200 Euro als Taschengeld<br />
für den Famulus sollen die<br />
Studenten frühzeitig in den Kontakt<br />
mit nie<strong>der</strong>gelassenen Ärzten im Bundesland<br />
kommen. Durch positive Er-<br />
17<br />
Foto: Professor Dr. med. P. Schuff-Werner und<br />
Dr. med. W. Eckert bei <strong>der</strong> Unterschrift des Kooperationsvertrages.<br />
(Quelle: Christian Klein)<br />
fahrungen in Famulatur und PJ soll die<br />
Entscheidung für den späteren Berufsweg<br />
erleichtert werden. Der Zuschuss<br />
ist über einen Antrag bei <strong>der</strong> KVMV zu<br />
erhalten und wird für Praxisfamulaturen<br />
bei nie<strong>der</strong>gelassenen Vertragsärzten<br />
in Mecklenburg-Vorpommern für<br />
längstens zwei Mo nate gewährt. Bei<br />
einer Famulatur in einer hausärztlichen<br />
Praxis wird zusätzlich ein Lenkungszuschuss<br />
von 50 Euro gezahlt.<br />
Ein weiterer Weg, um den Hausarzt in<br />
Mecklenburg-Vorpommern vor dem<br />
Aussterben zu bewahren, wird künftig<br />
auch noch beschritten – mit <strong>der</strong> Errichtung<br />
einer Stiftungsprofessur für<br />
Allgemeinmedizin. Die Bewerber ha -<br />
ben am 21.10.2008 in einer Probe -<br />
vorlesung ihre Visitenkarte abge ge ben.<br />
Zur Zeit läuft das Auswahl verfahren.<br />
Christian Klein<br />
24. Ausgabe 2008
Das Studium <strong>der</strong> Medizin ist<br />
bekanntlich selbst im klinischen<br />
Abschnitt geprägt von<br />
Theorie und weniger von Praxis. Häufig<br />
wünschen sich Studenten einen näheren<br />
Bezug zur praktischen Tätigkeit<br />
in ihrem angestrebten Beruf. Selbstver -<br />
ständlich muss sorgfältig abgewogen<br />
werden, in welchen Situationen dieser<br />
Wunsch Berücksichtigung finden kann<br />
und in welchen nicht: Die <strong>Universität</strong><br />
ist einerseits zur Lehre verpflichtet,<br />
trägt an<strong>der</strong>erseits natürlich eine enorm<br />
hohe Verantwortung gegenüber den<br />
hier behandelten Patienten. So ist es<br />
nicht verwun<strong>der</strong>lich, dass <strong>der</strong> gut ausgebildete<br />
Facharzt am OP-Tisch das<br />
Skalpell führt und nicht <strong>der</strong> junge Student.<br />
Umso interessanter sind folglich Kursangebote,<br />
die genau diesen klinischpraktischen<br />
Teil <strong>der</strong> Ausbildung in den<br />
Mittelpunkt stellen. Ein Beispiel hierfür<br />
ist <strong>der</strong> von Herrn Professor Stuhldreier<br />
initiierte Minimal-Invasive-Chi rurgie-<br />
Kurs für Studenten. Die Teilnehmer<br />
können in dieser Veranstaltungsserie<br />
erste Erfahrungen im Umgang mit <strong>der</strong><br />
„Schlüsselloch-Chirurgie“ sammeln<br />
und einen Eindruck von den Vorteilen,<br />
aber auch den Schwierigkeiten dieser<br />
noch recht jungen Operationsform gewinnen.<br />
An einen kurzen theoretischen<br />
Beginn bezüglich geschicht -<br />
licher Entwicklung und Grundlagen<br />
<strong>der</strong> Minimal-Invasiven-Chirurgie (MIC)<br />
schließen sich bereits am ersten Kurstag<br />
praktische Übungen mit dem Laparoskop<br />
an. Im weiteren Kursverlauf<br />
24. Ausgabe 2008<br />
studium und lehre<br />
Hautnah dabei<br />
Minimal-Invasive-Chirurgie-Kurs für Studenten<br />
Foto: Professor Stuhldreier an einem künstlichen Abdomen. (Quelle: Torsten Schulz)<br />
werden die zu bewältigenden Aufgaben<br />
dann zunehmend komplexer.<br />
Während zunächst einfache Manöver<br />
wie z.B. <strong>der</strong> Transport kleiner Gegenstände<br />
in einem Phantom geübt werden,<br />
bilden komplexe Aufgaben mit<br />
zusammenhängenden Bewegungsabläufen<br />
den Abschluss dieser Veranstaltungsreihe.<br />
Ein kurzes Interview mit Professor<br />
Stuhldreier, dem Leiter <strong>der</strong> Abteilung<br />
für Kin<strong>der</strong>chirurgie des <strong>Universität</strong>sklinikums<br />
<strong>Rostock</strong>, ergab noch einmal<br />
die Möglichkeit den Endoskopiekurs<br />
aus seiner Sicht zu betrachten. Professor<br />
Stuhldreier weiß aus eigener Erfahrung<br />
um die Bedeutung und den<br />
Anreiz praktischer Bezüge für die Ausbildung<br />
<strong>der</strong> Medizinstudenten. Bereits<br />
an <strong>der</strong> <strong>Universität</strong> in Tübingen unterrichtete<br />
er deshalb an einem Trai-<br />
18<br />
ningszentrum für MIC. Aufgrund seines<br />
Interesses an dieser Operationsform<br />
und <strong>der</strong> langjährigen Erfahrung im<br />
Umgang mit <strong>der</strong> MIC wollte <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>chirurg<br />
motivierten Studenten einen<br />
Einblick in diesen Teil <strong>der</strong> Chirurgie ermöglichen.<br />
Nach <strong>der</strong> Anschaffung<br />
eines eigenen Arbeitsplatzes für die<br />
MIC-Ausbildung durch das Studiendekanat<br />
konnten die Studenten neben<br />
dieser praktischen Erfahrung auch die<br />
Möglichkeiten entdecken, welche die<br />
Laparoskopie mit sich bringt sowie<br />
auch die Schwierigkeiten im Umgang<br />
mit dem OP-Werkzeug kennen lernen.<br />
Die Kursteilnehmer können hier „am<br />
eigenen Leib erfahren“ wie schwierig<br />
<strong>der</strong> Umgang mit <strong>der</strong> speziellen Technik<br />
ist, die dem Beobachter am OP-Tisch<br />
doch so einfach erscheint. Zudem kann<br />
Herr Professor Stuhldreier auch seine<br />
persönlichen Erfahrungen über die<br />
MIC im Rahmen dieses Kursangebotes<br />
an die studentischen Teilnehmer weitergeben.<br />
Da <strong>der</strong> erste Kurs äußerst positiv aufgenommen<br />
wurde, soll er auch in den<br />
kommenden Jahren stattfinden. Professor<br />
Stuhldreier könnte sich darüber<br />
hinaus durchaus vorstellen, den Kurs<br />
noch etwas umfangreicher zu gestalten<br />
und auszubauen. In den kommenden<br />
ein bis zwei Jahren sollen zunächst<br />
noch weitere Erfahrungen für die Kurs-<br />
Fre<strong>der</strong>ike Miller zieht die Schrauben<br />
fest. Die kleine Metallplatte<br />
fügt ein abgesplittertes Stück<br />
Knochen wie<strong>der</strong> fest an seinen ursprünglichen<br />
Ort. Kein echter Knochen<br />
– Fre<strong>der</strong>ike Miller und ihre Kommilitonin<br />
Nadine Moßell tragen keine Kittel,<br />
<strong>der</strong> Operationsraum, in dem sie<br />
arbeiten, ist nicht steril. „Aber sonst ist<br />
alles authentisch“, sagt Dr. Georg Gradl,<br />
Oberarzt in <strong>der</strong> Unfallchirurgie des<br />
Uniklinikums <strong>Rostock</strong>. Das Werkzeug,<br />
die Implantate, auch die Beschaffenheit<br />
<strong>der</strong> Kunstknochen. Beste Voraussetzungen<br />
also, um das zu üben, was<br />
in ein paar Jahren Alltag sein wird. Nadine<br />
Moßell und Fre<strong>der</strong>ike Miller studieren<br />
Medizin an <strong>der</strong> Uni <strong>Rostock</strong> im<br />
10. Semester, und anstatt Ferien zu<br />
machen, besuchen sie <strong>der</strong>zeit zusammen<br />
mit zehn an<strong>der</strong>en Studenten die<br />
„Summer School“ <strong>der</strong> <strong>Rostock</strong>er Unfallchirurgie.<br />
Es ist <strong>der</strong> erste Kurs dieser<br />
Art, <strong>der</strong> künftig jedes Jahr in <strong>Rostock</strong><br />
studium und lehre<br />
gestaltung gewonnen werden. Dann<br />
wäre eventuell auch die Anmeldung<br />
als Wahlpflichtkurs für den klinischen<br />
Abschnitt denkbar. „Dies hängt dann<br />
vom Interesse <strong>der</strong> Studenten aber auch<br />
<strong>der</strong> personellen Kapazität <strong>der</strong> Klinik<br />
ab“, so <strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong> Abteilung für<br />
Kin<strong>der</strong>chirurgie.<br />
Es zeigt sich also, dass sowohl die Erwartungen<br />
und Motivationen <strong>der</strong> Lehrenden<br />
als auch <strong>der</strong> Lernenden sehr<br />
ähnlich sind. Professor Stuhldreier ist<br />
es gelungen, das Interesse <strong>der</strong> Kursteil -<br />
angeboten wird. „Normalerweise setzt<br />
die praktische Arbeit auf diesem Gebiet<br />
erst später, in <strong>der</strong> Facharztausbildung<br />
ein“, sagt Dr. Gradl. „Ich halte es<br />
aber für zwingend notwendig, dass<br />
auch das Studium so praxisnah wie<br />
möglich durchgeführt wird, damit die<br />
Studenten frühzeitig das Rüstzeug für<br />
ihre spätere Arbeit bekommen.“ Bei<br />
den Studierenden kommt das gut an.<br />
Während Nadine und Fre<strong>der</strong>ike ein<br />
eher filigranes Implantat bearbeiten,<br />
sitzen Christopher Lenz (27) und Mathias<br />
Licht (30), beide im zehnten Semester,<br />
an einem ungleich größeren<br />
Knochen. Die beiden künftigen Orthopäden<br />
proben den Einsatz eines<br />
Nagels, mit dem Frakturen des Oberschenkels<br />
geheilt werden können. Oberschenkelhalsfrakturen<br />
und Brüche des<br />
Handwurzelknochens seien die häufigsten<br />
Brüche, mit denen es Mediziner<br />
zu tun bekommen, so Dr. Gradl.<br />
Entsprechend sei ausreichend Praxis<br />
19<br />
nehmer an <strong>der</strong> Chirurgie zu wecken<br />
und ihnen erste handwerkliche Erfahrung<br />
im Umgang mit dem minimal-invasiven<br />
Instrumentarium zu vermitteln.<br />
Diese Veranstaltung ist eine wirkliche<br />
Bereicherung zum theorielastigen Studium<br />
und sollte Nachahmer in an<strong>der</strong>en<br />
klinischen Bereichen finden. Ich<br />
glaube, die Studenten würde es freuen…<br />
Torsten Schulz<br />
Operation am Kunstknochen<br />
<strong>Rostock</strong>er Medizinstudenten trainieren den Einsatz von Implantaten<br />
erfor<strong>der</strong>lich – speziell auch, wenn <strong>der</strong><br />
Knochen zum Beispiel direkt an <strong>der</strong><br />
bereits eingesetzten Hüftprothese bricht.<br />
Denn auch dies steht auf dem Plan <strong>der</strong><br />
<strong>Rostock</strong>er „Summer School“. Praxis<br />
nicht nur mit bestimmten Formen <strong>der</strong><br />
Behandlung, son<strong>der</strong>n auch bezogen<br />
auf die verwendete Technik. Denn die<br />
Implantate, die probeweise eingesetzt<br />
werden, entsprechen dem neuesten<br />
Stand <strong>der</strong> Technik und werden täglich<br />
verwendet. Eines dieser Implantate hat<br />
Dr. Gradl sogar selber entwickelt. „Wir<br />
lernen in diesem Kurs sehr viel“, sagt<br />
Fre<strong>der</strong>ike, die eigentlich Anästhesistin<br />
werden will. Doch Dr. Gradl versuche<br />
sie zu überzeugen, Unfallchirurgin zu<br />
werden. Vielleicht gibt die „Summer<br />
School“ den Ausschlag.<br />
Kerstin Grünzel<br />
24. Ausgabe 2008
Notfallmedizin einmal an<strong>der</strong>s!<br />
Notfallmedizin live erleben<br />
konnten alle Medizinstuden -<br />
ten, die einen freiwilligen<br />
Notfallkurs <strong>der</strong> Klink und Poliklinik für<br />
Anästhesiologie und Intensivtherapie<br />
im Sommersemester belegt hatten. Sie<br />
durften mit auf das Fusion-Festival fahren,<br />
um das im Kurs erworbene Wissen<br />
in die Praxis umzusetzen.<br />
Rund zwanzig Studenten hatten sich<br />
entschieden, am Kursus „Der interessante<br />
Notfall“ bei Dr. Gernot Rücker<br />
(Leiter RoSaNa) teilzunehmen. Einmal<br />
pro Woche wurden wir mit interessanten<br />
Situationen aus <strong>der</strong> Rettungsmedizin<br />
überrascht. An sehr realistischen<br />
Fällen konnten wir unser Wissen<br />
über Notfallmedizin schrittweise erweitern.<br />
Am Ende des Semesters stand als beson<strong>der</strong>es<br />
Highlight eine Exkursion zum<br />
Fusion-Festival auf dem Programm.<br />
Die Fusion ist eines <strong>der</strong> größten Festivals<br />
in Norddeutschland. Mehr als<br />
40.000 Besucher feiern über mehrere<br />
Tage auf einem alten Militärflugplatz<br />
ein buntes Fest mit Musik, Tanz, Thea-<br />
Foto: Blick von einem Hangar auf die Erste-<br />
Hilfe-Station. (Quelle: Christian Klein)<br />
24. Ausgabe 2008<br />
studium und lehre<br />
Das Notarzteinsatzfahrzeug – NEF. (Quelle: Christian Klein)<br />
ter und Aktionskunst. Je<strong>der</strong> Student,<br />
<strong>der</strong> regelmäßig beim Kurs war und <strong>der</strong><br />
Lust hatte, konnte mit nach Lärz/Müritz<br />
fahren und dort bei <strong>der</strong> Notfallversorgung<br />
mithelfen.<br />
Wir Studenten durften uns auf einer<br />
Wunschliste von Donnerstag bis Sonntag<br />
in 12-Stunden-Schichten einteilen.<br />
Wer wollte, konnte auch länger bleiben<br />
o<strong>der</strong> zwischendurch ein wenig<br />
mitfeiern. Da es viele interessante Fälle<br />
gab und wir viel Praxiserfahrung sammeln<br />
konnten, dachten wir Studenten<br />
aber kaum an das Feiern. Stattdessen<br />
versorgten wir fleißig Schnittwunden<br />
an Händen und Füßen, Verbrennungen,<br />
Schwächeanfälle, verletzte Knöchel<br />
o<strong>der</strong> Bauchschmerzen.<br />
Als Arbeitsplatz hatten wir eine richtige<br />
„Poliklinik“ zur Verfügung. Sie bestand<br />
aus einem Zelt mit drei Verbandsplätzen<br />
und vier Liegen für alle leicht<br />
Verletzten, sowie aus einem Intensiv-<br />
20<br />
bereich in einem Containerbau für<br />
„schwere Fälle“. Der Intensivbereich<br />
war unser Hauptarbeitsplatz. Vom<br />
schweren Asthmaanfall über Intoxikationen<br />
bis hin zum Krampfanfall<br />
konnte alles therapiert werden. Drei<br />
Betten mit EKG, Pulsoxymetrie und<br />
Blutdruckmessung erlaubten eine genaue<br />
Überwachung <strong>der</strong> Patienten.<br />
Auch Beatmungsgeräte, Notfallkoffer<br />
und Defibrillatoren waren vorhanden.<br />
Oftmals waren es bewusstseinsgetrübte<br />
Personen, die mit Sauerstoff, Zugängen<br />
und Infusionen versorgt und<br />
anschließend überwacht werden mus -<br />
sten. Meist besserte sich <strong>der</strong> Zustand<br />
sehr schnell, so dass viele Patienten<br />
nach einigen Stunden wie<strong>der</strong> aus dem<br />
DRK-Bereich entlassen werden konnten.<br />
Danach wurden die Patienten an<br />
Sozialarbeiter aus dem Eclipse-Zelt<br />
übergeben, das sich neben unserer<br />
„Poliklinik“ befand. Sie waren speziell<br />
im Umgang mit intoxikierten Patienten<br />
geschult. Im abgedunkelten Zelt war<br />
es angenehm ruhig. Es roch nach Tee<br />
und Räucherstäbchen. Die Kissen auf<br />
dem Boden ließen die Besucher bequem<br />
ihren Rausch ausschlafen. Außerdem<br />
konnten die Sozialarbeiter<br />
beruhigend auf Leute einwirken, die<br />
durch den Rausch unter Ängsten o<strong>der</strong><br />
Wahnvorstellungen litten.<br />
Das Festival ist sehr speziell. Die Menschen<br />
feiern sehr friedlich – es gibt<br />
kaum Schlägereien, was bei an<strong>der</strong>en<br />
Veranstaltungen dieser Größenordnung<br />
an <strong>der</strong> Tagesordnung ist. Auch die Einsatzfahrzeuge<br />
sehen auf <strong>der</strong> Fusion<br />
ungewöhnlich aus. Da es ein Privatgelände<br />
ist, hat <strong>der</strong> Veranstalter für das<br />
Rote Kreuz beson<strong>der</strong>e Notarztfahrzeuge<br />
zum Einsatz auf dem Gelände<br />
gebaut. Es gab beispielsweise einen<br />
alten Fiat Panda, bei dem die Kofferraumklappe<br />
abgebaut wurde und <strong>der</strong><br />
neben einer Konstruktion für eine Rettungstrage<br />
auch einen Praktikantensitz<br />
bekommen hat. Ausgerüstet mit Blaulicht,<br />
Notarzt-Beschriftung und Notfallrucksack<br />
war <strong>der</strong> kleine Fiat ideal<br />
für den Einsatz auf dem holprigen Fe-<br />
Zum zweiten Mal in <strong>der</strong> langen<br />
und traditionsreichen Geschichte<br />
<strong>der</strong> alma mater rostochiensis<br />
werden die Absolventen aller<br />
Fakultäten nach erfolgreichem Abschluss<br />
ihres Studiums in einem Festakt<br />
in <strong>der</strong> Yachthafenresidenz Hohe Düne<br />
verabschiedet. Am Abend feiern wir<br />
studium und lehre<br />
Foto: Ein zum Gürteltier umgebautes Auto.<br />
(Quelle: Christian Klein)<br />
stivalgelände. Ein alter Fiat-Kastenwagen<br />
mit einem Ofenrohr als Auspuff<br />
bot sogar noch etwas mehr Platz. Straßentaugliche<br />
Rettungswagen waren<br />
zwar auch vorhanden, aber für den<br />
schnellen Notfalleinsatz im holprigen<br />
Gelände eigneten sich die kleinen<br />
wendigen Fahrzeuge besser.<br />
Sehr angenehm für uns Studenten war<br />
das Praktikum, weil wir sehr viel selbständig<br />
arbeiten durften. Wann immer<br />
wir uns nicht ganz sicher waren, konnten<br />
wir einen <strong>der</strong> anwesenden Ärzte<br />
o<strong>der</strong> Rettungsassistenten fragen. Sie<br />
haben sehr viel erklärt, so dass <strong>der</strong><br />
alle gemeinsam mit unseren KommilitonInnen<br />
und Alumni, unseren Gäs ten<br />
und Freunden in fröhlicher und lockerer<br />
Atmosphäre auf dem Herbstball <strong>der</strong><br />
<strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong>. Dieser steht in diesem<br />
Jahr unter dem Thema “Frankreich”<br />
und die Leichtigkeit des Savoir<br />
Vivre und Laissez-faire bestimmen das<br />
21<br />
Foto: Krankentransportwagen einmal an<strong>der</strong>s.<br />
(Quelle: Christian Klein)<br />
Lerneffekt auf dem Festival wirklich<br />
groß war. Insgesamt war die Fusion<br />
damit eine sehr interessante Erfahrung.<br />
Nach den Schichten waren wir durch<br />
die Dauerbeschallung und die vielen<br />
Patientenkontakte zwar müde, aber glücklich.<br />
Viele Studenten waren sich nach<br />
all den Eindrücken im Kurs und im<br />
Praktikum sicher, dass sie im nächsten<br />
Jahr wie<strong>der</strong> dabei sein wollen.<br />
Christian Klein<br />
Tag <strong>der</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong> am 21. November 2008<br />
Der 21. November 2008 wird für die <strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong> ein ganz beson<strong>der</strong>er Tag<br />
Programm. An diesem Tag verabschieden<br />
<strong>der</strong> Rektor, Magnifizenz Professor<br />
Strothotte und die Dekane <strong>der</strong> neun Fakultäten<br />
die Absolventen <strong>der</strong> <strong>Universität</strong><br />
<strong>Rostock</strong> im Kongresszentrum <strong>der</strong><br />
Yachthafenresidenz Hohe Düne.<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Rostock</strong><br />
24. Ausgabe 2008
Ein Herz, das gleichmäßig 60bis<br />
80-mal in <strong>der</strong> Minute schlägt<br />
und dabei die ca. 4 bis 7 Liter<br />
Blut im Menschen zuverlässig durch<br />
den Körper pumpt: Das ist <strong>der</strong> Idealzustand.<br />
Doch viele Menschen leiden<br />
an Herzrasen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Herzrhyth -<br />
musstörungen. Sie min<strong>der</strong>n die Lebens -<br />
qualität oft erheblich und können<br />
lebensbedrohlich sein. Medikamente<br />
helfen nicht immer und eine Operation<br />
am offenen Herzen ist mit zusätzlichen<br />
Risiken behaftet. In vielen Fällen<br />
kann die so genannte Katheter-Ablation<br />
Abhilfe schaffen. Eine minimalinvasive<br />
elektrophysiologische Behandlung,<br />
mit <strong>der</strong> seit einem Jahr auch Patienten<br />
am <strong>Rostock</strong>er <strong>Universität</strong>sklinikum<br />
geholfen werden kann. Rund<br />
300 Patienten wurden bisher erfolgreich<br />
behandelt.<br />
Der Takt für die Kontraktionen des<br />
Herzmuskels wird vom so genannten<br />
Sinusknoten in <strong>der</strong> rechten Herzvorkammer<br />
vorgegeben. Es ist ein elektrischer<br />
Impuls, <strong>der</strong> durch die feinen<br />
Verästelungen des Herzens geleitet wird<br />
und das Herz schließlich zum Schlagen<br />
bringt. Herzrhythmusstörungen können<br />
in nahezu allen Bereichen des<br />
Herzens entstehen. Hier setzt die noch<br />
junge Disziplin <strong>der</strong> Elektrophysiologie<br />
an. Ein Katheter wird von <strong>der</strong> Leiste<br />
des Patienten durch die Blutbahn bis<br />
zum Herzen geführt, um die Stelle zu<br />
finden, die für die Rhythmusstörung<br />
verantwortlich ist. Ist diese gefunden,<br />
wird sie durch kurze Stromstöße ver-<br />
24. Ausgabe 2008<br />
klinikum<br />
Stromimpulse gegen stolpernde Herzen<br />
Katheter-Ablation befreite schon 300 Patienten von Herzrhythmusstörungen<br />
Professor Dr. Bänsch (r.) und Dr. Ibrahim Akin vor einer Ablation. (Quelle: UKR)<br />
ödet. Der Patient bekommt lediglich<br />
eine örtliche Betäubung in <strong>der</strong> Leistengegend<br />
und bemerkt kaum etwas.<br />
„Herzrhythmusstörungen sind häufig<br />
vererbt o<strong>der</strong> zumindest genetisch angelegt“,<br />
erläutert Professor Bänsch.<br />
Häufig sind die Patienten kaum älter<br />
als 40 Jahre, manchmal auch noch<br />
jünger. Kürzlich wurde eine 14-Jährige<br />
mit Herzrhythmusstörungen abladiert.<br />
„Elektrophysiologische Behandlungsmethoden<br />
werden künftig an Bedeutung<br />
gewinnen“, ist Professor Bänsch<br />
sicher. Zum einjährigen Bestehen <strong>der</strong><br />
Abteilung am <strong>Universität</strong>sklinikum<br />
<strong>Rostock</strong> wurde deshalb am 11. und<br />
12. September ein Symposium veranstaltet,<br />
wo entsprechende Entwicklungen<br />
in <strong>der</strong> Behandlung von Herzrhythmusstörungen<br />
diskutiert wurden. Neben<br />
22<br />
<strong>der</strong> Behandlung von Patienten wird in<br />
<strong>Rostock</strong> auch die Forschung vorangetrieben.<br />
Derzeit wird eine Studie<br />
durchgeführt, die einen im Krankheitsverlauf<br />
früheren Einsatz <strong>der</strong> Katheterablation<br />
zum Thema hat. Im<br />
Herbst wird in neuen Räumen eine<br />
Ambulanz für Elektrophysiologie und<br />
implantierbare Geräte eröffnet.<br />
Matthias Schümann<br />
Am <strong>Universität</strong>sklinikum <strong>Rostock</strong><br />
ist ein Mädchen aus Afghanistan<br />
erfolgreich am Herzen<br />
operiert worden. Die 12-jährige<br />
Ather Bibi Bakhar aus <strong>der</strong> afghanischen<br />
Stadt Paktia litt unter einem angeborenen<br />
Herzfehler, <strong>der</strong> bereits 2007<br />
in einem Krankenhaus operiert werden<br />
musste. Durch den Einsatz eines<br />
Herzkatheters am Uniklinik- um Ros -<br />
tock konnte <strong>der</strong> Fehler nun vollständig<br />
behoben werden. Das Mädchen wird<br />
in den nächsten Tagen geheilt zu seiner<br />
Familie nach Afghanistan zurückkehren.<br />
Das Kind war durch den Verein<br />
klinikum<br />
Mädchen aus Afghanistan erfolgreich in <strong>Rostock</strong> operiert<br />
Angeborener Herzfehler wurde durch Katheter geheilt<br />
Vertreter dreier großer norddeutscher<br />
Unternehmen überreichten<br />
am 11. Juni 2008<br />
einen Spendenscheck über 3000 Euro.<br />
Empfänger war die Abteilung Allgemeine<br />
Pädiatrie <strong>der</strong> <strong>Universität</strong>s-Kin<strong>der</strong>-<br />
und Jugendklinik <strong>Rostock</strong>, <strong>der</strong>en<br />
geschäftsführen<strong>der</strong> Direktor, Professor<br />
Dr. Dieter Haffner, den symbolischen<br />
Scheck entgegen nahm. Aufgebracht<br />
wurde die Spendensumme durch die<br />
Unternehmen AIDA Cruises, die Meyer<br />
Werft in Papenburg sowie den Germanischen<br />
Lloyd. Hansjörg Kunze, Sprecher<br />
von AIDA Cruises, bezeichnete es<br />
als ein wichtiges Anliegen, die medi-<br />
„Kin<strong>der</strong> brauchen uns“ nach Deutschland<br />
geholt worden. Die Behandlung<br />
<strong>der</strong> kleinen Bibi erfolgte in <strong>Rostock</strong> in<br />
enger Zusammenarbeit des Kardiologen<br />
Professor Dr. Christoph A. Nienaber<br />
und des Kin<strong>der</strong>kardiologen<br />
Professor Dr. Matthias Peuster. „Bibis<br />
Herzfeh- ler bestand in einer angeborenen<br />
Verbindung von Hauptschlaga<strong>der</strong><br />
und Lungenschlaga<strong>der</strong>“, erklärt<br />
Professor Peuster. Wird diese Verbindung<br />
nicht geschlossen, drohen Herzinsuffizienz<br />
(Herzschwäche) und<br />
Lungenhochdruck. Beides wirkt sich<br />
auf lange Sicht negativ auf den Ge-<br />
zinische Einrichtung für Kin<strong>der</strong> und Jugendliche<br />
in <strong>der</strong> Hansestadt <strong>Rostock</strong><br />
23<br />
samtorganismus aus, weshalb Betroffene<br />
ohne Behandlung kaum älter als<br />
30 Jahre werden. „Dank mo<strong>der</strong>ner Kathetertechnik<br />
lässt sich dieser Herzfehler<br />
aber sehr gut behandeln“, so<br />
Professor Peuster. Die Verbindung zwischen<br />
den beiden Gefäßen wurde mittels<br />
kleiner Metallspiralen verschlos sen.<br />
Eine weitere Behandlung ist nicht notwendig,<br />
weshalb das Mädchen jetzt<br />
nach Afghanistan zu ihrer Familie gebracht<br />
werden kann.<br />
Matthias Schümann<br />
Maritime Unternehmen spenden für die Uni-Kin<strong>der</strong>klinik<br />
AIDA Cruises, Meyer Werft und Germanischem Lloyd überreichten 3000 Euro<br />
Professor Dr. Dieter Haffner, Hansjörg Kunze, Jens Ahrenkiel,<br />
Manfred Müller-Fahrenholz. (Quelle: UKR)<br />
zu unterstützen. Für die Spendensumme<br />
soll laut Professor Haffner<br />
Spielzeug zur Ausgestaltung <strong>der</strong> Zimmer<br />
und Aufenthaltsräume gekauft<br />
werden. Die <strong>Universität</strong>s-Kin<strong>der</strong>- und<br />
Jugendklinik wird <strong>der</strong>zeit umfassend<br />
renoviert. Bis Ende 2008 sollen die Arbeiten<br />
abgeschlossen sein. Es entstehen<br />
wohnliche Krankenzimmer mit<br />
kleinen Bä<strong>der</strong>n und <strong>der</strong> Möglichkeit<br />
für Eltern, bei ihren Kin<strong>der</strong>n zu übernachten.<br />
Jedes Jahr werden in <strong>der</strong> Klinik<br />
rund 3500 Kin<strong>der</strong> stationär, rund<br />
10.000 Kin<strong>der</strong> ambulant behandelt.<br />
Matthias Schümann<br />
24. Ausgabe 2008
Allgemeines<br />
Ingrid Friedbichler, Michael<br />
Friedbichler<br />
Fachwortschatz Medizin Englisch<br />
Sprachtrainer u. Fachwörterbuch in<br />
einem<br />
Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2007.<br />
2. Auflage<br />
59,95 Euro<br />
Das Buch „Fachwortschatz Medizin –<br />
Englisch“ bezeichnet sich selbst als<br />
„Sprachtrainer und Fachwörterbuch in<br />
einem“. Diesem Titel kann man soweit<br />
nur zustimmen, das Konzept ist für ein<br />
Wörterbuch völlig neu und für einen<br />
Sprachtrainer absolut praktisch. Die<br />
Kombination aus beidem ist eine<br />
durchaus erfolgreiche Neuerung für<br />
diese Art von Literatur und wird den<br />
allermeisten eine große Hilfe für Prüfungen<br />
und alltägliche Anwendung<br />
sein.<br />
24. Ausgabe 2008<br />
wissenswert<br />
Fachwortschatz Medizin Englisch<br />
Sprache und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Glie<strong>der</strong>ung: nach Themengebieten, beginnend bei „basic medical terms“ bis „cli-<br />
nical terms“. Abbildungen: nicht viele, aber dafür entwe<strong>der</strong> verdeutlichend o<strong>der</strong><br />
aufheiternd. Inhaltsverzeichnis: Sehr gut strukturiert, unterteilt nach Lern-/Themengebieten,<br />
perfekt für die Vorbereitung von Auslandseinsätzen bzw. dort zum<br />
nachschlagen „im Kontext“<br />
Prüfungsvorbereitung<br />
Eignung des Buches: Das Buch ist nicht zum bloßen „durchlesen“ wie ein Textbook<br />
zur Prüfungsvorbereitung geeignet, es bietet eher im Rahmen eines Englisch-Kurses<br />
die Möglichkeit zu je<strong>der</strong>zeit alles schnell nachschlagen zu können<br />
und dabei mittels vieler Hinweise, Verlinkungen und kontextabhängiger Erklärungen<br />
einen sehr guten Überblick über den Bedeutungsbereich des jeweiligen<br />
Fachbegriffes zu bekommen. Wenn in den Kontexterklärungen englische Wort<br />
vorkommen die man eventuell nicht wissen könnte, werden diese in nahezu<br />
100% <strong>der</strong> Fälle am Rand neben dem Eintrag in einer kleinen Box übersetzt. Wer<br />
sich zur Prüfungsvorbereitung durch die Themen „basic medical terms“, „health<br />
care“, „body structures & functions“, „complex body functions“, „medical science“<br />
sowie „clinical terms“ arbeiten will, kann dann auch Themengebietsweise<br />
ein Kapitel „lesen“ und wird am Ende feststellen erfolgreich viele Bedeutungen<br />
im richtigen Rahmen behalten zu haben. Durch den deutschen & englischen<br />
Index lässt sich jedes Wort stressfrei flott nachschlagen und führt rasch zum Erfolg.<br />
Lernhilfen: Als Lernhilfen kann man die Erklärung <strong>der</strong> eventuell unbekannten<br />
Worte in <strong>der</strong> Box am rechten Seitenrand einstufen, diese führt dazu das<br />
man nicht durch eine Kontexterklärung an das nachschlagen vieler weiterer Wort<br />
gebunden wird, son<strong>der</strong>n diese auch einfach so schnell verstehen kann.<br />
Inhalt<br />
Gesamtinhalt: Es handelt sich um ein klassisches Wörterbuch, welches umfassend<br />
mit Kontextbedeutungen für jedes einzelne Wort erweitert wurde und für<br />
komplizierte Themen auch mal mit einer Abbildung aufwartet. Es ist sehr gut als<br />
Sprachtrainer & Fachwörterbuch nutzbar, wenn man schon einen Englischkurs<br />
besucht. Als alleiniger Sprachtrainer ist es nur eingeschränkt geeignet.<br />
Fazit<br />
Der Fachwortschatz Medizin Englisch ist ein sehr gut zusammengestelltes Wörterbuch<br />
mit Sprachtrainerfunktion. Es ist in beiden Sinnen gut und unkompliziert<br />
nutzbar. Es ist ein bisschen schade, dass dieses Buch auf <strong>der</strong> CD nochmal extra verkauft<br />
wird und die CD nicht einfach dem Buch beiliegt. Für Medizinstudenten die<br />
den Fachsprachkurs „medical english“ belegen und für solche die sich auch ohne<br />
diesen im Ausland verständigen wollen ist dieses Buch eine optimale Wahl.<br />
Paul Schwanitz<br />
24<br />
Allgemeines<br />
Detlev Schnei<strong>der</strong>, Frank Richling<br />
Checkliste Arzneimittel A – Z<br />
Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2008.<br />
5. überarbeitete und erweiterte Auflage.<br />
34,95 Euro<br />
Welcher Mediziner fühlt sich im undurchdringbaren<br />
Dschungel <strong>der</strong> zahllosen<br />
Medikamente nicht verloren?<br />
Bei jedem Arzneimittel sind spezielle<br />
Dinge zu beachten, Kontraindikationen<br />
zu bedenken und Kontrollen<br />
durch zuführen. Eine Möglichkeit, die<br />
wichtigsten Fakten aus den seitenlagen<br />
Fachinformationen herauszufiltern<br />
und einen guten Überblick zu bekommen,<br />
bietet die Checkliste Arzneimittel<br />
A-Z.<br />
Als beson<strong>der</strong>es Extra bekommt man<br />
mit einem Code für drei Jahre Zugriff<br />
auf die regelmäßig aktualisierte Online-Datenbank.<br />
Sprache und Glie<strong>der</strong>ung:<br />
Die Beson<strong>der</strong>heit <strong>der</strong> Checklisten-Reihe ist, dass die Bücher keinen zusam-<br />
menhängenden Text enthalten. Auch Bil<strong>der</strong> und Übersichten sind Mangelware.<br />
Statt dessen erfährt <strong>der</strong> Leser in kurzen Stichpunkten alles Wichtige auf den ersten<br />
Blick. Die Orientierung im Buch fällt dabei durch die sinnvolle Einteilung<br />
<strong>der</strong> Kapitel sehr leicht. Als zusätzliche Hilfestellung verfügt das Buch über ein<br />
Farbleitsystem durch die insgesamt fünf Kapitel. Im ersten Abschnitt wird dabei<br />
die aktuelle leitliniengerechte Therapie häufiger Krankheiten beschrieben. Im<br />
Hauptteil des Buches werden ca. 590 Wirkstoffprofile <strong>der</strong> gängigsten Arzneimittel<br />
in alphabetischer Ordnung vorgestellt. Anschließend erfährt <strong>der</strong> Leser<br />
nützliche Zusatzinformationen über die Therapie bei Niereninsuffizienz und die<br />
Wechselwirkungen mit Phenprocoumon. Den Abschluss bilden ein aktuelles<br />
Studienregister, sowie eine Übersicht über mehr als 3000 Handelsnamen und<br />
<strong>der</strong>en Wirkstoffe.<br />
Prüfungsvorbereitung:<br />
Für die Vorbereitung von Prüfungen hat das Buch keinerlei Relevanz. Man benötigt<br />
bereits ein breites Vorwissen, um das Potential des Buches voll ausschöpfen<br />
zu können. Bei den kurzen Stichworten, den tabellarischen Übersichten und<br />
sehr kleiner Schrift ist das Lesen auf Dauer sehr anstrengend. Die Checkliste ist<br />
vielmehr als aktuelles Nachschlagewerk im Kitteltaschenformat zu gebrauchen.<br />
Inhalt:<br />
Das Kitteltaschenbuch gibt einen Überblick über die Wirkprofile <strong>der</strong> gängigen<br />
Arzneimittel. Es benennt <strong>der</strong>en Indikationen, Kontraindikationen, Nebenwirken,<br />
Wechselwirkungen und <strong>der</strong>en Einsatz bei Schwangerschaft. Darüber hinaus erwähnt<br />
das Buch auch neueste Studienergebnisse. Beson<strong>der</strong>s wertvoll sind Übersichten<br />
zur Therapie häufiger Erkrankungen. Sobald man die Diagnose gestellt<br />
hat, braucht man eigentlich nur in <strong>der</strong> Checkliste nachzuschlagen, welche Therapie<br />
Mittel <strong>der</strong> ersten, zweiten o<strong>der</strong> dritten Wahl ist. Dabei erhält <strong>der</strong> Leser konkrete<br />
Dosierungsempfehlungen – auch bei Niereninsuffizienz. Sogar <strong>der</strong><br />
prozentuale Verlust <strong>der</strong> Arzneimittel bei <strong>der</strong> Hämodialyse und Studien, die die<br />
Wirksamkeit verschiedener Therapien belegen, sind angegeben.<br />
Fazit:<br />
Das Buch leistet ideale Dienste im Stationsalltag. Mit nur einem Blick findet man<br />
die medikamentöse Therapie <strong>der</strong> Wahl zu jedem Krankheitsbild und erfährt sofort,<br />
welche Beson<strong>der</strong>heiten bei <strong>der</strong> Therapie zu beachten sind. Die Checkliste<br />
gibt in wirklich überschaubarer Form Hinweise darauf, welche Kontraindikationen<br />
und Wechselwirkungen wirklich relevant sind.<br />
Christian Klein<br />
wissenswert<br />
Checkliste Arzneimittel A-Z<br />
25<br />
24. Ausgabe 2008
Allgemeines<br />
R. Roos, O. Genzel-Boroviczény, H.<br />
Proquitté<br />
Checkliste Neonatologie<br />
Das Neo-ABC<br />
Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2008.<br />
3. überarbeitete Auflage<br />
34,95 Euro<br />
Die Checkliste Neonatologie erscheint<br />
in diesem Jahr in ihrer 3. überarbeiteten<br />
Auflage. In ihrem altbewährten<br />
Konzept ist sie ein informativer, aber<br />
zugleich auch sehr praktischer Begleiter<br />
für Studenten im Praktischen Jahr<br />
o<strong>der</strong> Assistenzärzte, die bereits über<br />
viel Vorwissen verfügen. Zur Prüfungsvorbereitung<br />
im Fach Pädiatrie eignet<br />
es sich dabei nicht.<br />
24. Ausgabe 2008<br />
wissenswert<br />
Sprache und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Wie bei den Checklisten üblich, ist auch dieses Buch in kurzen Sätzen und Stich-<br />
punkten verfasst. Unterstützt von vielen übersichtlichen und hilfreichen Tabellen,<br />
Leitfäden zu den verschiedensten Themengebieten und einigen radiologischen<br />
Abbildungen vermittelt die Checkliste zum Einen viel Stoff und unterstützt<br />
den Praxisbezug. Zum An<strong>der</strong>en ermüdet die kleine und enge Schrift<br />
aber auf Dauer sehr.<br />
Geglie<strong>der</strong>t ist das Buch in die Kapitel Grundlagen, geburtshilfliche Informationen<br />
sowie Reanimation und Medikamententherapie. Die jeweilige farbige Hervorhebung<br />
<strong>der</strong> Kapitel ermöglicht eine schnelle Orientierung.<br />
Prüfungsvorbereitung<br />
Die Checkliste Neonatologie ist zum erstmaligen Lernen für eine Prüfung nicht<br />
geeignet. Dies liegt an den jeweils nur sehr kurzen Erklärungen zu den Krankheitsbil<strong>der</strong>n.<br />
Es werden vor allem weiterführende Informationen vermittelt, die<br />
sehr nützlich sind, wenn schon viel Vorwissen besteht. Durch die hohe Praxisrelevanz<br />
eignet es sich dabei gut als Nachschlagewerk für Famulaturen o<strong>der</strong> die<br />
ersten Jahre als Assistenzarzt im klinischen Alltag.<br />
Inhalt<br />
Die Checkliste vermittelt viele Informationen zu <strong>der</strong> Versorgung von Früh- und<br />
Neugeborenen. Im Grundlagenteil wird kurz auf Definitionen sowie umfangreich<br />
auf Arbeits- und Untersuchungstechniken und Fragen im Bereich <strong>der</strong> Elternbetreuung<br />
eingegangen.<br />
Der Hauptteil beschäftigt sich mit prägnanten Übersichten zu neonatologischen<br />
Krankheitsbil<strong>der</strong>n, wobei vor allem auf Diagnostik, Therapie, Komplikationen<br />
und z.T. <strong>der</strong>en Einbeziehung in den klinischen Alltag eingegangen wird (z.B.<br />
Maßnahmen im Kreissaal o<strong>der</strong> Einweisung/Entlassung auf Stationen).<br />
Daneben findet <strong>der</strong> interessierte Leser Informationen zu aktuellen Reanimationsrichtlinien<br />
sowie ausführliche Daten zur Medikamententherapie.<br />
Der Anhang bietet zusätzlich Formblätter, Perzentilkurven, Laborwerte und ausgewählte<br />
Informationen zu Gewinnung, Asservierung und Versand von Untersuchungsmaterial.<br />
Fazit<br />
Insgesamt ist die Checkliste sicherlich hervorragend als Nachschlagewerk o<strong>der</strong><br />
Gedächtnisstütze für die Kitteltaschen von Studenten bzw. Assistenzärzten geeignet,<br />
die in diesem speziellen Teilgebiet <strong>der</strong> Pädiatrie tätig werden wollen o<strong>der</strong><br />
es bereits sind. Es ersetzt auf keinen Fall ein Lehrbuch.<br />
Allgemeines<br />
1. ÄP Fachbände<br />
Stand: Examen Herbst 07<br />
Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2008.<br />
159,95 Euro<br />
Die Schwarze Reihe ist wohl fast<br />
jedem Medizinstudenten ein Begriff<br />
und spätestens zum herannahenden<br />
Physikum stapeln sich diese Bücher<br />
auf den Schreibtischen <strong>der</strong> Prüflinge.<br />
Nach wie vor scheint die Prüfungsvorbereitung<br />
mit <strong>der</strong> „schwarz-gelben“<br />
Literatur unumgänglich zu sein und<br />
bildet die Grundlage für einen erfolgreichen<br />
Examensabschluss am Ende<br />
<strong>der</strong> Vorklinik.<br />
Sprache und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Die einzelnen Bände <strong>der</strong> Schwarzen Reihe bestehen jeweils aus einer Auflistung<br />
bzw. Zusammenfassung <strong>der</strong> Prüfungsfragen vorangegangener Physika. Es handelt<br />
sich hierbei um die Originalprüfungsfragen mit Fragestellung und vorgegebenen<br />
Antwortmöglichkeiten. Im anschließenden Lösungsteil befinden sich ausführliche<br />
Erläuterungen zu den gestellten Aufgaben sowie eine Vielzahl von<br />
Lerntexten, welche die wichtigsten Themengebiete noch einmal kurz und prägnant<br />
zusammenfassen. Hierbei wird mit wenigen Worten ein Maximum an prüfungsrelevanten<br />
Fakten präsentiert. Diese Glie<strong>der</strong>ung ermöglicht eine<br />
abschließende Wie<strong>der</strong>holung <strong>der</strong> wichtigsten Themenkomplexe für das 1. Staatsexamen<br />
und ist folglich ideal zur unmittelbaren Prüfungsvorbereitung.<br />
Prüfungsvorbereitung<br />
In Hinblick auf die Examina ist die Schwarze Reihe nahezu unverzichtbar und<br />
bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden bei den schriftlichen Prüfungen.<br />
Die einzelnen Themenschwerpunkte werden nicht ausführlich erläutert,<br />
so dass es sich schwierig gestaltet ein noch unbekanntes Kapitel neu zu erarbeiten.<br />
Jedoch liegt darin auch nicht das Ziel dieser, speziell auf das Physikum<br />
abgestimmten, Bücherreihe. Vielmehr bildet sie den letzten Abschnitt in <strong>der</strong> Vorbereitung<br />
vieler Studenten auf das 1. Staatsexamen und soll neben einer realitätsnahen<br />
Prüfungssimulation als Kompendium für die Fächer <strong>der</strong> zweijährigen<br />
Vorklinik dienen.<br />
Inhalt<br />
Das gesamte Paket umfasst die Fächer Anatomie, Biochemie, Biologie, Chemie<br />
für Mediziner, Medizinische Psychologie/ Medizinische Soziologie, Physik für<br />
Mediziner und Physiologie. Je<strong>der</strong> einzelne Band besteht aus einer Sammlung<br />
an originalen Examensfragen mit den dazugehörigen Lösungskommentaren,<br />
sowie kurzen Lerntexten. Darüber hinaus findet <strong>der</strong> Leser eine Statistik über den<br />
prozentualen Anteil <strong>der</strong> einzelnen Fächer am gesamten Examen und kann folglich<br />
die Schwerpunkte <strong>der</strong> Prüfung erkennen und diese verstärkt berücksichtigen.<br />
Fazit<br />
Nach wie vor ist die Schwarze Reihe wohl eine <strong>der</strong> wichtigsten Lektüren im Hinblick<br />
auf die schriftlichen Staatsexamen. Neben <strong>der</strong> Funktion als Kompendium<br />
bietet sie den Studenten die Möglichkeit das bis dahin erarbeitete Wissen zu<br />
überprüfen und darüber hinaus sich mit den gängigen Formulierungen vertraut<br />
zu machen. Für das 1. Staatsexamen war und ist sie folglich weiterhin <strong>der</strong> Goldstandard.<br />
Torsten Schulz<br />
wissenswert<br />
Checkliste Neonatologie: Das Neo-ABC 1. ÄP Fachbände<br />
Maria Bretschnei<strong>der</strong><br />
26<br />
27<br />
24. Ausgabe 2008
Allgemeines<br />
2. ÄP - Hammerexamen<br />
Original-Prüfungsfragen mit Kommentar<br />
Examen Herbst 2006<br />
Examen Frühjahr 2007<br />
Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2008.<br />
34,95 Euro<br />
Pünktlich zum Hammerexamen erschien<br />
die erste Auflage <strong>der</strong> neuen<br />
Schwarzen Reihe im Georg Thieme<br />
Verlag. Neben einer zum Teil neuen<br />
Glie<strong>der</strong>ung vertraut <strong>der</strong> Verlag aber im<br />
Großen und Ganzen auf Altbewährtes.<br />
Original Prüfungsfragen mit kommentierten<br />
Antworten bilden weiterhin die<br />
Grundlage dieser Ausgabe.<br />
24. Ausgabe 2008<br />
wissenswert<br />
Sprache und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Die Ausgabe Examen Herbst 2006 und Frühjahr 2007 vertraut wie ihre Vorgän-<br />
ger auf die aktuellen Prüfungsfragen <strong>der</strong> vorangegangenen Staatsexamina kombiniert<br />
mit einer ausführlichen Erläuterung zu den einzelnen Lösungsvorschlägen.<br />
Mit meist ein bis zwei Sätzen wird <strong>der</strong> Grund dargelegt, warum<br />
eine Antwort als falsch o<strong>der</strong> richtig angesehen werden sollte. Diese Gestaltung<br />
des Buches för<strong>der</strong>t das Verständnis für die jeweiligen Lösungsansätze und zeigt<br />
zugleich kleine „Stolpersteine“ auf, welche dann in <strong>der</strong> späteren Prüfung eventuell<br />
umkurvt werden können.<br />
Prüfungsvorbereitung<br />
Für die Examina gilt die Schwarze Reihe weiterhin als enorm wichtig. Es ist sehr<br />
sinnvoll die einzelnen Fragen vorher einmal durchgekreuzt zu haben, nicht nur<br />
um sich eventuell wie<strong>der</strong>holende Fragen zu erkennen, son<strong>der</strong>n vielmehr um die<br />
Lösungsansätze zu verstehen und diese zu verinnerlichen. Es scheint darüber<br />
hinaus ebenfalls sehr günstig neben den aktuellsten Auflagen auch weiter zurück<br />
liegende Examina zu bearbeiten. In <strong>der</strong> Summe ermöglicht dies eine sehr gute<br />
Prüfungsvorbereitung.<br />
Inhalt<br />
Das beschriebene Buch beinhaltet neben knapp 650 Original Prüfungsfragen<br />
mit ausführlichem Kommentar auch mehrere Fallstudien, welche einen zusammenhängenden<br />
Fragenkomplex beinhalten und damit das Bild einer realen Patientengeschichte<br />
vorstellen. In den Fallstudien werden dem Leser neben einer<br />
Anamnese auch <strong>der</strong> Aufnahmebefund sowie weitere Ergebnisse klinischer Untersuchungen<br />
geschil<strong>der</strong>t, aus denen dann im Anschluss eine Serie aus ca. 12 bis<br />
15 Fragen hervorgeht. Zwar ist durch diesen Zusammenhang <strong>der</strong> Fragen <strong>der</strong> Prüfungsstoff<br />
auf interessante Art und Weise aufgearbeitet worden, allerdings bedarf<br />
es einer ausgesprochenen Konzentration und Merkfähigkeit die Summe aller<br />
beschriebenen Details im Kopf zu behalten.<br />
Fazit<br />
Die Prüfungsvorbereitung für die einzelnen Staatsexamina sollte immer auch<br />
die Bearbeitung <strong>der</strong> Schwarzen Reihe beinhalten. Neben dem Training für die<br />
schriftliche Prüfung können viele Fakten noch einmal rekapituliert und ins Gedächtnis<br />
gerufen werden. Ein neuer und durchaus positiver Aspekt liegt in dem<br />
verstärkt in den Vor<strong>der</strong>grund gestellten Bezug zur klinischen Praxis, was die Bearbeitung<br />
<strong>der</strong> Fragen weniger ermüdend und zum Teil sogar spannend erscheinen<br />
lässt.<br />
Allgemeines<br />
2. ÄP - Hammerexamen<br />
Examen Herbst 2007<br />
Original-IMPP-Prüfungsfragen mit<br />
Kommentar<br />
Schwarze Reihe<br />
Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2008.<br />
24,95 Euro<br />
Je<strong>der</strong> Student <strong>der</strong> sich aufs Examen<br />
vorbereitet wird kaum ohne ein umfassendes<br />
Kompendium und die<br />
schwarze Reihe auskommen. Seit dem<br />
Herbst 2006 zeigt sich das Staatsexamen<br />
nach <strong>der</strong> neuen Approbationsordnung<br />
in einem neuen Gewand und<br />
wird auch „Hammerexamen“ genannt.<br />
Glie<strong>der</strong>ung<br />
Die neue schwarze Reihe, ist wie die alte schwarze Reihe, in einen Frage- und<br />
ein Kommentarteil unterglie<strong>der</strong>t. Dargestellt sind die Fälle des Originalexamens<br />
Herbst 2007 und <strong>der</strong>en Einzelfragen. Geglie<strong>der</strong>t wird <strong>der</strong> Fragenteil wie im richtigen<br />
Examen in Tag 1-3. Im Anhang finden sich die Bil<strong>der</strong>, sowie das Referenzregister<br />
<strong>der</strong> Laborwerte.<br />
Inhalt<br />
Auf den Inhalt <strong>der</strong> Fragen und ihre subjektive Beurteilung werde ich nicht eingehen.<br />
Der Kommentarteil umfasst knapp 100 Seiten und nimmt damit den<br />
Hauptteil des Buches ein. Insgesamt 13 Autoren kommentieren die Antwortmöglichkeiten.<br />
Im Kommentarteil werden die wichtigsten Fakten zu den abgefragten<br />
Krankheiten erläutert. Die Beschreibung erfolgt klar verständlich und<br />
wichtige Details sind fettgedruckt hervorgehoben.<br />
Fazit<br />
Ohne die schwarze Reihe o<strong>der</strong> die Alternative medi-script CD kommt wohl kein<br />
Student durchs Examen. Vorteil des Buchs ist, dass es zum Mitnehmen und<br />
„Kreuzen“ für unterwegs gut geeignet ist. Das Lesen des ausführlichen Kommentarteils<br />
ist unerlässlich für den Lernerfolg und das Bestehen <strong>der</strong> Prüfung.<br />
R. Baukholt<br />
wissenswert<br />
2. ÄP - Hammerexamen 2. ÄP - Hammerexamen | Examen Herbst 2007<br />
Torsten Schulz<br />
28<br />
29<br />
24. Ausgabe 2008
Allgemeines<br />
Norbert Roewer, Holger Thiel<br />
Taschenatlas <strong>der</strong> Anästhesie<br />
Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2008.<br />
3.Auflage<br />
39,95 Euro<br />
„Fakten soviel wie nötig- Hintergründe<br />
soviel wie möglich!“ damit wirbt <strong>der</strong><br />
Verlag für die erweiterte und völlig<br />
überarbeitete 3.Auflage. Dieses Zitat<br />
zeigt die Intention des Verlages, ein<br />
Kompendium für die Kitteltasche zu<br />
schaffen. Ein Buch das den schnellen<br />
Blick im Praktikum und PJ erleichtert,<br />
jedoch kein umfassendes Lehrbuch ersetzt.<br />
24. Ausgabe 2008<br />
wissenswert<br />
Taschenatlas <strong>der</strong> Anästhesie<br />
Sprache und Glie<strong>der</strong>ung<br />
In fünfzehn Kapiteln werden die Themengebiete <strong>der</strong> Anästhesie beschrieben.<br />
Jedem dieser Abschnitte ist eine Farbe zugewiesen. Dadurch wird ein schneller<br />
Zugriff auf ein spezielles Thema erleichtert. Wie von Taschenatlanten bekannt,<br />
glie<strong>der</strong>n sich die Seiten abwechselnd in Text- und Bilddarstellung. Lei<strong>der</strong> wird<br />
dadurch manchmal <strong>der</strong> Lesefluss unterbrochen, da die Abbildungen nicht immer<br />
auf <strong>der</strong> gegenüberliegenden Seite <strong>der</strong> Textstelle zu finden sind. Weiterhin werden<br />
nicht alle Abbildungen explizit im Text aufgeführt. Dem Leser wird <strong>der</strong> Einstieg<br />
erleichtert, in dem Bildüberschriften den Textüberschriften entsprechen.<br />
Dadurch wird spielend eine schnelle Übersicht über den Text möglich. Die<br />
sprachliche Gestaltung ermöglicht ein rasches Lesetempo durch die einfache<br />
Strukturierung. Wichtige Fachbegriffe werden durch Fett- o<strong>der</strong> Kursivschrift hervorgehoben.<br />
Abkürzungen werden umfassend erläutert und im Anhang zusammengefasst.<br />
Schade ist, dass sich Fehler bei den Son<strong>der</strong>zeichen eingeschlichen<br />
haben. Die Textstellen werden auf einer beiliegenden Karte gelistet und revidiert.<br />
Prüfungsvorbereitung<br />
Als Begleitung zu Vorlesungsmitschriften ist dieses Buch durchaus zu empfehlen.<br />
Allerdings werden nicht alle Vorlesungsthemen und damit prüfungsrelevanten<br />
Themen abgefasst.<br />
Inhalt<br />
Wichtig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass nicht alle Fachbereiche <strong>der</strong><br />
Anästhesiologie aufgeführt sind. Die Intensivmedizin wird nicht dargestellt. Die<br />
Schmerztherapie wird meiner Ansicht nach nur zu kurz behandelt. Dem im klinischen<br />
Alltag immer wichtiger werdenden chronischen Schmerz, dem sich auch<br />
<strong>der</strong> Anästhesist widmet, wird das Buch nicht gerecht. Der Notfallmedizin widmen<br />
sich die Abschnitte Komplikationen in <strong>der</strong> Anästhesie und Kardiopulmonale<br />
Reanimation. Der Taschenatlas befasst sich also hauptsächlich mit dem<br />
Fachbereich <strong>der</strong> Anästhesie. Dieser wird jedoch sehr ansprechend, praxisnah<br />
und umfassend präsentiert. Beson<strong>der</strong>s schön ist <strong>der</strong> tabellarisch gestalte Anhang<br />
mit allen wichtigen facts zu Medikamenten in <strong>der</strong> Anästhesie.<br />
Fazit<br />
Ein ergänzendes Werk, das jedoch nicht mit Lehrbüchern gleichzusetzen ist und<br />
kritisch betrachtet werden sollte. Hilfreich für Studenten, die visuell lernen, denn<br />
die 174 Abbildungen sind sehr einprägsam gestaltet.<br />
R. Baukholt<br />
30
Sie sind für Ihre Patienten da.<br />
Wir für Ihre Finanzen.<br />
Unsere individuellen Finanzlösungen für Mediziner.<br />
Wir entwickeln als unabhängiger Makler Finanzlösungen speziell für anspruchsvolle Mediziner. Das Beson<strong>der</strong>e an diesen Lösungen ist,<br />
dass sie die einzelnen Bausteine aus den Bereichen Vorsorge, Vermögens- und Risikomanagement individuell miteinan<strong>der</strong> verknüpfen.<br />
MLP bietet Ihnen damit integrierte Bank- und Versicherungsdienstleistungen, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen und Zielen passen.<br />
Rufen Sie uns an.<br />
MLP Finanzdienstleistungen AG<br />
Geschäftsstelle <strong>Rostock</strong> I, Grubenstraße 48<br />
18055 <strong>Rostock</strong>, Telefon (0381) 49282-0<br />
E-Mail: rostock1@mlp-ag.com<br />
www.mlp.de