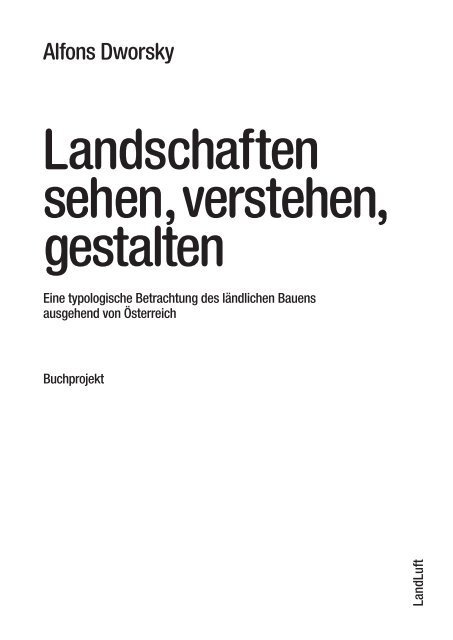Alfons Dworsky - LandLuft
Alfons Dworsky - LandLuft
Alfons Dworsky - LandLuft
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SkizzenEinige Beispiele aus demumfangreichen Fundusvon <strong>Alfons</strong> <strong>Dworsky</strong>, derneben Fotos und Dias auchunzählige Skizzen undhandgezeichnete Schemataumfasst. Diese stellenauf unterschiedlichstenMaßstabsebenenZusammenhänge undEntwicklungen einfachverständlich dar.5. Was sind die nächsten Schritte?Das vorliegende Konzept steckt den inhaltlichen Rahmen und die Zielrichtung ab. DasBuchprojekt ist auf mehrere Jahre angelegt und umfasst folgende Punkte:• Verfassen der Texte und Herstellung der Illustrationen mit wissenschaftlicherAssistenz• Aufbereitung des umfangreichen Karten- und Fotomaterials aus dem Besitz <strong>Alfons</strong><strong>Dworsky</strong>s• Herstellung eines qualitativ hochwertigen Buches mit DVD-BeilageUm diese Ziele umsetzen zu können, ist das Projekt auf Kooperations- und Finanzierungspartnerangewiesen. Diese können sich sowohl aus großen institutionellen Förderstellenals auch aus kleineren Beitragsgebern (ev. in Form eines Subskriptionssystems)zusammensetzen.4
InhaltLandschaftensehen, verstehen, gestaltenEntwurf für die Gliederungdes Buches:Das Buch soll imWesentlichen aus zweigleichwertigen Hauptteilensowie einem Glossar mitwissenschaftlichem Apparatinkl. DVD bestehen. Derangestrebte Umfang ist ca.300-350 Seiten.I. Die Genese der österreichischen Kulturlandschaft – eine Schule des SehensDieser erste Teil ist eine objektivierte Darstellung von Werden und Transformation dermitteleuropäischen Kulturlandschaft, ausgehend von Österreich. Wesentliche Inhalte sind:• Einleitende Skizzen zu einer vergleichend typologischen Betrachtungsweise• Entwurf einer Periodisierung• Herausarbeiten der verschiedenen naturräumlichen, sozioökonomischen,technologischen Faktoren, die auf die Kulturlandschaft und ihre Entwicklung wirktenund bis in die Gegenwart wirken; Exemplifizierung anhand der Gegenüberstellung vonkonkreten Beispielen, die bis ins Anekdotische gehen (gegenwärtig und historisch, bis zurObjekt- und Detailebene)II. Der Blick auf die Landschaft – Landschaftswahrnehmung und GestaltungEntwurf einer Kulturgeschichte, vom archaischen …. bis zum postmodernen Blick derGegenwart. Wichtig dabei sind:• Ein enger Zusammenhang mit dem ersten Teil des Buches (Beispiele etc.)• Eine (kunst)historische, punktuelle Illustration der verschiedenen Blicke• Die Frage nach dem „Regionalen“ in der gegenwärtigen Baupraxis: Regionales Bauen vs.RegionalismusIII. GlossarDieser Abschnitt erklärt und illustriert die wichtigsten Begriffe, Konzepte und Ideen zumThema „Bauen im ländlichen Raum“: von Altstraßenforschung bis Zwerchhof.----------Wissenschaftlicher ApparatLiteratur / Quellen / Abbildungsnachweis / kommentierter Verweis auf interessantesunpubliziertes Material / ergänzendes KartenmaterialKommentartext zu den Klaarkarten auf der DVD: Entstehung und Wert des Materials,biographisches zu Adalbert Klaar, Relevanz für Forschung und PlanungSonderpunkt / Beilage: DVD mit dem Kartenfundus von Adalbert KlaarSchwerpunkt ist die Veröffentlichung von Klaars Siedlungsformenkarte Österreichs5
Luftaufnahmen undSatellitenbilderIn Gegenüberstellungzu den Skizzen, Plänenund Schemata wird alszusätzliche illustrative Ebeneeine repräsentative Auswahlan historischen undrezenten Luftaufnahmenund Satellitenbildernzum Verständnis derunterschiedlichenStrukturen undLandschaftsräumebeitragen.Die Auswahl zeigt dasMühlviertel (l.o.), dieBucklige Welt (l.m.), dasSteirische Randgebirge (l.u.)und das Wiener Becken(r.o.) als Beispiele aus demAlpenvorland, Obertilliachals Beispiel einer Siedlungim alpinen Raum (r.u.)und Oggau am NeusiedlerSee (r.m.) als Ort in derpannonischen Ebene.Quellen: Google Maps;Lothar Beckel: LuftbildatlasÖsterreich - eineLandeskunde mit 80farbigen Luftaufnahmen.Wien 1969.6
Adalbert KlaarGeb. 1900 in Wien, gest.1981 in Klosterneuburg.Architekt, Siedlungs- undHausformenforscher.1919-1924 Studiumder Architektur an derTechnischen HochschuleWien. Seit 1942Lehrtätigkeit im FachgebietSiedlungskunde an derTechnischen HochschuleWien bzw. an der UniversitätWien. 1946-65 war Klaarim Bundesdenkmalamtbeschäftigt.Seine Bedeutungerlangte Klaar durch einesystematische Entwicklungder Siedlungs- undFlurformenkunde inÖsterreich und die Schaffungeiner wissenschaftlichenTerminologie. Nachdem Zweiten Weltkriegwurde Klaar durch seinemethodisch konzipiertenBaualterpläne von Kirchen,Burgen und Schlössernbekannt. Die ab 1972publizierten Baualterplänevon Märkten und Städtenbilden bis heute die Basisfür Denkmalschutz und-pflege in Österreich.Ebenso wirkte Klaar durchseine bautechnischenUntersuchungen vonBauernhausformen v.a. inOstösterreich bahnbrechend.Quelle:http://www.architektenlexikon.at7
Schema Periodisierung( F. Hauer )Schema Faktoren undSchwerpunkte( F. Hauer )8
ProjektbibliographieLandschaftensehen, verstehen, gestaltenArtikel im AnhangPublikationen und akademische Schriften von <strong>Alfons</strong> <strong>Dworsky</strong>Die Ehre Erbhof. Analyse einer jungen Tradition. (Hg. gemeinsam mit Hartmut Schider),Salzburg, Wien 1980Entwicklung und Typologie der Salzburger Bauerngehöfte. Diss. TU Wien 1984Gesammelte Publikationen zum ländlichen Bauwesen. Habil.-Schrift TU Wien 1989Typenentwürfe für die Oststeiermark. Wien 1986Reihe, Raster und Division. Verwandtschaftsbeziehungen ländlicher Gehöftfamilien. Skizzeam Leitfaden der Dachgerüstentwicklung. Skriptum TU Wien 1986Landschaft, Siedeln und Bauen. In: Theres Friewald-Hofbauer (Hg.), HeimSuchungen. 15Jahre Europäischer Dorferneuerungspreis im Spiegel der Zeit. Wien 2005, S. 100-108Kulturlandschaft und Raummodelle. In: Hansjörg Küster (Hg.), Kulturlandschaften.Frankfurt/Main 2008, S. 105-112Raummodelle im Wandel. In: BHU – Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (Hg.),Regionale Baukultur als Beitrag zur Erhaltung von Kulturlandschaften. Bonn 2010, S. 52-59Ländliche Räume im Wandel. In: Deutsche Stiftung Kulturlandschaft und aid (Hg.),Globalisierte Landwirtschaft und regionale Baukultur. Bonn 2012, S. 5-12Referenzwerke (unvollständig)Wilhelm Abel: Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters - ein Beitrag zur Siedlungs- undAgrargeschichte Deutschlands. Stuttgart 1955Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer: Alpine Siedlungsmodelle. 2007Alfredo Baeschlin et al.: Wegleitung für die Aufnahmen der bäuerlichen Hausformen undSiedlungen in der Schweiz. Basel 1948Lothar Beckel: Luftbildatlas Österreich - eine Landeskunde mit 80 farbigen Luftaufnahmen.Wien 1969Günther Franz: Deutsche Agrargeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart (QuellenundArbeitshefte zur Geschichte und Gemeinschaftskunde 4244 ). Stuttgart 1966Albert Hauser: Wald und Feld in der alten Schweiz. Beiträge zur schweizerischen Agrar- undForstgeschichte. München 1972Christoph Hölz, Walter Hauser, Archiv für Baukunst (Hg.): Weiterbauen am Land - Verlustund Erhalt der bäuerlichen Kulturlandschaft in den Alpen. Innsbruck, Wien 2011Adalbert Klaar: Niederösterreichische Dorf- und Stadtsiedlungen aus der Babenbergerzeit.Diss. TH Wien 1929Adalbert Klaar: Die Siedlungs- und Hausformen des Wiener Waldes. Stuttgart 1936Adalbert Klaar: Begleittext zu den Baualterplänen österreichischer Städte. Wien 19809
Projektbibliographie & KartenmaterialLandschaftensehen, verstehen, gestaltenHansjörg Küster: Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa - von der Eiszeit bis zurGegenwart. München 2010Jon Matthieu: Geschichte der Alpen 1500–1900. Umwelt, Entwicklung, Gesellschaft. Wien2001Jon Matthieu: Die Alpen! Zur europäischen Wahrnehmungsgeschichte seit der Renaissance.Bern 2005August Meitzen: Siedlung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten,Römer, Finnen und Slawen (in 3 Bd. mit Atlasbd.). Berlin 1895 (Neudruck 1963)Paul Oliver (Hg.): Encyclopedia of vernacular architecture of the world (3 Bde.: Bd 1:Theories and principles. Bd 2: Cultures and habitats I. Bd.3: Cultures and habitats II.Cambridge 1997/98Karin Raith: Wohnhöhle und Luftschloss. Konzepte und Konstruktionen an der Schnittstellezwischen Architektur und Boden, Kultur und Natur. Wien 2003Jörg Schröder und Kerstin Weiger (Hg.): Landraum. Beyond Rural Design. Berlin 2010Rolf Peter Sieferle (et.al): Das Ende der Fläche. Wien 2006Karten und Pläne von Adalbert Klaar und Bearbeitungen anderer AutorInnenBauernhauspläne [Adalbert Klaar. Bearb. von <strong>Alfons</strong> <strong>Dworsky</strong>]. Wien 1969Kunsttopographische Planaufnahmen in den Bundesländern Österreichs. Wien 1959Siedlungsformenkarte der Reichsgaue Wien, Kärnten, Niederdonau, Oberdonau, Salzburg,Steiermark und Tirol, und Vorarlberg + Begleitheft. Wien 1942Josef Köstlbauer und Johannes Zopp: Siedlungskundlicher Werkplan (Ca. 10 gef. Bl., ersch.o.J. zw. 1956 - 1959: 1. Vierkanthof, 2. Paarhof, 3. Tirol-Salzb. Einheitshaus, 4. InnviertlerVierseithof, 5. Vorarlberger Bauernhaus, 6. Streckhof, 7. Dreiseithof, 8. Zwerchhof, 9.Haufenhof, 10. Kärntner Ringhof)Alfred Charamza und Christoph Rainer: Professor Adalbert Klaar Bauernhauspläne.Dokumentation und Interpretation. Wien 1988 (Dipl.-Arbeit betreut von <strong>Alfons</strong> <strong>Dworsky</strong>)Ernst Burgstaller, Richard Wolfram und Adolf Helbok (Hg.): ÖsterreichischerVolkskundeatlas. Unter dem Patronat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 6Lieferungen, Linz 1959–1978.Thomas Wrbka: Kulturlandschaftsgliederung Österreich (CD-ROM, Endbericht desgleichnamigen Forschungsprojekts / Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft undKultur), Wien 2002.10
Impressum<strong>LandLuft</strong>Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen RäumenBrandnerweg 6A-9062 Moosburg/WörtherseeLederergasse 23A-1080 WienEmail: buchprojekt@landluft.atwww.landluft.atProjektteam:<strong>Alfons</strong> <strong>Dworsky</strong>Friedrich HauerJudith LeitnerRoland GruberInitiator: Erich RaithWien, März 201211
52Regionale Baukultur, BHU 2010Raummodelle im Wandel<strong>Alfons</strong> <strong>Dworsky</strong>D ie Begriffe „Region“, „Stadt“,„Land“, „Landschaft“ etc. sindKategorien menschlicher Raumwahrnehmung,und nicht Namen (Nomina)für objektiv existierende Dinge. Im Zugemenschlicher Evolutionsprozesse verändernsich Welt- und Raumbeschreibungenständig, damit auch die erwähntenBegriffe. Bedeutungen und Inhalte aktuellerRaummodelle haben sich als Fol-ge von Globalisierung und Virtualisierungso sehr verformt und erweitert, dass für kom-mende Entwicklungen und Erscheinungen treffendereBezeichnungen und Begriffe geprägt und verwendet werden sollten.1. Stadt: Das traditionell-europäische Raummodellbasiert auf einer alten dualen Leitvorstellung; Stadt als verarbeitendes und gleichsam angespanntesZentrum inmitten produzierender, peripherer, ländlicher Räume, denen neuerdings ökologische und harmonisierende Funktionen zugewachsen sind. Der neue, noch namenlos urbanisierte Raum ist nicht mehr als Ringstruktur, sondern als Netz zu verstehen.Bei der Beschreibung dieses Wandels ist die Ungleichzeitigkeitzivilisatorischer Prozesse im Auge zu behalten; dynamischen Metropolregionen in stürmischerGärung stehen ausgereifte und denkmalgegenerschützte historische Stadtkerne, reglose Kleinstädte und verbrauchte Entleerungsräume gegenüber. Aus unharmonischen Entwicklungsdisparitäten, etwazwischen Zentren und Peripherie, ergeben sich nicht nur abschöpfbare Wertgefälle, sondern auch Nährbödenfür destruktive politische Regionalismen und problematische Wanderungsanreize. 2 2. Region: Der Begriff „Region“ bezeichnetzunächst nur einen Bereich,nen ist: Nach planerischem Begriffsver-eine Sphäre, die genauer zu bezeich-ständnis ist Region größer als Kommuneoder Ort, aber kleiner als Land odertrativen Machtbereichen werden sichStaat. Mit dem Verblassen von adminis-berandete polyfunktionale Kultur- undkünftige Regionen eher als unscharfRegionale Baukultur ließ und lässt sich nicht inLebensentfaltungsräume darstellen. 2len, es gab und gibt immer nur mehrschichtige Ver-einem homogenen geographischen Mosaik darstel-breitungsmuster architektonischer Typologien; zumerlicher Hausformen ein relativ kleinregionales Ver-Beispiel wird die Kartierung von Kernbereichen bäu-ten werden größere Bereiche ausweisen. Verwandtebreitungsmuster ergeben, doch Gehöftformenkar-aber andere Verbreitungsmuster zeigen Bauten desAdels der Kirche, die bügerlichen Stadthäuser aberauch Bauten von Industrie, Handel und Verkehr. Dashaupt, so nur in einem Stapel thematischer Schich-bedeutet, dass man regionale Baukultur, wenn über-3. Ländlicher Raum: In traditionellem Begriffsvertenvollständig kartieren kann.Raum, auch als Kulturlandschaft bezeichnet,ständnis ein vorwiegend agrarwirtschaftlich getraschütztedie als Kontrast zu Naturlandschaft gesehen wird.Da aber die gesamte Erdoberfläche mehr oder wenigeranthropogen verändert oder beeinflusst ist, er-gibt sich daraus kein analytisch brauchbares Kriterium.Eher sinnvoll wäre eine strukturelle Typologienaturgeprägter Räume, die nur Vergleichbares vergleicht:Neue (Kultur-)Landschaften werden poly-funktionale Räume mit agrarischer Vergangenheitund urbaner Zukunft sein.4. (Raum-)Planung: Planung wird als vorausschauendeOrdnung und Gestaltung von Räumennach gesellschaftlichen Interessen, planerischenLeitbildern und politischen Zielen verstanden. Tatsächlichlässt sich Raumplanung auf das Herstellen,Einräumen oder Verweigern von individuellen undgesellschaftlichen Entfaltungschancen und auf dieBereitstellung öffentlicher Infrastrukturen zurückführen.Technische Ergebnisplanung (z.B. Infrastruktur)und rechtlich bindende Raumordnung (z.B. Bauleitplanung)werden in Zukunft gegenüber der ProzessplanungBeteiligungsverfahren, endogener Initiativen,in den Hintergrund treten. Leitbilder,Moderationen, Mediationen, flexible Handlungsszenarienwerden gegenüber der VerordnungsplanungGewicht gewinnen.Was ist Regionalismus?Regionalismus ist kein architektonischer „Stil“, sondernzunächst eine umfassende, kulturpolitischeEinstellung, die das regionale Sein, etwa der Landsmannschaft,der geographischen Sprach- und Kulturgemeinschaftals Hauptkriterium jeder Lebensentfaltungsieht und dem ökonomischen Status nurzweitrangige Bedeutung einräumt. Im Gegensatz zudiesen Positionen stehen internationale Tendenzen,wonach ökonomische und soziale Klassen- oderSchichtzugehörigkeiten auch für das räumliche, regionaleBewusstsein bestimmend sind.Regionale Architektur, was ist das?Grundsätzlich ist das gesamte ortsfeste bauliche Geschehenin Vergangenheit und Gegenwart u. A. eine„regionale“ Erscheinung, aus der sich kein gestalterischesWerturteil ableiten lässt. Ob im Einzelfall eineregionale Prägung erkennbar ist oder nicht, ob dar-<strong>Alfons</strong> <strong>Dworsky</strong>: Raummodelle im Wandelaus architektonische Qualitätskriterien abzuleitensind oder nicht, bildet eine weiterführende nicht objektivierbareFrage. So gesehen ist „Regionale Architektur“weder schön noch unschön, es ist die umfassendearchitektonische Repräsentation einer Region.Regionalistische Architektur, was ist das?In den Kunstwissenschaften stehen „-ismen“ für bestimmteEinstellungen und Programme, auch fürDogmata. So liegt auch „Regionalistischer Architektur“immer ein bewusstes Gestaltungsprogramm zugrunde.Darin liegt der wesentliche Unterschied zunaiver, spontaner, eben regionaler Architektur. DieFrage nach den Programmen verweist modifiziert aufdie Ausgangsfrage: Wie veränderte oder verändertder Wandel räumlicher Modelle und Wahrnehmungendie Vorstellungen vom Umraum und der Region,und welche Ausgangspunkte und Thesen könntenein Gestaltungsprogramm tragen? 3Es folgen einige rohe Skizzen zur Geschichte derBlickbeziehungen zwischen Mensch und Umraumund einige Spekulationen über die sich daraus ergebendenGestaltungsansätze:Der archaische Blick(Altsteinzeit, teilweise bis heute)In der Frühzeit mancher Kulturen wurde die Naturals „lebensfeindliche Lebensspenderin“ erfahrenund oft in ambivalenten Numina und Göttinnen personalisiert.Daraus ergeben sich charakteristischeKosmologien und die Naturbilder der Jäger-Sammlerund Hirtennomaden, soweit sich dies aus archäologischenErkenntnissen erschließt. Der Himmel, einGewölbe senkrecht über dem Scheitel, der Wasserspiegelals Grenze zu Unter- und Nebenwelten, unddazwischen die bewohnbare und gleichermaßen gefährlicheErde. Schutzbauten, die die konzeptuell53
54Regionale Baukultur, BHU 2010Abb. 1: Val Versaszca/Tessin/Schweiz. Von Sonognotaleinwärts Foto: A. <strong>Dworsky</strong>der Abwehr bzw. Beschwichtigung vonUnkontrollierbarem dienen, kodifizierteBezugnahmen auf Kosmologien, Architekturals Selbstbehauptung in Raumund Zeit. Rezente Reste von archaischenNatursichten hielten bzw. halten sich imKultbau, als Ausdrucksmittel von Erhabenheitund Dauer und in romantischenSinnkonzepten. Die Welt als anthropozentrischeSphäre, ein kosmologischesRaummodell.Die neolithischen Entdeckungen: Viehzuchtund Ackerbau brachten ein völligneues Raummodell mit sich: Die Erdoberflächedifferenziert sich zu einerdualen Raumorganisation von umfassenderchaotischer „Wildnis“, und darin eingebettetentsteht das von Menschen planmäßig urbar gemachtesoziale und familiäre Kulturland. Das sozialesKulturland steht für einigermaßen gesicherte Lebensentfaltungim Bereich und Schutz der Gemarkung.Das Land „gehört“ der Urbarialherrschaft,diese beseitigt Schädlinge und verleiht Nutzungsrechte.Es gibt Territorialisiertes Recht. FamiliäresKulturland besteht aus dem „Gut“, der Lebensgrundlageeiner Familie oder eines Clans. Die Gesellschaftgarantiert und tradiert den unwidersprochenen„Fruchtgenuss“. Individuelles Eigentum ist nur„Habe“, die vererbt oder als Grabbeigabe persönlichesAttribut bleibt. Aus diesem dualen Raummodellkonzipiertes sich die Ästhetik des Paradieses, imGegensatz zur Wildnis, die Wertschätzung des „lieblichenOrtes“ das meint ein wohlgeordnetes, fruchtbaresund geschütztes Territorium; wir finden friedliches„Bauernland“ in den jeweils regionalen Ausprägungen.Der bäuerliche Blick(Europäische Antike bis Reformation,teilweise bis heute)Abb. 2: Sankt Gerold/Walsertal/Vlbg./Österreich Foto: A. <strong>Dworsky</strong>Der herrschaftliche Blick(Europäische Antike bis 1800)Die Landvilla als Zentrum eines – größeren – herrschaftlichenGutsbetriebes ist seit der griechisch-römischenAntike bekannt und beliebt. Das römischsenatorischeLandgut war nicht Lebensmittelpunktlandsässiger Eliten, sondern eher eine Kombinationvon ertragsorientiertem Betrieb und Refugium fürprimär stadtsässige Eigentümer. Im keltisch-germanischenEinflussraum überwog das „Herrenhaus“,der „Saal“ eines landsässigen Adels. Als der venezianischeSeehandel im östlichen Mittelmeer ab 1453durch die türkische Eroberung Konstantinopels riskantgeworden war, wandte sich das Interesse derInvestoren der terra ferma, der Binnenkolonisationetwa der unteren Poebene zu. Das aufkeimende humanistischeInteresse an Naturwissenschaft und derbautypologische Vorrat: „Antike Villa“ und „Herrenhaus“sowie die modische Villenbegeisterung vene-Abb. 3: Villa Poiana/Poiana Maggiore, Veneto. Arch.: AndreaPalladio 1549 Foto: A. <strong>Dworsky</strong><strong>Alfons</strong> <strong>Dworsky</strong>: Raummodelle im Wandelzianischer Investoren lösten Impulse aus, die nichtnur zur Ausformung der Renaissancevillen von AndreaPalladio, Vincento Scamozzi, Sebastiano Serliou.a. führten, sondern auch ein neues Raumideal erzeugten:Die urbane Landvilla in dominanter Lageinmitten von bäuerlichem Kulturland. Gegen Endedes ancien regime konzipieren aufgeklärte Fürstenharmonisierte Raum- und Gesellschaftsmodelle alsGegenthese zur (Französischen) Revolution.Der bürgerliche Blick(1750 bis 1930, teilweise bis heute)In bürgerlichen Architekturpräferenzen wirkt oft dasIdeal großbürgerlich-landadeliger Repräsentation;diese Imitation erzwingt, dass „Motive“ von authentischenZeichen ab- oder hergeleitet werden. „Landschaft“wird nicht mehr mit dem rationalen, bäuerlichenBlick, auch nicht souverän, sondern romantisch,motivisch als malerischer Sachverhalt wahrgenom-Abb. 4: Ruissalo/Turku/Finnland: Großbürgerliche Sommervillaum 1880 im Schweizer- oder Chaletstil erbautFoto: A. <strong>Dworsky</strong>55
56Regionale Baukultur, BHU 2010men. Das Suchfeld geeigneter „Motive“ sind wenigerreale regionale Strukturen, sondern eher populäreIdealbilder. Zusätzlich zum bürgerlichen Mythos„Schweiz“, der Abstrakta wie Freiheit und Erhabenheitder Natur in konkrete Bilder fassen ließ, wurdeab 1851 auf Weltausstellungen das Schweizer Chaletals Synonym für elegant-folkloristisches Landlebenweltweit wirksam. Eine Rolle, die nach 1945 in bescheideneremAusmaß dem Tirolerhaus zufiel.Der nationalromantische Blick(1830 bis 1930)Erst im Zuge der nachnapoleonischen NeuordnungEuropas entstehen die politischen und kulturellenAbb. 5: L‘Hospitalet/Katalonien/Spanien: Villa J. um 1870.Arch.: Josep Maria Jujol Foto: A. <strong>Dworsky</strong>Konzepte der heutigen Nationalstaaten. Im Zuge regionalistischerkultureller Selbstfindung erwacht um1850 ein zunächst romantisches, später auch wissenschaftlichesInteresse an Volkskunde und Volkskunst.Wir treffen Dokumentation und Sammlungvon Bauaufnahmen, Lieder und Legenden, bäuerlicheSachkultur als Vorwegnahmen von Unabhängikeitsbestrebungen.Nationalromantik ist die spezifischeErscheinungsform des Regionalismus im 19.Jhdt. Im Jugendstil, einer unpolitisch-bürgerlichidealistischenVariante der Nationalromantik, spielenVolkskunst, ländliche Motive, Ästhetisierung desFrühlings- und Landlebens eine anregende Rolle. DieBildwelten Carl Larssons fassen das Lebensgefühlkultivierter bürgerlicher Ländlichkeit.Der faschistische Blick(1918 bis 1945, teilweise auch länger)Einige Erneuerungsansätze nach dem Ersten Weltkrieggehen von futuristischen, biologistischen, sozialrevolutionärenund antidemokratischen Thesenaus, dem Nährboden vieler unterschiedlicher Faschismen.„Gesundheit“ wird zum Zentralbegrifffaschistischer Ideologien, meist von Attributen wieKraft, Schönheit, Tapferkeit, Jugendlichkeit, Heroismusund soldatischer Opferbereitschaft umranktund umnebelt. Als ewiger Quell unverdorbener Gesundheitgalt und gilt der ländliche Raum, die urwüchsigeBäuerlichkeit. Aus dem immanenten Widerspruchzwischen rigider Zentralgewalt und jeglichenTraditionen regionaler Autonomie ergibt sich,dass bestehende Regionalkultur in faschistischenSystemen durchwegs bekämpft und unterdrückt,aber ein synthetischer Staatsfolklorismus zusammenmit einem verordneten Regionalismus zum ästhetischenLeitbild der programmatischen „volksverbundenen“Erneuerung gesetzt wird. Das Paradoxondes Internationalen Heimatstils wird so geboren.<strong>Alfons</strong> <strong>Dworsky</strong>: Raummodelle im WandelAbb. 6: Potsdam/Brandenburg/Deutschland: Schloss Cecilienhof 1917.Arch.: Paul Schulze-Naumburg Foto: A. <strong>Dworsky</strong>zelfälle oder individuelle Ausprägungengrundsätzlicher Strukturmodelle.Die Methoden und Perspektivender „Strukturalen Anthropologie“lösen ab 1950 in der Haus-Siedlungs- und Landschaftsforschungdie fruchtbaren Impulsezur Überwindung völkischer Dogmataaus. Im methodischenGleichschritt mit der vergleichendenVerhaltensforschung werdenkomparative Studien zur „Struktur“der besiedelten Kulturlandschaftangestellt, mit dem Ziel dieseneu zu lesen und rational zuentschlüsseln.Darauf aufbauende Gestaltungskonzeptekönnen sich imGegensatz zu folkloristischen bzw.postmodernen DekorationsmodenDer phänomenologischstrukturalistischeBlick(1900 bis heute)Im Gefolge der Aufklärung etablierensich Phänomenologie undPragmatismus als anerkannte Methodendes Erkenntnisgewinns.These: Man kann die Welt aufgrundvon vergleichend beobachtetenErscheinungen und Handlungenverstehen. Schon im späten19. Jhdt. gehen die Strukturalistendavon aus, dass – zunächstsoziale – Strukturen als BeziehungsundHandlungsnetze verstandenund modellhaft dargestellt werdenkönnen und sollen. Die manifestenErscheinungen der Welt seien Ein-Abb. 7: Kalkriese/Niedersachsen/Deutschland: Museum Varusschlacht 2002.Arch.: Annette Gigon & Mike Guyer Foto: A. <strong>Dworsky</strong>57
58Regionale Baukultur, BHU 2010der Architektur des Ortes widmen. Die architektonischeFassung des genius loci wird auch kritischer Regionalismusgenannt.Der alternative Blick(1968 bis heute)Die 1968er Kritik erschöpfte sich nicht nur in einerStudentenrevolte gegen das postfaschistische Establishmentdes Wirtschaftswunders, sondern markiertauch den Beginn eines „grünen“ Umdenkens: DieGrenzen des Wachstums werden bewusst, der Kollapsbestehender ökologischer und ökonomischerSysteme wird prophezeit, ein radikales Umschwenken-Umdenkengefordert. Die traditionell bewirtschafteteund besiedelte Kulturlandschaft wird alserfolgreiches und im Wesentlichen nachhaltiges Systembetrachtet. Nicht die effizientere Ausbeutungvon Umwelt und Menschen, sondern die nachhaltigeVerfeinerung sollte sozialen und technologischenEntwicklungen zum Ziel gesetzt werden. Neue regionale,solidarische Ökonomien und Kulturen sindzu fördern. Diese umfassenden Forderungen wirktdirekt auf planerische und gestalterische Programme:Ökophile Wirtschaftskonzepte, Beschränkungauf regionale erneuerbare Energieträger und Baustoffe,intelligente Verkehrssysteme, autonome bzw.angepasste Umwelttechnologien, Baubiologie, aberauch grenzwissenschaftliche Konzepte von Raumund Landschaft wie Geomantie, Radiästhesie, FengShui, ... 4Abb. 8: Egebjerg/Ballerup/Kopenhagen/Dänemark: Zoomorphes Künstlerhaus um1995 Foto: A. <strong>Dworsky</strong>Ausblick: Urnäsch(2008)Die Schweizer/Appenzeller GemeindeUrnäsch war nach demNiedergang der regionalen Textilindustrieauf den agrarischen Sektorzurückgeworfen und suchteneue Zusatzökonomien, klugerweiseaus der Inwertsetzung lokalerRessourcen. Für die schweizerischeReisekasse REKA, eine soli darökonomischeOrganisation, wurde2006 bis 2008 von der ArchitektengemeinschaftGnaiger, Dietrich,Untertrifaller geplant, eine Feriensiedlungerrichtet. Die Finanzierungdes gemeinnützigen Projekts warauf wenig Eigenmitteln, Sachmittelder Gemeinde (Bauholz), Zuschüsseund unrentierliche Bürgerbeteiligungenaufgebaut. Das Konstruktions-und Ausbauholz kam aus demlokalen Umkreis. Durch traditionsorientierte,aber innovative Holz-<strong>Alfons</strong> <strong>Dworsky</strong>: Raummodelle im Wandel1 KÜHN, M. (2000): Vom Ring zumNetz? Siedlungsstrukturelle Modellezum Verhältnis von Großstadt undLandschaft in der Stadtregion. – In:DISP 143. – Zürich.WEBER, G. (2010): Der ländlicheRaum – Mythen und Fakten. In:„Ländlicher Raum“ Online-Fachzeitschriftdes Bundesministeriums fürLand- und Forstwirtschaft, Umweltund Wasserwirtschaft.2 Liste der größten Metropolregionen:http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Metropolregionen_der_WeltAbb. 9: Urnäsch/Appenzell/Schweiz ReKa Feriensiedlung 2005.Arch.: Gnaiger, Dietrich, Untertrifaller Foto: A. <strong>Dworsky</strong>verwendung konnte auf Leimungen und Behandlungenvöllig verzichtet werden. Die Siedlungstypologieentspricht der traditionellen Raumfügung im alpinenBereich, auf formale Folklorismen wurde völlig verzichtet,die Detailkultur und Sorgfalt der Ausführunghält dem Vergleich mit den historischen Appenzellerhäusernstand, zugleich wurde ein Minergiestandarderreicht. Ein Referenzprojekt für Nachhaltigkeit undregionale Baukultur. Die typische Melange aller fürdas Gelingen des Projektes notwendigen Bedingungenund Blickrichtungen war vermutlich nur im RaumOstschweiz-Vorarlberg vorhanden; ein Beispiel neuerregionaler Baukultur.Anmerkungen, Hinweise und QuellenAuf eine umfassende Darlegung von Standardwerkenwurde verzichtet, nur einige weniger bekannteweiterführende Hinweise, insbesondere zu empfehlenswerten,derzeit im Netz verfügbaren Arbeitensollen zur Vertiefung anregen.3 RUDOFSKY, B. (1987): ArchitectureWithout Architects. A Short Introductionto Non-Pedigreed Architecture.– New Mexico.RAINER, R. (1961): Anonymes Bauen im Nordburgenland.– Salzburg.ACHLEITNER, F. (2001): Region, ein Konstrukt? Regionalismus,eine Pleite? – Basel.LAMPUGNANI, V. M. (Hrsg.) (2000): Die Architektur, dieTradition und der Ort. Regionalismen in der europäischenStadt. – Stuttgart, München.COLANTONIO-VENTURELLI, R. (Hrsg.) (2004): La cultura delpaesaggio, le sue origini, la situazione attuale e le prospettivefuture. – Menaggio.http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5055/pdf/I_paesaggi.pdfOMBELLINI, S. (2009): Tradizione vs Immaginazione.Architettura contemporanea nell‘area alpina. – Parma.http://dspace-unipr.cilea.it/handle/1889/10484 Österreichisches Institut für Baubiologie und Bauökologie:Unter der Rubrik „Forschungsberichte“ stehenderzeit einige empfehlenswerte Arbeiten als Downloadzur Verfügung, z. B.: Baubiologie – Grenzwissenschaften:http://www.ibo.at/de/publikationen/buecher.htm 59