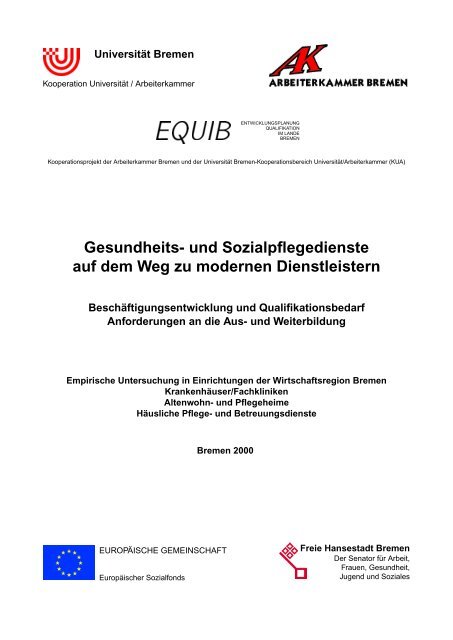Gesundheits- und Sozialpflegedienste auf dem Weg zu modernen ...
Gesundheits- und Sozialpflegedienste auf dem Weg zu modernen ...
Gesundheits- und Sozialpflegedienste auf dem Weg zu modernen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� Universität<br />
Bremen<br />
Kooperation Universität / Arbeiterkammer<br />
�����<br />
ENTWICKLUNGSPLANUNG<br />
QUALIFIKATION<br />
IM LANDE<br />
BREMEN<br />
Kooperationsprojekt der Arbeiterkammer Bremen <strong>und</strong> der Universität Bremen-Kooperationsbereich Universität/Arbeiterkammer (KUA)<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
<strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zu</strong> <strong>modernen</strong> Dienstleistern<br />
Beschäftigungsentwicklung <strong>und</strong> Qualifikationsbedarf<br />
Anforderungen an die Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Empirische Untersuchung in Einrichtungen der Wirtschaftsregion Bremen<br />
Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
Häusliche Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste<br />
Bremen 2000<br />
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT<br />
Europäischer Sozialfonds<br />
Freie Hansestadt Bremen<br />
Der Senator für Arbeit,<br />
Frauen, Ges<strong>und</strong>heit,<br />
Jugend <strong>und</strong> Soziales
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
<strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zu</strong> <strong>modernen</strong> Dienstleistern<br />
Beschäftigungsentwicklung <strong>und</strong> Qualifikationsbedarf<br />
Anforderungen an die Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Empirische Untersuchung in Einrichtungen der Wirtschaftsregion Bremen<br />
Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
Häusliche Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste<br />
Bremen 2000<br />
Ulf Benedix, Jutta Knuth, Gerlinde Hammer, Erich Wachtveitl<br />
Fachliche Beratung <strong>und</strong> Mitarbeit:<br />
Christoph Hübner: baw - Büro für Arbeitswissenschaften <strong>und</strong> Weiterbildung, Dortm<strong>und</strong><br />
Das Projekt EQUIB wird im Auftrag des Senators für Arbeit, Frauen, Ges<strong>und</strong>heit, Jugend <strong>und</strong> Soziales durchgeführt <strong>und</strong> aus<br />
Landesmitteln sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.<br />
An der Projektdurchführung beteiligen sich als Kooperationspartner die Arbeiterkammer Bremen <strong>und</strong> die Universität Bremen –<br />
Kooperationsbereich Universität/Arbeiterkammer (KUA).
Inhaltsverzeichnis<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Zusammenfassung <strong>und</strong> Übersicht über wichtige Ergebnisse der Untersuchung .. III<br />
0. Einleitung....................................................................................................................1<br />
1. Einführung in die Untersuchung .............................................................................. 5<br />
1.1 Zum Strukturwandel im Humandienstleistungsbereich.......................................... 5<br />
1.2 Aufgabenverlagerung <strong>und</strong> neue Qualifikationsanforderungen............................... 7<br />
1.3 Schwerpunkte <strong>zu</strong>kunftsorientierter Pflegekompetenzen ........................................ 9<br />
2. Empirisches Informations- <strong>und</strong> Erhebungsnetz ................................................... 11<br />
2.1 Ermittlung der Gr<strong>und</strong>gesamtheit........................................................................... 11<br />
2.2 Zur Struktur des eingesetzten Fragebogens .......................................................... 12<br />
2.3 Der Rückl<strong>auf</strong> der postalischen Befragung ............................................................ 12<br />
2.4 Ergänzende Experteninterviews <strong>und</strong> deren Themenschwerpunkte ...................... 13<br />
3. Struktur der Pflegeeinrichtungen........................................................................... 15<br />
3.1 Zusammenset<strong>zu</strong>ng des Samples nach Einrichtungsarten...................................... 15<br />
3.2 Die Organisationsformen der Einrichtungen ........................................................ 15<br />
3.3 Verteilung der Pflegeleistungen differenziert nach Einrichtungsarten................. 17<br />
4. Personalstruktur <strong>und</strong> -entwicklung bei den <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Sozialpflegedienste</strong>n ................................................................................................. 21<br />
4.1 Der <strong>zu</strong>künftige Bedarf an Pflegepersonal nach Einrichtungsarten....................... 22<br />
4.2 Der geschätzte <strong>zu</strong>künftige Bedarf differenziert nach Qualifikationsstufen.......... 23<br />
4.3 Deckung des Arbeitskräftebedarfs über den regionalen Arbeitsmarkt................. 26<br />
4.4 Hindernisse bei Neueinstellungen......................................................................... 29<br />
4.5 Rekrutierungsstrategien für geplante Neueinstellungen ....................................... 30<br />
5. Organisationsstrukturelle Entwicklung................................................................. 31<br />
5.1 Qualitätssicherung................................................................................................. 31<br />
5.2 Die Bedeutung von Managementaktivitäten in Be<strong>zu</strong>g <strong>auf</strong> Arbeits-, <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong><strong>und</strong><br />
Umweltschutz (Integrierte Managementsysteme) ......................................... 33<br />
5.3 Bedeutung <strong>und</strong> Präferenzen der technologischen Innovationen<br />
im Pflegebereich ................................................................................................... 34<br />
5.3.1 Rangskala technologischer Innovationen im Pflegebereich insgesamt ......... 35<br />
5.3.2 Die Präferenzen technologischer Innovationen nach Einrichtungsarten ....... 36<br />
5.3.3 Ergän<strong>zu</strong>ngen <strong>zu</strong>m Einsatz neuer Technologien in der Pflege ....................... 37<br />
5.4 Die Veränderungen in der Arbeits- <strong>und</strong> Abl<strong>auf</strong>organisation................................ 39<br />
6. Die Entwicklung des Qualifikationsbedarfs .......................................................... 43<br />
6.1 Zur Methodik der Qualifikationsbedarfsanalyse .................................................. 43<br />
6.2 Qualifikationsbedarf insgesamt für alle Einrichtungsarten................................... 46<br />
6.3 Qualifikationsbedarf in der stationären Krankenpflege:<br />
Krankenhäuser/Fachkliniken ................................................................................ 49<br />
6.4 Qualifikationsbedarf in der stationären Altenpflege: Altenwohn<strong>und</strong><br />
Pflegeheime.................................................................................................... 52<br />
I
EQUIB<br />
6.5 Qualifikationsbedarf in der ambulanten Pflege: Häusliche Pflege- <strong>und</strong><br />
Betreuungsdienste................................................................................................. 55<br />
6.6 Fazit <strong>und</strong> Empfehlungen....................................................................................... 58<br />
6.7 Strategien der Qualifikationsbedarfsdeckung in den Einrichtungen .................... 64<br />
7. Entwicklungstendenzen der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung.......................................... 67<br />
7.1 Neue integrierte Bildungsansätze <strong>zu</strong>r Professionalisierung der Pflegeberufe <strong>und</strong><br />
Ansätze der Verschmel<strong>zu</strong>ng der Berufe in der Pflegepraxis ................................ 68<br />
7.2 Zum Problem der Arbeitsplatzsicherung <strong>auf</strong>gr<strong>und</strong> <strong>zu</strong>nehmender<br />
„Aka<strong>dem</strong>isierung“ der gehobenen Pflegeausbildung ........................................... 69<br />
7.3 Spezifische Probleme der Weiterbildungspraxis .................................................. 70<br />
7.4 Pflegeüberleitung als eigenständiger Dienst in den<br />
Krankenhäusern/Fachkliniken .............................................................................. 72<br />
Anhang........................................................................................................................... 77<br />
II<br />
Literatur.......................................................................................................................77<br />
Abbildungsverzeichnis................................................................................................ 79<br />
Tabellenverzeichnis .................................................................................................... 79<br />
Projekt EQUIB............................................................................................................ 80<br />
Von EQUIB verwendete Methoden <strong>zu</strong>r Erhebung des <strong>zu</strong>künftigen<br />
Qualifikationsbedarfs............................................................................................ 81<br />
Liste der EQUIB-Veröffentlichungen......................................................................... 88
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Zusammenfassung <strong>und</strong> Übersicht über wichtige Ergebnisse der Untersuchung<br />
1. Gesellschaftspolitische Strukturbedingungen der Untersuchung<br />
Im b<strong>und</strong>esdeutschen <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesen ist seit Jahren ein struktureller Veränderungssprozess<br />
<strong>zu</strong> beobachten, der nach einer Phase der Expansion, Spezialisierung<br />
<strong>und</strong> Technisierung dieses Sektors nun eher <strong>auf</strong> strukturelle <strong>und</strong> qualitative Veränderungen<br />
fokussiert ist.<br />
Die beginnende Umstrukturierung der Krankenhäuser <strong>zu</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>zentren, die<br />
Schaffung von regionalen Netzwerken für integrierte <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>leistungen <strong>und</strong> die<br />
Verringerung der Anzahl der Krankenhäuser evozieren in <strong>zu</strong>nehmen<strong>dem</strong> Maße integrative<br />
multifunktionale Versorgungsstrukturen. Es entstehen Einrichtungen, die eine Erweiterung<br />
des Dienstleistungsangebots <strong>zu</strong> <strong>modernen</strong> integrierten <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>dienstleistern<br />
vorantreiben.<br />
Dabei stellen die Patienten als K<strong>und</strong>en medizinisch-pflegerischer Dienstleistungen gestiegene<br />
Ansprüche an die Qualität der medizinischen <strong>und</strong> pflegerischen Versorgung,<br />
die die Entwicklung neuer Pflegekonzepte, die Anwendung neuer Technologien sowie<br />
moderner Arbeits- <strong>und</strong> Kooperationsbeziehungen in <strong>und</strong> zwischen den Pflegeeinrichtungen<br />
erfordern.<br />
Eine sich abzeichnende Tendenz <strong>zu</strong>r Einrichtung von selbständig wirtschaftenden Abteilungen<br />
in den Krankenhäusern, sog. Profit-Center, eine beginnende Enthierarchisierung<br />
der Krankenhausorganisation <strong>und</strong> die Zunahme interdisziplinärer Arbeit <strong>und</strong> projektorientierter<br />
Arbeitsstrukturen führen auch <strong>zu</strong> einer Ausweitung von administrativen<br />
<strong>und</strong> betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten <strong>auf</strong> Seiten des Pflegepersonals <strong>und</strong> nicht nur<br />
bei den Leitungsfunktionen.<br />
K<strong>und</strong>enorientierung <strong>und</strong> Qualität der Pflegeleistungen bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit<br />
sind u.a. auch die Kriterien, an denen sich im Zuge der skizzierten Entwicklung<br />
ebenfalls Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime wie die seit Inkrafttreten der Pflegeversicherung<br />
anwachsende Anzahl der ambulanten Pflegedienste messen müssen.<br />
In der berufsbildungspolitischen Diskussion überwiegen gegenwärtig Bildungskonzepte,<br />
die die Vereinheitlichung <strong>und</strong> Zusammenfassung einzelner Berufsfelder favorisieren.<br />
Angestrebt wird eine integrierte Pflegeausbildung <strong>zu</strong>r „Pflegefachkraft“ im Berufsfeld<br />
Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales. Der Einigungsprozess der einzelnen Interessenvertretungen<br />
<strong>und</strong> Instanzen ist z.Z. noch nicht abgeschlossen.<br />
Für die <strong>zu</strong>künftige Professionalisierung der Pflege werden auch für den Fort- <strong>und</strong> Weiterbildungsbereich<br />
Strukturen angestrebt, die gezielt <strong>auf</strong> die neuen Anforderungen fach<strong>und</strong><br />
arbeitsfeldbezogen sowie funktionsbezogen vorbereiten. Hier wird insbesondere der<br />
Ausbau bzw. die Neuschaffung von Bildungsmöglichkeiten mit <strong>auf</strong>stiegsbezogener<br />
Relevanz angestrebt.<br />
III
EQUIB<br />
Im Kontext dieser Entwicklung ist die vorliegende Studie von EQUIB (Entwicklungsplanung-Qualifikation-Industrieregion<br />
Bremen) <strong>zu</strong> sehen. Im Auftrag des Senators für<br />
Arbeit, Frauen, Ges<strong>und</strong>heit, Jugend <strong>und</strong> Soziales wird eine regionalspezifische Repräsentativerhebung<br />
aller regionalen Anbieter der „<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong>“<br />
vorgelegt, die folgende Schwerpunkte hat:<br />
• Beschäftigungsstruktur <strong>und</strong> –entwicklung der Pflegeberufe im Lande Bremen,<br />
• technologische <strong>und</strong> arbeitsorganisatorische Innovationsentwicklung in den Einrichtungen<br />
der stationären Kranken- <strong>und</strong> Altenpflege sowie der häuslichen Pflege,<br />
• qualitativ <strong>und</strong> quantitativ ermittelte <strong>und</strong> nach Einrichtungsart differenzierte Qualifikationsbedarfe<br />
einschließlich der gewählten Bedarfsdeckungsstrategien sowie Anforderungen<br />
an die berufliche Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung.<br />
2. Das Untersuchungsfeld<br />
Die Gr<strong>und</strong>gesamtheit der Repräsentativuntersuchung bilden alle Anbieter ambulanter<br />
<strong>und</strong> stationärer <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflege in Bremen <strong>und</strong> Bremerhaven. Da<strong>zu</strong> gehören<br />
die Krankenhäuser sowie die Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime für die überwiegend<br />
stationäre Versorgung <strong>und</strong> die häuslichen Krankenpflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste für<br />
den ambulanten Pflegebereich.<br />
Als Resultat einer Vorermittlung wurde der Fragebogen im 2. Quartal 1999 an die bereinigte<br />
Gr<strong>und</strong>gesamtheit von insgesamt 203 Einrichtungen versandt.<br />
Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
gesamt: 15 Einrichtungen<br />
Bremen: 12 Einrichtungen<br />
Bremerhaven: 3 Einrichtungen<br />
Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
gesamt: 73 Einrichtungen<br />
Bremen: 63 Einrichtungen<br />
Bremerhaven: 10 Einrichtungen<br />
Ambulante häusliche Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste<br />
gesamt: 115 Einrichtungen<br />
Bremen: 91 Einrichtungen<br />
Bremerhaven: 24 Einrichtungen<br />
Das Ergebnis der postalischen Befragung ist ein Rückl<strong>auf</strong> aus insgesamt 94 Einrichtungen.<br />
Dies entspricht einer Rückl<strong>auf</strong>quote von 46% <strong>und</strong> weist <strong>auf</strong> eine hohe Akzeptanz<br />
des Untersuchungsvorhabens bei den Diensteanbietern hin.<br />
Zur Absicherung bzw. qualitativen Ergän<strong>zu</strong>ng der Repräsentativdaten wurden umfangreiche<br />
leitfadengestützte Interviews mit Experten aus Institutionen <strong>und</strong> Pflegeeinrichtungen<br />
durchgeführt. Es sollten persönliche Erfahrungen <strong>und</strong> Ansichten, die sowohl aus<br />
<strong>dem</strong> unmittelbaren Funktionsbereich aber auch aus internem Expertenwissen in Be<strong>zu</strong>g<br />
<strong>auf</strong> die allgemeine Situation <strong>und</strong> Entwicklung des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegebereichs<br />
resultieren, ermittelt werden.<br />
IV
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Im Einzelnen wurden folgende Schwerpunkte thematisiert:<br />
• zentrale Entwicklungstrends des Strukturwandels aus der Sichtweise des jeweiligen<br />
Experten,<br />
• wesentliche organisationsstrukturelle Veränderungen des gesamten Sektors: Qualitätssicherung,<br />
Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz, Umweltschutz; Veränderungen der<br />
Arbeits- <strong>und</strong> Abl<strong>auf</strong>organisation <strong>auf</strong>gr<strong>und</strong> organisationsstruktureller <strong>und</strong> technologischer<br />
Innovationen,<br />
• Entwicklung der technologischen Innovationen im Pflegebereich <strong>und</strong> ihre Konsequenzen<br />
für die Qualifikationsstrukturen <strong>und</strong> den Qualifikationsbedarf der Einrichtungen,<br />
• allgemeine Entwicklungstendenzen <strong>und</strong> Erfordernisse der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung.<br />
3. Zur Methodik der Qualifikationsbedarfsanalyse<br />
Es wurden drei, für die Einrichtungsarten stationäre Kranken- <strong>und</strong> Altenpflege sowie<br />
häusliche Pflege spezifizierte Fragebögen entwickelt, die sich aus fünf identischen<br />
Gliederungspunkten <strong>auf</strong>bauen.<br />
1. Angaben <strong>zu</strong>r Einrichtung<br />
2. Personalstruktur <strong>und</strong> –entwicklung<br />
3. Organisationsstrukturelle Entwicklung<br />
4. Qualifikationsbedarfe <strong>und</strong> Strategien ihrer Deckung<br />
5. Entwicklungstendenzen der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Die durchgeführte Qualifikationsbedarfsanalyse, die <strong>auf</strong> ermittelten Daten unter Punkt 4<br />
„Qualifikationsbedarfe <strong>und</strong> Strategien ihrer Deckung“ basiert, umfasst fünf Ebenen:<br />
1. Sie erfasst die in den Pflegeberufen <strong>zu</strong> differenzierenden 21 Einzelqualifikationen<br />
nach drei Unterscheidungskriterien:<br />
a) Pfegequalifikationen<br />
• Pflegeplanung/-prozess/-dokumentation<br />
• neue Pflegeverfahren<br />
• geronto-psychiatrische Kompetenz<br />
• Pflegeberatung<br />
• präventive/rehabilitative Beratung<br />
• interkulturelle Pflegekompetenz<br />
b) Überfachliche Qualifikationen<br />
• BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
• Recht<br />
• Organisationsentwicklung<br />
• Personalplanung/-einsatz<br />
• Marketing<br />
• Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologie, Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
• EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
• Qualitätssicherung<br />
V
EQUIB<br />
• Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
• Umweltschutz<br />
c) Schlüsselqualifikationen<br />
• soziale/kommunikative Kompetenz<br />
• Kompetenz für interdisziplinäre Zusammenarbeit (Teamarbeit)<br />
• Verantwortungsbereitschaft<br />
• Gestaltungskompetenz<br />
• Qualitätsbewusstsein<br />
2. Die einzelnen insgesamt 21 Qualifikationselemente werden jeweils <strong>auf</strong> drei Qualifikationsebenen<br />
bezogen, die im Pflegebereich unterschieden werden können:<br />
• Personal in Leitungsfunktionen<br />
• Examinierte Pflegekräfte (3 Jahre)<br />
• Examinierte Pflegekräfte (1 Jahr)<br />
3. Die Ergebnisse werden mit den Daten der einzelnen Einrichtungsarten Kranken-, Alten-<br />
<strong>und</strong> häusliche Pflege korreliert, so dass je nach Einrichtungsart spezifizierte Qualifikations-<br />
<strong>und</strong> Anforderungsprofile gewonnen werden können.<br />
4. Dabei wurde in einem vierten Schritt der unmittelbare Bedarf <strong>und</strong> die Art <strong>und</strong> Weise<br />
seiner Deckung nach den Kriterien „intern“, „extern“, „in- <strong>und</strong> extern“, „offen“ unterschieden.<br />
5. Um die empirischen Ergebnisse <strong>zu</strong> arrondieren, wurden ergänzend <strong>zu</strong>r Repräsentativerhebung<br />
Expertenmeinungen <strong>zu</strong> verschiedenen Schwerpunkten der Thematik eingeholt<br />
<strong>und</strong> in die empirischen Ergebnisse eingearbeitet.<br />
4. Angaben <strong>zu</strong> den Einrichtungen<br />
Bei den Einrichtungsarten setzt sich der Befragungsrückl<strong>auf</strong> wie folgt <strong>zu</strong>sammen:<br />
• 17% der Einrichtungen sind Krankenhäuser/Fachkliniken (16),<br />
• 36% der Einrichtungen sind als Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime der stationären Pflege<br />
<strong>zu</strong><strong>zu</strong>ordnen (34),<br />
• 47% der Einrichtungen sind Anbieter ambulanter häuslicher Pflege <strong>und</strong> Betreuung<br />
(44).<br />
Die Organisationsformen:<br />
Die regionalen Krankenhäuser/Fachkliniken sind <strong>zu</strong> 75% kommunal organisiert.<br />
Bei den Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheimen überwiegt die frei gemeinnützige Organisationsform<br />
mit 67,6%.<br />
Die Anbieter ambulanter häuslicher Pflege- <strong>und</strong> Betreuung sind mit 70,5% überwiegend<br />
privatwirtschaftlich organisiert.<br />
VI
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
5. Personalbedarfsdeckung<br />
Der Bereich der ambulanten Pflege, in <strong>dem</strong> seit der Einführung der Pflegeversicherung<br />
zahlreiche Arbeitsplätze neu geschaffen wurden, bleibt weiterhin <strong>auf</strong> Wachstumskurs,<br />
denn bei den häuslichen Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdiensten wird mit den höchsten Zuwachsraten<br />
für Beschäftigung gerechnet. Die Einrichtungen gehen überwiegend von<br />
einem <strong>zu</strong>nehmenden Bedarf für alle Qualifikationsstufen aus; die höchste Rate ist bei<br />
den examinierten Pflegekräften (3j.) <strong>zu</strong> erwarten.<br />
Auch für den Bereich der Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime prognostizieren die Experten<br />
eine gleichbleibende bis <strong>zu</strong>nehmende Tendenz für Personalbedarf für alle Funktionsebenen<br />
im Pflegebereich. Dies gilt auch für die Anzahl der <strong>zu</strong>künftigen Ausbildungsplätze.<br />
Ganz anders stellt sich das Bild für die Krankenhäuser/Fachkliniken dar. Im Bereich<br />
der stationären Krankenpflege gehen die befragten Experten überwiegend von <strong>zu</strong>künftig<br />
geringerem Personalbestand aus. Dies ist nicht <strong>zu</strong>letzt eine Konsequenz der bisherigen<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>reformen, die u.a. <strong>zu</strong> Zentralisations- <strong>und</strong> Konzentrationsprozessen in den<br />
Krankenhäusern/Fachkliniken <strong>und</strong> damit <strong>zu</strong> Arbeitsplatzabbau geführt haben. Es ist<br />
damit <strong>zu</strong> rechnen, dass sich diese Tendenz auch <strong>zu</strong>künftig weiter fortsetzen wird. Ein<br />
Teil des im Krankenhausbereich freigesetzten Personals wird sicherlich in den Bereich<br />
der häuslichen Pflege <strong>und</strong> der stationären Altenpflege überwechseln. Die damit verb<strong>und</strong>enen<br />
neuen bzw. erweiterten Aufgaben- <strong>und</strong> Anforderungsprofile werden Anpassungsqualifizierungen<br />
notwendig machen.<br />
Deckung des Arbeitskräftebedarfs über den regionalen Arbeitsmarkt<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
im Wesentlichen keine Rekrutierungsprobleme für Neueinstellungen über den regionalen<br />
Arbeitsmarkt sehen.<br />
Im Bereich der stationären Altenpflege ergibt sich aber ein etwas differenzierteres<br />
Bild. Nur für die Qualifikationsstufe der examinierten Fachkräfte (1j.) hält der regionale<br />
Arbeitsmarkt ein ausreichendes Angebot vor. Bei der Suche nach Personal für Leitungsfunktionen<br />
<strong>und</strong> examinierten Pflegekräften (3j.) stoßen die Einrichtungen überwiegend<br />
<strong>auf</strong> Schwierigkeiten.<br />
Noch problematischer ist die Situation für die häuslichen Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste.<br />
Für die gehobenen Qualifikationsstufen finden sie nur <strong>zu</strong> etwa einem Drittel<br />
adäquates Fachpersonal <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> regionalen Arbeitsmarkt vor. In diesem Ergebnis reflektiert<br />
sich der Umstand, dass der Pflegezweig der häuslichen Pflege eine noch relativ<br />
junge <strong>und</strong> <strong>zu</strong><strong>dem</strong> wachsende Disziplin ist, so dass der Arbeitsmarkt einer entsprechenden<br />
quantitativen Nachfrage nach qualitativ ausgewiesenem Pflegepersonal für diesen<br />
Bereich (noch) nicht mit einem ausreichenden Personalangebot begegnen kann.<br />
VII
EQUIB<br />
Fazit: Krankenhäuser bauen <strong>auf</strong> allen Qualifikationsstufen perspektivisch eher Personal<br />
ab. Die größte Arbeitsplatz<strong>zu</strong>wachsrate in den nächsten Jahren bezüglich des gesamten<br />
Pflegebereichs ist in der häuslichen Pflege <strong>zu</strong> erwarten. Die Altenpflege nimmt in diesem<br />
Vergleich einen mittleren Platz ein. Den Qualifikationsbereich mit der erwarteten<br />
größten Zuwachsrate stellt die examinierte Pflegekraft mit dreijähriger Ausbildung dar.<br />
6. Organisationsstrukturelle Entwicklung<br />
Qualitätssicherung<br />
Gemäß <strong>dem</strong> in der Pflegebranche mittlerweile durchgesetzten Leitsatz: „Wir sind der<br />
Qualität verpflichtet“, womit ein konsequentes Qualitätsmanagement praktiziert werden<br />
soll, wird der K<strong>und</strong>e in den Mittelpunkt der angebotenen Dienstleistung gestellt.<br />
Ebenso stellen Bestimmungen des SGB XI den Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt<br />
der Leistungserbringung <strong>und</strong> stärken dessen Position. Dabei sieht sich der Leistungsanbieter<br />
mit neuen Anforderungen hinsichtlich seiner Leistungsqualität in Richtung einer<br />
Kopplung der Versorgungsverträge an die Erfüllung von Leistungsbeschreibungen nach<br />
Art, Umfang, Inhalt (siehe § 93ff BSHG/ § 80 SGB Xl) konfrontiert. Die Gewähr für<br />
eine angemessene Leistung in den Einrichtungen wird von den Kostenträgern <strong>zu</strong>künftig<br />
weniger über die Steuerung von finanziellen Mitteln <strong>zu</strong>r Leistungserbringung erreicht<br />
als über den <strong>Weg</strong> der Einforderung einer kontinuierlichen Qualitätssicherung durch das<br />
Qualitätsmanagement der Leistungsanbieter.<br />
Dieser Sachverhalt wird durch die Untersuchung bestätigt: Über 90% aller von EQUIB<br />
befragten Einrichtungen betreiben Qualitätssicherung <strong>und</strong> zwar fast <strong>zu</strong> gleichen Teilen<br />
nach den befragten Methoden DIN ISO 9000 ff., EFQM, Gütesiegel mit einem leichten<br />
Übergewicht bei DIN ISO 9000 ff.<br />
Auf die Beachtung der Prinzipien eines ausgewiesenen Qualitätsmanagements wird<br />
Wert gelegt. Dabei werden äußerst unterschiedliche Ansätze für ein Qualitätsmanagement<br />
in den Einrichtungen praktiziert, wobei Qualitätsbe<strong>auf</strong>tragte <strong>und</strong> die Implementation<br />
von Qualitätszirkeln, vor allem im Sinne praxisnaher Lösungen, eine große Rolle<br />
spielen.<br />
In Krankenhäusern wird das Instrument „Supervision“ deutlich öfter eingesetzt als bei<br />
der Alten- <strong>und</strong> der häuslichen Pflege. Für die übrigen Kriterien wie Pflegeleitbild, Pflegestandards,<br />
Controlling gilt, dass sie für alle Einrichtungsarten eine nahe<strong>zu</strong> gleich<br />
große praktische Bedeutung haben.<br />
Die Bedarfsbef<strong>und</strong>e dieser Untersuchung bestätigen <strong>auf</strong> der Ebene der Gewichtung der<br />
Anforderungen „Qualitätsbewusstsein <strong>und</strong> –sicherung“ diesen Trend. Die Einrichtungen<br />
reagieren <strong>auf</strong> die öffentliche Vorgabe von Qualitätsmaßstäben durch eigene Qualifizierungsanstrengungen,<br />
wobei sie auch <strong>auf</strong> die Dienstleistungen externer Qualitätssicherungs-<br />
<strong>und</strong> Zertifizierungseinrichtungen <strong>zu</strong>rückgreifen.<br />
VIII
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Integrierte Managementaktivitäten<br />
Im Zuge einer wachsenden Orientierung des Pflegemanagements an allgemeingültigen<br />
Pflegequalitätsstandards, die in der beruflichen Praxis entwickelt, umgesetzt <strong>und</strong> gesichert<br />
werden müssen, rücken weitere Schutzbereiche in den Managementhorizont der<br />
Pflegeleitungen. Hier<strong>zu</strong> gehören der Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz sowie der Umweltschutz.<br />
Als Bestandteile eines integrierten Managementverständnisses sollen betriebliche<br />
Maßnahmen <strong>auf</strong> diesen Gebieten nicht nur gesetzlichen Auflagen <strong>und</strong> den<br />
Schutzbestimmungen von EU-Richtlinien Genüge leisten, sondern insgesamt der Aktivierung<br />
einer qualitätsorientierten <strong>und</strong> ganzheitlichen Pflegepraxis dienen. Hervor<strong>zu</strong>heben<br />
sind die außerordentlich hohen Prozentangaben in diesen Bereichen (ca. 70 – 95%).<br />
Vor allem der Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz wird von allen drei Einrichtungsarten<br />
sehr hoch bewertet (im Durchschnitt zwischen 83% <strong>und</strong> 100%). Die Qualifikationsbedarfsanalyse<br />
bestätigt diese hohe Wertschät<strong>zu</strong>ng qualifikationsseitig, d.h. dass für dieses<br />
Qualifikationssegment mit die höchsten Bedarfsmeldungen abgegeben wurden.<br />
Technologische Präferenzen<br />
Im Pflegesektor entwickeln sich neue Technologien mit <strong>dem</strong> Schwerpunkt IuK-Technologie/Netzwerke/EDV,<br />
wobei auch bei der Implementation moderner Pflegetechnik<br />
ein Innovationsprozess <strong>zu</strong> beobachten ist. Schwerpunkte liegen bei der Pflegedokumentation<br />
wie auch in der interinstitutionellen Netzwerkorientierung, die langfristig <strong>zu</strong><br />
einem Integrations- <strong>und</strong> Kooperationsprozess verschiedener Pflegeeinrichtungsarten<br />
<strong>und</strong> –tätigkeitsstrukturen, vor allem im Bereich der Schnittstellen zwischen stationären<br />
<strong>und</strong> ambulanten Pflegedienstleistungen, führen wird.<br />
Die sich abzeichnende <strong>zu</strong>nehmende „Technologisierung“ des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegesektors<br />
ist bedeutsam für die künftige Entwicklung dieser Branche, weil sich in<br />
dieser Entwicklungstendenz neue Qualifikationsperspektiven, arbeitsorganisatorische<br />
Innovationen <strong>und</strong> möglicherweise künftig erhebliche Rationalisierungspotenziale im<br />
Pflegebereich dokumentieren.<br />
Veränderungen der Arbeitsorganisation<br />
Neue Arbeitsorganisationskonzepte, wie sie im Zuge der öffentlich <strong>und</strong> politisch geforderten<br />
Reorganisation des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>sektors induziert werden, verknüpfen technologische<br />
Innovation vor allem im Bereich der Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik<br />
mit organisatorischen Veränderungen. Diese sind durch Privatisierungs- <strong>und</strong> Kommerzialisierungstendenzen<br />
gekennzeichnet, so dass man heut<strong>zu</strong>tage auch im Pflegesektor<br />
von einer Tendenz <strong>zu</strong> in sich geschlossenen Organisations- <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeitskonzepten<br />
spricht (Profitcenter), die mit der Forderung nach größerer Flexibilität <strong>und</strong> Aufgabenorientierung<br />
korrespondiert.<br />
In der Repräsentativerhebung wurden die Einrichtungen <strong>zu</strong> diesem Thema nach<br />
folgenden Unterscheidungskriterien befragt:<br />
• Tendenz <strong>zu</strong> selbständigen Untereinheiten<br />
• Abteilungen mit eigener Budgetverantwortung<br />
• organisatorische Dezentralisierung<br />
IX
EQUIB<br />
• Schnittstellen für stationäre/ambulante Pflege<br />
• Arbeit in Kooperationsmodellen mit anderen Diensteanbietern<br />
• Care-Management (individuelle Zuschneidung von Leistungen)<br />
• Ansätze interdisziplinärer Teamarbeit<br />
Die Krankenhäuser weisen deutlicher als die anderen Abteilungen eine arbeitsorganisatorisch<br />
innovative Orientierung <strong>auf</strong>. Die Bedeutung von vier Kriterien, Teamarbeit,<br />
Care-Management, Schnittstellen stationär-ambulanter Pflege <strong>und</strong> Abteilungen mit<br />
Budgetverantwortung, wird für den Krankenhaussektor mit 100% angegeben. Eine<br />
Tendenz <strong>zu</strong>r organisatorischen Dezentralisierung <strong>und</strong> <strong>zu</strong>r Schaffung autonomer institutioneller<br />
Subeinheiten mit Budgetverantwortung <strong>und</strong> erweiterter Handlungskompetenz<br />
ist unverkennbar. Dabei scheint sich in der Entwicklung pflegerischer Tätigkeitsstrukturen<br />
ein Trend <strong>zu</strong> kooperativen <strong>und</strong> teamförmigen Arbeits<strong>zu</strong>sammenhängen <strong>zu</strong> bestätigen,<br />
wie er aus <strong>dem</strong> industriellen Arbeitssektor oder aus bestimmten Entwicklungsströmungen<br />
im Verwaltungssektor inzwischen geläufig ist. Doch auch die restlichen abgefragten<br />
innovativen arbeitsorganisatorischen Kriterien erreichen im Schnitt Werte über<br />
70%.<br />
Die arbeitsorganisatorischen Entwicklungen in der häuslichen Pflege <strong>und</strong> in der stationären<br />
Altenpflege zeigen die gleiche Richtung an. In der häuslichen Pflege sind Kooperations-<br />
<strong>und</strong> Schnittstellenmodelle <strong>und</strong> damit der Aufbau von interdisziplinärer<br />
Teamarbeit schon weiter fortgeschritten als bei der Altenpflege.<br />
Die <strong>auf</strong>gezeigten organisationsstrukturellen Entwicklungen haben Auswirkungen <strong>auf</strong><br />
das Berufsbild der Pflege. Der Pflegeberuf wird in je<strong>dem</strong> Falle durch die Informations-<br />
<strong>und</strong> Kommunikationstechnologie, Management <strong>und</strong> Controlling komplexer werden,<br />
da sich die Informationsverarbeitung von der Dateneingabe bis <strong>zu</strong>r Interpretation<br />
ohne pflegerisch-medizinisches Fachwissen schwerlich erschließen läßt. Die Abteilungspflegeleitung<br />
muss neben pflegerisch-fachlichen Aufgaben neue Funktionen erfüllen:<br />
Personalentwicklungsplanung, Marketing für das spezifische Patientensegment<br />
der Abteilung, Qualitätssicherung, Controlling, Koordination mit anderen Berufsgruppen<br />
<strong>und</strong> anderen Einrichtungen. Bei der Erfüllung dieser Management<strong>auf</strong>gaben wird,<br />
neben kommunikativer <strong>und</strong> fachlicher Kompetenz, insbesondere ein kompetenter Umgang<br />
mit der Informationstechnologie <strong>zu</strong> einer Schlüsselqualifikation („Medienkompetenz“)<br />
werden.<br />
7. Zusammenfassung der Qualifikationsbedarfstrends für alle Einrichtungsarten<br />
Als erstes sind die durchweg hohen Qualifikationsbedarfsmeldungen aller untersuchten<br />
Einrichtungen der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong> hervor<strong>zu</strong>heben.<br />
Die technischen <strong>und</strong> organisationsstrukturellen Veränderungen (vgl. Kap. 5) in dieser<br />
Branche stellen notwendigerweise neue Arbeits- <strong>und</strong> Aufgabenanforderungen an die<br />
Beschäftigten aller Hierarchiestufen. Ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Qualifikationsbedarfsanalyse<br />
ist, dass die Verantwortlichen erkannt haben, dass die Umstrukturierung<br />
der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong> <strong>zu</strong> <strong>modernen</strong> Dienstleistern einer<br />
qualifikatorischen Flankierung <strong>auf</strong> Seiten der Humanressourcen bedarf.<br />
X
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
• Qualifizierungsbedarf für Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Auffallend sind die z.T. fast 100%igen Bedarfsmeldungen für dieses Qualifizierungssegment,<br />
die quer durch alle Einrichtungen <strong>und</strong> für alle Qualifikationsebenen angegeben<br />
werden.<br />
Diese Bedarfsmeldungen dürften sich einmal aus <strong>dem</strong> Arbeitsschutzgesetz ergeben, das<br />
für Ende 1999 die letzte Frist für die Durchführung von arbeitsplatzbezogenen Gefährdungsanalysen,<br />
die eine Unterweisung/Unterrichtung der Mitarbeiter über potenzielle<br />
ges<strong>und</strong>heitliche Gefährdungen sowie deren Vermeidung miteinschließen, vorsieht.<br />
Zum zweiten steigen die ges<strong>und</strong>heitlichen, körperlichen wie psychischen Belastungen<br />
der in diesem Sektor Beschäftigten als Folge der Entwicklung <strong>zu</strong>m Dienstleistungssektor<br />
in Kombination mit der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>reform <strong>und</strong> der Pflegeversicherung, die mit reduzierten<br />
Budgets qualitäts- <strong>und</strong> k<strong>und</strong>enorientierte Dienstleistungen verlangen, an.<br />
Bemerkenswert ist, dass die Einrichtungen aus diesen beiden Momenten, der rechtlichen<br />
Verpflichtung wie den ges<strong>und</strong>heitlichen Belastungen für die Beschäftigten, den Schluss<br />
gezogen haben, einen Qualifizierungsschwerpunkt im Bereich Arbeitsschutz <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>förderung<br />
<strong>zu</strong> setzen. Konsequent ist die Meldung entsprechender Qualifizierungsbedarfe<br />
für alle Qualifikationsstufen, da Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz nur als<br />
ganzheitlicher Prozess im Unternehmen seine ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Wirkungen entfalten<br />
kann.<br />
Empfehlung: Spezifische <strong>auf</strong> diese <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>dienstleistungseinrichtungen <strong>zu</strong>geschnittene<br />
ganzheitliche Beratungs- <strong>und</strong> Qualifizierungsangebote, z.B. Arbeits- <strong>und</strong><br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutzmanagementsysteme, fehlen in der Region Bremen/Bremerhaven.<br />
Angesichts des hohen gemeldeten Bedarfs der Einrichtungen sollte überlegt werden,<br />
wie <strong>zu</strong> einzelnen Bereichen bestehende Angebote (Stressprävention, Rückenschule<br />
usw.) <strong>zu</strong> einem Gesamtpaket ergänzt <strong>und</strong> eventuell in Modellprojekten <strong>zu</strong>r betrieblichen<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>förderung bei <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong>n durchgeführt werden<br />
könnten.<br />
• Qualifizierungsfeld Umweltschutz<br />
Auch in diesem Bereich finden sich vor allem für das Leitungspersonal aller Einrichtungsarten<br />
sehr hohe Bedarfsmeldungen. Neben rechtlichen Kenntnissen sind Verfahren<br />
der Integration von Umweltschutz<strong>auf</strong>lagen <strong>auf</strong> arbeitsorganisatorischer Ebene <strong>zu</strong> klären.<br />
Beratungsangebote <strong>zu</strong>geschnitten <strong>auf</strong> die Belange (z.B. Gefahrstoff-, Abfallbeseitigung<br />
bei medizinischen Hilfsmitteln, Medikamenten, Desinfektionsmitteln usw.) dieses Sektors<br />
werden nachgefragt.<br />
Empfehlung: Es bietet sich an, den Umweltschutz in Verfahren <strong>und</strong> Systemen <strong>zu</strong>m<br />
Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz <strong>und</strong> Qualitätssicherung <strong>zu</strong> integrieren (Integrierte<br />
Managementsysteme).<br />
XI
EQUIB<br />
• Qualitätssicherung (überfachliche Qualifikation) <strong>und</strong> Qualitätsbewusstsein<br />
(Schlüsselqualifikation)<br />
Als weiteres Qualifikationssegment ist in allen Einrichtungen, wenn auch abgestuft<br />
nach den drei Qualifikationsebenen, die Qualitätssicherung als Implementation eines<br />
abprüfbaren Verfahrens wie als extrafunktionale Kompetenz des Einzelnen <strong>zu</strong> identifizieren.<br />
Zum einen sind diese Qualifikationsbedarfsmeldungen sicherlich begründet in der mit<br />
der Pflegeversicherung festgeschriebenen Verpflichtung, Qualitätssicherung <strong>zu</strong> betreiben;<br />
<strong>zu</strong>m anderen setzen alle Einrichtungen <strong>auf</strong> die Schulung eines Qualitätsbewusstseins<br />
ihrer Mitarbeiter, sehen also die Notwendigkeit, Qualität jeder einzelnen Pflegeleistung<br />
<strong>zu</strong> einem der wichtigsten Kriterien ihres Dienstleistungsangebots <strong>zu</strong> erklären.<br />
Analog <strong>zu</strong> <strong>dem</strong> Qualifikationssegment Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz kann auch hier<br />
nur ein ganzheitlicher Ansatz, der die Einrichtungen als „lernende Unternehmen“ begreift,<br />
<strong>auf</strong> Dauer Erfolg, sprich Durchset<strong>zu</strong>ng <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> Markt der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>diensteanbieter,<br />
versprechen.<br />
Empfehlung: Ausgehend von Forderungen nach Qualitätssicherungsverfahren, die<br />
speziell <strong>auf</strong> die Pflegesituation <strong>zu</strong>geschnitten sind, sollte angesichts der hohen Bedarfsmeldungen<br />
überlegt werden, ob auch hier die unterschiedlichen Angebote <strong>und</strong> Ansätze<br />
in der Region gebündelt <strong>und</strong> <strong>zu</strong> einem solchen einrichtungsspezifischen Modellprojekt<br />
weiterentwickelt werden könnten, das Qualifizierung der Mitarbeiter, Beratung<br />
bei den Schritten der Implementation sowie Hilfestellung bei der Anerkennung/Zertifizierung<br />
kombiniert. Ein Beratungs- <strong>und</strong> Qualifizierungsprojekt für Qualitätssicherung<br />
könnte <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> „Bremer Qualitätssiegel für ambulante Pflegedienste“<br />
beruhen <strong>und</strong> Weiterentwicklungen für andere Bereiche initiieren. Für den Bedarf solcher<br />
spezifischen Qualifizierungs- <strong>und</strong> Beratungsangebote sprechen auch Modellprojekte,<br />
die in anderen Regionen angeregt wurden.<br />
Im Hinblick <strong>auf</strong> die hohen Handlungsbedarfe im Bereich Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>sowie<br />
Umweltschutz ist an die Entwicklung von Schnittstellen des Qualitätsmanagements<br />
<strong>zu</strong> diesen Bereichen bzw. von Integrierten Managementsystemen speziell für<br />
diesen Sektor <strong>zu</strong> denken.<br />
• Qualifizierungsbedarf (nicht nur) für das Leitungspersonal<br />
Für die übrigen überfachlichen Qualifikationen bezogen <strong>auf</strong> die Schwerpunkte<br />
Führungs- <strong>und</strong> Managementkompetenzen (Recht, BWL, Marketing, Personal- <strong>und</strong> Organisationsentwicklung)<br />
wurden durchweg sehr hohe (im Durchschnitt über 85 – 90%)<br />
Bedarfsmeldungen für das Personal in Leitungsfunktionen abgegeben. Dieselbe Aussage<br />
trifft <strong>auf</strong> den Bereich der neuen IuK-Technologien/Netzwerke/EDV <strong>zu</strong>.<br />
Mit <strong>dem</strong> Qualifikationsniveau sinken in der Tendenz auch die angegebenen Bedarfe.<br />
Bemerkenswert ist, dass der Modernisierungs-, Professionalisierungs- <strong>und</strong> Umstrukturierungsprozess<br />
(Stichworte: Dezentralisierung, Profit-Center, K<strong>und</strong>enorientierung,<br />
Prävention, Rehabilitation) des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegesektors von den Verantwortlichen<br />
noch umfangreiche Qualifizierungsanstrengungen <strong>zu</strong> verlangen scheint.<br />
XII
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Empfehlung: Da gerade dieser Sektor eine wichtige Rolle für die Stärkung des regionalen<br />
Dienstleistungssektors spielt, sollte das schon bestehende Angebot in der Region<br />
<strong>auf</strong> seine Bedarfsdeckung hin überprüft werden <strong>und</strong> gegebenenfalls vor allem durch<br />
handlungsorientierte Angebote im Bereich der Personal- <strong>und</strong> Organisationsentwicklung<br />
ergänzt werden; gemeint sind damit Beratungs- <strong>und</strong> Qualifizierungsangebote, die<br />
Theorie <strong>und</strong> direkte einrichtungsspezifische Umset<strong>zu</strong>ngsstrategien (z.B. durch<br />
Coaching) kombinieren.<br />
Zum zweiten ist die Bedeutung der neuen Technologien für den ganzen Sektor unübersehbar;<br />
sie werden alle gewohnten Pflegetätigkeiten sowie Verwaltungs- <strong>und</strong> Organisations<strong>auf</strong>gaben<br />
tangieren. Weiterbildungsangebote hier sollten sich nicht nur <strong>auf</strong> die<br />
Vermittlung technischer Kompetenzen beschränken, sondern auch da<strong>zu</strong> beitragen, die<br />
Einsatzmöglichkeiten hinsichtlich arbeitserleichternder <strong>und</strong> –einsparender technikbasierter<br />
Prozesse <strong>auf</strong><strong>zu</strong>zeigen. Den gerade dieses Wissen – das zeigten auch die Expertengespräche<br />
– ist Vorausset<strong>zu</strong>ng für eine <strong>zu</strong>kunftsweisende <strong>und</strong> wettbewerbsentscheidende<br />
Planung <strong>zu</strong>r Implementation neuer Technologien. Auf diesem Sektor werden –<br />
gerade weil die technischen Möglichkeiten neu <strong>zu</strong> erschließen sind – <strong>zu</strong>r Zeit kontinuierlich<br />
neue Produkte <strong>auf</strong> den Markt gebracht bzw. innovative technologische Projektvorhaben<br />
gestartet.<br />
Die Einrichtungen benötigen Experten, die den Pflegesektor <strong>und</strong> den sich neu entwikkelnden<br />
Pflegetechniksektor kennen, als kompetente Technik-Berater. Zu überlegen<br />
wäre die öffentliche Förderung solcher Experten, die <strong>zu</strong><strong>dem</strong> eine Vernet<strong>zu</strong>ng des ganzen<br />
Sektors vorantreiben könnten.<br />
• Fachspezifischer Qualifizierungsbedarf<br />
Auffallend ist, dass auch in diesem Segment das Personal in Leitungsfunktionen den<br />
höchsten Bedarf anmeldet (im Durchschnitt ähnliche Prozentzahlen um 80 – 90% wie<br />
für die übrigen Qualifikationen). Eine Arbeitsteilung streng nach Leitungs- <strong>und</strong> ausführenden<br />
Arbeiten scheint in diesem Sektor nicht durchgängig ausgeprägt <strong>zu</strong> sein.<br />
Für das dreijährig qualifizierte Pflegepersonal bildet dieses Qualifikationssegment<br />
erwartungsgemäß den Schwerpunkt aller Bedarfsmeldungen. Die neuen fachlichen<br />
Kompetenzen, z.T. durch die Nut<strong>zu</strong>ng neuer IuK-Technologien, z.T. durch die neu <strong>auf</strong><br />
die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>dienstleister <strong>zu</strong>kommenden Aufgaben (z.B. Pflege <strong>zu</strong>nehmend älterer,<br />
oft psychisch kranker Menschen) bestimmt, erfordern breite Qualifizierungsanstrengungen<br />
(im Durchschnitt 80% Angaben). Aber auch hier ist eine abfallende Kurve der Bedarfsmeldungen<br />
für die Helferberufe (wenn auch differenziert in den einzelnen Einrichtungsarten)<br />
<strong>zu</strong> konstatieren.<br />
Empfehlung: Da das Angebot in diesem Segment – <strong>zu</strong>m großen Teil durch interne<br />
Maßnahmen abgedeckt, z.T. durch geförderte Projekte unterstützt – ausreichend erscheint,<br />
kann angesichts der hohen Bedarfsmeldungen nur die Empfehlung gegeben<br />
werden, das Niveau <strong>und</strong> auch die öffentliche Projektförderung <strong>auf</strong>recht<strong>zu</strong>erhalten.<br />
Da auch in anderen deutschen Regionen wie im europäischen Ausland ähnliche Anstrengungen<br />
<strong>zu</strong>r Entwicklung innovativer Qualifizierungsmaßnahmen unternommen<br />
werden, könnte ein Informationsaustausch eventuell <strong>zu</strong> neuen Ideen <strong>und</strong> Synergien für<br />
die hiesige Region führen.<br />
XIII
EQUIB<br />
• Qualifizierungsbedarf für Schlüsselqualifikationen<br />
Für alle Qualifikationsebenen, angeführt vom Leitungspersonal abgestuft bei den Helferberufen,<br />
werden hier im Bereich der extrafunktionalen Kompetenzen Defizite<br />
gesehen. Neue Formen der Arbeitsorganisation, eine Neuausrichtung der Aufgaben hin<br />
<strong>zu</strong>m K<strong>und</strong>en erfordert konsequenterweise – soll die Neudefinition des pflegerischen<br />
Selbstverständnisses <strong>und</strong> neuer Berufsbilder gelingen – neue personale, soziale <strong>und</strong><br />
kommunikative Kompetenzen. Diese Kompetenzen sind kein fassbarer Lehrgegenstand<br />
wie z.B. Dokumentationsverfahren, sondern betreffen in der Regel Einstellungen <strong>und</strong><br />
Haltungen in der täglichen Berufsausübung sowie Fähigkeiten im Umgang mit anderen<br />
Menschen.<br />
Am besten werden diese Kompetenzen in der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung <strong>zu</strong>m Beruf gelernt,<br />
wenn die Methodik <strong>und</strong> Didaktik den Erwerb extrafunktionaler Qualifikationen<br />
befördert <strong>und</strong> fordert. Teamfähigkeit usw. wird durch Bearbeitung von Aufgaben in der<br />
Form von Team-/Projektarbeit gelernt. Kommunikative Kompetenzen werden erworben,<br />
wenn die Gelegenheit besteht, sich über Probleme/Themen auseinander<strong>zu</strong>setzen,<br />
Rollen <strong>zu</strong> tauschen usw. Zum zweiten spielt die Unternehmensphilosophie bzw. –<br />
führung eine entscheidende Rolle für die Ausbildung dieser Fähigkeiten. Teamfähigkeit<br />
<strong>und</strong> autoritärer Führungsstil passen nicht <strong>zu</strong>sammen.<br />
Empfehlung: Insofern sind die hohen Bedarfsmeldungen eine Aufforderung an die<br />
Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsanbieter, verstärkt die Förderung dieser extrafunktionalen<br />
Kompetenzen in die Konzeption <strong>und</strong> Entwicklung ihrer Angebote <strong>zu</strong> integrieren. Moderne<br />
Lern- <strong>und</strong> Lehrformen, die selbstständiges, selbstverantwortliches Lernen fördern,<br />
Projektarbeit anbieten, die Vermittlung von Moderationstechniken einschließen<br />
<strong>und</strong> die nicht <strong>zu</strong>letzt auch die Neuen Medien als Lernmittel, z.B. Internetrecherche, einsetzen,<br />
sind für die Erfüllung dieser Anforderung nötig.<br />
Schlussempfehlungen: Koordinierungsstelle – Informationsnetzwerk – Modellprojekte<br />
In dieser Untersuchung konnten qualifikatorische Implikationen eines sozialen <strong>und</strong><br />
ökonomischen Wandlungsprozesses in Einrichtungen der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
in der Region Bremen identifiziert werden, die im Zuge technologisch <strong>und</strong><br />
arbeitsorganisatorisch induzierter Innovationen in diesem Sektor relevant sind oder <strong>zu</strong>künftig<br />
relevant werden. Die Notwendigkeit, <strong>auf</strong> diese Entwicklungen mit <strong>zu</strong>kunftsorientierten<br />
Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsaktivitäten <strong>zu</strong> reagieren, kann <strong>auf</strong> lange Sicht arbeitsplatzrelevante<br />
Stabilisierungswirkungen für dieses Arbeitsmarktsegment zeitigen. Es<br />
erscheint daher sinnvoll, <strong>auf</strong> der ges<strong>und</strong>heits- wie arbeitsmarktpolitischen Entscheidungsebene<br />
solche Qualifizierungsaktivitäten durch entsprechende Flankierungsmaßnahmen<br />
<strong>zu</strong> fördern.<br />
Angesichts der sehr hohen <strong>und</strong> <strong>zu</strong>m großen Teil anspruchsvollen Qualifikationsbedarfsmeldungen<br />
wie auch des breiten Qualifizierungsangebots in der Region sollte<br />
darüber nachgedacht werden, wie Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsaktivitäten in <strong>dem</strong> gesamten<br />
potenziellen Wachstumssektor der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflege koordiniert werden<br />
können, um auch hier Kosten <strong>zu</strong> senken, Synergien aus<strong>zu</strong>nutzen <strong>und</strong> so ein effektives,<br />
<strong>auf</strong> die spezifischen innovativen Bedarfe der Region abgestimmtes Angebot präsentieren<br />
<strong>zu</strong> können.<br />
XIV
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
In diesem die Qualifizierungsaktivitäten koordinierenden Gremium (z.B. ständige<br />
Arbeitsgruppe, „R<strong>und</strong>er Tisch“) sollten neben den Vertretern aller Einrichtungsarten<br />
<strong>und</strong> ihrer Verbände, Vertreter von beteiligten senatorischen Dienststellen, von Arbeitsverwaltungen,<br />
von Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsträgern sowie der aka<strong>dem</strong>ischen Ausbildung/Wissenschaft<br />
vertreten sein.<br />
Da nicht nur in der Region Bremen/Bremerhaven der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegesektor<br />
im Umbruch ist, wäre u.E. eine wichtige <strong>zu</strong>sätzliche Aufgabe dieses Gremiums,<br />
die Informationen über innovative Projekte, neue Ausbildungsprojekte, Konferenzen<br />
etc. in Deutschland wie in Europa für die Betroffenen hier in der Region <strong>zu</strong>gänglich <strong>zu</strong><br />
machen sowie einen überregionalen Erfahrungs-/Informationsaustausch an<strong>zu</strong>regen;<br />
nur so lassen sich gerade in „Aufbruchsituationen“ synergetische Effekte gewinnen. Da<br />
neue IuK-Technologien auch im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegesektor <strong>zu</strong>nehmend die<br />
Arbeit bestimmen, würde es sich anbieten, eine Art „internetgestütztes Informationsnetz“<br />
<strong>auf</strong><strong>zu</strong>bauen, in <strong>dem</strong> überregionale Informationen wie regionalspezifische Nachrichten<br />
verbreitet werden könnten.<br />
Auf jeden Fall sollten Modellprojekte, die neue Methoden (z.B. Telelearning, selbstgesteuertes<br />
Lernen) <strong>und</strong> Inhalte (z.B. Integrierte Managementsysteme für den Pflegebereich,<br />
technisch-basierte Pflege<strong>auf</strong>gaben, integrierte Erstausbildungskonzepte) entwikkeln,<br />
die für die notwendige qualifikatorische Flankierung der erfolgreichen Umstrukturierung<br />
dieses Wachstumssektors sorgen, weiterhin verstärkt initiiert <strong>und</strong> gefördert werden.<br />
8. Zusammenfassung der Qualifikationsbedarfsdeckungsstrategien in allen Einrichtungen<br />
In der Untersuchungskonzeption wurden vier Kriterien der Bedarfsdeckung unterschieden:<br />
Bedarfsdeckung durch intern durchgeführte Maßnahmen, Bedarfsdeckung durch<br />
externe Anbieter, Bedarfsdeckung durch die Verknüpfung von internen <strong>und</strong> externen<br />
Maßnahmen sowie Bedarfsdeckungsstrategie „noch offen“.<br />
Da die Weiterbildungslandschaft für den <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegebereich sehr<br />
stark durch einrichtungsinterne Abteilungen geprägt ist – Krankenhäuser <strong>und</strong> der Bereich<br />
der Altenpflege verfügen über eigene Weiterbildungsabteilungen – dominieren im<br />
Vergleich der vier Bedarfsdeckungsstrategien die Qualifizierungen durch einrichtungsintern<br />
durchgeführte Schulungsmaßnahmen für alle drei untersuchten Funktionsbereiche.<br />
Bedarfsdeckung durch intern durchgeführte Weiterbildungsmaßnahmen<br />
Für das Leitungspersonal kann im Wesentlichen für alle Qualifikationsbereiche eine<br />
hohe interne Qualifizierung festgestellt werden, bei den examinierten Pflegekräften (3j.)<br />
liegen die Spitzen bei den Pflegekompetenzen <strong>und</strong> Schlüsselqualifikationen. Die Beschäftigten<br />
in Helferfunktionen werden in allen Bereichen überwiegend intern geschult.<br />
XV
EQUIB<br />
Bedarfsdeckung durch die Inanspruchnahme von externen Weiterbildungsanbietern<br />
Der Umfang an extern durchgeführten Qualifizierungen fällt deutlich geringer aus. Beachtenswerte<br />
Nennungen gibt es für das Leitungspersonal nur für die Qualifikationselemente<br />
geronto-psychiatrische Kompetenz, BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling, Recht<br />
sowie Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz <strong>und</strong> Qualitätssicherung. Für diese letztgenannten<br />
Bereiche werden auch für die Qualifizierung der examinierten Pflegekräfte externe Berater<br />
in Anspruch genommen.<br />
Bedarfsdeckung durch die Verknüpfung von interner <strong>und</strong> externer Weiterbildung<br />
Diese Strategie wird am häufigsten für die Bereiche Qualitätssicherung, Arbeits- <strong>und</strong><br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz sowie die Schlüsselqualifikation Qualitätsbewusstsein angewendet.<br />
Für die Fachkräfte <strong>und</strong> Helferfunktionen in der Pflege erweitert sich diese Art <strong>und</strong><br />
Weise der Schulung noch <strong>auf</strong> die Anwendung neuer Pflegeverfahren.<br />
Zukünftige Bedarfsdeckungsstrategie „noch offen“<br />
Für diese Kategorie, die interessant ist für <strong>zu</strong> entwickelnde <strong>zu</strong>kunftsorientierte Weiterbildungsmaßnahmen<br />
der externen Anbieter, liegen die Spitzen für die Leitungsfunktionen<br />
bei der geronto-psychiatrischen Kompetenz, der präventiven/rehabilitativen Beratung,<br />
der interkulturellen Kompetenz sowie <strong>dem</strong> Umweltschutz. Für die examinierten<br />
Pflegekräfte ergeben sich die höchsten Bedarfsnennungen ebenfalls für die gerontopsychiatrische<br />
<strong>und</strong> interkulturelle Kompetenz, den Umweltschutz sowie für erforderliche<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagenschulungen.<br />
9. Entwicklungstendenzen der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Für die Weiterentwicklung der Qualität der Berufe, deren Handlungskompetenzen,<br />
fachliche Orientierungen <strong>und</strong> Wissensbezüge bieten sich vor allem Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungskonzepte<br />
an, die eine Förderung beruflicher Schlüsselkompetenzen fokussieren<br />
<strong>und</strong> sich <strong>auf</strong> eine berufsübergreifende Struktur von Handlungskonzepten <strong>und</strong> Methoden<br />
konzentrieren. Dieser Trend wird durch die Bef<strong>und</strong>e der Qualifikationsbedarfsanalyse<br />
dieser Untersuchung nachhaltig gestützt.<br />
Neue integrierte Bildungsansätze <strong>zu</strong>r Professionalisierung der Pflegeberufe <strong>und</strong><br />
Ansätze der Verschmel<strong>zu</strong>ng der Berufe in der Pflegepraxis<br />
Der Frage der Integrationsnotwendigkeit von Pflegeberufen in der Erstausbildung, die<br />
dann durch Spezialisierungsprozesse komplettiert wird, messen die befragten Experten<br />
insgesamt eine große Bedeutung bei. Alle Befragten aus den Krankenhäusern/Fachkliniken<br />
halten eine integrierte berufliche Ausbildung für wünschenswert, in<br />
der stationären Altenpflege sind es 83% <strong>und</strong> in der häuslichen Pflege 95%. Dieses repräsentative<br />
Ergebnis untermauert eindeutig die aktuelle berufsbildungspolitische Diskussion<br />
<strong>und</strong> die Berechtigung von Modellversuchen für eine einheitliche pflegerische<br />
Gr<strong>und</strong>ausbildung mit dar<strong>auf</strong> <strong>auf</strong>bauenden Spezialisierungen.<br />
Ansätze einer Verschmel<strong>zu</strong>ng von Berufen in der täglichen Pflegepraxis sehen die Experten<br />
– wenn auch im Vergleich <strong>zu</strong>r wünschenswerten <strong>zu</strong>kunftsorientierten Berufsausbildungsreform<br />
– in weit geringerem Maße auch schon <strong>zu</strong>m Zeitpunkt der Repräsenta-<br />
XVI
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
tivbefragung. Etwas mehr als die Hälfte der Experten aus den Bereichen häusliche<br />
Pflege <strong>und</strong> stationäre Altenpflege stellt heute schon Verschmel<strong>zu</strong>ngen der Berufsbilder<br />
in der Pflegepraxis fest, so z.B. die Zusammenarbeit bzw. gleiche Aufgabenprofile für<br />
Kranken- <strong>und</strong> Altenpflegepersonal. Die Experten weisen dar<strong>auf</strong> hin, dass diese Verzahnungstendenz<br />
<strong>zu</strong>künftig an Bedeutung gewinnen wird. Im Krankenhausbereich stellt<br />
sich schon jetzt die Situation etwas anders dar. Hier sehen 70% der Experten Verschmel<strong>zu</strong>ngsansätze<br />
in der Pflegepraxis. Sie beziehen sich im Wesentlichen <strong>auf</strong> die Bereiche<br />
Krankenpflege mit spezieller geronto-psychiatrischer Orientierung sowie allgemeine<br />
Krankenpflege mit Kinderkrankenpflege.<br />
Neue Qualifikation: Fachkraft für Pflegeüberleitung<br />
Der Bereich der Pflegeüberleitung wird insbesondere vor <strong>dem</strong> Hintergr<strong>und</strong> der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>reform<br />
2000, die in vielen Segmenten die ambulante Pflege vor die stationäre stellt,<br />
<strong>zu</strong>künftig sowohl quantitativ als auch qualitativ an Bedeutung gewinnen. Für die Qualitätssicherung<br />
der Pflegeüberleitung bedarf es deshalb eines systematischen Pflegeüberleitungsmanagement,<br />
das die komplexen Aufgabenfelder professionell gestaltet.<br />
Empfehlung: Die Schaffung einer neuen Qualifikation „Fachkraft für Pflegeüberleitung“<br />
scheint sich für die Experten als notwendige Konsequenz <strong>zu</strong> ergeben, um so die<br />
optimale schnittstellenübergreifende Versorgung der Patienten <strong>zu</strong> erreichen. Darüber<br />
hinaus sollte das Aufgabenfeld „Pflegeüberleitung“ auch in der intendierten integrierten<br />
Gr<strong>und</strong>ausbildung für die Pflegeberufe Berücksichtigung finden, um das nötige<br />
Problembewusstsein bei den <strong>zu</strong>künftigen Pflegekräften schon in der Erstausbildungsphase<br />
<strong>zu</strong> schaffen. Und nicht <strong>zu</strong>letzt vor <strong>dem</strong> Hintergr<strong>und</strong> der skizzierten aktuellen<br />
komplexen Aufgaben <strong>und</strong> genannten Qualifikationsdefizite für eine qualitätsorientierte<br />
Pflegeüberleitung sollten Weiterbildungen für das Personal in der Pflegeüberleitung<br />
sowie für weitere Funktionsgruppen, z.B. Stationspflegekräfte, angeboten werden.<br />
Spezifische Problematik der Weiterbildungspraxis<br />
Obwohl Qualifizierungsbedarf in den Einrichtungen existiert, der auch aus Sicht der<br />
Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsexperten <strong>zu</strong>r Bewältigung der <strong>zu</strong>künftigen Pflege<strong>auf</strong>gaben<br />
befriedigt werden muss, findet die dafür notwendige Qualifizierung nicht in ausreichen<strong>dem</strong><br />
Maße statt. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen Bedarfsnennungen <strong>und</strong> der<br />
Weiterbildungspraxis. Ein wesentlicher Gr<strong>und</strong> hierfür dürfte in mangelnder systematischer<br />
Personalentwicklungsplanung der Einrichtungen liegen. Aber auch andere<br />
Hemmnisse wie gültige Arbeitszeitregelungen (Schichtpläne), Doppelbelastung (Familie<br />
<strong>und</strong> Beruf) des weiblichen Pflegepersonals etc. spielen eine wichtige Rolle.<br />
Empfehlung: Unter Berücksichtigung der spezifischen Arbeitszeitregelungen im Pflegebereich<br />
sollten Weiterbildungsanbieter in der Lage sein, die Weiterbildungskurse<br />
sehr flexibel <strong>auf</strong> die zeitlichen Bedürfnisse bzw. Notwendigkeiten der potentiellen<br />
Teilnehmerkreise <strong>zu</strong><strong>zu</strong>schneiden.<br />
Da ein großer Anteil des Teilnehmerkreises weibliche Pflegekräfte sein wird, könnte<br />
durch die Möglichkeit der begleitenden Kinderbetreuung die Motivation <strong>zu</strong>r Teilnahme<br />
an einer Qualifizierung erhöht werden.<br />
XVII
EQUIB<br />
Aber auch neue Formen <strong>und</strong> Methoden des Lernens sollten angesichts der spezifischen<br />
Situation im Pflegebereich in das Blickfeld der Weiterbildungsgestaltung kommen.<br />
Hier<strong>zu</strong> gehören der modulare Aufbau von Weiterbildungsinhalten, Ansätze von<br />
Telelearning mit Vertiefung in Präsenzphasen in den Weiterbildungseinrichtungen sowie<br />
die Vermittlung von Fähigkeiten für selbstorganisiertes Lernen.<br />
Um den aktuell drängenden Bedarf an qualifiziertem Leitungspersonal <strong>zu</strong> begegnen,<br />
wird empfohlen, das schon in der Region bestehende Angebot an diesbezüglicher <strong>auf</strong>stiegsbezogener<br />
Qualifizierung <strong>zu</strong> verstärken <strong>und</strong> es „frauen- bzw. familienfre<strong>und</strong>licher“<br />
<strong>zu</strong> gestalten.<br />
Eine weitere Maßnahme, die <strong>zu</strong>r Ankurbelung der Weiterbildungsbereitschaft der Einrichtungen<br />
überlegt werden sollte, könnte das in der Region Bremen schon erprobte<br />
Modell von „Job-Rotation“ darstellen, da es gerade in Unternehmen mit knapper Personaldecke<br />
eine Entlastung durch das Zurverfügungstellen von „Stellvertreter/innen“<br />
schafft<br />
XVIII
0. Einleitung<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Das <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesen ist seit Jahren in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess begriffen.<br />
Nach Jahren der Expansion, Spezialisierung <strong>und</strong> Technisierung werden <strong>zu</strong>nehmend<br />
neue, strukturelle <strong>und</strong> qualitative Veränderungen erkennbar. Maßgebend für diese Entwicklung<br />
sind Veränderungen der <strong>dem</strong>ografischen Entwicklung. Mit <strong>dem</strong> Wachsen<br />
der sogenannten Alterspyramide ist ein Wandel des Krankheitsspektrums verb<strong>und</strong>en.<br />
Experten sprechen von einem veränderten Panorama der Krankheitsbilder. Multimorbidität<br />
<strong>und</strong> chronische Leiden werden immer häufiger diagnostiziert.<br />
Daneben ist ein gr<strong>und</strong>legender gesellschaftlicher Wandel fest<strong>zu</strong>stellen. Eine Tendenz<br />
<strong>zu</strong>r Singularisierung <strong>und</strong> eine Zunahme von Einpersonen- <strong>und</strong> kinderlosen Haushalten<br />
sowie die tendenzielle Auflösung der privaten sozialen Sicherungsnetze <strong>und</strong> der überkommenen<br />
Familienstrukturen sind unübersehbar.<br />
Steigender Personalbedarf im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegebereich<br />
Durch diese Veränderungen steigt die Nachfrage nach personenbezogenen Dienstleistungen<br />
<strong>und</strong> damit der Personalbedarf für Pflege, Beratung <strong>und</strong> Betreuung. Auf der<br />
anderen Seite sind die Diensteanbieter mit veränderten rechtlichen Rahmen- <strong>und</strong> Finanzierungsbedingungen<br />
<strong>und</strong> umfangreichen Kostensenkungsmaßnahmen im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesen<br />
konfrontiert.<br />
Die Entwicklung der gesellschaftlichen Versorgungsstrukturen ist durch Verteilungskämpfe<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesen zwischen ambulanter <strong>und</strong> stationärer Versorgung sowie<br />
zwischen den Kranken- <strong>und</strong> Pflegekassen geprägt. Andererseits ist ein massiver Ausbau<br />
dezentraler ambulanter Versorgungsstrukturen, Vor- <strong>und</strong> Nachsorgeeinrichtungen der<br />
stationären Behandlung insbesondere von privaten ambulanten Pflegediensten <strong>und</strong><br />
Krankenhausdiensten <strong>zu</strong> konstatieren, der durch einen Prozess <strong>zu</strong>nehmender Privatisierung<br />
begleitet wird.<br />
Die Einrichtung von Profit-Centern in den Krankenhäusern ist dafür ein Beleg. Die<br />
Umwandlung von Teilbereichen kommunaler Krankenhäuser in „wirtschaftlich selbständige<br />
ambulante oder stationäre Pflegeeinrichtungen“ ist explizit vom Gesetzgeber<br />
gefordert. 1 Die Umstrukturierung der Krankenhäuser <strong>zu</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>zentren, die Schaffung<br />
von regionalen Netzwerken für integrierte <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>leistungen <strong>und</strong> die <strong>zu</strong>nehmende<br />
Konzentration der Einrichtungen <strong>und</strong> die Verringerung der Anzahl der Krankenhäuser<br />
evozieren in <strong>zu</strong>nehmen<strong>dem</strong> Maße integrative multifunktionale Versorgungsstrukturen,<br />
die eine Erweiterung des Dienstleistungsangebots <strong>und</strong> die Entwicklung der<br />
Krankenhäuser <strong>zu</strong> <strong>modernen</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>dienstleistern vorantreiben.<br />
Neue Qualifikationsanforderungen an das Pflegepersonal<br />
Dabei sind <strong>auf</strong> der K<strong>und</strong>enseite gestiegene Ansprüche an die Qualität der medizinischen<br />
<strong>und</strong> pflegerischen Versorgung <strong>zu</strong> beobachten, die die Entwicklung neuer Pflegekonzepte,<br />
die Anwendung neuer Technologien <strong>und</strong> moderner Arbeits- <strong>und</strong> Kooperationsbeziehungen<br />
in <strong>und</strong> zwischen den Pflegeeinrichtungen erfordern.<br />
1 Vgl: Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), § 6 Abs. 3<br />
1
EQUIB<br />
Eine sich abzeichnende Tendenz der Enthierarchisierung der Krankenhausorganisation<br />
<strong>und</strong> die Zunahme interdisziplinärer Arbeit <strong>und</strong> projektorientierter Arbeitsstrukturen führen<br />
auch <strong>zu</strong> einer Erweiterung von administrativen <strong>und</strong> betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten<br />
<strong>auf</strong> Seiten des Pflegepersonals vor allem bei den Leitungsfunktionen.<br />
Neue Berufsprofile<br />
Das B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Pflegeverbände sowie die gewerkschaftliche<br />
Interessenvertretung kommen übereinstimmend <strong>zu</strong> <strong>dem</strong> Bef<strong>und</strong>, dass<br />
die bestehenden Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsstrukturen der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegeberufe<br />
den veränderten Anforderungen nicht mehr gerecht werden <strong>und</strong> durch modifizierte<br />
bzw. neue Berufsprofile in Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung ergänzt werden müssen. Dabei<br />
steht das Ziel im Vordergr<strong>und</strong>, professionelle Pflege-, Beratungs- <strong>und</strong> Betreuungsfunktionen<br />
<strong>zu</strong> schaffen. In der berufsbildungspolitischen Diskussion überwiegen gegenwärtig<br />
Bildungskonzepte, die <strong>auf</strong> die Vereinheitlichung <strong>und</strong> Zusammenfassung einzelner<br />
Berufsfelder <strong>zu</strong>geschnitten sind. Angestrebt wird eine integrierte Pflegeausbildung<br />
<strong>zu</strong>r „Pflegefachkraft“ im Berufsfeld Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales.<br />
Für die <strong>zu</strong>künftige Professionalisierung der Pflege werden auch für den Fort- <strong>und</strong> Weiterbildungsbereich<br />
Strukturen angestrebt, die gezielt <strong>auf</strong> die neuen Anforderungen fach<strong>und</strong><br />
arbeitsfeldbezogen sowie funktionsbezogen vorbereiten. Hier wird insbesondere der<br />
Ausbau bzw. die Neuschaffung von Bildungsmöglichkeiten mit <strong>auf</strong>stiegsbezogener<br />
Relevanz angestrebt.<br />
An Hochschulen <strong>und</strong> Universitäten 2 hat es in den letzten Jahren einen massiven Ausbau<br />
des Studienangebots für Pflegeberufe gegeben. Der Trend <strong>zu</strong>r „Aka<strong>dem</strong>isierung“ in den<br />
Pflegeberufen setzt sich weiter fort. Für das Berufsausbildungsstudium an Fachhochschulen<br />
wird analog <strong>zu</strong>r Erstausbildung ein integriertes gr<strong>und</strong>ständiges Pflegestudium<br />
vorgeschlagen. Etliche Fachhochschulen <strong>und</strong> einige Universitäten bieten inzwischen<br />
Studiengänge in Pflegepädagogik <strong>und</strong> –management an.<br />
Regionale Qualifikationsbedarfsanalyse<br />
Im Kontext dieser Entwicklung ist die vorliegende EQUIB-Studie <strong>zu</strong> sehen. Sie verfolgt<br />
weniger die Intention, einen konzeptionellen Beitrag <strong>zu</strong>r Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung im<br />
Pflegedienstbereich <strong>zu</strong> liefern, sondern sie ist eine Studie <strong>zu</strong>r Erweiterung der empirischen<br />
Datenbasis, um bildungs- <strong>und</strong> arbeitsmarktpolitisches Handeln im Rahmen regionaler<br />
Orientierung <strong>zu</strong> f<strong>und</strong>ieren.<br />
Im Auftrag des Senators für Arbeit, Frauen, Jugend, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales wird<br />
hiermit eine regionalsspezifische Repräsentativerhebung „<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong>“<br />
vorgelegt, die folgende Schwerpunkte hat:<br />
• Beschäftigungsstruktur <strong>und</strong> -entwicklung der Pflegeberufe im Lande Bremen,<br />
• technologische <strong>und</strong> arbeitsorganisatorische Innovationsentwicklung in den Einrichtungen<br />
der stationären Kranken- <strong>und</strong> Altenpflege sowie der häuslichen Pflege<br />
2 Vgl. Kap 7<br />
2
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
• <strong>und</strong> daraus resultierende, qualitativ <strong>und</strong> quantitativ ermittelte <strong>und</strong> nach Einrichtungsart<br />
differenzierte, Qualifikationsbedarfe <strong>und</strong> Bedarfsdeckungsstrategien sowie<br />
Anforderungen an die berufliche Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung.<br />
3
EQUIB<br />
4
1. Einführung in die Untersuchung<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
1.1 Zum Strukturwandel im Humandienstleistungsbereich<br />
Die in der Medienöffentlichkeit <strong>und</strong> in ges<strong>und</strong>heitspolitischen Expertenkreisen stattfindende<br />
Diskussion um die „Strukturkrise im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialbereich“ offenbart<br />
die Existenz von Problemkreisen, die erhebliche gesellschaftspolitische Umbrüche im<br />
b<strong>und</strong>esdeutschen <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialwesen signalisieren.<br />
In dieser Debatte können im Wesentlichen drei große Umwäl<strong>zu</strong>ngsindikatoren identifiziert<br />
werden:<br />
• die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>strukturpolitik mit ihrer gesetzlichen Regelungs- <strong>und</strong> Kostendämpfungsproblematik,<br />
• der im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesen <strong>zu</strong>nehmende Einsatz moderner Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik<br />
<strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen neuen Organisations- <strong>und</strong> Arbeitsformen<br />
in den Pflegeeinrichtungen,<br />
• die neuen arbeitsmarktpolitischen Perspektiven für die Pflegeberufe <strong>und</strong> deren qualifikatorische<br />
Implikationen für das berufliche Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungssystem.<br />
Ohne hier näher <strong>auf</strong> die Zusammenhänge <strong>und</strong> Gründe der gegenwärtigen ges<strong>und</strong>heitsstrukturellen<br />
Problematik eingehen <strong>zu</strong> können, wie sie durch die drei Umwäl<strong>zu</strong>ngsindikatoren<br />
gekennzeichnet ist, soll der Bedeutungsgehalt einiger wichtiger gesellschaftspolitischer<br />
Aspekte für die empirische Qualifikationsbedarfsanalyse, wie sie hiermit von<br />
EQUIB vorgelegt wird, skizziert werden.<br />
Der Arbeitsmarkt für Pflegeberufe wird derzeit mit den Attributen „entwicklungsfähig,<br />
dynamisch <strong>und</strong> expandierend“ charakterisiert, da nach jahrelangem Pflegenotstand<br />
strukturelle Veränderungen überfällig geworden sind. Die Entwicklung der häuslichen<br />
Pflege z.B. hat mit der Einführung der Pflegeversicherung die Infrastruktur der pflegerischen<br />
Versorgung verbessert. Gleichzeitig sollte sich hier ein bedeutendes Arbeitsmarktsegment<br />
eröffnen. Die Rede ist von mehreren 100.000 Arbeitsplätzen, die in der<br />
häuslichen Pflege <strong>und</strong> den angrenzenden Dienstleistungen künftig <strong>zu</strong>r Verfügung stehen<br />
könnten.<br />
„Mit einem Beschäftigungswachstum von 60% hat der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>sektor in den letzten<br />
15 Jahren bei weitem die Zuwächse harter Wirtschaftsbereiche wie der Industrie übertroffen:<br />
Das freiberufliche <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesen gehörte in den letzten 20 Jahren <strong>zu</strong> den<br />
wenigen Jobmaschinen – 132.000 neue Arbeitsplätze entstanden hier, wo neun von zehn<br />
Beschäftigten Frauen sind. Da<strong>zu</strong> kommen über 270.000 neue Jobs in der Freien Wohlfahrtspflege,<br />
hat das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet.“ 3<br />
Während die quantitativen Fragen nach <strong>dem</strong> Ausmaß des Personalbedarfs derzeit viel<br />
Beachtung finden, ist die Diskussion über den gesellschaftlichen Bedarf an einzelnen<br />
pflegerischen Berufsgruppen, über die notwendige Anpassung traditioneller Berufsbilder<br />
an <strong>zu</strong>künftige Trends, die Gewährleistung eines entsprechenden Ausbildungsniveaus<br />
mit <strong>zu</strong>kunftsorientierten Qualifikationsprofilen eher unterentwickelt.<br />
3 Vgl. Schulz, O.: Berufe in der Zukunftsbranche Ges<strong>und</strong>heit. In: Süddeutsche Zeitung 13./14.11.1999<br />
5
EQUIB<br />
Die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>berufe sind sowohl mit neuen, innovationsfördernden bzw. -fordernden<br />
gesetzlichen Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit konfrontiert als auch mit Anforderungen<br />
<strong>auf</strong>gr<strong>und</strong> verschiedener gesellschaftlicher Faktoren.<br />
Diese sind gekennzeichnet durch <strong>dem</strong>ografische <strong>und</strong> soziale Veränderungstendenzen,<br />
die die Sozialformen des Zusammenlebens der Bürger in dieser Gesellschaft nachhaltig<br />
betreffen. Mit der kontinuierlichen Zunahme der Zahl älterer <strong>und</strong> alter Menschen, bedingt<br />
durch die sinkende Sterblichkeitsrate, stellt sich ein nicht mehr <strong>zu</strong> übersehender<br />
Prozess der „Alterung der Gesellschaft“ ein, der eine Verschiebung des epi<strong>dem</strong>iologischen<br />
Spektrums mit sich bringt. Funktionale Konsequenzen chronischer Erkrankungen<br />
<strong>und</strong> Behinderungen in fortgeschrittenem Alter sowie Einbußen in den geistigen <strong>und</strong><br />
psychischen Fähigkeiten manifestieren sich verstärkt, so dass im Zuge der Populationsalterung<br />
mit einem beträchtlichen Zuwachs an Klienten mit kognitiven <strong>und</strong> psychiatrischen<br />
Problemen <strong>zu</strong> rechnen ist. 4<br />
Kur<strong>zu</strong>m: Der Versorgungsbedarf der Gesellschaft, die individuellen Ansprüche <strong>und</strong><br />
die Typologie der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>probleme haben sich geändert. Zu den allgemeinen epi<strong>dem</strong>iologischen<br />
Neuerungen gehören Veränderungen im Krankheitsspektrum: Heute<br />
gibt es vermehrt chronische Erkrankungen, die es durch Prävention <strong>und</strong> Prophylaxe <strong>zu</strong><br />
verhindern gilt.<br />
Das ges<strong>und</strong>heitliche Versorgungssystem versucht, diesen Problemen aber immer noch<br />
mit Mitteln bei<strong>zu</strong>kommen, die fast ausschließlich <strong>auf</strong> die Bewältigung akuter <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>störungen<br />
ausgerichtet sind, mit der Konsequenz, dass die Beschäftigten der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>berufe<br />
in der Ausbildung nach wie vor <strong>zu</strong>wenig <strong>auf</strong> die Prophylaxe chronischer<br />
Erkrankungen <strong>und</strong> die therapeutische <strong>und</strong> pflegerische Berücksichtigung der Lebenslagen<br />
von Menschen mit dauerhaften Beeinträchtigungen <strong>und</strong> Behinderungen vorbereitet<br />
werden. Bei der Ausbildung in den <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>berufen muss deshalb künftig<br />
primär <strong>auf</strong> die Wahrnehmung der Präventions<strong>auf</strong>gaben wie der Rehabilitations<strong>auf</strong>gaben<br />
vorbereitet werden. 5<br />
Weiter führt der technische <strong>und</strong> medizinische Fortschritt <strong>zu</strong>r Leistungsausweitung, vor<br />
allem bei der ärztlichen Tätigkeit in <strong>und</strong> außerhalb des Krankenhauses. Da jedoch viele<br />
der durch die technische Machbarkeit induzierten medizinischen Eingriffe nicht ohne<br />
eine pflegerische Betreuung auskommen, vermehrt sich auch das pflegerische Angebot<br />
<strong>und</strong> seine Inanspruchnahme. 6<br />
4 Vgl. Garms-Homolovà, V.: <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>berufe im Wandel – Qualifikationen unter Innovationsdruck. In:<br />
Meifort, B. (Hrsg.): Arbeiten <strong>und</strong> Lernen unter Innovationsdruck, B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung,<br />
Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen Bildung, Heft 221, Berlin 1998, S. 13ff.<br />
Diese Entwicklung findet ihren Niederschlag in der durchgeführten regionalen Qualifikationsbedarfsanalyse,<br />
in der durchweg hohe Bedarfsmeldungen „geronto-psychiatrischen Kompetenzen“ ermittelt wurden.<br />
(vgl. Kap. 6)<br />
5 Dass präventive <strong>und</strong> rehabilitative Leistungen vermehrt beansprucht werden, zeigen die entsprechenden<br />
hohen Bedarfsmeldungen der hiesigen Humandienstleistungsanbieter. (vgl. Kap 6)<br />
6 Als Beleg für diese Entwicklung könnte die gleichzeitige Zunahme der häuslichen Pflege <strong>und</strong> der Pflege<br />
im Krankenhaus dienen. „Noch nie wurde so viel für die Pflege ausgegeben wie im letzten Jahr!“ klagen<br />
die Vertreter der Kassen. Dabei ist diese Bilanz nur das Nebenprodukt der erheblichen Zunahme ärztlicher<br />
Maßnahmen, wie z.B. von Operationen, die – wie früher – im Krankenhaus, neuerdings aber auch<br />
immer öfter ambulant durchgeführt werden.<br />
6
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Wenn man die künftige Organisations- <strong>und</strong> Personalentwicklung im Pflegebereich<br />
antizipieren will, so wird man mit Anforderungen an den pflegerischen Beruf konfrontiert<br />
werden, die aus gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen in vielen Branchen des<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Dienstleistungssektors bekannt sind: Der Pflegeberuf wird in je<strong>dem</strong><br />
Fall durch Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologie, Management<strong>auf</strong>gaben <strong>und</strong><br />
Controllingprozesse komplexer werden. Die Pflegeleitungen werden sich neben pflegerisch-fachlichen<br />
Aufgaben neuen Funktionen der Personalentwicklung, des Marketing<br />
<strong>und</strong> der Qualitätssicherung widmen müssen. Für der Bewältigung all dieser Aufgaben<br />
wird der kompetente Umgang mit IuK-Technologie/Vernet<strong>zu</strong>ng/EDV <strong>zu</strong> einer Kernqualifikation<br />
(„Medienkompetenz“) werden. 7<br />
Ein wichtiger Gr<strong>und</strong> für diesen Entwicklungstrend liegt in den Besonderheiten der<br />
ges<strong>und</strong>heitspolitischen Strukturveränderungen im Pflegebereich begründet, wie sie vor<br />
allem durch das <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>strukturgesetz sollizitiert werden. Neue Organisations<strong>und</strong><br />
Finanzierungsregelungen forcieren betriebswirtschaftliches Denken in <strong>zu</strong>nehmend<br />
privat organisierten Pflegeeinrichtungen. Sie verschärfen den Wettbewerb zwischen<br />
Abteilungen der Krankenhäuser oder anderen gemeinnützigen oder privaten pflegerischen<br />
Leistungsanbietern. Dabei beginnen sich auch neue „Pflegemärkte“ wie die<br />
Kurzzeitpflege, die Nachsorge oder Schnittstellen zwischen <strong>dem</strong> stationären <strong>und</strong> ambulanten<br />
Bereich <strong>zu</strong> entwickeln.<br />
1.2 Aufgabenverlagerung <strong>und</strong> neue Qualifikationsanforderungen<br />
Neue Aufgaben, veränderte Arbeitsanforderungen <strong>und</strong> großenteils neue Handlungsabläufe<br />
im Pflege- wie Verwaltungsbereich der Einrichtungen strukturieren die Qualifikationsprofile<br />
in den einzelnen Qualifikationsstufen <strong>und</strong> verschiedenen Einrichtungsarten.<br />
Mit <strong>dem</strong> <strong>zu</strong>nehmenden Einsatz von IuK-Technologien bei Pflege<strong>auf</strong>gaben <strong>und</strong> Verwaltung,<br />
mit der Forderung nach dezentraler Budgetverantwortung, Wirtschaftlichkeitsrechnungen,<br />
verstärktem Controlling <strong>und</strong> Qualitätsmanagement sowie mit der Neuorientierung<br />
der angebotenen Pflegedienstleistungen an K<strong>und</strong>enwünsche <strong>und</strong> -interessen<br />
wird den Einrichtungen wie den einzelnen Beschäftigten ein Mehr an differenzierter<br />
täglicher Leistung abverlangt. Zusätzliche Qualifizierungsanstrengungen <strong>auf</strong> allen Hierarchiestufen,<br />
spezifiziert nach Einrichtungsart wie auch einrichtungsübergreifend werden<br />
nötig.<br />
Entwicklungstrends mit daraus abgeleiteten Aufgabenverlagerungen lassen sich wie<br />
folgt charakterisieren:<br />
• Die Arbeit in der häuslichen Versorgung, die immer mehr <strong>zu</strong>m Schwerpunkt der<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>berufe wird, umfasst gänzlich andere Bereiche als die Beschäftigung in<br />
einer stationären Pflegeinstitution. So beschränken sich die ambulanten Betreuungs<strong>auf</strong>gaben<br />
nicht allein <strong>auf</strong> den Klienten. Gefordert wird im wahren Sinne eine ganzheitliche<br />
Arbeitsweise, denn auch das soziale Umfeld <strong>und</strong> die häuslichen Bedingungen<br />
sind Gegenstand der Intervention. Die häufig defizitären häuslichen Bedingungen<br />
sind für die Pflegekräfte <strong>zu</strong>gleich erschwerte Arbeitsbedingungen. Pflege-<br />
7 Vgl. Csongár, G: Professionalisierungstrends im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialmanagement – Anforderungen<br />
an die berufliche Weiterbildung. In: Meifort, B. (Hrsg.): Arbeiten <strong>und</strong> Lernen unter Innovationsdruck,<br />
B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen Bildung, Heft 221, Berlin 1998, S. 66f.<br />
7
EQUIB<br />
dienstleistungen werden mit hauswirtschaftlichen Angeboten kombiniert werden<br />
müssen, um den Aufwand für Haushaltsversorgung miterledigen <strong>zu</strong> können.<br />
• Die Anzahl der Übergänge von einem Dienst <strong>zu</strong>m anderen wird künftig <strong>zu</strong>nehmen,<br />
weil – u.a. <strong>auf</strong> Basis des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>förderungsgesetzes – ein diversifiziertes<br />
Dienstleistungsangebot <strong>zu</strong>r Verfügung steht, etwa Nachtbetreuung <strong>und</strong> Kurzzeitpflege.<br />
Diese Übergänge stellen die Pflege vor neue Aufgaben der Überleitung <strong>und</strong><br />
deren Risikobewältigung. 8 Das Berufsbild einer „Fachkraft für Pflegeüberleitung“<br />
ist in der Diskussion. 9<br />
• Die Rekonvaleszenzphase wird sich nach Hause verlagern. Die häusliche Betreuung<br />
von Personen nach operativen Eingriffen, von Kranken, die weiterhin intensive<br />
„Krankenpflege“ brauchen, wird nicht nur von den ambulanten Pflegediensten, sondern<br />
ebenso vom Krankenhaus angeboten werden. Für das Pflegepersonal ergibt<br />
sich daraus die Notwendigkeit <strong>zu</strong> lernen, abwechselnd in beiden Bereichen, <strong>dem</strong><br />
stationären wie auch <strong>dem</strong> ambulanten, <strong>zu</strong> arbeiten.<br />
• Pflegeheime werden kurz- <strong>und</strong> mittelfristig fast nur noch Klienten <strong>auf</strong>nehmen, deren<br />
häusliche Betreuung <strong>zu</strong> <strong>auf</strong>wendig <strong>und</strong> <strong>zu</strong> teuer ist. Hin<strong>zu</strong> kommen vermehrt<br />
Pflegebedürftige, die alleinstehend sind <strong>und</strong> für Betreuungs<strong>auf</strong>gaben nicht <strong>auf</strong> Angehörige<br />
<strong>zu</strong>rückgreifen können. Zugleich werden Pflegeheime auch für die sogenannte<br />
„subakute“ Versorgung <strong>zu</strong>ständig sein <strong>und</strong> deshalb partiell die heutigen<br />
Krankenhäuser bei der Gr<strong>und</strong>versorgung ersetzen. Hier werden vermehrt Krankenpflegequalifikationen<br />
benötigt werden.<br />
• Ein horizontal verknüpftes System der stationären <strong>und</strong> ambulanten medizinischen,<br />
therapeutischen <strong>und</strong> pflegerischen Angebote wurde seit Jahren gefordert. Jetzt, mit<br />
der wirtschaftlich bedingten Verschlankung der Krankenhäuser, Verkür<strong>zu</strong>ng der<br />
Verweildauer <strong>und</strong> selektiven Gewährleistung stationärer Betreuung im Alter, wird<br />
es ansatzweise realisiert. Neue Methoden der Versorgungsverzahnung gewinnen<br />
bereits heute an Bedeutung. Es beginnt sich das sogenannte „Care-Management“ <strong>zu</strong><br />
etablieren, eine individualisierte Zuschneidung von Versorgungsleistungen <strong>auf</strong> Problemlagen<br />
der K<strong>und</strong>en. Damit einhergeht das Erfordernis, EDV-gestützte Planungsmethoden,<br />
die Dienstleistungen für Pflege, Hauswirtschaft <strong>und</strong> Therapie <strong>zu</strong><br />
einem Gesamtpaket verknüpfen, <strong>zu</strong> applizieren.<br />
Mit dieser Entwicklung von Querschnitts<strong>auf</strong>gaben entsteht ein Innovationsdruck <strong>auf</strong><br />
das qualifizierte <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>personal, das <strong>zu</strong>nehmend in die Erhebung von Daten,<br />
Dokumentation, Bewertung des Versorgungsprozesses, seiner Qualität <strong>und</strong> seiner Ergebnisse<br />
involviert sein wird. Eine qualifizierte Pflegekraft erhält beispielsweise <strong>zu</strong>sätzlich<br />
die Verantwortung für die Verteilung der <strong>zu</strong>r Verfügung stehenden Budgets <strong>und</strong><br />
anderer Ressourcen, für die Leistungstransparenz <strong>und</strong> den Verk<strong>auf</strong> von Pflegeleistungen.<br />
Dabei bedient sie sich der Mittel der virtuellen Kommunikation, muss eine Reihe<br />
administrativer Aufgaben übernehmen <strong>und</strong> in Managementbereiche vordringen, die<br />
noch bis vor kurzem nicht in den Bereich der Pflegetätigkeiten fielen. 10<br />
8 Vgl. <strong>zu</strong> <strong>dem</strong> Thema die Broschüre von Wolters, P.: Pflegeüberleitung in NRW, Schriftenreihe des Instituts<br />
für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld, Oktober 1996<br />
9 Vgl. Kap. 7<br />
10 Für fachübergreifende Qualifikationen werden in der regionalen Qualifikationsbedarfsanalyse von allen<br />
drei Einrichtungsarten gleichermaßen die höchsten Bedarfsmeldungen für Personal in Leitungsfunktionen<br />
abgegeben. (vgl. Kap. 6<br />
8
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Die vielfältigen Veränderungen, etwa die Implementierung von IuK-Technologien für<br />
die Erfüllung vieler <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong><strong>auf</strong>gaben, geänderte gesetzliche Vorschriften <strong>und</strong> gesellschaftlich<br />
relevante <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>probleme verlangen nach einem neuen Zuschnitt der<br />
Tätigkeitsfelder von angestammten Berufen <strong>und</strong> einer umfassenden Reform angestammter<br />
Qualifikationskonzepte. Vor <strong>dem</strong> Hintergr<strong>und</strong> der skizzierten Entwicklungen<br />
ist konsequenterweise eine Diskussion über Modernisierung, Professionalisierung<br />
<strong>und</strong> Aka<strong>dem</strong>isierung der Pflegeberufe hinsichtlich Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
nicht nur in Gang gesetzt worden; deren erste Ergebnisse sind in verschiedenen Modellprojekten<br />
(u.a. auch in Bremen) bereits erfolgreich umgesetzt worden. 11<br />
1.3 Schwerpunkte <strong>zu</strong>kunftsorientierter Pflegekompetenzen 12<br />
Nimmt man die klassische Struktur der Berufsausbildung, so kann der Horizont beruflicher<br />
Kompetenzerweiterung im Pflegebereich ansatzweise folgendermaßen abgesteckt<br />
werden:<br />
Fachliche Kompetenz<br />
Als Gr<strong>und</strong>lage für fachlich kompetentes Handeln sollen qualifizierte Pflegekräfte ein<br />
berufliches Selbstverständnis entwickeln, das <strong>auf</strong> folgenden Gr<strong>und</strong>prinzipien basiert:<br />
Pflege zielt dar<strong>auf</strong> ab, die Ges<strong>und</strong>heit des einzelnen Menschen <strong>zu</strong> erhalten bzw. wieder<br />
her<strong>zu</strong>stellen <strong>und</strong> <strong>zu</strong> fördern <strong>und</strong> ihn unter Einbeziehung seines sozialen Umfeldes bei<br />
Krankheit <strong>und</strong> Behinderung <strong>zu</strong> unterstützen. Demnach sollen die Aus<strong>zu</strong>bildenden lernen,<br />
traditionelle Strukturen der helfenden Beziehung kritisch <strong>zu</strong> hinterfragen, Pflegebedürftige<br />
in ihren sozialen Lebensbezügen <strong>zu</strong> sehen <strong>und</strong> insbesondere die im Einzelfall<br />
vorhandenen Ressourcen des Pflegebedürftigen <strong>und</strong> seines sozialen Umfeldes <strong>zu</strong> suchen<br />
<strong>und</strong> <strong>zu</strong> stärken.<br />
Sozial-kommunikative Kompetenz<br />
Eine wichtige Zielset<strong>zu</strong>ng bei der Entwicklung sozialer Kompetenz besteht darin, dass<br />
die Aus<strong>zu</strong>bildenden lernen „die Welt der Klienten <strong>zu</strong> verstehen <strong>und</strong> aus ihrer Perspektive<br />
<strong>zu</strong> sehen“, also empathische Fähigkeiten <strong>auf</strong>- <strong>und</strong> aus<strong>zu</strong>bauen. Ein weiterer<br />
Schwerpunkt der Vermittlung sozialer Kompetenz sollte die Konfliktfähigkeit <strong>und</strong> die<br />
(Selbst-)Kritikfähigkeit stärken. Bei der kommunikativen Kompetenz geht es vorrangig<br />
darum, die Aus<strong>zu</strong>bildenden <strong>zu</strong> befähigen, ihren eigenen Standpunkt <strong>zu</strong> artikulieren <strong>und</strong><br />
argumentativ <strong>zu</strong> vertreten, Gedanken <strong>und</strong> Beobachtungen präzise mündlich <strong>und</strong> schriftlich<br />
wieder<strong>zu</strong>geben sowie Gespräche gezielt <strong>zu</strong> initiieren <strong>und</strong> <strong>zu</strong> moderieren.<br />
Methodische Kompetenz<br />
Um Pflege als Prozess planen, durchführen, evaluieren <strong>und</strong> in ihrer Qualität sichern <strong>zu</strong><br />
können, bedarf es entsprechender methodischer Fähigkeiten. So müssen die künftigen<br />
Pflegekräfte lernen, klientenbezogene Informationen in Kooperation mit Kollegen <strong>und</strong><br />
anderen Berufstätigen ein<strong>zu</strong>holen <strong>und</strong> <strong>zu</strong> verarbeiten, Entscheidungen <strong>zu</strong> treffen <strong>und</strong><br />
11<br />
Nähere Ausführungen <strong>zu</strong> dieser Thematik siehe Kap.7.<br />
12<br />
Vgl. Oelke, U.: Gemeinsame Gr<strong>und</strong>ausbildung für alle Pflegeberufe. In: Pflegezeitschrift 4/99, Stuttgart<br />
1999, S. 298f.<br />
9
EQUIB<br />
Prioritäten bei der Bewältigung von Arbeitsanforderungen <strong>zu</strong> setzen. Vor allem aber<br />
müssen sie praktische Problemlösungen kompetent erarbeiten können.<br />
Medienkompetenz<br />
Für die Bewältigung all dieser komplexen Aufgaben rückt auch die Schlüsselqualifikation<br />
„Medienkompetenz“ in das Blickfeld der Erstausbildung im Pflegebereich.<br />
10
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
2. Empirisches Informations- <strong>und</strong> Erhebungsnetz<br />
2.1 Ermittlung der Gr<strong>und</strong>gesamtheit<br />
Die Gr<strong>und</strong>gesamtheit der Repräsentativuntersuchung bilden alle Anbieter ambulanter<br />
<strong>und</strong> stationärer <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflege in Bremen <strong>und</strong> Bremerhaven. Da<strong>zu</strong> gehören<br />
die Krankenhäuser sowie die Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime für die überwiegend<br />
stationäre Versorgung <strong>und</strong> die häuslichen Krankenpflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste für<br />
den ambulanten Pflegebereich.<br />
Angestrebt wurde eine Totalerhebung aller regionalen Diensteanbieter. Für die Ermittlung<br />
der Gr<strong>und</strong>gesamtheit standen Verzeichnisse des Senators für Frauen, Ges<strong>und</strong>heit,<br />
Jugend, Soziales <strong>und</strong> Umweltschutz für die Krankenhäuser im Lande Bremen, für<br />
die Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime <strong>und</strong> die Anbieter häuslicher Kranken- <strong>und</strong> Betreuungsdienste<br />
<strong>zu</strong>r Verfügung. Sie wurden durch eigene Recherchen aktualisiert <strong>und</strong> komplettiert.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage der so ermittelten 224 Einrichtungen wurde eine systematische telefonische<br />
Vorbefragung durchgeführt. Ziel war es <strong>zu</strong>m einen, kompetente Ansprechpartner<br />
für die Teilnahme an der Untersuchung <strong>zu</strong> gewinnen. Darüber hinaus konnten schon<br />
im Vorfeld der postalischen Versendung der Fragebögen Einrichtungen ausgeschlossen<br />
werden, die nur beratende Tätigkeiten, nicht aber Pflegedienste anbieten oder die <strong>zu</strong><br />
Beginn der Repräsentativerhebung nicht mehr existierten.<br />
Zeitpunkt der Untersuchung<br />
Als Resultat dieser Vorermittlung wurde der Fragebogen im 2. Quartal 1999 an die bereinigte<br />
Gr<strong>und</strong>gesamtheit von insgesamt 203 Einrichtungen versandt. Nach Einrichtungsarten<br />
<strong>und</strong> Standort gliedern sich die angeschriebenen Einrichtungen wie folgt <strong>auf</strong>:<br />
Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
gesamt: 15 Einrichtungen 13<br />
Bremen: 12 Einrichtungen<br />
Bremerhaven: 3 Einrichtungen<br />
Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
gesamt: 73 Einrichtungen<br />
Bremen: 63 Einrichtungen<br />
Bremerhaven: 10 Einrichtungen<br />
Ambulante häusliche Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste<br />
gesamt: 115 Einrichtungen<br />
Bremen: 91 Einrichtungen<br />
Bremerhaven: 24 Einrichtungen<br />
13 Die Pflegedirektion des ZKH-St. Jürgen Str. hat sich entschieden, den Fragebogen nicht für das Krankenhaus<br />
zentral aus<strong>zu</strong>füllen, sondern die Daten aus den einzelnen Fachkliniken erheben <strong>zu</strong> lassen. Insofern<br />
ist das Krankenhaus mit mehreren Fachkliniken vertreten.<br />
11
EQUIB<br />
2.2 Zur Struktur des eingesetzten Fragebogens<br />
Da sich die Repräsentativerhebung an verschiedene Arten von Pflegeeinrichtungen<br />
wendet, mussten drei, für die Einrichtungsarten spezifizierte Fragebögen entwickelt<br />
werden:<br />
• Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
• Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
• Häusliche Krankenpflege <strong>und</strong> Betreuung<br />
Die Gr<strong>und</strong>struktur der Fragebogen blieb mit ihren fünf Gliederungspunkten identisch:<br />
1. Angaben <strong>zu</strong>r Einrichtung<br />
2. Personalstruktur <strong>und</strong> -entwicklung<br />
3. Organisationsstrukturelle Entwicklung<br />
4. Qualifikationsbedarfe <strong>und</strong> Strategien ihrer Deckung<br />
5. Entwicklungstendenzen der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Zu <strong>dem</strong> Abschnitt „Personalstruktur- <strong>und</strong> -entwicklung“ wurden <strong>zu</strong> den Themen Neueinstellung<br />
<strong>und</strong> Rekrutierungspraxis offene, nicht standardisierte Fragen gestellt.<br />
Im Frageteil „Entwicklungstendenzen der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung“ wurden fünf offene<br />
Themenbereiche abgefragt:<br />
1. Professionalisierung <strong>und</strong> neue Bildungskonzepte<br />
2. Entwicklung der Berufsbilder in der Pflegepraxis<br />
3. Aka<strong>dem</strong>isierungstendenzen<br />
4. Probleme der Weiterbildungspraxis<br />
5. Probleme der Pflegeüberleitung<br />
2.3 Der Rückl<strong>auf</strong> der postalischen Befragung<br />
Das Ergebnis der postalischen Befragung ist ein Rückl<strong>auf</strong> aus insgesamt 94 Einrichtungen.<br />
Dies entspricht einer Rückl<strong>auf</strong>quote von 46% <strong>und</strong> weist <strong>auf</strong> eine hohe Akzeptanz<br />
des Untersuchungsvorhabens bei den Diensteanbietern hin. Denn allgemein wird dieser<br />
Dienstleistungsbranche in Expertenkreisen eine gewisse „Auskunftsmüdigkeit“ <strong>zu</strong>geschrieben.<br />
Ein wesentlicher Gr<strong>und</strong> für das relativ hohe Interesse an dieser Untersuchung<br />
dürfte auch darin bestehen, dass im Anschluß an die Versendung der Fragebögen noch<br />
einmal der persönliche telefonische Kontakt mit allen angeschriebenen Experten in den<br />
Einrichtungen <strong>auf</strong>genommen wurde. In den Gesprächen konnten <strong>zu</strong><strong>dem</strong> häufig einzelne<br />
Fragestellungen vertieft <strong>und</strong> wichtige z.T. sehr spezifische Zusatzinformationen gewonnen<br />
werden. Die Nichtteilnahme von Einrichtungen an der Untersuchung wurde im Wesentlichen<br />
mit <strong>dem</strong> beruflich bedingten Zeitmangel <strong>und</strong> datenschutzrechtlichen Bedenken<br />
begründet.<br />
12
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
2.4 Ergänzende Experteninterviews <strong>und</strong> deren Themenschwerpunkte<br />
Zur Absicherung bzw. qualitativen Ergän<strong>zu</strong>ng der Repräsentativdaten sind umfangreiche<br />
Interviews mit Experten aus Institutionen <strong>und</strong> Pflegeeinrichtungen unverzichtbar.<br />
Sie sind jeweils Bestandteil des methodischen Instrumentariums der von EQUIB durchgeführten<br />
Qualifikationsbedarfsermittlungen. 14<br />
Für die vorliegende Repräsentativerhebung wurden im Vorfeld der Untersuchung Sondierungsgespräche<br />
mit Experten geführt. Ziel war es, für die Allgemeinheit der Einrichtungen<br />
relevante Themenfelder <strong>und</strong> Fragestellungen <strong>zu</strong> entwickeln, um so den Repräsentativfragebogen<br />
operationalisierbar <strong>zu</strong> machen. Darüber hinaus wurden anhand<br />
von teilstandardisierten Gesprächsleitfäden weitere Expertengespräche geführt, um die<br />
Vertiefung einzelner zentraler Schwerpunkte <strong>zu</strong> ermöglichen.<br />
Anzahl <strong>und</strong> Funktionen der befragten Experten<br />
Für die qualitative Befragung wurden 22 Experten kontaktiert. Das dadurch gewonnene<br />
Expertenwissen beinhaltet aus unterschiedlichen Perspektiven <strong>und</strong> Erfahrungshorizonten<br />
eine differenzierte Bestands<strong>auf</strong>nahme der allgemeinen <strong>und</strong> auch besonderen Entwicklungstendenzen<br />
im Bereich der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflege. Im Einzelnen wurden<br />
umfangreiche Interviews mit Vertretern aus folgenden Bereichen/Institutionen geführt:<br />
• Institutionen der regionalen Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung (5 Interviews)<br />
• wissenschaftliche Ausbildung in Bremen (2 Interviews)<br />
• <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>behörden in Bremen <strong>und</strong> Bremerhaven (3 Interviews)<br />
• Krankenhäuser (4 Interviews)<br />
• Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime (4 Interviews)<br />
• Ambulante häusliche Krankenpflege (3 Interviews)<br />
• Software-Hersteller für Krankenhaus-Informationssysteme (1 Interview)<br />
Befragung anhand teilstandardisierter Gesprächsleitfäden<br />
Die Expertenbefragungen wurden anhand von teilstandardisierten Gesprächsleitfäden<br />
während des gesamten Untersuchungszeitraums (1. bis 3. Quartal 1999) durchgeführt<br />
<strong>und</strong> durch prozessbegleitende Nachfragen ergänzt. Mit diesem Verfahren wurde sichergestellt,<br />
dass das Expertenwissen der Gesprächspartner, ihre persönlichen Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> Ansichten, die sowohl aus ihrem unmittelbaren Funktionsbereich als auch aus ihrer<br />
Einsicht in die Entwicklungstendenzen des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegebereichs resultieren,<br />
für das Projektvorhaben genutzt werden können.<br />
Im Einzelnen wurden die folgenden Themenschwerpunkte diskutiert:<br />
• zentrale Entwicklungstrends des den gesamten Bereich betreffenden Strukturwandels<br />
aus der Sichtweise des jeweiligen Experten,<br />
• wesentliche organisationsstrukturelle Veränderungen des gesamten Sektors: Qualitätssicherung,<br />
Arbeitsschutz <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz, Umweltschutz, Veränderungen<br />
14 Erläuterungen <strong>zu</strong>r allgemeinen Methode der EQUIB-Untersuchungen finden sich im Anhang.<br />
13
EQUIB<br />
der Arbeits- <strong>und</strong> Abl<strong>auf</strong>organisation <strong>auf</strong>gr<strong>und</strong> organisationsstruktureller <strong>und</strong> technologischer<br />
Innovationen,<br />
• Entwicklung der technologischen Innovationen im Pflegebereich,<br />
• Konsequenzen dieser Entwicklungen für die Qualifikationsstrukturen,<br />
• Qualifikationsbedarf in den Einrichtungen,<br />
• allgemeine Entwicklungstendenzen <strong>und</strong> Erfordernisse der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung.<br />
14
3. Struktur der Pflegeeinrichtungen<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
3.1 Zusammenset<strong>zu</strong>ng des Samples nach Einrichtungsarten<br />
44<br />
Abb. 1: Rückl<strong>auf</strong> spezifiziert nach Einrichtungsarten (Angaben in absoluten Zahlen)<br />
16<br />
34<br />
Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
Differenziert nach Einrichtungsarten setzt sich der Rückl<strong>auf</strong> wie folgt <strong>zu</strong>sammen:<br />
ambulante häusliche Pflege- <strong>und</strong><br />
Betreuungsdienste<br />
• 17% der Einrichtungen sind Krankenhäuser/Fachkliniken (16),<br />
• 36% der Einrichtungen sind als Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime der stationären Pflege<br />
<strong>zu</strong><strong>zu</strong>ordnen (34),<br />
• 47% der Einrichtungen sind Anbieter ambulanter häuslicher Pflege <strong>und</strong> Betreuung<br />
(44).<br />
3.2 Die Organisationsformen der Einrichtungen<br />
Die Organisationsformen der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong> sind <strong>zu</strong> unterscheiden<br />
in kommunal, frei gemeinnützig <strong>und</strong> privatwirtschaftlich.<br />
privat<br />
frei gemeinnützig<br />
kommunal<br />
12,8<br />
Abb. 2: Organisationsformen der Einrichtungsarten (Angaben in Prozent)<br />
40,4<br />
46,8<br />
15
EQUIB<br />
• Nahe<strong>zu</strong> die Hälfte der befragten Einrichtungen ist privatwirtschaftlich organisiert.<br />
• Zwei Fünftel der Diensteanbieter arbeiten als frei gemeinnützige Einrichtungen.<br />
• Ca. 13% der Einrichtungen (ausschließlich Krankenhäuser/Fachkliniken) werden<br />
von der Kommune betrieben.<br />
• Die Auswertung der Daten bezogen <strong>auf</strong> die Organisationsformen der einzelnen<br />
Einrichtungsarten ergibt folgende Schwerpunktbildungen:<br />
16<br />
Häusliche Pflege<br />
Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
Krankenhaus/Fachklinik<br />
29,5<br />
67,6<br />
70,5<br />
75,0 12,5<br />
kommunal gemeinnützig privat<br />
Abb. 3: Organisatorische Zuordnung differenziert nach einzelnen Einrichtungsarten (Angaben in Prozent)<br />
• Die regionalen Krankenhäuser/Fachkliniken sind <strong>zu</strong> 75% kommunal organisiert.<br />
• Bei den Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheimen überwiegt die frei gemeinnützige Organisationsform<br />
mit 67,6%.<br />
• Die Anbieter ambulanter häuslicher Pflege <strong>und</strong> Betreuung sind mit 70,5% überwiegend<br />
privatwirtschaftlich organisiert.<br />
32,4<br />
12,5
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
3.3 Verteilung der Pflegeleistungen differenziert nach Einrichtungsarten<br />
Die unterschiedliche Anzahl der in diesem Kapitel ausgewerteten einzelnen Pflegeleistungen<br />
resultiert aus den quantitativ differenzierten Kernbereichen des Pflegedienstleistungsangebots<br />
der drei untersuchten Einrichtungsarten.<br />
Die Kategorie Krankenhäuser/Fachkliniken weist folgende Verteilung der spezifischen<br />
Pflegeleistungen <strong>auf</strong>.<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
100<br />
68<br />
stationäre Pflege teilstationäre<br />
Pflege<br />
25<br />
31<br />
ambulante Pflege sonstiges<br />
Abb. 4: Pflegeleistungen Krankenhäuser/Fachkliniken (Angaben in Prozent)<br />
Bemerkenswert ist, dass nur jedes vierte an der Befragung teilgenommene Krankenhaus/Fachklinik<br />
Dienstleistungen für die ambulante Pflege anbietet. 15<br />
15 Aktuelle Beispiele weisen jedoch dar<strong>auf</strong> hin, dass die Einrichtungen der überwiegend stationären Krankenpflege<br />
durch den Ausbau innovativer Dienstleistungsangebote die Verzahnung von ambulanter <strong>und</strong><br />
stationärer Arbeit ausweiten. So wurde in einem Zentralkrankenhaus ein „Interdisziplinäres Kurzzeittherapie-Centrum“<br />
(IKC) eröffnet. Ziel ist es, den Krankenhaus<strong>auf</strong>enthalt der Patienten für bestimmte Operationen<br />
<strong>auf</strong> drei Tage <strong>zu</strong> beschränken. Desweiteren verfügt dieses Krankenhaus mittlerweile über ein<br />
„Präambulantes Zentrum“. Diese Einrichtung ist b<strong>und</strong>esweit die erste ihrer Art. Das „Präambulante Zentrum“<br />
(PAZ) bildet eine Schnittstelle zwischen der stationären <strong>und</strong> ambulanten Versorgung. Hier soll der<br />
Patient lernen, nach der Entlassung eigenständig spezielle Pflegemethoden durch<strong>zu</strong>führen.<br />
17
EQUIB<br />
Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
18<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
91<br />
stationäre<br />
Pflege<br />
44<br />
35<br />
Kurzzeitpflege ambulante<br />
Pflege<br />
Abb. 5: Pflegeleistungen Altenpflege (Angaben in Prozent)<br />
18 15<br />
sonstiges Tagespflege andere<br />
Altersgruppen<br />
Die stationäre Altenpflege nimmt mit über 90% die Spitze der Pflegeleistungen in diesem<br />
Bereich ein. Für innovative Dienstleistungsangebote ergibt sich folgende Rangfolge:<br />
Mehr als zwei Fünftel der Einrichtungen bietet die Kurzzeitpflege an, gut ein<br />
Drittel betätigt sich im ambulanten Pflegebereich. Die Tagespflege, die insbesondere <strong>zu</strong><br />
den innovativen Dienstleistungsangeboten zählt, fällt mit 15% der Nennungen allerdings<br />
hinter diesem Angebot deutlich <strong>zu</strong>rück. Nur in 5 der insgesamt 34 befragten Altenwohn-<br />
<strong>und</strong> Pflegeheime werden <strong>zu</strong>m Zeitpunkt der Erhebung Tagespatienten <strong>auf</strong>genommen.<br />
9
Häusliche Krankenpflege <strong>und</strong> Betreuung<br />
Gr<strong>und</strong>pflege<br />
Behandlungspflege<br />
hauswirtschaftliche Versorgung<br />
Beratungspflege<br />
Familienpflege<br />
sonstiges<br />
Rehabilitation<br />
Kurzzeitpflege<br />
Tagespflege<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
0<br />
7<br />
18<br />
32<br />
43<br />
0 20 40 60 80 100 120<br />
Abb. 6: Pflegeleistungen häusliche Pflege <strong>und</strong> Betreuung (Angaben in Prozent)<br />
Die Pflegeleistungen bei den Einrichtungen der ausschließlich ambulanten Pflege konzentrieren<br />
sich im Wesentlichen <strong>auf</strong> die Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Behandlungspflege, die hauswirtschaftliche<br />
Versorgung sowie die Beratungspflege 16 , die in diesem Segment immer bedeutsamer<br />
wird.<br />
Die hauswirtschaftlichen Versorgungsleistungen werden von den befragten Einrichtungen<br />
in der Gewichtung den Pflegetätigkeiten fast gleichgestellt (über 90%). Damit wird<br />
allein bei dieser Einrichtungsart der häuslichen Pflege ein Aktionsbereich bedeutsam,<br />
der außerhalb des medizinisch-pflegerischen Leistungsspektrums liegt <strong>und</strong> möglicherweise<br />
auch entsprechend modifizierte Qualifikationen verlangt. 17<br />
Für den ebenfalls immer wichtiger werdenden Bereich der Rehabilitation sind nur relativ<br />
wenig Nennungen <strong>zu</strong> verzeichnen (18%). Nach diesem Ergebnis scheint sich die<br />
wachsende Bedeutung von Rehabilitationsmaßnahmen im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesen als Trend<br />
in der häuslichen Pflege noch nicht äquivalent nieder<strong>zu</strong>schlagen.<br />
16 Zu der Beratungspflege gehören die Anleitung von Angehörigen/Fre<strong>und</strong>en/Nachbarn in den pflegerischen<br />
Gr<strong>und</strong>kenntnissen, patientenbezogene aktivierende Pflege usw.<br />
17 In der Qualifikationsbedarfsanalyse für die häusliche Pflege wird von dieser Besonderheit abstrahiert,<br />
da sich ein <strong>zu</strong>sätzlicher Qualifikationsbedarf aus der Anlage dieser Untersuchung nicht ableiten läßt.<br />
86<br />
91<br />
96<br />
96<br />
19
EQUIB<br />
20
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
4. Personalstruktur <strong>und</strong> -entwicklung bei den <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong>n<br />
Die folgende Tabelle dokumentiert den aktuellen Bestand an hochqualifiziertem<br />
bzw. examiniertem Pflegepersonal differenziert nach Einrichtungsarten <strong>und</strong> den einzelnen<br />
Funktionsebenen. 18 Im Durchschnitt sind ca. 80 – 90% des Personals Frauen.<br />
Personal in Leitungsfunktionen<br />
alle<br />
Einrichtungen<br />
Krankenhäuser/<br />
Fachkliniken<br />
Altenwohn-<strong>und</strong><br />
Pflegeheime<br />
Häusliche<br />
Pflegedienste<br />
728 477 125 126<br />
exam. Pflegekräfte (3J.) 5274 4087 657 530<br />
exam. Pflegekräfte (1J.) 804 225 466 113<br />
HuF-Pfleger/innen 12 0 0 12<br />
Aus<strong>zu</strong>bildende 650 613 37 0<br />
Tabelle 1: Die hier dokumentierten absoluten Zahlen sind von den Einrichtungen z.T. geschätzte<br />
Werte.<br />
Unter der Kategorie „examinierte Pflegekräfte (3j.)“ 19 ist der Personalbestand aus den<br />
Berufen Krankenschwester/-pfleger, Kinderkrankenschwester/-pfleger sowie Altenpfleger/in<br />
<strong>zu</strong>sammengefasst.<br />
Die Kategorie „examinierte Pflegekräfte (1j.)“ 20 erfasst den Bestand an Helferberufen:<br />
Krankenpflegehelfer/in, Altenpflegehelfer/in.<br />
Der Anteil der Haus- <strong>und</strong> Familienpfleger/innen (HuF-Pflegekräfte) in den häuslichen<br />
Pflegediensten ist mit der absoluten Anzahl von 12 Beschäftigten verschwindend gering.<br />
Er spielt für die Frage der Qualifizierung daher in dieser Untersuchung keine<br />
Rolle.<br />
An der Untersuchung haben ambulante häusliche Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste teilgenommen,<br />
die keine Pflegekräfte ausbilden. Bei ihnen werden nur Praktikumsplätze für<br />
Aus<strong>zu</strong>bildende in Pflegeberufen angeboten. Die Erstausbildung der Pflegeberufe findet<br />
hingegen an Pflegefachschulen in Verbindung mit den stationären Pflegeeinrichtungen<br />
statt. Im Hinblick <strong>auf</strong> eine gezielte Personalentwicklungsplanung wird dies von den<br />
ambulanten Pflegediensten als Mangel empf<strong>und</strong>en. Sie können ihrem steigenden Bedarf<br />
an solchen Arbeitskräften nicht durch eigene Ausbildungsanstrengungen begegnen. 21<br />
18 Neben diesen qualifizierten Fachkräften sind in den ambulanten Pflegediensten <strong>und</strong> Einrichtungen der<br />
stationären Altenpflege sehr viele angelernte Pflegekräfte beschäftigt. Diese Beschäftigten sind überwiegend<br />
Frauen in Arbeitsverhältnissen <strong>auf</strong> DM 630.- Basis. Die vorliegende Untersuchung konzentrierte<br />
sich nur <strong>auf</strong> die Ermittlung des Qualifikationsbedarfs für die qualifizierten Pflegekräfte.<br />
19 In der Untersuchung werden für die „examinierten Pflegekräfte (3j.)“ auch die Bezeichnungen „Exami-<br />
nierte (3j.)“ <strong>und</strong> „Dreijährige“ verwendet.<br />
20 In der Untersuchung werden für die „examinierten Pflegekräfte (1j.)“ auch die Bezeichnungen „Exami-<br />
nierte (1j.)“ <strong>und</strong> „Einjährige“ verwendet.<br />
21 Über zeitnah realisierbare Lösungsmöglichkeiten dieses Defizits nach<strong>zu</strong>denken, wäre u.E. eine der<br />
Aufgaben des vorgeschlagenen „R<strong>und</strong>en Tisches“. (vgl. Kap. ????)<br />
21
EQUIB<br />
Wie aus der Tabelle hervorgeht, stellen die Krankenhäuser/Fachkliniken den weitaus<br />
größten Anteil (Verhältnis ca. 4:1) des in die Untersuchung einbezogenen Pflegepersonals,<br />
so dass sich die in der Erhebung ermittelten Qualifikationsbedarfe für die verschiedenen<br />
Einrichtungsarten <strong>auf</strong> je unterschiedliche Quanta von Personal beziehen.<br />
4.1 Der <strong>zu</strong>künftige Bedarf an Pflegepersonal nach Einrichtungsarten<br />
Die folgende Abbildung dokumentiert die Beschäftigungsentwicklung in den befragten<br />
Einrichtungen bezogen <strong>auf</strong> das gesamte Pflegepersonal.<br />
22<br />
Krankenhaus/Fachklinik<br />
Altenwohn- <strong>und</strong><br />
Pflegeheime<br />
Häusliche Pflege<br />
4<br />
6<br />
28<br />
46<br />
57<br />
27<br />
66<br />
geringer gleichbleibend <strong>zu</strong>nehmend<br />
Abb. 7: Geschätzter <strong>zu</strong>künftiger Bedarf insgesamt nach Einrichtungsarten (Angaben in Prozent)<br />
Es ergeben sich deutliche einrichtungsspezifische Unterschiede beim geschätzten <strong>zu</strong>künftigen<br />
Bedarf an Pflegepersonal insgesamt:<br />
• Die höchsten Zuwachsraten für Beschäftigung sind bei den häuslichen Pflege- <strong>und</strong><br />
Betreuungsdiensten <strong>zu</strong> erwarten. Hier gehen zwei Drittel der sich <strong>zu</strong> dieser Frage<br />
geäußerten Einrichtungen von <strong>zu</strong>nehmen<strong>dem</strong> Personalbedarf aus. Dieser Bef<strong>und</strong><br />
korrespondiert mit <strong>dem</strong> kontinuierlichen Wachstum dieses Sektors seit Inkrafttreten<br />
der gesetzlichen Pflegeversicherung<br />
• In der Kategorie der Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime signalisieren nahe<strong>zu</strong> zwei Fünftel<br />
<strong>zu</strong>nehmenden Bedarf.<br />
• Die Krankenhäuser kalkulieren im Gegensatz <strong>zu</strong> den beiden anderen Einrichtungsarten<br />
mit einer überproportionalen Abnahme des quantitativen Bedarfs an Beschäftigten<br />
im Pflegebereich.<br />
39<br />
27
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
4.2 Der geschätzte <strong>zu</strong>künftige Bedarf differenziert nach Qualifikationsstufen<br />
Personal in Leitungsfunktionen<br />
Krankenhaus/Fachklinik<br />
Altenwohn- <strong>und</strong><br />
Pflegeheime<br />
Häusliche Pflege<br />
8<br />
29<br />
74<br />
84<br />
64<br />
geringer gleichbleibend <strong>zu</strong>nehmend<br />
Abb. 8: Bedarf an Personal in Leitungsfunktionen (Angaben in Prozent)<br />
• Der größte Personal<strong>zu</strong>wachs für leitendes Pflegepersonal wird von den häuslichen<br />
Pflegediensten angegeben. Jede vierte Einrichtung will ihr Leitungspersonal <strong>zu</strong>künftig<br />
erweitern. 22<br />
• Bei den Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheimen wird überwiegend von einem gleichbleibenden<br />
Personalbestand ausgegangen.<br />
• Für den Krankenhausbereich wird eine deutliche Abnahme des leitenden Pflegepersonals<br />
prognostiziert. Dieser Bef<strong>und</strong> verweist <strong>auf</strong> die <strong>zu</strong>künftig sich weiter fortsetzende<br />
Zentralisations- <strong>und</strong> Konzentrationstendenz in der stationären Krankenpflege.<br />
Examinierte Pflegekräfte (3j.)<br />
Krankenhaus/Fachklinik<br />
Altenwohn- <strong>und</strong><br />
Pflegeheime<br />
Häusliche Pflege<br />
4<br />
5<br />
Abb. 9: Bedarf an Examinierten (3j.), (Angaben in Prozent)<br />
33<br />
22<br />
54<br />
50<br />
73<br />
geringer gleichbleibend <strong>zu</strong>nehmend<br />
• Auch für das pflegende Fachpersonal wird bei den ambulanten Pflegediensten mit<br />
Abstand (73%) der höchste <strong>zu</strong>sätzliche Bedarf im Verhältnis der drei Einrichtungsarten<br />
angegeben. Fasst man die Kategorien „gleichbleibend <strong>und</strong> <strong>zu</strong>nehmend“ <strong>zu</strong>-<br />
22 Nach <strong>dem</strong> Adecco Stellenindex für Fach- <strong>und</strong> Führungskräfte stieg im Jahre 1999 die Nachfrage nach<br />
„Sozialmanagern“ um 26% gegenüber <strong>dem</strong> Vorjahr. Der für das Land Bremen festgestellte Trend entspricht<br />
folglich der b<strong>und</strong>esweiten Entwicklung. „Die Welt“: Sozialmanager machen das Rennen. 29.<br />
Januar 2000<br />
42<br />
26<br />
17<br />
7<br />
8<br />
23
EQUIB<br />
sammen, so kann festgehalten werden, dass gegenwärtig nur verschwindend wenig<br />
Einrichtungen mit Entlassungen aus betriebsökonomischen Gründen rechnen.<br />
• Dieser Bef<strong>und</strong> trifft auch <strong>auf</strong> die Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime <strong>zu</strong>, wenngleich die<br />
Zuwachsraten in diesem Bereich im Verhältnis <strong>zu</strong>r ambulanten häuslichen Pflege<br />
geringer ausfallen.<br />
• Im Krankenhausbereich stellt sich das Bild hingegen anders dar. Ein Drittel der Einrichtungen<br />
geht von <strong>zu</strong>künftig geringerem Bedarf aus, nur ganz wenige Einrichtungen<br />
rechnen mit Neueinstellungen.<br />
Examinierte Pflegekräfte (1j.)<br />
24<br />
Krankenhaus/Fachklinik<br />
Altenwohn- <strong>und</strong><br />
Pflegeheime<br />
Häusliche Pflege<br />
10<br />
30<br />
70<br />
70<br />
60<br />
geringer gleichbleibend <strong>zu</strong>nehmend<br />
Abb. 10: Bedarf an Examinierten (1j.), (Angaben in Prozent)<br />
• Auch für die Pflegehelferfunktionen gehen die häuslichen Pflegedienste mit deutlichem<br />
Abstand <strong>zu</strong> den anderen Einrichtungen von <strong>zu</strong>künftig größerem Personalbedarf<br />
aus. Obwohl 10% der Einrichtungen mit einem geringeren Personalbedarf<br />
rechnen, kann im Hinblick <strong>auf</strong> den ebenfalls für die anderen Funktionsebenen<br />
wachsenden Personalbedarf in der häuslichen Pflege mit einem Beschäftigungswachstum<br />
in dieser Pflegeart gerechnet werden.<br />
• Die Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime gehen dagegen eher von einer gleichbleibenden<br />
Tendenz (70%) in dieser Qualifikationsstufe aus, wobei mit einem Abbau von Arbeitskräften<br />
hier gar nicht gerechnet wird.<br />
• Die Krankenhäuser/Fachkliniken erwarten mehrheitlich einen Abbau an Pflegepersonal<br />
in Helferfunktionen (70%), so dass man hier auch im Hinblick <strong>auf</strong> die Bef<strong>und</strong>e<br />
für die höheren Personalstellen mit einem nicht unerheblichen Arbeitsplatzabbau<br />
rechnen muss.<br />
20<br />
30<br />
10
Erwarteter Bedarf an Aus<strong>zu</strong>bildenden<br />
Krankenhaus/Fachklinik<br />
Altenwohn- <strong>und</strong><br />
Pflegeheime<br />
Abb. 11: Bedarf an Aus<strong>zu</strong>bildenden (Angaben in Prozent)<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
50<br />
93<br />
40<br />
geringer gleichbleibend <strong>zu</strong>nehmend<br />
• Die befragten Experten in den Krankenhäusern/Fachkliniken geben einen nur gering<br />
steigenden Ausbildungsbedarf für die Berufe Kinderkrankenschwester/pfleger <strong>und</strong><br />
Krankenschwester/pfleger an. 23 Die Hälfte der Experten schätzt hingegen den <strong>zu</strong>künftigen<br />
Bedarf geringer ein.<br />
• In der Altenpflege stellt sich die Ausbildungssituation für Altenpfleger/innen anders<br />
dar. Auch hier prognostizieren die Experten nur sehr geringen <strong>zu</strong>sätzlichen Bedarf.<br />
Sie gehen nahe<strong>zu</strong> alle aber von einem <strong>zu</strong>künftig gleichbleibenden Bestand an Ausbildungsplätzen<br />
aus.<br />
• In den Einrichtungen der häuslichen Pflege <strong>und</strong> Betreuung findet keine Ausbildung<br />
<strong>zu</strong> examinierten Pflegeberufen statt. Hier werden Praktikantenplätze für die Pflegeberufe<br />
<strong>zu</strong>r Verfügung gestellt. In Anbetracht der hier wachsenden Nachfrage nach<br />
qualifiziert ausgebildetem Personal besteht u.E. dringender Handlungsbedarf, vor<br />
allem auch deshalb, weil diese Einrichtungen ihren steigenden Bedarf nicht durch<br />
eigene Ausbildungsanstrengungen befriedigen können.<br />
Fazit<br />
Der Bereich der ambulanten Pflege, in <strong>dem</strong> seit der Einführung der Pflegeversicherung<br />
zahlreiche Arbeitsplätze neu geschaffen wurden, bleibt weiterhin <strong>auf</strong> Wachstumskurs,<br />
denn bei den häuslichen Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdiensten wird mit den höchsten Zuwachsraten<br />
für Beschäftigung gerechnet. Die Einrichtungen gehen überwiegend von<br />
einem <strong>zu</strong>nehmenden Bedarf für alle Qualifikationsstufen aus; die höchste Rate ist bei<br />
den examinierten Pflegekräften (3j.) <strong>zu</strong> erwarten.<br />
Auch für den Bereich der Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime prognostizieren die Experten<br />
eine gleichbleibende bis <strong>zu</strong>nehmende Tendenz für Personalbedarf für alle Funktionsebenen<br />
im Pflegebereich. Dies gilt auch für die Anzahl der <strong>zu</strong>künftigen Ausbildungsplätze.<br />
23 Der „Landeskrankenhausplan der Freien Hansestadt Bremen 1998 bis 2003“ weist für das Land<br />
Bremen für die Jahre 1999 <strong>und</strong> 2000 gleich hohe Ausbildungszahlen aus. Festgelegt sind Ausbildungsplätze<br />
<strong>zu</strong>r Kinderkrankenschwester/<strong>zu</strong>m Kinderkrankenpfleger <strong>und</strong> <strong>zu</strong>r Krankenschwester/<strong>zu</strong>m Krankenpfleger<br />
in Höhe von insgesamt 747 pro Ausbildungsjahrgang.<br />
10<br />
7<br />
25
EQUIB<br />
Ganz anders stellt sich das Bild für die Krankenhäuser/Fachkliniken dar. Im Bereich<br />
der stationären Krankenpflege gehen die befragten Experten überwiegend von <strong>zu</strong>künftig<br />
geringerem Personalbestand aus. Dies ist nicht <strong>zu</strong>letzt eine Konsequenz der bisherigen<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>reformen, die u.a. <strong>zu</strong> Zentralisations- <strong>und</strong> Konzentrationsprozessen in den<br />
Krankenhäusern/Fachkliniken <strong>und</strong> damit <strong>zu</strong> Arbeitsplatzabbau geführt haben. Es ist<br />
damit <strong>zu</strong> rechnen, dass sich diese Tendenz auch <strong>zu</strong>künftig weiter fortsetzen wird. Ein<br />
Teil des im Krankenhausbereich freigesetzten Personals wird sicherlich in den Bereich<br />
der häuslichen Pflege <strong>und</strong> der stationären Altenpflege überwechseln. Die damit verb<strong>und</strong>enen<br />
neuen bzw. erweiterten Aufgaben- <strong>und</strong> Anforderungsprofile werden Anpassungsqualifizierungen<br />
notwendig machen. 24<br />
4.3 Deckung des Arbeitskräftebedarfs über den regionalen Arbeitsmarkt<br />
Um einen Überblick über die regionalen Rekrutierungsbedingungen des arbeitsmarkt<strong>und</strong><br />
wirtschaftspolitisch insgesamt bedeutenden <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegebereichs<br />
<strong>zu</strong> erhalten, wurden die Einrichtungen gefragt, ob sie adäquates Pflegepersonal für geplante<br />
Neueinstellungen in ausreichen<strong>dem</strong> Maße in der Region vorfinden. Die im Folgenden<br />
dargestellten Ergebnisse werden wiederum differenziert nach den drei Funktionsebenen.<br />
Personal in Leitungsfunktionen<br />
26<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
33<br />
67<br />
52<br />
48<br />
Krankenhaus/Fachklinik Altenwohn- <strong>und</strong><br />
Pflegeheime<br />
nein ja<br />
63<br />
37<br />
Häusliche Pflege<br />
Abb. 12: Bedarfsdeckung <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> regionalen Arbeitsmarkt: Leitungsfunktionen (Angaben in Prozent)<br />
• Die Krankenhäuser/Fachkliniken können überwiegend ihren Bedarf für Leitungsfunktionen<br />
über den regionalen Arbeitsmarkt decken.<br />
• In der stationären Altenpflege sieht nur etwa die Hälfte der Experten keine Rekrutierungsprobleme.<br />
24 An<strong>zu</strong>merken ist, dass hier in dieser Untersuchung Trends, nicht absolute Zahlen, angegeben werden.<br />
Insofern können keine quantitativen Angaben <strong>zu</strong>m Personalabbau bzw. <strong>zu</strong>r –nachfrage dokumentiert<br />
werden.
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
• Hingegen stellt sich für die häuslichen Pflegedienste die Situation noch problematischer<br />
dar. Hier haben zwei Drittel der suchenden Einrichtungen Schwierigkeiten,<br />
geeignetes Personal am regionalen Arbeitsmarkt <strong>zu</strong> finden.<br />
Examinierte Pflegekräfte (3j.)<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
6<br />
94<br />
59<br />
41<br />
Krankenhaus/Fachklinik Altenwohn- <strong>und</strong><br />
Pflegeheime<br />
nein ja<br />
71<br />
29<br />
Häusliche Pflege<br />
Abb. 13: Bedarfsdeckung <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> regionalen Arbeitsmarkt: Examinierte Pflegekräfte (3j.) (Angaben<br />
in Prozent)<br />
• Der Personalbedarf für examinierte Pflegekräfte (3j.) wird in den Krankenhäusern/Fachkliniken<br />
fast ausschließlich über den regionalen Arbeitsmarkt gedeckt.<br />
Einen wesentlichen Teil des Bedarfs bilden sie selbst in den Krankenpflegeschulen<br />
aus.<br />
• Bei den Einrichtungen der stationären Altenpflege überwiegen die Rekrutierungsprobleme,<br />
das nötige Personal <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> regionalen Arbeitsmarkt <strong>zu</strong> beziehen.<br />
• Im Bereich der häuslichen Pflege <strong>und</strong> Betreuung sieht die Situation noch problematischer<br />
aus. Nur ein Drittel ist mit <strong>dem</strong> regionalen Arbeitskräfteangebot <strong>zu</strong>frieden.<br />
27
EQUIB<br />
Examinierte Pflegekräfte (1j.)<br />
28<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
17<br />
83<br />
35<br />
65<br />
Krankenhaus/Fachklinik Altenwohn- <strong>und</strong><br />
Pflegeheime<br />
nein ja<br />
48<br />
52<br />
Häusliche Pflege<br />
Abb. 14: Bedarfsdeckung <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> regionalen Arbeitsmarkt: Examinierte Pflegekräfte (1j.) (Angaben<br />
in Prozent)<br />
• Für die Qualifikationen der Helferberufe stellt sich das Bild im Unterschied <strong>zu</strong> den<br />
höheren Funktionsebenen deutlich anders dar. Alle drei Einrichtungsarten haben<br />
überwiegend keine Schwierigkeiten bei der Suche nach adäquatem Pflegepersonal<br />
für Hilfsfunktionen. Jedoch ist auch hier – entsprechend den Bef<strong>und</strong>en für die höheren<br />
Qualifikationsstufen – die ansteigende Kurve für einrichtungsspezifische Rekrutierungsprobleme<br />
des gesuchten Personals fest<strong>zu</strong>stellen.<br />
Fazit<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
im Wesentlichen keine Rekrutierungsprobleme für Neueinstellungen über den regionalen<br />
Arbeitsmarkt sehen. Im Bereich der stationären Altenpflege ergibt sich aber ein<br />
etwas differenzierteres Bild. Nur für die Qualifikationsstufe der examinierten Fachkräfte<br />
(1j.) hält der regionale Arbeitsmarkt ein ausreichendes Angebot vor. Bei der Suche nach<br />
Personal für Leitungsfunktionen <strong>und</strong> examinierten Pflegekräften (3j.) stoßen die Einrichtungen<br />
überwiegend <strong>auf</strong> Schwierigkeiten. Noch problematischer ist die Situation für<br />
die häuslichen Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste. Für die gehobenen Qualifikationsstufen<br />
finden sie nur <strong>zu</strong> etwa einem Drittel adäquates Fachpersonal <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> regionalen<br />
Arbeitsmarkt vor. In diesem Ergebnis reflektiert sich der Umstand, dass der Pflegezweig<br />
der häuslichen Pflege eine noch relativ junge <strong>und</strong> <strong>zu</strong><strong>dem</strong> wachsende Disziplin ist,<br />
so dass der Arbeitsmarkt einer entsprechenden quantitativen Nachfrage nach qualitativ<br />
ausgewiesenem Pflegepersonal für diesen Bereich (noch) nicht mit einem ausreichenden<br />
Personalangebot begegnen kann.
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
4.4 Hindernisse bei Neueinstellungen<br />
Bremen/Bremerhaven ist eine Region mit hoher Arbeitslosigkeit. Der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong><br />
Sozialpflegebereich ist innerhalb des gesamten expandierenden Dienstleistungssekors<br />
ein bedeutender Wachstumsbereich in der Region. Vor <strong>dem</strong> Hintergr<strong>und</strong> der Nachfrage<br />
nach ausreichend qualifiziertem Personal, die offensichtlich nicht problemlos <strong>zu</strong> befriedigen<br />
ist, wurden die Experten nach möglichen Hindernissen für geplante Neueinstellungen<br />
gefragt. Die im Folgenden dokumentierten Aussagen wurden im offen gestalteten<br />
Frageteil der Repräsentativuntersuchung erhoben. Sie geben die Meinung der Experten<br />
wieder, die sich <strong>zu</strong> diesem Fragenkomplex geäußert haben.<br />
Als Haupthindernis für Neueinstellungen von Leitungspersonal, das man aus <strong>dem</strong> regionalen<br />
Arbeitsmarkt rekrutieren kann, wird die prinzipielle „Unattraktivität“ von<br />
Pflegeberufen gesehen. Gemeint sind hiermit in erster Linie Arbeitsverhältnisse mit<br />
relativ schlechter Bezahlung <strong>und</strong> hohen körperlichen <strong>und</strong> psychischen Belastungen sowie<br />
Dienstplänen, die keine geregelte Freizeit <strong>zu</strong>lassen. Zu<strong>dem</strong> reichen die Qualifikationen<br />
für die immer komplexer werdenden Führungs<strong>auf</strong>gaben häufig nicht aus.<br />
Der als relativ „neu“ bezeichnete Arbeitsmarkt speziell in der ambulanten Pflege gilt<br />
ohnehin nicht als besonders entwickelt, so dass eine relativ große Nachfrage nach Leitungspersonal<br />
einem z.Zt. noch relativ geringen Angebot gegenübersteht, womit die<br />
empirischen Bef<strong>und</strong>e dieser Untersuchung gestützt werden (vgl. die vorigen Unterkapitel).<br />
Bei der Neueinstellung von examinierten Pflegekräften (3j.) wird <strong>auf</strong> eine prinzipielle<br />
Marktenge verwiesen, die es erschwert, das passende Personal <strong>zu</strong> rekrutieren. Zu<strong>dem</strong><br />
werden für diese Qualifikationsstufe häufig Ausbildungsmängel <strong>und</strong> mangelnde berufliche<br />
Motivation der Pflegekräfte als Einstellungshindernisse angegeben.<br />
Für die examinierten Pflegekräfte (1j.) gelten im Prinzip dieselben Einstellungshindernisse,<br />
wenn auch nicht im gleichen Ausmaß. In der Regel ist der objektive Mangel<br />
an ausreichend qualifiziertem <strong>und</strong> motiviertem Personal <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> Arbeitsmarkt der<br />
Haupthinderungsgr<strong>und</strong> für Neueinstellungen dieser Funktionsebene.<br />
Fazit<br />
Als Hindernisse für geplante Neueinstellungen werden im Wesentlichen Qualifikations<strong>und</strong><br />
Motivationsdefizite genannt. Dieser Problematik ist mit verstärkten Qualifizierungsanstrengungen<br />
<strong>auf</strong> allen Hierarchiestufen <strong>zu</strong> begegnen. Durch die Professionalisierung<br />
der gesamten Pflegeausbildung 25 wird die gesellschaftliche Anerkennung der Pflegeberufe<br />
wachsen <strong>und</strong> sich langfristig in attraktiveren Arbeitsbedingungen niederschlagen<br />
müssen.<br />
25 Vgl. Kap. 7<br />
29
EQUIB<br />
4.5 Rekrutierungsstrategien für geplante Neueinstellungen<br />
Da der regionale Arbeitsmarkt die <strong>zu</strong>nehmende Nachfrage nach qualifiziertem Personal<br />
nicht ausreichend deckt, greifen die Einrichtungen auch <strong>zu</strong> überregionalen Rekrutierungsstrategien.<br />
Um detaillierte Hinweise <strong>zu</strong> den Strategien für geplante Neueinstellungen<br />
<strong>zu</strong> erhalten, wurden die Einrichtungen gefragt, mit Hilfe welcher Dienstleister der<br />
Arbeitsvermittlung bzw. welcher Medien sie versuchen, ihren Arbeitskräftebedarf <strong>zu</strong><br />
decken. Im Folgenden wird die Inanspruchnahme von Arbeitsämtern <strong>und</strong> privater Arbeitsvermittlung<br />
sowie die Rekrutierung über Printmedien <strong>und</strong> Internet differenziert<br />
nach den Einrichtungsarten dokumentiert.<br />
Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
• Printmedien stehen mit 87% an der Spitze der Rekrutierungsstrategien.<br />
• Die Krankenhäuser/Fachkliniken nehmen <strong>zu</strong> gleichen Teilen die regionale Arbeitsverwaltung<br />
<strong>und</strong> das Internet in Anspruch (27%).<br />
• Zu nur knapp 7% werden private Arbeitsvermittler kontaktiert.<br />
Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
• Die regionalen Arbeitsämter stehen mit 84% an der Spitze der Nennungen.<br />
• Knapp dahinter liegen die Printmedien mit 80%.<br />
• Für die privaten Arbeitsvermittler <strong>und</strong> das Internet liegen jeweils knapp 7% der<br />
Nennungen aus dieser Einrichtungsart vor.<br />
Häusliche Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste<br />
• Mit ca. 86% der Nennungen wird auch in dieser Einrichtungsart die regionale Arbeitsvermittlung<br />
am häufigsten in Anspruch genommen.<br />
• Die Printmedien folgen mit 81% der Nennungen.<br />
• Private Arbeitsvermittler werden <strong>zu</strong> 14% kontaktiert.<br />
• Zu fast 10% erfolgt die Suche über das Internet.<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Rekrutierungsstrategien für die<br />
drei erfassten Einrichtungsarten unterschiedlich ausfallen. Während für die Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
die Suche nach Arbeitskräften über die Printmedien bei weitem<br />
überwiegt, erfolgt bei den Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheimen <strong>und</strong> den ambulanten Diensten<br />
die Suche über die regionalen Arbeitsämter sowie über die Printmedien <strong>zu</strong> etwa gleichen<br />
Teilen.<br />
Hervor<strong>zu</strong>heben ist der relativ große Anteil der Internetnut<strong>zu</strong>ng in der Rekrutierungspraxis<br />
der Krankenhäuser (27%). Das neue Informations- <strong>und</strong> Kommunikationsmedium hat<br />
mit <strong>dem</strong> Arbeitsamt bei dieser Einrichtungsart als Arbeitsvermittler gleichgezogen. Zumindest<br />
für den Krankenhaussektor stellt sich somit das neue Medium Internet als konkurrenzfähig<br />
<strong>zu</strong> den traditionellen <strong>Weg</strong>en der Arbeitskräfterekrutierung dar.<br />
30
5. Organisationsstrukturelle Entwicklung<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
5.1 Qualitätssicherung<br />
Nach <strong>dem</strong> in der Pflegebranche mittlerweile durchgesetzten Leitsatz: „Wir sind der<br />
Qualität verpflichtet“, mit <strong>dem</strong> man sich einem konsequenten Qualitätsmanagement<br />
verschrieben hat, wird der K<strong>und</strong>e in den Mittelpunkt der angebotenen Dienstleistung<br />
gestellt.<br />
„Mit <strong>dem</strong> Gesetz <strong>zu</strong>r Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab <strong>dem</strong><br />
Jahr 2000 wird das <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>system an den Bedürfnissen der Patientinnen<br />
<strong>und</strong> Patienten ausgerichtet. Qualität <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit werden gesichert.<br />
Statt massiver Zuzahlungserhöhungen <strong>und</strong> Leistungskür<strong>zu</strong>ngen,.....<br />
setzt die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>reform der B<strong>und</strong>esregierung <strong>auf</strong> einen verantwortlichen<br />
Umgang mit den vorhandenen Finanzmitteln. Die Qualitätssicherung<br />
ist bisher beschränkt <strong>auf</strong> einige Berufsgruppen oder Versorgungsbereiche.<br />
Das wird nun anders. Die Qualitätssicherung wird <strong>zu</strong>m durchgängigen Gestaltungsprinzip.<br />
Es wird ein umfassendes System der Qualitätssicherung<br />
<strong>und</strong> eine Bewertung von Kosten <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit von medizinischen<br />
Technologien eingeführt. So wird z.B. auch für Ärzte/Zahnärzte, Krankenhäuser<br />
sowie stationäre Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationseinrichtungen – wie<br />
in der Industrie – Qualitätsmanagement verpflichtend.“ 26<br />
Ebenso stellen Bestimmungen des SGB XI den Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt<br />
der Leistungserbringung <strong>und</strong> stärken dessen Position. Dabei findet sich der Leistungsanbieter<br />
mit neuen Anforderungen hinsichtlich seiner Leistungsqualität in Richtung einer<br />
Kopplung der Versorgungsverträge an die Erfüllung von Leistungsbeschreibungen<br />
nach Art, Umfang, Inhalt (siehe § 93ff BSHG/ § 80 SGB Xl) konfrontiert.<br />
Zum näheren Verständnis sei hier Wissert zitiert:<br />
„Mit der Einführung des SGB XI sind (gewollt) Rahmenbedingungen geschaffen<br />
worden, bei denen die Dienste <strong>und</strong> Einrichtungen im Pflegebereich<br />
<strong>zu</strong>m einen unter der Maßgabe eines öffentlich-rechtlichen Leistungsgeschehens<br />
handeln dürfen bzw. müssen. Zum anderen werden sie derzeit in einen<br />
Wettbewerb hineingeführt <strong>und</strong> damit <strong>zu</strong>m Nachweis ihrer Effektivität <strong>und</strong><br />
ihrer Effizienz gezwungen. Als <strong>dem</strong> SGB XI immanente (Neben-) Wirkungen<br />
sind dabei außer<strong>dem</strong> die handlungsleitenden Prinzipien der "Rationalisierung"<br />
<strong>und</strong> der "Rationierung" leistungsgesetzlich finanzierter Maßnahmen<br />
in das Handlungsfeld "Pflege" eingeführt worden. Beide Prinzipien beeinflussen<br />
gegenwärtig (<strong>und</strong> wohl auch in Zukunft) das Geschehen in der Medizin<br />
<strong>und</strong> der Pflege stark.“ 27<br />
26 Presse- <strong>und</strong> Informationsamt der B<strong>und</strong>esregierung: Sozialpolitische Umschau, Ausgabe 38, Berlin 1999<br />
27 Vgl. Wissert, M.: Case-Management im professionellen Interessengeflecht: Konkurrenz für Sozialarbeit?<br />
In: Schmidt, R., Thiele, A. (Hrsg.): Konturen der neuen Pflegelandschaft, Positionen, Widersprüche,<br />
Konsequenzen, Regensburg 1998, S. 159<br />
31
EQUIB<br />
Die Gewähr für eine angemessene Leistung in den Einrichtungen wird von den Kostenträgern<br />
also <strong>zu</strong>künftig weniger über die Steuerung von finanziellen Mitteln <strong>zu</strong>r<br />
Leistungserbringung erreicht als über den <strong>Weg</strong> der Einforderung einer kontinuierlichen<br />
Qualitätssicherung durch das Qualitätsmanagement der Leistungsanbieter. 28<br />
Die Befragungsergebnisse bestätigen diese Tendenz: Über 90% aller von EQUIB befragten<br />
Einrichtungen betreiben Qualitätssicherung <strong>und</strong> zwar fast <strong>zu</strong> gleichen Teilen<br />
nach den befragten Methoden, Verfahren <strong>und</strong> Instrumenten DIN ISO 9000 ff., EFQM 29 ,<br />
Gütesiegel <strong>und</strong> „sonstige“ mit einem leichten Übergewicht bei DIN ISO 9000 ff., wobei<br />
übereinstimmend die Prinzipien eines ausgewiesenen Qualitätsmanagements eine große<br />
Rolle spielen. Bei Krankenhäusern ist Supervision deutlich öfter im Einsatz als bei der<br />
Alten- <strong>und</strong> der häuslichen Pflege. Für die übrigen Kriterien wie Pflegeleitbild, Pflegestandards<br />
sowie Controlling gilt, dass sie für alle Einrichtungsarten eine nahe<strong>zu</strong> gleich<br />
große praktische Bedeutung haben. 30<br />
Es werden äußerst unterschiedliche Ansätze für ein Qualitätsmanagement in den Einrichtungen<br />
praktiziert, wobei die Funktion von Qualitätsbe<strong>auf</strong>tragten <strong>und</strong> Qualitätszirkeln<br />
im Sinne praxisnaher Lösungen eine große Rolle spielt. 31 Ohne die Maßnahmen<br />
quantifizieren <strong>zu</strong> können, werden folgende Methoden, Verfahren <strong>und</strong> Instrumente der<br />
Qualitätssicherung favorisiert:<br />
• Total-Quality-Management<br />
• Maßnahmen nach § 80 SGB XI<br />
• Gütesiegel TÜV/Rheinland in Anlehnung an DIN ISO 9000 ff. Zertifizierung<br />
• systematisches Korrektur- <strong>und</strong> Reklamationswesen<br />
• Qualitätszirkel<br />
• Qualitätsbe<strong>auf</strong>tragte, interne Audits<br />
• Qualitätskonferenzen<br />
Als wichtiges Resultat bleibt fest<strong>zu</strong>halten: Im Pflegedienstbereich wird nicht ein bestimmtes<br />
Verfahren <strong>zu</strong>r Qualitätssicherung <strong>und</strong> Zertifizierung favorisiert. Der über<br />
90%ige Anteil der befragten Einrichtungen mit Qualitätsmanagement weist <strong>auf</strong> ein hohes<br />
Maß an Problembewusstsein in dieser Frage hin. Verantwortlich für diese Entwicklung<br />
sind sicherlich auch die gesetzlichen Vorschriften <strong>und</strong> die verschärften Wettbewerbsbedingungen,<br />
die den Pflegeeinrichtungen in ihrer Leistungsorientierung ein sorgfältiges<br />
Qualitätsmanagement <strong>auf</strong>nötigen.<br />
28 Vgl. Müller, J.: Qualitätsmanagement in der ambulanten <strong>und</strong> stationären Altenhilfe – Aufgabe der Verbände<br />
<strong>und</strong> Einrichtungen. In: Schmidt, R. u.a. (Hrsg.): Ansätze <strong>zu</strong>r Weiterentwicklung der ambulanten<br />
pflegerischen Versorgungsstruktur, Band 5, Regensburg 1998<br />
29 EFQM: European Fo<strong>und</strong>ation for Quality Management. Das <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>amt Bremen hat 1999 in Kooperation<br />
mit anderen regionalen Einrichtungen der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflege das „Bremer Qualitätssiegel<br />
für ambulante Pflegedienste“ (BQS) nach dieser Methode entwickelt. Danach können sich die<br />
Pflegedienste <strong>auf</strong> freiwilliger Basis einer ausführlichen Begutachtung durch das <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>amt unterziehen<br />
<strong>und</strong> bekommen bei der Erfüllung der strengen Vorgaben für zwei Jahre ein Gütesiegel. Mit der<br />
Vergabe des Gütesiegels übernimmt Bremen b<strong>und</strong>esweit eine Vorreiterposition.<br />
30 Im „Berliner Memorandum“ vom 14. Januar 2000 der B<strong>und</strong>eskonferenz für Qualitätssicherung im<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Pflegewesen wird dagegen für die Einführung einheitlicher Verfahren plädiert. Quelle:<br />
http://www.uni-dortm<strong>und</strong>.de/FFG<br />
31 Vgl. auch Abschlussbericht Qualitätssicherung im Krankenhaus, Schriftenreihe des B<strong>und</strong>esministeriums<br />
für Ges<strong>und</strong>heit, Bd. 96, Baden Baden 1997<br />
32
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
5.2 Die Bedeutung von Managementaktivitäten in Be<strong>zu</strong>g <strong>auf</strong> Arbeits-, <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>-<br />
<strong>und</strong> Umweltschutz (Integrierte Managementsysteme)<br />
Im Zuge einer wachsenden Orientierung des Pflegemanagements an allgemeingültigen<br />
Pflegequalitätsstandards, die in der beruflichen Praxis entwickelt, umgesetzt <strong>und</strong> gesichert<br />
werden müssen, rücken weitere Schutzbereiche in den Managementhorizont der<br />
Pflegeleitungen. Hier<strong>zu</strong> gehören der Arbeits-, <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Umweltschutz. Als<br />
Bestandteile eines integrierten Managementverständnisses sollen betriebliche Maßnahmen<br />
<strong>auf</strong> diesen Gebieten nicht nur gesetzlichen Auflagen <strong>und</strong> den Schutzbestimmungen<br />
von EU-Richtlinien Genüge leisten, sondern insgesamt der Aktivierung einer qualitätsorientierten<br />
<strong>und</strong> ganzheitlichen Pflegepraxis dienen.<br />
Umweltschutz<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Arbeitsschutz<br />
6<br />
13<br />
31<br />
94<br />
87<br />
69<br />
klein/gering mittelmäßig/groß<br />
Abb. 15: Integrierte Managementaktivitäten (Angaben in Prozent)<br />
• Dem <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz wird insgesamt eine größere Bedeutung <strong>zu</strong>gemessen als<br />
den beiden anderen Schutzbereichen, wobei der Umweltschutz am geringsten bewertet<br />
wird <strong>und</strong> <strong>dem</strong> Arbeitsschutz damit eine mittlere Position <strong>zu</strong>fällt.<br />
• Der Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz wird von allen drei Einrichtungsarten verhältnismäßig<br />
gleich hoch bewertet, so dass der Schluss naheliegt, dass das Problembewusstsein<br />
bezüglich dieser beiden Schutzbereiche im Management der Einrichtungen<br />
ausreichend entwickelt ist. Es dokumentiert sich darin ein Bewusstsein, dass<br />
durch Arbeitssicherheits- <strong>und</strong> -schutzmaßnahmen sowie durch präventive <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>förderung<br />
die Arbeitsproduktivität wie die subjektive Zufriedenheit der Mitarbeiter<br />
am Arbeitsplatz wachsen kann, so dass die Qualität der Arbeit wie das soziale<br />
Arbeitsklima gefördert werden können. Denn die in den Pflegeberufen Beschäftigten<br />
sind sehr hohen – seit der Pflegeversicherung <strong>und</strong> <strong>dem</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>gesetz noch<br />
<strong>zu</strong>nehmenden – physischen <strong>und</strong> psychischen Belastungen ausgesetzt, <strong>und</strong> mit der<br />
Ges<strong>und</strong>heit der Betroffenen leidet auch die Qualität der geleisteten Arbeit. Zu<strong>dem</strong><br />
macht sich darin auch die gesetzliche Verpflichtung <strong>zu</strong> einem betrieblichen Arbeits<strong>und</strong><br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz (Umset<strong>zu</strong>ng der EU-Arbeitsschutz-Richtlinien in nationales<br />
Recht) geltend. 32<br />
• Wenn man die Ergebnisse spezifisch nach den verschiedenen Einrichtungsarten differenziert,<br />
so kann man feststellen, dass für die Krankenhäuser/Fachkliniken mit<br />
über 90% der Umweltschutz wichtiger ist als für die häusliche Krankenpflege, die<br />
32 Das Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 verlangt bis Ende 1999 die Durchführung von Arbeitsplatz-/Gefährdungsanalysen<br />
sowie deren Dokumentation einschließlich der Erstellung von Maßnahmenkatalogen<br />
<strong>zu</strong>r Behebung festgestellter Mängel/Gefährdungen. (siehe Gesetz????)<br />
33
EQUIB<br />
34<br />
die Bedeutung des Umweltschutzes nur mit r<strong>und</strong> 59% zwischen mittelmäßig <strong>und</strong><br />
groß bewertet. In den Einrichtungen der stationären Altenpflege spielt der Bereich<br />
mit 70% eine mittelmäßig bis große Rolle. Diese Unterschiede erklären sich aus der<br />
praktischen Relevanz, die Abfallbeseitigungs- <strong>und</strong> Umweltschutz<strong>auf</strong>lagen für die<br />
einzelnen Einrichtungsarten haben.<br />
5.3 Bedeutung <strong>und</strong> Präferenzen der technologischen Innovationen im Pflegebereich<br />
Die technologische Entwicklung im Pflegedienstbereich ist geprägt durch die auch von<br />
anderen Wirtschaftsbereichen bekannte Tendenz <strong>zu</strong>r EDV-gestützten Kommunikation<br />
<strong>und</strong> Netzwerktechnologie. Die Vernet<strong>zu</strong>ng von Einrichtungen des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesens<br />
durch die IuK-Technologien steht dabei erst am Beginn <strong>und</strong> ist auch für die empirische<br />
Forschung relatives Neuland. Zur Zeit werden technische Vorausset<strong>zu</strong>ngen <strong>und</strong> Teilprojekte<br />
in einzelnen Bereichen realisiert; die Stichworte sind Krankenhaus-Informationssysteme,<br />
Pflegedokumentation, Telemedizin etc. Die Einsatzpotenziale für die Einführung<br />
der neuen Technologien sind noch nicht ganzheitlich erfasst. Hohe Investitionskosten<br />
verhindern bisher eine breite Einführung technisch machbarer lokaler <strong>und</strong><br />
überregionaler Netzwerke.<br />
Als aktuelles Beispiel für die Vernet<strong>zu</strong>ng von <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialleistungen sei an<br />
dieser Stelle näher <strong>auf</strong> ein Modellprojekt, das in Bremerhaven durchgeführt wird, hingewiesen:<br />
„In <strong>dem</strong> Projekt „<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Soziallotse Bremerhaven“ soll eine<br />
Vernet<strong>zu</strong>ng mit Informations- <strong>und</strong> Kommunikations-Technologien der verschiedenen<br />
Anbieter von <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialleistungen in Bremerhaven<br />
erreicht werden. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen außer der technischen Realisierung<br />
auch die damit verb<strong>und</strong>enen Aspekte des Datenaustausches, der Nut<strong>zu</strong>ng<br />
der technischen Einrichtungen sowie die damit verb<strong>und</strong>enen arbeitsorganisatorischen<br />
<strong>und</strong> qualifikatorischen Fragestellungen. Die Frage der Datensicherheit,<br />
der Archivierung <strong>und</strong> des sofortigen Zugriffs etc. ist ein ebenfalls<br />
<strong>zu</strong> beachtendes Thema dieses Projektes. Das Ziel ist es beispielsweise hierbei,<br />
sehr frühzeitig <strong>und</strong> geplant alle notwendigen Informationen vom Patienten<br />
für den Behandler <strong>und</strong> Betreuer vor<strong>zu</strong>halten <strong>und</strong> ihm <strong>zu</strong>r Verfügung<br />
<strong>zu</strong> stellen. Eine ausreichende Transparenz <strong>und</strong> Akzeptanz der Informationsflüsse<br />
ist ein wesentliches Ziel. Das Projekt hat weit über die Region Bremerhavens<br />
hinaus Modellcharakter. Bei einer erfolgreichen Realisierung –<br />
insbesondere in der Vernet<strong>zu</strong>ng vom stationären <strong>zu</strong>m ambulanten Bereich –<br />
ist es <strong>auf</strong> die Stadt Bremen <strong>und</strong> andere Regionen übertragbar. Durch das<br />
Projekt bieten sich gute Möglichkeiten, spezifisches regionales Know-how<br />
in den Bereichen IuK-Technologien <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>dienstleistungen <strong>auf</strong><strong>zu</strong>bauen<br />
<strong>und</strong> <strong>zu</strong> nutzen. Das Projekt ermöglicht eine umfassende <strong>und</strong> gemeinschaftliche<br />
Kompetenzentwicklung hinsichtlich der Nut<strong>zu</strong>ng von IuK-Systemen<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>bereich.“ 33<br />
33 Quelle: http://www.biba.uni-bremen.de/projects/lotse/lotse.htm
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Die immer wieder geforderte Kooperation <strong>und</strong> Vernet<strong>zu</strong>ng des ambulanten mit <strong>dem</strong><br />
stationären <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>sektor sowie der einzelnen Pflegeeinrichtungen untereinander<br />
bekommt durch die IuK-Techniken ihre technologische Basis. Die Einführung der<br />
neuen Technologien verläuft im ambulanten <strong>und</strong> stationären Sektor parallel <strong>und</strong> weitgehend<br />
unabhängig voneinander. Sie umfasst nicht nur elektronische Technologien, sondern<br />
erstreckt sich auch <strong>auf</strong> andere innovative Bereiche der Pflege- <strong>und</strong> Medizintechniken.<br />
Im Folgenden wird die technologische Innovationsorientierung der Pflegeeinrichtungen<br />
untersucht. Dabei konzentriert sich die Untersuchung <strong>auf</strong> sechs Hauptbereiche<br />
technologischer Entwicklung im Pflegesektor:<br />
• moderne Pflegetechnik<br />
• EDV-gestützte Pflegedokumentation<br />
• neue Diagnose- <strong>und</strong> Therapietechnik<br />
• EDV-gestützte Kooperation mit externen Dienstleistern<br />
• Krankenhaus-Informationssysteme<br />
• Telemedizin<br />
5.3.1 Rangskala technologischer Innovationen im Pflegebereich insgesamt<br />
moderne Pflegetechnik<br />
EDV-gestützte Pflegedokumentation<br />
KH-Informationssysteme<br />
EDV-gestützte Kooperation mit ext. Dienstleistern<br />
neue Diagnose- <strong>und</strong> Therapietechnik<br />
Telemedizin<br />
Abb. 16: Technologische Präferenzen (Angaben in Prozent)<br />
2<br />
22<br />
24<br />
26<br />
60<br />
74<br />
98<br />
78<br />
76<br />
74<br />
kein/gering mittelmäßig/groß<br />
• Der eindeutige Vorrang der technologischen Entwicklung bei moderner Pflegetechnik<br />
ist bedeutsam für die künftige Entwicklung dieser Branche, weil sich in dieser<br />
Entwicklungstendenz neue Qualifikationsperspektiven, arbeitsorganisatorische Innovationen<br />
<strong>und</strong> möglicherweise künftig erhebliche Rationalisierungspotenziale im<br />
Pflegebereich dokumentieren.<br />
• Dass eine <strong>zu</strong>kunftsorientierte technologische Entwicklung wie „Telemedizin“ <strong>auf</strong><br />
<strong>dem</strong> letzten Platz steht, verweist allerdings dar<strong>auf</strong>, dass gr<strong>und</strong>sätzlichere innovative<br />
40<br />
26<br />
35
EQUIB<br />
Tendenzen, die aller Voraussicht nach die Zukunft dieses Dienstleistungssektors<br />
stark beeinflussen <strong>und</strong> umwälzen werden, heute noch relativ unidentifizierbar sind.<br />
• Allerdings ist das deutliche Mittelfeld, in <strong>dem</strong> die Bedeutung von EDV-gestützten<br />
Techniken steht, hervor<strong>zu</strong>heben, da sich hierin ein starker Trend <strong>zu</strong>r Computerisierung<br />
der Pflegeberufe insgesamt manifestiert.<br />
5.3.2 Die Präferenzen technologischer Innovationen nach Einrichtungsarten<br />
36<br />
moderne Pflegetechnik<br />
EDV-gestützte<br />
Pflegedokumentation<br />
KH-Informationssysteme<br />
EDV-gestützte<br />
Kooperation mit ext.<br />
Dienstleistern<br />
neue Diagnose- <strong>und</strong><br />
Therapietechnik<br />
Telemedizin<br />
21<br />
15<br />
26<br />
50<br />
60<br />
60<br />
71<br />
69<br />
70<br />
68<br />
74<br />
74<br />
95<br />
100<br />
100<br />
94<br />
94<br />
100<br />
Krankenpflege Altenpflege häusliche Pflege<br />
Abb. 17: Technologische Präferenzen nach Einrichtungsarten (Daten in Prozent <strong>und</strong> <strong>auf</strong> Basis der <strong>zu</strong>sammengefassten<br />
Kategorien mittelmäßig/groß)<br />
Dieses Schaubild differenziert die Rangfolge von technologischen Präferenzen bei den<br />
Pflegeeinrichtungen:<br />
• Die technologische Orientierung bei den Krankenhäusern ist erwartungsgemäß größer<br />
als bei den anderen Einrichtungsarten. Bei vier von sieben Kategorien wird von<br />
den Krankenhäusern/Fachkliniken eine 100%ige Bedeutungs<strong>zu</strong>schreibung vorgenommen.<br />
Bei zwei weiteren, <strong>auf</strong> die EDV-bezogenen Technologien beträgt der Wert<br />
für die Krankenhäuser immer noch 94% gegenüber 70%igen Werten bei der Alten<strong>und</strong><br />
der häuslichen Pflege.<br />
• In der Technikentwicklung dominiert entsprechend den Arbeitsschwerpunkten die<br />
Ausrichtung an <strong>modernen</strong> Pflegetechniken vor der Diagnose- <strong>und</strong> Therapietechnik<br />
<strong>und</strong> zwar bei allen drei Einrichtungsarten. Folglich kann dies allerdings nicht als<br />
objektive Bedeutungsunterscheidung gewertet werden, da hier den innovativen Tendenzen<br />
in der Pflegetechnik verständlicherweise größere Bedeutung beimessen<br />
wird, als z.B. der Technikentwicklung im Diagnosebereich. Das Gleiche gilt für den<br />
Bereich der Telemedizin.<br />
• Die Alten- <strong>und</strong> häusliche Pflege unterscheiden sich in ihren technologischen Präferenzen<br />
nicht wesentlich voneinander. Die Ausnahme stellt die Diagnose- <strong>und</strong> The-
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
rapietechnik dar. Hier liegen die Altenpflegeeinrichtungen gegenüber der häuslichen<br />
Pflege deutlich vorn.<br />
• Dem Einsatz von EDV wird in der Pflegedokumentation, in der Zusammenarbeit<br />
mit externen Diensteanbietern <strong>und</strong> bei den Krankenhaus-Informationssystemen eine<br />
etwa gleich große Bedeutung <strong>zu</strong>gewiesen, wobei die Bedeutung dieser technologischen<br />
Entwicklungen im Krankenhaussektor überwiegt, der <strong>auf</strong>gr<strong>und</strong> seiner Arbeitsbereiche<br />
„Vorreiter“ im NT-Bereich ist.<br />
5.3.3 Ergän<strong>zu</strong>ngen <strong>zu</strong>m Einsatz neuer Technologien in der Pflege<br />
Um die aktuelle Problematik beim Einsatz von EDV-Technologie bezogen <strong>auf</strong> die<br />
Qualifizierungs- <strong>und</strong> Akzeptanzproblematik näher <strong>zu</strong> kennzeichnen, sei Folgendes zitiert:<br />
„Ein Bereich, bei <strong>dem</strong> Technik ins Spiel kommt, resultiert aus <strong>dem</strong> SGB XI<br />
direkt. Daß dies vollkommen neue Anforderungen an die Organisation der<br />
ambulanten pflegerischen Versorgung stellt, dürfte offenk<strong>und</strong>ig sein. Auch<br />
eventuell <strong>auf</strong>tretende Akzeptanzprobleme beim Personal eines ambulanten<br />
Pflegedienstes gilt es hierbei mit<strong>zu</strong>denken. Der bzw. die 'gläserne Mitarbeiterln'<br />
ist in diesem Kontext keine abstruse Vision, sondern die Problematik<br />
stellt sich sehr konkret z.B. hinsichtlich der Aspekte Datenschutz, Kontrolle<br />
<strong>und</strong> auch Rationalisierung. Eine generelle, auch künftige Zunahme<br />
von (luK-) Technologien im ambulanten Pflegebereich darf als weitestgehend<br />
gesichert gelten. Die Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes hat<br />
diese Tendenz sicherlich befördert.“ 34<br />
Die im Folgenden dokumentierten Ergebnisse resultieren aus themenspezifischen Zusammenfassungen<br />
der Expertengespräche, die mit Vertretern der regionalen Krankenhäuser<br />
geführt wurden. Sie bestätigen die oben angeführte Tendenz auch für den Krankenhausbereich.<br />
Praktische Erfahrungen mit EDV-Technologie im medizinisch-pflegerischen Bereich<br />
der Krankenhäuser<br />
Die krankenhausinterne EDV-Anwendung umfasst den Einsatz von Personalcomputern<br />
nicht nur in der Verwaltung, sondern auch <strong>auf</strong> den Stationen im medizinischen <strong>und</strong><br />
pflegerischen Bereich. Dabei wird das Prinzip des PC-basierten Netzwerks praktiziert,<br />
wobei der Gr<strong>und</strong> dafür einfach ist: Einzelplatzrechner sind im Handling flexibler, das<br />
digitalisierte Know-how kann stückweise angewendet werden <strong>und</strong> die Installation krankenhausspezifischer<br />
Software kann so effizienter gemacht werden. Heute findet man<br />
z.T. mindestens zwei Personalcomputer <strong>auf</strong> jeder Station. Dabei gilt die Daten- <strong>und</strong><br />
Ausfallsicherheit als gewährleistet.<br />
Probleme gibt es besonders bei der qualifizierenden Einführung der Mitarbeiter in die<br />
EDV, weil i.d.R. der Stationsbetrieb reibungslos weiterl<strong>auf</strong>en muss. Der EDV-Einsatz<br />
bedeutet also <strong>zu</strong>nächst einen erheblichen Mehr<strong>auf</strong>wand an Arbeitszeit <strong>und</strong> Kosten. Da-<br />
34 Vgl. J<strong>auf</strong>mann, D.: Pflege <strong>und</strong> Technik: Eine neue Qualität von Dienstleistungsarbeit. In: `97 Jahrbuch<br />
Sozialwissenschaftliche Technikberichterstattung, Schwerpunkt: Moderne Dienstleistungswelten, SOFI –<br />
Göttingen 1997<br />
37
EQUIB<br />
bei ist der Grad der Akzeptanz von EDV innerhalb der Belegschaften sehr unterschiedlich.<br />
Generell gilt: Jüngere Beschäftigte stehen der EDV <strong>auf</strong>geschlossener gegenüber als<br />
ältere Mitarbeiter. Die immer komplexer werdenden EDV-Programme stellen oft für die<br />
Beschäftigten ein Qualifizierungsproblem dar.<br />
Aktueller Einsatz von EDV-Technologie im medizinisch-pflegerischen Bereich der<br />
Krankenhäuser<br />
Wenn man den Einsatz von EDV-Technologie im Krankenhaus <strong>zu</strong>sammenfasst, ergeben<br />
sich im Wesentlichen folgende Anwendungsbereiche:<br />
• Dienstplanprogammgestaltung<br />
• Personal- <strong>und</strong> Ressourcenmanagement / Personalabrechnungen<br />
• Physikalische Therapie<br />
• Labor/EKG<br />
• Infosystem für Ärzte: Abrufung von Diagnose-/Therapieplänen, Datenbanken,<br />
Handbücher <strong>und</strong> Auskunftsprogramme<br />
• Ernährungs-/Diätprogramm<br />
Perspektivische Anwendungsbereiche von EDV-Technologie im medizinisch-pflegerischen<br />
Bereich der Krankenhäuser<br />
Nach Experten<strong>auf</strong>fassung konzentrieren sich die technologischen Innovationen neben<br />
den bereits eingeführten Technologien künftig schwerpunktmäßig <strong>auf</strong> folgende Bereiche:<br />
• Pflegedokumentation: Standards für die Pflegedokumentation müssen noch weiterentwickelt<br />
werden, um sie EDV-gestützt durchführen <strong>zu</strong> können.<br />
• Radiologie: Röntgen<strong>auf</strong>nahmen sind bisher noch nicht digitalisierbar. Insbesondere<br />
sind hierfür hohe Übertragungskapazitäten notwendig.<br />
• Auch Bedside-Computing setzt taugliche Hardware voraus. Die konkreten Formen<br />
<strong>zu</strong>künftiger Anwendung sind derzeit noch nicht absehbar. Die Anwendung <strong>auf</strong> den<br />
Intensivstationen steckt noch in den Anfängen. Es läuft z.Zt. in einem Krankenhaus<br />
ein Pilotprojekt für „Essensbestellungen vom Bett“.<br />
• Die Krankenhauslogistik ist in den regionalen Krankenhäusern gegenwärtig noch<br />
eher ein Konzept als technologische Praxis. Materiallager <strong>und</strong> Warenanforderungen<br />
l<strong>auf</strong>en aber schon z.T. EDV-gestützt.<br />
• Als Beispiel für eine EDV-gestützte Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern<br />
kann das „Medizinisch virtuelle Netzwerk“ 35 gelten: Dabei übermittelt das Krankenhaus<br />
Daten (Arztbriefe) an Hausärzte; die Hausärzte wiederum können per EDV<br />
Terminbestellungen z.B. für Operationen <strong>auf</strong>geben. Sinnvoll <strong>und</strong> notwendig wäre<br />
eine Vernet<strong>zu</strong>ng mit den anderen regionalen Krankenhäusern. Die Austauschbarkeit<br />
der medizinischen Daten <strong>und</strong> ein intensives Consulting wären so möglich.<br />
35 Dieses Netzwerk wird z.Zt. in einem Bremer Zentralkrankenhaus angedacht. Das Krankenhaus gilt<br />
insgesamt als Vorreiter technologischer Innovationen im IuK-Bereich in der Region.<br />
38
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Fazit<br />
Im Pflegesektor entwickeln sich neue Technologien mit <strong>dem</strong> Schwerpunkt IuK-Technologien,<br />
Netzwerke, EDV, wobei auch bei der Implementation moderner Pflegetechnik<br />
ein Innovationsprozess <strong>zu</strong> beobachten ist. Schwerpunkte liegen bei der Pflegedokumentation<br />
wie auch in der interinstitutionellen Netzwerkorientierung, die langfristig <strong>zu</strong><br />
einem Integrations- <strong>und</strong> Kooperationsprozess verschiedener Pflegeeinrichtungsarten<br />
<strong>und</strong> –tätigkeitsstrukturen, vor allem im Bereich der Schnittstellen zwischen stationären<br />
<strong>und</strong> ambulanten Pflegedienstleistungen, führen wird (vgl. auch Bef<strong>und</strong>e der Repräsentativerhebung<br />
in diesem Abschnitt).<br />
5.4 Die Veränderungen in der Arbeits- <strong>und</strong> Abl<strong>auf</strong>organisation<br />
Neue Arbeitsorganisationskonzepte, wie sie im Zuge der öffentlich <strong>und</strong> politisch geforderten<br />
Reorganisation des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>sektors induziert werden, verknüpfen technologische<br />
Innovationen vor allem im Bereich der Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik<br />
mit organisatorischen Veränderungen. Diese sind durch Privatisierungs- <strong>und</strong> Kommerzialisierungstendenzen<br />
gekennzeichnet, so dass man heut<strong>zu</strong>tage auch im Pflegesektor<br />
von einer Tendenz <strong>zu</strong> in sich geschlossenen Organisations- <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeitskonzepten<br />
spricht (Profitcenter), die mit der Forderung nach größerer Flexibilität <strong>und</strong> Aufgabenorientierung<br />
korrespondiert.<br />
In der Repräsentativerhebung wurden die Einrichtungen <strong>zu</strong> diesem Themenkomplex<br />
nach folgenden Unterscheidungskriterien befragt:<br />
• Tendenz <strong>zu</strong> selbstständigen Untereinheiten<br />
• Abteilungen mit eigener Budgetverantwortung<br />
• organisatorische Dezentralisierung<br />
• Schnittstellen für stationäre/ambulante Pflege<br />
• Arbeit in Kooperationsmodellen mit anderen Diensteanbietern<br />
• Care-Management (individuelle Zuschneidung von Leistungen)<br />
• Ansätze interdisziplinärer Teamarbeit<br />
39
EQUIB<br />
40<br />
Tendenz <strong>zu</strong> selbständigen Untereinheiten<br />
Abteilungen mit eigener Budgetverantwortung<br />
organisatorische Dezentralisierung<br />
Schnittstellen für stationäre/ambulante Pflege<br />
Arbeit in Kooperationsmodellen<br />
Care-Management<br />
Ansätze interdisziplinärer Teamarbeit<br />
44<br />
53<br />
66<br />
67<br />
64<br />
64<br />
73<br />
71<br />
73<br />
81<br />
85<br />
91<br />
90<br />
86<br />
94<br />
95<br />
94<br />
100<br />
100<br />
100<br />
100<br />
Krankenhaus Altenpflege häusliche Pflege<br />
Abb. 18: Veränderungen der Arbeits- <strong>und</strong> Abl<strong>auf</strong>organisation (Angaben in Prozent)<br />
Die Krankenhäuser weisen signifikanter als die beiden anderen Bereiche eine arbeitsorganisatorisch<br />
innovative Orientierung <strong>auf</strong>. Die Tendenz der organisatorischen Dezentralisierung<br />
<strong>und</strong> die Schaffung autonomer Subeinheiten mit Budgetverantwortung <strong>und</strong><br />
erweiterter Handlungskompetenz ist unverkennbar, ebenso wie eine Tendenz <strong>zu</strong> <strong>modernen</strong>,<br />
k<strong>und</strong>enorientierten Strukturen. Dabei scheint sich in der Entwicklung pflegerischer<br />
Tätigkeitsstrukturen ein Trend <strong>zu</strong> kooperativen <strong>und</strong> teamförmigen Arbeits<strong>zu</strong>sammenhängen<br />
<strong>zu</strong> bestätigen, wie er aus <strong>dem</strong> industriellen Arbeitssektor oder aus bestimmten<br />
Entwicklungsströmungen im Verwaltungssektor heute schon geläufig ist.<br />
Die häusliche Pflege hat gegenüber der Altenpflege einen leichten Modernisierungsvorsprung<br />
bei arbeitsorganisatorischen Strukturen, vor allen Dingen, was die Entwicklung<br />
von Arbeitsbeziehungen in Kooperationsmodellen <strong>und</strong> das Care-Management sowie<br />
die Einrichtung von Schnittstellen zwischen stationärer <strong>und</strong> ambulanter Pflege betrifft.<br />
Nach den quantitativen Ergebnissen ist eine Tendenz <strong>zu</strong>r organisatorischen Dezentralisierung<br />
erst bei gut der Hälfte der Einrichtungen <strong>zu</strong> verzeichnen, <strong>und</strong> auch die Anzahl<br />
von Abteilungen mit eigener Budgetverantwortung schlägt nur im Krankenhaussektor<br />
relevant <strong>zu</strong> Buche. Aber aus den von EQUIB in Verbindung mit dieser Studie<br />
geführten Expertengesprächen geht hervor, dass sich die Aufgabenbereiche z.B. der<br />
Wohlfahrtsverbände, die insbesondere im Bereich der Altenpflege <strong>und</strong> häuslichen ambulanten<br />
Krankenpflege tätig sind, in den letzten Jahren massiv ausgeweitet haben. In<br />
allen Abteilungen ist eine Entwicklung <strong>zu</strong>r marktorientierten Kalkulation mit den <strong>zu</strong>r<br />
Verfügung stehenden finanziellen Mitteln <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> Vormarsch. Als Konsequenz dieser<br />
Entwicklung werden z.T. Personalkosten für Controlling-Aufgaben reduziert <strong>und</strong> Stellen<br />
gestrichen.
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Zur Untermauerung dieser regionalen empirischen Ergebnisse soll <strong>auf</strong> G. Csongár verwiesen<br />
werden, die die Entstehung neuer Arbeitsanforderungen bestätigt, die sich aus<br />
der Einführung der Informations-Technik vor allem bei Verwaltungstätigkeiten ergeben.<br />
Auch die Erfassung von pflegerischen Leistungen <strong>und</strong> eine neue Budgetverantwortung,<br />
sowie Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Controlling werden als zentrale Anforderungen angeführt.<br />
Personalführung <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enfre<strong>und</strong>lichkeit prägen die neuen Handlungsabläufe im<br />
Rahmen der Koordination <strong>und</strong> Kommunikation von Pflegetätigkeiten. 36<br />
Fazit<br />
Die sich derzeit in diesem Sektor entwickelnden Pflegestandards werden mit neuen<br />
Organisationskonzepten der Pflege korrespondieren. Die Organisation der Pflege wird<br />
sich an neuen Pflegemodellen am einzelnen Kostenträger Patient (Care-Management)<br />
orientieren. Insofern ist es denkbar, dass sich ein Pflegekonzept durchsetzen wird, das<br />
<strong>auf</strong> der Trennung von Anordnung <strong>und</strong> Durchführung basiert.<br />
Für das Pflegepersonal ergeben sich hieraus erhebliche neue berufliche Anforderungen.<br />
Die Pflege wird <strong>zu</strong>nehmend mit betriebsorganisatorischen Aufgaben konfrontiert.<br />
Das eröffnet nicht nur <strong>dem</strong> fortgebildeten Personal sondern auch entsprechenden „Seiteneinsteigern“<br />
– Absolventen des Fachhochschul- bzw. Hochschulbereichs – ein wachsendes<br />
Betätigungsfeld. Darüber hinaus ergeben sich <strong>zu</strong>nehmend Aufstiegschancen für<br />
das vorhandene Pflegepersonal, wenn sich weitere Qualifikationsdifferenzierungen innerhalb<br />
des Pflegeberufs vollziehen. 37<br />
Der Pflegeberuf wird in je<strong>dem</strong> Falle durch die Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologie,<br />
Management- <strong>und</strong> Controlling<strong>auf</strong>gaben komplexer werden, da sich die<br />
Informationsverarbeitung von der Dateneingabe bis <strong>zu</strong>r Interpretation ohne pflegerischmedizinisches<br />
Fachwissen schwerlich erschließen läßt.<br />
Die Abteilungspflegeleitung muss neben pflegerisch-fachlichen Aufgaben neue Funktionen<br />
erfüllen: Personalentwicklungsplanung, Marketing für das spezifische Patientensegment<br />
der Abteilung, Qualitätssicherung, Controlling, Koordination mit anderen Berufsgruppen<br />
<strong>und</strong> anderen Einrichtungen. Bei der Erfüllung dieser Management<strong>auf</strong>gaben<br />
wird, neben kommunikativer <strong>und</strong> fachlicher Kompetenz, insbesondere ein kompetenter<br />
Umgang mit der Informationstechnologie <strong>zu</strong> einer Schlüsselqualifikation („Medienkompetenz“)<br />
werden.<br />
36<br />
Vgl. Csongár, G.: Beschäftigungsentwicklung <strong>und</strong> Qualifikationsbedarf im Funktionsbereich des mittleren<br />
<strong>und</strong> höheren Managements im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialwesen. In: Berufsbildung <strong>und</strong> Beschäftigung<br />
im personenbezogenen Dienstleistungssektor, B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen<br />
Bildung, Heft 43, Berlin 1997, S. 168f<br />
37<br />
Vgl. Meifort, B. u.a.: Professionalisierung durch Weiterbildung, B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berichte<br />
<strong>zu</strong>r beruflichen Bildung, Heft 32, Berlin 1998, S. 49<br />
41
EQUIB<br />
42
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
6. Die Entwicklung des Qualifikationsbedarfs<br />
Wie in der Repräsentativbefragung ermittelt <strong>und</strong> in den vorherigen Kapiteln dargestellt,<br />
vollziehen sich in den Einrichtungen der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflege umfangreiche<br />
organisationsstrukturelle <strong>und</strong> technologische Veränderungen, die mit neuen bzw. erweiterten<br />
Anforderungen an die Qualifikationen des Pflegepersonals aller Funktionsebenen<br />
verb<strong>und</strong>en sind. Die weitreichenden strukturellen – stattgef<strong>und</strong>enen wie prospektierten<br />
– Veränderungen im Pflegesektor korrespondieren mit den durchweg hohen<br />
Qualifikationsbedarfsmeldungen der Einrichtungen, die an der Untersuchung teilgenommen<br />
haben.<br />
Für eine gezielte Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Qualifizierungspolitik ist es wichtig, <strong>auf</strong> detaillierte<br />
Angaben <strong>zu</strong> Qualifizierungserfordernissen bei der Planung <strong>und</strong> Implementierung von<br />
konkreten Maßnahmen <strong>zu</strong>rückgreifen <strong>zu</strong> können. Die Einrichtungen wurden deshalb<br />
gebeten, ihren Qualifikationsbedarf <strong>zu</strong> konkretisieren.<br />
6.1 Zur Methodik der Qualifikationsbedarfsanalyse<br />
Die durchgeführte Qualifikationsbedarfsanalyse umfasst fünf Ebenen:<br />
1. Sie erfasst die in den Pflegeberufen <strong>zu</strong> differenzierenden 21 Einzelqualifikationen<br />
nach drei Unterscheidungskriterien: 38<br />
a) Pflegequalifikationen<br />
• Pflegeplanung/-prozess/-dokumentation<br />
• neue Pflegeverfahren<br />
• geronto-psychiatrische Kompetenz<br />
• Pflegeberatung<br />
• präventive/rehabilitative Beratung<br />
• interkulturelle Pflegekompetenz<br />
b) Überfachliche Qualifikationen<br />
• BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
• Recht<br />
• Organisationsentwicklung<br />
• Personalplanung/-einsatz<br />
• Marketing<br />
• Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologie, Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
• EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
• Qualitätssicherung<br />
• Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
• Umweltschutz<br />
38 Die <strong>auf</strong>geführten Qualifikationselemente bilden die Gesamtheit der im Pflegebereich in den drei Einrichtungsarten<br />
abverlangten Qualifikationen, wobei die jeweils konkreten Arbeitsfunktionen sich aus<br />
Elementen der Hauptbereiche Fachkompetenzen, überfachliche Qualifikationselemente <strong>und</strong> Schlüsselqualifikationen<br />
<strong>zu</strong>sammensetzen. Für die Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung bedeutet diese Differenzierung, dass<br />
bei jeder Maßnahme mehrere Qualifikationselemente als Einheit in der praktischen Arbeit oder Kurseinheit<br />
angeeignet bzw. ausgebildet werden.<br />
43
EQUIB<br />
c) Schlüsselqualifikationen 39<br />
• soziale/kommunikative Kompetenz<br />
• Kompetenz für interdisziplinäre Zusammenarbeit (Teamarbeit)<br />
• Verantwortungsbereitschaft<br />
• Gestaltungskompetenz<br />
• Qualitätsbewusstsein<br />
2. Die einzelnen, insgesamt 21 Qualifikationselemente, werden jeweils <strong>auf</strong> drei Qualifikationsebenen<br />
bezogen, die im Pflegebereich unterschieden werden können:<br />
• Personal in Leitungsfunktionen<br />
• Examinierte Pflegekräfte (3 Jahre)<br />
• Examinierte Pflegekräfte (1Jahr)<br />
3. Die Ergebnisse werden mit den Daten der einzelnen Einrichtungsarten Kranken-,<br />
Alten- <strong>und</strong> häusliche Pflege korreliert, so dass je nach Einrichtungsart spezifizierte<br />
Qualifikations- <strong>und</strong> Anforderungsprofile gewonnen werden konnten.<br />
4. Dabei wurde in einem vierten Schritt der unmittelbare Bedarf <strong>und</strong> die Art <strong>und</strong> Weise<br />
seiner Deckung nach den Kriterien „intern“, „extern“, „in- <strong>und</strong> extern“, „offen“ unterschieden.<br />
40<br />
5. Um die empirischen Ergebnisse ab<strong>zu</strong>r<strong>und</strong>en, wurden in einem fünften Schritt Expertenmeinungen<br />
<strong>zu</strong> verschiedenen Schwerpunkten der Thematik eingeholt <strong>und</strong> in die empirischen<br />
Ergebnisse eingearbeitet.<br />
39 Vgl. Burmeister, J., Lehnerer, C.: Untersuchung der Beschäftigungsentwicklung <strong>und</strong> des Qualifikationsbedarfs<br />
in mittleren Positionen des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialwesens – Anforderungen an die berufliche<br />
Weiterbildung. In: Meifort, B. u.a. (Hrsg.): Berufsbildung <strong>und</strong> Beschäftigung im personenbezogenen<br />
Dienstleistungssektor, B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Heft 43, Berlin 1999, S. 175f.<br />
Zum Vergleich eine andere Definition von Schlüssel- <strong>und</strong> Fachqualifikationen:<br />
• "Budgetkompetenz": interne Kosten- <strong>und</strong> Leistungsrechnung, abteilungsspezifisches Controlling,<br />
strategisches Controlling <strong>auf</strong> Klinikebene<br />
• "Management/ Organisation": Projektorganisation/Mitarbeiterführung <strong>und</strong> –motivation, Personalbedarfsplanung,<br />
Rekrutierung <strong>und</strong> Personalentwicklungsplanung, Dienstplangestaltung, Dienstleistungs-Marketing,<br />
Qualitätsmanagement<br />
• "Umgang mit Informationstechnologie": EDV-Gr<strong>und</strong>wissen: Software <strong>und</strong> Hardware, strategisches<br />
<strong>und</strong> operatives Informationsmanagement: Technikeinsatzplanung, EDV-gestützte Dienstplangestaltung,<br />
EDV-gestützte Dokumentationssysteme<br />
• "persönliche Führungskompetenz": Rhetorik /Gesprächsführung, Argumentation <strong>und</strong> Verhandlung,<br />
Konfliktmanagement, Zeitmanagement<br />
• Fachliche Qualifikationen: Pflege(bedarfs)planung, Pflegedokumentation, Pflegekonzepte<br />
40 Zur Erläuterung: Im Bereich der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong> wird im Verhältnis <strong>zu</strong> anderen<br />
Wirtschaftszweigen ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Qualifizierungsbedarf durch intern durchgeführte<br />
Weiterbildungsmaßnahmen realisiert. Mehrere Krankenhäuser <strong>und</strong> einige frei gemeinnützig organisierte<br />
Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime/ambulante Pflegedienste verfügen über interne Weiterbildungsabteilungen.<br />
In den insbesondere privat organisierten häuslichen Pflegeeinrichtungen qualifiziert sich das<br />
leitende Management häufig durch Selbststudium.<br />
44
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Aufbau des Kapitels<br />
Die folgenden Unterkapitel dokumentieren <strong>und</strong> analysieren – immer jeweils differenziert<br />
nach den drei untersuchten Funktionsebenen Personal in Leitungsfunktionen, examinierte<br />
Fachkräfte (3j.), examinierte Fachkräfte (1j.) –<br />
• den Qualifikationsbedarf insgesamt für alle Einrichtungsarten,<br />
• den Qualifikationsbedarf in der stationären Krankenpflege: Krankenhäu-<br />
•<br />
ser/Fachkliniken,<br />
den Qualifikationsbedarf in der stationären Altenpflege: Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime,<br />
• den Qualifikationsbedarf bei der ambulanten Krankenpflege <strong>und</strong> Betreuung: Häusliche<br />
Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste.<br />
Im Anschluss an diese <strong>zu</strong>m größten Teil quantitative Auswertung der Qualifikationsbedarfe<br />
erfolgt eine kurze qualitative Analyse der Bedarfsmeldungen der drei Einrichtungsarten.<br />
Diese Darstellungsform bietet sich <strong>auf</strong>gr<strong>und</strong> von einigen, allen Einrichtungen<br />
gemeinsamen Qualifikationsbedarfstrends (z.B. in den Bereichen Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz,<br />
Qualitätssicherung) an, um Wiederholungen <strong>zu</strong> vermeiden.<br />
Abschließend werden die von den Einrichtungen für die jeweils angegebenen Qualifizierungsinhalte<br />
gewählten Bedarfsdeckungsstrategien dargestellt.<br />
45
EQUIB<br />
6.2 Qualifikationsbedarf insgesamt für alle Einrichtungsarten<br />
Personal in Leitungsfunktionen<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz<br />
Pflegeberatung<br />
prävent./rehabil. Beratung<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
Recht<br />
Organisationsentwicklung<br />
Personalplanung/-einsatz<br />
Marketing<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätssicherung<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Umweltschutz<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
Qualitätsbewusstsein<br />
46<br />
11<br />
16<br />
24<br />
11<br />
12<br />
22<br />
12<br />
10<br />
13<br />
11<br />
16<br />
14<br />
10<br />
3<br />
6<br />
12<br />
21<br />
20<br />
19<br />
17<br />
13<br />
89<br />
84<br />
76<br />
89<br />
88<br />
78<br />
88<br />
90<br />
87<br />
89<br />
84<br />
86<br />
90<br />
97<br />
94<br />
88<br />
79<br />
80<br />
81<br />
83<br />
87<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
Abb. 19: Qualifikationsbedarf für Personal in Leitungsfunktionen insgesamt (Angaben in Prozent)<br />
• Der Qualifizierungsbedarf <strong>auf</strong> der Leitungsebene wird bezüglich fast aller Qualifikationselemente<br />
als gleichmäßig hoch betrachtet (Nennungen ab 76% <strong>auf</strong>wärts). Es<br />
läßt sich also kein spezieller Qualifizierungsbedarf nachweisen, der aus <strong>dem</strong> Umfeld<br />
der gängigen Anforderungen herausragen würde.<br />
• Dass der Bedarf in Be<strong>zu</strong>g <strong>auf</strong> Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz <strong>und</strong> bei der Qualitätssicherung<br />
etwas höher liegt als im Durchschnitt, entspricht den Bef<strong>und</strong>en, die die<br />
Untersuchung der organisationsstrukturellen Entwicklung (siehe Kap. 5) ergeben hat<br />
<strong>und</strong> gilt deshalb sowohl für alle Qualifikationsstufen als auch für alle Einrichtungstypen<br />
gleichermaßen.<br />
• Nach interkultureller sowie geronto-psychiatrischer Pflegekompetenz wird ein relativ<br />
geringerer Bedarf angemeldet, was für die Leitungsebene einleuchtet, da es sich<br />
hierbei in erster Linie um spezielle Kompetenzen des Pflegepersonals unmittelbar<br />
bezogen <strong>auf</strong> die <strong>zu</strong> pflegende Person handelt.
Examinierte Pflegekräfte (3j.)<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz<br />
Pflegeberatung<br />
prävent./rehabil. Beratung<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
Recht<br />
Organisationsentwicklung<br />
Personalplanung/-einsatz<br />
Marketing<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätssicherung<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Umweltschutz<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
Qualitätsbewusstsein<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
6<br />
14<br />
13<br />
19<br />
21<br />
21<br />
23<br />
28<br />
21<br />
29<br />
20<br />
29<br />
18<br />
38<br />
54<br />
48<br />
54<br />
51<br />
60<br />
61<br />
44<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
94<br />
86<br />
87<br />
81<br />
79<br />
79<br />
77<br />
72<br />
79<br />
71<br />
80<br />
71<br />
82<br />
62<br />
46<br />
52<br />
46<br />
49<br />
40<br />
39<br />
56<br />
Abb. 20: Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (3j.) insgesamt (Angaben in Prozent)<br />
Bei den Examinierten (3j.) wird der Bedarf insgesamt differenzierter gesehen als <strong>auf</strong> der<br />
Ebene der Leitungsfunktionen:<br />
• Während die Schlüsselqualifikationen relativ gleichmäßig hoch bewertet werden, ist<br />
es <strong>auf</strong>fällig, dass die fachübergreifenden, in den k<strong>auf</strong>männischen <strong>und</strong> datenverarbeitenden<br />
Bereich hineinreichenden Qualifikationsanforderungen deutlich minderbewertet<br />
werden.<br />
• Dagegen spielen die Fachkompetenzen im pflegerischen Bereich eine größere Rolle,<br />
vor allem was die Pflegeplanung <strong>und</strong> -dokumentation sowie neue Pflegeverfahren<br />
betrifft. Hier wird offenbar ein Nachholbedarf formuliert, der sich <strong>auf</strong> moderne Verfahren<br />
<strong>und</strong> Pflegetechniken richtet, bei denen, bezogen <strong>auf</strong> den praktischen Pflegebereich,<br />
Beratungstätigkeiten wie präventive Maßnahmen eine relativ große Rolle<br />
spielen.<br />
• Der Qualifizierungsbedarf für Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz fällt bei dieser Qualifikationsstufe<br />
am höchsten aus.<br />
47
EQUIB<br />
Examinierte Pflegekräfte (1j.)<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz<br />
Pflegeberatung<br />
prävent./rehabil. Beratung<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
Recht<br />
Organisationsentwicklung<br />
Personalplanung/-einsatz<br />
Marketing<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätssicherung<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Umweltschutz<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
Qualitätsbewusstsein<br />
48<br />
6<br />
38<br />
38<br />
44<br />
60<br />
58<br />
49<br />
61<br />
62<br />
52<br />
56<br />
50<br />
66<br />
43<br />
78<br />
74<br />
79<br />
80<br />
80<br />
80<br />
72<br />
94<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
62<br />
62<br />
56<br />
40<br />
42<br />
51<br />
39<br />
38<br />
48<br />
44<br />
50<br />
34<br />
57<br />
Abb. 21: Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (1j.) insgesamt (Angaben in Prozent)<br />
22<br />
26<br />
21<br />
20<br />
20<br />
20<br />
28<br />
• Anders als bei den „Dreijährigen“ wird der Qualifikationsbedarf bei dieser Zielgruppe<br />
insgesamt im Durchschnitt weit geringer eingeschätzt, wenn auch die Gewichtung<br />
der verschiedenen Qualifikationsbereiche vergleichbar ist.<br />
• Bei den konkreten Pflegequalifikationen, soweit sie neue Verfahren, die Dokumentation<br />
<strong>und</strong> die geronto-psychiatrische Befähigung betreffen, wird ein überdurchschnittlicher<br />
Bedarf angemeldet.<br />
• Darüber hinaus sind auch bestimmte Schlüsselqualifikationen wie Verantwortung,<br />
Qualitätsbewusstsein sowie Kooperations- <strong>und</strong> Kommunikationsfähigkeit relativ<br />
bedeutend.<br />
• Bei der fachübergreifenden Qualifikation „Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz“ wird<br />
wie bei den anderen Qualifikationsstufen ebenfalls ein fast 100%iger Bedarf gesehen,<br />
während die übrigen Kriterien in diesem Qualifikationssegment eher unterbewertet<br />
werden.
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
6.3 Qualifikationsbedarf in der stationären Krankenpflege: Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
Personal in Leitungsfunktionen<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz<br />
Pflegeberatung<br />
prävent./rehabil. Beratung<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
Recht<br />
Organisationsentwicklung<br />
Personalplanung/-einsatz<br />
Marketing<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätssicherung<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Umweltschutz<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
Qualitätsbewusstsein<br />
6<br />
6<br />
19<br />
13<br />
13<br />
13<br />
13<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
13<br />
6<br />
6<br />
6<br />
31<br />
100<br />
94<br />
81<br />
88<br />
88<br />
88<br />
100<br />
94<br />
100<br />
88<br />
94<br />
94<br />
94<br />
94<br />
88<br />
100<br />
94<br />
94<br />
94<br />
100<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
Abb. 22: Qualifikationsbedarf für Personal in Leitungsfunktionen der Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
(Angaben in Prozent)<br />
• Es ist ein relativ gleichmäßiger sehr hoher Qualifikationsbedarf in allen Bereichen<br />
<strong>zu</strong> konstatieren.<br />
• Dass die geronto-psychiatrische Kompetenz in der Krankenpflege etwas <strong>zu</strong>rückbleibt,<br />
ist einleuchtend, da diese Qualifikation schwerpunktmäßig in der Altenpflege<br />
erwartet wird.<br />
• Wenn man die Spezifikation Krankenhaus/Fachklinik mit den Resultaten der Bedarfsanalyse<br />
insgesamt für alle Einrichtungen vergleicht, so ergeben sich folgende<br />
markante Unterschiede: Beim Qualitätsbewusstsein, der sozialkommunikativen<br />
Kompetenz, der Personalplanung, beim Recht <strong>und</strong> bei der Pflegedokumentation<br />
wird hier ein 100%iger Bedarf für das Leitungspersonal gesehen (Werte insgesamt<br />
zwischen 80% <strong>und</strong> 90%). Nimmt man dann noch die durchweg hohen Bedarfsmeldungen<br />
in den Feldern BWL, Organisationsentwicklung, Marketing <strong>und</strong> Neue<br />
Technologien da<strong>zu</strong>, zeigt sich, dass im Krankenhausbereich die Umstrukturierung<br />
von öffentlichen Einrichtungen in marktwirtschaftlich organisierte Unternehmungen<br />
69<br />
49
EQUIB<br />
50<br />
voll im Gange ist <strong>und</strong> die Notwendigkeit, diesen Umstrukturierungsprozess mit einer<br />
Qualifizierungsoffensive <strong>zu</strong> flankieren, erkannt ist.<br />
Examinierte Pflegekräfte (3j.)<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz<br />
Pflegeberatung<br />
prävent./rehabil. Beratung<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
Recht<br />
Organisationsentwicklung<br />
Personalplanung/-einsatz<br />
Marketing<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätssicherung<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Umweltschutz<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
Qualitätsbewusstsein<br />
6<br />
12<br />
37<br />
12<br />
19<br />
12<br />
25<br />
12<br />
25<br />
31<br />
37<br />
31<br />
19<br />
19<br />
6<br />
19<br />
19<br />
25<br />
12<br />
19<br />
12<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
94<br />
88<br />
63<br />
88<br />
81<br />
88<br />
75<br />
88<br />
75<br />
69<br />
63<br />
69<br />
81<br />
81<br />
94<br />
81<br />
81<br />
75<br />
88<br />
81<br />
88<br />
Abb. 23: Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (3j.) der Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
(Angaben in Prozent)<br />
• Gegenüber den Leitungsfunktionen fällt das Bedarfsniveau bei den „Dreijährigen“<br />
in Be<strong>zu</strong>g <strong>auf</strong> fast alle Qualifikationskriterien deutlich ab, wobei der Unterschied <strong>auf</strong><br />
der überfachlichen Ebene überproportional größer ist.<br />
• Die Pflegequalifikationen werden mit Ausnahme der geronto-psychiatrischen Kompetenz<br />
als sehr wichtig eingestuft, <strong>dem</strong>gegenüber ist ein geringes Zurückbleiben bei<br />
einigen fachübergreifenden Qualifikationen <strong>zu</strong> konstatieren.<br />
• Dem Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz wird auch hier eine sehr hohe Bedeutung beigemessen.<br />
• Gemessen am Bedarf insgesamt für alle drei Einrichtungsarten wird für diese Funktionsebene<br />
im Krankenhaus ein etwas höherer Pflegekompetenzbedarf – mit Ausnahme<br />
der geronto-psychiatrischen Kompetenz – angegeben.
Examinierte Pflegekräfte (1j.)<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz<br />
Pflegeberatung<br />
prävent./rehabil. Beratung<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
Recht<br />
Organisationsentwicklung<br />
Personalplanung/-einsatz<br />
Marketing<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätssicherung<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Umweltschutz<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
Qualitätsbewusstsein<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
6<br />
31<br />
50<br />
75<br />
75<br />
69<br />
69<br />
69<br />
75<br />
75<br />
75<br />
75<br />
81<br />
81<br />
75<br />
81<br />
94<br />
94<br />
94<br />
94<br />
88<br />
94<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
69<br />
50<br />
25<br />
25<br />
31<br />
31<br />
6<br />
19<br />
6<br />
6<br />
6<br />
12<br />
31<br />
25<br />
Abb. 24: Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (1j.) der Krankenhäuser/Fachkliniken<br />
(Angaben in Prozent)<br />
• Mit Ausnahme der Qualifikationsbereiche Pflegeverfahren <strong>und</strong> -dokumentation <strong>und</strong><br />
beim Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz ist der Qualifizierungsbedarf insgesamt <strong>auf</strong><br />
dieser Stufe deutlich weniger prägnant.<br />
• Bemerkenswert ist für diese Qualifikationsebene der geringe Bedarf bei den Schlüsselqualifikationen.<br />
Dieses Resultat bedeutet, dass Kompetenzen wie „Verantwortungsbereitschaft“,<br />
„Qualitätsbewusstsein“ etc. <strong>auf</strong> den Arbeitsplätzen mit geringerer<br />
Qualifikation heut<strong>zu</strong>tage wie auch künftig offenbar keine so große Rolle <strong>zu</strong>erkannt<br />
werden soll.<br />
• Weiter <strong>auf</strong>fallend sind die explizit geringen Bedarfsangaben im Feld der fachübergreifenden<br />
Qualifikationen. Es drängt sich die Interpretation <strong>auf</strong>, dass der Umstrukturierungsprozess<br />
im Krankenhaus weitestgehend <strong>auf</strong> die höheren Qualifikationsstufen<br />
beschränkt bleibt <strong>und</strong> diese Pflegekräfte (1j.) nur die notwendigen neuen fachlichen<br />
Pflegequalifikationen erhalten werden.<br />
25<br />
25<br />
25<br />
19<br />
19<br />
25<br />
51
EQUIB<br />
6.4 Qualifikationsbedarf in der stationären Altenpflege: Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
Personal in Leitungsfunktionen<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation 16<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren 25<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz 25<br />
Pflegeberatung 13<br />
prävent./rehabil. Beratung 16<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
34<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling 22<br />
Recht 22<br />
Organisationsentwicklung 22<br />
Personalplanung/-einsatz 16<br />
Marketing 25<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng 22<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen 13<br />
Qualitätssicherung 3<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz 3<br />
Umweltschutz 9<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
34<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
41<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
31<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
31<br />
Qualitätsbewusstsein 25<br />
52<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
84<br />
75<br />
75<br />
88<br />
84<br />
66<br />
78<br />
78<br />
78<br />
84<br />
75<br />
78<br />
88<br />
97<br />
97<br />
91<br />
66<br />
59<br />
69<br />
69<br />
75<br />
Abb. 25: Qualifikationsbedarf für Personal in Leitungsfunktionen der stationären Altenpflege (Angaben<br />
in Prozent)<br />
• Die Spitzen des Bedarfs liegen bei den Qualifizierungsfeldern Qualitätssicherung,<br />
Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz sowie Umweltschutz.<br />
• Die übrigen Bedarfe für das Personal in Leitungsfunktionen sind ungefähr gleichmäßig<br />
verteilt, wobei im Bereich der Schlüsselqualifikationen ein relativ geringerer<br />
Bedarf gesehen wird, als bei den fachlichen- bzw. fachübergreifenden Qualifikationen.<br />
In diesem Bereich gibt es einen deutlichen Unterschied <strong>zu</strong> den Krankenhäusern,<br />
die gerade den Schlüsselqualifikationen eine hohe Priorität <strong>zu</strong>weisen. Auch für<br />
die Pflegequalifikationen ist dieser Unterschied prägnant. 41<br />
41 Ein Rückschluss <strong>auf</strong> das Qualifikationsniveau in den Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheimen im Vergleich <strong>zu</strong><br />
den Krankenhäusern aus diesem Bef<strong>und</strong> ist nicht <strong>zu</strong>lässig, da hier nach <strong>dem</strong> künftigen Bedarf gefragt<br />
wurde. Der relativ geringere Bedarf kann sich aus schon in der Vergangenheit erfolgter Qualifizierung<br />
ergeben.
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
• Interessant ist, dass in Sachen Umweltschutz, Qualitätssicherung, Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
obiger Bef<strong>und</strong> im Verhältnis <strong>zu</strong> den Krankenhäusern nicht bestätigt<br />
wird. Hier wird ein geringfügig höherer Bedarf für das Leitungspersonal in der Altenpflege<br />
angemeldet.<br />
Examinierte Pflegekräfte (3j.)<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz<br />
Pflegeberatung<br />
prävent./rehabil. Beratung<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
Recht<br />
Organisationsentwicklung<br />
Personalplanung/-einsatz<br />
Marketing<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätssicherung<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Umweltschutz<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
Qualitätsbewusstsein<br />
3<br />
19<br />
13<br />
13<br />
22<br />
25<br />
16<br />
16<br />
22<br />
25<br />
38<br />
38<br />
38<br />
47<br />
53<br />
72<br />
63<br />
66<br />
63<br />
75<br />
78<br />
97<br />
81<br />
88<br />
88<br />
78<br />
75<br />
84<br />
84<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
78<br />
75<br />
63<br />
63<br />
63<br />
53<br />
47<br />
28<br />
38<br />
34<br />
38<br />
25<br />
22<br />
Abb. 26: Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (3j.) der stationären Altenpflege (Angaben<br />
in Prozent)<br />
• Für die Pflege- <strong>und</strong> Schlüsselqualifikationen werden insgesamt die höchsten Bedarfe<br />
gemeldet.<br />
• Bezogen <strong>auf</strong> einzelne Qualifizierungsfelder liegen die Nennungen für Arbeits- <strong>und</strong><br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz, neue Pflegeverfahren <strong>und</strong> geronto-psychiatrische Kompetenz an<br />
der Spitze. Ein überdurchschnittlicher „Nachholbedarf“ für diese letztgenannte<br />
Qualifikation wurde auch in den zahlreichen Expertengesprächen immer wieder<br />
hervorgehoben.<br />
• Auffällig, aber für diese Qualifikationsebene nicht untypisch, ist, dass die Pflegequalifikationen<br />
<strong>auf</strong> einen überproportionalen Bedarf stoßen, während die überfachlichen<br />
Fähigkeiten der Organisation, der Geschäftsabwicklung etc. offenbar schwerpunktmäßig<br />
den Leitungsfunktionen vorbehalten sind.<br />
53
EQUIB<br />
• Der Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz ist <strong>auf</strong> dieser Ebene bedarfsdominierend, ein<br />
Ergebnis, das sich genau so wie das Qualitätsbewusstsein <strong>und</strong> die Qualitätssicherung<br />
von <strong>dem</strong> Bef<strong>und</strong> <strong>auf</strong> der Leitungsebene allerdings nur unwesentlich unterscheidet.<br />
Examinierte Pflegekräfte (1j.)<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz<br />
Pflegeberatung<br />
prävent./rehabil. Beratung<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
Recht<br />
Organisationsentwicklung<br />
Personalplanung/-einsatz<br />
Marketing<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätssicherung<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Umweltschutz<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
Qualitätsbewusstsein<br />
54<br />
3<br />
47<br />
34<br />
38<br />
59<br />
56<br />
47<br />
81<br />
78<br />
78<br />
81<br />
84<br />
81<br />
69<br />
50<br />
28<br />
59<br />
59<br />
66<br />
50<br />
75<br />
97<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
53<br />
66<br />
63<br />
41<br />
44<br />
53<br />
19<br />
22<br />
22<br />
19<br />
16<br />
19<br />
31<br />
50<br />
72<br />
41<br />
41<br />
34<br />
50<br />
25<br />
Abb. 27: Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (1j.) der stationären Altenpflege (Angaben<br />
in Prozent)<br />
• Insgesamt ist der Qualifikationsbedarf für die Helferfunktionen im Verhältnis <strong>zu</strong> den<br />
höher Qualifizierten geringer ausgeprägt.<br />
• Der Bedarf dominiert in dieser Qualifikationsstufe bei den Pflegequalifikationen,<br />
aber auch das Qualitätsbewusstsein wird hoch <strong>und</strong> der Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
sehr hoch eingeschätzt. Dieses Ergebnis ist gegenüber den anderen Qualifikationsstufen<br />
jedoch nicht spezifisch.<br />
• Erwartungsgemäß fallen die Meldungen für die übrigen überfachlichen Qualifikationen<br />
am geringsten aus, wenn auch höher als im Krankenhaussektor.<br />
• Auffällig sind die im Verhältnis <strong>zu</strong> den examinierten Pflegekräften (3j.) auch hier<br />
insgesamt geringeren Bedarfsmeldungen bei den persönlichen <strong>und</strong> sozialen Kompetenzen.
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
6.5 Qualifikationsbedarf in der ambulanten Pflege: Häusliche Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste<br />
Personal in Leitungsfunktionen<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation 12<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren 12<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz 21<br />
Pflegeberatung 7<br />
prävent./rehabil. Beratung 10<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz 17<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling 5<br />
Recht 5<br />
Organisationsentwicklung 10<br />
Personalplanung/-einsatz 12<br />
Marketing 9<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng 12<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen 10<br />
Qualitätssicherung 2<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz 7<br />
Umweltschutz 14<br />
soziale/kommunikative Kompetenz 19<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit 10<br />
Verantwortungsbereitschaft 14<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit 10<br />
Qualitätsbewusstsein 10<br />
88<br />
88<br />
79<br />
93<br />
90<br />
83<br />
95<br />
95<br />
90<br />
88<br />
91<br />
88<br />
90<br />
98<br />
93<br />
86<br />
81<br />
90<br />
86<br />
90<br />
90<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
Abb. 28: Qualifikationsbedarf für Personal in Leitungsfunktionen der häuslichen Pflege (Angaben in<br />
Prozent)<br />
• Der Qualifikationsbedarf bei den Leitungsfunktionen der häuslichen Pflegedienste<br />
ist relativ gleichmäßig <strong>auf</strong> alle Qualifizierungskriterien verteilt. Er liegt im hohen<br />
Bereich (um 90%), mit geringer Abweichung nach unten bei der geronto-psychiatrischen<br />
<strong>und</strong> der interkulturellen Pflegekompetenz sowie der sozial/kommunikativen<br />
Kompetenz. Er weist die bei Altenpflegeeinrichtungen diagnostizierten Schwankungen<br />
zwischen Fach-, überfachlichen <strong>und</strong> Schlüsselqualifikationen nicht im gleichen<br />
Maße <strong>auf</strong>.<br />
• Die ambulanten Pflegeeinrichtungen, deren Anzahl seit Einführung der Pflegeversicherung<br />
kontinuierlich gewachsen ist, sind in der Mehrzahl kleinere Einrichtungen,<br />
bei denen die Leitung alle Aufgaben kompetent beherrschen muss. Dass sich<br />
das leitende Personal verstärkt <strong>auf</strong> Markt- <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enorientierung als das Erfolgskriterium<br />
eines Dienstleistungsunternehmens einstellt, zeigen die sehr hohen Bedarfsmeldungen<br />
im Segment der überfachlichen Qualifikationen.<br />
55
EQUIB<br />
Examinierte Pflegekräfte (3j.)<br />
56<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz<br />
Pflegeberatung<br />
prävent./rehabil. Beratung<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
Recht<br />
Organisationsentwicklung<br />
Personalplanung/-einsatz<br />
Marketing<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätssicherung<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Umweltschutz<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
Qualitätsbewusstsein<br />
7<br />
14<br />
14<br />
17<br />
24<br />
19<br />
17<br />
33<br />
19<br />
24<br />
21<br />
26<br />
21<br />
40<br />
52<br />
50<br />
57<br />
50<br />
57<br />
59<br />
52<br />
93<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
86<br />
86<br />
83<br />
76<br />
81<br />
83<br />
67<br />
81<br />
76<br />
79<br />
74<br />
79<br />
60<br />
48<br />
50<br />
43<br />
50<br />
43<br />
41<br />
48<br />
Abb. 29: Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (3j.) in der häuslichen Pflege (Angaben in<br />
Prozent)<br />
• Für die examinierten Pflegekräfte (3j.) wird der höchste Qualifizierungsbedarf für<br />
den Bereich Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz (93%) angegeben.<br />
• Darüber hinaus stehen die <strong>modernen</strong> Pflegekompetenzen <strong>und</strong> Schlüsselqualifizierungen<br />
an der Spitze der Bedarfsskala. Für diese Ebene scheint sich ein Nachholbedarf<br />
<strong>zu</strong> ergeben, der u.U. auch damit <strong>zu</strong>sammenhängt, dass sich gerade bei den<br />
dreijährig Qualifizierten im häuslichen Pflegebereich eine Veränderung im Qualifikationsprofil<br />
durch veränderte Arbeitsanforderungen ergibt, die aus den Umstrukturierungen<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesen hin <strong>zu</strong> Humandienstleistern herrühren.<br />
• Was die fachübergreifenden, insbesondere die k<strong>auf</strong>männisch orientierten Qualifikationen<br />
betrifft, so liegen sie im Verhältnis <strong>zu</strong>r stationären Altenpflege in einem<br />
deutlich höheren Bedarfsbereich. Es scheint also für die häusliche Pflege für dreijährig<br />
ausgebildete Pflegekräfte wichtig <strong>zu</strong> sein, über Qualifikationen <strong>zu</strong> verfügen, die<br />
da<strong>zu</strong> befähigen, sich marktorientiert <strong>und</strong> k<strong>auf</strong>männisch <strong>zu</strong> verhalten, wo<strong>zu</strong> im weiteren<br />
Sinn die Managementfähigkeiten zählen, die nicht schon durch den Kanon der<br />
Schlüsselqualifikationen erfasst werden. Im ambulanten Pflegebereich scheint <strong>auf</strong>
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
dieser Qualifikationsstufe vermehrt die Übernahme von (Teil-)Leitungsfunktionen<br />
in Eigenverantwortung erwartet <strong>zu</strong> werden.<br />
Examinierte Pflegekräfte (1j.)<br />
Pflegeplanung/-prozeß/-dokumentation<br />
Anw. neuer Pflegeverfahren<br />
geronto-psychiatr. Kompetenz<br />
Pflegeberatung<br />
prävent./rehabil. Beratung<br />
Interkulturelle Pflegekompetenz<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling<br />
Recht<br />
Organisationsentwicklung<br />
Personalplanung/-einsatz<br />
Marketing<br />
IuK-Tech./-Vernet<strong>zu</strong>ng<br />
EDV-Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätssicherung<br />
Arbeits- u. <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Umweltschutz<br />
soziale/kommunikative Kompetenz<br />
Komp. f. interdisziplinäre Teamarbeit<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
arb.org. Gestaltungskomp./Planungsfähigkeit<br />
Qualitätsbewusstsein<br />
7<br />
33<br />
36<br />
38<br />
43<br />
38<br />
41<br />
38<br />
43<br />
55<br />
55<br />
52<br />
60<br />
69<br />
69<br />
74<br />
74<br />
71<br />
76<br />
76<br />
64<br />
93<br />
kein Bedarf Bedarf<br />
67<br />
64<br />
62<br />
62<br />
62<br />
57<br />
57<br />
45<br />
45<br />
48<br />
40<br />
31<br />
31<br />
26<br />
26<br />
29<br />
24<br />
24<br />
36<br />
Abb. 30: Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (1j.) in der häuslichen Pflege (Angaben in<br />
Prozent)<br />
• Der Bef<strong>und</strong> für die Helferberufe fällt bezogen <strong>auf</strong> die Bedarfsnennungen insgesamt<br />
deutlich geringer aus als bei den Pflegefachkräften. Nur im Bereich Arbeits- <strong>und</strong><br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz wird ein nahe<strong>zu</strong> 100% Bedarf gemeldet.<br />
• In der häuslichen Pflege bekommen in der Kategorie der „Einjährigen“ Schlüsselqualifikationen<br />
<strong>und</strong> <strong>zu</strong>kunftsorientierte Pflegequalifikationen ein bei weitem größeres<br />
Gewicht gegenüber den überfachlichen Qualifikationselementen. Das hier konstatierte<br />
Übergewicht dieser Qualifikationssegmente lässt u.E. den Schluss <strong>zu</strong>, dass<br />
in der ambulanten Pflege die Arbeitsteilung zwischen den Qualifikationsebenen weniger<br />
strikt gehandhabt wird, dass hier <strong>auf</strong> selbständiges teamorientiertes Arbeitsverhalten<br />
auch dieser Pflegekräfte großer Wert gelegt wird.<br />
57
EQUIB<br />
6.6 Fazit <strong>und</strong> Empfehlungen<br />
Als erstes sind die durchweg hohen Qualifikationsbedarfsmeldungen aller untersuchten<br />
Einrichtungen der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong> hervor<strong>zu</strong>heben.<br />
Die technischen <strong>und</strong> organisationsstrukturellen Veränderungen (vgl. Kap. 5) in dieser<br />
Branche stellen notwendigerweise neue Arbeits- <strong>und</strong> Aufgabenanforderungen an die<br />
Beschäftigten aller Hierarchiestufen. Ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Qualifikationsbedarfsanalyse<br />
ist, dass die Verantwortlichen erkannt haben, dass die Umstrukturierung<br />
der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong> <strong>zu</strong> <strong>modernen</strong> Dienstleistern einer<br />
qualifikatorischen Flankierung <strong>auf</strong> Seiten der Humanressourcen bedarf.<br />
• Qualifizierungsbedarf für Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
Auffallend sind die z.T. fast 100%igen Bedarfsmeldungen für dieses Qualifizierungssegment,<br />
die quer durch alle Einrichtungen <strong>und</strong> für alle Qualifikationsebenen angegeben<br />
werden.<br />
Diese Bedarfsmeldungen dürften sich einmal aus <strong>dem</strong> Arbeitsschutzgesetz ergeben, das<br />
für Ende 1999 die letzte Frist für die Durchführung von arbeitsplatzbezogenen Gefährdungsanalysen,<br />
die eine Unterweisung/Unterrichtung der Mitarbeiter über potenzielle<br />
ges<strong>und</strong>heitliche Gefährdungen sowie deren Vermeidung miteinschließen, vorsieht. Da<br />
alle Einrichtungen ungeachtet ihrer Beschäftigtenzahl <strong>und</strong> ihres Rechtsstatus unter dieses<br />
Gesetz fallen, haben alle Einrichtungen einen entsprechenden Handlungsbedarf.<br />
Zum zweiten steigen die ges<strong>und</strong>heitlichen, körperlichen wie psychischen Belastungen<br />
der in diesem Sektor Beschäftigten als Folge der Entwicklung <strong>zu</strong>m Dienstleistungssektor<br />
in Kombination mit der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>reform <strong>und</strong> der Pflegeversicherung, die mit reduzierten<br />
Budgets qualitäts- <strong>und</strong> k<strong>und</strong>enorientierte Dienstleistungen verlangen, an. Dieses<br />
Urteil jedenfalls wird u.a. von den befragten Experten wie auch den Berufsgenossenschaften<br />
vertreten <strong>und</strong> ist in Untersuchungen 42 belegt. Die Folgen dieser Belastungen<br />
machen sich u.a. im eingeschränkten Arbeitseinsatz des Pflegepersonals geltend, der<br />
sich in der Qualität <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enorientierung der Pflegeleistungen zeigen kann oder manifestieren<br />
sich in Arbeitsunfähigkeit/Krankheit.<br />
Bemerkenswert ist, dass die Einrichtungen aus diesen beiden Momenten, der rechtlichen<br />
Verpflichtung wie den ges<strong>und</strong>heitlichen Belastungen für die Beschäftigten, den Schluss<br />
gezogen haben, einen Qualifizierungsschwerpunkt im Bereich Arbeitsschutz <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>förderung<br />
<strong>zu</strong> setzen. Diese Qualifizierungsinhalte sind insofern als Bestandteil<br />
der Pflegeausbildung an<strong>zu</strong>sehen, als sie die Kenntnisse über sowie den ges<strong>und</strong>heitsgerechten<br />
(<strong>und</strong> damit leistungserhaltenden) Umgang mit potenziellen Gefährdungen der<br />
Pflegearbeit thematisieren (z.B. Schutz vor Infektionen, rückenschonendes Heben).<br />
Konsequent ist die Meldung entsprechender Qualifizierungsbedarfe für alle Qualifika-<br />
42 Vgl.: Referat von Dr. Siegfried Weyerer vom Zentralinstitut für seelische Ges<strong>und</strong>heit in Mannheim <strong>auf</strong><br />
<strong>dem</strong> Ersten Landespflegetag in Stuttgart (12/98). In: Pflegezeitschrift 2/99, S. 90ff.<br />
Vgl.: In der Altenpflege mehr Stress für Beschäftigte. In: Arbeit&Ökologie-Briefe Nr. 9 vom 5. Mai<br />
1999. AiB Verlag GmbH, Köln 1999.<br />
58
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
tionsstufen, da Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz nur als ganzheitlicher Prozess im Unternehmen<br />
seine ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Wirkungen entfalten kann. Wenn die Leitung<br />
Schutzmaßnahmen (Impfungen, Tragen von Handschuhen, Hebehilfen usw.) <strong>zu</strong>r Verfügung<br />
stellt, müssen sie von den Pflegekräften auch in die Pflegearbeit integriert <strong>und</strong><br />
praktiziert werden.<br />
Empfehlung<br />
Spezifische <strong>auf</strong> diese <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>dienstleistungseinrichtungen <strong>zu</strong>geschnittene ganzheitliche<br />
Beratungs- <strong>und</strong> Qualifizierungsangebote, z.B. Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutzmanagementsysteme,<br />
fehlen in der Region Bremen/Bremerhaven. Angesichts des<br />
hohen gemeldeten Bedarfs der Einrichtungen sollte überlegt werden, wie <strong>zu</strong> einzelnen<br />
Bereichen bestehende Angebote (Stressprävention, Rückenschule usw.) <strong>zu</strong> einem Gesamtpaket<br />
ergänzt <strong>und</strong> eventuell in Modellprojekten <strong>zu</strong>r betrieblichen <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>förderung<br />
bei <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong>n durchgeführt werden könnten.<br />
• Qualifizierungsfeld Umweltschutz<br />
Auch in diesem Bereich finden sich vor allem für das Leitungspersonal aller Einrichtungsarten<br />
sehr hohe Bedarfsmeldungen. Neben rechtlichen Kenntnissen sind Verfahren<br />
der Integration von Umweltschutz<strong>auf</strong>lagen <strong>auf</strong> arbeitsorganisatorischer Ebene <strong>zu</strong> klären.<br />
Beratungsangebote <strong>zu</strong>geschnitten <strong>auf</strong> die Belange (z.B. Gefahrstoff-, Abfallbeseitigung<br />
bei medizinischen Hilfsmitteln, Medikamenten, Desinfektionsmitteln usw.) dieses Sektors<br />
werden nachgefragt.<br />
Empfehlung<br />
Es bietet sich an, den Umweltschutz in Verfahren <strong>und</strong> Systemen <strong>zu</strong>m Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
<strong>und</strong> Qualitätssicherung <strong>zu</strong> integrieren (Integrierte Managementsysteme).<br />
• Qualitätssicherung (überfachliche Qualifikation) <strong>und</strong> Qualitätsbewusstsein<br />
(Schlüsselqualifikation)<br />
Als weiteres Qualifikationssegment ist in allen Einrichtungen, wenn auch abgestuft<br />
nach den drei Qualifikationsebenen, die Qualitätssicherung als Implementation eines<br />
abprüfbaren Verfahrens wie als extrafunktionale Kompetenz des Einzelnen <strong>zu</strong> identifizieren.<br />
Zum einen sind diese Qualifikationsbedarfsmeldungen sicherlich begründet in der mit<br />
der Pflegeversicherung (vgl. Kap. 5.1) festgeschriebenen Verpflichtung, Qualitätssicherung<br />
<strong>zu</strong> betreiben; <strong>zu</strong>m anderen setzen alle Einrichtungen <strong>auf</strong> die Schulung eines Qualitätsbewusstseins<br />
ihrer Mitarbeiter, sehen also die Notwendigkeit, Qualität jeder einzelnen<br />
Pflegeleistung <strong>zu</strong> einem der wichtigsten Kriterien ihres Dienstleistungsangebots<br />
<strong>zu</strong> erklären.<br />
59
EQUIB<br />
Analog <strong>zu</strong> <strong>dem</strong> Qualifikationssegment Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz kann auch hier<br />
nur ein ganzheitlicher Ansatz, der die Einrichtungen als „lernende Unternehmen“ begreift,<br />
<strong>auf</strong> Dauer Erfolg, sprich Durchset<strong>zu</strong>ng <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> Markt der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>diensteanbieter,<br />
versprechen.<br />
Empfehlung<br />
Ausgehend von Forderungen nach Qualitätssicherungsverfahren, die speziell <strong>auf</strong> die<br />
Pflegesituation <strong>zu</strong>geschnitten sind 43 , sollte angesichts der hohen Bedarfsmeldungen<br />
überlegt werden, ob auch hier die unterschiedlichen Angebote <strong>und</strong> Ansätze in der Region<br />
gebündelt <strong>und</strong> <strong>zu</strong> einem solchen einrichtungsspezifischen Modellprojekt weiterentwickelt<br />
werden könnten, das Qualifizierung der Mitarbeiter, Beratung bei den<br />
Schritten der Implementation sowie Hilfestellung bei der Anerkennung/Zertifizierung<br />
kombiniert. Ein Beratungs- <strong>und</strong> Qualifizierungsprojekt für Qualitätssicherung könnte<br />
<strong>auf</strong> <strong>dem</strong> „Bremer Qualitätssiegel für ambulante Pflegedienste“ beruhen <strong>und</strong> Weiterentwicklungen<br />
für andere Bereiche initiieren. Für den Bedarf solcher spezifischen Qualifizierungs-<br />
<strong>und</strong> Beratungsangebote sprechen auch Modellprojekte, die in anderen Regionen<br />
angeregt wurden. 44<br />
Im Hinblick <strong>auf</strong> die hohen Handlungsbedarfe im Bereich Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>sowie<br />
Umweltschutz ist an die Entwicklung von Schnittstellen des Qualitätsmanagements<br />
<strong>zu</strong> diesen Bereichen bzw. von Integrierten Managementsystemen speziell für diesen<br />
Sektor <strong>zu</strong> denken.<br />
• Qualifizierungsbedarf (nicht nur) für das Leitungspersonal<br />
Für die übrigen überfachlichen Qualifikationen bezogen <strong>auf</strong> die Schwerpunkte<br />
Führungs- <strong>und</strong> Managementkompetenzen (Recht, BWL, Marketing, Personal- <strong>und</strong> Organisationsentwicklung)<br />
wurden durchweg sehr hohe (im Durchschnitt über 85 – 90%)<br />
Bedarfsmeldungen für das Personal in Leitungsfunktionen abgegeben. Dieselbe Aussage<br />
trifft <strong>auf</strong> den Bereich der neuen IuK-Technologien/Netzwerke/EDV <strong>zu</strong>.<br />
Mit <strong>dem</strong> Qualifikationsniveau sinken in der Tendenz auch die angegebenen Bedarfe<br />
(wenn auch wie ausgeführt einrichtungsspezifisch unterschiedlich). Bemerkenswert ist,<br />
dass der Modernisierungs-, Professionalisierungs- <strong>und</strong> Umstrukturierungsprozess<br />
(Stichworte: Dezentralisierung, Profit-Center, K<strong>und</strong>enorientierung, Prävention, Rehabi-<br />
43<br />
Vgl. „Berliner Memorandum“, <strong>auf</strong> das bereits im Kap. 5.1 hingewiesen wurde.<br />
44<br />
Vgl.: Deutscher Verein für Qualitätsmanagement in Sozialen Dienstleistungsunternehmen e.V. Quelle:<br />
http://www.qmsd.de/<br />
Vgl.: Informationsdienst Wissenschaft: Qualitätsmanagement im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesen. Quelle:<br />
http://www.fh-luebeck.de/aktuelles vom 19. Oktober 1999<br />
Vgl.: BÄK-Intern, Köln 15. März 1999: Auf der Basis eines offenen Rahmenvertrages haben die B<strong>und</strong>esärztekammer<br />
<strong>und</strong> der Verband der Angestellten-Krankenkassen/Arbeiter-Ersatzkassen-Verband ein<br />
erstes Konzept <strong>zu</strong>r Beurteilung <strong>und</strong> Zertifizierung von Krankenhäusern vorgelegt. Darüber hinaus beteiligen<br />
sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat <strong>und</strong> die proCUM Cert GmbH an<br />
diesem Zertifizierungsprojekt. Mit diesem Projekt wird den bestehenden <strong>und</strong> un<strong>zu</strong>länglichen Verfahren<br />
aus <strong>dem</strong> industriellen Bereich (DIN ISO 9000) ein schlüssiges krankenhausspezifisches Verfahren entgegengesetzt.<br />
60
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
litation) des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegesektors von den Verantwortlichen noch umfangreiche<br />
Qualifizierungsanstrengungen <strong>zu</strong> verlangen scheint.<br />
Empfehlung<br />
Da gerade dieser Sektor eine wichtige Rolle für die Stärkung des regionalen Dienstleistungssektors<br />
spielt, sollte das schon bestehende Angebot in der Region <strong>auf</strong> seine<br />
Bedarfsdeckung hin überprüft werden <strong>und</strong> gegebenenfalls vor allem durch handlungsorientierte<br />
Angebote im Bereich der Personal- <strong>und</strong> Organisationsentwicklung ergänzt<br />
werden; gemeint sind damit Beratungs- <strong>und</strong> Qualifizierungsangebote, die Theorie <strong>und</strong><br />
direkte einrichtungsspezifische Umset<strong>zu</strong>ngsstrategien (z.B. durch Coaching) kombinieren.<br />
Zum zweiten ist die Bedeutung der neuen Technologien für den ganzen Sektor unübersehbar;<br />
sie werden alle gewohnten Pflegetätigkeiten sowie Verwaltungs- <strong>und</strong> Organisations<strong>auf</strong>gaben<br />
tangieren. Weiterbildungsangebote hier sollten sich nicht nur <strong>auf</strong> die<br />
Vermittlung technischer Kompetenzen beschränken, sondern auch da<strong>zu</strong> beitragen, die<br />
Einsatzmöglichkeiten hinsichtlich arbeitserleichternder <strong>und</strong> –einsparender technikbasierter<br />
Prozesse <strong>auf</strong><strong>zu</strong>zeigen. 45 Den gerade dieses Wissen – das zeigten auch die Expertengespräche<br />
– ist Vorausset<strong>zu</strong>ng für eine <strong>zu</strong>kunftsweisende <strong>und</strong> wettbewerbsentscheidende<br />
Planung <strong>zu</strong>r Implementation neuer Technologien. Auf diesem Sektor werden –<br />
gerade weil die technischen Möglichkeiten neu <strong>zu</strong> erschließen sind – <strong>zu</strong>r Zeit kontinuierlich<br />
neue Produkte <strong>auf</strong> den Markt gebracht bzw. innovative technologische Projektvorhaben<br />
gestartet. 46<br />
Die Einrichtungen benötigen Experten, die den Pflegesektor <strong>und</strong> den sich neu entwikkelnden<br />
Pflegetechniksektor kennen, als kompetente Technik-Berater. Zu überlegen<br />
wäre die öffentliche Förderung solcher Experten, die <strong>zu</strong><strong>dem</strong> eine Vernet<strong>zu</strong>ng des ganzen<br />
Sektors vorantreiben könnten. 47<br />
• Fachspezifischer Qualifizierungsbedarf<br />
Auffallend ist, dass auch in diesem Segment das Personal in Leitungsfunktionen den<br />
höchsten Bedarf anmeldet (im Durchschnitt ähnliche Prozentzahlen um 80 – 90% wie<br />
für die übrigen Qualifikationen). Eine Arbeitsteilung streng nach Leitungs- <strong>und</strong> ausführenden<br />
Arbeiten scheint in diesem Sektor nicht durchgängig ausgeprägt <strong>zu</strong> sein.<br />
45<br />
Vgl. die Studie des Centrums für Krankenhausmanagement (CKM) der Universität Münster: Krankenhäuser<br />
nutzen Internet nicht optimal. „Mehr als zwei Drittel der befragten Krankenhäuser messen <strong>dem</strong><br />
Internet zwar eine hohe strategische Bedeutung bei, haben aber keine Vorstellung, wie sie es aktiv einsetzen<br />
können.“ Quelle: http://www.gnn.de/0001/00011006-ji.html vom 10. Januar 2000<br />
46<br />
Vgl.: Informationsdienst Wissenschaft: Forum für Krankenhaus-Software. Quelle: http://idw.tuclausthal.de/<br />
vom 18. Januar 2000<br />
Vgl.: Informationsdienst Wissenschaft: Dienstpläne aus <strong>dem</strong> Computer. Quelle: http:// idw.tuclausthal.de/<br />
vom 15. Februar 2000<br />
47<br />
Das schon an anderer Stelle ausgeführte Projekt „<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Soziallotse Bremerhaven“ ist ein<br />
erster guter Schritt in die angedachte Richtung.<br />
61
EQUIB<br />
Für das dreijährig qualifizierte Pflegepersonal bildet dieses Qualifikationssegment<br />
erwartungsgemäß den Schwerpunkt aller Bedarfsmeldungen. Die neuen fachlichen<br />
Kompetenzen, z.T. durch die Nut<strong>zu</strong>ng neuer IuK-Technologien, z.T. durch die neu <strong>auf</strong><br />
die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>dienstleister <strong>zu</strong>kommenden Aufgaben (z.B. Pflege <strong>zu</strong>nehmend älterer,<br />
oft psychisch kranker Menschen) bestimmt, erfordern breite Qualifizierungsanstrengungen<br />
(im Durchschnitt 80% Angaben). Aber auch hier ist eine abfallende Kurve der Bedarfsmeldungen<br />
für die Helferberufe (wenn auch differenziert in den einzelnen Einrichtungsarten)<br />
<strong>zu</strong> konstatieren.<br />
Empfehlung<br />
Da das Angebot in diesem Segment – <strong>zu</strong>m großen Teil durch interne Maßnahmen abgedeckt,<br />
z.T. durch geförderte Projekte unterstützt – ausreichend erscheint, kann angesichts<br />
der hohen Bedarfsmeldungen nur die Empfehlung gegeben werden, das Niveau<br />
<strong>und</strong> auch die öffentliche Projektförderung <strong>auf</strong>recht<strong>zu</strong>erhalten. Da auch in anderen<br />
deutschen Regionen wie im europäischen Ausland ähnliche Anstrengungen <strong>zu</strong>r Entwicklung<br />
innovativer Qualifizierungsmaßnahmen unternommen werden, könnte ein<br />
Informationsaustausch eventuell <strong>zu</strong> neuen Ideen <strong>und</strong> Synergien für die hiesige Region<br />
führen.<br />
• Qualifizierungsbedarf für Schlüsselqualifikationen<br />
Für alle Qualifikationsebenen, angeführt vom Leitungspersonal abgestuft bei den Helferberufen,<br />
werden hier im Bereich der extrafunktionalen Kompetenzen Defizite<br />
gesehen. Neue Formen der Arbeitsorganisation, eine Neuausrichtung der Aufgaben hin<br />
<strong>zu</strong>m K<strong>und</strong>en erfordert konsequenterweise – soll die Neudefinition des pflegerischen<br />
Selbstverständnisses <strong>und</strong> neuer Berufsbilder gelingen – neue personale, soziale <strong>und</strong><br />
kommunikative Kompetenzen. Diese Kompetenzen sind kein fassbarer Lehrgegenstand<br />
wie z.B. Dokumentationsverfahren, sondern betreffen in der Regel Einstellungen <strong>und</strong><br />
Haltungen in der täglichen Berufsausübung sowie Fähigkeiten im Umgang mit anderen<br />
Menschen.<br />
Am besten werden diese Kompetenzen in der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung <strong>zu</strong>m Beruf gelernt,<br />
wenn die Methodik <strong>und</strong> Didaktik den Erwerb extrafunktionaler Qualifikationen<br />
befördert <strong>und</strong> fordert. Teamfähigkeit usw. wird durch Bearbeitung von Aufgaben in der<br />
Form von Team-/Projektarbeit gelernt. Kommunikative Kompetenzen werden erworben,<br />
wenn die Gelegenheit besteht, sich über Probleme/Themen auseinander<strong>zu</strong>setzen,<br />
Rollen <strong>zu</strong> tauschen usw.<br />
Zum zweiten spielt die Unternehmensphilosophie bzw. -führung eine entscheidende<br />
Rolle für die Ausbildung dieser Fähigkeiten. Teamfähigkeit <strong>und</strong> autoritärer Führungsstil<br />
passen nicht <strong>zu</strong>sammen.<br />
Empfehlung<br />
Insofern sind die hohen Bedarfsmeldungen eine Aufforderung an die Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsanbieter,<br />
verstärkt die Förderung dieser extrafunktionalen Kompetenzen in die<br />
Konzeption <strong>und</strong> Entwicklung ihrer Angebote <strong>zu</strong> integrieren. Moderne Lern- <strong>und</strong><br />
Lehrformen, die selbstständiges, selbstverantwortliches Lernen fördern, Projektarbeit<br />
62
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
anbieten, die Vermittlung von Moderationstechniken einschließen <strong>und</strong> die nicht <strong>zu</strong>letzt<br />
auch die Neuen Medien als Lernmittel, z.B. Internetrecherche, einsetzen, sind für die<br />
Erfüllung dieser Anforderung nötig.<br />
Schlussempfehlungen: Koordinierungsstelle – Informationsnetzwerk – Modellprojekte<br />
In dieser Untersuchung konnten qualifikatorische Implikationen eines sozialen <strong>und</strong><br />
ökonomischen Wandlungsprozesses in Einrichtungen der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
in der Region Bremen identifiziert werden, die im Zuge technologisch <strong>und</strong><br />
arbeitsorganisatorisch induzierter Innovationen in diesem Sektor relevant sind oder <strong>zu</strong>künftig<br />
relevant werden. Die Notwendigkeit, <strong>auf</strong> diese Entwicklungen mit <strong>zu</strong>kunftsorientierten<br />
Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsaktivitäten <strong>zu</strong> reagieren, kann <strong>auf</strong> lange Sicht arbeitsplatzrelevante<br />
Stabilisierungswirkungen für dieses Arbeitsmarktsegment zeitigen. Es<br />
erscheint daher sinnvoll, <strong>auf</strong> der ges<strong>und</strong>heits- wie arbeitsmarktpolitischen Entscheidungsebene<br />
solche Qualifizierungsaktivitäten durch entsprechende Flankierungsmaßnahmen<br />
<strong>zu</strong> fördern.<br />
Angesichts der sehr hohen <strong>und</strong> <strong>zu</strong>m großen Teil anspruchsvollen Qualifikationsbedarfsmeldungen<br />
wie auch des breiten Qualifizierungsangebots in der Region – Ergebnisse,<br />
die diese <strong>auf</strong> die Pflegeberufe <strong>zu</strong>geschnittene EQUIB-Untersuchung erbracht hat<br />
– sollte darüber nachgedacht werden (wie auch schon an anderer Stelle empfohlen), wie<br />
Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsaktivitäten in <strong>dem</strong> gesamten potenziellen Wachstumssektor der<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflege koordiniert werden können, um auch hier Kosten <strong>zu</strong> senken,<br />
Synergien aus<strong>zu</strong>nutzen <strong>und</strong> so ein effektives, <strong>auf</strong> die spezifischen innovativen Bedarfe<br />
der Region abgestimmtes Angebot präsentieren <strong>zu</strong> können.<br />
In diesem die Qualifizierungsaktivitäten koordinierenden Gremium (z.B. ständige<br />
Arbeitsgruppe, „R<strong>und</strong>er Tisch“) sollten neben den Vertretern aller Einrichtungsarten<br />
<strong>und</strong> ihrer Verbände, Vertreter von beteiligten senatorischen Dienststellen, von Arbeitsverwaltungen,<br />
von Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsträgern sowie der aka<strong>dem</strong>ischen Ausbildung/Wissenschaft<br />
vertreten sein.<br />
Da nicht nur in der Region Bremen/Bremerhaven der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegesektor<br />
im Umbruch ist, wäre u.E. eine wichtige <strong>zu</strong>sätzliche Aufgabe dieses Gremiums,<br />
die Informationen über innovative Projekte 48 , neue Ausbildungsprojekte 49 , Konferenzen<br />
etc. in Deutschland wie in Europa für die Betroffenen hier in der Region <strong>zu</strong>gänglich <strong>zu</strong><br />
machen sowie einen überregionalen Erfahrungs-/Informationsaustausch an<strong>zu</strong>regen;<br />
nur so lassen sich gerade in „Aufbruchsituationen“ synergetische Effekte gewinnen. Da<br />
neue IuK-Technologien auch im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegesektor <strong>zu</strong>nehmend die<br />
Arbeit bestimmen, würde es sich anbieten, eine Art „internetgestütztes Informationsnetz“<br />
(eventuell mit einer newsgroup) <strong>auf</strong><strong>zu</strong>bauen, in <strong>dem</strong> überregionale Informationen<br />
wie regionalspezifische Nachrichten verbreitet werden könnten.<br />
48 Z.B.: „Für mehr Gruppenarbeit im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wesen“. Ein Forschungsprojekt an der Universität<br />
Bochum, das die Auswirkungen verschiedener Pflegesysteme <strong>und</strong> Arbeitsorganisationsformen <strong>auf</strong> die<br />
Qualität der Dienstleistung im Krankenhaus untersucht. Informationsdienst Wissenschaft. Quelle:<br />
http://idw.tu-clausthal.de/public/zeige_ pm.html?pmid=17779<br />
49 Z.B.: Modellversuch <strong>zu</strong>r Integration der Erstausbildung in der Alten-, Kranken- <strong>und</strong> Kinderkrankenpflege<br />
in Nordrhein-Westfalen, betreut von der Universität Bielefeld.<br />
63
EQUIB<br />
Auf jeden Fall sollten Modellprojekte, die neue Methoden (z.B. Telelearning, selbstgesteuertes<br />
Lernen) <strong>und</strong> Inhalte (z.B. Integrierte Managementsysteme für den Pflegebereich,<br />
technisch-basierte Pflege<strong>auf</strong>gaben, integrierte Erstausbildungskonzepte) entwikkeln,<br />
die für die notwendige qualifikatorische Flankierung der erfolgreichen Umstrukturierung<br />
dieses Wachstumssektors sorgen, weiterhin verstärkt initiiert <strong>und</strong> gefördert werden.<br />
6.7 Strategien der Qualifikationsbedarfsdeckung in den Einrichtungen<br />
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse geben einen Überblick über die Art <strong>und</strong><br />
Weisen der Bedarfsdeckungsmethoden, wie sie für die einzelnen Qualifikationsbereiche<br />
in den Einrichtungen favorisiert werden. In der Untersuchungskonzeption wurden vier<br />
Kriterien der Bedarfsdeckung unterschieden: Bedarfsdeckung durch intern durchgeführte<br />
Maßnahmen, Bedarfsdeckung durch externe Anbieter, Bedarfsdeckung durch die<br />
Verknüpfung von internen <strong>und</strong> externen Maßnahmen sowie Bedarfsdeckungsstrategie<br />
„noch offen“. Bei der Beantwortung des Fragebogens sollte bezogen <strong>auf</strong> die jeweiligen<br />
Inhalte der geplanten Weiterbildung angegeben werden, welche Strategien der Bedarfsdeckung<br />
gewählt werden.<br />
Die Weiterbildungslandschaft für den <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegebereich ist sehr<br />
stark durch einrichtungsinterne Abteilungen geprägt. Die meisten Krankenhäuser verfügen<br />
über eigene Weiterbildungsabteilungen <strong>und</strong> auch der Bereich der Altenpflege arbeitet<br />
sehr eng mit z.T. verbandsangeschlossenen Anbietern <strong>zu</strong>sammen. Nur die häusliche<br />
Pflege als überwiegend privatwirtschaftlich organisierte Einrichtungsart verfügt in<br />
der Regel nicht über Möglichkeiten der internen Qualifizierung, wenn sie nicht organisatorisch<br />
der stationären Altenpflege angeschlossen ist. Stattdessen gibt es vereinzelt<br />
zielgerichtete Weiterbildungsangebote, die die Pflegedienste selbst auch ansatzweise in<br />
Kooperation mit anderen Anbietern für die Branche durchführen. Darüber hinaus sind<br />
es im Wesentlichen die Pflegedienstleitungen, die sich durch selbstorganisiertes Lernen<br />
qualifizieren <strong>und</strong> dieses Wissen dann an die Beschäftigten weitergeben.<br />
Dieses relativ – insbesondere auch im Verhältnis <strong>zu</strong> anderen Dienstleistungsbranchen –<br />
umfangreiche Netz an internen Weiterbildungsaktivitäten kann allgemein als ausgeprägter<br />
Wille der Branche <strong>zu</strong>r Selbstqualifizierung bewertet werden. Die Ergebnisse der<br />
Repräsentativerhebung bestätigen im Wesentlichen diese Entwicklung.<br />
Bedarfsdeckung durch intern durchgeführte Weiterbildungsmaßnahmen<br />
Fasst man die Bedarfsdeckungsstrategien für alle Einrichtungsarten <strong>und</strong> bezogen <strong>auf</strong> die<br />
drei untersuchten Funktionsstufen Personal in Leitungsfunktionen, examinierte Pflegekräfte<br />
(3j.)<strong>und</strong> (1j.) <strong>zu</strong>sammen, so dominieren die institutionsintern durchgeführten<br />
Maßnahmen eindeutig. Für das Leitungspersonal kann im Wesentlichen für alle Qualifikationsbereiche<br />
eine hohe interne Qualifizierung festgestellt werden, bei den examinierten<br />
Pflegekräften (3j.) liegen die Spitzen bei den Pflegekompetenzen <strong>und</strong> Schlüsselqualifikationen.<br />
Die Beschäftigten in Helferfunktionen werden in allen Bereichen überwiegend<br />
intern geschult.<br />
64
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Bedarfsdeckung durch die Inanspruchnahme von externen Weiterbildungsanbietern<br />
Der Umfang an extern durchgeführten Qualifizierungen fällt im Verhältnis <strong>zu</strong>r internen<br />
Weiterbildung deutlich geringer aus. Beachtenswerte Nennungen gibt es für das Leitungspersonal<br />
nur für die Qualifikationselemente geronto-psychiatrische Kompetenz,<br />
BWL-Gr<strong>und</strong>lagen/Controlling, Recht sowie Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz <strong>und</strong> Qualitätssicherung.<br />
Für diese letztgenannten Bereiche werden auch für die Qualifizierung<br />
der examinierten Pflegekräfte externe Berater, z.B. von Berufsgenossenschaften, in Anspruch<br />
genommen.<br />
Bedarfsdeckung durch die Verknüpfung von interner <strong>und</strong> externer Weiterbildung<br />
Die Verknüpfung von interner <strong>und</strong> externer Weiterbildung als dritte Bedarfsdeckungsstrategie<br />
wird am häufigsten für die Bereiche Qualitätssicherung, Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>schutz<br />
sowie die Schlüsselqualifikation Qualitätsbewusstsein angewendet. Für die<br />
Fachkräfte <strong>und</strong> Helferfunktionen in der Pflege erweitert sich diese Art <strong>und</strong> Weise der<br />
Schulung noch <strong>auf</strong> die Anwendung neuer Pflegeverfahren.<br />
Zukünftige Bedarfsdeckungsstrategie „noch offen“<br />
Für diese Kategorie, die insbesondere interessant ist für <strong>zu</strong> entwickelnde <strong>zu</strong>kunftsorientierte<br />
Weiterbildungsmaßnahmen der externen Anbieter, fällt die relativ homogene<br />
Struktur der Bedarfsdeckungsmethoden für die einzelnen Funktionsbereiche etwas differenzierter<br />
aus. Die Spitzen liegen für die Leitungsfunktionen bei der geronto-psychiatrischen<br />
Kompetenz, der präventiven/rehabilitativen Beratung, der interkulturellen<br />
Kompetenz sowie <strong>dem</strong> Umweltschutz. Für die examinierten Pflegekräfte ergeben sich<br />
die höchsten Bedarfsnennungen ebenfalls für die geronto-psychiatrische <strong>und</strong> interkulturelle<br />
Kompetenz sowie den Umweltschutz. Für die 3j. examinierten Pflegekräfte ist darüber<br />
hinaus die Strategie für erforderliche EDV-Gr<strong>und</strong>lagenschulungen noch sehr häufig<br />
ungeklärt.<br />
Fazit <strong>und</strong> Empfehlung<br />
Im Vergleich der vier Bedarfsdeckungsstrategien dominieren im Wesentlichen die Qualifizierungen<br />
durch einrichtungsintern durchgeführte Schulungsmaßnahmen für alle drei<br />
untersuchten Funktionsbereiche. Bezogen <strong>auf</strong> die drei Einrichtungsarten stellt sich das<br />
Bild dennoch etwas differenzierter dar. Insbesondere die privatwirtschaftlich organisierten<br />
häuslichen Pflege- <strong>und</strong> Betreuungsdienste verfügen nicht über so ausgeprägte<br />
interne Weiterbildungsstrukturen wie die stationären Pflegeeinrichtungen <strong>und</strong> die ihnen<br />
angeschlossenen ambulanten Pflegedienste <strong>und</strong> greifen deswegen öfters <strong>auf</strong> externe<br />
Dienstleister <strong>zu</strong>rück.<br />
Empfehlung<br />
Die <strong>zu</strong>künftigen Weiterbildungsangebote der externen Anbieter sollten diesen Aspekt<br />
berücksichtigen. Darüber hinaus sollten sich <strong>zu</strong> entwickelnde Maßnahmen nicht nur <strong>auf</strong><br />
die weitestgehend noch „offenen“ Bedarfsdeckungen konzentrieren, sondern auch die<br />
Verknüpfungsmöglichkeiten von interner <strong>und</strong> externer Weiterbildung durch kooperativ<br />
gestaltete Angebote stärker berücksichtigen, um dadurch eine Effektivitäts<br />
steigerung für die Qualifizierungsnotwendigkeiten der gesamten Branche <strong>zu</strong> erreichen.<br />
65
EQUIB<br />
Denn auch die internen Einrichtungen stehen <strong>zu</strong>nehmend (wegen Kostendruck) vor der<br />
Notwendigkeit, externe Angebote <strong>zu</strong> unterbreiten.<br />
Um weitere Synergieeffekte <strong>zu</strong> erzielen, sollte auch über die Schaffung einer Koordinierungsstelle<br />
nachgedacht werden, deren Aufgabe neben der Koordinierung der regionalen<br />
Weiterbildungsaktivitäten u.a. darin bestände, vorhandene Modellprojekte für<br />
Weiterbildung im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialpflegebereich in Deutschland <strong>und</strong> Europa <strong>auf</strong><br />
ihre Transfermöglichkeiten in die Region <strong>zu</strong> überprüfen.<br />
66
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
7. Entwicklungstendenzen der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Für die Weiterentwicklung der Qualität der Berufe, deren Handlungskompetenzen,<br />
fachliche Orientierungen <strong>und</strong> Wissensbezüge – darüber sind sich die Berufsbildungsexperten<br />
einig – bieten sich vor allem Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungskonzepte an, die eine Förderung<br />
beruflicher Schlüsselkompetenzen fokussieren <strong>und</strong> sich <strong>auf</strong> eine berufsübergreifende<br />
Struktur von Handlungskonzepten <strong>und</strong> Methoden konzentrieren. Dieser Trend<br />
wird durch die Bef<strong>und</strong>e der Qualifikationsbedarfsanalyse dieser Untersuchung nachhaltig<br />
gestützt.<br />
Die als „Professionalisierung“ beschriebene berufliche Modernisierungsstrategie stellt<br />
eine Qualifizierung beruflicher Praxis <strong>und</strong> Arbeit durch interdisziplinäres, wissenschaftsbezogenes<br />
berufliches Lernen in den Mittelpunkt. Als „Professionalisierung<br />
durch Weiterbildung“ im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialwesen<br />
„.......richtet sie sich dar<strong>auf</strong>, übergreifende berufliche Kompetenzen <strong>zu</strong>r Gestaltung<br />
<strong>und</strong> Verbesserung gesellschaftlicher Realität von unterstüt<strong>zu</strong>ngsbedürftigen<br />
Lebenswelten <strong>zu</strong> vermitteln.“ 50<br />
Bezogen <strong>auf</strong> die Erstausbildung richten sich die Professionalisierungstendenzen <strong>auf</strong><br />
die Neustrukturierung einzelner Berufsbilder <strong>zu</strong> einer integrierten Gr<strong>und</strong>ausbildung,<br />
an die sich Bildungskonzepte für Spezialisierungen anschließen. Damit werden wesentliche<br />
Ausbildungsinhalte in den Bereich der Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung verlagert.<br />
In diesem Sinne wurde der Reflexionsstand der Einrichtungen über mögliche Veränderungsperspektiven<br />
in der Praxis der beruflichen Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung durch offen<br />
gestaltete Fragestellungen in der Repräsentativerhebung eruiert. Darüber hinaus wurde<br />
diese Befragung durch qualitative Expertengespräche komplettiert.<br />
Es wurde nach der Bedeutung folgender Entwicklungstrends in der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
sowie spezifischen Problemen der Weiterbildungspraxis gefragt:<br />
• Zur Professionalisierung der Pflege sind neue Bildungskonzepte im Gespräch. Sind<br />
Integrationsprozesse in der Erstausbildung <strong>und</strong> Spezialisierungsansätze in der Fortbildung<br />
wünschenswert?<br />
• Gibt es Ansätze einer Verschmel<strong>zu</strong>ng von Berufsbildern <strong>zu</strong>gunsten von Kombinationspflegeberufen<br />
in der Pflegepraxis?<br />
• Ergeben sich durch die <strong>zu</strong>nehmende „Aka<strong>dem</strong>isierung“ der gehobenen Pflegeausbildung<br />
Arbeitsplatzsicherungsprobleme für Pflegeleitungen mit traditioneller Ausbildung?<br />
• Gibt es spezifische Probleme in der Weiterbildungspraxis?<br />
• Gibt es spezielle Qualifizierungsbedarfe für das Personal, das in den Krankenhäusern/Fachkliniken<br />
für den Funktionsbereich „Pflegeüberleitung“ <strong>zu</strong>ständig ist?<br />
50 Vgl. Becker, W.: Förderung von Schlüsselkompetenzen im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialwesen durch berufliche<br />
Weiterbildung. In: Professionalisierung durch Weiterbildung. B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung,<br />
Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen Bildung, Heft 32, Berlin 1998, S. 19f<br />
67
EQUIB<br />
7.1 Neue integrierte Bildungsansätze <strong>zu</strong>r Professionalisierung der Pflegeberufe<br />
<strong>und</strong> Ansätze der Verschmel<strong>zu</strong>ng der Berufe in der Pflegepraxis<br />
Der Frage der Integrationsnotwendigkeit von Pflegeberufen in der Erstausbildung, die<br />
dann durch Spezialisierungsprozesse komplettiert wird, messen die befragten Experten<br />
insgesamt eine große Bedeutung bei. Alle Befragten aus den Krankenhäusern/Fachkliniken<br />
halten eine integrierte berufliche Ausbildung für wünschenswert, in<br />
der stationären Altenpflege sind es 83% <strong>und</strong> in der häuslichen Pflege 95%. Dieses repräsentative<br />
Ergebnis untermauert eindeutig die aktuelle berufsbildungspolitische Diskussion<br />
<strong>und</strong> die Berechtigung von Modellversuchen 51 für eine einheitliche pflegerische<br />
Gr<strong>und</strong>ausbildung mit dar<strong>auf</strong> <strong>auf</strong>bauenden Spezialisierungen.<br />
Ansätze einer Verschmel<strong>zu</strong>ng von Berufen in der täglichen Pflegepraxis sehen die Experten<br />
– wenn auch im Vergleich <strong>zu</strong>r wünschenswerten <strong>zu</strong>kunftsorientierten Berufsausbildungsreform<br />
– in weit geringerem Maße auch schon <strong>zu</strong>m Zeitpunkt der Repräsentativbefragung.<br />
Etwas mehr als die Hälfte der Experten aus den Bereichen häusliche<br />
Pflege <strong>und</strong> stationäre Altenpflege stellt heute schon Verschmel<strong>zu</strong>ngen der Berufsbilder<br />
in der Pflegepraxis fest, so z.B. die Zusammenarbeit bzw. gleiche Aufgabenprofile für<br />
Kranken- <strong>und</strong> Altenpflegepersonal. Die Experten weisen dar<strong>auf</strong> hin, dass diese Verzahnungstendenz<br />
<strong>zu</strong>künftig an Bedeutung gewinnen wird. Im Krankenhausbereich stellt<br />
sich schon jetzt die Situation etwas anders dar. Hier sehen 70% der Experten Verschmel<strong>zu</strong>ngsansätze<br />
in der Pflegepraxis. Sie beziehen sich im Wesentlichen <strong>auf</strong> die Bereiche<br />
Krankenpflege mit spezieller geronto-psychiatrischer Orientierung sowie allgemeine<br />
Krankenpflege mit Kinderkrankenpflege.<br />
Insgesamt wird konstatiert, dass die Qualifikationsanforderungen im Pflegebereich<br />
einer ständigen Anpassung an ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> berufspolitische Veränderungen <strong>und</strong><br />
Entwicklungen unterliegen <strong>und</strong> daher fortwährender Berufsbildergän<strong>zu</strong>ngen bzw. –<br />
anpassungen bedürfen. Die in diesem Zusammenhang von den Experten geäußerten<br />
konkreten Veränderungsnotwendigkeiten beziehen sich im Wesentlichen <strong>auf</strong> die<br />
folgenden Schwerpunkte:<br />
• Übereinstimmend kommen die Experten <strong>zu</strong> <strong>dem</strong> Bef<strong>und</strong>, dass <strong>zu</strong>künftig im gesamten<br />
Pflegebereich sowohl qualifizierte Generalisten als auch Spezialisten gleichermaßen<br />
ihre Berechtigung haben <strong>und</strong> gebraucht werden. Diese Entwicklung spielt<br />
nicht <strong>zu</strong>letzt für die in Ansätzen schon praktizierte <strong>und</strong> sich weiter ausdehnende interdisziplinäre<br />
Teamarbeit sowohl einrichtungsintern als auch zwischen den einzelnen<br />
Pflegeeinrichtungen <strong>und</strong> sie ergänzenden <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>dienstleistern eine bedeutende<br />
Rolle.<br />
51<br />
Vgl. Oelke, U.: Gemeinsame Gr<strong>und</strong>ausbildung für alle Pflegeberufe. In: Pflegezeitschrift 4/99, Stuttgart<br />
1999<br />
Für das Land Bremen ist von einigen regionalen Pflegefachschulen, <strong>dem</strong> Senator für Arbeit, Frauen, Ges<strong>und</strong>heit,<br />
Jugend <strong>und</strong> Soziales <strong>und</strong> <strong>dem</strong> Institut für angewandte Pflegeforschung sowie <strong>dem</strong> Zentrum für<br />
Public Health der Universität Bremen ein Praxis-Projekt „Integrierte Pflegeausbildung im Lande Bremen“<br />
geplant. Mit dieser Kooperation soll ein innovatives <strong>und</strong> <strong>zu</strong>kunftsweisendes Projekt integrativer Pflegeausbildung,<br />
das die gemeinsame Ausbildung der bisher separat ausgebildeten Berufsfelder Kranken-,<br />
Kinderkranken- <strong>und</strong> Altenpflege erprobt, implementiert werden. Für das Praxis-Projekt ist eine L<strong>auf</strong>zeit<br />
von 3 1/2 Jahren vorgesehen.<br />
68
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
• Auch vor diesem Hintergr<strong>und</strong> wird die Anhebung einer integrierten modular <strong>auf</strong>gebauten<br />
Pflegeausbildung <strong>auf</strong> vier Ausbildungsjahre von der Mehrheit der Experten<br />
für dringend erforderlich gehalten, um adäquat <strong>auf</strong> die komplexen Praxisanforderungen<br />
vorbereiten <strong>zu</strong> können.<br />
• In der Ausbildung sollten <strong>zu</strong><strong>dem</strong> die den Pflegequalifikationen <strong>zu</strong><strong>zu</strong>ordnenden Bereiche<br />
Intensivpflege, Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation sowie geronto-psychiatrische<br />
Kompetenz wesentlich mehr Gewicht bekommen.<br />
• Aber auch überfachliche Qualifikationen aus den Segmenten Verwaltungsorganisation<br />
<strong>und</strong> –recht, k<strong>auf</strong>männische Gr<strong>und</strong>bildung sowie EDV-Gr<strong>und</strong>bildung müssen in<br />
der Ausbildung stärkere Berücksichtigung finden, da sie <strong>zu</strong>künftig sowohl quantitativ<br />
als auch qualitativ einen größeren Stellenwert für das Pflegepersonal haben werden.<br />
• Nach einhelliger Auffassung der Experten sollte auch der gesamte Bereich der extrafunktionalen<br />
Qualifikationen sowohl in der integrierten Gr<strong>und</strong>bildung als auch<br />
bei den anschließenden Spezialisierungen <strong>zu</strong>künftig eine größere Rolle spielen. Dabei<br />
sollte sich die Vermittlung der den Schlüsselqualifikationen <strong>zu</strong><strong>zu</strong>ordnenden<br />
Kompetenzschwerpunkte wie „ein roter Faden“ durch die jeweiligen Aus- <strong>und</strong><br />
Weiterbildungsbestandteile ziehen. Didaktik <strong>und</strong> Methodik der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
selbst sollten unter Berücksichtigung der <strong>zu</strong> vermittelnden personalen <strong>und</strong> sozialen<br />
Kompetenzen an die neuen Erfordernisse angepasst werden (z.B. Team- <strong>und</strong><br />
Projektarbeit als Arbeitsformen in der Ausbildung).<br />
7.2 Zum Problem der Arbeitsplatzsicherung <strong>auf</strong>gr<strong>und</strong> <strong>zu</strong>nehmender „Aka<strong>dem</strong>isierung“<br />
der gehobenen Pflegeausbildung<br />
Professionalisierungstendenzen bei der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung von Nachwuchskräften<br />
für den originären Pflegebereich <strong>und</strong> die <strong>zu</strong>nehmende Aka<strong>dem</strong>isierung der Ausbildung<br />
von Führungskräften werden häufig in einem Zuge genannt, wenn es um die Neustrukturierung<br />
der Pflegeausbildung geht. 52<br />
Um den Untersuchungsschwerpunkt <strong>zu</strong> den Tendenzen der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
ab<strong>zu</strong>r<strong>und</strong>en, stellte sich vor diesem Hintergr<strong>und</strong> die Frage, ob es heute schon Arbeitsplatzsicherungsprobleme<br />
für leitendes Pflegepersonal durch die Konkurrenz von Absolventen<br />
der aka<strong>dem</strong>ischen Ausbildung in nennenswertem Ausmaß gibt bzw. <strong>zu</strong>künftig<br />
vermehrt geben wird.<br />
Die Ergebnisse der Expertenbefragung können wie folgt <strong>zu</strong>sammengefasst werden:<br />
Im Bereich der häuslichen Pflege <strong>und</strong> der stationären Altenpflege sehen ca. 50% der<br />
Experten heute schon gr<strong>und</strong>sätzliche Arbeitsplatzsicherungsprobleme durch die aka<strong>dem</strong>isch<br />
ausgebildeten Kräfte. Im Krankenhaussektor liegt der Prozentsatz sogar bei 63%.<br />
52<br />
Vgl. ÖTV Stuttgart (Hrsg.): Reform der Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung in den Pflegeberufen, Schriftenreihe<br />
Berufsbildung 11, Stuttgart 1996<br />
Vgl. Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK): Bildungskonzept Pflege 2000, Eschborn 1997<br />
Vgl. Becker, W., Meifort, B.: Pflegen als Beruf – ein Berufsfeld in der Entwicklung. B<strong>und</strong>esinstitut für<br />
Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen Bildung, Heft 169. Berlin 1994<br />
69
EQUIB<br />
Die Unterscheidung in die aka<strong>dem</strong>ische Ausbildung für Leitungsfunktionen im Pflegebereich<br />
53 <strong>und</strong> die Ausbildung von Lehrkräften für Pflegefachschulen 54 ergibt allerdings<br />
ein etwas differenzierteres Bild.<br />
Leitungsfunktionen im Pflegebereich<br />
Gegenwärtig wird der Wettbewerbsdruck von Seiten der aka<strong>dem</strong>isierten Pflegeausbildung<br />
<strong>auf</strong> die Pflegeleitungen mit traditionellem Ausbildungsweg für noch nicht so gravierend<br />
gehalten, da dieses Personal <strong>zu</strong> regelmäßigen Weiterbildungen verpflichtet ist<br />
<strong>und</strong> mindestens zwei Jahre Praxis in den letzten fünf Jahren für leitende Positionen erforderlich<br />
sind. Diese Kriterien erfüllen die Absolventen der Studiengänge Pflegewissenschaften<br />
nicht durchgängig. Häufig scheint die praktische Qualifizierung noch <strong>zu</strong>wenig<br />
im Blickfeld der Ausbildung <strong>zu</strong> sein, so dass den Aka<strong>dem</strong>ikern eine umfangreiche<br />
praktische Erfahrung fehlt. Dennoch kann eine mögliche Entwicklung in diese<br />
Richtung nicht ausgeschlossen werden.<br />
Nach Expertenmeinung werden viele Arbeitgeber <strong>zu</strong>künftig die aka<strong>dem</strong>isch qualifizierten<br />
Bewerber bevor<strong>zu</strong>gen, <strong>zu</strong>mal die Absolventen der Pflegestudiengänge eine stärkere<br />
betriebswirtschaftliche Ausrichtung erfahren, die heut<strong>zu</strong>tage immer wichtiger wird.<br />
Um den traditionell ausgebildeten Mitarbeitern den Anschluß an neue Qualifikationsanforderungen<br />
<strong>zu</strong> ermöglichen, sollte deshalb die pflegerische Ausbildung mit einer Management-Zusatzqualifikation<br />
verb<strong>und</strong>en sowie ein großes Maß an sozialer <strong>und</strong> persönlicher<br />
Kompetenz vermittelt werden.<br />
Die Experten kommen jedoch auch einstimmig <strong>zu</strong> <strong>dem</strong> Bef<strong>und</strong>, dass <strong>zu</strong>künftig beide<br />
<strong>Weg</strong>e, sowohl der eher praxisorientierte traditionelle als auch der aka<strong>dem</strong>ische, ihre<br />
Funktion <strong>und</strong> damit Berechtigung in den veränderten Strukturen der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>versorgung<br />
haben werden.<br />
Lehrpersonal an den Pflegefachschulen<br />
Die Wettbewerbssituation wird sich durch die Aka<strong>dem</strong>isierung der Ausbildung des<br />
Pflegelehrpersonals für die bisher traditionell ausgebildeten Lehrkräfte an Pflegefachschulen<br />
– Ausbildung <strong>zu</strong>r Pflegekraft mit <strong>zu</strong>sätzlicher pädagogischer Qualifikation –<br />
<strong>zu</strong>künftig wesentlich verschärfen. Nach Expertenmeinung ist schon heute die Tendenz<br />
absehbar, dass die Pflegefachschulen eher <strong>auf</strong> aka<strong>dem</strong>isch ausgebildetes Lehrpersonal<br />
in der Pflege – Studium <strong>und</strong> Referendariat – setzen werden.<br />
7.3 Spezifische Probleme der Weiterbildungspraxis<br />
Wenn auch aus der <strong>zu</strong> beobachtenden „Aka<strong>dem</strong>isierung“ der Pflegeausbildung jedenfalls<br />
für die höheren Pflegeleitungstätigkeiten momentan kein größeres Kompetenzproblem<br />
erwächst, so wird doch von den befragten Experten ein Problembereich thematisiert,<br />
der vor allem in der Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung der mittleren Funktionsebenen<br />
relevant ist.<br />
53<br />
An der Hochschule Bremen wird der „Internationale Studiengang für Pflegeleitung (ISP) angeboten.<br />
Die Universität Bremen bietet im Fachbereich 11 – Human- <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wissenschaften – Pflegewissenschaft<br />
– den Aufbaustudiengang „Öffentliche Ges<strong>und</strong>heit/<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>wissenschaften an.<br />
54<br />
Ebenfalls an der Universität Bremen wird im Fachbereich 11 der Studiengang „Lehramt Pflegewissenschaft“<br />
angeboten.<br />
70
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Das Spektrum der Problematiken in der Weiterbildungspraxis ist vielfältig:<br />
• Längerfristige Kursangebote wie z.B. „Stationsleitung“ als berufsbegleitende Maßnahme<br />
stoßen <strong>auf</strong> wenig Interesse, weil die Qualifikation/Funktion keinen großen<br />
Gehaltssprung ermöglicht, finanziell also nicht besonders attraktiv ist. Die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>-<br />
<strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong> bewegen sich <strong>zu</strong>m großen Teil im „Dunstkreis des öffentlichen<br />
Dienstes". Regelmäßige Gehaltserhöhungen/Gehaltsstufen sind bis <strong>zu</strong> einem<br />
bestimmten Alter tarifvertraglich garantiert, ohne dass man sich <strong>zu</strong>sätzlich<br />
qualifizieren muss. Die Motivation <strong>und</strong> die Eigeninitiative für eine berufliche Weiterqualifizierung<br />
ist deshalb traditionell nicht sehr ausgeprägt.<br />
• Die gültigen Arbeitszeitregelungen, insbesondere die Festlegung der Dienst- <strong>und</strong><br />
Schichtpläne sowie die hohe Arbeitsintensität <strong>und</strong> die psychische <strong>und</strong> physische<br />
Belastung im Pflegebereich werden als weiteres Hemmnis für die Teilnahme an<br />
Qualifizierungen gewertet.<br />
• Zu<strong>dem</strong> kommt, dass in allen Einrichtungen überwiegend weibliches Pflegepersonal<br />
beschäftigt ist. Viele von ihnen sehen nicht <strong>zu</strong>letzt <strong>auf</strong>gr<strong>und</strong> ihrer Doppelbelastung –<br />
Familie <strong>und</strong> Beruf – keine Spielräume für eine <strong>zu</strong>sätzliche berufliche Weiterqualifizierung.<br />
• Der Standpunkt einer systematischen Personalentwicklung mittels Weiterqualifizierung<br />
setzt sich erst langsam in den Einrichtungen durch. Oft herrscht bei den Personalverantwortlichen<br />
die Praxis vor, dass die Erledigung des Tagesgeschäfts Vorrang<br />
hat. Qualifizierungsmaßnahmen werden i.d.R. nicht als Investitionen in die Zukunft<br />
gesehen, sondern eher als Ab<strong>zu</strong>g von Arbeitszeit gewertet, die sich die Einrichtungen<br />
ökonomisch nur schwer leisten können.<br />
• Ein Hindernis wird auch in der traditionellen Leitungsstruktur, insbesondere in<br />
Krankenhäusern gesehen. Die organisatorische Dreiteilung des Krankenhausbetriebes<br />
in Verwaltung, Ärzteschaft <strong>und</strong> Pflegedienst <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen unterschiedlichen<br />
Interessenkonstellationen können in diesem Zusammenhang als retardierendes<br />
Moment <strong>auf</strong>gefasst werden.<br />
• Es wird ein regionalspezifischer Bedarf für <strong>auf</strong>stiegsbezogene Qualifizierung konstatiert.<br />
55 Gesucht wird vor allem qualifiziertes Leitungspersonal in den Einrichtungen,<br />
eine Nachfrage, die der regionale Arbeitsmarkt allerdings nicht ausreichend befriedigen<br />
kann. 56 Im Gegenteil: Es ist sogar eine Abwanderungsbewegung nach<br />
Süddeutschland <strong>zu</strong> beobachten, durch die qualifiziertes Personal aus der Region abgezogen<br />
wird.<br />
Fazit <strong>und</strong> Empfehlung<br />
Obwohl Qualifizierungsbedarf in den Einrichtungen existiert, der auch aus Sicht der<br />
Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsexperten <strong>zu</strong>r Bewältigung der <strong>zu</strong>künftigen Pflege<strong>auf</strong>gaben<br />
befriedigt werden muss, findet die dafür notwendige Qualifizierung nicht in ausreichen<strong>dem</strong><br />
Maße statt. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen Bedarfsnennungen <strong>und</strong> der<br />
55 Ab Mai 2000 können sich in Bremen Pflegekräfte <strong>zu</strong> „Pflegemeistern/innen“ ausbilden lassen. Dieser<br />
Aufstiegslehrgang ist b<strong>und</strong>esweit erst der zweite dieser Art. Die staatliche Anerkennung des Titels steht<br />
allerdings noch aus.<br />
56 Vgl. hier<strong>zu</strong> Kap. 4.<br />
71
EQUIB<br />
Weiterbildungspraxis. Ein wesentlicher Gr<strong>und</strong> hierfür dürfte in mangelnder systematischer<br />
Personalentwicklungsplanung der Einrichtungen liegen.<br />
Empfehlung<br />
Unter Berücksichtigung der spezifischen Arbeitszeitregelungen im Pflegebereich sollten<br />
Weiterbildungsanbieter in der Lage sein, die Weiterbildungskurse sehr flexibel <strong>auf</strong><br />
die zeitlichen Bedürfnisse bzw. Notwendigkeiten der potentiellen Teilnehmerkreise <strong>zu</strong><strong>zu</strong>schneiden.<br />
Dies könnte in enger Absprache mit den Personalverantwortlichen <strong>und</strong><br />
den Teilnehmern geschehen.<br />
Da ein großer Anteil des Teilnehmerkreises weibliche Pflegekräfte sein wird, könnte<br />
durch die Möglichkeit der begleitenden Kinderbetreuung die Motivation <strong>zu</strong>r Teilnahme<br />
an einer Qualifizierung erhöht werden.<br />
Aber auch neue Formen <strong>und</strong> Methoden des Lernens sollten angesichts der spezifischen<br />
Situation im Pflegebereich in das Blickfeld der Weiterbildungsgestaltung kommen.<br />
Hier<strong>zu</strong> gehören der modulare Aufbau von Weiterbildungsinhalten, Ansätze von<br />
Telelearning mit Vertiefung in Präsenzphasen in den Weiterbildungseinrichtungen sowie<br />
die Vermittlung von Fähigkeiten für selbstorganisiertes Lernen.<br />
Um den aktuell drängenden Bedarf an qualifiziertem Leitungspersonal <strong>zu</strong> begegnen,<br />
wird empfohlen, das schon in der Region bestehende Angebot an diesbezüglicher <strong>auf</strong>stiegsbezogener<br />
Qualifizierung <strong>zu</strong> verstärken <strong>und</strong> es „frauen- bzw. familienfre<strong>und</strong>licher“<br />
(s.o.) <strong>zu</strong> gestalten.<br />
Eine weitere Maßnahme, die <strong>zu</strong>r Ankurbelung der Weiterbildungsbereitschaft der Einrichtungen<br />
überlegt werden sollte, könnte das in der Region Bremen schon erprobte<br />
Modell von „Job-Rotation“ darstellen, da es gerade in Unternehmen mit knapper Personaldecke<br />
eine Entlastung durch das Zurverfügungstellen von „Stellvertreter/innen“<br />
schafft.<br />
7.4 Pflegeüberleitung als eigenständiger Dienst in den Krankenhäusern/Fachkliniken<br />
Der Funktionsbereich „Pflegeüberleitung“ wurde in den letzten Jahren in den meisten<br />
der regionalen Krankenhäuser/Fachkliniken als eigenständiger Dienst eingerichtet. Die<br />
Pflegeüberleitung fiel bis dahin in den Aufgabenbereich der Beschäftigten des Sozialen<br />
Dienstes im Krankenhaus. Die neugeschaffenen Funktionsstellen in den stationären Einrichtungen<br />
werden in Kooperation mit <strong>dem</strong> Sozialen Dienst in der Regel von internen<br />
Pflegefachkräften ausgeübt. Dabei versteht sich Pflegeüberleitung als<br />
72<br />
„....Lösungsansatz für verschiedene Schnittstellenprobleme. Sie soll da<strong>zu</strong><br />
beitragen, dass der Patient beim Übergang zwischen den Institutionen der<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>versorgung bzw. beim Übergang in die ambulante Betreuung<br />
alle notwendigen Leistungen zeitgerecht <strong>und</strong> entsprechend seiner individu-
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
ellen Hilfebedarfe erhält, um einem Bruch in der Qualität der Betreuung<br />
bzw. pflegerischen Leistungen vor<strong>zu</strong>beugen.“ 57<br />
Die fünf wichtigsten Pflegeüberleitungsvarianten beziehen sich <strong>auf</strong> die Überleitung<br />
• vom Krankenhaus in die häusliche Pflege mit professioneller Hilfe,<br />
• vom Krankenhaus in ein Altenwohn- <strong>und</strong> Pflegeheim,<br />
• von einer anderen Einrichtung in ein Krankenhaus,<br />
• bei der Verlegung des Patienten in ein heimatnahes Krankenhaus oder in eine Rehabilitationseinrichtung,<br />
• nach Hause mit der Unterstüt<strong>zu</strong>ng pflegender Angehöriger.<br />
Für die systematische <strong>und</strong> adäquate Berücksichtigung der pflegerischen Belange der<br />
Patienten <strong>und</strong> ihrer Angehörigen halten die Experten die Schaffung eines ausdifferenzierten<br />
Überleitungsmanagements in den Krankenhäusern für unerläßlich. Dieses umfasst<br />
im Wesentlichen medizinische, pflegerische <strong>und</strong> administrative Beratungs- <strong>und</strong><br />
Management<strong>auf</strong>gaben bezogen <strong>auf</strong> die Begleitung, Moderation <strong>und</strong> Kontrolle des Prozesses<br />
der Überleitung vom Krankenhaus<strong>auf</strong>enthalt in weitere Versorgungseinrichtungen<br />
<strong>und</strong> Betreuungsangebote. Aber auch bei der Aufnahme eines vorstationär pflegerisch<br />
betreuten Patienten in das Krankenhaus kann die Pflegeüberleitung eine wichtige<br />
Funktion in der Vermittlung von Informationen <strong>und</strong> Kontakten zwischen den Pflegenden<br />
übernehmen.<br />
Um die Kontinuität der Pflege beim Übergang der Patienten zwischen den Institutionen<br />
bzw. Betreuungsformen <strong>auf</strong> hohem Qualitätsniveau sicher<strong>zu</strong>stellen, muss das Personal<br />
für Überleitungspflege über vielfältige fachliche, organisatorische <strong>und</strong> soziale Kompetenzen<br />
verfügen. Ohne Anspruch <strong>auf</strong> Vollständigkeit sollen hier die wesentlichen Elemente<br />
des Anforderungsprofils für das Überleitungsmanagement dokumentiert werden.<br />
Das Personal muss verfügen über:<br />
• Managementkompetenzen: Planung, Moderation, Überwachung des Überleitungsprozesses,<br />
Vernet<strong>zu</strong>ng der Aktivitäten.<br />
• soziale/kommunikative Kompetenzen: Da<strong>zu</strong> gehört die adäquate <strong>und</strong> umfassende<br />
Beratung von Patienten <strong>und</strong> Angehörigen in schwierigen Lebenslagen, Kooperation<br />
mit verschiedenen Berufsgruppen in oft konfliktbelasteten Strukturen usw.<br />
• besondere fachliche Kenntnisse: Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen der Pflege durch<br />
Angehörige beurteilen können, Pflege/Begleitung spezieller Patientengruppen z.B.<br />
psychisch veränderter alter Menschen oder Sterbender, fachliche Beratung der beteiligten<br />
Pflegekräfte.<br />
• IuK-Kompetenz: Umgang mit Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologien,<br />
z.B. elektronischem Leitsystem 58 , EDV-Systemen.<br />
• methodische Kompetenz: Überleitungsspezifische Anforderungen an pflegeprozessorientiertes<br />
Arbeiten, Sozialanamnese, Konzeptentwicklung, Qualitätssicherung.<br />
57 Domscheit, Stefan; Wingenfeld, Klaus: Pflegeüberleitung in Nordrhein-Westfalen. Schriftenreihe des<br />
Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld. Bielefeld 1996, S. 2<br />
58 Vgl. Kap.5: Projekt: <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Soziallotse Bremerhaven<br />
73
EQUIB<br />
• organisationsbezogene <strong>und</strong> sozialrechtliche Kenntnisse: Umfassende Kenntnis<br />
über das Leistungsprofil <strong>und</strong> Probleme der ambulanten, teilstationären <strong>und</strong> stationären<br />
Einrichtungen, Leistungsprofil von nichtpflegerischen Versorgungs- <strong>und</strong> Betreuungsangeboten,<br />
leistungsrechtliche Zuständigkeiten.<br />
• pädagogische Kompetenzen: Fortbildungskompetenz für Hauspflegekurse für die<br />
pflegenden Angehörigen/Fre<strong>und</strong>en/Nachbarn.<br />
Angesichts dieses sehr komplexen Anforderungsprofils wird von den <strong>zu</strong> diesem Thema<br />
befragen Experten die Schaffung der neuen Qualifikation „Fachkraft für Pflegeüberleitung“<br />
für erforderlich gehalten. Dies nicht <strong>zu</strong>letzt vor <strong>dem</strong> Hintergr<strong>und</strong>, dass dieser<br />
Funktionsbereich <strong>zu</strong>künftig an Bedeutung gewinnen wird <strong>und</strong> deshalb einer Professionalisierung<br />
dringend bedarf. 59<br />
Auch die Ergebnisse der Repräsentativbefragung unterstreichen die Forderung nach<br />
verstärkten Qualifizierungsanstrengungen für das Personal der Pflegeüberleitung. Nahe<strong>zu</strong><br />
70% der Experten aus den häuslichen Pflegediensten sehen hier Qualifikationsbedarf.<br />
Im Bereich der stationären Alten- <strong>und</strong> Krankenpflege sind es 63% bzw. 60%.<br />
In den <strong>zu</strong> diesem Themenkomplex <strong>zu</strong>sätzlich geführten qualitativen Expertengesprächen<br />
kristallisierten sich im Wesentlichen die im folgenden <strong>auf</strong>geführten inhaltlichen<br />
Defizite bei der Pflegeüberleitungspraxis heraus:<br />
• Fachkräfte in der Pflegeüberleitung müssen für eine qualitätsorientierte Überleitung<br />
sowohl über fachspezifische Pflegekompetenzen als auch über ein hohes Maß an organisatorischen/administrativen<br />
Kompetenzen verfügen. Dieses komplexe Anforderungsprofil<br />
ist häufig nicht ausreichend vorhanden, was u.a. da<strong>zu</strong> beiträgt, dass<br />
der Pflegeüberleitungsprozess nicht optimal sowohl für die Patienten als auch für<br />
die beteiligten Versorgungseinrichtungen abläuft. So kommt es im Einzelnen <strong>zu</strong> patientenbezogenen<br />
Beratungsdefiziten über die effektivste Methode der weiteren Behandlung/Betreuung.<br />
• Darüber hinaus ist die Pflegeüberleitung häufig nicht umfassend über die spezifischen<br />
Angebote insbesondere der häuslichen Pflegedienste informiert.<br />
• Zu<strong>dem</strong> erschweren sehr häufig un<strong>zu</strong>reichend ausgefüllte Überleitungsprotokolle die<br />
Arbeit der nachgeordneten Pflege- <strong>und</strong> Betreuungseinrichtungen.<br />
Fazit <strong>und</strong> Empfehlung<br />
Der Bereich der Pflegeüberleitung wird insbesondere vor <strong>dem</strong> Hintergr<strong>und</strong> der <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>reform<br />
2000, die in vielen Segmenten die ambulante Pflege vor die stationäre stellt,<br />
<strong>zu</strong>künftig sowohl quantitativ als auch qualitativ an Bedeutung gewinnen. Für die Qua-<br />
59 Die Edith-Stein-Aka<strong>dem</strong>ie in Neuwied hat in den Jahren 1995 bis 1997 als einzige Einrichtung b<strong>und</strong>esweit<br />
eine Aufstiegsfortbildung „Berater/in für Pflegeüberleitung“ durchgeführt. Es wurden zwei Lehrgänge<br />
mit jeweils ca. 50 Teilnehmer/innen durchgeführt <strong>und</strong> mit einem Zertifikatsabschluss beendet. Der<br />
Teilnehmerkreis kam aus ganz Deutschland. Seit 1997 wurde diese Fortbildung <strong>auf</strong>gr<strong>und</strong> <strong>zu</strong> geringen<br />
Teilnehmerinteresses nicht mehr angeboten. Ein wesentlicher Gr<strong>und</strong> für die mangelnde Nachfrage waren<br />
die <strong>zu</strong>m damaligen Zeitpunkt relativ schlechten Einstellungschancen für den Funktionsbereich der Pflegeüberleitung.<br />
74
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
litätssicherung der Pflegeüberleitung bedarf es deshalb eines systematischen Pflegeüberleitungsmanagement,<br />
das die komplexen Aufgabenfelder professionell gestaltet.<br />
Die Schaffung einer neuen Qualifikation „Fachkraft für Pflegeüberleitung“ scheint<br />
sich für die Experten als notwendige Konsequenz <strong>zu</strong> ergeben, um so die optimale<br />
schnittstellenübergreifende Versorgung der Patienten <strong>zu</strong> erreichen. Darüber hinaus<br />
sollte das Aufgabenfeld „Pflegeüberleitung“ auch in der intendierten integrierten<br />
Gr<strong>und</strong>ausbildung für die Pflegeberufe Berücksichtigung finden, um das nötige Problembewusstsein<br />
bei den <strong>zu</strong>künftigen Pflegekräften schon in der Erstausbildungsphase<br />
<strong>zu</strong> schaffen. Und nicht <strong>zu</strong>letzt vor <strong>dem</strong> Hintergr<strong>und</strong> der skizzierten aktuellen komplexen<br />
Aufgaben <strong>und</strong> genannten Qualifikationsdefizite für eine qualitätsorientierte Pflegeüberleitung<br />
sollten Weiterbildungen für das Personal in der Pflegeüberleitung sowie für<br />
weitere Funktionsgruppen, z.B. Stationspflegekräfte, angeboten werden.<br />
75
EQUIB<br />
76
Anhang<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Literatur<br />
Becker, W.: Förderung von Schlüsselkompetenzen im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialwesen<br />
durch berufliche Weiterbildung. In: Professionalisierung durch Weiterbildung.<br />
B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen Bildung, Heft 32, Berlin<br />
1998<br />
Becker, W., Meifort, B.: Pflegen als Beruf – ein Berufsfeld in der Entwicklung.<br />
B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen Bildung, Heft 169, Berlin<br />
1994<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit: Abschlussbericht Qualitätssicherung im<br />
Krankenhaus, Schriftenreihe des B<strong>und</strong>esministeriums für Ges<strong>und</strong>heit, Bd. 96, Baden-<br />
Baden 1997<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit: Leitfaden <strong>zu</strong>r Neuordnung des Pflegedienstes,<br />
Schriftenreihe des B<strong>und</strong>esministeriums für Ges<strong>und</strong>heit, Bd. 31, Baden-Baden 1993<br />
Burmeister, J., Lehnerer, C.: Untersuchung der Beschäftigungsentwicklung <strong>und</strong> des<br />
Qualifikationsbedarfs in mittleren Positionen des <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialwesens –<br />
Anforderungen an die berufliche Weiterbildung. In: Meifort, B. u.a. (Hrsg):<br />
Berufsbildung <strong>und</strong> Beschäftigung im personenbezogenen Dienstleistungssektor,<br />
B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen Bildung, Heft 34, Berlin<br />
1997<br />
Csongár, G.: Professionalisierungstrends im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> Sozialmanagement -<br />
Anforderungen an die berufliche Weiterbildung. In: Meifort, B. (Hrsg.): Arbeiten <strong>und</strong><br />
Lernen unter Innovationsdruck, B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r<br />
beruflichen Bildung, Heft 221, Berlin 1998<br />
Csongár, G.: Beschäftigungsentwicklung <strong>und</strong> Qualifikationsbedarf im<br />
Funktionsbereich des mittleren <strong>und</strong> höheren Managements im <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong><br />
Sozialwesen. In: Berufsbildung <strong>und</strong> Beschäftigung im personenbezogenen<br />
Dienstleistungssektor, B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen<br />
Bildung, Heft 43, Berlin 1999<br />
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe: Bildungskonzept Pflege 2000, Eschborn<br />
1997<br />
Gabanyi, M.: Ambulante Pflegedienste im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit,<br />
Qualität <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enorientierung, Augsburg 1997<br />
Garms-Homolovà, V.: <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>berufe im Wandel - Qualifikationen unter<br />
Innovationsdruck. In: Meifort, B. (Hrsg.): Arbeiten <strong>und</strong> Lernen unter Innovationsdruck,<br />
B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen Bildung, Heft 221, Berlin<br />
1998<br />
77
EQUIB<br />
Hartwig, T.: Pflegedokumentation: Ein rechtliches Muß oder eine segensreiche Pflicht?<br />
In: Pflegezeitschrift 4/99, Stuttgart 1999<br />
J<strong>auf</strong>mann, D.: Pflege <strong>und</strong> Technik: Eine neue Qualität von Dienstleistungsarbeit. In:<br />
Jahrbuch Sozialwissenschaftliche Technikberichterstattung, SOFI, Göttingen 1997<br />
Lin<strong>dem</strong>eyer, T.: Anforderungen an Qualifizierungsstrategien <strong>und</strong> Arbeitsgestaltung in<br />
der klinischen Krankenpflege, Skript, Kongress des B<strong>und</strong>esinstituts für Berufsbildung,<br />
Berlin 1996<br />
Meifort, B., Mettin, G.: <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>pflege, Überlegungen <strong>zu</strong> einem BBiG-<br />
Pflegeberuf, B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berlin 1998<br />
Meifort, B. u.a.: Berufsbildung <strong>und</strong> Beschäftigung im personenbezogenen<br />
Dienstleistungssektor, B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen<br />
Bildung, Heft 43, Berlin 1997<br />
Meifort, B. u.a.: Professionalisierung durch Weiterbildung, B<strong>und</strong>esinstitut für<br />
Berufsbildung, Berichte <strong>zu</strong>r beruflichen Bildung, Heft 32, Berlin 1998<br />
Oelke, U.: Gemeinsame Gr<strong>und</strong>ausbildung für alle Pflegeberufe. In: Pflegezeitschrift<br />
4/99, Stuttgart 1999<br />
ÖTV Stuttgart (Hrsg.): Reform der Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung in den<br />
Pflegeberufen, Schriftenreihe Berufsbildung 11, Stuttgart 1996<br />
Presse- <strong>und</strong> Informationsamt der B<strong>und</strong>esregierung: Sozialpolitische Umschau,<br />
Ausgabe 38, Berlin 1999<br />
Schmidt, R., Winkler, A. (Hrsg.): Ansätze <strong>zu</strong>r Weiterentwicklung der ambulanten<br />
pflegerischen Versorgungsstruktur, Beiträge <strong>zu</strong>r sozialen Gerontologie, Sozialpolitik<br />
<strong>und</strong> Versorgungsforschung, Bd. 5, Regensburg 1998<br />
Schmidt, R., Winkler, A. (Hrsg.): Konturen der neuen Pflegelandschaft, Positionen,<br />
Widersprüche, Konsequenzen, Beiträge <strong>zu</strong>r sozialen Gerontologie, Sozialpolitik <strong>und</strong><br />
Versorgungsforschung, Bd. 4, Regensburg 1998<br />
Senator für Frauen, Ges<strong>und</strong>heit, Jugend, Soziales <strong>und</strong> Umweltschutz: Landes-<br />
Krankenhausplan der Freien Hansestadt Bremen 1998 bis 2003, Bremen 1998<br />
Wissert, M.: Case-Management im professionellen Interessengeflecht: Konkurrenz für<br />
Sozialarbeit? In: Schmidt, R. u.a. (Hrsg.): Konturen der neuen Pflegelandschaft,<br />
Positionen, Widersprüche, Konsequenzen, Beiträge <strong>zu</strong>r sozialen Gerontologie,<br />
Sozialpolitik <strong>und</strong> Versorgungsforschung, Bd. 4, Regensburg 1998<br />
Wolters, P.: Pflegeüberleitung in NRW, Schriftenreihe des Instituts für<br />
Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld, Bielefeld 1996<br />
78
Abbildungsverzeichnis<br />
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
1. Rückl<strong>auf</strong> spezifiziert nach Einrichtungsarten ........................................................... 15<br />
2. Organisationsformen der Einrichtungsarten ............................................................ 15<br />
3. Organisatorische Zuordnung differenziert nach einzelnen Einrichtungsarten ......... 16<br />
4. Pflegeleistungen Krankenhäuser/Fachkliniken ........................................................ 17<br />
5. Pflegeleistungen Altenpflege ................................................................................... 18<br />
6. Pflegeleistungen häusliche Pflege <strong>und</strong> Betreuung ................................................... 19<br />
7. Geschätzter <strong>zu</strong>künftiger Bedarf insgesamt nach Einrichtungsarten ........................ 22<br />
8. Bedarf an Personal in Leitungsfunktionen ............................................................... 23<br />
9. Bedarf an Examinierten (3j.)..................................................................................... 23<br />
10. Bedarf an Examinierten (1j.)..................................................................................... 24<br />
11. Bedarf an Aus<strong>zu</strong>bildenden ....................................................................................... 25<br />
12. Bedarfsdeckung <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> regionalen Arbeitsmarkt: Leitungsfunktionen ................ 26<br />
13. Bedarfsdeckung <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> regionalen Arbeitsmarkt: Examinierte Pflegekräfte (3j.) 27<br />
14. Bedarfsdeckung <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> regionalen Arbeitsmarkt: Examinierte Pflegekräfte (1j.) 28<br />
15. Integrierte Managementaktivitäten .......................................................................... 33<br />
16. Technologische Präferenzen .................................................................................... 35<br />
17. Technologische Präferenzen nach Einrichtungsarten ............................................... 36<br />
18. Veränderungen der Arbeits- <strong>und</strong> Abl<strong>auf</strong>organisation .............................................. 40<br />
19. Qualifikationsbedarf für Personal in Leitungsfunktionen insgesamt ....................... 46<br />
20. Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (3j.) insgesamt .......................... 47<br />
21. Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (1j.) insgesamt .......................... 48<br />
22. Qualifikationsbedarf für Personal in Leitungsfunktionen der<br />
Krankenhäuser/Fachkliniken ................................................................................... 49<br />
23. Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (3j.) der<br />
Krankenhäuser/Fachkliniken ................................................................................... 50<br />
24. Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (1j.) der<br />
Krankenhäuser/Fachkliniken ................................................................................... 51<br />
25. Qualifikationsbedarf für Personal in Leitungsfunktionen<br />
der stationären Altenpflege ...................................................................................... 52<br />
26. Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (3j.)<br />
der stationären Altenpflege ...................................................................................... 53<br />
27. Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (1j.)<br />
der stationären Altenpflege ...................................................................................... 54<br />
28. Qualifikationsbedarf für Personal in Leitungsfunktionen der häuslichen Pflege .... 55<br />
29. Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (3j.) in der häuslichen Pflege ... 56<br />
30. Qualifikationsbedarf für examinierte Pflegekräfte (1j.) in der häuslichen Pflege ... 57<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Aktueller Bestand des Pflegepersonals in den Einrichtungen. ...................... 21<br />
79
Universität Bremen<br />
Kooperation Universität/<br />
Arbeiterkammer<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
EQUIB<br />
Entwicklungsplanung Qualifikation in der Industrieregion Bremen<br />
Das Projekt erarbeitet seit 1990 regionale<br />
Qualifikationsbedarfsanalysen für das Land<br />
Bremen mit <strong>dem</strong> Ziel, eine f<strong>und</strong>ierte Datenbasis<br />
für die Förderung <strong>und</strong> Gestaltung der<br />
regionalen "beruflichen Qualifizierung" <strong>zu</strong><br />
ermitteln. Gemäß der Absicht des Auftraggebers<br />
sollen die Ergebnisse einen Beitrag<br />
da<strong>zu</strong> leisten, die Integration einer an der<br />
Schaffung <strong>und</strong> Erhaltung von innovativen<br />
Arbeitsplätzen orientierten Wirtschaftsstruktur-<br />
<strong>und</strong> Arbeitsmarktpolitik <strong>zu</strong> befördern, in<br />
deren Rahmen <strong>dem</strong> "Standortfaktor Qualifikation"<br />
entscheidende Bedeutung <strong>zu</strong>kommt.<br />
Dessen Prägung durch die Innovationsfähigkeit<br />
kleiner <strong>und</strong> mittlerer Unternehmen<br />
findet dabei vorrangige Beachtung.<br />
Die Untersuchungen haben zwei Schwerpunkte:<br />
<strong>zu</strong>m einen sollen mit einem „Monitoring-System“<br />
branchenübergreifend aktuelle Trends zeitnah<br />
erfaßt werden; <strong>zu</strong>m zweiten werden branchenbezogene<br />
Repräsentativbefragungen, ergänzt<br />
durch qualitative Expertengespräche, <strong>zu</strong>r Eruierung<br />
spezifischer Bedarfe durchgeführt.<br />
Um eine möglichst praxisnahe Umset<strong>zu</strong>ng <strong>und</strong><br />
Konkretisierung des Untersuchungs<strong>auf</strong>trags <strong>zu</strong><br />
gewährleisten, steht <strong>dem</strong> Projekt für die Ergebnisbewertung<br />
sowie für die Auswahl der jeweils<br />
<strong>zu</strong> untersuchenden Branchen, Berufe <strong>und</strong> Technologiebereiche<br />
ein Beirat <strong>zu</strong>r Seite, <strong>dem</strong> neben<br />
<strong>dem</strong> <strong>auf</strong>traggebenden Ressort Vertreter der<br />
Handels-, der Industrie- <strong>und</strong> Handwerks-, der<br />
Angestellten- <strong>und</strong> der Arbeiterkammer sowie<br />
der Arbeitsverwaltung angehören.<br />
Die Projektergebnisse (siehe Liste der Veröffentlichungen)<br />
bieten den <strong>zu</strong>ständigen staatlichen<br />
Ressorts, der Arbeitsverwaltung, den<br />
Betrieben <strong>und</strong> ihren Arbeitnehmervertretungen<br />
sowie den Einrichtungen der beruflichen Aus<strong>und</strong><br />
Weiterbildung gesichertere Planungs- <strong>und</strong><br />
Handlungshilfen für die Konzipierung, Förderung<br />
<strong>und</strong> Umset<strong>zu</strong>ng von innovationsspezifischen<br />
Qualifizierungsmaßnahmen. Eine Reihe<br />
von Weiterbildungsmaßnahmen <strong>und</strong> Modellprojekten<br />
wurden bisher unter Be<strong>zu</strong>gnahme <strong>auf</strong><br />
Ergebnisse von EQUIB konzipiert.<br />
Da der Projekt<strong>auf</strong>trag vor allem <strong>auf</strong> die Ermittlung<br />
innovativer Qualifizierungsbedarfe infolge der<br />
Einführung Neuer Technologien <strong>und</strong> veränderter<br />
Formen der Arbeitsorganisation gerichtet ist, weisen<br />
alle durchgeführten Analysen <strong>und</strong> Erhebungen<br />
zwei zentrale Schwerpunkte <strong>auf</strong>:<br />
• Struktureller <strong>und</strong> technologischer Rahmen der<br />
Betriebe<br />
• Berufsbezogene Qualifikationsbedarfe <strong>und</strong><br />
-inhalte infolge betrieblicher Innovationen.<br />
An den einzelnen Betriebsbefragungen (z.T. im<br />
Längsschnitt), für die ein differenziertes methodisches<br />
Instrumentarium entwickelt wurde, sind je<br />
nach Thematik <strong>und</strong> Umfang der einbezogenen<br />
Branchen zwischen 100 <strong>und</strong> 300 Unternehmen<br />
beteiligt.<br />
Daten <strong>und</strong> Informationen<br />
Projektträger Arbeiterkammer Bremen<br />
Projektdurchführung Universität Bremen, Kooperation<br />
Universität/Arbeiterkammer<br />
Projektleitung Gerlinde Hammer<br />
Wiss. Mitarbeiter Ulf Benedix, Jutta Knuth<br />
Förderung Europäischer Sozialfonds,<br />
Senator für Arbeit, Land Bremen<br />
Zuständige Behörde Senator für Arbeit<br />
L<strong>auf</strong>zeit seit 1990 fortl<strong>auf</strong>end<br />
Kontakt Gerlinde Hammer<br />
Fon: 0049-421-218-9514<br />
Fax: 0049-421-218-4560<br />
e-mail: ghammer@uni-bremen.de<br />
Universität Bremen/KUA (FVG-Mitte)<br />
Postfach 330440<br />
D - 28334 Bremen<br />
EUROPÄISCHE<br />
GEMEINSCHAFT<br />
Europäischer Sozialfonds
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
Von EQUIB verwendete Methoden <strong>zu</strong>r Erhebung des <strong>zu</strong>künftigen Qualifikationsbedarfs<br />
Allgemeine Anforderungen an Qualifikationsbedarfsanalysen (QBA)<br />
Die hohe Komplexität von Qualifikationsbedarfsanalysen begründet sich <strong>zu</strong>m einen aus<br />
<strong>dem</strong> impliziten Zusammenhang der Qualifikationsveränderungen mit der dynamischen<br />
technologischen wie wirtschaftlichen Entwicklung sowie aus den Änderungen der regionalen,<br />
nationalen wie globalen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Qualifikationsbedarfsprognosen<br />
müssen die aus diesen Entwicklungen folgenden Implikationen<br />
für die Qualifikationsentwicklung abbilden können. Handlungsorientierte QBA<br />
stellen erweiterte Anforderungen: Ihre Ergebnisse, Prognosen <strong>und</strong> Empfehlungen<br />
müssen die Umsetzbarkeit in praktische Maßnahmen <strong>und</strong> Handlungsoptionen unter<br />
Beweis stellen können. Dabei ist eine Vielfalt von Nut<strong>zu</strong>ngsinteressen <strong>zu</strong> berücksichtigen:<br />
das Spektrum reicht von der Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Qualifizierungspolitik (Entwicklung<br />
des Standortfaktors Qualifikation), über die Wirtschafts- <strong>und</strong> Technologiepolitik<br />
(Förderung des Technologietransfers), über Weiterbildungseinrichtungen (bedarfsgerechte<br />
Gestaltung des Kursangebots) bis hin <strong>zu</strong> Betrieben (Informationen über<br />
technologische <strong>und</strong> qualifikatorische Standards als Wettbewerbsgr<strong>und</strong>lage).<br />
Deshalb muss das methodische Instrumentarium, das bei dieser QBA <strong>zu</strong>m Einsatz<br />
kommt, hohe Ansprüche erfüllen.<br />
Prinzipieller Untersuchungsansatz <strong>und</strong> Forschungsdesign<br />
Zur Bestimmung des Qualifikationsbedarfs <strong>und</strong> seiner Entwicklung bieten sich der empirischen<br />
Forschung im Wesentlichen zwei Ansätze an:<br />
• Auswertung der Einschät<strong>zu</strong>ng von Experten:<br />
Auf der Basis der Befragung inner- <strong>und</strong> außerbetrieblicher Experten lassen sich subjektive<br />
Einschät<strong>zu</strong>ngen <strong>zu</strong> künftigen QB <strong>zu</strong> Tendenzaussagen <strong>zu</strong>sammenfassen. Je breiter<br />
das Spektrum der befragten Funktionsträger ist, desto <strong>zu</strong>verlässiger werden die Auswertungen<br />
bezüglich künftiger Qualifikationstrends sein können.<br />
• Untersuchungen der technologischen <strong>und</strong> organisatorischen Entwicklungen:<br />
In der Folge technologischer <strong>und</strong> organisatorischer Innovationen entstehen veränderte<br />
Qualifikationsanforderungen für die Beschäftigten; Inhalt <strong>und</strong> Umfang dieser Anforderungen<br />
sind determiniert durch die Spezifik der Technologie <strong>und</strong> der Betriebs- <strong>und</strong><br />
Arbeitsorganisation. Aufgr<strong>und</strong> der erwarteten Geschwindigkeit ihrer Diffusion, d.h.<br />
ihrer betrieblichen Implementation, läßt sich abschätzen, wann <strong>und</strong> in welchem Umfang<br />
sowie für welche Beschäftigungsgruppen sich veränderte Qualifikationsanforderungen<br />
verallgemeinern.<br />
Der Ansatz von EQUIB<br />
Das Projektteam EQUIB hat sich für die regionalspezifischen QBA für eine Integration<br />
beider Ansätze unter Verwendung einer Kombination von qualitativen <strong>und</strong> quantitativen<br />
Methoden entschieden; da von den Ergebnissen des Projektes Planungsdaten <strong>und</strong><br />
Handlungsorientierungen für die regionalen, staatlichen <strong>und</strong> betrieblichen Qualifizierungsstrategien<br />
erwartet werden, müssen allgemein <strong>zu</strong> erwartende Trends <strong>zu</strong>sätzlich <strong>auf</strong><br />
die tatsächlichen betrieblichen Qualifikationsentwicklungen in der Region bezogen werden.<br />
81
EQUIB<br />
Forschungsdesign<br />
Mit folgen<strong>dem</strong> in allen repräsentativen Sektorstudien angewandten Forschungsdesign<br />
(vgl. Abbildung 1) lassen sich relativ <strong>zu</strong>verlässige Aussagen <strong>zu</strong>r Qualifikationsbedarfsentwicklung<br />
formulieren.<br />
82<br />
Forschungsdesign: Repräsentativerhebung + Expertenbefragungen<br />
• Felderschließung<br />
Forschungsdesign des Projektes EQUIB<br />
Expertenbefragung I<br />
(regionale/überregionale Experten)<br />
• Vorbereitung der Repräsentativerhebung (Operationalisierung<br />
der Fragestellungen)<br />
Repräsentativerhebung<br />
• Teil A: Innovationsentwicklung<br />
• Teil B: Qualifikationsentwicklung<br />
Expertenbefragung II<br />
(regionale Experten)<br />
• Nachbereitung/Evaluation der Repräsentativerhebung<br />
(qualitative Bewertung von Ergebnissen)<br />
• Betriebs-/branchenspezifische Sonderaspekte
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
• Vorbereitung der Repräsentativerhebungen: Expertenbefragung I<br />
Mit umfangreichen leitfadengestützten Experteninterviews (z.T. in Form von<br />
Gruppendiskussionen) mit Gesprächspartnern aus Betrieben (bevor<strong>zu</strong>gt: Marktführer)<br />
<strong>und</strong> Institutionen (Kammern, Forschungs- <strong>und</strong> Beratungseinrichtungen, Aus- <strong>und</strong><br />
Weiterbildungsinstituten, Gewerkschaften) wird die Branchenuntersuchung eingeleitet.<br />
Dieser erste qualitative Untersuchungsschritt dient vor allem da<strong>zu</strong>, den Untersuchungsgegenstand<br />
inhaltlich <strong>zu</strong> bestimmen <strong>und</strong> seine wesentlichen Merkmale <strong>zu</strong> definieren<br />
(Felderschließung).<br />
Inhaltliche Schwerpunkte sind kurz- <strong>und</strong> mittelfristig <strong>zu</strong> erwartende Technik- <strong>und</strong> Organisationsentwicklungen<br />
<strong>und</strong> die dadurch evozierten Qualifikationsfolgen. Neben der<br />
Findung der dafür relevanten Fragestellungen (die vor allem in hochtechnisierten <strong>und</strong><br />
spezialisierten (Teil-) Branchen der Mitwirkung von Experten bedürfen) werden - z.T.<br />
in einem zweiten Gesprächstermin - die vom Projektteam vorgenommenen Operationalisierungen<br />
der Fragen für den <strong>zu</strong> entwickelnden standardisierten Fragebogen der Repräsentativerhebung<br />
diskutiert. Auf diese Weise erfährt das Befragungsinstrumentarium<br />
eine erste Evaluation.<br />
• Durchführung der Repräsentativerhebung<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage der qualitativen Ergebnisse des ersten Untersuchungsschritts erfolgt<br />
die Erhebung quantitativer Daten in den Betrieben des Untersuchungsfeldes mittels eines<br />
(recht detaillierten, 4-6 seitigen) standardisierten Fragebogens (mit geschlossenen<br />
<strong>und</strong> z.T. auch mit offenen Fragestellungen). Analog <strong>zu</strong> den Befragungsschwerpunkten<br />
der qualitativen Experteninterviews weisen alle repräsentativen Erhebungen zwei zentrale<br />
Schwerpunkte <strong>auf</strong>:<br />
• Teil A Innovationsentwicklung: organisations-struktureller <strong>und</strong> technologischer<br />
Rahmen (Ist-Zustand <strong>und</strong> Planungen) der Betriebe<br />
• Teil B Qualifikationsentwicklung: berufsbezogene QB <strong>und</strong> -inhalte sowie neue<br />
Querschnitts<strong>auf</strong>gaben <strong>und</strong> Strategien <strong>zu</strong> deren Deckung<br />
Die Fragebögen werden postalisch an die ermittelte Gr<strong>und</strong>gesamtheit der Betriebe verschickt.<br />
Im Anschluß daran erfolgt eine telefonische Kontakt<strong>auf</strong>nahme mit den <strong>zu</strong>ständigen<br />
betrieblichen Experten, um eventuelle offene Fragen <strong>zu</strong> beantworten <strong>und</strong> die<br />
Betriebe für die Teilnahme an der Befragung <strong>zu</strong> gewinnen. Eine kontinuierlich relativ<br />
hohe Rückl<strong>auf</strong>quote (<strong>zu</strong>meist> 50%) beweist die Akzeptanz der EQUIB-Befragungen in<br />
der Region.<br />
• Nachbereitung der Repräsentativerhebungen: Expertenbefragung II<br />
Nach Auswertung der Repräsentativdaten werden die zentralen Ergebnisse der Sektorstudie<br />
wiederum mit betrieblichen <strong>und</strong> sonstigen Fachexperten diskutiert <strong>und</strong> interpretiert;<br />
Ziel ist es, die in der Studie gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der Richtung<br />
<strong>und</strong> Tiefe der betrieblich geplanten Technikimplementationen, der angestrebten Organisationsentwicklungen<br />
sowie der dadurch evozierten QB vor <strong>dem</strong> Hintergr<strong>und</strong> der Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> des Kenntnisstandes der Experten <strong>zu</strong> reflektieren; eine solche einsatz<strong>und</strong><br />
dialogorientierte Evaluation durch eine zweite qualitative Expertenbefragung ist<br />
<strong>zu</strong> empfehlen, da die Ergebnisse für konkrete innovative Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsmaßnahmen<br />
taugen sollen.<br />
83
EQUIB<br />
Methodologische Probleme <strong>und</strong> methodische Lösungen<br />
Methodologische Probleme ergeben sich vor allem hinsichtlich der Validität <strong>und</strong> Reliabilität<br />
der gewonnenen Daten <strong>und</strong> deren Interpretation. Das Projekt EQUIB hatte von<br />
Anfang an den Auftrag, QB <strong>zu</strong> eruieren, um den Akteuren des Arbeitsmarktes <strong>und</strong> der<br />
Berufsbildung konkrete Plan- <strong>und</strong> Handlungshilfen <strong>zu</strong>r Verfügung <strong>zu</strong> stellen.<br />
Es ging also darum, durch die Wahl/Kombination der „richtigen“ Methoden die Ermittlung<br />
der tatsächlichen betrieblichen Qualifikationsentwicklung sicher<strong>zu</strong>stellen.<br />
Die zentrale Problemstellung, die es aus Sicht des Projektes EQUIB <strong>zu</strong> lösen gilt,<br />
ist:<br />
A ���� betriebliche Experten sind die „sichersten“ Datenlieferanten für eine QBA<br />
B ���� jedoch ist damit das Problem der „Betriebssubjektivität“ der Angaben <strong>auf</strong><br />
<strong>dem</strong> Tisch,<br />
C ���� das nach methodischen Lösungen <strong>zu</strong>r „Objektivierbarkeit“ dieser<br />
notwendigen Angaben verlangt.<br />
A ���� Repräsentative Erhebung betrieblicher Struktur- <strong>und</strong> Qualifizierungsdaten<br />
<strong>auf</strong> Basis der Angaben betrieblicher Experten.<br />
Für konkret umsetzbare Ergebnisse ist der Betrieb als Ausgangspunkt der Ermittlung<br />
künftiger QB unverzichtbar. Es empfiehlt sich, das Datenmaterial <strong>zu</strong>m QB in quantitativen<br />
<strong>und</strong> qualitativen Befragungen von betrieblichen Experten (in der Regel Betriebsleitung,<br />
bei größeren Betrieben die jeweiligen für Personal- <strong>und</strong> Qualifizierungsfragen,<br />
aber auch für technische Organisation etc. verantwortlichen Führungskräfte) <strong>zu</strong> gewinnen.<br />
Dieses Vorgehen liegt in den folgenden Überlegungen begründet:<br />
• Statt abstrakter Ableitungen von globalen Qualifizierungstrends z.B. aus der Extrapolation<br />
<strong>und</strong> Fortschreibung von statistischen Daten des Beschäftigungssystems <strong>und</strong><br />
der Qualifikationsstruktur stehen konkrete Qualifizierungsinhalte im Mittelpunkt, so<br />
dass die Ergebnisse oft weit weniger spekulativ ausfallen.<br />
• Eine „experimentelle Qualifizierung“ können sich in der aktuellen, von knappen<br />
Mitteln geprägten Lage weder die Betriebe, noch die Anbieter <strong>und</strong> staatlichen Mittelgeber<br />
von Qualifizierungsmaßnahmen, noch die Beschäftigten selbst leisten. Daher<br />
muss die Bedarfsanalyse Schwerpunkte des praktischen betrieblichen Qualifizierungsbedarfs<br />
herausarbeiten, die insbesondere der aktuellen Entwicklung in „durchschnittlichen“<br />
kleinen <strong>und</strong> mittleren Unternehmen Rechnung tragen.<br />
• Betriebliche Angaben <strong>zu</strong>m Qualifizierungsbedarf sind relativ „immun“ gegen vorschnelle<br />
Überschät<strong>zu</strong>ngen <strong>und</strong> Verabsolutierungen von neuen Qualifikationstrends,<br />
die ihre Tragfähigkeit all<strong>zu</strong> oft nicht unter Beweis stellen können.<br />
84
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
B ���� Die Problematik der „Betriebssubjektivität“<br />
Die Methode der Befragung betrieblicher Experten ist allerdings mit <strong>dem</strong> Problem der<br />
„Betriebssubjektivität“ der Angaben behaftet 60 ; die im Folgenden <strong>auf</strong>geführten Faktoren<br />
beeinflussen die Angaben aus vielen Betrieben in eine ähnliche Richtung, was sich entsprechend<br />
systematisch in den Ergebnissen niederschlagen kann:<br />
• Abwartende Haltung gegenüber neuen Entwicklungen<br />
Gerade die oben genannte, berechtigte Skepsis gegenüber neuen Schlagworten kann<br />
auch da<strong>zu</strong> führen, dass wichtige neue Entwicklungen unterschätzt werden <strong>und</strong> erforderlicher<br />
Qualifizierungsbedarf nicht rechtzeitig gesehen wird.<br />
• Kurzfristiges Qualifikationsdenken<br />
Gerade in KMU ist eine ad-hoc-Qualifizierung immer noch recht weit verbreitet.<br />
Erst wenn der Bedarf <strong>auf</strong>tritt, wird reagiert - also dann, wenn durch Störungen oder<br />
mangelnde Effizienz das Qualifikationsdefizit unübersehbar geworden ist <strong>und</strong> bereits<br />
betriebswirtschaftliche Nachteile hervorgebracht hat. Als Begründung für die<br />
Beibehaltung dieses Vorgehens wird oft dar<strong>auf</strong> verwiesen, dass man ohnehin flexibel<br />
<strong>auf</strong> K<strong>und</strong>en<strong>auf</strong>träge reagieren müsse <strong>und</strong> sich daher auch keine „Qualifizierung<br />
<strong>auf</strong> Vorrat“ leisten könne. Dies wirkt sich auch in der Erhebung in geringeren Qualifikationsbedarfsangaben<br />
aus.<br />
• Einseitiges Kostendenken<br />
Wenn Qualifikationsmaßnahmen einseitig unter Kostengesichtspunkten betrachtet<br />
werden, können sinnvolle Qualifikationsmaßnahmen, deren Realisierung aus Kostengründen<br />
unterbleibt oder <strong>zu</strong>nächst <strong>zu</strong>rückgestellt wird, aus <strong>dem</strong> angegebenen<br />
Qualifizierungsbedarfsumfang herausfallen.<br />
• Un<strong>zu</strong>reichende Beteiligung der Beschäftigten an der Qualifizierungsplanung<br />
Da in vielen Betrieben eine systematische Qualifizierungsplanung noch nicht durchgeführt<br />
wird, sind auch die Qualifizierungsbedarfe, die die Beschäftigten selbst in<br />
ihrer praktischen Arbeit feststellen, in den Angaben der betrieblichen Experten oft<br />
nicht berücksichtigt.<br />
Insgesamt ergibt sich damit ein gewisses Auseinanderfallen des von den Betrieben angegebenen<br />
„betriebssubjektiven“ Qualifizierungsbedürfnisses <strong>und</strong> <strong>dem</strong> „objektiven“<br />
Qualifizierungsbedarf. Es soll aber auch die gegenläufige Erfahrung nicht unerwähnt<br />
bleiben, dass Betriebsleiter neue Qualifizierungsinhalte für ihre Mitarbeiter benennen,<br />
von ihrer Umset<strong>zu</strong>ng in konkrete Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung aber etwa aus Kosten- <strong>und</strong><br />
Zeitgründen wieder Abstand nehmen.<br />
C ���� Methodische Lösungen<br />
• Erhebung der betrieblichen Technologie- <strong>und</strong> Organisationsentwicklung<br />
Einen wesentlichen Lösungsansatz im Umgang mit den genannten „subjektiven“<br />
60 Damit ist nicht gemeint, dass die Betriebe jeweils betriebsspezifisch unterschiedliche QB - bedingt<br />
durch Größe, Branchen<strong>zu</strong>gehörigkeit, Produkt, Produktionsform, Technologieausstattung, Arbeitsorganisationsform<br />
<strong>und</strong> Qualifikationsvorausset<strong>zu</strong>ngen der Beschäftigten - anmelden: die Repräsentativerhebung<br />
zielt ja gerade dar<strong>auf</strong> ab, die allgemeine Qualifikationsentwicklung möglichst genau ab<strong>zu</strong>bilden, wie sie<br />
sich aus <strong>dem</strong> Querschnitt der einzelbetrieblichen QB ergibt.<br />
85
EQUIB<br />
86<br />
Faktoren stellt eine in die Untersuchung integrierte systematische Erfassung der<br />
Technologie- <strong>und</strong> Organisationsentwicklung dar. Daher bildet die repräsentative Erhebung<br />
des aktuellen Stands der betrieblichen Ausstattung mit neuen technischen<br />
Mitteln <strong>und</strong> Systemen sowie deren kurz- <strong>und</strong> mittelfristige Planung ein Kernstück<br />
der Untersuchung des betrieblichen QB. Sie wird ergänzt um die Ermittlung betriebsstruktureller<br />
Umstellungs- <strong>und</strong> Rationalisierungsprozesse.<br />
Innovationsentwicklung <strong>und</strong> Qualifikationsentwicklung stehen in den Betrieben in<br />
einer engen Wechselbeziehung. Als eine wesentliche Gr<strong>und</strong>lage des Wandels der<br />
Qualifikationsanforderungen <strong>und</strong> als Auslöser von QB bildet die Innovationsentwicklung<br />
daher selbst einen eigenständigen Untersuchungsgegenstand. Im Rahmen<br />
einer QBA zielt ihre Untersuchung dar<strong>auf</strong> ab, soweit wie möglich die konkreten Inhalte<br />
der geänderten, erweiterten oder neuen Anforderungen an die Beschäftigten<br />
heraus<strong>zu</strong>arbeiten <strong>und</strong> diese Ergebnisse mit den „subjektiven“ QB-Angaben der Experten<br />
ab<strong>zu</strong>gleichen.<br />
Solche Analysen stellen eine der wenigen Mittel dar, „objektivierte“ Daten <strong>zu</strong>r<br />
Qualifikationsentwicklung der Beschäftigten <strong>zu</strong> gewinnen. Dabei ist selbstverständlich<br />
nicht die Behauptung einer „monokausalen“ Entsprechung von Technologieentwicklung<br />
<strong>und</strong> neuen Qualifikationen für ihren Einsatz intendiert. Um eine derartige<br />
technik-bornierte Einseitigkeit aus<strong>zu</strong>schalten, schließt sich eine ausführliche Diskussion<br />
dieser Ergebnisse im Rahmen von Expertengesprächen über damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Qualifikationsfolgen an.<br />
• Differenzierte Erhebung konkreter Qualifizierungsinhalte<br />
Ein weiteres Mittel, den Einfluß „betriebssubjektiver“ Faktoren <strong>auf</strong> die QBA <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>drängen,<br />
steht mit der inhaltlichen Ausrichtung des Fragebogens <strong>auf</strong> die Erhebung<br />
konkreter Qualifizierungsbedarfe <strong>zu</strong>r Verfügung. Weil der gewählte Untersuchungsansatz<br />
bei den konkreten Bedarfen für eine höchst dynamische Technologie-<br />
<strong>und</strong> Innovationsentwicklung anknüpft, ist eine gr<strong>und</strong>legende theoretische<br />
Einarbeitung <strong>und</strong> kontinuierliche Verfolgung aktueller insbesondere technischer<br />
Entwicklungstrends unverzichtbar. Da bei der konkreten Fragebogenentwicklung<br />
<strong>zu</strong>m QB bei hochinnovativen Entwicklungen oft tiefergehende, z.B. ingenieurwissenschaftliche<br />
Kenntnisse, von großem Nutzen sind, hat sich das Vorgehen bewährt,<br />
hier<strong>zu</strong> Experten aus den entsprechenden wissenschaftlichen Disziplinen für die<br />
Fragebogenkonzeptionierung hin<strong>zu</strong><strong>zu</strong>ziehen.<br />
Wenn statt allgemein-abstrakter Angaben <strong>zu</strong>m Qualifizierungsbedarf vorwiegend<br />
konkrete Bedarfe für einzelne Berufe bzw. Berufsgruppen <strong>zu</strong> einzelnen Technologien<br />
oder bestimmbaren strukturellen Innovationen erhoben werden, wird der<br />
Betrieb <strong>zu</strong>mindest für die Befragung selbst quasi „gezwungen“, sich <strong>auf</strong> den Standpunkt<br />
einer systematischen Qualifikationsbedarfsfeststellung <strong>zu</strong> stellen. Allerdings<br />
ist mit einem solchen Verfahren als Nachteil ein großer Fragebogenumfang wie<br />
auch eine sehr hohe Fragebogenkomplexität verb<strong>und</strong>en; dies macht die Befragung<br />
für die Betriebe sehr <strong>auf</strong>wendig. Um eine genügend hohe Rückl<strong>auf</strong>quote <strong>zu</strong> erhalten,<br />
muss für die Akzeptanz der Befragung bei den Betrieben geworben werden.<br />
• Ergänzende qualitative Interviews unverzichtbar<br />
Auch wenn bereits in der Repräsentativbefragung eine möglichst konkrete Bedarfsermittlung<br />
angestrebt wird, so hat dieses Verfahren doch darin seine Grenzen,<br />
dass übergreifende <strong>und</strong> allgemeingültige Ergebnisse nur erreicht werden können,<br />
wenn den Betrieben verallgemeinerungsfähige Kategorien im Repräsentativfrage-
Qualifizierung für die <strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong><br />
bogen angeboten werden. Die Ermittlung der einzelnen inhaltlichen Schwerpunkte<br />
neuer Qualifikationsbedarfsentwicklungen bedarf daher eines weiteren Untersuchungsschritts.<br />
Sie können nur in (die Repräsentativbefragung ergänzenden) Experteninterviews<br />
mit Gesprächspartnern aus den Betrieben erhoben werden; für<br />
deren Durchführung haben sich halboffene Fragebögen bewährt, die <strong>zu</strong><strong>dem</strong> nach<br />
Themen <strong>und</strong> betrieblichen Besonderheiten (z.B. Handwerk gegenüber Industrie)<br />
differenziert werden können. Diese qualitativen Interviews können <strong>zu</strong>sätzlich <strong>zu</strong><br />
betrieblichen/thematischen Fallanalysen ausgearbeitet werden.<br />
• Einbe<strong>zu</strong>g der Beschäftigten in die Bedarfsanalyse<br />
Da die von den Beschäftigten als „Experten ihrer eigenen Arbeit“ wahrgenommenen<br />
Qualifizierungsbedarfe von praktischer Bedeutung sind, um die Angaben der Experten<br />
des Managements ab<strong>zu</strong>r<strong>und</strong>en, ist ein <strong>zu</strong>mindest exemplarischer Einbe<strong>zu</strong>g der<br />
Beschäftigten in die QBA unbedingt wünschenswert. Dies gilt insbesondere in einer<br />
Zeit, in der lebenslange Weiterqualifizierung Bedingung für relative Beschäftigungssicherheit<br />
ist <strong>und</strong> der Eigeninitiative der Beschäftigten daher <strong>zu</strong>nehmend Bedeutung<br />
<strong>zu</strong>kommt <strong>und</strong> von den Betrieben auch vermehrt erwartet wird. Als Methoden<br />
bieten sich quantitative Befragungen (gewichtete Stichprobe) oder Gruppendiskussionen<br />
an.<br />
87
Liste der EQUIB-Veröffentlichungen<br />
Die Publikationen können telefonisch (0421/218 95 15), per Fax (0421/218- 45 60) sowie per Email<br />
(ubenedix@uni-bremen.de) angefordert werden.<br />
Berufsreport 1: Industrielle Metallberufe (quantitativ)<br />
Teil A: Struktur der Technologieimplementation, Faktoren der Nachfrageentwicklung nach Industriellen Metallberufen,<br />
betriebliche Strategien der Bedarfsdeckung <strong>und</strong> Bewertung des Fachkräfteangebots (1991)<br />
Teil B: Fachkräftebedarf für Neue Technologien: Gesamtnachfrage <strong>und</strong> Einzelanalysen <strong>zu</strong> den Industriellen Metallberufen<br />
einschließlich ihrer Fachrichtungen sowie Einzelauswertungen <strong>zu</strong> Technologien mit hoher Nachfrage<br />
(1991)<br />
Berufsreport 2: Industrielle Metallberufe (qualitativ)<br />
Technologiespezifische Tätigkeitsbereiche <strong>und</strong> berufsspezifischer Bedarf an innovationsorientierten Aus- <strong>und</strong><br />
Weiterbildungsmaßnahmen für ausgewählte Neue Technologien (1991)<br />
– vergriffen –<br />
Berufsreport 3: Handwerkliche Metallberufe<br />
Umfang der betrieblichen Personalbedarfsentwicklung, betriebliche Strategien der Bedarfsdeckung, Tätigkeitsbereiche<br />
<strong>und</strong> Anforderungen an die Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung, Trends <strong>und</strong> Probleme in der technologiebedingten<br />
Qualifikationsentwicklung (1992)<br />
Berufsreport 4: Handwerkliche Metallberufe: Klempner, Gas- <strong>und</strong> Wasserinstallateur, Zentralhei<strong>zu</strong>ngs-<br />
<strong>und</strong> Lüftungsbauer<br />
Neue Techniken <strong>und</strong> Verarbeitungsmethoden, Personalbedarfsentwicklung, Anforderungen an die Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
(1992)<br />
Berufsreport 5: Industrielle <strong>und</strong> Handwerkliche Elektroberufe für den Einsatz an Neuen Technologien<br />
in metallverarbeitenden Betrieben<br />
Personalbedarf, Strategien der Bedarfsdeckung, Anforderungen an die Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung (1993)<br />
Berufsreport 6: Neue Technologien <strong>und</strong> produktionsorientierte Dienstleistungsberufe<br />
Personal- <strong>und</strong> Fortbildungsbedarf für Ingenieure, Techniker <strong>und</strong> Industriemeister (1993)<br />
Stand <strong>und</strong> Entwicklung technologischer Innovationen in der Industrieregion Bremen<br />
Eine regionale Untersuchung in Betrieben der Metallindustrie <strong>und</strong> des Metallhandwerks (1992)<br />
Analysen betrieblicher Strukturdaten für eine integrierte Technologie-, Beschäftigungs- <strong>und</strong><br />
Qualifizierungspolitik im Lande Bremen<br />
Zusammenfassung der EQUIB-Untersuchungen (1993)<br />
Aspekte der regionalen Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Qualifizierungspolitik (1993)<br />
Bedeutung der Herstellerkurse<br />
Erstausbildung in der betrieblichen Praxis<br />
Problemgruppen des Arbeitsmarkts<br />
Der Standortfaktor Qualifikation in der Industrieregion Bremen<br />
Bestands<strong>auf</strong>nahme <strong>und</strong> Perspektiven des Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsbedarfs Industrieller Metallberufe für Neue<br />
Technologien (Hg. Projekt EQUIB, 1991; Beiträge <strong>zu</strong> einer Fachtagung des Projekts)<br />
– vergriffen –<br />
Informations-, Beratungs- <strong>und</strong> Qualifizierungsbedarf von Bremer <strong>und</strong> Bremerhavener Betrieben<br />
für die Teilnahme am Europäischen Binnenmarkt<br />
(1993)<br />
Neue Technologien <strong>und</strong> Qualifikationsfolgen im distributiven Dienstleistungssektor der Wirtschaftsregion<br />
Bremen 1 (1995)<br />
Informations- <strong>und</strong> kommunikationstechnische Innovationen <strong>und</strong> logistische Integration:<br />
• Transport-, Umschlags- <strong>und</strong> Lagereibetriebe<br />
• Groß- <strong>und</strong> Außenhandelsbetriebe
Neue Technologien <strong>und</strong> Qualifikationsfolgen im distributiven Dienstleistungssektor der Wirtschaftsregion<br />
Bremen 2 (1996)<br />
Repräsentativuntersuchung in Verkehrs- <strong>und</strong> Handelsbetrieben<br />
• Strukturwandel <strong>und</strong> logistische Integration<br />
• Stand <strong>und</strong> Entwicklung technologischer Innovationen<br />
• Neue <strong>und</strong> erweiterte Qualifikationsanforderungen<br />
• Strategien der Bedarfsdeckung<br />
Das Druck- <strong>und</strong> Verlagswesen <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zu</strong>m Mediendienstleister: Neue Technologien <strong>und</strong><br />
Produkte: Folgen für Arbeitsorganisation <strong>und</strong> Qualifikation (1996)<br />
Empirische Untersuchung in Institutionen <strong>und</strong> Betrieben der Wirtschaftsregion Bremen<br />
• Druckvorstufenbetriebe<br />
• Werbeagenturen<br />
• Druckereien<br />
• Zeitungsverlage<br />
Technologieentwicklung <strong>und</strong> Qualifikationsfolgen in Metallindustrie <strong>und</strong> Metallhandwerk (1997)<br />
Repräsentativuntersuchung in Bremer <strong>und</strong> Bremerhavener Betrieben<br />
IuK-Technik <strong>und</strong> Neue Technologien im Metallhandwerk: Einsatz, Beratung, Verb<strong>und</strong>ausbildung<br />
(1997)<br />
Ausgewählte Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in Bremer <strong>und</strong> Bremerhavener Metallbetrieben<br />
Städtetourismus, Messe- <strong>und</strong> Kongreßwesen: Dienstleistungsperspektiven <strong>und</strong> Qualifikationsfolgen<br />
(1997)<br />
Empirische Studie in Bremer <strong>und</strong> Bremerhavener Unternehmen <strong>und</strong> Institutionen<br />
Qualifikationsentwicklung im Nahrungs -<strong>und</strong> Genußmittelgewerbe: Technologieeinsatz, Organisationsstruktur<br />
<strong>und</strong> Qualifikationsfolgen (1999)<br />
Repräsentativuntersuchung in Bremer <strong>und</strong> Bremerhavener Betrieben<br />
Qualifizierung für die Wissensgesellschaft (2000)<br />
Erstausbildung, Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung, Trends der Qualifikationsentwicklung in der Informationstechnik-<br />
Branche des Landes Bremen<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heits</strong>- <strong>und</strong> <strong>Sozialpflegedienste</strong> <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zu</strong> <strong>modernen</strong> Dienstleistern (2000)<br />
Beschäftigungsentwicklung <strong>und</strong> Qualifikationsbedarf, Anforderungen an die Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Reihe: Betriebliche Innovationen <strong>und</strong> Qualifizierung<br />
Beiträge <strong>zu</strong>r Umset<strong>zu</strong>ng in die Praxis<br />
Band 1: Oberflächentechnologie (1998)<br />
Untersuchung über verwandte Verfahren, Informations- <strong>und</strong> Qualifikationsbedarfe in Betrieben der Industrieregion<br />
Bremen<br />
Band 2: IuK-Technikeinsatz <strong>und</strong> Qualifikationsbedarf in den Speditionsbetrieben der Wirtschaftsregion<br />
Bremen (1998)<br />
Untersuchung über die Folgen des Strukturwandels <strong>und</strong> der technologischen Innovation für die Mitarbeiterqualifizierung