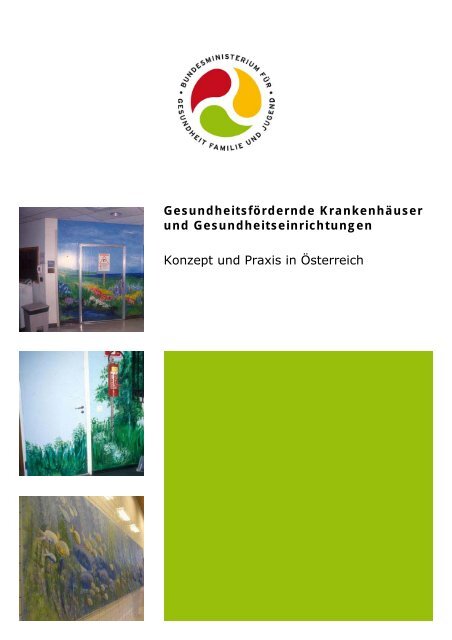Gesundheitsfördernde Krankenhäuser und ...
Gesundheitsfördernde Krankenhäuser und ...
Gesundheitsfördernde Krankenhäuser und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhäuser<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenKonzept <strong>und</strong> Praxis in Österreich
Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhäuser <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenKonzept <strong>und</strong> Praxis in Österreich3
ImpressumHerausgeber, Medieninhaber <strong>und</strong> Hersteller:B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit, Familie <strong>und</strong> Jugend, Sektion IVRadetzkystraße 2, 1030 WienAlle Rechte vorbehalten.Für den Inhalt verantwortlichHon.-Prof. Dr. Robert Schlögel, Leiter der Sektion IVKonzepterstellung <strong>und</strong> Redaktion:Christina Dietscher, Karl Krajic, Jürgen M. PelikanLudwig Boltzmann Institut für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsforschungWHO-Kooperationszentrum für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Krankenhaus <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitswesenDruck: Kopierstelle des BMGFJ, Radetzkystraße 2, 1030 WienErscheinungsjahr: 2008Cover-Fotos:Wandmalereien in Krankenhäusern, abgedruckt mit fre<strong>und</strong>licher Genehmigung derfinnisch-amerikanischen Künstlerin Rea Nurmi (die Bildrechte liegen bei der Künstlerin).http://www.reanurmi.com/Bestellmöglichkeiten:Telefon: +43-1/711 00-4700 DWE-Mail: broschuerenservice@bmgfj.gv.atInternet: http://www.bmgfj.gv.atISBN 978-3-902611-21-5
InhaltVorwort:Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen –ein wichtiger Beitrag zur Qualitätsentwicklung im Ges<strong>und</strong>heitswesenAndrea KDOLSKY 9Vorwort:Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen –chancenträchtige Settings der Ges<strong>und</strong>heitsförderungKlaus ROPIN 111Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen 131.1EinleitungJürgen M. PELIKAN, Christina DIETSCHER, Karl KRAJIC 141.2Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Qualitätsstrategie von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenJürgen M. PELIKAN, Christina DIETSCHER, Karl KRAJIC 171.35 Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Krankenhaus: Pilotierung in ÖsterreichChristina DIETSCHER 411.4Zur Evidenz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenChristina DIETSCHER 452Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen umsetzen:Beispiele für PatientInnen, MitarbeiterInnen, die regionaleBevölkerung <strong>und</strong> die ges<strong>und</strong>heitsfördernde Setting-Gestaltung 532.1EinleitungChristina DIETSCHER 542.2Ges<strong>und</strong>heitsförderung für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche im Ges<strong>und</strong>heitswesenPeter NOWAK 552.3Anschlüsse der Ges<strong>und</strong>heitsförderung an die AkutgeriatrieInterview mit Ulrike SOMMEREGGER 602.4Patientenselbsthilfe <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderungInterview mit Monika MAIER 632.5Aggressions-, Gewalt- <strong>und</strong> Deeskalationsmanagement für MitarbeiterInnen: EinProjekt der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>Harald STEFAN 662.6Frauenges<strong>und</strong>heit(-sförderung) im Spital als gemeindenahes Angebot: DieFrauenges<strong>und</strong>heitszentren F.E.M. <strong>und</strong> F.E.M. Süd – Ziele, Strategien, ErgebnisseBeate WIMMER-PUCHINGER, Daniela KERN, Hilde WOLF 745
2.7Grosse schützen Kleine – ein erfolgreiches Model of Best Practice an derSchnittstelle zwischen Krankenhaus <strong>und</strong> regionaler BevölkerungGudula BRANDMAYR 812.8Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Setting-Gestaltung am Beispiel der Kooperation Ges<strong>und</strong>heitsfördernder<strong>und</strong> Rauchfreier Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenChristina DIETSCHER, Sonja NOVAK-ZEZULA 862.9Beiträge der Ges<strong>und</strong>heitsförderung zur PatientensicherheitÜbersetzung eines Papiers einer HPH-Arbeitsgruppe 912.10Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Strategie für Trägerorganisationen am Beispiel desWiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>es (KAV)Christine PRAMER 963Netzwerke: Eine Strategie zur Unterstützung vonGes<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen 1013.1Das internationale Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(HPH)Christina DIETSCHER, Jürgen M. PELIKAN 1023.2Das Österreichische Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG)Christina DIETSCHER, Rainer HUBMANN 1083.3Unterstützung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Wien: Vom Modellprojekt zur WienerAllianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderungUrsula HÜBEL 1144Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungen 1194.1Empfehlungen für Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenJürgen M. PELIKAN, Christina DIETSCHER 1204.2Empfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen von Ges<strong>und</strong>heitsförderungdurch EntscheidungsträgerInnen in Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesenJürgen M. PELIKAN, Christina DIETSCHER 1235Anhänge 1275.1Auszüge aus der Budapester Erklärung Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser(WHO 1991): 17 Forderungen in vier Zielbereichen 1285.2Auszüge aus den Wiener Empfehlungen für Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhäuser(WHO 1997): Handlungsempfehlungen in vier Bereichen 1306
5.3Statuten des Internationalen Netzwerks Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (HPH) 1325.4Überblick: Gesetzliche Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung im österreichischenGes<strong>und</strong>heitswesen 1405.5Mitglieder <strong>und</strong> Partner des Vereins „Österreichisches Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen“ (ONGKG) 1445.6NetzwerkkoordinatorInnen <strong>und</strong> andere internationale AkteurInnen im BereichGes<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen 1495.7.Weiterführende Links 1555.8AutorInnen <strong>und</strong> InterviewpartnerInnen 1567
VorworteVorwortGes<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen –ein wichtiger Beitrag zur Qualitätsentwicklung imGes<strong>und</strong>heitswesenDas österreichische Ges<strong>und</strong>heitssystem gehört zu den besten der Welt. Dennoch stellendie aktuellen epidemiologischen <strong>und</strong> demografischen Entwicklungen – vor allem die Zunahmedes Anteils älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung <strong>und</strong> der Anstieg chronischerErkrankungen – den Ges<strong>und</strong>heitssektor vor Herausforderungen, die nicht allein mitden Möglichkeiten der Spitzenmedizin zu bewältigen sind.Wie bereits die Ottawa-Charta der Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation von 1986 erwähnt, müssenunterschiedliche Sektoren – Bildung, Wirtschaft, Umwelt <strong>und</strong> andere – zur Ges<strong>und</strong>erhaltungder Bevölkerung in unterschiedlicher Weise beitragen, <strong>und</strong> auch der Ges<strong>und</strong>heitssektorhat spezifische Möglichkeiten, die gemäß den Forderungen der Ottawa-Chartaüber Diagnose <strong>und</strong> Behandlung hinausgehen müssen. Dazu gehören unter anderem:• Verbesserung der klinischen Ergebnisse der Krankenbehandlung durch Einbau vonGes<strong>und</strong>heitsförderung in Behandlungsroutinen• Nutzung des vorhandenen Know-Hows zu Ges<strong>und</strong>heitsfragen (vor allem auf dem Gebietder Lebensstilentwicklung <strong>und</strong> des Umgangs mit chronischen Erkrankungen) fürInformation, Beratung <strong>und</strong> Training• Vorbildwirkung von Angehörigen der Ges<strong>und</strong>heitsberufe für PatientInnen <strong>und</strong> BesucherInnen• Aufzeigen von spezifischen Ges<strong>und</strong>heitsrisiken auf Gr<strong>und</strong>lage der Auswertung vonPatientendaten (Ges<strong>und</strong>heitsberichterstattung)• Forschung <strong>und</strong> Ausbildung auch zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung• Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung für MitarbeiterInnen, da Arbeitsplätze im Ges<strong>und</strong>heitswesenzu den belastendsten zählen.Die jüngere Evidenzforschung zeigt, dass so verstandene Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungennicht nur eine plausible, sondern auch eine wirksame Strategiezur Stärkung der Ges<strong>und</strong>heit von PatientInnen, MitarbeiterInnen <strong>und</strong> der regionalen Bevölkerungist.Aus diesem Gr<strong>und</strong> bekennt sich das österreichische Ges<strong>und</strong>heitsressort des B<strong>und</strong>es zurGes<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> unterstützt die Entwicklung <strong>und</strong> Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsstrategienim Ges<strong>und</strong>heitssektor seit vielen Jahren. Neben der Förderung spezifischerImplementierungsprojekte <strong>und</strong> Unterstützungsstrukturen wie dem ÖsterreichischenNetzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG) hat sich das Ministerium immer auch um eine nachhaltige Verankerung vonGes<strong>und</strong>heitsförderung bemüht, sodass es heute eine Reihe von gesetzlichen Gr<strong>und</strong>lagenzur Umsetzung im österreichischen Ges<strong>und</strong>heitswesen gibt. Zuletzt wurde im Ges<strong>und</strong>-9
Vorworteheitsqualitätsgesetz (2005) definiert, dass Ges<strong>und</strong>heitsförderung auch Bestandteil der zuerbringenden Qualität von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen ist, <strong>und</strong> in Art 15a B-VG (2008-2013)wird Ges<strong>und</strong>heitsförderung als eine der Aufgaben der Landesges<strong>und</strong>heitsplattformenfestgelegt.Ich freue mich, dass das Ges<strong>und</strong>heitsressort im Rahmen seiner politischen Möglichkeitenkontinuierlich zur Stärkung der Verbreitung <strong>und</strong> Umsetzung dieser wichtigen Strategie inÖsterreich beitragen konnte, wie dies in den zahlreichen Umsetzungsbeispielen in dieserBroschüre zum Ausdruck kommt. Und ich bin stolz darauf, dass Österreich darüber hinausmit dem WHO-Kooperationszentrum für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Krankenhaus <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen über ein internationales Kompetenzzentrum auf dem Gebiet der Ges<strong>und</strong>heitsförderungim Ges<strong>und</strong>heitswesen verfügt.Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der in dieser Broschüre zusammengefasste Erkenntnisstandzur Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Ges<strong>und</strong>heitswesen bei PraktikerInnen <strong>und</strong>EntscheidungsträgerInnen des österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektors gleichermaßen aufbreites Echo stößt. Ziel sollte sein, dass jede österreichische Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung aucheine ges<strong>und</strong>heitsfördernde Einrichtung ist. Das Ges<strong>und</strong>heitsressort wird das weitere qualitativabgesicherte Wachstum von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen indiesem Sinne unterstützen <strong>und</strong> gemeinsam mit den Ländern, Spitalserhalten <strong>und</strong> Betreibernvon Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen Schritte zu einer effektiven Implementierung derentsprechenden Forderungen des Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetzes setzen. Denn nur durcheine weitere Verbreitung <strong>und</strong> Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung sowohl auf Ebeneeinzelner Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen als auch durch stärkere föderale <strong>und</strong> regionale Verankerungkönnen die potenziellen Beiträge der Ges<strong>und</strong>heitsförderung zur öffentlichenGes<strong>und</strong>heit möglichst weitgehend ausgeschöpft werden.Ich danke Allen, die zur Umsetzung <strong>und</strong> Qualitätsentwicklung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungim österreichischen Ges<strong>und</strong>heitswesen schon bisher beigetragen haben, <strong>und</strong> hoffe, dassihr Beispiel Schule machen wird.Dr. Andrea KdolskyB<strong>und</strong>esministerin für Ges<strong>und</strong>heit, Familie <strong>und</strong> Jugend10
VorworteVorwortKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen –chancenträchtige Settings derGes<strong>und</strong>heitsförderungKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen stellen aus Sicht des Fonds Ges<strong>und</strong>es Österreichseit Jahren bedeutende <strong>und</strong> chancenträchtige Settings der Ges<strong>und</strong>heitsförderungdar. Viele dieser Einrichtungen haben sich längst vom Kompetenzzentrum für biomedizinischeDiagnostik, Vorsorge <strong>und</strong> Therapie hin zu Knotenpunkten der Ges<strong>und</strong>heitsförderungweiterentwickelt, die nun auch für einen ressourcenorientierten, ganzheitlich ausgerichtetenBeratungs-, Betreuungs- <strong>und</strong> Behandlungsansatz auf professioneller <strong>und</strong> wissenschaftlicherBasis stehen.Insbesondere die Ges<strong>und</strong>heitsfördernden Krankenhäuser können bereits auf eine mehrjährigeTradition als Kristallisationspunkte der Ges<strong>und</strong>heitsförderung zurückblicken. Ihreprimäre Funktion <strong>und</strong> natürliche Autorität als Expertenorganisation für Krankheits(früh)erkennung<strong>und</strong> -behandlung einerseits <strong>und</strong> die große Zahl <strong>und</strong> heterogeneZusammensetzung der täglich in diesen Settings zusammenkommenden Menschen andererseitsbergen bedeutendes Potenzial für die Ges<strong>und</strong>heitsförderung:• für die in diesen Einrichtungen Beschäftigten, zu denen sowohl ProfessionistInnen imGes<strong>und</strong>heitsdienst als auch RepräsentantInnen anderer, nicht krankheits- oder ges<strong>und</strong>heitsbezogenerBerufe gehören;• für die PatientInnen <strong>und</strong> ihre Angehörigen, die durch den Anlass für den Aufenthaltoft besonders für Ges<strong>und</strong>heitsfragen sensibilisiert sind;• für die Region – z.B. über den Kontakt mit LieferantInnen bzw. externe DienstleisterInnenaus der näheren <strong>und</strong> ferneren Umgebung.Insgesamt ergeben sich für Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen vielfältige Kontakte <strong>und</strong> Möglichkeitenfür Informationstransfer <strong>und</strong> Interventionen, die auch in angegliederte Settingsbzw. auch in kooperierende Settings wie die Gemeinde / Stadt / Region, das familiäreSetting (von MitarbeiterInnen <strong>und</strong> PatientInnen) oder auch in betriebliche Settings (z.B.regionale Wirtschaftsbetriebe) hineinwirken.All diese Kontakte <strong>und</strong> Beziehungen sind in ihrer Vielfalt mit dem neuronalen Geflecht<strong>und</strong> mit den Verschaltungen des menschlichen Gehirns gut vergleichbar <strong>und</strong> eignen sichbesonders als Nährboden <strong>und</strong> Transfersystem für viele Ansätze der Ges<strong>und</strong>heitsförderung.Gerade die Ges<strong>und</strong>heitsfördernden Krankenhäuser haben bewiesen, wie auf wissenschaftlichf<strong>und</strong>ierter Basis praxisrelevante <strong>und</strong> praxisnahe Präventions- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderungskonzepteentwickelt, erprobt, integriert <strong>und</strong> dann auch auf ihre Wirksamkeitüberprüft werden können. Und sie veranschaulichen gangbare Wege, wie ihre Ergebnisse<strong>und</strong> Produkte für breite Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht werden können.Die Voraussetzungen für professionelle Ges<strong>und</strong>heitsförderung sind in vielerlei Hinsichtlohnend: Diese Institutionen sind es gewohnt, mit einem hohen Qualitätsanspruch, sehrstrukturiert <strong>und</strong> effizient zu arbeiten, mit einer Vielzahl von Zielgruppen <strong>und</strong> Einflussfaktorenzurecht zu kommen, sich dabei ständig selbst weiter zu entwickeln <strong>und</strong> dazuzulernen<strong>und</strong> sich selbst als „Reagenzglas“ zur Entwicklung neuer Ansätze <strong>und</strong> Methoden zuverstehen <strong>und</strong> zur Verfügung zu stellen. Diese Qualitäten haben ganz sicher dazu beigetragen,dass aus Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen immer wieder spürbare Impulse für die Ges<strong>und</strong>heitsförderungkommen.Waren die Aktivitäten anfänglich noch vielfach einem etwas eingeschränkten, ausschließlichbiomedizinischen Ges<strong>und</strong>heitsbegriff verpflichtet <strong>und</strong> die gesetzten Interventionen11
Vorwortebesonders im verhaltenspräventiven Bereich angesiedelt, so hat es gerade in den letztenzwei Jahren spürbar eine Weiterentwicklung in Richtung eines ganzheitlichen Ges<strong>und</strong>heitsverständnisses<strong>und</strong> auch zur Einbeziehung verhältnisorientierter Ansätze gegeben.Bedeutende Verdienste hierzu sind aus Sicht des Fonds Ges<strong>und</strong>es Österreich im Bereichder Betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung zu betonen – nicht zuletzt deshalb, weil die indiesen Einrichtungen arbeitenden Menschen aufgr<strong>und</strong> der Arbeitsinhalte, -strukturen <strong>und</strong>-bedingungen auch ganz besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Aber auch im Bereichregionaler Ges<strong>und</strong>heitsförderung sind Krankenhäuser <strong>und</strong> andere Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenoftmals naheliegende Kompetenzzentren, die mit natürlicher Autorität <strong>und</strong> mit dringendbenötigten, aber anderweitig vielfach fehlenden, Kompetenzen ausgestattet sind.Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre beleuchtet, so kann konstatiert werden,dass bereits zahlreiche Krankenhäuser <strong>und</strong> auch erste andere Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenin Österreich eine Entwicklung im Sinne einer der wichtigsten Forderungen der OttawaCharta der WHO zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung aus dem Jahre 1986, nämlich nach einer “Reorientierungder Ges<strong>und</strong>heitsdienste“ in ges<strong>und</strong>heitsförderliche Richtung zumindest begonnen,einige auch schon sehr weit umgesetzt <strong>und</strong> integriert haben.Besucht man die jährlichen nationalen Konferenzen des Vereins „Österreichisches NetzwerkGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen“, so kannman diese Entwicklung an zahlreichen wissenschaftlichen Präsentationen <strong>und</strong> Praxisbeispielenaus Häusern aus dem gesamten B<strong>und</strong>esgebiet verfolgen. Der Fonds Ges<strong>und</strong>esÖsterreich konnte bei einigen dieser Projekte <strong>und</strong> Aktivitäten in der Vergangenheit auchinhaltlich <strong>und</strong> finanziell unterstützen <strong>und</strong> dadurch mit gestalten. Eine solche Entwicklungwar allerdings nur dadurch möglich, dass Politik, Ges<strong>und</strong>heitswesen, Wissenschaft <strong>und</strong>PraktikerInnen eine gemeinsame Idee aufgegriffen, daran geglaubt <strong>und</strong> an deren Realisierungkonsequent zusammen gearbeitet haben. In diesem Sinne ist die heutige Situationder Ges<strong>und</strong>heitsfördernden Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen ein schönesModell für den Gr<strong>und</strong>gedanken der Ges<strong>und</strong>heitsförderung: wissenschaftlich f<strong>und</strong>iert, vernetzend<strong>und</strong> alle relevanten Kräfte einbeziehend praxiswirksame Ansätze zu verfolgen,partizipativ zu planen <strong>und</strong> zur Umsetzung zu bringen.Für den Fonds Ges<strong>und</strong>es Österreich kann ich der Überzeugung Ausdruck geben, dass derrichtige Weg beschritten wurde, dass diese Entwicklung dem Wohl der österreichischenBevölkerung dient <strong>und</strong> somit dieser Weg auch konsequent weiter gegangen werden soll,denn noch sind nicht alle erstrebenswerten Ziele, etwa das Rauchfreie Krankenhaus, vollerreicht. Der Fonds Ges<strong>und</strong>es Österreich wird auch weiterhin gerne im Rahmen seinesAuftrages <strong>und</strong> seiner Möglichkeiten einen Beitrag dazu leisten.Dr. Klaus RopinGes<strong>und</strong>heit Österreich GmbH, Geschäftsbereich Fonds Ges<strong>und</strong>es Österreich12
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen1Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen13
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen1.1EinleitungJürgen M. PELIKAN, Christina DIETSCHER, Karl KRAJICGes<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen hat sich in den letzten 20 Jahren zueiner etablierten Strategie des Ges<strong>und</strong>heitswesens entwickelt – von Anfang an mit maßgeblicherösterreichischer Beteiligung: Auf Gr<strong>und</strong>lage der WHO-Ottawa-Charta (1986)<strong>und</strong> weiterführender Überlegungen einer WHO-Expertengruppe zu deren Übertragbarkeitauf Krankenhäuser (Milz / Vang 1989) wurde im Jahr 1989 an der Wiener KrankenanstaltRudolfstiftung das Modellprojekt „Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankenhaus“ gestartet – mitdem Ziel, die von der WHO definierten Prinzipien der Ges<strong>und</strong>heitsförderung erstmalsauch in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen für die drei Zielgruppen PatientInnen, MitarbeiterInnen<strong>und</strong> regionale Bevölkerung zu erproben <strong>und</strong> umzusetzen. Bereits im Jahr daraufwurde das Internationale Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser(HPH) gegründet – zunächst als „Multi City Action Plan“ des WHO-Projektes „HealthyCities“. 1991 formulierte eine Expertengruppe in der „Budapest Declaration on HealthPromoting Hospitals“ (WHO 1991) wesentliche Ziele <strong>und</strong> Inhalte Ges<strong>und</strong>heitsfördernderGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen. Dieses Dokument war die Gr<strong>und</strong>lage für die Rekrutierungvon Krankenhäusern für ein erstes europäisches Umsetzungsprojekt der WHO.An diesem „European Pilot Hospital Project on Health Promoting Hospitals -EPHP“ (1993-1997) waren 20 Krankenhäuser aus 11 europäischen Staaten beteiligt(Nowak et al. 1997, Pelikan et al. 1998, Pelikan / Wolff 1999). Die Koordination <strong>und</strong> wissenschaftlicheBegleitung dieses Projektes durch das Ludwig Boltzmann Institut für Medizin-<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologie (LBIMGS) wurde vom österreichischen B<strong>und</strong>esressort fürGes<strong>und</strong>heit finanziert, das auch die Ernennung des LBIMGS zum WHO-Kooperationszentrum (seit 1992) <strong>und</strong> dessen Funktion als erstes Sekretariat des HPH-Netzwerks ermöglichte. Auf Basis der Ergebnisse des EPHP wurden 1997 die „ViennaRecommendations on Health Promoting Hospitals“ verabschiedet: Dieses Dokumentorientierte die – ab 1995 von der WHO aktiv verfolgte <strong>und</strong> von der EU unterstützte – Politikder Etablierung nationaler <strong>und</strong> regionaler Netzwerke von HPH.Das nationale Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser in Österreichwurde 1996 basierend auf den Erfahrungen des Wiener Modellprojekts <strong>und</strong> des EPHP <strong>und</strong>mit Unterstützung durch das B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit gegründet. Seit Oktober2006 ist das Netzwerk als gemeinnütziger Verein „Österreichisches Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen“ organisiert. In Übereinstimmungmit dem österreichischen Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetz (2005) steht es nunallen österreichischen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen offen. Auf regionaler Ebene hatdie Stadt Wien ihre Pilotrolle beim Wiener Modellprojekt wieder aufgenommen <strong>und</strong> unterstütztals erstes österreichisches B<strong>und</strong>esland ein eigenes Regionalnetzwerk, seit demJahr 2000 als Initiative „Informationsnetzwerk für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Wiener Spitälern<strong>und</strong> Pflegeeinrichtungen“, das 2008 in die trägerübergreifende Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderungin Spitälern, Pflegeeinrichtungen <strong>und</strong> Seniorenwohneinrichtungenübergeführt wurde.Nicht nur in Österreich, auch international hat sich die Netzwerkstrategie von HPH alserfolgreich erwiesen: Heute, nahezu 20 Jahre nach dem Start des Wiener Modellprojekts,präsentiert sich HPH als globales Netzwerk, das 37 nationale <strong>und</strong> regionale Netzwerkein drei Kontinenten (Europa, Nordamerika, Asien) <strong>und</strong> einzelne Mitgliedseinrichtungenaus Ländern ohne eigenes Netzwerk in einem weiteren Kontinent (Australien) umfasst.Insgesamt gibt es etwa 700 offiziell registrierte Mitgliedseinrichtungen. Diese Größe<strong>und</strong> Verbreitung machten eine Formalisierung der HPH-Steuerungsstrukturen erforderlich:Das Netzwerk verfügt seit 2006 über einen aus seinen Mitgliedern gewähltenVorstand, führt eine jährliche internationale Mitgliederversammlung durch <strong>und</strong> ist seit14
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen2008 als internationaler Verein mit besonderer Beziehung zur WHO organisiert(vgl. dazu auch Kapitel 3.1 bzw. die deutsche Übersetzung der Statuten in Anhang 5.3).Um im Ges<strong>und</strong>heitswesen anschlussfähig <strong>und</strong> nachhaltig erfolgreich zu sein, war es fürHPH erforderlich, seine strategischen <strong>und</strong> inhaltlichen Schwerpunkte permanent an diedynamischen Entwicklungen in diesem Feld anzupassen. So hat das Netzwerk auf dieimmer wichtiger werdende Kooperation <strong>und</strong> Vernetzung unterschiedlicher Versorgungsebenen<strong>und</strong> -einrichtungen im Jahr 2007 durch eine Öffnung für alle Typen vonGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen reagiert.Schon länger ein Thema ist die zunehmende Bedeutung der Qualitätsbewegungen imGes<strong>und</strong>heitswesen: HPH, das ursprünglich als offener Organisationsentwicklungsansatzentwickelt worden war, hat etwa ab dem Jahr 2000 immer mehr auf die Entwicklung vonStrategien <strong>und</strong> Instrumenten gesetzt, die eine Verbindung von (Qualitäts-)Management<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen unterstützen. Heute liegt einKonzept von 18 Kernstrategien, 7 Umsetzungsstrategien (Pelikan et al. 2006) <strong>und</strong>fünf Standards (Gröne 2007) vor, die die Planung, Implementierung, Qualitätsbewertung<strong>und</strong> kontinuierliche Weiterentwicklung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung sowie die Anbindungan das (Qualitäts-)Management (vgl. Brandt 2001) in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenunterstützen. Auch die Evidenzlage für Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Ges<strong>und</strong>heitswesen istmittlerweile sehr gut <strong>und</strong> entwickelt sich permanent weiter (vgl. auch Kapitel 1.4 in dieserBroschüre).Vor dem Hintergr<strong>und</strong> dieser erfolgreichen Entwicklungen bietet das folgende Kapitel einenÜberblick über den gegenwärtigen Entwicklungsstand des HPH-Konzeptes, dieAnwendung von HPH-Instrumenten in Österreich <strong>und</strong> die verfügbare Evidenz fürden HPH-Ansatz.Wir danken dem österreichischen B<strong>und</strong>esressort für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> seinen MitarbeiterInnen,die das „Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhaus“ über viele Jahre engagiert begleitethaben, sehr herzlich für ihre Unterstützung, die eine permanente Weiterentwicklung vonHPH sowohl in Österreich als auch international ermöglicht <strong>und</strong> damit wesentlich zumErfolg dieses Netzwerks beigetragen hat.LiteraturBrandt E. (Ed.) (2001): Qualitätsmanagement <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Krankenhaus: Handbuchzur EFQM-Einführung. Neuwied & Kriftel: LuchterhandGröne O. (2006): Implementing health promotion in hospitals: Manual and self-assessment forms.Copenhagen: World Health OrganizationMilz H., Vang J. (1989): Consultation on the Role of Health Promoting Hospitals. In: Health PromotionInternational 3 (4), 425-427Nowak P., Lobnig H., Pelikan J.M., Krajic K. (1997): Das Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhaus. Ergebnisse<strong>und</strong> Umsetzungserfahrungen am Beispiel eines österreichischen Modellprojekts. Wien:BMAGSPelikan J.M., Garcia-Barbero M., Lobnig H., Krajic K. (1998): Pathways to a Health Promoting Hospital.Experiences from the European Pilot Hospital Project 1993-1997. Gamburg: Health PromotionPublicationsPelikan J.M., Krajic K., Dietscher C. (2006): Putting HPH Policy into Action. Working Paper of theWHO Collaborating Centre on Health Promotion in Hospitals and Health Care. Vienna: LudwigBoltzmann Institute for the Sociology of Health and Medicine. (http://www.hphhc.cc/Downloads/HPH-Publications/wp-strategies-final.pdf;Zugriff am 03.07.2008)Pelikan J.M., Wolff S. (Hg.) (1999): Das ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhaus. Konzepte <strong>und</strong>Beispiele zur Entwicklung einer lernenden Organisation. Weinheim <strong>und</strong> München: Juventa15
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenRepublik Österreich (Hg., 2005): Artikel 9, B<strong>und</strong>esgesetz zur Qualität von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen(Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetz – GQG). In: 179. B<strong>und</strong>esgesetz, mit dem das B<strong>und</strong>esgesetz überKrankenanstalten <strong>und</strong> Kuranstalten, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das GewerblicheSozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- <strong>und</strong>Unfallversicherungsgesetz, das Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetz, das Ärztegesetz 1998 <strong>und</strong>das B<strong>und</strong>esgesetz über die Dokumentation im Ges<strong>und</strong>heitswesen geändert sowie ein B<strong>und</strong>esgesetzzur Qualität von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen <strong>und</strong> ein B<strong>und</strong>esgesetz über Telematik im Ges<strong>und</strong>heitswesenerlassen werden (Ges<strong>und</strong>heitsreformgesetz 2005)World Health Organization (1986): Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: WHOWorld Health Organization – Regional Office for Europe (1991): The Budapest Declarationon Health Promoting Hospitals. Copenhagen: World Health OrganizationWorld Health Organization – Regional Office for Europe (1997): The Vienna Recommendations onHealth Promoting Hospitals. Copenhagen: World Health Organization16
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen1.2Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Neuorientierungs- <strong>und</strong>Qualitätsstrategie von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenJürgen M. PELIKAN, Christina DIETSCHER, Karl KRAJICGes<strong>und</strong>heitsförderung hat sich in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen bereits vor der Verbreitungder Qualitätsbewegungen als Reformstrategie im Ges<strong>und</strong>heitswesen bewährt <strong>und</strong> dortPionierarbeit für systematische Organisationsentwicklung geleistet (vgl. Pelikan etal. 1998a). Seit den ersten Phasen der Konzeptentwicklung <strong>und</strong> -umsetzung wurde dabeidas Ziel verfolgt, durch eine ges<strong>und</strong>heitsförderliche Weiterentwicklung der klinischpflegerischenKernaufgaben <strong>und</strong> der zur Leistungserbringung erforderlichen Strukturen<strong>und</strong> Prozesse den Ges<strong>und</strong>heitsgewinn von PatientInnen, MitarbeiterInnen <strong>und</strong> derregionalen Bevölkerung zu verbessern. Zusätzlich ging <strong>und</strong> geht es z.T. auch darum,neben den kurativen Leistungen spezifische ges<strong>und</strong>heitsfördernde <strong>und</strong> primärpräventiveLeistungsangebote zu etablieren, um den mittel- <strong>und</strong> langfristigen Ges<strong>und</strong>heitsgewinnder genannten Zielgruppen <strong>und</strong> damit die Public Health-Orientierung von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenauszubauen (vgl. WHO 1991).Als etwa ab Mitte der 1990er Jahre die Qualitätsbewegungen im Ges<strong>und</strong>heitswesenzunehmend an Bedeutung gewannen, wurde eine Adaptierung des bis dahin als offenesEntwicklungskonzept propagierten HPH-Ansatzes erforderlich. Den Auftakt entsprechenderEntwicklungen bildete die 7. Internationale Konferenz Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser„Health Promotion and Quality: Challenges and Opportunities forHealth Promoting Hospitals“ in Swansea, Wales, 1999. Zwei Jahre später kam es zurGründung zweier internationaler HPH-Arbeitsgruppen, die an spezifischen Instrumentenzur Verbindung von Qualität <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung arbeiteten. Die Ergebnisse derArbeitsgruppen wurden 2006 veröffentlicht, sodass nunmehr Strategien <strong>und</strong> Standardszur Umsetzung von HPH als organisationsumfassender Gesamtansatz vorliegen(Pelikan et al. 2006, Gröne 2006).Auf den folgenden Seiten werden die konzeptuellen Gr<strong>und</strong>lagen dieser Instrumente <strong>und</strong>die Instrumente selbst dargestellt.Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Reformkonzept fürGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen: Gr<strong>und</strong>lagen, 18Kernstrategien, 7 Implementierungsstrategien,5 StandardsDie Gr<strong>und</strong>lagenMit der Ottawa-Charta zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung (WHO 1986), die im Rahmen derErsten Weltkonferenz zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung verabschiedet wurde, hat die WHO einumfassendes Gesamtpaket zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung mit dem Ziel der Verbesserung deröffentlichen Ges<strong>und</strong>heit geschnürt, das neben dem Ges<strong>und</strong>heitswesen auch alle anderensozialen Sektoren als wichtige Umsetzungspartner sieht. Das in der Charta beschriebeneKonzept zielt darauf ab, Menschen zu befähigen, die Einflussfaktoren auf ihre Ges<strong>und</strong>heit(d.h. ihre Ges<strong>und</strong>heitsdeterminanten 1 , siehe Abbildung 1 unten) zu verbessern <strong>und</strong>dadurch ihre Ges<strong>und</strong>heit zu steigern (WHO 1986 2 ). Dabei wird Ges<strong>und</strong>heit – im Anschlussan das WHO-Gründungsdokument von 1948 – als umfassendes somato-psycho-1 Zu Ges<strong>und</strong>heitsdeterminanten vgl. Dahlgren / Whitehead (1991) <strong>und</strong> CSDH (2008). Closing the gap in a generation:health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission onSocial Determinants of Health. Geneva, World Health Organization.2 „Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve their health.“17
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagensoziales Gesamtphänomen <strong>und</strong> nicht nur als die Abwesenheit von Krankheit oder Behinderungverstanden.Die Ottawa-Charta hat auch den sogenannten Setting-Ansatz 3 in die konzeptuelleGr<strong>und</strong>lage vieler spezifischer Ges<strong>und</strong>heitsförderungsprogramme (z.B. Ges<strong>und</strong>e Städte,Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Schulen) <strong>und</strong> auch Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(HPH) eingeführt.Abbildung 1: Ges<strong>und</strong>heitsdeterminanten nach Dahlgren / Whitehead (1991)Die Ottawa-Charta, die inzwischen von fünf weiteren Weltkonferenzen zur Ges<strong>und</strong>heitsförderungbestätigt <strong>und</strong> weiter entwickelt wurde, definiert drei Gr<strong>und</strong>prinzipien zur Förderungder Ges<strong>und</strong>heit:• Interessen vertreten (Anwaltschaft für Ges<strong>und</strong>heit);• Befähigen <strong>und</strong> ermöglichen (insbesondere durch partizipative <strong>und</strong> edukative Prozesse– das sogenannte „Empowerment-Konzept“ der Ges<strong>und</strong>heitsförderung);• Vermitteln <strong>und</strong> vernetzen (Kooperationen zwischen unterschiedlichen Akteuren<strong>und</strong> Sektoren).Diese Gr<strong>und</strong>prinzipien sollen gemäß der Charta in fünf Hauptaktionsbereichen der Ges<strong>und</strong>heitsförderungumgesetzt werden:1. Schaffung einer ges<strong>und</strong>heitsfördernden Gesamtpolitik (dieses Thema wurde vonder Zweiten Weltkonferenz zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung 1988 in Adelaide weitergeführt<strong>und</strong> in Europa im Jahr 2006 von der finnischen EU-Präsidentschaft unter dem Slogan„Health in All Policies“ wieder aufgegriffen (vgl. dazu Stahl et al. 2006)2. Ges<strong>und</strong>heitsförderliche Lebenswelten schaffen (dieser Aktionsbereich, dem die DritteWeltkonferenz zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung in S<strong>und</strong>svall 1991 gewidmet war, ist dieGr<strong>und</strong>lage des Setting-Ansatzes)3. Ges<strong>und</strong>heitsbezogene Gemeinschaftsaktionen unterstützen (u.a. diesem Themawidmete sich die Vierte Weltkonferenz in Jakarta 1997 mit einem inhaltlichenSchwerpunkt auf der Rolle von Partnerschaften für Ges<strong>und</strong>heit (vgl. dazu WHO 1998)3 Der Setting-Ansatz der Ges<strong>und</strong>heitsförderung geht davon aus, dass der bestmögliche Wirkungsgrad von Ges<strong>und</strong>heitsförderungs-Interventionenerzielt wird, wenn innerhalb eines Interventionsbereichs (eines „Settings“)sowohl personenorientierte als auch umfeldbezogene Interventionen kombiniert werden (Veränderung von Verhalten<strong>und</strong> Verhältnissen). Der Setting-Ansatz erlaubt darüber hinaus, innerhalb des Interventionsbereichs unterschiedlicheZielgruppen zu erreichen – in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen z.B. PatientInnen <strong>und</strong> MitarbeiterInnen. (vgl.zum Settings-Ansatz u.a. Engelmann / Halkow 2008).18
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen4. Persönliche Kompetenzen entwickeln5. Die Ges<strong>und</strong>heitsdienste neu orientieren (dieser Bereich schließt an die Alma Ata-Erklärung der WHO zur primären Ges<strong>und</strong>heitsversorgung von 1978 an, die Ges<strong>und</strong>heitsförderungerstmals als Aufgabe der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung definiert 4 ).Zwar sind gr<strong>und</strong>sätzlich alle genannten Gr<strong>und</strong>prinzipien <strong>und</strong> Aktionsbereiche der Ottawa-Charta auch für die Anwendung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen relevant, <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenkönnen zu allen einen spezifischen Beitrag leisten. Aber der fünfte Aktionsbereichspricht Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen explizit an. Im Detail heißt es dazu:Ges<strong>und</strong>heitsdienste neu orientieren„Die Verantwortung für die Ges<strong>und</strong>heitsförderung wird in den Ges<strong>und</strong>heitsdienstenvon Einzelpersonen, Gruppen, den Ärzten <strong>und</strong> anderen Mitarbeitern des Ges<strong>und</strong>heitswesens,den Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen <strong>und</strong> dem Staat geteilt. Sie müssen gemeinsam daraufhinarbeiten, ein Versorgungssystem zu entwickeln, das auf die stärkere Förderungvon Ges<strong>und</strong>heit ausgerichtet ist <strong>und</strong> weit über die medizinisch-kurativen Betreuungsleistungenhinausgeht. Die Ges<strong>und</strong>heitsdienste müssen dabei eine Haltung einnehmen,die feinfühlig <strong>und</strong> respektvoll die unterschiedlichen kulturellen Bedürfnisseanerkennt. Sie sollten dabei die Wünsche von Individuen <strong>und</strong> sozialen Gruppennach einem gesünderen Leben aufgreifen <strong>und</strong> unterstützen sowie Möglichkeiten derbesseren Koordination zwischen dem Ges<strong>und</strong>heitssektor <strong>und</strong> anderen sozialen,politischen, ökonomischen Kräften eröffnen.Eine solche Neuorientierung von Ges<strong>und</strong>heitsdiensten erfordert zugleich eine stärkereAufmerksamkeit für ges<strong>und</strong>heitsbezogene Forschung wie auch für die notwendigenVeränderungen in der beruflichen Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung. Ziel dieser Bemühungensoll ein Wandel der Einstellungen <strong>und</strong> der Organisationsformen sein, die eineOrientierung auf die Bedürfnisse des Menschen als ganzheitliche Persönlichkeitermöglichen.“Wie ist die im Dokument geforderte „Neuorientierung der Ges<strong>und</strong>heitsdienste“ zu verstehen?Zwei mögliche Lesarten bieten sich an:• Neuorientierung einzelner Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen: Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungensind die wichtigsten Akteure des Ges<strong>und</strong>heitswesens. Die Prinzipien der Ottawa-Charta können daher nur durch eine Weiterentwicklung dieser Einrichtungen im Sinneder Ges<strong>und</strong>heitsförderung umgesetzt werden.• Neuorientierung von Ges<strong>und</strong>heitssystemen insgesamt: Die umfassende Verwirklichungder Forderungen der Ottawa-Charta bedarf darüber hinaus einer Neuausrichtungvon Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Politiksystemen insgesamt, da einige der genanntenForderungen (z.B. die in der Charta genannte Anpassungen der beruflichen Aus- <strong>und</strong>Weiterbildung, der Organisations- <strong>und</strong> Finanzierungsformen, aber auch die Entwicklungvon Ges<strong>und</strong>heitszielen <strong>und</strong> Steuerungsstrukturen, die über den Ges<strong>und</strong>heitsbereichhinaus auch andere Sektoren umfassen 5 ) nicht in der Kompetenz einzelner Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenliegen. Idealerweise sollte eine umfassende Neuorientierungdaher beide Ansätze verbinden.4 „Die internationale Konferenz zur Primären Ges<strong>und</strong>heitsversorgung [...] erklärt hiermit dringenden Handlungsbedarffür alle Regierungen, Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Entwicklungsarbeiter <strong>und</strong> die Weltgemeinschaft auf dem Gebietdes Schutzes <strong>und</strong> der Förderung der Ges<strong>und</strong>heit aller Menschen dieser Erde.“ (WHO 1978, Übersetzung durchdas LBIHPR 2008)5 Ein gutes österreichisches Beispiel ist das Land Steiermark: Vom Ges<strong>und</strong>heitsressort wurden unter Federführungder Landesges<strong>und</strong>heitsplattform in einem partizipativen, bevölkerungsnahen Prozess eine Reihe von Ges<strong>und</strong>heitszielenin den Bereichen „Ges<strong>und</strong>e Lebensverhältnisse“ (Arbeitsbedingungen, Lernbedingungen, Lebenin der Gemeinde <strong>und</strong> zu Hause), „Rahmenbedingungen für ein ges<strong>und</strong>es Leben“ (mit vor allem lebensstil- <strong>und</strong>präventionsorientierten Unterzielen), <strong>und</strong> „Ges<strong>und</strong>heitsförderndes Ges<strong>und</strong>heitssystem“ entwickelt, an deren Umsetzungnun gearbeitet wird (vgl. http://www.ges<strong>und</strong>heit.steiermark.at/cms/beitrag/10743729/9586209, Zugriff am13.08.2008).19
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenDie bisher bestehenden Netzwerke Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen arbeitenvor allem am ersten Bereich – der Neuorientierung einzelner Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen– bemühen sich aber auch, soweit möglich, um eine Weiterentwicklung der ges<strong>und</strong>heits-<strong>und</strong> gesamtpolitischen Rahmenbedingungen 6 . Gegenstand der vorliegendenBroschüre ist jedoch in erster Linie eine umfassende Darstellung des ersten Bereichs. ImFolgenden soll das Gr<strong>und</strong>lagenkonzept dafür im Detail dargestellt werden.18 Kernstrategien, 7 Implementierungssstrategien <strong>und</strong> 5Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenIn diesem Kapitel wird die Argumentation vertreten, dass Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen– verstanden als zusätzliches Qualitätskriterium neben fachlichen,ökonomischen, ökologischen, sozialen <strong>und</strong> anderen Kriterien – im Sinne der Optimierungvon Strukturen, Prozessen <strong>und</strong> Ergebnissen (Ges<strong>und</strong>heitsoutcomes) 7 in die strategischeQualitätsarbeit von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen eingebaut werden kann <strong>und</strong> soll.Idealerweise führt dies dazu, dass jede fachliche <strong>und</strong> Management-Entscheidung – egal,ob im Einkauf, in der Personalentwicklung oder im klinischen Bereich – auch mit Hinblickauf die potenziell ges<strong>und</strong>heitsförderliche / krankmachende Wirkung der Entscheidunggetroffen wird.Folgt man dem gängigen Donabedian’schen Qualitätsverständnis, wonach die erwünschtenErgebnisse durch eine entsprechende Entwicklung von Strukturen <strong>und</strong> Prozessen zuerreichen sind, muss nun zunächst geklärt werden, welche ges<strong>und</strong>heitsfördernden Ergebnissein Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen zu erzielen sind:Ges<strong>und</strong>heitsförderung in der Ergebnisqualität von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenAls relevante Ergebnisse von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen werden üblicherweise die folgendenangesehen:• klinische Outcomes (auch mittel- <strong>und</strong> langfristig),• Lebensqualität,• Patientenzufriedenheit <strong>und</strong>• (in zunehmendem Maß) Patientensicherheit.Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen unterstützen natürlich dieses Outcome-Verständnis, erweitern es aber auch in einigen Punkten:1. Aufgr<strong>und</strong> des aus der Ottawa-Charta abgeleiteten Setting-Ansatzes der Ges<strong>und</strong>heitsförderunggeht es nicht nur um die Ges<strong>und</strong>heit von PatientInnen, sondern es wird eineVerbesserung des Ges<strong>und</strong>heitsgewinns von drei Zielgruppen – PatientInnen,MitarbeiterInnen <strong>und</strong> regionale Bevölkerung – angezielt (vgl. Statuten des InternationalenHPH-Netzwerks in Anhang 5.3).2. Ges<strong>und</strong>heitsförderung verstärkt den Fokus auf mittel- <strong>und</strong> langfristige Ges<strong>und</strong>heitsgewinneder genannten Zielgruppen (etwa durch Vermeidung unnötiger Behandlungbei PatientInnen, durch Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung bei MitarbeiterInnen).3. Durch die Orientierung an einem umfassenden somato-psycho-sozialen Ges<strong>und</strong>heitskonzeptwerden auch psychische <strong>und</strong> soziale Ges<strong>und</strong>heits-Outcomes in die Ergebnisbewertungaufgenommen.4. Als eigenen Ergebnisbereich fügt Ges<strong>und</strong>heitsförderung das Konzept der Ges<strong>und</strong>heitskompetenz(vgl. dazu Nutbeam, Kickbusch 2000) als spezifischen messbarenOutcome von (edukativen) empowernden Prozessen hinzu.6 So ist etwa die Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung im österreichischen Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetz von2005 durch Beratungen mit dem Österreichischen Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser zustandegekommen. Ein Überblick über die österreichische Gesetzeslage zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Ges<strong>und</strong>heitswesenfindet sich im Anhang.7 vgl. zum hier zugr<strong>und</strong>e gelegten Qualitätsverständnis Donabedian (1982)20
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenDer Setting-Ansatz der Ges<strong>und</strong>heitsförderung betrachtet Outcomes aber nicht isoliert. Dadas Ziel ein möglichst hoher <strong>und</strong> dauerhafter Ges<strong>und</strong>heitsgewinn ist, werden auch die –intendierten oder nicht intendierten – Ges<strong>und</strong>heits-Impacts der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungals materielle <strong>und</strong> soziale Umwelt zu relevanten <strong>und</strong> damit zu beobachtenden bzw.zu messenden <strong>und</strong> zu verbessernden Größen .Ges<strong>und</strong>heitsförderliche Gestaltung von Strukturen <strong>und</strong> ProzessenVor diesem Hintergr<strong>und</strong> können in weiterer Folge die zur Erreichung der erwünschtenErgebnisse erforderlichen Strukturen <strong>und</strong> Prozesse definiert werden. Dafür gibt es zweiAnsätze:1. Ges<strong>und</strong>heitsförderliche Weiterentwicklung bestehender Prozesse <strong>und</strong> Strukturenoder ges<strong>und</strong>heitsförderndes (Qualitäts-)Management der Leistungserbringung:Neue Erkenntnisse aus der Forschung, die permanente Weiterentwicklungvon professionellen Standards <strong>und</strong> gesetzlichen Rahmenbedingungen, medizintechnischeEntwicklungen <strong>und</strong> budgetäre Rahmenbedingungen, aber auch K<strong>und</strong>enerwartungenmachen eine permanente Weiterentwicklung von Leistungen im Ges<strong>und</strong>heitswesenerforderlich. So gehören Qualitätsmanagementansätze <strong>und</strong> -systeme wieTQM, EFQM, ISO (vgl. z.B. Hartl / Wernisch 2001), aber auch Evidence-Based Medicine(vgl. z.B. Kunz et al. 2000) bzw. Evidence Based Nursing (vgl. z.B. Behrens / Langer2004), professionelles Beschwerdemanagement, Patientenrechte (vgl. z.B. ÖsterreichischePatientencharta 2006) etc. längst zum Alltag vieler Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen.Um neben anderen auch die Kriterien 8 der Ges<strong>und</strong>heitsförderung – für PatientInnen,MitarbeiterInnen <strong>und</strong> die regionale Bevölkerung – systematisch <strong>und</strong> strukturiertin diese permanente Entwicklung einbringen zu können, empfiehlt es sich, dieVerantwortung für diesen Themenkreis explizit im (Qualitäts-)Management von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenzu verankern (vgl. Pelikan et al. 2006).2. Strategische Neupositionierung durch Einführung zusätzlicher ges<strong>und</strong>heitsfördernderLeistungsangebote: Epidemiologische <strong>und</strong> demografische Entwicklungen,neue Technologien sowie gesetzliche <strong>und</strong> finanzielle Regelungen für die Leistungserbringung(z.B. Verschiebungen zwischen Leistungserbringern) erfordern einekontinuierliche Anpassung nicht nur der Art der Leistungserbringung, sondern desLeistungsspektrums selbst an die jeweils aktuelle Situation. Anknüpfungspunkte fürdie Ges<strong>und</strong>heitsförderung ergeben sich vor allem bei präventiven <strong>und</strong> rehabilitativenAngeboten, bei Angeboten der kontinuierlichen Betreuung chronisch Kranker einschließlichvon Trainings- <strong>und</strong> Schulungsmaßnahmen.Empfehlungen für spezifische inhaltliche Umsetzungsschritte sowohl für die ges<strong>und</strong>heitsförderndeErbringung bestehender Leistungen als auch für neue ges<strong>und</strong>heitsförderndeLeistungen wurden erstmals in der Budapester Erklärung Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser(WHO 1991) formuliert <strong>und</strong> 1997 mit den Wiener Empfehlungen für Ges<strong>und</strong>heitsförderndeKrankenhäuser erweitert (Auszüge aus beiden Dokumenten sieheAnhänge 5.1 <strong>und</strong> 5.2). Weiterentwicklungen <strong>und</strong> Anpassungen der HPH-Inhalte wie derUmsetzungsweisen an die Qualitätsbewegungen erfolgten durch zwei internationaleWHO-Arbeitsgruppen des HPH-Netzwerks in den Jahren 2001 bis 2006:• Die Gruppe „Putting HPH Policy into Action“ (koordiniert vom WHO-Kooperationszentrum für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Krankenhaus <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesenin Wien) lieferte mit den 18 Kernstrategien Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen<strong>und</strong> sieben Implementationsstrategien einen Strategierahmenfür einen „total HPH-Approach“ (vgl. Pelikan et al. 2006).8 Der kanadische Ges<strong>und</strong>heitswissenschaftler Irving Rootman hat aus dem Ges<strong>und</strong>heitsförderungskonzept derWHO die folgenden sieben Ges<strong>und</strong>heitsförderungs-Kriterien abgeleitet: Empowernd, partizipativ, an einem ganzheitlichenGes<strong>und</strong>heitskonzept orientiert, an ges<strong>und</strong>heitlicher Chancengleichheit orientiert, multistrategisch, intersektoral,nachhaltig (vgl. Rootman 2001)21
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen• Die Gruppe „Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Krankenhaus“ (koordiniertvon der WHO Europa) entwickelte ein Set von 5 Standards <strong>und</strong> ein zugehörigesSelbstbewertungsinstrumentarium, das im Rahmen des Qualitätsmanagementsvon Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen eingesetzt werden kann (vgl. Gröne 2006) <strong>und</strong> mittlerweileauch in Österreich getestet wurde (vgl. dazu Kapitel 1.3 in dieser Broschüre).Im Folgenden wird ein Überblick über die Ergebnisse der Arbeit beider Gruppen gegeben.Die 18 Kernstrategien Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenDie 18 Kernstrategien beziehen sich auf die drei Zielgruppen PatientInnen (StrategienPAT-1 bis PAT-6), MitarbeiterInnen (Strategien MIT-1 bis MIT-6) <strong>und</strong> regionaleBevölkerung (Strategien REG-1 bis REG-6). Für jede dieser drei Zielgruppenwurden sechs spezifische Strategien definiert, die an folgenden Gr<strong>und</strong>unterscheidungenorientiert sind:1. Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Gestaltung von Dienstleistungen <strong>und</strong> Prozessen (Strategien1, 2, 4 <strong>und</strong> 5) versus ges<strong>und</strong>heitsfördernde Gestaltung der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungals Lebenswelt bzw. Setting (Strategien 3 <strong>und</strong> 6).2. Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Gestaltung bestehender klinischer <strong>und</strong> Hotelleistungen(Strategien 1, 2) versus Einführung neuer, u.a. edukativer ges<strong>und</strong>heitsfördernderLeistungsangebote (Strategien 4, 5). Diese Leistungsangebote können sich wiederumauf zwei Bereiche beziehen:3. Angebote zum Management spezifischer Krankheiten (Strategien 2, 4) versus Angebotezur Verbesserung der positiven Ges<strong>und</strong>heit durch Lebensstilentwicklung(Strategien 1, 5).4. In Bezug auf das Setting bzw. die Lebenswelt ist die Weiterentwicklung der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungselbst (Strategie 3) von der Beteiligung an ges<strong>und</strong>heitsfördernderRegionalentwicklung (Kooperation mit der Gemeinde oder mit anderenSettings wie Schulen, Betrieben) zu unterscheiden (Strategie 6).Aus diesen Gr<strong>und</strong>optionen ergeben sich folgende sechs mögliche Strategien der Ges<strong>und</strong>heitsförderung,die in unterschiedlicher Weise für die drei genannten Zielgruppen <strong>und</strong>auch für unterschiedliche Typen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen gelten:1. Empowerment für ges<strong>und</strong>heitsfördernde Selbstreproduktion (= permanenteWiederherstellung der eigenen Ges<strong>und</strong>heit)2. Empowerment für ges<strong>und</strong>heitsfördernde Koproduktion (= aktive Beteiligungder jeweiligen Zielgruppe an der Erhaltung bzw. Verbesserung ihrer Ges<strong>und</strong>heit)3. Ges<strong>und</strong>heitsfördernde <strong>und</strong> empowernde Gestaltung der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungals Lebenswelt (= Setting-Gestaltung)4. Empowerment für Krankheitsmanagement (= v.a. edukative Maßnahmen zurUnterstützung des ges<strong>und</strong>heitsfördernden Selbstmanagements chronischer Erkrankungen<strong>und</strong> / oder rehabilitativer Maßnahmen)5. Empowerment für Lebensstilentwicklung (v.a. Ernährung, Bewegung, Umgangmit Alkohol <strong>und</strong> Nikotin mit Hinblick auf mittel- <strong>und</strong> langfristige Ges<strong>und</strong>heitsgewinne)6. Beiträge zur ges<strong>und</strong>heitsfördernden <strong>und</strong> empowernden RegionalentwicklungZusammengefasst ergeben diese Strategien – jeweils angewendet auf die drei ZielgruppenPatientInnen, MitarbeiterInnen <strong>und</strong> regionale Bevölkerung – eine Matrix mit 18 Kernstrategien,die in der folgenden Tabelle 1 zusammengefasst sind:22
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenTabelle 1: 18 Kernstrategien Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenGes<strong>und</strong>heitsförderungdurch …PatientInnen MitarbeiterInnen Region… für:Empowerment fürges<strong>und</strong>heitsförderndeSelbstreproduktion(= permanente Wiederherstellungder eigenen Ges<strong>und</strong>heit)Empowerment fürges<strong>und</strong>heitsförderndeKoproduktionGes<strong>und</strong>heitsfördernde <strong>und</strong>empowernde Gestaltungder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungals LebensweltEmpowerment für KrankheitsmanagementEmpowerment für LebensstilentwicklungBeiträge zur ges<strong>und</strong>heitsfördernden<strong>und</strong> empowerndenRegionalentwicklungPAT-1:(Selbst-)Erhalt bzw.Förderung bestehenderGes<strong>und</strong>heit währenddes Aufenthaltesin der EinrichtungPAT-2:Partizipation amKernprozess derBehandlung <strong>und</strong>PflegePAT-3:Ges<strong>und</strong>heitsfördernde,empowerndeLebenswelt für PatientInnenPAT-4:Empowerment fürdas eigene Krankheitsmanagement(auch nach der Entlassung)PAT-5:Empowerment fürLebensstilentwicklung(auch nach derEntlassung)PAT-6:Beiträge zur Entwicklungvon ges<strong>und</strong>heitsfördernden,empowernden Infrastrukturen<strong>und</strong> Angebotenfür (bestimmte)PatientInnenMIT-1:(Selbst-)Erhalt bzw.Förderung bestehenderGes<strong>und</strong>heit währenddes Arbeitslebensin der EinrichtungMIT-2:Mitgestaltung derArbeitsabläufe <strong>und</strong>ArbeitsstrukturenMIT-3:Ges<strong>und</strong>heitsfördernde,empowerndeLebenswelt für MitarbeiterInnenMIT-4:Empowerment fürdas Selbstmanagementvon (Berufs-)KrankheitenMIT-5:Empowerment fürLebensstilentwicklungMIT-6:Beiträge zur Entwicklungvon ges<strong>und</strong>heitsfördernden,empowernden Infrastrukturen<strong>und</strong> Angebotenfür MitarbeiterInnenREG-1:(Selbst-)Erhalt bzw.Förderung bestehenderGes<strong>und</strong>heit durchadäquaten, egalitärenZugang zur EinrichtungREG-2:Ges<strong>und</strong>heitsförderndeZusammenarbeitzwischen unterschiedlichenLeistungserbringernREG-3:Ges<strong>und</strong>heitsfördernde,empowerndeLebenswelt für dieRegionREG-4:Empowerment fürdas Selbstmanagement(chronischer)KrankheitenREG-5:Empowerment fürLebensstilentwicklungREG-6:Beiträge zur allgemeinges<strong>und</strong>heitsfördernden<strong>und</strong> empowerndenRegionalentwicklungQualitätsentwicklung bestehenderLeistungen <strong>und</strong> StrukturenEntwicklung neuer Leistungen <strong>und</strong>StrukturenIn der Praxis lassen sich spezifische Maßnahmen nicht immer eindeutig nur einerStrategie zuordnen. Je umfassender eine Maßnahme angelegt ist, desto mehr Strategienwird sie auch berühren (Beispiel: Die Entwicklung zur Rauchfreien Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung,die Einführung ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ernährung oder patientenorientierteKommunikation beziehen sich jeweils sowohl auf bestimmte Leistungen als auch auf dieGestaltung der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung als Setting bzw. Lebenswelt <strong>und</strong> auf mehrereZielgruppen zugleich). Idealerweise werden Maßnahmen zur Umsetzung der 18 Strategiendaher aufeinander bezogen geplant <strong>und</strong> in Form von Programmen umgesetzt, umdurch eine jeweils angemessene Kombination Synergien für die unterschiedlichen Zielgruppennutzen zu können.Umfassende Policies oder Programme können entweder an bestimmten Themenstellungenoder Problemen bzw. „Issues“ (z.B. Rauchen, Ernährung) oder an bestimmtenPopulationen (z.B. Kinder, Alter, Frauen, MigrantInnen) ansetzen. Sie kombinierenjeweils Maßnahmen aus unterschiedlichen Kernstrategien, um eine komplexe, aber fokussierteVerbesserung zu erzielen.An welchen Strategien eine Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung schwerpunktmäßig arbeitet<strong>und</strong> vor allem, ob primär an der ges<strong>und</strong>heitsfördernden Weiterentwicklung bestehender23
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenDienstleistungen bzw. an der Entwicklung der Einrichtung als Lebenswelt oder an derEinführung neuer Angebote <strong>und</strong> an Beiträgen zur ges<strong>und</strong>heitsfördernden Regionalentwicklunggearbeitet wird, hängt wesentlich von den spezifischen Rahmenbedingungender Einrichtung ab: z.B. von bestehenden medizinischen Schwerpunkten, vonAngeboten anderer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen in der Region, von regionalen oder nationalenges<strong>und</strong>heitspolitischen Vorgaben <strong>und</strong> Präferenzen, von bestehenden oder neu aufzubauendenKooperationen <strong>und</strong> natürlich auch von der Verfügbarkeit von Evidenz <strong>und</strong>Finanzierungsmöglichkeiten für bestimmte Maßnahmen.Die bisherige Praxis zeigt allerdings, dass es – nicht nur für Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen –oft einfacher ist, neue Leistungen einzuführen, als bestehende Leistungen in ges<strong>und</strong>heitsfördernderWeise weiterzuentwickeln. Dennoch sollte eine Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung, diedas Qualitätsmerkmal “ges<strong>und</strong>heitsfördernd” anstrebt, vor allem an der Umsetzung derStrategien 1, 2 <strong>und</strong> 3, die ja ihr Kerngeschäft betreffen, arbeiten. Notwendige Voraussetzungdafür ist ein organisationsinternes, idealerweise an das (Qualitäts-)Managementgekoppeltes Unterstützungssystem. In Österreich haben viele Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenbereits Qualitätsmanagementsysteme eingeführt, die auch für Ges<strong>und</strong>heitsförderunggenutzt werden können. Die im folgenden beschriebenen sieben Implementationsstrategienzeigen auf, was ein solches Unterstützungssystem berücksichtigen sollte.7 Implementierungsstrategien Ges<strong>und</strong>heitsfördernderGes<strong>und</strong>heitseinrichtungenSelbst die Implementierung geringfügiger Änderungen in Organisationen bedarf,wenn diese Änderungen effektiv, effizient <strong>und</strong> nachhaltig sein sollen, eines geplanten<strong>und</strong> monitierten Projektmanagements. Dies trifft sowohl auf Qualitätsmanagementim Allgemeinen als auch auf die Einführung der besonderen Qualität der Ges<strong>und</strong>heitsförderungin die komplexen Strukturen <strong>und</strong> Alltagsroutinen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenzu. Daher hat HPH seit seinen Anfängen von den beteiligten Einrichtungen die Implementierungvon Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen mittels systematischen <strong>und</strong> dokumentiertenProjektmanagements gefordert. Aber zur Implementierung des umfassenden HPH-Ansatzes sind weiterführende Investitionen in ges<strong>und</strong>heitsfördernde Infrastrukturen <strong>und</strong>Ressourcen erforderlich: Bereits in den ersten HPH-Projekten, dem Modellprojekt „Ges<strong>und</strong>heit<strong>und</strong> Krankenhaus“ an der Wiener Krankenanstalt Rudolfstiftung <strong>und</strong> im EuropäischenPilotkrankenhausprojekt „Health Promoting Hospitals“ verpflichteten sich die beteiligtenEinrichtungen zur Etablierung allgemeiner Ges<strong>und</strong>heitsförderungsstrukturen innerhalbihrer Organisation (Ges<strong>und</strong>heitsförderungs-Manager, Ges<strong>und</strong>heitsförderungskomitee,Ansprechpersonen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in den Organisationseinheiten, etc.),um dadurch die Umsetzung spezifischer fokussierter Projekte zu unterstützen. Die WHO-Arbeitsgruppe „Putting HPH Policy into Action“ hat diese Anforderungen systematischweiterentwickelt (vgl. Tabelle 2 unten).24
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenTabelle 2: Sieben Implementierungsstrategien Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenQualitätsfunktion / -aktivität für die Qualitätvon ...Strukturen von Dienstleistungen(& des Settings)Prozesse von Dienstleistungen(& des Settings)Ergebnisse / Impactsvon Dienstleistungen(& des Settings)1. Definition S1Definition von Ges<strong>und</strong>heitsförderungskriterien<strong>und</strong> -standards für Strukturen2. Messungen (Assessment,Monitoring,Evaluation)3. Sicherung, Entwicklung,VerbesserungS2Messen der Ges<strong>und</strong>heitsförderungvon StrukturenS3Entwicklung der Ges<strong>und</strong>heitsförderungvon Sturkturendurch Organisations-,Personal-, TechnikentwicklungP1Definition von Ges<strong>und</strong>heitsförderungskriterien<strong>und</strong> -standards für ProzesseP2Messen der Ges<strong>und</strong>heitsförderungvon ProzessenXO1Definition von Ges<strong>und</strong>heitsförderungszielenfürErgebnisse / ImpactsO2Messen der Ges<strong>und</strong>heitsförderungvon Ergebnissen/ ImpactsXDiese Tabelle beruht auf drei Gr<strong>und</strong>annahmen: Erstens geht sie gemäß DonabediansQualitätsverständnis davon aus, dass die Qualität ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ergebnissedurch die Qualität ges<strong>und</strong>heitsfördernder Prozesse erzeugt wird, die wiederumdurch ges<strong>und</strong>heitsfördernde Strukturen ermöglicht werden müssen. Zweitens verwendetsie drei Schritte eines verkürzten Qualitätszirkels: Ges<strong>und</strong>heitsförderungsqualitätmuss definiert <strong>und</strong> in spezifischen Kontexten gemessen werden, bevor sie, fallsnötig, verbessert werden kann. Die Ergebnisse der Verbesserung müssen wiederum monitiertoder evaluiert werden. Drittens wird von der Annahme ausgegangen, dass nurStrukturen direkt beeinflusst <strong>und</strong> verbessert werden können, während dies aufProzesse <strong>und</strong> Ergebnisse nicht zutrifft. Das Ergebnis sind sieben Implementierungsstrategien,die im Sinne eines „totalen“ <strong>und</strong> kontinuierlichen Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmanagementsin einer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung kombiniert werden müssen. Da aus einer Metaperspektivedie Qualität von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsergebnissen von der Qualität ges<strong>und</strong>heitsförderungsbezogenerDefinitions-, Mess- <strong>und</strong> Verbesserungsprozesse abhängt, müssenadäquate Strukturen zur Unterstützung dieser Qualitätsprozesse sichergestellt werden.Daher muss eine Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung, die sich einem umfassendenHPH-Ansatz verpflichtet, Ges<strong>und</strong>heitsförderungswerte, -prinzipien <strong>und</strong> –ziele,Standards, Kriterien <strong>und</strong> Indikatoren in ihre schriftliche Vision, ihr Leitbild, inProgramm, Aktionspläne, Leitlinien, Manuale <strong>und</strong> Protokolle einbauen. Sie mussin Ges<strong>und</strong>heitsförderungsprogramme, Projekte <strong>und</strong> Disseminationsstrategien investieren.Sie muss einen Ges<strong>und</strong>heitsförderungs-Manager, ein Team, ein Komitee <strong>und</strong> Kontaktpersonenin allen Organisationseinheiten implementieren <strong>und</strong> – nicht zuletzt – ein spezifischesGes<strong>und</strong>heitsförderungsbudget einrichten. Derartige Unterstützungsstrukturen sindnotwendig <strong>und</strong> müssen – entweder als eigene spezifische Struktur oder integriert insQualitäts- <strong>und</strong> / oder Nachhaltigkeitsmanagement – in das Management-System der Einrichtungintegriert werden. Die Qualität spezifischer Ges<strong>und</strong>heitsförderungsinterventionen<strong>und</strong> ihrer Ergebnisse hängt von der Qualität dieser Ges<strong>und</strong>heitsförderungsumsetzungsoderUnterstützungsstrukturen ab.Die 5 Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenDie fünf Standards <strong>und</strong> ein zugehöriges Selbstbewertungsinstrument (vgl. Gröne2006)wurden entwickelt, um Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen die Möglichkeit einer Standortbestimmungin Bezug auf die Qualität von Ges<strong>und</strong>heitsförderung zu geben, diewiederum Basis für die Entwicklung von Aktionsplänen zur kontinuierlichen Verbesserungder Ges<strong>und</strong>heitsförderungsqualität sein sollen.25
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenInhaltlich orientieren sich die nach den Vorgaben der ISQua (International Society forQuality in Healthcare, siehe http://www.isqua.org/) entwickelten Standards am Patientenpfad.Sie umfassen folgende Bereiche:• STANDARD 1: Management-Gr<strong>und</strong>sätze (Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Bestandteil derUnternehmenspolitik)• STANDARD 2: Patienteneinschätzung (Einbau von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in dieAnamnese)• STANDARD 3: Patienteninformation <strong>und</strong> -intervention (Vermittlung von lt.Anamnese relevanten Ges<strong>und</strong>heitsinformationen <strong>und</strong> Durchführung notwendiger Ges<strong>und</strong>heitsförderungsinterventionen)• STANDARD 4: Förderung eines ges<strong>und</strong>en Arbeitsplatzes• STANDARD 5: Kontinuität <strong>und</strong> Kooperation (Sicherstellung der Ges<strong>und</strong>heitsförderungsleistungenauch nach der Entlassung)Jeder der fünf Standards umfasst eine Anzahl von Substandards <strong>und</strong> messbaren Elementen,die eine Selbstbewertung des jeweiligen Bereichs ermöglichen (vgl. auch Kapitel 1.3zur Pilotierung der Standards in Österreich).Die Strategien <strong>und</strong> Standards im Detail:Interventionen für drei Zielgruppen <strong>und</strong>umfassende OrganisationsentwicklungWie ist Ges<strong>und</strong>heitsförderung für PatientInnen in denKernstrategien <strong>und</strong> Standards repräsentiert?Obwohl die Aufgabe von Krankenbehandlungseinrichtungen in einem Spektrum von Ges<strong>und</strong>heitsförderung,Primär-, Sek<strong>und</strong>är- <strong>und</strong> Tertiärprävention traditionell eher im Bereichder Sek<strong>und</strong>är- <strong>und</strong> Tertiärpävention anzusiedeln ist, schreibt man diesen Einrichtungenin den letzten Jahren eine immer wichtigere Rolle auch in der Primärprävention<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung zu (vgl. Tonnesen et al. 2005).Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen haben einerseits vielfache Möglichkeiten, die Ges<strong>und</strong>heitsressourcenvon PatientInnen zu stärken, <strong>und</strong> zwar vor allem durch Informationen <strong>und</strong> Schulungen9 mittels empowernder Kommunikation 10 . Zum anderen können sie aber auch zurReduktion von Ges<strong>und</strong>heitsrisiken (Sicherheitsrisiken, Hospitalismusrisiken etc.) beitragen– zum einen ebenfalls über kommunikative Interventionen, zum anderen aber auchüber die Entwicklung des Krankenhausumfeldes. Ziel entsprechender Maßnahmen ist dieSteigerung des klinischen Outcomes (auch mittel- <strong>und</strong> langfristig), der Patientenzufriedenheit,der Lebensqualität <strong>und</strong> der Ges<strong>und</strong>heitskompetenz (healthliteracy) der PatientInnen. Im Folgenden werden die patientenorientierten Strategien<strong>und</strong> Standards des HPH-Konzeptes im Detail beschrieben.9 Unabhängig von der unmittelbaren Ursache für den Kontakt mit einer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung stellt der Aufenthalthäufig auch ein „Window of Opportunity“ für die Initiierung von Lebensstiländerungen mit dem Ziel mittel- <strong>und</strong>langfristigen Ges<strong>und</strong>heitsgewinns dar: Ein bestehendes Ges<strong>und</strong>heitsproblem erhöht meist die Bereitschaft zurVeränderung des eigenen Verhaltens (vgl. z.B. WHO – Regional Office for the Americas 2000.10 Kommunikation ist ein wesentliches Mittel zur Befähigung von PatientInnen zur aktiven Mitarbeit im Diagnose<strong>und</strong>Behandlungsprozess, etwa in Form der aktiven Vorbereitung auf elektive chirurgische Eingriffe oder desSelbstmanagements nach chirurgischen Eingriffen. Vor allem für bestimmte vulnerable Gruppen wie MigrantInnenträgt kulturelle Kompetenz – die rascher zur richtigen Diagnose <strong>und</strong> einer entsprechenden Behandlung führt –nachweislich zur Steigerung der Wirksamkeit der Kommunikation bei (vgl. Goode et al. 2006). Aktuelle Forschungenetwa aus Deutschland (vgl. Ehlers et al. 2008) zeigen darüber hinaus, dass empathische Kommunikationmessbare stressreduzierende Wirkungen hat <strong>und</strong> damit nicht nur kognitiv über Wissensvermittlung, sondern auchbiochemisch Ges<strong>und</strong>heit fördert.26
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenGes<strong>und</strong>heitsfördernde Dienstleistungen für PatientInnen: Die KernstrategienPAT-1, PAT-2, PAT-4 <strong>und</strong> PAT-5 <strong>und</strong> die Standards 2, 3 <strong>und</strong> 5Strategie PAT-1: Empowerment von PatientInnen für ges<strong>und</strong>heitsförderndeSelbstpflege im KrankenhausPatientInnen, die mit dem Krankenbehandlungssystem in Kontakt kommen, sind nie nurkrank, sondern verfügen immer über eine gewisse Teil- bzw. Restges<strong>und</strong>heit sowohl inkörperlicher als auch in psychischer <strong>und</strong> sozialer Hinsicht. Trotz aller positiver Wirkungenauf die Ges<strong>und</strong>heit stellt der Aufenthalt in einer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung auch eine Reihevon Risiken für die PatientInnen dar:Nach der Holmes-Rahe-Stressskala erreichen persönliche Verletzungen oder Erkrankungenbei Erwachsenen – die ja meist den Gr<strong>und</strong> für einen Kontakt mit dem System darstellen– 53 von 100 möglichen Stresspunkten <strong>und</strong> liegen damit im oberen Bereich dermöglichen Stressoren (Holmes / Rahe 1967). Gerade für Kinder <strong>und</strong> ältere Personenkann eine zu geringe psychische Unterstützung auch langfristige psychische Problemenach sich ziehen, etwa posttraumatische Störungen bei Kindern oder den Verlust derSelbständigkeit bei betagten PatientInnen, auch bekannt als „Hospitalismus-Effekte“ 11 .Wie Studien aus der Psychoneuroimmunologie <strong>und</strong> der Stressforschung zeigen, bestehenaber klare Zusammenhänge zwischen Stressoren <strong>und</strong> dem Funktionieren des Immunsystemsbzw. der Genesung nach einer Erkrankung (vgl. z.B. Kiecolt-Glaser et al. 2002).Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie sehr der Erfolg der Patientenrolle nicht nur von derprofessionellen Behandlung, sondern auch von den individuellen psychischen, physischen<strong>und</strong> sozialen Faktoren abhängt. Strategie PAT-1 fordert daher die Unterstützungder PatientInnen in der Selbstpflege ihrer Ges<strong>und</strong>heit – um dadurch optimaleHeilungsvoraussetzungen zu schaffen.In Abhängigkeit von ihrem Ges<strong>und</strong>heitsstatus ist die Selbstpflege entweder zur Gänzevon den PatientInnen selbst zu leisten oder durch professionelle Betreuung zu unterstützenbzw. zu substituieren. Zur Vermeidung von Hospitalismus sollten PatientInnen inmöglichst hohem Maß selbst für ihre Bedürfnisse sorgen können (das jeweilige Ausmaßan möglicher Selbstpflege kann z.B. durch Pflegediagnosen erhoben werden). Um dieseForm von „Selbstpflege” von zum Teil schwer kranken Personen außerhalb ihrer vertrautenHaushaltsumgebung <strong>und</strong> unter Bedingungen von hoch bürokratischen Krankenhausorganisationenmöglich zu machen, müssen die Ges<strong>und</strong>heitsprofessionisten ihre Arbeit soempowernd wie möglich gestalten <strong>und</strong> dabei auch kulturelle Unterschiede der PatientInnenberücksichtigen. Empowerment bezieht sich hier wiederum auf die körperliche, psychische<strong>und</strong> soziale Dimension: In Bezug auf die körperliche Dimension der Ges<strong>und</strong>heitgeht es dabei zum Beispiel um die Sicherstellung einer ausreichenden <strong>und</strong> adäquatenErnährung, die etwa im Krankenhaus keine Selbstverständlichkeit darstellt, <strong>und</strong> um dieFörderung von Bewegung. Die psychische Ges<strong>und</strong>heit ist z.B. durch Wahrung der Privatsphäreder PatientInnen bzw. durch entsprechende unterstützende Angebote sicherzustellen,<strong>und</strong> die Selbstpflege der sozialen Ges<strong>und</strong>heit umfasst z.B. die Möglichkeit zumKontakt mit Angehörigen bzw. – vor allem bei längeren Aufenthalten – die Möglichkeit,berufliche Kontakte zu pflegen.Die Effekte von Maßnahmen, die der Strategie PAT-1 zugerechnet werden können, wurdeninsbesondere in Bezug auf Hospitalismus untersucht (vgl. z.B. Vetter 1995). Beispielevon erfolgreich in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen implementierten Interventionen, die sichauf diese Strategie beziehen, umfassen:• Patientenhilfsteam zur Unterstützung der psychosozialen Bedürfnisse von PatientInnen(Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien; siehe Nowak et al. 1998);11 Einen Überblick zum Thema bietet die Online-Enzyklopädie Wikipedia unterhttp://de.wikipedia.org/wiki/Hospitalismus (Zugriff am 13.08.2008)27
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen• Allgemeine Patienteninformation (z.B. über Infrastrukturen, Besuchszeiten) beider Aufnahme (Beispiel guter Praxis: Griffin Hospital, USA; www.griffinhealth.org,Zugriff am 13.08.2008);• Angebote <strong>und</strong> Optionen zur Unterstützung von PatientInnen zum selbstverantwortlichenUmgang mit bestimmten Bedürfnissen (z.B. Bewegung, Wahrnehmen kulturellerAktivitäten, Patientenbibliotheken, Diskussionen, Internet-Café).• Anbieten psychologischer Unterstützung zum Umgang mit Stress <strong>und</strong> Ängsten imZusammenhang mit dem Krankenhausaufenthalt oder der Krankheit des / der PatientIn(z.B. bei Krebs, bei allen Formen chronischer Erkrankungen).Strategie PAT-2 – Empowerment von PatientInnen für die ges<strong>und</strong>heitsförderndeKoproduktion von Behandlung <strong>und</strong> PflegeDie Kernleistungen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen bestehen in diagnostischen, therapeutischen<strong>und</strong> pflegerischen Leistungen für akute <strong>und</strong> chronische Krankheiten, sowohl fürstationäre als auch für ambulante PatientInnen. Strategie PAT-2 bezieht sich auf die langeTradition der Qualitätssicherung <strong>und</strong> Qualitätsentwicklung von Kernleistungen– angefangen bei der Ausbildung der Ges<strong>und</strong>heitsprofessionisten über die in den letzten20 Jahren zunehmend etablierte Entwicklung von Prozessen <strong>und</strong> Strukturen von Organisationen<strong>und</strong> übergeordneten Systemen.Wie kann Ges<strong>und</strong>heitsförderung zur Qualitätsverbesserung der Kernprozesse in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenbeitragen? Das Empowerment-Konzept der Ges<strong>und</strong>heitsförderung betontdie Notwendigkeit der Kontrolle über die Ges<strong>und</strong>heit durch die Betroffenenselbst – was in Bezug auf PatientInnen bedeutet, dass sie nicht nur als Interventionsobjekte,sondern – so wie dies auch für andere Dienstleistungen diskutiert wird – auchals KoproduzentInnen dieser Interventionen gesehen werden. Damit der / die KoproduzentIndiese Rolle aktiv wahrnehmen kann, muss er / sie – vor allem durch kommunikative<strong>und</strong> edukative Interventionen – empowert werden, einen entsprechendenBeitrag zu leisten: Den PatientInnen sollen spezifische ges<strong>und</strong>heitsrelevante Informationen,Fähigkeiten <strong>und</strong> Motivation vermittelt werden. Damit dies im klinischen Alltag geschehenkann, sind entsprechende Maßnahmen <strong>und</strong> die dafür nötige Zeit in den Behandlungsprozesseinzuplanen.Ein praktisches Beispiel für das Empowerment von PatientInnen für die Koproduktionges<strong>und</strong>heitsfördernder Behandlung <strong>und</strong> Pflege sind diagnose- <strong>und</strong> behandlungsbezogenePatienteninformationen, Trainings and Beratungen (z.B. präoperative Patienteninformation),um die PatientInnen zu befähigen,• aktiv zum Diagnoseprozess beizutragen <strong>und</strong> dadurch die Qualität der Diagnose zusteigern;• sich aktiv in Behandlungsentscheidungen einzubringen;• sich aktiv am Behandlungs- <strong>und</strong> Pflegeprozess zu beteiligen (z.B. durch Einhalten vonVerschreibungen) <strong>und</strong> dadurch die Ergebnisse zu verbessern.Durch Studien z.B. an chirurgischen PatientInnen ist schon seit vielen Jahren bekannt<strong>und</strong> immer wieder bestätigt worden, dass diese Art des Empowerments von Patient-Innen nicht nur deren Zufriedenheit verbessert, sondern sich auch günstig aufklinische Indikatoren wie postchirurgische Komplikationen <strong>und</strong> Aufenthaltsdauerauswirkt (vgl. Wimmer / Pelikan 1984, Johnston / Vögele 1992, Tonnesen et al.2005).Strategie PAT-4: Empowerment von PatientInnen für das ges<strong>und</strong>heitsförderndeManagement ihrer ErkrankungExperteninterventionen in spezifischen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen stellen in der Regellediglich einen Wendepunkt im Krankheitsprozess <strong>und</strong> eine Gr<strong>und</strong>lage für die Genesungbzw. das erfolgreiche Management einer chronischen Erkrankung dar. Die Hauptrolle inder Genesung bzw. des täglichen Krankheitsmanagements (zur Vorbeugung bzw.28
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenzur Verlangsamung des Voranschreitens einer Krankheit) müssen aber die PatientInnen<strong>und</strong> ihre Angehörigen spielen – natürlich mit der entsprechenden professionellenUnterstützung durch das Krankenhaus oder andere Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (die entsprechendenZuständigkeiten sind in unterschiedlichen Ges<strong>und</strong>heitssystemen sehr unterschiedlichgeregelt). Diese Phase der Krankheitskarriere dauert meist wesentlich länger<strong>und</strong> entzieht sich in der Regel der direkten Kontrolle durch eine Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung,ist aber von zentraler Bedeutung für den Outcome – für das Wiedererlangen von Ges<strong>und</strong>heit<strong>und</strong> Lebensqualität. Die professionelle Unterstützung in dieser Phase istim Wesentlichen edukativ <strong>und</strong> besteht hauptsächlich aus der Bereitstellung vonInformation, Beratung <strong>und</strong> Training.Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen müssen also diese mittelfristige Perspektive auf die Krankheitskarriereberücksichtigen, indem sie entweder selbst die notwendige krankheitsspezifischeUnterstützung bereitstellen oder indem sie PatientInnen an andere, spezialisierteAnbieter vermitteln. Je komplexer <strong>und</strong> seltener eine Erkrankung, desto eher muss dieseAufgabe von einem Krankenhaus übernommen werden. Adäquate gesetzliche <strong>und</strong> finanzielleRegelungen sind eine wesentliche Voraussetzung für die systematische Erbringungentsprechender Leistungen.Im internationalen HPH-Netzwerk gibt es zahlreiche Beispiele für effektive Interventionendieser Art von Dienstleistungen, z.B. Schulungen für DiabetikerInnen oder COPD-PatientInnen. Nach Tonnesen et al. (2005) handelt es sich bei den dieser Strategie zuzuordnendenMaßnahmen um spezifische Ges<strong>und</strong>heitsförderung, die sich auf die Beeinflussungvon Ges<strong>und</strong>heitsdeterminanten bezieht, die für bestimmte Zielgruppen (z.B.chronisch Kranke) besonders wichtig sind – mit dem Ziel, den Krankheitsverlauf durchBefähigung der PatientInnen zum Selbstmanagement möglichst günstig zu beeinflussen.Davon zu unterscheiden ist die allgemeine Ges<strong>und</strong>heitsförderung, die sich auf generelleGes<strong>und</strong>heitsdeterminanten wie Lebensstile etc. bezieht <strong>und</strong> der sich die folgendeStrategie widmet:Strategie PAT-5: Empowerment von PatientInnen für die ges<strong>und</strong>heitsförderndeLebensstilentwicklungDer Ges<strong>und</strong>heitsgewinn, der durch Interventionen in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen erzieltwerden kann, lässt sich durch eine noch langfristigere Perspektive weiter steigern. Diezukünftige (positive) Ges<strong>und</strong>heit von Personen – der Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>und</strong> die individuellenGes<strong>und</strong>heitsressourcen – kann durch Lebensstiländerungen verbessert werden(vgl. z.B. WHO 2002). Auch hier sind es wieder vor allem edukative Maßnahmen (Information,Beratung, Training), die zur Beeinflussung individueller Lebensstile beitragen.Natürlich können solche Angebote nicht nur von unterschiedlichen Anbietern im Ges<strong>und</strong>heitswesen,sondern auch aus dem Sozialbereich <strong>und</strong> der Erwachsenenbildung kommen.Ges<strong>und</strong>heitserziehung könnte in diesem Sinn zu einem Modul innerhalb eines Gesamtpaketsder edukativen Kommunikation werden. Investitionen in diese Richtung würden helfen,Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen in Richtung Ges<strong>und</strong>heitszentren mit verstärkter PublicHealth-Orientierung weiterzuentwickeln.International wie in Österreich gibt es zahlreiche dokumentierte Erfahrungen mit entsprechendenMaßnahmen, etwa zu den Themen Rauchen, Ernährung, Alkohol <strong>und</strong> Bewegung(vgl. Dietscher et al. 2002).Die patientenorientierten Standards 2, 3 <strong>und</strong> 5Während die patientenorientierten Strategien einen allgemeinen konzeptuellen Rahmender Ges<strong>und</strong>heitsförderung für diese Zielgruppe geben, unterstützen die Standards durchein Selbstbewertungsinstrument <strong>und</strong> Anregungen zur Entwicklung von Aktionsplänen diespezifische <strong>und</strong> gezielte Implementierung. So fordert Standard 2 (Patienteneinschätzung),dass bereits die Anamnese auch mit Hinblick auf Ges<strong>und</strong>heitsförderungerfolgt <strong>und</strong> die Lebensstile der PatientInnen gezielt erhoben <strong>und</strong> dokumentiert werden.Darauf aufbauend können dann gemäß Standard 3 (Patienteninformation <strong>und</strong> -29
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenintervention) gezielt Informationen vermittelt <strong>und</strong> Schulungs- <strong>und</strong> Trainingsmaßnahmenfür PatientInnen angeboten werden, die entweder der allgemeinen oder derspezifischen Ges<strong>und</strong>heitsförderung dienen. Standard 5 (Kontinuität <strong>und</strong> Kooperation)fordert schließlich, dass auch in der Zusammenarbeit mit anderen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen<strong>und</strong> vor allem bei der Entlassung oder Überweisung von PatientInnen dieKontinuität der ges<strong>und</strong>heitsfördernden Leistungen sichergestellt wird.Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Lebenswelten / Settings für PatientInnen: StrategienPAT-3 <strong>und</strong> PAT-6Strategie PAT-3: Entwicklung von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen zu ges<strong>und</strong>heitsförderlichen,unterstützenden Umgebungen für PatientInnenGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen bestehen nicht nur aus Dienstleistungsprozessen, sondernauch aus einem Kontext, in dem diese Leistungen erbracht werden. Während dieDienstleistungen (Ges<strong>und</strong>heits-)Outputs bzw. Outcomes erzeugen, hat der Kontext, d.h.die Situation bzw. das Setting, ges<strong>und</strong>heitsrelevante Impacts. Es gibt Impacts des materiellenSettings (Krankenhausinfektionen, Luftqualität, Temperatur, Sick Building-Syndrom, etc.), aber auch Impacts des Krankenhauses als soziales Setting mit seinenspezifischen Organisationsstrukturen <strong>und</strong> seiner Kultur, die neben der professionellenBetreuung der PatientInnen auch deren psychisches Wohlbefinden <strong>und</strong> ihre Möglichkeitender Koproduktion <strong>und</strong> Selbstpflege beeinflussen.Was ist der Beitrag der Ges<strong>und</strong>heitsförderung zur Settings-Entwicklung? Förderliche Umwelten(sowohl in physischer als auch in sozialer Hinsicht) spielen in der Ges<strong>und</strong>heitsförderungeine besondere Rolle, weswegen die Entwicklung sogenannter Settings eine wesentlicheStrategie in der Ges<strong>und</strong>heitsförderung darstellt.Ein Beispiel für die ges<strong>und</strong>heitsfördernde Wirkung dieser Strategie schildern Beauchemin/ Hays (1998) in ihrer Untersuchung der Wirkung des Blicks aus dem Fenster <strong>und</strong> vorallem des Sonnenlichts in Krankenzimmern auf die Genesung von HerzinfarktpatientInnen.Andere Beispiele wären Vorkehrungen zur Sturzprophylaxe (von Bedeutung insbesonderefür ältere PatientInnen).Strategie PAT-6: Teilnahme an der ges<strong>und</strong>heitsfördernden <strong>und</strong> empowerndenEntwicklung von regionalen Infrastrukturen für bestimmte PatientenbedürfnisseDie Strategien PAT-1 bis PAT-3 zielen auf die Verbesserung der Qualität der Akutbehandlung<strong>und</strong> ihres Umfeldes ab, Strategien PAT-4 <strong>und</strong> PAT-5 widmen sich Maßnahmen zurSteigerung des mittel- <strong>und</strong> langfristigen Ges<strong>und</strong>heitsgewinns – mit einem beachtlichenpotenziellen Beitrag zur Verbesserung des Ges<strong>und</strong>heitsgewinns von PatientInnen. Aberaufgr<strong>und</strong> der anhaltenden Verkürzung der Verweildauern vor allem im stationären Sektor,während der solche Strategien zum Einsatz kommen können, werden von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenzunehmend zusätzliche Angebote erwartet, die die Nachhaltigkeit <strong>und</strong>Langzeitwirkung der Behandlung absichern helfen. Hier setzt Strategie PAT-6 an.Wie die WHO in ihren Papieren – angefangen bei der Ottawa-Charta (1986) – immer wiederbetont, hängt die Möglichkeit zu einer ges<strong>und</strong>en Lebensgestaltung nur zum Teil vomindividuellen Wissen, von persönlichen Fähigkeiten <strong>und</strong> Motivlagen ab. Wesentlich sindauch Möglichkeiten, Ressourcen <strong>und</strong> Anreizsysteme in der Umwelt der handelnden Personen.Welche Rolle können Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen in der Entwicklung dieser Möglichkeiten<strong>und</strong> Ressourcen für PatientInnen spielen? Sie sind aufgr<strong>und</strong> ihrer Position (Wissen, Prestige)in der Lage, sich für die Ges<strong>und</strong>heitsinteressen von spezifischen Personen <strong>und</strong>Gruppen in ihrer Gemeinde einzusetzen. Aufgr<strong>und</strong> ihres spezifischen Profils sind Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenin diesen Rollen nur schwer durch andere Akteure ersetzbar. Trotzdem30
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenbraucht es, um diese Aufgaben gut erfüllen zu können, dafür spezifische Ressourcen <strong>und</strong>spezifische Routinen. Beispiele der Implementierung dieser Strategie umfassen z.B. dieUnterstützung von Patientenselbsthilfegruppen, oder die Bereitstellung spezifischermedizinischer Produkte (Heilbehelfe), die für PatientInnen anderweitig schwer erhältlichsind.Wie ist Ges<strong>und</strong>heitsförderung für MitarbeiterInnen in denKernstrategien <strong>und</strong> Standards repräsentiert?Europaweit sind etwa 10% der Beschäftigten im Ges<strong>und</strong>heitswesen tätig, davon in denEU-27 über 70% Frauen (vgl. European Fo<strong>und</strong>ation for the Improvement of Living andWorking Conditions 2007). Der Ges<strong>und</strong>heitssektor hat der zitierten Studie zufolge vondreizehn untersuchten Sektoren den vierthöchsten Ges<strong>und</strong>heits-Impact auf die MitarbeiterInnen.• Die psychischen Belastungen sind im Ges<strong>und</strong>heitssektor von den 13 untersuchtenSektoren am höchsten: MitarbeiterInnen in diesem Sektor haben von allenSektoren das höchste Risiko, am Arbeitsplatz Gewalt oder Belästigungen ausgesetztzu sein, sie müssen die höchsten Anforderungen in Bezug auf Flexibilität (Ausübungunterschiedlicher Tätigkeitsbereiche) <strong>und</strong> Teamarbeit erfüllen, <strong>und</strong> der Ges<strong>und</strong>heitssektorist durch das höchste Ausmaß an Arbeitsunterbrechungen gekennzeichnet(European Fo<strong>und</strong>ation for the Improvement of Living and Working Conditions2007). Weitere, von der Studie nicht untersuchte psychische Belastungen sind durchdie permanente Konfrontation mit Leid <strong>und</strong> Tod gegeben.• In Bezug auf die von der European Fo<strong>und</strong>ation for the Improvement of Living andWorking Conditions untersuchten physischen Ges<strong>und</strong>heitsbelastungen ist vor allemdie Belastung durch rotierende Schichten zu nennen – auch hier liegt derGes<strong>und</strong>heitssektor an erster Stelle. In Bezug auf Abend- <strong>und</strong> Nachtarbeit sowieWochenenddienste liegt er an 4. bzw. 5. Stelle. Ebenfalls hoch sind biologische <strong>und</strong>chemische Belastungen – hier liegt der Ges<strong>und</strong>heitssektor an 2. Stelle. Bei allenanderen körperlichen Risiken (einschließlich der ergonomischen Belastungen) liegenGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen eher nicht im oberen Belastungsbereich. (EuropeanFo<strong>und</strong>ation for the Improvement of Living and Working Conditions 2007)• Belastungen der sozialen Ges<strong>und</strong>heit – (mangelnde) Karrieremöglichkeiten, dieVereinbarkeit von Beruf <strong>und</strong> Privatleben – wurden von der genannten Studie nichtbranchenspezifisch untersucht. Es ist aber aus anderen Untersuchungen bekannt,dass vor allem die Pflege unter mangelnden Karrierechancen leidet (vgl. z.B. Krajic etal. 2005). Zudem stellen die unregelmäßigen Arbeitszeiten, v.a. die Notwendigkeit rotierenderSchichten <strong>und</strong> Nachtarbeit, besondere Anforderungen an die Verbindungvon Berufs- <strong>und</strong> Privatleben.Hinzu kommt, dass das Ges<strong>und</strong>heitswesen in den letzten Jahren dauerreformiert wird(z.B. Schließungen / Zusammenlegungen von Einheiten <strong>und</strong> ganzen Häusern, Veränderungenvon Erwartungen <strong>und</strong> Anforderungen an die MitarbeiterInnen), sodass viele MitarbeiterInnenverunsichert <strong>und</strong> demotiviert sind. Dies alles erfolgt unter Bedingungensteigender Arbeitsbelastungen (nicht zuletzt durch die immer kürzeren Verweildauern,die durch den medizinisch-technischen Fortschritt möglich werden <strong>und</strong> die immer mehrVerwaltungsaufwand mit sich ziehen).Da sich bestimmte berufliche Belastungen mit dem Alter verstärken, kann der hohe Altersschnittder MitarbeiterInnen im Ges<strong>und</strong>heitswesen, der durch die Veränderung derBevölkerungspyramide <strong>und</strong> die gesetzliche Anhebung des Pensionsantrittsalters bedingtist, als weiteres Problem dieses Sektors angesehen werden (vgl. Dietscher et al. 2005).Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> verw<strong>und</strong>ert es nicht, dass das Konzept „Ges<strong>und</strong>heitsförderndeGes<strong>und</strong>heitseinrichtung“ von Angehörigen der Ges<strong>und</strong>heitsberufe zumindest in Österreichoft in erster Linie als eine Strategie zur Unterstützung der MitarbeiterInnen verstanden31
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenwird: Zweifelsohne herrscht hier – so wie auch in anderen Branchen – großer Handlungsbedarf.Ziel der mitarbeiterorientierten Strategien im Konzept Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen ist in erster Linie, die Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Arbeitszufriedenheitder MitarbeiterInnen aller Berufsgruppen zu erhalten <strong>und</strong> zu fördern (mitmessbaren Outcomes in den Bereichen Arbeitszufriedenheit, bei spezifischen z.B. stressbezogenenGes<strong>und</strong>heitsparametern, bei Fluktuationsraten <strong>und</strong> in Bezug auf die Ges<strong>und</strong>heitskompetenzder MitarbeiterInnen), <strong>und</strong> zwar durch eine entsprechende Weiterentwicklungder Arbeitsabläufe <strong>und</strong> über die Gestaltung der materiellen <strong>und</strong> der sozio-kulturellenUmwelt der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung. Während es bei den PatientInnenum das Angebot ges<strong>und</strong>heitsfördernder Dienstleistungen in einer ges<strong>und</strong>heitsförderndenLebenswelt geht, fokussieren die mitarbeiterorientierten Strategien <strong>und</strong> Standardsdie ges<strong>und</strong>heitsfördernde Leistungserbringung in einer ges<strong>und</strong>heitsförderndenLebenswelt.Aus dem gut etablierten Feld der Betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung liegen zahlreicheerprobte Instrumente vor 12 , die zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung für MitarbeiterInnen genutztwerden können. Eine Sammlung einschlägiger Leitlinien findet sich zum Beispiel auf derWebsite der Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Wiener Spitälern, Pflegeeinrichtungen<strong>und</strong> Seniorenwohneinrichtungen (http://www.allianz-gfwien.at/htm/leit_arbeitsplatz.htm).Mit den Kernstrategien <strong>und</strong> Standards wurden darüberhinaus eigene Instrumente des HPH geschaffen, die die allgemeinen Instrumentespezifisch für Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen ergänzen:Strategie MIT-1 – Leben in der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungDiese Strategie widmet sich – wie bei den PatientInnen – den menschlichen Gr<strong>und</strong>lagen,die den MitarbeiterInnen das Erfüllen ihrer Arbeitsrolle erst ermöglichen – das heißt, ihrensomato-psycho-sozialen Gr<strong>und</strong>bedürfnissen, deren Erfüllung zumindest in minimalerWeise auch am Arbeitsplatz möglich sein muss, um Ges<strong>und</strong>heit langfristig zu erhalten.Umsetzungsmaßnahmen umfassen etwa das Ermöglichen von biologisch notwendigenErholungsphasen, die Organisation von Essensmöglichkeiten während der Arbeitszeit<strong>und</strong> die Berücksichtigung von Work-Life-Balance in der Arbeitszeitgestaltung.Strategie MIT-2 – Gestaltung der Arbeitsprozesse in der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungDiese Strategie thematisiert die Auswirkung von Arbeitsprozessen auf die Ges<strong>und</strong>heit derMitarbeiterInnen <strong>und</strong> die Möglichkeit der Gestaltung <strong>und</strong> Weiterentwicklung dieser Prozessedurch die MitarbeiterInnen selbst. Umsetzungsmaßnahmen umfassen zum BeispielGes<strong>und</strong>heitszirkel <strong>und</strong> Führungskräftetrainings.Strategie MIT-3 – Gestaltung der ArbeitsumweltDiese Strategie zielt auf die Verbesserung der Ges<strong>und</strong>heitswirkung der materiellen <strong>und</strong>sozio-kulturellen Umwelt von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen ab – Umsetzungsmaßnahmenumfassen etwa die Verbesserung ergonomischer Bedingungen <strong>und</strong> des Arbeitsklimas.12 sowohl branchenunspezfische Instrumente wie z.B. der Ges<strong>und</strong>heitszirkel (vgl. z.B. Schröer / Sochert 1997) alsauch Instrumente für Probleme, die Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen spezifisch betreffen, wie z.B. Empfehlungen für dieGestaltung von Nacht- <strong>und</strong> Schichtarbeit32
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenStrategie MIT-4 – Empowerment für ein ges<strong>und</strong>heitsförderndesSelbstmanagement bestehender Ges<strong>und</strong>heitsbelastungenNicht alle Ges<strong>und</strong>heitsprobleme können – wie in den Strategien MIT-1 bis MIT-3 angelegt– primärpräventiv durch die entsprechende Gestaltung des Arbeitslebens vermieden werden.Wo bereits Probleme bestehen, bedarf es der Kompensation nicht vermeidbarerBelastungen <strong>und</strong> dadurch entstandener körperlicher oder psychischer Beeinträchtigungen,um die betroffenen MitarbeiterInnen im Erhalt ihrer Arbeitsfähigkeitzu unterstützen. Zu den Umsetzungsmaßnahmen gehört u.a. die Unterstützung im Umgangmit Suchtproblemen, die Entwicklung altersgrechter Arbeitskarrieren (vgl. dazu z.B.Morschhäuser / Sochert 2006) oder die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit.Strategie MIT-5 – Empowerment zur Weiterentwicklung ges<strong>und</strong>heitsfördernderLebensstileWie auch bei den PatientInnen geht es in der Strategie MIT-5 darum, durch Unterstützungges<strong>und</strong>heitsfördernder Lebensstile – vor allem Ernährung, Bewegung, der Umgangmit Sucht- <strong>und</strong> Genussstoffen sowie der Umgang mit Stress – die mittel<strong>und</strong>langfristigen Ges<strong>und</strong>heitsgewinne der MitarbeiterInnen zu steigern. Für MitarbeiterInnenin Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen ist dies besonders wichtig, weil die unregelmäßigenArbeitszeiten eine besondere Herausforderung an ges<strong>und</strong>e Lebensstile (z.B. regelmäßigeBewegung <strong>und</strong> Ernährung) stellen. Neben entsprechenden Informationen <strong>und</strong> Schulungenkönnen auch Kantinenangebote, betriebliche Sportgruppen <strong>und</strong> die klare Ausschilderungvon Nichtraucherbereichen zur Umsetzung dieser Strategie beitragen.Strategie MIT-6 – Beiträge zur ges<strong>und</strong>heitsfördernden Gestaltung der Regionfür MitarbeiterInnenIhre Orientierung an sozialer Verantwortung können Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen über ihreGrenzen hinaus durch Beiträge zur ges<strong>und</strong>heitsfördernden Gestaltung der Region für MitarbeiterInnenunter Beweis stellen. Umsetzungsmaßnahmen wären etwa die Unterstützungvon MitarbeiterInnen in der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel statt PKWs (diesfördert neben der Umwelt auch die Verkehrssicherheit nach langen Diensten), das Anbietenvon Betriebskinderkrippen <strong>und</strong> Kindergärten mit an die Dienstzeiten angepasstenÖffnungszeiten oder Abkommen mit regionalen Fitnesscentern oder Kulturanbieternfür verbilligte Tarife für die MitarbeiterInnen.Standard 4 – Förderung eines ges<strong>und</strong>en ArbeitsplatzesDie Implementierung der Strategien MIT-1 bis MIT-6 wird durch Standard 4 unterstützt.Hier wird die betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung explizit als Managementverantwortungin der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung definiert. Sub-Standards zu Standard 4 betreffen dieGewährleistung der Arbeitssicherheit, Mitarbeiterschulungen <strong>und</strong> Personalentwicklungauch in Bezug auf Ges<strong>und</strong>heitsförderung (zur Steigerung der Ges<strong>und</strong>heitskompetenz),die Entwicklung von Arbeitsabläufen in interdisziplinären Teams, die Erhaltung<strong>und</strong> Entwicklung des Ges<strong>und</strong>heitsbewusstseins der MitarbeiterInnen, Angebote fürRauchstopp-Interventionen <strong>und</strong> jährliche Mitarbeiterbefragungen.33
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenWie ist Ges<strong>und</strong>heitsförderung für die regionale Bevölkerung in denKernstrategien <strong>und</strong> Standards repräsentiert?Natürlich beeinflussen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen in erster Linie die Ges<strong>und</strong>heit ihrer PatientInnen<strong>und</strong> MitarbeiterInnen. Aber auch (potenzielle) Effekte auf die Gesunheitsbalanceanderer Bevölkerungsgruppen in der Nachbarschaft bzw. im Einzugsgebiet können in einemumfassenden Ges<strong>und</strong>heitsförderungskonzept bearbeitet werden. Der mögliche Ges<strong>und</strong>heitseinflussvon Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen auf die Region, insbesondere auch mitHinblick auf die öffentliche Ges<strong>und</strong>heit, wird bislang allerdings noch wenig debattiert –am ehesten noch im Kontext des Umweltmanagements (Abwässer, Emissionen, hoherEnergieverbrauch, hohes Verkehrsaufkommen, ...).Es gibt aber noch eine Reihe anderer Möglichkeiten, wie Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen zurFörderung der Ges<strong>und</strong>heit in der Region beitragen können, die im Folgenden wiederumanhand von 6 Strategien (REG-1 bis REG-6) dargestellt werden. Im Unterschied zuden patienten- <strong>und</strong> mitarbeiterorientierten Strategien, die in erster Linie aufQualitätsentwicklungen innerhalb von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen abzielen, behandelndiese Strategien im wesentlichen die Außenbeziehungen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen.Da die Rolle von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen in der Region in unterschiedlichen Staaten<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssystemen sehr unterschiedlich definiert ist <strong>und</strong> es daher sehr schwierigist, international verbindliche Richtlinien auszuarbeiten, liegen für diesen Bereich keineStandards vor.Strategie REG-1 – Empowerment der regionalen Bevölkerung zumges<strong>und</strong>heitsfördernden Selbstmanagement durch Unterstützung einesadäquaten Zugangs zu Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungenDie Möglichkeit, Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen in angemessener Weise <strong>und</strong> vor allemrechtzeitig in Anspruch nehmen zu können, ist eine wichtige Voraussetzung für die eigeneGes<strong>und</strong>heit. Ges<strong>und</strong>heitsförderung lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dassGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen aktiv zur Verbesserung des Zugangs zu ihren Leistungenbeitragen können. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen, die an sozio-ökonomischbenachteiligte Gruppen wie MigrantInnen oder Personen mit niedrigem Bildungsniveaugerichtet sind, die bekanntermaßen über weniger Ges<strong>und</strong>heitskompetenz verfügen <strong>und</strong>Leistungen weniger in Anspruch nehmen.Strategie REG-2 – Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Zusammenarbeit zwischenunterschiedlichen LeistungserbringernDie professionelle Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Versorgungsebenen isteine wichtige Voraussetzung sowohl der Förderung eines adäquaten Zugangs (vgl. StrategieREG-1) <strong>und</strong> der Vermeidung von Fehlversorgung als auch der optimalen Betreuungvon PatientInnen im gesamten Verlauf ihrer Patientenkarriere. Neben der Implementierungentsprechender (auch technisch unterstützter) Kommunikationsstrukturen tragendazu auch gemeinsame Fortbildungen von MitarbeiterInnen unterschiedlicherVersorgungsebenen bei. Damit kann gleich auch noch ein weiteres Ziel – nämlichder Transfer von Know-How zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung zwischen unterschiedlichen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen– unterstützt werden.34
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenStrategie REG-3: Entwicklung von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen zuges<strong>und</strong>heitsfördernden Umwelten für die RegionGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen als materielle <strong>und</strong> soziale Settings bzw. Lebenswelten habennicht nur Effekte auf die Ges<strong>und</strong>heit der Menschen, die sich in ihnen bewegen, sondernauch auf die Menschen in ihrer Nachbarschaft. Aus einer ökologischen <strong>und</strong> Qualitätsperspektivesind insbesondere die negativen Effekte von (großen) Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenauf Luftverschmutzung <strong>und</strong> Wasserbelastung, sowie Beiträge zur Lärm- <strong>und</strong> Verkehrsbelastung(über Krankentransporte, BesucherInnen, MitarbeiterInnen) zu reduzieren.Aus Perspektive der Ges<strong>und</strong>heitsförderung geht es darüber hinaus auch um denAusbau positiver Effekte, etwa in Form der Zurverfügungstellung von Infrastrukturenfür die Nachbarschaft (z.B. Räume für Treffen, Sport- <strong>und</strong> Freizeitaktivitäten). Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenkönnen sich beispielsweise als kulturelles Zentrum etablieren(wie z.B. das Krankenhaus Repty, in Polen (vgl. Eysymontt et.al. 1998).Strategie REG-4 – Empowerment der regionalen Bevölkerung zumges<strong>und</strong>heitsfördernden KrankheitsmanagementGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen können über ihre eigenen PatientInnen (<strong>und</strong> deren Angehörige)sowie ihre MitarbeiterInnen hinaus auch weitere Personen im Management chronischerErkrankungen unterstützen, indem sie ihre entsprechenden Angebote für einenweiteren Personenkreis öffnen. Dies würde insbesondere für seltene ErkrankungenSinn machen, zu denen einzelne externe Anbieter häufig nicht über die nötige Expertiseverfügen. Beispiele aus Österreich umfassen z.B. Alkohol- <strong>und</strong> Drogenberatung für Betriebe<strong>und</strong> Schulen durch spezielle Suchtkliniken, oder die Schulung von KindergartenpädagogInnen<strong>und</strong> LehrerInnen in der Betreuung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichenmit spezifischen chronischen Erkrankungen.Strategie Reg-5 – Empowerment der regionalen Bevölkerung für dieges<strong>und</strong>heitsfördernde LebensstilentwicklungSelbstverständlich können Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen – abhängig von ihren definiertenAufgaben, von den Leistungen anderer Anbieter <strong>und</strong> von Finanzierungsmöglichkeiten –Informations- <strong>und</strong> Schulungsangebote für die Entwicklung ges<strong>und</strong>heitsfördernderLebensstile einem breiteren Bevölkerungskreis anbieten, um ihre diesbezügliche Expertisefür ihre Region nutzbar zu machen.Strategie REG-6 – Beiträge zur ges<strong>und</strong>heitsfördernden RegionalentwicklungEin weiterer für die öffentliche Ges<strong>und</strong>heit besonders wichtiger Bereich sind Beiträge vonGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen zur ges<strong>und</strong>heitsfördernden Regionalentwicklung: Ges<strong>und</strong>heitsprofessionistenhaben oft nicht nur einen besonders guten Überblick über regionale Ges<strong>und</strong>heitsprobleme,sondern verfügen aufgr<strong>und</strong> ihrer Expertise, ihres Prestiges <strong>und</strong> ihrerWirtschaftsmacht auch über eine Stimme, die gehört wird. Eine mögliche Form des Beitragsist die Aufbereitung von Patientendaten für die regionale Ges<strong>und</strong>heitsberichterstattung,um so eine datenbasierte Handlungsgr<strong>und</strong>lage für Verbesserungsmaßnahmenzu schaffen. Durch „Partnerschaften für Ges<strong>und</strong>heit“ (vgl. Jakarta-Erklärungder WHO von 1998) – z.B. in Form spezifischer Kooperationen mit der Regionalverwaltung,mit Betrieben oder Schulen – können Maßnahmen der betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung,der Ges<strong>und</strong>heitserziehung oder der verbesserten Ges<strong>und</strong>heitsversorgung fürsoziale Randgruppen unterstützt werden.35
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagentümerInnen <strong>und</strong> Financiers angewiesen – denn wie man aus der Management-Literatur weiß, wird Verordnetes nicht ohne Weiteres übernommen (vgl. Covey 2005).Geeignete Medien zur Information sind z.B. interne R<strong>und</strong>briefe, Intranet, Hausmessen.Methoden zur Förderung von Einbeziehung <strong>und</strong> Partizipation sind Ges<strong>und</strong>heitszirkeloder betriebliches Vorschlagswesen.• Um sicherzustellen, dass die Qualität der Ges<strong>und</strong>heitsförderung laufend weiter entwickeltwird, ist eine Analyse von Strukturen <strong>und</strong> Prozessen (Assessment), dieIdentifizierung von ges<strong>und</strong>heitsfördernden (empowernden, partizipativen)Beiträgen zu deren Verbesserung, eine Priorisierung der gef<strong>und</strong>en Interventionsbereiche(z.B. mit Hilfe der fünf Standards) <strong>und</strong> die regelmäßige Überprüfung vonErfolgen (z.B. Mitarbeiter- <strong>und</strong> Patientenbefragungen, die eine Einschätzung des Ges<strong>und</strong>heitsgewinns<strong>und</strong> der Ges<strong>und</strong>heitskompetenz ermöglichen) erforderlich.• Nachhaltige ges<strong>und</strong>heitsfördernde Entwicklungen können erzielt werden, wenn Ges<strong>und</strong>heitsförderungin professionelle Standards, Leitlinien <strong>und</strong> klinische Pfadeintegriert wird. Eine weitere Möglichkeit sind spezifische Ges<strong>und</strong>heitsförderungs-Programme für bestimmte Lebensstile (z.B. Rauchfrei-Programm gemäß den Vorgabendes European Network for Smoke-Free Hospitals 13 ), für bestimmte Zielgruppen(z.b. Baby Friendly- oder Migrant Friendly-Programme, Kinderfre<strong>und</strong>liches Krankenhaus,allgemeine Patientenorientierungs- oder Patientensicherheitsprogramme,soziale Gerechtigkeit, Mitarbeiterfre<strong>und</strong>liches Krankenhaus, Familienfre<strong>und</strong>licher Arbeitsplatz),für bestimmte Erkrankungen, für die Gestaltung der Einrichtung alsSetting bzw. Lebenswelt (z.B. ökologische Gestaltung, ergonomische Gestaltung,Verkehrsplanung), oder für zur Regionalentwicklung (z.B. regelmäßige Ges<strong>und</strong>heitsberichterstattung,Ges<strong>und</strong>e Allianzen, Ges<strong>und</strong>heitsangebote für die regionale Bevölkerung).• Dies setzt auch die ges<strong>und</strong>heitsfördernde Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung derMitarbeiterInnen sowie ein entsprechendes Führungskräftetraining voraus.Standard 1: Management-Gr<strong>und</strong>sätzeAuch für den Management-Bereich liegt mit den Standards die Möglichkeit einer Selbstbewertung<strong>und</strong> der darauf aufbauenden Entwicklung <strong>und</strong> Implementierung von Aktionsplänenvor. Der Standard <strong>und</strong> seine Substandards fordern die klare Festlegung derVerantwortung für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in der Organisation, die Bereitstellungvon Ressourcen für die Implementierung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung, <strong>und</strong> die datenbasierteEvaluierung der Qualität von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen.Rahmenbedingungen für Ges<strong>und</strong>heitsförderndeGes<strong>und</strong>heitseinrichtungenUnterstützendes Ges<strong>und</strong>heitswesenEs wäre natürlich für eine Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung, die einen “totalen Ges<strong>und</strong>heitsförderungs-Ansatz”im oben beschriebenen Sinn umsetzen möchte, sehr hilfreich, wenn dieseEntwicklung auch durch entsprechende Unterstützung aus dem Umfeld unterstützt würden– etwa durch einen hohen Stellenwert von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in der Ges<strong>und</strong>heitspolitik<strong>und</strong> in der Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung von Angehörigen derGes<strong>und</strong>heitsberufe.Österreich ist diesbezüglich auf einem guten Weg – ist Ges<strong>und</strong>heitsförderung dochmehrfach als Aufgabe des Ges<strong>und</strong>heitswesens gesetzlich verankert 14 . Neben Regelungenfür bestimmte Berufsgruppen (Allgemein- <strong>und</strong> ArbeitsmedizinerInnen, Ges<strong>und</strong>heits-<strong>und</strong> Krankenpflegepersonen) <strong>und</strong> für bestimmte Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (Kas-13 vgl. dazu die Website des European Network for Smoke-Free Hospitals, http://ensh.aphp.fr/ (Zugriff am14.08.2008)14 (vgl. dazu Übersicht im Anhang)37
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagensen, arbeitsmedizinische Zentren) stellt das Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetz (2005) eineexplizite Verbindung zwischen Qualitätsarbeit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Ges<strong>und</strong>heitswesenher. Damit steht Österreich nicht alleine da: Auch in anderen EU-Staatenist Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Qualitätsdimension des Ges<strong>und</strong>heitswesens definiert,so etwa in Irland, wo sie in der Verantwortung des Department for Health andChildren <strong>und</strong> damit eines der drei nationalen Akteure liegt, die gemeinsam unter der Leitungdes Health Service Executive das Ges<strong>und</strong>heitssystem gestalten. In Spanien gehörtsie zu den Leitprinzipien des Nationalen Qualitätsplans von 2006 (vgl. Legido-Quigley etal. 2008).LiteraturBauchemin K.M., Hays P. (1998): Dying in the dark: Sunshine, gender and outcomes in myocardialinfarctions. In: Journal of the Royal Society of Medicine. Vol. 91, No. 7, 352-354Behrens J., Langer G. (2004): Evidence-based Nursing. Vertrauensbildende Entzauberung der„Wissenschaft“. Qualitative <strong>und</strong> quantitative Methoden bei täglichen Pflegeentscheidungen. Bern:Verlag Hans HuberBrandt E. (Ed.) (2001): Qualitätsmanagement <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Krankenhaus: Handbuchzur EFQM-Einführung. Neuwied & Kriftel: LuchterhandCovey S.R. (2005): Die 7 Wege zur Effektivität: Prinzipien für persönlichen <strong>und</strong> beruflichen Erfolg.Offenbach: GabalDahlgren G., Whitehead M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health.Stockholm: Institute for Future Studies.Di Blasi, Z., Harkness, E., Ernst, E., Georgiou, A., Kleijnen, J. (2001): Influence of context effectson health outcomes: a systematic review. In: The Lancet, Vol 357, March 10, 757-762.Dietscher C., Krajic K., Nowak P., Stidl T., Pelikan J.M: (2002): Das Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhaus.Konzepte, Beispiele <strong>und</strong> Erfahrungen aus dem internationalen Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser. Wien: B<strong>und</strong>esministerium für soziale Sicherheit <strong>und</strong> GenerationenDietscher C., Nowak P., Schmied H. (2005): Factsheet: "Altern in Ges<strong>und</strong>heit für Mitarbeiter/innen:Beiträge von Spitälern <strong>und</strong> Pflegeeinrichtungen". Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitssoziologieDonabedian A. (1982): The Criteria and Standards of Quality. Explorations in Quality Assessmentand Monitoring. Michigan: Health Administration PressEhlers B., Dziewas R., Weise C., Blankenburg K., Gummert J., Strauss B., Brandt E., Albes J.(2008): Influencing anxiety and stress in cardiosurgical patients by means of perioperative psychologicalor spiritual interventions. Referat am 15. Mai 2008 im Rahmen der 16. Internationalen KonferenzGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen, BerlinEngelmann F., Halkow A. (2008): Der Setting-Ansatz in der Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Genealogie,Konzeption, Praxis, Evidenzbasierung. Berlin: WZBEuropean Fo<strong>und</strong>ation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eds., 2007): FourthEuropean Working Conditions Survey. Dublin: European Fo<strong>und</strong>ation for the Improvement of Livingand Working ConditionsEysymontt Z., Baczek Z., Marzec A. (1998): “The Upper Silesian Rehabilitation Centre ‘Repty’ inUstron as a Pilot Health Promoting Hosptial” in: Pelikan J.M., Garcia-Barbero M., Lobnig H., KrajicK. (1998): Pathways to a Health Promoting Hospital. Experiences from the European Pilot HospitalProject 1993-1997. Gamburg: G. Conrad Health Promotion Publications, 293-308Goode T.D., Dunne M.C., Bronheim S.M. (2006): The evidence base for cultural and linguistic competencyin health care. Washington: Georgetown University38
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenGröne O. (2006): Implementing health promotion in hospitals: Manual and self-assessment forms.Copenhagen: World Health OrganizationHartl F., Wernisch D. (2001): Qualitätsmanagement in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen. Konzeption - Implementierung– Verbesserung. Wien: ÖÄKHolmes TH, Rahe RH (1967). "The Social Readjustment Rating Scale". J Psychosom Res 11 (2):213-8Johnston, M., Vögele, C. (1992): Welchen Nutzen hat psychologische Operationsvorbereitung? EineMetaanalyse der Literatur zur psychologischen Operationsvorbereitung Erwachsener. In: Schmidt,L.R. (Eds.): Psychologische Aspekte medizinischer Maßnahmen. Berlin: Springer. 215-246.Kiecolt-Glaser J., McGuire L., Robles T.F., Glaser R. (2002): Psychoneuroimmunology and PsychosomaticMedicine: Back to the Future. In: Psychosomatic Medicine 64, 15-28Legido-Quigley H. McKee M., Nolte E., Glinos I.A. (Eds., 2008): Assuring the quality of health carein the European Union: A case for action. Copenhagen: World Health Organziation – Regional Officefor EuropeKrajic K., Vyslouzil M., Nowak P. (2005): Pflegenotstand in Österreich? Diagnosen <strong>und</strong>Lösungsmöglichkeiten mit einem Schwerpunkt auf Entwicklung der Arbeitsbedingungen des diplomiertenPflegepersonals. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologieKunz R., Ollenschläger G., Raspe H.H., Jonitz G., Kolkmann F.W. (HG., 2000): Lehrbuch EvidenzbasierteMedizin in Klinik <strong>und</strong> Praxis. Köln: Deutscher ÄrzteverlagMintzberg H. (1997): Toward Healthier Hospitals. In: Healthcare Management Review 22 (4), 9-18Morschhäuser M., Sochert R. (2006): Healthy work in an ageing Europe. Strategies and instrumentsfor prolonging working life. Essen: Federal Association for Company Health Insurance F<strong>und</strong>sNowak P., Lobnig H., Krajic K., Pelikan J.M: (1998): Case Study Rudolfstiftung Hospital, Vienna,Austria – WHO Model Project “Health and Hospital”. In: Pelikan J.M., Garcia-Barbero M., Lobnig H.,Krajic K. (1998): Pathways to a Health Promoting Hospital. Experiences from the European PilotHospital Project 1993-1997. Gamburg: G. Conrad Health Promotion Publications, 47-66Panamerican Health Organization – Regional Office of the World Health Organization (Eds., 2000):Fifth Global Conference on Health Promotion: Final Report. Washington: Panamerican Health OrganizationPelikan J.M., Garcia-Barbero M., Lobnig H., Krajic K. (Eds., 1998a): Pathways to a Health PromotingHospitals. Experiences from the European Pilot Hospital Project 1993-1997. Gamburg: HealthPromotion PublicationsPelikan J.M., Lobnig H., Krajic K., Dietscher C. (1998b): Structure, process and outcome of theEuropean Pilot Hospital Project – a summary. In: Pelikan J.M., Garcia-Barbero M., Lobnig H., KrajicK. (Eds., 1998): Pathways to a Health Promoting Hospitals. Experiences from the European PilotHospital Project 1993-1997. Gamburg: Health Promotion Publications, pp. 17-44Pelikan J.M., Krajic K., Dietscher C. (2001): Health Promoting Hospitals: Concept and Development.In: Patient Education and Counselling 45 (4), 239-243Pelikan J.M., Krajic K., Dietscher C. (2006): Putting HPH Policy into Action. Working Paper of theWHO Collaborating Centre on Health Promotion in Hospitals and Health Care. Vienna: LudwigBoltzmann Institute for the Sociology of Health and Medicine. (http://www.hphhc.cc/Downloads/HPH-Publications/wp-strategies-final.pdf;Zugriff am 03.07.2008)Republik Österreich (Hg., 2005): Artikel 9, B<strong>und</strong>esgesetz zur Qualität von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen(Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetz – GQG). In: 179. B<strong>und</strong>esgesetz, mit dem das B<strong>und</strong>esgesetz überKrankenanstalten <strong>und</strong> Kuranstalten, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das GewerblicheSozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- <strong>und</strong>Unfallversicherungsgesetz, das Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetz, das Ärztegesetz 1998 <strong>und</strong>das B<strong>und</strong>esgesetz über die Dokumentation im Ges<strong>und</strong>heitswesen geändert sowie ein B<strong>und</strong>esgesetz39
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenzur Qualität von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen <strong>und</strong> ein B<strong>und</strong>esgesetz über Telematik im Ges<strong>und</strong>heitswesenerlassen werden (Ges<strong>und</strong>heitsreformgesetz 2005)Rootman, I.; Goodstadt, M.; Hyndman, B.; McQueen, D. V.; Potvin, L.; Springett, J.; Ziglio, E.(2001): Evaluation in health promotion: principles and perspectives. WHO Regional Publications.European Series; No. 92. WHO: CopenhagenSchröer A., Sochert R. (1997): Ges<strong>und</strong>heitszirkel im Betrieb. Modelle <strong>und</strong> praktische Durchführung.Wiesbaden: Universum VerlagsanstaltStahl T., Wismar M., Ollila E., Lahtinen E., Leppo K. (Eds., 2006): Health in all policies: Prospectsand potentials. Helsinki: Ministry of Social Affairs and HealthTonnesen H., Fugleholm A., Jorgensen S.J. (2005): Evidence for health promotion in hospitals. In:Groene O., Garcia-Barbero M. (2005): Health promotion in hospitals: Evidence and qualitymanagement. Copenhagen: World Health Organization – Regional Office for EuropeVetter N. (1995): The hospital – From the centre of excellence to community support. London:ChapmanWimmer H., Pelikan J.M. (1984): Effekte psychosozialer Interventionen bei der prä- <strong>und</strong> postoperativenBetreuung von Patienten im Krankenhaus. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitssoziologieWorld Health Organization. (1948) Constitution. Geneva: World Health OrganizationWorld Health Organization (1978): Declaration of Alma-Ata. International Conference on PrimaryHealth Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. Geneva: WHOWorld Health Organization (1986): Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: World HealthOrganizationWorld Health Organization (1997): The Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the21st Century. Geneva: World Health OrganizationWorld Health Organization (2002): Physical inactivity a leading cause of disease and disability.Geneva: World Health OrganizationWorld Health Organization – Regional Office for Europe (1991): The Budapest Declaration onHealth Promoting Hospitals. Copenhagen: World Health Organization - Regional Office for EuropeWorld Health Organization – Regional Office for Europe (1997): The Vienna Recommendations onHealth Promoting Hospitals40
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen1.35 Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung imKrankenhaus: Pilotierung in ÖsterreichChristina DIETSCHERAls Reaktion auf die zunehmende Bedeutung von Qualität im Ges<strong>und</strong>heitswesenwurde im internationalen Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(HPH) in den letzten Jahren ein Set von fünf Standards (Gröne2006) ausgearbeitet <strong>und</strong> international getestet, die Orientierung bei der Entwicklung zurGes<strong>und</strong>heitsfördernden Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung bieten sollen. Methodisch orientierte sichder von einer internationalen WHO-Arbeitgsruppe unter dänischer Führung geleisteteEntwicklungsprozess am ALPHA-Programm der ISQUA.Inhaltlich orientieren sich die Standards sowohl am Patientenpfad – von der Aufnahmeüber die Behandlung <strong>und</strong> Pflege bis zur Entlassung – als auch an der Gestaltung von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenals ges<strong>und</strong>e Arbeitsplätze <strong>und</strong> an der Notwendigkeit, Ges<strong>und</strong>heitsförderungsystematisch in Führungs- <strong>und</strong> Managemententscheidungen einzubinden.Die Standards umfassen die folgenden Bereiche:• STANDARD 1: Management-Gr<strong>und</strong>sätze (Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Unternehmenspolitik)• STANDARD 2: Patienteneinschätzung (Einbau von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Aufnahme/ Anamnese)• STANDARD 3: Patienteninformation <strong>und</strong> -intervention (Vermittlung von lt. Anamneserelevanten Ges<strong>und</strong>heitsinformationen)• STANDARD 4: Förderung eines ges<strong>und</strong>en Arbeitsplatzes• STANDARD 5: Kontinuität <strong>und</strong> Kooperation (Sicherstellung der Ges<strong>und</strong>heitsförderungsleistungenauch nach der Entlassung)Um die Einbindung dieser Standards ins (Qualitäts-)Management von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenzu erleichtern, wurde dazu ein Selbstbewertungs-Instrumentarium entwickelt.Für jeden der 5 Standards steht darin eine Reihe von spezifischen Fragestellungen(sogenannten „messbaren Elementen“, insgesamt 40) zur Verfügung. Deren Erfüllungkann jeweils mit „ja“, „teilweise“ oder „nein“ bewertet werden. Aus der Beantwortung dereinem Standard zugeordneten „messbaren Elemente“ ergibt sich die Gesamteinschätzungfür den jeweiligen Standard sowie schließlich der Ges<strong>und</strong>heitsförderungs-Qualitätswertfür ein Haus. In Ergänzung zu den messbaren Elementen, die im Sinne des Donabedian’schenQualitätskonzeptes (vgl. z.B. Donabedian 1982) zur Erfassung ges<strong>und</strong>heitsförderungsrelevanterStrukturen <strong>und</strong> Prozesse entwickelt wurden, gibt es im Instrumentariumauch noch eine Reihe ergänzender Indikatoren, die eine Ergebnismessung ermöglichen.In einer internationalen Testung des Selbstbewertungsinstrumentariums (Gröne /Alonso / Klazinga 2007) war die Machbarkeit <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>sätzliche Sinnhaftigkeit derSelbstbewertung mit Hilfe dieses Instrumentariums <strong>und</strong> die darauf aufbauende Entwicklungvon Aktionsplänen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung bereits gr<strong>und</strong>sätzlich bewiesen worden.Nachdem in Kooperation mit dem Deutschen Netz Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungeneine Übersetzung der Standards <strong>und</strong> des Selbstbewertungsinstruments insDeutsche erfolgt war, waren ab 2006 die Voraussetzungen für eine Testung auch in Österreichgegeben. Durch Verabschiedung des Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetzes von 2005,das die Erbringung von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen in einem „ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Umfeld“vorsieht, lag auch eine gesetzliche Gr<strong>und</strong>lage für ein solches Vorhaben vor. Mit Unterstützungdes B<strong>und</strong>esministeriums für Ges<strong>und</strong>heit konnte die österreichische Pilotierungim Zeitraum Herbst 2006 bis Mai 2007 an zehn Partnereinrichtungen des ÖsterreichischenNetzwerks Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG) realisiert werden. Für die wissenschaftliche Begleitung <strong>und</strong> Gesamtpro-41
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenjektkoordinierung war das Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologieverantwortlich. Im Folgenden werden die Projektziele, der Ablauf <strong>und</strong> die Ergebnisseder Pilotierung beschrieben.Ziele <strong>und</strong> AblaufDie ProjektzieleHauptziel des Projektes war die Verbesserung der Gr<strong>und</strong>lagen für die Erbringungqualitätsvoller Ges<strong>und</strong>heitsförderung in österreichischen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen.Dafür wurden drei spezifische Subziele verfolgt:1. Testung der Machbarkeit der Selbstbewertung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Österreichin Zusammenarbeit mit Partnerkrankenhäusern aus dem ÖsterreichischenNetzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG);2. Unterstützung der beteiligten Krankenhäuser in der Weiterentwicklung derGes<strong>und</strong>heitsförderungsqualität im Rahmen des Selbstbewertungsprozesses;3. Auf Basis der Projekterfahrungen: Sofern nötig, Erarbeitung von Ergänzungen zumProjekthandbuch <strong>und</strong> Anpassung an österreichische Spezifika.In erster Linie ging es also um die Bewertung <strong>und</strong> Weiterentwicklung des Instrumentariums<strong>und</strong> die Entwicklung von Empfehlungen für eine breitere Umsetzung, nicht um eineBewertung der Ges<strong>und</strong>heitsförderungsqualität der beteiligten Häuser.Der Ablauf der PilotierungAls erster Schritt erfolgte eine Ausschreibung an die Partnereinrichtungen des ÖsterreichischenNetzwerks Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG). Gesucht wurden Häuser, die bereit waren, im Rahmen des Projektes folgendeLeistungen zu erbringen:• Nominierung von 2 Ansprechpersonen für die hausinterne Projektkoordination(idealerweise die ONGKG-Ansprechperson <strong>und</strong> der / die QualitätsmanagerIn) als Ansprechpartnerfür die Kooperation in der Gesamtprojektgruppe;• Klärung der hausinternen Projektreichweite (Pilot-Abteilungen oder ganzesHaus);• Zusammenstellung <strong>und</strong> Koordination eines hausinternen, interdisziplinären <strong>und</strong>interhierarchischen Teams zur Durchführung der Selbstbewertung (idealerweisesollten VertreterInnen von Medizin, Pflege, Verwaltung / Administration, einE VertreterInder Kollegialen Führung <strong>und</strong> der Personalvertretung einbezogen sein);• Durchführung der Selbstbewertung;• Dokumentation der Erfahrungen mit der Selbstbewertung (mittels Dokumentationsbogen);• Teilnahme der Projekt-Ansprechpersonen an einem häuserübergreifenden Auswertungs-Workshop.Für die Mitarbeit konnten zehn ONGKG-Mitgliedshäuser unterschiedlicher Größe <strong>und</strong> Ausrichtungaus sechs B<strong>und</strong>esländern gewonnen werden. An diesen Häusern wurden vonHerbst 2006 bis Jänner 2007 die Voraussetzungen für eine Selbstbewertung – Einholeneines Auftrags durch die Kollegiale Führung, Einrichten der Projektteams – geschaffen.Die eigentliche Selbstbewertung <strong>und</strong> deren Dokumentation erfolgte in den beteiligtenHäusern zwischen März <strong>und</strong> April 2007. Im Mai 2007 fand ein gemeinsamer Abschluss<strong>und</strong>Interpretationsworkshop der Ansprechpersonen aus den beteiligten Häusern statt.42
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenErgebnisse der SelbstbewertungVerständlichkeit des Instruments <strong>und</strong> Machbarkeit der SelbstbewertungDie erste Frage, die im Rahmen des Projektes beantwortet werden sollte, war, ob dasInstrumentarium – das ja in einem internationalen Kontext entwickelt worden war – fürdie Beteiligten verständlich <strong>und</strong> unter österreichischen Bedingungen handhabbar ist. Umdies erheben zu können, wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Projektbegleitung einDokumentationsfragebogen entwickelt, den die beteiligten Einrichtungen anhand ihrerErfahrungen ausfüllten. Die Ergebnisse der Dokumentation wurden im Rahmen des Auswertungsworkshopsdes Projektes gemeinsam diskutiert <strong>und</strong> mit den VertreterInnen derPilothäuser reflektiert.Gr<strong>und</strong>sätzlich stellten die Häuser dem Instrumentarium ein gutes Zeugnis aus. Sowohldie Verständlichkeit als auch die Angemessenheit für Bedingungen österreichischerKrankenanstalten wurden – mit einer Ausnahme – als gut bewertet.In Bezug auf die Machbarkeit konnte die Selbstbewertung an neun der zehn beteiligtenHäuser durchgeführt werden. Das Haus, das keine Selbstbewertung durchführte, befandsich zum Projektzeitpunkt in einer organisatorischen Umbruchphase. Die gr<strong>und</strong>sätzlicheMachbarkeit kann damit als gegeben angesehen werden. Aufgr<strong>und</strong> der Projekterfahrungenist es jedoch empfehlenswert, die Selbstbewertung in einer eher „ruhigen“ Phaseanzusiedeln.Ein Punkt wurde in der Projektgruppe ausführlicher diskutiert, <strong>und</strong> zwar, ob es – vor allemin großen Häusern – sinnvoll ist, eine Standard-Selbstbewertung für ein Gesamthausdurchzuführen. Die TeilnehmerInnen wiesen auf die beträchtlichen Unterschiede hinsichtlichAbläufen <strong>und</strong> Qualitätsniveaus zwischen unterschiedlichen Organisationseinheitenhin. Demnach könnte insbesondere die aus der Selbstbewertung resultierendeEntwicklung von Aktionsplänen – vor allem in großen Häusern – für einzelneOrganisationseinheiten effektiver sein als für ein Gesamthaus.Ein zweiter zentraler Diskussionspunkt betraf die Frage, ab wann ein messbares Elementmit „Ja“, „teilweise“ oder „nein“ zu beantworten ist – dazu gibt es im Handbuch zurSelbstbewertung keine eindeutigen Antworten. In Anlehnung an andere Qualitätsbewertungsverfahren(vgl. Nowak, Schmied 2003) entwickelte die Projektgruppe daher denVorschlag, die einzelnen messbaren Elemente bis zu einem Erfüllungsgrad von 25% als„nein“, bis zu 75% als „teilweise“ <strong>und</strong> ab 76% als „ja“ zu bewerten.Eignet sich das Instrumentarium für Benchmarking?Eine weitere zentrale Frage des Pilotprojektes war die potenzielle Eignung der Standardsfür Benchmarking. Diesbezüglich zeigte sich, dass die Standards, Substandards <strong>und</strong>messbaren Elemente zwar Differenzen zwischen unterschiedlichen Einrichtungen aufzeigen,dass diese Differenzen aber nicht nur real existierende Qualitätsunterschiede (z.B.Vorhandensein oder Nichtvorhandensein schriftlicher Unterlagen <strong>und</strong> Dokumentationenzu bestimmten Themen), sondern auch Unterschiede in den Kulturen der Einrichtungen(z.B. Offenheit, Reflexivität, Ausmaß an Selbstkritik) widerspiegeln.Für eine Benchmarking-Anwendung müsste daher ein rigoroses Projektdesign mitverbindlichen Eckdaten entwickelt werden, die zumindest die folgenden Bereiche umfassen:• Festlegung der Reichweite (einzelne Abteilungen, Gesamthäuser)• Verbindlich festgelegtes Erhebungsverfahren• Verbindlich festgelegte Indikatoren (dafür wurden im Projekt Vorschläge entwickelt,die aber im Projektrahmen nicht mehr getestet werden konnten).43
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenAbschluss <strong>und</strong> AusblickDas Selbstbewertungsinstrumentarium war aus Perspektive der beteiligten Einrichtungensehr nützlich für die Bewertung der Ges<strong>und</strong>heitsförderungsqualität <strong>und</strong> Identifizierungentsprechender Entwicklungspotenziale. Als besonderer Nutzen wurde die interdisziplinäreZusammensetzung der Selbstbewertungsgruppen gesehen, die deminterdisziplinären Austausch <strong>und</strong> dem wechselseitigen Verständnis der unterschiedlichenGes<strong>und</strong>heitsförderungsberufe füreinander sehr zugute kam. Die Gesamtergebnisse desProjektes sind in einem Projektbericht des Boltzmann-Instituts dokumentiert (vgl. Dietscheret al. 2007).Die positiven Erfahrungen mit den Standards – sowohl international als auch in Österreich– haben in der Zwischenzeit dazu geführt, dass das Österreichische NetzwerkGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (ONGKG)eine verpflichtende Standardselbstbewertung bei jeder Verlängerung der Mitgliedschaftim Netzwerk einbeführt hat. Für die Zukunft lässt dies eine weitere Qualitätssteigerungder Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen erwarten.LiteraturDietscher C., Nowak P., Pelikan J.M. (2007): 5 Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Krankenhaus.Durchführung <strong>und</strong> wissenschaftliche Begleitung einer Pilottestung. Endbericht für dasB<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit, Familie <strong>und</strong> Jugend. Wien: Ludwig Boltzmann Institut fürMedizin- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologieDonabedian A. (1982): The Criteria and Standards of Quality. Explorations in Quality Assessmentand Monitoring. Michigan: Health Administration PressGröne O. (2006): Implementing health promotion in hospitals: Manual and self-assessment forms.Copenhagen: World Health OrganizationGröne O., Alonso, Klazinga (in press): Validation of the WHO self assessment tool for health promotionin hospitals: results of a study in 38 hospitals in 8 countries.44
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen1.4Zur Evidenz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung inGes<strong>und</strong>heitseinrichtungenChristina DIETSCHEREinleitung: Zum EvidenzbegriffMit dem Siegeszug der Evidenzbasierten Medizin ab den 1970er Jahren (vgl. Cochrane1972) hat die Forderung nach Wirknachweisen von Interventionen – auch als Gr<strong>und</strong>lagefür Investitionsentscheidungen – zunehmend Einzug ins Ges<strong>und</strong>heitswesen gehalten,zuerst in der Medizin, dann auch in der Pflege. Auch Ges<strong>und</strong>heitsförderung steht in diesemmedizinisch-pflegerisch-therapeutischen Umfeld unter zunehmendem Evidenzdruck.Allerdings sind die methodischen Ansprüche des klinischen Evidenz-Konzeptes(vgl. Tabelle 3 unten) nur bedingt auf Ges<strong>und</strong>heitsförderung übertragbar.Tabelle 3: Unterschiedliche Ebenen der EvidenzLevel 1 • Es gibt ausreichende Nachweise für die Wirksamkeit aus systematischenÜberblicksarbeiten (Meta-Analysen) auf Basis zahlreicher randomisiertkontrollierterStudien.Level 2 • Es gibt Nachweise für die Wirksamkeit aus zumindest einer randomisiertenKontrollstudie.Level 3 • Es gibt Nachweise für die Wirksamkeit aus methodisch gut konzipierten Studien,ohne randomisierte Gruppenzuweisung.Level 4a • Es gibt Nachweis für die Wirksamkeit aus klinischen Berichten.Level 4b • Stellt die Meinung respektierter Experten dar, basierend auf klinischen Erfahrungswertenbzw. Berichten von Experten-Komitees.(Quelle: Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin, Deutschland / zitiert nach Wikipedia, Zugriffam 03.07.2008)Zumindest der als Goldstandard angesehene Level 1 (Wirksamkeitsnachweise, die aufMeta-Analysen randomisierter Kontrollstudien beruhen) ist, ebenso wie auch Level 2(einzelne randomisierte Kontrollstudien) in der Ges<strong>und</strong>heitsförderung nur zum Teil anwendbar.Dies liegt an der komplexen Natur von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen:Während klinische Interventionen häufig rein personenorientiert <strong>und</strong> bei ausreichendgroßen Fallzahlen vergleichsweise leicht nach bestimmten personenbezogenen Faktorenwie Alter, Geschlecht, soziale Schicht, Komorbidität kontrolliert werden können, trifft diesauf viele Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen nicht zu – vor allem dann, wenn Interventionensowohl personen- als auch umweltbezogen sind <strong>und</strong> zur Erreichung ein <strong>und</strong>desselben Ziels (z.B. Rauchstopp) eine Kombination verschiedener Strategien – wie Informations-<strong>und</strong> Schulungsmaßnahmen, Rauchverbote in Gebäuden, etc. – zum Einsatzkommt. Zudem können Ges<strong>und</strong>heitsförderungsinterventionen kaum in einem wirklichenKontrolldesign, d.h. abgeschirmt von potenziellen externen Einflussfaktoren 15 durchgeführtwerden. Es ist also methodisch äußerst schwierig, beobachtbare Wirkungen tatsächlicheindeutig einer komplexen Intervention zuzuschreiben. Jedenfalls bedarf es teurer,aufwändiger <strong>und</strong> langfristiger 16 Forschungsdesigns, um zu einigermaßen verlässlichenAussagen über die Wirksamkeit solcher Interventionen zu kommen. Vor allem bei Maßnahmenmit einem Fokus auf Organisations- <strong>und</strong> Settingsentwicklung wird dieszusätzlich dadurch erschwert, dass kaum geeignete Kontrollgruppen (d.h. weitere intervenierte<strong>und</strong> nicht intervenierte Organisationen oder Settings) in ausreichend großer Anzahlgef<strong>und</strong>en werden können.15 So darf etwa der Einfluss der Tabakpreise auf die Größe der Raucherpopulation einer Gesellschaft nicht unterschätztwerden.16 Die Wirksamkeit von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen (z.B. die Wirkung von Lebensstilschulungen bei Kindern<strong>und</strong> Jugendlichen auf die langfristige Entwicklung ges<strong>und</strong>er Lebensstile) zeigt sich oft erst Jahre nach derIntervention.45
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenFür diese komplexen, multistrategischen Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmenmuss man sich daher aufgr<strong>und</strong> der methodischen Einschränkungen mit aus klinischerPerspektive niederen Evidenzniveaus zufrieden geben. Für sehr spezifische personenorientierte,eher klinische Maßnahmen gibt es hingegen durchaus gute Evidenzniveausfür Ges<strong>und</strong>heitsförderungsinterventionen.Im Folgenden wird die Evidenz für Maßnahmen zur Förderung der unterschiedlichen Zielgruppendes Konzeptes „Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung“ anhand ausgewählterBeispiele diskutiert.Evidenz für unterschiedliche ZielgruppenPatientInnenPatientenorientierte Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen umfassen• die Unterstützung der PatientInnen im persönlichen Ges<strong>und</strong>heitsmanagement in derEinrichtung (Strategie PAT-1)• den Einbau von Prinzipien der Ges<strong>und</strong>heitsförderung (v.a. umfassendes Ges<strong>und</strong>heitsverständnis,Empowerment, Partizipation) in die allgemeinen Dienstleistungen (StrategiePAT-2)• die Ergänzung der klinischen Gr<strong>und</strong>leistungen um allgemeine <strong>und</strong> spezifische Ges<strong>und</strong>heitsförderung(vgl. dazu Tonnesen et al. 2005), d.h. das Empowerment von PatientInnenzur Lebensstilentwicklung (Strategie PAT-5) <strong>und</strong> zum Krankheitsmanagement(Strategie PAT-4)• die Weiterentwicklung der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung zu einem ges<strong>und</strong>heitsförderlicherenUmfeld (Strategie PAT-3) <strong>und</strong>• Beiträge zur patientenorientierten Weiterentwicklung der Region (Strategie PAT-6).(vgl. dazu auch Kapitel 1.2 oder Pelikan et al. 2006)Neben verbesserten klinischen Outcomes sind wesentliche Ergebnisse, die mit diesenMaßnahmen erzielt werden sollen, auch gesteigertes Wohlbefinden <strong>und</strong> mehr Zufriedenheit,mehr Compliance <strong>und</strong> eine bessere Ges<strong>und</strong>heitskompetenz der PatientInnen. Untersuchungenzur Evidenz von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen müssen daher auch aufdiese Dimensionen Bezug nehmen.Personenorientierte Maßnahmen für PatientInnenFür einzelne, sehr spezifische personenorientierte Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmensind für Ges<strong>und</strong>heitsförderung bei PatientInnen durchaus hohe Evidenzniveausim Sinne des EBM-Konzeptes zu erreichen. Entsprechende Studien führt zum Beispieldas WHO-Kooperationszentrum für Evidenzbasierte Klinische Ges<strong>und</strong>heitsförderungin Kopenhagen durch. So ist etwa belegt, dass Rauchstopp-Intervention voreinem chirurgischen Eingriff Komplikationen nach dem Eingriff reduzieren können. Generellist das Evidenzniveau für die Wirksamkeit systematischer Lebensstilinterventionen inklinischen Settings, wie z.B. Alkohol-, Ernährungs- <strong>und</strong> Bewegungsschulungen, hoch (vgl.Tonnesen et al. 2005).Darüber hinaus gibt es aber auch zahlreiche Belege für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen,die noch stärker an den Kernleistungen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen ansetzen. Sosteht etwa die positive Ges<strong>und</strong>heitswirkung von professionellem Schmerzmanagementebenso außer Frage wie die Wirksamkeit spezifischer präoperativer Patientenschulungen(z.B. Aufbau der Rückenmuskulatur vor Rückenoperationen), wodurch Risiken währenddes Eingriffs reduziert <strong>und</strong> die Heilung nach dem Eingriff beschleunigt werden können46
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen(vgl. Tonnesen 2008) 17 . Tonnesen et al. (2005) leiten aus diesen Erkenntnissen eine Reiheevidenzbasierter Handlungsempfehlungen für allgemeine patientenbezogeneGes<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (vgl. HPH-Kernstrategie PAT-5)ab, die in Tabelle 4 aufgelistet sind:Tabelle 4: Evidenzbasierte Maßnahmen der allgemeinen Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(nach Tonnesen et al. 2005)Interventionsbereich Empfohlene Interventionen:Rauchen • Identifikation von RaucherInnen <strong>und</strong> ihrer Rauchgeschichte• Mündliche <strong>und</strong> schriftliche Information über die schädlichen Effektedes Rauchens <strong>und</strong> die positiven Effekte des Rauchstopps sowieüber Möglichkeiten der Rauchentwöhnung• Beratung <strong>und</strong> Empfehlungen zum Rauchstopp• Maßnahmen zum Rauchstopp als integrierter Bestandteil der BehandlungAlkohol • Identifikation von Personen mit problematischem Trinkverhaltengemäß ICD-10-Kriterien• Mündliche <strong>und</strong> schriftliche Information über die schädlichen Effektedes Alkoholabusus <strong>und</strong> die positiven Effekte der Alkoholentwöhnungsowie über entsprechende Möglichkeiten• Für Personen mit problematischem Trinkverhalten: Empfehlungenzur Entwöhnung oder zur Mengenreduktion• Angebot von Kurzinterventionen oder Überweisung an entsprechendeFachabteilungenBewegung • Identifikation von PatientInnen mit Bewegungsmangel• Bewegungsberatung gemäß internationaler Empfehlungen <strong>und</strong>Leitlinien• Systematische Trainingsprogramme für besonders betroffene Patientengruppen(v.a. Personen mit Herz- <strong>und</strong> Lungenerkrankungen,DiabetikerInnen, chirurgische <strong>und</strong> psychiatrische PatientInnen, unter-<strong>und</strong> übergewichtige Personen)Ernährung / UntergewichtErnährung /Übergewicht• Identifikation von unterernährten PatientInnen oder einem Risikofür Unterernährung• Initiierung entsprechender Ernährungsmaßnahmen, Beobachtungvon Körpergewicht <strong>und</strong> Ernährungsverhalten während des Aufenthalts• Bei Entlassung: Information zum Ernährungsstatus an Hausarzt,pflegende Angehörige• Identifikation übergewichtiger PatientInnen: Screening auf Diabetes<strong>und</strong> andere Komplikationen• Beratung zu Ernährung <strong>und</strong> Bewegung• Systematische Trainingsprogramme für betroffene Patientengruppen• Sicherstellung des Follow-Up in der Weiterbetreuung nach EntlassungZumindest noch ein weiterer allgemeiner Ges<strong>und</strong>heitsförderungsansatz mit hohem Evidenzniveauverdient hier Erwähnung, <strong>und</strong> zwar die Förderung des Stillens im Rahmen derGeburtshilfe. Stillen hat ja nachweislich Langzeitwirkungen auf die Entwicklung des Immunsystemsvon Menschen, <strong>und</strong> durch gezielte Information <strong>und</strong> Schulungen kann dieStillrate nachweislich erhöht werden. Diese Erkenntnis ist Gr<strong>und</strong>lage des UNICEF-Programms „Baby Friendly Hospitals“ (UNICEF 2008).17 Derartige Studien werden seit vielen Jahren für unterschiedliche medizinische / chirurgische Bereiche durchgeführt<strong>und</strong> bestätigen immer wieder die positiven Effekte von Patientenschulungen vor medizinischen Eingriffen(vgl. z.B. Wimmer / Pelikan 1984).47
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenDarüber hinaus empfehlen Tonnesen et al. (2005) aufgr<strong>und</strong> der Evidenzlage eine Reihespezifischer, eher dem rehabilitativen Bereich zugehörige Maßnahmen (bzw.HPH-Kernstrategie PAT-4) für PatientInnen mit bestimmten Erkrankungen, die in Tabelle5 unten dargestellt sind:Tabelle 5: Evidenzbasierte Maßnahmen der spezifischen Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(nach Tonnesen et al. 2005)ZielgruppeEmpfohlene spezifische Ges<strong>und</strong>heitsförderungsinterventionen:PatientInnen mitHerz-Kreislauf-Erkrankungen• Körperliches Training• Spezifische Lebensstilintervention in Bezug auf Ernährung, Rauchen,Alkohol <strong>und</strong> Medikamenteneinnahme• Patientenschulungen• Psychosoziale UnterstützungCOPD-PatientInnen • Rauchstopp-Unterstützung• Körperliches Training / Training zu Hause• Physiotherapie• Ernährungsberatung• Psychosoziale Unterstützung• PatientenschulungenOsteoporose • Rauchstopp-Unterstützung• Alkoholreduktion oder -entwöhnung• Ermutigung zu körperlicher BetätigungKrebs • Psychosoziale Unterstützung <strong>und</strong> Beratung• Körperliche Aktivität <strong>und</strong> Entspannungstraining• Ernährungsberatung• Rauchstopp-Unterstützung• Beratung bei sexuellen Problemen• Unterstützung in der Kommunikation mit AngehörigenAuch andere AutorInnen (z.B. Johnson 2000, Mullen / Bartholomew 2000) führen Evidenzfür die Wirkung von Schulungs- <strong>und</strong> Trainingsmaßnahmen, also Maßnahmen im Bereichder HPH-Kernstrategie PAT-5, zur Verbesserung des Selbstmanagements bei PatientInnenmit chronischen Erkrankungen, insbesondere Asthma <strong>und</strong> Diabetes, an.Settingorientierte MaßnahmenDer Setting-Ansatz der Ges<strong>und</strong>heitsförderung rückt aber nicht nur die Wirkung vonDienstleistungen ins Zentrum des Evidenz-Interesses, sondern auch die Wirkungen desUmfeldes, in dem diese erbracht werden (HPH-Kernstrategie PAT-3). So meint Lethbridge(2000), dass Erkenntnisse aus der Psychoneuroimmunologie (d.h. Erkenntnisseüber Möglichkeiten zur gezielten Beeinflussung der Psyche als Mittel zur Verbesserungauch der körperlichen Ges<strong>und</strong>heit) in Zukunft das Design von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen<strong>und</strong> die Art der Leistungserbringung entscheidend prägen werden. In dieseRichtung weist z.B. auch die Studie „Dying in the dark“ von Beauchemin / Hays(1998) an 628 Herzinfarkt-PatientInnen. Die Studie ergab einen klaren Zusammenhangzwischen der Sonnigkeit eines Zimmers <strong>und</strong> dem klinischen Outcome: Sowohl Männer alsauch Frauen in den sonnigen Zimmern hatten eine geringere Mortalität, <strong>und</strong> bei Frauen insonnigen Räumen verkürzte sich der Aufenthalt signifikant. Die AutorInnen vermuten hiereinen Zusammenhang zwischen Licht, verbesserter psychischer Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> davonbeeinflusster körperlicher Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> ziehen den Schluss, dass die Qualität der Beleuchtungmöglicherweise eine wichtige Rolle in der Rehabilitation nach Herzinfarkt spielenkönnte.Das kalifornische Centre for Health Design hat 2004 die Metastudie „The Role of the PhysicalEnvironment in the Hospital of the 21st Century: A Once-in-a-Lifetime Opportunity“48
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenpubliziert (Ulrich et al. 2004), die auf Gr<strong>und</strong>lage von mehr als 600 Einzelstudienklare Zusammenhänge zwischen Stress <strong>und</strong> Sicherheit von PatientInnen <strong>und</strong>MitarbeiterInnen <strong>und</strong> dem Design einer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung aufzeigt. AufGr<strong>und</strong>lage der Ergebnisse werden in dem Dokument eine Reihe spezifischer Design-Empfehlungen zur Stressreduktion in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen formuliert. 2005 folgteauf Gr<strong>und</strong>lage der Forschungsergebnisse die Herausgabe einer Design-Scorecard, dieGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen bei der Setting-Entwicklung unterstützen soll (The Center forHealth Design 2005).MitarbeiterInnenDie Ges<strong>und</strong>heitsförderung für MitarbeiterInnen umfasst• die Unterstützung der MitarbeiterInnen im persönlichen Ges<strong>und</strong>heitsmanagementwährend der Arbeit (Strategie MIT-1)• die ges<strong>und</strong>heitsfördernde Weiterentwicklung der Leistungserbringung (Abläufe, Infrastrukturen– Strategie MIT-2)• Empowerment der MitarbeiterInnen zur Lebensstilentwicklung (Strategie MIT-5) <strong>und</strong>zum Krankheitsmanagement (Strategie MIT-4)• die Weiterentwicklung der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung zu einem ges<strong>und</strong>heitsförderlicherenUmfeld (Strategie MIT-3) <strong>und</strong>• Beiträge zur mitarbeiterorientierten Weiterentwicklung der Region (Strategie MIT-6).(vgl. Pelikan et al. 2006)Wirksamkeitsnachweise für Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderungAls wesentliche zu erwartende Wirkungen betrieblicher Ges<strong>und</strong>heitsförderung beschreibenSokoll / Kramer / Bödeker (2008) die Verbesserung von Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Wohlbefindenvon Beschäftigten am Arbeitsplatz <strong>und</strong> die Prävention arbeitsweltassoziierter Erkrankungen.In ihrer aktuellen Publikation „Wirksamkeit <strong>und</strong> Nutzen betrieblicher Ges<strong>und</strong>heitsförderung<strong>und</strong> Prävention“ geben sie im Sinne einer Metastudie einen Überblick überden Stand der BGF-Forschung. Die zugr<strong>und</strong>e liegenden Einzelstudien beziehen sich zwarauf Betriebe allgemein, schließen aber auch eine Anzahl von Studien aus Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenmit ein.Die AutorInnen schätzen die Evidenzlage für Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung alsgr<strong>und</strong>sätzlich sehr gut ein (Ausnahme: mangelnde Wirknachweise gibt es in den BereichenBetriebliche Alkoholprävention <strong>und</strong> Reduktion von Übergewicht). Demnachherrscht Konsens darüber, dass Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung (auch in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen)wesentlich zur Ges<strong>und</strong>erhaltung, Senkung von Ges<strong>und</strong>heitsrisiken <strong>und</strong>Krankheitshäufigkeiten von Beschäftigten beiträgt. Ebenso werden dadurch ges<strong>und</strong>heitsbewussteVerhaltensweisen gefördert. Und auch über den ökonomischen Nutzen herrschtEinigkeit in der Fachliteratur.Spezifische Wirksamkeitsnachweise gibt es für die folgenden Bereiche, die überwiegendden HPH-Kernstrategien MIT-4 (Krankheitsprävention) <strong>und</strong> MIT-5 (Lebensstilentwicklung)zugerechnet werden können:• Förderung der körperlichen Aktivität durch Bewegungsprogramme <strong>und</strong> durch motivierendeHinweistafeln (z.B. Aufforderung zur Nutzung von Treppen)• Änderung des Ernährungsverhaltens sowohl durch Beratung als auch durch Kantinenangebote• Gruppeninterventionen zur Raucherentwöhnung, wobei Belohnungssysteme dieTeilnahme an solchen Interventionen <strong>und</strong> damit die absolute Anzahl der hervorgehendenNichtraucherInnen steigern können• Rauchverbote als wirksames Mittel zum Nichtraucherschutz (aber nicht zumRauchstopp)• Kombination individueller <strong>und</strong> organisationsbezogener Maßnahmen zur Präventionpsychischer Erkrankungen49
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen• Spezifische körperliche Übungsprogramme zur Vorbeugung von Muskelskelett-ErkrankungenDie Mehrzahl der diesen Erkenntnissen zugr<strong>und</strong>e liegenden Studien behandelt rein verhaltensorientierteMaßnahmen. Dennoch kommen die AutorInnen aufgr<strong>und</strong> der vorliegendenLiteratur zum Schluss, dass die Kombination verhaltens- <strong>und</strong> verhältnispräventiverAnsätze (im Sinne der Strategie MIT-3) effektiver zur Betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderungbeiträgt als nur einer der beiden Ansätze.Was die Methodik der Betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung betrifft, so hat vor allem inDeutschland in den letzten Jahren der Ges<strong>und</strong>heitszirkel, ein Instrument, das im Sinneder partizipativen Gestaltung des Arbeitslebens der HPH-Kernstrategie MIT-2 zugerechnetwerden kann, weite Verbreitung gef<strong>und</strong>en. Zur Wirksamkeit dieses Instruments liegenzahlreiche Einzelstudien <strong>und</strong> Evaluationen vor, allerdings keine randomisierten Kontrollstudien.Obwohl die unterschiedlichen vorliegenden Studien dem Ges<strong>und</strong>heitszirkelsehr gute Wirksamkeit bescheinigen, ist also im strengen Sinne das Evidenzniveau fürdieses Verfahren gering (Sokoll / Kramer / Bödeker 2008).Regionale BevölkerungJe nach Perspektive umfasst die regionale Ges<strong>und</strong>heitsförderung durch Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen• Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zur Versorgung (insbesondere auch fürbenachteiligte Gruppen) (Strategie REG-1)• Maßnahmen zur Verbesserung von Kontinuität <strong>und</strong> Kooperation in der Versorgung(Strategie REG-2)• Allgemeine <strong>und</strong> spezifische Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen für die regionale Bevölkerung(„community health services“) (Strategien REG-5 <strong>und</strong> REG-4)• Maßnahmen zur Verbesserung der Ökologie von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (StrategieREG-3)• Beiträge zur ges<strong>und</strong>heitsfördernden Regionalentwicklung (Strategie REG-6)(vgl. Pelikan et al. 2006)Die erwarteten Wirkungen sind unterschiedlich: Sie reichen von verbesserten Ges<strong>und</strong>heitschancen(von benachteiligten Gruppen in) der regionalen Bevölkerung über die Entwicklungvon Kooperationsbeziehungen zwischen unterschiedlichen Versorgungseinrichtungenbis zur Etablierung umfassenden Umweltmanagements <strong>und</strong> zu ges<strong>und</strong>heitsförderndenAllianzen mit Einrichtungen aus anderen Sektoren in der Region.Wahrscheinlich handelt es sich bei Maßnahmen dieses Bereichs – auch aufgr<strong>und</strong> der großenVielfalt in Bezug auf die möglichen Interventionen <strong>und</strong> die beabsichtigten Wirkungen– um die am wenigsten untersuchten <strong>und</strong> daher auch mit der geringsten Evidenz belegtenaus dem Konzept „Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung“.Dennoch gibt es auch hier Wirknachweise für unterschiedliche Interventionen, wenn auchauf unterschiedlichen Evidenzniveaus. So belegen Projekte wie das EU-Projekt „MigrantFriendly Hospitals“, dass Krankenhäuser im Sinne der Kernstrategie REG-1 durch bestimmteMaßnahmen den Zugang für fremdsprachige PatientInnen erleichtern können(http://www.mfh-eu.net/public/home.htm). Wirksamkeit <strong>und</strong> Machbarkeit ökologischerEntwicklungen in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (Kernstrategie REG-3) sind etwa durch Umweltzertifzierungs-Verfahrenbelegt, <strong>und</strong> für Beiträge zur ges<strong>und</strong>heitsfördernden Regionalentwicklung(Strategie REG-6) gibt es zumindest Beispiele für erfolgreiche <strong>und</strong> evaluierteProjekte (siehe auch Kapitel 2.7 zur Initiative „Große schützen Kleine“ in dieser Publikation).50
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenWirksamkeitsnachweise für den Gesamtansatz„Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung“Aufgr<strong>und</strong> des umfassenden Konzeptes „Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung“,das alle mit der Einrichtung Befassten <strong>und</strong> von ihr Betroffenen berührt <strong>und</strong> alle ihreStrukturen <strong>und</strong> Prozesse betrifft, ist für die umfassende Umsetzung des HPH-Ansatzesein gesamtorganisatorischer Zugang erforderlich. Wie weiter oben ausgeführt, sind fürAnsätze der Organisationsentwicklung (OE) aufgr<strong>und</strong> der vielen unterschiedlichen Wirkfaktoren<strong>und</strong> der Schwierigkeit, ein Kontrollgruppendesign durchzuführen, kaum hoheEvidenzniveaus im Sinne der Evidenzbasierten Medizin zu erzielen.Aber es gibt Erfahrungen bereits aus den Anfängen des HPH (Wiener Modellprojekt, europäischesPilotkrankenhausprojekt), die auf Basis von Projektevaluationen die Machbarkeitvon HPH als organisationsumfassender Gesamtansatz belegen (vgl. z.B. Pelikan etal. 1998). Auch neuere Studien erlauben eine positive Einschätzung dieses Ansatzes (vgl.Tonnesen et al. 2005). Andere ExpertInnen wie Johnson (2000) weisen darauf hin, dasssich OE-Strategien, die sich in anderen Bereichen bewährt haben, nicht ohne Weiteresauf Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen übertragen lassen, weil deren Gr<strong>und</strong>kultur sich wesentlichvon anderen Organisationstypen wie z.B. Industriebetrieben unterscheidet: Bei Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenhandelt es sich um Expertenorganisationen, die u.a. durch fragmentierteLeistungserbringung, unklare gesamtorganisatorische Zielsetzungen <strong>und</strong> unterschiedlicheArten von Rollenkonflikten geprägt sind (vgl. Mintzberg 1997). In solchenEinrichtungen spielt professionelles Management traditionell eine vergleichsweise geringeRolle <strong>und</strong> wird u.U. sogar als Gefahr gesehen (vgl. Borchers / Iseringhausen 2008). DieEinführung neuer, zusätzlicher Ges<strong>und</strong>heitsförderungsleistungen erweist sich unter diesenBedingungen daher oftmals als praktikabler als die ges<strong>und</strong>heitsfördernde Weiterentwicklungdes Bestehenden, die langfristige Umsetzung scheitert dann aber z.T. an denentsprechenden Kompetenzen der Einrichtungen <strong>und</strong> an Finanzierungsmöglichkeiten.Zur Bearbeitung des Problems empfehlen ExpertInnen (z.B. Johnson 2000) die Veränderungder externen Rahmenbedingungen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen:So ist etwa bekannt, dass Finanzierungsströme die erbrachten Leistungen wesentlichbeeinflussen. Demnach wäre zu erwarten, dass die Möglichkeit, Ges<strong>und</strong>heitsförderungsleistungenin leistungsorientierten Finanzierungssystemen abrechnen zu können,zu einer entscheidenden Stärkung der Ges<strong>und</strong>heitsförderung führen würde (vgl. Tonnesenet al. 2007), <strong>und</strong> Johnson (2000) sieht in per-capita-finanzierten Ges<strong>und</strong>heitssystemendeutliche Vorzüge im Vergleich zu leistungsorientierten Finanzierungssystemen:Pauschbeträge pro Kopf motivieren Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen eher dazu, mit dem verfügbarenGeld – auch unter Einsatz von Ges<strong>und</strong>heitsförderung – den größtmöglichen Ges<strong>und</strong>heitsgewinnzu erzielen.LiteraturBeauchemin K.M., Hays P. (1999): Dying in the dark: sunshine, gender and outcomes inmyocardial infarction. In: Journal of the Royal Society of Medicine 91 (7), 352-354Borchers U., Iseringhausen O. (2008): Ges<strong>und</strong>heitsförderliche Organisationsgestaltung – Zur Reformder Expertenorganisation Krankenhaus: Hemmnisse <strong>und</strong> Perspektiven. Referat im Rahmendes Kongresses 2008 der Deutschsprachigen Medizin- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologen „Auf dem Wegzur Ges<strong>und</strong>heitsgesellschaft?“, 27.-29. März 2008, Bad GleichenbergCochrane A. (1972): Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health ServicesWise M., Nutbeam D. (2007): Enabling health systems transformation: what progress has beenmade in re-orienting health services? In: Promotion & Education, Supplement 2, 2007Goel W., McIsaac W. (2000): Health promotion in clinical practice. In: Poland B., Green L.W.,Rootman I. (Eds.) (2000): Settings for health promotion. Linking theory and practice. ThousandOaks: Sage, 217-23251
Kapitel 1 | Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagenJohnson J.L. (2000): The health care instituion as a setting for health promotion. In: Poland B.,Green L.W., Rootman I. (Eds.) (2000): Settings for health promotion. Linking theory and practice.Thousand Oaks: Sage, 175-198Lethbridge J. (2000): Commentary on Johnson J.L. (2000): The health care instituion as a settingfor health promotion. In: Poland B., Green L.W., Rootman I. (Eds.) (2000): Settings for healthpromotion. Linking theory and practice. Thousand Oaks: Sage, 199-206Mintzberg H. (1997): Toward Healthier Hospitals. In: Healthcare Management Review 22 (4), 9-18Mullen P.D., Bartholomew L.K. (2000): Commentary on Johnson J.L. (2000): The health careinstituion as a setting for health promotion. In: Poland B., Green L.W., Rootman I. (Eds.) (2000):Settings for health promotion. Linking theory and practice. Thousand Oaks: Sage, 206-216Pelikan J.M., Krajic K., Dietscher C. (2006): Putting HPH Policy into Action. Working Paper of theWHO Collaborating Centre on Health Promotion in Hospitals and Health Care. Vienna: LudwigBoltzmann Institute for the Sociology of Health and Medicine. (http://www.hphhc.cc/Downloads/HPH-Publications/wp-strategies-final.pdf;Zugriff am 03.07.2008)Sockoll I., Kramer I., Bödeker W. (2008): Wirksamkeit <strong>und</strong> Nutzen betrieblicher Ges<strong>und</strong>heitsförderung<strong>und</strong> Prävention. Essen: BKK B<strong>und</strong>esverband, iga.report 13 (http://www.igainfo.de/fileadmin/texte/iga_report_13.pdf,Zugriff am 03.07.2008)Tonnesen H., Christensen M.E., Groene O., O'Riordan A., Simonelli F., Suurorg L., Morris D., VibeP., Himel S., Hansen,P.E. (2007): An evaluation of a model for the systematic documentation ofhospital-based health promotion activities: results from a multicentre study. In: Bmc HealthServices Research (http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-7-145.pdf; Zugriff am03.07.2008)Tonnesen H., Fugleholm A., Jorgensen S.J. (2005): Evidence for health promotion in hospitals. In:Groene O., Garcia-Barbero M. (2005): Health promotion in hospitals: Evidence and qualitymanagement. Copenhagen: World Health Organization – Regional Office for EuropeTonnesen H. (2008): Evidence-based clinical health promotion. Referat im Rahmen der 16. InternationalenKonferenz Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen, 15.Mai 2008, BerlinThe Center for Health Design (2005): Scorecard for Evidence-Based Design. Concord, California:The Center for Health Design(http://www.healthdesign.org/research/reports/documents/scorecard_12_05.pdf, Zugriff am14.08.2008)Ulrich R., Quan X., Zimring C., Joseph A., Choudhary R. (2004): The Role of the Physical Environmentin the Hospital of the 21st Century: A Once-in-a-Lifetime Opportunity. Concord, California:The Center for Health DesignUNICEF (2008): The Baby Friendly Hospital Initiative(http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/baby.htm; Zugriff am 03.07.2008)Wimmer H., Pelikan J.M. (1984): Effekte psychosozialer Interventionen bei der prä- <strong>und</strong> postoperativenBetreuung von Patienten im Krankenhaus. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitssoziologieWise M., Nutbeam D. (2007): Enabling health systems transformation: what progress has beenmade in re-orienting health services? In: Promotion & Education Supplement 2 (2007), 23-2752
Kapitel 2 | Beispiele2Ges<strong>und</strong>heitsförderung inGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen umsetzen:Beispiele fürPatientInnen,MitarbeiterInnen,die regionale Bevölkerung <strong>und</strong> dieges<strong>und</strong>heitsfördernde Setting-Gestaltung53
Kapitel 2 | Beispiele2.1EinleitungChristina DIETSCHERDie Kapitel in Teil 2 dieser Broschüre thematisieren Möglichkeiten der Umsetzung vonGes<strong>und</strong>heitsförderung für unterschiedliche Zielgruppen <strong>und</strong> durch unterschiedliche AkteurInnenim Ges<strong>und</strong>heitswesen. Wie die Beschreibung der 18 Kernstrategien Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser <strong>und</strong> der fünf Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Teil1 nahe legt, können die Beispiele die Vielfalt der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungennur sehr begrenzt wiedergeben.Die aufgenommenen Beiträge beleuchten aber jeweils spezifische Zugänge der• Ges<strong>und</strong>heitsförderung für unterschiedliche Zielgruppen (Kapitel 2.2: Kinder <strong>und</strong>Jugendliche; Kapitel 2.3: geriatrische PatientInnen; 2.4: PatientInnen; 2.5: MitarbeiterInnen;Kapitel 2.7: Regionale Bevölkerung)• themenspezifischen Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung (Kapitel 2.5: Deeskalationsmanagement;Kapitel 2.7: Kindersicherheit; Kapitel 2.8: Rauchfreie Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen;Kapitel 2.9: Patientensicherheit)• Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Aufgabe unterschiedlicher Typen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(Kapitel 2.6: Frauenges<strong>und</strong>heitszentren; Kapitel 2.10: Trägereinrichtungen)Die aufgenommenen Beiträge wurden ausgewählt, weil sie entweder den Kriterien fürgute Praxis 18 genügen <strong>und</strong> / oder innovative Zugänge zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung mit Potenzialfür die Zukunft darstellen (wie z.B. der Ausbau der Kooperation mit Selbsthilfeeinrichtungenoder das Fach der Akutgeriatrie).Schließlich demonstrieren die Beispiele, dass zur Erreichung der Ziele der Ges<strong>und</strong>heitsförderungviele unterschiedliche, aus vielfältigen Hintergründen <strong>und</strong> Traditionen stammendeAnsätze <strong>und</strong> Instrumente beitragen können. In diesem Sinne ist Ges<strong>und</strong>heitsförderungals integratives Rahmenkonzept für Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen zu verstehen.18 Auf einem klaren Konzept beruhend, dokumentiert <strong>und</strong> evaluiert, bei der / den Zielgruppen akzeptiert, effektiv,effizient, transferiert, nachhaltig (vgl. Health Promotion for Children and Adolescents in & by Hospitals (Eds.,2007): Template for Description of Good Practice)54
Kapitel 2 | Beispiele2.2Ges<strong>und</strong>heitsförderung für Kinder <strong>und</strong> Jugendlicheim Ges<strong>und</strong>heitswesenPeter NOWAKEinleitungKinder <strong>und</strong> Jugendliche sind in zweierlei Hinsicht eine besondere Zielgruppe für Ges<strong>und</strong>heitsförderung:Kinder sind eine sehr verletzliche Bevölkerungsgruppe <strong>und</strong> für sie,als Heranwachsende, sind alle Impulse der Umwelt besonders prägend <strong>und</strong> langfristigwirksam. Letzteres gilt insbesondere für die Ges<strong>und</strong>heit von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<strong>und</strong> damit auch für Maßnahmen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Die Weltges<strong>und</strong>heitsorganisationhat daher in den letzten Jahren in mehreren Berichten <strong>und</strong> Strategiepapieren (WHO2005 a-d) auf die besondere Ges<strong>und</strong>heitssituation von Kindern aufmerksam gemacht. DieVerletzlichkeit dieser Gruppe hat auch zu internationalen Anstrengungen geführt, besondereRechte für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche zu formulieren <strong>und</strong> weltweit durchzusetzen.So wurde 1990 die „UN-Konvention über die Rechte des Kindes“ verabschiedet.(http://www.unis.unvienna.org/unis/de/library_2004kinderkonvention.html)Die internationalen Bestrebungen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung für Kinder <strong>und</strong> Jugendlichekonzentrierten sich zunächst auf den Bereich der Schule <strong>und</strong> führten zur Entwicklung vonNetzwerken „Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Schulen“ in vielen Staaten (so auch in Österreich, s.http://www.ges<strong>und</strong>eschule.at). 1995 führte die WHO diese unterschiedlichen Strategienin der „Global school health initiative“(http://www.who.int/school_youth_health/gshi/en/index.html) zusammen. Die besondereSituation, der sich Kinder <strong>und</strong> Jugendliche in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen gegenübersehen, wird im Ges<strong>und</strong>heitswesen seit vielen Jahren thematisiert <strong>und</strong> führtenicht zuletzt zu spezialisierten Einrichtungen der Kinder- <strong>und</strong> Jugendheilk<strong>und</strong>e. Die sehrdynamische Entwicklung in diesem Bereich (z.B. Rückgang der Geburtenrate, Zunahmedes Anteils von Kindern mit Migrationshintergr<strong>und</strong>) führt auch zu Reformanstrengungenim Ges<strong>und</strong>heitswesen (z.B. „Österreichischer Ges<strong>und</strong>heitsplan für Kinder“ 2005),die aber nur am Rande Fragen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung aufgreifen. Frühe Versuche dersystematischen Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung im stationären Bereich für dieseZielgruppe (Southall et al. 2000) waren zwar international sehr vernetzt, fanden in Österreichkaum Resonanz.Die internationale Task ForceVor diesem Hintergr<strong>und</strong> wurde im Rahmen des Internationalen Netzwerkes Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (HPH) im Jahr 2004 eine internationale„Task Force on Health Promotion for Children and Adolescents in & byHospitals and Health Services (HPH-CA)“(http://www.meyer.it/layHPH_duecolonne.php?IDCategoria=695) unter der Schirmherrschaftdes WHO gegründet, die sich der verstärkten Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungfür Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen im Krankenhaus – <strong>und</strong> zunehmend auch in anderenGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen – widmen sollte. Koordiniert wird die Task Force vom Ges<strong>und</strong>heitsförderungsteamdes A. Meyer University Children's Hospital 19 in Florenz. In derGruppe arbeiten ExpertInnen aus 12 europäischen Ländern zusammen (u.a. aus Österreich).19 Seit 2006 gleichzeitig auch “WHO Collaborating Centre for Health Promotion Capacity Building inChild and Adolescent Health”55
Kapitel 2 | BeispieleIn mehreren aufeinander bezogenen Arbeitspaketen entwickelt diese Task Force seitherGr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Umsetzungsstrategien der Ges<strong>und</strong>heitsförderung für Kinder<strong>und</strong> Jugendliche in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen. Im Besonderen liegen die Schwerpunkteder Arbeit auf der• Umsetzung von Kinderrechten in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen• Erhebung des Status Quo der Ges<strong>und</strong>heitsförderung für Kinder in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen• Sammlung <strong>und</strong> Entwicklung von „Modellen guter Praxis“• Entwicklung von Standards <strong>und</strong> Leitlinien für die Praxis(vgl. Abb. 2 unten)Abbildung 2: Arbeitsbereiche <strong>und</strong> Strategien von HPH-CADie Erarbeitung konzeptueller Gr<strong>und</strong>lagen erfolgte auf Basis einer ersten Literaturstudie(Aujoulat et al. 2006), welche die zentralen Bedürfnisse <strong>und</strong> Anliegen von Kinder <strong>und</strong>Jugendlichen in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen untersuchte <strong>und</strong> einen Überblick zu vorliegendenStrategien des ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Umgangs mit diesen Bedürfnissen gab. Einezweite Gr<strong>und</strong>lage war die enge Kooperation mit der „European Association forChildren in Hospitals“ (EACH), die erstmals 1988 eine „Charta für Kinder im Spital“(www.kind<strong>und</strong>spital.ch/charta-d.pdf) verabschiedet hat, die 2001 überarbeitet neu aufgelegtwurde.In einer europaweiten Fragebogen-Erhebung in über 100 Krankenhäusern bzw. Abteilungenfür Kinder- <strong>und</strong> Jugendheilk<strong>und</strong>e wurde erstmals der Status Quo zu Rechten vonKindern <strong>und</strong> Jugendlichen, zu Standards der Implementierung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung<strong>und</strong> zu laufenden Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen erhoben <strong>und</strong> analysiert (Simonelliet al. 2005). Die bisherigen Ergebnisse dieser Gr<strong>und</strong>lagenarbeit wurden 2007 in drei Publikationenzusammengefasst, die über die internationale Task Force erhältlich sind:• Backgro<strong>und</strong> Document : Eine Art Leitbild zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung von Kindern<strong>und</strong> Jugendlichen im Krankenhaus, in dem Definitionen <strong>und</strong> Ziele festgehalten sind.• Recommendations on Children´s Rights in Hospital: Ein Strategiepapier zurweiteren Verankerung der Rechte von Kinder n<strong>und</strong> Jugendlichen in Kinderspitälern<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssystemen• Template for Description of Good Practices: Ein Fragebogen zur Beschreibungvon erfolgreichen Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmodellen im Bereich der stationären Kinder<strong>und</strong>Jugendversorgung als erster Schritt für Austausch <strong>und</strong> Wissenstransfer zwischenPraktikerInnen56
Kapitel 2 | BeispieleÖsterreichische Initiativen zur Ges<strong>und</strong>heitsförderungvon Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen im Krankenhaus2004 wurde auf Initiative des Task Force-Leiters Fabrizio Simonelli (Florenz) die StadtWien <strong>und</strong> in Folge die Wiener Universitätsklinik für Kinder- <strong>und</strong> Jugendheilk<strong>und</strong>e(Univ.Prof. Dr. Irmgard Eichler; Univ.Prof. Dr. Klaus Arbeiter) als österreichische Vertretungin die Task Force eingeladen. Von 2005-2008 beteiligte sich auch das Ludwig BoltzmannInstitut für Medizin- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologie (Mag. Peter Nowak) als wissenschaftlicheBeratungsinstitution an der Task Force.Die erste aktive, österreichische Beteiligung an den internationalen Aktivitäten entstandüber die 2004-05 durchgeführte Status Quo-Erhebung zu Kinderrechten <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung,an der 16 österreichische Abteilungen für Kinder- <strong>und</strong> Jugendheilk<strong>und</strong>eteilnahmen. Die Stadt Wien (Bereichsleitung für Strukturentwicklung)unterstützte eine ergänzende Vollerhebung für die Wiener Einrichtungen. Die Erhebungsergebnissezeigten für die Wiener <strong>und</strong> österreichischen Kinderabteilungen iminternationalen Vergleich einen Nachholbedarf in der strukturellen Verankerung(Charta, Leitbild, Standards) der Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> der Rechte der Kinder. Beieinem sehr unterschiedlichen Antwortverhalten in der Vollerhebung der Wiener Abteilungenzeigt sich, dass hier relativ viele Ges<strong>und</strong>heitsförderungsaktivitäten durchgeführtwerden, aber fast ausschließlich für PatientInnen <strong>und</strong> Eltern. Es wurden nur sehr wenigeGes<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen für MitarbeiterInnen dokumentiert (vgl. Eichler / Nowak2006; Nowak / Eichler et al. 2005).Diese Ergebnisse waren nicht zuletzt ein wichtiger Impuls für die Bereichsleitung fürStrukturentwicklung der Stadt Wien, 2005 einen Schwerpunkt „Weiterentwicklungvon Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Kinderabteilungen“ im Rahmen des Wiener Informationsnetzwerkesfür Spitäler <strong>und</strong> Pflegeeinrichtungen (http://www.gspwieninfo.net)zu setzen. Als Auftakt des Schwerpunktes fand im Jänner 2006 ein Workshopmit den LeiterInnen aller Wiener Kinderabteilungen statt, um Möglichkeiten der Weiterentwicklungvon Ges<strong>und</strong>heitsförderung zu diskutieren. Ergebnis dieses Workshops wardie Einberufung einer Arbeitsgruppe bestehend aus 1-2 Delegierten aus jederWiener Kinderabteilung <strong>und</strong> mit dem Auftrag, Vorschläge für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmenin Wien zu entwickeln. In vier Workshops entwickelte diese Arbeitsgruppeaus einem breiten Spektrum von Maßnahmenvorschlägen <strong>und</strong> -ideen eine priorisierteListe von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen, die zu Jahresbeginn 2007 zur vordringlichenUmsetzung in Wien vorgeschlagen wurden. Die Vorschläge umfassen folgendePunkte:• Einbindung der Wiener Kinderabteilungen in das Deeskaltionsmanagement-Programm des Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>es (verbesserter Umgang mit Konflikten<strong>und</strong> Gewalt – vgl. dazu auch Kapitel 2.5 in dieser Broschüre)• Austausch von in Wien verwendeten Informationsangeboten über Ges<strong>und</strong>heits<strong>und</strong>Krankheitsmanagement für Kinder <strong>und</strong> Betreuungspersonen• Verbesserter Zugang zu Supervisionsangeboten für MitarbeiterInnen• Herausgabe, Drucklegung <strong>und</strong> Dissemination einer österreichischen Ausgabe derEACH-Charta für die Rechte von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen im Krankenhaus in Kooperationmit EACH, KiB children care (Österreichvertretung von EACH) <strong>und</strong> demBMGFJ.• Verbesserte Beratungsleistungen der Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend<strong>und</strong> Familie auf bzw. in Kooperation mit den Kinderabteilungen.Erste Ergebnisse liegen inzwischen vor, <strong>und</strong> die weitere Umsetzung wird von der Generaldirektiondes Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>es (KAV) unterstützt.57
Kapitel 2 | BeispieleEin erstes ResümeeDie hier berichteten Ges<strong>und</strong>heitsförderungsaktivitäten stehen im Zusammenhang mitdem Internationalen (<strong>und</strong> Wiener) Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen <strong>und</strong> repräsentieren nur einen kleinen Teil der tatsächlich inÖsterreich gesetzten Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen. So bietet z.B. die Webseite derÖsterreichische Gesellschaft für Kinder- <strong>und</strong> Jugendheilk<strong>und</strong>e(http://www.docs4you.at/Content.Node/Vorsorgemedizin/index.php) vielfältige Informationenzur Prävention für Kinder bzw. bieten alle Abteilungen (<strong>und</strong> Krankenhäuser) fürKinder- <strong>und</strong> Jugendheilk<strong>und</strong>e spezielle Informations- <strong>und</strong> Beratungsangebote im Bereichder Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> des Managements von chronischen Erkrankungen an. DieInitiative der Wiener Kinderabteilungen hat aber auch systematischen Weiterentwicklungsbedarfaufgezeigt:• Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Kinder- <strong>und</strong> Jugendabteilungen hängt am Engagementvon idealistischen Einzelpersonen <strong>und</strong> ist bisher kaum strukturell (z.B. durch klareAufgaben- <strong>und</strong> Ressourcenzuteilung in der Abteilung) verankert. Auch scheint dasEngagement für Ges<strong>und</strong>heitsförderung für die einzelnen MitarbeiterInnen wenig Anerkennung(etwa im Sinne einer Karriereplanung) nach sich zu ziehen.• Ges<strong>und</strong>heitsförderung für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche scheint vielerorts die Ges<strong>und</strong>heitsförderungfür MitarbeiterInnen in den Hintergr<strong>und</strong> zu stellen. Ges<strong>und</strong>heitsförderungkönnte hier zur zusätzlichen Belastung für die MitarbeiterInnen werden.• Jedenfalls in Hinblick auf patientenseitige Ges<strong>und</strong>heitsförderung scheint es ratsam,die besonderen Rahmenbedingungen der Abteilungen für Kinder- <strong>und</strong> Jugendheilk<strong>und</strong>edurch konkreten fachlichen Austausch <strong>und</strong> abteilungsübergreifende Kooperationaufzugreifen <strong>und</strong> zu unterstützen. Der abteilungsübergreifende Austauschzu Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen kann sehr anregend <strong>und</strong> hilfreich sein,ist aber bisher kaum realisiert <strong>und</strong> erfordert die systematische Unterstützung derKrankenhausträger.• Ges<strong>und</strong>heitsförderungsleistungen (insbesondere Beratung von jungen Eltern <strong>und</strong>chronisch erkrankten Kindern bzw. deren Eltern) sind wesentlicher Teil der Alltagsroutineder Kinder- <strong>und</strong> Jugendabteilungen, aber formell nicht (oder kaum) im Aufgabenprofil<strong>und</strong> Finanzierungsschema der Abteilungen abgesichert.• Für einige Ges<strong>und</strong>heitsförderungsinitiativen bieten sich übersektorale Kooperationenan (z.B. Kinder- <strong>und</strong> Jugendämter, Schulen), in denen die zentralen Ges<strong>und</strong>heitsförderungsleistungennicht in der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung erbracht werden.Die Initiierung <strong>und</strong> Weiterentwicklung dieser Kooperationen bedarf jedoch Aufmerksamkeit<strong>und</strong> Zeit vom Krankenhauspersonal.• Forschungsergebnisse zur Evidenz von Ges<strong>und</strong>heitsförderung für Kinder <strong>und</strong> Jugendlicheim <strong>und</strong> durch Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen liegen kaum vor (weder in Österreichnoch international).Auch ohne ausreichende Evidenz scheint jedoch das Engagement für Ges<strong>und</strong>heitsförderungfür Kinder <strong>und</strong> Jugendliche in Kinderabteilungen sinnvoll <strong>und</strong> notwendig, aber stecktnoch in den Kinderschuhen!LiteraturAujoulat, I.; Simonelli, F.; Deccache, A. (2006): Health promotion needs of children andadolescents in hospitals: A review. In: Patient Education and Counseling, 61, 1, S. 23-32.Eichler, I.; Nowak, P. (2006): Exploratory survey on health promotion activities carried out inchildren's hospitals and paediatric departments in Vienna. Palanga. (Posterpresentation at the14thInternational Conference HPH)Nowak, P.; Eichler, I.; Griebler, R.; Schmied, H. (2005): Ersterhebung zur Verankerung von Rechtender Kinder <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung in österreichischen Kinderabteilungen. St.Pölten.(Posterpräsentation auf der 43. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- <strong>und</strong>Jugendheilk<strong>und</strong>e)58
Kapitel 2 | BeispieleNowak, P.; Schmied, H. (2007): Template for Description of Good Practices. Florence: HPH TaskForce on Health Promotion for Children and Adolescents in & by Hospitals (HPH-CA)Simonelli, F.; Majer, K.; Pinilla, M. J. C.; Teodori, C.; Iannello, T. (Hg.)(2005): Health Promotionfor Children and Adolescents in Hospital (HPH-CA). Backgro<strong>und</strong> Survey. Florence: HPH WorkingGroup on Health Promotion for Children and Adolescentes in Hospital.Simonelli, F.; Majer, K.; Pinilla, M. J. C. (2007): Backgro<strong>und</strong> document. Florence: Health Promotionfor Children and Adolescents in & by Hospitals (HPH-CA).Simonelli, F.; Majer, K.; Pinilla, M. J. C.; Filippazi, G. (2007): Recommendations on Children'sRights in Hospital. Knowing and respecting the rights of children in hospital. Florence: HealthPromotion for Children and Adolescents in & by Hospitals (HPH-CA).Southall, D. P.; Burr, S.; Smith, R. D.; Bull, D. N.; Radford, A.; Williams, A.; Nicholson, S. (2000):The Child-Friendly Healthcare Initiative (CFHI): Healthcare Provision in Accordance With the UNConvention on the Rights of the Child. In: Pediatrics, 106, 5, S. 1054-1064.WHO (2005a): Mental Health Policy and Service Guidance Package : Child and Adolescent MentalHealth Policies and Plans. Genf: World Health Organization.WHO (2005b): Pocket book of hospital care for children: guidelines for the management ofcommon illnesses with limited resources. Genf: World Health Organization.WHO (2005c): The European health report 2005. Public health action for healthier children andpopulations. Copenhagen: WHO Europe.WHO (2005d): European strategy for child and adolescent health and development. Copenhagen:WHO Europe.59
Kapitel 2 | Beispiele2.3Anschlüsse der Ges<strong>und</strong>heitsförderung an dieAkutgeriatrieInterview mit Primaria Dr. Ulrike SOMMEREGGER, KH der Stadt Wien HietzingEinleitungDemografische Veränderungen sind einer der wesentlichen Motoren für die (Weiter-)Entwicklung medizinischer Disziplinen. So haben die steigende Lebenserwartung <strong>und</strong> derimmer größere Anteil alter <strong>und</strong> hochbetagter Menschen an der Gesamtbevölkerung zurAusdifferenzierung des Fachs der Akutgeriatrie 20 <strong>und</strong> Remobilisation beigetragen,das in der Planung des österreichischen Ges<strong>und</strong>heitswesens – als Department oder Abteilungder Inneren Medizin oder Neurologie – erstmals im Österreichischen Krankenanstaltenplan1999 Erwähnung findet <strong>und</strong> dessen weiterer Ausbau im Österreichischen StrukturplanGes<strong>und</strong>heit (BMGF 2006) vorgesehen ist.Zielgruppe sind geriatrische PatientInnen, bei denen folgende Kriterien vorliegen:• Somatische oder psychische Multimorbidität, die eine stationäre Akutbehandlung erforderlichmacht.• Einschränkung oder Bedrohung der Selbständigkeit durch den Verlust funktioneller<strong>und</strong> gegebenenfalls kognitiver Fähigkeiten oder durch psychische Probleme im Rahmeneiner Erkrankung.• Bedarf nach funktionsfördernden, funktionserhaltenden oder reintegrierenden Maßnahmen.(B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen 2007)Hauptziele der Behandlung sind die Erhaltung von Körperfunktionen <strong>und</strong> Lebensqualitätsowie die Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Selbständigkeit <strong>und</strong> dieReintegration in das eigene Lebensumfeld.Damit ist die Akutgeriatrie aus zumindest zwei Gründen hoch anschlussfähig an Ges<strong>und</strong>heitsförderung:Zum einen, weil sie sich einer besonders vulnerablen Gruppevon PatientInnen mit hohem Hospitalismusrisiko 21 annimmt. Zum anderen, weil sie– vielleicht stärker als andere medizinische Disziplinen – ganz im Sinne des Empowermentkonzeptesder Ges<strong>und</strong>heitsförderung neben bestmöglicher medizinischer,pflegerischer <strong>und</strong> therapeutischer Versorgung wesentlich auf Hilfe zur Selbsthilfe baut.So ist es vielleicht kein Zufall, dass die Ansprechperson für Ges<strong>und</strong>heitsförderung amKrankenhaus der Stadt Wien Hietzing, Frau Primaria Dr. Ulrike Sommeregger, als Abteilungsvorständinfür Akutgeriatrie tätig ist. In einem für die vorliegende Broschüre geführtenInterview äußerte sie sich zum Stellenwert von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in dieser Disziplin– für die PatientInnen, aber vor allem auch für die MitarbeiterInnen, die in diesemFeld besonderen Belastungen ausgesetzt sind.20 Der Österreichische Strukturplan Ges<strong>und</strong>heit (BMGF 2006) definiert die Akutgeriatrie wie folgt: „FächerübergreifendePrimärversorgung direkt aufgenommener geriatrischer Patientinnen <strong>und</strong> Patienten sowie Weiterführungder Behandlung akutkranker geriatrischer Patientinnen <strong>und</strong> Patienten aus anderen Abteilungen (Fachbereichen)durch geriatrisch qualifiziertes, interdisziplinäres Team <strong>und</strong> durch multidimensionales Behandlungs- <strong>und</strong> Betreuungsangebot(unter Beachtung medizinischer, funktioneller, psychischer, kognitiver <strong>und</strong> sozialer Aspekte derErkrankungen geriatrischer Patientinnen <strong>und</strong> Patienten).21 Hospitalismus bezeichnet die negativen körperlichen <strong>und</strong> seelischen Begleitfolgen längerer Krankenhaus- oderHeimaufenthalte. Besonders betroffen sind Babys, Kinder <strong>und</strong> alte Menschen (vgl. WIKIPEDIAhttp://de.wikipedia.org/wiki/Hospitalismus, Zugriff am 04.07.2008)60
Kapitel 2 | BeispieleInterview mit Prim. Dr. Ulrike Sommeregger, Krankenhaus der Stadt WienHietzingFrau Primaria, welche Rolle spielt Ges<strong>und</strong>heitsförderung für akutgeriatrische PatientInnen?Ges<strong>und</strong>heitsförderung stellt eigentlich den Schwerpunkt unserer Tätigkeit dar.Unser Hauptziel ist ja neben der medizinischen Behandlung der akuten Erkrankungen dieFörderung <strong>und</strong> der Erhalt bzw. die größtmögliche Wiederherstellung der Selbstständigkeitbzw. der Lebensqualität. Dabei hat die Kommunikation mit den PatientInnen einenbesonders hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, die persönlichen Entscheidungenälterer Menschen zu akzeptieren, auch, wenn diese Entscheidungen manchmal unvernünftigerscheinen. Die Grenze ziehen wir erst bei offensichtlicher Unfähigkeit, die Realitätzu erfassen. Bei dieser Beurteilung hilft auch das geriatrische Assessment <strong>und</strong> diegemeinsame Beurteilung im interdisziplinären Team.Welche Rolle spielt die Kooperation mit den Angehörigen?Die ist sehr wichtig: Eine Außenanamnese mit Angehörigen ist unerlässlich, um den Gesamtkontextder PatientInnen einschätzen zu können. Ein anderer wichtiger Aspekt istdie Überzeugungs- <strong>und</strong> Motivationsarbeit bei Angehörigen: Ich biete einmal wöchentlicheinen Sprechtag an, denn oft wird eine Empfehlung, die von einer höheren Hierarchieebenekommt, besser akzeptiert <strong>und</strong> angenommen, auch wenn KollegInnen genaudie gleiche Empfehlung aussprechen. Vor allem geben solche Gespräche Orientierung <strong>und</strong>nehmen die Angst.Und wie sieht es mit der Ges<strong>und</strong>heitsförderung für die MitarbeiterInnen aus?Die Erfahrung zeigt, dass die Geriatrie ein Bereich für reife Persönlichkeiten ist.Junges Pflegepersonal hat teilweise Schwierigkeiten mit dem physisch <strong>und</strong> psychischbesonders belastenden Klientel der Akutgeriatrie. Auch die Fluktuation ist in unseremBereich bei jungen MitarbeiterInnen deutlich höher als bei älteren. Ein Personalstockan älteren MitarbeiterInnen ist hier notwendig. Da ist es natürlich eine besondereHerausforderung, die Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen zu erhalten.Das ist einerseits Thema der Personalplanung <strong>und</strong> -entwicklung, andererseits benötigteine solche Belegschaft auch im Hinblick auf Ges<strong>und</strong>heitsförderung besondere Aufmerksamkeit.Viele MitarbeiterInnen bringen „Vorschäden“ (z.T. irreversible Schädigungen derWirbelsäule usw.) aus früheren Beschäftigungen (wie der Altenpflege) mit. Ein weitererwichtiger Aspekt ist eine gute Teambildung, die wiederum zu Motivation beiträgt <strong>und</strong> dahersicherlich auch als ges<strong>und</strong>heitsförderliche Maßnahme zu werten ist. In einem gutenTeam ist sich jedes Mitglied seiner Rolle <strong>und</strong> seiner Verantwortung bewusst. Eine guteTeambildung ist natürlich eine Führungsfrage, hier ist insbesondere die Stationsleitunggefragt.Die Atmosphäre am Arbeitsplatz sowie die erlebte Sinnhaftigkeit der Arbeit <strong>und</strong> das Gefühldes eigenen Beitrags zum Ganzen sind von großer Bedeutung. Auch ein guter Informations-<strong>und</strong> Kommunikationsfluss ist Gr<strong>und</strong>voraussetzung für eine gelingendeZusammenarbeit.Besonders wichtig erscheint auch immer wieder der Umgang mit Konflikten <strong>und</strong> Fehlern.Hier sind besonders die Führungskräfte aller Ebenen gefragt <strong>und</strong> zu einer gutenEinschätzung von Situationen sowie einer aktiven Beeinflussung aufgefordert. Aber auchdie einzelnen MitarbeiterInnen werden dazu ermutigt, Konflikte offen anzusprechen.Was sind Ihrer Meinung nach wichtige Voraussetzungen für die Weiterentwicklung derGes<strong>und</strong>heitsförderung im Spitalswesen? Wo liegen die Knackpunkte?Die Führung (auf höchster Ebene) muss hinter diesem Konzept stehen, eine Top DownStruktur ist unerlässlich, denn hier werden schließlich die Entscheidungen getroffen.61
Kapitel 2 | BeispieleFür unser Haus war die Aufnahme von Ges<strong>und</strong>heitsförderung ins Leitbild desWiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>es eine entscheidende Maßnahme. Dadurch gibtes nun offizielle Beauftragte für Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> auch ein Mitglied der KollegialenFührung muss sich mit dem Thema Ges<strong>und</strong>heitsförderung befassen. Das unterstütztdie Weiterentwicklung natürlich sehr.Das bedeutsamste Argument für Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Spital ist meiner Ansichtnach die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen. Längere Ausfällebelasten immer auch das unmittelbare Umfeld stark <strong>und</strong> wirken unter Umständenals Multiplikator für andere Belastungssituationen. Auch den damit einhergehendenKnow-How Verlust kann sich niemand leisten.Vielen Dank für das Gespräch.LiteraturB<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen (Hg.) (2006): Österreichischer Strukturplan Ges<strong>und</strong>heit2006 – ÖSG 2006 (inklusive Großgeräteplan). Wien: B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit<strong>und</strong> Frauen(http://bmgf.cms.apa.at/cms/site/attachments/1/0/1/CH0716/CMS1136983382893/oesg2006_280606.pdf; Zugriff am 04.07.2008)B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen (Hg.) (2007): Leistungsorientierte KrankenanstaltenfinanzierungLKF – Modell 2007. Wien: B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen(http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/2/9/3/CH0719/CMS1159517964510/modell_2007.pdf; Zugriff am 04.07.2008)62
Kapitel 2 | Beispiele2.4Patientenselbsthilfe <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderungInterview mit Mag. Monika MAIER, Sprecherin der ARGE Selbsthilfe ÖsterreichEinleitungEin wesentliches Ziel der Ges<strong>und</strong>heitsförderung für PatientInnen ist deren Befähigung,mit den eigenen Ges<strong>und</strong>heitsproblemen möglichst kompetent umzugehen: Diesverbessert nachweislich klinische Outcomes <strong>und</strong> Lebensqualität <strong>und</strong> verhindert ungeplanteWiederaufnahmen (vgl. auch Kapitel 1.4 zur Evidenz von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in dieserBroschüre).Zur Erreichung von Ges<strong>und</strong>heitskompetenz kann neben qualitativ hochwertiger professionellerUnterstützung natürlich auch die Selbsthilfe wesentlich beitragen. So sagtBobzien (2007), dass der Aktivierung von Selbsthilfekräften bei PatientInnen eine salutogeneWirkung zugeschrieben wird, da dadurch persönliche <strong>und</strong> soziale Ges<strong>und</strong>heitsressourcengestärkt werden. Selbsthilfeorganisationen sind aus dieser Perspektive alswichtige mögliche Partner Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenanzusehen. Die enge Verbindung zwischen Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Selbsthilfe zeigtsich in Österreich auch dadurch, dass das österreichweite Projekt SIGIS 22 (Service <strong>und</strong>Information für Ges<strong>und</strong>heitsinitiativen <strong>und</strong> Selbsthilfeorganisationen) beim Fonds Ges<strong>und</strong>esÖsterreich angesiedelt ist.Obwohl es einzelne Ansätze <strong>und</strong> Projektbeispiele für Kooperationen zwischen Ges<strong>und</strong>heitsförderndenGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen <strong>und</strong> Selbsthilfe gibt, wurde dennoch wederinternational noch in Österreich bisher am Aufbau einer systematischen, umsetzungsorientiertenKooperation Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenmit Selbsthilfeorganisationen gearbeitet, sodass in diesem Bereich Entwicklungspotenzialefür die Zukunft liegen.Ein mögliches Bindeglied zwischen Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Selbsthilfe in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenstellt das Qualitätssiegel „Selbsthilfefre<strong>und</strong>liches Krankenhaus“dar, das von KISS Hamburg 23 im Rahmen eines Modellprojekts entwickeltwurde. Es definiert acht Qualitätsbereiche der Selbsthilfefre<strong>und</strong>lichkeit:1. Bereitstellen von Räumen, Infrastruktur <strong>und</strong> Präsentationsmöglichkeiten für Selbsthilfegruppen2. Routinemäßige Information der PatientInnen bzw. ihrer Angehörigen über die Möglichkeitzur Teilnahme an Selbsthilfegruppen3. Unterstützung von Selbsthilfegruppen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit4. Benennung eines / einer Selbsthilfebeauftragten im Krankenhaus5. Regelmäßiger Informations- <strong>und</strong> Erfahrungsaustausch zwischen Selbsthilfegruppe(n)<strong>und</strong> Krankenhaus6. Selbsthilfegruppen sind in die Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung der MitarbeiterInnen zumThema Selbsthilfe einbezogen7. Selbsthilfegruppen haben die Möglichkeit zur Mitwirkung an Qualitätszirkeln, Ethikkommissionen<strong>und</strong> Ähnlichem8. Kooperationen mit Selbsthilfegruppen beruhen auf formalen, dokumentierten BeschlüssenAn der Entwicklung eines Gütesiegels „Selbsthilfefre<strong>und</strong>liches Krankenhaus“ arbeitet auchdie Selbsthilfe Kärnten (vgl. Selbsthilfe Kärnten 2006), deren Geschäftsführerin <strong>und</strong>22 http://www.fgoe.org/aktivitaeten/selbsthilfe/selbsthilfe?set_language=de&cl=de (Zugriff am 04.07.2008)23 Kontakt- <strong>und</strong> Informationsstellen für Selbsthilfegruppen in Hamburg – siehe http://www.kiss-hh.de/ (Zugriff am04.07.2008)63
Kapitel 2 | BeispieleSprecherin der ARGE Selbsthilfe Österreich, Mag. Monika Maier, für diese Broschüre einInterview zum Stellenwert der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in der Selbsthilfe gab.Interview mit Mag. Monika Maier (Sprecherin der ARGE Selbsthilfe Österreich)Frau Mag. Maier, was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichsten Beiträge der Ges<strong>und</strong>heitsförderungzur Selbsthilfe – <strong>und</strong> umgekehrt?In der Allgemeinbevölkerung wird Ges<strong>und</strong>heitsförderung oft mit Prävention gleichgesetzt,<strong>und</strong> das zeigt, dass das Konzept einfach noch nicht an der Basis angekommenist. Entsprechend wird Ges<strong>und</strong>heitsförderung auch in den Selbsthilfegruppen noch wenigberücksichtigt – es herrscht die Ansicht vor „Das betrifft uns nicht, wir sind ja schließlichschon krank“: Die ges<strong>und</strong>en Anteile, die es natürlich auch bei kranken Menschen gibt,werden oft gar nicht wahrgenommen bzw. wird die Ressourcenstärkung, die in derSelbsthilfe geleistet wird, nicht als Ges<strong>und</strong>heitsförderung verstanden.Auf der Ebene der Dachverbände der Selbsthilfegruppen, die ja eine wichtige Interessenvertretungsind, werden aber klassische Aufgaben der Ges<strong>und</strong>heitsförderungim Sinne von Befähigung <strong>und</strong> Ermächtigung wahrgenommen.Wie sehen Sie die Rolle der Selbsthilfe im Krankenhaus?Im Krankenhaus werden Projekte für PatientInnen gemacht, jedoch zu wenig mit PatientInnen,die ihren Bedarf ja eigentlich am besten kennen, ohne aber selbst Anbieter zusein. Besonders chronisch Kranke kennen sich im System oft sehr gut aus <strong>und</strong>kennen eben auch die Lücken. Die Einbeziehung der PatientInnen in die Gestaltungder Angebote ist aber sowohl für die einzelnen PatientInnen als auch für das System einegroße Herausforderung. Denn Partizipation braucht entsprechende Rahmenbedingungen,setzt u.a. ausreichende Informationen voraus (z.B. für Patientenvertretungen inGremien). Ohne diese Information spielt die Patientenvertretung nur eine Alibirolle.Welche Verbesserung der Kooperation mit Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen würden Sie sichwünschen?Ich wünsche mir einen strukturierten Erfahrungs- <strong>und</strong> Informationsaustausch, wieer ja auch im Gütesiegel „Selbsthilfegruppenfre<strong>und</strong>liches Krankenhaus“ angelegt ist -vom Nebeneinander zum Miteinander. Dafür braucht es Sensibilisierung für das Thema,Beziehungsarbeit <strong>und</strong> Information wichtiger Partner, zum Beispiel von Turnusärzten. Etwaauch die Einbeziehung von PatientenvertreterInnen in Qualitätsgremien <strong>und</strong> natürlichin die Entwicklung von Projekten, die für PatientInnen gemacht werden.Eine andere gute Möglichkeit ist, PatientInnen in Informationsveranstaltungen zu bestimmtenThemen einzubeziehen: Fachinformationen zum Beispiel über Schlaganfallfindet man ja heute überall, aber Erfahrungsberichte eher nicht. Da wären PatientInnenwirklich eine Ressource, das wäre dann Ges<strong>und</strong>heitsförderung, die an der Basisansetzt, weil nicht nur Fachinformation vermittelt würde, sondern Information überden Umgang mit der Krankheit im Alltag. Und damit könnte man auch ein positives Bildvermitteln: Man kann sehen, wie es gelingt, trotz einer Krankheit seinen Alltag <strong>und</strong> seinLeben zu gestalten. Dadurch kann man Menschen befähigen, sich aktiv mit ihrer Krankheitauseinander zu setzen.Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit <strong>und</strong> gegenseitigen Unterstützung von Selbsthilfe<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsfördernden Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen schienen Ihnen sinnvoll?Zunächst einmal ist es wichtig zu sehen, dass aktive PatientInnen einen Benefit fürGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen darstellen. Das kann auch zu einer verbesserten Effizienzder Leistungserbringung führen.64
Kapitel 2 | BeispieleUm dies zu erreichen, sollten Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungengenerell einen stärkeren Fokus auf Patientenorientierung legen <strong>und</strong> eine aktivePatientenrolle unterstützen <strong>und</strong> akzeptieren. Eine Möglichkeit wäre sicherlich auch, dasGütesiegel „Selbsthilfegruppenfre<strong>und</strong>liches Krankenhaus“ aufzugreifen <strong>und</strong> dessen Inhaltezu leben.Frau Magister, vielen Dank für das Gespräch.LiteraturBobzien M. (2007): Qualitätssiegel Selbsthilfefre<strong>und</strong>liches Krankenhaus – die Zusammenarbeit mitSelbsthilfe systematisch entwickeln. In: Public Health Forum 15 (55), 25.e1-25.e3Selbsthilfe Kärnten – Dachverband für Selbsthilfeorganisationen im Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsbereich,Behindertenverbände <strong>und</strong> -organisationen (2006): Jahresbericht 2006. (www.selbsthilfekaernten.at/.../media/archive1/Selbsthilfe-Jahresberichte/&file=Jahresbericht_2006.pdf;Zugriffam 04.07.2008)65
Kapitel 2 | Beispiele2.5Aggressions-, Gewalt- <strong>und</strong>DeeskalationsmanagementEin Projekt der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong> 24Harald STEFANAusgangpunktIn den vergangenen Jahren ist das Thema Aggression <strong>und</strong> Gewalt im Ges<strong>und</strong>heitswesenimmer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit innerhalb der Gesellschaft<strong>und</strong> der Fachöffentlichkeit gelangt. Verschiedene Untersuchungen zur Thematik habengezeigt, dass es im Ges<strong>und</strong>heitsdienst immer wieder zu Übergriffen kommt. Dabei spielenvielfältige Einflussfaktoren, die nur bedingt vorhersehbar sind, eine Rolle. In zunehmendemMaße gehen die im Ges<strong>und</strong>heitswesen Tätigen offen <strong>und</strong> bewusst mit diesemPhänomen um <strong>und</strong> suchen nach geeigneten theoretischen Konzepten <strong>und</strong> Handlungsansätzen.Analysen haben nachgewiesen, dass das Leugnen <strong>und</strong> der vermeidende Umgang nicht zueinem professionellen Umgang mit dem Phänomen Aggression <strong>und</strong> Gewalt beitragen 25 .Aber selbst bei einem offenen, prophylaktischen Umgang mit der Thematik lassen sichgewalttätige Übergriffe nicht immer vermeiden. Verschiedene Studien 26 zeigen, dass Aggression<strong>und</strong> Gewalt zu den strukturellen Gegebenheiten an Arbeitsplätzen imGes<strong>und</strong>heitswesen gehören. Deswegen ist es notwendig, alle MitarbeiterInnen inEinrichtungen des Ges<strong>und</strong>heitswesens im professionellen Umgang mit Aggression,Gewalt <strong>und</strong> Deeskalationsmanagement zu schulen. Ein effizienter Weg dahinsind verbindliche interne Schulungen für alle MitarbeiterInnen (multiprofessionellerAnsatz). In diesen Schulungen müssen interaktive, kommunikative <strong>und</strong> körperliche Fertigkeitenvermittelt werden, die dann im beruflichen Alltag angewendet werden können.Durch ein systematisches Training werden auf der persönlichen Ebene die Selbstsicherheit<strong>und</strong> die subjektive Sicherheit der geschulten MitarbeiterInnen verbessert. Aufder organisatorischen Ebene werden insgesamt Wahrnehmung, Sensibilität <strong>und</strong> Sicherheitin den Institutionen verbessert, so dass Kommunikations- <strong>und</strong> Körpertechnikengezielt <strong>und</strong> angemessen eingesetzt werden.Aggression <strong>und</strong> Gewalt sind Phänomene, die die MitarbeiterInnen aller Berufsgruppen imGes<strong>und</strong>heitswesen betreffen, wenn auch auf unterschiedlichen Hierarchieebenen in unterschiedlicherForm. Aggressions- <strong>und</strong> Sicherheitsmanagement ist nur dann wirksam,wenn alle Berufsgruppen <strong>und</strong> alle Ebenen daran aktiv beteiligt sind. Sollteder Einsatz von körperlichen Interventionen notwenig werden, kommen Techniken zurAnwendung, die die aggressive / gewalttätige Person weder verletzen, noch ihr körperlicheSchmerzen zufügen <strong>und</strong> dennoch wirkungsvoll sind. Diese Techniken müssen von derMehrheit der MitarbeiterInnen leicht erlernt <strong>und</strong> angewendet werden können.Bei körperlichen Interventionen stehen immer die Sicherheit der MitarbeiterInnen<strong>und</strong> die Sicherheit der PatientInnen / Klienten gleichermaßen im Mittelpunkt.Die Sorge für die PatientInnen ist das zentrale Element der Deeskalation. Dasheißt, das Eingreifen zielt immer darauf ab, den Kontakt <strong>und</strong> die Kommunikation zuPatientInnen / KlientInnen aufrecht zu erhalten bzw. schnellstmöglich wiederherzustellen.Dabei ist die Sensibilität für die Kontinuität der Arbeitsbeziehung bzw. dertherapeutischen Beziehung von zentraler Bedeutung.24 Auftraggeberin des Projektes ist Frau Gen.Oberin Charlotte Staudinger (KAV), die Projektleitung liegt bei HaraldStefan, MSc, Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe, Wien.25 Yehuda, Rachel: “Risk Factors for Posttraumatic Stress Disorder”, American Psychiatric Press, WashingtonDC, 199926 Siehe Literatur66
Kapitel 2 | BeispieleAusbildung zur TrainerIn für Aggressions-, Gewalt- <strong>und</strong>DeeskalationsmanagementWir sind davon überzeugt, dass die Ausbildung von TrainerInnen für Aggressions-, Gewalt-<strong>und</strong> Deeskalationsmanagement nach den geschilderten Prinzipien <strong>und</strong> folgerichtigdie Etablierung von systematischem Aggressions- <strong>und</strong> Sicherheitsmanagement in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungeneinen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Versorgungsqualität,Sicherheit <strong>und</strong> Zufriedenheit der PatientInnen <strong>und</strong> MitarbeiterInnenhaben wird.Ziele der TrainerausbildungDie Ausbildung zum internen Trainer für Aggressionsmanagement zielt darauf ab, MitarbeiterInnenso auszubilden, dass sie in der Lage sind, in ihrer Einrichtung als TrainerIn<strong>und</strong> BeraterIn zum Themenkomplex Deeskalationsmanagement zu arbeiten. Dies beinhaltet,gemeinsam mit ihrer Einrichtung Konzepte <strong>und</strong> Strategien zu entwickeln,um sowohl innerhalb einer Institution Schulungen <strong>und</strong> Basiskurse in Aggressions-, Gewalt-<strong>und</strong> Deeskalationsmanagement durchführen zu können, als auch ihr erworbenesWissen <strong>und</strong> ihre Erfahrung zur Beratung der KollegInnen <strong>und</strong> zur Entwicklung von Sicherheits-<strong>und</strong> Aggressionsmanagement in der Institution einzubringen.Die erworbenen Handlungskompetenzen umfassen alle drei Aspekte von Gewaltsituationen,nämlich1. Prävention,2. Krisenbewältigung <strong>und</strong>3. Nachsorge / Nachbereitung.Theoretischer Hintergr<strong>und</strong>Das Ausbildungsprogramm orientiert sich an internationalen Ausbildungsrichtlinienfür Aggressionsmanagementprogramme, v. a. an in Großbritannien entwickeltenKonzepten <strong>und</strong> Standards (Royal College of Nursing Institute [RCNI] <strong>und</strong> English NationalBoard [ENB] in Zusammenarbeit mit dem Department of Nursing der Keele University;Standards des UKCC jetzt NMC [Nursing and Midwifery Council], NIMHE [NationalInstitute for Mental Health England]).Vermitteltete Wissensinhalte der Trainerausbildung sind Theorien <strong>und</strong> Modelle zur Entstehung<strong>und</strong> zum Verlauf von Aggressionen, Modelle der Krisenkommunikation, Fakten<strong>und</strong> wissenschaftliche Untersuchungen zum Phänomen Aggression <strong>und</strong> Gewalt im Ges<strong>und</strong>heitswesen,rechtliche Aspekte, Erfassungs- <strong>und</strong> Einschätzungsinstrumente sowieKonzepte <strong>und</strong> Strategien zu Prävention, Krisenmanagement <strong>und</strong> Nachsorge.Reflexion <strong>und</strong> Selbstwahrnehmung sowie Auseinandersetzung mit der eigenen Gr<strong>und</strong>haltung<strong>und</strong> der zukünftigen Rolle des / der TrainerIn <strong>und</strong> BeraterIn sind weitere wichtigeAusbildungsinhalte.Die Körpertechniken zum Selbstschutz <strong>und</strong> zur Kontrolle von Personen stammen zum Teilaus den in Großbritannien entwickelten Control & Restraint <strong>und</strong> MAPA (siehe oben: Lehrgangder Keele University) <strong>und</strong> aus dem AIKIDO <strong>und</strong> wurden zu möglichst sanften, abersicheren Techniken weiterentwickelt. Die Körpertechniken werden immer zusammen mitden Kommunikationstechniken gesehen, d.h. das In-Kontakt-bleiben <strong>und</strong> das Erreichendes Gegenüber stehen immer im Mittelpunkt. Didaktische Aspekte bzgl. Präsentation,Wissensvermittlung <strong>und</strong> Umgang mit KursteilnehmerInnen sind in die Ausbildungsmoduleintegriert.67
Kapitel 2 | BeispieleVoraussetzungen auf Seiten der LehrgangsteilnehmerInnenDie Ausbildung <strong>und</strong> Begleitung der angehenden TrainerInnen knüpft an die Erfahrungender TeilnehmerInnen an, sodass bereits vorhandene Fertigkeiten <strong>und</strong> Expertise aufgegriffen<strong>und</strong> weiterentwickelt werden.Im Rahmen der Ausbildung wird umfassend auf die Situation in den Herkunftseinrichtungender TeilnehmerInnen eingegangen. Dabei wird die individuelle Situationmit Hinblick auf Probleme <strong>und</strong> Ressourcen genau betrachtet <strong>und</strong> von hier aus angemessene,professionelle Handlungsstrategien zum Umgang mit Aggression <strong>und</strong> Gewalt inder jeweiligen Einrichtung entwickelt. Das heißt, die TeilnehmerInnen lernen, praxis- <strong>und</strong>problemorientierte Handlungsstrategien zu entwickeln <strong>und</strong> können somit ihrer Einrichtunganschließend als BeraterIn für dieses Gebiet zu Verfügung stehen. Gr<strong>und</strong>voraussetzungfür die TrainerInnenausbildung sind angemessene soziale Kompetenzen <strong>und</strong> notwendigepsychomotorische Fähigkeiten, um anschließend als TrainerIn tätig zu sein.Mehrjährige Praxiserfahrung ist empfehlenswert, ebenso wie Erfahrung im Leiten vonGruppen <strong>und</strong> / oder im Unterrichten. Die vorherige Beschäftigung mit diesem Themenkomplexwird erwünscht, die Teilnahme an einem Basistraining Aggressions-, Gewalt<strong>und</strong>Deeskalationsmanagement ist verpflichtend.Studien weisen darauf hin, dass die Gr<strong>und</strong>haltung, mit welcher die MitarbeiterInnenden PatientInnen begegnen, entscheidenden Einfluss auf den Verlaufvon Eskalations-Deeskalations-Zyklen hat. Daher ist es wichtig, dass potentielleTrainerInnen für Aggressionsmanagement eine entsprechende Gr<strong>und</strong>haltung mitbringen,um TeilnehmerInnen <strong>und</strong> KollegInnen eine hilfreiche, von Respekt, Sorge <strong>und</strong> Interesseam Gegenüber geprägte Gr<strong>und</strong>haltung vermitteln zu können.Zum jetzigen Zeitpunkt befinden sich Konzepte zur Prävention <strong>und</strong> zum therapeutischenUmgang mit herausforderndem, aggressivem <strong>und</strong> gewalttätigen Verhalten in stetigerEntwicklung. Potenzielle TrainerInnen sollten daher Neugier, Bereitschaft am fortlaufendenLernen <strong>und</strong> Bereitschaft zur Weiterentwicklung im Ges<strong>und</strong>heitswesen mitbringen. Eshat sich in der Praxis bewährt, dass jeweils 2 TeilnehmerInnen pro Einrichtungeine solche Weiterbildung gemeinsam durchlaufen. Dadurch wird die Umsetzung indie Praxis verbessert. Je nach Größe der Einrichtungen hat es sich bewährt, für größereInstitutionen entsprechend mehr TrainerInnen auszubilden.Umfang <strong>und</strong> Inhalte der WeiterbildungEine Weiterbildung zum / zur TrainerIn für Aggressionsmanagement findet über einenZeitraum von 9-12 Monaten statt. Der Gesamtumfang der Weiterbildung beträgt inklusivedes 5-tägigen Basistrainings (Gr<strong>und</strong>voraussetzung) <strong>und</strong> eines 5-tägigen, unter Supervisionselbst durchgeführten Basistrainings sowie der Studienzeit ca. 40-50 Tage. DieAbschlussarbeit hat einen Umfang von mindestens 25 Seiten.Inhaltlich umfasst die Weiterbildung folgende Punkte:1. Aggressionstheorien / Attributionstheorie2. Assessmentfertigkeiten3. Rechtliche <strong>und</strong> ethische Aspekte4. Konfliktmanagement, Konfliktlösestrategien, verbale Deeskalation5. Nachbetreuung nach belastenden Ereignissen6. Medizinische <strong>und</strong> pharmakologische Aspekte7. Befreiungs- <strong>und</strong> Teamtechniken8. Handlungskompetenzen in Bezug auf spezifische Gruppen, insb. in somatischen Bereichen9. Organisations- <strong>und</strong> Teamkultur10. Berufsgruppenspezifische Aspekte11. Sicherheitsmanagement68
Kapitel 2 | Beispiele12. Vorgehen bei der Durchführung eines Basiskurses, inklusive didaktische <strong>und</strong> methodischeAspekteAusblick <strong>und</strong> PerspektiveDie Auseinandersetzung mit dem Phänomen Aggression <strong>und</strong> Gewalt in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenfindet in Österreich <strong>und</strong> Deutschland zunehmend statt. Die systematische Erfassungvon Häufigkeit, Art <strong>und</strong> Ausmaß von aggressiven <strong>und</strong> gewalttätigen Übergriffenerfolgt nur vereinzelt <strong>und</strong> regional sehr unterschiedlich. Eine systematische Auseinandersetzungmit Aggression-, Gewalt-, Sicherheits- <strong>und</strong> Deeskalationsmanagement findet imdeutschsprachigen Raum ebenfalls regional sehr unterschiedlich statt. Die Ausbildung vonBeraterInnen <strong>und</strong> TrainerInnen für Deeskalations- <strong>und</strong> Sicherheitsmanagement im Ges<strong>und</strong>heitswesenkann zur konstruktiven Auseinandersetzung mit diesem Aspekt der Ges<strong>und</strong>heitsversorgungbeitragen <strong>und</strong> gleichzeitig interessierte Einrichtungen dabei unterstützen,f<strong>und</strong>ierte <strong>und</strong> systematische Handlungsstrategien (für Aggressions-, Gewalt- <strong>und</strong>Deeskalationsmanagement) zu entwickeln <strong>und</strong> umzusetzen.Neben der Weiterbildung erfolgt der Aufbau eines Netzwerkes von TrainerInnen fürAggressions-, Gewalt- <strong>und</strong> Deeskalationsmanagement in Österreich (ÖNTAD),wie dies bereits in anderen Ländern geschehen ist. Diese Netzwerkarbeit funktioniertdurch internationale Vernetzung mit den Ländern Großbritannien, Niederlande, Schweden,Norwegen, Italien, Griechenland, Deutschland <strong>und</strong> den USA.Ziel der Vernetzung ist die Identifikation der hilfreichsten Konzepte, Strategien<strong>und</strong> Techniken (auch für unterschiedliche Kontexte) <strong>und</strong> weiterführend die Entwicklungvon Qualitätsstandards für diesen Bereich auf internationaler Ebene. Dazuwurde im September 2008 in Amsterdam (NL) auch offiziell das „European Network ofTrainers in the Management of Aggression (ENTMA)“ in einer konstituierenden Sitzunggegründet, wo die österreichischen TrainerInnen ebenso Mitglieder sind. Bisher wurden inWien 21 MitarbeiterInnen (Medizin / Pflege) zu TrainerInnen ausgebildet.Innerhalb von drei Jahren absolvierten ca. 1300 MitarbeiterInnen der Psychiatrieabteilungenin Wien (ÄrztInnen, PsychologInnen, Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> KrankenpflegepersonenTherapeutInnen etc.) den fünftägigen Basiskurs Deeskalationsmanagement.Eine Ausweitung auf andere medizinische <strong>und</strong> soziale Bereiche wurde auf Gr<strong>und</strong> der starkenNachfrage im September 2008 in Wien gestartet. Es werden in einer drei Semesterdauernden Weiterbildung weitere 22 TrainerInnen für den Bereich allgemeine Krankenhäuser,Geriatriezentren <strong>und</strong> Rettungsdienst in Wien ausgebildet.LiteraturAbderhalden C., Needham I., Friedlie TK., Poelmans J., Dassen T. (2002). Perception of aggressionamong psychiatric nurses in Switzerland. In: Acta Psychiatrica Scandinavica, 106. (Suppl. 412):110-117.Anderson, C. (2002). Workplace violence: are some nurses more vulnerable? Issues Ment HealthNurs, 23(4), 351-366.Arntz, J. E., Arntz, B. B. (2001). Violence towards health care staff and possible effects on the qualityof patient care. Social Science and Medicine, 52(3): 417-427.Bensley, L., Nelson, N., Kaufman, J., Silverstein, B., Kalat, J., Walter Shields, J. (1997). Injuriesdue to assaults on psychiatric hospital employees in Washington state. American Journal of IndustrialMedicine, 31: 92-99.Bohner, G. (2002). Einstellungen. In: Stroebe, W.; Jonas, K.; Hewstone, M. (Hrsg.): Sozialpsychologie.Eine Einführung. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg, S 266.69
Kapitel 2 | BeispieleCarmel, H. & Hunter, M. P. A. (1989). Staff injuries from Patient violence. Hospital CommunityPsychiatry 40: 41-6.Cohen-Mansfield, J., Marx, M. S., Rosenthal, A. S. (1990). Dementia and agitation in nursing homeresidents: How are they related? Psychology and Aging, 5(1): 3-8.Colenda, C. C. & Hamer, R. M. (1992). Antecedents and interventions for aggressive behaviour ofpatients at a gerontopsychiatric state hospital. Hospital and Community Psychiatry, 42(3): 287-292.Duncan, S., Estabrooks, C. A., Reimer, M. (2000). Violence against nurses. Alta RN, 56 (2): 13-14.Estryn-Behar, M., Van der Heijden, B., Camerino, D., Fry, C., Le Nezet O., Conway P.M., HasselhornH-M - The NEXT Study group (2008). Violence risks in nursing – results from the European‘NEXT’ Study. Occupational Medicine 2008; 58:107-114. Published online January 2008doi:10.1093/occmed/kqm142Farrell, G. & Bobrowski, C. (2003). Preliminary Results of the Scoping Workplace Aggression inNursing (SWAN) Survey. Launceston: Media Briefing, Tasmanian School of Nursing.Fitzwater, E. L. & Gates D. M. (2002). Geriatric Nursing. Volume 23, Number 1.Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: an introduction to theoryand research. Reading Mass.: Addison-WesleyFrühwacht, M., Haenschke, B. (1994). Ideenfindung/Kreativitätstechniken. In: Heeg F.J., Meyer-Dohm P. (Hrsg.). Methoden der Organisationsgestaltung <strong>und</strong> Personalentwicklung. München. S.548.Galtung, J. (1993): Kulturelle Gewalt. In: Aggression <strong>und</strong> Gewalt (Hrsg.: Landeszentrale für politischeBildung, Baden-Württemberg). Kohlhammer, Stuttgart 1993, 52-73Gates, D. M., Fitzwater, E., & Meyer, U. (1999). Violence against caregivers in nursing homes:Expected, tolerated, and accepted. J Gerontol Nurs (4), 12-22.Gates, D. M. Fitzwater, E., Deets, C. (2003). Development of instruments to assess assaultive behaviorin nursing homes. Journal of Gerontological Nursing, 29 (8): 37-45.Geen, R. G. (2001). Human Aggression. Open University Press, Buckingham. S 3.Hesketh, K.L., Duncan, S. M., Estabrooks, C. A., Reimer, M. A., Giovanetti, P., Hyndmann, K.(2003). Workplace violence in Alberta and British Columbia hospitals. Healthy Policy, 63: 311-321.Holden, C. (2005). Gewalt <strong>und</strong> Aggression gegenüber Mitarbeitern. Management des Problems ineiner Akuteinrichtung. Hospital, 2/05: 19-20.Home Office – Research (2001). Development and Statistics Directorate Communications DevelopmentUnit. Violence at Work: New Findings from the 2000 British Crime Survey, London.Hurlebaus, A. (1994). Aggressive behavior management for nurses: An international issue? Journalof Healthcare Protection Management, 10 (2): 97-106.ICN – International Council of Nurses (2001). Leitfaden zum Umgang mit Gewalt am Arbeitsplatz.St. Gallen: Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern <strong>und</strong> Krankenpfleger SBK Sektion SGTG AI AR.ILO – International Labour Office (2002). Guidelines for Addressing Workplace Violence in theHealth Sector. International Labour Office, International Council of Nurses, World Health Organisationand Public Services International Framework. Geneva.Jansen, G., Dassen, T., & Moorer, P. (1997). The perception of aggression. Scand J Caring Sci,11(1), 51-55.Jansen, G., Dassen, T. W., & Groot Jebbink, G. (2005). Staff attitudes towards aggression in healthcare: a review of the literature. J Psychiatr Ment Health Nurs, 12(1), 3-13.70
Kapitel 2 | BeispieleJansen, G., Middel, B., Dassen, T. (2005): An international comparative study on the reliability andvalidity of the attitude of towards aggression scale. Int. Journal of Nursing Studies, 42: 467–477.Lion, J. R., Snyder, W., & Merrill, G. L. (1981). Underreporting of assaults on staff in a state hospital.Hosp Community Psychiatry, 32(7), 497-498.LoBiondo-Wood, G. & Haber, J. (2005). Pflegeforschung. 2. Auflage, Urban&Fischer Verlag. München,Jena.Lusk, S. L. (1992). Violence experienced by nurses' aides in nursing homes: an exploratory study.AAOHN Journal, 40(5): 237-241.Luthans, F. (1985). Organisational behavoir. 4. Edition. Tokyo. S. 156.Mamier, I. & Dassen, T. (1999). Perception of violence-international comparison of an instrument(POAS). Abstract, the 2nd European conference of the Association for Common European NuringDiagnosis, Interventions and Outcomes (ACENDIO), 19-20 march 1999, Venezia.May, D. D., & Grubbs, L. M. (2002). The extent, nature, and precipitating factors of nurse assaultamong three groups of registered nurses in a regional medical center. J Emergency Nursing, 28(1),11-17.May, D. D. & Grubbs, L. M. (2002). The extent, nature and response to victimization of emer-gencynurses in Pennslyvania. J Emergency Nursing, 17 (5): 282-294.Mayhew, C. (2000). Preventing Client-Initiated Violence: A Practical Handbook, Research and publicpolicy series no. 30. Canberra: Australian Institute of Criminology.McCall, B. P. & Horwitz, I. B. (2004). Workplace violence in Oregon: An analysis using workerscompensation claims from 1990-1997. J Occupational and Environmental Medicine, 46(4): 357-366.Menckel, E. & Viitasra, E. (2002). Threats and violence in Swedish care and welfaremagnitude ofthe problem and impact on municipal personnel. Scandinavian J Caring Sciences, 16: 376-385.Mentes, J.C., & Ferrario, J. (1989). Calmino aggressive reactions: A preventive program. J GerontologicalNursing, 15(2): 22-27.Morrison, E.F. (1990). Violent psychiatric inpatients in a public hospital. Scholarly inquiry for nursingpractice, 4 (1): 65-82.Needham, I. (2001). Gewalt gegenüber in der Notfallpflege in der Deutschschweiz. Ergebnis einerUmfrage. Foliensatz. URL: http://www.notfallpflege.ch/text/lnformationig.htm [Zugriff 28.9.2005].Needham, I., Abderhalden, C., Dassen, T., Haug, H. J., & Fischer, J. E. (2004). The perception ofaggression by nurses: Psychometric scale testing and derivation of a short instrument. J PsychiatrMent Health Nurs, 11(1), 36-42.Needham, I., Abderhalden, C., Zeller, A., Dassen, T., Haug, H.J., Fischer, J.E., Halfens, R.J.(2005). The effect of a training course on nursing students attitudes toward, perceptions of, andconfidence in managing patient aggression. J. Nurs Educ. 44 (9): 415-410.Nijman, H. L. I., Allertz, W. W. F., àCampo, J. L. M. G., & Ravelli, D. P. (1997). Aggressive behavioron an acute psychiatric admission ward. Eur J Psychiat, 11(1), 104-114.Nijman, H. (1999). Aggressive behavior of psychiatric patients: Measurement, prevalence, anddeterminants. Unpublished Doctoral thesis, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht.Nijman, H. & Palmstierna, T. (2002). Measuring aggression with the staff observation aggressionscale – revised. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106. (Suppl. 412): 101-102.Nijman, H., Bowers, L., Oud, N., & Jansen, G. (2005). Psychiatric Nurses Experiences With InpatientAggression. AGGRESSIVE BEHAVIOR, Volume 31,, pages 217–227.71
Kapitel 2 | BeispieleNijman, H. L., Palmstierna, T., Almvik, R., & Stolker, J. J. (2005). Fifteen years of research with theStaff Observation Aggression Scale: a review. Acta Psychiatr Scand, 111(1), 12-21.Oud, N. E. (2001). Handhabung von Aggression. Skriptum zum TrainerInnenlehrgang. Unpublishedmanuscript. Amsterdam.Oud, N. E. (1997). Aggression and psychitric nursing. Broens and Oud: Partnership for consultingand training. Amsterdam.Olweus, D. (1999). Täter-Opfer-Probleme in der Schule: Erkenntnisstand <strong>und</strong> Interventionsprogramm.In: H. G. Holtappels (Hrsg.), Forschung über Gewalt an Schulen. Erscheinungs-formen,Ursachen, Konzepte <strong>und</strong> Prävention. Weinheim: Juventa 281-297Palmstierna, T., & Wistedt, B. (1987). Staff observation aggression scale, SOAS: Presentation andevaluation. Acta Psychiatr Scand, 76, 657-663.Paterson, B., McCornish, A. G., & Bradley, P. (1999). Violence at work. Nurs Stand, 13(21), 43-46.Polit, D. F. & Hungler, B. P. (1999). Nursing research: principles and methods (6th ed.). Philadelphia:Lippincott.Poster, E. & Ryan, J. (1993) At risk of assault. Nursing Times 89, 30-33.Presley, D. & Robinson, G. (2002). Violence in the emergency department: Nurses contend withprevention in the healthcare arena. Nursing Clinics of North America, 37(1): 161-9.Rees, C., Lehane, M. (1996). Wittnessing violence to staff: a study of nurses experiences. NursStand, 11(13-15): 45-47Sachs, L. (2004). Angewandte Statistik. 11. aktualisierte Auflage, Springer Verlag. Berlin, Heidelberg,New York.Schrenk W., Stefan, H. & Dorfmeister, G. (2006). Analyse der Aggressionsereignisse im PsychiatrischenKrankenhaus mittels SOAS. Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>, unveröffentlichter Bericht.Shah, A., & De, T. (1997). The relationship between two scales measuring aggressive behavoiramong continuing-care psychogeriatric inpatients, International Psychogeriatrics, 9: 471-477.Shah, A. & De, T. (1998). The effect of an educational intervention package about aggressive behaviourdirected at the nursing staff on a continuing care psychogeriatric ward. International Journalof Geriatric Psychiatry, 13: 35-40.Sprenger, R. (2001). Aggressives Verhalten von Patienten gegenüber Pflegenden. Fortbildungsbedarfim Zusammenhang mit Aggression. Universität Maastricht.Stefan, H. (2005). Aggression <strong>und</strong> Gewalt im Ges<strong>und</strong>heitsbereich. ÖPZ – Österreichische PflegeZeitschrift (Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflegeverband). 08-09: 15-18.Stefan, H. & Dorfmeister, G. (2005). Unveröffentlichte Teilergebnisse aus den Evaluierungs-bögendes Basiskurs "Aggressions- Deeskalationsmanagement". Wiener Kranken-anstaltenverb<strong>und</strong>.Stefan, H. & Dorfmeister, G. (2005). Aggression-, Gewalt- <strong>und</strong> Deeskalationsmanagement im Ges<strong>und</strong>heitsbereich.7th ENDA Conference, Vienna. European Nurse Directors Association & ÖsterreichischerGes<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflegeverband. Abstraktband; Foliensatz. URL:http://www.oegkv.at/uploads/media/Harald-Stefan.pdf [Zugriff 15.10.2005].Stefan, H., Schrenk, W. & Dorfmeister, G. (2006). Unveröffentlichte Ergebnisse der Erhebung vonAggressionsereignissen in der Psychiatrie mittels SOAS. Wiener Krankenanstalten-verb<strong>und</strong>.Staehle, H. (1991). Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive. 6 Auflage, München.S. 179.Sommargren, C. (1994). Violence as an occupational hazard in the acute care setting. AmericanAssociation of Critical Care Nurses: Clinical Issues, 5: 516-522.72
Kapitel 2 | BeispieleWAG – Wiener Arbeitsgemeinschaft für Ges<strong>und</strong>heitsförderung (2004). Ges<strong>und</strong>heitspreises derStadt Wien. URL: http://www.wien.gv.at/wag/#wag [Zugriff 23.9.2005].Wells, J. & Bowers, L. (2002). How prevalent is violence towards nurses working in general hospitalsin the UK? J Advanced Nursing, 39 (3): 230-240.Whittington, R. & Wykes, T. (1996). An evaluation of staff training in psychological techniques forthe management of patient aggression. Journal of Clinical Nursing (5): 257–261.Whitley, G.G., Jacobson, G.A. & Gawrys, M.T. (1996). The impact of violence in the health caresetting upon nursing education. J Nursing Education, 35 (5): 211-218.Wilkinson, C. L. (1999). An evaluation of an educational program on the management of assaultivebehavior. J Gerontological Nursing, 25 (4): 6-11.Wrigley, P. (1995). Managing aggression in general hospitals. Australian Nursing J, 3(1): 20-22.Zimbardo, P. G., & Gerrig, R. J. (1999). Psychologie (J. Baur & F. Jacobi & M. Reiss, Trans. 7thed.). New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. S. 334.73
Kapitel 2 | Beispiele2.6Frauenges<strong>und</strong>heit(-sförderung) im Spital:Die Frauenges<strong>und</strong>heitszentren F.E.M. <strong>und</strong> F.E.M. Süd – Ziele,Strategien, ErgebnisseBeate WIMMER-PUCHINGER, Daniela KERN, Hilde WOLFFrauenges<strong>und</strong>heitszentren – Impulsgeberinnen fürfrauenadäquate Behandlungsqualität an der SchnittstelleKrankenhausFrauenges<strong>und</strong>heitszentren wurden, als Reaktion auf Erkenntnisse der Frauenges<strong>und</strong>heitsforschungsowie der Frauenges<strong>und</strong>heitsbewegung der 1970er bis zu den 1990er Jahren,zunächst in den USA <strong>und</strong> in Großbritannien etabliert, seit Mitte der 70er Jahre auch inBerlin <strong>und</strong> anderen deutschen Städten errichtet. Initiiert durch die internationale WHO-Konferenz „Women’s Health and Urban Policy“ im Jahr 1991 wurde eine Empfehlungfür Frauenges<strong>und</strong>heitszentren als wichtige frauenspezifische „Multiplikatorinnen“ausgesprochen. Wien hat 1992 als erste österreichische Stadt in Kooperation mitder WHO ein Fünf-Jahres-Modellprojekt zur Frauenges<strong>und</strong>heitsförderung in einerFrauenklinik (der Semmelweis-Klinik in Wien) gestartet. Dieses Modellprojekt wurde vomLudwig Boltzmann Institut für Frauenges<strong>und</strong>heitsforschung unter der Leitung von FrauUniv. Prof. Dr. Beate Wimmer-Puchinger durchgeführt.Als Setting wurde bewusst eine von Frauen sehr akzeptierte Frauenklinik gewählt<strong>und</strong> im Vorfeld der Gründung eine umfassende Machbarkeitsstudie durchgeführt (vgl.Abbildung 3 unten). Diese ermittelte ges<strong>und</strong>heitliche, soziale <strong>und</strong> psychische Belastungenvon Frauen aller Alters- <strong>und</strong> Bildungsschichten in niedergelassenen Praxen, Kliniken,Apotheken <strong>und</strong> Einkaufszentren, sowie Erwartungen der Frauen an das Ges<strong>und</strong>heitssystem.Weiters wurden zuweisende ÄrztInnen <strong>und</strong> ApothekerInnen um ihre Einschätzungder Belastungen ihrer Patientinnen / Klientinnen <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen Bedürfnisseinterviewt. Auf dieser empirischen Basis wurden Schwerpunkte der Angebote sowiestrategische Vorgangsweisen entwickelt. Dies erfolgte in einem Organisationsentwicklungsprozessgemeinsam mit dem gesamten Team der Semmelweisklinik. Das heißt, dasFrauenges<strong>und</strong>heitszentrum F.E.M. 27 wurde in seiner Implementierungsphase sowohl partizipativ,als auch in einem Top-Down-Ansatz mit dem Klinikpersonal aller Berufsgruppen(GynäkologInnen, ÄrztInnen, PsychologInnen, Pflegepersonal, Verwaltungspersonal, SozialarbeiterInnen)erarbeitet. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Betreuungsqualitätder Klinik <strong>und</strong> die des Frauenges<strong>und</strong>heitszentrums kompatibel sind. Ein Ergebnis warzum Beispiel eine für alle Patientinnen transparente Leitlinie für eine frauengerechtemedizinische Behandlung.Im Gegensatz zu Deutschland war es von Anfang an erklärtes Ziel der Gründung dieserEinrichtung, kein elitäres Zentrum für Akademikerinnen, sondern ein niederschwelligesAngebot für die „Durchschnittsfrau“ mit Mehrfachbelastungen zusein. Daher war es auch von Beginn an wichtig, die Angebote kostenlos bzw. mit minimalenBeitragsleistungen zu halten.27 das Akronym für „Frauen – Eltern – Mädchen“74
Kapitel 2 | BeispieleAbbildung 3: Studien im Rahmen der ProjektkonzeptionIm Folgenden werden die einzelnen Ziele, Schritte <strong>und</strong> Ergebnisse der Umsetzung dargestellt.Frauenges<strong>und</strong>heitszentrum F.E.M. – ein Meilenstein derFrauenges<strong>und</strong>heitsförderung in Österreich:Der Ansatz, spezielle Frauenges<strong>und</strong>heitsangebote in einem Krankenhaus zu etablieren,war europaweit innovativ <strong>und</strong> erweckte großes Interesse in anderen Städten, wie zumBeispiel München, Köln, Berlin. Die Chancen, Frauenges<strong>und</strong>heitsförderung gemeinsammit einer Frauenges<strong>und</strong>heitsklinik zu entwickeln, liegen in folgenden Überlegungen:1. Hohe Frequentierung von Frauen / Patientinnen in wichtigen lebensverändernden,oft auch belastenden Lebensabschnitten2. Unterstützung der Frauen durch bessere Informationen <strong>und</strong> Wissen, in ihrer Mit<strong>und</strong>Selbstbestimmung wichtiger ges<strong>und</strong>heitlicher Entscheidungen3. Hoher Frauenanteil im Pflegebereich, Doppelbelastung der Arbeitnehmerinnen inder Organisation Krankenhaus4. Nutzung der Infrastruktur, Organisationsstruktur der medizinischen Ressourcen<strong>und</strong> des hohen medizinischen Know-Hows5. Gemeinsame Leitbildentwicklung in Richtung Patientinnen-Orientierung <strong>und</strong>Ganzheitliches Ges<strong>und</strong>heits-Krankheits-Verständnis durch regelmäßige Aus- <strong>und</strong>Fortbildung des Personals.1998 erhielt das WHO Modellprojekt den “WHO-Award for Excellence in a Women’s /Children’s Health Project“. Dabei wurden der innovative Charakter der Einrichtung, dievorbildhafte Konzeptidee sowie die einzelnen Maßnahmen prämiert. Was unterscheidet75
Kapitel 2 | BeispieleF.E.M. von anderen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen? Die folgenden Aspekte <strong>und</strong> Merkmalezeigen die bahnbrechende <strong>und</strong> richtungsweisende Konzeptualisierung auf:1. Schaffung frauengerechter Strukturen im Medizinsystem2. Kooperation mit der Klinik im Sinne eines Kompetenzzentrums für Frauenges<strong>und</strong>heit3. Unterstützung durch den Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>4. Aufsuchende Ges<strong>und</strong>heitsförderung5. Verschränkung von Sozialarbeit, Medizin <strong>und</strong> psychosozialer Betreuung6. Interdisziplinärer <strong>und</strong> frauenspezifischer Ansatz mit Fokus auf Vernetzung <strong>und</strong> Kooperation.Angebote zu folgenden Themen <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsfragen, die für Frauen relevant sind,wurden erstmalig in Österreich aufgebaut: Essstörungsgruppen für Teenager, SexualpädagogischeWorkshops für Jugendliche, aber auch für Eltern, interdisziplinäre Informationsabendezum Klimakterium (Gynäkologin, Psychotherapeutin), Gesprächsgruppen fürFrauen 60+, Mütter- <strong>und</strong> Vätergruppen (mit begleitender Kinderbetreuung), Selbstbehauptungsgruppen,Raucherinnenentwöhnungsgruppen, „Schlank ohne Diät“-Angebote,Osteoporosepräventions- <strong>und</strong> Selbsthilfegruppe, Einzel- <strong>und</strong> Paarberatung in Lebenskrisen,Gynäkologie-Infotelefon, etc.Das multiprofessionelle ExpertInnenteam bestand dabei aus Psychologinnen, Psychotherapeutinnen,Hebammen, Bewegungstrainerinnen, Sozialarbeiterinnen, Beschäftigungstherapeutinnen<strong>und</strong> Physiotherapeutinnen.Ziele, Strategien, Schwerpunkte des Frauenges<strong>und</strong>heitszentrums F.E.M.Das Frauenges<strong>und</strong>heitszentrum F.E.M. in der Semmelweis-Frauenklinik hatte folgendedrei Dynamiken zum Ziel:1. Qualitätssicherung für Patientinnen der Klinik durch eine interdisziplinäre Plattform.In dieser alle Berufsgruppen des Hauses umfassenden Gruppe wurden laufendQualitätsmanagementprojekte erarbeitet, wie zum Beispiel die Verkürzung derWartedauer, Standards für eine bessere Kommunikation mit <strong>und</strong> Informationder Patientinnen. Wichtig war, für Frauenges<strong>und</strong>heit sowie für die spezifische Lebenssituationder Frauen zu sensibilisieren <strong>und</strong> dafür die medizinischen Ressourcendes Hauses zu nützen. Die leitende Vision dabei war, die Klinik auch als einen Ortder Information <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung für Frauen zu definieren.2. Die zweite strategische Ausrichtung liegt im Frauenges<strong>und</strong>heitszentrum selbst alseine der Medizin vorgelagerte Einrichtung, die maßgeschneiderte Ges<strong>und</strong>heitsförderungsangebotefür Frauen, zum Beispiel Informationsabende, Kurse, Gruppen,Einzelberatungen für spezifische Fragestellungen <strong>und</strong> Belastungen von Frauen in verschiedenenLebensphasen, Geburtsvorbereitungs-Wochenenden etc., anbietet.3. Aus- <strong>und</strong> Fortbildungen für verschiedenen Berufsgruppen (SozialarbeiterInnen,Pflegepersonal, GynäkologInnen) sowie Vernetzungsabende mit dem niedergelassenenBereich <strong>und</strong> anderen psychosozialen Einrichtungen.Erfahrungsbericht nach 5 Jahren ModellprojektEine umfassende Evaluierung des Modellprojektes bestätigte, dass die Implementierungin einer Frauenklinik Gewinne <strong>und</strong> Synergien sowohl für das Klinikpersonal, fürdie Patientinnen als auch für die bessere Zusammenarbeit mit anderen Sozial<strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen erbracht hat. Es konnten auch wichtige Betreuungsstandardfür Frauen entwickelt werden. Die Nachfrage nach den Angeboten des F.E.M.hat sich ebenfalls sehr rasch sehr gut entwickelt: Nach 5 Jahren konnten 26.000 Klientinnenkontaktefür die diversen Angebote verzeichnet werden.Folgende Datenquellen wurden für die Evaluierung herangezogen:76
Kapitel 2 | Beispiele1. Teilnehmerinnen Befragungen vor <strong>und</strong> nach Inanspruchnahme der Angebote bzw.Kurse2. Kontaktpunktanalysen durch „Silent-Shoppers“3. Fragebogenerhebung beim Klinikpersonal4. Frauenbefragungen an externen Orten (Bekanntheit, Beliebtheit, etc.)5. Telefonbefragung bei Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen der umliegenden Bezirke.Die Effizienzüberprüfung der Inanspruchnahme verschiedener Angebote zeigte eine positiveNachhaltigkeit. Es konnte ein Ansteigen des Wohlbefindens sowie der allgemeinenZufriedenheit im Vergleich zum Ausgangswert gemessen werden. Da vieleder Angebote innovativ <strong>und</strong> sehr bedürfnisorientiert waren, wurde das F.E.M. durch dieMedien, aber auch durch M<strong>und</strong>propaganda <strong>und</strong> auch Zuweisungen von der Klinik bekannt<strong>und</strong> von Frauen aus Niederösterreich <strong>und</strong> Burgenland frequentiert.Vom Erfolgsmodellprojekt zur InstitutionNach den positiven Erfahrungen einer geschlechtsspezifischen ges<strong>und</strong>heitsförderndenEinrichtung in einer Klinik wurde 1999 ein zweites Frauenges<strong>und</strong>heitszentrum inWien errichtet, das F.E.M. Süd. F.E.M. Süd wurde in einem Schwerpunktkrankenhaus(Kaiser Franz Josef Spital) in Favoriten, einem sozial benachteiligten, bevölkerungsreichenWiener Bezirk, etabliert. Auch diese Einrichtung wurde in einem Organisationsentwicklungsprozess,in den alle Primariate des Hauses eingeb<strong>und</strong>en waren, partizipativentwickelt. Eine Patientinnen- <strong>und</strong> Frauenbefragung ging der Gründung voraus, um ineiner Machbarkeitsstudie ebenfalls punktgenau <strong>und</strong> auf Daten basierend die Angebote zuentwickeln. Während die ersten Jahre F.E.M. davon geprägt waren, ein umfangreichesKurs- <strong>und</strong> Beratungsprogramm zu etablieren, das von den Frauen <strong>und</strong> Mädchen sehr gutangenommen wurde <strong>und</strong> das F.E.M. als wichtige Serviceeinrichtung für Frauenges<strong>und</strong>heitetabliert hat, wurde in den letzten 5 Jahren zusätzlich ein Schwerpunkt von Projektenfür sozial benachteiligte Frauengruppen aufgebaut. Mit Hilfe von aufsuchender Ges<strong>und</strong>heitsarbeitwurden Maßnahmen für wohnungslose Frauen, Ges<strong>und</strong>heitsinformationenfür Frauen <strong>und</strong> Mädchen mit Behinderung, türkischsprachige Beratung für belastete Müttersowie Ernährungsprogramme für sozial benachteiligte Familien äußerst erfolgreichdurchgeführt. Auch diese Strategien bestechen durch Innovation <strong>und</strong> wurden vom WienerProgramm für Frauenges<strong>und</strong>heit finanziert.Nach dem Gender-Prinzip wurde auch das erste Männerges<strong>und</strong>heitszentrum M.E.N. inWien eingerichtet. Als Träger der nunmehr drei Einrichtungen, F.E.M., F.E.M. Süd <strong>und</strong>M.E.N. wurde 1999 ein Verein gegründet. Die Finanzierung aller drei Einrichtungen erfolgtauf Basis eines Leistungsvertrages durch den Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>,durch Mittel der Stadt, sowie durch den B<strong>und</strong>.ErgebnisseDas erste Frauenges<strong>und</strong>heitszentrum F.E.M. an der Wiener Semmelweisklinik verzeichnetpro Jahr an die 30.000 Kontakte mit Frauen. Es sind dies vorwiegend telefonische Anfragen<strong>und</strong> Kriseninterventionen, E-Mail Beratungen, psychologische Beratungen, Kurse,Workshops <strong>und</strong> Informationsabende. Hauptthemen sind Essstörungen / Essverhalten,psychische Krisen, Schwangerschaft sowie Schwangerschaftskonflikte, Sexualität <strong>und</strong>Verhütung (vgl. Abbildung 4 unten).77
Kapitel 2 | BeispieleAbbildung 4: Hauptthemen von Beratungen im F.E.M.Hauptthemen in den Beratungen11%Sexualität4%Schwangerschaftskrisen+PPD2%Verlust/Trauer5%Depression41%Essstörungen/Essverhalten24%Schwangerschaftskonflikt7%FamiliäreProbleme6%Paarkonflikte/TrennungWas die Klientinnenstruktur betrifft, sind nach einer statistischen Analyse über ein Drittelder F.E.M. Besucherinnen zwischen 20 <strong>und</strong> 35 Jahren alt, ein weiteres Drittel sind Mädchenunter 20. 21% sind 36-50 Jahre alt, 20% älter als 50 Jahre. Die überwiegendeMehrheit der F.E.M. Klientinnen ist verheiratet, 20% sind ohne fixe Beziehung beziehungsweisein getrennten Haushalten lebend. 61% der Frauen, die das F.E.M. aufsuchen,sind kinderlos, davon 22% Schwangere. Mit 41% ist die Mehrheit der F.E.M.-KlientInnenberufstätig, 22% der Klientinnen befinden sich in Ausbildung, 16% in Karenz.Auch das Frauenges<strong>und</strong>heitszentrum F.E.M. Süd mit dem Schwerpunkt auf sozial benachteiligteFrauen verzeichnete im Jahr 2006 etwa 30.000 Kontakte. 16.042 Kontakte kamenmit deutschsprachigen Frauen zustande, 14.442 durch die Arbeit mit fremdsprachigenFrauen. Mittlerweile hat beinahe die Hälfte der Klientinnen nicht-deutschsprachigen Hintergr<strong>und</strong>(vgl. Abbildung 5 unten).FEM Süd Klientinnen-Kontakte 2006nach Sprachefremdsprachig48%Abbildung 5: Klientinnen des F.E.M. Süd mit deutscher <strong>und</strong> nicht deutscher Muttersprachedeutschsprachig52%Neben mehrsprachigen Kursen, Gruppen <strong>und</strong> Vorträgen können Frauen auch muttersprachlicheBeratung durch das interkulturelle <strong>und</strong> multidisziplinäre Team in Anspruchnehmen. Die Inhalte der Beratungen 2006 sind in Abbildung 6 unten dargestellt.78
Kapitel 2 | BeispieleAbbildung 6: Beratungsinhalte am F.E.M. Süd im Jahr 2006Beratungen 2006n = 621Soziales17%Ges<strong>und</strong>heit, AllgemeineMedizin24%Psychologie42%Gynäkologie17%Das durchschnittliche Alter der Klientinnen des F.E.M. Süd liegt bei ca. 40 Jahren. Aufgr<strong>und</strong>der Zielgruppe verfügen die meisten Klientinnen als höchsten Schulabschluss übereinen Volks- <strong>und</strong> Hauptschulabschluss, wobei 53% der türkischsprachigen Frauen dieAbsolvierung einer Volksschule als höchsten Schulabschluss angeben. Auch die Berufstätigkeitder F.E.M. Süd-Klientinnen zeigt nach Sprachgruppen getrennt ein sehr heterogenesBild: So sind die deutschsprachige Frauen großteils berufstätig (48%) oder in Pension(13%), türkischsprachige Klientinnen sind besonders häufig als Hausfrauen tätig(40%), <strong>und</strong> die bosnisch-, kroatisch-, oder serbischsprachigen Frauen sind leider zu 40%auf Jobsuche (40%).ResümeeDie beiden Frauenges<strong>und</strong>heitszentren F.E.M. <strong>und</strong> F.E.M. Süd haben sich als Kompetenzzentrenfür Frauen in Wien etabliert. Die vor 15 Jahren festgelegten Hauptziele desF.E.M. haben auch heute noch ihre Gültigkeit <strong>und</strong> dienen als Gr<strong>und</strong>lage für die Definitionvon Teilzielen <strong>und</strong> weiterführenden Maßnahmen. Prävention, Empowerment, Abbau vonsozialen Barrieren <strong>und</strong> Frauenorientierung im Ges<strong>und</strong>heitswesen sind hier wesentlicheSchlagworte. F.E.M. <strong>und</strong> F.E.M.-Süd als Ges<strong>und</strong>heitszentren im kurativen System übernehmeneine Schnittstellenfunktion zwischen Krankenhaus, niedergelassenen ÄrztInnensowie anderen im Ges<strong>und</strong>heitswesen Tätigen <strong>und</strong> den Frauen im Raum Wien. Sie leistenzudem einen wesentlichen Beitrag dazu, zukunftsweisende Leitbilder für ein „womenfriendly hospital“ zu entwickeln.Es hat sich sehr bewährt, die geschlechtsspezifische Ges<strong>und</strong>heitsförderung im SettingKrankenhaus anzusiedeln, da dieser Ansatz zahlreiche Synergien <strong>und</strong> Kooperationenermöglicht. Mit diesem Ansatz der Frauenges<strong>und</strong>heitszentren im Spitalsbereichkonnte modellhaft <strong>und</strong> innovativ innerhalb einer Organisation ein Kompetenzzentrum fürGes<strong>und</strong>heitsförderung, das mit vielen medizinischen Abteilungen kooperiert, aufgebautwerden. In diesem Sinne ermöglichen die F.E.M.s sowohl bevölkerungsbezogene ges<strong>und</strong>heitlicheServiceleistungen als auch zusätzliche Benefits für die Patientinnender Krankenhäuser, an die sie angeschlossen sind. Dies entspricht somit in nahezuallen Punkten den Visionen <strong>und</strong> Leitlinien ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser (vgl.Dietscher et al. 2003). Weiters werden durch diesen Ansatz die genderspezifischen Empfehlungender WHO realisiert. Mit der aufsuchenden <strong>und</strong> somit niederschwelligen Arbeit,mit der vor allem sozial benachteiligte Zielgruppen sehr gut erreicht werden <strong>und</strong> somit indas Ges<strong>und</strong>heitssystem integriert werden können, bestreiten diese Einrichtungen wichtigeBrückenfunktionen, die die Lücken zwischen dem niedergelassenen Bereich <strong>und</strong>dem kurativen stationären Bereich unter dem Aspekt der Ges<strong>und</strong>heitsförderungschließen. Auf Gr<strong>und</strong>lage der Daten <strong>und</strong> Fakten sind die Frauenges<strong>und</strong>heitszentren79
Kapitel 2 | BeispieleF.E.M., F.E.M. Süd sowie das Männerges<strong>und</strong>heitszentrum M.E.N. ein zukunftsweisendesModel of good practice, Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Setting Krankenhaus geschlechts-<strong>und</strong> zielgruppenspezifisch zu etablieren.Literatur:Dietscher C., Krajic K, Stidl T., Pelikan J.M. (2003): Das ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhaus – Konzepte,Beispiele <strong>und</strong> Erfahrungen aus dem Internationalen Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser.Wien: BMSGWimmer-Puchinger B. (2008). Frauenges<strong>und</strong>heit: Von der Programmatik zur Umsetzung. In: SpickerI., Sprengseis G. (Hg.): Ges<strong>und</strong>heitsförderung stärken. Kritische Aspekte <strong>und</strong> Lösungsansätze.Wien: FacultasWeitere Informationen zu F.E.M., F.E.M.-Süd <strong>und</strong> M.E.N. gibt es im Internet unterhttp://www.fem.at80
Kapitel 2 | Beispiele2.7Grosse schützen Kleine – ein erfolgreiches Modelof Best Practice an der Schnittstelle zwischenKrankenhaus <strong>und</strong> regionaler BevölkerungGudula BRANDMAYREinleitungDas Österreichische Komitee für Unfallverhütung im Kindesalter „Grosse schützen Kleine“wurde im Jahr 1983 vom damaligen Vorstand der Univ. Klinik für Kinder- <strong>und</strong> Jugendchirurgiein Graz, Univ. Prof. Dr. Hugo Sauer, nach einem schwedischem Vorbild gegründet.Unter der Prämisse „Vorsorgen ist besser als Heilen“ machten sich engagierteÄrztInnen, PsychologInnen, PädagogInnen, Kinderkrankenpflegepersonen <strong>und</strong> viele mehrans Werk, die Todesursache Nummer Eins bei Kindern – den Kinderunfall – durch zielgerichteteAufklärungsarbeit zu bekämpfen. Univ. Prof. Dr. Michael Höllwarth, derzeitigerVorstand der Univ. Klinik für Kinder- <strong>und</strong> Jugendchirurgie in Graz, fungiert seit dem Jahr1993 als Präsident des Vereines. Der Hauptsitz von „Grosse schützen Kleine“ ist inGraz. Durch Landesstellen in Kärnten, Salzburg <strong>und</strong> Niederösterreich hat sich derAktionsradius auch auf andere B<strong>und</strong>esländer erweitert. In jedem dieser B<strong>und</strong>esländer istder Sitz der Landesstelle in einem Krankenhaus.Als Non-Profit Organisation hat es sich „Grosse schützen Kleine“ von Anbeginn zum Zielgesetzt, die Zahl der schweren <strong>und</strong> tödlichen Unfälle bei Kindern im Alter von 0-14 Jahrenzu reduzieren. In Österreich ereignen sich jährlich 170.000 Kinderunfälle inder Altersgruppe von 0-14 Jahren, r<strong>und</strong> 50 Kinder sterben an den Folgen einesUnfalls.„Grosse schützen Kleine“ liefert mit seinen Aktivitäten <strong>und</strong> Maßnahmen einen wichtigenBeitrag zur Reduktion der Kinderunfälle in Österreich. Basis aller Aktionen ist einef<strong>und</strong>ierte Analyse des Unfallherganges <strong>und</strong> der verursachenden Faktoren sowiederen Korrelation zu Unfallfolgen <strong>und</strong> Verletzungen. Die Detailanalyse der Unfällewird in enger Zusammenarbeit mit dem LKH Univ. Klinikum Graz, das auch als Ges<strong>und</strong>heitsförderndesKrankenhaus anerkannt ist, durchgeführt. Mit dem im Jahr 2003gegründeten Zentrum für Kinderunfallforschung wurde ein Meilenstein gesetzt, der denAustausch der Ergebnisse wissenschaftlicher Studien mit den in der Praxis tätigen Personenermöglicht.Die Arbeit von „Grosse schützen Kleine“ umfasst die Prävention von Kinderunfällen inden Bereichen Heim, Freizeit, Sport, Verkehr <strong>und</strong> Schule. Auf Basis der im Detailanalysierten Kinderunfalldaten <strong>und</strong> der aus den Analysen abgeleiteten Notwendigkeitenzum Handeln entwickelt „Grosse schützen Kleine“ mit verschiedenen Partnern Kampagnen<strong>und</strong> Programme zur Kindersicherheit. Die Bandbreite reicht von der Radhelmkampagneüber den Kindersitzcheck <strong>und</strong> eine Lern-CD-Rom für Volksschüler bis zur Kindersicherheitsbox,der Sicherheitsbroschüre für zuhause <strong>und</strong> Schulungen für all jene, dieberuflich mit Kindern zu tun haben. Die Finanzierung der Maßnahmen <strong>und</strong> Aktivitätenerfolgt zum einen durch projektbezogene Subventionen der öffentlichen Hand wiezum Beispiel B<strong>und</strong>esministerien, Landesregierungen, Sozialversicherungsträger <strong>und</strong> zumanderen durch Sponsoren aus der Wirtschaft. In der Planung <strong>und</strong> Ausführung der einzelnenMaßnahmen <strong>und</strong> Aktivitäten erfolgt der Austausch <strong>und</strong> die Vernetzung mit anderenInstitutionen, die ebenso im Bereich Unfallverhütung tätig sind.Beispielgebend für die Arbeit von „Grosse schützen Kleine“ sollen hier zwei aktuelle Projekteangeführt <strong>und</strong> näher beschrieben werden:• die „BÄRENBURG“, das 1. Österreichische Kindersicherheitshaus in Graz• das Projekt Kindersicherer Bezirk.81
Kapitel 2 | BeispieleBeide Projekte demonstrieren die Einbindung der drei wesentlichen Zielgruppen einesGes<strong>und</strong>heitsfördernden Krankenhauses – PatientInnen, MitarbeiterInnen <strong>und</strong> regionaleBevölkerung.UmsetzungsbeispieleBÄRENBURG – Erstes Österreichisches KindersicherheitshausMit der „BÄRENBURG“, dem ersten Österreichischen Kindersicherheitshaus, das im September2008 am LKH-Univ. Klinikum Graz eröffnet wurde, schuf „Grosse schützen Kleine“eine Einrichtung, in der Eltern <strong>und</strong> alle, die mit Kindern zu tun haben, wie ÄrztInnen,LehrerInnen, KindergartenpädagogInnen, Hebammen, Kinderkrankenpflegepersonen <strong>und</strong>viele mehr, f<strong>und</strong>ierte Informationen zu Kinderunfällen <strong>und</strong> deren Prävention finden.Ziel ist es, die Bevölkerung zum Thema Kindersicherheit zu informieren <strong>und</strong> zu sensibilisieren<strong>und</strong> damit das allgemeine Sicherheitsbewusstsein im Sinne einer umfassendenGes<strong>und</strong>heitsförderung zu heben. Mit der „BÄRENBURG“ schuf „Grosse schützen Kleine“ inZusammenarbeit mit der Steiermärkischen Krankenanstalten Gesellschaft (KAGes) <strong>und</strong>dem LKH-Univ. Klinikum Graz das erste Kindersicherheitszentrum in Österreichnach australischem Modell. Im Kinderzentrum des LKH Univ. Klinikum Graz, das sowohldie Kinderklinik als auch die Kinderchirurgie umfasst, werden jährlich r<strong>und</strong> 140.000 kleinePatientInnen ambulant <strong>und</strong> stationär betreut. An der Univ. Klinik für Kinder- <strong>und</strong> Jugendchirurgiewerden jährlich 12.000 Kinderunfälle behandelt. Diese Zahlen veranschaulichen,welch großes Potenzial für die Bewusstseinsbildung im Bereich Kindersicherheit imdirekten Kontakt mit den Eltern im unmittelbaren Krankenhausbereich liegt.Eltern, deren Kinder aufgr<strong>und</strong> eines Unfalles oder einer Krankheit medizinischer Versorgungbedürfen, sind in einer Ausnahmesituation – im Vordergr<strong>und</strong> steht die Sorge umdas Kind. Dies ist jedoch auch der Zeitpunkt, zu dem Eltern Informationen zumThema Krankheits- <strong>und</strong> Unfallvorsorge besonders offen gegenüber stehen <strong>und</strong>entsprechende Tipps gerne annehmen. Zumeist sind Eltern mit ihren Kindern im Zugeder Untersuchungen auch in einer Warteposition, in der sie Zeit haben, sich Informationendurchzulesen oder praktische Anwendungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Kinderunfällenanzusehen. Als erstes österreichisches Zentrum für Kindersicherheit trägt die„BÄRENBURG“ im LKH Univ. Klinikum Graz diesen Ansprüchen Rechnung <strong>und</strong> holt Elterndort ab, wo sie gerade stehen – sei es, dass sie ein Beratungsgespräch suchen, Informationin Form von Broschüren mitnehmen wollen oder sich in der kindersicher ausgestattetenSchauwohnung praktische Präventionsmaßnahmen zeigen lassen möchten.Der Kinderspielplatz <strong>und</strong> die Kinderbibliothek, die sich in der Nähe des Kinderzentrumsbefinden <strong>und</strong> sich auch großer Beliebtheit bei Eltern <strong>und</strong> Kindern erfreuen, sindebenfalls in die „BÄRENBURG“ integriert.Die „BÄRENBURG – Kindersicherheitshaus Graz“ bietet Eltern sowie den MitarbeiterInnendes LKH-Univ. Klinikums Graz <strong>und</strong> allen Interessierten aus der Region:1. Beratungsgespräche zur Prävention von Kinderunfällen (Heim/Freizeit/Sport/Verkehr)2. Berufsgruppenspezifische Schulungen zum Thema Kindersicherheit3. Beratung zur Spielplatzsicherheit4. Produktion <strong>und</strong> Verteilung von Informationsbroschüren5. Aufklärung <strong>und</strong> Information zum Thema Produktsicherheit6. Präsentationsräume zu passiven Schutzeinrichtungen für den Haushalt in Form einerSchauwohnung7. Planung <strong>und</strong> Durchführung von Kindersicherheitsaktionen8. Unfallursachenforschung zur Kinderunfallverhütung in enger Kooperation mit der Abteilungfür Unfallforschung <strong>und</strong> -prophylaxe der Univ.-Klinik für Kinder- <strong>und</strong> Jugendchirurgiein Graz82
Kapitel 2 | BeispieleKindersicherer BezirkZiele <strong>und</strong> MaßnahmenDas Konzept einer „Sicheren Gemeinde“ wurde im Rahmen der 1. Weltkonferenz zurUnfallverhütung in Stockholm im Jahre 1989 vorgestellt. Diesem Konzept liegt eineIdee zugr<strong>und</strong>e, die in der Praxis bereits seit den siebziger Jahren des letzten Jahrh<strong>und</strong>ertsin verschiedenen Gemeinden Europas umgesetzt wurde. Gr<strong>und</strong>intention dabei istes, keine neuen Organisationen zu schaffen, sondern mit bereits existierenden Organisationen,Vereinen <strong>und</strong> Institutionen über eine leitende <strong>und</strong> koordinierendeStelle alle Kräfte <strong>und</strong> Anstrengungen im Bereich der Unfallverhütung zu bündeln<strong>und</strong> möglichst effizient <strong>und</strong> effektiv einzusetzen.„Grosse schützen Kleine“ bündelt in diesem Sinne nun mit Unterstützung des Ges<strong>und</strong>heits-<strong>und</strong> der Gemeinderessorts des Landes Steiermark durch das Projekt „KindersichererBezirk“ alle Anstrengungen im Bereich der Kinderunfallverhütung im Bezirk Deutschlandsberg,um mit einem konzentrierten Einsatz der Mittel eine effektive Senkung derKinderunfallzahlen zu erreichen.Das Projekt „Kindersicherer Bezirk“ wird als Pilotprojekt im Bezirk Deutschlandsbergüber einen Zeitraum von drei Jahren durchgeführt. Vor allem tödliche Unfälle<strong>und</strong> Unfälle mit bleibender Behinderung sollen wesentlich reduziert werden. Damit dieseAnforderung erfüllt werden kann, wird in Zusammenarbeit mit dem lokalen Krankenhaus,den AllgemeinmedizinerInnen <strong>und</strong> FachärztInnen sowie mit Unterstützung des UniversitätsklinikumsGraz eine Analyse der Unfalldaten durchgeführt. Als Nahtstelle zur regionalenGes<strong>und</strong>heitsförderung fungiert „Grosse schützen Kleine“ als Projektträger <strong>und</strong> integriertdie Steiermärkische Krankenanstalten Gesellschaft (KAGes) als Verantwortungsträgermit ihren Krankenhäusern in Deutschlandsberg, Wagna <strong>und</strong> Graz in die Basiserhebungder Kinderunfalldaten. Prioritäten für Maßnahmen zur Kinderunfallverhütung ergebensich in Folge aus den erhobenen Krankenhausdaten, den Unfalldaten der niedergelassenenÄrztInnen <strong>und</strong> aus einer repräsentativen Umfrage mit Eltern von Kindern imAlter von 0-17 Jahren, bei der Detailinformationen zu Risikobewusstsein <strong>und</strong> Gefahreneinschätzungerhoben werden. Institutionen <strong>und</strong> Einrichtungen, die vor Ort in den Bereichender Ges<strong>und</strong>en Gemeinden, Ersten Hilfe, des Brandschutzes, der Verkehrs- <strong>und</strong>Schulsicherheit tätig sind, werden in die Umsetzung der Präventionsmaßnahmen eingeb<strong>und</strong>en.Entsprechend setzt der „Kindersichere Bezirk“ auch die WHO-Strategie „Partnerschaftenfür Ges<strong>und</strong>heit“ um (vgl. Jakarta-Deklaration, WHO 1998).Ziel ist es, während der dreijährigen Projektlaufzeit in der Interventionsregion die relativeKinderunfallhäufigkeit um 10% zu senken. Für die Kontrolle <strong>und</strong> dementsprechendewissenschaftliche Auswertung ist das Projekt in vier Phasen gegliedert:1. Erhebung der Basisdaten als Gr<strong>und</strong>lage für die Entwicklung von Interventionsstrategien2. Erarbeitung <strong>und</strong> Umsetzung eines Interventionsplanes3. Erfolgskontrolle4. Implementierung im gesamten B<strong>und</strong>eslandDie einzelnen Teilschritte innerhalb des Phasenmodells basieren auf einer stufenweisen<strong>und</strong> multiplen Vorgangsweise:• Epidemiologische Datenerfassung (unter gleichzeitiger Heranziehung eines Kontrollbezirkes)• Auswahl von Risikogruppen <strong>und</strong> Bewertung der Unfallschwere• Aufbau einer interdisziplinären Projektgruppe mit möglichst breiter lokaler Streuung• Erarbeitung eines gemeinsamen Strategie- <strong>und</strong> Aktionsplanes• Umsetzung <strong>und</strong> Implementierung des Aktionsplanes• Evaluierung der Maßnahmen <strong>und</strong> epidemiologische Datenerfassung in der Interventions-<strong>und</strong> Kontrollregion83
Kapitel 2 | Beispiele• Modifikation der Ausgangsüberlegungen <strong>und</strong> ZielsetzungenSteiermarkweite UmsetzungNach drei Jahren wird auf Basis der gewonnenen Ergebnisse das Projekt überarbeitet <strong>und</strong>als Modell für die gesamte Steiermark ausformuliert. In der Projektregion selbst sollenjene Strukturen, die im Bereich Kindersicherheit geschaffen <strong>und</strong> gestärkt wurden, imSinne einer umfassenden Ges<strong>und</strong>heitsförderung eine nachhaltige Verankerung finden.Das Projekt „Kindersicherer Bezirk“ entspricht mit seiner Zielsetzung <strong>und</strong> der Art der Umsetzungden im Jahr 2006/2007 im Auftrag des Ges<strong>und</strong>heitsressorts erarbeiteten Ges<strong>und</strong>heitszielenfür die Steiermark 28 . Darin wurde die Unfallverhütungsarbeit alseines von acht Kernthemen für die Schaffung von Rahmenbedingungen für einges<strong>und</strong>es Leben in der Steiermark definiert. Die 25-jährige Arbeit von „Grosse schützenKleine“ wird in diesem Zusammenhang als beispielgebend für die Schaffung eines entsprechendenUmfeldes zur Reduzierung der Unfälle <strong>und</strong> der damit einhergehenden Ges<strong>und</strong>heitsfolgenbeschrieben.Conclusio:Unfallverhütung ist wie viele andere Themen im Ges<strong>und</strong>heitsförderungsbereichein Langzeitauftrag. Ziel ist die Schaffung einer „Culture of Safety“ innerhalb der Gesellschaft<strong>und</strong> ihrer Strukturen, wie es in vielen skandinavischen Ländern bereits der Fallist.Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereines im Jahr 2003 hat „Grosse schützenKleine“ die Entwicklung der Kinderunfallzahlen in Österreich analysiert. Durch Weiterentwicklungenin technischen Bereichen, Verbesserungen der Lebens- <strong>und</strong> Wohnumstände,die Einführung nachweislich effizienter Gesetzgebungen zur Erhöhung der Kindersicherheit,entsprechende Angebote der Wirtschaft sowie aufgr<strong>und</strong> regelmäßiger Aufklärungskampagnen<strong>und</strong> der damit einhergehenden Sensibilisierung für Gefahrenbereiche konntegezeigt werden, dass Kindersicherheit nachhaltig gesteigert werden kann. Die Kinderunfallzahlensind innerhalb von 20 Jahren in Österreich signifikant gesunken: Im Bereichder nichttödlichen Kinderunfälle um 37% <strong>und</strong> im Bereich der tödlichen Kinderunfällesogar um 75%. Durch gemeinsame Anstrengungen vieler Institutionen <strong>und</strong> Einrichtungenkonnte - wie der Rückgang der Kinderunfälle in Österreich zeigt - sehr viel erreicht werden,trotzdem gibt es nach wie vor viel zu tun. Abgesehen vom Leid für die Betroffenen<strong>und</strong> ihre Familie verursachen Unfälle auch enorme Kosten für die Volkswirtschaft. Unfällein allen Altersgruppen kosten den österreichischen Staat jährlich r<strong>und</strong> 18 Milliarden Euro.Ebenso gilt es, Trends im Unfallgeschehen zu beobachten <strong>und</strong> darauf entsprechend zureagieren. Dies betrifft zum Beispiel die Einführung neuer Produkte am Markt <strong>und</strong> derenVerwendung durch Kinder <strong>und</strong> Erwachsene, aber auch Änderungen in den Lebensgewohnheitender Menschen, wie die vermehrte Verwendung von Swimmingpools <strong>und</strong> Biotopenim eigenen Garten, die in den letzten Jahren zu einem erhöhten Risikopotenzial fürkindliche Ertrinkungsunfälle geführt hat.„Grosse schützen Kleine“ hat in Kooperation mit Ges<strong>und</strong>heitsfördernden Krankenhäuserndie Möglichkeit, durch prospektive <strong>und</strong> retrospektive Unfalldatenerfassung einen wichtigenBeitrag in der frühzeitigen Erkennung von Unfalltrends zu liefern <strong>und</strong> bildetdaher mit dem Krankenhaus die Schnittstelle für eine effektive regionale Ges<strong>und</strong>heitsförderung.28 Die steirischen Ges<strong>und</strong>heitsziele sind online zugänglich überhttp://www.ges<strong>und</strong>heit.steiermark.at/cms/beitrag/10743729/958620984
Kapitel 2 | BeispieleLiteraturWorld Health Organization – Regional Office for Europe (1997): The Jakarta Declaration on LeadingHealth Promotion into the 21st Century. Geneva: World Health OrganizationMehr Informationen zur Arbeit von „Grosse schützen Kleine“ gibt es im Internet unterhttp://www.grosse-schuetzen-kleine.at85
Kapitel 2 | Beispiele2.8Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Setting-Entwicklung amBeispiel der Kooperation Ges<strong>und</strong>heitsfördernder<strong>und</strong> Rauchfreier Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenChristina DIETSCHER, Sonja NOVAK-ZEZULADer Tabakkonsum wird in den Industrieländern derzeit als bedeutendstes einzelnes Ges<strong>und</strong>heitsrisiko<strong>und</strong> als führende Ursache frühzeitiger Mortalität angesehen. Allein in Österreichsterben pro Jahr r<strong>und</strong> 14.000 Menschen an tabakabhängigen Erkrankungen (vgl.Österreichische ARGE Suchtprävention 2006). Der Nichtraucherschutz <strong>und</strong> die Motivationvon RaucherInnen zu Lebensstiländerungen (Rauchstopp oder zumindest Reduktion desRauchverhaltens) sind daher vorrangige Ziele von Prävention <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung.Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen – vor allem jene, die sich auch ges<strong>und</strong>heitsfördernd nennen –sind nicht nur aufgr<strong>und</strong> ihrer Expertise wichtige Partner in der Umsetzung dieses Ziels.Sie sind auch selbst in mehrfacher Weise betroffen:• Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen behandeln Personen, die bereits an den Folgen des Tabakkonsumsleiden, ebenso wie RaucherInnen, bei denen noch keine erkennbaren Folgenaufgetreten sind. Beide Gruppen können von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen in der Einleitungvon Lebensstilveränderungen unterstützt werden. Bei der zweiten Gruppegeht es vor allem auch um die routinemäßige Feststellung problematischenRauchverhaltens (z.B. im Rahmen der Anamnese) <strong>und</strong> um die Bewusstmachungdes mit dem Tabakkonsum verb<strong>und</strong>enen Risikos bei den betroffenen Personen(vgl. dazu auch die Beschreibung der patientenbezogenen Standards 2, „Patienteneinschätzung“,<strong>und</strong> 3, „Patienteninformation <strong>und</strong> -intervention in Kapitel 1.2).• Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen sind wichtige Arbeitgeber mit einem z.T. überdurchschnittlichhohen Raucheranteil in der Belegschaft. Auch für diese Zielgruppe geht es– sowohl im Sinne der eigenen Ges<strong>und</strong>heit der MitarbeiterInnen als auch im Sinne derVorbildwirkung bei PatientInnen <strong>und</strong> BesucherInnen – um Angebote zur Unterstützungeiner Lebensstiländerung (vgl. dazu auch die Beschreibung des mitarbeiterbezogenenStandards 4, „Förderung eines ges<strong>und</strong>en Arbeitsplatzes“, in Kapitel1.2).• Sowohl für PatientInnen als auch für MitarbeiterInnen geht es auch um einen effektivenNichtraucherschutz.An der Entwicklung <strong>und</strong> Umsetzung geeigneter Maßnahmen wird im internationalenNetzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (HPH)schon lange gearbeitet. Bereits im Rahmen der Ersten Internationalen Konferenz Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser "Establishing a New Structure of the Network:The European Pilot Hospital Project & Tobacco-Free Hospitals" (Warschau, 1993)wurde eine internationale HPH-Arbeitsgruppe zum Thema eingerichtet, <strong>und</strong> seit etwa 10Jahren sind Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen durch Vorgaben der WHO zueiner Nichtrauchen-Politik verpflichtet. Lange Zeit blieb die Umsetzung von Tabakstrategienim Netzwerk dennoch ein Randthema: Die herrschende europäische Kultur sah inLebensstilinterventionen einen Eingriff in die persönliche Freiheit. Erst allmählich setztesich von den USA kommend die Meinung durch, dass Tabak kein Genuss-, sondern einSuchtmittel mit massiv schädigender Wirkung ist, <strong>und</strong> immer mehr europäische Länderverschärften ihre entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. So gilt z.B. für Österreich,dass öffentliche Gebäude, zu denen ja auch Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen gehören, rauchfreizu sein haben 29 .29 vgl. österreichisches Tabakgesetz (167. B<strong>und</strong>esgesetz, mit dem das B<strong>und</strong>esgesetz über das Herstellen <strong>und</strong>das In-Verkehr-Bringen von Tabakerzeugnissen sowie die Werbung für Tabakerzeugnisse <strong>und</strong> den Nichtraucherschutz(Tabakgesetz) geändert wird), § 13, Nichtraucherschutz, in der Fassung von 200486
Kapitel 2 | BeispieleDie gesetzlichen Regelungen geben Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen allerdings keinUmsetzungswerkzeug an die Hand – die bisherige Praxis hat gezeigt, dass die Einrichtungrauchfreier Einrichtungen ein komplexes <strong>und</strong> schwieriges Unterfangen ist. Wederin Österreich noch international führten Gesetze bislang zu einer systematischen Umsetzungvon Nichtraucherschutz <strong>und</strong> Tabakentwöhnung in Krankenhäusern <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen.Wie etwa über Präsentationen bei internationalen HPH-Konferenzensichtbar wird, setzen tabakbezogene Maßnahmen häufig noch immer punktuell <strong>und</strong> wenigerim Rahmen eines umfassenden Gesamtansatzes an. Um Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenvor diesem Hintergr<strong>und</strong> darin zu unterstützen, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen<strong>und</strong> dabei den entscheidenden Schritt von Einzelmaßnahmen zur Politik-<strong>und</strong> Strategieentwicklung zu gehen, wurde in den letzten Jahren eine umfassendeKooperation zwischen dem internationalen HPH-Netzwerk <strong>und</strong> dem EuropäischenNetzwerk Rauchfreier Krankenhäuser (ENSH) entwickelt. Der jüngsteSchritt dieser Kooperation war die Gründung einer internationalen Arbeitsgruppe im Mai2008, in der VertreterInnen beider Netzwerke kooperieren – mit dem Ziel, möglichst vieleGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen zu erreichen, sie in der Nutzung der vom ENSH entwickeltenInstrumente zur Etablierung von Rauchfreiheit in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen zu unterstützen<strong>und</strong> an der Weiterentwicklung dieser Instrumente zu arbeiten.In Deutschland <strong>und</strong> Österreich sind heute die Koordinationsstellen für Ges<strong>und</strong>heitsfördernde<strong>und</strong> Rauchfreie Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen gekoppelt, um entsprechende Synergienzwischen beiden Netzwerken nutzen zu können. Das Österreichische Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (ONGKG) hat seit2007 eine eigene Sektion „Rauchfreie Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen“, die die Instrumentedes ENSH in Österreich verbreitet <strong>und</strong> gemäß den Richtlinien des ENSH ZertifizierungenRauchfreier Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen in Österreich vornimmt. Im Folgenden werden dieInstrumente des ENSH, die Gr<strong>und</strong>lage dieses Zertifizierungsprogramms sind, vorgestellt.Die Instrumente des Europäischen NetzwerksRauchfreier Krankenhäuser <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (ENSH)Kodex <strong>und</strong> StandardsDas ENSH wurde 1999 mit dem Ziel der Förderung <strong>und</strong> Unterstützung von Krankenhäusern<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen auf dem Weg zur Rauchfreiheit gegründet. Der Kodex,in dem die Gr<strong>und</strong>sätze des ENSH dargelegt sind, verpflichtet seine Mitgliedseinrichtungenzu umfassenden Bemühungen zur Reduktion des Tabakkonsums <strong>und</strong> seinerschädlichen Ges<strong>und</strong>heitsfolgen bei MitarbeiterInnen, PatientInnen <strong>und</strong> BesucherInnen.Im Sinne des Setting-Ansatzes der Ges<strong>und</strong>heitsförderung (vgl. z.B. Dooris et al. 2007)werden dazu personen- <strong>und</strong> situationsbezogene Interventionen kombiniert, die vonder Schaffung einer rauchfreien Umgebung zum Schutz der NichtraucherInnen bis zuraktiven Unterstützung von RaucherInnen bei der Tabakentwöhnung reichen.Im Detail umfasst der Kodex die im folgenden dargestellten Anforderungen, zu denenjeweils auch Standards mit ausgearbeiteten Fragen zur Selbstbewertung vorliegen:1. Engagement: Alle EntscheidungsträgerInnen werden in die Aktivitäten zum rauchfreienKrankenhaus einbezogen <strong>und</strong> wirken an dessen Umsetzung mit. Krankenhauspersonal<strong>und</strong> PatientInnen werden darüber informiert.2. Information: Eine Arbeitsgruppe wird eingerichtet, ein Strategie- <strong>und</strong> Maßnahmenplanwird entwickelt.3. Schulung <strong>und</strong> Prävention: Das Krankenhauspersonal erhält Informationen <strong>und</strong>Schulungen zur Unterstützung der PatientInnen in der Tabakentwöhnung.4. Unterstützung bei der Tabakentwöhnung: Tabakentwöhnungsmaßnahmen fürPatientInnen <strong>und</strong> Personal werden angeboten.87
Kapitel 2 | Beispiele5. Rauchverbote: Raucherbereiche – solange ihr Vorhandensein als notwendig erachtetwird – sind von klinischen Bereichen <strong>und</strong> Aufnahmebereichen strikt getrennt. Sie sinddeutlich ausgewiesen.6. Einschränkung der Anreize zum Rauchen: Eine ausreichende Beschilderung (auchPoster, Wegweiser etc.) weist auf das generelle Rauchverbot hin. Tabakautomaten<strong>und</strong> Aschenbecher werden aus dem Krankenhausgebäude <strong>und</strong> vom Gelände entfernt.7. Ges<strong>und</strong>e Arbeitsplätze: Die Ges<strong>und</strong>heit des Krankenhauspersonals wird durchNichtraucherschutz <strong>und</strong> Tabakentwöhnungsmaßnahmen im Krankenhaus gefördert.8. Förderung des Nichtrauchens: Das Krankenhaus unterstützt Aktionen zur Förderungdes Nichtrauchens.9. Überprüfung der Aktivitäten zum rauchfreien Krankenhaus: Informationsmaterialienwerden laufend aktualisiert. Die Einhaltung der Nichtraucherschutzregelungenwird ständig geprüft <strong>und</strong> dokumentiert.10. Langfristige UmsetzungZur Unterstützung der Umsetzung des Kodex hat das ENSH eine Reihe von Instrumenten(Fragebogen, Leitfaden) für den Einsatz in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen entwickelt.Diese Instrumente liegen in einer Übersetzung der deutschen ENSH-Kontaktstelle indeutscher Sprache vor <strong>und</strong> können in Österreich über die Geschäftsstelle des ÖsterreichischenNetzwerks Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG) bezogen werden. Als Anreiz für Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen, die zugegeben anspruchsvollenZiele des ENSH umzusetzen, hat das ENSH ein Zertifizierungsprogrammentwickelt.Zertifizierung zur Rauchfreien Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungDie Selbsteinschätzung nach den europäischen StandardsDie Selbsteinschätzung nach den europäischen Standards für Rauchfreie Krankenhäuser<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (vgl. Kodex oben) ermöglicht eine Stärken-Schwächen-Analyse in Bezug auf die Rauchfrei-Strategie einer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung.Auf dieser Basis können Aktionspläne zur Verbesserung der Situation entwickeltwerden. Eine wiederholte Durchführung der Selbsteinschätzung erlaubt die nachvollziehbareDokumentation der erzielten Entwicklungen.Europäische Zertifikate für Rauchfreie Krankenhäuser <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenJe nach Stand der Umsetzung können Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen Zertifikate in den StufenBronze, Silber <strong>und</strong> Gold erlangen. Die Zertifikate haben eine Gültigkeit von zweiJahren, danach ist eine Rezertifizierung möglich <strong>und</strong> wünschenswert.Mindestvoraussetzung zur Erlangung eines Zertifikats ist die Einreichung einesschriftlichen Antrags <strong>und</strong> die Erklärung der Leitung des Hauses zum Engagement inder Umsetzung des europäischen Kodex. Weiters muss eine erste Selbsteinschätzungnach den europäischen Standards eingereicht werden <strong>und</strong> einE AnsprechpartnerInfür das Rauchfrei-Projekt in der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung benannt sein. Die weiterenBedingungen unterscheiden sich je nach Zertifizierungsniveau (vgl. Abbildung 7 unten).88
Kapitel 2 | BeispieleAbbildung 7: Die drei Zertifizierungs-Levels des ENSHGOLDSILBERDie Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung ist vollständig rauchfrei, sowohl in denGebäuden als auch im Areal – alle Punkte des Kodex sind voll <strong>und</strong>ganz umgesetzt.Das Mindestmaß zum Schutz der NichtraucherInnen in derGes<strong>und</strong>heitseinrichtung ist erreicht – der Kodex ist zu 75%umgesetzt.Benennung eines / einer Verantwortlichen <strong>und</strong>BRONZEmindestens 18 Punkte in den Standards 1 <strong>und</strong> 2nach dem KodexIn Österreich werden Zertifizierungen nach diesem Schema seit 2007 durchgeführt. Biszur Drucklegung dieser Broschüre wurden bereits acht österreichische Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungennach dem ENHS-Kodex als Rauchfreie Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung auf der Bronze-Stufe zertifiziert, weitere Einrichtungen befinden sich im Zertifizierungsverfahren:Bronze-Zertifizierungen im Jahr 2007:• A.ö. Krankenhaus der Stadt Linz• A.ö. Landeskrankenhaus - Universitätsklinikum Graz• A.ö. Landeskrankenhaus Klagenfurt• LKH Salzburg- St. Johannsspital• Christian Doppler-Klinik• Landesklinik St. VeitBronze-Zertifizierungen im Jahr 2008:• Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz• Krankenhaus der Elisabethinen LinzSchlussfolgerungen <strong>und</strong> AusblickAufgr<strong>und</strong> der Evidenzlage sind Nichtraucherschutz <strong>und</strong> Raucherentwöhnungwichtige Ziele der Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> vor allem auch ges<strong>und</strong>heitsfördernderGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen. Mit dem vom ENSH entwickelten Instrumentarium liegenerprobte <strong>und</strong> wirksame Hilfen für Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen in der Weiterentwicklungihrer diesbezüglichen Strategien <strong>und</strong> Maßnahmen vor.Das große Interesse österreichischer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen an diesen Instrumentenzeigt, dass viele Einrichtungen nach einer geeigneten Unterstützung in der Umsetzungihres gesetzlichen Auftrags zum Nichtraucherschutz suchen.Das österreichische Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG) hat das Thema mit seiner 2007 gegründeten Sektion „RauchfreieGes<strong>und</strong>heitseinrichtung“ aufgegriffen. Im Rahmen der Jahreskonferenzen des ONGKGwerden von der Sektion spezifische Informations- <strong>und</strong> Trainingsworkshops fürinteressierte Einrichtungen angeboten, sodass für die Zukunft eine weitere Verbreitung<strong>und</strong> Qualitätsentwicklung von Rauchfrei-Strategien in österreichischen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenerwartet werden kann.LiteraturEuropäisches Netzwerk Rauchfreier Krankenhäuser <strong>und</strong> Einrichtungen im Ges<strong>und</strong>heitswesen: Kodexdes Europäischen Netzwerkes rauchfreier Krankenhäuser, deutsche Übersetzung im Rahmendes Projektes "Rauchfrei am Arbeitsplatz", November 2003 durch die B<strong>und</strong>esvereinigung für Ges<strong>und</strong>heite.V.Dooris M:, Poland B., Kolbe L., de Leeuw E., McCall D.S., Wharf-Higgins J. (2007): Healty Settings.Building Evidence for the Effectiveness of Whole Systems Health Promotion – Challenges and Fu-89
Kapitel 2 | Beispieleture Directions. In: McQueen D.V., Jones C. (2002): Global Perspectives of Health Promotion Effectiveness.New York: Springer, p. 327-352Österreichische ARGE Suchtvorbeugung (2006). Tabak.http://www.praevention.at/upload/products/Tabak.pdf (Zugriff am 15.08.2008)90
Kapitel 2 | Beispiele2.9Beiträge der Ges<strong>und</strong>heitsförderung zurPatientensicherheitÜbersetzte <strong>und</strong> redigierte Fassung eines Arbeitspapiers der internationalen HPH-Arbeitsgruppe „Patient Safety in Health Promoting Hospitals“ 30Probleme der Patientensicherheit sind nachweislich für eine hohe Anzahl vermeidbarerTodesfälle <strong>und</strong> verminderter Lebensqualität von PatientInnen verantwortlich(Kohn et al. 2000). Aus diesem Gr<strong>und</strong> arbeiten internationale Organisationenwie die WHO (vgl. WHO World Alliance for Patient Safety 2006), die EuropäischeKommission (auf Initiative der EU-Präsidentschaft Großbritanniens im Jahr 2005; vgl.European Commission 2005, 2006) <strong>und</strong> Qualitätsunternehmen wie die Joint Commission(vgl. Joint Commission 2007) intensiv an Strategien zur Verbesserung der Patientensicherheit.Auch in der aktuellen Strategie der WHO (Regionalbüro für Europa “StrengthenedHealth Systems Save More Lives”, WHO-Euro 2005) spielt Patientensicherheit einewichtige Rolle.Adäquate Patientensicherheit ist nicht nur eine wichtige Gr<strong>und</strong>voraussetzung für effektiveGes<strong>und</strong>heitsförderung (die ohne eine sichere Basisversorgung als sinnloser Luxus erschiene),sondern Ges<strong>und</strong>heitsförderung kann auch zur Verbesserung der Patientensicherheitbeitragen. Daher wurde im Jahr 2006 eine Arbeitsgruppe des internationalenNetzwerks Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(HPH) eingesetzt, um die Synergien zwischen beiden Ansätzen herauszuarbeiten <strong>und</strong>entsprechende Empfehlungen zu formulieren.Wie kann Ges<strong>und</strong>heitsförderung zur Patientensicherheitbeitragen?Entsprechend den internationalen HPH-Statuten, die am 14. Mai 2008 verabschiedetwurden (siehe Anhang 5.3), zielt HPH auf mehr Ges<strong>und</strong>heitsgewinn für PatientInnen,MitarbeiterInnen <strong>und</strong> die regionale Bevölkerung ab. Ohne adäquate Patientensicherheitist dieses anspruchsvolle Ziel nicht zu erreichen: PatientInnen imSinne des Hippokratischen Eids keinen Schaden zuzufügen, ist die absolute Gr<strong>und</strong>voraussetzung– auch wenn dies anspruchsvoll genug ist, sind klinische Interventionen dochtrotz ihrer unbestritten positiven Wirkungen auch riskant: Neben den Fehlern, die imRoutinebetrieb passieren können – z.B. Verwechslungen von Bef<strong>und</strong>en oder bei der Medikamentenvergabe– müssen in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen u.a. PatientInnen mit übertragbarenKrankheiten behandelt werden, ohne dass dabei andere PatientInnen gefährdetwerden. Gerade bei PatientInnen mit schweren <strong>und</strong> unter Umständen tödlichen Erkrankungenkommen invasive Techniken wie Chemotherapien zum Einsatz, deren Anwendungzur Wiederherstellung der Ges<strong>und</strong>heit oder zumindest zur Lebensverlängerungerforderlich ist, die aber immer mit einem Restrisiko verb<strong>und</strong>en sind.Bislang liegt eine Vielzahl von Standards, Leitlinien <strong>und</strong> Instrumenten vor, die unterschiedlichsteAspekte der Patientensicherheit behandeln, darunter die Verbesserung derprofessionellen Kommunikation, der eindeutigen Identifikation von PatientInnen, der Medikamentenvergabe<strong>und</strong> chirurgischer Abläufe <strong>und</strong> die Reduktion von Krankenhausinfektion<strong>und</strong> Stürzen. Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen brauchen also das Rad30 Mitglieder der Gruppe sind: Dr. Zora Bruchacova (Koordinatorin, HPH-Netzwerk Slowakei, Mag. Christina Dietscher(Koordinatorin ONGKG), Dr. Carlo Favaretti (Koordinator, HPH-Netzwerk Italien), Oliver Gröne (ehem.WHO-Euro), Maria Hallman-Keiskoski (Finnisches HPH-Netzwerk), Dr. Milena Kalvachova (Koordinatorin, TschechischesHPH-Netzwerk), Dr. Jerzy Karski (Koordinator, Polnisches HPH-Netzwerk), Dr. Margareta Kristenson(Koordinatorin, Schwedisches HPH-Netzwerk), Univ.Prof. Dr. Jürgen M. Pelikan (Direktor, WHO-Kooperationszentrum für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Krankenhaus <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen), Dr. Luigi Resegotti(Koordinator, HPH-Regionalnetwerk Piemont), <strong>und</strong> James Robinson (Schottland)91
Kapitel 2 | Beispieleder Patientensicherheit nicht neu zu erfinden, <strong>und</strong> es ist zu wünschen, dass jede Ges<strong>und</strong>heitsförderndeGes<strong>und</strong>heitseinrichtung sich auch umfassend mit Patientensicherheitbeschäftigt. Umgekehrt können Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenaber auch spezifische eigene Beiträge zur Patientensicherheit leisten.Beiträge Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen zurVerbesserung der PatientensicherheitDie praktische Umsetzung von Maßnahmen zur Patientensicherheit ist trotz der bekanntenRisiken <strong>und</strong> der verfügbaren Instrumente bisher hinter den Erwartungenzurückgeblieben (Leape / Berwick 2005) – denn die Veränderung organisationaler Praxisist äußerst voraussetzungsreich: Aus der Organisationsforschung weiß man, dass dieQualitäten von Führung <strong>und</strong> Management, Organisationskultur <strong>und</strong> Kommunikation entscheidendeFaktoren in der Veränderung von Organisationen sind (Read 2000). Diesstellt gerade Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen vor besondere Herausforderungen, denn sie gehörennach Mintzberg (1997) dem Typus der „Expertenorganisation“ an, in der das Managementtraditionell einen schweren Stand hat.Im Konzept „Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung“ wird der Organisationsentwicklungdaher besonderes Augenmerk gewidmet – <strong>und</strong> davon könnten auch andereEntwicklungsstrategien profitieren. Denn es scheint, dass Organisationen, die bereits eineReformstrategie erfolgreich implementiert haben <strong>und</strong> damit über Erfahrungen in Veränderungsprozessenverfügen, auch mit neuen Strategien besser zurecht kommen. Nebendiesem allgemeinen sind die folgenden spezifischen Beiträge der Ges<strong>und</strong>heitsförderungzur Patientensicherheit zu nennen:Umfassendes Ges<strong>und</strong>heitsverständnisWichtiges Ziel der Patientensicherheit ist vor allem die physische Ges<strong>und</strong>heit der PatientInnen.Aus dem umfassenden, somato-psycho-sozialen Ges<strong>und</strong>heitsverständnis der Ges<strong>und</strong>heitsförderungkann man lernen, dass die Unterstützung der psychischen <strong>und</strong> sozialenDimensionen wesentlich zu diesem Ziel beitragen können:1. Psychische / mentale Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Patientensicherheit: Ein Krankenhausaufenthaltist für die PatientInnen häufig mit Ängsten <strong>und</strong> Stress verb<strong>und</strong>en, die zuMissverständnissen führen <strong>und</strong> Barrieren für die Compliance <strong>und</strong> die Kooperation inder Behandlung darstellen können. Einschränkungen der psychischen Ges<strong>und</strong>heitstellen in dieser Hinsicht ein wichtiges Risiko für die Patientensicherheit dar. Besondersdeutlich wird dies in der Psychiatrie, wo eingeschränkte Kommunikationsfähigkeitoder Aggression zu besonders hohen Sicherheitsproblemen führen (vgl. NationalPatient Safety Agency 2008). Die Förderung der psychischen Ges<strong>und</strong>heit bei PatientInnen,aber auch die Unterstützung des Personals im Umgang mit “schwierigen” PatientInnensind daher wichtige Beiträge zur Verbesserung der Patientensicherheit.2. Soziale Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Patientensicherheit: Aus der Forschung zur ges<strong>und</strong>heitlichenUngleichheit ist bekannt, dass ein niedriger sozio-ökonomischer Status zumindestin so fern mit Patientensicherheit zusammenhängt, als damit ein eingeschränkterZugang zu Ges<strong>und</strong>heitsleistungen <strong>und</strong> riskanteres Ges<strong>und</strong>heitsverhalten einschließlichproblematischer Selbstmedikation verb<strong>und</strong>en sind. Kulturelle Unterschiede <strong>und</strong>Sprachprobleme können derartige Probleme intensivieren <strong>und</strong> bedingen häufig reduzierteGes<strong>und</strong>heitskompetenz <strong>und</strong> eingeschränkte Kommunikations- <strong>und</strong> Kooperationsfähigkeitin der Behandlung <strong>und</strong> Betreuung. Vor allem für vulnerable Gruppen vonPatientInnen kann die Verbesserung der kulturellen Kompetenz in einer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungdaher auch zu einer Erhöhung der Patientensicherheit beitragen.92
Kapitel 2 | BeispieleGes<strong>und</strong>heitsförderung für MitarbeiterInnen – eine Determinante derPatientensicherheitKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen sind nicht nur für ihre PatientInnen, sondernauch für die MitarbeiterInnen riskant (vgl. European Fo<strong>und</strong>ation for the Improvementof Living and Working Conditions 2007). Das daraus resultierende hohe Belastungs<strong>und</strong>Stressniveau begünstigt die Entstehung von Überarbeitung, Burnout <strong>und</strong> Depressionen,die wiederum die Wahrscheinlichkeit von Fehlern erhöhen (vgl. z.B. Fahrenkopf etal. 2008).Adäquate Arbeitsbedingungen <strong>und</strong> ausreichende Personalbesetzung (vgl. Aiken2005) sind daher nicht nur Forderungen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung, sondern wichtigeVoraussetzungen der Patientensicherheit (vgl. auch Wu 2000). Dazu kommt, dassdie Einführung von Patientensicherheitsroutinen wie z.B. die Implementierung von Fehler-Monitoring-Systemenaufgr<strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen Gefahr möglicher Schuldzuschreibungenarbeitsklimatisch heikel sind. Der Erfolg entsprechender Bemühungenhängt wesentlich von der Bereitschaft der MitarbeiterInnen zur Einhaltung dieser Routinenab. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Existenz oder Entwicklung einer offenen,vertrauensvollen <strong>und</strong> nicht beschuldigenden Kultur (vgl. z.B. Firth-Cozens 2004).Verbesserung der Ges<strong>und</strong>heitskompetenz <strong>und</strong> des Empowerments vonPatientInnen für die Koproduktion in sicheren BehandlungsroutinenDas technische Management von Risiken ist eine wichtige Seite der Patientensicherheit.Die andere Seite ist die Verbesserung der Ges<strong>und</strong>heitskompetenz von PatientInnenals KoproduzentInnen ihrer Ges<strong>und</strong>heit durch professionelle Kommunikation<strong>und</strong> Kooperation, Patienteninformation <strong>und</strong> -schulung (vgl. z.B. Coulter 2006; Coulter /Ellins 2007). Hier gibt es deutliche Synergien zwischen Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Patientensicherheit,geht es doch um das Empowerment der PatientInnen zur aktiven Kooperationin der Behandlung <strong>und</strong> Betreuung. In einigen Fällen, zum Beispiel wenn esum die Vermeidung von chirurgischen Eingriffen auf der falschen Körperseite geht, kannes für die Sicherheit der PatientInnen bereits einen großen Unterschied machen, ob diezu operierende Stelle vor dem Eingriff noch einmal zwischen PatientIn <strong>und</strong> ProfessionistInnenbestätigt wird. Zur Unterstützung der Einbeziehung der PatientInnen in Sicherheitsfragenhat etwa die Joint Commission bereits im Jahr 2001 die Kampagne“Speak Up for Patient Safety” ins Leben gerufen, die PatientInnen ermutigt, Sicherheitsproblemeanzusprechen <strong>und</strong> sich für deren Verbesserung einzusetzen. Das Trainingvon MitarbeiterInnen in patientenorientierter Kommunikation, Informationsvermittlung<strong>und</strong> Schulung ist demnach eine wichtige Maßnahme nicht nur im Sinneder Ges<strong>und</strong>heitsförderung, sondern auch der Patientensicherheit.Weiterentwicklung der physischen <strong>und</strong> kulturellen UmgebungAuch in Bezug auf die Weiterentwicklung der Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung als physische <strong>und</strong>kulturelle Umgebung bzw. Setting gibt es deutliche Synergien zwischen Ges<strong>und</strong>heitsförderung<strong>und</strong> Patientensicherheit: Das Setting kann sich in unterschiedlicherWeise auf die Patientensicherheit auswirken, z.B. durch sichere oder unsichere Lagerung<strong>und</strong> Verteilung von Medikamenten (die einen Missbrauch oder Verwechslungen erleichternoder erschweren), oder über Infrastrukturen wie rutschsichere Böden <strong>und</strong>Haltegriffe zur Vermeidung von Unfällen. Die räumlichen Möglichkeiten können weitershinderlich oder förderlich für Kommunikation <strong>und</strong> Kooperation sein. In diesemSinn tragen auch das Design <strong>und</strong> die Informationssysteme zur Patientensicherheitbei.93
Kapitel 2 | BeispieleOrientierung an nachhaltigem Ges<strong>und</strong>heitsgewinnHPH zielt auf nachhaltigen Ges<strong>und</strong>heitsgewinn ab. Wichtig sind nicht nur die unmittelbarenErgebnisse von klinischen Interventionen, sondern die Langzeitwirkung auf die somato-psycho-sozialeGes<strong>und</strong>heit (messbar zumindest über klinische Outcomes, Zufriedenheit<strong>und</strong> Lebensqualität). Aus dieser Perspektive ergeben sich zumindest drei Verbindungenzur Patientensicherheit.1. Der übermäßige Einsatz von Behandlungstechnologien <strong>und</strong> vor allem unnötige Interventionenkönnen zu iatrogenen Patientenverletzungen führen (Youngberg, Hatlie2004). Die Vermeidung unnötiger Behandlungen sollte daher vor allem für Ges<strong>und</strong>heitsförderndeGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen ein wichtiges Ziel sein.2. Wie Forschungen von Tonnesen et al. (2005) belegen, können behandlungsbezogeneKomplikationsrisiken in manchen Fällen durch vorausschauende Planung reduziertwerden: So kann die Ermutigung der PatientInnen zu spezifischen Lebensstiländerungenvor chirurgischen Eingriffen (z.B. Rauchstopp, Verzicht auf Alkoholkonsum,spezifische kräftigende Gymnastik) Komplikationen nach der Intervention reduzieren.3. Die Orientierung an nachhaltigem Ges<strong>und</strong>heitsgewinn bedingt die Notwendigkeit zurVerbesserung der Kooperation <strong>und</strong> des Informationstransfers zwischen unterschiedlichenVersorgungsebenen. Daher sind Ansätze, die sich nicht nur aufeinzelne Einrichtungen beziehen, sondern die Nahtstellen im Blick haben (z.B. gemeinsamesTraining von MitarbeiterInnen unterschiedlicher Einrichtungen), besonderswichtig, um Sicherheit während der gesamten Patientenkarriere gewährleisten zukönnen (vgl. Kripalani et al. 2007).Literatur:Aiken L.H. (2005): Improving Patient Safety: The Link Between Nursing and Quality of Care.Research in Profile, 12. p 4Coulter A. (2006): Patient safety: what role can patients play? Health Expectations 9 (3), pp 205-206Coulter A., Ellins J. (2007): Effectiveness of strategies for informing, educating, and involvingpatients. British Medical Journal, 335 (7609), pp 24-27European Commission (Eds.) (2005): Luxembourg Declaration on Patient SafetyEuropean Commission (Eds.) (2006): Special Eurobarometer: Medical Errors. Luxembourg: DGSancoEuropean Fo<strong>und</strong>ation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eds., 2007): FourthEuropean Working Conditions Survey. Dublin: European Fo<strong>und</strong>ation for the Improvement of Livingand Working ConditionsFahrenkopf A.M., Sectish T., Barger L.K., Sharek P.J., Lewin D., Chiang V.W., Edwards S.,Wiedermann B.L., Landrigan C.P. (2008): Rates of medical errors among depressed and burnt outresidents: prospective cohort studie. In: British Medical Journal, published 7 February 2008,(http://www.bmj.com/cgi/content/full/bmj.39469.763218.Bev1?fmr, Zugriff am 3. April 2008)Firth-Cozens J. (2004): Organisational trust: the keystone to patient safety. Quality and Safety inHealth Care 13 (1), pp 56-61Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (2007): Meeting the InternationalPatient Safety Goals, 117 pages. ISBN: 978-1-59940-158-4Kripalani S., LeFevre F., Phillips C.O., Williams M.V., Basaviah P., Baker D.W. (2007): Deficits inCommunication and Information Transfer Between Hospital-Based and Primary Care Physicians:Implications for Patient Safety and Continuity of Care. Journal of the American Medical Association,297 (8), pp 831-84194
Kapitel 2 | BeispieleKohn L.T.; Corrigan J.M.; Donaldson M.S. (2000): To err is human: Building a safer health system.Washington: National Academy of SciencesLeape L.; Berwick D.M. (2005): Five Years After To Err Is Human: What Have We Learned? In:JAMA 293 (19), 2384-2390Mintzberg H. (1997): Toward Healthier Hospitals. In: Healthcare Management Review 22 (4), 9-18National Patient Safety Agency (2008): Independent investigation of serious patient safetyincidents in mental health services Good practice guidance. London: National Patient Safety AgencyRead A. (2000): Determinants of successful organisational innovation: A review of currentresearch. In: Journal of Management Practice, 3 (1), p. 96-119Tonnesen h.; Fugleholm A. M., Jorgensen,Svend Juul (2005): Evidence for health promotion inhospitals. In: Groene,Oliver; Garcia-Barbero,Mila (Eds.) (2005): Health promotion in hospitals:Evidence and quality management. Copenhagen: World Health Organization – Regional Office forEuropeWHO World Alliance for Patient Safety (Eds.)(2006): London Declaration. Patients for PatientSaftey. World Health OrganizationWorld Health Organization – Regional Office for Europe (2005): Strengthened Health Systems savemore lives. An insight into WHO’s European Health Systems’ Strategy. Copenhagen: World HealthOrganization – Regional Office for EuropeWu, A.W. (2000): Medical error: the second victim. The doctor who makes the mistake needs helptoo. In: British Medical Journal 2000 (320), pp. 726-727Youngberg B., Hatlie M.J. (2004): The Patient Safety Handbook. Sudbury: Jones & BartlettPublishers95
Kapitel 2 | Beispiele2.10Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Strategie fürTrägerorganisationen am Beispiel des WienerKrankenanstaltenverb<strong>und</strong>s (KAV)Christine PRAMERGr<strong>und</strong>lagen der Ges<strong>und</strong>heitsförderungsarbeit im WienerKrankenanstaltenverb<strong>und</strong>Im Leitbild des Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>s (Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>2003a) wird das Bekenntnis zu den Gedanken <strong>und</strong> Zielen umfassender Ges<strong>und</strong>heitsförderungals einer der Aspekte der kontinuierlichen Verbesserung der Leistungsqualität definiert.In der darauf aufbauenden Strategie der Qualitätsarbeit des KAV (Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>2003b) wird Ges<strong>und</strong>heitsförderung entsprechend als Bestandteileines integrierten Managements mit den vier Säulen Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement,Umweltmanagement <strong>und</strong> eben Ges<strong>und</strong>heitsförderung gesehen. Unter Ges<strong>und</strong>heitsförderungwerden im Dokument alle Aktivitäten <strong>und</strong> Handlungen verstanden, diezum Ziel haben, die Ges<strong>und</strong>heit von MitarbeiterInnen <strong>und</strong> PatientInnen zu erhalten <strong>und</strong>zu fördern, sowie MitarbeiterInnen <strong>und</strong> PatientInnen zur Stärkung ihrer Ges<strong>und</strong>heit zubefähigen. Auf diesen Gr<strong>und</strong>lagen wurde für die Umsetzung des Ges<strong>und</strong>heitsförderungsbereichs2005 ein eigenes Ges<strong>und</strong>heitsförderungskonzept erarbeitet, an dessen Umsetzungim KAV in den Jahren 2007-2011 mit Schwerpunkt auf die Zielgruppe der MitarbeiterInnengearbeitet wird.Der Stellenwert von Ges<strong>und</strong>heitsförderung im KAV kommt darüber hinaus durch Mitgliedschaftder Gesamtunternehmung mit derzeit 7 Einrichtungen (Stand: Oktober 2008) imÖsterreichischen Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG) zum Ausdruck.Gr<strong>und</strong>sätze der Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Leitbild des KAVDie Arbeitswelt, insbesondere die Erwerbsarbeit, ist einer der wesentlichsten Lebensbereichedes erwachsenen Menschen; Ges<strong>und</strong>heit am Arbeitsplatz ist für alle – Führungskräftewie auch MitarbeiterInnen – ein wichtiges Thema. Die große Leitlinie der Ges<strong>und</strong>heitsförderungist die Ottawa-Charta der WHO (1986), dort ist explizit festgehalten: „Ges<strong>und</strong>heitsförderungzielt auf den Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmungüber ihre Ges<strong>und</strong>heit zu ermöglichen <strong>und</strong> sie damit zur Stärkung ihrer Ges<strong>und</strong>heitzu befähigen.“ Ges<strong>und</strong>heit wird hier als dauerhafter Entwicklungsprozess verstanden,der nicht nur physische Aspekte betont, sondern auch psychische <strong>und</strong> sozialeDimensionen beinhaltet (vgl. Bamberg et. al. 1998).Der Kernbegriff in der Ottawa-Charta ist „Empowerment“, dieser zielt darauf ab, dassMenschen die Fähigkeit entwickeln <strong>und</strong> verbessern, ihre soziale Lebenswelt <strong>und</strong> ihr Lebenselbst zu gestalten <strong>und</strong> sich nicht gestalten zu lassen (Stark 1996).Ges<strong>und</strong>heitsförderung im KAV baut auf folgenden Gr<strong>und</strong>sätzen auf:• Verhaltensprävention• Verhältnisprävention• Setting-Ansatz <strong>und</strong>• Salutogenese96
Kapitel 2 | BeispieleVerhaltenspräventionVerhaltensprävention ist ein Sammelbegriff für Strategien, die die Beeinflussung vonges<strong>und</strong>heitsrelevanten Verhaltensweisen beinhalten. Verhaltensprävention kann abzielenauf:• die Initiierung <strong>und</strong> Stabilisierung von ges<strong>und</strong>heitsfördernden Verhaltensweisen (ges<strong>und</strong>eErnährung, körperliche Bewegung, safer sex...) oder• die Vermeidung <strong>und</strong> Veränderung von ges<strong>und</strong>heitsriskanten Verhaltensweisen (Rauchen,Alkoholmissbrauch, falsche Ernährung).VerhältnispräventionVerhältnisprävention steht für Strategien, die auf die Kontrolle, Reduzierung oder Beseitigungvon Ges<strong>und</strong>heitsrisiken in den Umwelt- <strong>und</strong> Lebensbedingungen, auf die Verringerungoder Beseitigung von Krankheits- <strong>und</strong> Unfallursachen in den allgemeinen Lebens-,Arbeits- <strong>und</strong> Umweltverhältnissen bzw. auf die Herstellung ges<strong>und</strong>er Verhältnisseabzielen. Es gibt drei klassische Felder der Verhältnisprävention:• die Veränderung der Arbeitsbedingungen in den Betrieben (Arbeitsschutz, Humanisierungder Arbeit);• kommunale Aktivitäten zur Verbesserung der öffentlichen hygienischen Wohn-, Verkehrs-<strong>und</strong> allgemeinen Sicherheitsbedingungen (z.B. Bäderaufsicht, Kanalisation);• überregionale, nationale <strong>und</strong> internationale Aktivitäten im Bereich der Sozial-, Ges<strong>und</strong>heits-,Bildungs-, Steuer-, Arbeitsmarkt-, Wirtschafts-, Städtebau-, Verkehrs-,Umwelt- <strong>und</strong> Verbraucherpolitik bzw. des Ges<strong>und</strong>heits-, Umwelt-, Arbeits- <strong>und</strong>Verbraucherschutzes.Diese Beispiele zeigen, dass bei Verhältnisprävention Gestaltungsaktivitäten auf vielenEbenen <strong>und</strong> Sektoren möglich sind. Diese können mit einer Vielzahl an Instrumentenumgesetzt werden, von der Gesetzgebung angefangen bis zur Finanzierung <strong>und</strong> Durchführungvon ges<strong>und</strong>heitsfördernden Einzelprojekten. Verhalten <strong>und</strong> Verhältnisse bedingensich also gegenseitig.Setting-AnsatzEin Setting wird einerseits als ein soziales System verstanden, das eine Vielzahl relevanterUmwelteinflüsse auf eine bestimmte Personengruppe umfasst. Es ist andererseits einSystem, in dem Bedingungen von Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankheit auch gestaltet werden können.In erster Linie werden Kommunen, Schulen, Krankenhäuser <strong>und</strong> Betriebe als Settingsbetrachtet (Grossmann / Scala 2001). Der Setting-Ansatz fokussiert auf die Rahmenbedingungendes Lebens, Lernens, Arbeitens <strong>und</strong> Konsumierens von Menschen. DieserAnsatz trägt der Tatsache Rechnung, dass die Ges<strong>und</strong>heitsprobleme einer Bevölkerungsgruppedas Resultat einer Wechselwirkung zwischen ökonomischer, sozialer <strong>und</strong>organisatorischer Umwelt <strong>und</strong> persönlicher Lebensweise sind.SalutogeneseDie Salutogenese zählt zu den einflussreichsten Ansätzen der Ges<strong>und</strong>heitssoziologie,der Ges<strong>und</strong>heitspsychologie <strong>und</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften insgesamt. Ihr Begründer,Aaron Antonovsky, stellte die Frage in den Mittelpunkt, was die Bedingungen für dieEntstehung <strong>und</strong> Erhaltung von Ges<strong>und</strong>heit (= Saluto-Genese) sind (vgl. Antonovsky1996).Kernstücke des Salutogenese-Konzeptes sind der sogenannte Kohärenz-Sinn <strong>und</strong> dieihn bestimmenden generalisierten Widerstandsressourcen:97
Kapitel 2 | BeispieleNach Antonovsky trägt der Kohärenz-Sinn – das Ausmaß, in dem eine Person die Welt alsverstehbar, handhabbar bzw. bewältigbar <strong>und</strong> sinnvoll erlebt – wesentlich zur Ges<strong>und</strong>heitserhaltungbei: Je stärker das Kohärenzgefühl, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,Stressoren erfolgreich <strong>und</strong> mit positiven Auswirkungen auf die Ges<strong>und</strong>heit zu bewältigen.Voraussetzung für ein hohes Kohärenzgefühl ist ein ausreichendes Maß an Widerstandsressourcen,worunter nach Antonovsky die folgenden verstanden werden:• körperliche / konstitutionelle Ressourcen (z.B. intakte Immunabwehr)• personale <strong>und</strong> psychische Ressourcen (z.B. Ges<strong>und</strong>heitswissen <strong>und</strong> -handlungsvermögen, Intelligenz <strong>und</strong> geistige Flexibilität, Anpassungsfähigkeit)• interpersonale Ressourcen (Unterstützung durch soziale Netzwerke, soziale Integration<strong>und</strong> aktive Teilnahme an Entscheidungs- <strong>und</strong> Kontrollprozessen, die die eigene Lebensgestaltungbetreffen),• soziokulturelle Ressourcen (Eingeb<strong>und</strong>enheit in stabile Kulturen, Orientierung an lebensleitendenÜberzeugungen)• materielle Ressourcen (Ernährung, Wohnung, etc.).Projekt Ges<strong>und</strong>heitsförderung im KAVDie ProjektstrukturDie Strategie der Ges<strong>und</strong>heitsförderung im KAV wird seit 2006 von einer Steuerungsgruppebearbeitet <strong>und</strong> festgelegt. Die Steuerungsgruppe umfasst VertreterInnen der Generaldirektion(GED), der Direktionen der Teilunternehmungen 1 (Krankenanstalten), 2(Allgemeines Krankenhaus) <strong>und</strong> 4 (Pflegeheime) sowie der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten/ Hauptgruppe II. Als Schnittstelle zwischen Steuerungsgruppe <strong>und</strong> Häusernwurde pro Haus eine strategische <strong>und</strong> eine operative Ansprechperson nominiert.Die Aufgaben der Steuerungsgruppe wurden folgendermaßen definiert:• Informationsplattform zum Austausch von Erfahrungen, Ergebnissen <strong>und</strong> Fortschritten• Management – Vorbereiten, Treffen <strong>und</strong> Umsetzen von Entscheidungen• Monitoring von Stimmungen <strong>und</strong> Handlungen in der Organisation, um daraus Konsequenzenfür das Projekt abzuleiten• Controlling des Prozesses <strong>und</strong> Vorschläge, wie nachzusteuern ist• MarketingDie Aufgaben der AnsprechpartnerInnen auf strategischer <strong>und</strong> operativer Ebene sind folgendermaßenfestgelegt:• Anbindung der Ges<strong>und</strong>heitsförderung an die Gesamtstrategie des jeweiligen Hauses• Strukturentwicklung für interne Ges<strong>und</strong>heitsförderung (niederschwellige Informationsdrehscheibesicherstellen)• Klärung von Rollen <strong>und</strong> Zuständigkeiten• Kommunikation hinsichtlich Ges<strong>und</strong>heitsförderung innerhalb <strong>und</strong> außerhalb derDienststelle• Mitglied in diversen Hausgremien (z.B. Qualitätssicherungskommission)• Integration von <strong>und</strong> inhaltliche Verknüpfung mit anderen relevanten Themen <strong>und</strong> Projekten(z.B. Brandschutz, Umweltschutz)• Erfahrungsaustausch, Informationstransfer, Monitoring laufender Projekte <strong>und</strong> abgeschlossenerMaßnahmenDie ProjektthemenStartpunkt für die Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung im KAV war die Kickoff-Großveranstaltung mit dem Titel „Ges<strong>und</strong>heit ist unsere Stärke“ am 20.11.2007. DasMotto lautete: „Den Stein ins Rollen bringen!“98
Kapitel 2 | BeispieleDer Workshop behandelte vor allem die beiden Schwerpunktthemen Sucht am Arbeitsplatz(Alkohol, Nikotin, Medikamente) sowie Productive Ageing (alternsgerechter ArbeitsplatzKAV), die von der Steuerungsgruppe als prioritär ausgewählt worden waren.Diese Themenbereiche wurden den TeilnehmerInnen, vorwiegend Führungskräften ausdem KAV, durch Impulsreferate von ExpertInnen nähergebracht. In den anschließendenWorkshops wurden unter Einbeziehung aller TeilnehmerInnen Wissen, Erfahrungen ausder Praxis, Initiativen <strong>und</strong> Maßnahmen behandelt.Ziel war es, den TeilnehmerInnen das zu diesen Themen geplante KAV Projekt 2007 –2011 vorzustellen, die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Projektthemen zu beginnen,Erfahrungen auszutauschen, Wissen zu vermitteln <strong>und</strong> Führungskräfte zu stärken,• mit dem Symptom des Suchtmittelmissbrauchs am Arbeitsplatz verantwortungsbewusstumzugehen• sich mit den Auswirkungen des aktuellen demographischen Trends der alternden Gesellschaft<strong>und</strong> seiner Auswirkungen auf das Ges<strong>und</strong>heitswesen vor allem in Form derProblematik der Beschäftigungs(un)fähigkeit von zunehmend älteren Erwerbspersonenauseinander zu setzen.Es wurde deutlich, dass hier neben der Verhaltensprävention auch die Verhältnispräventionverstärkt einsetzen muss, um zu nachhaltigen Lösungen zu kommen.Sucht am ArbeitsplatzAb 2008 werden den Dienststellen des KAV seitens der Projektleitung in Kooperation mitdem Anton-Proksch-Institut zehn Seminartermine zum Thema „Suchtprävention - Umgangmit dem Thema Sucht am Arbeitsplatz“ mit folgenden Inhalten angeboten:• Sensibilisierung für diesen Themenbereich• Theoretisches Gr<strong>und</strong>lagenwissen• Umsetzung der Theorie als Führungsaufgabe• Umsetzung der Seminarinhalte am Arbeitsplatz (Organisation)Das große Teilnahmeinteresse spiegelt deutlich die Aktualität des Themas wider.Productive AgeingSeit 2007 stellt sich der KAV der Herausforderung, ges<strong>und</strong>e <strong>und</strong> produktive Arbeitsweltenfür MitarbeiterInnen für den gesamten Arbeitszeitraum zu schaffen. Der KAV positioniertsich somit, entsprechend den demographischen Entwicklung, als attraktiver Arbeitsgeberauch für ältere ArbeitnehmerInnen.Dabei geht es nicht nur um die altersadäquate Arbeitsanforderung, sondern auch um denwertschätzenden Umgang mit MitarbeiterInnen in allen Lebensphasen. Zur Bearbeitungdieser Herausforderungen wurde das Programm „Productive Ageing“ entwickelt. SpezifischeArbeitsgruppen werden sich mit den Themen alternsgerechte Arbeitszeiten, Arbeitsorganisation,Arbeitsplätze, Personalführung etc. beschäftigen, um für das gesamte Unternehmenein Konzept zu entwickeln. Am 16.6.2008 hat ein erster gemeinsamer Workshopder Arbeitsgruppen stattgef<strong>und</strong>en, in dem inhaltlich an der Vision <strong>und</strong> dem Ziel einerges<strong>und</strong>en <strong>und</strong> altersadäquaten Arbeitswelt im KAV weitergearbeitet wurde.99
Kapitel 2 | BeispieleWeitere Ges<strong>und</strong>heitsförderungsaktivitätenAbschließend sei noch erwähnt, dass heuer 2 weitere Meilensteine der Ges<strong>und</strong>heitsförderungim KAV abgeschlossen werden. Zum einen handelt es sich dabei um eine zentraleDatenbank für Ges<strong>und</strong>heitsförderung, welche derzeit in Zusammenarbeit mit der KAV-ITentwickelt wird <strong>und</strong> zum Ziel hat, alle KAV-Projekte im Bereich der Ges<strong>und</strong>heitsförderungdarzustellen. Diese Datenbank kann von allen MitarbeiterInnen eingesehen werden.Zum anderen werden erstmalig für das Jahr 2008 im Sinne der Zielerreichung der Ges<strong>und</strong>heitsförderungdie Krankenanstalten <strong>und</strong> Geriatriezentren des KAV einen Ges<strong>und</strong>heitsberichterstellen. Die jährliche Fortführung der Berichterstattung wurde von derSteuerungsgruppe festgelegt. Beabsichtigt ist, dass die Ges<strong>und</strong>heitsberichte der einzelnenEinrichtungen KAV-intern auf der Ges<strong>und</strong>heitsförderungs-Homepage einsehbar sind.Unabhängig davon wird ein Folder für die Ges<strong>und</strong>heitsförderung erstellt, der als Erstinformationfür MitarbeiterInnen, PatientInnen / BewohnerInnen <strong>und</strong> BesucherInnen inallen Krankenanstalten <strong>und</strong> Geriatriezentren des KAV aufliegen wird.LiteraturAntonovsky A. (1996): The salutogenic model as a theory to guide health promotion. In: HealthPromotion International 11 (1), 11-18Bamberg E., Ducki A., Metz A..M. (1998): Handbuch Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Arbeits<strong>und</strong>organisationspsychologische Methoden <strong>und</strong> Konzepte. Göttingen: Verlag für AngewandtePsychologieGrossmann R., Scala K. (Hg., 2001): Intelligentes Krankenhaus. Innovative Beispiele derOrganisationsentwicklung in Krankenhäusern <strong>und</strong> Pflegeheimen. Wien, New York: SpringerStark W. (1996): Empowerment. Neue Handlungskompetenzen in der psychosozialen Praxis.Freiburg. LambertusWiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong> (Hg., 2003a): Unsere Stärken – unsere Ziele. Das Leitbild desWiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>es. Wien: Generaldirektion Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong> (Hg., 2003a): Strategie der Qualitätsarbeit. UnternehmungWiener Krankenanstaltenverunbd. Wien: Generaldirektion Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>World Health Organization (1986): Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: World HealthOrganization100
Kapitel 3 | Netzwerke3Netzwerke: Eine Strategiezur Unterstützung vonGes<strong>und</strong>heitsförderung inGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen101
Kapitel 3 | Netzwerke3.1Das Internationale NetzwerkGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (HPH)Christina DIETSCHER, Jürgen M. PELIKANDie Rolle von Netzwerken in der Ges<strong>und</strong>heitsförderungSo wie für Städte, Schulen <strong>und</strong> andere Settings setzte die Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation(WHO) auch für die Verbreitung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenschon früh auf die Netzwerkstrategie: Diese im Vergleich zu anderen Kooperationsformenrelativ unverbindliche Form der Zusammenarbeit hat den Vorteil, dass sie interessiertenAkteurInnen einen Kooperationsrahmen mit relativ geringen bürokratischen Hürden –auch über Rechtsformen, Organisations- <strong>und</strong> Staatsgrenzen hinweg – bietet (vgl. Lobnig1999).Die Partner in solchen Netzwerken können sowohl Personen als auch Organisationen sein,die unterschiedliche Felder wie Wissenschaft, Praxis, Politik etc. <strong>und</strong> damit auch unterschiedlicheExpertisen repräsentieren. Netzwerke der Ges<strong>und</strong>heitsförderung zielen dabeivor allem auf die Kapazitätsentwicklung für Ges<strong>und</strong>heitsförderung, d.h. auf dieEntwicklung von Expertise <strong>und</strong> Partnerschaften, die Generierung von Ressourcen,die Personen-, Organisations- <strong>und</strong> Systementwicklung mit dem Ziel der Verbesserungder Rahmenbedingungen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung (vgl. dazu u.a. New SouthWales Department of Health, 2001).Zur Umsetzung dieser Ziele ist die lose Kooperationsform von Netzwerken allein allerdingsnicht ausreichend: Für kontinuierliche Netzwerkarbeit braucht es bestimmte Partner(wie zum Beispiel die WHO-Kooperationszentren, die das HPH-Netzwerk unterstützen),die verbindlich die Verantwortung für bestimmte Bereiche übernehmen. Eine zusätzlicheMöglichkeit zur Weiterentwicklung bestimmter Netzwerkaspekte sind Projekte,die (meist temporär) für Verbindlichkeit zwischen den Partnern sorgen. Beides – sowohlPartner mit klaren Rollen als auch Projekte - haben die Entwicklung von HPH seit derGründung des Netzwerks unterstützt <strong>und</strong> kontinuierlich vorangetrieben.Historische Entwicklung von HPHBereits 1990 wurde auf Gr<strong>und</strong>lage des 1989 gestarteten WHO-Modellprojekts „Ges<strong>und</strong>heit<strong>und</strong> Krankenhaus“ an der Wiener Rudolfstiftung von der WHO das InternationaleNetzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser (HPH) gegründet – zunächst als „MultiCity Action Plan“ der WHO-Healthy-Cities <strong>und</strong> ExpertInnennetzwerk mit dem Ziel derKonzeptentwicklung. Mit der Verabschiedung der „Budapest Declaration on Health PromotingHospitals“ (siehe Anhang 5.1) konnte bereits 1991 ein erstes Produkt vorgelegtwerden, in dem erstmals Ziele <strong>und</strong> Inhalte von HPH definiert sind.Der nächste wichtige Schritt in der Entwicklung des Internationalen HPH-Netzwerks wardas European Pilot Hospital Project on Health Promoting Hospitals (EPHP), an demvon 1993-1997 zwanzig Krankenhäuser aus elf europäischen Staaten teilnahmen (darunterauch die Wiener Rudolfstiftung, vgl. Abbildung 8 unten). Das EPHP konnte zeigen,dass die im Rahmen des Wiener Modellprojekts entwickelten Ges<strong>und</strong>heitsförderungskonzeptein Krankenhäusern unterschiedlicher Größen <strong>und</strong> Typen <strong>und</strong> in unterschiedlichenGes<strong>und</strong>heitssystemen erfolgreich umgesetzt werden können (vgl.Pelikan et al. 1998).102
Kapitel 3 | NetzwerkeAbbildung 8: Teilnehmerstaaten am European Pilot Hospital Project (EPHP)Bereits im Rahmen der Ausschreibung für die Teilnahme am EPHP waren Krankenhäusergesucht worden, die bereit waren, ihre Projekterfahrungen regional / national weiterzugeben<strong>und</strong> sich für die Gründung von Netzwerken Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuserzu engagieren. Von den 11 am EPHP beteiligten Staaten (vgl. Abbildung 8oben) konnten sich dann auch mit Ausnahme Ungarns in allen Staaten dauerhafteNetzwerke etablieren 31 . Auch in Österreich wurde 1996 mit Unterstützung desGes<strong>und</strong>heitsressorts des B<strong>und</strong>es ein eigenes nationales Netzwerk gegründet (vgl. dazuKapitel 3.2 in dieser Broschüre).Seit dem Start des EPHP im Jahr 1993 gibt es – begleitend zur Arbeit in den Krankenhäusern– eine jährliche internationale Konferenz <strong>und</strong> einen Netzwerk-Newsletter, derzunächst zweimal jährlich <strong>und</strong> seit 2008 alle 2 Monate erscheint. Nach Abschluss desEPHP stellten vor allem die jährliche Konferenz des Netzwerks <strong>und</strong> die jeweils im Vorfeldder Konferenz stattfindende Versammlung der NetzwerkkoordinatorInnen die wichtigsteStruktur zur Aufrechterhaltung <strong>und</strong> Weiterentwicklung einer Netzwerkidentität dar. Umdarüber hinaus die weitere Verbreitung der im EPHP aufgebauten Expertise sicherzustellen,beschloss die WHO 1995, über das internationale Netzwerk hinaus die Gründungvon nationalen <strong>und</strong> regionalen Netzwerken Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuserals wichtige Begleit- <strong>und</strong> Unterstützungsstruktur gezielt voranzutreiben.1996 konnte auch die Europäische Kommission zur Unterstützung der Netzwerkstrategiegewonnen werden: In Wien wurde ein EU-geförderter Workshop mit dem Ziel der Gründungweiterer HPH-Netzwerke durchgeführt (Pelikan et al. 1996). 1997 – im Abschlussjahrdes EPHP – wurde mit den „Vienna Recommendations“ (WHO 1997) ein neues HPH-Netzwerkdokument vorgelegt, das neben der Aktualisierung der AufgabenbeschreibungGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser (<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen) auch die Rolleder Netzwerke definiert.Aus den 20 EPHP-Pilotkrankenhäusern in 11 europäischen Staaten hat sich seither eininternationales Netzwerk mit 37 nationalen / regionalen Netzwerken in 23Staaten in 3 Kontinenten (Europa, Asien, Nordamerika) entwickelt, das etwa 700 Mit-31 für die damalige Tschechoslowakei zunächst auf dem Gebiet der heutigen Slowakei. Tschechien folgte erst vorwenigen Jahren. In Ungarn war nach dem EPHP ein nationales HPH-Netzwerk gegründet worden, das 2007formal eingestellt wurde.103
Kapitel 3 | Netzwerkegliedseinrichtungen repräsentiert. Seit dem Jahr 2007 nimmt das Netzwerk neben Krankenhäusernformell auch andere Typen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen auf <strong>und</strong> trägt damitden permanenten Weiterentwicklungen im Ges<strong>und</strong>heitswesen Rechnung.Während jährlich neue nationale <strong>und</strong> regionale HPH-Netzwerke hinzukommen (zuletzt2008 die Regionalnetzwerke Katalonien / Spanien <strong>und</strong> Toronto / Kanada), mussten einzelneNetzwerke auch (vorübergehend) wieder aufgelöst werden, so etwa das ungarischeNetzwerk, das sich in einem von massiven Umbrüchen charakterisierten Ges<strong>und</strong>heitssystembislang nicht behaupten konnte, <strong>und</strong> das dänische Netzwerk, das aufgr<strong>und</strong> der Zusammenlegungvon Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen zahlenmäßig stark an Mitgliedern <strong>und</strong> Ressourcenverlor <strong>und</strong> gegenwärtig an einem Neustart arbeitet. Der aktuelle Stand der HPH-Netzwerke ist in Abbildung 9 unten dargestellt.Abbildung 9: Staaten mit existierenden HPH-Netzwerken, einzelnen Mitgliedern<strong>und</strong> regelmäßiger Teilnahme an internationalen HPH-KonferenzenStrukturen des internationalen HPH-NetzwerksLeitungs-, Koordinations- <strong>und</strong> KommunikationsstrukturenDie bisherige Erfahrung im HPH-Netzwerk, aber auch in anderen Ges<strong>und</strong>heitsförderungsnetzwerkenhat gezeigt, dass mit zunehmendem Wachstum <strong>und</strong> zunehmender Professionalisierungauch eine zunehmende Verbindlichkeit der Arbeitsweise in Netzwerken verb<strong>und</strong>enist, die sich auch in der Weiterentwicklung von Organisationsformen widerspiegelt.So präsentiert sich HPH seit 2008 als internationale, als Verein nach SchweizerRecht organisierte NPO mit Mitgliedern bzw. InteressentInnen aus fünf Kontintenten (vgl.Statuten im Anhang 5.3). Unterschiedliche AkteurInnen haben darin die Verantwortungfür spezifische Aufgaben übernommen:• Die Generalversammlung (Gremium der Netzwerk-KoordinatorInnen), die einmaljährlich zusammenkommt, ist die wichtigste Entscheidungsinstanz des Netzwerks.• Der aus den Mitgliedern der Generalversammlung gewählte Vorstand bereitet dieEntscheidungen der Generalversammlungen vor <strong>und</strong> führt während des Jahres dieGeschäfte des internationalen Vereins.104
Kapitel 3 | Netzwerke• Ein internationales Netzwerksekretariat (angesiedelt am WHO-Kooperationszentrum für Evidenzbasierte Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Kopenhagen) unterstütztden Vorstand <strong>und</strong> die Generalversammlung in ihren Funktionen <strong>und</strong> ist fürdie Mitgliederverwaltung <strong>und</strong> die Wartung einer interaktiven Website verantwortlich.• Das WHO-Kooperationszentrum für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Krankenhaus <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen(Wien) ist u.a. für die wissenschaftliche Koordination der jährlicheninternationalen Konferenzen <strong>und</strong> die wissenschaftliche Redaktion eines alle zweiMonate erscheinenden internationalen Netzwerk-Newsletters verantwortlich.Dieses Medium wird seit dem Jahr 2007 vom kanadischen HPH-Netzwerk ins Französischeübersetzt.Parallel zur Entwicklung dieser das gesamte HPH-Netzwerk umfassenden Strukturen habensich bereits früh spezifische Sub-Strukturen (Task Forces, Arbeitsgruppen, themenspezifischeMedien) gebildet, die entweder bestimmte Teilaspekte des HPH-Konzeptesbehandeln <strong>und</strong> / oder sich an bestimmte Typen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen richten.Forschung <strong>und</strong> Entwicklung: Arbeitsgruppen, Task Forces,ProjekteKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen sind hoch spezialisierte Organisationen.Um ein Konzept wie HPH in solchen Einrichtungen dauerhaft verankern zu können, bedarfes der Ausdifferenzierung für unterschiedliche Berufsgruppen <strong>und</strong> Schwerpunktbereiche.Im HPH leisten diese Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsaufgabe von der Generalversammlungeingesetzte internationale Arbeitsgruppen (mit einer von vornherein befristetenDauer), Task Forces (dauerhafte themenspezifische Unterstützungsstrukturen) <strong>und</strong> spezifischeForschungs- <strong>und</strong> Implementierungsprojekte.ArbeitsgruppenBeispiele für den Einsatz von Arbeitsgruppen im HPH sind die Entwicklung der 18 HPH-Kernstrategien <strong>und</strong> der 5 Standards, für die jeweils eine internationale HPH-Arbeitsgruppe verantwortlich zeichnet (vgl. Kapitel 1.2 in dieser Broschüre). Bis Ende2008 wird von einer weiteren Arbeitsgruppe ein Strategiepapier zu Patientensicherheit<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung erwartet, das auch Empfehlungen zur Unterstützung von Patientensicherheitdurch HPH enthalten soll (vgl. Kapitel 2.9).Task ForcesTask Forces wurden <strong>und</strong> werden im HPH eingerichtet, um entweder Ges<strong>und</strong>heitsförderungspezifisch für einen bestimmten Typus von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen weiter zuentwickeln oder um spezifische Themen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Netzwerk zu propagieren.Das internationale HPH-Netzwerk hat zum Zeitpunkt der Drucklegung dieserBroschüre vier Task Forces, von denen die beiden erstgenannten dem ersten Typus entsprechen,die beiden anderen dem zweiten Typus:• Ges<strong>und</strong>heitsförderung in der Psychiatrie (seit 1998): Diese Task Force wird vomWalter Picard-Spital in Riedstadt (Deutschland) koordiniert. Sie adaptiert HPH-Dokumente wie die fünf Standards spezifisch für die Psychiatrie <strong>und</strong> organisiert imRahmen der internationalen HPH-Konferenzen regelmäßig Vernetzungsworkshops.• Ges<strong>und</strong>heitsförderung für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche in <strong>und</strong> durch Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(seit 2004): Diese Task Force wird vom A. Meyer-Universitätskrankenhaus für Kinder- <strong>und</strong> Jugendheilk<strong>und</strong>e in Florenz koordiniert. DieAufgaben der Task Force liegen in der Umsetzung von Kinderrechten in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen,der Erhebung des Status Quo der Ges<strong>und</strong>heitsförderung für Kinder inGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen, der Sammlung <strong>und</strong> Entwicklung von „Modellen guter Pra-105
Kapitel 3 | Netzwerkexis“ <strong>und</strong> in der Entwicklung von Standards <strong>und</strong> Leitlinien für die Praxis (vgl. auch Kapitel2.2 in dieser Broschüre).• MigrantInnenfre<strong>und</strong>liche <strong>und</strong> kulturell kompetente Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(seit 2005): Die von der HPH-Koordinationsstelle des Regionalnetzwerks EmiliaRomagna geleitete Task Force ging aus dem vom Wiener WHO-Kooperationszentrumfür Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Krankenhaus <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen koordiniertenEU-Projekt „Migrant Friendly Hospitals“ hervor. Zielsetzung ist die Weiterentwicklungkultureller Kompetenz in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen als wichtiger Beitrag zu einerqualitativ hochwertigen Versorgung.• Rauchfreie Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (seit 2008): Diese Task Force ging aus derimmer stärker werdenden Kooperation zwischen dem HPH-Netzwerk <strong>und</strong> dem EuropäischenNetzwerk Rauchfreier Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (ENSH) hervor. Ziel ist dieUnterstützung möglichst vieler Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen inder Entwicklung zum rauchfreien Setting durch Propagierung <strong>und</strong> Weiterentwicklungder vom ENSH entwickelten Umsetzungsinstrumente.Web- <strong>und</strong> Kontaktadressen zu allen Task Forces können dem Anhang 5.6 dieser Broschüreentnommen werden.ProjekteFür spezifische Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsfragen wurden <strong>und</strong> werden – angefangenvom EPHP – immer wieder internationale Projekte im HPH-Netzwerk durchgeführt. So hatdas WHO-Kooperationszentrum in Kopenhagen eine internationale Studie zur Anwendbarkeitspezifischer Ges<strong>und</strong>heitsförderungsleistungen im Rahmen leistungsorientierterFinanzierungssysteme (DRGs) koordiniert <strong>und</strong> leitet gegenwärtig ein Projekt zur Entwicklungeines Dokumentationsinstruments für lebensstilspezifische Risikofaktoren, das inZukunft in der Umsetzung von HPH-Standard 2, Patienteneinschätzung (vgl. Kapitel 1.2),angewendet werden soll.Einschätzung <strong>und</strong> AusblickHPH hat in den letzten 20 Jahren im schwierigen Umfeld dauerreformierter Ges<strong>und</strong>heitssysteme<strong>und</strong> auch gegen die Konkurrenz anderer Reformstrategien des Ges<strong>und</strong>heitswesens– wie der Qualität – eine permanente quantitative <strong>und</strong> qualitative Weiterentwicklunggenommen. Mit der Etablierung als internationaler Verein hat das Netzwerk im Jahr 2008erstmals auch eine rechtsverbindliche Struktur erhalten.Damit sind gr<strong>und</strong>sätzlich die Weichen für eine Weiterentwicklung des bisherigen Erfolgskursesgestellt, <strong>und</strong> Schritte zur Sicherung eines weiterführenden qualitativen <strong>und</strong> quantitativenWachstums werden laufend gesetzt. Das Wachstum wird aber auch mit weiterenHerausforderungen verb<strong>und</strong>en sein:• Quantitatives Wachstum: Das bisherige quantitative Wachstum von HPH kann alsstetig, aber langsam bezeichnet werden. Dies dürfte neben der Komplexität des Ansatzesauch auf die bislang zu wenig transportierte Evidenzbasierung vieler ges<strong>und</strong>heitsfördernderMaßnahmen, die ja gerade im klinischen Bereich besonders wichtigist, zurückzuführen sein. Neben gezielter Information <strong>und</strong> Verbreitung – wie derzeit inAsien, wo mit Unterstützung des taiwanesischen HPH-Netzwerks an der Gründungweiterer Netzwerke in Südkorea <strong>und</strong> Thailand gearbeitet wird – wird das weitereWachstum von HPH daher auch von der Verfügbarkeit <strong>und</strong> Vermittlung von Evidenz<strong>und</strong> klaren, im klinischen Alltag leicht anwendbaren Umsetzungsinstrumenten fürspezifische Aspekte der Ges<strong>und</strong>heitsförderung abhängen. Aufgr<strong>und</strong> der Öffnung desNetzwerks für unterschiedliche Typen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen wird eine besondereHerausforderung auch in der Entwicklung von Instrumenten für diese unterschiedlicheTypen liegen.106
Kapitel 3 | Netzwerke• Qualitatives Wachstum: Mit dem permanenten quantitativen Wachstum von HPHwird die Qualitätssicherung <strong>und</strong> -entwicklung zu einer immer wichtigeren <strong>und</strong> anspruchsvollerenAufgabe im Netzwerk. Die zunehmende Heterogenität der Mitglieder– sowohl in Bezug auf unterschiedliche kulturelle Hintergründe als auch hinsichtlichverschiedener Typen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen – bedingt sehr unterschiedlicheZugänge zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Um vor diesem Hintergr<strong>und</strong> sicherstellen zu können,dass die Anerkennung als Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung in unterschiedlichenNetzwerken <strong>und</strong> Kontinenten in vergleichbarer Weise gehandhabtwird, wird es vermutlich der weiteren Standardisierung von HPH bedürfen.Um eine f<strong>und</strong>iertere Basis für eine Weiterentwicklung von HPH zu bekommen, laufen aufNetzwerk-Gesamtebene derzeit Vorbereitungsarbeiten für eine umfassende Evaluationvon HPH, deren Ergebnisse in künftige Strategien <strong>und</strong> Instrumenten einfließen sollen.LiteraturLobnig H., Nowak P., Pelikan J.M. (1999): Die Umsetzung der Vision des Ges<strong>und</strong>heitsförderndenKrankenhauses: Projektmanagement, Organisationsentwicklung <strong>und</strong> Networking. In: Pelikan J.M.,Wolff S. (Hg. 1999): Die Umsetzung der Vision des Ges<strong>und</strong>heitsfördernden Krankenhauses:Projektmanagement, Organisationsentwicklung <strong>und</strong> Networking. Weinheim <strong>und</strong> München: Juventa,pp. 51-66Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologie (Hg., 1996):Ges<strong>und</strong>heitsförderndes Krankenhaus – Vorbereitung eines informellen supranationalen Netzwerks.Endbericht. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologieNew South Wales Department of Health (Eds., 2001): A framework for building capacity to improvehealth. New South Wales Department of HealthPelikan J.M., Garcia-Barbero M., Lobnig H., Krajic K. (1998): Pathways to a Health PromotingHospitals. Experiences from the European Pilot Hospital Project 1993-1997. Gamburg: HealthPromotion PublicationsWorld Health Organization – Regional Office for Europe (1991): The Budapest Declaration onHealth Promoting Hospitals. Copenhagen: World Health Organization - Regional Office for EuropeWorld Health Organization – Regional Office for Europe (1997): The Vienna Recommendations onHealth Promoting Hospitals107
Kapitel 3 | Netzwerke3.2Das Österreichische NetzwerkGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (ONGKG)Christina DIETSCHER, Rainer HUBMANNDie Entwicklung des ONGKGDas Österreichische Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenhat – historisch bedingt – die längste Geschichte der bislang 37 nationalen<strong>und</strong> regionalen Netzwerke Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen:Bereits das erste europäische Modellprojekt „Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankenhaus“fand – mit Unterstützung der Stadt Wien <strong>und</strong> des Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>es –von 1989 bis 1996 in Wien statt.Die ersten Zwischenergebnisse dieses Projektes führten bereits 1990 zur Gründung desInternationalen WHO-Netzwerks Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser (<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen),das zunächst als loser Verband von InteressentInnen <strong>und</strong> Organisationenbestand. Als von 1993 bis 1997 ein europäisches Modellkrankenhausprojekt mitdem Ziel der Überprüfung der Machbarkeit von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenin unterschiedlichen Ges<strong>und</strong>heitssystemen durchgeführt wurde, war Österreichmit der Rudolfstiftung wieder in einem Verb<strong>und</strong> von 20 Spitälern aller Größen <strong>und</strong>Typen aus 11 europäischen Staaten vertreten.1995 hat die WHO die Entwicklung nationaler <strong>und</strong> regionaler Netzwerke zur offiziellenStrategie der Verbreitung <strong>und</strong> Weiterentwicklungen von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenerklärt. Es ist nicht zuletzt den positiven Erfahrungen aus derRudolfstiftung zu verdanken 32 , dass mit Unterstützung des Ges<strong>und</strong>heitsressorts des B<strong>und</strong>esbereits 1996 das österreichische Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäusergegründet werden konnte. Seither führt das Netzwerk eine jährliche Konferenzdurch <strong>und</strong> gibt einen R<strong>und</strong>brief für Mitglieder <strong>und</strong> InteressentInnen heraus.2006 – anlässlich des zehnjährigen Bestehens – gründeten die Partnerkrankenhäuserdes Netzwerks den gemeinnützigen Verein „Österreichisches Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen – ONGKG“, dernunmehr die Arbeit des früher unter „ÖNGK“ firmierenden Netzwerkes mit einer eigenenRechtspersönlichkeit fortsetzt. Zugleich mit der Vereinsgründung öffnete sich das Netzwerk– in Übereinstimmung mit dem Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetzvon 2005 – für alle österreichischen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen. Die Mitgliedschaftist nunmehr auch für Trägereinrichtungen <strong>und</strong> politische Körperschaften wie z.B. Ges<strong>und</strong>heitsplattformenmöglich.Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für diese Broschüre setzen sich die Mitgliederdes Netzwerks aus 19 Krankenhäusern (<strong>und</strong> zwei weiteren im Antragsstadium), einemGeriatriezentrum <strong>und</strong> dem Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong> als erste Trägereinrichtungsowie – auf Ebene der fördernden Mitglieder – aus dem B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>-32 Die Erfahrungen aus dem Modellprojekt wurden in 10 Modelldokumenten zusammengefasst, die die ges<strong>und</strong>heitsförderndeBearbeitung spezifischer Probleme von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen zum Thema haben: ein übergeordnetesDokument zur Unterstützung von Krankenhäusern in der Etablierung eines organisationsumfassendenGesamtansatzes <strong>und</strong> neun themenspezifische Dokumente zur Einführung von ges<strong>und</strong>er Ernährung, vonFührungskräftelehrgängen für Pflegepersonen, von ehrenamtlicher Hilfe im Krankenhaus, von Kreuzweh-Präventionskursen, von Praxisanleitungen im Pflegedienst, von interprofessionellen Teambesprechungen, vonumfassendem Hygienemanagement, von patientenorientierter Gruppenpflege <strong>und</strong> zum ergonomischen Umbaueiner Station.108
Kapitel 3 | Netzwerkeheit <strong>und</strong> dem Ges<strong>und</strong>heitsfonds Steiermark – Ges<strong>und</strong>heitsplattform zusammen (vgl. Abbildung10 unten).Abbildung 10: Die Mitgliedseinrichtungen des ONGKG (Stand August 2008):Ziele <strong>und</strong> Strategien des ONGKGQualitätsentwicklung durch Ges<strong>und</strong>heitsförderungHauptziel des ONGKG ist – in Übereinstimmung mit dem international entwickelten <strong>und</strong>erprobten Konzept „Ges<strong>und</strong>heitsförderndes Krankenhaus“ – die Unterstützung österreichischerGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen <strong>und</strong> des österreichischen Ges<strong>und</strong>heitswesensinsgesamt in der Qualitätsentwicklung von <strong>und</strong> durch Ges<strong>und</strong>heitsförderung.Qualifizierung: Anerkennungsverfahren <strong>und</strong> Coaching-WorkshopZur Erreichung dieses Ziels führt das Netzwerk ein Anerkennungsverfahren für ordentlicheMitglieder durch. Dabei werden unter anderem drei Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmender antragstellenden Einrichtungen einem Peer Review-Verfahren unterzogen.Ein weiteres Angebot zur Qualitätsentwicklung ist der jährlich stattfindende Coaching-Workshop für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen, der die Möglichkeit bietet, geplanteoder laufende Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen in einem intervisorischen Design zureflektieren <strong>und</strong> weiterzuentwickeln.Häuserübergreifende ProjekteDa die Erfahrung wiederholt gezeigt hat, dass einzelne Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen in derUmsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung immer wieder an ihre Grenzen stoßen, organisiertdas Netzwerk nach Möglichkeit gemeinsame, häuserübergreifende Projekte zu bestimmtenBereichen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung. So wurde 2006 / 2007 eine Pilottestung derfünf international entwickelten Standards für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungendurchgeführt, aus der Empfehlungen für die österreichische Umsetzung hervorgingen(vgl. dazu Kapitel 1.3 in dieser Broschüre).109
Kapitel 3 | NetzwerkeZertifizierung Rauchfreier Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenEine weitere Strategie zur Vertiefung bestimmter Themen ist die Kooperation mit kompetentenPartnern. So arbeitet das ONGKG eng mit dem Europäischen NetzwerkRauchfreier Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (ENSH) zusammen <strong>und</strong> unterstützt mit seinerSektion „Rauchfreie Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen“ österreichische Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenin der Erlangung von Rauchfrei-Zertifzierungen gemäß den Richtlinien des ENSH(vgl. Kapitel 2.8 in dieser Broschüre).Information <strong>und</strong> VernetzungEiner der Vorteile von Netzwerken ist die Möglichkeit zu Kooperation <strong>und</strong> Austausch, sodassInteressierte, die ein bestimmtes Thema bearbeiten wollen, das Rad nicht neu erfindenmüssen, sondern auf bestehende Erfahrungen zurückgreifen können. Das ONGKGorganisiert zu diesem Zweck eine jährliche Konferenz, die allen interessierten Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenoffen steht <strong>und</strong> deren Ergebnisse jeweils als virtuelle Publikationim Internet nachgelesen werden können, gibt einen E-Mail-R<strong>und</strong>brief heraus <strong>und</strong>betreut eine Website (http://www.oengk.net - ab November 2008:http://www.ongkgk.at) mit umfassenden Informationen zu Konzept <strong>und</strong> Praxis Ges<strong>und</strong>heitsfördernderGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen <strong>und</strong> Links zu allen Mitgliedseinrichtungen.Internationale ZusammenarbeitEin wichtiger Aspekt für die Qualität des ONGKG ist die Zusammenarbeit <strong>und</strong> Vernetzungmit dem internationalen Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen vor allem im Rahmen der jährlichen internationalenKonferenzen <strong>und</strong> der in deren Vorfeld stattfindenden internationalen Generalversammlungen.Ein vertiefter Austausch besteht vor allem mit den Netzwerken inDeutschland <strong>und</strong> der Schweiz, mit denen Österreich neben ähnlichen Ges<strong>und</strong>heitssystemenauch die Sprache gemein hat. Seit dem Jahr 2001 findet alle vier Jahre eine gemeinsameKonferenz der drei deutschsprachigen Netzwerke <strong>und</strong> ihrer Mitgliedshäuserstatt.Zwischenergebnisse der bisherigen NetzwerkarbeitWas konnte mit der Netzwerkarbeit in Österreich bisher erreicht werden? Im Folgendenwerden einige wesentliche (Zwischen-)Ergebnisse dargestellt.Ergebnisse auf Ebene der MitgliedseinrichtungenDas Österreichische Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenkonnte in den 12 Jahren seines bisherigen Bestehens ein stetiges – <strong>und</strong>sich zunehmend beschleunigendes – Wachstum verzeichnen (vgl. Abbildung 11 unten):Nach den ersten sechs formalen Beitritten 1998 ist das Netzwerk bis zum Zeitpunkt derDrucklegung dieser Broschüre auf 23 Mitglieder angewachsen (zwei weitere im Antragsstadium)<strong>und</strong> hat sich damit in zehn Jahren praktisch vervierfacht.110
Kapitel 3 | NetzwerkeAbbildung 11: Zuwachs an Mitgliedern im ONGKG 1998-2007Insgesamt haben die Mitglieder des Netzwerks bisher 115 dokumentierte <strong>und</strong> anerkannteGes<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen durchgeführt <strong>und</strong> deren Ergebnisse z.T. im Rahmenvon Netzwerkkonferenzen <strong>und</strong> im Netzwerkr<strong>und</strong>brief präsentiert <strong>und</strong> publiziert. Wurdenvon den Projekthäusern anfangs vor allem innovative Projekte durchgeführt <strong>und</strong> zur Anerkennungeingereicht, können für die Anerkennung seit 2004 auch Routinemaßnahmeneingereicht werden. Diese Änderung der Einreichkriterien hatte das Ziel, die Nachhaltigkeitvon Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen in den Partnereinrichtungen zu fördern.Zusätzlich zu den vielen Einzelmaßnahmen ist zu beobachten, dass Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenmit zunehmender Dauer der Mitgliedschaft im Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsförderungzunehmend in der Organisation verankern (z.B. durch Etablierung vonStabstellen, durch explizite Anbindung ans Qualitätsmanagement), wie dies auch in denUmsetzungsempfehlungen zu den 18 Kernstrategien <strong>und</strong> in Standard 1 der fünf Standardsder Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen gefordert wird (vgl. Kapitel1.2 in dieser Broschüre).Ergebnisse aus häuserübergreifenden ProjektenIm Österreichischen Netzwerk wurden bisher drei von der Koordinationsstelle betreutehäuserübergreifende Projekte durchgeführt, die jeweils zur Entwicklung spezifischer Instrumente(Empfehlungen, Leitfäden, Fragebögen) führten:• Empowerment chirurgischer PatientInnen (2001): Ziel dieses vom Ges<strong>und</strong>heitsressortdes B<strong>und</strong>es geförderten Projektes war die Implementierung <strong>und</strong> Evaluierungvon Empowerment-Strategien (Patienteninformation <strong>und</strong> -schulung) für chirurgischePatientInnen. Im Rahmen des Projektes, an dem drei Netzwerkhäuser beteiligt waren,konnten frühere Forschungsergebnisse, wonach solche Strategien sowohl die Patientenzufriedenheitals auch klinische Outcomes <strong>und</strong> Lebensqualität günstig beeinflussen,erneut bestätigt werden. Die Ergebnisse des Projektes wurden vom B<strong>und</strong>esministeriumfür Ges<strong>und</strong>heit publiziert (BMGF 2003).111
Kapitel 3 | Netzwerke• „Ges<strong>und</strong>heit – MitarbeiterInnen – Krankenhaus“ (2005-2007). Dieses transdisziplinäreProjekt, an dem fünf ONGKG-Häuser <strong>und</strong> zwei weitere Krankenanstaltenteilnahmen, wurde vom Wissenschaftsministerium gefördert. Ziel war es, in einer Kooperationzwischen Praxis <strong>und</strong> Wissenschaft ein Instrument zur Mitbarbeiterbefragungin Krankenhäusern zu entwickeln, das in Übereinstimmung mit den WHO-Konzeptenzur Ges<strong>und</strong>heitsförderung ermöglicht, den somato-psycho-sozialen Ges<strong>und</strong>heitsstatusvon MitarbeiterInnen <strong>und</strong> dessen Determinanten im Setting Krankenhaus zu erheben.Als Ergebnis des Projektes liegt ein getesteter Fragebogen mit Empfehlungen zur Anwendungin Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen vor (Karl-Trummer et al. 2007).• Pilotierung der Standards für Ges<strong>und</strong>heitsförderung (2006-2007). Dieses Projektwurde vom Ges<strong>und</strong>heitsministerium gefördert <strong>und</strong> hatte das Ziel, die Machbarkeitder von einer internationalen WHO-Arbeitsgruppe entwickelten Standards derGes<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen unter Bedingungen des österreichischenGes<strong>und</strong>heitssystems zu testen (vgl. dazu auch Kapitel 1.3 in dieser Broschüre).Als Ergebnis liegt ein Projektbericht mit Umsetzungsempfehlungen vor (Dietscher/ Nowak / Pelikan 2007).Ergebnisse auf NetzwerkebeneIn seiner mittlerweile zwölfjährigen Geschichte konnte das ONGKG – in Kooperation mitpotenten Partnern – nachhaltige Unterstützungsstrukturen für die Vernetzung <strong>und</strong> Qualifizierungvon Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen auf dem Gebiet der Ges<strong>und</strong>heitsförderung aufbauen.Unterstützer <strong>und</strong> PartnerDie kontinuierliche Unterstützung des ONGKG durch das B<strong>und</strong>esministerium fürGes<strong>und</strong>heit (seit 2007 als förderndes Mitglied) hat den bisherigen Erfolg des Netzwerkswesentlich unterstützt. Die Ges<strong>und</strong>heitsverantwortlichen der Länder, die PräsidentInnender Berufsgruppenverbände der Ges<strong>und</strong>heitsberufe, VertreterInnen der Gewerkschaft<strong>und</strong> der Sozialversicherungen sowie der Patientenanwaltschaft, der Dachverbandder österreichischen Selbsthilfegruppen <strong>und</strong> Trägerorganisationen von Krankenanstaltenübernehmen regelmäßig den Ehrenschutz für die jährliche Netzwerkkonferenz <strong>und</strong> unterstützendie Partnerkrankenhäuser in ihren Tätigkeiten. Die Steirische Landesges<strong>und</strong>heitsplattformist seit 2008 förderndes Mitglied im Verein.ReichweiteDas ONGKG erreicht mit seinen Medien alle österreichischen Krankenhäuser <strong>und</strong> vieleandere, vor allem stationäre Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen. Von den ca. 140 österreichischenAllgemeinkrankenanstalten haben bisher 13% die Anerkennung als Partnerkrankenhausdes Österreichischen Netzwerks erhalten, wesentlich mehr Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenbeteiligen sich über die Jahreskonferenzen, das Coaching-Angebot fürGes<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen, im Rahmen von Netzwerk-Projekten oder über dieNutzung des Netzwerk-Newsletters <strong>und</strong> der Netzwerk-Website.Schlussfolgerungen <strong>und</strong> AusblickEs ist ein wichtiges Ziel des Vereins ONGKG, die positiven Entwicklungen der letztenJahre auch in Zukunft weiterzuführen <strong>und</strong> den österreichischen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenbedarfsorientierte <strong>und</strong> kompetente Unterstützung in der Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungzu bieten.Die mehrfache gesetzliche Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Aufgabe des österreichischenGes<strong>und</strong>heitswesens – vor allem das Qualitätsgesetz von 2005, wonach Ges<strong>und</strong>heitsleistungenin einem ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Umfeld zu erbringen sind, <strong>und</strong> die112
Kapitel 3 | NetzwerkeArt. 15a-Vereinbarung 2008-2013, wonach die Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsprojekteneine der Aufgaben der Landesges<strong>und</strong>heitsplattformen darstellt 33 – lassen fürdie Zukunft auch eine weitere politische Unterstützung der Netzwerkarbeit <strong>und</strong> damitgünstige Rahmenbedingungen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenerwarten.Schwerpunkte der künftigen Netzwerkarbeit werden in den nächsten Jahren auf das weiterequantitative <strong>und</strong> qualitative Wachstum abzielen.Quantitatives WachstumDas ONGKG hat bis 2006 vor allem mit Krankenhäusern gearbeitet. Im Interesse derGes<strong>und</strong>heitsförderung von PatientInnen ist aber auch auf dem Gebiet der Ges<strong>und</strong>heitsförderungdie Kooperation zwischen unterschiedlichen Typen von Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungennotwendig. Dies bedarf einer Adaptierung des Ges<strong>und</strong>heitsförderungskonzeptes fürunterschiedliche Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen.Qualitatives WachstumBei der ONGKG-Generalversammlung im Juni 2008 wurde beschlossen, dass Einrichtungen,die ihre Mitgliedschaft im ONGKG verlängern, eine verpflichtende Selbstbewertungnach den Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung durchführen müssen. Davon istein weiterer Qualitätsschub in den Mitgliedseinrichtungen zu erwarten.Darüber hinaus wird laufend an der Weiterentwicklung bestehender Netzwerkinstrumentegearbeitet. Für 2008 ist insbesondere die Herausgabe einer Sammelmappe für Mitgliedseinrichtungen(Zusammenstellung von Konzepten <strong>und</strong> Umsetzungsinstrumenten)geplant.LiteraturB<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen (Hg., 2003): Koproduktion durchEmpowerment. Mehr Qualität durch verbesserte Kommunikation mit Patient/innen in der Chirurgie.Wien: B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> FrauenDietscher C., Nowak P., Pelikan J.M: (2007): 5 Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Krankenhaus.Durchführung <strong>und</strong> wissenschaftliche Begleitung einer Pilottestung. Endbericht für das B<strong>und</strong>esministeriumfür Ges<strong>und</strong>heit, Familie <strong>und</strong> Jugend. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Medizin<strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitssoziologieKarl-Trummer U., Novak-Zezula S., Loidolt A., Schmied H. (2007): MitarbeiterInnenges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong>ihre Determinanten im Setting Krankenhaus. Endbericht für das B<strong>und</strong>esministerium für Wissenschaft<strong>und</strong> Forschung. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologie33 zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen vgl. auch Übersicht im Anhang113
Kapitel 3 | Netzwerke3.3Unterstützung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung inWien: Vom Modellprojekt zur Wiener Allianz fürGes<strong>und</strong>heitsförderungUrsula HÜBELDie Anfänge des „Ges<strong>und</strong>heitsförderndenKrankenhauses“ in WienWien ist schon seit 1989 Pionierstadt für die Umsetzung der Ges<strong>und</strong>heitsförderungsstrategie„Health Promoting Hospitals“ der Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation. So war das ersteWHO-Modellprojekt „Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankenhaus“ (1989-1996) an der Wiener KrankenanstaltRudolfstiftung angesiedelt, <strong>und</strong> die Rudolfstiftung vertrat Wien <strong>und</strong> Österreichauch von 1993-1997 im Europäischen Pilotkrankenhausprojekt Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser (mit insgesamt 20 teilnehmenden Spitälern aus 11 Staaten). Heute gibtes bereits 8 Wiener Partnerkrankenhäuser im seit 1996 bestehenden ÖsterreichischenNetzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG), <strong>und</strong> auch der Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong> ist ein Partner des Netzwerks.Das Wiener Informationsnetz Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Spitälern<strong>und</strong> PflegeeinrichtungenIm Jahr 2000 begann die Stadt Wien, das „Wiener Informationsnetzwerk zur Ges<strong>und</strong>heitsförderungin Spitälern <strong>und</strong> Pflegeeinrichtungen“ als ergänzendes, niedrigschwelligesAngebot zum österreichischen Netzwerk aufzubauen, das sich von Anfang an auch anPflegeeinrichtungen richtete <strong>und</strong> diesbezüglich eine österreichische Vorreiterrolle einnahm.Die Arbeit des Informationsnetzwerks hatte die allgemeine Information <strong>und</strong> Fortbildungeiner breiten Fachöffentlichkeit zu Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Krankenhaus <strong>und</strong> Pflegeeinrichtungensowie Vernetzungsangebote für die AkteurInnen aus diesen Einrichtungenzum Ziel. In der siebenjährigen Laufzeit (2000-2007) konnte eine breite Fachdiskussionzur Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Entwicklungsstrategie des Wiener Ges<strong>und</strong>heitswesens angeregtwerden.Die Aktivitäten des Informationsnetzwerks bestanden in folgenden, in Tabelle 6 untenzusammengefassten wesentlichen Punkten:Tabelle 6: Aktivitäten des Wiener Informationsnetzwerks 2000-2007Veranstaltungen,Workshops <strong>und</strong> Vorträge(insgesamt ca.1100 TeilnehmerInnen):• „Start-Enquete“ „Vernetzung <strong>und</strong> Zusammenarbeit: Ges<strong>und</strong>heitsförderungin Wiener Spitälern <strong>und</strong> Pflegeheimen“ (Februar 2000)• 5 Workshops (+ ein Follow-Up-Workshop) zur Information <strong>und</strong> Aktivierungvon Führungskräften <strong>und</strong> ExpertInnen (insgesamt habenca. 550 Führungskräften teilgenommen, zwei Workshops davon imOpen-Space-Design)• 4-teilige Veranstaltungsreihe „Vernetzung <strong>und</strong> Zusammenarbeit“• 4 Wien-spezifische Workshops auf den Jahreskonferenzen des „ÖsterreichischenNetzwerkes Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser(ÖNGK)“• 3 Vorträge im Rahmen von Wiener Ges<strong>und</strong>heitsförderungsveranstaltungen• 5 Vorträge im Rahmen (inter)nationaler Ges<strong>und</strong>heitsförderungskonferenzen114
Kapitel 3 | Netzwerke• 4 Beiträge im Rahmen des SteinhofsymposionsPublikationen: • 10 Publikationen in österreichischen FachzeitschriftenMedien <strong>und</strong> Wissensmanagement:Kooperationen <strong>und</strong>Strukturaufbau:• Aufbau <strong>und</strong> laufendes Contentmanagement einer Homepage• Herausgabe eines halbjährlichen Newsletters• Einrichtung einer Online-Projektdatenbank mit 168 Wiener Projekten• spezifische Wissensaufbereitung:• 3 Factsheets (inkl. ausführlicher Literaturliste zum jeweiligenThema)• Leitliniensammlung• FAQs auf Homepage• Strategische Kooperation mit Trägerorganisationen (seit 2002 kontinuierlichmit dem Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>)• Aufbau einer Ges<strong>und</strong>heitsförderungsgruppe der Wiener Kinder- <strong>und</strong>Jugendabteilungen (inkl. 4 Workshops) <strong>und</strong> Überleitung in die Ges<strong>und</strong>heitsförderungsstrukturdes Wiener Krankenanstaltenb<strong>und</strong>esFachberatungen: • Fachberatungen zum Konzept des Ges<strong>und</strong>heitsförderlichen KrankenhausesThemenschwerpunkte: • Psychosoziale Ges<strong>und</strong>heit bei MitarbeiterInnen in Spitälern <strong>und</strong>Pflegeeinrichtungen (2003)• Ges<strong>und</strong>heitsförderndes Führen in Spitälern <strong>und</strong> Pflegeeinrichtungen(2004)• Aufbau eines Arbeitsschwerpunkts zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung vonKindern <strong>und</strong> Jugendlichen im Krankenhaus (2004-2007)• Ges<strong>und</strong>heitsförderung für <strong>und</strong> durch ältere MitarbeiterInnen (seit2005).Vom Informationsnetzwerk zur AllianzDas „Wiener Informationsnetzwerk Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Spitälern <strong>und</strong> Pflegeeinrichtungen“wurde von der Bereichsleitung für Strukturentwicklung in der GeschäftsgruppeGes<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales der Stadt Wien getragen <strong>und</strong> erhielt wissenschaftliche <strong>und</strong> organisatorischeUnterstützung durch das Ludwig Boltzmann-Institut für Medizin- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologie(Vorgänger des jetzigen Ludwig Boltzmann Instituts für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsforschung).In die strategische Gestaltung war vor 2007 nur eine große Trägereinrichtung– nämlich der Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>, vertreten durch die Generaldirektionsowie die Teilunternehmung 1 (Spitäler) – direkt involviert. Diese erfolgreicheKooperation auf oberster Trägerebene wurde durch die Gründung der „Allianz fürGes<strong>und</strong>heitsförderung in Wiener Spitälern, Pflegeeinrichtungen <strong>und</strong> Seniorenwohneinrichtungen“erweitert, um in Zukunft noch mehr zur Etablierung <strong>und</strong> breiten Umsetzung vonGes<strong>und</strong>heitsförderung im stationären Ges<strong>und</strong>heitswesen in Wien beitragen zu können.Nach Vorgesprächen mit den potenziellen Allianzpartnern, die zwischen Juli <strong>und</strong> Oktober2006 stattfanden, war es am 15. März 2007 soweit: Die "Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderungin Wiener Spitälern, Pflegeeinrichtungen <strong>und</strong> Seniorenwohneinrichtungen" wurdemit der feierlichen Unterzeichnung der "Kooperationsvereinbarung" durch die oberstenManagerInnen des Wiener Ges<strong>und</strong>heitswesens unter dem Vorsitz der Gemeinderätin <strong>und</strong>Vorsitzenden des Wiener Ges<strong>und</strong>heitsausschusses, Marianne Klicka, begründet.115
Kapitel 3 | NetzwerkeAbbildung 12: Gründung der Wiener Allianz am 15. März 2007(Gruppenfoto aus der konstituierenden Sitzung der Allianz – von links: OBEN: Mag.a Ursula Hübel (BST), Mag.Siegfried Weilharter (Wiener Pflege-, Patientinnen- <strong>und</strong> Patientenanwaltschaft), Mag.a Gabriele Graumann(KWP), DI Dr. Hannes Schmidl (BST), Oberin Christa Winter (KAV-TU4), Ing. Johann Kaiser (AUVA), Mag. StephanLampl (Vinzenz Gruppe), Mag.a Christine Pramer (KAV-GD), Hermann Schmied (LBIMGS), Mag. PeterNowak (LBIMGS); UNTEN: GF Edith Piroska (KWP), GR Marianne Klicka (Vorsitzende des Wiener Ges<strong>und</strong>heitsausschusses),GO Charlotte Staudinger (KAV-GD)An der umfassenden Ges<strong>und</strong>heitsinitiative beteiligen sich der Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>mit seinen Einrichtungen (vom AKH über alle Akutspitäler bis zu den Pflegeeinrichtungen),die AUVA mit ihren Unfallspitälern <strong>und</strong> Rehabilitationseinrichtungen, die VinzenzGruppe als größter Wiener konfessioneller Träger mit ihren fünf Spitälern, die WienerGebietskrankenkasse mit dem Hanusch Krankenhaus <strong>und</strong> das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser.Die Wiener Pflege-, Patientinnen- <strong>und</strong> Patientenanwaltschaft ist beratenderPartner der Allianz. Die Bereichsleitung für Strukturentwicklung übernimmt innerhalbder Allianz die Aufgabe der Koordinationsstelle.Im Detail sollen folgende Ziele mit der Allianz erreicht werden:• Verbreitung <strong>und</strong> vertiefte Umsetzung des Konzeptes "Ges<strong>und</strong>heitsförderndes Krankenhaus/ Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung" in Wiener Spitälern, Pflegeeinrichtungen<strong>und</strong> Seniorenwohneinrichtungen zur Förderung der Ges<strong>und</strong>heit von PatientInnen,MitarbeiterInnen <strong>und</strong> der regionalen Bevölkerung• Einschätzung des Bedarfs <strong>und</strong> Bündelung vorhandener Interessen <strong>und</strong> Ressourcen fürGes<strong>und</strong>heitsförderung in Wiener Spitälern, Pflegeheimen <strong>und</strong> Seniorenwohneinrichtungen• Ermöglichung des Wissenstransfers zwischen Trägerorganisationen bzw. Spitälern,Pflegeeinrichtungen <strong>und</strong> Seniorenwohneinrichtungen• Entwicklung von abgestimmten Umsetzungsschwerpunkten• Systematische Unterstützung <strong>und</strong> strukturelle Verankerung der Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungin den operativen Einheiten der einzelnen Allianzpartner• Initiierung <strong>und</strong> Vorbereitung einer möglichen weitergehenden strukturellen Verankerungvon Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Ges<strong>und</strong>heitswesen in Wien.116
Kapitel 3 | NetzwerkeDie Laufzeit der Allianz ist vorerst auf fünf Jahre befristet (März 2007 – März 2012) – dieWeiterarbeit der Allianz nach diesem Zeitpunkt ist prinzipiell vorgesehen <strong>und</strong> muss durcheine neue Vereinbarung zwischen den Partnern geregelt werden.Arbeitsweise der AllianzWie arbeitet die „Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Wiener Spitälern, Pflegeeinrichtungen<strong>und</strong> Seniorenwohneinrichtungen“? Die vielen schon jetzt laufenden Einzelinitiativensollen sichtbar gemacht <strong>und</strong> ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch über die Organisationsgrenzenhinweg begonnen werden. Newsletter, Website, Datenbank <strong>und</strong> Workshopsfür Führungskräfte <strong>und</strong> Fachkräfte unterstützen diesen Wissensaufbau. Zweimal jährlichwerden die Fortschritte der gemeinsamen Strategie evaluiert <strong>und</strong> weitere Entwicklungsinitiativengesetzt.Darüber hinaus wird zum Zeitpunkt der Drucklegung über die Umsetzung eines trägerübergreifendenGes<strong>und</strong>heitsförderungsprojekts zum Thema „Altern in Ges<strong>und</strong>heit amArbeitsplatz“ beraten, das auch im Zentrum der ersten gemeinsamen Veranstaltung derAllianz am 7. November 2007 stand. Die Ergebnisse dieser mit über 250 TeilnehmerInnenaus allen Einrichtungen besonders gut besuchten Veranstaltung fließen in den derzeitlaufenden Prozess der Detailplanung des gemeinsamen Projektes ebenso ein wie wissenschaftlicheErkenntnisse, „Models of Good Practice“ <strong>und</strong> insbesondere auch die Ausgangssituation,Bedürfnisse <strong>und</strong> Möglichkeiten der einzelnen Träger. Idealer Weise wird einmultistrategischer Ansatz verfolgt, der neben der persönlichen Ges<strong>und</strong>heit auch an internenStrukturen (z.B.: Entwicklung horizontaler Karrieremodelle), Personalentwicklung<strong>und</strong> im Bereich Unternehmenskultur <strong>und</strong> Führung ansetzt.Mit der „Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung“ wird der erfolgreiche Weg des „Wiener Informationsnetzwerkes“,das 2000 von der Bereichsleitung für Strukturentwicklung initiiertwurde, auf einer breiteren Basis <strong>und</strong> einem stärkeren Fokus auf Umsetzung fortgesetzt.Die Stadt Wien trägt damit den Empfehlungen der WHO zum Aufbau von Partnerschaftenfür Ges<strong>und</strong>heit als wesentliche Strategie für die nachhaltige Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungRechnung (vgl. Jakarata-Deklaration zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung im 21.Jahrh<strong>und</strong>ert, WHO 1997; Bangkok-Charta zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung in einer globalisiertenWelt, WHO 2005).LiteraturWorld Health Organization (1997): The Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the21st Century. Geneva: World Health OrganizationWorld Health Organization (2005): The Bangkok Charter on Health Promotion in a GlobalizedWorld. Geneva: World Health Organization117
Kapitel 3 | Netzwerke118
Kapitel 4 | Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungen4Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungen119
Kapitel 4 | Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungen4.1Empfehlungen für Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen <strong>und</strong>TrägerorganisationenJürgen M. PELIKAN, Christina DIETSCHERDie Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen blickt internationalwie in Österreich auf nahezu 20 Jahre Erfahrung zurück. Die Sinnhaftigkeit, Machbarkeit<strong>und</strong> in zunehmendem Ausmaß auch die Evidenz dieses Ansatzes haben sich indieser Zeit immer mehr bestätigt (vgl. Kapitel 1.4 zur Evidenz <strong>und</strong> Kapitel 2 zu Umsetzungsbeispielenin dieser Broschüre).In der Umsetzung hat sich das Health Promoting Hospitals (HPH)-Konzept immer an denPrinzipien von professionellem Projektmanagement <strong>und</strong> Organisationsentwicklungorientiert, wobei zuletzt mit der Entwicklung der 18 HPH-Kernstrategien, 7 Implementierungsstrategien<strong>und</strong> den 5 Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenein wichtiger Schritt vom offenen Organisationsentwicklungs-Ansatz hin zueiner stärkeren Standardisierung (mit dem Potenzial zum Benchmarking) <strong>und</strong> einerexpliziten Anbindung ans (Qualitäts-)Management gesetzt wurde (vgl. Kapitel 1.2<strong>und</strong> 1.3 in dieser Broschüre).Dies ist der Hintergr<strong>und</strong> für die folgenden Empfehlungen, die sich an die Leitungsebene<strong>und</strong> das Qualitätsmanagement einzelner Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen <strong>und</strong> Trägerorganisationenrichten <strong>und</strong> zwei Ebenen behandeln:• Empfehlungen für Aufbau <strong>und</strong> Weiterentwicklung einer organisationsinternen Unterstützungsstrukturfür Ges<strong>und</strong>heitsförderung;• Empfehlungen für die Auswahl, Planung, Umsetzung <strong>und</strong> Bewertung spezifischer Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen.Systematische Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungFür eine systematische Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung greifen einzelne Projekteoder Maßnahmen in der Regel zu kurz – dafür bedarf es der Entwicklung spezifischer Unterstützungsstrukturensowohl auf der Ebene von Trägerorganisationen als auch auf derEbene einzelner Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen. Je klarer die Trägerorganisationeine entsprechende Ges<strong>und</strong>heitsförderungspolitik vorgibt <strong>und</strong> fördert,desto einfacher ist die Umsetzung auch auf Ebene der einzelnen Einrichtungendes Trägers.Empfehlungen für den Aufbau <strong>und</strong> die kontinuierliche Weiterentwicklung einerspezifischen Unterstützungsstruktur für Ges<strong>und</strong>heitsförderungDie Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in einer Trägerorganisation oder einer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die dauerhafte <strong>und</strong>systematische Umsetzung. Entsprechend sieht das Internationale Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (HPH) zumindest die Benennungeiner hausinternen Ansprechperson für Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> die Einreichungdes Antrags auf Aufnahme ins Netzwerk durch die oberste Führungsebene vor.Das Österreichische Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG) folgt diesen Vorgaben.Darüber hinaus können aufgr<strong>und</strong> der bisherigen Erfahrungen in der Umsetzung von HPHfolgende weitere Empfehlungen zur Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung aus den Umsetzungsempfehlungenzu den 18 Kernstrategien, den 7 Implementierungsstrategien <strong>und</strong>aus Standard 1 (vgl. dazu auch Kapitel 1.2 dieser Broschüre) abgeleitet werden:120
Kapitel 4 | Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungen• Beauftragung durch die oberste Führungsebene• Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Leitbild der Einrichtung• Explizite Festlegung der Verantwortung für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in der Organisationentweder als eigene Stabsstelle oder als explizite Aufgabe des Qualitätsmanagements34• Einrichtung einer interdisziplinären, interhierarchischen Steuerungsgruppe für Ges<strong>und</strong>heitsförderung• Verabschiedung jährlicher Aktionspläne zur Umsetzung <strong>und</strong> Weiterentwicklung vonGes<strong>und</strong>heitsförderung• Festlegung eines expliziten Budgets für Ges<strong>und</strong>heitsförderung• Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Thema der Personalentwicklung <strong>und</strong> bei der Einschulungneuer MitarbeiterInnen• Regelmäßige organisationsinterne Information über Ges<strong>und</strong>heitsförderung (z.B.interner R<strong>und</strong>brief, Intranet)Eine Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in diesem Sinn ermöglicht auch die systematische,geplante <strong>und</strong> kontinuierliche Auswahl, Planung, Umsetzung <strong>und</strong> Bewertung(Evaluierung bzw. Controlling) von spezifischen Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen, wieim Folgenden vorgeschlagen.Empfehlungen für die Auswahl, Planung, Umsetzung <strong>und</strong> Bewertungspezifischer MaßnahmenAssessment-basierte Auswahl von MaßnahmenWie für andere Organisationsentwicklungs- <strong>und</strong> Reformansätze gilt auch für Ges<strong>und</strong>heitsförderung,dass die Auswahl, Planung <strong>und</strong> Umsetzung spezifischer Maßnahmen auf eineIst-Analyse aufbauen sollte. Für HPH sind dabei zumindest die folgenden vier Bereiche zuberücksichtigen:• Situation der PatientInnen in der Einrichtung: Stärken <strong>und</strong> Schwächen derDienstleistungen <strong>und</strong> Infrastrukturen der Einrichtung hinsichtlich ihrer Beiträge zuEmpowerment, Partizipation, Wohlbefinden, Zufriedenheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitskompetenzder PatientInnen• Situation der MitarbeiterInnen: Stärken <strong>und</strong> Schwächen der Dienstleistungen <strong>und</strong>Infrastrukturen der Einrichtung hinsichtlich ihrer Beiträge zu Empowerment, Partizipation,Wohlbefinden, Arbeitszufriedenheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitskompetenz der MitarbeiterInnen• Regionale Ges<strong>und</strong>heits-Impacts der Einrichtung: Stärken <strong>und</strong> Schwächen hinsichtlichdes Zugangs (für benachteiligte Gruppen), der Kooperation mit vor- <strong>und</strong>nachgelagerten Betreuungseinrichtungen, der Umweltwirkung <strong>und</strong> der ges<strong>und</strong>heitsförderndenKooperation mit regionalen Partnern• Organisatorische Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung: Stärken <strong>und</strong>Schwächen der Einrichtung hinsichtlich der strukturellen Verankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungAls Orientierung für ein derartiges Assessment können die 18 Kernstrategien der Ges<strong>und</strong>heitsförderungin Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen <strong>und</strong> die 7 Implementierungsstrategiendienen, <strong>und</strong> auch die 5 Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung unterstützen ein Assessmentfür Teilbereiche des HPH-Gesamtkonzeptes (vgl. Kapitel 1.2). Jedenfallssollte das Assessment interdisziplinär <strong>und</strong> interhierarchisch – in großen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenam besten getrennt nach Organisationseinheiten – durchgeführtwerden.34 Welche Lösung hier gewählt wird, hängt davon ab, welche Strukturen in einer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen bereitsetabliert sind. Beispiele aus dem ONGKG reichen von Ges<strong>und</strong>heitsförderung als explizite Aufgabe des Qualitätsmanagementsüber Stabsstellenverbünde aus Qualitätsmanagement <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung bis zu eigenenStabsstellen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung.121
Kapitel 4 | Schlussfolgerungen <strong>und</strong> EmpfehlungenPlanung <strong>und</strong> UmsetzungFür die konkrete Bearbeitung sollten jene im Rahmen des Assessments identifiziertenProblembereiche ausgewählt werden, die in der Einrichtung als prioritär erachtet werden<strong>und</strong> für die mit den Mitteln <strong>und</strong> Rahmenbedingungen der jeweiligen Träger- oder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungVerbesserungen in einem befristeten Zeitraum realistisch erwartbarsind. Nach Möglichkeit sollte dabei auf verfügbare <strong>und</strong> evidenzbasierte Instrumentebzw. Programme (z.B. Baby Friendly Hospitals, Smoke-Free Hospitals) zurückgegriffenwerden.Für die Umsetzung gelten im wesentlichen dieselben Kriterien wie für andere Projekte(professionelles Projektmanagement <strong>und</strong> Sicherstellung der zeitlichen, sachlichen <strong>und</strong>sozialen Ressourcen). Ergebnis sollte nach Möglichkeit eine dauerhafte Veränderungvon Routinen <strong>und</strong> / oder Infrastrukturen in der Einrichtung sein.BewertungWie für alle professionellen Maßnahmen gilt auch für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsprojekte <strong>und</strong>-routinen, dass die Wirkung mess- <strong>und</strong> überprüfbar sein muss. Wie bereits eingangserwähnt, zielen Maßnahmen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung auf eine Verbesserung der Wirkungvon Dienstleistungen <strong>und</strong> Infrastrukturen auf Wohlbefinden, (Arbeits-)Zufriedenheit, Lebensqualität <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitskompetenz von Personen sowie – bei spezifischenklinischen Ges<strong>und</strong>heitsförderungsinterventionen – auf eine Verbesserung spezifischerklinischer Outcomes ab.Für Projekte zur Erreichung spezifischer Teilziele sind jeweils adäquate Evaluationsdesignszu entwickeln, die nach Möglichkeit sowohl auf Prozesse als auch auf Ergebnissedes Projektes fokussieren <strong>und</strong> erlauben, einen Zusammenhang zwischen beiden herzustellen.Wo solche Projekte bereits in Routinen übergeführt werden konnten, geht es um dieEtablierung angemessener Monitoring- <strong>und</strong> Controllingmechanismen. Um den Aufwanddafür möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich, spezifische Fragen zu Ges<strong>und</strong>heitsförderungs-Outcomesin Routinebefragungen der Einrichtung (z.B. in regelmäßigeMitarbeiter- <strong>und</strong> Patientenbefragungen) zu integrieren.Ergänzende Unterstützung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung durchTrägerorganisationenZusätzlich zu den genannten Maßnahmen im Bereich des Aufbaus ges<strong>und</strong>heitsfördernderStrukturen 35 haben Trägerorganisationen die Möglichkeit, ihre Einrichtungen in der Umsetzungvon Ges<strong>und</strong>heitsförderung durch folgende Bereiche ergänzend zu unterstützen:• Einbau von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Zielvereinbarungen mit zugehörigen Einrichtungen• Gezielte Personalplanung <strong>und</strong> -entwicklung auch auf dem Gebiet der Ges<strong>und</strong>heitsförderung• Durchführung von organisationsübergreifenden Projekten der Trägereinrichtung(z.B. mit dem Ziel des Benchmarking).35 Ein gutes Beispiel dafür ist der Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong> (KAV), der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in seinemLeitbild <strong>und</strong> als integrierten Bestandteil seines Qualitätskonzept definiert hat. Dies hat dazu geführt, dass es heutein jeder Einrichtung des KAV eine Ansprechperson für Ges<strong>und</strong>heitsförderung mit definierten Aufgaben gibt (vgl.Kapitel 2.10 in dieser Broschüre).122
Kapitel 4 | Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungen4.2Empfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungenvon Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Ges<strong>und</strong>heitswesendurch Entscheidungsträger ausGes<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesenJürgen M. PELIKAN, Christina DIETSCHERGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen sind die zentralen Handlungsakteure des Ges<strong>und</strong>heitswesens.Die Ottawa-Charta (WHO, 1986) attestiert ihnen eine bedeutende Rolle in der Umsetzungvon Ges<strong>und</strong>heitsförderung, die von der jüngeren Evidenzforschung bestätigt wird (vgl.Kapitel 1.4 in dieser Broschüre). Ohne weiterführende Unterstützung sind die Möglichkeiteneinzelner Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen zur Realisierung des vollen Potenzials der Ges<strong>und</strong>heitsförderungaber begrenzt.Die bisherigen Erfahrungen aus dem österreichischen <strong>und</strong> internationalen Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen legen nahe, dass dieUnterstützung durch die nationale Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> andere ges<strong>und</strong>heitspolitischeAkteure <strong>und</strong> Entscheidungsträger aus dem Ges<strong>und</strong>heitswesen die Verbreitung <strong>und</strong> praktischeUmsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen wesentlich unterstützt.In Österreich können sich Entscheidungsträger dabei auf die mehrfache gesetzlicheVerankerung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung als Aufgabe des Ges<strong>und</strong>heitswesens beziehen:• Bereits seit 1992 ist Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzals Aufgabe der Kassen definiert.• Das Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetz von 2005 sieht die Erbringung von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen„in einem ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Umfeld“ vor.• Die Artikel 15a-Vereinbarung zwischen B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern zur Finanzierung desGes<strong>und</strong>heitswesens (2008-2013) definiert Ges<strong>und</strong>heitsförderungsprojekte als eineder Aufgaben von Landesges<strong>und</strong>heitsplattformen.• Nach dem Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflegegesetz <strong>und</strong> der Ärztinnen- / Ärzte-Ausbildungsordnung haben Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflegepersonen <strong>und</strong> ÄrztInnenfür Allgemeinmedizin eine gesetzlich definierte Zuständigkeit für Ges<strong>und</strong>heitsförderung.(vgl. Anhang 5.4)Unterschiedliche Typen von Akteuren <strong>und</strong> Entscheidungsträgern aus dem Ges<strong>und</strong>heitswesen<strong>und</strong> der Ges<strong>und</strong>heitspolitik können zur Umsetzung dieser gesetzlichen Bestimmungenin unterschiedlicher Weise beitragen. Die im Folgenden formulierten Empfehlungenrichten sich entsprechend an• Die nationale Ges<strong>und</strong>heitspolitik• Länder <strong>und</strong> Landesges<strong>und</strong>heitsplattformen• Sozialversicherungen / KassenUnterstützung auf nationaler ges<strong>und</strong>heitspolitischer EbeneDie Empfehlungen zur Unterstützung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung an die nationale Ges<strong>und</strong>heitspolitikgliedern sich in zwei Gruppen:a) Institutionialisierung, Ausbau <strong>und</strong> verstärkte Umsetzung von bereits angelegtenFormen der Unterstützungb) Weiterführende Formen der Unterstützung123
Kapitel 4 | Schlussfolgerungen <strong>und</strong> EmpfehlungenInstitutionialisierung, Ausbau <strong>und</strong> verstärkte Umsetzung von bereits laufendenFormen der UnterstützungDie österreichische Ges<strong>und</strong>heitspolitik hat die Entwicklung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung alsAufgabe des Ges<strong>und</strong>heitswesens bisher in vielfältiger Weise unterstützt. Die folgendenEmpfehlungen schlagen eine Weiterführung <strong>und</strong> zum Teil einen Ausbau dieser Unterstützungvor:• Gesetzliche Rahmenbedingungen: Ges<strong>und</strong>heitsförderung ist in Österreich zwarbereits mehrfach als Aufgabe des Ges<strong>und</strong>heitswesens verankert (vgl. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetz, Artikel 15a-Vereinbarung). Allerdingswird die Umsetzung nicht oder nicht ausreichend exekutiert.Folgende Schritte zur Implementierung der gesetzlichen Bestimmungen, dievon der Forderung nach der Erbringung von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen in einem ges<strong>und</strong>heitsförderlichenUmwelt bis zur Durchführung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsprojektendurch B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsagentur <strong>und</strong> Landesges<strong>und</strong>heitsplattformen reichen, könnenempfoheln werden:o Unterstützung von Pilot- <strong>und</strong> Rollout-Projekten zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung inGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen;o Entwicklung von Qualitätskriterien <strong>und</strong> Standards für Ges<strong>und</strong>heitsförderungin Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (etwa aufbauend auf den fünf in Österreichbereits erprobten Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen);oMonitoring von Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Rahmen von Qualitätsberichterstattung.• Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung der Ges<strong>und</strong>heitsberufe: Gestzliche Bestimmungenhinsichtlich der beruflichen Zuständigkeit <strong>und</strong> Ausbildungsregelungen gibt es in Österreichbisher für die Pflege, die Allgemein- <strong>und</strong> die Arbeitsmedizin. Entsprechende gesetzlicheBestimmungen wären insbesondere auch für FachärztInnen sowohl imniedergelassenen Bereich als auch in Krankenhäusern <strong>und</strong> für andere Ges<strong>und</strong>heitsberufsgruppenzu erlassen.• Forschung <strong>und</strong> Entwicklung: Das Ges<strong>und</strong>heitsressort des B<strong>und</strong>es hat in der Vergangenheitbereits Forschungs- <strong>und</strong> Implementierungsprojekte zur Ges<strong>und</strong>heitsförderungunterstützt, u.a. das Projekt „Empowerment chirurgischer PatientInnen“ 36 <strong>und</strong>die Pilotierung der 5 Standards für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Österreich 37 . Um einestärkere Multiplikatorwirkung zu erzielen, sollten in Zukunft spezifische klinischeForschungsprojekte zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung (analog zu den Forschungen amWHO-Kooperationszentrum für Evidenzbasierte Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Kopenhagen)unterstützt werden – dies würde die Akzeptanz von Ges<strong>und</strong>heitsförderung insbesonderebei ÄrztInnen deutlich erhöhen.• Weiterentwicklung <strong>und</strong> Förderung von unterstützenden Infrastrukturen für Ges<strong>und</strong>heitsförderungim österreichischen Ges<strong>und</strong>heitswesen: Durch die Aktivitätendes Österreichischen Netzwerks Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG), das 1996 auf Initiative des Ges<strong>und</strong>heitsressortsdes B<strong>und</strong>es gegründet wurde, besteht in Österreich bisher vor allem Kompetenz<strong>und</strong> Expertise im Bereich der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Krankenhäusern. Einnächster wichtiger Schritt ist – im Sinne des Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetzes, das sichauf alle Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen bezieht – die Stärkung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungauch für andere Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen. Eine Möglichkeit, diese Entwicklungvoranzutreiben, wären spezifische Kooperationen mit dem ONGKG unterNutzung dessen langjähriger Erfahrungen. Ein anderer wichtiger Ansatz ist dieEtablierung von Allianzen <strong>und</strong> Kooperationen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung mit re-36 B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen (Hg., 2003): Koproduktion durchEmpowerment. Mehr Qualität durch verbesserte Kommunikation mit Patient/innen in der Chirurgie. Wien: B<strong>und</strong>esministeriumfür Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen37 Dietscher C., Nowak P., Pelikan J.M. (2007): 5 Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Krankenhaus. Durchführung<strong>und</strong> wissenschaftliche Begleitung einer Pilottestung. Endbericht für das B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit,Familie <strong>und</strong> Jugend. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssoziologie124
Kapitel 4 | Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungenlevanten Akteuren aus dem österreichischen Ges<strong>und</strong>heitswesen (Sozialversicherungen/ Kassen, Berufsgruppenverbände, Landesges<strong>und</strong>heitsplattformen, ...).Weiterführende Formen der UnterstützungDie folgenden Empfehlungen beziehen sich auf Bereiche, die in Österreich noch nicht umgesetztwerden:• Schaffung (finanzieller) Anreizsysteme: Man weiß aus der Forschung zur leistungsorientiertenFinanzierung von Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen, dass Geldflüsse die Leistungserbringungwesentlich beeinflussen. Eine Integration von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsleistungenins LKF (etwa nach den von Tonnesen et al. 38 ausgearbeitetenEmpfehlungen) würde daher die Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung wesentlich<strong>und</strong> nachhaltig unterstützen.• Entwicklung von nationalen Ges<strong>und</strong>heitszielen <strong>und</strong> Definition von Aufgaben desGes<strong>und</strong>heitswesens in der Zielerreichung: Auch von expliziten Zielvorgaben wäre einewesentliche Stärkung der Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenzu erwarten.Unterstützung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung durch Länder <strong>und</strong>Landesges<strong>und</strong>heitsplattformenAlle für die B<strong>und</strong>espolitik genannten Empfehlungen gelten selbstverständlich auch für dieEbene der Länder <strong>und</strong> Landesges<strong>und</strong>heitsplattformen.Als spezifische Empfehlung auf Länderebene ist die Beauftragung von Forschungs<strong>und</strong>Implementierungsprojekte im Bereich der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(die ja zu den Aufgaben der Landesges<strong>und</strong>heitsplattformenzählt) zu nennen.Wie das Land Steiermark zeigt, können Ges<strong>und</strong>heitsplattformen ihre Aufgabe der Unterstützungvon Ges<strong>und</strong>heitsförderungsprojekten aber noch umfassender wahrnehmen. Sowurden in der Steiermark spezifische Ges<strong>und</strong>heitsziele ausgearbeitet, an deren Umsetzungdie Plattform nun arbeitet. Eines dieser Ziele, „Ges<strong>und</strong>heitsförderndes Ges<strong>und</strong>heitssystemgestalten“, verfolgt die Strategie, dass alle steirischen Krankenhäuser ihreAufgaben am Paradigma eines umfassenden <strong>und</strong> positiven Ges<strong>und</strong>heitsbegriffs orientieren.In diesem Sinne leistet die Plattform wichtige Bewusstseinsbildungsarbeit <strong>und</strong> bereitetden Boden für eine breite Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung auf 39 .Ges<strong>und</strong>heitsförderung im österreichischen Ges<strong>und</strong>heitswesen könnte von einer Übertragungdieser Strategie auf andere B<strong>und</strong>esländer sehr profitieren.Unterstützung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung durch Sozialversicherung <strong>und</strong> KassenNach §116 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ist die österreichische Sozialversicherungauch für Ges<strong>und</strong>heitsförderung zuständig. Das Gesetz ist sehr offenformuliert <strong>und</strong> ermöglicht damit eine breite Auslegung – gegenwärtig engagieren sichdie österreichischen Kassen vor allem auf dem Gebiet der Betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung.Aufgr<strong>und</strong> der guten Evidenz dafür, dass der Kontakt mit einer Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungsich als Startpunkt für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsinterventionen bei PatientIn-38 Tonnesen H., Christensen M.E., Groene O., O'Riordan A., Simonelli F., Suurorg L., Morris D., Vibe P., HimelS., Hansen,P.E. (2007): An evaluation of a model for the systematic documentation of hospital-based healthpromotion activities: results from a multicentre study. In: Bmc Health Services Research(http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-7-145.pdf; Zugriff am 03.07.2008)39 vgl. http://www.ges<strong>und</strong>heit.steiermark.at/cms/beitrag/10743729/9586209, Zugriff am 13.08.2008125
Kapitel 4 | Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungennen besonders gut eignet 40 , wäre aber zu empfehlen, dass sich die Sozialversicherung<strong>und</strong> die Kassen auch für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in der Krankenbehandlung – alsojenem Bereich, den sie auch finanzieren <strong>und</strong> beauftragen – einsetzen. Dies kann geradein der Primärprävention chronischer Erkrankungen <strong>und</strong> bei Personen mit bereits diagnostiziertenchronischen Erkrankungen langrfistig helfen, Behandlungskosten zu senken.Sozialversicherung <strong>und</strong> Kassen können sich auf zumindest dreifache Weise in diesemBereich engagieren:• Einbau von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Verträge mit Leistungserbringern;• Förderung von Infrastrukturen (z.B. Koordinations- <strong>und</strong> Kompetenzzentren analogzur Betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung) für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen,insbesondere für den niedergelassenen Bereich;• Untertützung von spezifischen Umsetzungsprojekten (etwa im Sinne von Benchmarking).40 vgl. z.B. Tonnesen H., Fugleholm A., Jorgensen S.J. (2005): Evidence for health promotion in hospitals. In:Groene O., Garcia-Barbero M. (2005): Health promotion in hospitals: Evidence and quality management.Copenhagen: World Health Organization – Regional Office for Europe126
Kapitel 5 | Anhänge5Anhänge127
Kapitel 5 | Anhänge5.1Auszüge aus der Budapester ErklärungGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser (WHO1991): 17 Forderungen in vier ZielbereichenOrganisations- <strong>und</strong> settingbezogene Maßnahmen• überall im Krankenhaus Gelegenheiten zur Entwicklung von Perspektiven, Zielen <strong>und</strong>Strukturen schaffen, die Ges<strong>und</strong>heit in den Mittelpunkt stellen;• eine gemeinsame Unternehmensphilosophie innerhalb des Krankenhauses entwickeln,welche die Ziele des Ges<strong>und</strong>heitsfördernden Krankenhauses umfasst;• Bewusstsein wecken für den Einfluss des Umfeldes des Krankenhauses auf die Ges<strong>und</strong>heitder PatientInnen, des Personals <strong>und</strong> der Gemeinde; die äußere <strong>und</strong> innereGestaltung des Krankenhauskomplexes sollte Heilungsprozesse unterstützen <strong>und</strong> fördern;• die ges<strong>und</strong>heitsfördernde Qualität <strong>und</strong> Vielfalt der Ernährungsangebote im Krankenhausfür PatientInnen <strong>und</strong> Belegschaft verbessern;Maßnahmen für PatientInnen:• eine aktive <strong>und</strong> mitwirkende Rolle der PatientInnen entsprechend ihrem jeweiligenges<strong>und</strong>heitlichen Vermögen fördern;• überall im Krankenhaus partizipative, auf die Verbesserung der Ges<strong>und</strong>heit ausgerichteteVerfahren <strong>und</strong> Abläufe unterstützen;• das Ausmaß der Unterstützung, das PatientInnen <strong>und</strong> ihre Angehörigen durch dasKrankenhaus erhalten, durch kommunale Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsdienste <strong>und</strong> / oderSelbsthilfegruppen <strong>und</strong> -organisationen vergrößern;• spezifische Zielgruppen (beispielsweise nach Alter, Dauer der Krankheit, usw.) innerhalbdes Krankenhauses identifizieren <strong>und</strong> ihre besonderen ges<strong>und</strong>heitlichen Bedürfnisseanerkennen;• die Unterschiede in den Wertsystemen, Bedürfnissen <strong>und</strong> kulturellen Bedingungenvon Individuen <strong>und</strong> verschiedenen Bevölkerungsgruppen anerkennen;• unterstützende, humane <strong>und</strong> anregende Lebensbedingungen im Krankenhaus insbesonderefür Langzeitpatienten <strong>und</strong> chronisch Kranke entwickeln;• die Versorgung mit Information <strong>und</strong> Kommunikation sowie mit Ausbildungs- <strong>und</strong> Trainingsprogrammenfür PatientInnen <strong>und</strong> ihre Angehörigen erhöhen <strong>und</strong> deren Qualitätverbessern;Maßnahmen für MitarbeiterInnen:• ges<strong>und</strong>e Arbeitsbedingungen für sämtliche MitarbeiterInnen des Krankenhausesschaffen;• sich bemühen, das Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhaus zu einem Modell für ges<strong>und</strong>eDienstleistungen <strong>und</strong> Arbeitsplätze zu machen;• das Angebot <strong>und</strong> die Qualität von Ausbildungs- <strong>und</strong> Trainingsprogrammen für dasPersonal erhöhen;Gemeindebezogene Maßnahmen:• die Zusammenarbeit zwischen lokalen Initiativen im Bereich der Ges<strong>und</strong>heitsförderung<strong>und</strong> den Kommunalbehörden pflegen <strong>und</strong> fördern;• die Kommunikation <strong>und</strong> Zusammenarbeit mit bestehenden Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsdienstenin der Gemeinde verbessern;128
Kapitel 5 | Anhänge• im Krankenhaus eine epidemiologische, speziell auf die Verhütung von Krankheiten<strong>und</strong> Unfällen bezogene Datenbasis entwickeln <strong>und</strong> diese Informationen an öffentlicheEntscheidungsträger <strong>und</strong> andere Institutionen in der Gemeinde weitergeben.129
Kapitel 5 | Anhänge5.2Auszüge aus den Wiener Empfehlungen fürGes<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhäuser (WHO1997): Handlungsempfehlungen in vier BereichenVerbindliches Engagement für ein Ges<strong>und</strong>heitsförderndes Krankenhaus schaffen<strong>und</strong> Mitwirkungsmöglichkeiten stärken durch:• Förderung von partizipatorischen <strong>und</strong> am Ges<strong>und</strong>heitsgewinn orientierten Organisationsprozessen<strong>und</strong> Verfahren im gesamten Krankenhausbereich unter aktiver Einbeziehungaller Berufsgruppen, einschließlich der Bildung von Allianzen mit anderenFachkräften außerhalb des Krankenhauses;• Förderung einer aktiven Mitwirkung <strong>und</strong> Mitentscheidung der Patienten entsprechendihrer vorhandenen Ges<strong>und</strong>heitspotentiale <strong>und</strong> Erfahrungen, Stärkung der Rechte derPatienten, Verbesserung ihres Wohlbefindens <strong>und</strong> Schaffung einer ges<strong>und</strong>heitsförderndenUmwelt im Krankenhaus für die Patienten <strong>und</strong> deren Angehörige;• Schaffung ges<strong>und</strong>er Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter des Krankenhauses; dasschließt auch die Reduktion von krankenhaus-spezifischen Ges<strong>und</strong>heitsgefahren <strong>und</strong>von psychosozialen Risikofaktoren ein;• Stärkung der Verpflichtung des Krankenhausmanagements hin zu einer am Ges<strong>und</strong>heitsgewinnorientierten Politik sowie Integration von Ges<strong>und</strong>heitsförderung als wesentlichesKriterium in alle alltäglichen Entscheidungsprozesse der Organisation Krankenhaus.Verbesserung der Kommunikation, Information <strong>und</strong> Ausbildung durch:• Verbesserung der Kommunikation <strong>und</strong> Krankenhauskultur zur Förderung der Lebensqualitätder Krankenhausmitarbeiter. (Der Stil der Kommunikation unter den Mit-Arbeitern sollte den Erfordernissen der berufsübergreifenden Kooperation gerechtwerden <strong>und</strong> von gegenseitiger Akzeptanz getragen sein);• Verbesserung der Kommunikation zwischen den Mitarbeitern des Krankenhauses <strong>und</strong>den Patienten, basierend auf gegenseitigem Respekt <strong>und</strong> mitmenschlichem Verständnis;• Verstärkung der Angebote <strong>und</strong> Qualität der Information, Kommunikation, Ausbildungs-<strong>und</strong> Trainingsprogramme für Patienten <strong>und</strong> deren Angehörige im Umgang mitGes<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankheit;• Integration der Gr<strong>und</strong>sätze eines ges<strong>und</strong>heitsfördernden Krankenhauses in die Alltagsroutinendes Krankenhauses im Zuge der Entwicklung einer "Corporate Identity"im Krankenhaus;• Verbesserung der Kommunikation <strong>und</strong> Zusammenarbeit mit bestehenden Ges<strong>und</strong>heits-<strong>und</strong> Sozialdiensten im kommunalen Umfeld, mit lokalen Initiativen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung,Selbsthilfeeinrichtungen <strong>und</strong> anderen Organisationen mit dem Ziel derOptimierung der Schnitt- bzw. Nahtstellen zwischen verschiedenen Diensten <strong>und</strong> Akteurendes Ges<strong>und</strong>heitssektors;• Entwicklung von Informationssystemen, die nicht nur administrativen Zwecken dienen,sondern auch die ges<strong>und</strong>heitlichen Ergebnisse messen <strong>und</strong> darstellen.Nutzung von Methoden <strong>und</strong> Techniken der Organisationsentwicklung <strong>und</strong> desProjektmanagements:• Entwicklung des Krankenhauses zu einer lernenden Organisation durch Veränderungbestehender Krankenhausroutinen;130
Kapitel 5 | Anhänge• Ausbildung <strong>und</strong> Training des Krankenhauspersonals in den für die Ges<strong>und</strong>heitsförderungrelevanten Bereichen wie Aufklärung, Kommunikation, psychosoziale Fähigkeiten<strong>und</strong> Fertigkeiten sowie Management;• Ausbildung der Projektleiter in Methoden des Projektmanagements <strong>und</strong> in kommunikativenFertigkeiten.Aus Erfahrung lernen:• durch Austausch von Erfahrungen mit der Umsetzung Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhaus-Projekteauf nationaler <strong>und</strong> internationaler Ebene sollten die teilnehmendenKrankenhäuser unterstützt werden, von den unterschiedlichen Herangehensweisen zuProblemlösungen zu lernen;• Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhäuser sollten sich deshalb zu regionalem, nationalem<strong>und</strong> inter-nationalem Informations- <strong>und</strong> Erfahrungsaustausch verpflichten.131
Kapitel 5 | Anhänge5.3Statuten des Internationalen NetzwerksGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (HPH)Verabschiedet am 14. Mai 2008 41PräambelDie Entstehung des Internationalen Netzwerkes Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen geht auf eine Initiative der Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation(WHO) zur Umsetzung der WHO-Gr<strong>und</strong>sätze zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung zurück. SeineZielgruppen sind PatientInnen, MitarbeiterInnen, die Gemeinde sowie die Umwelt vonKrankenhäusern <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen. Das Netzwerk hat nun eine stabile Phaseerreicht, die es ihm ermöglicht, als Rechtspersönlichkeit <strong>und</strong> Hauptkooperationspartnerder WHO aufzutreten.Mit diesen Statuten legt das Internationale HPH-Netzwerk seinen Zweck <strong>und</strong> seine Zielefest <strong>und</strong> definiert die Regeln für Entscheidungen seiner Organe sowie die Beziehungenzwischen seinen Mitgliedern <strong>und</strong> internationalen Partnern.Artikel IName, Ziele, Sitz1. MissionDie Ges<strong>und</strong>heitsfördernden Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen des InternationalenNetzwerks streben die Integration der Konzepte, Werte, Strategien <strong>und</strong> Standardsoder Indikatoren der Ges<strong>und</strong>heitsförderung in die organisationale Struktur <strong>und</strong> Kulturvon Krankenhäusern <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen an. Das Ziel ist mehr Ges<strong>und</strong>heitsgewinndurch die Verbesserung der Qualität von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen, der Beziehungenzwischen Krankenhaus / Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen mit der Gemeinde <strong>und</strong> der Umwelt,sowie der Bedingungen für die Zufriedenheit von PatientInnen, Angehörigen <strong>und</strong> MitarbeiterInnen.Das Internationale Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen,im folgenden das Internationale Netzwerk genannt, folgt den in der Ottawa-Charta (1986), der Budapester Erklärung (1991), den Wiener Empfehlungen (1997), derBangkok-Charta (2006) <strong>und</strong> den Standards der Ges<strong>und</strong>heitsförderung im Krankenhaus(2004) festgeschriebenen WHO-Gr<strong>und</strong>sätzen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Das InternationaleHPH-Netzwerk kooperiert zur Umsetzung von Ges<strong>und</strong>heitsförderungsstrategien wiePatientensicherheit (2004) oder Prävention nicht übertragbarer Krankheiten in der EuropäischenWHO-Region (2006) mit internationalen Organisationen wie der EuropäischenKommission <strong>und</strong> der WHO.2. ZweckDas Internationale HPH-Netzwerk fördert die Verbreitung des Konzeptes der Ges<strong>und</strong>heitsförderungin Krankenhäusern <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen (entsprechend der Definitionin der oben angeführten Mission). Auf internationaler Ebene unterstützt es inLändern <strong>und</strong> Regionen die Umsetzung des Konzepts mittels technischer Hilfestellungen<strong>und</strong> der Gründung neuer nationaler / regionaler Netzwerke.41 Das vorliegende Dokument wurde durch eine gemeinsame Übersetzung der englischen Originalfassung durchdie Deutschsprachigen Netzwerke Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen, an derChristina Dietscher, Nils Undritz, Werner Schmidt, Felix Bruder <strong>und</strong> Elimar Brandt mitgewirkt haben.132
Kapitel 5 | Anhänge3. Ziele• Aufbau von Kompetenzen in zentralen Bereichen Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen <strong>und</strong> partnerschaftliche Zusammenarbeit in jenenBereichen, in denen Kooperationsbedarf besteht• Stärkung der HPH-bezogenen Forschung <strong>und</strong> Vermittlung von Anreizen zur Entwicklung,Übersetzung <strong>und</strong> Verbreitung relevanten Wissens• Definition von Normen <strong>und</strong> Standards, sowie Unterstützung <strong>und</strong> Monitoring ihrer Implementierung• Formulierung von ethischen <strong>und</strong> evidenzbasierten Gr<strong>und</strong>sätzen <strong>und</strong> Verfahrensweisen• Bereitstellung von technischer Unterstützung, Förderung des Wertewandels, Aufbaudauerhafter internationaler Strukturen <strong>und</strong> Kapazitäten• Monitoring der Entwicklung von Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Krankenhäusern <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen4. ReferenzrechtRechtsgr<strong>und</strong>lage für die Konstituierung des Internationalen HPH-Netzwerks als Verein istdas Schweizer Zivilrecht, Artikel 60 ff. Eine Entscheidung zur Änderung des Referenzrechtsbedarf einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmen in der Generalversammlung(Art. V, §6).5. Das Internationale HPH-SekretariatDas Internationale HPH-Sekretariat kann sich in jedem von der Generalversammlungfestgesetzten Mitgliedsland befinden. Eine Entscheidung zur Änderung des Sekretariatssitzesbedarf einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmen in der Generalversammlung(Art. V, §6).Das Internationale HPH-Sekretariat soll normalerweise in einem WHO-Kooperationszentrum angesiedelt sein. Die Funktionen des Kooperationszentrums <strong>und</strong>des / der Mitgliedsnetzwerk(e) in einem Land sollen getrennt sein.Artikel IIMitgliedschaft <strong>und</strong> Wahlrecht1. Kollektive Mitglieder1.1 Zulassung zur MitgliedschaftDie Nationalen / Regionalen HPH-Netzwerke konstituieren die kollektiven Mitgliederdes Internationalen HPH-Netzwerks. Nationale / regionale Netzwerke, die ArtikelI § 1 unterstützen, können zur Mitgliedschaft zugelassen werden.1.2 RepräsentativitätEin nationales / regionales HPH-Netzwerk muss mindestens 3 Krankenhäuser /Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen repräsentieren.1.3 Aufgaben <strong>und</strong> PflichtenAufgaben eines nationalen / regionalen HPH-Netzwerks sind:• Nationale / regionale Umsetzung der Mission, des Zwecks <strong>und</strong> der Ziele derGes<strong>und</strong>heitsförderungsprinzipien der WHO gemäß Artikel I § 1, 2 <strong>und</strong> 3 obendurch Unterstützung von Strategie- <strong>und</strong> Planungsarbeit, Implementation vonGes<strong>und</strong>heitsförderung, Entwicklung eines Kommunikationssystems, sowie Angebotenfür Ausbildung <strong>und</strong> Training• Entwicklung einer Strategie <strong>und</strong> eines Aktionsplans zu deren Implementierung• Einsetzen einer Koordinationsinstanz <strong>und</strong> eines / einer Koordinatorin• Rekrutierung <strong>und</strong> Anerkennung neuer Mitgliedskrankenhäuser <strong>und</strong> -ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen im nationalen / regionalen Netzwerk <strong>und</strong> Meldung andas Internationale HPH-Sekretariat• Einsammeln der von der Generalversammlung festgesetzten Mitgliedsgbeiträgevon allen Mitgliedern <strong>und</strong> Zahlung des vollen Betrags an das InternationaleHPH-Sekretariat innerhalb der festgesetzten Zahlungsfristen• Periodische Übermittlung eines Fortschrittsberichts an den InternationalenVorstand133
Kapitel 5 | Anhänge• Zustimmung der konstituierenden Mitglieder zu den Regeln <strong>und</strong> Funktionsweisendes Nationalen / Regionalen Netzwerks.1.4 AufnahmeDie Aufnahme ins Internationale HPH-Netzwerk erfolgt durch Zustimmung desVorstands. Ein Vertrag mit vierjähriger Laufzeit wird zwischen der nationalen / regionalenKoordinationsstelle <strong>und</strong> dem Internationalen HPH-Sekretariat unterzeichnet.1.5 StimmrechtDas Stimmrecht in der Generalversammlung steht ausschließlich nationalen / regionalenNetzwerken zu. Der Koordinator / die Koordinatorin oder eine anderevom nationalen / regionalen Netz bevollmächtigte Person übt dieses Recht aus.Jedem nationalen / regionalen Netzwerk steht eine Stimme zu.2. Einzelmitglieder2.1 Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen, die Mitglied eines nationalen / regionalenNetzwerks sind, werden durch die von ihrem nationalen / regionalenNetzwerk unterzeichnete schriftliche Absichtserklärung (letter of intent), welchedie Mission dieser Statuten anerkennt, zu Einzel-Mitgliedern im InternationalenHPH-Netzwerk.2.2 Ausnahmen sind Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen in Ländern, in denenkein Netzwerk besteht. Diese können vom Internationalen HPH-Netzwerk alsGes<strong>und</strong>heitsförderndes Krankenhaus oder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung als Mitglied desInternationalen Netzwerks anerkannt werden. Sie werden Mitglied durch Unterzeichnungder Absichtserklärung mit dem Internationalen HPH-Sekretariat. DerVorstand muss in Folge ihre Mitgliedschaft ratifizieren.2.3 Einzelmitglieder werden in der Generalversammlung durch eine/n bevollmächtigte/nnationale/n / regionale/n KoordinatorIn oder eine andere autorisierte Personder designierten nationalen / regionalen Koordinationseinrichtung vertreten.2.4 Individuelle <strong>und</strong> vom Internationalen HPH-Netzwerk als Ges<strong>und</strong>heitsförderndesKrankenhaus oder Ges<strong>und</strong>heitseinrichtung anerkannte Mitglieder haben gemäßdieser Statuten Anspruch auf die Unterstützung des Internationalen <strong>und</strong> der Nationalen/ Regionalen HPH-Netzwerke sowie auf vergünstigte Gebühren bei internationalenHPH-Veranstaltungen.3. GeschäftsordnungDie Generalversammlung kann detailliertere Regelungen über die Mitgliedschaftskriterienfestsetzen.Artikel IIIPartnerschaft mit internationalen OrganisationenDas Internationale HPH-Netzwerk betraut WHO-Kooperationszentren mit der Verantwortungfür seine wichtigsten Funktionen.Das Internationale HPH-Netzwerk arbeitet zur Unterstützung seiner ges<strong>und</strong>heitsförderndenStrategien gemäß Art. I § 1 mit internationalen Organisationen wie der EuropäischenKommission oder der WHO zusammen.Darüber hinaus stellt das Internationale HPH-Netzwerk für alle Mitgliedsstaaten mit HPH-Mitgliedern Knowhow, Instrumente <strong>und</strong> technische Unterstützung für die Umsetzung derStrategie, die Stärkung ihrer Public Health-Politik <strong>und</strong> ihrer Ges<strong>und</strong>heitssysteme in Richtungverstärkter Möglichkeiten für Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> die Kontrolle nicht übertragbarerKrankheiten sowie zur Sicherstellung des Zugangs im Sinne chancengleicherGes<strong>und</strong>heitsversorgung <strong>und</strong> zur Implementierung zuverlässiger Monitoring-Mechanismenzur Verfügung.134
Kapitel 5 | AnhängeArtikel IVOrganeDie Generalversammlung <strong>und</strong> der Vorstand sind die Organe des Internationalen HPH-Netzwerks.Artikel VDie Generalversammlung1 Die Generalversammlung ist die Versammlung der Kollektiven Mitglieder des InternationalenHHP-Netzwerks. Sie stellt das höchste Organ des Internationalen Netzwerksdar.2 Die Generalversammlung trifft sich mindestens einmal jährlich <strong>und</strong> vorzugsweise inVerbindung mit der Internationalen HPH-Konferenz.3 Ort <strong>und</strong> Datum eines von der Generalversammlung beschlossenen Treffens müssenden Mitgliedern mindestens drei Monate im Voraus bekannt gegeben werden.4 Alle kollektiven Mitglieder <strong>und</strong> Task Force-Leiter des Internationalen HPH-Netzwerkshaben das Recht zur Teilnahme <strong>und</strong> Anhörung an der Generalversammlung. DasStimmrecht in der Generalversammlung steht nur den Kollektiven Mitgliedern zu. DasStimmrecht ist in Art. II § 1.6 beschrieben.5 Im Rahmen ihrer Treffen hat die Generalversammlung folgende Aufgaben:5.1 Wahl der Vorstandsmitglieder gemäß Statuten5.2 Beratung strategischer Fragen <strong>und</strong> Verabschiedung des Strategieplans des InternationalenHPH-Netzwerks5.3 Entgegennahme des jährlichen Berichts des Vorstands <strong>und</strong> des InternationalenHPH-Sekretariats5.4 Beschluss des Aktionsplans für das kommende Jahr5.5 Festlegen der Mitgliedsgebühren für individuelle Mitgliedskrankenhäuser <strong>und</strong> -ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen. Die jeweils geltenden Gebühren sind in einem Anhangzu den Statuten festgehalten.5.6 Beschluss des Budgets <strong>und</strong> des Rechnungsabschlusses, die vom InternationalenHPH-Sekretariat vorgelegt werden.5.7 Beendung von Mitgliedschaften gemäß Art. XIV5.8 Beschluss einer Spesenersatzregelung für Mitglieder der Organe5.9 Verabschieden von Vorgaben, Regelungen, Abläufen <strong>und</strong> Mitgliedschaftskriterien5.10 Beschluss von Statutenänderungen mit Zweidrittel-Mehrheiten der anwesendenStimmberechtigten gemäß Art. XVI <strong>und</strong> Art. V § 6.5.11 Beschluss über den Sitz des Kongresssekretariats <strong>und</strong> des InternationalenSekretariats gemäß den Empfehlungen des Vorstands in Übereinstimmung mitArt. I § 5 <strong>und</strong> Art. 6 § 10.6 Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller kollektivenMitglieder anwesend sind. Die Entscheidungen der Generalversammlung werdendurch einfache Mehrheit getroffen. Ausnahmen sind Entscheidungen über das Referenzrecht,den Sitz des Internationalen HPH-Sekretariats (Art. I § 4, 5), Änderungendes Statuts (§ 5.10 oben <strong>und</strong> Art. XVI) oder über die Auflösung des InternationalenHPH-Netzwerks (Art. XVII), für die eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich ist.7 Mitglieder der Generalversammlung können Anträge zur Tagesordnung einbringen.Alle Anträge sind dem Internationalen HPH-Sekretariat acht Wochen vor dem jeweiligenTreffen zu übermitteln, <strong>und</strong> die Tagesordnung der Generalversammlung mussvier Wochen vor dem jeweiligen Termin an die Mitglieder übermittelt werden.Die Generalversammlung kann nur über Anträge abstimmen, die zuvor dem Vorstandvorgelegt wurden, der dann die Generalversammlung darüber informiert. Dennochkönnen aktuelle Themen, die einer aktuellen Entscheidung bedürfen, von der Generalversammlungberaten werden, sofern sie mit einfacher Mehrheit entschieden werdenkönnen <strong>und</strong> eine Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden Stimmen dies wünscht (§6 oben).135
Kapitel 5 | AnhängeArtikel VIDer Vorstand1. Der Vorstand bereitet die Entscheidungen der Generalversammlung vor, führt sie aus<strong>und</strong> führt die Vereinsgeschäfte in der Zeit zwischen den Generalversammlungen. Erbefasst sich mit allen in den Statuten festgelegten Aufgaben, die nicht in die statutengemäßeZuständigkeit der Generalversammlung fallen.2. Der Vorstand besteht aus sieben von der Generalversammlung gewählten Mitgliedern<strong>und</strong> zwei permanenten Mitgliedern für VertreterInnen von WHO-Kooperationszentren,die Funktionen gemäß Artikel VIII <strong>und</strong> IX ausüben. Die Mitglieder haben das Recht,abzustimmen. Ausgenommen sind mögliche mit einer Abstimmung zusammenhängendeInteressenskonflikte.2.1 Der Vorstand hat die Möglichkeit, Beobachter zuzuziehen, die internationale Organisationenaußerhalb des HPH-Netzwerks vertreten, die spezielle Verträge mit dem Netzwerkhaben, wie zum Beispiel die Europäische Kommission oder die WHO (Art. III).3. Die Mitglieder des Vorstands werden auf jeweils zwei Jahre gewählt. Sie können einmalwiedergewählt werden.4. Nach der Wahl konstituiert der Vorstand sich selbst <strong>und</strong> wählt eine/n Vorsitzende/n<strong>und</strong> eine/n Vizevorsitzende/n.5. Der Vorstand kommt mindestens zweimal jährlich zusammen.6. Nur Personen, die ein nationales / regionales Netzwerk repräsentieren, kommen alsVorstandsmitglied in Frage (Artikel II § 2.3).7. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder einschließlich desVorsitzenden anwesend sind. Er trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit.8. Der Vorstand empfiehlt der Generalversammlung den Sitz des Kongresssekretariats(üblicherweise in einem WHO-Kooperationszentrum).9. Der Vorstand empfiehlt der Generalversammlung den Sitz des Internationalen HPH-Sekretariats (üblicherweise in einem WHO-Kooperationszentrum).10. Der Vorstand genehmigt die Rahmenvorgaben für den Auftrag (terms of references)des Internationalen HPH-Sekretariats <strong>und</strong> des Kongresssekretariats, sofern dieseFunktionen des internationalen HPH-Netzwerks betreffen (Artikel VIII <strong>und</strong> IX). DieseRahmenvorgaben werden mit den zuständigen Organisationen vereinbart <strong>und</strong> geltenüblicherweise für eine Periode von vier Jahren.Artikel VIIBriefwahl <strong>und</strong> Stimmberechtigung1 Wenn eine Angelegenheit, wie es der Fall sein kann, einer Entscheidung bedarf, dienicht bis zum nächsten Treffen des Vorstands aufgeschoben werden kann, kann der /die DirektorIn des internationalen HPH-Sekretariats vom / von der Vorstandsvorsitzendenermächtigt werden, die Meinungen der betroffenen Mitglieder schriftlich einzuholen<strong>und</strong> auf Gr<strong>und</strong> der sich abzeichnenden Meinungsmehrheit die notwendigenSchritte einzuleiten.2 Die Generalversammlung kann keine Abstimmungen auf dem schriftlichen Wegdurchführen.Eine Stimmübertragung von einem Mitglied auf das andere ist sowohl in der Generalversammlungals auch im Vorstand nicht zulässig.Artikel VIII Internationales HPH-Sekretariat1 Das Internationale HPH-Sekretariat erfüllt folgende Aufgaben:1.1 Administration1.2 Entwicklung einer Kommunikationsstrategie1.3 Interne <strong>und</strong> externe Kommunikation1.4 Bereitstellen von Fachkommentaren <strong>und</strong> die Beantwortung von Anfragen1.5 Öffentlichkeitsarbeit für HPH136
Kapitel 5 | Anhänge2 Das Internationale HPH-Sekretariat bereitet die Zielsetzungen des InternationalenHPH-Netzwerks gemäß Artikel I § 3 vor <strong>und</strong> führt sie aus. Es verwaltet Mitgliedschaftenim Netzwerk. Es überwacht die Einzahlung der Mitgliedsgebühren <strong>und</strong> erstellt dasBudget sowie die Finanzberichte. Es bereitet die Treffen der Generalversammlung <strong>und</strong>des Vorstands vor, führt die Protokolle <strong>und</strong> die Buchhaltung. Es arbeitet kontinuierlichan der Weiterentwicklung einer Kommunikationsstrategie zur Vernetzung der Mitglieder<strong>und</strong> zum Austausch von Wissen <strong>und</strong> Erfahrungen, <strong>und</strong> an deren Implementierungmittels einer interaktive Webseite.3 Das Internationale HPH-Sekretariat ist normalerweise an einem WHO-Kooperationszentrum angesiedelt. Die Funktionen des Internationalen HPH-Sekretariats sollen zum Wohl aller Mitglieder ausgeübt werden.4 Der / die DirektorIn des WHO-Kooperationszentrums ist zugleich der / die GeschäftsführerIndes Internationalen HPH-Sekretariats. In dieser Rolle hat er / sie sich gegenüberder Generalversammlung <strong>und</strong> dem Vorstand zu verantworten.Artikel IXKongresssekretariat1 Die jährliche Internationale HPH-Konferenz wird normalerweise vom Kongresssekretariatin Zusammenarbeit mit jenem nationalen / regionalen Netzwerk organisiert,das als Gastgeber fungiert. Sie einigen sich auf ein gemeinsames Budget, das derGeneralversammlung vorzulegen ist.2 Das Kongresssekretariat bietet seine Leistungen dem nationalen / regionalen Netzwerkan, das als Gastgeber fungiert. Es moderiert ein Wissenschaftliches Komitee ausFreiwilligen, das aus VertreterInnen der Nationalen / Regionalen HPH-Netzwerke <strong>und</strong>/ oder der individuellen Mitglieder, VertreterInnen der KoorganisatorInnen <strong>und</strong> externenwissenschaftlichen Mitgliedern besteht. Das Wissenschaftliche Komitee berät dieThemen, die ReferentInnen <strong>und</strong> die Auswahl der eingereichten Beiträge.3 Das Kongresssekretariat ist üblicherweise an einem WHO-Kooperationszentrum angesiedelt.Seine Funktionen sollen zum Wohle aller Mitglieder ausgeübt werden.4 Das Kongresssekretariat ist dem Vorstand gegenüber berichtspflichtig.5 Die HPH-Konferenz soll sich in erster Linie über die Teilnahmegebühren finanzieren.Artikel XTask ForcesTask Forces werden vom Vorstand vorgeschlagen <strong>und</strong> von der Generalversammlung genehmigt.Sie sind Teams zur ergebnisorientierter Behandlung von Themen mit besondererExpertise innerhalb der allgemeinen Ziele des Internationalen HPH-Netzwerks. TaskForces arbeiten gemäß einer Geschäftsordnung <strong>und</strong> daraus abgeleiteter Aktionspläne. Siesind Ansprechpartner für technische, organisatorische <strong>und</strong> wissenschaftliche Unterstützungzu speziellen Themen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung1 Die Themen einer Task Force stimmen üblicherweise mit HPH-Gr<strong>und</strong>sätzen <strong>und</strong> Wertenüberein.2 Die Mitglieder einer Task Force schlagen der Generalversammlung, welcher das Genehmigungsrechtvorbehalten ist, eine/n Task Force-LeiterIn vor. Task Force-LeiterInnen sollten Mitglieder des Internationalen HPH-Netzwerks sein.3 Task Forces werden von der Generalversammlung für vier Jahre eingesetzt. Eine Verlängerungist möglich.4 Der / die Task Force-LeiterIn ist dem Vorstand berichtspflichtig <strong>und</strong> übermittelt regelmäßigeFortschrittsberichte.5 Task Forces haben die Möglichkeit, sich im Rahmen der Internationalen HPH-Konferenz zu treffen, <strong>und</strong> Task Force-LeiterInnen werden vom Internationalen HPH-Sekretariat zur Teilnahme bei den Generalversammlungen eingeladen.6 Task Forces sind gr<strong>und</strong>sätzlich selbstfinanziert, können aber den Vorstand für spezielleVorhaben um Unterstützung ersuchen. Der Vorstand kann diese Ansuchen der Generalversammlungvorschlagen, die darüber abstimmt.137
Kapitel 5 | AnhängeArtikel XIArbeitsgruppenArbeitsgruppen können vom Vorstand oder der Generalversammlung eingesetzt werden.Üblicherweise sind Arbeitsgruppen projektförmig innerhalb eines bestimmten Zeitraums<strong>und</strong> mit dem Ziel der Erstellung klar definierter Ergebnisse organisiert, die zur Erreichungder allgemeinen Ziele des Internationalen HPH-Netzwerks beitragen (Art. I § 3).1 Das Thema einer Arbeitsgruppe entspricht den Gr<strong>und</strong>sätzen <strong>und</strong> Werten von HPH.2 Die Mitglieder von Arbeitsgruppen sind Mitglieder des Internationalen HPH-Netzwerks<strong>und</strong> VertreterInnen unterschiedlicher Einrichtungen wie Krankenhäusern, Universitätszentren,Public Health-Einrichtungen <strong>und</strong> Freiwilligen-Organisationen.3 Eine Arbeitsgruppe kann durch Beschluss der Generalversammlung fortgesetzt, beendetoder in eine Task Force umgewandelt werden.4 Arbeitsgruppen sind dem Vorstand berichtspflichtig <strong>und</strong> stellen regelmäßige Fortschrittsberichtezur Verfügung.5 Arbeitsgruppen sind gr<strong>und</strong>sätzlich selbstfinanziert, können aber den Vorstand für spezielleVorhaben um Unterstützung ersuchen. Der Vorstand kann diese Ansuchen derGeneralversammlung vorschlagen, die darüber abstimmt.Artikel XIIFinanzierung1 Der Vorstand lässt die Finanzgebarung des Internationalen HPH-Netzwerks jährlichvon einer anerkannten Einrichtung aus dem Finanzwesen überprüfen. Das Ergebniswird der Generalversammlung bei ihren regulären Treffen vorgelegt (Art. V § 5.6, Art.VIII § 2). Das Finanzjahr des Internationalen HPH-Netzwerks läuft vom 1. Januar zum31. Dezember.2 Die Einkünfte können sich aus Mitgliedsgebühren <strong>und</strong> anderen Quellen zusammensetzen.Artikel XIII Austritt eines kollektiven Mitglieds1 Ein nationales / regionales Netzwerk, das mit der Zahlung seiner Mitgliedsgebührennicht im Verzug ist, kann aus dem Internationalen HPH-Netzwerk per 31. Dezembereines Jahres austreten, wenn es den Vorstand darüber 12 Monate im Voraus informiert.Der Vorstand bestätigt dem betroffenen Netzwerk den Austritt. Nach Ablauf derzwölfmonatigen Austrittsfrist gibt das betroffene nationale / regionale HPH-Netzwerkalle Rechte <strong>und</strong> Pflichten der Mitgliedschaft auf.Artikel XIV Entzug <strong>und</strong> Beendigung der Kollektiven MitgliedschaftIm Falle fehlender Zahlungen erhält ein Kollektives Mitglied zwei Verwarnungen – einepro Kalenderjahr. Nach der zweiten Warnung folgt der Entzug des Stimmrechts in derGeneralversammlung. Im Fall fortgesetzten Zahlungsverzugs wird das Mitglied nach Ablaufder Vereinbarung aus dem Internationalen HPH-Netzwerk ausgeschlossen.1 In Ausnahmefällen wird ein Kollektives Mitglied von der Mitgliedschaft suspendiert,wenn es nicht in der Lage ist, seine Kernaufgaben zu erfüllen (Art. II § 1.4).2 Der Vorstand entscheidet auf Gr<strong>und</strong>lage der Einschätzung des jeweiligen Falls überden Zeitrahmen <strong>und</strong> die Suspension.3 Der Vorstand kann der Generalversammlung die Beendigung der Mitgliedschaft einesbeliebigen nationalen / regionalen Netzwerks vorschlagen, wenn dieses nachweislichgegen die Mitgliedschaftskriterien (Art. II § 1) verstößt.138
Kapitel 5 | AnhängeArtikel XVWiedereinsetzungs- <strong>und</strong> / oder Wiederzulassungsverfahren1. Wiederzulassung nach SuspendierungDem Wiederzulassungsprozedere hat eine Erfüllung der Mitgliedschaftsverpflichtungen,einschließlich der Zahlung der Gebühren für den Zeitraum der Ausschließung, voranzugehen.Im Falle eines vorangegangenen Ausschlusses für mehr als vier Jahre kann das kollektiveMitglied ohne Zahlung der ausständigen Gebühren wiederzugelassen werden,wenn es die Mitgliedschaftskriterien erfüllt <strong>und</strong> die fälligen Gebühren für ein Kalenderjahrim Voraus bezahlt.Die Generalversammlung ist über derartige Wiederzulassungen vonKollektiven Mitgliedern in Kenntnis zu setzen.2. Wiederzulassung nach einem Austritt oder einer Beendigung der MitgliedschaftNach einem Austritt oder einer Beendigung der Mitgliedschaft entspricht das Wiederzulassungsprozederedem Verfahren für Neuaufnahmen (Art. II § 1), ergänzt um folgendePunkte:Ein Nationales / Regionales Netzwerk, das die internationale Mitgliedschaft auf eigeneInitiative zurückgelegt hat <strong>und</strong> mit der Zahlung seiner Gebühren nicht im Rückstand ist(Art. VIII), kann sich um Wiederzulassung bewerben, wenn es die Kriterien der Mitgliedschafterfüllt <strong>und</strong> in der Zwischenzeit nicht durch ein anderes nationales / regionalesNetzwerk in diesem Land ersetzt wurde.Wenn die Beendigung der Mitgliedschaft mit einem Zahlungsrückstand verb<strong>und</strong>en war,ist für die Neuanerkennung die Vorauszahlung der Gebühren für ein Kalenderjahr erforderlich.Artikel XVI Änderungen der StatutenJeder Antrag auf Änderung dieses Statuts muss dem Vorstand mindestens sechs Monatevor der nächsten Generalversammlung schriftlich übermittelt werden <strong>und</strong> erlangt nurdurch Zustimmung einer Zweidrittel-Mehrheit der in der Generalversammlung anwesendenStimmen Gültigkeit (Art. V § 6).Artikel XVII Auflösung des Internationalen HPH-NetzwerksDas Internationale HPH-Netzwerk kann nur durch eine Ankündigung des Vorstandes mindestensneun Monate im Voraus <strong>und</strong> durch Zustimmung eine Zweidrittel-Mehrheit deranwesenden Stimmen aufgelöst werden (Art. V § 6).Im Fall der Auflösung des Internationalen HPH-Netzwerks führt der Vorstand die Liquidierungdurch, wobei der Verbleib der Aktiva des Internationalen HPH-Netzwerks zu regelnist. Das Prozedere hat in Übereinstimmung mit dem Referenzrecht zu erfolgen, unterdem das Internationale HPH-Netzwerk konstituiert wurde <strong>und</strong>, soweit möglich, das Wohlder internationalen Aktivitäten der kollektiven <strong>und</strong> individuellen Mitglieder zu berücksichtigen.Artikel XVIIIInkrafttretenDiese Statuten treten mit Beschluss einer Dreiviertelmehrheit der bei der Generalversammlungam 14. Mai 2008 anwesenden Stimmen in Kraft.*****139
Kapitel 5 | Anhänge5.4Überblick: Gesetzliche Verankerung vonGes<strong>und</strong>heitsförderung im österreichischenGes<strong>und</strong>heitswesenGes<strong>und</strong>heitsförderung ist in österreichischen B<strong>und</strong>esgesetzen sowohl als Aufgabe vonGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen (Hauptverband, Kassen, Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen, ArbeitsmedizinischeZentren) als auch spezifisch für bestimmte Berufsgruppen (Ges<strong>und</strong>heits-<strong>und</strong> KrankenpflegerInnen, AllgemeinmedizinerInnen, ArbeitsmedizinerInnen)definiert. Die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungsstücke sind im Folgenden aufgelistet.Über das Rechtsinformationssystem, einen Online-Service des B<strong>und</strong>eskanzleramts,können die entsprechenden Rechtsinformationen online eingesehen werden(http://www.ris2.bka/gv.at)Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (1992)§ 116(1) „Die Krankenversicherung trifft Vorsorge ... für die Ges<strong>und</strong>heitsförderung“.§ 154b. Ges<strong>und</strong>heitsförderung(1) Die Krankenversicherungsträger haben allgemein über Ges<strong>und</strong>heitsgefährdung <strong>und</strong>über die Verhütung von Krankheiten <strong>und</strong> Unfällen - ausgenommen Arbeitsunfälle - aufzuklärensowie darüber zu beraten, wie Gefährdungen vermieden <strong>und</strong> Krankheiten sowieUnfälle - ausgenommen Arbeitsunfälle - verhütet werden können.(2) Fallen Maßnahmen gemäß Abs. 1 auch in den sachlichen oder örtlichen Aufgabenbereichanderer Einrichtungen (Behörden, Versicherungsträger, gemeinnützige Einrichtungen<strong>und</strong> dergleichen), so kann mit diesen eine Vereinbarung über ein planmäßiges Zusammenwirken<strong>und</strong> eine Beteiligung an den Kosten getroffen werden.(3) Der Krankenversicherungsträger kann die im Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen auchdadurch treffen, dass er sich an Einrichtungen der Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge, die den gleichenZwecken dienen, beteiligt. Abs. 2 ist anzuwenden.(BGBl. Nr. 676/1991, Art. II Z 29) - 1.1.1992.§ 447a.(11) Nach Maßgabe des Einlangens sind die Mittel nach Abs. 10 zu1. zwei Dritteln an den Ausgleichsfonds für die Krankenanstaltenfinanzierung nach § 447f<strong>und</strong>2. einem Drittel an den Fonds für Vorsorge(Ges<strong>und</strong>en)untersuchungen <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderungnach § 447h zu überweisen.§ 447h. – Fonds für Vorsorge(Ges<strong>und</strong>en)untersuchungen <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung(1) Beim Hauptverband ist ein Fonds für Vorsorge(Ges<strong>und</strong>en)untersuchungen<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung zu errichten. [...](3) Die Mittel des Fonds sind für Vorsorge(Ges<strong>und</strong>en)untersuchungen sowie für vomHauptverband koordinierte Maßnahmen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung zu verwenden.Mindestens 10% dieser Mittel sind jeweils für b<strong>und</strong>esweite Maßnahmen zurFörderung <strong>und</strong> Erhöhung der Inanspruchnahme von Vorsorge(Ges<strong>und</strong>en)untersuchungen<strong>und</strong> Maßnahmen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung zuverwenden; [...].ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (1994)§ 81. (1) Arbeitsmediziner haben die Aufgabe, die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer,die Sicherheitsvertrauenspersonen <strong>und</strong> die Belegschaftsorgane auf dem Gebiet des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes,der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Ges<strong>und</strong>heitsförde-140
Kapitel 5 | Anhängerung <strong>und</strong> der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten <strong>und</strong> die Arbeitgeber beider Erfüllung ihrer Pflichten auf diesen Gebieten zu unterstützen.§ 88. - Arbeitsschutzausschuss(1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für Arbeitsstätten, in denen sie regelmäßig mindestens100 Arbeitnehmer beschäftigen, einen Arbeitsschutzausschuss einzurichten. Diese Verpflichtunggilt für Arbeitsstätten, in denen mindestens drei Viertel der Arbeitsplätze Büroarbeitsplätzeoder Arbeitsplätze mit Büroarbeitsplätzen vergleichbaren Gefährdungen <strong>und</strong>Belastungen sind, erst ab der regelmäßigen Beschäftigung von mindestens 250 Arbeitnehmern.Die auf Baustellen oder auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigten Arbeitnehmersind einzurechnen.(2) Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, die gegenseitige Information, denErfahrungsaustausch <strong>und</strong> die Koordination der betrieblichen Arbeitsschutzeinrichtungenzu gewährleisten <strong>und</strong> auf eine Verbesserung der Sicherheit, des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes <strong>und</strong>der Arbeitsbedingungen hinzuwirken. Der Arbeitsschutzausschuss hat sämtliche Anliegender Sicherheit, des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Ges<strong>und</strong>heitsförderung<strong>und</strong> der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten. [...]Verordnung über Arbeitsmedizinische Zentren (1996)§1 – Ärztliche Leitung <strong>und</strong> weitere ArbeistmedizinerInnen(3) Zur arbeitsmedizinischen Betreuung im Sinne der Abs. 1 <strong>und</strong> 2 zählen die Beratungvon Arbeitgeber/innen, Arbeitnehmer/innen, Sicherheitsvertrauenspersonen <strong>und</strong>Belegschaftsorganen auf dem Gebiet des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungenbezogenen Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> der menschengerechten Arbeitsgestaltung,die Unterstützung der Arbeitgeber/innen bei der Erfüllung ihrer Pflichten aufdiesen Gebieten sowie die für die fachliche Leitung des Zentrums notwendigen Koordinations-<strong>und</strong> Leitungstätigkeiten.Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflegegesetz – GuKG (1997)§ 11 – Berufsbild(1) Der gehobene Dienst für Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflege ist der pflegerische Teilder ges<strong>und</strong>heitsfördernden, präventiven, diagnostischen, therapeutischen <strong>und</strong> rehabilitativenMaßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> zur Verhütungvon Krankheiten.(2) Er umfasst die Pflege <strong>und</strong> Betreuung von Menschen aller Altersstufen bei körperlichen<strong>und</strong> psychischen Erkrankungen, die Pflege <strong>und</strong> Betreuung behinderter Menschen,Schwerkranker <strong>und</strong> Sterbender sowie die pflegerische Mitwirkung an der Rehabilitation,der primären Ges<strong>und</strong>heitsversorgung, der Förderung der Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> der Verhütungvon Krankheiten im intra- <strong>und</strong> extramuralen Bereich.§ 14 – eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich1) Die Ausübung des gehobenen Dienstes für Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflege umfasstdie eigenverantwortliche Diagnostik, Planung, Organisation, Durchführung <strong>und</strong> Kontrollealler pflegerischen Maßnahmen im intra- <strong>und</strong> extramuralen Bereich (Pflegeprozess), dieGes<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> -beratung im Rahmen der Pflege, die Pflegeforschungsowie die Durchführung administrativer Aufgaben im Rahmen der Pflege.(2) Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst insbesondere:[...][...]6. Information über Krankheitsvorbeugung <strong>und</strong> Anwendung von ges<strong>und</strong>heitsförderndenMaßnahmen,[...]§ 42.Die Ausbildung in der allgemeinen Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflege beinhaltet insbesonderefolgende Sachgebiete:141
Kapitel 5 | Anhänge[...]14. Ges<strong>und</strong>heitserziehung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung, einschließlich Arbeitsmedizin[...]Ges<strong>und</strong>heitsqualitätsgesetz – GQG (2005)§ 2. – BegriffsbestimmungenIm Sinne dieses B<strong>und</strong>esgesetzes bedeuten die Begriffe:17. "Gr<strong>und</strong>prinzipien der Ges<strong>und</strong>heitsförderung" im Rahmen der Erbringung von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen:Ges<strong>und</strong>heitsförderung zielt auf den Prozess ab, den Menschen ein hohesMaß an Selbstbestimmung über ihre Ges<strong>und</strong>heit zu ermöglichen <strong>und</strong> sie zur Stärkung ihrerGes<strong>und</strong>heit zu befähigen.§3 - Anwendungsbereich(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind bei der Erbringung von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen,unabhängig von der Organisationsform der Leistungserbringerin / des Leistungserbringerseinzuhalten. Die Ges<strong>und</strong>heitsleistungen müssen den auf Gr<strong>und</strong> dieses Gesetzes geltendenVorgaben <strong>und</strong> dem jeweiligen anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse <strong>und</strong>Erfahrungen entsprechen sowie in der fachlich gebotenen Qualität <strong>und</strong> in einem ges<strong>und</strong>heitsförderlichenUmfeld erbracht werden.§4 - Qualitätsstandards(2) Die B<strong>und</strong>esministerin / Der B<strong>und</strong>esminister für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen kann im Zusammenhangmit der Erbringung von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen Qualitätsstandards als B<strong>und</strong>esqualitätsleitlinienempfehlen oder als B<strong>und</strong>esqualitätsrichtlinien durch Verordnungerlassen, wobei insbesondere auf Folgendes zu achten ist:[...]4. Gr<strong>und</strong>prinzipien der Ges<strong>und</strong>heitsförderungÄrztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung (2006)§ 5.(1) Das Aufgabengebiet der Ärztin für Allgemeinmedizin/des Arztes für Allgemeinmedizinumfasst die medizinische Betreuung des gesamten menschlichen Lebensbereiches,insbesondere die diesbezügliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung, Krankheitserkennung <strong>und</strong>Krankenbehandlung aller Personen, unabhängig von Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Art der Ges<strong>und</strong>heitsstörung.(2) Die wesentlichen Aufgaben der Ärztin für Allgemeinmedizin/des Arztes für Allgemeinmedizinliegen in der1. Ges<strong>und</strong>heitsförderung, -vorsorge <strong>und</strong> -nachsorge,[...]§ 6.Ziel der allgemeinärztlichen Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Ausübungder Allgemeinmedizin gemäß § 5 durch den geregelten Erwerb <strong>und</strong> Nachweis vonfür die gewissenhafte Betreuung von Patientinnen/Patienten notwendigen Kenntnisse,Erfahrungen <strong>und</strong> Fertigkeiten, insbesondere in[...]3. Ges<strong>und</strong>heitsförderung,[...]Patientencharta (2006)(2) Die Leistungen auf dem Gebiet des Ges<strong>und</strong>heitswesens sind auch auf den Gebietender Ges<strong>und</strong>heitsförderung, der Vorsorge- <strong>und</strong> Arbeitsmedizin sowie der Rehabilitation<strong>und</strong> des Kurwesens sicherzustellen.142
Kapitel 5 | AnhängeVEREINBARUNG gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation <strong>und</strong> Finanzierungdes Ges<strong>und</strong>heitswesens (2008-2013)Artikel 5 - Nahtstellenmanagement(3) Diese Rahmenvorgaben haben zumindest die Verantwortung <strong>und</strong> die Kostentragung,ebenso die Ressourcenplanung <strong>und</strong> -sicherstellung zu beinhalten. Der funktionierendeInformationstransfer zur organisatorischen Sicherstellung eines nahtlosen Übergangesder Patientinnen- <strong>und</strong> Patientenversorgung zwischen leistungserbringenden Einrichtungenist zu gewährleisten. Die Rahmenvorgaben haben ein ges<strong>und</strong>heitsförderndes Umfeldzu berücksichtigen.Artikel 20 – Aufgaben der Ges<strong>und</strong>heitsplattformen auf Länderebene im Rahmender Landesges<strong>und</strong>heitsfonds(1) Die Ges<strong>und</strong>heitsplattformen auf Länderebene haben zur Planung, Steuerung <strong>und</strong> Finanzierungdes Ges<strong>und</strong>heitswesens im Landesbereich insbesondere folgende Aufgabenunter Einhaltung der Vorgaben der B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsagentur <strong>und</strong> unter Berücksichtigunggesamtökonomischer Auswirkungen wahrzunehmen:[...]8. Entwicklung von Projekten zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung[...]143
Kapitel 5 | Anhänge5.5Mitglieder <strong>und</strong> Einrichtungen des Vereins„Österreichisches NetzwerkGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen“ (ONGKG)Mitgliedseinrichtungen im ONGKG (Stand September 2008)Einrichtung, KontaktpersonKärntenA.ö. Landeskrankenhaus KlagenfurtSt. Veiter Straße 479026 Klagenfurthttp://www.lkh-klu.atDr. Angelika Kresnikangelika.kresnik@lkh-klu.atA.ö. Krankenhaus Barmherzige Brüder St. Veitan der GlanSpitalgasse 269300 St. Veit/Glanhttp://www.bbstveit.atDr. Karin Höffererkarin.hoefferer@bbstveit.atZuletzt anerkannte Maßnahmen• Förderung der Eigeninitiative – Ges<strong>und</strong>heitszirkel• „Schmerzarmes Krankenhaus“ – Projekt zurOptimierung der postoperativen Schmerztherapie• Sturzklinik• Individuell abgestimmte Ernährung onkologischerPatienten - Vermeiden von Mangelernährung/ Kachexie• Interdisziplinäre Betreuung der Diabetikervon der Aufnahme bis zur Adaptierung der Lifestyleänderungim Alltag, in Zusammenarbeitmit Angehörigen, Hausarzt <strong>und</strong> extramuralenInsititutionen• Ganzheitliche bzw. integrierte WochenbettpflegeOberösterreichKrankenhaus der Barmherzigen SchwesternLinz Betriebsgesellschaft m.b.H.Seilerstätte 44010 Linzhttp://www.bhs-linz.at• 7-Säulen Aktiv-Programm - eine Initiative zurFörderung der Ges<strong>und</strong>heit von Mitarbeitenden• Kommunikations-Projekt• Betriebs- <strong>und</strong> Organisations-Psychologie BEOMag. Charlotte Dichtlcharlotte.dichtl@bhs.atA.ö. Krankenhaus der Elisabethinen LinzFadingerstraße 14020 Linzhttp://www.elisabethinen.or.atMag. Lydia Breitschopflydia.breitschopf@elisabethinen.or.atAllgemeines Krankenhaus der Stadt LinzKrankenhausstraße 94020 Linzhttp://www.linz.at/akh/index.aspOA Dr. Rainer Hubmannrainer.hubmann@akh.linz.atA.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbHder Franziskanerinnen von Vöcklabruck(Zum Zeitpunkt der Drucklegung in Anerken-• Schritt für Schritt zum Wohlfühlgewicht• Aromapflege im Aufwachraum• Implementierung der Aromapflege <strong>und</strong> Wickelauf der Station Chirurgie Klasse• Tagesklinik im Krankenhaus der ElisabethinenLinz (Konzept für tagesklinische Strukturen• Projekt „MigrantInnenfre<strong>und</strong>liches Krankenhaus“• Projekt Rückenschule• Bad Aussee Ges<strong>und</strong>heitswoche. Teil der betrieblichenGes<strong>und</strong>heitsförderung Am PULS• ZAK / Zertifizierter Anwenderkurs für Kinaesthetics• Kooperation KH Braunau mit KKH Simbach144
Kapitel 5 | AnhängeEinrichtung, Kontaktpersonnungsphase)Ringstraße 605280 Braunauhttp://www.khbr.atZuletzt anerkannte Maßnahmen• Rauchfrei in die Zukunft – RaucherentwöhnungsseminarIng. Markus Plungermarkus.plunger@khbr.atSalzburgDiakonissen-Krankenhaus SalzburgGuggenbichlerstraße 205026 Salzburghttp://www.diakoniewerk.at/dkhsal.htm• Magen-Darm Zentrum• Rauchfreies Krankenhaus• Komplementäre PflegePrim. Dr. Anton Heisera.heiser@diakoniewerk.atA.ö. Krankenhaus OberndorfParacelsusstraße 375110 Oberndorfhttp://www.krankenhaus-oberndorf.at/• "GehWichtig!" Natürlich ernähren. Leicht bewegen.Selbstbewusst leben.• Die Fußpflege des Diabetikers• EntlassungsmanagementDGKS Agnes Herzoga.herzog@kh-obdf.salzburg.atA.ö. Krankenhaus der Halleiner KA-BetriebsgesmbHBürgermeisterstraße 345400 Halleinhttp://www.kh-hallein.at/Pfl.Dir. DGKP Karl Schwaigerkarl.schwaiger@kh-hallein.at• Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Qualitätssicherungdurch "Kinästhetik in der Pflege"• Systemische Teamentwicklung von Pflegepersonalim ressourcenbezogenen salutogenetischenKontext• Organisationsentwicklung in der InternenAbteilung des Krankenhauses HalleinSteiermarkGeriatrische Ges<strong>und</strong>heitszentren der StadtGrazAlbert-Schweitzer-Gasse 368020 Grazhttp://www.ggz.graz.at• Ernährungsteam der GGZ• Strukturierte Durchführung einer Pflegevisite• Strukturaufbau Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung- Gemeinsam Ges<strong>und</strong> in die ZukunftDGKS Helga Gafiukhelga.gafiuk@stadt.graz.atLandeskrankenhaus - UniversitätsklinikumGrazAuenbrugger Platz 18036 Grazhttp://www.klinikum-graz.at/• "Bewegungs- <strong>und</strong> Stützapparat" am KlinikumGraz• EBN / Evidenve-based NursingMag. Christine Foussekchristine.foussek@klinikum-graz.atA.ö. Landeskrankenhaus DeutschlandsbergRadl-Pass-B<strong>und</strong>esstraße 298530 Deutschlandsberghttp://www.lkh-deutschlandsberg.at/• AUEL: Aus Unerwarteten Ereignissen Lernen• Sturzerhebung, Auswertung <strong>und</strong> Sturzpräventionim KrankenhausBetr.Dir. Dipl.KH-Bw. Franz Lienhart, MBAMAS145
Kapitel 5 | AnhängeEinrichtung, Kontaktpersonfranz.lienhart@lkh-deutschlandsberg.atA.ö. Landeskrankenhaus Bruck an der MurTragösserstraße 18600 Bruckhttp://www.lkh-bruck.at/Betr.Dir. KH-Bw. Nikolaus Koller, MAS MBATel: +43 /3862/ 895 – 21 00nikolaus.koller@lkh-bruck.atZuletzt anerkannte Maßnahmen• Allgemeine Mitarbeitereinführung "Check in"im LKH Bruck/Mur• Etablierung eines ErnährungsmedizinischenDienstes• Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Qualitätssicherungdurch "Kinästhetik in der Pflege"TirolBezirkskrankenhaus Schwaz Betriebsgesellschaftm.b.H.Swarovskistraße 16130 Schwazhttp://www.kh-schwaz.at• Umfassendes Disease Management Diabetesam Krankenhaus Schwaz• Ges<strong>und</strong>heitsmeile Lichthalle• RauchfreiDipl. GT Petra Grössl-Wechselbergerbetriebsrat@kh-schwaz.atWienKrankenanstalt der Stadt Wien Rudolfstiftunginklusive Standort Semmelweis FrauenklinikJuchgasse 251030 Wienhttp://www.wienkav.at/kav/kar/• Stabstelle für Kontinenz <strong>und</strong> Stomaberatung• "Ges<strong>und</strong> <strong>und</strong> fit - wir machen mit" - Schulkinderbesuchen die RudolfstiftungOSr. Christa Neubert Pleßlchrista.neubert-plessl@wienkav.atKrankenanstalt Sanatorium HeraLöblichgasse 141090 Wienhttp://www.hera.co.at/• Kinästhetic interdisziplinär• Projekt - Work-Life-Balance im OPHeidemarie Täuber, MScwissensmanagement@hera.co.atSozialmedizinisches Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital der Stadt WienK<strong>und</strong>ratstraße 31100 Wienhttp://www.wienkav.at/kav/kfj/• „Nach Herzenslust“ – Favoritner Frauen lebenges<strong>und</strong>• Mindfulness-Based Stress Reduction Trainingbei Pflegepersonen• HändehygieneÄ.Dir. Dr. Margit Endlermargit.endler@wienkav.atKrankenhaus der Stadt Wien Hietzing mitNeurologischem Zentrum RosenhügelWolkersbergenstraße 1• Ges<strong>und</strong>heitsförderungstage für Schulen imBereich des Einzugsgebietes des Krankenhauses(13, 23,14)1130 Wienhttp://www.wienkav.at/kav/khl/Prim. Dr. Ulrike Sommereggerulrike.sommeregger@wienkav.at• Interdisziplinäre Entwicklung, Implementierung<strong>und</strong> Evaluierung des Prozesses der oralenMedikation bei Sondenpatient/inn/en imKrankenhaus Hietzing mit NeurologischemZentrum Rosenhügel• Projekt „EDV-unterstützte Dokumentation<strong>und</strong> statistische Auswertung von MRSA-Fällen, sowie Implementierung eines EDVunterstütztenMRSA-Frühwarnsystems“Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner • Das nachhaltige Krankenhaus: eine intelli-146
Kapitel 5 | AnhängeEinrichtung, KontaktpersonHöhe – Otto Wagner Spital mit PflegezentrumBaumgartner Höhe 11140 Wienhttp://www.wienkav.at/kav/ows/OA Dr. Karl PURZNERkarl.purzner@wienkav.atWilhelminenspital der Stadt Wien(Zum Zeitpunkt der Drucklegung in Anerkennungsphase)Montleartstraße 371160 Wienhttp://www.wienkav.at/kav/will/Zuletzt anerkannte Maßnahmengente <strong>und</strong> lernende Organisation. Interventionsbereich1 - Die normative Ebene: NachhaltigeUnternehmenssteuerung• Das nachhaltige Krankenhaus: eine intelligente<strong>und</strong> lernende Organisation. Interventionsbereich2 - Die strategische Ebene:Nachhaltige Leistungs- <strong>und</strong> Kapazitätsplanung• Das nachhaltige Krankenhaus: eine intelligente<strong>und</strong> lernende Organisation. Interventionsbereich3 - Die operative Ebene: NachhaltigeLeistungserbringung• Ges<strong>und</strong>enuntersuchungen• Rauchfreies Krankenhaus - "Auf dem Weg inein rauchfreies Leben!"• Ges<strong>und</strong>es Altern am Arbeitsplatz trotz Veränderungsdruckim Bereich Hebammen WilhelminenspitalPfl.Dir. Günter Dorfmeister, MSc MASguenter.dorfmeister@wienkav.atUniversitätsklinik für Kinder- <strong>und</strong> Jugendheilk<strong>und</strong>eam Allgemeinen Krankenhaus WienWähringer Gürtel 18-201180 Wienhttp://www.meduniwien.ac.at/kikliStat.Sr. DKKS Ingrid Zöhreringrid.zoehrer@akhwien.atSozialmedizinisches Zentrum Ost – DonauspitalLangobardenstraße 1221220 Wienhttp://www.wienkav.at/kav/dsp/• Installierung eines Fitnessraums für Mitarbeiterder Univ. Klinik für Kinder- <strong>und</strong> Jugendheilk<strong>und</strong>eWien• Ressourcenorientierung <strong>und</strong> Ressourcendiagnostikbei somatisch oder psychisch erkranktenKindern <strong>und</strong> ihren Familien. Der Kohärenzsinnals Mediatorvariable im Krankenheitsverlauf.(Wissenschaftliches Projekt zurGr<strong>und</strong>lagen-forschung im Bereich GF)• Übergabe vom Kinder- ins Erwachsenen CF-Zentrum• Ges<strong>und</strong> Gewinnt• Ges<strong>und</strong>heitsförderungstage 2008 im Donauspital• Projekt Rauchfreies KrankenhausDr. Eva Friedlereva.friedler@wienkav.atWiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong> - GeneraldirektionThomas-Klestil-Platz 7/11030 Wienhttp://www.wienkav.atMag. Margit Wiederschwingermargit.wiederschwinger@wienkav.atFördernde MitgliederB<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit, Familie<strong>und</strong> JugendRadetzkystraße 21030 Wienhttp://www.bmgfj.gv.atGes<strong>und</strong>heitsfonds Steiermark – Ges<strong>und</strong>heitsplattformBurggasse 48011 GrazMag. Patrizia Theurerpatrizia.theurer@bmgfj.gv.atMag. Christa Peinhauptchrista.peinhaupt@stmk.gv.at147
Kapitel 5 | AnhängeEinrichtung, Kontaktpersonwww.ges<strong>und</strong>heitsfonds.steiermark.atZuletzt anerkannte MaßnahmenGeschäftsstelle des Vereins ONGKGÖsterreichische Gesellschaft fürTheorie <strong>und</strong> Praxis der Ges<strong>und</strong>heitsförderung (ÖGTPGF)C/o Ludwig Boltzmann Institut für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsforschungUntere Donaustraße 47 / 3. OG1020 WienTel: +43 1 2121 493 21e-mail: oenetz.soc-gruwi@univie.ac.atWeb: http:www.oengk.net (ab November 2008: www.ongkg.at)148
Kapitel 5 | Anhänge5.6NetzwerkkoordinatorInnen <strong>und</strong> andereinternationale AkteurInnen im BereichGes<strong>und</strong>heitsfördernde Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenInternational agierende HPH-Akteur/inn/e/nEinrichtung, Funktion Ansprechpersonen KontaktadresseSekretariat des InternationalenNetzwerks Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(HPH)Hanne Tønnesen, MD(Direktorin)Bispebjerg University HospitalClinical Unit of Preventive Medicine andHealth PromotionBispebjerg Bakke 23DK-2400 Copenhagen NVe-mail: ht02@bbh.regionh.dk(verantwortlich für Fragender Mitgliedschaft <strong>und</strong> Strategieentwicklungim internationalenHPH-Netzwerk)WHO-Kooperationszentrum fürevidenzbasierte Ges<strong>und</strong>heitsförderungim KrankenhausFührt klinische Forschungenmit dem Ziel der Verbesserungder Evidenz für klinischeGes<strong>und</strong>heitsförderungdurchWHO-Kooperationszentrum fürGes<strong>und</strong>heitsförderung inKrankenhaus <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesenVerantwortlich für die wissenschaftlicheVorbereitung<strong>und</strong> Durchführung der jährlicheninternationalen HPH-Netzwerkkonferenz, dieHerausgabe des internationalenNetzwerk-Newsletters<strong>und</strong> für Forschung <strong>und</strong>Entwicklung zu HPHWHO-Kooperationszentrum fürGes<strong>und</strong>heitsförderung<strong>und</strong> Kapazitätsentwicklungfür die Ges<strong>und</strong>heitvon Kindern <strong>und</strong> JugendlichenVerantwortlich für Forschung<strong>und</strong> Entwicklung zuFragen der Ges<strong>und</strong>heitsförderungfür Kinder <strong>und</strong> Jugendliche<strong>und</strong> die TaskForce „Health Promotion forChildren and Adolescents inHanne Tønnesen, MD(Direktorin)Univ.Prof. Dr. Jürgen M.Pelikan (Direktor)Dr. Fabrizio Simonelli(Leiter)http://www.healthpromotinghospitals.orgBispebjerg University HospitalClinical Unit of Preventive Medicine andHealth PromotionBispebjerg Bakke 23DK-2400 Copenhagen NVe-mail: ht02@bbh.regionh.dkhttp://www.who-cc.dkLudwig Boltzmann Institut für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsforschung(LBIHPR)Untere Donaustraße 47A-1020 Wiene-Mail: hph.soc-gruwi@univie.ac.athttp://www.hph-hc.ccA. Meyer University Children's HospitalHealth Promotion ProgrammeViale Gramsci, 42I-50132Florence, Italye-mail: f.simonelli@meyer.itwho.collaboratingcentre@meyer.it149
Kapitel 5 | AnhängeEinrichtung, Funktion Ansprechpersonen Kontaktadresse& by Hospitals and HealthServices“Internationale TaskForce „Ges<strong>und</strong>heitsförderndepsychiatrischeGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen“Vernetzung von themenspezifischenExpertInnen<strong>und</strong> AktivistInnen, Organisationvon Veranstaltungen,Workshops <strong>und</strong> Vorträgenim Rahmen der internationalenHPH-Konferenzen,Publikationen, Tool-EntwicklungInternationale TaskForce „Migrant Friendlyand Culturally CompetentHospitals“Prof. Dr. Hartmut Berger(Koordinator)Dr. Antonio Chiarenza(Koordinator)Walter-Picard-KlinikPostfach 1362D-64560 Riedstadtberger@zsp-philippshospital.dehttp://www.hpps.net/Azienda USL di Reggio EmiliaVia Amendola, 2IT- 42100 Reggio Emiliaantonio.chiarenza@ausl.re.itVernetzung von themenspezifischenExpertInnen<strong>und</strong> AktivistInnen, Organisationvon Veranstaltungen,Workshops <strong>und</strong> Vorträgenim Rahmen der internationalenHPH-Konferenzen,Publikationen, Tool-EntwicklungInternationale Arbeitsgruppe“Smoke-free United”Ms. Ann O’Riordan (Koordinatorin)http://www.ausl.re.it/HPH/FrontEnd/Home/Default.aspx?channel_id=38Strategieentwicklung fürdas internatioanle HPH-Netzwerk zum ThemaRauchfreien Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenin Zusammenarbeitmit dem EuropäischenNetzwerk „Smoke-Free Hospitals“ (ENSFH)Nationale uns regionale HPH-NetzwerkeDie nationalen <strong>und</strong> regionalen Netzwerke, aus denen sich das internationale HPH-Netzwerk zusammensetzt, haben insgesamt mehr als 700 Mitgliedseinrichtungen.NetzwerkBelgisches Netzwerk (französischsprachig)Bulgarisches NetzwerkKoordinationMr. Jacques DUMONTHôpital Erasme – ULBRoute de Lennik, 808B-1070 BruxellesE-mail : jdumont@ulb.ac.beWeb: http://www.ulb.ac.beProf. Bencho BENCHEVNational Centre of Public Health Protection15. D. NestorovBG-1431 Sofiabenchev@nchi.government.bg150
Kapitel 5 | AnhängeNetzwerkChina – Regionalnetzwerk TaiwanDeutsches NetzwerkEstnisches NetzwerkFinnisches NetzwerkFranzösisches NetzwerkGriechisches NetzwerkGroßbritannien – nordirisches NetzwerkGroßbritannien – schottisches NetzwerkIrisches NetzwerkItalienisches nationales NetzwerkKoordinationDr. Shu-Ti Chiou CHIOUInstitute of Public Health and Department of Social MedicineNational Yang-Ming UniversityNo. 155, sec. 2, Liong St. Beitou,, District Taipei CityTW- 11221 TaipeiE-Mail: stchiou@ym.edu.twMr. Felix BRUDERDeutsches Netz Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser gem.e.V.Saarbrücker Straße 20/ 2110405 BerlinEmail: info@dngfk.deWeb: http://www.dngfk.de/Dr. Tiiu HAERMTervise Arengu InstituutHiiu 42EE-11619 TallinnE-Mail: tai@tai.eeDr. Virpi HONKALAMedical Director, Raahe District HospitalPL 25FI-92101 RaaheE-Mail: virpi.honkala@ras.fiDr. Pierre BUTTETInstitut National de Prévention et d'Education pour la Santé42, Boulevard de la LibérationFR-93203 Saint Denis CedexE-Mail: pierre.buttet@inpes.sante.frProf. Yannis TOUNTASUniversity of Athens Medical SchoolDirector, Center for Health Service Research25, Alexandroupoleos StreetGR-11527 AthensE-Mail: chsr@med.uoa.grMs. Barbara PORTER18 Ormeau AvenueBelfast BT2 8HSE-Mail: b.porter@hpani.org.ukMs. Lorna RENWICKNHS Health ScotlandRosebury House9 Haymarket TerraceEH12 5E2 EdinburghE-Mail: Lorna.Renwick@health.scot.nhs.ukMs. Ann O'RIORDANJames Connolly Memorial HospitalBlanchardstownIE Dublin 15E-Mail: info@ihph.ieWeb: http://www.hphallireland.orgDr. Carlo FAVARETTIDirector General, Azienda Ospedaliero-Universitaria"Santa Maria della Misericordia"151
Kapitel 5 | AnhängeNetzwerkKoordinationPiazzale Santa Maria della Misericordia, 15IT-33100 UdineE-mail: favaretti.carlo@aoud.sanita.fvg.itWeb: http://www.retehphitalia.it/RegionalnetzwerkCampaniaRegionalnetzwerkEmilia RomagnaRegionalnetzwerkFriuli Venezia GiuliaRegionalnetzwerkLiguriaRegionalnetzwerkLombardiaRegionalnetzwerkPiemonteRegionalnetzwerkSizilienRegionalnetzwerkTrentinoRegionalnetzwerkToscanaDr. Sara DIAMAREAzienda Sanitaria Locale Napoli 1Isola F/9Palazzo EsedraIT-80143 NapoliE-Mail: rydiama@tin.itDr. Mariella MARTININetwork CoordinatorReggio Emilia Health AuthorityPresidio Ospedaliero ProvincialeE-Mail: martinia@ausl.re.itWeb:http://www.ausl.re.it/HPH/FrontEnd/Home/Default.aspxDr. Cristina AGUZZOLIAzienda per i Servizi Sanitari n2 "Isontina"Via Vittorio Veneto 174IT-34170 GoriziaE-Mail: cristina.aguzzoli@ass2.sanita.fvg.itDr. Roberto PREDONZANIOspedale di ImperiaVia S. Agata 57IT-18 100 ImperiaE-mail: r.predonzani@asl1.liguria.itDr. Luciano BRESCIANIDirectorate General for HealthVia Pola 9/11IT-20124 MilanE-Mail: hph@dgsan.lombardia.itDr. Luigi RESGOTTICIPESVia Sant'Agostino, 2010122 TorinoE-Mail: cipes@cipespiemonte.itWeb: http://www.cipespiemonte.it/Dr. Gianpiero SERONIOspedale Bucceri la FermaVia Messine Marine, 197IT-90121 PalermoE-Mail: seroni.gianpiero@fbfpa.itWeb: http://www.retehphsicilia.org/contenuti1.htmDr. Lorella MOLTENIAPSS TRENTOVia De Gasperi, 79IT-38100 TrentoE-Mail: Molteni.l@apss.tn.itWeb: http://www.retehphitalia.it/Dr. Paolo MORELLO MARCHESEAzienda Ospedaliera "A. Meyer"Direzione Sanitaria AziendaleVia Luca Giordano 7m152
Kapitel 5 | AnhängeNetzwerkKoordinationIT-50132 FirenzeE-Mail: p.morello@meyer.itWeb: http://www.meyer.it/RegionalnetzwerkValle d’AostaRegionalnetzwerkVenetoDr. Giorgio GALLIAzienda USL Valle d'AostaVia Guido Rey,1IT-11100 AostaE-Mail: galli.giorgio@uslaosta.comWeb: http://www.ausl.vda.itDr. Simone TASSOHealth Educational and Promoting Service, Asolo (TV) ItalyOspedale Civile S.GiacomoVia Ospedale 18IT-31033 Castelfranco VenetoE-Mail: hph@ulssasolo.ven.itWeb: http://www.ulssasolo.ven.it/hph/Kanada – Regionalnetzwerk QuebecKanada – Regionalnetzwerk TorontoKasachisches NetzwerkLitauisches NetzwerkNorwegisches NetzwerkDr. Louis CÔTÉAgence de Santé et des Services Sociale de Montreal3725 Rue Saint-DenisCA-Montreal H2X 3L9E-Mail: louis_cote@ssss.gouv.qc.caMs. Susan HIMELTrillium Health Centre100, QueenswayCA-Mississsauga, ON L5B 1B8E-Mail: shimel@bridgepointhealth.caMaiya JANGOZINANational Centre of the Healthy Lifestyle Development86, Kunaev StrKZ-480100 AlmatyE-Mail: jangozina@ncphld.kzProf. Irena MISEVICIENEKaunas Medical UniversityEivenių g. 4LT-50009 KaunasE-mail: irenmisev@kmu.ltWeb: http://www.kmu.lt/SSL/Ms. Joruun SVENDSENSosial og helsedirektoratetAvedeling for spesialisthelsetjenesteP.O.Box 7000 St Olavs plassNO-0130 OsloE-Mail: jsv@shdir.noÖsterreichisches Netzwerk (ONGKG) Mag. Christina DIETSCHERC/o Ludwig Boltzmann Institut für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsforschungUntere Donaustraße 47 / 3. OGE-Mail: oenetz.soc-gruwi@univie.ac.atWeb: http://www.oengk.netPolnisches NetzwerkDr. Jerzy KARSKIMedical University of Warsaw, Department of Public HealthBanacha Street 1a, Bloc F, room 41aPL-02097 WarschauE-Mail: j.karski@mp.pl153
Kapitel 5 | AnhängeNetzwerkRussisches NetzwerkSchwedisches NetzwerkSchweizerisches NetzwerkSlowakisches NetzwerkSpanien – RegionalnetzwerkKatalonienTschechisches NetzwerkKoordinationProf. George GOLUKHOVFo<strong>und</strong>ation "21 Century Hospital"Lobachevskogo Str., 42RU-119415 MoscowE-Mail: nmo1@inbox.ruMs. Evalill NILSSONFolkhälsovetenskapligt centrumUniversitetssjukhusetSE-581 85 LinköpingE-Mail: evalill.nilsson@lio.seWeb: http://www.natverket-hfs.se/Mr. Nils UNDRITZSwiss HPH NetworkWeidweg 14CH-5034 SuhrE-Mail: contact@healthhospitals.chWeb: http://www.healthhospitals.ch/Dr. Zora BRUCHACOVAMinistry of the Interior of the Slovak RepublicHealthcare DepartmentG<strong>und</strong>ulicova 2SK-81272 BratislavaE-Mail: bruchaco@minv.skDr. Cristina INIESTA BLASCOInstitut Municipal Essistenca SanitarifiPasseig Maritin, 25-29ES-08003 BarcelonaE-Mail: ciniesta@imas.imim.esMilena KALVACHOVAMinistry of HealthDeparment of HealthcarePalackeho Namesti 4CZ-12801 Prague 2E-Mail: milena.kalvachova@mzcr.cz154
Kapitel 5 | Anhänge5.7Weiterführende LinksFolgende Links bieten weiterführende Informationen zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen:Informationen in ÖsterreichÖsterreichisches Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen(ONGKG):www.oengk.net (ab November 2008: http://www.ongkg.at)Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Wiener Spitälern, Pflegeeinrichtungen <strong>und</strong> Seniorenwohneinrichtungen:http://www.allianz-gf-wien.atInformationen internationalInternationales HPH-Sekretariat Kopenhagen <strong>und</strong> WHO-Kooperationszentrum für EvidenzbasierteGes<strong>und</strong>heitsförderung im Krankenhaus:www.who-cc.dkWHO-Kooperationszentrum für Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Krankenhaus <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen:www.hph-hc.cc155
Kapitel 5 | Anhänge5.8AutorInnen <strong>und</strong> InterviewpartnerInnenMag. Gudula BRANDMAYRGrosse schützen Kleine, Österreichisches Komitee fürUnfallverhütung im KindesalterAuenbruggerplatz 348036 Graze-mail: gudula.brandmayr@klinikum-graz.atMag. Christina DIETSCHERKoordination, Geschäftsstelle des Österreichischen NetzwerksGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenLudwig Boltzmann Institut fürGes<strong>und</strong>heitsförderungsforschungUntere Donaustraße 471020 Wiene-mail: christina.dietscher@lbihpr.lbg.ac.atMag. Ursula HÜBELBereichsleitung für StrukturentwicklungAbteilung Ges<strong>und</strong>heitsförderungZelinkagasse 41010 Wiene-mail: ursula.huebel@wien.gv.atOA Dr. Rainer HUBMANNVorsitzender, Österreichisches Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernderKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungenAllgemeines Krankenhaus der Stadt Linz GmbH2. Med. AbteilungKrankenhausstraße 94020 Linze-mail: rainer.hubmann@akh.linz.atBM Dr. Andrea KDOLSKYB<strong>und</strong>esministerin für Ges<strong>und</strong>heit, Familie <strong>und</strong> JugendRadetzkystraße 21031 Wienandrea.kdolsky@bmgfj.gv.atMag. Daniela KERNLeitung, F.E.M.Bastiengasse 36-381180 Wiend.kern@fem.atUniv.Lektor Dr. Karl KRAJICLudwig Boltzmann Institut fürGes<strong>und</strong>heitsförderungsforschungUntere Donaustraße 471020 Wiene-mail: karl.krajic@lbihpr.lbg.ac.atGF Mag. Monika MAIERArge Selbsthilfe ÖsterreichKempfstraße 23/ 3 Stock, Postfach 1089010 Klagenfurte-mail: maier@selbsthilfe-kaernten.at156
Kapitel 5 | AnhängeMag.Dr. Sonja NOVAK-ZEZULACenter for Health and MigrationDanube University Kresms – Office ViennaSchikanedergasse 121040 Wiene-mail: sonja.novak-zezula@univie.ac.atMag.Dr. Peter NOWAKLudwig Boltzmann Institut fürGes<strong>und</strong>heitsförderungsforschungUntere Donaustraße 471020 Wiene-mail: peter.nowak@lbihpr.lbg.ac.atUniv.Prof. Dr. Jürgen M. PELIKANDirektor, WHO-Kooperationszentrum für Ges<strong>und</strong>heitsförderungin Krankenhaus <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesenc/o Ludwig Boltzmann Institut für Ges<strong>und</strong>heitsförderungsforschungUntere Donaustraße 471020 Wiene-mail: juergen.Pelikan@univie.ac.atMag. Christine PRAMERWiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong> - GeneraldirektionGeschäftsbereich QualitätsarbeitThomas-Klestil-Platz 7/11030 Wiene-mail: christine.pramer@wienkav.atDr. Klaus ROPINGes<strong>und</strong>heit Österreich GmbHGeschäftsbereich Fonds Ges<strong>und</strong>es ÖsterreichAspernbrückenstraße 21020 Wiene-mail: klaus.ropin@fgoe.orgPrim.Dr. Ulrike SOMMEREGGERHarald STEFAN, MScUniv.Prof. Dr. Beate WIMMER-PUCHINGERKrankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum RosenhügelAbteilungsvorstand, AkutgeriatrieWolkersbergenstraße 11130 Wiene-mail: ulrike.sommeregger@wienkav.atSozialmedizinisches Zentrum Baumgartner HöheBaumgartner Höhe 11145 Wiene-mail: harald.stefan@wienkav.atFonds Soziales WienFrauenges<strong>und</strong>heitsbeauftragte der Stadt WienGuglgasse 7-91030 Wiene-mail: beate.wimmer-puchinger@fsw.atMag. Hilde WOLFLeitung, F.E.M. SüdSMZ Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital der Stadt WienK<strong>und</strong>ratstraße 31100 Wien157
Kapitel 5 | Anhängee-mail: hilde.wolf@wienkav.at158
Das WHO-Konzept „Ges<strong>und</strong>heitsförderndeKrankenhäuser <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen“wird seit Ende der 1980er Jahre unterwesentlicher österreichischer Mitwirkungentwickelt, erprobt <strong>und</strong> verbreitet. Heutegibt es weltweit Initiativen <strong>und</strong> NetzwerkeGes<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen, darunter auchdas österreichische Netzwerk, das 1996gegründet wurde.Die Broschüre gibt einen Überblick überKonzepte, international erprobte Instrumente<strong>und</strong> Evidenz des Ansatzes. ZahlreicheBeispiele für bewährte ges<strong>und</strong>heitsförderndeMaßnahmen aus österreichischenGes<strong>und</strong>heitseinrichtungen werden vorgestellt.Bestelltelefon:01/711 00-4700