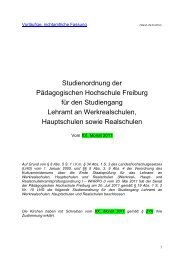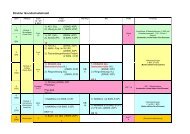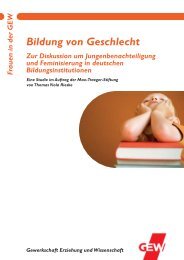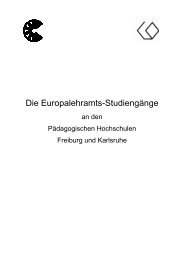Blick zurück nach vorn
Blick zurück nach vorn
Blick zurück nach vorn
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
58<br />
einer Schule zwischen Schulleitung, Eltern<br />
sowie Schülerinnen und Schülern befinden,<br />
haben einen maßgeblichen Anteil an<br />
der Ausgestaltung des pädagogischen Alltags.<br />
Ob sie wollen oder nicht: Lehrkräfte<br />
stricken an der Herstellung von Männlichkeit<br />
und Weiblichkeit mit – auch wenn sie<br />
für sich und ihren Unterricht „Geschlechtsneutralität“<br />
postulieren. (…) Eine Perspektive<br />
zur Vermeidung von geschlechtlichem<br />
Stereotypisieren liegt zum einen in einer<br />
konsequenteren Ausrichtung auf Gendersensibilität<br />
in der Lehrkraftausbildung und<br />
in einem stärker individualisierten und differenzierteren<br />
<strong>Blick</strong> auf die Schülerinnen<br />
und Schüler.<br />
…<br />
Ein Modell, das sich für den Umgang<br />
mit der Kategorie Geschlecht in der Schule<br />
eignet und versucht, geschlechtliches<br />
Stereotypisieren zu vermeiden, geht von<br />
einem „Dreischritt“ aus a) dramatisieren,<br />
b) differenzieren und c) entdramatisieren.<br />
Dies bedeutet, dass eine Dramatisierung,<br />
d.h. eine Offenlegung der existierenden<br />
Geschlechterdifferenzen eine notwendige<br />
Voraussetzung für die Thematisierung<br />
geschlechtlicher Ungleichheiten in der<br />
Schule ist. Denn – wie aus der Geschlechterforschung<br />
bekannt – nur wenn die<br />
zwar sozial konstruierten, gleichwohl real<br />
ja durchaus existierenden Differenzen erkannt<br />
werden, kann auch an ihrer Veränderung<br />
gearbeitet werden. Um Stereotype<br />
und naturalisierende Festschreibungen<br />
zu vermeiden, bedarf es in einem zweiten<br />
Schritt einer Differenzierung. Es gibt<br />
nicht nur „den Schüler“ oder „die Schülerin“<br />
sondern vielfältige unterschiedliche<br />
Positionen, kulturelle Hintergründe, sexuelle<br />
Orientierungen etc. Häufig werden<br />
alle Schüler unter den Labels „laut“, „störend“<br />
oder „lebendig“ subsumiert, obwohl<br />
es auch „leise Jungen“ gibt, die innerhalb<br />
der Jungengruppe untergeordnet sind. Sie<br />
kommen häufig ebenso wenig zu Wort,<br />
wie die untergeordneten Mädchen. Im<br />
dritten Schritt kann dann Geschlecht entdramatisiert<br />
werden, um den <strong>Blick</strong> auf den<br />
einzelnen Schüler/die Schülerin freizumachen.<br />
(…) Auf Seiten der Schülerinnen und<br />
Schüler finden sich auf der pragmatischen<br />
Ebene bereits vielschichtige Praktiken der<br />
Entdramatisierung von Geschlecht, insbesondere<br />
in Situationen, die durch hohe<br />
institutionelle Kontrolle gekennzeichnet<br />
sind. Bei Klassenarbeiten beispielsweise<br />
wird das ansonsten gültige „Interaktionstabu“<br />
zwischen Mädchen und Jungen zugunsten<br />
bestmöglicher Abschreiberesultate<br />
aufgehoben. Geschlecht spielt selbst auf<br />
Nachfrage hier keine Rolle. Die Herstellung<br />
von Geschlecht – das „doing gender“ tritt<br />
also in den Hintergrund zugunsten der Erfüllung<br />
der Leistungsanforderungen der<br />
Institution Schule.<br />
Jürgen Budde (l.) und Doris Schreck.<br />
Vereinbarkeit von Studium, Beruf und<br />
Familie an der PH: Das Modellprojekt „PH<br />
Campinis“, die flexible Kinderbetreuungsmöglichkeit<br />
an der Hochschule, trägt entscheidend<br />
zur Verbesserung der Situation<br />
studierender oder berufstätiger Eltern<br />
bei. Die Eröffnungsfeier fand Anfang November<br />
2006 statt und bot Gelegenheit,<br />
das Projekt näher kennen zu lernen. (siehe<br />
dazu S. 59).<br />
Die GenderWoche ein Erfolg?<br />
Ich meine „Ja“! Und das nicht in erster<br />
Linie deshalb, weil ein Moment des Innehaltens<br />
im Tagesgeschäft und der Betrachtung<br />
dessen, was „so alles war“, zu Tage<br />
gefördert hat, dass an der Hochschule in<br />
Sachen Gleichstellungsarbeit in den vergangenen<br />
25 Jahren sehr viel in Bewegung<br />
gesetzt wurde und auch einige Erfolge erzielt<br />
werden konnten. Wichtiger noch erscheint<br />
mir, dass die unterschiedlichen<br />
Veranstaltungen der GenderWoche viele<br />
Kolleginnen, Kollegen und Studierende, die<br />
sich für Gleichstellung, für die Entwicklung<br />
von Gender Studies und für Familienfreundlichkeit<br />
an der Hochschule engagieren,<br />
zu Gesprächen und Diskussionen<br />
zusammengeführt hat. Für die Zukunft<br />
ist zu wünschen, dass dieser gemeinsame<br />
Gender-Faden auf vielen Ebenen weitergesponnen<br />
wird.<br />
Anmerkung<br />
1) Vgl. u.a. Kotthoff, Helga (2003): Was heißt eigentlich<br />
doing gender? Differenzierungen im Feld<br />
von Interaktion und Geschlecht. In: Freiburger<br />
FrauenStudien 12: Dimensionen von Gender Studies.<br />
Freiburg: jos fritz Verlag, S. 125-161. Lorber,<br />
Judith (2004): Man muss bei Gender ansetzen, um<br />
Gender zu demonstrieren: Feministische Theorie<br />
und Degendering. In: Zeitschrift für Frauenforschung<br />
und Geschlechterstudien. 22 (2004) H. 2 u.<br />
3. Bielefeld, Kleine Verlag, S. 9-24.<br />
PH-FR 2007/1