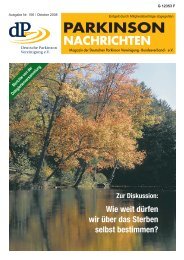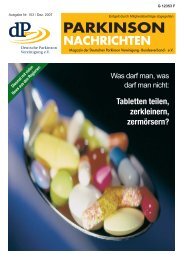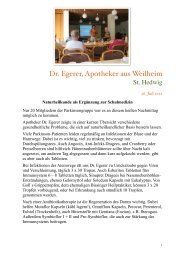dPV Aktuell 48 - Deutsche Parkinson Vereinigung eV
dPV Aktuell 48 - Deutsche Parkinson Vereinigung eV
dPV Aktuell 48 - Deutsche Parkinson Vereinigung eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Atypische <strong>Parkinson</strong>-Syndrome:<br />
AKTUELL<br />
von: Prof. Reiner Thümler, Mainz<br />
September 2009<br />
NR. <strong>48</strong><br />
Multiple Systematrophie (MSA),<br />
progressive supranukleäre Blickparese (PSP),<br />
kortikobasale Degeneration (KBD)<br />
Unter dem Begriff <strong>Parkinson</strong>-Syndrome werden Erkrankungen zusammengefasst, die mit<br />
klinischen Zeichen einer <strong>Parkinson</strong>-Krankheit (= idiopathisches <strong>Parkinson</strong>-Syndrom) einhergehen,<br />
jedoch Besonderheiten hinsichtlich der Ursache, des Verlaufs, der Symptomkonstellation<br />
und des Ansprechens auf <strong>Parkinson</strong>mittel aufweisen.<br />
<strong>Parkinson</strong>-Syndrome werden<br />
in vier Gruppen eingeteilt:<br />
◆ idiopathisches <strong>Parkinson</strong>-<br />
Syndrom<br />
◆ familiäres <strong>Parkinson</strong>-Syndrom<br />
◆ symptomatisches <strong>Parkinson</strong>-Syndrom<br />
◆ atypisches <strong>Parkinson</strong>-Syndrom<br />
Die häufigste Form ist das idiopathische<br />
<strong>Parkinson</strong>-Syndrom<br />
(IPS), das auch als <strong>Parkinson</strong>-<br />
Krankheit bezeichnet wird. Wenn<br />
schon früh, in einzelnen Fällen<br />
schon vor den ersten motorischen<br />
<strong>Parkinson</strong>-Symptomen<br />
eine Demenz auftritt, kann es<br />
sich um eine Demenz vom<br />
Lewy-Körper-Typ handeln, wogegen<br />
die <strong>Parkinson</strong>-Demenz<br />
erst im späten Verlauf auftritt.<br />
Familiäre <strong>Parkinson</strong>-Syndrome<br />
sind sehr selten. Der Begriff<br />
„symptomatisches <strong>Parkinson</strong>-<br />
Syndrom“ weist darauf hin, dass<br />
die klinischen Zeichen (= Symptome)<br />
Ausdruck einer bekannten,<br />
meist auch ursächlich behandelbaren<br />
Erkrankung ist, wie<br />
z.B. Stoffwechselkrankheiten,<br />
Raumforderung im Gehirn (Tumor,<br />
Blutung), Hydrozephalus,<br />
kleine Infarkte in den Basalganglien<br />
oder als häufigste Form das<br />
durch Medikamente ausgelöstes<br />
<strong>Parkinson</strong>-Syndrom. Die Abgrenzung<br />
gelingt heute rasch durch<br />
CT und MRT.<br />
In diesem Beitrag werden die<br />
atypischen <strong>Parkinson</strong>-Syndrome<br />
besprochen, die in drei Gruppen<br />
klassifiziert werden:<br />
◆ Multi-System-Atrophie (MSA)<br />
◆ Progressive supranukleäre Blickparese (PSP)<br />
◆ Kortikobasale Degeneration (KBD)<br />
Die Multi-System-Atrophie<br />
Multi-System-Atrophie bedeutet,<br />
dass mehrere (= multi) neuronale<br />
Systeme vom Zellunter-<br />
gang (Atrophie) betroffen sind.<br />
Die MSA ist das häufigste atypische<br />
<strong>Parkinson</strong>-Syndrom mit<br />
durchschnittlich 6,4 MSA-Fällen<br />
pro100.000 Einwohner (zum<br />
Vergleich: am idiopathischen<br />
<strong>Parkinson</strong>-Syndrom erkranken<br />
durchschnittlich 100-200 von<br />
100.000 Einwohnern).<br />
Forscher der Universitätsklinik<br />
Tübingen haben aktuell<br />
nachgewiesen, dass erbliche<br />
Genvarianten das MSA-Risiko<br />
deutlich erhöhen In einem überarbeiteten<br />
Konsensuspapier<br />
aus dem letzten Jahr wurden die<br />
Kriterien für eine „mögliche MSA“<br />
und eine „wahrscheinliche MSA“<br />
herausgestellt. Die Diagnosesicherung<br />
(„definitive MSA“) ist<br />
erst nach dem Tode durch den<br />
neuropathologischen Nachweis<br />
<strong>dPV</strong> aktuell . Nr. <strong>48</strong> . September 2009 Seite 1
esonderer zellulärer Einschlusskörperchen(α-Synuklein-positive<br />
gliale zytoplasmatische Einschlüsse)<br />
möglich. Die Diagnose<br />
MSA ist wahrscheinlich,<br />
wenn autonome Funktionsstörungen<br />
(Harninkontinenz, Sexualfunktionsstörungen,deutlicher<br />
orthostatischer Blutdruckabfall<br />
im Stehen) entweder in<br />
Kombination mit <strong>Parkinson</strong>-Symptomen<br />
oder mit Kleinhirnstörungen<br />
auftreten. Wichtiges Merkmal<br />
bei Vorliegen von <strong>Parkinson</strong>zeichen<br />
ist das fehlende oder<br />
geringe Ansprechen auf L-Dopa.<br />
Die mittlere Überlebenszeit wird<br />
mit 9 Jahren angegeben.<br />
Es werden zwei Untergrup-<br />
pen der MSA unterschieden: die<br />
MSA-P stellt sich vorwiegend mit<br />
<strong>Parkinson</strong>-Zeichen dar (das „P“<br />
steht für <strong>Parkinson</strong>), während<br />
die MSA-C überwiegend Kleinhirnzeichen<br />
aufweist („C“ steht<br />
für Cerebellum = Kleinhirn).<br />
Die Europäische MSA Studiengruppe<br />
hat 2008 zeigen<br />
können, dass bestimmte klinische<br />
Symptome eine MSA wahrscheinlich<br />
machen. Wenn mindestens<br />
zwei der nachfolgenden „Warnzeichen“:<br />
frühe Instabilität mit<br />
häufigen Stürzen, rasches Fortschreiten<br />
der Erkrankung, abnorme<br />
Körperhaltung, bulbäre<br />
Symptome (Sprach- oder Schluckstörung),<br />
Atemstörungen und<br />
Diagnostische Kategorien und Kriterien für MSA<br />
Mögliche MSA<br />
Affektinkontinenz vorhanden<br />
sind, gilt die Diagnose als nahezu<br />
sicher (Spezifität 98,3%).<br />
Weitere klinische Zeichen sind<br />
dystone Störungen mit nach<br />
vorn geneigter Kopfstellung<br />
(Antecollis), irregulärer Tremor<br />
bzw. Halte- und Aktionsmyoklonus.REM-Schlafverhaltensstörungen<br />
mit groben motorischen<br />
Bewegungen im Schlaf<br />
können ein sehr frühes Zeichen<br />
sein. Eine Funktionsstörung der<br />
Stimmbänder kann nachts einen<br />
inspiratorischen Stridor hervorrufen.<br />
Da ein Teil der MSA-Patienten<br />
für 1-2 Jahre auf eine L-Dopa-Therapie<br />
anspricht, ist ein<br />
<strong>Parkinson</strong>-Syndrom (Bradykinese, Rigor, Tremor, Gang- und Standinstabilität<br />
oder<br />
Kleinhirnsyndrom (Gangataxie mit zerebellärer Dysarthrie, Extremitätenataxie oder zerebellärer<br />
Okulomotorikstörung)<br />
plus<br />
zumindest ein Symptom hinweisend auf autonome Störung (sonst nicht erklärbare Blasen<br />
inkontinenz oder unvollständige Blasenentleerung, erektile Dysfunktion) oder signifikanter<br />
orthostatischer Blutdruckabfall ohne Erfüllung der Kriterien für wahrscheinliche MSA<br />
plus<br />
Mindestens ein Zusatzsymptom für mögliche MSA<br />
Wahrscheinliche MSA<br />
Autonome Störung mit Blaseninkontinenz (Unfähigkeit, die Blasenentleerung zu steuern,<br />
begleitet von erektiler Dysfunktion bei Männern) oder orthostatischer Abfall des Blutdrucks bei<br />
3-minütigem Stehen von > 30 mmHg systolisch oder > 15 mmHg diastolisch<br />
plus<br />
<strong>Parkinson</strong>-Syndrom mit fehlendem/geringem Ansprechen auf L-Dopa<br />
oder<br />
Zerebelläres Syndrom (Gangataxie mit zerebellärer Dysarthrie, Extremitätenataxie oder<br />
zerebellärer Okulomotorikstörung)<br />
Definitive MSA<br />
Pathologischer Nachweis einer hohen Dichte an α-Synuklein-positiven glialen zytoplasmatischen<br />
Einschlüssen in Verbindung mit degenerativen Veränderungen im nigrostriatalen und<br />
olivopontozerebellären System<br />
<strong>dPV</strong> aktuell . Nr. <strong>48</strong> . September 2009 Seite 2
Therapieversuch mit L-Dopa gerechtfertigt,<br />
das langsam unter<br />
Domperidon-Schutz bis 1000 mg<br />
aufdosiert wird. In einigen Fällen<br />
kann die Kombination mit<br />
Dopaminagonisten oder die Umstellung<br />
auf einen anderen Dopaminagonisten<br />
zu einem befristeten<br />
Erfolg führen. Ob Amantadin<br />
wirksam ist, erscheint fraglich,<br />
es kann jedoch seine antriebssteigernde<br />
Wirkung bei Tagesmüdigkeit<br />
ausgenutzt werden.<br />
Wichtig ist, dass die dopaminerge<br />
Therapie nur bei spürbarem<br />
Erfolg fortgesetzt wird.<br />
Beim Absetzvorgang der dopaminergen<br />
Therapie lässt sich<br />
nochmals überprüfen, ob die<br />
Therapie wirksam war.<br />
Einen hohen Stellenwert hat<br />
die symptomatische Therapie<br />
der autonomen Störungen. Bei<br />
orthostatischer Hypotonie empfehlen<br />
sich z. B. Stützstrümpfe,<br />
die nächtliche Hochlagerung<br />
des Oberkörpers (20-30°) und<br />
eine salzreiche Diät. Medikamentös<br />
sind z. B. Midodrin und/<br />
oder Fludrocortison und Etilefrin<br />
wirksam. Bei erektiler Dysfunktion<br />
können unter ärztlicher Kontrolle<br />
PDE-Inhibitoren (z. B. Sildanafil,<br />
Viagra) eingesetzt werden.<br />
Bei Blasenentleerungsstörungen<br />
muss vor Einleitung<br />
der medikamentösen Therapie<br />
eine urologische bzw. gynäkologische<br />
Abklärung erfolgen. Meist<br />
liegt eine Überaktivität des Detrusormuskels<br />
mit Dranginkontinenz<br />
vor, die z. B. mit Oxybutynin<br />
oder Tamsulosin) behandelt<br />
werden kann.<br />
Progressive supranukleäre<br />
Blicklähmung (PSP)<br />
Bei der progressiven (= fortschreitenden)<br />
supranukleären (=<br />
oberhalb eines Kerngebietes<br />
gelegenen) Blicklähmung besteht<br />
neben dem rasch fortschreitenden<br />
akinetisch-rigiden<br />
<strong>Parkinson</strong>-Syndrom eine Lähmung<br />
der Blickbewegung nach<br />
unten, die der Krankheit ihren Namen<br />
gegeben hat. Wahrscheinlich<br />
ist die Diagnose PSP, wenn<br />
schon im ersten Krankheitsjahr<br />
eine ausgeprägte Stand- und<br />
Gangunsicherheit mit Sturzneigung<br />
nach hinten auftritt. Die<br />
PSP tritt etwa so häufig (bzw. so<br />
selten) wie die MSA auf, die mittlere<br />
Überlebenszeit ist mit 5,6<br />
Jahren geringer.<br />
Klinisch werden neuerdings<br />
mindestens zwei Untergruppen<br />
der PSP unterschieden: die klassische<br />
PSP (nach einem der Erstbeschreiber<br />
auch als Richardson<br />
Syndrom genannt) und das PSP-<br />
<strong>Parkinson</strong> Syndrom (PSP-P).<br />
Progressive supranukleäre Blickparese (PSP)<br />
Die klassische PSP geht mit<br />
einer frühzeitigen Gang- und<br />
Standunsicherheit, einer Sturzneigung<br />
nach hinten, der charakteristischen<br />
Blicklähmung<br />
(nach unten) und kognitiven Einschränkungen<br />
einher.<br />
Der <strong>Parkinson</strong>-Typ (PSP-P)<br />
ist oft schwer vom idiopathischen<br />
<strong>Parkinson</strong>-Syndrom zu<br />
unterscheiden, da die Erkrankung<br />
asymmetrisch mit Tremor<br />
und Steifheit der Extremitäten<br />
beginnen und gut auf L-Dopa ansprechen<br />
kann.<br />
Die Haltung ist eher aufrecht, das<br />
Mitschwingen der Arme kaum<br />
gemindert. Die Betroffenen klagen<br />
über Seh- und Lesestörungen,<br />
die sich durch den Ausfall<br />
rascher Augenbewegungen erklären.<br />
Wegen der eingeschränkten<br />
Blickwendung nach unten<br />
beklagen die Patienten oft Sehstörungen<br />
beim Essen (sie sehen<br />
den Teller nicht) oder beim<br />
Hinabsteigen einer Treppe (sie<br />
erkennen die Stufen nicht). Mit<br />
Fortschreiten der Blickparese<br />
(auch zur Seite) werden bei einer<br />
Blickwendung Kopf und Rumpf „en<br />
bloc“ gedreht. Die Augen erscheinen<br />
starr und sind aufgerissen,<br />
die Oberlider zurückgezogen<br />
und die Stirn gerunzelt, was den<br />
Eindruck eines „erstaunten Blicks“<br />
vermittelt.<br />
Merkmale ◆ Auftreten nach dem 40., meist zwischen dem 50. und 65. Lebensjahr<br />
◆ Häufigkeit: 7 von 100.000 der über 55jährigen<br />
◆ Schlechte Ansprechbarkeit auf L-Dopa und Dopaminagonisten<br />
klinische<br />
Zeichen ◆ Blicklähmung nach oben, später nach unten<br />
◆ Rigor mit axialer Betonung, Bradykinese, vorwiegend Beine betroffen,<br />
selten Ruhetremor<br />
◆ frühe Stand- und Gangunsicherheit, Sturzneigung, Kopf-Rumpf-Wendung<br />
„en bloc“<br />
◆ kognitive Zeichen (Frontalhirnzeichen) in späteren Stadien<br />
◆ Sprech- und Schluckstörungen - „Applauszeichen“ (s. S. 4.)<br />
◆ Affektinkontinenz<br />
<strong>dPV</strong> aktuell . Nr. <strong>48</strong> . September 2009 Seite 3
Als markanter Hinweis für<br />
PSP wird das sogenannte Applauszeichen<br />
herausgestellt:<br />
nach der Aufforderung exakt<br />
dreimal zu klatschen, wird häufiger<br />
als dreimal applaudiert.<br />
Neuropathologisches Substrat<br />
ist eine Schädigung frontaler<br />
Zentren, die automatische Bewegungsabläufe<br />
steuern. Psychisch<br />
fällt eine ausgeprägte emotionale<br />
Labilität mit pathologischem Weinen<br />
und Lachen auf (Affektinkontinenz,<br />
pathologische Rührseligkeit).<br />
Im weiteren Verlauf treten<br />
Sprech- und Schluckstörungen<br />
hinzu. Die Patienten werden rollstuhlpflichtig<br />
und zunehmend<br />
pflegeabhängig. Nicht selten ist<br />
schließlich eine Aspirationspneumonie<br />
die eigentliche Todesursache.<br />
Im Vergleich zur MSA ist bei<br />
der PSP in noch geringerem<br />
Maße (10%) durch Dopaminergika<br />
(L-Dopa, Dopaminagonisten)<br />
ein nur befristeter Erfolg zu<br />
erwarten. Weitere, auch meist<br />
nur kurzfristig wirksame Mittel<br />
sind Amantadin, Anticholinergika<br />
und trizyklische Antidepressiva.<br />
Berichte über kurzfristige<br />
Erfolge beziehen sich auch<br />
auf Zolpidem und das Koenzym<br />
Q10. Nichtmedikamentöse Maßnahmen<br />
wie Physiotherapie, Logopädie,<br />
psychosoziale Betreuung<br />
und Hilfsmittelversorgung<br />
haben einen hohen Stellenwert.<br />
Ausgeprägte Schluckstörungen<br />
können eine Sondenernährung<br />
(PEG) notwendig machen.<br />
Eine internationale Forschergruppe<br />
hat in einer aktuellen großangelegten<br />
Studie (NNIPPS-<br />
Studie, Brain 132, 2009) zeigen<br />
können, dass das bei ALS erfolgreich<br />
eingesetzte Riluzol keinen<br />
signifikanten Effekt auf die<br />
Überlebensrate oder die fortschreitende<br />
funktionelle Beeinträchtigung<br />
von PSP und MSA<br />
hat. Ein wichtiges Ergebnis die-<br />
ser Studie ist, das die in dieser<br />
Untersuchung zugrundegelegten<br />
Diagnosekriterien (NNIPPS-<br />
Kriterien) mit hoher Zuverlässigkeit<br />
eine Unterscheidung von<br />
MSA und PSP zulassen.<br />
Kortikobasale Degeneration<br />
(CBD)<br />
Die außerordentlich selten<br />
vorkommende kortikobasale Degeneration<br />
beginnt meist mit einer<br />
einseitigen akinetisch-rigiden<br />
<strong>Parkinson</strong>-Symptomatik, zu<br />
der sich ein irregulärer Halteund<br />
Aktionstremor einer Hand<br />
sowie distale Muskelzuckungen<br />
(fokale Myoklonien als Halteoder<br />
Aktionsmyoklonus) und dystone<br />
Bewegungsstörungen gesellen.<br />
Weitere Kennzeichen sind<br />
eine Apraxie (Apraxie = Unfähigkeit,<br />
Körperteile in einen zweckmäßigen<br />
Handlungsablauf einzubinden)<br />
und die sogenannte<br />
kortikale Empfindungsstörung.<br />
Bei dieser eigenartigen Störung<br />
haben die Betroffenen das Gefühl,<br />
ihr Arm bzw. ihr Bein gehöre<br />
nicht zu ihnen, sei ihnen fremd.<br />
Daher auch die Bezeichnung<br />
„alien-hand/limb“-Phänomen,<br />
(engl. alien = fremd, limb = Bein).<br />
Kortikobasale Degeneration<br />
Merkmale ◆ sehr selten, beginnt um das 60. Lebensjahr,<br />
Krankheitsdauer 7-10 Jahre<br />
◆ Schlechte Ansprechbarkeit auf L-Dopa<br />
◆ Dopaminagonisten sind nicht wirksam<br />
◆ Beginn mit akinetisch-rigiden <strong>Parkinson</strong>-<br />
Zeichen<br />
klinisch<br />
führende<br />
Zeichen<br />
◆ irregulärer Halte und Aktionstremor, imponiert<br />
teilweise als Myoklonus<br />
◆ Dystone Bewegungen der oberen Extremitäten<br />
- Apraxie im Hand- und Mundbereich<br />
◆ Fremdgefühl für Extremitäten („Alien-hand/<br />
limb“-Phänomen)<br />
◆ Sprech- und Schluckstörungen<br />
Medikamentös wird L-Dopa in<br />
langsam ansteigender Dosierung<br />
bis 1000 mg unter Domperidonschutz<br />
eingesetzt. Dopaminagonisten<br />
sind nicht wirksam.<br />
Tremor und Myoklonus lassen<br />
sich durch Betablocker bzw.<br />
Clonazepam über einen gewissen<br />
Zeitraum bessern. Wie bei<br />
MSA und der PSP sind Physiotherapie<br />
und psychosoziale Betreuung<br />
wichtige Therapiepfeiler<br />
der kortikobasalen Degeneration.<br />
<strong>dPV</strong> aktuell<br />
Organ der <strong>Deutsche</strong>n <strong>Parkinson</strong><br />
<strong>Vereinigung</strong> - Bundesverband - e.V.<br />
Moselstraße 31, 41464 Neuss<br />
Telefon (0 21 31) 41 01 6/7<br />
Faxabruf 0180 5 72 75 46<br />
Verantwortlich:<br />
Magdalene Kaminski, 1. Vorsitzende<br />
Co-Autor:<br />
Lutz Johner, Hamburg<br />
Konten:<br />
<strong>Deutsche</strong> <strong>Parkinson</strong> <strong>Vereinigung</strong><br />
- Bundesverband - e.V.<br />
SEB AG Bank<br />
170 856 99 00 (BLZ 300 101 11)<br />
Stadtsparkasse Neuss<br />
280 842 (BLZ 305 500 00)<br />
Hans-Tauber-Stiftung<br />
SEB AG Bank Neuss<br />
143 734 45 00 (BLZ 300 101 11)<br />
Die <strong>dPV</strong>-aktuell Nr. 49 ist ab<br />
Mitte November 2009 abrufbar.<br />
<strong>dPV</strong> aktuell . Nr. <strong>48</strong> . September 2009 Seite 4