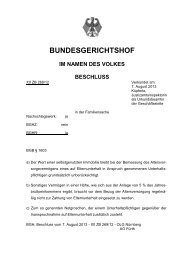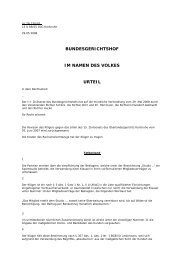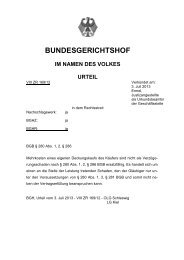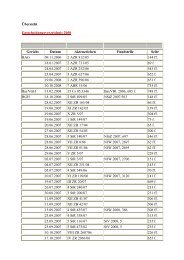Robert Freitag und Stefan Leible Grundfragen der ... - Ja-Aktuell
Robert Freitag und Stefan Leible Grundfragen der ... - Ja-Aktuell
Robert Freitag und Stefan Leible Grundfragen der ... - Ja-Aktuell
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aufsatz Zivilrecht z AGBG<br />
3. Die Behörde ist während <strong>der</strong> Anhängigkeit einer<br />
Verpflichtungsklage nicht daran gehin<strong>der</strong>t, erneut über<br />
den Antrag <strong>der</strong> Kl zu entscheiden. Die Einbeziehung<br />
dieses VA in den Verwaltungsprozeû bedarf keiner Klageän<strong>der</strong>ung<br />
gem § 91 VwGO, da <strong>der</strong> Streitgegenstand<br />
<strong>der</strong> Verpflichtungsklage nicht geän<strong>der</strong>t wird.<br />
Zivilrecht Aufsatz<br />
Gr<strong>und</strong>fragen <strong>der</strong> Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in<br />
Verträge<br />
Dr. <strong>Robert</strong> <strong>Freitag</strong>, Wiss. Ass., Maître en droit, Bielefeld, <strong>und</strong> Dr. <strong>Stefan</strong> <strong>Leible</strong>, Wiss. Ass., Bayreuth<br />
A) Einführung<br />
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind aus dem<br />
heutigen Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken.<br />
Kaum ein gröûerer Vertrag o<strong>der</strong> ein Geschäft des täglichen<br />
Lebens kommt ohne vorformulierte Vertragsklauseln<br />
zustande. Das hat zahlreiche Gründe, die sich<br />
vor allem unter den Stichworten »Rationalisierung«<br />
<strong>und</strong> »Lückenfüllung« zusammenfassen lassen. Wer<br />
seine Leistungen einer Vielzahl von K<strong>und</strong>en anbietet,<br />
ist an einer Rationalisierung <strong>der</strong> Geschäftsabwicklung<br />
durch die Verwendung einheitlicher Geschäftsbedingungen<br />
interessiert. AGB vereinfachen für ihren Verwen<strong>der</strong><br />
die Unternehmensorganisation, schaffen Planungs-<br />
<strong>und</strong> Rechtssicherheit <strong>und</strong> erleichtern die Kalkulation.<br />
Sie machen eine Aushandlung des Vertrags<br />
mit jedem einzelnen K<strong>und</strong>en überflüssig <strong>und</strong> ersparen<br />
dadurch sowohl dem Verwen<strong>der</strong> als auch dem K<strong>und</strong>en<br />
Kosten <strong>und</strong> Mühe. AGB haben darüber hinaus auch<br />
eine wichtige Lückenfüllungsfunktion: Das Gesetz enthält<br />
häufig keine Regelungen rechtlicher Detailfragen,<br />
die für die konkreten Parteien bedeutsam sind. Standardisierte<br />
Klauselwerke bieten hier die Möglichkeit,<br />
privatautonom zwischen den Parteien geltendes Recht<br />
zu setzen <strong>und</strong> Gesetzeslücken zu schlieûen bzw dispositive<br />
Vorschriften abzubedingen. Sie erlauben es zudem,<br />
sich von den gesetzlichen Vertragstypen zu lösen<br />
<strong>und</strong> neue, eigenständige Vertragsformen herauszubilden.<br />
Die Entwicklung zahlreicher sogenannter »mo<strong>der</strong>ner<br />
Vertragstypen«, 1 etwa des Kreditkarten-, Leasing-<br />
o<strong>der</strong> Factoringvertrags, wäre ohne die Verwendung<br />
von AGB kaum denkbar gewesen.<br />
Allerdings ist die Verwendung von AGB zugleich<br />
mit Gefahren behaftet. 2 Die Vorformulierung des Vertragsinhalts<br />
durch eine Partei birgt in typischer Weise<br />
das Risiko, daû die Vertragsbedingungen ausschlieûlich<br />
o<strong>der</strong> übermäûig auf die Interessen des Verwen-<br />
<strong>der</strong>s zugeschnitten sind, während diejenigen des Vertragspartners<br />
nicht ausreichend berücksichtigt werden.<br />
Dies kann zu nicht hinnehmbaren Vertragsdisparitäten<br />
führen. Zwar schlieût <strong>der</strong> Vertragspartner als<br />
privatautonom handelndes Rechtssubjekt auch den<br />
unter Verwendung von AGB zustande kommenden<br />
Vertrag aus freien Stücken ab, doch hat er im Gegensatz<br />
zum Individualvertrag keine o<strong>der</strong> nur höchst<br />
eingeschränkte Möglichkeiten, auf den ihm vorgegebenen<br />
Vertragsinhalt Einfluû zu nehmen. Dies liegt<br />
allerdings nicht ± wie oft behauptet 3 ± an <strong>der</strong> »wirtschaftlichen<br />
Übermacht« des Verwen<strong>der</strong>s bzw <strong>der</strong><br />
»wirtschaftlichen Unterlegenheit« <strong>der</strong> Vertragsgegenseite.<br />
Denn vorformulierte Vertragsklauseln werden<br />
häufig auch von geschäftserfahrenen Vertragsparteien,<br />
etwa Unternehmen, wi<strong>der</strong>spruchslos akzeptiert,<br />
selbst wenn sie wirtschaftlich mächtiger als <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong><br />
sind. In <strong>der</strong> Regel bleibt ihnen unter ökonomischen<br />
Gesichtspunkten auch keine an<strong>der</strong>e Alternative,<br />
da sie sonst vor jedem Vertragsschluû die AGB <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en Vertragspartei kontrollieren, unter Umständen<br />
abweichende Klauseln aushandeln <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> sich<br />
auf die Suche nach Vertragspartnern mit für sie günstigeren<br />
Klauseln begeben müûten. Das aber verursacht<br />
Kosten, die meist auûer Verhältnis zum Wert<br />
des abgeschlossenen Geschäfts stehen. Wer für sein<br />
1 Vgl dazu zB Martinek Mo<strong>der</strong>ne Vertragstypen, Bd I: Leasing <strong>und</strong> Factoring,<br />
1991; Bd II: Franchising, Know-how-Verträge, Management- <strong>und</strong><br />
Consultingverträge, 1992; Bd III: Computerverträge, Kreditkartenverträge<br />
sowie sonstige mo<strong>der</strong>ne Vertragstypen, 1993<br />
2 Erstmals <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>legend Raiser Das Recht <strong>der</strong> Allgemeinen Geschäftsbedingungen,<br />
1935. Zuvor bereits Hamelbeck Begriff, Arten <strong>und</strong> Verbindlichkeit<br />
<strong>der</strong> Allg Geschäftsbedingungen 1930; Michel Die Allg Geschäftsbedingungen<br />
als Vertragsbestandteil in <strong>der</strong> Rechtsprechung,<br />
1932<br />
3 Insb Damm JZ 1978, 173; Fehl Systematik des Rechts <strong>der</strong> Allgemeinen<br />
Geschäftsbedingungen, 1979, 90 ff; Pflug Kontrakt <strong>und</strong> Status im Recht<br />
<strong>der</strong> Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 1986, 24 ff<br />
JA 2000 Heft 11 n n 887 "
Unternehmen Büromaterial kauft, für den lohnt sich<br />
eine solche Vorgehensweise schlicht nicht. Genau dieser<br />
Umstand wird von den Verwen<strong>der</strong>n <strong>der</strong> AGB zur<br />
Abwälzung vertraglicher Risiken auf den K<strong>und</strong>en<br />
ausgenutzt. Bereits die Tatsache <strong>der</strong> einseitigen Vorformulierung<br />
führt zu einer Überlegenheit des Verwen<strong>der</strong>s<br />
<strong>und</strong> verursacht ein vertragliches Ungleichgewicht.<br />
4<br />
Ziel <strong>der</strong> AGB-Kontrolle ist daher insbeson<strong>der</strong>e die<br />
Verhin<strong>der</strong>ung des Miûbrauchs <strong>der</strong> einseitigen Vertragsgestaltungsfreiheit<br />
des Verwen<strong>der</strong>s. Die Überprüfung<br />
vorformulierter Vertragsklauseln bezweckt somit<br />
nicht nur den Schutz generell schwächerer Marktteilnehmer<br />
(etwa <strong>der</strong> Verbraucher), 5 son<strong>der</strong>n dient ganz<br />
allgemein <strong>der</strong> Sicherung <strong>der</strong> Funktionsfähigkeit eines<br />
auf dem Prinzip <strong>der</strong> Privatautonomie beruhenden Privatrechtssystems.<br />
6 Seit dem Inkrafttreten des AGB-Gesetzes<br />
am 1. 4. 1977 existieren detaillierte Vorgaben<br />
für die Überprüfung vorformulierter Vertragsbedingungen.<br />
1996 wurde das AGB-Gesetz geringfügig umgestaltet,<br />
um es den Erfor<strong>der</strong>nissen <strong>der</strong> EG-Richtlinie<br />
93/13 über miûbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen<br />
7 anzupassen. 8<br />
Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> groûen Bedeutung <strong>der</strong> durch AGB bewirkten<br />
Standardisierung von Verträgen war lange<br />
Zeit umstritten, obAGB gleichsam privat gesetztes<br />
<strong>und</strong> damit nichtstaatliches Recht sind (so die sog Normentheorie<br />
9 ) o<strong>der</strong> lediglich eine Ausprägung <strong>der</strong> allgemeinen<br />
Vertragsfreiheit iSd § 305 BGB darstellen<br />
(sog Vertragstheorie). 10 Indem <strong>der</strong> Gesetzgeber in § 2<br />
AGBG die Einbeziehung von AGB vom Einverständnis<br />
<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragspartei abhängig gemacht hat,<br />
hat er sich eindeutig <strong>der</strong> Vertragstheorie angeschlossen.<br />
Obwohl AGB ihrer Natur nach einseitig von einer<br />
Vertragspartei vorgegeben werden <strong>und</strong> nicht das Resultat<br />
des für Individualverträge üblichen Aushandelns<br />
sind, enthält das AGB-Gesetz mit den Bestimmungen<br />
<strong>der</strong> Einbeziehungskontrolle Maûstäbe dafür,<br />
unter welchen Bedingungen die stillschweigende Akzeptanz<br />
dieser Regelungen einer ausdrücklichen inhaltlichen<br />
Zustimmung <strong>und</strong> einem Aushandeln gleichzustellen<br />
ist. 11<br />
Der folgende Beitrag geht daher <strong>der</strong> Frage nach,<br />
welche Vertragsbestandteile überhaupt als AGB bezeichnet<br />
werden (B) <strong>und</strong> wie diese Gegenstand einer<br />
vertraglichen Abrede werden können (unter C). Die<br />
Maûstäbe <strong>der</strong> inhaltlichen Überprüfung von AGB sind<br />
hingegen geson<strong>der</strong>t zu erörtern. 12<br />
B) Der Begriff <strong>der</strong> AGB<br />
Um AGB handelt es sich nach <strong>der</strong> Legaldefinition des<br />
§ 1 I AGBG bei allen Vertragsbedingungen, die für<br />
eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert worden<br />
sind (I.) <strong>und</strong> die eine Vertragspartei ± <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong><br />
± <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragspartei bei Abschluû des Vertrages<br />
stellt (II.).<br />
AGBG z Zivilrecht Aufsatz<br />
I. Vorformulierung für eine Vielzahl von Verträgen<br />
1. Vorformulierung für Vielzahl von Verträgen<br />
Die Vertragsbedingungen müssen vorformuliert, dh<br />
bereits vor Vertragsschluû vollständig erstellt <strong>und</strong> abrufbar<br />
sein. Sie müssen ferner für eine Vielzahl von<br />
Verträgen vorformuliert worden sein. Das ist immer<br />
anzunehmen, wenn <strong>der</strong> Ersteller die Klauseln für eine<br />
Vielzahl künftiger Verwendungen bestimmt hat. 13 Irrelevant<br />
hingegen ist, ob<strong>der</strong> konkrete Verwen<strong>der</strong> von<br />
den AGB einmal o<strong>der</strong> mehrfach Gebrauch macht 14<br />
<strong>und</strong> wer die AGB erstellt hat. 15 Die geringe Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Person des konkreten Verwen<strong>der</strong>s beruht auf dem<br />
Zweck des Gesetzes, das vor den spezifischen Gefahren<br />
vorformulierter Klauseln schützen will: Die Risiken<br />
von AGB beruhen darauf, daû sie von ihrem<br />
Ersteller regelmäûig planvoll zu Lasten <strong>der</strong> künftigen<br />
an<strong>der</strong>en Vertragspartner ausgestaltet worden<br />
sind. Indem <strong>der</strong> konkrete Verwen<strong>der</strong> seinem Vertrag<br />
»fremde AGB« zugr<strong>und</strong>e legt, macht er sich diese zu<br />
eigen <strong>und</strong> greift damit willentlich auf den Sachverstand<br />
des Erstellers zurück. Daher muû er sich auch<br />
an den Maûstäben messen lassen, die für eine Verwendung<br />
<strong>der</strong> AGB durch den Ersteller gelten würden.<br />
Beispiel: V ist durch einen Erbfall Eigentümer zweier<br />
Wohnungen geworden. Während er in die gröûere<br />
Wohnung selber einzieht, möchte er die an<strong>der</strong>e ver-<br />
4 Vgl etwa Hönn Kompensation gestörter Vertragsparität, 1982, 149;<br />
Ohlendorf-v. Hertel Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen<br />
im kaufmännischen Geschäftsverkehr gem § 24 AGBG, 1988, 71<br />
5 Dies ist allerdings die Zielsetzung <strong>der</strong> Klausel-Richtlinie <strong>der</strong> Europäischen<br />
Gemeinschaft (Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. 4. 1993<br />
über miûbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, ABl EG 1995 L<br />
95 vom 21. 5. 1993, 29 ff). Ihr Anwendungsbereich ist gem Art 1 I auf<br />
Verträge zwischen Verbrauchern <strong>und</strong> Gewerbetreibenden beschränkt.<br />
6 So etwa BGHZ 126, 326, 332; ausführlich Fastrich Richterliche Inhaltskontrolle<br />
im Privatrecht, 1992, 29 ff; weitere Nachw speziell zum Recht<br />
<strong>der</strong> AGB bei Ulmer in: Brandner/Ulmer/Hensen AGB-Gesetz, 8. Aufl<br />
(1997), Einl Rn 29 sowie Wolf in: Wolf/Horn/Lindacher AGB-Gesetz,<br />
4. Aufl (1999), Einl Rn 14<br />
7 Oben Fn 5<br />
8 Dazu Kretschmar Die Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. 4. 1993<br />
über miûbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen <strong>und</strong> das deutsche<br />
AGB-Gesetz, 1998<br />
9 In diesem Sinne insb Meyer-Cording Die Rechtsnormen, 1971, 84 ff,<br />
97 ff, 131 ff sowie zuletzt Pflug (Fn 3) 247 ff, ähnlich auch Kramer AcP<br />
188 (1988), 423, 426 f. Weitere Nachw bei Wolf in: Wolf/Horn/Lindacher<br />
Einl Rn 13 <strong>und</strong> Ulmer in: Brandner/Ulmer/Hensen Einl Rn 24 ff<br />
10 So die ganz hM, vgl Fastrich (Fn 6) 33 ff; Wolf JZ 1973, 229, 231 f sowie<br />
bei Wolf <strong>und</strong> Ulmer (obige Fn)<br />
11 Näher unten C) II. 1<br />
12 Dazu demnächst <strong>Freitag</strong>/<strong>Leible</strong> Gr<strong>und</strong>fragen <strong>der</strong> Inhaltskontrolle von<br />
AGB, JA 2001<br />
13 Eine wie<strong>der</strong>holte Verwendung ist nach überwiegen<strong>der</strong> Meinung bei<br />
einem Gebrauch in mindestens 3 ± 5 Fällen anzunehmen, vgl mwN Locher<br />
Das Recht <strong>der</strong> Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 3. Aufl, 1997,<br />
26; Wolf in: Wolf/Horn/Lindacher § 1 Rn 14; Ulmer in: Ulmer/Brandner/<br />
Hensen § 1 Rn 25<br />
14 HM, vgl BGH NJW 1987, 2373, 2374 (zur VOB/B); Ulmer in: Ulmer/<br />
Brandner/Hensen § 1 Rn 24 mwN in Fn 62; Wolf in: Wolf/Horn/Lindacher<br />
§ 1 Rn 13; aA Michalski/Römermann ZIP 1993, 1434, 1437 f, 1443 f<br />
(mindestens dreimaliger Gebrauch durch den Verwen<strong>der</strong>)<br />
15 BGH WM 1983, 1408; Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 1 Rn 21<br />
3 888 n n JA 2000 Heft 11
Aufsatz Zivilrecht z AGBG<br />
mieten. Dem Vertrag mit dem Mietinteressenten M<br />
legt er den aktuellen Formularmietvertrag desHaus<strong>und</strong><br />
Gr<strong>und</strong>besitzervereins zu Gr<strong>und</strong>e. Dessen Regelungen<br />
unterliegen dem AGBG, da esauf die Person<br />
des Erstellers nicht ankommt <strong>und</strong> <strong>der</strong> Haus- <strong>und</strong><br />
Gr<strong>und</strong>besitzerverein das Formular für eine Vielzahl<br />
von Verträgen entworfen hat.<br />
Wurden die Vertragsbedingungen vom Verwen<strong>der</strong><br />
o<strong>der</strong> in seinem Auftrag entworfen, liegen vorformulierte<br />
AGB nur vor, wenn die Klauseln nicht lediglich<br />
ad hoc, son<strong>der</strong>n mit dem Ziel ausgearbeitet wurden,<br />
als Gr<strong>und</strong>lage o<strong>der</strong> Rahmen für mehrere gleichartige<br />
Rechtsverhältnisse mit diesem o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en K<strong>und</strong>en<br />
zu dienen. 16 Wann das <strong>der</strong> Fall ist, ist im Einzelfall<br />
unter Berücksichtigung aller Umstände zu<br />
prüfen. Werden Vertragsbedingungen des Verwen<strong>der</strong><br />
tatsächlich mehreren Verträgen zugr<strong>und</strong>e gelegt,<br />
spricht eine Vermutung dafür, daû sie für diesen<br />
Zweck vorformuliert worden sind. Unter Umständen<br />
kann aber bereits die einmalige Verwendung von<br />
AGB genügen, falls <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong> schon zu diesem<br />
Zeitpunkt beabsichtigt, sie auch in weitere Verträge<br />
einzubeziehen. 17<br />
Darauf, in welcher Form bzw auf welchem Medium<br />
die vorformulierten Klauseln abrufbar gespeichert<br />
werden <strong>und</strong> obsie maschinen- o<strong>der</strong> handschriftlich in<br />
den Vertrag eingeführt werden, kommt es nach ganz<br />
herrschen<strong>der</strong> Ansicht nicht an. 18 Damit liegen AGB<br />
auch vor, wenn sie <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong> als Textbausteine<br />
auf seinem PC gespeichert hat, 19 die Klauseln lediglich<br />
in seinem Gedächtnis »aufbewahrt« o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>weitig<br />
kopierte Klauseln unverän<strong>der</strong>t handschriftlich in den<br />
Vertrag einfügt. 20<br />
Im übrigen können innerhalb eines einheitlichen<br />
Vertragswerkes nebeneinan<strong>der</strong> sowohl vorformulierte<br />
AGB wie auch individualvertraglich ausgehandelte<br />
Klauseln vorliegen. 21 Schlieût zB ein Generalunternehmer<br />
mit verschiedenen Subunternehmern jeweils individuell<br />
ausgehandelte Verträge über die Errichtung<br />
einzelner Teile eines Gesamtbauwerks <strong>und</strong> wird in diese<br />
regelmäûig eine von ihm vorformulierte Vertragsstrafeklausel<br />
einbezogen, fällt diese Klausel in den Anwendungsbereich<br />
des § 1 AGBG.<br />
2. Verbraucherverträge<br />
Eine Ausnahme von dem »Vielzahl«-Erfor<strong>der</strong>nis gilt<br />
gem § 24 a Nr 2 AGBG für in Verbraucherverträgen<br />
(zum Begriff u II. 3.) enthaltene Klauseln. 22 Diese unterliegen<br />
<strong>der</strong> AGB-Kontrolle selbst dann, wenn sie lediglich<br />
für den einmaligen Gebrauch erstellt worden<br />
sind, <strong>der</strong> Verbraucher aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Vorformulierung<br />
<strong>der</strong> Klauseln jedoch auf sie keinen inhaltlichen Einfluû<br />
nehmen konnte. Für <strong>der</strong>artige Einzelvertragsklauseln<br />
gelten nach dem Gesetzeswortlaut die §§ 5<br />
<strong>und</strong> 6 sowie die §§ 8 bis 12 AGBG, während die Vor-<br />
schriften über die Einbeziehungskontrolle <strong>der</strong> §§ 2<br />
<strong>und</strong> 3 AGBG keine Anwendung finden. 23<br />
II. Stellen <strong>der</strong> Vertragsbedingungen<br />
1. Gr<strong>und</strong>satz<br />
Die Kontrolle von AGB durch das AGBG erfor<strong>der</strong>t als<br />
weiteres, subjektives Kriterium, daû <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong><br />
die vorformulierten Bedingungen <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragspartei<br />
»stellt«. Gemeint ist damit eine einseitige<br />
Einführung <strong>der</strong> Klauseln in den Vertrag; <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong><br />
muû also darauf bestehen, den Vertrag nur zu<br />
den vorformulierten Bestimmungen abzuschlieûen.<br />
Obeine Partei Vertragsbedingungen »gestellt« hat,<br />
ist allein aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> tatsächlichen Handlungen <strong>der</strong><br />
Parteien zu beurteilen; demgegenüber spielen we<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Inhalt <strong>der</strong> Klauseln noch die wirtschaftliche<br />
o<strong>der</strong> intellektuelle Überlegenheit des Verwen<strong>der</strong>s<br />
eine Rolle. 24<br />
Beispiel: M mietet von V Geschäftsräume. Der Mietvertrag<br />
beruht auf einem von M mitgebrachten Mietvertragsformular,<br />
dessen Bestimmungen ± was M übersehen<br />
hat ± beson<strong>der</strong>s vermieterfre<strong>und</strong>lich ausgestaltet<br />
sind. Bemerkt M nach Abschluû des Vertrages, daû<br />
er durch einige Klauseln des Mietvertrags benachteiligt<br />
wird, kann er sich nicht auf den Schutz des AGBG<br />
berufen, da dieses nur dem Schutz des VertragspartnersdesVerwen<strong>der</strong>sdient.<br />
25<br />
Vorformulierte Vertragsbedingungen sind von keiner<br />
<strong>der</strong> Vertragsparteien »gestellt« worden, wenn beide<br />
unabhängig voneinan<strong>der</strong> ihre Einbeziehung verlangt<br />
haben. Gleiches gilt, wenn sie von einem unbeteiligten<br />
Dritten ± etwa einem Makler o<strong>der</strong> Notar ± vorgeschlagen<br />
worden sind.<br />
16 BGH NJW 1996, 249, 250<br />
17 Ob eine diesbezügliche Absicht vorliegt, ist anhand aller Begleitumstände<br />
zu ermitteln, vgl BGH NJW 1997, 135<br />
18 Vgl Wolf in Wolf/Horn/Lindacher § 1 Rn 12 <strong>und</strong> Ulmer in Ulmer/Brandner/Hensen<br />
§ 1 Rn 34 ff<br />
19 OLG Hamm NJW-RR 1988, 726<br />
20 BGHZ 115, 391, 394; BGH NJW 1988, 410; BGH NJW 1998, 1066, 1068;<br />
LG München I NJW 1982, 2130, 2130 f<br />
21 BGHZ 75, 15, 20; BGH WM 1996, 126, 127<br />
22 Diese Ausnahmeregelung ist auf die Klausel-Richtlinie zurückzuführen,<br />
die in ihrem Art 3 II an<strong>der</strong>s als das AGB-Gesetz kein Vielzahl-Erfor<strong>der</strong>nis<br />
enthält.<br />
23 Ob <strong>der</strong> Verzicht auf die Anwendung <strong>der</strong> §§ 2, 3 AGBGB mit den Vorgaben<br />
<strong>der</strong> Klausel-Richtlinie vereinbar ist, ist umstritten. Richtiger Ansicht<br />
nach ist § 24 a Nr 2 iSd Richtlinie dahingehend auszulegen, daû<br />
auch Individualklauseln <strong>der</strong> Einbeziehungskontrolle unterliegen, so<br />
Heinrichs NJW 1996, 2190, 2193; Eckert ZIP 1996, 1238, 1240; Köhler<br />
BGB AT, 24. Aufl, 1998, § 23 Rn 12; Palandt-Heinrichs, 59. Aufl, 2000,<br />
§ 24 a AGBG Rn 14; aA Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 24 a Rn 53;<br />
Horn in: Wolf/Horn/Lindacher § 24 a Rn 40<br />
24 Palandt-Heinrichs BGB, 59. Aufl, § 1 AGBG Rn 7; Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen<br />
§ 1 Rn 8<br />
25 BGH NJW 1995, 2034, 2035 f<br />
JA 2000 Heft 11 n n 889 "
2. Ausgehandelte Vertragsbedingungen<br />
Den Gegensatz zu den vom Verwen<strong>der</strong> »gestellten«<br />
AGB bilden individualvertraglich vereinbarte Klauseln.<br />
§ 1 II AGBG stellt daher klar, daû Vertragsbedingungen<br />
nicht als AGB anzusehen sind, soweit sie zwischen<br />
den Vertragsparteien im einzelnen ausgehandelt<br />
wurden.<br />
Ein individualvertragliches Aushandeln liegt jedenfalls<br />
dann vor, wenn eine zuvor formulierte Klausel<br />
von den Parteien im Rahmen des Vertragsschlusses<br />
abgewandelt o<strong>der</strong> ergänzt wird. Allerdings schlieût<br />
nach mittlerweile ganz herrschen<strong>der</strong> Ansicht selbst<br />
die unverän<strong>der</strong>te Übernahme einer vorformulierten<br />
Vertragsbestimmung ein »Aushandeln« iSv § 1 II<br />
AGBG nicht prinzipiell aus. 26 Ein »Aushandeln« liegt<br />
in diesem Fall freilich nur vor, wenn <strong>der</strong> Vertragspartner<br />
die reale Möglichkeit hatte, an <strong>der</strong> inhaltlichen<br />
Ausgestaltung <strong>der</strong> Klausel so mitzuwirken, daû ihr Inhalt<br />
Ausdruck <strong>der</strong> rechtsgeschäftlichen Selbstbestimmung<br />
bei<strong>der</strong> Vertragspartner ist. Hierfür muû <strong>der</strong><br />
Verwen<strong>der</strong> mindestens den gesetzesfremden Kern 27<br />
<strong>der</strong> Klausel in den Vertragsverhandlungen erkennbar<br />
<strong>und</strong> ernsthaft zur Disposition gestellt haben. 28 Die<br />
Beweislast hierfür liegt beim Verwen<strong>der</strong>, <strong>der</strong> ihr bei<br />
<strong>der</strong> unverän<strong>der</strong>ten Übernahme einer vorformulierten<br />
Klausel in das endgültige Vertragswerk in <strong>der</strong> Praxis<br />
kaum wird genügen können. 29<br />
Beispiel: Autohändler A bietet dem K<strong>und</strong>en K einen<br />
Neuwagen zum Preisvon 32 000 DM an. Dem Vertrag<br />
möchte er seine AGB zu Gr<strong>und</strong>e legen, die ua einen<br />
generellen Ausschluû <strong>der</strong> gesetzlichen Gewährleistung<br />
vorsehen. Während <strong>der</strong> Vertragsverhandlungen<br />
macht K indesdeutlich, daû er damit nicht einverstanden<br />
sei. Nach einigem Hin <strong>und</strong> Her einigen<br />
sich A <strong>und</strong> K darauf, die Ausschluûklausel unverän<strong>der</strong>t<br />
im Vertrag zu belassen, jedoch den Kaufpreis<br />
auf 30 000 DM zu senken <strong>und</strong> K eine kostenlose Autowäsche<br />
nach 5 000 Kilometern zuzugestehen. Der<br />
Gewährleistungsausschluû ist vorliegend nicht gem<br />
§ 11 Nr 10 a AGBGB unwirksam, da er nicht in einer<br />
AGB enthalten ist. Es erschiene unangemessen, A am<br />
Klauselverbot des § 11 Nr 10 a AGBG zu messen, obwohl<br />
er die Klausel nicht nur zur Disposition gestellt,<br />
son<strong>der</strong>n auch im Rahmen <strong>der</strong> Preisgestaltung berücksichtigt<br />
hat.<br />
Jedenfalls reicht es für ein individualvertragliches<br />
Aushandeln nicht aus, daû die Klausel dem K<strong>und</strong>en<br />
Wahlmöglichkeiten zwischen mehreren Vertragsbedingungen<br />
einräumt o<strong>der</strong> ihn zu ¾n<strong>der</strong>ungen o<strong>der</strong><br />
Streichungen auffor<strong>der</strong>t. 30 Auch eine vom K<strong>und</strong>en<br />
unterschriebene Bestätigung, die Bedingungen seien<br />
im einzelnen ausgehandelt worden, genügt nicht;<br />
eine solche Klausel ist sogar gem § 11 Nr 15 bAGBG<br />
nichtig. 31<br />
3. Verbraucherverträge<br />
Bei Verbraucherverträgen ist zu beachten, daû gem<br />
§ 24 a Nr 1 AGBG vorformulierte Klauseln unwi<strong>der</strong>leglich<br />
als vom Unternehmer gestellt gelten. An<strong>der</strong>s<br />
liegt es ausnahmsweise, wenn <strong>der</strong> Verbraucher die<br />
AGB selbst in den Vertrag eingeführt hat. Umfaût werden<br />
von <strong>der</strong> Vorschrift auf jeden Fall alle vorformulierten<br />
Vertragsbedingungen, die vom Unternehmen<br />
selbst o<strong>der</strong> in seinem Auftrag von einem Dritten erstellt<br />
wurden. Nach herrschen<strong>der</strong> Meinung sind aber<br />
auch solche vorformulierten Vertragsbedingungen<br />
kontrollfähig, die auf Vorschlag eines Dritten (etwa<br />
des beurk<strong>und</strong>enden Notars) in den Vertrag einbezogen<br />
worden sind. 32<br />
C) Die Einbeziehungskontrolle<br />
AGBG z Zivilrecht Aufsatz<br />
Neben <strong>der</strong> erst demnächst in einem geson<strong>der</strong>ten Beitrag<br />
zu behandelnden inhaltlichen Überprüfung von<br />
AGB stellt die sogenannte Einbeziehungskontrolle anhand<br />
<strong>der</strong> §§ 2, 3 AGBG das zweite Kernstück des AGB-<br />
Gesetzes dar. In diesem Rahmen wird überprüft, unter<br />
welchen Bedingungen die einseitigen vorformulierten<br />
Klauseln vertragliche Bindungswirkung zwischen den<br />
Parteien entfalten. Neben den im Gesetz geregelten<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen an die Einbringung <strong>der</strong> Klauseln gilt es<br />
zuvor, den sachlichen <strong>und</strong> persönlichen Anwendungsbereich<br />
des AGB-Gesetzes zu klären.<br />
I. Der Anwendungsbereich des AGBG<br />
Das AGB-Gesetz kann <strong>und</strong> will nicht sämtliche AGB in<br />
je<strong>der</strong> Situation kontrollieren. Vor <strong>der</strong> Überprüfung<br />
einer Klausel ist daher stets zu prüfen, obüberhaupt<br />
<strong>der</strong> sachliche <strong>und</strong> persönliche Anwendungsbereich<br />
des AGBG eröffnet ist.<br />
26 Gr<strong>und</strong>legend BGH NJW 1977, 624, 625 f; ebenso BGHZ 74, 204, 209 f;<br />
BGH NJW 1984, 109, 111; BGH NJW 1992, 1107, 1108; zuletzt BGH WM<br />
1998, 1289, 1291; Heinrichs NJW 1977, 1505, 1508; Schippel/Brambring<br />
DNotZ 1977, 131, 154 f; Staudinger-Schlosser BGB, 13. Aufl, 1998, § 1<br />
AGBG Rn 28, 31; Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 1 Rn 43 f. AA Stübing<br />
NJW 1978, 1606, 1611; Graf von Westphalen DB 1981, 61, 63 ff;<br />
Michalski/Römermann (Fn 14) 1438 ff<br />
27 Gemeint ist damit die in <strong>der</strong> Klausel formulierte Abweichung von einer<br />
in einem Gesetz, etwa dem BGB o<strong>der</strong> HGB, enthaltenen Regelung.<br />
28 BGHZ 85, 305, 308; BGHZ 104, 232, 236; BGH NJW-RR 1986, 54; BGH<br />
NJW-RR 1987, 144, 145; BGH NJW 1992, 1107, 1108; BGH NJW 1992,<br />
2759, 2760; BGH WM 1998, 1289, 1291; BGH ZIP 1998, 1756, jew mwN.<br />
Vgl dazu auch Schuhmann JZ 1998, 127 ff<br />
29 Die Darlegungs-<strong>und</strong> Beweislast dafür, daû im konkreten Fall ein Aushandeln<br />
<strong>der</strong> an sich vorformulierten Bedingungen stattgef<strong>und</strong>en hat,<br />
obliegt folglich dem Verwen<strong>der</strong>, vergleiche BGHZ 83, 56, 58; BGH WM<br />
1998, 1289, 1291<br />
30 BGHZ 98, 24, 28<br />
31 BGHZ 99, 374, 378<br />
32 Vgl zB Braunfels DNotZ 1997, 356, 376; Bunte DB 1996, 1389, 1392;<br />
Heinrichs NJW 1996, 2190, 2193; Kanzleitner DNotZ 1996, 867, 868 f;<br />
Köhler (Fn 23) § 23 Rn 11; Staudinger-Schlosser (1998) § 24 a Rn 39; aA<br />
Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen (Fn 10) § 24 a Rn 43<br />
3 890 n n JA 2000 Heft 11
Aufsatz Zivilrecht z AGBG<br />
1. Sachlicher Anwendungsbereich<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich finden zwar die Bestimmungen des<br />
AGBG auf alle privatrechtlichen Verträge Anwendung,<br />
doch schränkt § 23 I AGBGB dieses Prinzip erheblich<br />
ein: Gänzlich ausgeschlossen vom Anwendungsbereich<br />
des AGBG sind die praktisch bedeutsamen Verträge<br />
auf den Gebieten des Arbeits-, Erb-, Familien- <strong>und</strong> Gesellschaftsrechts.<br />
Dahinter steht <strong>der</strong> Gedanke, daû im<br />
Arbeitsrecht bereits auûerhalb des AGB-Gesetzes ein<br />
ausreichen<strong>der</strong> Schutz vor unangemessenen Klauseln<br />
gewährleistet ist, 33 während im Familien- <strong>und</strong> Erbrecht<br />
vorformulierte Klauseln praktisch keine Rolle<br />
spielen. 34 Im Gesellschaftsrecht resultiert <strong>der</strong> Verzicht<br />
auf die Klauselkontrolle aus <strong>der</strong> groûteils zwingenden<br />
Ausgestaltung des auf körperschaftlich organisierte<br />
Gesellschaften (AG, KGaA) anwendbaren Rechts, während<br />
Personengesellschaften (GbR, KG <strong>und</strong> oHG) sowie<br />
Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer personenbezogenen Struktur selten Anlaû zum<br />
Miûbrauch einseitiger Vertragsgestaltungsmacht bieten.<br />
35 Weitere, wenig systematische Ausnahmen von<br />
<strong>der</strong> Anwendung des AGBG enthält § 23 II AGBG. 36 Die<br />
dort angeführten Vertragstypen sind zwar nicht insgesamt<br />
von <strong>der</strong> AGB-Kontrolle ausgenommen, doch sind<br />
einzelne Vorschriften des AGBG auf sie nicht anwendbar.<br />
2. Persönlicher Anwendungsbereich<br />
Wie eingangs bereits erwähnt, liegt <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong> für die<br />
AGB-Kontrolle in <strong>der</strong> bei Verwendung Allgemeiner<br />
Geschäftsbedingungen generell bestehenden Gefahr<br />
einer einseitigen Ausnutzung <strong>der</strong> Vertragsfreiheit<br />
durch den Verwen<strong>der</strong>. Das AGB-Gesetz ist daher sowohl<br />
auf AGB anwendbar, die in Verträgen zwischen<br />
Unternehmen verwendet werden, als auch auf solche,<br />
die in Verträgen mit Verbrauchern o<strong>der</strong> zwischen Privatpersonen<br />
Verwendung finden. Lediglich die Intensität<br />
<strong>der</strong> Kontrolle variiert je nach Schutzbedürftigkeit<br />
<strong>der</strong> beteiligten Personen: Auf Verträge zwischen Privatpersonen,<br />
dh zwischen Parteien, von denen keine<br />
im Rahmen ihrer gewerblichen o<strong>der</strong> beruflichen Tätigkeit<br />
handelt, finden die Bestimmungen des AGB-<br />
Gesetzes uneingeschränkte Anwendung.<br />
An<strong>der</strong>es gilt hingegen im Geschäftsverkehr. Der Gesetzgeber<br />
geht im AGB-Recht ebenso wie im allgemeinen<br />
Zivilrecht davon aus, daû Personen, die bei Abschluû<br />
des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen<br />
o<strong>der</strong> selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln<br />
(§ 14 BGB), wenig schutzwürdig sind. 37 Gleiches gilt<br />
für juristische Personen des öffentlichen Rechts o<strong>der</strong><br />
öffentlich-rechtliche Son<strong>der</strong>vermögen. Werden daher<br />
AGB gegenüber <strong>der</strong>artigen Personen verwendet, sind<br />
die Vorschriften <strong>der</strong> §§ 2, 10, 11 AGBG über die Einbeziehungskontrolle<br />
<strong>und</strong> das Maû <strong>der</strong> Inhaltskontrolle<br />
(sowie Art 29 a EGBGB über den internationalen An-<br />
wendungsbereich des AGB-Gesetzes) 38 nicht anzuwenden.<br />
§ 24 S 2 AGBG stellt jedoch klar, daû die Generalklausel<br />
des § 9 AGBG im unternehmerischen Geschäftsverkehr<br />
auch insoweit gilt, als dies zur Unwirksamkeit<br />
von Vertragsbestimmungen führt, die in den<br />
§§ 10 <strong>und</strong> 11 AGBG genannt sind.<br />
Beson<strong>der</strong>heiten sind schlieûlich gem § 24 a AGBG<br />
bei Verbraucherverträgen zu beachten. Um einen<br />
Verbrauchervertrag handelt es sich bei einem Vertrag<br />
zwischen einem Unternehmer, dh einer Person, die in<br />
Ausübung ihrer gewerblichen o<strong>der</strong> beruflichen Tätigkeit<br />
handelt (§ 14 BGB), <strong>und</strong> einer natürlichen Person,<br />
dh einer Person, die zu einem Zweck kontrahiert,<br />
<strong>der</strong> we<strong>der</strong> einer gewerblichen noch einer selbständigen<br />
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann<br />
(§ 13 BGB). Auf solche Verträge sind die Vorschriften<br />
des AGB-Gesetzes mit den in § 24 a AGBG genannten<br />
Maûgaben anzuwenden. Während auf § 24 a Nr 1 <strong>und</strong><br />
2 AGB bereits eingegangen wurde, ist § 24 a Nr 3<br />
AGBG erst im Rahmen <strong>der</strong> Inhaltskontrolle zu erörtern.<br />
39<br />
II. Die Einbeziehung von AGB in den Vertrag<br />
1. Die Einbeziehungsvereinbarung<br />
AGB sind vertragsrechtliche Bestimmungen. Eine Bindung<br />
<strong>der</strong> Parteien an den Inhalt <strong>der</strong> Klauseln erfor<strong>der</strong>t<br />
demzufolge eine vertragliche Einigung über ihre<br />
Einbeziehung. 40 § 2 AGBG regelt daher in Ergänzung<br />
zu den §§ 145 ff BGB drei Voraussetzungen, unter denen<br />
AGB im Geschäftsverkehr mit Nichtunternehmern<br />
Vertragsbestandteil werden.<br />
a) Ausdrücklicher Hinweis bei Vertragsschluû<br />
Gem § 2 I AGBG muû <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong> die an<strong>der</strong>e Vertragspartei<br />
spätestens bei Vertragsschluû in <strong>der</strong> in § 2<br />
I Nr 1 geregelten Form auf seine AGB hinweisen. Dies<br />
bedeutet in zeitlicher Hinsicht, daû alle Hinweise auf<br />
die AGB, die erst nach Vertragsschluû erfolgen, unbeachtlich<br />
sind. 41 Dies gilt selbst dann, wenn <strong>der</strong> K<strong>und</strong>e<br />
33 Vgl Regierungsbegründung zum AGBG, BT-Ds 7/3919, 41<br />
34 Regierungsbegründung aaO (Fn 33)<br />
35 Näher dazu MünchKommBGB-Basedow Bd I, 3. Aufl, 1993, § 23 AGBG<br />
Rn 9; Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 23 Rn 19 f<br />
36 Die Beweggründe für die Herausnahme <strong>der</strong> angeführten Verträge aus<br />
dem Geltungsbereich einzelner Bestimmungen des AGB-Gesetzes sind<br />
so unterschiedlich wie die in § 23 II AGBG enthaltenen Verträge selbst,<br />
vgl zu den Motiven des Gesetzgebers im einzelnen die Regierungsbegründung,<br />
BT-Ds 7/3919, 41 ff<br />
37 Regierungsbegründung, BT-Ds 7/3919, 43<br />
38 Dazu <strong>Freitag</strong>/<strong>Leible</strong> EWS 2000, 342; Staudinger RIW 2000, 416; Wagner<br />
IPRax 2000, 249<br />
39 Dazu auch Michalski DB 1999, 677<br />
40 Vgl oben Fn 10<br />
41 Vgl zB BGH NJW 1978, 2243, 2244 (Lieferschein); NJW 1983, 2026, 2027<br />
(Frachtbrief-Übergabeschein); OLG Karlsruhe NJW-RR 1993, 567, 568<br />
(Rechnung)<br />
JA 2000 Heft 11 n n 891 "
die AGB bereits aufgr<strong>und</strong> früherer Rechtsbeziehungen<br />
mit dem Verwen<strong>der</strong> kennt. 42<br />
Beispiel: K bestellt bei V am 1. 3. 2000 telefonisch eine<br />
Lieferung Gartenscheren für 1 000 DM. Zusammen mit<br />
<strong>der</strong> Ware übersendet V dem K am 10. 3. 2000 einen<br />
Lieferschein, auf dessen Rückseite seine AGB abgedruckt<br />
sind, die einen Ausschluû jeglicher Gewährleistung<br />
vorsehen. Stellen sich die Scheren als stumpf<br />
heraus, kann sich V gegenüber dem Wandelungsbegehren<br />
des K nicht auf den Gewährleistungsausschluû berufen,<br />
weil dieser erst nach Vertragsschluû erfolgte.<br />
Problematisch ist die Frage <strong>der</strong> Rechtzeitigkeit bei<br />
AGB, die auf Eintrittskarten, Gar<strong>der</strong>obenmarken,<br />
Parkscheinen etc abgedruckt sind. Wird <strong>der</strong> Vertrag,<br />
was die Regel sein dürfte, bereits vor Aushändigung<br />
<strong>der</strong> Karte mündlich geschlossen, so können ihn die<br />
auf <strong>der</strong> später ausgehändigten Karte abgedruckten<br />
AGB nicht mehr abän<strong>der</strong>n. 43<br />
§ 2 I Nr 1 AGBG verlangt ferner einen »ausdrücklichen«<br />
Hinweis auf die AGB. Dieser muû unmiûverständlich<br />
mündlich o<strong>der</strong> schriftlich gegeben werden,<br />
wobei schriftliche Hinweise in nicht zu übersehen<strong>der</strong><br />
Weise <strong>und</strong> so deutlich zu sein haben, daû ein<br />
durchschnittlicher K<strong>und</strong>e sie bei Vertragsschluû ohne<br />
Schwierigkeiten wahrnehmen kann. 44 Daher werden<br />
beispielsweise die auf <strong>der</strong> Rückseite eines Vertragsformulars<br />
abgedruckten AGB nur Vertragsbestandteil,<br />
wenn auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite deutlich auf sie hingewiesen<br />
wird. Soll ein Vertrag im Internet unter Geltung<br />
von AGB geschlossen werden, bestehen im Hinblick<br />
auf das Hinweiserfor<strong>der</strong>nis keine Beson<strong>der</strong>heiten:<br />
Es reicht aus, wenn <strong>der</strong> Anbieter auf <strong>der</strong> Internetseite,<br />
auf <strong>der</strong> sich sein Angebot (bzw die entsprechende<br />
invitatio ad offerendum 45 ) befindet, deutlich macht,<br />
daû er nur unter Geltung seiner AGB kontrahieren<br />
wolle. § 2 I Nr 1 AGBG ist hingegen nicht Genüge getan,<br />
wenn <strong>der</strong> Verweis auf die AGB lediglich am untersten<br />
Ende <strong>der</strong> Maske plaziert o<strong>der</strong> optisch unverhältnismäûig<br />
klein gestaltet ist. 46<br />
Eines ausdrücklichen Hinweises bedarf es ausnahmsweise<br />
nicht, wenn er wegen <strong>der</strong> Art des Vertragsabschlusses<br />
nicht o<strong>der</strong> nur unter unverhältnismäûigen<br />
Schwierigkeiten möglich ist. Gem § 2 I Nr 1<br />
AGBG genügt es hier, wenn <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong> mit einem<br />
deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses<br />
auf seine AGB hinweist. Bedeutung kommt<br />
dem vor allem bei <strong>der</strong> Inanspruchnahme automatischer<br />
Einrichtungen zu, bei denen es am persönlichen<br />
Kontakt zwischen den Vertragsparteien fehlt, etwa<br />
bei <strong>der</strong> Benutzung von Parkhäusern, Autowaschanlagen,<br />
Schlieûfächern etc.<br />
b) Möglichkeit <strong>der</strong> zumutbaren Kenntnisnahme<br />
Darüber hinaus muû <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong> gem § 2 I Nr 2<br />
AGBG <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragspartei beim Vertrags-<br />
AGBG z Zivilrecht Aufsatz<br />
schluû die Möglichkeit verschaffen, in zumutbarer<br />
Weise vom Inhalt seiner AGB Kenntnis zu nehmen.<br />
Sind die Vertragsbedingungen beispielsweise ausgehängt,<br />
muû dies an einer deutlich sichtbaren Stelle<br />
geschehen sein <strong>und</strong> nicht etwa im hintersten, unbeleuchteten<br />
Winkel eines Ladenlokals. Fehlt es an<br />
einem Aushang o<strong>der</strong> wird <strong>der</strong> Vertrag mündlich an<br />
einem dritten Ort geschlossen, muû <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong><br />
dem K<strong>und</strong>en entwe<strong>der</strong> einen Abdruck seiner AGB<br />
überreichen o<strong>der</strong> ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme<br />
in ein mitgeführtes Exemplar gewähren. Das gilt<br />
auch, wenn <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong> branchenübliche AGB,<br />
beispielsweise bei Bauverträgen die VOB, in den Vertrag<br />
einbeziehen will. Ein bloûer Hinweis auf die VOB<br />
reicht für ihre Einbeziehung nicht aus; vielmehr muû<br />
<strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong> <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragspartei wenigstens<br />
die Möglichkeit zur Information über <strong>der</strong>en Inhalt<br />
verschaffen. 47<br />
Wird <strong>der</strong> Vertrag schriftlich geschlossen, genügt<br />
<strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong> seiner Obliegenheit zur Kenntnisverschaffung,<br />
wenn er den Text seiner AGB beilegt o<strong>der</strong><br />
zumindest in Katalogen, Preislisten, Prospekten o<strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en Druckwerken publiziert, die dem K<strong>und</strong>en<br />
spätestens bis zum Vertragsschluû zugehen. 48 Beim<br />
Vertragsschluû per Internet ist die Kenntnisnahme<br />
<strong>der</strong> AGB zumindest dann zumutbar, wenn diese vor<br />
dem Bestellformular aufgeführt o<strong>der</strong> wenn sie zwar<br />
auf einer davon separaten Internet-Seite gespeichert<br />
sind, <strong>der</strong> Vertragspartner jedoch durch einen link die<br />
betreffende Seite ohne weiteres aufrufen <strong>und</strong> die AGB<br />
dort lesen, speichern o<strong>der</strong> ausdrucken kann. 49<br />
Die Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme setzt<br />
weiterhin voraus, daû die AGB äuûerlich leserlich<br />
<strong>und</strong> sprachlich verständlich gefaût sind, <strong>der</strong> Durchschnittsk<strong>und</strong>e<br />
sie also ohne Zuhilfenahme einer Lupe<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er Hilfsmittel lesen <strong>und</strong> ± ohne rechtsk<strong>und</strong>ig<br />
zu sein ± auch verstehen kann. 50 Daran fehlt es zB,<br />
wenn schlicht auf Gesetzesregelungen verwiesen wird<br />
42 BGH NJW-RR 1987, 112, 113<br />
43 Die Einzelheiten sind freilich str, vgl dazu mwN Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen<br />
§ 2 Rn 34 <strong>und</strong> MünchKommBGB-Kötz § 2 AGBG Rn 7. Das<br />
LG Frankfurt/M NJW-RR 1988, 955 sah hingegen den Abdruck <strong>der</strong> Benutzungsordnung<br />
für ein Parkhaus auf <strong>der</strong> Rückseite des am Automaten<br />
gelösten Parkscheins als ausreichend an<br />
44 BGH NJW-RR 1987, 112, 113; MünchKommBGB-Kötz § 2 AGBG Rn 6; Palandt-Heinrichs<br />
§ 2 AGBG Rn 5<br />
45 Zur Abgrenzung von Offerte <strong>und</strong> invitatio ad offerendum allg Larenz/<br />
Wolf Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 8. Aufl, 1997, § 29<br />
Rn 19 f. Speziell zur Problematik im Internet ua Waldenberger BB<br />
1996, 2365; Mehrings BB 1998, 2373, 2375 mwN<br />
46 Waldenberger (Fn 45) 2368; Löhnig NJW 1997, 1688, 1688 f; Mehrings<br />
(Fn 45) 2374 ff<br />
47 BGHZ 85, 135, 138, ausführlich BGHZ 109, 192, 196 mwN<br />
48 Zu den Einzelheiten Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen (Fn 43) § 2<br />
Rn 45 ff<br />
49 Vgl Waldenberger (Fn 45) 2368 f; Löhnig (Fn 46) 1689; Ernst BB 1997,<br />
1057; Köhler NJW 1998, 185, 189; Taupitz/Kritter JuS 1999, 839, 844;<br />
Hoeren/Oberscheid VuR 1999, 371, 378; von Bernstorff RIW 2000, 14,<br />
15 f, alle mwN. Teilw aA Borges ZIP 1999, 130, 135; Mehrings (Fn 45)<br />
2374 ff<br />
50 Näher Wolf in: Wolf/Horn/Lindacher § 2 Rn 27; Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen<br />
§ 2 Rn 50 ff<br />
3 892 n n JA 2000 Heft 11
Aufsatz Zivilrecht z AGBG<br />
(etwa: »§ 537 BGB ist unanwendbar«), da <strong>der</strong>en Inhalt<br />
dem Durchschnittsk<strong>und</strong>en idR unbekannt sein wird. 51<br />
c) Einverständnis <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragspartei<br />
Schlieûlich muû die an<strong>der</strong>e Vertragspartei gem § 2 I<br />
aE AGBG mit <strong>der</strong> Einbeziehung <strong>der</strong> AGB einverstanden<br />
sein. Diese Zustimmung unterliegt als Willenserklärung<br />
den allgemeinen Regeln über Voraussetzungen<br />
<strong>und</strong> Wirksamkeit von Rechtsgeschäften, 52 so<br />
daû sie auch konkludent o<strong>der</strong> unter den Voraussetzungen<br />
des § 151 BGB, dh unter Verzicht auf das<br />
Zugangserfor<strong>der</strong>nis des § 130 BGB, erklärt werden<br />
kann. 53 Eine konkludente Annahme <strong>der</strong> AGB liegt im<br />
Zweifel vor, wenn die übrigen Voraussetzungen des<br />
§ 2 I AGBG erfüllt sind <strong>und</strong> sich die an<strong>der</strong>e Partei,<br />
auch ohne die Klauseln im einzelnen gelesen zu haben,<br />
auf den Vertrag eingelassen hat; ist sie mit <strong>der</strong><br />
Einbeziehung nicht einverstanden, muû sie dies bei<br />
Vertragsschluû ausdrücklich erklären. 54 An<strong>der</strong>s liegt<br />
es, wenn <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong> erst in seiner Vertragsannahmeerklärung,<br />
etwa einer Auftragsbestätigung, auf<br />
seine AGB hinweist. Da AGB bereits bei <strong>und</strong> nicht<br />
erst nach Vertragsschluû einbezogen werden müssen<br />
(vgl oben a), gilt <strong>der</strong> verspätete erstmalige Hinweis<br />
auf Klauselwerke als abän<strong>der</strong>nde Annahme <strong>der</strong> ursprünglichen<br />
Vertragsofferte <strong>und</strong> damit als neues Angebot<br />
iSv § 150 II BGB. Reagiert die an<strong>der</strong>e Partei<br />
hierauf nicht, kann ihr Schweigen gr<strong>und</strong>sätzlich nicht<br />
als Einverständnis gewertet werden. 55<br />
2. Einbeziehung unter Unternehmern<br />
a) Gr<strong>und</strong>züge<br />
§ 2 AGBG findet gem § 24 Nr 1 AGBG im Geschäftsverkehr<br />
keine Anwendung. Hier bleibt es bei den allgemeinen<br />
Regeln über Willenserklärungen <strong>und</strong> den Vertragsschluû.<br />
Daher bedarf es keines ausdrücklichen<br />
Hinweises auf die AGB. Schon ein konkludenter Hinweis<br />
ist ausreichend. 56 Dieser Unterschied zur Verwendung<br />
von AGB gegenüber Verbrauchern rechtfertigt<br />
sich daraus, daû ein Unternehmer im geschäftlichen<br />
Verkehr stets mit <strong>der</strong> Verwendung von AGB<br />
durch seinen Vertragspartner rechnen muû <strong>und</strong> sich<br />
daher beim Vertragsschluû beson<strong>der</strong>s sorgfältig zu<br />
informieren hat. Daraus folgt, daû AGB bereits dann<br />
Vertragsbestandteil werden, wenn zwei Unternehmer<br />
miteinan<strong>der</strong> in einer dauernden Geschäftsverbindung<br />
stehen <strong>und</strong> einer von ihnen bei früheren Vertragsschlüssen<br />
immer wie<strong>der</strong> darauf hingewiesen hat, daû<br />
er nur zu seinen Geschäftsbedingungen kontrahiere.<br />
Hat die an<strong>der</strong>e Vertragsteil dem in <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
nicht wi<strong>der</strong>sprochen, kann bei einem neuerlichen<br />
Vertragsschluû auch ohne einen entsprechenden Hinweis<br />
davon ausgegangen werden, daû beide Vertragsparteien<br />
mit <strong>der</strong> Geltung <strong>der</strong> AGB auch für den neu<br />
abgeschlossenen Vertrag einverstanden sind. 57 Ferner<br />
ist davon auszugehen, daû im Geschäftsverkehr zwischen<br />
zwei einer Branche angehörigen Parteien 58 die<br />
branchenüblichen AGB (zB die VOB im Bau- o<strong>der</strong><br />
die ADSp im Transportgewerbe) gr<strong>und</strong>sätzlich in den<br />
Vertrag einbezogen werden. 59 Allerdings muû auch<br />
bei Geschäften zwischen Unternehmen jede Vertragspartei<br />
die Möglichkeit zur Kenntnisnahme <strong>der</strong> AGB<br />
<strong>der</strong> Vertragsgegenseite besitzen. Die Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
hieran sind bei einem unternehmerisch tätigen Geschäftspartner<br />
freilich geringere als bei Verbrauchern.<br />
b) Kollidierende AGB<br />
Ein beson<strong>der</strong>es Problem bei Vertragsschlüssen zwischen<br />
Unternehmen stellen einan<strong>der</strong> wi<strong>der</strong>sprechende<br />
AGB dar.<br />
Beispiel: Der am Abschluû eines gewerblichen Kaufvertragesinteressierte<br />
Käufer (K) unterbreitet einem potentiellen<br />
Vertragspartner (V) ein Kaufangebot, dem er<br />
seine »Allgemeinen Einkaufsbedingungen« zu Gr<strong>und</strong>e<br />
legt. V erklärt sich mit dem Angebot einverstanden,<br />
weist in seiner Auftragsbestätigung jedoch auf seine<br />
»Allgemeinen Verkaufsbedingungen« hin, die inhaltlich<br />
abweichende Regelungen enthalten.<br />
Die Lösung des Wi<strong>der</strong>spruches wurde von <strong>der</strong> Rechtsprechung<br />
lange Zeit über § 150 II BGB gesucht. Sie<br />
erblickte in <strong>der</strong> Erklärung des V eine abän<strong>der</strong>nde Annahme<br />
<strong>der</strong> Offerte des K, dh eine Ablehnung des ursprünglichen<br />
Angebots, verb<strong>und</strong>en mit einem neuen.<br />
Dieses neue Angebot konnte K seinerseits nun entwe<strong>der</strong><br />
ablehnen o<strong>der</strong> ausdrücklich bzw konkludent<br />
akzeptieren. Im Zweifel sah <strong>der</strong> BGH in <strong>der</strong> wi<strong>der</strong>spruchslosen<br />
Durchführung des Vertrages ein stillschweigendes<br />
Einverständnis des Gegners mit den zuletzt<br />
eingebrachten AGB, da er mit diesen gerechnet<br />
hat bzw hätte rechnen müssen (Theorie vom »Wissenmüssen«).<br />
60<br />
51 OLG Karlsruhe NJW-RR 1986, 91, 92; OLG Schleswig NJW 1995, 2858,<br />
2859 (str)<br />
52 HM, vgl BGH WM 1982, 444, 445; Wolf in: Wolf/Horn/Lindacher § 2<br />
Rn 42; Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 2 Rn 61; aA die sog Normentheorie,<br />
dazu die Nachw oben Fn 9<br />
53 So auch explizit die Regierungsbegründung, BT-Ds 7/3919, 18<br />
54 BGH BB 1983, 15, 16; OLG Köln WM 1993, 369, 370; OLG Hamm BB<br />
1979, 1789<br />
55 BGHZ 18, 212, 215; BGHZ 61, 282, 287; BGH NJW 1988, 2106, 2108; näher<br />
Wolf in: Wolf/Horn/Lindacher § 2 Rn 37 <strong>und</strong> MünchKommBGB-<br />
Kötz § 2 AGBGB Rn 18, 29 mwN<br />
56 BGHZ 102, 293, 304; siehe auch Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 2<br />
Rn 80 ff mwN<br />
57 BGHZ 42, 53, 55; BGH NJW 1978, 2243<br />
58 An<strong>der</strong>s aber, soweit die an<strong>der</strong>e Partei offenk<strong>und</strong>ig branchenfremd ist,<br />
BGH BB 1976, 1386<br />
59 BGHZ 1, 83, 86; 3, 200, 203; teilw an<strong>der</strong>s BGH NJW 1985, 1838, 1840<br />
<strong>und</strong> BGH NJW-RR 1992, 626 f (die Branchenüblichkeit <strong>der</strong> AGB ist lediglich<br />
ein Indiz für die Einbeziehung)<br />
60 Seit BGHZ 18, 212, 215 ff; BGH BB 1951, 456; zuletzt BGH DB 1973, 2135<br />
JA 2000 Heft 11 n n 893 "
Diese »Theorie des letzten Wortes« ist mittlerweile<br />
zu Recht zugunsten einer Anwendung <strong>der</strong> Dissensvorschriften<br />
aufgegeben worden. 61 In dem Wi<strong>der</strong>spruch<br />
<strong>der</strong> AGB liegt ein offener Einigungsmangel gem § 154<br />
I S 1 BGB, da sich die Parteien ihrer Uneinigkeit hinsichtlich<br />
<strong>der</strong> in den AGB wi<strong>der</strong>sprüchlich geregelten<br />
Klauseln bewuût sind. Allerdings wird für kollidierende<br />
AGB die gesetzliche Auslegungsregel des § 154<br />
I S 1 BGB nicht angewendet, wonach im Falle des offenen<br />
Dissenses <strong>der</strong> Vertrag im Zweifel unwirksam ist.<br />
Vielmehr geht man davon aus, daû die Parteien immer<br />
dann, wenn sie den Vertrag trotz <strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>sprüche<br />
in den AGB durchführen, gr<strong>und</strong>sätzlich auch eine<br />
unvollständige Regelung gewollt haben, so daû <strong>der</strong><br />
Vertrag trotz des Einigungsmangels wirksam bleibt. 62<br />
Inhaltlich gilt das vertraglich Vereinbarte einschlieûlich<br />
<strong>der</strong>jenigen Teile <strong>der</strong> AGB bei<strong>der</strong> Parteien, die inhaltlich<br />
übereinstimmen. Vertragsbestandteil werden<br />
ferner diejenigen Klauseln einer <strong>der</strong> Vertragsparteien,<br />
mit denen die an<strong>der</strong>e Partei stillschweigend einverstanden<br />
ist. Von einem solchen stillschweigenden<br />
Einverständnis kann ausgegangen werden, wenn die<br />
Klauseln lediglich zu ihren Gunsten, nicht aber zu ihrem<br />
Nachteil wirken. Soweit die AGB miteinan<strong>der</strong> unvereinbar<br />
sind, werden sie nicht Vertragsbestandteil.<br />
Die hierdurch im Vertrag entstehenden Lücken sind<br />
durch ergänzende Vertragsauslegung <strong>und</strong> dispositives<br />
Gesetzesrecht zu schlieûen. 63<br />
Eine Abweichung von diesen Gr<strong>und</strong>sätzen <strong>und</strong> damit<br />
eine Anwendung von § 150 II BGB kommt allenfalls<br />
in Betracht, wenn eine Vertragspartei klar <strong>und</strong><br />
unmiûverständlich zum Ausdruck gebracht hat, daû<br />
sie unter keinen Umständen bei Geltung <strong>der</strong> AGB <strong>der</strong><br />
Vertragsgegenseite an <strong>der</strong> Wirksamkeit <strong>und</strong> Durchführung<br />
des Vertrags interessiert ist. 64 Dafür genügt<br />
es nach überwiegen<strong>der</strong> Ansicht nicht, wenn sie in ihre<br />
AGB eine sog »Abwehrklausel« aufgenommen hat, in<br />
<strong>der</strong> sie erklärt, daû sie gr<strong>und</strong>sätzlich nur zu ihren<br />
AGB kontrahieren möchte <strong>und</strong> AGB <strong>der</strong> Vertragsgegenseite<br />
nicht anerkennt. Es müssen vielmehr weitere<br />
Umstände hinzukommen, die deutlich machen,<br />
daû sie die AGB <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragspartei keinesfalls<br />
akzeptieren wird. 65<br />
3. Überraschende Klauseln<br />
In AGB enthaltene Klauselwerke sind häufig sehr umfangreich<br />
<strong>und</strong> komplex. Der Vertragspartner des Verwen<strong>der</strong>s<br />
wäre daher regelmäûig überfor<strong>der</strong>t, müûte<br />
er die AGB vollständig auch im Hinblick auf vertragliche<br />
Nebenpunkte untersuchen, um gegebenenfalls<br />
auf individualvertraglichen Abweichungen zu bestehen.<br />
Er soll vielmehr auf ein Mindestmaû an Redlichkeit<br />
des Verwen<strong>der</strong>s vertrauen <strong>und</strong> davon ausgehen<br />
können, daû die AGB keine Regelung enthalten, die in<br />
keinerlei Zusammenhang mit dem eigentlichen Vertragsgegenstand<br />
stehen o<strong>der</strong> in grobunbilliger Weise<br />
AGBG z Zivilrecht Aufsatz<br />
über das inhaltlich Angemessene hinausgehen. 66 §3<br />
AGBG stellt damit eine Ausprägung des im Recht <strong>der</strong><br />
AGB generell zu beachtenden Transparenzgebotes, 67<br />
dh <strong>der</strong> Verpflichtung zur »hinreichend verständlichen<br />
<strong>und</strong> eindeutigen Konditionengestaltung«, 68 dar.<br />
Gem § 3 AGBG werden »überraschende Klauseln«<br />
zwingend <strong>und</strong> unabhängig vom Willen <strong>der</strong> Beteiligten<br />
bei Vorliegen zweier Voraussetzungen nicht Vertragsbestandteil:<br />
Die betreffenden AGB müssen objektiv,<br />
dh im Hinblick auf die beson<strong>der</strong>en Umstände des Falles,<br />
vor allem nach dem äuûeren Erscheinungsbild<br />
des Vertrages, ungewöhnlich sein <strong>und</strong> <strong>der</strong> Vertragspartner<br />
des Verwen<strong>der</strong>s hierdurch in subjektiver Hinsicht<br />
überrascht werden. Ungewöhnlich ist eine Klausel<br />
insbeson<strong>der</strong>e dann, wenn ihre Vereinbarung im<br />
Rahmen des konkreten Vertragstyps nicht üblich ist. 69<br />
Zusätzlich erfor<strong>der</strong>t das Eingreifen von § 3 AGBG<br />
einen »Überrumpelungseffekt«, <strong>der</strong> nur vorliegt, wenn<br />
die Klausel von den Erwartungen des Vertragspartners<br />
deutlich abweicht <strong>und</strong> <strong>der</strong> Vertragspartner mit<br />
dieser Abweichung den Umständen nach vernünftigerweise<br />
nicht rechnen muû. 70 Hinsichtlich des Erwartungshorizontes<br />
ist entsprechend <strong>der</strong> im Zivilrecht<br />
üblichen typisierenden Betrachtungsweise auf die Erkenntnismöglichkeiten<br />
des typischerweise bei Verträgen<br />
<strong>der</strong> geregelten Art zu erwartenden Durchschnittsk<strong>und</strong>en<br />
abzustellen. 71<br />
Der gr<strong>und</strong>sätzlich zugr<strong>und</strong>e zu legende generelle<br />
Maûstabkann aber durch die konkreten Verhältnisse<br />
beim Vertragsschluû modifiziert werden. So kann<br />
eine an sich übliche Klausel im konkreten Einzelfall<br />
gleichwohl »überraschend« sein, wenn <strong>der</strong> K<strong>und</strong>e<br />
aufgr<strong>und</strong> von ¾uûerungen <strong>der</strong> Vertragsgegenseite<br />
während <strong>der</strong> Vertragsverhandlungen davon ausgehen<br />
durfte, eine <strong>der</strong>artige Klausel sei in den verwendeten<br />
AGB nicht vorhanden. Umgekehrt kann eine an sich<br />
ungewöhnliche Klausel ihren überraschenden Charakter<br />
verlieren, wenn <strong>der</strong> K<strong>und</strong>e im Laufe <strong>der</strong> Vertragsverhandlungen<br />
ausdrücklich o<strong>der</strong> in sonstiger<br />
geeigneter Weise auf sie hingewiesen wurde. 72<br />
61 So schon BGHZ 61, 282, 285 ff; BGH BB 1974, 1136 f; BGH WM 1977,<br />
451, 452; aus dem Schrifttum Bunte JA 1982, 321, 322 ff (zum Eigentumsvorbehalt);<br />
Honsell JuS 1981, 705, 706 (zum Eigentumsvorbehalt);<br />
Lindacher JZ 1977, 604, 605<br />
62 Zu den Einzelheiten Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 2 Rn 98<br />
63 Vgl dazu zB <strong>Leible</strong>/Sosnitza Gr<strong>und</strong>fälle zum Recht des Eigentumsvorbehalts,<br />
JuS 2001 (im Druck), unter 1. Teil, III. 2<br />
64 BGHZ 61, 282, 287 f; MünchKommBGB-Kötz, § 2 AGBG Rn 31; Ulmer in:<br />
Ulmer/Brandner/Hensen, § 2 Rn 99<br />
65 Vgl Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 2 Rn 99<br />
66 So die Regierungsbegründung zu § 3 AGBG, BT-Ds 7/3919, 19<br />
67 Dazu Brandner FS Locher, 1990, 317; Köndgen NJW 1989, 943; Koller FS<br />
Steindorff, 1990, 667; Pflug AG 1992, 1; H. P. Westermann FS Steindorff,<br />
1990, 817<br />
68 Lindacher in: Wolf/Horn/Lindacher § 3 Rn 11<br />
69 Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 3 Rn 14 (teilw aA Lindacher in:<br />
Wolf/Horn/Lindacher § 3 Rn 27)<br />
70 BGHZ 100, 82, 85; BGHZ 109, 197, 201; Taupitz JuS 1989, 520, 522<br />
71 BGH BB 1995, 2186; Lindacher in: Wolf/Horn/Lindacher § 3 Rn 36<br />
72 Vgl mwN BGHZ 121, 107, 113; BGH NJW 1992, 1822, 1823; Locher<br />
(Fn 13) 58; Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 3 AGBG Rn 13 a<br />
3 894 n n JA 2000 Heft 11
Aufsatz Zivilrecht z AGBG<br />
Von den ungewöhnlichen sind die inhaltlich unbilligen<br />
Klauseln zu unterscheiden. 73 Zwar werden ungewöhnliche<br />
Geschäftsbedingungen nicht selten auch<br />
einen unangemessenen Inhalt haben, doch zwangsläufig<br />
ist das nicht. Es ist durchaus denkbar, daû<br />
unbillige Klauseln keine Überraschungscharakter besitzen,<br />
wie auch billige Klauseln ungewöhnlich <strong>und</strong><br />
überraschend sein können. In <strong>der</strong> Praxis wird es allerdings<br />
selten sein, daû <strong>der</strong> Vertragspartner des Verwen<strong>der</strong>s<br />
von Klauseln überrascht wird, die einer Inhaltskontrolle<br />
am Maûstabdes AGB-Gesetzes standhalten.<br />
III. Die Auslegung von AGB<br />
Die Auslegung von AGB richtet sich gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
nach den allgemeinen Regeln für die erläuternde <strong>und</strong><br />
ergänzende Auslegung von Rechtsgeschäften <strong>der</strong><br />
§§ 133, 157 BGB. Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Aufgaben<br />
<strong>und</strong> Gefahren, die mit <strong>der</strong> Verwendung standardisierter<br />
Klauseln verb<strong>und</strong>en sind, gilt es dabei jedoch einige<br />
spezifische Beson<strong>der</strong>heiten zu beachten. 74<br />
1. Der Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> objektiven Auslegung<br />
Der mit <strong>der</strong> Verwendung von AGB angestrebte Rationalisierungseffekt<br />
läût sich nur erreichen, wenn die<br />
Klauselwerke allen K<strong>und</strong>en gegenüber einheitlich ausgelegt<br />
werden. Daher sind AGB objektiv auszulegen,<br />
dh es kommt darauf an, wie sie von verständigen <strong>und</strong><br />
redlichen Vertragsparteien unter Abwägung <strong>der</strong> Interessen<br />
<strong>der</strong> normalerweise beteiligten Kreise verstanden<br />
werden. 75 Nicht maûgeblich ist demgegenüber,<br />
wie <strong>der</strong> konkrete Vertragspartner die Klausel verstanden<br />
hat. Eine Ausnahme vom Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> objektiven<br />
Auslegung ist jedoch dann geboten, wenn <strong>der</strong> Verwen<strong>der</strong><br />
<strong>und</strong> die an<strong>der</strong>e Vertragspartei übereinstimmend<br />
ein Verständnis <strong>der</strong> AGB entwickelt haben, das<br />
von dem sich bei objektiver Auslegung ergebenden<br />
Sinngehalt abweicht. 76 Das kann zB <strong>der</strong> Fall sein, wenn<br />
die Vertragsparteien vor Vertragsschluû über die Bedeutung<br />
des vorformulierten Textes gesprochen <strong>und</strong><br />
ihm übereinstimmend einen bestimmten Inhalt beigemessen<br />
haben.<br />
2. Die Unklarheitenregel des § 5 AGBG<br />
Gem § 5 AGBG gehen Zweifel bei <strong>der</strong> Auslegung von<br />
AGB zu Lasten des Verwen<strong>der</strong>s. Das gilt ebenso für<br />
vorformulierte Individualvereinbarungen in Verbraucherverträgen<br />
(§ 24 Nr 2 AGBG). Die Anwendbarkeit<br />
<strong>der</strong> Regel setzt zunächst einmal eine Unklarheit voraus,<br />
dh die Klausel muû bei objektiver Auslegung (vgl<br />
oben 1) mehrdeutig sein, also mindestens zwei verschiedene<br />
Auslegungen zulassen. Ist das <strong>der</strong> Fall, ist<br />
in einem nächsten Schritt <strong>der</strong> Klausel <strong>der</strong> Bedeutungsgehalt<br />
beizumessen, <strong>der</strong> typischerweise am ehesten<br />
dem Interesse des K<strong>und</strong>en entspricht. Angestrebt<br />
wird damit ein möglichst weitreichendes <strong>und</strong> damit<br />
k<strong>und</strong>enfre<strong>und</strong>liches Auslegungsergebnis. Sieht zB eine<br />
Klausel vor, daû eine Vertragsstrafe fällig wird, sobald<br />
<strong>der</strong> Schuldner in Verzug gerät, <strong>und</strong> daû es einer beson<strong>der</strong>en<br />
Inverzugsetzung nicht bedarf, so ist unklar,<br />
ob das Erfor<strong>der</strong>nis <strong>der</strong> Mahnung generell abbedungen<br />
o<strong>der</strong> lediglich eine zweite Mahnung des sich bereits<br />
im Verzug befindenden Schuldners entbehrlich ist.<br />
Nach <strong>der</strong> Unklarheitenregel des § 5 AGBG ist zugunsten<br />
des K<strong>und</strong>en von letzterer Variante auszugehen. 77<br />
Allerdings ist bei <strong>der</strong> k<strong>und</strong>enfre<strong>und</strong>lichen Auslegung<br />
einer Klausel auch <strong>der</strong> Regelungsgehalt <strong>der</strong> §§ 9<br />
bis 11 AGBG zu beachten. Weichen alle möglichen<br />
Deutungen <strong>der</strong> Klausel im Interesse des Verwen<strong>der</strong>s<br />
vom dispositiven Gesetzesrecht ab, liegt es gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
im Interesse <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragspartei, die Klausel<br />
insgesamt aus dem Vertrag auszuscheiden <strong>und</strong> auf<br />
die gesetzlichen Gr<strong>und</strong>wertungen zurückzugreifen. 78<br />
Dieser Gesichtspunkt bedingt bei nachteilig vom Gesetz<br />
abweichenden AGB eine Zwei-Schritt-Vorgehensweise:<br />
Zunächst ist durch Auslegung <strong>der</strong> k<strong>und</strong>enfeindlichste<br />
Inhalt <strong>der</strong> Klausel zu ermitteln <strong>und</strong> dieser am<br />
Maûstab<strong>der</strong> §§ 9 bis 11 AGBG daraufhin zu untersuchen,<br />
ober den K<strong>und</strong>en unangemessen benachteiligt.<br />
Erweist sich die Klausel danach als unangemessen, ist<br />
sie unabhängig von weiteren Deutungsmöglichkeiten<br />
insgesamt unwirksam <strong>und</strong> wird durch das dispositive<br />
Gesetzesrecht ersetzt. Hält hingegen selbst die k<strong>und</strong>enfeindlichste<br />
Auslegung <strong>der</strong> Inhaltskontrolle stand,<br />
ist <strong>der</strong> Klausel in einem zweiten Schritt <strong>der</strong> k<strong>und</strong>enfre<strong>und</strong>lichste<br />
Inhalt zugr<strong>und</strong>ezulegen.<br />
Beispiel (nach BGH NJW 1983, 1671 f): Ein Kaufvertrag<br />
wird unter Einbeziehung <strong>der</strong> AGB desVerkäufers<br />
geschlossen. In diesen heiût es: »Der K<strong>und</strong>e kann sich<br />
nicht auf den Einwand eines Preis- o<strong>der</strong> Kalkulationsirrtums<br />
berufen.« Die Klausel läût sich zum einen dahin<br />
auslegen, <strong>der</strong> Käufer dürfe den Vertrag nicht wegen<br />
einesIrrtumsanfechten, <strong>der</strong> ihm bei <strong>der</strong> Berechnung<br />
des Kaufpreises unterlaufen sei ± damit wie<strong>der</strong>holte<br />
sie lediglich das, was § 119 BGB ohnedies an-<br />
73 Dazu ua Lindacher in: Wolf/Horn/Lindacher § 3 Rn 5 ff; Münch-<br />
KommBGB-Kötz, § 3 AGBG Rn 2; Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 3<br />
Rn 5, alle mwN<br />
74 Zur Auslegung von AGB insb Krampe Die Unklarheitenregel, 1983;<br />
Dreher AcP 189 (1989), 342; Honsell JA 1985, 260 sowie Locher (Fn 13)<br />
60 ff<br />
75 Vgl BGHZ 77, 116, 118; BGHZ 79, 117, 119; BGH NJW 1992, 2629; BGH<br />
NJW-RR 1996, 856, 857; Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 5 Rn 13 ff<br />
mwN; krit ua Lindacher in: Wolf/Horn/Lindacher § 5 Rn 5 f mwN<br />
76 BGHZ 77, 116, 118 f; vgl Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 5 Rn 24<br />
mwN<br />
77 BGH NJW 1986, 2049, 2050<br />
78 HM, BGH NJW 1992, 1097, 1099; BGH NJW 1994, 1798, 1799; OLG<br />
Schleswig ZIP 1995, 759, 762; Lindacher in: Wolf/Horn/Lindacher § 5<br />
Rn 31 ff; Palandt-Heinrichs § 5 AGBG Rn 9; krit H. Roth WM 1991, 2085,<br />
2088 f<br />
JA 2000 Heft 11 n n 895 "
ordnet, da Motivirrtümer (mit Ausnahme <strong>der</strong> Regelung<br />
in § 119 II BGB) gr<strong>und</strong>sätzlich irrelevant sind. 79<br />
Ferner könnte die Klausel auch gem § 119 I BGB beachtliche<br />
Erklärungsirrtümer bei <strong>der</strong> Verständigung<br />
über den Kaufpreiso<strong>der</strong> gar an<strong>der</strong>e Rechtsbehelfe,<br />
etwa aus cic o<strong>der</strong> § 242 BGB ausschlieûen. Da die<br />
Klausel in <strong>der</strong> letztgenannten Alternative den K<strong>und</strong>en<br />
unangemessen iSd § 9 AGBG benachteiligt (BGH aaO),<br />
ist sie jedenfalls unwirksam, ihr zulässiger k<strong>und</strong>enfre<strong>und</strong>licher<br />
Inhalt daher irrelevant.<br />
IV. Der Vorrang <strong>der</strong> Individualabrede<br />
§ 4 AGBG bestimmt den Vorrang individueller Vertragsabreden<br />
vor an<strong>der</strong>slautenden AGB-Klauseln.<br />
Dieser rechtfertigt sich zum einen daraus, daû Individualabreden<br />
gegenüber den auf generelle Geltung<br />
abzielenden AGB die speziellere Regelung enthalten.<br />
Auûerdem besteht die wesentliche Funktion von AGB<br />
gerade in <strong>der</strong> Ergänzung, nicht aber <strong>der</strong> Verdrängung<br />
von Individualabreden. 80<br />
Beispiel: A kauft von B ein Auto. Als Liefertermin wird<br />
mündlich <strong>der</strong> 4. 6. 1999 vereinbart. Die in den Vertrag<br />
einbezogenen AGB desB sehen vor, daû Liefertermine<br />
unverbindlich sind. Die Individualabrede genieût hier<br />
gem § 4 AGBG Vorrang vor <strong>der</strong> vorformulierten Klausel.<br />
81 B ist daher zur Lieferung am 4. 6. 1999 verpflichtet<br />
<strong>und</strong> muû dem A aufgr<strong>und</strong> etwaiger Verzögerungen<br />
entstandene Schäden ersetzen (§ 286 I BGB).<br />
Im Zusammenhang mit dem Vorrang <strong>der</strong> Individualabrede<br />
resultieren beson<strong>der</strong>e Probleme aus den häufig<br />
in AGB anzutreffen sog »Schriftformklauseln«. 82<br />
Auf diesem Weg soll eine Berufung <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragspartei<br />
auf mündliche getroffene Individualver-<br />
Einführung in das Europäische Strafrecht<br />
± Sanktionskompetenzen auf europäischer Ebene ±<br />
Dr. Jörg Eisele, Wiss. Ass., Tübingen<br />
I. Einleitung<br />
Die europäische Integration ist mit dem Maastrichter<br />
Unionsvertrag vom 7. 2. 1992 <strong>und</strong> dem am 1. 5. 1999<br />
in Kraft getretenen Vertrag von Amsterdam 1 erheblich<br />
fortgeschritten. Die Entwicklung des Europäischen<br />
Straf- <strong>und</strong> Strafprozeûrechts konnte mit <strong>der</strong><br />
Geschwindigkeit dieser Integration bislang vor allem<br />
deshalbnicht Schritt halten, weil die Kompetenzen im<br />
Europäisches Strafrecht z Strafrecht Aufsatz<br />
einbarungen, die den sonstigen AGB wi<strong>der</strong>sprechen<br />
könnten, ausgeschlossen werden (etwa durch die Formulierung:<br />
»Nebenabreden sind nur wirksam, wenn<br />
sie schriftlich erfolgt sind«). Derartige Klauseln sind<br />
nach ganz herrschen<strong>der</strong> Ansicht unwirksam, wobei<br />
die Begründung freilich variiert. So wird behauptet,<br />
auch die Schriftformklausel vermöge nicht von <strong>der</strong> gesetzlichen<br />
Regelung des § 4 AGBG abzuweichen <strong>und</strong><br />
sei daher bereits aufgr<strong>und</strong> dieser Vorschrift unwirksam.<br />
83 AA nach folgt das gleiche Resultat daraus, daû<br />
eine Schriftformklausel unmittelbar den durch § 4<br />
AGBG gewährten Schutz aushöhle <strong>und</strong> damit eine unangemessene<br />
Benachteiligung <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Partei iSd<br />
§ 9 AGBG darstelle. 84 Entsprechendes gilt für sog »Bestätigungsklauseln«,<br />
die die Wirksamkeit mündlicher<br />
Abreden des handelnden Vertreters von einer schriftlichen<br />
Bestätigung seines Geschäftsherren abhängig<br />
machen. 85 Von Schriftformklauseln zu unterscheiden<br />
sind die sog Vollständigkeitsklauseln (etwa »Mündliche<br />
Nebenabreden wurden nicht getroffen«). Sie wie<strong>der</strong>holen<br />
lediglich die allgemeine Vermutung <strong>der</strong> Vollständigkeit<br />
<strong>der</strong> Vertragsurk<strong>und</strong>e <strong>und</strong> schneiden dem<br />
K<strong>und</strong>en nicht den Beweis des Gegenteils ab. 86<br />
79 Statt aller Palandt-Heinrichs § 119 Rn 29 <strong>und</strong> Larenz/Wolf (Fn 45) § 36<br />
Rn 14<br />
80 Köhler (Fn 23) § 23 Rn 23; Larenz/Wolf (Fn 45) § 43 Rn 46<br />
81 So speziell zu Klauseln, die den Liefertermin unverbindlich stellen,<br />
BGH WM 1984, 1317<br />
82 Ausführlich dazu Teske Schriftformklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen,<br />
1990; Weigel Schriftformklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen,<br />
1989<br />
83 So insb Larenz/Wolf (Fn 45) § 43 Rn 46; Lindacher in: Wolf/Horn/Lindacher<br />
§ 4 Rn 33; Palandt-Heinrichs § 4 AGBG Rn 5<br />
84 BGHZ 92, 24, 26; MünchKommBGB-Kötz, 3. Aufl, § 4 AGBG Rn 9; Staudinger-Schlosser<br />
BGB, 13. Bearb, § 4 AGBG Rn 23 ff mwN; Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen<br />
§ 4 Rn 29 ff<br />
85 Näher Ulmer in: Ulmer/Brandner/Hensen § 4 Rn 40 f<br />
86 BGHZ 93, 29, 60; BGH NJW 1985, 2329, 2331; Ulmer in: Ulmer/Brandner/<br />
Hensen § 4 Rn 39; krit Köhler (Fn 23) § 23 Rn 25<br />
Bereich <strong>der</strong> Strafrechtspflege ± auch nach den ¾n<strong>der</strong>ungen<br />
durch den Amsterdamer Vertrag ± noch weitgehend<br />
auf nationaler Ebene liegen. 2 Dementspre-<br />
1 Zur Entstehungsgeschichte des Vertrages von Amsterdam vgl Bitterlich<br />
in: Lenz EG-Vertrag, Kommentar, 2. Aufl, 1999, Einführung Rn 1; Oppermann<br />
Europarecht, 2. Aufl, 1999, § 1 Rn 44 ff; Streinz Europarecht,<br />
4. Aufl, 1999, Rn 39 ff<br />
2 Vgl dazu näher unten II<br />
3 896 n n JA 2000 Heft 11