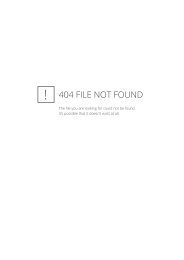Beiträge - ALEG
Beiträge - ALEG
Beiträge - ALEG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
Lateinamerikanischer Germanistenverband<br />
Sektion 10:<br />
Subjektivität und Objektivität: Gibt es Wahrheit in der Übersetzung?<br />
Sektionsleiter:<br />
Werner Heidermann (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasilien)<br />
Mary Snell-Hornby (Universität Wien, Österreich)<br />
Susana Kampff Lages (Universidade Federal Fluminense, Brasilien)<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
<strong>Beiträge</strong>:<br />
―Subjektivität und Objektivität in Gebrauch und Übersetzung von Ortsnamen am<br />
Beispiel Mexikos und Galiciens‖/ ―Subjetividad y objetividad en el uso y la<br />
traducción de los topónimos: los casos de México y Galicia‖<br />
Bahr, Christian<br />
Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie (IALT), Universität Leipzig<br />
In zwei- oder mehrsprachigen Gebieten kann der Gebrauch von Ortsnamen in der einen<br />
oder anderen Namensform eine subjektive Entscheidung sein, die eine ideologische<br />
Positionierung des Sprechers mit sich führt. Das Ziel dieses Beitrags ist es, die<br />
Sprachkonfliktsituationen im Bereich der Toponymie in Mexiko, wo zahlreiche<br />
Ortsnamen im Laufe der Kolonisations- und Dekolonisationsprozesse geändert wurden,<br />
und in Galicien, wo sich der Sprachkonflikt zwischen dem Galicischen und dem<br />
Spanischen auch in den Kastilianisierungen und Regalicisierungen der Ortsnamen<br />
widerspiegelt, zu vergleichen. Für beide Fälle sollen kurz die Standardisierungsprozesse<br />
im Bereich der Ortsnamen sowie die (ideologischen etc.) Implikationen ihres<br />
nichtnormativen Gebrauchs dargestellt werden. In einem zweiten Schritt soll die<br />
Übersetzung dieser Ortsnamen ins Deutsche untersucht werden, um herauszufinden, ob<br />
sich allgemeine Tendenzen feststellen lassen, die mit diesen Konflikten in<br />
Zusammenhang stehen. So soll beispielsweise analysiert werden, von welcher der<br />
Namensformen die ins Deutsche übernommenen Ortsnamen ausgehen. In diesem Sinne<br />
möchte der vorliegende Beitrag bestimmen, in welchem Maße davon gesprochen werden<br />
kann, dass die eher „subjektiven Faktoren“, die den Gebrauch mehrsprachiger Ortsnamen<br />
in ihrer endonymischen Umgebung bestimmen, bei der Übersetzung ins Deutsche an<br />
Bedeutung verlieren und stattdessen eher „objektive“ Faktoren wie die Namenart, die<br />
Ausgangssprache oder die Geschichte, Größe und Bedeutung des Namenträgers<br />
entscheidend sind.
En las regiones bilingües o plurilingües el uso de los topónimos en una u otra de sus<br />
formas lingüísticas puede suponer una decisión subjetiva que implique un<br />
posicionamiento ideológico por parte del hablante. El objetivo de esta comunicación es<br />
comparar estas situaciones de conflicto lingüístico en el ámbito de la toponimia en<br />
México, donde numerosos topónimos han ido cambiando durante los procesos de<br />
colonización y descolonización, y en Galicia, donde el conflicto lingüístico entre el<br />
gallego y el castellano se manifiesta también en las castellanizaciones y<br />
regalleguizaciones de los topónimos. Para ambos casos se describirán brevemente los<br />
procesos de estandarización de la toponimia y las implicaciones (ideológicas etc.) de los<br />
usos no normativos. En un segundo paso se analizará la traducción de estos topónimos al<br />
alemán para comprobar la existencia de tendencias generales relacionadas con estos<br />
conflictos, por ejemplo, se pretende verificar a partir de cuál de las formas lingüísticas se<br />
importan al alemán. En este sentido la presente comunicación se propone determinar en<br />
qué medida podríamos decir que los factores más bien “subjetivos” que determinan el uso<br />
de los topónimos plurilingües en su entorno endonímico pierden su importancia a la hora<br />
de la traducción al alemán, y en qué medida son decisivos factores más “objetivos” como<br />
el tipo de topónimo, las lenguas de partida o la historia, el tamaño y la importancia del<br />
lugar geográfico<br />
Übersetzungsdidaktik im Rahmen eines „Diplomado de Traducción―<br />
Boehm, Siegfried<br />
FES Acatlán, UNAM, Edo. de México<br />
Durch die ständig zunehmende Globalisierung, die sich in den letzten Jahren in allen<br />
Lebensbereichen durchgesetzt hat, ist auch der Bedarf an qualifizierten Übersetzern<br />
konstant gestiegen. Während die Fremdsprachenforschung derzeitig große Fortschritte<br />
erreicht und deren Vermittlung sich somit erheblich verbessert hat, befindet sich der<br />
Übersetzungsunterricht wenigstens hierzulande im Allgemeinen noch im<br />
Anfangsstadium. Viele Übersetzer haben sich somit autodidaktisch weiter gebildet und<br />
nur wenige können eine theoretisch- und praxisbezogene Ausbildung auf diesem Gebiet<br />
vorweisen. Im Gegensatz zur Fremdsprachenvermittlung gibt es auch kaum ausgebildete<br />
Lehrkräfte, die in der Lage sind Übersetzungsunterricht zu erteilen.<br />
Aufgrund dieser mangelnden Voraussetzungen sind wir an der Autonomen Nationalen<br />
Universität von Mexiko, FES Acatlán im Moment dabei einen Einführungskurs zum<br />
Übersetzer anzubieten. In sieben Modulen mit insgesamt 200 Stunden soll den<br />
Kursteilnehmern, die ausreichende Kenntnisse der Ausgangs- und Zielsprache vorweisen<br />
müssen, theoretisches und praktisches Wissen vermittelt werden mit dem Ziel<br />
verschiedene Textsorten profesionell zu übersetzen.<br />
Im folgenden Beitrag geht es um die Didaktik des Übersetzens, d.h. um die Vermittlung<br />
theoretischer und praktischer Aspekte, um die Rolle der Linguistik bei der Übersetzung,<br />
um Aufgaben und Ziele eines theoretisch orientierten Übersetzungsunterrichts sowie um<br />
didaktische Hinweise für rezeptive und produktive Phasen des Übersetzens. Letztendlich<br />
werden Überlegungen zur Bewertung der Übersetzungen angestellt. Sicherlich reicht der<br />
vorgestellte Kurs noch nicht aus um profesioneller Übersetzer zu werden, aber er ist
dennoch ein erster Schritt, um eine translatorische Kompetenz zu erlangen, die sich<br />
wahrscheinlich erst in der späteren Berufspraxis festigen kann.<br />
LÍNEAS ROJAS – die Übersetzung des Gedichts La muerte me da als Versuch einer<br />
transformativen Sprachergänzung<br />
Garbe, Susanne<br />
Universidad de Concepción (UdeC)<br />
In diesem Vortrag möchte ich meine translatorischen Auseinandersetzungen mit der<br />
experimentellen Literatur der mexikanischen Schriftstellerin Cristina Rivera Garza<br />
vorstellen.<br />
Besonders interessant ist ihr Werk La muerte me da, da dieses sowohl in Form eines<br />
Prosagedichts als auch in Form eines Thrillerromans vorliegt. Angesichts der Dichte der<br />
oftmals intertextuell referierenden Sprachspiele habe ich mich in meinen translatorischen<br />
Bemühungen zunächst auf das Prosagedicht konzentriert. Vor allem angesichts der Frage,<br />
ob man überhaupt von einem ,Original„ sprechen kann, wenn dies von Anfang an in zwei<br />
Versionen existiert, bietet sich hier Benjamins innovatives Konzept der<br />
,Sprachergänzung„ durch die ,fremde Art des Meinens„ als theoretischer Hintergrund für<br />
eine Übersetzung an. Denn anders als traditionelle Ansätze, zielt diese Methode nicht<br />
mehr darauf ab, ein vermeintliches ,Original„ zu verdeutschen. Vielmehr geht es darum,<br />
mit der als ,Umdichtung„ verstandenen Übersetzungsbewegung, die sogenannte ,reine<br />
Sprache„ als „Ausdruck des innersten Verhältnisses der Sprachen zueinander“<br />
aufzuspüren. Die ,reine Sprache„ ist die Sprache Gottes, die „nichts mehr meint“, sondern<br />
als „schöpferisches Wort das in allen Sprachen Gemeinte ist“, eine Sprache, der es nicht<br />
primär um die Vermittlung eines Inhalts zu tun ist, sondern in der das Wort selbst zum<br />
Thema wird – en arché en o lògos. In diesem Sinne richten sich meine Bemühungen<br />
darauf, die deutsche Sprache zu verspanischen und sie so – durch diese Ver-fremdung<br />
bereichert – der ,reinen Sprache„ ein Stück näher zu bringen.<br />
Können Übersetzungen alt werden oder wie modern darf ein Klassiker sein? Zum<br />
Phänomen Neuübersetzung<br />
García, Olga<br />
Universidad de Extremadura<br />
Dieser Vortrag befasst sich mit der Mehrdeutigkeit des Begriffs „retranslation“. Dazu<br />
seien zunächst die theoretischen Annäherungen an das Konzept der Neuübersetzung der<br />
Franzosen Berman und Gambier sowie die englischsprachigen Ausführungen von Pym,<br />
Venuti und Chesterman herangezogen. Es werden einige für den Übersetzer und auch<br />
Leser literarischer Werke interessante Aspekte diskutiert werden. Darüber hinaus gilt es,<br />
andere Aspekte, die direkten Bezug zum Begriff der Neuübersetzung haben, etwa das<br />
„Veraltern von Übersetzungen“ oder die „kanonische Übersetzung“, sowie einschlägige<br />
Gründe, die ein Neuübersetzen erfordern, zu untersuchen. Dies alles soll anhand von
Beispielen aus der deutschen Literatur und den entsprechenden Übersetzungen ins<br />
Spanische verdeutlicht werden.<br />
―Man solle einen Autor so übersetzen wie er selbst würde<br />
deutsch geschrieben haben.‖ Von einem Irrglauben bezüglich der Übersetzung<br />
Hennequín Mercier, Jean und Gruhn, Dorit Heike<br />
Sprachenfakultät der Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexiko<br />
Obwohl Friedrich Schleiermacher in seiner Abhandlung “Ueber die verschiedenen<br />
Methoden des Uebersezens” die im Titel zitierte Aussage schon zu Beginn des 19.<br />
Jahrhunderts als absurd entlarvte, ist bis heute der Irrglaube weit verbreitet, dass<br />
Übersetzen bedeute, einen Text so zu verfassen, wie der Autor es selbst getan hätte, wenn<br />
er der Zielsprache mächtig gewesen wäre. Worin besteht das Absurde dieser Vorstellung?<br />
Warum erfreut sie sich immer noch so groβer Beliebtheit, nicht nur unter Laien, sondern<br />
selbst unter professionellen Übersetzern? Und welches Konzept kann ihr<br />
entgegengestellt, d.h. wie kann dem komplexen Phänomen des Übersetzens besser<br />
Rechnung getragen werden?<br />
Diese Fragen werden uns in dem Vortrag beschäftigen. Den Versuch, einige Elemente zu<br />
ihrer Beantwortung beizutragen, sollen Beispiele aus mehreren Sprachen und Bereichen<br />
illustrativ unterstützen. Auch die Folgen der theoretischen Betrachtungen für die<br />
Übersetzungslehre sollen mitbedacht werden.<br />
Das Selbstverständnis des Übersetzers im Wandel: die Übersetzungen von O<br />
Mandarin und A Relíquia von Eça de Queirós<br />
Kind, Anette<br />
Departamento de Estudos Germanísticos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto<br />
Der bedeutendste portugiesische Romancier des 19. Jahrhunderts, Eça de Queirós, gehört<br />
im Deutschland des 20. Jahrhunderts zu den meistrezipierten portugiesischen Autoren.<br />
Verschiedene Rezeptionsphasen zeichnen sich durch eine quantitativ und qualitativ<br />
unterschiedliche Gewichtung der publizierten Werke in deutscher Sprache aus.<br />
Den Übersetzer stellt die Übertragung der Werke Eças insofern vor eine besondere<br />
Herausforderung, als dieser entscheidende stilistische Neuerungen in die lusophone<br />
Literatur eingeführt hat, wie Variationen sprachlicher Register, gezielten Einsatz erlebter<br />
Rede, Wortschöpfungen und Neologismen, ganz besonders aber die seinen Stil<br />
auszeichnenden Adjektivierungsprozesse, die sich u.a. in Stellung, Häufung, Synästhesie<br />
und Hypallage manifestieren.<br />
In vorliegendem Beitrag sollen einige Ergebnisse des Forschungsprojekts im Rahmen<br />
meiner Promotion aufgezeigt werden. Exemplarisch werden die Übersetzungen von zwei<br />
Prosatexten Eças untersucht: Der Mandarin und Die Reliquie, denen von Anbeginn der<br />
Eça-Rezeption in Deutschland ein besonderes Interesse der Leserschaft galt, was sich<br />
nicht zuletzt auf das beiden Texten gemeinsame phantastisch-exotische Element
zurückführen lässt. Anhand der verschiedenen zwischen 1918 und 1984 in Deutschland<br />
publizierten Übersetzungen lässt sich ein Wandel der Übersetzungsstrategien beim<br />
Translationsprozess aufzeigen. Es wird nicht nur dargestellt, inwieweit den Übersetzern<br />
der Drahtseilakt gelungen ist, den Eça eigenen Stil in deutscher Sprache wiederzugeben<br />
bzw. die Prozesse spielerischer Wortschöpfungen in der Zielsprache umzusetzen, sondern<br />
es soll auch anhand exemplarischer Analysen von Ausgangs- und Zieltexten<br />
veranschaulicht werden, was die Übersetzungen verschiedener Epochen auszeichnet und<br />
inwiefern sich Prioritäten im Translationsprozess verschoben haben.<br />
An den Grenzen der Übersetzbarkeit von modernen Prosatexten<br />
Münster, Morton<br />
Universidad de Extremadura<br />
Der stark ausgeprägte Sprachskeptizismus in Deutschland, Frankreich, Spanien und<br />
England seit dem 19. Jahrhundert, der sich etwa in der poésie pure, Hofmannsthals Ein<br />
Brief oder Mauthners Schriften zur Sprache widerspiegelt, führt zu einem poetologischen<br />
Umdenken. Um trotz des defizitären Wesens der Sprache mitzuteilen, was sich ihnen<br />
doch eigentlich entzieht, suchen Schriftsteller wie Joyce, Beckett, Hildesheimer, Simone<br />
oder Benet nach neuen Formen in der Literatur, etwa dem nouveau roman. Ihre<br />
innovativen Werke gelten jedoch als weitgehend unübersetzbar. Dabei verlagert die<br />
Poetisierung der Sprache, die zur Erhöhung der Form gegenüber dem Inhalt führt, die<br />
Schwierigkeiten einer Übersetzung. Die Semantik tritt in den Hintergrund, ohne jedoch<br />
belanglos zu werden. Mediale Überlagerungen in der Gestalt von Bild und Musik müssen<br />
berücksichtigt werden. Denn wie übersetzt man am besten aus Finnegans Wake „What<br />
clashes here of wills gen wonts, oystrygods gaggin fishy-gods ! Brékkek Kékkek“?<br />
Allein an diesem Werk haben sich zahlreiche Übersetzer versucht. Ein anderer Fall sind<br />
die Sprachspiele in Hildesheimers Prosa, die sich mindestens in Tynset und Masante in<br />
einen musikalischen Aufbau integrieren. Wie soll man diese Sprachspiele in eine andere<br />
Sprache übertragen, semantische Nuancen und Klangbild berücksichtigen, damit das<br />
Werk seinen musikalischen Charakter nicht verliert? Die hohe Komplexität dieser Art<br />
Literatur erfordert viel Kreativität und Fingerspitzengefühl des Übersetzers, der eine<br />
Balance zwischen Übersetzung und Nachdichtung finden muss. Bei diesem Vortrag<br />
sollen die Schwierigkeiten und Grenzen bei der Übersetzung (bzw. Nachdichtung) von<br />
modernen Prosawerken diskutiert werden.<br />
Sensible Texte und translatorisches Handeln: Die Judenbuche und ihre Übersetzer<br />
Nowinska, Magdalena<br />
Universidade de São Paulo (Brasilien)<br />
Der Vortrag zielt darauf ab, einen Aspekt des translatorischen Handelns zu diskutieren,<br />
nämlich das Verhältnis von Übersetzern zu den von ihnen übersetzten Texten, und geht<br />
dabei der Frage nach, ob und wie sich dieses Verhältnis in den übersetzten Texten
emerkbar macht. Ausgehend vom Modell der echoic translation von Theo Hermans<br />
(2007) stellt der Vortrag das Verhältnis der Übersetzer der Erzählung Die Judenbuche<br />
(1842) von Annette von Droste-Hülshoff zu diesem Text dar. Insbesondere geht es im<br />
Vortrag darum, das Verhältnis der Übersetzer zu einem sensiblen Aspekt der Erzählung<br />
zu diskutieren, nämlich dem von ihr thematisiertem spannungsgeladenen Verhältnis<br />
zwischen der jüdischen und nicht-jüdischen Bevölkerung im Deutschland des 18.<br />
Jahrhunderts. Der Vortrag präsentiert damit Ergebnisse einer von mir gerade<br />
eingereichten Dissertation, die der Frage nachgeht, ob Übersetzer beim Übersetzen eines<br />
"sensiblen Texts" (Simms 1997) die von der translatorischen Ethik geforderte<br />
Objektivität gegenüber dem zu übersetzenden Text bewahren (sollen).<br />
Der Gesang des Coyoten. Mexikanische Geschichten von Chrristoph Janacs. Die<br />
Übersetzung eines interkulturellen Textes<br />
Pacheco Vázquez, María Josefina<br />
Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de Filosofìa y Letras u. Centro de<br />
Enseñanza de Lenguas Extranjeras)<br />
Der österreichische Schriftsteller Christoph Janacs (Linz, 1955) ist mehrmals nach<br />
Mexiko gereist und hat eine grosse Interesse fûr die mexikanische Kultur gezegt,<br />
besonders fûr die Werke von Juan Rulfo. Er veröffentlichte schon verschiedene Titel mit<br />
dem Thema Mexikos: Templo Mayor (Gedichte, 1998), Aztekensommer (Roman, 2001,<br />
Stefan Zweig-Preis der Stadt Salzburg), und die Erzählungen die ich zurzeit Ûbersetze,<br />
Der Gesang des Coyoten. Mexikanische Geschichten, Haymon, 2001. Das Verständnis<br />
der mexikanischen Kultur und Mentálitat ist bei diesen Texten wirklich erstaunlich; bei<br />
der Erzählung „Diegos Totenkopf“ wird, z.B., die grausame Wirklichkeit mit den<br />
Mythen des mexikanischen Fest des Totentages gemischt. Bei einer anderen Erzählung<br />
gibt es auch eine weitere Perspektive, da es einen Dialog mit den Werken von G. G.<br />
Márquez vorgestellt wird. Aber die Mehrheit der Texte hat Mexiko als Zentrum und<br />
Motiv. Einige Kritiker finden, dass die Benutzung von mexikanischen Wörtern bei den<br />
Werken von Janacs exzessiv ist, aber ich verstehe es auch als Provokation: Wir,<br />
lateinamerikanische Leser, haben immer Texte mit europäischen Wörtern (auf<br />
Französisch, Englisch, usw.), ohne Klage gelesen.<br />
Ich habe schon die Hälfte der Erzählungen mit dem Gutacht von Janacs übersetzt, und ich<br />
hoffe, dass ich bald schon das Ganze habe, um eine mexikanische Version des Buches<br />
veröffentlichen zu können. Beim <strong>ALEG</strong> würde ich gerne ûber diesen Prozess sprechen.
Literarische Übersetzung in die Fremdsprache<br />
Muttersprachler der Ausgangssprache vs. Muttersprachler der Zielsprache in der<br />
literarischen Übersetzung<br />
Peña, Irsula Jesús<br />
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)<br />
Die Übersetzung in die Fremdsprache ist eine Aufgabe von auserwählten Sprachmittlern,<br />
von denen man behauptet, sie hätten die genügende Erfahrung und eine hohe<br />
fremdsprachliche Kompetenz. Da es sich um relative bzw. subjektive Bewertungen<br />
handelt, wollen wir uns hier mit dieser Problematik auseinandersetzen. Es ist eine Arbeit,<br />
die sich auf praktischen Beispielen in der Übersetzung von literarischen Texten von<br />
Spanisch ins Deutsche stützt. Wir versuchen folgende Fragen nachzugehen: In wie weit<br />
unterscheiden sich diese Übersetzungen aus dem Spanischen von Übersetzungen des<br />
gleichen Textes, die aber von einem Muttersprachler stammen? Welche Vorteile und<br />
Nachteile haben die Muttersprachler der Ausgangssprache gegenüber der Muttersprachler<br />
der Zielsprache? Wie werden die in Ausgangstext enthaltenen Wahrheiten von beiden<br />
Muttersprachlern in die Zielsprache übertragen? Wie gehen beide mit den interkulturellen<br />
Aspekt um? Die meisten Werke bzw. Anthologien der lateinamerikanischen Literatur<br />
sind von deutschsprachigen ins Deutsche übersetzt worden. Wäre nicht denkbar, sogar<br />
empfehlenswert die Bildung von Übersetzerduos von spanisch- bzw.<br />
portugiesischsprechenden für die Bewältigung der Literaturen unserer Sprachregionen?<br />
Lehrbücher für die Lehre der Translatologie?/ ¿Libros de texto para la enseñanza<br />
de la traductología?<br />
Pino Madroñal, Lucía Orquídea<br />
Fremdsprachenfakultät Universität Havanna<br />
Die Ausbildung im Bereich Translatologie unterscheidet sich von einem Ausbildungsort<br />
zum anderen, von Land zu Land, von Erdteil zu Erdteil. Das ist die Konsequenz von<br />
verschiednen Marktpräferenzen, den Eigenheiten der Studierenden, der Tradition bei der<br />
Ausbildung der entsprechenden Ausbildungsstätte u. ä.<br />
Die Lehrpläne der verschiedenen Ausbildungsstätten für Übersetzer und Dolmetscher<br />
stimmen aber in bestimmen Fächern überein. Sie behandeln unter anderem Fragen zur<br />
Geschichte der Translatologie, das Übersetzen und Dolmetschen von verschiedenen<br />
Textsorten mehrerer Textklassen und Fachbereiche, Theorie und Praxis der Translation,<br />
kontrastive Studien in ausgewählten Sprachen, Terminologie, EDV-gestützte Werkzeuge<br />
etc.<br />
In den bibliographischen Angaben jener Lehrpläne erscheinen aber sehr wenige<br />
Materialien, die als Lehrbücher betrachtet werden können. In dem Sprachenpaar Deutsch<br />
– Spanisch werden meist die Bücher von Amparo Hurtado Albir „Traducción y<br />
Traductología“ sowie „Enseñar a Traducir“ und von Christiane Nord „Lernziel:<br />
Professionelles Übersetzen Spanisch – Deutsch“ oder auch das „Handbuch Translation“<br />
von einem Autorenkollektiv genannt.<br />
Die Liste könnte um drei oder vier neuere Titeln erweitert werden. Verfügen wir aber in<br />
unseren jeweiligen Ausbildungsstätten über Lehrbücher für die Ausbildung in
Translatologie, die den oben genannten Bedürfnissen entsprechen? Wenn ja, wie werden<br />
jene linguistischen, textuellen, sozialen und interkulturellen Fragen behandelt? Welche<br />
und wie viel Theorie sollen sie enthalten? Auf diese und ähnliche Fragen werde ich in<br />
meinem Beitrag eingehen.<br />
La enseñanza de la traductología difiere de un centro formador a otro, de un país a otro, y<br />
por supuesto de un continente a otro. Esto responde a cuestiones tales como preferencias<br />
del mercado, características del alumnado, tradición en la formación entre otras.<br />
Los currículos de las diferentes instituciones formadoras coinciden sin embargo en toda<br />
una serie de materias, se incluye en cierta medida aspectos de la historia de la<br />
translatología, Traducción e interpretación de diferentes tipos de textos de diversos<br />
géneros y materias, Teoría y práctica de la traslación, Estudios comparativos entre pares<br />
de lenguas, Terminología, Herramientas informáticas para la traducción, etc. No obstante,<br />
en la bibliografía de estos programas aparecen muy contados materiales que podrían<br />
asumirse como un tipo de libros de texto para la enseñanza de nuestra ciencia. En el par<br />
de lenguas español-alemán se consignan por ejemplo Traducción y Traductología de<br />
Amparo Hurtado Albir, Enseñar a Traducir de la misma autora, Lernziel: Professionelles<br />
Übersetzen Spanisch-Deutsch de Christiane Nord, también de esta autora, Handbuch<br />
Translation de un colectivo de autores. La lista podría ampliarse a tres o cuatro libros más<br />
o menos recientes, pero ¿contamos con libros de texto para la enseñanza de la<br />
traductología en nuestros centros de estudio que respondan a las necesidades de<br />
formación arriba mencionadas? De ser así ¿cómo se insertan estos elementos lingüísticos,<br />
textuales, sociales e interculturales? ¿Hasta dónde y qué teoría deben abarcar? Sobre<br />
estas y otras interrogantes reflexionaremos en nuestra contribución.<br />
Duineser Elegien — Original und Übersetzung als transkulturelle Identifikation der<br />
Moderne bei Paulo Plínio Abreu (1950er Jahre, Belém) und Augusto de Campos<br />
(1990er Jahre, São Paulo).<br />
Pressler, Gunter Karl<br />
Universidade Federal do Pará (UFPA)<br />
Bekanntlich gibt es keine geschichtlich-kulturelle Äquivalenz zwischen zwei Ländern<br />
verschiedener Sprachen, auf verschiedenen Kontinenten und unter Berücksichtigung<br />
kolonialistischer Verhältnisse. Unser Beitrag fragt nicht nur ob mit der Rezeption der<br />
Poesie von Rainer Maria Rilke (1875-1926) ein bestimmtes Deutschlandbild mitgeteilt<br />
wurde oder entstand, sondern auch, inwieweit ein solches bei Lyrikübersetzung ein Rolle<br />
spielt. Die Studie zielt auf zwei translationswissenschaftliche Schwerpunkte: als<br />
Verständigungswissenschaft weckt sie hermeneutische Interessen (Subjekt-Objekt-<br />
Verhältnis), die ohnehin bei literarischen Übersetzungen elementar wichtig sind, zweitens<br />
geht es auch um “hierarchisch strukturierte Ortungen” (H.Kalverkämpers, 2009) im<br />
interkulturellen Rezeptionsvorgang, die im kreativen Prozess des Schreibens in einem<br />
bestimmten sozialpolitischen Umwelt zu berücksichtigen sind. Beide Übersetzer sind<br />
Poeten aus verschiedenen Regionen Brasiliens (Amazonien und São Paulo) und in<br />
verschiedenen Geschichtsepochen. Gemeinsam ist die Aktualisierung/Problematisierung
der Moderne: obwohl oder gerade angesichts eines ökonomischen (nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg) und politischen Niedergangs (Militärdiktatur), neue Generationen von<br />
Intelelektuellen und Künstlern entdecken das Werk Rilkes als poetische Referenz. Die<br />
Duineser Elegien gehören zu den “schwierigsten Texte der deutschen Literatur [...] neue<br />
Wortkombinationen, die die deutsche Sprache erlaubt, aber im Grunde nicht übersetzt<br />
werden können”. Rilke gehöre in eine Epoche des Übergangs (transição), in der “der<br />
Dichter nicht mehr poetisch im traditionellen Sinne zu denken wuβte [...] und an die<br />
linguístische Grenze des Sagbaren stieβ“(Abreu, 2008). Dieser Herausforderung, stellte<br />
sich der konkretistische Dichter Augusto de Campos: “I like Rilke”. Die poetische<br />
Sprache erreicht die Grenze der visuellen Wahrnehm- und Übersetzbarkeit. “Nur<br />
manchmal schiebt der Vorhang der Pupille/Sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein”<br />
(Rilke, 1907).<br />
Ist alles eine Reaktion auf Dada?<br />
Romão, Tito Lívio Cruz<br />
DLE/Universidade Federal do Ceará - PGET/Universidade Federal de Santa Catarina<br />
Im Jahre 2006 ließ der Schweizer Schriftsteller Peter K. Wehrli, der jahrelang als<br />
Kulturjournalist beim Schweizer Fernsehen tätig war und etwa durch seine Werke<br />
Katalog von Allem und El Catálogo Latinoamericano bekannt wurde, den Text Alles ist<br />
eine Reaktion auf Dada ins Portugiesische übersetzen. Der Text, der in Zürich abgefasst<br />
wurde, sollte von einem Übersetzer im nordostbrasilianischen Fortaleza ins<br />
Portugiesische übertragen werden und im mosambikanischen Maputo erscheinen. Der<br />
Übersetzer fertigte zuerst eine brasilianische Fassung des Ausgangstextes an, die in der<br />
Folge in eine „neutrale“ europäisch-portugiesische Version umzuschreiben wäre. Es gäbe<br />
nämlich brasilianische Wörter, die ersetzt sowie Rechtschreibdetails, die adaptiert werden<br />
sollten. Dies führte zu einem regen E-Mail-Austausch zwischen dem Autor und dem<br />
Übersetzer, der aufschlussreich und für beide Handelnde bereichernd war. Aus der<br />
Korrespondenz konnten u.a. folgende Erkenntnisse abgeleitet werden: a) der Originaltext<br />
bereitete dem Übersetzer Schwierigkeiten eher im Bereich der Kulturspezifik (und nicht<br />
etwa der Semantik bzw. Lexik); b) im Vergleich zwischen Ausgangstext und Zieltext<br />
konnte auf der semantischen Ebene festgestellt werden, wie manche Begriffe im<br />
zielsprachlichen Text an Bedeutung verloren bzw. gewonnen haben; c) durch den<br />
Ideenaustausch mit dem Autor konnte der Übersetzer durch konkrete Beispiele begreifen,<br />
wie sich dieser Übersetzungs- bzw. Kommunikationsprozess von der eher „normalen“<br />
Übersetzungsprozedur unterscheidet, bei der der Übersetzer keinen Kontakt zu dem<br />
Autor des Ausgangstextes hat. Mit diesem Kurzvortrag wird somit Einblick in Teile des<br />
o.g. E-Mail-Austauschs gewährt, so dass ausgehend von anschaulichen Beispielen eruiert<br />
wird, wie hilfreich und entscheidend der Dialog zwischen Übersetzer und Autor zu einem<br />
„störungsfreieren“ Übersetzungsablauf bzw. –ergebnis sein kann.
h h hi i . Probleme beim Über etzen von Ann Segher ‘ A fl g der<br />
toten Mädchen ins Spanische.<br />
Schulte, Klaus<br />
Universität Roskilde (Dänemark)<br />
Der Beitrag entsteht unter maßgeblicher Mitarbeit von Dr. Peter Jehle, Berlin,<br />
Mitherausgeber der Zeitschrift Das Argument und des Historisch Kritischen Wörterbuchs<br />
des Marxismus.<br />
Analysen des spezifischen Textverfahrens in Anna Seghers Exilerzählung Der Ausflug<br />
der toten Mädchen haben gezeigt, dass die Erfahrung eines Kulturzusammenstoßes,<br />
ausgelöst durch den erzwungenen Aufenthalt der Autorin im mexikanischen Exil, in<br />
diesem Text nicht nur thematisch ist, sondern eher noch in der literarischen Methode der<br />
Darstellung selber ihren genuinen ästhetischen Niederschlag findet. Wie genau die<br />
jeweiligen Leser sich gerade auf die hieraus resultierende konkrete Sprachgestalt<br />
einlassen, die die unabweisbare Rezeptionsvorgabe jeder Lektüre ist, entscheidet deshalb<br />
über die Angemessenheit dieser oder jener aus der Vielzahl von Lesarten dieser 1944<br />
(zuerst auf Spanisch!) erschienenen Erzählung, die zu einem der meist rezipierten<br />
Werken der deutschsprachigen Exilliteratur werden sollte. Für den besonderen<br />
Rezeptionstyp ‚Übersetzung„ ergeben sich hierbei jeweils zielsprachenspezifische<br />
Herausforderungen für Versuche, die kommunikationsstrategische Funktion derjenigen<br />
auch in der deutschen Ausgangssprache ungewöhnlichen sprachlichen Operationen der<br />
Zeit-, Orts- und Persondeixis angemessen zu berücksichtigen, denen die Erzählung das<br />
besondere Wirkungspotential verdankt, das ihre rezeptionsgeschichtlich erwiesene<br />
‚Haltbarkeit„ erklären mag.<br />
In Fortsetzung einschlägiger Untersuchungen zu Übersetzungen der Erzählung ins<br />
Dänische (Schulte 2004) und ins Französische (Roussel/Schulte 2007) wird der<br />
beabsichtigte Beitrag ausgewählte Passagen aus vier verschiedenen Übersetzungen ins<br />
Spanische miteinander vergleichen; dabei wird verdeutlicht, wie die jeweiligen<br />
Übersetzer auf die Schwierigkeiten reagieren, die sich u.a. aus den Unterschieden<br />
zwischen den Tempussystemen des Deutschen und des Spanischen ergeben. Der<br />
vergleichende Blick durch das Prisma der Übersetzungen auf den Originaltext trägt<br />
gleichzeitig zur genaueren Erkenntnis des in ihm realisierten Textverfahrens und damit<br />
der potentiellen Wirkungsweise seiner wichtigsten rezeptionsleitenden Elemente bei.<br />
Dolmetschen im Fremdsprachenunterricht- Rechtfertigung und<br />
Anwendungsbeispiele<br />
Sperr, Ulrike<br />
Universidad de las Américas Puebla<br />
In diesem Vortrag wird zunächst ein kurzer Überblick über die Verwendung des<br />
Übersetzens und Dolmetschens im Fremdsprachenunterricht (FSU) unter<br />
Berücksichtigung der verschiedenen methodischen Ansätze gegeben. Zu Zeiten der<br />
Grammatik-Übersetzungsmethode erreichte sie ihren Höhepunkt, wenig später schon<br />
wurde sie z.B. durch die audiovisuelle und die Direkte Methode völlig aus dem FSU
verdrängt. In Methoden wie der Suggestopädie und der Zweisprachigen Methode tauchte<br />
sie erneut auf, doch erst seit kurzem wird wieder ernsthaft über ihren Nutzen im FSU<br />
diskutiert, was darin gipfelte, dass einige Experten ihr sogar den Stellenwert einer fünften<br />
Fertigkeit (neben den vier Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen)<br />
zusprechen. Auch der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR)<br />
befürwortet die Sprachmittlung (d.h., das Übersetzen und Dolmetschen) als eine<br />
wichtige Teilkompetenz der Sprachenlerner. Durch den enormen Einfluss des GeR auf<br />
den lateinamerikanischen FSU i.A. ergibt sich die Frage, in wieweit auch der DaF-<br />
Unterricht in Mexiko hinsichtlich dieser Tendenz tranformiert werden könnte bzw. schon<br />
wird. Konkret heiβt das, dass schon im Anfängerunterricht spezifische Übungen integriert<br />
werden können, die die Grundlagen für eine sprachmittelnde Kompetenz bilden können<br />
ohne jegliche negative Auswirkungen auf die linguistische produktiven sowie rezeptiven<br />
Fertigkeiten in der Fremsprache zu haben. Es werden die Vor- und Nachteile, Chancen<br />
und Gefahren und neue Tendenzen des Übersetzens und Dolmetschens im FSU<br />
diskutiert, konkrete Anwendungsbeispiele erwähnt und über persönliche Erfahrungen mit<br />
dem Übersetzungs- und Dolmetschunterricht für fortgeschrittene Englisch- und<br />
Spanischlerner berichtet.
Biographische Angaben zu den Referenten der Sektion 10:<br />
Bahr, Christian<br />
- geb. 1982 in Jena<br />
- 2003-2009: Studium Diplom-Übersetzen (Spanisch, Französisch) an der<br />
Universität Leipzig, mit Auslandssemestern in Havanna und Genf<br />
- seit 2010: wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Iberoromanische Sprach-<br />
und Übersetzungswissenschaft des Instituts für Angewandte Linguistik und<br />
Translatologie der Universität Leipzig<br />
Boehm, Siegfried<br />
Der Referent ist seit 26 Jahren an der Deutschabteilung des Sprachenzentrums der<br />
FES Acatlán, UNAM tätig. Im Jahre 1992 hat er eine Übersetzerausbildung am El<br />
Colegio de México beendet, wo er später auch Übersetzungsunterricht erteilt hat.<br />
Außer dem DaF-Unterricht hat er Fremdsprachendidaktik in Letras Modernas an der<br />
Fakultät Filosofía y Letras gelehrt und derzeit ist er Tutor für zwei „Online-Fächer“<br />
der Licenciatura de Enseñanza de Lenguas (LICEL) an der FES Acatlán. Er ist Autor<br />
von zwei Lesekursen, einem Handbuch des Studienfachs „Bräuche und Kultur der<br />
deutschsprachigen Länder“ (LICEL), dem Buch La didáctica teatral como medio para<br />
lograr una sensibilidad intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras sowie<br />
von zahlreichen Artikeln und Aufsätzen im Bereich der Fremdsprachenforschung<br />
und Übersetzung. Zur Zeit arbeitet er am Projekt „Diplomado de traducción“ am<br />
Sprachenzentrum der FES Acatlán, UNAM mit.<br />
Garbe, Susanne<br />
2011 Dozentin für Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Concepción<br />
2011 Aufnahme einer Dissertation in romanistischer Medien- und<br />
Kulturwissenschaften<br />
2009-2011 Mitarbeit im Team der Internationalen Friedensschule Köln:<br />
wissenschaftliche Supervision des bilingualen Sprachkonzepts<br />
2006-2011 Mitarbeit im Gleichstellungsamt der Universität Düsseldorf: Marketing und<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
2004-2011 Diplomstudiengang Literaturübersetzen (Anglistik, Romanistik,<br />
Germanistik), Abschluss: Ø 1,2<br />
2010 Deutschlehrerin für Deutsch als Fremdsprache und Übersetzerin in der bilingualen<br />
Privatschule Insituto Gutenberg Mar del Plata, Argentinien<br />
2010 mehrmonatiger Studienaufenthalt in Spanien (Forschungsprojekt Walter Benjamins<br />
Theorie der ,reinen Sprache‟ und Sprachtraining)<br />
2009-2010 mehrmonatiger Studienaufenthalt in Peru (Forschungsprojekt Walter<br />
Benjamins Theorie der ,reinen Sprache‟ und Sprachtraining)<br />
2009 Wissenschaftliche Assistenz bei einer Doktorarbeit der Universität Köln, Thema:<br />
Bilingualität deutscher Kinder im Ausland<br />
2008 Übersetzung des Fotobildbands Teheran von Reza Nadji<br />
2007-2008 Mentee im Programm Net.Work21 – Leben und Arbeiten in der<br />
transkulturellen Gesellschaft (Team- und Individualcoaching)<br />
2006/2008 Praktika im Europäischen Übersetzungsinstitut
2007 Scheunemann-Stipendium und mehrmonatiges Praktikum in einer<br />
Übersetzungsagentur auf Ibiza<br />
García, Olga<br />
Studium der Germanistik und Übersetzungswissenschaft an der Universität Complutense<br />
Madrid. Übersetzerin bei Institutionen und Verlage; Lehrtätigkeiten an Universitäten in<br />
Spanien, Costa Rica und Slowenien. Derzeit Prof. für Deutsche Kulturgeschichte und<br />
Literatur an der Universität Extremadura. Leiterin des Instituts für Moderne Sprachen<br />
und Komparatistik. Essayistin und Übersetzerin literarischer Werke aus dem Deutschen.<br />
Hennequín Mercier, Jean<br />
Studium der Germanistik an der Universität Besançon, Frankreich, ist Dozent und<br />
Forscher an der Sprachenfakultät der Benemérita Universidad Autónoma de Puebla und<br />
professioneller Übersetzer. Er ist Autor des übersetzungstheoretischen Werks En busca<br />
de la piedra traductorial, des Werks La sociolingüística: ¿qué es? ¿para qué sirve?<br />
sowie Redaktionsleiter der Zeitschrift Lenguas en contexto (BUAP). Auβerdem hat er<br />
diverse Artikel über Übersetzungstheorie in verschiedenen akademischen Zeitschriften<br />
verfasst.<br />
Gruhn, Dorit Heike<br />
Dorit Heike Gruhn hat in Deutschland eine Ausbildung zur staatlich geprüften<br />
Übersetzerin absolviert und anschlieβend deutsche Literatur und<br />
Erziehungswissenschaften studiert. Gegenwärtig lehrt sie an der Sprachenfakultät der<br />
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla und arbeitet auβerdem als “perito<br />
traductor”. Sie ist Koautorin eines deutschsprachigen Reiseführers über Mexiko, hat<br />
diverse Veröffentlichungen im akademischen Bereich und fungiert als Sekretärin des<br />
Mexikanischen Deutschlehrerverbands.<br />
Kind, Anette<br />
1989 Licenciatura em Estudos Portugueses e Alemães an der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät der Universität Porto<br />
1991 Post-Graduierung in Übersetzung Deutsch-Portugiesisch an der<br />
Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Porto<br />
1997 Mestre em Estudos Alemães durch die Faculdade de Ciências Sociais e Humanas<br />
da Universidade Nova de Lisboa<br />
Seit 1990 Lektorin für Deutsch an der der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der<br />
Universität Porto. Arbeitsschwerpunkte: DaF, Übersetzung, Didaktik.<br />
Seit 2009: Doktorandin in Übersetzung (Universität Porto)<br />
Münster, Morton<br />
Morton Münster, Erststudium der Romanischen Philologie und Linguistik des Deutschen<br />
an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen von 2002 bis 2007 mit dem Abschluss<br />
Magister Artium. Zusatzstudium der Philosophie ebenfalls in Tübingen. Seit 2005 Freier<br />
Übersetzer und seit 2007 Lektor für Deutsche Philologie an der Universidad de<br />
Extremadura. Promotionsvorhaben im Cotutelleverfahren zwischen den Universitäten<br />
Tübingen und Extremadura seit 2008 mit dem Arbeitstitel „Das Unsagbare sagen. Ein
phänomenologischer Vergleich von Wolfgang Hildesheimers Masante und Tynset, Juan<br />
Benets Herrumbrosas lanzas und Mia Coutos Estórias abensonhadas“.<br />
Nowinska, Magdalena<br />
Studium der Geschichte, Slawistik und Anglistik an der Universität Regensburg und an<br />
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland. Studienaufenthalt an der<br />
Universität Leicester, England. M.A. in Osteuropäischer Geschichte. Promotion im<br />
Bereich der Übersetzungswissenschaft an der Universität São Paulo, Brasilien.<br />
Pacheco Vázquez, María Josefina<br />
Josefina Pacheco ist 1974 in Mexiko Stadt geboren. Sie studierte Germanistik an der<br />
Fakultät für Geisteswissenschaften der UNAM. Ihre Abschlussarbeit war die<br />
kommentierte Übersetzung ins Spanische des Romans Die Nachtwachen des<br />
Bonaventura. Um diese Übersetzung zu machen, hatte sie ein Stipendium des Fondo<br />
Nacional para la Cultura y las Artes; das Werk wurde 2003 veröffentlicht<br />
(México,CNCA, 2003, Clásicos de hoy). Sie hat auch Theaterstücke von Hans Sachs<br />
(Piezas de carnaval,Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura, 2005) und den Roman<br />
Lucinde, von F. Schlegel (Siglo XXI, 2008) u. a. Werke, auch ins Spanische übersetzt<br />
und veröffentlicht.<br />
Josefina Pacheco war Stipendiatin des DAAD beim Sonderprogramm für<br />
lateinamerikanische Germanisten (Albert-Ludwigs Universität Freiburg, 2003) und<br />
arbeitete als Lektorin der UNAM (2008-2009) an der Karl-Framzens Universität in Graz,<br />
Österreich. Frau Pacheco hat zahlreiche Vorträge in Mexiko und in anderen Ländern<br />
gehalten. Zurzeit unterrichtet sie Übersetzung an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät,<br />
an der UNAM, und DaF am Sprachzentrum (CELE) derselben Universität.<br />
Peña, Irsula Jesús<br />
1969-1973 Deutschlehrerstudium (Mittelstufe) Fremdspracheninstitut „Maxim Gorki“,<br />
Havanna.<br />
1973 – Sommerkurs für Germanistikstudenten, Universität Rostock<br />
Kurs für Deutschunterricht mit der Methode „Guten Tag Berlin“, Humboldtuniversität<br />
1973 – 1975 Deutschlehrer im Institut für Dolmetscher und Übersetzer „Paul Lafargue“,<br />
Havanna<br />
1975 -1979 Studium der Germanistik an der Universität Leipzig<br />
1979 -1983 Dozent an der Pädagogischen Hochschule für Fremdsprachen „Paul<br />
Lafargue“, Havanna<br />
1982- 6 Monatiger Weiterbildungskurs für Deutschlehrer an der Universität Potsdam.<br />
IWS Brandenburg.<br />
1983 – 1994 Übersetzer und Simultandolmetscher im ESTI. Fremdsprachendienst des<br />
Ministerrates der Republik Kubas.<br />
1998 – 1992 Promotion im Bereich der Komparativen Linguistik Deutsch – Spanisch.<br />
Dr. Phil mit dem Thema Substantiv – Verbkollokationen, Universität Leipzig.<br />
1994 – 1999 Direktor für Internationale Beziehungen der UNEAC (Schriftsteller- und<br />
Künstlerverband Kubas.<br />
Ab 2000 freischaffender literarischer Übersetzer, Fachübersetzer und Dolmetscher und<br />
Reiseleiter
Pino Madroñal, Lucía Orquídea<br />
Otros títulos: Germanista Diplomada<br />
Formación en Traducción e Interpretación<br />
Categoría docente: Prof. Titular<br />
Labor que desempeña: Profesora de traducción<br />
Líneas de investigación que desarrolla y las tres investigaciones más importantes<br />
realizadas en los últimos cinco años:<br />
Recursos lingüísticos para la expresión del mandato en un texto directivo<br />
La lingüística del texto y su aplicación en la enseñanza de la traducción a filólogos<br />
Acerca de la Audiodescripción<br />
Cognición y traducción<br />
Asignaturas que habitualmente imparte: Pre-grado: Traducción I y II, Gramática<br />
Alemana I y II, Traducción Asistida por computador<br />
Postgrado: Tópicos de Traductología<br />
Últimas publicaciones:<br />
Actas del XIII Congreso de la <strong>ALEG</strong>. Córdoba, Argentina (2009) Cruzando fronteras<br />
sensoriales: La audiodescripción.<br />
Traducción de tres artículos de Albrecht Neubert, que aparecerán en el 2011 en la serie<br />
“Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation“,<br />
Peter Lang Verlag: La Escuela Traductológica de Leipzig: sus inicios, su credo y su<br />
florecer (1965-1985).<br />
Otros: Presidenta del Congreso de la <strong>ALEG</strong>, La Habana, 2006<br />
Pressler, Gunter Karl<br />
Geb. 1951 in Delmenhorst (Niedersachsen). Nach Berufsausbildung und Zweitem<br />
Bildungsweg (Westfalen Kolleg/Paderborn) Studium der Neueren Deutschen<br />
Literaturgeschichte, Theaterwissenschaft und Philosophie in München und Neapel<br />
(Magister; Veröffentlichung 1998). Wissenschaftsjournalismus und Kongressorganisation<br />
(“Geist und Natur”, 1988 in Hannover; Theaterfestival 1980/82/84/87 in München und<br />
Stuttgart). Promotion an der Universität von São Paulo (USP) über die Rezeption Walter<br />
Benjamins in Brasilien (Veröffentlichung 2006). Sprachlehrer am Goethe-Institut und am<br />
brasilianischen Auβenministerium in Brasilia. Seit 1996 Hochschuldozent für<br />
Literaturtheorie an der Universität in Belém (UFPA) in der Graduation und in zwei<br />
Magisterstudiengängen. Forschungsgebiete: Handlungs- und Erzählteorie, Hermeneutik,<br />
Moderne, Rezeptions- und Übersetzungstheorie. Letzte Buch und<br />
Zeitschriftpublikationen: “De Marajó para o Mundo: a Cidade dos Sonhos”. Revista de<br />
História (Rio de Janeiro, 2011), “Amazoniens gröβter Romanautor Dalcídio Jurandir und<br />
die Welt des Marajó-Archipels” In: Amazonien. Weltregion und Welttheater. Berlin und<br />
São Paulo (2010), “Benjamin in der Perspektive der Konkreten Poesie (Brasilien)”<br />
(Pisa/Roma, 2009).<br />
Romão, Tito Lívio Cruz<br />
Dozent an der Universidade Federal do Ceará (Deutsche Sprache und Kultur sowie<br />
Übersetzungswissenschaft); vereidigter Übersetzer und Dolmetscher; verschiedene
übersetzte Artikel und Bücher (z.B.: Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, von<br />
Ottfried Höffe, Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles, von Hans-Georg<br />
Gadamer, und Legalität und Legitimität, von Carl Schmitt)<br />
Schulte, Klaus:<br />
Klaus Schulte, geb. 1946, studierte 1966 – 1971 Germanistik, Philosophie, Allgemeine<br />
und Vergleichende Literaturwissenschaften an der Freien Universität (West)Berlin,<br />
anschließend dort Teilzeitassistent und Projektforscher. 1975 associate professor für<br />
Deutsch und Interkulturelle Studien/Cultural Encounters (seit 2000), Universität<br />
Roskilde, Dänemark. Lehr- und Forschungsgebiete: Literaturwissenschaft; deutsche<br />
Literatur- und Kulturgeschichte im internationalen Kontext, speziell Geschichte der<br />
deutschsprachigen Exilliteratur; deutsche Landeskunde und Geschichte der deutschdänischen<br />
Kulturbeziehungen; Kulturtheorie und Kulturgeschichte Europas;<br />
Globalisierung, Ethnizität und Nation; (Neo)Rassismus und Antisemitismus; Theorie,<br />
Kritik und Praxis literarischer Übersetzung. (zu Letzterem vgl. u.a.: Schulte, Klaus,<br />
Hrsg.: (2004): Anna Seghers: Et Rejsemøde og andre fortællinger. Roskilde: Batzer &<br />
Co. (dänischspr. Nachwort, S.149-175); Roussel, Hélène. & Klaus Schulte (2007): Exil,<br />
Textverfahren und Übersetzungsstrategie. ‚Der Ausflug der toten Mädchen’ von Anna<br />
Seghers im Prisma verschiedener Übertragungen, vornehmlich ins Französische. In:<br />
Krohn, Claus-Dieter et. al. (Hrsg.), Mitarbeit Michaela Enderle-Ristori: Übersetzung als<br />
transkultureller Prozess. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch (25), (S. 90 – 111)<br />
München: edition text + kritik)<br />
Sperr, Ulrike<br />
1999 Beendung der Studiengänge Diplom-Übersetzer und Diplom-Dolmetscher an der<br />
Universität Leipzig mit Anglistik als Hauptfach, Hispanistik und Journalistik als<br />
Nebenfächer, sowie eines Spezial-Zertifikats als Simultan-Dolmetscherin für Englisch<br />
und Spanisch. 1999-2000 Hospitations- und Unterrichtspraktikum für Deutsch als<br />
Fremdsprache am Departamento de Lenguas Modernas der Universidad de Guadalajara,<br />
gefördert vom DAAD, Lehrkraft am Goethe-Institut in Guadalajara, Arbeit als<br />
Übersetzerin und Dolmetscherin für Deutsch und Spanisch. 2000 Beendung des<br />
Aufbaustudiums Deutsch als Fremdsprache am Herder-Institut der Universität Leipzig.<br />
Teilnahme als Referentin und Assistentin an Kolloquien und Kongressen über<br />
Übersetzen, Linguistik, Fremdsprachenlehren und autonomes Lernen. Seit 2000<br />
Vollzeitdozentin, 2001-2008 Koordinatorin der Deutschabteilung der Universidad de las<br />
Américas- Puebla, 2008-2010 Koordinatorin des Sprachlernzentrums der Universidad de<br />
las Américas- Puebla, seit 2010 Koordinatorin für Drittsprachen, Universidad de las<br />
Américas Puebla. Seit Mai 2009 Beisitzerin im Vorstand des Mexikanischen<br />
Deutschlehrerverbands AMPAL. Organisation einiger Linguisten- und DaF-Kongresse.