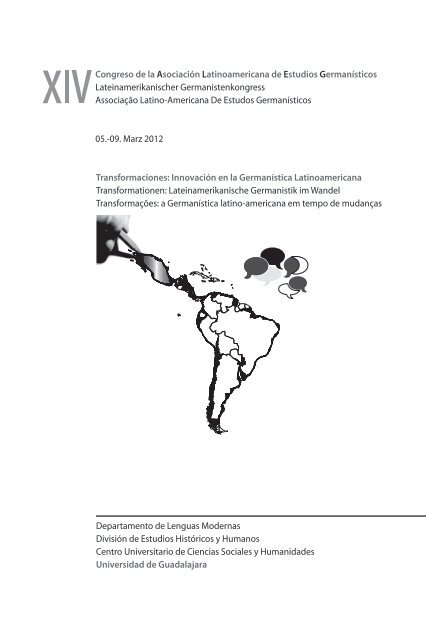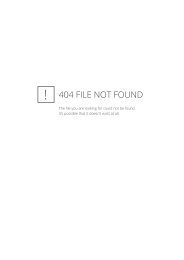detailliertes Programm - ALEG
detailliertes Programm - ALEG
detailliertes Programm - ALEG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Lateinamerikanischer Germanistenkongress<br />
Associação Latino-Americana De Estudos Germanísticos<br />
05.-09. Marz 2012<br />
Transformaciones: Innovación en la Germanística Latinoamericana<br />
Transformationen: Lateinamerikanische Germanistik im Wandel<br />
Transformações: a Germanística latino-americana em tempo de mudanças<br />
Departamento de Lenguas Modernas<br />
División de Estudios Históricos y Humanos<br />
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades<br />
Universidad de Guadalajara
Organisation v Organización<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Vorstand <strong>ALEG</strong><br />
Mesa directiva <strong>ALEG</strong><br />
<strong>ALEG</strong>-Mitorganisatorin<br />
Asistente de organización<br />
Organisationskommitee<br />
Comité organizador<br />
Graphisches Design<br />
Diseño Gráfico<br />
Kooperationspartner<br />
Instituciones<br />
colaboradoras<br />
2<br />
Dra. Olivia C. Díaz Pérez, Präsidentin / Presidenta<br />
Prof. Dr. Paulo Soethe, Vizepräsident / Vice-Presidente<br />
Dr. Florian Gräfe, Schatzmeister / Tesorero<br />
Mtra. Katharina Herzig, 1. Sekretärin / 1a. Secretaria<br />
Dra. Adriana R. Galván Torres, 2. Sekretärin / 2a. Secretaria<br />
Ulrike Pleß<br />
Olivia C. Díaz Pérez, Diana Rode, Luz María Enriquez Méndez, Florian Gräfe,<br />
Katharina Herzig, Florian Hruby, Adriana R. Galván Torres, Yolanda Gpe. García<br />
Cabrera, Valentina Janisch, Esmeralda Lizárraga Chávez, Giovanna del Carmen<br />
Lozano Ramos, Ulrike Pleß, Sabrina Sadowski, Paulo Soethe, Russy Vázquez<br />
Fregoso, Anna Wenzel<br />
Verónica Segovia<br />
l Universidad de Guadalajara<br />
l Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades<br />
l División de Estudios Históricos y Humanos<br />
l Departamento de Lenguas Modernas<br />
l Lehrstuhl Cortázar / Cátedra Julio Cortázar – Universidad de Guadalajara<br />
l Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)/ Servicio Alemán de<br />
Intercambio Académico<br />
l Deutsche Botschaft Mexiko / Embajada de la República Federal de<br />
Alemania en México<br />
l Goethe-Institut / Instituto Goethe<br />
l Österreichisches Kulturforum Mexiko / Foro Cultural de Austria<br />
l Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur /<br />
Ministerio Federal para la Educación, el Arte y la Cultura de Austria<br />
l Mexikanischer Deutschlehrerverband / Asociación Mexicana de<br />
Profesores de Alemán (AMPAL)<br />
l Stiftung Alexander von Humboldt (AvH) / Fundación Alexander von<br />
Humboldt<br />
l Kulturarbeit UdeG / Cultura UdeG
Begrüßungsworte v Palabras de bienvenida<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Estimados participantes del congreso:<br />
En nombre del comité organizador tenemos el gusto de darles la más cordial bienvenida<br />
al XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos con<br />
sede en la ciudad de Guadalajara. Es un gran honor para nuestra Universidad y nuestra<br />
ciudad tener la oportunidad de recibir a tan importante comunidad de Germanistas<br />
provenientes de más de 25 países.<br />
Durante los próximos 5 días nos espera un trabajo muy intenso y un programa<br />
muy prometedor. Esperamos que las 10 secciones programadas les ofrezcan la oportunidad<br />
de establecer un intensivo intercambio académico con colegas de diferentes<br />
países tanto de habla alemana como de Latinoamérica. Gracias al apoyo de importantes<br />
instituciones tendrán también la posibilidad de disfrutar un variado y muy interesante<br />
programa cultural, así como también la opción de acompañarnos a las excursiones organizadas<br />
a los alrededores de Guadalajara.<br />
Les deseamos una agradable estancia en Guadalajara y un interesante congreso.<br />
La mesa directiva de <strong>ALEG</strong> 2009-2012<br />
Liebe Kongressteilnehmer,<br />
im Namen des Organisationskomitees möchten wir Sie herzlich zum XIV. Kongress<br />
des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes in Guadalajara begrüßen. Es ist eine<br />
große Freude sowohl für unsere Universität als auch für unsere Stadt, so viele Germanisten<br />
aus mehr als 25 Ländern empfangen zu dürfen.<br />
Während des <strong>ALEG</strong>-Kongresses werden Sie innerhalb der zehn Sektionen, innerhalb<br />
der Plenar- und Semiplenarvorträge und der Workshops sicher die Gelegenheit zu einem<br />
intensiven fachlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen<br />
lateinamerikanischen und den deutschsprachigen Ländern haben und einige<br />
Anregungen mitnehmen.<br />
Dank der großzügigen Unterstützung von mexikanischen und deutschen wie auch<br />
österreichischen Organisationen können wir Ihnen ein interessantes kulturelles Rahmenprogramm<br />
innerhalb der Kongresswoche anbieten. Zudem haben Sie die Möglichkeit,<br />
an einer der Exkursionen in die Umgebung Guadalajaras teilzunehmen.<br />
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Guadalajara und eine anregende<br />
Kongresswoche!<br />
Der <strong>ALEG</strong>-Vorstand 2009-2012<br />
3
Danksagungen v Agradecimientos<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Extendemos un agradecimiento cordial a todas las instituciones colaboradoras<br />
por su apoyo financiero, personal y logístico para la realización del Congreso <strong>ALEG</strong>. En<br />
especial quisiéramos destacar el apoyo tan generoso por parte del DAAD.<br />
Nos gustaría externar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Universidad<br />
de Guadalajara, sobre todo al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades<br />
(CUCSH) que nos facilitó el espacio, la infraestructura y recursos para este congreso.<br />
Un agradecimiento también a todos los ponentes de las conferencias plenarias y<br />
semiplenarias, responsables de sección y de talleres por su invaluable contribución.<br />
Asimismo agradecemos al Prof. Dr. Dieter Rall, Prof. Dr. Rolf Renner, Prof. Dr. Erwin<br />
Tschirner y Dr. Friedhelm Schmidt-Welle por su asesoría académica y por acompañar<br />
a la mesa directiva de <strong>ALEG</strong> durante la planeación del congreso. Es importante para<br />
nosotros mencionar la destacada colaboración de todo el comité organizador en<br />
Guadalajara, en especial el de nuestra colega Ulrike Pleß.<br />
Por último, agradecemos también a todas las personas e instituciones que hicieron<br />
posible este congreso.<br />
4<br />
La mesa directiva del <strong>ALEG</strong>
Danksagungen v Agradecimientos<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Kooperationspartner für ihre finanzielle,<br />
personelle und logistische Unterstützung und für ihre gute Zusammenarbeit. Besonders<br />
hervorheben möchten wir die großzügige Unterstützung durch den DAAD.<br />
Vielen Dank an die Universidad de Guadalajara, vor allem an das<br />
geisteswissenschaftliche Universitätszentrum CUCSH, die uns Räumlichkeiten,<br />
Infrastruktur und Ressourcen für diesen Kongress zur Verfügung stellen. Bei allen<br />
Plenarvortragenden, Sektionsleitern und Workshopleitern bedanken wir uns ganz<br />
herzlich für ihre aktive und unentgeldliche inhaltliche Mitgestaltung des <strong>ALEG</strong>-<br />
Kongresses. Einen herzlichen Dank außerdem an Dr. Dieter Rall, Prof. Dr. Rolf Renner,<br />
Prof. Dr. Erwin Tschirner und Dr. Friedhelm Schmidt-Welle für ihre wissenschaftliche<br />
Beratung und Begleitung des <strong>ALEG</strong>-Vorstands während der Kongressplanung. Ein<br />
großes Dankeschön auch an unsere <strong>ALEG</strong>-Mitarbeiterin, Ulrike Pleß, und an das<br />
Organisationsteam hier vor Ort.<br />
Außerdem bedanken wir uns bei allen Personen und Institutionen, die diesen<br />
Kongress ermöglicht haben.<br />
Der <strong>ALEG</strong>-Vorstand<br />
5
Tagungsorte v Sedes<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
cucsh<br />
Geisteswissenschaftliches Zentrum<br />
Guanajuato 1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260. Guadalajara, Jalisco, México.<br />
Tel.: +52 (33) 38193300<br />
Das Geisteswissenschaftliche Zentrum der Universität Guadalajara wurde 1994 im Rahmen<br />
der 1989 begonnenen Strukturreform, welche zum Aufbau des Universitätsnetzwerkes<br />
Jalisco führte, gegründet.<br />
Der Großteil der Veranstaltungen des Kongresses wird hier im Campus stattfinden (siehe<br />
Campusplan).<br />
Paraninfo der Universität Guadalajara<br />
Av. Juárez 975, (Ecke Enrique Díaz de León)<br />
Tel.: +52-33-31341678<br />
Der Paraninfo befindet sich im Rektoratsgebäude der Universität Guadalajara und beherbergt<br />
zwei der bedeutensten Werke des mexikanischen Muralisten José Clemente<br />
Orozco aus dem Jahr 1936. Aufgrund der künstlerischen Reife Orozcos zu diesem Zeitpunkt<br />
wird den beiden Fresken ein großer Wert beigemessen: Der schöpferische und<br />
aufrührerische Mensch (El hombre creador y rebelde), dargestellt in der Kuppel des Gebäudes,<br />
und Das Volk und seine falschen Führer (El pueblo y sus falsos líderes) sind die Titel<br />
beider Werke, welche neben ihrer ästhetischen Bedeutung auch thematische Relevanz<br />
zeigen, da sie einerseits auf die humanistische und kulturelle Verantwortung der Universität<br />
hinweisen und andererseits die kritischen Ansichten Orozcos über die nationale<br />
und internationale Geschichte zum Ausdruck bringen.<br />
Im Paraninfo werden die Eröffnungsfeier und die Plenarvorträge des Kongresses<br />
stattfinden.<br />
6
Inhaltsverzeichnis v Índice<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanisten Verbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Organisation v Organización 2<br />
Begrüßungsworte v Palabras de bienvenida 3<br />
Danksagungen v Agradecimientos 4<br />
Tagungsort v Sede 6<br />
Inhaltsverzeichnis v Índice 8<br />
Plenarvorträge v Conferencias plenarias 10<br />
Semiplenarvorträge v Conferencias semiplenarias 11<br />
Vorschau Kulturprogramm v Introducción Programa cultural 14<br />
Sektion v Sección<br />
8<br />
1 Literatur, Film und visuelle Medien<br />
Literatura, cine y medios visuales 16<br />
2 Migration und Fremdheit in der deutschsprachigen und<br />
lateinamerikanischen Literatur<br />
Migración y Alteridad en la literatura de habla alemana<br />
y latinoamericana 35<br />
3 Repräsentationen von Erinnerung in Literatur und Film.<br />
Ein Vergleich zwischen Deutschland und Lateinamerika<br />
Representaciones de la memoria en la literatura y el cine.<br />
Una comparación entre Alemania y Latinoamérica. 59<br />
4 Germanistik und Romanistik im Gespräch. Perspektiven<br />
der gegenseitigen Bereicherung – Archive als Orte der Begegnung<br />
Germanística y Romanística en diálogo. Perspectivas<br />
y Germanistik und Romanistik im Gespräch. El trabajo de archivo<br />
como lugar del encuentro 75<br />
5 Zurück zur Wirklichkeit: Konfigurationen des Realen in der<br />
deutschsprachigen und lateinamerikanischen Literatur<br />
De regreso a la realidad: configuración de lo real en la literatura<br />
de lengua alemana y latinoamericana 88<br />
6 Didaktisch-methodische Transformationen im lateinamerikanischen<br />
DaF-Unterricht in der Erwachsenenbildung:<br />
Forschung und Unterrichtspraxis<br />
auf dem Prüfstand
Transformaciones didácticas y metodológicas en la clase de alemán<br />
en Latinoamérica en el campo de la educación superior:<br />
Estado actual de la investigación y la práctica 111<br />
7 Didaktisch-methodische Transformationen im lateinamerikanischen<br />
DaF-Unterricht im schulischen Kontext: Forschung und Unterrichtspraxis<br />
auf dem Prüfstand<br />
Transformaciones didácticas y metodológicas en la clase de alemán<br />
en Latinoamérica en el campo de la educación básica:<br />
Estado actual de la investigación y la práctica 134<br />
8 Angewandte Linguistik<br />
Lingüística aplicada 151<br />
9 Die deutsche Sprache aus lateinamerikanischer Sicht<br />
La lengua alemana desde una perspectiva latinoamericana 164<br />
10 Subjektivität und Objektivität: Gibt es Wahrheit in der Übersetzung?<br />
Subjetividad y objetividad: ¿existe una verdad en la traducción? 177<br />
Kulturprogramm v Programa cultural 195<br />
Workshops v Talleres 200<br />
Verlagspräsentationen v Editoriales 202<br />
Kooperationspartner v Instituciones organizadoras 205<br />
Masterstudiengang Deutsch als Fremdsprache:<br />
Estudios interculturales de lengua, literatura y cultura alemanas 210<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica<br />
de los Participantes 211<br />
9
Plenarvorträge v Conferencias plenarias<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanisten Verbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Transfer und Transformation. Die Literaturen der Welt aus transarealer Perspektive<br />
Prof. Dr. Ette, Ottmar<br />
Universität Potsdam, Deutschland<br />
Im Gegensatz zu dem von Goethe geprägten Konzept der »Weltliteratur«, das sich<br />
in einen polemischen Widerspruch zum zeitgenössisch propagierten Begriff der »Nationalliteratur«<br />
stellte, geht ein Verständnis der »Literaturen der Welt« von einem vielpoligen,<br />
vielsprachigen und viellogischen Verständnis literarischer Produktion und Rezeption<br />
aus. Der Vortrag unternimmt den Versuch, aus der Perspektive der TransArea-Studien<br />
eine literarische Globalisierungsgeschichte zu entfalten, die über insgesamt vier Phasen<br />
beschleunigter Globalisierung hinweg die Beziehungen zwischen literarischen und kulturellen<br />
Transfers und ihren jeweiligen Transformationen - selbstverständlich unter Einbeziehung<br />
deutschsprachiger Literaturen - anhand von Beispielen aus Europa und den<br />
Amerikas, Afrika und Asien analysiert und reflektiert.<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer international<br />
vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
Prof. Dr. Soethe, Paulo Astor<br />
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasilien<br />
Der Vortrag bespricht am Beispiel von verschiedenen, auch anscheinend traditionellen<br />
Forschungsthemen (insbesondere den bisher nicht systematisch erforschten<br />
Beziehungen von Thomas und Heinrich Mann zu Lateinamerika) ein Konzept zur Belebung<br />
und zur größeren Sichtbarkeit der Germanistik im Ausland bzw. des Fachgebiets<br />
Deutsch als Fremdsprache. Die Überwindung von einer defensiven Haltung gegenüber<br />
der (vielleicht unvermeidlichen, ja sogar eher ertragreichen) Konvivenz von Ansätzen<br />
wie interkultureller Germanistik, internationaler Germanistik und Deutsch als Fremdsprache<br />
sowie die methodologische Nutzung dieser Problematik als Ausgangspunkt<br />
zur Profilierung einer international vernetzten Gemeinschaft von Forschern in verwandten<br />
Bereichen (Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft) bieten sich in einer Zeit der<br />
erwünschten Entstehung von Clusters und Transfers als besonders geeignete Chance<br />
für die Weiterentwicklung und Konsolidierung des Fachgebiets an. Eine ausführliche<br />
und übersichtliche Bestandsaufnahme der bisherigen Forschungsergebnisse und laufenden<br />
Forschungsprojekte, der noch unerforschten Bestände in Archiven in Europa<br />
und Lateinamerika, der potentiellen und anschlussfähigeren Forschungsaufgaben im<br />
internationalen Kontext ist für die Zukunft des Fachgebiets in der heutigen lateinamerikanischen<br />
Universitätslandsschaft von entscheidender Bedeutung.<br />
10
Semiplenarvorträge v Conferencias semiplenarias<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanisten Verbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche Wissenschaft?<br />
Dr. Dornbusch, Claudia<br />
Universidade de Sao Paulo, Brasilien<br />
Inwiefern spielen DaF und Literaturwissenschaft gemeinsam eine Rolle in der Praxis<br />
der lateinamerikanischen Germanistik? Warum ist ein Plädoyer für eine Literaturwissenschaft<br />
in DaF nötig und ertragreich im Zusammenspiel mit Sprache und Übersetzung?<br />
Ist das eine Lösung für die ewig angekündigte Krise der europäischen Germanistik? Warum<br />
scheint die lateinamerikanische Germanistik sich nie in dieser Krise zu befinden?<br />
Von diesem Fragehintergrund ausgehend möchte ich in meinem Vortrag einige<br />
Aspekte unserer Arbeitsrealität an der Universität ansprechen, insbesondere die Arbeit<br />
mit Literatur, die einer aktualisierten Literaturwissenschaft gerecht werden muss,<br />
aber nicht ein reales Publikum vernachlässigen darf, welches ohne Vorkenntnisse der<br />
deutschen Sprache das Studium beginnt. Curriculare Fragen spielen ebenfalls eine<br />
nicht unbeträchtliche Rolle. Die Balance zu finden zwischen DaF-Strategien, literaturwissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen und kulturrelevanten Diskussionen ist hier die<br />
Herausforderung.<br />
Zum Stil deutscher wissenschaftlicher Vorträge<br />
(auch) aus kontrastiver Sicht.<br />
Prof. Dr. Fandrych, Christian<br />
Universität Leipzig, Deutschland<br />
In diesem Beitrag möchte ich anhand von Daten aus dem derzeit in Leipzig entstehenden<br />
Korpus “Gesprochene Wissenschaftssprache kontrastiv” (GeWiss) auf Stil und<br />
Funktion von sprachlichen Handlungen eingehen, mit denen der / die Vortragende seine<br />
Hörer/innen im weitesten Sinne “orientiert”. Diese Orientierung kann bezüglich des<br />
kommunikativen Makroereignisses “Tagung” erfolgen, sie kann sich auf die “Rahmung”<br />
des Vortrags durch Einführung und nachfolgende Diskussion beziehen, und sie kann<br />
sich auf die Strukturierung des Vortrags selbst beziehen. Anhand der Belege soll deutlich<br />
gemacht werden, dass sich die mündlichen Formen solcher Kommentierungen und<br />
Orientierungen in Stil und pragmatischer Funktion teils deutlich von vergleichbaren<br />
Handlungen in schriftlichen Texten unterscheiden. Dies deutet darauf hin, dass wir -<br />
deutlich stärker, als dies bis dato erfolgt ist - die mündlichen Varietät der Wissenschaftssprache<br />
als eigenständigen Bereich genauer untersuchen müssen, gerade aus Sprachvergleichsperspektive.<br />
Im Vortrag wird auch kurz das zu diesem Zweck entstehende<br />
Korpus “GeWiss” charakterisiert werden.<br />
11
12<br />
Semiplenarvorträge v Conferencias semiplenarias<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?<br />
Modelle zum Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz<br />
und ihre praktischen Konsequenzen<br />
Prof. Dr. Funk, Hermann<br />
Universität Jena, Deutschland<br />
In aktuellen Fremdsprachencurricula, Rahmenplänen und Testformaten haben<br />
sich die Gewichte deutlich verschoben: Vom Schriftlich-Rezeptiven zum Mündlich-<br />
Produktiven. Diese Entwicklung macht eine Neubewertung des Beitrags der Sprachbewusstheit,<br />
d. h. v. a. grammatischer Kenntnisse zur Entwicklung von Sprachkompetenz<br />
nötig. Während explizites Regelwissen vor allem im schriftlich-rezeptiven und<br />
-produktiven Bereich unbestreitbar nützlich ist, ist mehr und mehr umstritten, welchen<br />
Beitrag bewusst gemachte Regeln im Ausbau sprachlicher Interaktionskompetenz leisten<br />
können. Im Vortrag sollen verschiedene Positionen der Spracherwerbsforschung<br />
in dieser Frage kurz dargestellt und praktische Modelle des Aufbaus impliziter Regelkompetenz<br />
durch Übung im Sinne sinnvoller Sprachverwendung und Automatisierung<br />
vorgestellt werden.<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht in<br />
einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
Prof. Dr. Pupp Spinassé, Karen<br />
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasilien<br />
Deutsch ist eine der meistgelernten Sprachen in Brasilien, sei es in der Schule, in<br />
Sprachkursen oder an der Universität. Insgesamt schätzt man, dass ca. 70.500 Brasilianer<br />
die deutsche Sprache lernen – und die gröβte Mehrheit (etwa 52.000 davon) lernt<br />
das Deutsche im schulischen Bereich.<br />
Eine sehr groβe Anzahl von DaF-Schulen befindet sich in der Südregion Brasiliens,<br />
wo eine starke deutschsprachige Einwanderung stattfand. In den Bundesländern<br />
im Süden gibt es noch Ortschaften, in denen neben dem Portugiesischen auch ein<br />
deutscher Dialekt weiterhin gesprochen wird. Viele Schüler in diesen Kontexten bringen<br />
also zu ihrem Deutschunterricht gewisse sprachliche Vorkenntnisse mit, die zum<br />
Erlernen des Hochdeutschen beitragen könnten. Dennoch wird dieses Vorkenntnis<br />
oft nicht berücksichtigt und somit im Unterricht nicht einbezogen – was vielleicht<br />
von Vorteil wäre.<br />
Mit diesem Kontext als Forschungsobjekt möchte ich in diesem Beitrag mögliche<br />
sprachpolitische sowie didaktisch-methodische Vorgänge präsentieren, die eine Transformation<br />
im DaF-Unterricht in den dargestellten Regionen schaffen könnte. Das Ziel<br />
ist es, methodische Ansätze für diesen spezifischen Kontext zu besprechen, welche<br />
die Wahrnehmung der deutschstämmigen Mundart zugunsten des Lernerfolges im<br />
Deutschunterricht einsetzen.
Semiplenarvorträge v Conferencias semiplenarias<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und Alzheimer<br />
Dr. Schmidt-Welle, Friedhelm<br />
Iberoamerikanisches Institut Berlin, Deutschland<br />
Vor dem Hintergrund der neueren Erkenntnisse der Neurowissenschaften zu Funktion<br />
und Störungen des menschlichen Gedächtnisses beleuchtet der Vortrag, wie Alzheimer<br />
in deutschsprachiger und hispanoamerikanischer Kriminalliteratur repräsentiert<br />
wird. Dabei geht es in erster Linie darum zu zeigen, inwiefern Alzheimer über die<br />
Darstellung der Krankheit hinaus auch als Symbol für individuelle und kollektive Prozesse<br />
des Erinnerns und Vergessens fungiert.<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Prof. Dr. Tschirner, Erwin<br />
Universität Leipzig, Deutschland<br />
Grammatisches Wissen ist nach Eisenberg u.a. (2005:1071) Kohäsionswissen, das<br />
Wissen über „alle textuellen Zeichenbeziehungen, die an grammatische Funktionswörter<br />
und -zeichen geknüpft sind oder sich an deren Leistungen … orientieren.“ Die<br />
Autoren gehen weiterhin davon aus, dass diese „Kohäsionszeichen … ihre eigentliche<br />
Funktion … erst auf der Ebene des Textes [entfalten] (ibid.: 1072). Der Gemeinsame<br />
Europäische Referenzrahmen definiert grammatische Kompetenz nur sehr vage über<br />
die Präsenz und den Einfluss von Fehlern in einfachen oder komplexen Strukturen und<br />
Profile Deutsch (Glaboniat u.a. 2005) steht in seinem Grammatikansatz auf dem Niveau<br />
der späten 1970-er Jahre und dem notional-funktionalen Ansatz von Kontaktschwelle<br />
Deutsch (Baldegger u.a. 1982), deren grammatisches Inventar zum größten Teil übernommen<br />
wurde. Grundlage dieses Ansatzes sind Sprechakte, die vor allem auf der Ebene<br />
des Satzes und darunter operationalisiert werden. Es wundert deshalb nicht, dass<br />
sich grammatische Progressionen in Lehrwerken, Curricula und Tests in den letzten 30<br />
Jahren nur minimal verändert haben. Nimmt man jedoch die Definition von grammatischem<br />
Wissen als Kohäsionswissen ernst, dann muss grammatisches Wissen sowohl auf<br />
Satz- als auch, und vor allem, auf Textebene dargestellt werden. Dieser Vortrag möchte<br />
einen Beitrag zu einer Neukonzeptionalisierung von grammatischem Wissen und seiner<br />
Vermittlung im Fremdsprachenunterricht leisten, die sowohl auf der Annahme von<br />
Erwerbs- oder Kompetenzniveaus (wie z. B. im GER) aufbaut wie auf dem Konzept von<br />
grammatischem Wissen, wie es von Eisenberg u.a. vertreten wird.<br />
13
14<br />
Vorschau Kulturprogramm v Introducción Programa cultural<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanisten Verbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
© Jim Rakete © privat<br />
©privat<br />
©privat<br />
Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll:<br />
Grüße aus der Heimat. Neue deutsche<br />
Volkslieder<br />
Goethe-Institut Mexiko<br />
Mo 05.03.2012<br />
18:00 Uhr<br />
Auditorium Salvador Allende<br />
Karikaturenausstellung: Die Macht<br />
der Zeichnung - MeisterSchüler der<br />
Komischen Kunst<br />
Eine Ausstellung des Goethe-Instituts<br />
Mexiko und der Caricatura Kassel<br />
05.03.-09.03.1012<br />
Bibliothek „Dr. Manuel Rodríguez<br />
Lapuente“<br />
Mo-Fr 8:00 – 20:00 Uhr<br />
Sa 9:00 – 19:00 Uhr<br />
Lesung: Tarek Eltayeb<br />
Foro Cultural de Austria, BMUKK<br />
Di 06.03.2012<br />
18:00 Uhr<br />
Auditorium Salvador Allende
Kulturprogramm v Programa cultural<br />
©privat<br />
© Irène Lindgren<br />
Plenarvortrag Juan Villoro: “Te doy mi<br />
palabra” Un itinerario en la traducción<br />
Cátedra Cortázar (Lehrstuhl Cortázar)<br />
Do 08.03.2012<br />
19:00 Uhr<br />
Paraninfo Enrique Díaz de León<br />
Lesung Egon Schwarz:<br />
Unfreiwillige Wanderjahre<br />
Fr 09.03.2012<br />
09:00-11:00 Uhr<br />
Auditorium Carlos Ramírez Ladewig<br />
Dokumentarfilm Juliana Fischbein<br />
Universidad de Buenos Aires, Instituto Goethe, Buenos Aires, Argentinien<br />
Fr 09.03.2012<br />
09:00-11:00 Uhr<br />
Auditorium Silvano Barba<br />
d e s a p a r e c e r<br />
Exilio y Memoria en el marco del Nacionalsocialismo y las dictaduras de los años ’70 en<br />
el Cono Sur*<br />
d e s a p a r e c e r<br />
Exil und Erinnerung im Rahmen des Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er<br />
Jahre in Südamerika*<br />
Hinweis: der Dokumentarfilm ist auf Spanisch mit deutschen Untertiteln<br />
15
16<br />
Sektion 1<br />
Literatur, Film und visuelle Medien<br />
Sektionsleitung:<br />
Prof. Dr. Rolf G. Renner<br />
Universität Freiburg<br />
Dr. Claudia Dornbusch<br />
Universidade de Sao Paulo, Brasil<br />
Dr. Sergio Sánchez<br />
Universidad Nacional Autónoma de México<br />
Konzept der Sektion<br />
Weltweit sind in vielen Deutschabteilungen Film- und Medienanalyse zu einem<br />
festen Bestandteil von Forschung und Unterricht geworden. Zum einen, weil Fragestellungen<br />
der Intermedialität die traditionelle Literaturanalyse ergänzen und zugleich<br />
vertiefen. Zum anderen, weil vor allem die Entwicklung der technischen Medien einen<br />
globalen Kulturwandel und eine damit verbundene grundlegende Veränderung aller<br />
Wahrnehmungs- und Diskursformen eingeleitet hat, denen sich auch die nationalen<br />
Literaturwissenschaften zuwenden müssen.<br />
In der theoretischen Fundierung der Literatur- und Kulturwissenschaften hat dies<br />
bereits dazu geführt, dass Aspekte der Intertextualität und der Interkulturalität zunehmend<br />
der übergreifenden Perspektive der Intermedialität untergeordnet werden. Im<br />
Bereich der Kulturwissenschaften schließlich werden Fragen der bisherigen colonial<br />
studies und die damit verbundenen Beschreibungskategorien von Differenz, Alterität,<br />
Identität und Gedächtniskultur durch die Perspektive einer medial vermittelten Hybridisierung<br />
der postkolonialen Gesellschaften ersetzt.<br />
In drei Bereichen dieser Sektion sollen sowohl das historische und das funktionale<br />
Wechselspiel von Literatur- und Bildmedien als auch der durch die Bildmedien verbürgte<br />
Wandel der kulturellen Register untersucht werden.<br />
- Intermedialität als Signatur der Moderne, die Wechselbeziehung zwischen der Literatur<br />
und den modernen Bildmedien von Fotographie, Film und digitalem Bild.<br />
- Entstehung und Veränderung medientypischer Wahrnehmungs- und Präsentations-formen<br />
in der Literatur, dem Film und anderen Bild-Medien.<br />
- Die mediale Konstruktion von Selbst- und Fremdbild, die Visualisierung kollektiver<br />
Identitäten.
Sektion 1 v Sección 1<br />
Montag, 05.03.2012<br />
Uhrzeit Ort<br />
8:30-10:00 Einschreibung Paraninfo<br />
10:00-11:30 Eröffnungsveranstaltung:<br />
Juárez 975<br />
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Generalrektor (Ecke Enrique Díaz<br />
der Universität Guadalajara / Rector general de la<br />
Universidad de Guadalajara. Mtro. Pablo Arredondo<br />
Ramírez, Rektor des Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrums CUCSH / Rector del Centro Universitario<br />
de Ciencias Sociales y Humanidades. Dr. Lilia Oliver<br />
Sánchez, Leiterin der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät / Directora de la División de Estudios<br />
Históricos y Humanos. Dr. Edmund Duckwitz,<br />
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland /<br />
Embajador de la República Federal de Alemania.<br />
Dr. Alfred Längle, Botschafter der Republik Österreich<br />
/ Embajador de Austria. Dr. Gisela Schneider,<br />
Deutscher Akademischer Austauschdienst / Servicio<br />
Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Dr. Olivia<br />
C. Díaz Pérez, Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes / Presidenta de la Asociación<br />
Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
de León)<br />
11:30-12.00 Empfang des Generalrektors der Universität<br />
Guadalajara<br />
12:00-12:45 Plenarvortrag Paulo Astor Soethe:<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer<br />
international vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
12:45-13:30 Plenarvortrag Ottmar Ette: Die Literaturen der Welt aus<br />
transarealer Perspektive<br />
13:45-14:30 Abfahrt zum Tagungsort (CUCSH)<br />
14:30-16:00 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
16:00-16:30 Einführung in die Sektion Raum 61 H**<br />
16:30-17.00 Manfred Durzak „Peter Schneiders Theaterstück<br />
Totoloque. Das Geiseldrama von Mexiko- Tenochtitlan –<br />
Historienstück oder postkolonialer Text?“<br />
Raum 61 H<br />
17:00-17:30 Edgar Ortega Gonzalez Del libro al libreto Raum 61 H<br />
17
18<br />
17:30-18:00 Pause<br />
18:00-19:30 Kulturveranstaltung (Goethe-Institut): Kabaret und<br />
Musik mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll<br />
19:30 Empfang der Deutschen Botschaft<br />
Eröffnung Karikaturenausstellung Goethe-Institut<br />
Dienstag, 06.03.2012<br />
Sektion 1 v Sección 1<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
und Bibliothek<br />
Manuel Rodríguez<br />
Lapuente<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Hermann Funk:<br />
Auditorium<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?. Modelle zum<br />
Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz und ihre<br />
praktischen Konsequenzen<br />
Silvano Barba<br />
Semiplenarvortrag Friedhelm Schmidt-Welle:<br />
Auditorium Carlos<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und<br />
Alzheimer<br />
Ramírez Ladewig<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Susy Rodríguez Moreno *„Heroínas pírricas: algunas<br />
figuras femeninas de Heinrich von Kleist“<br />
Raum 61 H<br />
10:45-11:15 Nils Bernstein Über Medienkompetenz im<br />
Landeskunde-Unterricht. Suggerierte Faktualität und<br />
narrative Verfahren im Film am Beispiel von „Der Baader<br />
Meinhof Komplex“ (2008) und „Wer wenn nicht wir“<br />
(2011).<br />
Raum 61 H<br />
11:15-11:45 Svenja Frank Hollywood als Gedächtnisstütze:<br />
Intermedialität in Günter Grass’ Im Krebsgang<br />
Raum 61 H<br />
11:45-12:15 Pause<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Erwin Tschirner:<br />
Auditorium<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Silvano Barba<br />
Semiplenarvortrag Claudia Dornbusch:<br />
Auditorium Carlos<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche<br />
Wissenschaft?<br />
Ramírez Ladewig<br />
13:00-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)
Sektion 1 v Sección 1<br />
14:30-15:00 Rolf G. Renner 9/11: Die Interpretation des Desasters als<br />
Desaster der Interpretation<br />
15:00-15:30 Rolf-Peter Janz Die Interferenz von Text und Bild. Am<br />
Beispiel von W.G. Sebalds Roman „Austerlitz“<br />
15:30-16:00 Manuel Maldonado Alemán Keine Identität ohne<br />
Alterität – Eine Interpretation der Exilerfahrung<br />
Gustav Reglers anhand ausgewählter Werke und noch<br />
unveröffentlichter Briefe<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Guillaume Robin „Zwischen Literatur und Film: Kuhle<br />
Wampe oder wem gehört die Intermedialität.“<br />
17:00-17:30 Silvina Rotemberg *Sonnenallee y Good bye Lenin!: la<br />
RDA como objeto de representación<br />
17:30-18:00 Román Setton *Hans Jürgen Syberberg: reelaboración<br />
del pasado y redención La trilogía sobre Alemania y<br />
Parsifal<br />
18:15-19:45 Kulturveranstaltung (Foro Cultural de Austria,<br />
BMUKK):<br />
Lesung von Tarek Eltayeb<br />
Donnerstag, 08.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Christian Fandrych: Zum Stil<br />
deutscher wissenschaftlicher Vorträge (auch) aus<br />
kontrastiver Sicht.<br />
Semiplenarvortrag Karen Pupp Spinassé:<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht in<br />
einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Gundela Hachmann Sprachloses Verstehen. Visuelle<br />
Kompetenz in Yoko Tawadas Kinoroman Das nackte<br />
Auge<br />
10:45-11:15 Mihaela Zaharia „Das Leben ist hier beschaulich und<br />
wunderbar“ – Zur Rolle der Fremde in Doris Dörries<br />
Prosa und Filmen<br />
11:15-11:45 Karen Saban Transkulturelle Räume und neue<br />
Immigration in Deutschland und Argentinien<br />
Raum 61 H<br />
Raum 61 H<br />
Raum 61 H<br />
Raum 61 H<br />
Raum 61 H<br />
Raum 61 H<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium Carlos<br />
Ramírez Ladewig<br />
Raum 61 H<br />
Raum 61 H<br />
Raum 61 H<br />
19
20<br />
Sektion 1 v Sección 1<br />
11:45-12:00 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
12:00-12:30 Sandra Rios Kuri Bedeutungskonstruktionen im<br />
literarischen Diskurs und Identitätskonstruktionen<br />
von Gruppen: Versuch einer Begrenzung der<br />
Identitätskonstruktion im Roman Herr Lehmann<br />
Raum 61 H<br />
12:30-13:00 Isabel Gutiérrez Koester *“Entre el estereotipo y la<br />
realidad: Construcción fílmica en torno a la migración<br />
de retorno”<br />
Raum 61 H<br />
13:00-13:30 Sergio Sánchez Loyola *La Francobia en las letras<br />
alemanas, de la defensa lingüístico – literaria a la<br />
construcción de un estereotipo de identidad colectiva.<br />
Raum 61 H<br />
13:30-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
14:30-15:00<br />
15:00-15:30<br />
15:30-16:00<br />
Girla Castillo Rodriguez Julia oder Medea?: Die<br />
unerwünschte Liebe<br />
Raum 61 H<br />
16:00-16:30<br />
16:30-17:00<br />
17:00-17:30<br />
17:30-18:00<br />
Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
18:00-19:00 Abfahrt zum Paraninfo<br />
19:00 Kulturveranstaltung der Universität Guadalajara: Paraninfo<br />
Lehrstuhl „Cortázar“ (Cátedra Cortázar): Plenarvortrag Juárez 975<br />
Juan Villoro: *Te doy mi palabra. Un itinerario en la (Ecke Enrique Díaz<br />
traducción.<br />
de León)<br />
Freitag, 09.03.2012<br />
9:00-11:00 9:00-9:25 Reinhard Andress “... heiße ich daher<br />
die Emigration gut”: der Fall des Egon<br />
Schwarz<br />
9:25- 9:50 Egon Schwarz:<br />
Lesung auf Deutsch***<br />
10:00 - 11:00 Elisabeth Siefer: Einführung in die<br />
Übersetzung<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig
Sektion 1 v Sección 1<br />
9:00-11:00 10:00 - 11:00 Egon Schwarz: Lesung auf Spanisch<br />
-Diskussion<br />
Documental de Juliana Fischbein:<br />
des aparecer Exil und Erinnerung im Rahmen des<br />
Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er Jahre<br />
in Südamerika***<br />
Workshop Karen Schramm: Mündliches Erzählen im<br />
Fremdsprachenunterricht<br />
Workshop Dieter Jaeschke: Freundschaft, Ostalgie<br />
und weite Welt: Der Spielfilm „Friendship!“ (D 2010) im<br />
DaF-Unterricht<br />
Workshop Carmen Schier: Zur Arbeit mit Hörbüchern.<br />
Ein „Grenzgänger“ wird (neu) entdeckt<br />
9:00-10:00 Verlagspräsentation Martina Bartucz, Cornelsen<br />
Verlag: Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Verlagspräsentation Anne Robert, Hueber Verlage:<br />
Menschen<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: DaF<br />
kompakt – das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: „Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur Sprache<br />
11:00-11:30 Pause<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
11:30-12:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven der Germanistik in Auditorium Silvano<br />
Lateinamerika<br />
Barba<br />
Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: Beste<br />
Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
64 H<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven<br />
Tafelbildern am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz<br />
Neu“ und „Logisch!“<br />
65 H<br />
Verlagspräsentation Christina Kuhn, Cornelsen Verlag:<br />
Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was ändert sich,<br />
was bleibt?<br />
66 H<br />
12:30-13:30 Abschlussplenum <strong>ALEG</strong> Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
13:30-15:00 Mittagessen Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
61 H<br />
62 H<br />
63 H<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H<br />
64 H<br />
21
22<br />
Sektion 1 v Sección 1<br />
15:00-17:00 <strong>ALEG</strong>-Mitgliederversammlung Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
17:15-19:15 AMPAL- Mitgliederversammlung Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
20:00 Abendessen & Abschlussfeier El Callejón de<br />
los Rumberos.<br />
Chapultepec Ecke<br />
Lerdo de Tejada<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
** Die Tagungsräume befinden sich im 3. Stock des Gebäude H vom CUCSH.<br />
*** Teil der Sektion 2 und des Kulturprogramms; nähere Informationen im Kulturprogramm<br />
Beiträge in alphabetischer Reihenfolge<br />
Über Medienkompetenz im Landeskunde-Unterricht.<br />
Suggerierte Faktualität und narrative<br />
Verfahren im Film am Beispiel von<br />
„Der Baader Meinhof Komplex“ (2008) und „<br />
Wer wenn nicht wir“ (2011).<br />
Dr. des. Bernstein, Nils<br />
Universidad Nacional Autónoma de México (DAAD Lektor), Mexiko<br />
Die beiden Filme „Der Baader Meinhof Komplex“ (Regie: Uli Edel) und „Wer wenn<br />
nicht wir“ (Andres Veiel) setzen sich mit jeweils etwas verschobenem historischem<br />
Fokus und un terschiedlicher Ästhetik mit der Vor- bzw. Entstehungsgeschichte des<br />
Baader-Meinhof-Kom plexes auseinander. Ge meinsam ist ihnen auch der Bezug zur Literatur.<br />
Während U. Edels Film das gleichnamige Sachbuch von Stefan Aust zur Vorlage<br />
hat, beschäftigt sich A. Veiels an Gerd Koenens ‘biographischer Erzäh lung’ „Vesper, Ensslin,<br />
Baader“ orientierter Film mit der Lebensphase des Schriftstellers Bernward Vesper,<br />
die von der Partnerschaft mit Gudrun Ensslin geprägt war. Insofern eignen sich beide<br />
Filme zur landeskundlichen Vermittlung einer höchst brisanten Epoche der bundesrepublikanischen<br />
Geschichte und vermögen darüber hin aus, für medienspezifische<br />
Unterschiede der Darstellungsweise und den Wandel von Präsen tations- und Rezeptionsformen<br />
zu sensibilisieren. Im Vortrag sind zunächst Unterschiede und Gemeinsamkeiten<br />
der beiden Filme, der Bezug Film und Literatur sowie das Spannungsver hältnis<br />
zwischen Fiktionalität und (suggerierter) Faktualität zu beleuchten. Bei letzterem<br />
Aspekt soll besonders eine motivische Parallele genauer untersucht werden: Ulrike<br />
Meinhofs Austritt aus einem bürgerlichen Leben mit Familie ist in „Der Baader Meinhof<br />
Komplex“ durch einen Sprung durch ein Fenster während der Befreiung Andreas Baa-
Sektion 1 v Sección 1<br />
ders markiert. Gud run Ensslins Entscheidung zur aktiven Teilnahme an den Frankfurter<br />
Kaufhausbrandanschlä gen wird in „Wer wenn nicht wir“ durch eine vergleichbare (Tür-)<br />
Schwellenüberschreitung in Anwesenheit Vespers und des gemeinsamen Kindes illustriert.<br />
Die reflexive Durchdringung dieser motivischen Kompositionstechniken zeigt<br />
die Wichtigkeit der zu vermittelnden Me-dienkompetenz bei einem an medialen Präsentationsformen<br />
orientierten Landeskunde unterricht.<br />
Julia oder Medea?: Die unerwünschte Liebe<br />
Castillo Rodríguez, Girla<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
Die polemische Figur der Medea ist Gegenstand von zahlreichen Bearbeitungen<br />
gewesen, sowohl in der Literatur als auch in Bildmedien.<br />
Einige, wie der Film „Así es la Vida” von Arturo Ripstein, zeigen eine moderne Version<br />
der leidenschaftlichen, rachsüchtigen und grausamen Zauberin, die seit der Antike<br />
durch den Autor Seneca bekannt ist. Hingegen hat der Expressionist Hans Henny Jahnn<br />
in seiner Tragödie Medea eine menschlichere Frau dargestellt und hat den Akzent eher<br />
auf die Unversöhnlichkeit der Gegensätze gelegt, wobei Medea die Barbarin, die Alte<br />
und die Negerin ist, während Jason die Zivilisation und die Schönheit darstellt. In beiden<br />
Versionen kann man trotz der großen Unterschiede sehr gut den Archetyp der ausgeschlossenen,<br />
unvernünftigen Frau erkennen. Deswegen möchte ich hier die plastische<br />
Dimension untersuchen, die Literatur und Medien nutzen, um Bilder zu schaffen,<br />
die großen Einfluß auf das Weltbild einer Kultur haben.<br />
Peter Schneiders Theaterstück Totoloque. Das Geiseldrama von<br />
Mexiko-Tenochtitlan – Historienstück oder postkolonialer Text?<br />
Prof. Dr. Durzak, Manfred<br />
Universität Paderborn, Deutschland<br />
Peter Schneider, der auf Reisen Lateinamerika intensiv kennengelernt hat, thematisiert<br />
in seinem Stück die paradoxe Vernichtung des zahlenmäßig weit überlegenen<br />
Aztekenreiches durch die eigentlich von vornherein unterlegene räuberische Horde<br />
des spanischen Conquistador Cortez als exemplarische Kollision zweier grundlegend<br />
unterschiedlicher Kulturen: der fanatischen weißen Kultur der rational gesteuerten Eroberung,<br />
deren Gier sich zugleich religiös legitimiert weiß im biblischen Appell, sich die<br />
Erde untertan zu machen, und einer in mythische Traditionen eingebetteten Kultur der<br />
Azteken, die auf Ausgleich angelegt ist und die Wirklichkeit als zu hütendes Geschenk<br />
der Götter begreift. Das Stück ist damit weit mehr als ein historisch kostümierter Historientext,<br />
sondern lässt sich lesen als ein früher postkolonialer Text der deutschen Literatur,<br />
der grundlegenden Mechanismen der kolonialen Expansion der weißen Eroberer<br />
auf der Spur ist.<br />
23
24<br />
Sektion 1 v Sección 1<br />
Hollywood als Gedächtnisstütze: Intermedialität<br />
in Günter Grass’ Im Krebsgang<br />
Frank, Svenja<br />
University of Oxford, England<br />
Dass zwischen dem Untergang des Passagierschiffs Titanic und dem des nationalsozialistischen<br />
Kraft-Durch-Freude-Dampfers Wilhelm Gustloff Ähnlichkeiten bestehen,<br />
wurde wiederholt sowohl in Bezug auf die historischen Ereignisse selbst als auch auf<br />
verschiedene cinematographische Inszenierungen betont. Umso mehr erstaunt es,<br />
dass bisher scheinbar noch nicht auf die eindeutigen intermedialen Bezüge hingewiesen<br />
wurde, die sich zwischen Grass’ literarischer Verarbeitung des Gustloff-Stoffes<br />
in der Novelle Im Krebsgang (2002) und James Camerons Spielfilm Titanic (1997) ergeben.<br />
Der Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, dies in einem close reading nachzuholen, um<br />
darauf aufbauend nach der Funktion dieser Erzählstrategie zu fragen. Während Grass<br />
Intermedialität an vielen Stellen explizit macht und insbesondere die Neuen Medien als<br />
zentrale Handlungskomponente miteinbezieht, lenkt er den Blick von den eigentlichen<br />
intermedialen Manipulationen des Lesers ab und montiert die cinematographischen<br />
Bezüge auf Cameron’s Titanic hingegen unmarkiert in den Erinnerungsdiskurs. Hieran<br />
lässt sich zeigen, wie sich durch die intermediale Textstrategie neue Bedeutungsebenen<br />
ergeben. Unter anderem muss gefragt werden: Wie stellt die mediale Vermischung<br />
die Authentizität des Zeitzeugenberichts in Frage? Inwieweit referiert die intermediale<br />
Heterogenität strukturell auf die Heterogenität der Gedächtnisfunktionen zwischen<br />
vermeintlich Erinnertem und tatsächlich Erlebtem und kommt den bewegten Bildern<br />
dabei eine Sonderstellung in der literarischen Repräsentation des Erinnerungsprozess<br />
zu? Inwiefern nimmt der bewusste Rekurs auf die Populärkultur, insbesondere auf einen<br />
der kommerziell erfolgreichsten Spielfilme der Kinogeschichte, der mithin Profit aus der<br />
Tragödie schlägt, und an dem die Affinität von Katastrophendarstellungen zum Kitsch<br />
besonders deutlich wird, den vielbeschworenen Tabubruch des Textes zurück und inwiefern<br />
dekonstruiert sich der Text dadurch selbst?<br />
*Entre el estereotipo y la realidad:<br />
Construcción fílmica en torno a la migración de retorno<br />
Prof. Dr. Gutiérrez Koester, Isabel<br />
Universidad de Valencia, Spanien<br />
El análisis de obras cinematográficas y material multimedia se ha convertido en una<br />
de las herramientas más habituales y útiles en el estudio de las relaciones interculturales.<br />
Y es que no sólo los aspectos estéticos, narrativos y teóricos determinan el discurso<br />
mediático, sino que las proposiciones ideológicas pueden determinar las formas - expresivas<br />
y de contenido - de la construcción fílmica. Esto sucede de manera muy llamativa<br />
cuando se analiza material documental o fílmico referido al fenómeno de la llamada
Sektion 1 v Sección 1<br />
“migración de retorno”: Desde finales de los años 50 hasta la crisis del petróleo en 1973,<br />
el desarrollo económico de Alemania precisó de una enorme afluencia de mano obrera<br />
inmigrante. El paro y la pobreza llevaron así a muchos españoles a buscar mejores<br />
condiciones laborales y de vida en la emigración, fomentados además desde las instancias<br />
oficiales. El encuentro entre ambas culturas se vio reflejado en gran variedad de<br />
material audiovisual (documentales, noticias, películas), contribuyendo así de manera<br />
determinante a difundir una determinada imagen – a menudo estereotipada y cargada<br />
de prejuicios – de lo alemán en España y lo español en Alemania. La presenta comunicación<br />
tratará de analizar estas representaciones para determinar la imagen propia y la<br />
ajena en el marco de una identidad colectiva.<br />
Die Film- und Medienanalyse hat sich in den letzten Jahren als eine der beliebtesten<br />
und geeignetsten Methoden bei der Interkulturalitätsforschung bewährt. Es sind nicht<br />
nur die ästhetischen, narrativen und theoretischen Aspekte, die den medialen Diskurs<br />
prägen, sondern auch die ideologischen Aussagen können die formellen und inhaltlichen<br />
Formen des filmischen Konstrukts bestimmen. Besonders auffällig ist diese Tatsache bei<br />
einer näheren Untersuchung des filmischen Materials, das sich mit dem spanischen Gastarbeiterphänomen<br />
befasst: In den 50er Jahren führte das deutsche Wirtschaftswunder<br />
zu einem großen Arbeitskräftemangel. Dies hatte zur Folge, dass bis zur Ölkrise 1973,<br />
dank verschiedener Anwerbeabkommen, eine Vielzahl ausländischer Arbeitnehmer in<br />
die Bundesrepublik Deutschland einwanderte. Arbeitslosigkeit und Armut brachten viele<br />
Spanier dazu, in der Migration eine Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen<br />
zu suchen. Das Aufeinandertreffen zweier so verschiedener Kulturen ging meist mit einem<br />
komplexen Adaptationsprozess im Gastland einher und ließ häufig Vorurteile und<br />
Stereotype aufkommen, die in unserer heutigen Gesellschaft noch weit verbreitet sind.<br />
Der Beitrag beabsichtigt, diese Aspekte der deutsch-spanischen Beziehungen mit Hilfe<br />
verschiedener Dokumentationsmaterialien (Dokumentarfilme, Filme, Nachrichten) näher<br />
zu untersuchen und so das Selbst- und Fremdbild des Spaniers in Deutschland und des<br />
Deutschen in Spanien im Rahmen einer kollektiven Identität zu untersuchen.<br />
Sprachloses Verstehen. Visuelle Kompetenz<br />
in Yoko Tawadas Kinoroman Das nackte Auge<br />
Dr. Hachmann, Gundela<br />
Louisiana State University, USA<br />
oko Tawadas Roman Das nackte Auge schildert das Leben einer jungen Vietnamesin in<br />
Paris, die in die Welt des Kinos flüchtet, weil sie weder die französische Sprache noch die<br />
Kultur verstehen kann. Austausch- und Transformationsbewegungen zwischen Kulturen,<br />
Medien und Sprachen charakterisieren dann ihre Erfahrungen. Anhand der Filmrezeption<br />
jenseits der ihr unverständlichen Sprache heraus entwickelt die Protagonistin eine<br />
spezifisch visuelle Kompetenz, die sich ganz auf die Bildsprache des Mediums Kino kon-<br />
25
26<br />
Sektion 1 v Sección 1<br />
zentriert. In dieser Darstellung nähert sich der Roman dem an, was der Medientheoretiker<br />
Vilém Flusser die Technoimagination nennt, also die Fähigkeit, technisch produzierte<br />
Bilder als komplexe Repräsentationen von Begriffen zu verstehen. Diese literarische Annäherung<br />
an ein Bildverstehen antwortet auf die kulturelle Notwendigkeit, im Zeitalter<br />
nach dem visual turn der Omnipräsenz visueller Medien zu begegnen. Der Roman thematisiert<br />
die kulturelle Veränderung anhand der Transformationen der Protagonistin<br />
und problematisiert zentral die damit einhergehende Veränderung des Subjektbegriffs.<br />
In der Entwicklung von einem textuell zu einem visuell geprägten Zugang zur Welt löst<br />
eine vernetzende Synchronität die lineare Chronologie ab. Ich-Entgrenzung und Kohärenzverlust<br />
warnen in diesem Roman vor den möglichen Gefahren eines solchen Paradigmenwechsels.<br />
In Analogie zu der im Roman vorgebrachten Globalisierungskritik lässt sich<br />
diese Warnung als ein Plädoyer für ein ausgewogenes Komplementärverhältnis zwischen<br />
den Medien verstehen. So wie die einseitige Fokussierung auf die kapitalistisch geprägte<br />
Hegemonialkultur eine trügerische Freiheit beschert, so resultiert auch eine einseitige<br />
Konzentration auf visuelle Medien in verzerrten Begriffen von Ich und Welt.<br />
Die Interferenz von Text und Bild.<br />
Am Beispiel von W.G. Sebalds Roman „Austerlitz“<br />
Prof. Dr. Janz, Rolf-Peter<br />
Freie Universität Berlin, Deutschland<br />
W.G. Sebald gehört zu den international beachteten deutschsprachigen Autoren,<br />
die ihre Romane und Erzählungen („Austerlitz“, „Die Ringe des Saturn“, „Die Ausgewanderten“)<br />
mit Bildern (Fotos, Karten, Dokumenten etc.) versehen. An „Austerlitz“ lässt sich<br />
zeigen, dass die Erzählbarkeit von Geschichte nicht länger der Literatur allein zuzutrauen<br />
ist. Einer der Gründe für den Einsatz visueller Medien liegt darin, dass von einem<br />
Helden die Rede ist, der seine Kindheit nur dank seines Bildgedächtnisses ein Stück weit<br />
erinnern kann. So kommt es, dass im laufenden Text Bilder so angeordnet sind, dass<br />
oft unsicher bleibt, ob sie den Text illustrieren, ergänzen oder dessen Lektüre stören.<br />
Nur in den seltensten Fällen lassen sie sich als Dokumente fassen. Vielmehr sind sie so<br />
arrangiert, dass gerade die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentarischem unkenntlich<br />
wird. Die komplexe Überlagerung von Text und Bild sorgt für einen semantischen<br />
Mehrwert, der Geschichte zugänglich macht und zugleich verrätselt.<br />
Intermedialität der Erinnerung. Zum Verhältnis von<br />
Bild und Text bei Wilhelm Genazino und Monika Maron<br />
Prof. Dr. Maldonado Alemán, Manuel<br />
Universität Sevilla, Spanien<br />
Ob über Texte oder über Bilder, jeder Vergangenheitsbezug ist medial vermittelt.<br />
Pierre Nora hat es prägnant formuliert: „Das Gedächtnis haftet am Konkreten, im Raum,
Sektion 1 v Sección 1<br />
an der Geste, am Bild und Gegenstand“. Der Sozialpsychologe Harald Welzer geht einen<br />
Schritt weiter und negiert die Möglichkeit bilderloser Erinnerung: „Das Gedächtnis<br />
braucht die Bilder, an die sich die Geschichte als eine erinnerte und erzählbare knüpft,<br />
und es gibt zwar Bilder ohne Geschichte, aber keine Geschichte ohne Bilder.“ Diese<br />
scheint die Grundkonzeption zu sein, die Wilhelm Genazino in den Bänden Aus der Ferne<br />
(1993) und Auf der Kippe (2000) und Monika Maron im autobiografischen Text Pawels<br />
Briefe (1999) folgen. Wie für Roland Barthes ist die Fotografie für Genazino und Maron<br />
ein Gedächtnisträger, eine Emanation der ehemaligen Wirklichkeit, die Spuren von Vergangenheit<br />
trägt und die (einstige) Existenz eines Menschen, einer Gruppe oder einer<br />
Situation dokumentiert. Die Fotos vermitteln allerdings ein reduziertes und gebrochenes<br />
Bild der Wirklichkeit. Ihre Betrachtung fordert eine Auslegung, eine Lektüre, eine<br />
Reflexion heraus. Darin zeigt sich ihre Appellfunktion. Aus ihnen geht die dringende<br />
Aufforderung, sich intensiv auf ihre Erzählung einzulassen. Es genügt nicht, einen Wirklichkeitsausschnitt<br />
zu fixieren, das fotografische Bild muss auch dechiffriert werden. Es<br />
bedarf der narrativen Einbindung und der näheren Erklärung, um bedeutungsvoll zu<br />
werden. Das Bild erhält dann Sinn erst durch die Schrift. Und die Schrift erhält eine spezifische<br />
Authentizität durch die Unwiderlegbarkeit der Fotografie. Aus diesem Grund<br />
sind Schrift und fotografisches Bild aufeinander angewiesen. Der Beitrag untersucht das<br />
Verhältnis von Bild und Text bei Wilhelm Genazino und Monika Maron.<br />
Kafka: Vom Buch zum Drehbuch<br />
Ortega González, Edgar<br />
Universidad Nacional Autónoma de México<br />
Das literarische Werk von Franz Kafka wurde mehrfach verfilmt. Die Umsetzung der<br />
literarischen Arbeit mit visuellen Mitteln soll die Welt und typische Atmosphäre des<br />
tschechischen Autors darstellen. Diese Brücke zwischen Literatur und darstellender<br />
Künste bedeutet implizite Schwierigkeiten bei der Auslegung und der Darstellung.<br />
Basierend auf der These Miltos Manetas über Kafka und sein Werk als Vorläufer der<br />
konzeptuellen Kunst schlägt dieser Beitrag eine Analyse des Begriffs des abstrakten Charakters<br />
der menschlichen Existenz in einer Welt anonymisierten Zerfalls und Abbaus vor.<br />
Manetas betrachtet den Fall von Franz Kafka und die Furcht vor bestimmten Objekten<br />
als den ersten dokumentierten Fall von dem, was er als „zeitgenössische Objekte“,<br />
also Objekte, die von Interesse für bildende Künstler des vergangenen Jahrhunderts<br />
waren und die diese in ein Kunstwerk verwandelten, wobei eine doppelte Identität der<br />
Objekte bestand: Einheit und Simulation. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem Begriff<br />
des Menschen als eine Abstraktion, Abstraktion der menschlichen Existenz, die Kafka<br />
durch Weglassen der vollständigen Namen der Protagonisten, indem er sie in zwei<br />
der zu analysierenden Werke mit dem Buchstaben K. bezeichnet, und die Darstellung<br />
der absoluten Sinnlosigkeit der menschlichen Beziehungen erreicht.<br />
27
28<br />
Sektion 1 v Sección 1<br />
Darauf basierend schlage ich vor, dass Orson Welles und Michael Haneke einige der<br />
schmutzigsten Themen auf die große Leinwand bringen, neu erschaffen durch die eigenen<br />
Werke des Kinos in zwei ihrer Verfilmungen, wie „Der Prozess“ und „Das Schloss“, in<br />
welchen die Hauptpersonen als Abstraktionen präsentiert werden, in den Worten von<br />
Sánchez Vázquez, als reale Menschen und kafkaeske Helden.<br />
La obra literaria de Franz Kafka ha sido llevada al cine en muchas ocasiones. La recreación<br />
de la obra literaria por medios visuales intenta representar el mundo y la atmósfera<br />
típica del autor checo. Este puente que existe entre la literatura y el arte escénico<br />
significa una dificultad implícita en la interpretación y la representación de lo kafkiano.<br />
Esta ponencia propone un análisis sobre el concepto de carácter abstracto de la<br />
existencia humana despersonalizada en un mundo en descomposición y degradación,<br />
presente en la obra del expresionista, partiendo de la tesis de Miltos Manetas acerca de<br />
Kafka y su obra como precursores del arte conceptual. Manetas considera que el caso<br />
de Franz Kafka y el terror ante ciertos objetos es el primer caso documentado de lo que<br />
él llama “objetos contemporáneos”, es decir objetos que eran del interés de los artistas<br />
visuales del siglo pasado y los convertían en obra de arte, siendo éstos objetos de doble<br />
identidad: entidad y simulación. Esta tesis se vincula con el concepto del ser humano<br />
como una abstracción, abstracción de la existencia humana que Kafka hace al omitir el<br />
nombre completo de los personajes principales y designarlos con la letra K. en dos de<br />
las obras a analizar, y el absurdo absoluto de las relaciones humanas.<br />
Con esta base, propongo que Orson Welles y Michael Haneke llevan a la pantalla<br />
grande algunos de los temas más sórdidos, recreados mediante los artilugios propios<br />
del cine en dos de sus adaptaciones cinematográficas, tales como El proceso y El castillo;<br />
en las cuales se representa a los personajes principales mencionados como abstracciones,<br />
en palabras de Sánchez Vázquez, del hombre real y como héroes kafkianos.<br />
9/11: Die Interpretation des Desasters als Desaster der Interpretation<br />
Prof. Dr. Renner, Rolf<br />
Universität Freiburg, Deutschland<br />
In den emphatischen und irritierend unterschiedlichen Kommentaren über<br />
den Terrorangriff von 9/11, die den öffentlichen wie den wissenschaftlichen Diskurs<br />
bestimmten, wurden fast routinemäßig die zentralen Register herrschender politischer<br />
Diskurse mobilisiert. Dabei zeigte sich sowohl die Inkompatibilität von theoretisch<br />
begründetem Weltverstehen und unmittelbarer Erfahrung, als auch die Schwierigkeiten des<br />
Transfers vom theoretischen in den politischen Diskurs: Zugleich wurden die besonderen<br />
Anforderungen an eine Transformation dieses Ereignisses in filmische oder literarische<br />
Strategien deutlich. Am Ende war nichts mehr gewiss, die Vielstimmigkeit der Deutungen<br />
und Bewertungen offenbarte eine tiefe Orientierungslosigkeit westlicher Intelligenz. Das<br />
Desaster der terroristischen Attacke führte zu einem Desaster der Interpretationen.
Sektion 1 v Sección 1<br />
Zudem standen neben den unterschiedlichen politischen Kommentaren von<br />
Anfang an auch medientheoretische und medienästhetische Überlegungen, welche<br />
die Autonomie der medialen Vermittlung gegenüber der Faktizität des Ereignisses<br />
betonten, von Anfang an wurde der Terrorakt auch unter dem Blickwinkel seiner<br />
medialen Inszenierung wahrgenommen. Es zeigte sich, wie schwer es für die entwickelte<br />
Mediengesellschaft geworden ist, Faktizitäten und ihre mediale Präsentation<br />
voneinander zu trennen. Der Vortrag beschreibt die unterschiedlichen Register, mit<br />
denen 9/11 dargestellt wird, dabei erhält die Wechselbeziehung zwischen Bild und Text<br />
besondere Bedeutung.<br />
Bedeutungskonstruktionen im literarischen<br />
Diskurs und Identitätskonstruktionen von Gruppen:<br />
Versuch einer Begrenzung der Identitätskonstruktion<br />
im Roman Herr Lehmann.<br />
Ríos Kuri, Sandra<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
Der Vortrag beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Sprache und sozialer Kognition.<br />
Sie ist interessiert an narrativen Diskursen, welche die Urbilder einer bestimmten<br />
Gesellschaft aktualisieren. Der Prozess dieser Aktualisierung durch die Narrative als<br />
kognitives Hilfsmittel der Kultur ist die zentrale Frage, der ich nachgehen werde. Die<br />
narrativen Diskurse, zusammen mit sozialen Werten und Praktika einer Gesellschaft,<br />
kreieren eine kollektive Weltanschauung.<br />
Dabei interessiere ich mich für die Konzeptualisierung der sozialen Identität durch<br />
Narrative. Die narrative Konstruktion des Begriffes ,,sozialer Antiheld” als eine Art Selbstidentifikation<br />
jener deutschen Erwachsenen, die in großen und weltstädtischen Zusammenhängen<br />
wohnen, zum Beispiel in Kreuzberg, Berlin. Der Zeitgeist der 30-jährigen<br />
Kreuzberger nach dem Mauerfall wird deutlich dank der Konzeptualisierung des<br />
Begriffes ,,sozialer Antiheld”. Der Berliner Zeitgeist fungiert sozusagen als Muster der<br />
sozialen Identität.<br />
Mit Herr Lehmann (2003), einem Roman des deutschen Schriftsteller Sven Regener,<br />
finden wir eine charmante Perspektive jener individuellen Identitätskonstruktion, die<br />
gleichzeitig eine kollektive Identität widerspiegelt. Herr Lehmann enthält alle Zutaten,<br />
die man braucht, um Identitätskonstruktionen von Gruppen zu zeigen. Mit Themen wie<br />
Kreuzberg, den Berliner Mauerfall, 30 werden, nicht mäßiger, aber regelmäßiger Biertrinker<br />
sein, arbeiten in einer Kneipe, verliebt in Eine, die einen nicht liebt und einem<br />
besten Freund, der Künstler der Dekonstruktion ist, haben wir ein paar Merkmale, die<br />
uns erlauben durch die lehmannische Welt einzutauchen und uns selbst zu erkennen.<br />
Die Lektüre von Herr Lehmann ist nicht nur ein subjektives Phänomen des Verständnisses,<br />
sondern auch eine kollektive Erfahrung der Welt. Narrative gilt als Mittel der<br />
29
30<br />
Sektion 1 v Sección 1<br />
Identität. Sie ist die Brücke, um unsere einzigartige und kollektive Identität auszudrükken.<br />
Herr Lehmann gibt Hoffnung: Wenn er in Ordnung ist, dann bin ich es auch.<br />
Zwischen Literatur und Film: Kuhle Wampe oder wem gehört die Intermedialität.<br />
Dr. Robin, Guillaume<br />
Universität Paris Descartes, Frankreich<br />
Die Zwanziger Jahre bilden das Goldene Zeitalter des deutschen Kinos, das durch<br />
seine expressionistischen Filme von Murnau, Fritz Lang und Robert Wiene weltbekannt<br />
geworden ist. Die Arbeitersportfilme bleiben aber oft ein vergessener Aspekt dieser<br />
Goldenen Jahre. Die Filme, die als Arbeitersportfilme bezeichnet werden, sind mit dem<br />
Aufschwung der Arbeitersportbewegung in der Weimarer Republik eng verbunden.<br />
Um die anlässlich der IVG in Warschau eingeleitete Reflexion über die Entstehung<br />
des Arbeitersportfilms und deren Definition als hybride oder autonome Gattung fortzusetzen,<br />
wollen wir auf die Intermedialität fokussieren, die dem bekanntesten der Arbeitersportfilme<br />
zugrunde liegt: Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt.<br />
Dieser im Jahre 1932 gedrehte Film wird als einer der ersten proletarischen Tonfilme<br />
der Weimarer Republik abgestempelt. Der Initiator dieses Films ist der Regisseur Stalan<br />
Dudow, aber Bertolt Brecht nahm am Drehbuch teil. Es ist interessant damit festzustellen,<br />
dass Kuhle Wampe ein Film der Intermedialität ist und auf einem ständigen Hin und<br />
Her zwischen den dramaturgischen Prinzipien des Brechtschen Theaters und den modernen<br />
Filmtechniken beruht, die mit den Zwanziger Jahren einen vollen Aufschwung<br />
erlebten.<br />
Wie drückt sich die in Kuhle Wampe zugrunde liegende Wechselbeziehung zwischen<br />
Theater und Film aus? Inwiefern dient der intermediale Dialog zur Konstruktion<br />
einer proletarischen Identität im Brechtschen Sinne und erlaubt, über den bloßen Dokumentarfilm<br />
hinauszugehen? Welches Bild des Proletariats wird damit vermittelt? Zu<br />
welchen Mitten greift Kuhle Wampe, um die kollektive Identität darzustellen? In diesem<br />
Beitrag soll auf all diese Fragen eingegangen werden.<br />
* Heroínas pírricas: algunas figuras femeninas de Heinrich von Kleist<br />
Rodríguez Moreno, Susy<br />
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Mexiko<br />
En 2011 se cumplen 200 años de la muerte de uno de los escritores alemanes que<br />
influyó, de manera infalible, la literatura alemana del siglo XX: Heinrich von Kleist. Al<br />
menos tres biografías y un estudio (de lo más actualizado) sobre su vida, su obra y su recepción<br />
se han publicado casi simultáneamente en los últimos ocho años, sin descartar<br />
muchos estudios en torno a este autor. No es gratuito, ni el único mérito el bicentenario<br />
de su muerte, más bien es una relectura de las obras de uno de los primero “autores de<br />
la [pos]modernidad” como lo apuntó Christa Wolf.
Sektion 1 v Sección 1<br />
Considero uno de los aspectos que instala a Kleist en la “Modernidad” es su tratamiento<br />
de la mayoría de sus figuras femeninas, su reinterpretación si ésta proviene de<br />
la mitología griega: Penthesilea, Alcmena, Catalinita, Littengarde, Josefa y la Marquesa<br />
de O… Figuras que proyectan fuerzas internas, que las guían, las determinan, que las<br />
colocan fuera de los términos sociales propios. Sin embargo, estos impulsos reconocidos<br />
por ellas desde sus principios éticos provocan un desgajamiento anímico. No es<br />
el propósito consciente de estas mujeres cuestionar el sistema (social, judicial, religioso…),<br />
pero lo develan, lo muestran tan enclenque como es: con sus lados oscuros, incompletos,<br />
frágiles. Y muchas veces las heroínas de Kleist encarnan lo que su creador<br />
vivió: la pérdida de la gracia -su negación (o imposibilidad) de ser marioneta-. El desmoronamiento<br />
de éste (proyectado en ellas) representa, al final de cuentas, la victoria del<br />
ideal: el encuentro de la puerta trasera del paraíso (pasando por el Hades).<br />
*Sonnenallee y Good bye Lenin!:<br />
la RDA como objeto de representación<br />
Rotemberg, Silvina<br />
Universidad de Buenos Aires, Argentinien<br />
Der Beitrag geht der Frage nach, wie die DDR in zwei Filmen dargestellt wird,<br />
welche zu markanten Symbolen der Ostalgie geworden sind: Sonnenallee und Good<br />
bye Lenin!. Wir vertreten die Meinung, dass beide Filme eine für den Zuschauer offensichtlich<br />
nicht reale DDR-Fantasie kreieren. Beide Filme sind wie autonome Welten,<br />
die eine treue Darstellung der Wirklichkeit umgehen. Sie stellen die DDR mit Mitteln<br />
der filmischen Sprache dar, aber sie bedienen sich zugleich Darstellungstechniken<br />
der Literatur, im Fall von Sonnenallee des Theaters und in Good bye Lenin! des Fernsehjournalismus.<br />
Sonnenallee ist ein Film, der ausschließlich im Studio gedreht wurde,<br />
die Mauer und typische Gebäude der DDR wurden modellgetreu nachgebaut, die<br />
Figuren bewegen sich innerhalb eines Bühnenbildes, ihre Welt entfaltet sich zwischen<br />
den Requisiten. Der Regisseur schrieb gemeinsam mit Thomas Brussig, Autor des<br />
Romans Am kürzeren Ende der Sonnenallee, ein ausgesprochen literarisches Drehbuch.<br />
Good bye Lenin! macht seinerseits die fiktive Darstellung der DDR zur Achse der dramatischen<br />
Handlung. Es wird dabei mit einem Drehbuch gearbeitet, das sich Darstellungsmitteln<br />
bedient, die sonst eher der Literatur zugeordnet werden, wie etwa die<br />
Dingsymbolik, und verweist, wie auch in Sonnenallee, auf die literarische Gattung des<br />
Märchens.<br />
La ponencia tiene como objeto indagar cómo ha sido representada la RDA en<br />
dos películas convertidas en íconos de la Ostalgie: Sonnenallee y Good bye Lenin!.<br />
Consideramos que ambas películas construyen una RDA de fantasía y hacen evidente<br />
esa construcción para el espectador. Funcionan como universos autónomos que<br />
evaden una representación fiel de la realidad. Representan la RDA con herramientas<br />
31
32<br />
Sektion 1 v Sección 1<br />
del lenguaje cinematográfico pero emplean a la vez procedimientos propios de la<br />
literatura, en el caso de Sonnenallee también del teatro, y en Good bye Lenin! del noticiero<br />
televisivo. Sonnenalle es una película de estudio, el muro y edificios típicos de la<br />
RDA fueron recreados a partir de una maqueta, los personajes se mueven dentro de<br />
una escenografía, su mundo se despliega entre objetos de utilería. El director escribió<br />
junto con Thomas Brussig, autor de la novela Am kürzeren Ende der Sonnenallee, un<br />
guión de características fuertemente literarias. Por su parte, Good bye Lenin! toma la<br />
representación ficticia de la RDA como eje de la acción dramática. Lo hace desde un<br />
guión que emplea recursos originariamente propios de la literatura, como los objetos<br />
simbólicos, y remite, como sucede también en Sonnenallee, al género literario de los<br />
cuentos de maravillosos.<br />
Transkulturelle Räume und neue Immigration<br />
in Deutschland und Argentinien<br />
Dr. des. Saban, Karen<br />
Universität Heidelberg, Deutschland<br />
Im Zuge der Wirtschaftsemigration aus Bolivien, Peru und Paraguay sind in Argentinien<br />
transkulturelle Filme entstanden. Auch nach der Wende ist in Deutschland das Thema<br />
Migration im Kino stark vertreten. Verhandelt wird in beiden Fällen das Problem der<br />
Integration und der Identitätsfindung. Filme wie Bolivia (1999) von Adrián Caetano oder<br />
El niño pez (2009) von Lucía Puenzo zwingen dazu, die tradierten und romantisierenden<br />
Klischees um den Gründungsmythos Argentiniens als Schmelztiegel der Kulturen einer<br />
kritischen relecture zu unterziehen. Gleichzeitig konstruieren deutsche Filme wie Lichter<br />
(2003) von Hans-Christian Schmid und Gegen die Wand (2004) von Faith Akin soziale<br />
Topographien des Kulturkontakts, wobei durch ästhetische Verfahren Phänomene wie<br />
Diaspora und Ausgrenzung thematisiert werden.<br />
Der Vortrag legt den Schwerpunkt auf die neuen Zugehörigkeitsentwürfe und die<br />
daraus entstehenden „diasporischen Lebensräume“ (Clifford) der Einwanderer, in der<br />
Art wie sie in der Sprache, in den erzählten Räumen und in der Hybridisation der filmischen<br />
Gattungen zum Ausdruck kommen. Ausgehend von methodischen Prämissen<br />
der Kultur- und Transkulturellenwissenschaften wird gefragt: Wie werden in den<br />
Filmen die sozialen und kulturellen Räume konstruiert und welche Funktionen erfüllen<br />
sie? Können diese Raumkonstruktionen helfen, die realgeographischen Räume zu<br />
verstehen? Entstehen dabei im Kulturkontakt „Zwischenräume“ (Bhabha) mit kreativem<br />
Potential? Können überhaupt Ausgrenzung und Illegalität auch ihre eigene Grenze<br />
überschreiten und sich Richtung Begegnung und Neuorientierung entwickeln? Oder<br />
müssen optimistische Transkulturalitätskonzepte vor dem Hintergrund der Filme kritisch<br />
hinterfragt werden? Welche neuen Ergebnisse ermöglicht der Vergleich zwischen<br />
der neuen Filmlandschaft in Deutschland und in Argentinien?
Sektion 1 v Sección 1<br />
*La Francobia en las letras alemanas, de la defensa lingüístico – literaria<br />
a la construcciónde un estereotipo de identidad colectiva.<br />
Dr. Sánchez Loyola, Sergio<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
Die verschiedenen Bildungsversuche der germanischen Völker (der deutsche Sonderweg),<br />
die sie durchgehen mussten, um die Schaffung eines nationalen „Deutschtums“<br />
zu erreichen, fundamentierten sich in der Verteidigung des Eigenen und im Antiromanismus<br />
der Reformzeit, der schließlich mit der Zeit zu einer Frankophobie wurde,<br />
welche deutlich zu sehen ist in einigen literarischen Beispielen des erwähnten deutschen<br />
Sonderwegs. Ich interessiere mich daher für die Schaffung eines „völkischen Stereotyps<br />
gemeinsamer Identität“ in der deutschen Gesellschaft, der in der Frankophobie<br />
eine von den wichtigsten Verbreitungsmitteln fand, und mit dem damals versucht wurde,<br />
die verschiedenen bildenden Interesse der Gesellschaft zu vereinigen, was heute<br />
noch in einige Kommentaren von H. v. Kleist aber auch in verschiedenen literarischen<br />
Erwähnungen von Heinrich Heine, Rainer M. Rilke, Joseph Roth, Paul Celan und Patrick<br />
Süskind gefunden werden kann. Wie dieser Stereotyp erstanden ist und welche Rolle<br />
dieser in der Schaffung eines deutschen kulturellen und patriotischen Gefühls gespielt<br />
hat, sind zwei Elemente, die in dieser Arbeit behandelt werden.<br />
Los distintos intentos formativos por los que tuvieron que transitar los pueblos<br />
germanos a través de su derrotero especial (der deutsche Sonderweg) para alcanzar la<br />
formación de un constructo nacional en torno a la cultura alemana, se fundamentaron<br />
en la defensa de lo propio, en el antiromanismo propio de la Reforma que devino<br />
después en un sentimiento francofóbico visible en algunas alusiones literías propias de<br />
los distintos momentos fundacionales del devenir alemán. Me intereso entonces por<br />
la construcción en la sociedad alemana de un “estereotipo popular de identidad colectiva”<br />
con el que se intentó unificar al enorme magma cultural germano en un interés<br />
formativo propio que encontró en la francofobia a uno de sus medios más evidentes de<br />
difusión, como bien se puede apreciar en algunos comentarios de Heinrich von Kleist<br />
y en distintas alusiones literarias de Heinrich Heine, Rainer M. Rilke, Joseph Roth, Paul<br />
Celan y Patrick Süskind. Cómo se construyó este estereotipo y cuál fue su influencia en<br />
la construcción de un sentimiento cultural y patriótico alemanes son dos cuestiones<br />
que se abordan en esta investigación.<br />
*Hans Jürgen Syberberg: Verarbeitung der<br />
Vergangenheit und Erlösung - Die Deutschland-Trilogie und Parsifal<br />
Dr. Setton, Román<br />
Universidad de Buenos Aires, Argentinien<br />
In dieser Arbeit untersuche ich die Verarbeitung der Vergangenheit in der Filmproduktion<br />
von Syberberg, seine Behandlung der Verbindungen zwischen Volk und Macht<br />
33
34<br />
Sektion 1 v Sección 1<br />
und seinen Versuch, durch die Rückgewinnung von irrationalistisch-romantischen Tendenzen<br />
und mythischem Denken eine neue kollektive Identität zu etablieren. Im Einklang<br />
mit diesen Fragen wird hier seine Herangehensweise an die Beziehung zwischen<br />
dem Medium Film – und Kunst im Allgemeinen – und den vergangenen Modellen von<br />
Staat und Gesellschaft, die er ablehnt, untersucht, in Verbindung mit seinem künstlerischen<br />
Vorschlag, der an die Konstruktion eines kollektiven Subjekts orientiert ist. In<br />
Krisenzeiten der kollektiven Identität versucht Syberberg, die Befreiung von der Gegenwart<br />
zu verwirklichen und eine neue nationale Identität zu stiften.<br />
En este trabajo nos proponemos abordar la revisión del pasado en la producción<br />
cinematográfica de Syberberg, su tratamiento de los vínculos entre el pueblo y el poder,<br />
así como su intento de fundar una nueva identidad colectiva a través de la recuperación<br />
de ciertas tendencias del irracionalismo-romántico y el pensamiento mítico. En<br />
sintonía con estas cuestiones, indagaremos su abordaje de las relaciones entre el medio<br />
cinematográfico –y el arte en general– y los modelos de Estado y sociedad pretéritos<br />
que rechaza, junto con su propuesta artística orientada a la construcción de ese sujeto<br />
colectivo. Para ello, estudiaremos la trilogía sobre Alemania y el Parsifal. En tiempos de<br />
crisis de identidad colectiva, Syberberg persigue la redención del presente y una nueva<br />
identidad nacional.<br />
„Das Leben ist hier beschaulich und wunderbar“ –<br />
Zur Rolle der Fremde in Doris Dörries Prosa und Filmen<br />
Dr. Zaharia, Mihaela<br />
Universität Bukarest, Rumänien<br />
Egal ob es um Japan (Erleuchtung garantiert, Der Fischer und seine Frau, Kirschblüten.<br />
Hanami) oder Amerika – wo sie auch studierte – geht, um Bali oder Mexiko (Das blaue<br />
Kleid), spielt die Fremde für die Regisseurin und Schriftstellerin Doris Dörrie immer eine<br />
ausschlaggebende Rolle. Darin sucht sie nicht nur eine bereichernde Ergänzung ihrer<br />
eigenen menschlichen Formel, sondern auch Antworten für Fragen wie Leben und<br />
Tod oder Glück und Unglück. Eigentlich ist die Fremde bei Doris Dörrie als Flucht ins<br />
Anders[wo]sein zu verstehen. Zu zeigen, welchen inneren und äußeren Mechanismen<br />
sie dabei folgt, bleibt dann die Aufgabe unserer imagologisch und rezeptionsästhetisch<br />
orientierten Arbeit.
Sektion 2<br />
Migration und Fremdheit in der deutschsprachigen<br />
und lateinamerikanischen Literatur<br />
Sektionsleitung:<br />
Prof. Dr. Lila Bujaldón de Esteves<br />
Univ. Nacional de Cuyo, Argentina<br />
Dr. Olivia C. Díaz Pérez<br />
Universidad de Guadalajara<br />
Dr. Joachim Michael<br />
Universität Hamburg<br />
Konzept der Sektion<br />
Gegenstand der Sektion sind literarische Auseinandersetzungen mit den Phänomenen<br />
Fremdheit und Alterität, wie sie mit den vielschichtigen Migrationsprozessen vornehmlich<br />
im 20. Jahrhundert einhergehen. Angesprochen sind mit den Grenzüberschreitungen<br />
Erfahrungen von Verlust und Entwurzelung, die von der deutschsprachigen und<br />
lateinamerikanischen Literatur mannigfach artikuliert werden, ebenso wie Erkundungen<br />
des Neuen und Unbekannten bzw. Verkannten.<br />
Vieles spricht dafür, dass sich die Bewegung, die die Welt spätestens seit dem<br />
letzten Jahrhundert ergriffen hat, nicht mehr aufhalten lässt. Verfolgung, Krieg und<br />
Vertreibung sind bestimmend für Deutschland im 20. Jahrhundert, was sich nicht zuletzt<br />
in der Exilliteratur wiederspiegelt. Lateinamerika hat in diesen Aufbrüchen immer eine<br />
besondere Rolle gespielt. Hier schien eine Zukunft, die der Alte Kontinent verwirkt hatte.<br />
Hierher flohen u.a. deutschsprachige Intellektuelle vor den Nazis. Der Subkontinent<br />
wurde jedoch auch selbst zum Schauplatz grausamer Diktaturen (Argentinien, Brasilien,<br />
Chile usw.), die viele Intellektuelle ins Exil zwang. Hier stellt sich die Frage, wie sich die<br />
Vertreibung mit ihren schmerzhaften Erfahrungen von Verlust und Bedrohung in der<br />
literarischen Auseinandersetzung mit der Kultur des Gastlandes niederschlägt. Nicht<br />
zuletzt vor dem Hintergrund solcher existentiellen Erfahrungen der Entwurzelung hat<br />
der tschechisch-brasilianische Philosoph Vilém Flusser, der selbst vor den Nazis nach<br />
Brasilien floh, von der konstitutiven Bodenlosigkeit des Menschen gesprochen und gar<br />
eine „Philosophie der Emigration“ gefordert. Und tatsächlich scheint nicht absehbar,<br />
wie hinter diesen grundsätzlichen Heimatverlust zurückgegangen werden könnte.<br />
Fremdheit ist eine Erfahrung, der nicht mehr nur der Migrant ausgesetzt ist. Zu<br />
instabil ist auch das Heimische geworden unter dem Eindruck von fallenden Mauern<br />
und von Grenzen, die zunehmend zur Überschreitung einzuladen scheinen (und<br />
darum remilitarisiert werden). In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts kehrt sich das<br />
Verhältnis von Migration und Fremdheit weitgehend um: Migration entfaltet sich als<br />
35
36<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
vielfältiger Wanderungsprozess, der sich nun nach Europa und Nordamerika richtet.<br />
Während Einwanderungsländer (z.B. Mexiko) zu Auswanderungsländern werden,<br />
suchen Zuwanderer (auch aus Lateinamerika) nun Ziele auf, die sich bislang als Länder<br />
verstanden, die den Einheimischen in Europa vorbehalten waren. Dies spiegelt sich in<br />
einer Migrationsliteratur, die nicht zuletzt das interkulturelle Dazwischen zwischen dem<br />
Anderen und dem Eigenen (der Eltern und Großeltern) ausleuchtet. In dieser Literatur<br />
zeigt sich, dass die Arbeit suchenden „Gäste“ in Deutschland langsam zu Nachbarn<br />
werden. Ehe sich die Deutschen versehen, sind sie nicht mehr unter sich, und das Land<br />
ist ein anderes. Nicht nur die Zuwanderer und deren Nachkommen, sondern auch die<br />
Ansässigen werden von der Erfahrung der Fremdheit in ihrem Lebensumfeld erfasst.<br />
Zum Fremdwerden des eigenen Landes trägt in mancher Hinsicht auch das historische<br />
Ereignis der Deutschen Wiedervereinigung bei. Sie überwand einen weltgefährdenden<br />
Konflikt, aber sie führte auch diejenigen zusammen, die sich kaum mehr kannten<br />
bzw. kennen wollten. Die Wende-Literatur arbeitet hierbei u.a. eine neue Fremdheit<br />
heraus, die nicht mehr im Spannungsverhältnis zu dem steht, was deutsch ist. Sie<br />
macht deutlich, wie unter der Oberfläche anfänglicher nationaler Euphorie das geeinte<br />
Deutschland nicht mehr nur dasjenige bezeichnet, was den Deutschen als heimisch gilt.<br />
Dabei geht es insbesondere um die Auflösung jenes eigenen Deutschlands, das ohne<br />
die innerdeutsche Grenze zu existieren aufhörte.
Sektion 2 v Sección 2<br />
Montag, 05.03.2012<br />
Uhrzeit Ort<br />
8:30-10:00 Einschreibung Paraninfo<br />
10:00-11:30 Eröffnungsveranstaltung:<br />
Juárez 975<br />
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Generalrektor (Ecke Enrique Díaz<br />
der Universität Guadalajara / Rector general de la<br />
Universidad de Guadalajara. Mtro. Pablo Arredondo<br />
Ramírez, Rektor des Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrums CUCSH / Rector del Centro Universitario<br />
de Ciencias Sociales y Humanidades. Dr. Lilia Oliver<br />
Sánchez, Leiterin der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät / Directora de la División de Estudios<br />
Históricos y Humanos. Dr. Edmund Duckwitz,<br />
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland /<br />
Embajador de la República Federal de Alemania.<br />
Dr. Alfred Längle, Botschafter der Republik Österreich<br />
/ Embajador de Austria. Dr. Gisela Schneider,<br />
Deutscher Akademischer Austauschdienst / Servicio<br />
Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Dr. Olivia<br />
C. Díaz Pérez, Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes / Presidenta de la Asociación<br />
Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
de León)<br />
11:30-12.00 Empfang des Generalrektors der Universität<br />
Guadalajara<br />
12:00-12:45 Plenarvortrag Paulo Astor Soethe:<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer<br />
international vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
12:45-13:30 Plenarvortrag Ottmar Ette: Die Literaturen der Welt aus<br />
transarealer Perspektive<br />
13:45-14:30 Abfahrt zum Tagungsort (CUCSH)<br />
14:30-16:00 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
16:00-16:30 Einführung in die Sektion Raum 62 H**<br />
16:30-17.00 Ortrud Gutjahr Die Narration der Migration. Ein Abriss<br />
zur deutschsprachigen Migrationsliteratur<br />
Raum 62 H<br />
17:00-17:30 Anne Saint Sauveur-Henn Multiple Identität und<br />
Integration: eine Eigenart des Exils?<br />
Raum 62 H<br />
37
38<br />
17:30-18:00 Pause<br />
18:00-19:30 Kulturveranstaltung (Goethe-Institut): Kabaret und<br />
Musik mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll<br />
19:30 Empfang der Deutschen Botschaft<br />
Eröffnung Karikaturenausstellung Goethe-Institut<br />
Dienstag, 06.03.2012<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
Auditorium Salvador<br />
Allende<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
und Bibliothek<br />
Manuel Rodríguez<br />
Lapuente<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Hermann Funk:<br />
Auditorium<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?. Modelle zum<br />
Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz und ihre<br />
praktischen Konsequenzen<br />
Silvano Barba<br />
Semiplenarvortrag Friedhelm Schmidt-Welle:<br />
Auditorium Carlos<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und<br />
Alzheimer<br />
Ramírez Ladewig<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Christiane Zehl-Romeo Mexiko: Topos für Fremde und<br />
Heimat bei Anna Seghers<br />
Raum 62 H<br />
10:45-11:15 Klaus Eggensperger (In-Between – Anna Seghers‘<br />
Brasilienerzählung „Überfahrt<br />
Raum 62 H<br />
11:15-11:45 Olivia C. Díaz Pérez Mexiko als antitotalitärer Mythos<br />
im Werk von Anna Seghers<br />
Raum 62 H<br />
11:45-12:15 Pause<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Erwin Tschirner:<br />
Auditorium<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Silvano Barba<br />
Semiplenarvortrag Claudia Dornbusch:<br />
Auditorium Carlos<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche<br />
Wissenschaft?<br />
Ramírez Ladewig<br />
13:00-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
14:30-15:00 Lila Bujaldon de Esteves *Cuento y lápiz contra el<br />
nazismo. Una antología de 1936*<br />
Raum 62 H
Sektion 2 v Sección 2<br />
15:00-15:30 Frank Schulze „Verlust ideologischer Heimat in Reglers<br />
Spanienroman „Juanita“„<br />
Raum 62 H<br />
15:30-16:00 Sarah Anke Wegmann Keine Identität ohne Alterität<br />
– Eine Interpretation der Exilerfahrung Gustav<br />
Reglers anhand ausgewählter Werke und noch<br />
unveröffentlichter Briefe<br />
Raum 62 H<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Rainer Guldin Die Landschaft des Exils: Zum Verhältnis<br />
von Natur und Migration im Werk Vilém Flussers<br />
Raum 62 H<br />
17:00-17:30 Ivo Theele Losgelöst von Zeit und Raum: Das Hotel als<br />
heterotoper Warteraum in Ulrich Bechers Exil-Drama<br />
„Samba“<br />
Raum 62 H<br />
17:30-18:00 Joachim Michael Auswanderung und Tod Raum 62 H<br />
18:15-19:45 Kulturveranstaltung (Foro Cultural de Austria,<br />
Auditorium<br />
BMUKK):<br />
Lesung von Tarek Eltayeb<br />
Salvador Allende<br />
Donnerstag, 08.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Christian Fandrych: Zum Stil<br />
deutscher wissenschaftlicher Vorträge (auch) aus<br />
kontrastiver Sicht.<br />
Semiplenarvortrag Karen Pupp Spinassé:<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht<br />
in einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Silke Schuck „Unsere Welt brach auseinander“.<br />
Topographien der Fremdheit von Kleist bis Waldenfels<br />
10:45-11:15 Klaus Mueller Uhlenbrock Transnationale Migration<br />
und Literatur. Ein Beitrag zur literarischen Konfiguration<br />
von Lebensstrategien<br />
11:15-11:45 Hans Knoll Migration und Fremdheit im autobiographischen<br />
Schreiben: Harold Hatzolds Erinnerungen<br />
11:45-12:00 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
12:00-12:30 Christine Hüttinger Im bewegungslosen Erinnern, vor<br />
der Abreise, vor allen Abreisen, was soll uns aufgehen?”<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium Carlos<br />
Ramírez Ladewig<br />
Raum 62 H<br />
Raum 62 H<br />
Raum 62 H<br />
Raum 62 H<br />
39
40<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
12:30-13:00<br />
(Ingeborg Bachmann). Thematisierung von Identität,<br />
Heimat und Migration in der österreichischen Literatur.<br />
Isabel Hernández *La construcción de la identidad en<br />
la literatura suiza de migración: la narrativa de Catalin<br />
Dorian Florescu<br />
Raum 62 H<br />
13:00-13:30 Valentina Janisch Was die Wiener Musikszene<br />
über Migration erzählt: Verarbeitung von<br />
Migrationserfahrungen in Liedtexten<br />
Raum 62 H<br />
13:30-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
14:30-15:00 Norbert Wichard Fremdheit und Heimat in<br />
Mitteleuropa. Eine vergleichende Analyse von Literatur<br />
deutschsprachiger Autoren aus Ex-Jugoslawien und der<br />
‚innerdeutschen‘ Wendeliteratur<br />
Raum 62 H<br />
15:00-15:30 Cornelia Anna Maul Der Dritte Raum, nirgends. Terézia<br />
Moras Alle Tage im Spiegel der Transdifferenz<br />
Raum 62 H<br />
15:30-16:00 Enis Kadipinar „Ihre deutschen Wörter haben keine<br />
Kindheit“ Die kulturelle und hybride Identität in dem<br />
Werk „Das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen,<br />
aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus“<br />
von Emine Sevgi Özdamar<br />
Raum 62 H<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Regula Rohland de Langbehn Hans von Frankenberg<br />
(1840 – ca. 1916). Ein Historiker am Río de la Plata vor<br />
dem Ersten Weltkrieg<br />
Raum 62 H<br />
17:00-17:30 Vivian Finch Wo bin ich? Wilhelm Rotermunds “Die<br />
beiden Nachbarn. Bilder aus der Kolonie” und die<br />
Schwierigkeiten des deutschen Immigranten im späten<br />
19. Jahrhundert in Brasilien<br />
Raum 62 H<br />
17:30-18:00 Claudia Garnica de Bertona *Escribir en alemán desde<br />
la Argentina: Leonor Hary-Epp y su obra narrativa*<br />
Raum 62 H<br />
18:00-19:00 Abfahrt zum Paraninfo<br />
19:00 Kulturveranstaltung der Universität Guadalajara: Paraninfo<br />
Lehrstuhl „Cortázar“ (Cátedra Cortázar): Plenarvortrag Juárez 975<br />
Juan Villoro: *Te doy mi palabra. Un itinerario en la (Ecke Enrique Díaz<br />
traducción.<br />
de León)
Sektion 2 v Sección 2<br />
Freitag, 09.03.2012 11:30-12:30<br />
9:00-11:00 9:00-9:25 Reinhard Andress “... heiße ich<br />
daher die Emigration gut”: der<br />
Fall des Egon Schwarz<br />
9:25- 9:50 Egon Schwarz:<br />
Lesung auf Deutsch***<br />
9:00-11:00 10:00 – 11:00 -Elisabeth Siefer: Einführung in<br />
die Übersetzung<br />
-Egon Schwarz: Lesung auf<br />
Spanisch<br />
-Diskussion<br />
9:00-10:00<br />
Documental de Juliana Fischbein:<br />
des aparecer Exil und Erinnerung im Rahmen des<br />
Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er Jahre<br />
in Südamerika***<br />
Workshop Karen Schramm: Mündliches Erzählen im<br />
Fremdsprachenunterricht<br />
Workshop Dieter Jaeschke: Freundschaft, Ostalgie<br />
und weite Welt: Der Spielfilm „Friendship!“ (D 2010) im<br />
DaF-Unterricht<br />
Workshop Carmen Schier: Zur Arbeit mit Hörbüchern.<br />
Ein „Grenzgänger“ wird (neu) entdeckt<br />
Verlagspräsentation Martina Bartucz, Cornelsen<br />
Verlag: Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Verlagspräsentation Anne Robert, Hueber Verlage:<br />
Menschen<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: DaF<br />
kompakt – das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: „Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur<br />
Sprache<br />
11:00-11:30 Pause<br />
11:30-12:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven der Germanistik in<br />
Lateinamerika<br />
Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: Beste<br />
Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
61 H<br />
62 H<br />
63 H<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H<br />
64 H<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
41
42<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
11:30-12:30 Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven Tafelbildern<br />
am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz Neu“<br />
und „Logisch!“<br />
65 H<br />
Verlagspräsentation Christina Kuhn, Cornelsen Verlag:<br />
Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was ändert<br />
sich, was bleibt?<br />
66 H<br />
12:30-13:30 Abschlussplenum <strong>ALEG</strong> Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
13:30-15:00 Mittagessen Hof der Jurafakultät<br />
(siehe<br />
Campusplan)<br />
15:00-17:00 <strong>ALEG</strong>-Mitgliederversammlung Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
17:15-19:15 AMPAL- Mitgliederversammlung Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
20:00 Abendessen & Abschlussfeier El Callejón de<br />
los Rumberos.<br />
Chapultepec<br />
Ecke Lerdo de<br />
Tejada<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
** Die Tagungsräume befinden sich im 3. Stock des Gebäude H vom CUCSH.<br />
*** Teil der Sektion 2 und des Kulturprogramms; nähere Informationen im Kulturprogramm<br />
Beiträge in alphabetischer Reihenfolge<br />
„… heiße ich daher die Emigration gut“:<br />
der Fall des Egon Schwarz<br />
Dr. Andress, Reinhard<br />
Saint Louis Universität, USA<br />
Mit dem Cotta-Preis ausgezeichnet ist Egon Schwarz’ Unfreiwillige Wanderjahre<br />
(2005, ursprünglich 1979 als Keine Zeit für Eichendorff) die Autobiographie eines<br />
jüdischen Exilanten des Dritten Reiches. Der Exilweg führte von Wien über Bratislawa,<br />
ein Niemandsland zwischen Ungarn und Slowakien, Prag und Paris nach Südamerika,<br />
wo er in Bolivien, Chile und Ecuador zehn Jahre verbrachte, bevor es in die USA<br />
weiterging und er ein hochgeachteter Germanist und zum Mitbegründer der deutschen<br />
Exilstudien wurde.
Sektion 2 v Sección 2<br />
Die Autobiographie enthält einerseits eine Auseinandersetzung mit jenen Themen,<br />
die man für die Exilsituation erwarten würde: Verstoßenwerden, Verlust, Entwurzelung<br />
und die Erfahrung und Erkundung der Fremdheit. Doch, was die Autobiographie<br />
andererseits hervorhebt, ist, wie sich die Auseinandersetzung mit der Vertreibung aus<br />
Österreich und der Kultur der Gastländer literarisch und philosophisch niederschlägt.<br />
Schwarz gestaltet nämlich die Erfahrungen seines südamerikanischen Exildaseins in<br />
der literarischen Tradition des Picaro-Antihelden mit unglaublichen, dennoch wahren,<br />
Abenteuern und geht philosophisch der Frage nach, wie es mit den Möglichkeiten der<br />
freien Willensentscheidung angesichts überwältigender geschichtlicher Ereignisse<br />
steht. Trotz der Schwierigkeiten und Gefahren des Exils und seiner Zweifel an einer<br />
wirklich freien Willensentscheidung heißt er die Emigration als Prinzip gut, da sie<br />
im Fazit aus der heimatlichen Enge in die weite Welt führt und zur Gewinnung des<br />
Gleichgewichts in der Persönlichkeitsentwicklung beitragen kann. Das ist seine<br />
„Philosophie der Emigration“ im Sinne Vilém Flussers. In meinem Vortrag möchte ich<br />
Schwarz’ Buch in das Genre der Autobiographie einbetten und die hier ausgeführten<br />
Grundmotive anhand des Textes und anderer Quellen erläutern.<br />
*Cuento y lápiz contra el nazismo. Una antología de 1936<br />
Prof. Dr. Bujaldón de Esteves, Lila<br />
Universidad Nacional de Cuyo, Argentinien<br />
Im Rahmen der Studien zur deutschen Exilliteratur in Argentinien befasst sich<br />
die folgende Arbeit mit dem von Alfredo Cahn herausgegebenen und übersetzten<br />
Band „Cuentistas de la Alemania Libre“* [Erzähler freien Deutschlands]. Text- und<br />
Autorenauswahl, Prolog und inbesondere Clément Moreaus (1903-1988) Illustrationen<br />
werden hierbei im Zentrum der Untersuchung stehen. Dass sich Moreau - selber<br />
seit 1935 im argentinischen Exil - an dieser Ausgabe beteiligt hat, lässt das bereits<br />
vorhandene Kulturnetzwerk erkennen, um das sich die Verfechter eines „anderen“<br />
Deutschlands scharrten. Im Dialog zwischen Text und Bild kommt die Tragweite einer<br />
solchen Zusammenarbeit deutlich zum Ausdruck. Dieses kleine gemeinsame „Opus“<br />
bereichert sowohl die Laufbahn des Germanisten Alfredo Cahns (1902-1975) wie auch<br />
das frühe Werk Clément Moreaus in Argentinien. *Cuentistas de la Alemania Libre. Una<br />
antología compilada y traducida por Alfredo Cahn. Buenos Aires: Iman, 1936. 241 p.<br />
Este trabajo se propone presentar en el marco de la Literatura de Exilio alemán<br />
en la Argentina la antología compilada y traducida por Alfredo Cahn Cuentistas de la<br />
Alemania Libre*. Se analizará la selección de autores y cuentos llevada a cabo por el<br />
compilador, el prólogo que los precede y especialmente las ilustraciones de Clément<br />
Moreau (1903-1988) que acompañan los relatos. La colaboración del dibujante para<br />
realizar esta edición, también en el exilio argentino desde 1935, muestra la red cultural<br />
ya existente en esa época entre los defensores de “otra” Alemania, reflejada en el tomo<br />
43
44<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
por el diálogo entre texto e imagen. La trayectoria de Alfredo Cahn (1902-1975) como<br />
germanista y la obra temprana de Clément Moreau en la Argentina se ven enriquecidas<br />
con este pequeño “opus” conjunto. *Cuentistas de la Alemania Libre. Una antología<br />
compilada y traducida por Alfredo Cahn. Buenos Aires: Iman, 1936. 241 p.<br />
Mexiko als antitotalitärer Mythos im Werk von Anna Seghers<br />
Dr. Olivia C. Díaz Pérez<br />
Universidad de Guadalajara, México<br />
Anna Seghers’ Werk mit mexikanischer Thematik ist sehr eng mit den literarischen<br />
Mexiko-Bildern der ausländischen Intellektuellen, Schriftstellern oder Reisenden<br />
verbunden, die seit der Kolonialzeit den geographischen Ort Mexiko zur bloßen<br />
Projektionsfläche utopischer Entwürfe und exotischer Fluchträume gemacht haben.<br />
Besonders im 20. Jahrhundert löste Mexiko eine große Begeisterung unter vielen<br />
europäischen und US-amerikanischen Intellektuellen aus. Die Begegnung dieser<br />
Intellektuellen mit Mexiko ging meistens aus einer persönlichen Entscheidung hervor.<br />
Die deutschsprachigen Autoren hingegen, unter ihnen auch Anna Seghers, mussten<br />
ihre Begegnung mit dem Gastland Mexiko immer in Bezug auf ihre Vertreibung aus dem<br />
faschistischen Europa sehen, was auf unterschiedliche Art und Weise zum Gegenstand<br />
ihrer literarischen Arbeiten gemacht wurde. In diesem Vortrag möchte ich darauf<br />
eingehen, wie sich einerseits das Fremdheitsgefühl in Seghers` Texten mit mexikanischer<br />
Thematik offenbart und inwieweit sich Mexiko in ihnen und im Zusammenhang mit<br />
dem Nazionalsozialismus, dem mexikanischen Exil und der Wirklichkeit der DDR als ein<br />
antitotalitärer Mythos erweist.<br />
In-Between – Anna Seghers’ Brasilienerzählung „Überfahrt“<br />
Dr. Eggensperger, Klaus<br />
Universidade Federal do Paraná, Brasilien<br />
Überfahrt ist eine umfangreiche Erzählung von Anna Seghers aus dem Jahr<br />
1971. Ihr Protagonist ist ein junger Deutscher, der mit seinem Vater vor den Nazis ins<br />
brasilianische Exil geflohen ist und nach dem Zweiten Weltkrieg in das materiell wie<br />
moralisch daniederliegende Deutschland zurückgeht, um beim Aufbau der neuen<br />
Gesellschaftsordnung in der Ostzone und späteren DDR mitzuhelfen. Zweimal bekommt<br />
er die Gelegenheit, per Schiff nach Brasilien zurückzukehren. Von schrecklichen Zweifeln<br />
geplagt, ob seine große Jugendliebe in Brasilien noch lebt oder er frei dazu ist, sich mit<br />
einer bescheidenen Freundin in Ostdeutschland zu verbinden, lässt er die Chance zur<br />
Klärung verstreichen, flieht vor der Wahrheit.<br />
Die Erzählung wird in das Gesamtwerk Anna Seghers’ eingeordnet und danach<br />
befragt, wie kulturelle Alterität mit sexueller Differenz verbunden, also das literarische<br />
Motiv „Mann zwischen zwei unterschiedlichen Frauen“ (Lebensweisen, Kulturen)
Sektion 2 v Sección 2<br />
entwickelt wird. Dabei geht es besonders um den Zweifel in der Liebe und den<br />
Wunsch nach Gewissheit – hier mit der Problematik der deutschen Emigranten<br />
verbunden, im postfaschistischen Deutschland, dem „Land der kalten Herzen“, wieder<br />
Fuß zu fassen. Dazu kommt, wie in anderen späten Texten der Seghers, die versteckte<br />
Auseinandersetzung mit der eigenen Partei und dem politischen Glauben. Und nicht<br />
zuletzt lässt sich auch eine poetologische Ebene aufzeigen, wo eine der begabtesten<br />
deutschsprachigen Erzählerinnen des 20. Jahrhunderts über das Erzählen reflektiert.<br />
Wo bin ich? Wilhelm Rotermunds „Die beiden Nachbarn.<br />
Bilder aus der Kolonie“ und die Schwierigkeiten des deutschen<br />
Immigranten im späten 19. Jahrhundert in Brasilien<br />
Finch, Vivian<br />
Vanderbilt Universität, USA<br />
Wenn die Immigrationsgeschichte in Südbrasilien diskutiert wird, muss man<br />
den Namen Wilhelm Rotermund schon gehört haben. Seine Rolle ist wichtig für das<br />
Verständnis verschiedener Aspekten der deutschen Präsenz in Brasilien, besonders für<br />
die Präsenz der Lutheraner. Wilhelm Rotermund ist im Jahre 1874, nachdem er an der<br />
Universität Jena promoviert wurde, in Rio Grande do Sul, Brasilien angekommen. Er ist<br />
bis zu seinem Tod im Jahre 1925 in der Stadt São Leopoldo geblieben. Rotermund hat in<br />
dieser Zeit als lutherischer Pfarrer gepredigt, eine Schule und einen Verlag gegründet,<br />
und einen Kalender für die deutschen Immigranten veröffentlicht, in dem er seine<br />
eigene Literatur geschrieben hat.<br />
Eins seiner Werke, „Die beiden Nachbarn. Bilder aus der Kolonie,“ das 1883/1884<br />
in Rotermunds eigenen Kalender für die Deutschen in Brasilien erschienen ist,<br />
beschreibt ganz genau das Leben der deutschen Immigranten im Land zu der Zeit,<br />
und behandelt verschiedene Themen, die für ihn und für diese Zeit wichtig waren,<br />
wie Heimat, Identität, und Religion. In diesem Aufsatz werde ich diese Themen näher<br />
analysieren, mit dem Ziel, ein neues Verständnis des deutschen Immigranten zu<br />
finden. Dieses Verständnis ist nicht nur mit diesen Themen verbunden, sondern auch<br />
im Begriff Regionalismus verankert – ein Begriff, der in Deutschland beginnt, und in<br />
Brasilien wieder belebt wird.<br />
*Aus Argentinien in deutscher Sprache: Das erzählerische<br />
Werk von Leonor Hary-Epp/Escribir en alemán desde la Argentina:<br />
Leonor Hary-Epp y su obra narrativa<br />
Garnica de Bertona, Claudia<br />
Universidad Nacional de Cuyo, Argentinien<br />
Während meiner Forschung über die auslandsdeutsche Literatur in Argentinien<br />
konnte ich drei Etappen in deren geschichtlichen Entwicklung feststellen: Diese<br />
45
46<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
bezeichne ich als die Frühperiode (1870-1933), die Blütezeit (1933-1945) und die<br />
Spätperiode (1945-1970). Leonor Hary-Epp (Meran, Tirol, 1931-?) ist ohne Zweifel die<br />
herausragende Autorin der Spätperiode. Ihre Romane*, die meistens in Argentinien<br />
spielen, wurden jedoch in Deutschland veröffentlicht und sogar ins Spanische<br />
übersetzt. Sie zeigen eine große Bandbreite an argentinischen, deutschen und<br />
deutschargentinischen Figuren, die von großem Interesse für die imagologische<br />
Forschung sind. Diese Untersuchung präsentiert und beschreibt das Werk der<br />
Schriftstellerin Hary-Epp und zeigt die Aspekte ihrer Arbeit auf, die sie aus der Masse<br />
herausragen lassen, um sowohl ihre Herkunftskultur wie auch ihre Zielkultur zu<br />
würdigen. *Amado mío. München: Biederstein, 1955 / Die Frau des Fremden.<br />
München: Biederstein, 1956 / Die argentinische Heirat. Stuttgart: Europäischer<br />
Buchklub, 1961 / Auf den Boulevards der Pampa. München: Biederstein, 1970 / Die<br />
brasilianischen Blätter. Stuttgart: Werner Gebühr, 1973 / Santa Maria der guten Lüfte.<br />
München/Zürich: Droemer/Knaur, 1980.<br />
A través del estudio de la literatura en alemán escrita en la Argentina he podido<br />
establecer tres etapas de su desarrollo histórico: la que llamo de los comienzos (1870-<br />
1933), la del apogeo (1933-1945) y la de conclusión (1945-1970). Leonor Hary-Epp<br />
(Merano, Tirol, 1931- ¿?) es precisamente la escritora más destacada de la última. Sus<br />
novelas*, que mayormente transcurren en Argentina, pero que fueron publicadas<br />
preferentemente en Alemania y hasta traducidas al español, presentan un repertorio<br />
amplio de personajes argentinos, alemanes y germanoargentinos que revisten un<br />
marcado interés imagológico. Este trabajo pretende presentar y describir la labor de<br />
Hary-Epp como escritora, a la vez que marcar los aspectos que la sitúan en un lugar<br />
privilegiado para valorar tanto su cultura de origen como la de destino. *Amado mío.<br />
München: Biederstein, 1955 / Die Frau des Fremden. München: Biederstein, 1956 / Die<br />
argentinische Heirat. Stuttgart: Europäischer Buchklub, 1961 / Auf den Boulevards der<br />
Pampa. München: Biederstein, 1970 / Die brasilianischen Blätter. Stuttgart: Werner<br />
Gebühr, 1973 / Santa Maria der guten Lüfte. München/Zürich: Droemer/Knaur, 1980.<br />
Die Landschaft des Exils: Zum Verhältnis von Natur<br />
und Migration im Werk Vilém Flussers<br />
Prof. Dr. Guldin, Rainer<br />
Università della Svizzera Italiana (Lugano), Schweiz<br />
Vilém Flusser hat im Laufe der Jahre verschiedene Texte zur kulturellen und<br />
philosophischen Bedeutung der Natur verfasst. Neben Natural:mente: vários acessos ao<br />
significado da natureza (1979), welches 2000 auf Deutsch unter dem Titel Vogelflüge<br />
publiziert wurde und eine Reihe von scharfsinnigen phänomenologischen Essays<br />
zu unterschiedlichen Landschaftsmomenten enthält, sei noch an das Natur-Kapitel<br />
in Brasilien oder Die Suche nach dem neuen Menschen (1994) und den auf Französisch
Sektion 2 v Sección 2<br />
verfassten Text Orthonature / Paranature (1978) erinnert. Im Essay „Die Zeder im Park“,<br />
das in Vogelflüge enthalten ist, versucht Flusser, die existentielle Situation des bodenlosen<br />
Migranten auf fremdem Boden anhand des Bildes einer Zeder einzufangen. Im Natur-<br />
Kapitel aus Brasilien hingegen entwickelt er aus der spezifischen Beschaffenheit der<br />
tropischen Natur Brasiliens, die er den weitgehend gezähmten Landschaften Europas<br />
entgegensetzt, so etwas wie eine philosophische Reflexion zur möglichen Ausformung<br />
unterschiedlicher kollektiver kultureller Identitäten.<br />
Die Frage, der ich in meinem Beitrag nachgehen will, ist dem Verhältnis von<br />
Landschaft und Identität im Werk Vilém Flussers gewidmet. Welche Beziehung lässt sich<br />
zwischen den beiden Begriffen definieren? Welche Rolle spielen Landschaften bei der<br />
Herausbildung individueller und kollektiver Selbstbestimmungen? Wie verändert sich<br />
dieses Verhältnis im Falle von Migration oder Exil? Und schließlich: Gibt es bei Flusser so<br />
etwas wie eine Landschaft des Exils und welche Rolle spielt sie in seiner Formulierung<br />
einer Philosophie der Migration?<br />
Die Narration der Migration.<br />
Ein Abriss zur deutschsprachigen Migrationsliteratur<br />
Prof. Dr. Gutjahr, Ortrud<br />
Universität Hamburg, Deutschland<br />
Die seit dem Ende der 1970er Jahre in größerer Zahl erschienenen Publikationen<br />
von Autor/inn/en, die nach Deutschland immigriert sind und in ihrem Schreiben den<br />
Suchbewegungen zwischen unterschiedlichen kulturellen Identifikationsangeboten eine<br />
literarische Form geben, lenkten die Aufmerksamkeit nachhaltig auf die Gestaltung von<br />
Interkulturalität als Themengebiet und ästhetisches Verfahren in der deutschsprachigen<br />
Literatur. Besonders diejenigen Autor/inn/en, die einen Teil ihrer Sozialisation in Ländern<br />
erfuhren, mit denen Deutschland seit Ende der 1950er Jahre Anwerbeabkommen für<br />
ausländische Arbeitskräfte geschlossen hatte, machten das Erlernen der deutschen<br />
Sprache, Integrationsversuche und die damit verbundene Möglichkeit eines<br />
Bildungsaufstiegs zu bevorzugten Sujets ihres Schreibens. Die Protagonist/inn/en<br />
dieser Texte durchreisen nicht nur geographische Räume, sondern verändern in der<br />
Auseinandersetzung mit der ›Zielkultur‹ ihrer Migration auch die Beziehung zum<br />
kulturellen Kontext ihrer Sozialisierung. Dabei wird nicht selten das Zwischen-Zwei-<br />
Kulturen-Sein als ständiges Unterwegssein im Sinne neuer Identitätsfindung gefasst.<br />
Mit dieser ›Narration der Migration‹ hat sich eine spezifische Metaphorik herausgebildet,<br />
mit welcher der Erfahrung des Lebens in unterschiedlichen Wertekontexten Ausdruck<br />
verliehen wird. Auffällig sind Metaphern für den sprachlichen Akkulturationsprozess<br />
wie auch für die Verortung in einem Zwischenraum, wobei Muttersprache und<br />
›Fremdsprache‹ häufig zu einem neuen Artikulationsmedium amalgamieren und die<br />
Reflexion kultureller Prägung auf neue Weise möglich wird. Denn es geht nicht nur um<br />
47
48<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
das Erlernen der fremden Sprache, sondern auch um eine damit verbundene kulturelle<br />
Übersetzungsleistung und die Chance neuer Selbsterkundung und Welterschließung. Die<br />
Selbstsuche der Hauptfigur wird häufig durch eine naive, den kulturellen Zusammenhang<br />
scheinbar nicht kennende, pikareske Erzählperspektive geleitet. Mit der Insistenz<br />
auf Detailbeobachtungen, die aus dem kulturellen Bedeutungsnetz herausgelöst<br />
werden, können gängige Zuschreibungen hinterfragt und Tabus umgangen werden,<br />
die kulturspezifisch regeln, was nicht ausgesprochen werden darf. Der Vortrag wird<br />
den innovativen Entwicklungsprozess der deutschsprachigen Literatur unter den<br />
Bedingungen von Migration anhand zahlreicher Textbeispiele erläutern.<br />
* Die Konstruktion der Identiät in der schweizerischen Migrationsliteratur:<br />
Catalin Dorian Florescus Erzählwerk/<br />
La construcción de la identidad en la literatura suiza de migración:<br />
la narrativa de Catalin Dorian Florescu<br />
Prof. Dr. Hernández, Isabel<br />
Universidad Complutense de Madrid, Spanien<br />
Obwohl sich das Phänomen später als in Deutschland entwickelte, kann man<br />
auch im Fall der Schweizer Literatur von „Migrationsliteratur“ sprechen. Autoren<br />
ganz unterschiedlicher geographischer Herkunft haben anhand ihrer auf Deutsch<br />
verfassten Texte einen „dritten Raum“ geschaffen, mit Hilfe dessen sie neue Themen<br />
und Motive in die helvetische Literatur eingeführt haben. Einer der meistgelesenen<br />
Autoren ist der junge Schriftsteller rumänischer Abstammung Catalin Dorian Florescu<br />
(Temischvar, 1967), der seit der Veröffentlichung seines ersten Romans, Wunderzeit<br />
(2001), immer wieder aufzeigte, wie dieser „dritte Raum“ der einzig verbleibende<br />
Raum ist, in dem die verlorene (eigene) Identität nach dem Migrationsprozess<br />
(wieder-)gefunden werden kann. Eine Analyse der bisher veröffentlichten Romane<br />
dieses Autors zeigt die literarischen Verfahren, auf die er dabei zurückgreift,<br />
insbesondere das Erinnerungsvermögen.<br />
Aunque con posterioridad al desarrollo del fenómeno en Alemania, también puede<br />
hablarse en la actualidad del fenómeno “literatura de migración” en las letras suizas.<br />
Autores procedentes de muy diversas latitudes han constituido a través de sus textos<br />
escritos en alemán un “tercer espacio” a través del cual se han introducido nuevos temas<br />
y motivos en la literatura helvética. Uno de los autores más leídos es el joven de origen<br />
rumano Catalin Dorian Florescu (Timisoara, 1967), quien ya desde la publicación de su<br />
primera novela, Wunderzeit (2001), puso de manifiesto cómo este “tercer espacio” es<br />
el único lugar posible en el que resistir para conseguir encontrar la propia identidad<br />
perdida tras el proceso de migración. Un análisis de las novelas publicadas hasta ahora<br />
por este autor mostrará los recursos literarios utilizados para ello, de entre los que<br />
destaca fundamentalmente uno: la memoria.
Sektion 2 v Sección 2<br />
„Im bewegungslosen Erinnern, vor der Abreise, vor allen Abreisen,<br />
was soll uns aufgehen?“ (Ingeborg Bachmann).<br />
Thematisierung von Identität, Heimat und Migration<br />
in der österreichischen Literatur.<br />
Dr. Hüttinger, Christine<br />
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Mexiko<br />
In meinem Beitrag gehe ich von Jean Amérys Essay „Wieviel Heimat braucht<br />
der Mensch?“ aus, in dem er die Unmöglicheit der Reintegration in eine räumliche<br />
Gegebenheit analysiert, weil die verlorene Zeit nicht wiedergewonnen werden kann.<br />
Daran anknüpfend erläutere ich den Text von Barbara Frischmuth „Das Heimliche und<br />
das Unheimliche“, in der sie Ängste und Vorbehalte vor dem Migrationshintergrund vor<br />
allem der muslimischen Kultur analysiert. Österreich als Zielland der Emigration, die auf<br />
die dreißiger Jahre (Alya Rachmanova) zurückgeht, weist heute prominente Vertreter<br />
wie Vladimir Vertlieb und Dimitré Dinev auf. Symptomatisch für die Veränderung des<br />
klassischen Österreich-Begriffes sind Yildiz und Eltayeb. Heimat ändert sich, Heimat<br />
wird problematisch, phantastisch dargestellt von Ingeborg Bachmann in „Jugend<br />
in einer österreichischen Stadt“, in der sie gegen Vergessen und Verdrängen der NS-<br />
Vergangenheit anschreibt. Für die erste grosse Welle der Migration im Nationalsozialismis<br />
nenne ich stellvertretend Jean Améry, Theodor Kramer und Albert Drach. Dass die<br />
Heimat unheimlich wird, ist ebenfalls ein Thema mit einer langen Tradition, als Beispiele<br />
seien Klaus Höffer und Cornelius Hell genannt. Was wir als gegeben annehmen, ist ein<br />
Konstrukt unserer Erinnerungsfähigkeit, ein Thema um das die Romane von Marlene<br />
Streeruwitz kreisen.<br />
Was die Wiener Musikszene über Migration erzählt:<br />
Verarbeitung von Migrationserfahrungen in Liedtexten<br />
Janisch, Valentina<br />
OeAD, Österreich, Universidad de Guadalajara, Mexiko<br />
Im Jahr 2011 leben 1,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich,<br />
das ist fast ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. In Wien hat sogar jeder dritte Einwohner<br />
Migrationshintergrund. Und hinter jedem der fast 500.000 Menschen, die es aus<br />
unterschiedlichen Gründen aus dem Ausland nach Wien verschlagen hat, steht ein – oft<br />
dramatisches, traumatisches – Einzelschicksal. Einschneidende persönliche Erlebnisse<br />
und besonders traumatische Ereignisse wie eine erzwungene Flucht aus der Heimat<br />
und der Versuch, in einer neuen, unbekannten Welt Fuß zu fassen und seine Identität<br />
zwischen alter und neuer Heimat zu finden, werden oft in Textform verarbeitet – sei<br />
es in einem Tagebuch, das versteckt in einem Winkel die Freuden und Schmerzen des<br />
Besitzers für immer geheim hält, sei es in Form von Texten, die in Rhythmen gekleidet<br />
gleichsam in die Welt hinausgeschrien werden. Der Vortrag arbeitet anhand von<br />
49
50<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
aktuellen, sehr erfolgreichen Beispielen aus der Wiener Musikszene die Verarbeitung<br />
von Flucht, Migration und Leben in einer „neuen Heimat“ in Liedtexten heraus. Im<br />
Anschluss an den Vortrag soll über die Bedeutung von literarischer Verarbeitung<br />
von Migrationserfahrung in Form von Liedtexten diskutiert werden und über deren<br />
Funktion einer psychologischen Katharsis in Abgrenzung zu effekthascherischer<br />
Selbstdarstellung und absatzfördernder Dramatisierung persönlicher Schicksale.<br />
„Ihre deutschen Wörter haben keine Kindheit“<br />
Die kulturelle und hybride Identität in dem Werk „Das Leben ist eine<br />
Karawanserei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich<br />
raus“ von Emine Sevgi Özdamar<br />
Kadipinar, Enis<br />
Prepa Tec Campus Santa Catarina, Mexiko<br />
Es ist nicht nur die deutsche Gegenwartsliteratur, die durch Interkulturalität<br />
Brücken zu anderen Kulturen schlägt, sondern auch die deutsch-türkische Literatur, die<br />
die Isolation durchbricht und Brücken zwischen Orient und Okzident baut.<br />
Eine der bedeutendsten Autorinnen ist Emine Sevgi Özdamar, die ihre<br />
Erfahrungen von konventionellen Erzähltechniken freimachend – wie das bisher in der<br />
Gastarbeiterliteratur zu lesen war – ihr literarisches Schaffen vorlegt. Erstmalig stellt sie<br />
neben Feridun Zaimoğlu eine deutschtürkische Gegenwartsliteratur dar, deren Absicht<br />
nicht Sozialkritik, sondern die poetische Untersuchung der sozialen Zusammenhänge<br />
und des Fremdseins ist. Das Ziel des Artikels ist es darzustellen, mit welcher Erzähltechnik<br />
Özdamar in ihrem Roman „Das Leben ist eine Karawanserei“ die kulturelle und hybride<br />
Identität bearbeitet und welchen Stellenwert dabei die Metasprache in Bezug auf die<br />
Fremdheit einnimmt.<br />
(Schlüsselwörter: Interkulturalität, Gegenwartsliteratur, Fremdwahrnehmung und<br />
Migrantenliteratur)<br />
Migration und Fremdheit im autobiographischen Schreiben:<br />
Harold Hatzolds Erinnerungen<br />
Dr. Knoll, Hans<br />
Universidad Nacional de Córdoba, Argentinien<br />
„Die Tragik eines Menschenlebens, nach Erlebnissen niedergeschrieben“ – mit<br />
diesem Untertitel umschreibt Harold Hatzold das <strong>Programm</strong> seiner Memoiren. Tragik,<br />
wie sie der Autor versteht, ist unverschuldetes Unglück, das zum Strukturprinzip<br />
des eigenen Lebens und Leitmotiv seines Schreibens wird. Der Autor, Mitte des 19.<br />
Jahrhunderts in bescheidenste ländliche Verhältnisse Oberfrankens hineingeboren,<br />
blickt Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts aus Buenos Aires auf sein fast<br />
80-jähriges Leben zurück. Dieses Leben ist gekennzeichnet durch Vergeblichkeit,
Sektion 2 v Sección 2<br />
Unstetigkeit und Heimatlosigkeit. Der erste Teil seiner Erinnerungen ist Europa<br />
gewidmet, wo der Erzähler nach langen Wanderjahren als Handwerksbursche zunächst<br />
in der Schweiz, dann in England, vergeblich eine Existenz aufzubauen versucht, der<br />
zweite Teil befasst sich mit seinem ebenso wechselvollen Leben im Großraum Buenos<br />
Aires, wo er sich trotz zeitweiligen Wohlstands aber genau so wenig eine Grundlage für<br />
das Alter sichern kann. Unglück, so konstruiert der Autor, ist für ihn stets mit Egoismus,<br />
Missgunst und Ungerechtigkeit der Anderen, vor allem von Frauen verbunden, wobei er<br />
interessanterweise nicht bei den Ausländern, sondern bei seinen eigenen Landsleuten<br />
die Ursache seines Leidens sieht. Die Erfahrung von Fremdheit und Alterität ist bei ihm<br />
also immer sozial vermittelt, nicht geographisch oder ethnisch konditioniert. Dies führt<br />
ihn zu einer höchst undogmatischen Einschätzung seiner Umwelt und einer scharfen<br />
Kritik an der herrschenden Moral seiner Zeit. Als zweites Strukturprinzip des Werks lässt<br />
sich das Thema Migration ausmachen, das nicht nur die Existenz des Protagonisten<br />
bestimmt, sondern auch die Form seines Schreibens beeinflusst.<br />
Der Dritte Raum, nirgends. Terézia Moras Alle Tage im Spiegel<br />
der Transdifferenz<br />
Maul, Cornelia Anna<br />
Humboldt-Universität Berlin, Deutschland<br />
Prosatexte von Autorinnen und Autoren, die sich in mehreren kulturellen<br />
Deutungssystemen bewegen, werden in der Literaturkritik nicht selten einer<br />
biografistischen Lesart unterzogen. Von welch poetischer Dichte und Vielschichtigkeit<br />
transkulturelle Schreibweisen jedoch sein können, zeigt sich bei Betrachtung von<br />
Terézia Moras Debütroman Alle Tage (2004). Die Autorin, die innerhalb der deutschen<br />
Minderheit im ungarischen Sopron aufgewachsen, seit der Wende jedoch in Berlin<br />
wohnhaft ist, erzählt darin vom Kriegsflüchtling Abel Nema, der aus dem ehemaligen<br />
Jugoslawien in die deutsche Großstadt „B.“ kommt. Sein außergewöhnliches<br />
Sprachtalent, das es ihm ermöglicht, in Kürze zehn Sprachen perfekt und akzentfrei zu<br />
beherrschen, der eigenartige Geruch, der ihn umgibt, und sein Mangel an räumlichen<br />
Orientierungsvermögen lassen Abel Nema als Fremden par excellence erscheinen. Wie<br />
diese Andersheit des Protagonisten im Text narrativ inszeniert wird, werde ich mit Blick<br />
auf das kulturhermeneutische Modell der Transdifferenz darlegen. Denn anders als die<br />
vielfach zitierten Hybriditätskonzepte, die transkulturelle Identitäten in einem Dritten<br />
Raum verorten, betont der Transdifferenzansatz das Fortbestehen der Differenzen<br />
mitsamt den daraus resultierenden Schwierigkeiten für die Identitätskonstitution. Im<br />
Hinblick auf Abel Nemas Nichtidentifizierbarkeit wird zu fragen sein, welche Rolle die<br />
Darstellung von Raum und Zeit, die kontinuierlich wechselnden Erzählperspektiven<br />
und nicht zuletzt der eigentümliche Sprachduktus des Romans spielen. Abschließend<br />
möchte mein Beitrag zeigen, wie Terézia Mora, die sich selbst der Diskussion um ihre<br />
51
52<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
nationalliterarische Identität mit der Aussage entzieht, sie sei „genauso deutsch wie<br />
Kafka“, in Alle Tage eine Poetik der Transdifferenz beschreibt, die auch als Modell zur<br />
Analyse der Literarizität anderer transkultureller Texte fruchtbar gemacht werden kann.<br />
Auswanderung und Tod<br />
Dr. Michael, Joachim<br />
Universität Hamburg, Deutschland<br />
Das Thema der Migration erscheint bei W.G. Sebald primär vor dem Hintergrund der<br />
Verfolgung. Somit stellt sich die Auswanderung zunächst als eine Form des Überlebens<br />
dar. Was jedoch in Die Ausgewanderten deutlich wird, ist, dass sich Überleben und<br />
Verlust kaum die Waage halten. Alle vier in dem eigenwilligen Roman beschriebenen<br />
Schicksale enden nicht nur mit dem Selbstmord. Alle vier Figuren nehmen sich lange<br />
Zeit nach der Emigration das Leben. Dies bedeutet, dass die Auswanderung letztlich<br />
keine Rettung birgt. Das instabile Überleben der Auswanderer bleibt dauerhaft von<br />
der Negation bedroht und gibt ihr schließlich nach. Die Ferne in Raum und Zeit bietet<br />
keinen Schutz vor den Gräuel. Vor diesem Hintergrund gibt sich das Überleben der<br />
Geflüchteten als ein langwieriges Auswandern aus dem Leben zu erkennen. Der Ich-<br />
Erzähler rekonstruiert diese Schicksale ausgehend von punktuellen Berührungspunkten<br />
zu den Figuren. Er trotzt sie dem allgemeinen intentionalen Vergessen ab und bringt<br />
damit umrisshaft die Vernichtung zum Vorschein, die noch weit über den Holocaust<br />
und den Zweiten Weltkrieg hinaus fortwirkt. Das Buch gibt dem Grauen Ausdruck, dass<br />
es nicht vorbei ist, selbst wenn die Gewalt Jahrzehnte zurückliegt. Dieses Grauen befällt<br />
auch den Unbeteiligten, der sich in der Lektüre der Erzählungen damit auseinander<br />
setzen muss, dass die Zeit zwar fortschreitet, die Geschichte aber sich in Zerstörungen<br />
vollzieht, die ausweglos und unaufhebbar bleiben.<br />
Transnationale Migration und Literatur.<br />
Ein Beitrag zur literarischen Konfiguration von Lebensstrategien<br />
Dr. Müller Uhlenbrock, Klaus<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
Migration zwischen Weltregionen, Kontinenten und Staaten gehört zu den<br />
ältesten Sozialisationspraktiken der Menschheit. Die Form der nomadischen<br />
Bewegung war die Voraussetzung der anthropologischen Expansion auf der<br />
Erde. Die aktuelle Phase der Globalisierung in Form von räumlicher Mobilität<br />
impliziert Grenzüberschreitung von Waren, Kapitalströmen und Personen, die darauf<br />
angewiesen sind, der Migration entsprechende Lebensstrategien zu entwickeln.<br />
Die von der Migration ausgehenden Impulse werden von einer interdisziplinären<br />
Migrationsforschung analysiert, die sich in den letzten Jahrzehnten weltweit zu einer<br />
wichtigen Forschungsdisziplin entwickelt hat. Teil dieser inter- und multidisziplinär
Sektion 2 v Sección 2<br />
orientierten Migrationsforschung ist die Analyse des Zusammenhangs zwischen<br />
transnationaler Migration und Literatur. Die Literatur von Autoren und Autorinnen<br />
mit Migrationshintergrund bildet seit der Antike einen elementaren Bestandteil<br />
des weltweiten Kultur- und Zivilisationsverständnisses. Die literarische Gestaltung<br />
individueller Lebensstrategien (Verfolgung, Isolation, Entfremdung) ist Ausdruck des<br />
besonderen Schicksals von Migranten, die das Verhältnis von Heimatbindung und<br />
Heimatlosigkeit zum Thema machen. In dem wissenschaftlichen Beitrag zum <strong>ALEG</strong>-<br />
Kongress wird das in der literarischen Produktion thematisierte Selbstverständnis<br />
der Migrantenexistenz anhand von antiken und modernen Beispielen dargestellt, die<br />
allesamt der interkulturellen Literatur zuzurechnen sind.<br />
Hans von Frankenberg (1840 - ca. 1916).<br />
Ein Historiker am Río de la Plata vor dem Ersten Weltkrieg<br />
Dr. Rohland de Langbehn, Regula<br />
Universidad de Buenos Aires, Argentinien<br />
Mein Beitrag soll der Geschichte eines Historikers gewidmet sein, der sich auch als<br />
Journalist, unter anderem jahrelang maßgeblich am Argentinischen Tageblatt betätigte.<br />
Von Frankenberg (anfangs „Franckenberg“) ist ab ca. 1866 zunächst in Montevideo<br />
nachweisbar, dann in Buenos Aires und Paraná, später in Brasilien, und zuletzt wieder,<br />
für den Rest seiner Jahre, in Buenos Aires. Er kam als junger Lieutenant nach Südamerika<br />
und dürfte während dem Weltkrieg gestorben sein, denn er gratuliert Theodor Alemann<br />
noch Mitte 1916 zur Nr. 2000 des Argentinischen Wochenblatts. Seine zahlreichen<br />
Schriften bezeugen eine gute humanistische Bildung und ausgedehnte historische<br />
und politische Kenntnisse und Interessen. Von Frankenberg war der Autor des bisher<br />
ältesten deutschsprachigen Buches (1866), das in Argentinien nachweisbar ist, mit<br />
dem er die Gattung der Aufklärungsschriften über Südamerika begründet, und er hat<br />
1910 den Facundo von Sarmiento ins Deutsche übertragen. Er publizierte zunächst auf<br />
spanisch und später auf deutsch, und war von 1900 bis 1909 Lehrer an der Cangallo-<br />
Schule in Buenos Aires. Das Freimaurer-Lexikon von Aristides Lappas widmet ihm<br />
zwanzig Zeilen. Von Frankenberg gehört zu einer ganzen Gruppe von Intellektuellen,<br />
die vor dem Ersten Weltkrieg am Tageblatt tätig waren, mit deren Leben und Werk ich<br />
mich zur Zeit beschäftige.<br />
Multiple Identität und Integration: eine Eigenart des Exils?<br />
Prof. Dr. Saint Sauveur-Henn, Anne<br />
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Frankreich<br />
Die Erfahrung der Fremdheit erst im eigenen Land als „Verjagte“, dann im Exilland<br />
als „Flüchtlinge“ mussten 250.000 deutsche Juden oder politisch Verfolgte zwischen<br />
1933 und 1945 machen, von denen etwa 80.000 in Lateinamerika Zuflucht fanden.<br />
53
54<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
Während für einige im Exil eine Kontinuität bestand, erlitten andere einen radikalen<br />
Identitätsbruch.<br />
Jede Migration, ob wirtschaftlich oder politisch, ob freiwillig oder gezwungen,<br />
bedeutet eine Pluralisierung der Identitäten und die Entstehung von multiplen<br />
Identitäten, die sich in der Fremde durch verschiedene Integrationsformen zeigen,<br />
seien sie wirtschaftlich oder kulturell. Im jüdischen Exil ist die Lage umso komplizierter,<br />
als die jüdische Identität an sich vielfältig ist und 1933 zerrissen wurde.<br />
An verschiedenen Beispielen aus den drei Hauptfluchtländern (Deutschland,<br />
Österreich und der Tschechoslowakei) in unterschiedliche lateinamerikanische<br />
Fluchtziele (Mexiko, Argentinien, Bolivien, Uruguay) soll die Frage nach den<br />
unterschiedlichen Gründen für den Weg zur neuen Identitätsfindung erörtert werden:<br />
Wird die Fremdheit durch eine mögliche Integration oder eine Ablehnung derselben<br />
überwunden? Welche äußeren und inneren Ressourcen sind ein Hilfsmittel? Lässt sich<br />
eine Typologie der möglichen Reaktionen bzw. Unterschiede zwischen Exil als Eigenart<br />
und anderen Migrationsformen herausarbeiten?<br />
„Unsere Welt brach auseinander“.<br />
Topographien der Fremdheit von Kleist bis Waldenfels<br />
Schuck, Silke<br />
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland<br />
Unter die Autoren der deutschsprachigen Literatur, welche die Dimension der<br />
Fremdheit (H. Münkler) auf das Intensivste ausgelotet haben, zählt Heinrich von Kleist.<br />
Seine Texte exponieren die Risse und Widersprüche im Eigenen und bringen sie als<br />
Befremden zum Ausdruck. Mein Vortrag möchte zurückgreifen auf diese Befremden<br />
auslösenden Störungen und Versprechen, auf die Versehen und Verkennungsszenen<br />
in Kleists Texten, um die Frage zu stellen, wie sich in literarischen Räumen die<br />
Wiedereinrichtung von Ordnung herbeiführen lässt, ohne die Ambivalenz von Fremdem<br />
und Eigenem zu harmonisieren. Kleist spiegelt in seinen Texten diese moderne<br />
Erfahrung des Subjekts in seiner zerspaltenen Identität (ex. Amphitryon, Penthesilea),<br />
die noch das 20./21. Jahrhundert prägt. Interessant ist, dass er den Schauplatz der<br />
Erfahrung von Verlust und Entwurzelung mehrfach in die Ferne des Neuen Kontinents<br />
verlegt: Das Erdbeben in Chili oder die Verlobung in Santo Domingo zeichnen ein Bild<br />
der Grausamkeit, um der Bodenlosigkeit des Aufbruchs im alten Europa eine Sprache<br />
gewordene Utopie entgegenzusetzen. Im Vortrag soll diese Beobachtung einer sich in<br />
Sprache formalisierenden Instabilität vor dem Hintergrund der Phänomenologie des<br />
Fremden (Waldenfels) diskutiert werden. U.a. weist Waldenfels auf die Ambivalenz<br />
in der Erfahrung des Fremden hin: das Fremde gibt sich zwar als das Bedrohliche in<br />
Konkurrenz zum Eigenen zu erkennen, ist aber auch das Verlockende. Dem Fremden<br />
wohnt daher für Kleist die Möglichkeit zur Wiedereinrichtung der Welt inne; es ist sowohl
Sektion 2 v Sección 2<br />
Ausgrenzung als auch Aneignung, ein permanenter Wandel zwischen Fremdwerden,<br />
Fremdgewordenem und Befremden. In der Rückschau auf die Literatur der Epoche<br />
der Forschungsreisenden verfolgt der Vortrag das Ziel, jenen heutigen Ansatz des<br />
Fremdheitsdiskurses zu exponieren, der nicht die Überwindung des Fremden, sondern<br />
das Anerkennen der Andersheit in den Fokus rückt.<br />
„Verlust ideologischer Heimat in Reglers Spanienroman „Juanita“„<br />
Schulze, Frank<br />
DAAD, I.E.S. en Lenguas Vivas „J.R.Fernández“, Argentinien<br />
Im vorliegenden Beitrag sollen Exilkonzeptionen in den Spanien- und<br />
Mexikoromanen von Gustav Regler untersucht und verglichen werden. Nach einer<br />
kurzen Vorstellung theoretischer Überlegungen zur deutschsprachigen Exilliteratur,<br />
soll im analytischen Hauptteil des Beitrags einerseits die narrative Inszenierung des<br />
Spanischen Bürgerkriegs im Zentrum stehen, andererseits aber auch die Rolle Mexikos<br />
als Exilland fokussiert werden. Konzeptionen von „Fremdheit“, „Heimat“ und „Exotik“<br />
werden bei der Analyse im Mittelpunkt stehen.<br />
Losgelöst von Zeit und Raum: Das Hotel als heterotoper<br />
Warteraum in Ulrich Bechers Exil-Drama „Samba“<br />
Theele, Ivo<br />
Universität Paderborn, Deutschland<br />
In Ulrich Bechers Exil-Drama „Samba“ (Uraufführung 1951 in Wien) ist ein kleines,<br />
billiges Hotel am Rande des brasilianischen Urwaldes und letzter Fluchtpunkt<br />
europäischer Emigranten: Hier treffen der k. und k. Offizier mit dem morbiden<br />
Charme einer vergangenen Welt, ein Kellner vom Berliner Moritzplatz und ein<br />
kleines „Wiener Mädel“ aufeinander. Für sie alle ist das Hotel „Duque de Caxias“ in<br />
Ibarahy-na Serra, einer fiktiven Kleinstadt im mittelbrasilianischen Orgelgebirge, ein<br />
Warteraum: Sie erwarten sehnsüchtig das Ende des zweiten Weltkrieges, wünschen<br />
sich nichts mehr als die baldige Rückkehr in ihre Heimat. Zu ihren ganz persönlichen<br />
Ängsten, Depressionen, Sehnsüchten und zum Heimweh kommt noch die Belastung<br />
durch einen tyrannischen Polizeikommandanten, der in seiner Ahnungslosigkeit ein<br />
Anhänger Hitlers ist. Rings um die Emigranten tobt der Karneval der Einheimischen,<br />
der wilde Rhythmus des Sambas. Dieser aber bleibt stets nur Kulisse, da die<br />
Protagonisten unfähig sind, ihren Warteraum der Hotelhalle zu verlassen. Die These<br />
zielt dahingehend, dass das Hotel, das den Emigranten als Warteraum in einer<br />
fremden Kultur dient, ein nach Michel Foucaults Raumtheorie genuin heterotoper<br />
Raum ist. Dieser ermöglicht seinen ‚Insassen’ zwar zunächst, ihr bisheriges Leben<br />
halbwegs fortzuführen, macht es ihnen jedoch gleichzeitig auch unmöglich, einen<br />
Prozess der Akkulturation zu durchlaufen. Mittels einer Analyse der kulturellen<br />
55
56<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
Topographie des Exils ist zu untersuchen, wie sich der heterotope Raum des Exil-<br />
Hotels mit seinen spezifischen Eigenschaften auf seine Gäste, deren Gesamtsituation<br />
wie auch dem Verhalten untereinander auswirkt und dieses beeinflusst. Nicht zuletzt<br />
wird somit auch der Tatsache Beachtung geschenkt, dass der heterotope Warteraum<br />
auch Auswirkungen auf die dramentypische Handlungs- und Formstruktur von Ulrich<br />
Bechers „Samba“ hat.<br />
Keine Identität ohne Alterität – Eine Interpretation der Exilerfahrung<br />
Gustav Reglers anhand ausgewählter Werke<br />
und noch unveröffentlichter Briefe<br />
Wegmann, Sarah Anke<br />
Universität des Saarlandes, Deutschland<br />
Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass /<br />
Arbeitsstelle Gustav-Regler-Forschung<br />
Obschon Gustav Regler in seinen Schriften nicht nur die philosophischen und<br />
ästhetischen Entwicklungen, sondern vor allem die epochenspezifische politische<br />
Kontroverse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diskutiert, haben seine Werke<br />
in der jüngeren Exilforschung wenig Beachtung gefunden. Die autobiographischen<br />
wie erzählerischen Texte des aus Merzig gebürtigen Schriftstellers spiegeln<br />
die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges, den Niedergang der ersten deutschen<br />
Republik und den Aufstieg des Nationalsozialismus, die Flucht aus seiner Heimat<br />
und die Stationen seines Exils im Saargebiet, in Frankreich und in Mexiko. Die<br />
wiederkehrenden Motive von Zerrissenheit und Fremdheit sind Chiffren für die<br />
Signatur der Epoche. So dokumentiert das 1947 erschienene Buch Vulkanisches Land<br />
den Versuch einer literarischen Auseinandersetzung mit der indigenen Kultur des<br />
Gastlandes Mexiko. Die novellistische Reflexion über Gesellschaft, Geschichte und<br />
Topographie gibt den hilflosen Versuch einer auch inneren Grenzüberschreitung<br />
wider, die Regler zeitlebens nie gelungen ist. Die existentielle Erfahrung der<br />
Entwurzelung – der Verlust seines Lesepublikums und der damit verbundene<br />
Identitätsverlust als Schriftsteller – , aber auch die literarisch produktive Absorption<br />
des kulturell Neuen, findet sich auch in der 1943 ebenfalls im mexikanischen Exil<br />
entstandenen Gedichtsammlung The Bottomless Pit / Der Brunnen des Abgrunds.<br />
Vor dem Hintergrund bislang unveröffentlichter Briefe untersucht der Vortrag das<br />
Spannungsverhältnis von lebensgeschichtlicher Erfahrung und sprachkünstlerischer<br />
Verarbeitung derselben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den scheinbar<br />
ambivalenten, sich jedoch bedingenden Momenten von Alterität und Identität.<br />
Gleichzeitig werden das Verhältnis des genannten Phänomens, seine Auswirkung<br />
sowie die von Regler verwendeten Topoi und Motive diskutiert und in den Kontext<br />
der hispanoamerikanischen Literatur gestellt.
Sektion 2 v Sección 2<br />
Fremdheit und Heimat in Mitteleuropa. Eine vergleichende Analyse<br />
von Literatur deutschsprachiger Autoren aus Ex-Jugoslawien und der<br />
‚innerdeutschen‘ Wendeliteratur<br />
Dr. Wichard, Norbert<br />
Universität Köln, Deutschland<br />
Als Egon Erwin Kisch im gemeinsamen mexikanischen Exil Lenka Reinerová bei<br />
ihrer Abreise nach Belgrad bittet, Prag zu grüßen, ist sie irritiert. Er erwidert, so ist<br />
es jedenfalls in Reinerovás Erzählung Zu Hause in Prag – manchmal auch anderswo<br />
überliefert: „Aber guck auf die Landkarte: ein paar Zugstunden und du bist zu Hause,<br />
während ich am anderen Ende der Welt hocke.“ Aus der Entfernung scheinen die<br />
Grenzen zu verschwimmen, gleichwohl ist die Binnendifferenzierung Mitteleuropas<br />
bis heute sehr komplex. In der deutschsprachigen Literatur, die nach der Öffnung des<br />
‚Eisernen Vorhanges‘ entstanden ist, soll untersucht werden, wie Heimat und Fremdheit<br />
inszeniert werden. Dabei sollen zwei Schwerpunkte gebildet werden: Zum einen wird<br />
Literatur von Autoren untersucht, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen,<br />
aber in deutscher Sprache schreiben, dazu gehören u.a. Saša Stanišić und Marica<br />
Bodrožić. Ihre (meist autobiographisch geprägten) Protagonisten haben wegen Krieg<br />
oder aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat verlassen; in Deutschland, aber auch<br />
in ihrem Herkunftsland sehen sie sich konfrontiert mit Fremdheitserfahrungen und<br />
Identitätskrisen. Letzteres verbindet sie mit den Protagonisten, um die es im zweiten<br />
Schwerpunkt gehen soll: Anhand von Texten der Wendeliteratur soll vergleichend<br />
herausgearbeitet werden, wie durch die Veränderung der Grenzziehung innerhalb<br />
Deutschlands Fremdheit und Neuorientierung inszeniert werden (z. B. Monika Maron:<br />
Animal triste oder Ingo Schulze: Simple Storys). Mit dem vergleichenden Blick auf die<br />
Analyseergebnisse ist zu fragen, was Heimat und Fremdheit innerhalb Mitteleuropas<br />
nach dem Wandel der politischen Geographie heute bedeuten kann und welche<br />
Funktion Literatur dabei erhält – auch, aber nicht nur innerhalb der so genannten<br />
‚Migrationsliteratur‘.<br />
Mexiko: Topos für Fremde und Heimat bei Anna Seghers<br />
Zehl-Romeo, Christiane<br />
Tufts Universität, USA<br />
Ihre Freunde – und sie selbst – würden im mexikanischen Exil vielleicht ein „neues<br />
Kapitel der Weltliteratur“ schreiben, meinte Anna Seghers 1944 in einem Bericht,<br />
den sie an das Joint Anti-Fascist Rescue Committee in den USA schrieb. Tatsächlich<br />
wurden Exilerfahrungen und Auseinandersetzungen mit dem Fremden, die freiwillige<br />
oder erzwungene Migration mit sich brachten, zu einem immer wichtigeren Teil der<br />
Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts. Für Anna Seghers war Mexiko berereits das<br />
zweite Exilland, eines das sie unbedingt vermeiden wollte, weil es ihr im Gegensatz zu<br />
57
58<br />
Sektion 2 v Sección 2<br />
Frankreich, ihrem ersten Exilland, fern und fremd war, in dem sie sich aber wohl fühlte,<br />
als es ihr letzte, verzeifelte Zuflucht bot, für die sie stets dankbar blieb. Wie ich an Hand<br />
ihrer bekannten Erzählungen und unter Einbeziehung weniger bekannter Briefe in<br />
meinem Beitrag zeigen möchte, diente Mexiko Seghers, solange sie da lebte, als Topos<br />
für Fremde. Für sie, die sich seit ihrer Jugend in der vertrauten Heimat fremd gefühlt<br />
hatte, brachten Flucht und Exil eine schreckliche Vertiefung und Konkretisierung dieser<br />
Grunderfahrung und intensivierten die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Heimat.<br />
Mexiko lieferte die Bilder. Von da aus gesehen erschien nun Deutschland, ein neues,<br />
besseres Deutschland, als ersehnte Heimat. Doch als sich Nachkriegsdeutschland als<br />
„kalte Heimat“ erwies, wurde Mexiko, obwohl oder vielleicht, weil es Seghers nie mehr<br />
wiedersehen sollte, zum Topos für Heimat und Zugehörigkeit schlechthin, freilich nur<br />
für Mexikaner selbst. Für die überall Fremden, die ewigen Migranten und Heimatlosen,<br />
zu denen sich Seghers zuletzt zählte und zählen musste, war sie unerreichbar.
Sektion 3<br />
Repräsentationen von Erinnerung in Literatur und Film. Ein Vergleich zwischen<br />
Deutschland und Lateinamerika<br />
Sektionsleitung:<br />
Dr. Friedhelm Schmidt-Welle<br />
IAI, Berlin<br />
Dr. Ute Seydel<br />
UNAM, México<br />
Prof. Dr. Graciela Wamba Gaviña<br />
Universidad Nacional de la Plata, Argentina<br />
Konzept der Sektion<br />
Erinnerung ist in den letzten 20 Jahren zu einem der zentralen Querschnittsthemen<br />
unterschiedlicher Disziplinen wie etwa der Medizin, Biologie, Klinischen Psychologie,<br />
Literaturwissenschaft, Geschichte, der Kommunikations- und Politikwissenschaften<br />
geworden. Im Anschluss an die empirischen Erkenntnisse der Lebenswissenschaften<br />
zum Konstruktionscharakter von Erinnerung und vor dem Hintergrund der<br />
postdiktatorialen Situation verschiedener Länder Lateinamerikas sowie Deutschlands<br />
erlebt die Beschäftigung mit Erinnerung und Erinnerungskulturen in Literatur und Film<br />
eine Renaissance. Aber auch unabhängig vom Kontext der Aufarbeitung von Diktaturen<br />
werden Literatur und Film zunehmend als Teil des kollektiven bzw. kulturellen<br />
Gedächtnisses verstanden.<br />
In der Sektion werden die Repräsentationen von Erinnerung in Literatur und Film<br />
untersucht, wobei die einzelnen Vorträge nach Möglichkeit vergleichend Texte bzw.<br />
Filme aus Lateinamerika und Deutschland behandeln sollen. Dabei geht es uns mehr um<br />
die komparatistische transatlantische Perspektive bzw. auch die Repräsentationsformen<br />
der Erinnerung in Literatur und Film des jeweiligen Exils als um die Intermedialität<br />
zwischen Literatur und Film.<br />
59
60<br />
Montag, 05.03.2012<br />
Uhrzeit Ort<br />
Sektion 3 v Sección 3<br />
8:30-10:00 Einschreibung Paraninfo<br />
10:00-11:30 Eröffnungsveranstaltung:<br />
Juárez 975<br />
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Generalrektor (Ecke Enrique Díaz<br />
der Universität Guadalajara / Rector general de la<br />
Universidad de Guadalajara. Mtro. Pablo Arredondo<br />
Ramírez, Rektor des Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrums CUCSH / Rector del Centro Universitario<br />
de Ciencias Sociales y Humanidades. Dr. Lilia Oliver<br />
Sánchez, Leiterin der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät / Directora de la División de Estudios<br />
Históricos y Humanos. Dr. Edmund Duckwitz,<br />
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland /<br />
Embajador de la República Federal de Alemania.<br />
Dr. Alfred Längle, Botschafter der Republik Österreich<br />
/ Embajador de Austria. Dr. Gisela Schneider,<br />
Deutscher Akademischer Austauschdienst / Servicio<br />
Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Dr. Olivia<br />
C. Díaz Pérez, Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes / Presidenta de la Asociación<br />
Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
de León)<br />
11:30-12.00 Empfang des Generalrektors der Universität<br />
Guadalajara<br />
12:00-12:45 Plenarvortrag Paulo Astor Soethe:<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer<br />
international vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
12:45-13:30 Plenarvortrag Ottmar Ette: Die Literaturen der Welt aus<br />
transarealer Perspektive<br />
13:45-14:30 Abfahrt zum Tagungsort (CUCSH)<br />
14:30-16:00 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
16:00-16:30 Einführung in die Sektion Raum 63 H**<br />
16:30-17.00 Arturo Varela *Reescritura de temas de la literatura<br />
alemana de la posguerra en la antología<br />
poética Erdkunde de Marcel Beyer. Un ejercicio de<br />
rememorización histórica.<br />
Raum 63 H
Sektion 3 v Sección 3<br />
17:00-17:30 Ute Seydel El Holocausto en tanto tropos universal de la<br />
historia traumática<br />
17:30-18:00 Pause<br />
18:00-19:30 Kulturveranstaltung (Goethe-Institut): Kabaret und<br />
Musik mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll<br />
19:30 Empfang der Deutschen Botschaft<br />
Eröffnung Karikaturenausstellung Goethe-Institut<br />
Dienstag, 06.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Hermann Funk:<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?. Modelle zum<br />
Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz und ihre<br />
praktischen Konsequenzen<br />
Semiplenarvortrag Friedhelm Schmidt-Welle:<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und<br />
Alzheimer<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Sonia Arnold Wenn das Gedächtnis den Zugriff<br />
verweigert – zur Darstellung von Gedächtnisstörungen<br />
in der deutschsprachigen und brasilianischen<br />
Gegenwartsliteratur<br />
10:45-11:15 Graciela Wamba *Erinnerung an die Diktaturen: Das<br />
kollektive Gedächtnis lässt Deutsche und Argentinier<br />
Bilanz ziehen. Erzählung und Film bei der Konstruktion<br />
eines Diskurses über Gewalt<br />
11:15-11:45 Iris Hermann Ein Leben erinnern, ein Leben<br />
imaginieren: die jüdische Kommunistin Olga Benario-<br />
Prestes in brasilianischen und deutschen Filmen und<br />
Romanen<br />
11:45-12:15 Pause<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Erwin Tschirner:<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Raum 63 H<br />
Auditorium Salvador<br />
Allende<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
und Bibliothek<br />
Manuel Rodríguez<br />
Lapuente<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium Carlos<br />
Ramírez Ladewig<br />
Raum 63 H<br />
Raum 63 H<br />
Raum 63 H<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
61
62<br />
Sektion 3 v Sección 3<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Claudia Dornbusch:<br />
Auditorium Carlos<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche<br />
Wissenschaft?<br />
Ramírez Ladewig<br />
13:00-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
14:30-15:00 Esther Edelmann ‘Infierno vacío’ und ‘Krautsuppe<br />
ohne Kraut’ – Zur Poetik von Präsenz und Abwesenheit<br />
in Roberto Bolaños Estrella Distante und Herta Müllers<br />
Atemschaukel<br />
Raum 63 H<br />
15:00-15:30 Facundo Saxe *Vidas queer, ficción y dictaduras:<br />
la tematización de la memoria y las sexualidades<br />
disidentes en textos culturales alemanes y<br />
latinoamericanos. Queer Lebens, Erdichtung und<br />
Diktaturen: Die Thematisierung des Gedächtnisses und<br />
der dessidenten Sexualität in soeben erschienenen<br />
deutschen und lateinamerikanischen kulturellen<br />
Büchern.<br />
Raum 63 H<br />
15:30-16:00 Raum 63 H<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Rai Ingrid García *Maximiliano de Austria y su viaje a<br />
España. La construcción de un imperio sobre los retazos<br />
de la memoria<br />
Raum 63 H<br />
17:00-17:30 Teresa García *La construcción de la memoria: Relato<br />
de mi vida de Thomas Mann<br />
Raum 63 H<br />
17:30-18:00 Ingeborg Nickel Erinnerungsorte in der deutschen<br />
und mexikanischen Literatur zur Studentenbewegung<br />
von 1968: Präsentationsformen imaginierter und<br />
authentischer Gedächtnisorte.<br />
18:15-19:45 Kulturveranstaltung (Foro Cultural de Austria,<br />
Auditorium<br />
BMUKK):<br />
Lesung von Tarek Eltayeb<br />
Salvador Allende<br />
Donnerstag, 08.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Christian Fandrych: Zum Stil<br />
deutscher wissenschaftlicher Vorträge (auch) aus<br />
kontrastiver Sicht.<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba
Sektion 3 v Sección 3<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Karen Pupp Spinassé:<br />
Auditorium Carlos<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht<br />
in einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
Ramírez Ladewig<br />
9:45-10:15<br />
10:15-10:45<br />
10:45-11:15<br />
11:15-11:45<br />
Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
11:45-12:00<br />
12:00-12:30<br />
12:30-13:00<br />
13:00-13:30<br />
Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
13:30-14:30<br />
14:30-15:00<br />
15:00-15:30<br />
15:30-16:00<br />
Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
16:00-16:30<br />
16:30-17:00<br />
17:00-17:30<br />
17:30-18:00<br />
Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
18:00-19:00 Abfahrt zum Paraninfo<br />
19:00 Kulturveranstaltung der Universität Guadalajara:<br />
Lehrstuhl „Cortázar“ (Cátedra Cortázar): Plenarvortrag<br />
Paraninfo<br />
Juan Villoro: *Te doy mi palabra. Un itinerario en la Juárez 975<br />
traducción.<br />
(Ecke Enrique Díaz<br />
de León)<br />
Freitag, 09.03.2012<br />
9:00-11:00 9:00-9:25 Reinhard Andress “... heiße ich daher<br />
die Emigration gut”: der Fall des Egon<br />
Schwarz<br />
9:25- 09:50 Egon Schwarz:<br />
Lesung auf Deutsch***<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
63
64<br />
9:00-11:00 10:00 – 11:00 Elisabeth Siefer: Einführung in die<br />
Übersetzung<br />
Egon Schwarz: Lesung auf Spanisch<br />
-Diskussion<br />
9:00-10:00<br />
Documental de Juliana Fischbein:<br />
des aparecer Exil und Erinnerung im Rahmen des<br />
Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er Jahre<br />
in Südamerika***<br />
Workshop Karen Schramm: Mündliches Erzählen im<br />
Fremdsprachenunterricht<br />
Workshop Dieter Jaeschke: Freundschaft, Ostalgie<br />
und weite Welt: Der Spielfilm „Friendship!“ (D 2010) im<br />
DaF-Unterricht<br />
Workshop Carmen Schier: Zur Arbeit mit Hörbüchern.<br />
Ein „Grenzgänger“ wird (neu) entdeckt<br />
Verlagspräsentation Martina Bartucz, Cornelsen<br />
Verlag: Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Verlagspräsentation Anne Robert, Hueber Verlage:<br />
Menschen<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: DaF<br />
kompakt – das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: „Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur<br />
Sprache<br />
11:00-11:30 Pause<br />
Sektion 3 v Sección 3<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
11:30-12:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven der Germanistik in Auditorium Silvano<br />
Lateinamerika<br />
Barba<br />
Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: Beste<br />
Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
64 H<br />
11:30-12:30 Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven<br />
Tafelbildern am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz<br />
Neu“ und „Logisch!“<br />
65 H<br />
Verlagspräsentation Christina Kuhn, Cornelsen<br />
Verlag: Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was<br />
ändert sich, was bleibt?<br />
66 H<br />
12:30-13:30 Abschlussplenum <strong>ALEG</strong> Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
61 H<br />
62 H<br />
63 H<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H<br />
64 H
Sektion 3 v Sección 3<br />
13:30-15:00 Mittagessen Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
15:00-17:00 <strong>ALEG</strong>-Mitgliederversammlung Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
17:15-19:15 AMPAL- Mitgliederversammlung Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
20:00 Abendessen & Abschlussfeier El Callejón de<br />
los Rumberos.<br />
Chapultepec Ecke<br />
Lerdo de Tejada<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
** Die Tagungsräume befinden sich im 3. Stock des Gebäude H vom CUCSH.<br />
*** Teil der Sektion 2 und des Kulturprogramms; nähere Informationen im Kulturprogramm<br />
Beiträge in alphabetischer Reihenfolge<br />
Wenn das Gedächtnis den Zugriff verweigert – zur Darstellung von<br />
Gedächtnisstörungen in der deutschsprachigen und brasilianischen<br />
Gegenwartsliteratur<br />
Arnold, Sonja<br />
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasilien / DAAD<br />
Den „eternal sunshine of the spotless mind“ forderte Alexander Pope in seinem<br />
Gedicht Eloisa to Abelard und strebte damit die Befreiung von den Erinnerungen an<br />
eine unglückliche Liebe an. Dass die Befreiung von der Erinnerung nicht nur wohltuend<br />
ist, sondern gleichsam auch als Befreiung von ihrer Kraft fungiert, die regelrechte<br />
Identitätskrisen auslösen kann, zeigt ein Blick auf die aktuelle Literatur. Neben<br />
dem Erinnern steht nun vor allem der Prozess des Vergessens und die mangelnde<br />
Funktionalität des Gedächtnisses im Mittelpunkt. Dieses Phänomen zeigt sich in<br />
sogenannten Konfabulationen, die die Vermischung von Fakt und Fiktion zur Folge<br />
haben, in der verstärkten Auseinandersetzung mit falschen Erinnerungen (False Memory<br />
Debate) sowie in Gedächtnisstörungen mit realbiologischer Grundlage wie etwa in<br />
Martin Suters neurologischer Trilogie. Der Beitrag setzt sich mit drei zentralen Punkten<br />
auseinander: Zunächst werden unterschiedliche Phänomene der Thematisierung von<br />
Gedächtnisstörungen differenziert (Zugriffsstörungen, False Memories, neurobiologische<br />
Erkrankungen). Anschließend wird nach den narratologischen Komponenten zur<br />
literarischen Darstellung dieser Phänomene gefragt (unzuverlässige Erzählerfiguren,<br />
Vermischung von Fakt und Fiktion, Metaphorik des Vergessens). Methodisch dient<br />
an der Schnittstelle von historischen, psychologischen sowie neurologischen<br />
65
66<br />
Sektion 3 v Sección 3<br />
Gedächtnisdiskursen und Literatur das Konzept der Wirklichkeitserzählungen (Klein/<br />
Martínez) als Anknüpfungspunkt. In einem dritten Schritt werden deutschsprachige<br />
Autorinnen und Autoren (Marcel Beyer, Martin Suter, Christa Wolf) und brasilianische<br />
Autoren (Chico Buarque, Edney Silvestre, Carlos Heitor Cony) aus komparatistischer<br />
Perspektive in den Blick genommen. Ziel des Beitrags ist eine Konturierung der<br />
aktuellen Thematisierung und Darstellung von Gedächtnisstörungen im Vergleich von<br />
deutschsprachiger und brasilianischer Literatur.<br />
‘Infierno vacío’ und ‘Krautsuppe ohne Kraut’ – Zur Poetik von Präsenz<br />
und Abwesenheit in Roberto Bolaños Estrella Distante und Herta Müllers<br />
Atemschaukel<br />
Edelmann, Esther<br />
Rijksuniversiteit Groningen, Niederlande, Universidad de Granada, Spanien,<br />
Universiteit Leiden, Niederlande, University of Minnesota, USA<br />
Vergangenheitsbewältigung, die einst versäumte Justiz und die Frage nach<br />
Gerechtigkeit sind in postdiktatorialen Gesellschaften Themen, die oft nur<br />
unbefriedigend von abstrakten historisch-politischen und juristischen Diskursen<br />
aufgegriffen worden sind. Einerseits herrscht ein sich auf kollektive Amnesie<br />
berufender sozio-politischer Konsens, der in Hinblick auf wirtschaftlichen Aufschwung<br />
und neuer Zukunftsperspektive dazu tendiert, die Traumata der Vergangenheit zu<br />
verdrängen. Andererseits werden die gesellschaftliche Mitschuld und die Verbrechen<br />
Einzelner vertuscht, um sich der sozialen und juristischen Verantwortung zu<br />
entziehen. In diesem Kontext wird die Frage nach der Rolle der Literatur bezüglich der<br />
kollektiven Vergangenheitsbewältigung immer virulenter. Im Folgenden werde ich<br />
anhand der Romane Atemschaukel und Estrella Distante den Versuch unternehmen,<br />
aufzuzeigen, dass ihre poetologischen Elemente die Logik des sozio-politischen<br />
Konsenses sprengen. Im Anschluss an Agambens Konzept des Ausnahmezustands,<br />
d.h. die Außerkraftsetzung alltäglicher Deutungsmuster, die Diktaturen kennzeichnet,<br />
werde ich zeigen, dass die poetische Sprache Müllers und Bolaños das unfassbar<br />
Unaussprechbare, das mit der Erfahrung souveräner Gewalt verknüpft ist, objektiviert.<br />
Infolge individueller Traumata eröffnen sich sprachliche Leerstellen. Erfahrungen<br />
extremen psychischen Drucks und körperlicher Gewalt sind häufig nicht (mit)teilbar,<br />
ihnen fehlt das Signifikat oder Objekt in der Außenwelt. Ich vertrete die These, dass<br />
aufgrund dieser Abwesenheit ein Prozess poetischer Imagination einleitet wird, der<br />
das Unsagbare individuellen Leidens hervorhebt, jedoch zugleich dessen Negativität<br />
überwindet. Die poetologischen Elemente der Romane Müllers und Bolaños<br />
konstituieren somit das notwendige alternative Supplement zu politisch-historischen<br />
und juristischen Diskursen, in denen der singulären Erfahrung totalitärer Gewalt kaum<br />
eine Stimme verliehen wird.
Sektion 3 v Sección 3<br />
*La construcción de la memoria: Relato de mi vida de Thomas Mann<br />
Dr. García Díaz, Teresa<br />
Universidad Veracruzana, Mexiko<br />
Analizaré los matices con que se construye la evocación, el recuerdo y la memoria<br />
en Relato de mi vida de Thomas Mann. Me detendré en esa recuperación de la vida<br />
familiar en diferentes tiempos y distintos sucesos, con varios personajes “reales”, en las<br />
alusiones a espacios en los distintos viajes y en los vínculos entre vida y literatura a<br />
través de su propia obra y su proceso creativo.<br />
In meinem Beitrag werde ich analysieren, wie Thomas Mann in Über mich selbst den<br />
Erinnerungsprozess beschreibt und das Gedächtnis konstruiert. Speziell werde ich auf die<br />
Rekonstruktion des Familienlebens während der verschiedenen Abschnitte seines Lebens<br />
und im Kontext der unterschiedlichen historischen Ereignisse eingehen, bei denen<br />
Bezüge zu realen Personen, zu Orten und unterschiedlichen Reisen hergestellt werden.<br />
Außerdem werde ich auf die Verbindungen eingehen, die Mann ausgehend von eigenen<br />
Werken und dem eigenen kreativen Prozess, zwischen Leben und Literatur aufzeigt.<br />
*Maximiliano de Austria y su viaje a España.<br />
La construcción de un imperio sobre los retazos de la memoria<br />
Prof. Dr. García-Wistädt, Ingrid<br />
Universidad de Valencia, Spanien<br />
Maximiliano de Austria, futuro emperador de México, realiza en 1851 y 1852 sendos<br />
viajes a España que despiertan en él la memoria de los tiempos en los que su dinastía<br />
gobernaba estas tierras, especialmente el reinado de Carlos V, momento de máximo<br />
esplendor de la Casa de Austria e ideal de monarquía cristiana universal. Maximiliano se<br />
considera heredero de esta estirpe: como pariente legítimo se considera el más cercano<br />
a ellos, más que los soberanos y príncipes del país. La contemplación y el recuerdo de<br />
sus antepasados, así como la convicción de que su linaje debería estar reinando en<br />
España alimentan sus sueños.<br />
Cuando diez años después de su primer viaje a España conoce los planes de Napoleón<br />
III de ofrecerle la corona de México, considera ésta una oportunidad para devolver el brillo<br />
perdido y el poderío a su linaje - de cuyas huellas había sido testigo durante su estancia en<br />
España - y de hacer realidad su sueño, todo ello sustentado en parte sobre los recuerdos<br />
que había despertado en él la contemplación de sus lugares de la memoria - que en él se<br />
convierten en narración mítica del pasado, dejando de lado todo aspecto crítico -, lo que<br />
intentaremos ilustrar a través de los bocetos literarios de su viaje a España, así como de las<br />
cartas que intercambió con su esposa antes y durante su reinado en México.<br />
Erzherzog Maximilian von Österreich, der spätere Kaiser von Mexiko, unternimmt<br />
in den Jahren 1851 und 1852 zwei Reisen nach Spanien. Diese Aufenthalte erwecken in<br />
ihm die Erinnerung an die Zeiten, als seine Vorfahren dieses Land regierten, vor allem an<br />
67
68<br />
Sektion 3 v Sección 3<br />
die Regierungszeit Karls V. als Höhepunkt der Habsburger Herrschaft und als Ideal einer<br />
christlichen Universalmonarchie. Maximilian hält sich für den legitimen Erben dieses<br />
Geschlechts: Er stand seinen Vorfahren näher als die derzeitigen Herrscher Spaniens<br />
– so schreibt er in seinem Tagebuch. Die Erinnerung an seine toten Ahnen und der<br />
Glaube, dass die Seinigen noch in diesem Land herrschen sollten, nähren seine Träume.<br />
Zehn Jahre nach seiner ersten Reise nach Spanien erfährt er vom Plan Napoleons<br />
III., ihm die Krone Mexikos anzubieten und glaubt, die Gelegenheit gefunden zu haben,<br />
seinem Hause den verlorenen Glanz und die Macht - deren Spuren er während seines<br />
Aufenthaltes in Spanien erlebt hatte - wiederzugeben und dabei seine Träume zu<br />
verwirklichen, die auf eine nostalgische Betrachtung der Erinnerungsorte beruhen. Er<br />
beobachtet diese Orte nicht kritisch, sondern interpretiert sie im Sinne einer mythischen<br />
Erzählung der Vergangenheit. Dies soll durch die Analyse seiner Reiseskizzen aus<br />
Spanien sowie seiner Briefe über Mexiko veranschaulicht werden.<br />
Ein Leben erinnern, ein Leben imaginieren: die jüdische Kommunistin Olga<br />
Benario-Prestes in brasilianischen und deutschen Filmen und Romanen<br />
Prof. Dr. Hermann, Iris<br />
Universität Bamberg, Deutschland<br />
Das Schicksal der deutschen Kommunistin Olga Benario hat sowohl literarische wie<br />
auch filmische Bearbeitung erfahren. Während Ruth Werner in den 1960er Jahren einen<br />
Roman über Benario verfasst hat, legt Fernando Morais mehr als zwanzig Jahre später in<br />
Brasilien seinen vielbeachteten Roman vor. 2004 entstehen fast gleichzeitig in Brasilien<br />
und in Deutschland zwei Filme: Aus dem Jahr 2004 stammt der Dokumentarfilm Olga<br />
Benario – Ein Leben für die Revolution von Galip Iyitanir, ebenfalls 2004 kommt der<br />
Spielfilm Olga nach der Romanvorlage von Fernando Morais in die brasilianischen<br />
Kinos. Regie führt Jayme Monjardim. In stark gekürzter Form kommt er 2006 auch in<br />
die deutschen Kinos. Der Vortrag will vergleichend analysieren, welche verschiedenen<br />
Formen der Imagination und der Erinnerung sich mit der Person und Figur der Olga<br />
Benario in Brasilien und Deutschland verknüpfen. Dabei sollen sowohl ästhetische wie<br />
auch politisch/soziologische Aspekte Berücksichtigung finden: Wie wird im Kontext der<br />
Aufarbeitung des Vargasregimes und der Militärdiktatur die Kommunistin Benario in<br />
ihrer Bedeutung für den brasilianischen Kontext (als Gattin von Prestes etwa und als<br />
Mitkämpferin im Aufstand gegen Vargas) imaginiert, im Buch von Morais und in der<br />
später entstandenen melodramatischen Verfilmung? Welchen Platz nimmt Olga Benario<br />
in der Einnerungskultur der DDR und im Roman von Ruth Werner ein? Wie wird sie im<br />
wiedervereinigten Deutschland imaginiert? In diesem Zusammenhang ist es wichtig,<br />
nicht nur die literarische, filmische, sondern auch die publizistische Aufarbeitung des<br />
zumeist als heldinnenhaft dargestellten Schicksals einer politisch aktiven jüdischen<br />
Emigrantin zu beleuchten und zudem zu bedenken, welche spezifische Rolle ihr in der
Sektion 3 v Sección 3<br />
postdiktatorialen Erinnerungskultur der beiden Länder jeweils zugesprochen wird und<br />
welche spezifischen Formen die literarische und filmische Imagination ihres Lebens<br />
erfährt. Zuletzt ist danach zu fragen, wie ihr Jüdischsein und die damit verbundene<br />
spezifische Erinnerung in den Romanen und in den Filmen in Erscheinung tritt.<br />
Erinnerungsorte in der deutschen und mexikanischen Literatur zur<br />
Studentenbewegung von 1968: Präsentationsformen imaginierter und<br />
authentischer Gedächtnisorte.<br />
Nickel, Ingeborg<br />
Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland<br />
Die memoriale Topologie betrachtet - nach Maurice Halbwachs oder Pierre Nora<br />
- Landschaften, Innen- und Außenräume, Denkmäler etc. als Medium des kulturellen<br />
Gedächtnisses. Wie entstehen aus der Erinnerung Einzelner, die zunächst auf einer<br />
individuell-emotional geprägten Erfahrung basieren, kollektive Gedächtnisbilder?<br />
Wo werden diese kollektiv „verortet“? Gibt es unterschiedliche Verortungen je nach<br />
Generationszugehörigkeit?<br />
Am Beispiel der internationalen Studentenbewegung von 1968 wird die faktische<br />
Verortung und die Semiotisierung des Raums in der Erinnerungskultur von Mexiko<br />
und Deutschland aufgezeigt. Ein Vergleich der Bildarchive des Gedächtnisses läßt<br />
Parallelen und Unterschiede in den jeweiligen kulturellen Kontexten deutlich werden.<br />
Abschließend ein Vergleich mit den Erinnerungsorten der nachgeborenen Generation,<br />
die 1968 nicht mehr aus eigener Anschauung kennt.<br />
*Vidas Queer, ficción y dictaduras: la tematización de la memoria<br />
y las sexualidades disidentes en textos culturales alemanes<br />
y latinoamericanos recientes<br />
Queer Lebens, Erdichtung und Diktaturen: Die Thematisierung<br />
des Gedächtnisses und der dessidenten Sexualität in soeben<br />
erschienenen deutschen und lateinamerikanischen kulturellen<br />
Büchern.<br />
Saxe, Facundo Nazareno<br />
Universidad Nacional de La Plata, Argentinien;<br />
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales<br />
(IdIHCS), CONICET<br />
La situación del colectivo LGBTI y la expresión cultural de las sexualidades disidentes<br />
en momentos históricos dictatoriales y represivos es un tema de análisis y reflexión<br />
relativamente reciente para el canon artístico e histórico. Las llamadas “vidas queer”<br />
(Butler, 2009) que no pueden ser “lloradas” se convierten en “víctimas queer” de parte<br />
de un sistema que invisibiliza y margina la sexualidad “abyecta”. La cuestión de estas<br />
69
70<br />
Sektion 3 v Sección 3<br />
“víctimas queer”, en los respectivos casos de la segunda guerra mundial y las dictaduras<br />
de los años setenta en Latinoamérica son temas elididos, silenciados u olvidados por el<br />
canon y la memoria histórica. A partir de tal apreciación, es que entiendo que la literatura<br />
y otros textos culturales (cine, historieta) serían los espacios socio-políticos que otorgan<br />
voz a los sujetos queer invisibilizados. En otras palabras, las ficciones producidas con<br />
posterioridad a los momentos históricos contarían a través de sus temáticas la situación<br />
de las vidas queer, tópico ausente en el canon histórico tradicional. De esta forma,<br />
el tratamiento y la tematización del cruce entre memoria y diversidad sexual que se<br />
presenta en los ámbitos culturales alemanes y latinoamericanos de las últimas décadas<br />
viene a problematizar, analizar y reflexionar sobre este tema, como ya mencioné,<br />
olvidado e invisibilizado por la tradición heteronormativa.<br />
Este trabajo busca establecer continuidades, similitudes y diferencias en la<br />
ficcionalización de la situación del colectivo LGBTI en las dictaduras latinoamericanas y<br />
el régimen nazi respectivamente, a través de ficciones que funcionarán como ejemplos<br />
paradigmáticos respecto al tratamiento del tema en los textos culturales recientes.<br />
Die Situation des LGBTI-Kollektivs und die kulturelle Ausdruckweise der<br />
dessidenten Sexualität in diktatorischen und unterdrückenden historischen<br />
Momenten ist ein ziemlich neuerliches Analyse- und Reflexionsthema für den<br />
artistischen und historischen Kanon. Die sogennanten „Queer Lebens“ (Butler,<br />
2009), die nicht geweint werden können, werden zu „Queer Opfern“ auf seiten eines<br />
Systems, das der verächtlichen Sexualität unsichtbar macht und sie marginalisiert.<br />
Die Sache dieser „Queer Opfern“, in den jeweiligen Fällen des Zweiten Weltkrieges<br />
und der lateinamerikanischen Diktaturen in den 70er Jahren, sind von dem<br />
Kanon und dem historischen Gedächtnis elidierte, geschwiegene und vergessene<br />
Thematiken. Von solcher Schätzung ab begreife ich, dass die Literatur und andere<br />
kulturelle Texte (wie das Kino und die Kurzgeschichte) die sozio-politischen Räume<br />
wären, die den unsichtbaren „Queer Personen“ „Stimme“ geben. Anders gesagt, die<br />
sich nach den historischen Momenten ereigneten Fiktionen erzählen, durch ihre<br />
Thematiken, die Situation der „Queer Lebens“; abwesende Topik in dem historischen,<br />
traditionellen Kanon. Auf diese Weise, die Behandlung und die Thematisierung der<br />
Kreuzung aus Gedächtnis- und Sexual-Verschiedenheit, die in den deutschen und<br />
lateinamerikanischen Kultur-Bereichen von den letzten Dekaden erscheinen, um<br />
dieses Thema zu problematisieren, zu analysieren und nachzudenken. Ein von der<br />
heteronormativen Tradition vergessenes und unsichtbares Objekt.<br />
Diese Arbeit versucht, Kontinuität, Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten bei der<br />
Fiktionalisierung der Siutation des LGBTI-Kollektivs, während der lateinamerikanischen<br />
Diktaturen und der Naziregierung, durch die Fiktionen, die als paradigmatische<br />
Beispiele in Hinsicht auf die Behandlung des Themas in den neuerlichen Kultur-Texten<br />
funktionieren würden.
Sektion 3 v Sección 3<br />
El Holocausto en tanto tropos universal de la historia traumática<br />
Dr. Seydel, Ute<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
Andreas Huyssen ha destacado en En busca del futuro perdido. Cultura y memoria<br />
en tiempos de la globalización (2002) que el Holocausto en tanto tropos universal de<br />
la historia traumática se desplazó hacia otros contextos no relacionados; no sólo ha<br />
permitido la activación de la memoria traumática respecto al terrorismo de Estado y el<br />
genocidio ocurridos después de la persecución y el exterminio de los judíos durante<br />
la dictadura nacionalsocialista. Al contrario, también ha servido para realizar relecturas<br />
acerca de episodios de la historia universal en los que ya antes se perpetraron genocidios.<br />
Así, se ha construido una especie de memoria histórica transnacional acerca de abusos<br />
perpetrados por regímenes autoritarios o acerca de crímenes de Guerra.<br />
En particular, abordaré en la ponencia dos textos literarios: del autor alemán de<br />
origen turco Zafer Şenocak Gefährliche Verwandtschaften, novela en que están presentes<br />
referencias al Holocausto y su elaboración en la memoria familiar así como al genocidio de<br />
los armenios que durante la Primera Guerra Mundial fue cometido en el Imperio Otomano<br />
por los turcos; y del autor mexicano José Emilio Pacheco Morirás lejos, relato en que se<br />
establece un paralelismo entre la Conquista e Inquisición españolas y el Holocausto.<br />
Andreas Huyssen hat in En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de<br />
la globalización (2002) hervorgehoben, dass der Holocaust als universeller Tropus für<br />
traumatische geschichtliche Erfahrung in anderen Kontexten verwendet wird. Dies hat<br />
nicht nur ermöglicht, die traumatische Erinnerung an staatlichen Terror und Genozide,<br />
die nach der Judenverfolgung und –vernichtung während der nationalsozialistischen<br />
Diktatur stattgefunden haben, zu aktivieren, sondern auch Relektüren vorzunehmen,<br />
die sich auf frühere geschichtliche Episoden beziehen, während derer Genozide<br />
geschehen sind. So ist in Bezug auf autoritäre Regime und Kriegsverbrechen eine<br />
transnationale historische Erinnerung entstanden.<br />
In meinem Vortrag werde ich speziell auf zwei literarische Texte eingehen:<br />
Gefährliche Verwandtschaften, ein Roman, in dem Zafer Şenocak sowohl auf den<br />
Holocaust und seine Aufarbeitung im Familiengedächtnis als auch auf den Genozid<br />
eingeht, der im Osmanischen Reich von den Türken an den Armeniern während des<br />
Ersten Weltkrieges verübt wurde.<br />
*Reescritura de temas de la literatura alemana de la posguerra en la antología<br />
poética Erdkunde de Marcel Beyer. Un ejercicio de rememorización histórica.<br />
Varela Alvarez Jacinto Arturo<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
Con la conmemoración de distintas fechas con un gran contenido histórico, como<br />
la caída del muro de Berlín o la reunificación alemana, presenciamos eventos que<br />
71
72<br />
Sektion 3 v Sección 3<br />
forman parte de la memoria colectiva y que son repetidos para no olvidar un momento<br />
histórico importante.<br />
Distintos medios han contribuido a la construcción de la memoria, como la<br />
literatura escrita tras el fin la Segunda Guerra Mundial por algunos integrantes del<br />
Grupo 47 y más tarde, algunos del movimiento estudiantil de los 60s. A raíz de la<br />
caída del muro de Berlín surgió una literatura alemana, que aborda, entre otros,<br />
temas propios de la literatura de la posguerra y con ello reescribe hechos históricos<br />
que aparentemente ya formaban parte del archivo muerto. Algunos de estos autores<br />
son Thomas Brussig, Ingo Schulze, Claudia Rausch, Bernhard Schlink, Marcel Beyer o<br />
Günter Grass.<br />
Esta ponencia se centrará en el trabajo de Marcel Beyer, especialmente en la<br />
antología poética Erdkunde en la que el autor escribe sobre temas de la Segunda<br />
Guerra Mundial y sus consecuencias en la sociedad de cultura alemana de aquel<br />
entonces. Lo hace en un poema dividido en varias partes y escrito con un verso<br />
atípico, en el cual Beyer hace uso de recursos lingüísticos que en algún momento<br />
utilizaría por primera vez el escritor Paul Celan. De igual manera se discutirá el<br />
porque de este ejercicio de rememorización y de su aportación a la literatura alemana<br />
contemporánea.<br />
Mit dem Gedenken an verschiedenen Terminen mit einem großen historischen<br />
Inhalt, wie dem Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands,<br />
erleben wir Ereignisse, die Teil des kollektiven Gedächtnisses sind und wiederholt<br />
werden, um nicht einen wichtigen historischen Moment zu vergessen.<br />
Verschiedene Medien haben der Konstruktion der Erinnerung geholfen, wie die<br />
geschriebene Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg von einigen Mitgliedern der<br />
Gruppe 47 und später, einige Studentenbewegungen der 60er Jahre. Nach dem Fall<br />
der Berliner Mauer kam eine deutsche Literatur, in der Themen der Nachkriegszeit<br />
behandelt werden, womit historische Ereignissen beschrieben werden, die scheinbar<br />
im Keller waren. Einige dieser Autoren sind Thomas Brussig, Ingo Schulze, Claudia<br />
Rausch, Bernhard Schlink, Marcel Beyer und Günter Grass.<br />
Diese Präsentation wird sich auf die Arbeit von Marcel Beyer konzentrieren, vor<br />
allem in dem Gedichtband „Erdkunde“, in dem der Autor über den Zweiten Weltkrieg<br />
und seine Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt schreibt.<br />
Es wird in einem Gedicht gemacht, das sich in mehrere Teile gliedert und dass in einer<br />
ungewöhnlichen Vers geschrieben ist, in dem Beyer sprachliche Ressourcen nutzt<br />
, die zum ersten Mal der Schriftsteller Paul Celan benutzte. Anschließend werden<br />
auch der Grund für diese Übung von „sich wieder erinnern“ und seinen Beitrag zur<br />
zeitgenössischen deutschen Literatur diskutieren.
Sektion 3 v Sección 3<br />
*Erinnerung an die Diktaturen: Das kollektive Gedächtnis lässt<br />
Deutsche und Argentinier Bilanz ziehen. Erzählung und Film bei der<br />
Konstruktion eines Diskurses über Gewalt<br />
Memoria de las dictaduras: alemanes y argentinos en un balance<br />
de movimientos mnémicos colectivos. Narrativa y cine en la<br />
construcción de un discurso acerca de la violencia.<br />
Prof. Dr. Wamba Gaviña, Graciela<br />
Universidad Nacional de La Plata, Argentinien<br />
Das kollektive Gedächtnis verarbeitet die kulturellen Traumata, indem es ein<br />
Gründungsmythos erzeugt, das ständig neu interpretiert wird, und zwar nicht nur von<br />
denjenigen, die die Traumata miterlebt haben, sondern auch von den nachfolgenden<br />
Generationen, als Erinnerungen, die in bestimmten Diskursen der Medien erwähnt<br />
werden, die aktuelle Tatsachen zu erklären oder zu begründen versuchen. In dieser<br />
Arbeit greifen wir die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust<br />
als Gründungsmythos auf, um die argentinische Vergangenheit – besonders die<br />
Militärdiktatur und die von ihr ausgeübte Gewalt – ins Gedächtnis zurückzurufen.<br />
Für die Analyse der Darstellungsformen der Erinnerung untersuchen wir die<br />
Filmproduktionen Die Freundin (1988) und Der deutsche Freund (2011) von Jeanine<br />
Meerapfel, die argentinisch-deutsche Koproduktion Die Tränen meiner Mutter (2008)<br />
von Alejandro Cardenas-Amelio und Ein Lied in mir (2011) von Florian Cossen. Es handelt<br />
sich in allen Fällen um Filme, die Diskurse der Erinnerung darstellen, und in denen sich<br />
die Erinnerungen an den Nazismus in Deutschland mit denen an die Militärdiktatur in<br />
Argentinien kreuzen, verbunden durch die Gewalt und das Schweigen der Institutionen,<br />
dem mehrere Generationen in beiden Ländern ausgesetzt wurden.<br />
Im Bereich der Erzählung werden wir das Thema anhand von Wakolda, von Lucia<br />
Puenzo behandeln. Das Werk erscheint zwar 2011 als Roman, wird aber zugleich als Film<br />
angekündigt, und darin geht es um die Legende von Joseph Mengele in Patagonien.<br />
Untersucht werden sollen auch El secreto bien guardado (2009) von Viviana Rivero (mit<br />
dem Thema des berühmten Edén-Hotels in Córdoba als Kulisse) und Lejos de dónde (2009)<br />
von Edgardo Cozarinsky, Roman, in dem ein Sohn das Geheimnis seiner unerkannt nach<br />
Buenos Aires gereisten Mutter entdeckt. In deutscher Sprache befassen wir uns mit den<br />
Romanen Sieben Jahre Ewigkeit, eine deutsche Liebe (2009) von Gisela Heidenreich und<br />
Woher der Wind weht. Ein Patagonienroman (2010) von Guido Schmidt.<br />
Schwerpunkt der Untersuchung ist das Bestehen einer gründenden traumatischen<br />
Situation sowohl der zeitgenössischen Geschichte Deutschlands als auch Argentiniens,<br />
die in keinem der beiden Fälle an Gültigkeit verliert oder erstarrt, sondern neu belebt<br />
und neu funktionalisiert wird und auch für das Gedächtnis der Generationen, die<br />
bereits drei Grade von den Geschehnissen entfernt sind, die das kollektive Gedächtnis<br />
heraufbeschwört, nichts an Aktualität einbüßt.<br />
73
74<br />
Sektion 3 v Sección 3<br />
La memoria colectiva procesa los traumas culturales generando un mito fundante<br />
que se reinterpreta continuamente, no sólo por aquellos que formaron parte del<br />
mismo, sino por las generaciones siguientes en calidad de recuerdos convocados en<br />
determinados discursos de los medios, que intentan aclarar o dar cuenta de hechos<br />
actuales. En este trabajo tomaremos el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y el<br />
Holocausto como mito fundacional para la evocación del pasado argentino, sobre todo<br />
con referencia a la dictadura militar y a la violencia ejercida.<br />
Para el análisis de las formas de representación del recuerdo, tomaremos las<br />
producciones fílmicas La Amiga (1988) y El amigo alemán (2011) de Jeanine Meerapfel,<br />
la coproducción argentino-alemana Die Tränen meiner Mutter (2008) de Alejandro<br />
Cardenas-Amelio y Ein Lied in mir (2011) de Florian Cossen. Se trata en todos los casos<br />
de obras fílmicas que representan discursos de la memoria y en las que se entrecruzan<br />
los recuerdos del nazismo en Alemania con los de la dictadura militar en Argentina,<br />
aunados por la violencia y el silencio institucional al que fueron sometidas varias<br />
generaciones de ambos países.<br />
Con referencia a la narrativa abordaremos el tema con Wakolda, de Lucia Puenzo.<br />
Esta obra, que si bien aparece como novela en 2011, se anuncia como película con la<br />
leyenda de Josef Mengele en la Patagonia en El secreto bien guardado (2009) de Viviana<br />
Rivero (con el tema del famoso hotel Edén de Córdoba como escenario) y con Lejos<br />
de dónde (2009) de Edgardo Cozarinsky, en la que un hijo descubre el secreto de su<br />
madre alemana llegada de incógnito a Buenos Aires. Por el lado alemán, tomaremos las<br />
novelas Sieben Jahre Ewigketi, eine deutsche Liebe (2009) de Gisela Heindenreich y Woher<br />
der Wind weht. Ein Patagonienroman (2010) de Guido Schmidt.<br />
El eje del análisis se centrará en la existencia de un hecho traumático fundacional,<br />
tanto de la historia contemporánea de Alemania como la de Argentina, que, en ambos<br />
casos, no pierde vigencia ni se fosiliza, sino que opera funcionalmente revitalizado y<br />
sin perder la actualidad, aún para la memoria de generaciones alejadas tres grados del<br />
momento evocado en la memoria colectiva
Sektion 4<br />
Germanistik und Romanistik im Gespräch. Perspektiven der gegenseitigen Bereicherung<br />
– Archive als Orte der Begegnung<br />
Sektionsleitung:<br />
Prof. Dr. Dieter Rall<br />
Universidad Nacional Autónoma de México<br />
Prof. Dr. Paulo Soethe<br />
Universidade Federal do Paraná, Brasil<br />
Konzept der Sektion<br />
Die Erforschung von Sprache und Literatur durch Germanisten in Lateinamerika<br />
in Zusammenarbeit mit romanistischen Partnern vor Ort sowie Romanisten und<br />
Germanisten im deutschsprachigen Raum enthält ein großes Potenzial der Entwicklung<br />
und Internationalisierung von beiden Fachgebieten, Germanistik und Romanistik, in<br />
Lateinamerika und im Übersee.<br />
Beispielsweise können durch die systematische Nutzung und Erfassung von<br />
literarischen Archiven durch Germanisten und Romanisten im Rahmen integrierter<br />
Forschungsprojekte wissenschaftliche Diskurse entstehen, die eingemeißelt werden<br />
können auf die materielle Basis der Bestände, Kataloge, Publikationen. Archive<br />
werden somit zu transnationalen Orten der Begegnung von neuen transdisziplinären<br />
Kommunikationsgemeinschaften. Durch Vernetzung der Information und Gestaltung<br />
von Netzwerken in der Forschung kann man reelle Grenzüberschreitungen üben. Ein<br />
wichtiges Stichwort für die Sektion ist daher: Netzwerktechnologien.<br />
Archive in Europa verfügen über lateinamerikabezogenes, noch unerforschtes<br />
Material. In Lateinamerika sind viele Quellen in entstehenden bzw. sich erweiternden<br />
literarischen und historischen Archiven nur für Forscher mit germanistischem<br />
Hintergrund zugänglich: Denn durch die starke Präsenz der deutschen Kultur im<br />
Subkontinent, durch Exil und Immigration, sowie durch die starken Beziehungen<br />
intellektueller Kreise zum deutschsprachigen Raum seit der frühen Geschichte<br />
Lateinamerikas kommt immer wieder neues deutschsprachiges Material ans Licht.<br />
Diese Bestände weisen selbstverständlich ein Interesse auch für die europäische<br />
Forschung auf.<br />
Man fängt erst jetzt an, die Forschung über die Präsenz und Rezeption<br />
lateinamerikanischer Themen und Texte in der deutschsprachigen Literatur systematisch<br />
auszuwerten und zu erweitern. Ebenso steht die ausführliche Erforschung der Präsenz<br />
und Rezeption deutschsprachiger Texte und Autoren in der lateinamerikanischen<br />
Literatur noch bevor. Die gegenseitigen Spiegelungen legen daher die Konzeption und<br />
Durchführung von internationalen Forschungsprojekten nahe, die germanistische<br />
75
76<br />
Sektion 4 v Sección 4<br />
Abteilungen in Lateinamerika und Abteilungen für Romanistik in den deutschsprachigen<br />
Ländern zusammenbringen. Es geht für diese zumeist kleinen Abteilungen auf<br />
beiden Seiten des Atlantiks um den akademinschen Gewinn von forschungspolitischer<br />
Relevanz und Legitimität innerhalb der jeweiligen eigenen Universität, um den<br />
Gewinn an Bedeutung und Visibilität in der Beziehung mit Verwaltungsbehörden in<br />
verschiedenen Instanzen, sowie um die Etablierung der jeweiligen Fachrichtungen in<br />
der entsprechenden wissenschaftlichen Szene.
Sektion 4 v Sección 4<br />
Montag, 05.03.2012<br />
Uhrzeit Ort<br />
8:30-10:00 Einschreibung Paraninfo<br />
10:00-11:30 Eröffnungsveranstaltung:<br />
Juárez 975<br />
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Generalrektor (Ecke Enrique Díaz<br />
der Universität Guadalajara / Rector general de la<br />
Universidad de Guadalajara. Mtro. Pablo Arredondo<br />
Ramírez, Rektor des Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrums CUCSH / Rector del Centro Universitario<br />
de Ciencias Sociales y Humanidades. Dr. Lilia Oliver<br />
Sánchez, Leiterin der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät / Directora de la División de Estudios<br />
Históricos y Humanos. Dr. Edmund Duckwitz,<br />
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland /<br />
Embajador de la República Federal de Alemania.<br />
Dr. Alfred Längle, Botschafter der Republik Österreich<br />
/ Embajador de Austria. Dr. Gisela Schneider,<br />
Deutscher Akademischer Austauschdienst / Servicio<br />
Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Dr. Olivia<br />
C. Díaz Pérez, Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes / Presidenta de la Asociación<br />
Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
de León)<br />
11:30-12.00 Empfang des Generalrektors der Universität<br />
Guadalajara<br />
12:00-12:45 Plenarvortrag Paulo Astor Soethe:<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer<br />
international vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
12:45-13:30 Plenarvortrag Ottmar Ette: Die Literaturen der Welt aus<br />
transarealer Perspektive<br />
13:45-14:30 Abfahrt zum Tagungsort (CUCSH)<br />
14:30-16:00<br />
16:00-16:30<br />
16:30-17.00<br />
17:00-17:30<br />
Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
17:30-18:00 Pause<br />
77
78<br />
18:00-19:30 Kulturveranstaltung (Goethe-Institut): Kabaret und<br />
Musik mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll<br />
19:30 Empfang der Deutschen Botschaft<br />
Eröffnung Karikaturenausstellung Goethe-Institut<br />
Dienstag, 06.03.2012<br />
Sektion 4 v Sección 4<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
und Bibliothek<br />
Manuel Rodríguez<br />
Lapuente<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Hermann Funk:<br />
Auditorium<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?. Modelle zum<br />
Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz und ihre<br />
praktischen Konsequenzen<br />
Silvano Barba<br />
Semiplenarvortrag Friedhelm Schmidt-Welle:<br />
Auditorium Carlos<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und<br />
Alzheimer<br />
Ramírez Ladewig<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Einführung in die Sektion Raum 64 H**<br />
10:45-11:15 Maria Brumm: Gerhart Muench, ein deutscher Musiker,<br />
Philosoph und Dichter in Mexiko. Eine Reise ohne<br />
Rückkehr.<br />
Raum 64 H<br />
11:15-11:45 Sibele Paulino: Interdisziplinäre Betrachtungen zum<br />
Brasilien-Roman Tropen, von Robert Müller<br />
Raum 64 H<br />
11:45-12:15 Pause<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Erwin Tschirner:<br />
Auditorium<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Silvano Barba<br />
Semiplenarvortrag Claudia Dornbusch:<br />
Auditorium Carlos<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche Wissenschaft?<br />
Ramírez Ladewig<br />
13:00-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
14:30-15:00 Gerson Neumann: Archive als Orte der Begegnung? Die<br />
Arbeit im Bereich der deutschen Literatur in brasilianischen<br />
Archiven<br />
Raum 64 H
Sektion 4 v Sección 4<br />
15:00-15:30 Susanne Thiemann: Germanistik im Nordwesten<br />
Argentiniens<br />
Raum 64 H<br />
15:30-16:00 Gustavo Giovannini: *Goethe en los textos ensayísticos<br />
de J. L. Borges<br />
Raum 64 H<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Raum 64 H<br />
17:00-17:30 Raum 64 H<br />
17:30-18:00 Raum 64 H<br />
18:15-19:45 Kulturveranstaltung (Foro Cultural de Austria,<br />
Auditorium<br />
BMUKK):<br />
Lesung von Tarek Eltayeb<br />
Salvador Allende<br />
Donnerstag, 08.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Christian Fandrych: Zum Stil deut- Auditorium<br />
scher wissenschaftlicher Vorträge (auch) aus kontrastiver<br />
Sicht.<br />
Silvano Barba<br />
Semiplenarvortrag Karen Pupp Spinassé:<br />
Auditorium Carlos<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht in<br />
einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
Ramírez Ladewig<br />
9:45-10:15<br />
10:15-10:45<br />
10:45-11:15<br />
11:15-11:45<br />
Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
11:45-12:00<br />
12:00-12:30<br />
12:30-13:00<br />
13:00-13:30<br />
Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
13:30-14:30<br />
14:30-15:00<br />
15:00-15:30<br />
15:30-16:00<br />
Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
79
80<br />
16:30-17:00 Gesine Müller: Der Lateinamerika-Nachlaß des Suhr-<br />
17:00-17:30<br />
kamp-Verlags im Deutschen Literaturarchiv Marbach:<br />
transatlantische Netzwerktechnologien<br />
Anna Kinder: Das Siegfried-Unseld-Archiv im Deutschen<br />
Literaturarchiv Marbach – Potentiale transdisziplinärer<br />
und transnationaler Forschung<br />
17:30-18:00 Ernest Hess-Lüttich: Die Erkundung deutschsprachiger<br />
Sprachenklaven in Lateinamerika als Anlass zur Kooperation<br />
von Germanistik und Romanistik<br />
18:00-19:00 Abfahrt zum Paraninfo<br />
19:00 Kulturveranstaltung der Universität Guadalajara:<br />
Lehrstuhl „Cortázar“ (Cátedra Cortázar): Plenarvortrag<br />
Juan Villoro: *Te doy mi palabra. Un itinerario en la traducción.<br />
Freitag, 09.03.2012<br />
9:00-11:00 9:00-9:25 Reinhard Andress “... heiße ich<br />
daher die Emigration gut”: der<br />
Fall des Egon Schwarz<br />
9:25- 09:50 Egon Schwarz:<br />
Lesung auf Deutsch***<br />
10:00 – 11:00 -Elisabeth Siefer: Einführung in<br />
die Übersetzung<br />
-Egon Schwarz: Lesung auf<br />
Spanisch<br />
-Diskussion<br />
Documental de Juliana Fischbein:<br />
des aparecer Exil und Erinnerung im Rahmen des<br />
Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er Jahre<br />
in Südamerika***<br />
Workshop Karen Schramm: Mündliches Erzählen im<br />
Fremdsprachenunterricht<br />
Workshop Dieter Jaeschke: Freundschaft, Ostalgie<br />
und weite Welt: Der Spielfilm „Friendship!“ (D 2010) im<br />
DaF-Unterricht<br />
Workshop Carmen Schier: Zur Arbeit mit Hörbüchern.<br />
Ein „Grenzgänger“ wird (neu) entdeckt<br />
Sektion 4 v Sección 4<br />
Paraninfo<br />
Juárez 975<br />
(Ecke Enrique Díaz<br />
de León)<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
61 H<br />
62 H<br />
63 H
Sektion 4 v Sección 4<br />
9:00-10:00 Verlagspräsentation Martina Bartucz, Cornelsen<br />
Verlag: Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Verlagspräsentation Anne Robert, Hueber Verlage:<br />
Menschen<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: DaF<br />
kompakt – das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: „Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur<br />
Sprache<br />
11:00-11:30 Pause<br />
11:30-12:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven der Germanistik in Auditorium Silvano<br />
Lateinamerika<br />
Barba<br />
Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: Beste<br />
Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
64 H<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven<br />
Tafelbildern am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz<br />
Neu“ und „Logisch!“<br />
65 H<br />
Verlagspräsentation Christina Kuhn, Cornelsen Verlag:<br />
Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was ändert sich,<br />
was bleibt?<br />
66 H<br />
12:30-13:30 Abschlussplenum <strong>ALEG</strong> Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
13:30-15:00 Mittagessen Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
15:00-17:00 <strong>ALEG</strong>-Mitgliederversammlung Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
17:15-19:15 AMPAL- Mitgliederversammlung Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
20:00 Abendessen & Abschlussfeier El Callejón de<br />
los Rumberos.<br />
Chapultepec Ecke<br />
Lerdo de Tejada<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H<br />
64 H<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
** Die Tagungsräume befinden sich im 3. Stock des Gebäude H vom CUCSH.<br />
*** Teil der Sektion 2 und des Kulturprogramms; nähere Informationen im Kulturprogramm<br />
81
82<br />
Beiträge in alphabetischer Reihenfolge<br />
Sektion 4 v Sección 4<br />
Gerhart Muench, ein deutscher Musiker, Philosoph und Dichter in Mexiko.<br />
Eine Reise ohne Rückkehr.<br />
Brumm, Maria<br />
Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, México<br />
Gerhart Muench (Dresden, 1907 – Tacámbaro, Michoacán, 1988) ist, wenn<br />
überhaupt, als Musiker bekannt. Als Pianist, Komponist und Dozent hat er in Mexiko<br />
tiefe Spuren hinterlassen. Er lebte dort 35 Jahre, davon die meiste Zeit in Michoacán. Sein<br />
Nachlass enthält aber auch Gedichte, Essays und andere Texte, die seine lebenslange<br />
schriftstellerische Tätigkeit belegen. 2007, zu seinem hundertsten Geburtstag wurde<br />
der zweisprachige Gedichtband Labyrinthus herausgegeben und dem folgt jetzt eine<br />
zweisprachige Ausgabe von anderen Texten unter dem Titel Metaphysische Marginalia<br />
und andere Schriften. Muench war ein vielseitiger Gelehrter, er schrieb über Philosophie<br />
wie über Literatur, Anthropologie, Mythologie und seine Lebensgeschichte ist ebenso<br />
faszinierend wie seine Texte, deren Übersetzung einer intensiven investigativen<br />
Tätigkeit bedurfte. Mit der Veröffentlichung seiner Schriften kann die Rezeption<br />
beginnen, sowohl in Amerika wie auch in Deutschland, wo er fast unbekannt ist, also in<br />
der Germanistik und der Romanistik.<br />
*Goethe en los textos ensayísticos de J. L. Borges<br />
Giovannini, Gustavo<br />
Universidad Nacional de Córdoba, Argentinien<br />
Entre las décadas de 1930 y 1950 importantes intelectuales latinoamericanos, por<br />
ejemplo Alfonso Reyes, expresaron su admiración por la obra y la personalidad de Johann<br />
W. von Goethe. En este contexto contrasta, sin embargo, la valoración ambigua, crítica y<br />
a menudo negativa que tuvo Jorge L. Borges sobre el gran escritor del clasicismo alemán.<br />
Borges dejó testimonio de la distancia que lo separaba de Goethe en ensayos,<br />
reseñas bibliográficas, conferencias y diarios personales. También en el cuento<br />
Deutsches Requiem esbozó una consideración crítica sobre la obra más célebre de<br />
Goethe, el Fausto. Estos juicios de Borges sobre Goethe sólo pueden comprenderse a<br />
partir del rol que juegan su propia concepción estético-literaria, la imagen de Goethe<br />
creada por la germanística desde fines del siglo XlX y, no en menor medida, la situación<br />
política imperante en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial.<br />
Im Laufe der Jahrzehnte 1930-1950 drückten rennomierte lateinamerikanische<br />
Intellektuelle – u.a. Alfonso Reyes – ihre Bewunderung für Johann W. von Goethes<br />
Werke und Persönlichkeit aus. Hierzu im Gegensatz steht jedoch die mehrdeutige,<br />
kritische und oft negative Beurteilung, die Jorge L. Borges dem gröβten Dichter der<br />
deutschen Klassik zuschrieb.
Sektion 4 v Sección 4<br />
Borges legte Zeugnis von seiner entfernten Beziehung zu Goethe in Essays,<br />
Rezensionen, Vorträgen und Tagebüchern ab. Auch in der Erzählung Deutsches Requiem<br />
skizzierte er seine kritische Betrachtungsweise über das wichtigste Goethe-Werk Faust.<br />
Borges Urteile über Goethe können nur verstanden werden, wenn man die Rolle<br />
seiner eigene ästhetische-literarische Konzeption berücksichtigt, das Goethe-Bild, das<br />
die Germanistik ab dem späten 19. Jahrhundert geschaffen hat, und nicht zuletzt die<br />
politische Situation Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg.<br />
Die Erkundung deutschsprachiger Sprachenklaven in Lateinamerika als<br />
Anlass zur Kooperation von Germanistik und Romanistik (am Beispiel der<br />
Sprachinselforschung in San Jerónimo Norte)<br />
Prof. Dr. Hess-Lüttich, Ernest<br />
Universität Bern, Schweiz<br />
Die Untersuchung von Sprachminderheiten, die Sprachinselforschung und die<br />
Analyse des sog. Code Switching sind relativ junge, aber seit etwa zwei Dekaden auch<br />
in der Germanistik ungemein prosperierende Forschungsgebiete der Angewandten<br />
Linguistik im Schnittfeld von Dialektologie, Geo-, Areal-, Ethno- und Soziolinguistik.<br />
Nach den 1989 vom Mannheimer Institut für Deutsche Sprache (IDS) inaugurierten<br />
Bestandsaufnahmen zum Stand des Sprachgebrauchs deutschsprachiger<br />
Minderheiten im nicht-deutschsprachigen Ausland und den Leitstudien des Duisburger<br />
Soziolinguisten Ulrich Ammon (1990 ff.) wuchs das Bewußtsein dafür, daß die Zeit<br />
drängt, wenn das Wissen über solche spezifischen Varietäten des Deutschen (vor allem<br />
in Übersee) gesichert werden soll, bevor die Erst- und Zweitsprachkompetenz der<br />
Sprecher/innen infolge von Assimilationsprozessen gänzlich verlorengegangen ist.<br />
Zwei Desiderate sind dabei augenfällig: zum einen mangelt es der germanistischen<br />
Erkundung deutschsprachiger Minderheiten erkennbar an Kooperationen mit den<br />
Philologien der jeweiligen Mehrheitssprachen (in Lateinamerika etwa mit der Romanistik<br />
bzw. Hispanistik); zum andern mangelt es an Erkundungen von nicht-deutschen,<br />
aber deutschsprachigen Minderheiten (auf der Basis nationaler Varietäten wie dem<br />
Österreichischen oder dem Schweizerdeutschen). Während z.B. der Sprachstand<br />
etlicher ‚deutscher‘ Enklaven im Ausland heute einigermaßen gut dokumentiert ist,<br />
gibt es für die Varietäten von aus der Deutsch-Schweiz ausgewanderten Minoritäten<br />
kaum verlässliches empirisch erhobenes und linguistisch analysiertes Material. Daher<br />
soll der Vortrag eine exemplarische Untersuchung des ‚Schweizerdeutschen‘ (genauer:<br />
des Walliserdeutschen) in ausgewählten Gemeinden (hier besonders der Kolonie San<br />
Jerónimo Norte in der argentinischen Provinz Santa Fé) auf der Grundlage eines Corpus<br />
von authentischem Sprachmaterial ins Zentrum stellen, um anhand dieses Beispiels<br />
für eine stärkere Kooperation zwischen den beteiligten Philologien (Germanistik,<br />
Linguistik, Romanistik, Hispanistik) zu werben.<br />
83
84<br />
Sektion 4 v Sección 4<br />
Das Siegfried-Unseld-Archiv im Deutschen Literaturarchiv Marbach – Potentiale<br />
transdisziplinärer und transnationaler Forschung<br />
Dr. Kinder, Anna<br />
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Deutschland<br />
Im Herbst 2009 gelang es dem Deutschen Literaturarchiv Marbach, die bedeutenden<br />
Archive der Verlage Suhrkamp und Insel für sich zu gewinnen. Die umfangreichen<br />
Bestände enthalten einmalige Schätze zur deutschen und internationalen Literatur-<br />
und Intellektuellengeschichte des 20. Jahrhunderts. Der Bestand, der nun das Siegfried-<br />
Unseld-Archiv (SUA) bildet, ist in seiner Gesamtheit eine beispiellose Sammlung<br />
literarischer und geistesgeschichtlicher Quellen, nicht nur der Bundesrepublik. Denn<br />
neben einer Vielzahl an Briefen und Manuskripten maßgeblicher Schriftsteller und<br />
Gelehrter wie Theodor W. Adorno, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger,<br />
Max Frisch, Jürgen Habermas, Peter Handke, Uwe Johnson, Niklas Luhmann, Gershom<br />
Scholem, Jacob Taubes oder Martin Walser spiegelt sich im Archiv auch Suhrkamps<br />
internationale Bedeutung wider. Neben zahlreichen europäischen Autoren wie Roland<br />
Barthes, Samuel Beckett, Marguerite Duras, T.S. Eliot, Michel Foucault, James Joyce oder<br />
Amos Oz kommt hier den lateinamerikanischen Autoren eine besondere Bedeutung zu,<br />
spielte Suhrkamp bei deren Entdeckung und Kanonisierung doch eine zentrale Rolle.<br />
Die hochverdichtete Überlieferungslage, sowohl was die Quantität als auch die Qualität<br />
der Dokumente betrifft, schafft in der deutschen Forschungs- und Archivlandschaft<br />
eine bisher nicht dagewesene Situation, die den Weg für neue Forschungswege und<br />
-kooperationen eröffnet. Die Netzwerke, die sich aus dem Archivmaterial erforschen<br />
lassen, erfordern selbst eine vernetzte Forschung. Germanistische, romanistische<br />
und anglistische Literaturwissenschaften, Kulturwissenschaften, Ideengeschichte,<br />
Soziologie, Philosophie: Der Bestand des SUA ermöglicht und fordert einen Blick über<br />
die Fachgrenzen der deutschen Literaturwissenschaft hinaus.<br />
In dem geplanten Beitrag soll nicht nur das Siegfried-Unseld-Archiv im DLA Marbach<br />
vorgestellt, sondern vor allem dessen Forschungspotential, wie es das DLA im Rahmen<br />
des geplanten Suhrkamp-Forschungskollegs realisiert, skizziert werden.<br />
Der Lateinamerika-Nachlaß des Suhrkamp-Verlags im Deutschen<br />
Literaturarchiv Marbach: transatlantische Netzwerktechnologien<br />
Dr. Müller, Gesine<br />
Universität Potsdam, Deutschland<br />
„Aber unsere Entdeckung … war Sigfried Unseld.“ – Mit diesen Worten des<br />
mexikanischen Nobelpreisträgers Octavio Paz betitelt Jan Bürger seinen Artikel über<br />
„Einen ersten Blick auf die Archive der Verlage Suhrkamp und Insel“. (Bürger 2010: 13)<br />
Was bedeutet es für eine Aufarbeitung der Geschichte deutsch-lateinamerikanischer<br />
Netzwerktechnologien, daß der Suhrkamp-Nachlass mit seinem bedeutungsvollen
Sektion 4 v Sección 4<br />
Lateinamerika-<strong>Programm</strong> vom Deutschen Literaturarchiv Marbach im Januar 2010<br />
übernommen wurde? Das Lateinamerika-<strong>Programm</strong> des Suhrkamp-Verlags hatte sich<br />
seit Ende der 1960er Jahre konstant entwickelt. Seit der ersten Vallejo-Ausgabe im Jahre<br />
1963 wurde es beständig ausgeweitet – bis zum Höhepunkt der Verkaufszahlen mit<br />
Isabel Allendes Geisterhaus in den 1980er Jahren mit 7 Mio. Exemplaren. Wie läßt sich die<br />
Geschichte der Rezeption lateinamerikanischer Literatur in Deutschland schreiben, in der<br />
der Suhrkamp-Verlag bis heute mit seinen 380 Titeln die Protagonistenrolle innerhalb<br />
der Verlagslandschaft einnimmt? Bis 1976 war Deutschland der Außenseiter, was die<br />
Rezeption der zeitgenössischen lateinamerikanischen Literatur in Europa angeht. Sie galt<br />
als Exotikum oder Steckenpferd für Liebhaber bzw. Experten. Generell gesehen war sie ein<br />
weißer Fleck. (Strausfeld 156) Die bedeutenden Werke, die übersetzt vorlagen, wurden in<br />
den sechziger Jahren kaum zur Kenntnis genommen – Erzählungen von Borges fanden<br />
nie mehr als 5000 Käufer, Rulfo und Roa Bastos wurden verramscht, Carpentier und Bioy<br />
Casares blieben Geheimtipps für Insider. Selbst das Erfolgsbuch par excellence, „Hundert<br />
Jahre Einsamkeit“, fand vor 1970 nur 9000 Käufer, trotz der mehr als 50 hymnischen<br />
Kritiken. Das galt als Rekord. Der Beitrag will angesichts dieses außergewöhnlichen<br />
Nachlasses im Deutschen Literaturarchiv Marbach Etappen einer Rezeptionsgeschichte<br />
lateinamerikanischer Literatur in Deutschland profilieren und dabei fragen, auf welche<br />
Art und Weise bestimmte Netzwerke im Kanonisierungsprozess einen Beitrag geleistet<br />
haben, der wiederum Folgen für eine Ausdifferenzierung des Konzepts Weltliteratur hatte.<br />
Archive als Orte der Begegnung? Die Arbeit im Bereich der deutschen<br />
Literatur in brasilianischen Archiven<br />
Dr. Neumann, Gerson Roberto<br />
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasilien<br />
Im April 2011 fand das Kolloquium “Coleções da imigração alemã e as novas<br />
possibilidades da digitalização” im Goethe Institut – Porto Alegre – in Brasilien<br />
statt. Organisiert wurde es von Institutionen aus Deutschland und Brasilien: dem<br />
Iberoamerikanischen Institut (Berlin) und dem Instituto Martius-Staden (São Paulo). Das<br />
deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung war Veranstalter.<br />
Ziel war es, einen Dialog zwischen deutschen und brasilianischen Benutzern<br />
von Bilbliotheken und Archiven herzustellen und ein Diskussionsforum anzufangen.<br />
Außerdem sollten die, in kleinen Archiven, Museen und Bibliotheken oft vergessenen<br />
historischen Dokumente identifiziert werden, um dann zusammen über mögliche<br />
Digitalisierungsformen sowie über die Erhaltung wichtiger Dokumente zu diskutieren.<br />
Durch diese Initiative kann eine Vernetzung in der Forschung beider Länder<br />
ermöglicht werden.<br />
Dies stellte eine besonders wichtige Gelegenheit dar, um über die Lage der<br />
bibliographischen Forschung in Hinblick auf die in Brasilien veröffentlichte Literatur<br />
85
86<br />
Sektion 4 v Sección 4<br />
in deutscher Sprache zu diskutieren. Mein Beitrag lautete “Eingeschlossen in Archiven.<br />
Die Suche nach Materialien zur deutschen Auswanderung nach Brasilien im Bereich<br />
Literaturwissenschaft.”<br />
Mein Ziel in der Sektion “Germanistik und Romanistik im Gespräch. Perspektiven<br />
der gegenseitigen Bereicherung – Archive als Orte der Begegnung” ist, über die<br />
brasilianischen Archive zu berichten, gerade weil sie sehr wertvolle Bestände besitzen.<br />
Diese können brasilianischen und deutschen Forschern eine andere, oft nicht bekannte<br />
Perspektive der Beziehung zwischen den beiden Ländern erlauben. Als Ergänzung soll<br />
aber auch die andere Seite, nämlich die Lage der deutschen Archive als Forschungsort<br />
für brasilianische Forscher, die ein Bild Brasiliens in der deutschen Literatur herzustellen<br />
versuchen, als Bericht eigener Erfahrung erwähnt werden.<br />
Interdisziplinäre Betrachtungen zum Brasilien-Roman Tropen, von Robert Müller<br />
Paulino, Sibele<br />
Universidade Federal do Paraná, Brasilien<br />
Der Beitrag analysiert Aspekte des Romans Tropen (1915) des österreichischen<br />
Schriftstellers Robert Müller unter dem Gesichtspunkt der Figuration des Raumes<br />
und der kulturellen Mobilität der Figuren in fremden Kontexten. Die Arbeit beachtet<br />
besonders den Dialog des Romans mit der Figuration des fiktiven brasilianischen<br />
Raumes. Der theoretische Ansatz der Arbeit ist interdisziplinär fundiert, zumal der<br />
Roman durch die Wahrnehmung einer literarischen Figur geografische Fragen<br />
programmatisch berücksichtigt. Das Werk weist daher ein für die aktuelle Geografie<br />
deutliches Interesse auf, obwohl sich bisher die Sekundärliteratur zumeist der<br />
psichoanalytischen Beudeutung dieser Figuration gewidmet hat. Die Beschreibung<br />
des Raumes (die Handlung spielt sich überwiegend im brasilianischen Amazonien ab)<br />
ist außer der von Christien Liederer bereits analysierten „Geografie der Seele“, im Wort<br />
der Hauptfigur des Romans, ebenso eine „Kartographie der Wahrnehmung fremder<br />
Kulturen“.<br />
Germanistik im Nordwesten Argentiniens<br />
Dr. Thiemann, Susanne<br />
Facultad de Filosofía y Letras der Universidad Nacional de Tucumán (Lektorat<br />
DAAD), Argentinien<br />
Dass Menschen im Nordwesten Argentiniens, kurz vor den Anden, umgeben von<br />
subtropischen Nebelwäldern, Deutsch lernen sollen, um in Deutschland einen Studien-<br />
oder Forschungsaufenthalt absolvieren zu können, ist gerade noch nachvollziehbar.<br />
Aber Germanistik, Deutsche Literatur- und Sprachwissenschaft zu studieren, scheint<br />
ebenso exotisch wie der hier bis vor kurzem lebende Ameisenbär. Dennoch ist vielen<br />
Studierenden, Dozenten und Forschern Deutsche Literatur nicht unbekannt. Die
Sektion 4 v Sección 4<br />
Kenntnisse beziehen sich jedoch hauptsächlich auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts.<br />
Das Wissen über Deutsche Literatur scheint in der Vergangenheit stehen geblieben zu<br />
sein. Dieses Phänomen deckt sich mit der Analyse der Bibliotheksbestände der Facultad<br />
de Filosofía y Letras der UNT: Die über 1300 Titel stammen, bis auf wenige Ausnahmen,<br />
aus den Jahren 1835-1973. Hieraus lassen sich verschiedene Dinge ablesen: Zum einen<br />
können Aussagen über das Interesse an bestimmten Autoren gemacht werden, zum<br />
anderen werden geschichtliche Ereignisse sichtbar: Ab 1975 übernahm in Argentinien<br />
eine Militärjunta die Macht. Gerade in Tucumán und besonders an der Facultad de<br />
Filosofía y Letras der UNT wurden im Vorfeld zahlreiche Intellektuelle und Professoren<br />
aus den Aulen heraus verhaftet, gefoltert und ermordet. Auch das Lesen von Büchern<br />
wurde strikt reglementiert, Haushalte nach „kommunistischen“ Titeln durchsucht. Ein<br />
aktuelles Projekt der Facultad de Filosofía y Letras sieht die Sammlung von relevanten<br />
Dokumenten vor, um ein Archiv zu gründen. Das hier vorgestellte Projekt möchte einen<br />
Beitrag zur Erforschung der Geschichte der Fakultät und insbesondere ihrer Germanistik<br />
leisten und einen Grundstein für zukünftige Forschungen legen.<br />
87
88<br />
Sektion 5<br />
Zurück zur Wirklichkeit: Konfigurationen des Realen in der deutschsprachigen<br />
und lateinamerikanischen Literatur<br />
Sektionsleitung:<br />
Prof. Dr. Paul Michael Lützeler<br />
Washington University<br />
Dr. Juliana Perez<br />
USP Brasil<br />
Prof. Dr. Miguel Vedda<br />
UBA, Argentina<br />
Konzept der Sektion<br />
In den letzten Jahrzehnten wurde in der kultur- und literaturwissenschaftlichen<br />
Debatte stets angenommen, dass “Wirklichkeit” erst durch Sprache konstituiert wird<br />
und wurde intralinguistisch, diskursiv oder narrativ verstanden. Wörter wie “Daten”,<br />
“Fakten”, “Reales”, “Welt”, “Wahrheit” u. a. seien diskursive Konstruktionen, die – später<br />
– wegen ihres nicht undurchschauten Verhältnisses zu Macht und Ideologie auch<br />
dekonstruiert werden sollten. Die Folge war eine relativ einseitige Beschränkung auf<br />
Text- und Diskursphänomene, auf autoreferentielle und metanarrative Strukturen,<br />
die sich scheinbar nicht mit einer vorgängigen außersprachlichen Wirklichkeit in<br />
Verbindung bringen ließen.<br />
Indessen lassen sich Hinweise auf extratextuelle Wirklichkeiten in den<br />
verschiedensten literarischen Texten beobachten: Das könnte man nicht nur von<br />
Literatur sagen, die sich als politisch engagiert versteht, sondern auch von der<br />
Literatur, die auf fiktionale Weise ethische Fragen stellt, oder von der, die historische<br />
Ereignisse rekonstruieren will, aber selbst von Texten, die durch Allegorie und Phantasie<br />
gesellschaftliche Verhältnisse kritisieren, satirisch verfremden oder in Frage stellen.<br />
Einen Realitätsbezug muss sogar eine Literatur aufweisen, die sich stark auf subjektive<br />
Erfahrungen stützt und einen Leser zur Identifikation anregt. “Wirklichkeit” kommt auch<br />
unabhängig von der Gattung in den Texten vor: Wenngleich seit dem 18. Jahrhundert<br />
der Roman zur zentralen literarischen Form geworden ist, wird der Umgang mit der<br />
Wirklichkeit auch in Drama und Lyrik gestaltet.<br />
In dieser Sektion werden Beiträge angenommen, die folgende Fragen diskutieren:<br />
Wie wird “Wirklichkeit” in der deutschsprachigen und lateinamerikanischen Literatur<br />
konfiguriert? Wie verstehen deutschsprachige und lateinamerikanische Schriftsteller<br />
das Verhältnis zwischen dem literarischen Text und der extralinguistischen Wirklichkeit?<br />
Wie wird die Frage der Wirklichkeit in den verschiedenen literarischen Gattungen<br />
behandelt? Welche Rolle spielen dabei ethische (auch menschenrechtliche), politische
und soziale Fragen? Wie wird das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Literatur in den<br />
unterschiedlichen literarischen Theorien verstanden? Welche Aspekte können Theorien<br />
der Rezeption bzw. Produktion des literarischen Textes zur Frage beitragen? Welche<br />
Faktoren sollten berücksichtigt werden, wenn eine Auffassung von Literatur gesucht<br />
wird, die vom sprachlichen Charakter des menschlichen Wirklichkeitsbezuges ausgeht<br />
und dennoch eine außersprachliche Wirklichkeit voraussetzt?<br />
89
90<br />
Montag, 05.03.2012<br />
Uhrzeit Ort<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
8:30-10:00 Einschreibung Paraninfo<br />
10:00-11:30 Eröffnungsveranstaltung:<br />
Juárez 975<br />
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Generalrektor (Ecke Enrique Díaz<br />
der Universität Guadalajara / Rector general de la<br />
Universidad de Guadalajara. Mtro. Pablo Arredondo<br />
Ramírez, Rektor des Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrums CUCSH / Rector del Centro Universitario<br />
de Ciencias Sociales y Humanidades. Dr. Lilia Oliver<br />
Sánchez, Leiterin der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät / Directora de la División de Estudios<br />
Históricos y Humanos. Dr. Edmund Duckwitz,<br />
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland /<br />
Embajador de la República Federal de Alemania.<br />
Dr. Alfred Längle, Botschafter der Republik Österreich<br />
/ Embajador de Austria. Dr. Gisela Schneider,<br />
Deutscher Akademischer Austauschdienst / Servicio<br />
Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Dr. Olivia<br />
C. Díaz Pérez, Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes / Presidenta de la Asociación<br />
Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
de León)<br />
11:30-12.00 Empfang des Generalrektors der Universität<br />
Guadalajara<br />
12:00-12:45 Plenarvortrag Paulo Astor Soethe:<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer<br />
international vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
12:45-13:30 Plenarvortrag Ottmar Ette: Die Literaturen der Welt<br />
aus transarealer Perspektive<br />
13:45-14:30 Abfahrt zum Tagungsort (CUCSH)<br />
14:30-16:00 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Vor dem<br />
Auditorium Salvador<br />
Allende<br />
16:00-16:30 Inge Stephan RAF- Gespenster. Die Trilogie Deutscher<br />
Herbst von F.C. Delius zwischen Faktizität und<br />
Fiktionalisierung<br />
Raum 65 H**
Sektion 5 v Sección 5<br />
16:30-17.00 Dieter Rall Wirklichkeit’ und Mythos der Fremdenlegion<br />
in Romanen und Berichten deutschsprachiger und<br />
mexikanischer Autoren<br />
17:00-17:30 Miguel Vedda *The real Thing. Elaboraciones literarias<br />
de lo real en compilaciones de “casos criminales<br />
célebres” de la literatura alemana decimonónica<br />
17:30-18:00 Pause<br />
18:00-19:30 Kulturveranstaltung (Goethe-Institut): Kabaret und<br />
Musik mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll<br />
19:30 Empfang der Deutschen Botschaft<br />
Eröffnung Karikaturenausstellung Goethe-Institut<br />
Dienstag, 06.03.2012<br />
Raum 65 H<br />
Raum 65 H<br />
Auditorium Salvador<br />
Allende<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
und Bibliothek<br />
Manuel Rodríguez<br />
Lapuente<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Hermann Funk:<br />
Auditorium<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?. Modelle zum<br />
Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz und ihre<br />
praktischen Konsequenzen<br />
Silvano Barba<br />
Semiplenarvortrag Friedhelm Schmidt-Welle:<br />
Auditorium Carlos<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und<br />
Alzheimer<br />
Ramírez Ladewig<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Günter Augustin Kunst oder Diskurs Raum 65 H<br />
10:45-11:15 Helmut Galle Von der Konstruktion des Genies<br />
zur Rekonstruktion des historischen Menschen:<br />
Romanbiographien über große<br />
Musiker von Werfel bis Krausser<br />
Raum 65 H<br />
11:15-11:45 Adriana Massa La visión indirecta de la identidad<br />
personal en Borges Gibt es nicht de Gerhard Köpf<br />
Raum 65 H<br />
11:45-12:15 Pause<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Erwin Tschirner:<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
91
92<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Claudia Dornbusch:<br />
Auditorium Carlos<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche<br />
Wissenschaft?<br />
Ramírez Ladewig<br />
13:00-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
14:30-15:00 Patricia Dávalos Auf der Suche nach sich selbst und nach<br />
einer neuen Schreibweise: Christa Wolfs Kindheitsmuster<br />
Raum 65 H<br />
15:00-15:30 Heike Muranyi Wirklichkeitsentwürfe in Erzählungen<br />
von Clemens Meyer.<br />
Raum 65 H<br />
15:30-16:00 Tobias Kraft Entwurf eines »Realismus der<br />
Globalisierung« am Beispiel der Romane von Terézia<br />
Mora<br />
Raum 65 H<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Tercio Redondo Arbeit und soziale Fragen bei Robert<br />
Walser, Cyro dos Anjos und Graciliano Ramos<br />
Raum 65 H<br />
17:00-17:30 Suzana C. Albuquerque Die Ausnahme und die Regel oder<br />
die Ausnahme als Regel: das Lehrstück von Bertolt Brecht<br />
Raum 65 H<br />
17:30-18:00 Elisabeth A. Mager Hois Dialektik in der Dichtung von<br />
Bertolt Brecht<br />
Raum 65 H<br />
18:15-19:45 Kulturveranstaltung (Foro Cultural de Austria,<br />
Auditorium<br />
BMUKK):<br />
Lesung von Tarek Eltayeb<br />
Salvador Allende<br />
Donnerstag, 08.03.2012<br />
Semiplenarvortrag Christian Fandrych: Zum Stil<br />
deutscher wissenschaftlicher Vorträge (auch) aus<br />
9:00 – 9:45 kontrastiver Sicht.<br />
Semiplenarvortrag Karen Pupp Spinassé:<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht<br />
in einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Paul Michael Lützeler Hermann Broch ueber das<br />
oekonomische Gleichgewicht<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium Carlos<br />
Ramírez Ladewig<br />
Raum 65 H
Sektion 5 v Sección 5<br />
10:45-11:15 Juliana Perez Zur Frage der Wirklichkeit bei Paul Celan Raum 65 H<br />
11:15-11:45 Bastian Reinert Jenseits des Realen. Hans Erich<br />
Nossack und Juan Rulfo<br />
Raum 65 H<br />
11:45-12:00 Pause<br />
12:00-12:30<br />
Sektionsarbeit<br />
Valeria Pereira Die Darstellung der Suche nach<br />
Erkenntnis in Jahnns „Ein Knabe weint“<br />
Raum 65 H<br />
12:30-13:00 Gloria Ito Sugiyama *La recepción de lo fantástico en<br />
Latinoamérica: Julio Cortázar<br />
Thomas Antonic Wirklichkeit ist eine Frage der<br />
Perspektive. Verhandlungen von Wirklichkeiten,<br />
Raum 65 H<br />
13:00-13:30 Fiktionen und Simulationen bei Wolfgang Bauer und<br />
einigen Vertretern der sogenannten „phantastischen<br />
Literatur“ des Cono Sur.<br />
Raum 65 H<br />
13:30-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
14:30-15:00 Paul Schneeberger Wien-Bilder in der österreichischen<br />
Literatur des 21. Jahrhunderts<br />
Raum 65 H<br />
15:00-15:30 Adriana Haro-Luviano *Literarische Bilder von<br />
Schauplätzen in Mexiko-Stadt<br />
Raum 65 H<br />
15:30-16:00 Sigurd Jennerjahn La recepción de lo fantástico en<br />
Latinoamérica: Julio Cortázar<br />
Raum 65 H<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
Joshua Bonilla Intertextualität als Durchbruch<br />
16:30-17:00 ins Reale: Heinrich von Kleists “Prinz Friedrich von<br />
Homburg” und seine literarischen Vorgänger<br />
17:00-17:30<br />
17:30-18:00<br />
18:00-19:00 Abfahrt zum Paraninfo<br />
Kulturveranstaltung der Universität Guadalajara:<br />
19:00<br />
Lehrstuhl „Cortázar“ (Cátedra Cortázar): Plenarvortrag<br />
Juan Villoro: *Te doy mi palabra. Un itinerario en la<br />
traducción.<br />
Raum 65 H<br />
Paraninfo<br />
Juárez 975<br />
(Ecke Enrique Díaz<br />
de León)<br />
93
94<br />
Freitag, 09.03.2012<br />
9:00-11:00 9:00-9:25 Reinhard Andress “... heiße ich daher<br />
die Emigration gut”: der Fall des Egon<br />
Schwarz<br />
9:25- 09:50 Egon Schwarz:<br />
Lesung auf Deutsch***<br />
10:00 – 11:00 Elisabeth Siefer: Einführung in die<br />
Übersetzung<br />
Egon Schwarz: Lesung auf Spanisch<br />
-Diskussion<br />
9:00-10:00<br />
Documental de Juliana Fischbein:<br />
des aparecer Exil und Erinnerung im Rahmen des<br />
Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er Jahre<br />
in Südamerika***<br />
Workshop Karen Schramm: Mündliches Erzählen im<br />
Fremdsprachenunterricht<br />
Workshop Dieter Jaeschke: Freundschaft, Ostalgie<br />
und weite Welt: Der Spielfilm „Friendship!“ (D 2010) im<br />
DaF-Unterricht<br />
Workshop Carmen Schier: Zur Arbeit mit Hörbüchern.<br />
Ein „Grenzgänger“ wird (neu) entdeckt<br />
Verlagspräsentation Martina Bartucz, Cornelsen<br />
Verlag: Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Verlagspräsentation Anne Robert, Hueber Verlage:<br />
Menschen<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: DaF<br />
kompakt – das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: „Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur<br />
Sprache<br />
11:00-11:30 Pause<br />
11:30-12:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven der Germanistik in<br />
Lateinamerika<br />
Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: Beste<br />
Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
11:30-12:30 Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
61 H<br />
62 H<br />
63 H<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H<br />
64 H<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
64 H<br />
65 H
Sektion 5 v Sección 5<br />
Tafelbildern am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz<br />
Neu“ und „Logisch!“<br />
Verlagspräsentation Christina Kuhn, Cornelsen<br />
Verlag: Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was<br />
ändert sich, was bleibt?<br />
66 H<br />
12:30-13:30 Abschlussplenum <strong>ALEG</strong> Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
13:30-15:00 Mittagessen Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
15:00-17:00 <strong>ALEG</strong>-Mitgliederversammlung Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
17:15-19:15 AMPAL- Mitgliederversammlung Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
20:00 Abendessen & Abschlussfeier El Callejón de<br />
los Rumberos.<br />
Chapultepec Ecke<br />
Lerdo de Tejada<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
** Die Tagungsräume befinden sich im 3. Stock des Gebäude H vom CUCSH.<br />
*** Teil der Sektion 2 und des Kulturprogramms; nähere Informationen im Kulturprogramm<br />
Beiträge in alphabetischer Reihenfolge<br />
Wirklichkeit ist eine Frage der Perspektive. Verhandlungen von Wirklichkeiten,<br />
Fiktionen und Simulationen bei Wolfgang Bauer und einigen Vertretern der<br />
sogenannten „phantastischen Literatur“ des Cono Sur<br />
Dr. Antonic, Thomas<br />
Universität Wien, Österreich<br />
Wolfgang Bauer bezeichnete die Werkphase, in der er mit Stücken wie Magic<br />
Afternoon (1968) und Gespenster (1973) weltweit Erfolge feierte, lediglich als „side step“<br />
und konfrontierte Publikum und Kritik ab Magnetküsse (1976) mit einer „komplexen<br />
Verquickung von ästhetischen Experimenten mit philosophisch-existenziellen Inhalten“<br />
(Paul Pechmann), die weitestgehend auf Verständnisprobleme stießen. Es handelt sich<br />
bei diesen späteren Stücken um einen „Weg nach Innen“, wie es Martin Esslin bezeichnet,<br />
bei dem „die Ebene der äußeren Wirklichkeit verlassen wird und wir in das Bewußtsein<br />
[...] der Figuren eintreten“: Magnetküsse etwa zeigt in 90 Minuten eine einzige Sekunde<br />
in der Wahrnehmung des Schriftstellers Ernst Ziak, dessen Identität gerade im Auflösen<br />
begriffen ist. Das erinnert etwa an Jorge Luis Borges’ Erzählung El milagro secreto [dt.<br />
95
96<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
Das geheime Wunder], in der einem Schriftsteller in der Sekunde seiner Hinrichtung ein<br />
ganzes Jahr geschenkt wird, um sein letztes Drama vollenden zu können – was sich<br />
allerdings nur im Bewusstsein des Protagonisten ereignet. Weder bei Borges noch bei<br />
Bauer handelt es sich jedoch streng genommen um „phantastische Literatur“ im Sinne<br />
der Darstellung von Unmöglichem oder Übernatürlichem, sondern um philosophische<br />
Gedankenexperimente, die in literarischen Texten verarbeitet werden. Es ist also eine<br />
Form der Darstellung von Wirklichkeit aus einer extremen Innenperspektive. (Dass im<br />
Traum das Zeitempfinden quasi ausgeschaltet wird und ein „langer“ Traum in Wahrheit<br />
nur einige Sekunden dauert, ist schon länger bekannt und legt nahe, dass eine solche<br />
Wahrnehmung von Zeit auch bei Eintritt des Todes vorkommen kann.)<br />
Zudem verhandeln sowohl Borges als auch Bauer das Verhältnis von Realität und<br />
Simulation, indem Metafiktionen entworfen werden, die sich mit der Fiktion vermischen,<br />
decken oder diese überlagern. Man denke etwa an Borges’ El hacedor [dt. Borges und<br />
ich], worin ein Reich geschildert wird, in dem die Kartographen eine so detaillierte Karte<br />
anfertigen, dass Karte und Territorium schließlich exakt zur Deckung kommen, oder an die<br />
dramatis personae in Bauers Café Tamagotchi (1998), die ausschließlich computergenerierte,<br />
fremdgesteuerte Simulationen von Menschen sind, die sich im zweiten Teil des Stücks<br />
jedoch so „echt“ verhalten, dass der Rezipent nicht mehr zu unterscheiden vermag, ob es<br />
sich nun um Simulationen oder um „wirkliche“ Menschen handelt. Tatsächlich handelt es<br />
sich – um mit Baudrillard zu sprechen – um die „Substituierung des Realen durch Zeichen<br />
des Realen“, was schließlich zur Auslöschung des Realen führt, da dieses im Falle von Café<br />
Tamagotchi schlichtweg nicht mehr vorhanden ist.<br />
Weitere Parallelen lassen sich zwischen Bauer und Adolfo Bioy Casares ziehen (z.B.<br />
die Simulation in Bioy Casares’ La invención de Morel [1940, dt. Morels Erfindung]), zu<br />
Jenaro Prieto Leteliers Roman El socio (1928), oder zu den Dramen Roberto Arlts (z.B. El<br />
fabricante de fantasmas oder Saverio el cruel [beide 1936]), die, wie einige Stücke Bauers,<br />
eine Verwandtschaft zu den Rollenspielen und der daraus resultierenden Konkurrenz<br />
von Wirklichkeiten in den Stücken Luigi Pirandellos aufweisen.<br />
Kunst oder Diskurs<br />
Prof. Dr. Augustin, Günther<br />
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasilien<br />
In der Novelle Un episodio en la vida del pintor viageiro des argentinischen<br />
Schriftstellers César Aira werden eine Reihe der Fragen dargestellt und reflektiert,<br />
welche diese Sektion behandelt. Ist der Titel noch anonym formuliert, so geht es im<br />
Text auch um einst real existierende Figuren, den Maler Moritz Rugendas, der Alexander<br />
von Humboldts Modell der Naturdarstellung fort- aber auch umschreiben will. Es<br />
geht also um die Grundfrage der Repräsentation. Dabei scheint der Erzähler einem<br />
gemäßigten Konstruktivismus das Wort zu reden, widerlegt sich aber selber durch
Sektion 5 v Sección 5<br />
seinen Rückgriff auf real-historische Fakten. Die Mischung aus historischen Fakten,<br />
Fiktion und Reflektion ist eine Allegorie der Suche nach der wahren Darstellungsform<br />
am Beispiel des Selbst- oder Fremdverständnisses Lateinamerikas. Damit werden neben<br />
der historisch-politischen Frage auch die Fragen der Konfiguration von Wirklichkeit<br />
und des Verhältnisses von literarischem Text und außersprachlicher Wirklichkeit<br />
angesprochen. Ausgehend von der Rugendas zugeschriebenen Feststellung des<br />
Erzählers “el arte era más útil que el discurso” wollen wir dann das Verhältnis von<br />
intuitiver und diskursiver Darstellung im Lichte Kants beleuchten. Außerdem stellt<br />
sich uns die Frage, welche Faktoren berücksichtigt werden sollten, um eine Auffassung<br />
von Literatur zu begründen, die sowohl die sprachliche als auch die außersprachliche<br />
Komponente eines literarischen Textes in Betracht zieht. Wir gehen dabei von einer<br />
dialektischen Beziehung von Sprache und Wirklichkeit aus und benutzen den Begriff<br />
„Diskurs“ im Sinne einer historisch bedingten intentionalen Rede. Dieser Begriff kann<br />
auch auf literarische Texte angewandt werden und bezieht sich auf die sprachliche<br />
Form die außer- oder vorsprachliche Gegebenheiten zum Ausdruck bringt.<br />
Intertextualität als Durchbruch ins Reale: Heinrich von Kleists “Prinz Friedrich<br />
von Homburg” und seine literarischen Vorgänger<br />
Bonilla, Joshua Clemente<br />
University of Chicago, USA<br />
Der Verzicht auf die Wirklichkeitsdarstellung gilt als axiomatisches Kennzeichen<br />
der deutschen Romantik, besonders im Bereich der dramatischen Literatur. In der<br />
bekanntesten Inkarnation der romantischen Dramatik, der Tieck’schen Ironie, gibt<br />
das Dargestellte jeden Anspruch auf diegetische Kohärenz sowie metadramatische<br />
Realität auf. Die Ablehnung des von der Aufklärung geprägten ‘Illusionstheaters’<br />
sollte insbesondere die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Stück als ästhetisches<br />
Geschehen zurückgewinnen. Für Autoren am Rande der Romantik, nicht zuletzt für<br />
Heinrich von Kleist, dessen “Prinz Friedrich von Homburg” in meinem Vortrag behandelt<br />
wird, wird die gescheiterte Überwindung einer objektiven Realität zur zentralen<br />
Problemstellung.<br />
In Kleists letztem dramatischen Werk konzipiert der zum Tode verurteilte Titelheld ein<br />
transzendierendes Ideal nach seiner Phantasie, und Homburgs imaginierter Sieg über den Tod<br />
strebt offensichtlich Kleists literarischen Vorgängern, z.B. Friedrich Schillers Wallenstein und<br />
Pedro Calderóns standhaftem Prinzen, anachronistisch nach. Durch eine hochtheatralische<br />
Inszenierung seines Todesurteils in der allerletzten Szene wurde jedoch die unbändige<br />
Phantasie des Prinzen Homburgs rettungslos zerschmettert, eine Rückkehr ins Reale, welche<br />
in der Sekundärliteratur traditionell als Vervollkommnung seiner Bildung gelesen wird. Diese<br />
Lektüre vertuscht jedoch die Zweckmäßigkeit der intertextuellen Vorbilder des Dramas, die<br />
in Homburgs drei Monologen besonderes zentral erscheinen. Mein Vortrag beschäftigt sich<br />
97
98<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
intensiv mit diesen drei Szenen und deren Bezug auf Calderóns “standhaften Prinzen,” den<br />
Kleist durch Adam Müllers dramatische Vorlesungen zweifellos gekannt hat. In Hinsicht<br />
auf dieses romantische und spanische Vorbild versteht sich der abschießende Durchbruch<br />
ins Reale vielmehr als Zusammenstoß einer intertextuell geprägten Phantasie und einer<br />
unvermeidlichen objektiven Wirklichkeit.<br />
Die Ausnahme und die Regel oder die Ausnahme als Regel: das Lehrstück von<br />
Bertolt Brecht.<br />
Campos de Albuquerque Mello, Suzana<br />
Faculdade de Tecnologia de São Paulo, Brasilien<br />
Dieser Vortrag hat das Ziel, eine kurze Lesung des Lehrstücks Die Ausnahme<br />
und die Regel (1929/39) von Bertolt Brecht vorzustellen. Die Lesung bezieht den<br />
Entstehungskontext, also den Zusammenhang mit der Weimarer Republik, ein, die<br />
Stilistik des Autors, seine Stellung und Beziehung zum Theater sowie das Publikum, an<br />
welches das Stück gerichtet ist. Mit diesem Ziel wird der Text vorgestellt und der “Dialog”<br />
zwischen Bertolt Brecht und dem Juristen Carl Schmitt soll aufgezeigt werden. In der<br />
Weimaren Republik verfasste der Jurist vier Werke (Die Diktatur, Politische Theologie,<br />
Legalität und Legitimität und Der Hüter der Verfassung), die scheinbar massgeblich die<br />
Nazi Ideologie beeinflussten. So birgt das Werk Die Ausnahme und die Regel einige<br />
Elemente, die mit den Ideen von Carl Schmitt in Beziehung gebracht werden können,<br />
dies natürlich durch die Dialektik.<br />
Auf der Suche nach sich selbst und nach einer neuen Schreibweise:<br />
Christa Wolfs Kindheitsmuster<br />
Dávalos, Patricia Miranda<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien<br />
Christa Wolf ist vielleicht die erfolgreichste Autorin der ehemaligen DDR und ihr<br />
persönlicher und literarischer Weg war eng verbunden mit dem des Staates, in dem sie<br />
lebte. 1976 erschien das Werk Kindheitsmuster. Trotz eines Hinweises am Anfang des<br />
Textes mit der Behauptung, dass Inhalt und Figuren Erfindungen seien, wird offensichtlich<br />
von einer entscheidenden Lebensphase Wolfs erzählt – ihrer Kindheit während der NS-<br />
Zeit und der Neuorientierung in der Nachkriegszeit. Nach über 30 Jahren veröffentlichte<br />
sie Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud (2010), das dem Werk Kindheitsmuster<br />
sehr ähnlich ist, sowohl in der Erzählstruktur und den verwendeten literarischen Mitteln,<br />
als auch in der Thematik. Es geht wieder um einen Hauptmoment im Leben der Autorin –<br />
die Veränderungen und die Anpassungsschwierigkeiten nach der Wende. Erneut gibt es<br />
einen Hinweis auf die Fiktionalität eines jedoch deutlich autobiografischen Textes.<br />
Durch einen Vergleich der beiden Bücher soll analysiert werden, welche sprachlichen<br />
Mittel und literarischen Strategien die Autorin zu den zwei verschiedenen Zeitpunkten
Sektion 5 v Sección 5<br />
einsetzt, um die persönliche Erfahrung, die Auseinandersetzung mit der eigenen<br />
Vergangenheit und der eigenen “Schuld” zu konfigurien – z.B. die Verbindung von<br />
persönlichen Ereignissen mit der zeitgenössischen Geschichte, sodass Zusammenhänge<br />
und Analogien entstehen. Zum Schluss wird versucht, das Unternehmen Wolfs nicht<br />
als isoliertes Phänomen zu verstehen, sondern als Teil einer literarischen Tendenz<br />
der letzten Jahrzehnte, nämlich der Autofiktion. Der Begriff soll beim Verständnis<br />
der Texte helfen, die mit Faktualität und Fiktionalität spielen, bei denen es um einen<br />
Gattungsgrenzfall geht und welche die Suche nach neuen literarischen Strategien der<br />
Erzählung persönlicher Erfahrungen spiegeln.<br />
Von der Konstruktion des Genies zur Rekonstruktion des historischen<br />
Menschen: Romanbiographien über große Musiker von Werfel bis Krausser<br />
Prof. Dr. Galle, Helmut P.E.<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien<br />
In der Vorbemerkung zu Verdi. Roman der Oper zitiert Franz Werfel 1923 die Worte<br />
seines Protagonisten: “Die Wahrheit nachbilden mag gut sein, aber die Wahrheit<br />
erfinden ist besser, viel besser”. Fiktionale Bücher über historische Personen stehen unter<br />
einem doppelten Anspruch: sie müssen sowohl den ästhetischen Forderungen an den<br />
Roman gerecht werden, ohne dadurch in krassen Widerspruch zu den geschichtlichen<br />
Tatsachen zu geraten. Wie geht der Schriftsteller mit dem Konflikt zwischen ausmalender<br />
Imagination und Faktentreue um? Wie vermittelt er seinem Leser das in seiner Erzählung<br />
hergestellte spezifische Verhältnis von Geschichte und Phantasie? Welche spezifische<br />
Art von Wahrheit glaubt er – in Konkurrenz mit dem historiographischen Genre der<br />
Biographie – mithilfe der Fiktionalisierung hervorbringen zu können? Diesen Fragen<br />
soll anhand von fünf Büchern über Komponisten nachgegangen werden. Dazu zählen<br />
neben Werfels Roman die Bücher von: Klaus Mann über Tschaikowsky (Symphonie<br />
Pathétique, 1949), Wolfgang Hildesheimer über Mozart (1977), Peter Härtling über<br />
Schubert (1992) und Helmut Krausser über Puccini (2008). Keiner der fünf Autoren<br />
verzichtet auf seinen literarischen Ehrgeiz bei der Darstellung von Vita und Genie<br />
seines Protagonisten. Verfasst und publiziert über einen Zeitraum von nahezu einem<br />
Jahrhundert lassen die Befunde möglicherweise auch Rückschlüsse zu, wie sich das<br />
Fiktionsverständnis von der Weimarer Republik bis heute gewandelt hat.<br />
*Literarische Bilder von Schauplätzen in Mexiko-Stadt<br />
Haro-Luviano, Adriana<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, México<br />
In der Tradition der deutschsprachigen Literaturen gibt es viele Beispiele verschiedener<br />
Gattungen, in denen die Wirklichkeit lateinamerikanischer Großstädte beschrieben<br />
wird. Dasselbe gilt für die Literatur Lateinamerikas. Aus den vielen literarischen Bil-<br />
99
100<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
dern der Megalopolis in Werken mexikanischer und deutschsprachiger Autoren wähle<br />
ich für diesen Beitrag bestimmte reale Schauplätze der Stadt Mexiko aus. Dabei werden<br />
nicht nur architektonische, künstlerische und stadtplanerische Aspekte fokusiert und<br />
kritisiert, sondern auch politische, soziale und kulturelle Phänomene dargestellt.<br />
Die Werke von zwei jungen aktuellen Schriftstellern Deutschlands, Stefan Wimmer<br />
(Der König von Mexiko) und Airen (I Am Airen Man), enthalten viele Großstadtszenen, die<br />
eine Realität literarisch widerspiegeln. In meinem Beitrag ergänze ich die Darstellung<br />
der deutschen Autoren mit den in zwei mexikanischen Romanen enthaltenen Ansichten<br />
von Mexiko-Stadt. Es handelt sich um die zeitgenössischen Schriftsteller Gonzalo<br />
Celorio (Y retiemble en sus centros la tierra) und Guillermo Fadanelli (Hotel DF).<br />
*Die Rezeption des Phantastischen in der latinamerikanischen Literatur:<br />
Julio Cortázar<br />
Ito Sugiyama, Gloria Josephine Hiroko<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, México<br />
Podemos juzgar a partir de nuestras propias categorías culturales y por lo tanto<br />
nuestras certezas son relativas y la única manera de comprender lo otro, lo extraño, es<br />
de acuerdo a lo que conocemos.<br />
En La literatura fantástica comenta Borges: Europa quiere siempre tener todo claro.<br />
Crea términos para nombrar todo. Establece una diferencia entre fantasía y realidad.<br />
Mientras que en Latinoamérica estos términos están tan imbricadas y vivimos en las dos<br />
a la vez, o pasamos tan sutilmente de una a otra que los términos se confunden.<br />
Hablaré de Julio Cortázar, autor argentino, latinoamericano, universal para quien<br />
lo fantástico nos acompaña aun en la cotidianeidad Para él no es necesario que existan<br />
elementos determinados para que un texto se considere fantástico, como lo era<br />
anteriormente. Hay autores que poseen la creencia de que un texto es fantástico por la<br />
presencia de fantasmas o seres sobrenaturales, como lo fue el caso de Lovecraft.<br />
Lo fantástico dejó de clasificarse por los elementos que lo conformaban. El tema<br />
podía ser un indicio de la pertenencia al género fantástico, pero no elemento único<br />
ni exclusivo. Lo fantástico se convirtió en un instrumento estético cuyo objetivo fue<br />
poner en duda lo real de la realidad, su efecto. Un efecto con profundas repercusiones<br />
subversivas, ya que dudar de la realidad pareció la mejor manera de acorralar a la<br />
ideología, dice Agustín Cadena, quien es novelista, cuentista, ensayista, poeta y<br />
traductor, además de profesor universitario de literatura. Obtuvo algunos premios<br />
entre los que se cuentan: el Premio Nacional Universidad Veracruzana 1992, y el Premio<br />
Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada 1998.<br />
Wir können aufgrund von unserer eigenen kulturellen Kategorie beurteilen,<br />
wodurch unsere Wahrheiten nur relativ sind und der einzige Weg etwas anderes, etwas<br />
Fremdes zu verstehen, ist unserem Wissen entsprechend.
Sektion 5 v Sección 5<br />
Borges sagt in seinem Werk Phantastische Literatur: Europa will immer klar sein. Es<br />
schafft Begriffe für alles. Es erstellt Unterschiede zwischen Phantasie und Wirklichkeit.<br />
In Lateinamerika hingegen sind diese Begriffe miteinander verwoben, dort leben sie<br />
in Phantasie und Wirklichkeit gleichzeitig bzw. springen unauffällig vom einen zum<br />
anderen, sodass die Begriffe dort verwechselt werden.<br />
Ich werde von Julio Cortázar, einem argentinischen, lateinamerikianschen und auch<br />
universellen Schriftsteller, dessen fantastischen Gedanken uns noch heute im Alltag<br />
begleitet. Für ihn ist es nicht von Bedeutung, dass vorbestimmte Elemente existieren,<br />
was früher der Fall war, damit ein Text fantastisch wird. Es gibt Autoren, die glauben,<br />
dass ein Text nur phantastisch sein kann, wenn Geister oder übernatürlichen Wesen<br />
anwesend sind, so wie bei Lovecraft.<br />
Die fantastischen Elemente konnten nicht mehr durch die, aus denen sie bestanden,<br />
klassifiziert werden. Das Thema könnte ein Zeichen der Zugehörigkeit zu dem Fantasy-<br />
Genre sein, jedoch nicht als einziges oder ausschließliches Element. Die fantastischen<br />
Elemente wurde zu einem ästhetischen Instrument, dessen Ziel war, die Realität der<br />
Wirklichkeit und ihre Wirkung zu hinterfragen. Eine Wirkung mit tiefgreifende subversive<br />
Auswirkungen, da laut Agustín Cadena, Schriftsteller, Essayist, Dichter, Übersetzer und<br />
Universitätsprofessor für Literatur, das Zweiflen an der Realität der beste Weg ist, die<br />
Ideologie zu befragen. Cadena erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem der<br />
“Premio Nacional de la Universidad Veracruzana“, 1992, und der Kinder Short Story Preis<br />
Juan de la Cabada, 1998.<br />
Verlorene Welten und mythische Reisen. Die Tropen in zwei Romanen vom<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
Jennerjahn, Sigurd<br />
Universidade Federal do Pará in Belém, Brasilien<br />
In den beiden Romanen The Lost World (1912) des britischen Schriftstellers Arthur<br />
Conan Doyle und Tropen (1915) des Österreichers Robert Müller entfaltet sich die<br />
Handlung – auf je unterschiedliche Weise – im Amazonasgebiet. Beide Autoren waren<br />
mit dem Ort der Handlung nicht aus erster Hand vertraut, sondern stützten sich auf<br />
Reise- und Forschungsberichte aus ihrer Zeit. Sieht man von den Unterschieden<br />
hinsichtlich des Genres und der Erzählstruktur ab, gestalten beide Romane die<br />
dichotomische Beziehung zwischen Zivilisation und Wildnis bzw. Wildheit. In beiden<br />
Romanen spielen Motive der Schatzsuche eine Rolle und die wissenschaftlichtechnische<br />
Erschlieβung des amazonischen Dschungels wird verhandelt. In dem Beitrag<br />
wird gezeigt, wie Amazonien in den beiden Texten als Raum der Handlung dargestellt<br />
wird. Welche zeitgenössischen Diskurse werden aufgenommen? Welche Ereignisse<br />
der Zeit schlagen sich nieder? Wie wird das Feld zwischen den Polen Zivilisation und<br />
Wildnis, Kultur und Natur aufgebaut? Welche ethischen Implikationen ergeben sich aus<br />
101
102<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
den Handlungsoptionen Gestalten oder Bewahren für die Akteure? Schlieβlich wird ein<br />
Blick auf das kulturelle Nachleben der Romane geworfen und die darin beleuchteten<br />
Fragen werden zu aktuellen Diskussionen um den Amazonas in Beziehung gesetzt.<br />
Entwurf eines »Realismus der Globalisierung« am Beispiel der Romane von<br />
Terézia Mora<br />
Kraft, Tobias<br />
Universität Potsdam, Deutschland<br />
War der literarische Realismus des 19. Jahrhunderts ein »bürgerlicher« und der<br />
des 20. ein je nach Befund »sozialistischer« oder »magischer«, so können wir unter<br />
den Vorzeichen des nicht mehr ganz so jungen aktuellen Jahrhunderts von einem<br />
»Realismus der Globalisierung« sprechen.<br />
Das Leitmedium dieses Realismus des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr der<br />
»klassische« Roman, die Malerei oder die Bildhauerei, sondern der Film, und in<br />
besonderem Maße das Fernsehen (The Wire, 2002-2008; Breaking Bad, 2008-2012).<br />
Der Rückbezug zur generischen Form des Romans bleibt bei diesen hochwertigen<br />
»visual novels« zwar stets evident, doch scheint der Erzähltext als Medium einer<br />
zeitgenössischen Ästhetik des Realen gegen diese Dominanz der visuellen Narrative<br />
eine seiner letzten Domänen bereits verloren zu haben. Welche Rolle kann die Literatur<br />
angesichts dieser weit fortgeschrittenen Verschiebung des medialen Feldes noch<br />
spielen? Welche Eigenständigkeit kann sie darin behaupten?<br />
Das Ziel dieses Vortrags soll sein, diese beiden Fragen am Beispiel der Romane<br />
Alle Tage (2004) und Der einzige Mann auf dem Kontinent (2009) von Terézia Mora<br />
exemplarisch zu beantworten.<br />
Moras Romane lassen sich in zweierlei Weise einem hier postulierten »Realismus<br />
der Globalisierung« zuordnen. Zum einen durch die ganz in die gegenwärtigen<br />
Gesellschaftskonfigurationen des Globalen verankerten Romangegenstände: der<br />
Migration als Zustand fortgesetzter Ortlosigkeiten (Alle Tage) sowie der internet-basierten<br />
Arbeitsökonomie (Der Mann …). Zum anderen durch die literarische Darstellung der<br />
von diesen Konstellationen dynamisierten Weltwahrnehmungen als Krise von Sprache<br />
und Identifikation sowie als Verlust bindender Referentialitäten. So unterschiedlich<br />
beide Romane in ihrer thematischen Ausrichtung auf den ersten Blick auch sein<br />
mögen, so deutlich fügen sie sich ein in einen gemeinsamen, den Herausforderungen<br />
globalisierter Lebensumstände verarbeitenden Rahmen. Die Spezifik einer „Literatur des<br />
Globalen“ (Ulfried Reichardt) jenseits postmoderner Repräsentationskritik ist im Fall der<br />
Texte von Mora im Wesentlichen eine Leistung ihrer Erzähltechnik. Darin verbinden und<br />
überlagern sich Erzähl- und Personenstimmen in komplexer Polyphonie und erzeugen<br />
Hochgeschwindigkeitsnetze variabler Perspektiven-, Zeit- und Distanzverhältnisse<br />
zwischen Erzähler- und Figurendiegese, welche die Differenz zwischen Erlebtem und
Sektion 5 v Sección 5<br />
Erzähltem in zuweilen berauschender Prosa nachvollziehen. Diese Differenz jedoch<br />
ist Fundamentalerfahrung der Protagonisten migrantischer wie postmigrantischer<br />
Gesellschaftskontexte, sie ist zweite Natur eines Berufsalltags im digitalen Zeitalter.<br />
Hermann Broch über das ökonomische Gleichgewicht<br />
Prof. Dr. Lützeler, Paul Michael<br />
Washington University in St. Louis, U.S.A.<br />
Hermann Broch wird oft als „letzter Metaphysiker“ eingeschätzt, dessen abstrakte<br />
Werttheorie gerade seinen Roman Die Schlafwandler sperrig und schwer verständlich<br />
mache. Dabei wird oft übersehen, dass die konkreten gesellschaftlichen Kräfte bzw.<br />
Institutionen von Geschäft und Kommerz, von Markt und Börse in der Trilogie zentral<br />
behandelt werden. In den drei Teilromanen sind Besitz und Geld im „Pasenow“, Geld und<br />
‚Erlösung‘ im „Esch“ und Geld um des Geldes willen die dominanten Polaritäten bzw.<br />
Themen. Gezeigt wird, wie Kommerzialisierung die sozialen, religiösen und politischen<br />
Strukturen auβer Kraft setzt und durch ihre Dominanz zerstört.<br />
Dialektik in der Dichtung von Bertolt Brecht<br />
Dr. Mager Hois, Elisabeth Albine<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, México<br />
Die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit erfolgt in der Dichtung von Bertolt<br />
Brecht vor allem in Form der Dialektik, worin seine marxistische Denkweise ihren<br />
Niederschlag findet. Seine widersprüchlichen Gedichte, die aus der jeweiligen Situation<br />
einer konkreten Wirklichkeit entstanden („Gelegenheitsgedichte“) sollten den Leser aus<br />
seiner Lethargie wecken und ihn zur sozialen Handlungsweise aufrufen. So erfolgt eine<br />
dialektische Wechselbeziehung zwischen verschiedenen Vorgängen des Vergangenen<br />
und Gegenwärtigen, dem Allgemeinen und dem Persönlichen. Im Grunde wird keine<br />
Mystifizierung der Vorgänge gesucht, sondern die nackte Wirklichkeit, die in seinem<br />
nüchternen Wortschatz zum Ausdruck kommt.<br />
In der Dichtung von Bertolt Brecht stehen neben den Gedichten auch Gegengedichte,<br />
die zu einer Bewusstseinsverschärfung des Lesers beitragen sollen, sowohl im<br />
Persönlichen als auch im Politischen. Diese Art von Dialektik findet sich aber nicht nur in<br />
der Gegenüberstellung von Gedichten, sondern auch innerhalb der einzelnen Gedichte<br />
selber, im lexikalen („antiidealistische Lexik“) als auch im morphologischen Bereich, wo<br />
Flexionen und Inversionen bis an die Grenzen des Erlaubten gelangen.<br />
Somit unterteilt sich diese Arbeit in einen theoretischen Teil, in dem die Dialektik<br />
im Allgemeinen und die Dialektik Bertolt Brechts im Besonderen behandelt werden,<br />
und in einen konkret historischen und literarischen Bereich, wo die verschiedenen<br />
literarischen Entwicklungen Bertolt Brechts unter dem Gesichtspunkt der Dialektik<br />
analysiert werden. Schließlich wird anhand der Gegenüberstellung von einzelnen<br />
103
104<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
Gedichten auf deren dialektische Verfahrensweise aufmerksam gemacht, ebenso auf<br />
deren Binnenstruktur.<br />
La visión indirecta de la identidad personal en Borges gibt es nicht<br />
de Gerhard Köpf<br />
Dra. Massa, Adriana<br />
Universidad Nacional de Córdoba, Argentinien<br />
En 1991 Gerhard Köpf publica la Novelle Borges gibt es nicht. A través de la tesis<br />
de que el hombre real designado con el nombre de Jorge Luis Borges no ha existido<br />
y sólo es una invención de Adolfo Bioy Casares, se plantea la relación entre la realidad<br />
extratextual y la ficción literaria y el consecuente cuestionamiento de la identidad<br />
personal. De este modo Köpf desarrolla un tema caro a Borges: la tensión entre la<br />
realidad de la vida y la realidad de la literatura. El trabajo se centrará en el estudio de<br />
esa tensión y buscará precisar la concepción de realidad que se encuentra en la obra de<br />
Köpf y de qué manera se la configura, como así también la relevancia que tiene esta<br />
cuestión en los dos autores.<br />
Wirklichkeitsentwürfe in Erzählungen von Clemens Meyer<br />
Dr. Muranyi, Heike<br />
Universidade Federal de Minas Gerais (Lektorat DAAD), Brasilien<br />
In den Texten des Leipziger Autors Clemens Meyer begegnen dem Leser häufig<br />
Figuren, deren Lebensentwürfe gescheitert scheinen und die einen Eindruck von<br />
Verlorenheit und Einsamkeit vermitteln. Doch anstatt lediglich ein Szenario neuer<br />
ostdeutscher Hoffnungslosigkeit zu entwerfen, entwickelt Meyer anhand seiner Figuren<br />
Formen individueller Wirklichkeitserfahrung, in der sich Vergangenheitsreflexion<br />
und Zukunftsprojektion überlagern und dabei immer wieder – wenn auch nicht<br />
ausschließlich – die Existenz des ‚Wendeverlierers‘ problematisieren, stehen doch viele<br />
der Brüche in den erzählten Biographien mit den Ereignissen der jüngeren deutschen<br />
Geschichte in Zusammenhang. Dass dabei auch interkulturelle Perspektiven aufgetan<br />
werden, beweist die Erzählung Warten auf Südamerika, in der faktische und erträumte<br />
Wirklichkeit auf eindringliche Art und Weise verwoben sind.<br />
Anhand einiger ausgewählter Textbeispiele möchte ich die von Meyer angewandten<br />
Strategien zum Entwurf individueller Wirklichkeit(en) kurz darstellen und analysieren.<br />
Die Darstellung der Suche nach Erkenntnis in Jahnns Ein Knabe weint<br />
Dr. Pereira, Veléria Sabrina<br />
Universidade São Paulo, Brasilien<br />
In der Kurzgeschichte Ein Knabe weint (1929) wird das Funktionieren von zwei<br />
verschiedenen „Maschinen“ vorgestellt: einem spielenden Orgelautomaten und
Sektion 5 v Sección 5<br />
einem menschlichen Körper, bzw. einem weinenden Kind. Hans Henny Jahnn, der<br />
Orgelbaumeister von Beruf war, beschreibt das Instrument durch die Perspektive eines<br />
Knaben, der es neugierig beobachtet und zuhört. Anhand weniger fachlicher Daten<br />
produziert der Autor eine sensorielle Deskription des Automaten, und danach die<br />
physischen Reaktionen des Kinderkörpers, wenn das Kindzu weinen beginnt. Obwohl<br />
es sich um eine fiktionale Geschichte handelt, werden nur „verifizierbare“ Fakten<br />
dargestellt, wie der Knabe aussieht und was sein Körper macht; der Autor verzichtet<br />
auf die Schilderung des Gefühles, das das Weinen verursacht. Mit der Beschreibung der<br />
Entdeckungen des Kindes und der Reaktionen seines Körpers – die ihn an die Maschine<br />
annähern – versucht Jahnn eine präzisere Darstellung eines Gefühles zu geben, die<br />
durch die geläufigen Begriffe der literarischen Darstellung nicht erreicht werden kann.<br />
Der Beitrag analysiert die Parallelführung von Körper und Maschine im Text und<br />
stellt Verbindungen her zwischen seiner narrativ-fiktionalen Konstituiertheit und der<br />
expliziten Thematisierung des Erkenntnisproblems.<br />
Zur Frage der Wirklichkeit bei Paul Celan<br />
Prof. Dr. Perez, Juliana<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien<br />
Dass Paul Celans Dichtung auf die historischen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs,<br />
insbesondere die Shoah und die neuen Formen von Antisemitismus in Europa<br />
Bezug nimmt, wird heute nicht nur in der Forschungsliteratur als Voraussetzung<br />
für das Verständnis seiner Gedichte angesehen. Trotzdem herrscht nicht nur in der<br />
Sekundärliteratur die Meinung, Celans Dichtung sei hermetisch und weise folglich<br />
außer dem Bezug zur Shoah keine anderen Hinweise auf eine extratextuelle Wirklichkeit<br />
auf. Hingegen schreibt Celan selbst in einem bekannten Text aus dem Jahr 1958:<br />
“Wirklichkeit ist nicht, Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein”. Im Sinne einer<br />
Beschreibung der Sprache des Dichters gilt es, in diesem Vortrag herauszuarbeiten, wie<br />
Paul Celan die “Wirklichkeit” und ihr Verhältnis zur Dichtung versteht.<br />
“Wirklichkeit” und Mythos der Fremdenlegion in Romanen und Berichten<br />
deutschsprachiger und mexikanischer Autoren<br />
Prof. Dr. Rall, Dieter<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, México<br />
Die französische Fremdenlegion wird seit ihrer Gründung im Jahr 1831 verherrlicht<br />
und verteufelt: In französischen Publikationen über die Legion herrscht – mit<br />
signifikanten Ausnahmen – ein bewundernder Ton vor, der bisweilen an Hagiographie<br />
grenzt, während deutschsprachige Autoren die Legion – je nach Perspektive und<br />
Erfahrung – als Abenteuer, als Strafkolonie oder als „verkaufte Jahre“ darstellen.<br />
Die ‚Wirklichkeit’ der Fremdenlegion wird höchst kontrovers beschrieben, sei es in<br />
105
106<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
Zeugnissen ehemaliger Legionäre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz<br />
(z. B. In der Fremdenlegion von Erwin Rosen (1909, mit 39 Neuauflagen bis 1934)<br />
und Afrikanische Spiele (1936/1987) von Ernst Jünger) oder in den Erzählungen<br />
und Romanen von Friedrich Glauser (Gourrama (1937/1997) und Die Fieberkurve<br />
(1938/1995)). In Mexiko finden wir das Thema der Fremdenlegion im Rahmen der<br />
historischen und literarischen Aufarbeitung der französischen Intervention unter<br />
Kaiser Maximilian in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts (z.B. im Roman Noticias del<br />
Imperio (1987) von Fernando del Paso).<br />
Wie ein historisches Ereignis das Selbstverständnis der Legion geprägt hat, zeige<br />
ich anhand von Nacherzählungen des Scharmützels von Camarón im Staat Veracruz<br />
(1863), wo der „Camerone-Mythos der Legion“ geboren wurde. Camarón fand Eingang<br />
in die Literatur, und der Camerone-Tag wird alljährlich am 30. April feierlich im<br />
Hauptquartier der Fremdenlegion begangen. Darstellungen des Alltags, von Einsätzen<br />
und Gefechten der Legion in Nordafrika entnehme ich u.a. den zitierten Publikationen.<br />
Dabei lassen sich wesentliche stilistische und inhaltliche Unterschiede beobachten,<br />
die einerseits mit den untersuchten Gattungen, andererseits mit der Ideologie, dem<br />
kulturellen Hintergrund der Autoren und mit der Epoche zu tun haben, in der die<br />
Werke entstanden sind.<br />
Arbeit und soziale Fragen bei Robert Walser, Cyro dos Anjos und Graciliano<br />
Ramos<br />
Prof Dr. Redondo, Tercio<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien<br />
Este trabalho procura verificar, na forma da desilusão aventada por Lukács em<br />
Teoria do romance, o lugar ocupado por personagens romanescas de Robert Walser,<br />
em comparação com a prosa de Graciliano Ramos e Cyro dos Anjos, dois escritores<br />
brasileiros. Abordam-se as obras O ajudante, de Walser, Angústia, de Graciliano Ramos,<br />
e O amanuense Belmiro, de dos Anjos. A hipótese aqui levantada é a de que na virada<br />
do século XIX e nas primeiras décadas do século seguinte a literatura alemã e em certa<br />
medida também a literatura brasileira lograram constituir um tipo social que retrata do<br />
modo mais radical a experiência da impossibilidade de conciliação do homem moderno<br />
com alguma forma de ideal ou de socialização ao modo do romance de formação. Ao<br />
menos é o que parece ser observável num ambiente de grande instabilidade econômica,<br />
em que o rebaixamento social configura uma ameaça constante. Consumado o risco<br />
da perda econômica e da decadência social, cumpre avaliar até que ponto as obras de<br />
Robert Walser, Cyro dos Anjos e Graciliano Ramos logram uma estrutura narrativa capaz<br />
de acolher a pobreza como elemento-chave de sua forma e conteúdo.<br />
Dieser Beitrag versucht, sowohl einige Romanfiguren bei Robert Walser als auch<br />
bei Graciliano Ramos und Cyro dos Anjos, zweier brasilianischer Autoren, in der
Sektion 5 v Sección 5<br />
Perspektive der “Desillusionierung” zu untersuchen, wie sie Lukács in seinem Theorie<br />
des Romans formuliert. Dafür werden Walsers Der Gehülfe, Ramos Angústia und<br />
Anjos O Amanuense Belmiro in Anspruch genommen. Hiernach lautet die Hypothese,<br />
dass um die Wende des 19. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des 20.<br />
Jahrhunderts die Literatur im deutschsprachigen Raum und gewissermaßen auch<br />
die brasilianische Literatur Romanfiguren erschafft haben, die am radikalsten die<br />
Unmöglichkeit der Versöhnung zwischen den modernen Menschen und einem Ideal<br />
oder einer vollständigen Vergesellschaftungsform darstellen, die in der Tradition des<br />
Bildungsromans noch zu finden waren. Es wird hier vermutet, dass dieses literarische<br />
Phänomen auf die große Wirtschaftsinstabilität der Epoche zu beziehen ist, und in<br />
Bezug auf den Wirtschaftsverlust und die Deklassierung wird dann untersucht, wie<br />
erfolgreich die Romane der drei Autoren in deren Versuch sind, die Armut als Inhalt wie<br />
auch als Form zu behandeln.<br />
Jenseits des Realen. Hans Erich Nossack und Juan Rulfo<br />
Dr. Reinert, Bastian<br />
The University of Chicago, USA<br />
Der Erzähler aus dem Jenseits, der, um überhaupt sprechen zu können, in gewisser<br />
Weise seinen eigenen Tod überlebt haben muss, stellt eine Irritation herkömmlicher<br />
Rezeptionserwartungen dar, ist seine Erzählposition doch gleichsam eine Verletzung<br />
konventioneller Erzählmuster. Von den antiken Hadesfahrten über die satirischen<br />
Totengespräche seit Lukian (und bis Enzensberger) hin zu den Briefsammlungen von<br />
Toten im 18. Jahrhundert entwickelt sich ein Erzählmuster, das schließlich aus der<br />
Postmoderne nicht mehr wegzudenken ist: der tote Erzähler in Literatur und (seit Billy<br />
Wilders Sunset Blvd., 1950) auch in Film und Fernsehen.<br />
Unter je unterschiedlichen politischen Vorzeichen setzen Hans Erich Nossack mit<br />
Nekyia (1947) [und nur am Rande mit Spätestens im November (1955)] und Juan Rulfo<br />
mit El Llano en llamas (1952, Der Llano in Flammen) und Pedro Páramo (1955) dennoch<br />
auf denselben, erzählerischen Konventionsbruch. Sie legen dabei offen, wie sie nach<br />
ihrem spezifischen Verständnis des magischen Realismus und angesichts der prekären<br />
Ethik einer Nachkriegsgesellschaft mit drängenden sozialen Problemen trotz oder<br />
gerade mit den toten Erzählern ihren je eigenen Wirklichkeitsbezug herstellen.<br />
Die postmortale Erzählinstanz zielt dabei genau ins Zentrum dessen, was die jeweils<br />
beschriebene Wirklichkeit eines literarischen Textes konfiguriert und – trotz seiner<br />
Künstlichkeit und ausgestellten Produziertheit – überhaupt noch als solche erfahrbar<br />
macht. Ganz offensichtlich wird ja in den literarischen Beispielen einer solchen narratio<br />
post mortem eine Wirklichkeit inszeniert, die als Illusion bereits ostentativ durchbrochen<br />
ist, die also gar nicht mehr den Versuch unternimmt, noch unmittelbar anzuschließen<br />
an bis dahin etablierte Vorstellungen des Realen.<br />
107
108<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
Wien-Bilder in der österreichischen Literatur des 21. Jahrhunderts<br />
Schneeberger, Paul Christoph<br />
Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de Enseñanza de Lenguas<br />
Extranjeras, México<br />
2005 manifestierte sich ein schon seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts<br />
andauernder Trend: Unverhältnismäßig viele literarische Neuerscheinungen auf<br />
dem deutschsprachigen Buchmarkt – hauptsächlich Romane – hatten sich Wien als<br />
Handlungsschauplatz (und teilweise mehr als das) auserkoren und das Feuilleton<br />
reagierte merklich darauf. Dadurch wurde auch ich aufmerksam auf dieses Thema und<br />
mein Interesse wurde geweckt, wie meine Heimatstadt literarisch dargestellt wird.<br />
Die Affinität zwischen der Gattung Roman und dem Schauplatz, Thema oder<br />
Sujet Stadt ist ja nichts Neues – zahlreiche Beispiele aus der Literaturgeschichte<br />
könnten hier genannt werden. Das soll aber nicht das Ziel dieses Vortrags sein, denn<br />
nicht der Blick auf die literarische Vergangenheit, sondern die Beschäftigung mit der<br />
literarischen Gegenwart, ihre Bezugnahme auf Wien ist die dominierende Intention.<br />
Die zentrale Frage wird auch nicht sein, welche Entwicklungen sich aus Vergleichen<br />
zwischen dem noch jungen 21. Jahrhundert und dem 20. Jahrhundert ergeben. Nein<br />
– der Focus dieses Vortrags wird auf das Hier und Jetzt und auf die jüngste literarische<br />
Vergangenheit gerichtet. Auf diese Weise soll das Phänomen der zahlreichen im 21.<br />
Jahrhundert erschienenen Wien-Romane untersucht und dargestellt und die Frage<br />
nach der literarischen Wirklichkeit Wiens beantwortet werden.<br />
RAF-Gespenster. Die Triologie Deutscher Herbst von F.C. Delius zwischen<br />
Faktizität und Fiktionalisierung<br />
Prof. Dr. Stephan, Inge<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland<br />
Mit den drei Romanen Ein Held der inneren Sicherheit (1981), Mogadischu Fensterplatz<br />
(1987) und Himmelfahrt eines Staatsfeindes (1992) hat F.C. Delius eine beeindruckende<br />
Chronik der bundesrepublikanischen Gesellschaft in Zeiten ihrer größten Gefährdung<br />
vorgelegt. Sie wurde von der damaligen Kritik als brillante Terrorismus-Studie zwar<br />
durchaus gewürdigt, ist in den gegenwärtigen Debatten über die RAF aber kaum<br />
präsent. Die drei Romane sind nicht nur eine frühe und hellsichtige Auseinandersetzung<br />
mit dem Terrorismus und seinen bis heute verstörenden Folgen, sie sind bedeutsam<br />
auch als Beispiel einer politischen Erzähltradition, in der Fakten und Fiktionen narrativ<br />
so verschränkt sind, dass eine „Wirklichkeit“ entsteht, die den historischen Abläufen<br />
immer verbunden bleibt, zugleich aber fiktionale Räume eröffnet, in denen Geschichte<br />
subjektiv erfahrbar wird.<br />
In meinem Vortrag möchte ich mich auf das erzählerische Verfahren von Delius<br />
konzentrieren, der sich mit den satirischen Texten Wir Unternehmer (1966) und Unsere
Sektion 5 v Sección 5<br />
Siemens-Welt (1972) zunächst einen Namen als Dokumentarschriftsteller gemacht hat.<br />
In den letzten Jahrzehnten hat er sich zu einem sensiblen Erzähler entwickelt, der z.B.<br />
in dem Erinnerungsbuch Bildnis der Mutter als junge Frau (2006) Dokumentarisches und<br />
Autobiographisches, Politisches und Persönliches kunstvoll mischt. Die Verleihung des<br />
Büchner-Preises (2011) ist die längst fällige Würdigung eines über die Jahre kontinuierlich<br />
gewachsenen, imponierenden Gesamtwerkes. Die drei Terrorismus-Romane, die 1997<br />
zur Trilogie Deutscher Herbst zusammengefügt worden sind, stellen in gewisser Weise<br />
ein Verbindungsstück zwischen dem frühen und dem späten Erzähler her. Ich werde<br />
sie nicht nur im Gesamtwerk des Autors, sondern auch in den Erinnerungsdiskursen<br />
verorten, die sich in den letzten Jahren um die RAF und ihr Nachleben gebildet haben,<br />
um die spezifischen Rolle herauszuarbeiten, die Delius als politischer Chronist im<br />
kulturellen Leben der BRD mit seiner RAF-Trilogie einnimmt.<br />
*The real Thing. Elaboraciones literarias de lo real en compilaciones de „casos<br />
criminales célebres“ de la literatura alemana decimonónica<br />
Prof. Dr. Vedda, Miguel<br />
Universität Buenos Aires, Argentinien<br />
El propósito del trabajo es examinar una serie de reflexiones teóricas<br />
contemporáneas, gestadas en Alemania y en Latinoamérica, sobre el subgénero de la<br />
literatura criminal basada en casos reales. Se trata de una forma de la literatura trivial<br />
que ha tenido uno de sus puntos de origen fundamentales en las Causes celébres et<br />
interéssantes (1735ss.) editadas por Gayot de Pitaval, y que alcanzó una intensa y difusión<br />
en los países de lengua alemana. A través de compilaciones tales como Aktenmäßige<br />
Darstellung merkwürdiger Verbrechen (1828-29) de Paul Johann Anselm Feuerbach<br />
(1775-1833), la serie Der neue Pitaval (1842-62), editada por Willibald Alexis (1798-<br />
1871) y Julius Eduard Hitzig (1780-1849), y algunas de las novelas de Jodocus Donatus<br />
Hubertus Temme (1798-1881), el subgénero asumió, en el ámbito germanoparlante,<br />
cualidades específicas, originales, que aún no han sido analizadas de manera exhaustiva.<br />
Importante es, ante todo, estudiar la tensión que en estas obras se produce entre, por<br />
un lado, un afán de reconstrucción realista –y aun “positivista”– de los crímenes, basadas<br />
en actas, protocolos de audiencias, declaraciones de testigos y, ocasionalmente, en<br />
teorías seudocientíficas sobre el crimen, y, por otro, el deseo de captar la atención de los<br />
lectores a través de una acción tensa y sustentada en el aprovechamiento de recursos<br />
propios de la literatura trivial, que con todo divergen sustancialmente de la tradición<br />
anglosajona de la detective novel.<br />
Absicht dieses Vortrags ist es, eine Reihe von Novellen und Erzählungen zu<br />
analysieren, die zur populären Gattung der „Darstellungen echter Kriminalfälle“<br />
gehören. Es handelt sich um eine Variante der Trivialliteratur, die eine ihrer wichtigsten<br />
Prototypen in Gayot de Pitavals Causes celébres et interéssantes (1735 ff.) hat, und<br />
109
110<br />
Sektion 5 v Sección 5<br />
die im deutschsprachigen Raum große Verbreitung fand. Mit Sammlungen wie etwa<br />
Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen (1828-29) von Paul Johann Anselm<br />
Feuerbach, Der neue Pitaval. Eine Sammlung der interessantesten Criminalgeschichten<br />
aller Länder und Völker (1842 ff.; Hgg. Willibald Alexis und Julius Eduard Hitzig)<br />
sowie mit einigen Romanen von Jodocus Donatus Hubertus Temme, erlangte die<br />
Gattung in Deutschland charakteristische Eigenschaften, die noch nicht ausreichend<br />
analysiert worden sind. Wichtig ist hierbei vor allem die Untersuchung des in diesen<br />
Werken bestehenden Verhältnisses zwischen, einerseits, einem Streben nach<br />
„realistischer“ oder sogar „positivistischer“ Wiedergabe der Kriminalfälle (auf Akten,<br />
Verhandlungsprotokollen, kommentierenden Armerkungen und – gelegentlich –<br />
pseudowissenschaftlichen Theorien beruhend), und andererseits dem Wunsch, eine<br />
spannende Handlung zu konstruieren, die – anhand verschiedener Ressourcen aus der<br />
traditionellen Trivialliteratur – die Aufmerksamkeit der Leser erregen sollte.
Sektion 6<br />
Didaktisch-methodische Transformationen im lateinamerikanischen DaF-Unterricht<br />
in der Erwachsenenbildung: Forschung und Unterrichtspraxis auf dem Prüfstand<br />
Sektionsleitung:<br />
Dr. Hermann Funk<br />
Universität Jena, Deutschland<br />
Katharina Herzig<br />
Universidad de Guadalajara, México<br />
Dr. Sabine Pfleger<br />
Universidad Nacional Autónoma de México<br />
Dr. Carmen Schier<br />
Universität Leipzig, Deutschland<br />
Konzept der Sektion<br />
Die Gestaltung von DaF-Unterricht in der Erwachsenenbildung steht im<br />
lateinamerikanischen Kontext vor vielfältigen Herausforderungen. Zum einen stellt<br />
sich die Frage, inwieweit die auf den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen<br />
(GeR) abgestimmten Lehrwerke und internationalen Prüfungsformate die<br />
Curriculumentwicklung in den unterschiedlichen Lernkontexten in Bereichen der<br />
Erwachsenenbildung beeinflusst haben und wie eine Balance zwischen Standardisierung<br />
und zielgruppenspezifischer Unterrichtsgestaltung in den vielfältigen DaF-Lernkontexten<br />
in Lateinamerika erreicht werden kann.<br />
Eine weitere Herausforderung stellt die Umsetzung aktueller didaktischer<br />
Ansätze in lateinamerikanischen DaF-Lernkontexten dar, z.B. die Schaffung<br />
einer binnendifferenzierten Lernumgebung durch veränderte Sozial- und<br />
Vermittlungsformen oder die Einbeziehung neuer Medien in den DaF-Unterricht<br />
(eventuell sogar im Rahmen eines Blended-Learning-Modells). In diesem<br />
Zusammenhang geht es auch um die veränderte Rolle des Lehrers und um die Frage<br />
der Förderung von Lernerautonomie.<br />
Nicht nur die Unterrichtspraxis, auch die didaktische Forschung soll in dieser<br />
Sektion im Mittelpunkt stehen. Inwieweit konnte sich Fremdsprachendidaktik unter<br />
Berücksichtigung eigener Lehr- und Lerntraditionen bisher als eigenständiges<br />
Forschungsgebiet in Lateinamerika etablieren? In welchen Bereichen lassen sich<br />
didaktische Forschungsdesiderata im lateinamerikanischen Kontext identifizieren?<br />
Es sind vor allem Beiträge in einer der folgenden Kategorien willkommen:<br />
Vorstellung innovativer Praxisbeispiele (“best-practice”-Beispiele) aus spezifischen<br />
DaF-Lernkontexten im Bereich der Erwachsenenbildung in Lateinamerika.<br />
111
112<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
Vorstellung von Curricula, Unterrichtsmaterialien und Aufgabenformaten, die für<br />
spezifische DaF-Lernkontexte im Bereich der Erwachsenenbildung in Lateinamerika<br />
entwickelt wurden.<br />
(Empirische) Forschungsvorhaben aus dem didaktisch-methodischen Bereich.<br />
Theoretische Reflexionen, die Perspektiven der didaktischen Forschung in<br />
Lateinamerika aufzeigen.
Sektion 6 v Sección 6<br />
Montag, 05.03.2012<br />
Uhrzeit Ort<br />
8:30-10:00 Einschreibung Paraninfo<br />
10:00-11:30 Eröffnungsveranstaltung:<br />
Juárez 975<br />
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Generalrektor (Ecke Enrique Díaz de<br />
der Universität Guadalajara / Rector general de la<br />
Universidad de Guadalajara. Mtro. Pablo Arredondo<br />
Ramírez, Rektor des Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrums CUCSH / Rector del Centro Universitario<br />
de Ciencias Sociales y Humanidades. Dr. Lilia Oliver<br />
Sánchez, Leiterin der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät / Directora de la División de Estudios<br />
Históricos y Humanos. Dr. Edmund Duckwitz,<br />
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland /<br />
Embajador de la República Federal de Alemania.<br />
Dr. Alfred Längle, Botschafter der Republik<br />
Österreich / Embajador de Austria. Dr.<br />
Gisela Schneider, Deutscher Akademischer<br />
Austauschdienst / Servicio Alemán de<br />
Intercambio Académico (DAAD). Dr. Olivia C.<br />
Díaz Pérez, Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes / Presidenta de la Asociación<br />
Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
León)<br />
11:30-12.00 Empfang des Generalrektors der Universität<br />
Guadalajara<br />
12:00-12:45 Plenarvortrag Paulo Astor Soethe:<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer<br />
international vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
12:45-13:30 Plenarvortrag Ottmar Ette: Die Literaturen der Welt<br />
aus transarealer Perspektive<br />
13:45-14:30 Abfahrt zum Tagungsort (CUCSH)<br />
14:30-16:00 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Vor dem<br />
Auditorium Salvador<br />
Allende<br />
16:00-16:30 Einführung Raum 66 H**<br />
16:30-17.00 Nils Bernstein Phraseodidaktische Vorschläge anhand<br />
der Liedtexte Rainald Grebes<br />
Raum 66 H<br />
113
17:00-17:30 Mario López Barrios Lexik und Interkomprehension<br />
in drei germanischen Sprachen (Deutsch, Englisch,<br />
Niederländisch). Ergebnisse und didaktische<br />
Implikationen einer lexikometrischen Analyse.<br />
17:30-18:00 Pause<br />
18:00-19:30 Kulturveranstaltung (Goethe-Institut): Kabaret und<br />
Musik mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll<br />
19:30 Empfang der Deutschen Botschaft<br />
Eröffnung Karikaturenausstellung Goethe-Institut<br />
114<br />
Dienstag, 06.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Hermann Funk:<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?. Modelle zum<br />
Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz und ihre<br />
praktischen Konsequenzen<br />
Semiplenarvortrag Friedhelm Schmidt-Welle:<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und<br />
Alzheimer<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Katja Schmiedgen „Wir müssen äh wir können…“ –<br />
Das mündliche selbstinitiierte Selbstreparaturverhalten<br />
von Lernenden des Deutschen als Fremdsprache<br />
10:45-11:15 Sabrina Sadowski Zielgruppenspezifischer DaF-<br />
Unterricht mit besonderer Berücksichtung der Fertigkeit<br />
Schreiben für Studierende am geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrum der Universidad de Guadalajara in Mexiko- ein<br />
praktisches Beispiel.<br />
11:15-11:45 Simone Auf der Maur Tomé Erwerb von<br />
Textkompetenz im universitären Kontext: Angebote<br />
und Unzulänglichkeiten gängiger DaF-Lehrwerke der<br />
Mittelstufe<br />
11:45-12:15 Pause<br />
Raum 66 H<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
Auditorium Salvador<br />
Allende<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende und<br />
Bibliothek Manuel<br />
Rodríguez Lapuente<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium Carlos<br />
Ramírez Ladewig<br />
Raum 66 H<br />
Raum 66 H<br />
Raum 66 H
Sektion 6 v Sección 6<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Erwin Tschirner:<br />
Auditorium<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Silvano Barba<br />
Semiplenarvortrag Claudia Dornbusch:<br />
Auditorium Carlos<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche<br />
Wissenschaft?<br />
Ramírez Ladewig<br />
13:00-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
14:30-15:00 Arlety Góngora Ruiz *El trabajo con textos paralelos en<br />
la clase de alemán con fines específicos*<br />
Raum 66 H<br />
15:00-15:30 Katharina Herzig Der Gemeinsame europäische<br />
Referenzrahmen in Mexiko: Bestandsaufnahme,<br />
Herausforderungen und Möglichkeiten<br />
Raum 66 H<br />
15:30-16:00 Christina Kuhn Berufsorientierter<br />
Fremdsprachenunterricht – Lernziele und<br />
Übungskonzepte zwischen Arbeitswelt und GER<br />
Raum 66 H<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Patrycja Lorenz Neue Ansätze in der Gestaltung von<br />
Curricula und Unterrichtsmaterialien für die Niveaustufe<br />
A1. Am Beispiel des DaF-Unterrichts am Spracheninstitut<br />
der Universidad del Norte, Barranquilla, Kolumbien.<br />
Raum 66 H<br />
17:00-17:30 Kristina Peuschel Neue Wege der<br />
Curriculumentwicklung – Szenarien im Sprachunterricht<br />
für Studierende der Germanistik der Universidade de São<br />
Paulo im 3. Studienjahr<br />
Raum 66 H<br />
17:30-18:00 Norma Wucherpfennig Vom Redemittel zum Text -<br />
Fachübergreifende akademische Sprache im Unterricht<br />
mit Hörern aller Fakultäten<br />
Raum 66 H<br />
18:15-19:45 Kulturveranstaltung (Foro Cultural de Austria,<br />
Auditorium<br />
BMUKK):<br />
Lesung von Tarek Eltayeb<br />
Salvador Allende<br />
Donnerstag, 08.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Christian Fandrych: Zum Stil<br />
deutscher wissenschaftlicher Vorträge (auch) aus<br />
kontrastiver Sicht.<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
115
116<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Karen Pupp Spinassé:<br />
Auditorium Carlos<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht<br />
in einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
Ramírez Ladewig<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Israel Garciadiego Ramos *Interculturalidad y lenguas<br />
extranjeras en México / Interkulturalität und Fremdsprachen<br />
in Mexiko*<br />
Raum 66 H<br />
10:45-11:15 Alberto Morales Domínguez Erkundungen der<br />
Deutschlandbilder und der komplementären nationalen<br />
Selbstbilder von kubanischen Reiseleitern.<br />
Raum 66 H<br />
11:15-11:45 Sabine Pfleger Die Rolle des Lehrers im interkulturellen<br />
Klassenraum Lateinamerikas<br />
Raum 66 H<br />
11:45-12:00 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
12:00-12:30 Nuria Alcalde Mato *Un método didáctico alternativo<br />
para el aprendizaje léxico en alemán como lengua<br />
extranjera / Eine alternative didaktische Methode zum<br />
Wortschatzerwerb bei Deutsch als Fremdsprache*<br />
Raum 66 H<br />
12:30-13:00 Anja MacKeldey El Arte de aprender a nadar entre dos<br />
aguas – Die Kunst zu lernen, wie man zwischen zwei<br />
Stühlen sitzt<br />
Raum 66 H<br />
13:00-13:30 Diana Hirschfeld Funktioniert die formative Evaluation<br />
wirklich? Metaevaluation eines Portfolioprojekts.<br />
Raum 66 H<br />
13:30-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
14:30-15:00 Rogéria Costa Pereira Die Integration elektronischer<br />
Medien im DaF-Unterricht am Beispiel von Moodle und<br />
einem Weblog<br />
Raum 66 H<br />
15:00-15:30 Chiara Donà Blended Learning oder die Mischung<br />
macht’s. Die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten für<br />
ein erfolgreiches Lehr-Lernkonzept.<br />
Raum 66 H<br />
15:30-16:00 Diana Feick Autonomie der Gruppe. Eine interaktionsanalytische<br />
Untersuchung von Entscheidungsprozessen<br />
im DaF-Handyvideoprojekt<br />
Raum 66 H<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Abschlussplenaum Raum 66 H
Sektion 6 v Sección 6<br />
17:00-17:30<br />
17:30-18:00<br />
18:00-19:00 Abfahrt zum Paraninfo<br />
19:00 Kulturveranstaltung der Universität Guadalajara:<br />
Lehrstuhl „Cortázar“ (Cátedra Cortázar): Plenarvortrag<br />
Juan Villoro: *Te doy mi palabra. Un itinerario en la<br />
traducción.<br />
Freitag, 09.03.2012<br />
9:00-11:00 9:00-9:25 Reinhard Andress “... heiße ich<br />
daher die Emigration gut”: der Fall<br />
des Egon Schwarz<br />
9:25- 09:50 Egon Schwarz:<br />
Lesung auf Deutsch***<br />
10:00 – 11:00 Elisabeth Siefer: Einführung in die<br />
Übersetzung<br />
Egon Schwarz: Lesung auf<br />
Spanisch - Diskussion<br />
9:00-10:00<br />
Documental de Juliana Fischbein:<br />
des aparecer Exil und Erinnerung im Rahmen des<br />
Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er Jahre<br />
in Südamerika***<br />
Workshop Karen Schramm: Mündliches Erzählen im<br />
Fremdsprachenunterricht<br />
Workshop Dieter Jaeschke: Freundschaft, Ostalgie<br />
und weite Welt: Der Spielfilm „Friendship!“ (D 2010) im<br />
DaF-Unterricht<br />
Workshop Carmen Schier: Zur Arbeit mit Hörbüchern.<br />
Ein „Grenzgänger“ wird (neu) entdeckt<br />
Verlagspräsentation Martina Bartucz, Cornelsen<br />
Verlag: Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Verlagspräsentation Anne Robert, Hueber Verlage:<br />
Menschen<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: DaF<br />
kompakt – das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: „Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur<br />
Sprache<br />
Paraninfo<br />
Juárez 975<br />
(Ecke Enrique Díaz<br />
de León)<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
61 H<br />
62 H<br />
63 H<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H<br />
64 H<br />
117
118<br />
11:00-11:30 Pause<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
11:30-12:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven der Germanistik in Auditorium Silvano<br />
Lateinamerika<br />
Barba<br />
Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: Beste<br />
Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
64 H<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven<br />
Tafelbildern am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz<br />
Neu“ und „Logisch!“<br />
65 H<br />
Verlagspräsentation Christina Kuhn, Cornelsen<br />
Verlag: Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was<br />
ändert sich, was bleibt?<br />
66 H<br />
12:30-13:30 Abschlussplenum <strong>ALEG</strong> Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
13:30-15:00 Mittagessen Hof der Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
15:00-17:00 <strong>ALEG</strong>-Mitgliederversammlung Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
17:15-19:15 AMPAL- Mitgliederversammlung Auditorium Silvano<br />
Barba<br />
20:00 Abendessen & Abschlussfeier El Callejón de<br />
los Rumberos.<br />
Chapultepec Ecke<br />
Lerdo de Tejada<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
** Die Tagungsräume befinden sich im 3. Stock des Gebäude H vom CUCSH.<br />
*** Teil der Sektion 2 und des Kulturprogramms; nähere Informationen im Kulturprogramm<br />
Beiträge in alphabetischer Reihenfolge<br />
*Un método didáctico alternativo para el aprendizaje léxico en alemán<br />
como lengua extranjera / Eine alternative didaktische Methode zum<br />
Wortschatzerwerb bei Deutsch als Fremdsprache<br />
Alcalde Mato, Nuria<br />
Universität des Saarlandes, Deutschland<br />
En 1953, gracias a unos lingüistas franceses que investigaban el léxico de su lengua,<br />
aparece por primera vez la noción de léxico disponible, que corresponde al conjunto de palabras<br />
que los hablantes tienen en el lexicón mental y cuyo uso está condicionado por el
Sektion 6 v Sección 6<br />
tema concreto de la comunicación. A partir de ese momento se hace distinción entre conceptos<br />
como léxico básico, fundamental y frecuente, por un lado, y disponible, por otro. En<br />
la década de los 70, comienza a investigarse este léxico disponible del español recopilando<br />
estudios exhaustivos de gran parte del mundo hispanohablante. Sus objetivos primordiales<br />
se centran en descubrir qué palabras usan los hablantes de una comunidad ante<br />
determinados estímulos verbales, ofreciendo una nueva alternativa a los referentes de<br />
léxico básico y fundamental del español utilizados hasta la fecha, y una significativa relevancia<br />
en el ámbito aplicado de la enseñanza del léxico de la lengua materna y extranjera.<br />
En esta comunicación presentamos las características y ventajas de esta metodología<br />
de análisis para el estudio del léxico de una lengua, mencionamos diversas posibilidades<br />
de selección de vocabulario utilizadas hasta la actualidad respecto al alemán como<br />
lengua extranjera y, dado que hasta la actualidad -a pesar de haberse escrito mucho en<br />
Alemania sobre conceptos como Grundwortschatz, passiver/rezeptiver, aktiver/produktiver<br />
y potentieller Wortschatz o incluso sobre la frecuencia en el vocabulario- no se han tenido<br />
en cuenta estudios de disponibilidad léxica como orientación metodológica, proponemos<br />
que se considere también para esta lengua con objeto de mejorar su enseñanza.<br />
Im Zuge von Forschungsarbeiten französischer Sprachwissenschaftler zum<br />
Wortschatz der französischen Sprache, taucht im Jahr 1953 zum ersten Mal der Begriff<br />
verfügbarer Wortschatz auf. Dabei handelt es sich um die Gesamtheit der Wörter, die<br />
das mentale (geistige) Wörterbuch der Sprecher einer Sprache beinhaltet und deren<br />
Verwendung, die durch die Kommunikation gesteuert wird.<br />
In der Folge wird zwischen Grund-, Haupt- und dem häufig verwendeten Wortschatz<br />
einerseits sowie dem verfügbaren Wortschatz andererseits unterschieden. In den<br />
siebziger Jahren wurden mit Hilfe einer Zusammenführung weitreichender Studien<br />
aus einem Großteil der spanischsprachigen Länder die ersten Forschungen zum<br />
verfügbaren Wortschatz des Spanischen durchgeführt.<br />
Der grundlegende Forschungsgegenstand dabei war es in Erfahrung zu bringen,<br />
welche Wörter von den Sprechern einer Sprachgemeinschaft bei bestimmten verbalen<br />
Reizen benutzt werden, indem man Alternativen für die bisherige Verwendung des<br />
spanischen Grund- und Hauptwortschatzes aufgezeigt und auf die zentrale Bedeutung<br />
für die angewandte Lehre des muttersprachlichen und fremdsprachlichen Wortschatzes<br />
hingewiesen hat.<br />
In diesem Vortrag möchten wir die grundlegenden Eigenschaften und Vorteile<br />
dieser (Analyse) Methode zur Untersuchung des Wortschatzes einer Sprache vorstellen,<br />
unterschiedliche bisher genutzte Auswahlmöglichkeiten des Wortschatzes für Deutsch<br />
als Fremdsprache zur Sprache bringen und aufgrund der Tatsache, dass bis zum heutigen<br />
Tag Untersuchungen zur Verfügbarkeit des Wortschatzes als methodische Orientierung<br />
keine Berücksichtigung fanden, obwohl es in Deutschland zahlreiche Publikationen zu<br />
Themen wie Grundwortschatz, passiver/rezeptiver, aktiver/produktiver sowie potentieller<br />
119
120<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
Wortschatz oder sogar zur Häufigkeit im Wortschatz gab, den Vorschlag unterbreiten,<br />
auch bei dieser Sprache die Verfügbarkeit des Wortschatzes zur Optimierung ihrer<br />
Lehre zu berücksichtigen.<br />
Erwerb von Textkompetenz im universitären Kontext:<br />
Angebote und Unzulänglichkeiten gängiger<br />
DaF-Lehrwerke der Mittelstufe<br />
Auf der Maur Tomé, Simone<br />
Universidade do Porto, Portugal<br />
Im vorliegenden Beitrag sollen einige vorläufige Ergebnisse meines<br />
Forschungsprojekts aufgezeigt werden, welches sich zum Ziel setzt, Parameter für<br />
die Förderung der Textkompetenz universitärer DaF-Lernender aufzustellen. Ich<br />
gehe dabei von der neueren didaktischen Annahme aus, dass die Rezeption und<br />
die Produktion von Texten bzw. von gewissen Textsorten einander bedingen. Der<br />
entscheidende Impuls für dieses Vorhaben stammt aus meiner Tätigkeit als Dozentin<br />
an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Porto (FLUP), wo ich im<br />
Masterstudiengang für angehende DaF-Lehrer im Bereich der Didaktik tätig bin.<br />
Dabei stelle ich fest, dass die Studierenden nicht nur erhebliche Schwierigkeiten mit<br />
der Rezeption von deutschen Fachtexten haben, also damit, den Texten wichtige<br />
Informationen zu entnehmen, sondern auch damit, diese mit eigenen Worten<br />
wiederzugeben und kritisch über das Gelesene in der Fremdsprache mündlich und<br />
schriftlich zu reflektieren. Ursachen dafür können mit Lerntraditionen, aber auch mit<br />
im Unterricht verwendeten Materialien, methodischen Vorgehensweisen und Übungs-<br />
und Aufgabenformen in Zusammenhang gebracht werden.<br />
Mein Projekt umfasst folgende Schritte: Befragung von sämtlichen DaF-<br />
Studierenden der FLUP auf dem Niveau B2 (Bachelor) zu der Einschätzung ihrer<br />
Textsortenkenntnisse, zu ihren Lernbedürfnissen und zum Nutzen der Arbeit mit den<br />
Lehrwerken, die im sprachpraktischen Unterricht kurstragend verwendet werden;<br />
Erstellung eines allgemeinen Kriterienkatalogs mit Merkmalen der zu erwerbenden<br />
Textkompetenz von DaF-Lernenden im universitären Kontext; Untersuchung einzelner<br />
Lehrwerke (B2) in Hinblick auf behandelte Textsorten, Übungen und Aufgaben zur<br />
Rezeption und Produktion von Texten mit dem Ziel festzustellen, inwiefern dieses<br />
Lernangebot diese Kriterien einzulösen vermögen.<br />
Phraseodidaktische Vorschläge anhand der Liedtexte Rainald Grebes<br />
Dr. Bernstein, Nils<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
Lernende beschäftigen sich bereits im Anfängerunterricht mit Routineformeln<br />
als Unterkategorie der Phraseologie, beispielsweise zum Verfassen von Briefen (Sehr
Sektion 6 v Sección 6<br />
geehrte Damen und Herren etc.). Auch in fortgeschrittenen Kursen oder in der DSH-<br />
Prüfung sind Phraseologismen wegen ihrer übertragenen Bedeutung ein relevantes<br />
und lohnenswertes Thema.<br />
Für den deutschen Sänger und Kabarettisten Rainald Grebe sind Phraseologismen<br />
ein produktiver Steinbruch im Erarbeiten von Liedtexten. Mit Adornos Aperçu „Es gibt<br />
kein richtiges Leben im falschen“, das den Refrain des gleichnamigen Liedes bildet,<br />
lässt sich Grebes allgemeine Kritik sowohl an bürgerlichen als auch an alternativen<br />
Standpunkten zusammenfassen. Neben geflügelten Worten, deren Urheber sich noch<br />
ausmachen lassen, verwendet Grebe feste Formeln aller Art, um seine Umwertung aller<br />
Werte zu propagieren. Einerseits illustriert das Neukontextualisieren, Remotivieren<br />
und Weiterführen den Reiz von Phraseologismenklassen wie Sponti-Sprüchen und<br />
Slogans, andererseits scheint ein zentraler Appell Grebes auch im Hinterfragen des<br />
unreflektierten Gebrauchs solcher Phrasen zu liegen.<br />
Im Vortrag sollen zunächst einige Beispiele zur Vermittlung von Phraseologismen im<br />
Fremdspracheunterricht sowie der grundlegende und immer noch aktuelle, auf Lüger<br />
zurückgehende Vierschritt (Erkennen, Entschlüsseln, Festigen, Verwenden) reflektiert<br />
werden. Dabei wird sich zeigen, dass es sowohl im Bereich der phraseodidaktischen<br />
Forschung als auch in den diesbezüglichen unterrichtspraktischen Vorschlägen<br />
interessante Forschungslücken gibt. Anschließend werden anhand ausgewählter<br />
Textbeispiele Grebes Didaktisierungsmöglichkeiten von Phraseologismen vorgestellt,<br />
die ausführlich zu diskutieren sind. Die kontextsensitive Analyse mit Fokus auf die<br />
Phraseologismen in Liedtexten dient der Auseinandersetzung mit Sprachdidaktik und<br />
Landeskunde im Konnex DaF und Musik.<br />
Die Integration elektronischer Medien im DaF-Unterricht<br />
am Beispiel von Moodle und einem Weblog<br />
Costa Pereira, Rogéria<br />
Universidade Federal do Ceará, Brasilien<br />
Die Integration neuer Medien im Fremdsprachenunterricht ist fast eine<br />
Selbstverständlichkeit geworden. DaF-Verlage bieten schon seit Jahren auf ihren<br />
Internetseiten ein ergänzendes Angebot zu ihren Lehrwerken an, die von Lesetexten bis<br />
zu Grammatikübungen gehen. Einige Verlage stellen mittlerweile Moodle-Kursinhalte zur<br />
Verfügung, die als „Ergänzung des gewohnten Präsensunterrichts“ und als „Unterstützung<br />
der Lernerautonomie“ fungieren sollen. Es stellt sich in diesem Kontext aber die Frage, in<br />
wieweit elektronische Medien im Unterricht eingesetzt werden können/sollen, und wie<br />
ihre Einsetzung den Unterricht zielgruppenspezifischer gestalten kann.<br />
Der Kurzvortrag gibt einen Überblick über die Erfahrung mit der Einsetzung<br />
elektronischer Medien, und zwar der Lernplattform Moodle und eines Weblogs, in<br />
zwei verschiedenen Kursen auf dem Niveau A1/1 für Studenten aller Fachrichtungen.<br />
121
122<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
Dabei wird auch diskutiert, wie die Einsetzung dieser Medien zur Förderung der<br />
Lernerautonomie und der Zielgruppenspezifizierung beigetragen hat.<br />
Blended Learning oder die Mischung macht’s.<br />
Die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten für ein erfolgreiches<br />
Lehr-Lernkonzept.<br />
Donà, Chiara<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Acatlán, Mexiko<br />
Das BL hat sich in den letzten Jahren als die realisierbare Form des Lernens mit<br />
elektronischen Medien herausgestellt. Nachdem das reine E-Learning vor allem<br />
wegen des Fehlens von Präsenzphasen nicht so erfolgreich war, wie in der ersten<br />
Begeisterung angenommen, finden heutzutage Blended-Learning-Ansätze immer<br />
mehr Akzeptanz. Dazu haben insbesondere die Veränderungen, die durch das Web<br />
2.0 in der Kommunikation hervorgerufen wurden, beigetragen, denn die Nutztung<br />
von elektronischen Medien und Technologien stellen keine Hürde mehr und sind aus<br />
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.<br />
Auch im Deutschunterricht kann man von den Vorteilen des Web 2.0 profitieren und<br />
Blogs, Wikis, Soziale Netzwerke und Lernplattformen gut in den Unterricht einbinden.<br />
Obwohl in vielen Institutionen manchmal die technische Ausstattung fehlt, ist die<br />
Implementierung von Blended Learning-Szenarien nicht unmöglich. Es fehlt jedoch<br />
an Aus- und Weiterbildung der Lehrer, die sich häufig über die Nutzung einer Blended<br />
Learning-Umgebung noch nicht bewusst sind.<br />
Ziel des Vortrags ist die Darstellung der Möglichkeiten der Nutzung von Blogs, Wikis<br />
und Lernplattformen im Deutschunterricht.<br />
Autonomie der Gruppe. Eine interaktionsanalytische<br />
Untersuchung von Entscheidungsprozessen im<br />
DaF-Handyvideoprojekt<br />
Feick, Diana<br />
Universität Leipzig, Deutschland<br />
Die Sloganisierung des Begriffs der Lernerautonomie wurde von Barbara<br />
Schmenk 2008 eindrücklich nachgewiesen und infolge dessen zur Bewusstmachung<br />
der gegenseitigen Bedingtheit von Selbst- und Fremdbestimmung im<br />
Fremdsprachenunterricht für ein soziales Autonomieverständnis plädiert. Somit<br />
erfahren Kontextgebundenheit und die soziale Dimension fremdsprachlichen<br />
Lehrens und Lernens die Beachtung, die individualistische Sichtweisen auf<br />
Lernerautonomie bisher nur unzureichend berücksichtigten. Zur Entsloganisierung<br />
des Modeworts kann als eine mögliche Strategie die empirische Untersuchung<br />
sozialer Lernprozesse innerhalb bestimmter, meist institutioneller und damit wenig
Sektion 6 v Sección 6<br />
autonomieförderlicher Lernumgebungen beitragen. In diesem Vortrag soll das soziale<br />
Verständnis von Autonomie und dessen Angemessenheit für den institutionellen<br />
Fremdsprachenerwerb diskutiert werden. Die für die explorativ-interpretative Studie<br />
erhobenen Daten stammen aus einem Handyvideoprojekt im mexikanischen Deutschals-Fremdsprache-Unterricht,<br />
in dessen Kontext untersucht werden soll, wie sich die<br />
videographisch festgehaltene polyadische Interaktion zur Entscheidungsfindung<br />
innerhalb von drei Fokusgruppen in bestimmten Projektphasen gestaltet. Zusätzlich<br />
wurde die Wahrnehmung dieser Aushandlungen durch einzelne Gruppenmitglieder<br />
mittels videostimulated recall erfasst, um sie den Interaktionsdaten validierend<br />
gegenüberzustellen. Welche Potenziale von Gruppenautonomie polyadische<br />
Interaktionen zur Entscheidungsfindung in sich tragen können, soll anhand eines<br />
Ausblicks auf erste Analysergebnisse der Studie diskutiert werden.<br />
*Interculturalidad y lenguas extranjeras en México /<br />
Interkulturalität und Fremdsprachen in Mexiko<br />
Garciadiego Ramos, Israel Rubén.<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
La interculturalidad es una característica deseable en alguien que aprende una lengua<br />
ajena a la propia y que por lo tanto se debe fomentar en la clase. Sin embargo, las<br />
reflexiones acerca de lo que se pretende lograr con el estudiante y sobre todo el cómo<br />
están todavía en un nivel incipiente incluso en Europa. La formación de profesores, el<br />
desarrollo de currícula y la creación de políticas institucionales que integren y fomenten<br />
la interculturalidad avanzan lentamente, mucho más que las necesidades surgidas de los<br />
movimientos migratorios que caracterizan hoy por hoy al mundo moderno. Tomando en<br />
cuenta la situación anterior y que la enseñanza y certificación de lenguas extranjeras en<br />
México se orientan cada vez más hacia el Marco Común Europeo de Referencia para las<br />
Lenguas, cabe preguntarse a qué condiciones se enfrenta la adopción del modelo educativo<br />
intercultural en México, tomando en cuenta que nuestro contexto tiene condiciones<br />
y objetivos distintos a los europeos. Ante este panorama surgen diversas preguntas como:<br />
¿Cuál es la política lingüística mexicana respecto de la enseñanza de lenguas extranjeras?,<br />
¿Cuál es el actual estado de cosas respecto a la interculturalidad en México?, ¿Hasta qué<br />
grado y en qué instituciones de la enseñanza de lenguas ha permeado el aspecto intercultural?<br />
y ¿Cuál es el concepto de interculturalidad en que se basan los esfuerzos hecho<br />
hasta ahora? Esta ponencia trata de dar respuesta a estas cuestiones.<br />
Interkulturalität ist eine wünschenswerte Eigenschaft von einem Lerner/ einer<br />
Lernerin einer Fremdsprache und aus diesem Grund muss man sie im Unterricht<br />
unterstützen. Die Auseinandersetzungen mit der Frage was man mit dem Lerner im Bezug<br />
auf die Interkulturalität machen will und besonders wie, sind jedoch noch auf einem<br />
beginnenden Niveau selbst in Europa. Die Lehrerausbildung, die Curriculumsforschung<br />
123
124<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
und die Entwicklung einer Sprachpolitik, die das Interkulturelle berücksichtigen und<br />
fördern, entwickeln sich sehr langsam, langsamer als die Bedürfnisse, die aus den<br />
Migrationsprozessen, die heutzutage die moderne Welt kennzeichnen, entstehen.<br />
Wenn man diese Situation und die Lage der Fremdsprachen in Mexiko, wo Unterricht<br />
und Prüfung immer mehr an den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für<br />
Sprachen orientiert sind, beachtet, kann man nach der Rolle der interkulturellen Ansatz<br />
in Mexiko fragen, in einem Land, das sehr unterschiedliche Bedingungen und Ziele<br />
als die europäischen hat. Unter diesen Umständen enstehen Fragen wie Folgende:<br />
Welche Sprachpolitik hat Mexiko im Bezug auf Fremdsrachen? Wie ist die aktuelle Lage<br />
der Interkulturalität in Mexiko? Inwiefern und in welchen Sprachinstitutionen spielt<br />
der interkulturellen Ansatz im Fremdsprachenunterricht eine Rolle? Und was ist der<br />
interkulturelle Begriff, auf dem die didaktischen interkulturellen Vorschläge begründet<br />
sind? Dieser Beitrag versucht diese Fragen zu beantworten.<br />
*El trabajo con textos paralelos en la clase de alemán con fines específicos<br />
Dr. Góngora Ruiz, Arlety<br />
Universität Havanna, Kuba<br />
En Cuba se forman desde hace apenas 10 años especialistas en turismo para<br />
que dirijan diversas instituciones turísticas del país y realicen gestión turística de alto<br />
nivel. Ellos precisan de buenos conocimientos y habilidades en la lengua extranjera,<br />
en correspondencia con su especialidad que les permitan una actuación profesional<br />
adecuada.<br />
Los profesores de alemán en esta carrera hemos constatado que el programa<br />
de la asignatura aborda un alemán de generalidad que no se corresponde con la<br />
comunicación especializada y que faltan materiales de enseñanza relevantes que<br />
posibiliten el desarrollo de una competencia lingüística especializada en los estudiantes.<br />
Los libros existentes para el turismo - concebidos para aprendices de futuras labores<br />
de servicio en el turismo- se presentan como inadecuados para este nuevo nivel,<br />
encaminado a la formación de directivos del turismo. Por eso, se están desarrollando<br />
materiales que se avengan a las exigencias y al perfil de los futuros especialistas.<br />
A mediados de 2011 con el apoyo del DAAD la ponente trabajó en el desarrollo de<br />
un material para el desarrollo de una competencia lingüístico-textual especializada en<br />
las clases de alemán con fines específicos en el turismo. Precisamente este material para<br />
clases constituye el centro de la ponencia que deseo presentar en el congreso y que<br />
aborda, además, la concepción en la que éste se basa, los factores tenidos en cuenta,<br />
el papel de elementos específicos de los estudiantes y del país como escenario en su<br />
concepción, las adaptaciones necesarias in situ al aplicarse en clases, etc.<br />
In Kuba werden seit fast 10 Jahren Tourismusspezialisten ausgebildet, die als<br />
Führungskräfte in den verschiedenen touristischen Einrichtungen fungieren sollen. Der
Sektion 6 v Sección 6<br />
Licenciado en Turismo muss in der Lage sein, Tourismusmanagement auf höchstem<br />
Niveau durchzuführen. Dazu sind gute fachbezogene Fremdsprachenkenntnisse und<br />
Fähigkeiten erforderlich. Das Fach Deutsch als zweite Fremdsprache wird erst seit 5<br />
Jahre ins Studienprogramm einbezogen. Damit fand das fachbezogene Deutsch zum<br />
ersten Mal Platz in der universitären Ausbildung Kubas.<br />
Als Deutschlehrer sind wir damit konfrontiert, dass sich das Fachprogramm auf<br />
ein allgemeines Deutsch beschränkt, und der Fachkommunikation nicht genügend<br />
entspricht sowie relevante Lernmaterialien für das Fach fehlen, die es ermöglichen,<br />
eine fachsprachliche Kompetenz bei den kubanischen Tourismusstudierenden<br />
herauszubilden. Die existierenden Lehrwerke für den Tourismusbereich sind spezifisch<br />
für Auszubildende konzipiert, die direkt in den verschiedenen Dienstleistungsbereichen<br />
arbeiten. Sie entsprechen nicht den Anforderungen für den Deutschunterricht im<br />
Studium, der vor allem auf das Management abzielt. Deutschlehrer stehen deswegen<br />
vor der Aufgabe, neue Materialien zum Unterricht zu entwickeln.<br />
Mit der Entwicklung eines neuen Materials zur Förderung der fachsprachlichen<br />
Textkompetenz im fachbezogenen Deutschunterricht im Bereich des Tourismus<br />
habe ich mich 2011 am Herder Institut der Universität Leipzig beschäftigt. Mit<br />
dem Vortrag “Paralleltexte im fachbezogenen Deutschunterricht” möchte ich die<br />
Gesamtkonzeption des Materials vorstellen, welche Faktoren in Betracht gezogen<br />
wurden, wie spezifische Lerner- und Landesbezogene Elemente bei der ganzen<br />
Konzeption eine Rolle spielen, welche Anpassungen vor Ort bei seiner Anwendung<br />
im Unterricht nötig waren und warum. Ich hoffe damit einen Impuls für die Diskussion<br />
der teilnehmenden Deutschlehrer zu geben und zur Weiterentwicklung des Materials<br />
beizutragen.<br />
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen in Mexiko: Bestandsaufnahme,<br />
Herausforderungen und Möglichkeiten<br />
Herzig, Katharina<br />
Universidad de Guadalajara, Mexiko<br />
Sowohl der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR) als auch<br />
der weitgehend standardisierte Lehrwerks- und Prüfungsmarkt in den deutschsprachigen<br />
Ländern haben gravierende Auswirkungen auf den Fremdsprachenunterricht in Mexiko.<br />
Diese Auswirkungen sollen am Beispiel der Zielgruppe der Deutschlerner an der<br />
geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universidad de Guadalajara zunächst genauer<br />
betrachtet und die damit verbundenen Herausforderungen dargestellt werden.<br />
Anschließend sollen exemplarisch Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie der<br />
DaF-Unterricht für diese Zielgruppe enger an den individuellen Lernerbedürfnissen<br />
ausgerichtet und binnendifferenzierter gestaltet werden kann und welche Rolle<br />
der GeR dabei spielen könnte. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie die<br />
125
126<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
Deutschlernenden (Niveau A2) dabei unterstützt werden können, im Rahmen<br />
eines Blended-Learning-Konzepts eigene Handlungsziele in Bezug auf Deutsch als<br />
Fremdsprache zu entwickeln.<br />
Funktioniert die formative Evaluation wirklich? Metaevaluation eines<br />
Portfolioprojekts.<br />
Hirschfeld, Diana<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
Als Forschungsarbeit im Rahmen des Masterstudienprogramms für Angewandte<br />
Linguistik der UNAM wird eine Metaevaluation durchgeführt, um den Prozess<br />
einer formativen Evaluation besser zu verstehen und beurteilen zu können. In<br />
der Fachliteratur wird das Geschehen im Unterrichtsraum oft als „black box“<br />
bezeichnet: man kennt den „input“ und den „output“, aber man weiß kaum, was in<br />
der Zwischenzeit geschieht. Wie funktioniert eine formative Evaluation überhaupt?<br />
Kann man mit einer formativen Evaluation wirklich Lernprozesse, nicht nur Produkte,<br />
dokumentieren? Was passiert in einem Portfolioprojekt, wenn LehrerIn und Lernende<br />
zusammenarbeiten, um die schriftliche Produktion in DaF zu verbessern? Wie<br />
verändert sich die Textproduktion im Laufe des Lernprozesses? Welche Rolle spielt die<br />
Korrektion in dieser Veränderung? Wie wirkt das Feedback auf die Lerner? Welchen<br />
Einfluss spielt die Reflexion über das eigene Lernen auf die Autonomie der Lerner?<br />
Auf diese Fragen soll der Vortrag eingehen und erste Ergebnisse einer qualitativen<br />
Forschung (case study) vorstellen.<br />
Berufsorientierter Fremdsprachenunterricht – Lernziele und Übungskonzepte<br />
zwischen Arbeitswelt und GER<br />
Dr. Kuhn, Christina<br />
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland<br />
Berufsorientierung von Beginn des Fremdsprachenlernens erscheint nicht nur<br />
angesichts der sich ständig verändernden kommunikativen Anforderungen der<br />
Arbeitswelt notwendig, für die Lernenden ist sie oft ein großer Motivationsfaktor.<br />
Obwohl Referenzrahmen und Profile Deutsch die Integration beruflicher Komponenten<br />
ab A1 fordern, wird berufsbezogenes Fremdsprachenlernen häufig noch immer mit<br />
Fachsprache gleichgesetzt, vom allgemeinsprachlichen Unterricht separiert und<br />
allenfalls für den Unterricht ab B2 eingeplant. Ausgehend von der These, dass jeder<br />
Fremdsprachenunterricht potenziell berufsvorbereitend ist, sollen im Beitrag<br />
berufs- und arbeitsplatzrelevante (Sprach)Handlungsfelder und kommunikative<br />
Anforderungen am Arbeitsplatz bezogen auf die Situation in Südamerika aufgezeigt,<br />
grundlegende Zielgruppen und Lernziele differenziert und Übungsbeispiele für die<br />
frühe Integration des Berufsbezugs in DaF-Lehrwerke zur Diskussion gestellt werden.
Sektion 6 v Sección 6<br />
Lexik und Interkomprehension in drei germanischen<br />
Sprachen (Deutsch, Englisch, Niederländisch).<br />
Ergebnisse und didaktische Implikationen einer<br />
lexikometrischen Analyse.<br />
Prof. Dr. López Barrios, Mario<br />
Unviersidad Nacional de Córdoba, Argentinien<br />
Die simultane Entwicklung von Lesefertigkeiten in den germanischen Sprachen<br />
Deutsch und Niederländisch sowie die Weiterentwicklung dieser Fertigkeit in Englisch,<br />
die als Brückensprache auf den Weg der zwei ersten Sprachen fungiert, beruht auf<br />
einen starken Einsatz datengeleiteter Verstehensprozesse. Dabei spielt das lexikalische<br />
und das strategische Wissen der Lerner eine wichtige Rolle: die Leser wenden<br />
Inferier- und Transferstrategien an, die im Zusammenspiel mit ihrem Weltwissen aktiv<br />
an der Sinnkonstruktion der fremdsprachlichen Texte mitwirken. Deshalb soll der<br />
Anteil des inferierbaren und transferierbaren Wortschatzes – der sog. „transparente“<br />
Wortschatz – groß genug sein, damit dem Leser ein globales Verständnis ermöglicht<br />
wird. Ziel des Beitrags ist es, eine lexikometrische Analyse einiger deutsch-, englisch-<br />
und niederländischsprachiger Texte durchzuführen, die für einen multilingualen<br />
Lesekurs ausgewählt wurden. Die Ergebnisse dieser Analyse soll der Bestimmung des<br />
Schwierigkeitsgrades dieser Texte dienen, und den Kurserstellern somit wissenschaftlich<br />
abgesicherte Kriterien der Textsequenzierung liefern. Darüber hinaus erlaubt die<br />
Analyse der Types und Tokens eine Einsicht in die Frequenz und Vorkommenshäufigkeit<br />
der verschiedenen lexikalischen Einheiten, was eine zusätzliche Hilfe bei der Erstellung<br />
einer Lesegrammatik bereitstellt.<br />
Neue Ansätze in der Gestaltung von Curricula und<br />
Unterrichtsmaterialien für die Niveaustufe A1.<br />
Am Beispiel des DaF-Unterrichts am Spracheninstitut der<br />
Universidad del Norte, Barranquilla, Kolumbien.<br />
Lorenz, Patrycja<br />
Universidad del Norte Barranquilla, Kolumbien<br />
Ausgehend von dem „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen“<br />
und unter Berücksichtigung des Systems „Profile Deutsch“ soll ein Vorschlag für<br />
Curriculumentwicklung am Beispiel des DaF-Unterrichts an der Universidad del<br />
Norte in Barranquilla diskutiert werden. Das vorgestellte Curriculum will die im<br />
GER sehr allgemein festgelegten Ziele, Niveaustufen und Handlungsmöglichkeiten<br />
für die Zielgruppe - im konkreten Fall Studierende der Studiengänge „Relaciones<br />
Internacionales“ und „Negocios Internacionales“ in der Niveaustufe A1 - definieren. Das<br />
Curriculum befindet sich in einem ständigen Entwicklungsprozess und soll nicht als<br />
endgültig betrachtet werden.<br />
127
128<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
Das Curriculum soll den Deutschlehrern des Instituts bei der Planung eines<br />
hochschulspezifischen und hochschuladäquaten Deutschunterrichts helfen, durch<br />
den die Studierenden die den Deskriptoren (Kann-Beschreibungen) entsprechenden<br />
und im Sinne des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens vergleichbare<br />
Deutschkenntnisse erwerben. Es soll auch als Unterstützung für die Lehrkräfte bei der<br />
Erstellung eigener Unterrichtsmaterialien gesehen werden.<br />
Der Beitrag skizziert darüber hinaus die Rahmenbedingungen im Bereich des DaF-<br />
Unterrichts an der Universidad del Norte sowie die Aufteilung der Niveaustufen auf die<br />
einzelnen Semester und definiert die spezifischen Kann-Beschreibungen anhand damit<br />
verbundener Aufgaben und Unterrichtsmaterialien.<br />
El Arte de aprender a nadar entre dos aguas – Die Kunst<br />
zu lernen, wie man zwischen zwei Stühlen sitzt<br />
MacKeldey, Anja María<br />
Deutsche Schule Medellín /Universidad de Antioquia Sede Medellín, Kolumbien<br />
Angesichts einer immer schnell lebigeren Welt können wir unserer Rolle als<br />
Ko-konstrukteure der sozialen und politischen Wirklichkeit einen neuen Wert<br />
zumessen, wenn wir uns im Sinne der „co-razón“ (gemeinsame Herz-Vernunft) als<br />
anarkosolidarische Personen verstehen. Dafür müssen die Personen, die wie wir in<br />
formellen bzw. informellen Erziehungskontexten tätig sind, lernen, den Umgang<br />
mit den (Aus)wirkungen unserer Handlungen bzw. mit denen der anderen lehren<br />
zu können. Dieser im Colegio Alemán Medellín ko-konstruierte Beitrag zu einer<br />
performativ interkulturellen Pädagogik sucht unsere Körper und Sprechhandlungen<br />
in formellen Lern/Lehrkontexten les- und transformierbar zu machen. Die dabei<br />
entwickelte performative Methodologie verpflichtet alle Beteiligte die Schlüsselrolle<br />
unseres Körpers als Handelnder und Verhandelter (an)zuerkennen. Gleichzeitig<br />
liefert sie auch mäeutisch-didaktische Hilfsmittel, um den Anspruch zu verwirklichen,<br />
mögliche Bildungsprozesse anarkosolidarischer Personen in der gemeinsamen Herz-<br />
Vernunft in Gang zu setzen.<br />
Erkundungen der Deutschlandbilder und der<br />
komplementären nationalen Selbstbilder von<br />
kubanischen Reiseleitern.<br />
Morales Domínguez, Alberto Alejandro<br />
Universität von Havanna, Kuba<br />
Wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen aufeinander treffen, leiden<br />
diese Begegnungen nicht selten an der Verwechslung des selbtskonstruierten Bildes<br />
vom Fremden mit dem Fremden selbst. Gelingt es dagegen, den Zusammenhang<br />
von Selbst-und Fremdbildkonstruktionen bewusst zu machen, so können mögliche
Sektion 6 v Sección 6<br />
Missverständnisse bei interkulturellen Begegnungen als Lehrchance begriffen und<br />
damit mittelfristig verringert werden.<br />
Wie sehen kubanische Reiseleiter die deutschen Touristen? Wie sehen sie im<br />
Vergleich dazu sich selbst? Diese Fragen werden nicht abstrakt - theoretisch, sondern<br />
durch den Einsatz eines Interkulturellen Workshops für kubanische Reiseleiter<br />
behandelt. Weil unser Denken und Handeln mehr als wir glauben von Stereotypen,<br />
die wir von anderen Menschen und Kulturen haben, bestimmt ist, werden in einem<br />
ersten Schritt die spontanen Bilder zu verschiedenen beruflichen interkulturellen<br />
Themen erkundet. Anschlieβend wird der Zusammenhang von kollektiven Fremd-<br />
und Selbstbildkonstruktionen erfahrbar gemacht. Angestrebt wird die Erstellung einer<br />
Multimedia des Workshops mit Kommentaren der TeilnehmerInnen, die als Material<br />
für interkulturelles Lernen zwischen beiden Seiten verwendet werden kann. Das<br />
Multimedia-Paket gibt uns ein wertvolles Werkzeug in die Hand, um den Unterricht, den<br />
Lehr- und Lernprozess in Halbanwesenheit - bzw. Fernstudienkurse zu unterstützen. Es<br />
wird vorausgesetzt, dass solche Materialien für Studenten und Arbeiter im kubanischen<br />
Tourismussektor nicht vorhanden sind.<br />
Neue Wege der Curriculumentwicklung – Szenarien<br />
im Sprachunterricht<br />
für Studierende der Germanistik der<br />
Universidade de São Paulo im 3. Studienjahr<br />
Dr. Peuschel, Kristina<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien<br />
Ein Curriculum ist „eine bildungstheoretisch begründete, mit den Mitteln der<br />
Wissenschaft entwickelte und durch eine ständige Revision an die wechselnden<br />
Anforderungen der Gesellschaft angepasste und öffentlich verantwortete Darstellung<br />
dessen, was und wie unter welchen Bedingungen gelehrt und gelernt werden soll.“<br />
(Barkowski & Krumm, 2010, 40)<br />
Unter den Prämissen moderner Fremdsprachendidaktik und den Herausforderungen,<br />
die sich daraus für die fremdsprachliche Ausbildung im Hochschulkontext der<br />
Universidade de São Paulo (USP) ergeben, ist es nicht nur interessant, sondern auch<br />
immer wieder notwendig, bestehende und erfolgreich erprobte Curricula weiter zu<br />
entwickeln und zu prüfen, ob sie nach wie vor die gesellschaftlichen Anforderungen<br />
in einer globalisierten und mehrsprachigen Welt zu bedienen vermögen. Aktuelle<br />
Tendenzen der europäischen Fremdsprachendidaktik versuchen über die Definition<br />
und empirische Validierung von Kompetenzen sprachlicher Handlungsfähigkeiten und<br />
einer zunehmenden Aufgaben-, Lerner- und Handlungsorientierung in der Vermittlung<br />
von Fremdsprachen neue Wege zu gehen. Diese aktuellen europäischen Entwicklungen<br />
zielgruppenspezifisch für den Bereich der germanistischen Ausbildung an der USP<br />
129
130<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
gewinnbringend aufzuarbeiten, ist Ziel des hier skizzierten Forschungsprojektes, das<br />
seinen Anfang in einem Seminar mit Masterstudierenden der Universität Leipzig nahm.<br />
Angesichts der aktuellen Situation in Lateinamerika scheint es notwendig,<br />
die Forderung nach einer stärkeren Lernerorientierung und auch die Forderung<br />
nach Mehrsprachigkeit aufzugreifen und entsprechend den Bedingungen an den<br />
jeweiligen Standorten zu beleuchten. Gerade am Übergang zwischen allgemeinem<br />
Sprachunterricht Deutsch und der Spezialisierung auf einen der germanistischen<br />
Fachbereiche im 3. Studienjahr scheint es notwendig, stärker vorbereitend die<br />
zukünftigen Bedürfnisse der Lernenden auch curricular zu verankern.<br />
Der Beitrag stellt das Untersuchungsdesign und erste Ergebnisse aus einer<br />
Pilotstudie vor.<br />
Die Rolle des Lehrers im interkulturellen Klassenraum<br />
Lateinamerikas<br />
Dr. Pfleger, Sabine<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
Fremdsprachenunterricht ist traditionell ein beliebtes Experimentierfeld für<br />
ganz unterschiedliche Denkströmungen: Für Theorien und Methodologien und das<br />
Entwickeln und Ausprobieren ganz allgemein.<br />
Spätestens seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der<br />
fremdsprachliche Klassenraum zum Lieblingskind der Globalisierungstheorien erklärt,<br />
hatte man hier doch ein Spielfeld entdeckt, in dem sprachlich versierte, interkulturell<br />
kompetente Menschen herangezogen werden können, und das besonders in der<br />
Erwachsenenbildung. Die Rede ist von den sogenannten „intercultural key skills“.<br />
Der europäische Referenzrahmen trägt sein Schärflein dazu bei, in dem man dort<br />
ganz selbstverständlich interkulturelle Inhalte, zugeschnitten auf die spezielle<br />
europäische Bildungs- und Arbeitskultur, anbietet. Nicht immer übertragbar und 1:1<br />
umsetzbar für den lateinamerikanischen Kontinent. Dementsprechend tut man sich<br />
hier in der Erwachsenenfremdsprachen(aus-)bildung auch recht schwer mit dem<br />
Einbinden interkultureller Inhalte in das (noch immer vornehmlich) von Grammatik<br />
und Lexikpaukerei gestaltete Tagesgeschehen.<br />
Das man weiterhin an tradierten Unterrichtsmodellen festhält hat nicht nur mit<br />
örtlichen Lernertraditionen zu tun, sondern hängt vor allem damit zusammen, dass<br />
es zu wenig und nur unzureichende Weiterbildungsangebote für Sprachenlehrer<br />
gibt, die helfen könnten, die Rolle des Lehrers in einem interkulturell ausgerichteten<br />
Sprachenunterricht neu zu definieren.<br />
In meinem Vortrag gehe ich auf die mit der „interkulturellen Wende“ verbundenen<br />
Probleme für die veränderte Rolle des Fremdsprachenlehrers für den Fall Mexiko ein, wobei<br />
durchaus auch mögliche Lösungsansätze der derzeitigen Problematik diskutiert werden sollen.
Sektion 6 v Sección 6<br />
Zielgruppenspezifischer DaF- Unterricht mit besonderer<br />
Berücksichtigung der Fertigkeit Schreiben für<br />
Studierende am geisteswissenschaftlichen Zentrum der<br />
Universidad de Guadalajara in Mexiko- ein praktisches<br />
Beispiel.<br />
Sadowski, Sabrina<br />
Universidad de Guadalajara, Mexiko<br />
Im Bereich Deutsch als Fremdsprache für Studierende der Geisteswissenschaften<br />
gibt es bis zum heutigen Datum kaum Material für die Niveaustufen A1 und A2 nach<br />
dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Daher fehlt es unter<br />
anderem auch an der Universidad de Guadalajara an adäquatem Unterrichtsmaterial für<br />
zielgruppenspezifischen Deutschunterricht.<br />
Um diesem Defizit entgegen zu wirken, wurden exemplarisch einige Reihenplanungen<br />
entwickelt. Ein daraus hervorgehender praktischer Unterrichtsvorschlag soll in Form<br />
einer ausgearbeiteten Stundenplanung vorgestellt werden und den Schwerpunkt des<br />
Vortrages bilden. Das geisteswissenschaftliche Zentrum der Universidad de Guadalajara<br />
und die dort existierenden Rahmenbedingungen dienen dabei als Exempel. Dies<br />
bedeutet vor allem, dass auch das kurstragende Lehrwerk studio d vom Cornelsen<br />
Verlag für die praktischen Überlegungen berücksichtigt wurde.<br />
Der theoretisch-wissenschaftliche Fokus liegt hierbei insbesondere auf der in<br />
der Vergangenheit lange vernachlässigten Fertigkeit Schreiben, da diese speziell<br />
im Grundstufenbereich, und damit für die Mehrheit der Deutschlernenden und –<br />
lehrenden am geisteswissenschaftlichen Zentrum, immer noch eine besonders große<br />
Herausforderung darstellt.<br />
„Wir müssen äh wir können…“ – Das mündliche<br />
selbstinitiierte Selbstreparaturverhalten von Lernenden<br />
des Deutschen als Fremdsprache<br />
Schmiedgen, Katja<br />
Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexiko<br />
Mit Sprechen verbringt der Mensch im Laufe seines Lebens viel Zeit, sei es in der<br />
Unterhaltung mit anderen oder im Gespräch mit sich selbst. Der Weg vom Gedanken-<br />
zum Redefluss ist dabei alles andere als einfach und direkt. Unentwegt erfolgt eine<br />
Kontrolle, ob das, was geäußert wird, sprachlich korrekt ist und das zum Ausdruck<br />
bringt, was gemeint ist. Wird bei diesem Monitoring eine Komplikation festgestellt,<br />
kann eine Richtigstellung erfolgen. Die Fähigkeit zur selbstinitiierten Selbstreparatur<br />
ist dabei jedem eigen und entsprechende Korrekturen sind sowohl beim mutter- als<br />
auch beim fremdsprachlichen Sprechen natürlich und allgegenwärtig. Was aber<br />
genau kennzeichnet das selbstinitiierte Selbstreparaturverhalten von Lernenden<br />
131
132<br />
Sektion 6 v Sección 6<br />
des Deutschen als Fremdsprache? Eine detaillierte Beschreibung dieses im Bereich<br />
DaF bisher kaum betrachteten Phänomens der mündlichen Performanz zu liefern,<br />
war das Ziel einer empirischen Untersuchung mit mexikanischen Deutschlernenden.<br />
Anhand detaillierter Transkripte von Gruppenarbeitsgesprächen wurde ein Korpus<br />
von 532 Reparatursequenzen nach Qualität kodiert sowie jeweilige Vorkommen<br />
deskriptiv-statistisch ausgewertet. Der Untersuchungsschwerpunkt lag dabei auf<br />
Wiederholungen, Fehlstarts, Sprachwechseln und offenen Reparatursequenzen. Diese<br />
Formen der Selbstreparaturen traten konstant und mehrheitlich verzögerungsfrei mit<br />
einer Häufigkeit von 6,5 Selbstreparaturen je einhundert Wörter auf. Bei den offenen<br />
Reparatursequenzen ließen sich zudem verschiedene Reparaturtypen differenzieren,<br />
je nachdem welches sprachliche Element in welcher Form modifiziert wurde.<br />
Auffällig ist die Tendenz hin zu Reparaturen, denen ein Fehler im eigentlichen Sinne<br />
zugrunde liegt, gegenüber Angemessenheits- und Neuformulierungsreparaturen. Die<br />
festgestellte qualitativ und individuell unterschiedliche Ausprägung der untersuchten<br />
Reparaturindikatoren kann unter anderem Hinweise auf differenziertes Monitoring<br />
sowie ein situations- und sprecherabhängig unterschiedliches Maß an Output-<br />
Kontrolle geben.<br />
Vom Redemittel zum Text - Fachübergreifende<br />
akademische Sprache im Unterricht mit Hörern aller<br />
Fakultäten<br />
Wucherpfennig, Norma<br />
Universidade Estadual de Campinas, Brasilien<br />
Am Sprachlehrzentrum der Unicamp wird mit dem von der Deutschabteilung<br />
übersetzten und von unserem Universitätsverlag herausgegebenen zweisprachigen<br />
Lehrwerk Blaue Blume gearbeitet. Es richtet sich an Lerner mit akademischem Profil,<br />
die nicht in erster Linie an Alltagssprache interessiert sind, sondern z.B. Zugang<br />
zu deutschsprachigen Texten suchen. So liegt der Fokus insbesondere auf dem<br />
Lesen und Lesestrategien, ohne jedoch die anderen Fertigkeiten auszublenden.<br />
Das Repertoire an Texten ist allerdings nicht spezifisch auf universitäres Publikum<br />
ausgerichtet, sondern eher soziokultureller, geschichtlicher bzw. literarischer Natur.<br />
Insofern liegt es nahe, dem allgemeinsprachlichen Unterricht fachsprachliche<br />
Komponenten hinzuzufügen. Da sich unser Angebot an Hörer aller Fakultäten richtet<br />
und die Kurse hinsichtlich der Studiengänge gemischt sind, lässt sich schwerlich mit<br />
Fachtexten einer bestimmten Richtung arbeiten. Um dennoch auf die Besonderheiten<br />
der Wissenschaftssprache einzugehen, bietet es sich daher an, das Augenmerk auf<br />
fachübergreifende Strukturen zu lenken.<br />
Publikationen wie Mehlhorn (Iudicium 2009) oder Schäfer/Heinrich (Iudicium<br />
2010) geben Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten im Kontext deutscher
Sektion 6 v Sección 6<br />
Hochschulen und stellen u.a. Listen mit Redemitteln und Strukturen für verschiedene<br />
Kommunikationssituationen zur Verfügung. Dieser Beitrag soll sich damit<br />
auseinandersetzen, wie man diese Redemittel produktiv in den Unterricht integrieren<br />
kann. Dabei wird u.a. folgenden Fragestellungen nachgegangen: Auf welche<br />
Unterschiede hinsichtlich des wissenschaftlichen Arbeitens in Brasilien und Deutschland<br />
muss geachtet werden und wie kann man diese bewusst machen? Wie kann man die<br />
Studierenden zur Verinnerlichung und aktiven Verwendung der Redemittel bringen?<br />
Welche Schwierigkeiten können auftreten? Mögliche Arbeits- und Einsatzformen sollen<br />
anhand von Praxiserfahrungen beleuchtet werden.<br />
133
Sektion 7<br />
Didaktisch-methodische Transformationen im lateinamerikanischen DaF-Unterricht<br />
im schulischen Kontext: Forschung und Unterrichtspraxis auf dem Prüfstand<br />
134<br />
Sektionsleitung:<br />
Prof. Dr. Mario López Barrios<br />
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina<br />
Prof. Dr. Karen Pupp Spinassé<br />
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil<br />
Dr. Karen Schramm<br />
Universität Leipzig, Deutschland<br />
Konzept der Sektion<br />
Die Gestaltung von DaF-Unterricht im schulischen Bereich steht im lateinamerikanischen<br />
Kontext vor vielfältigen Herausforderungen. Zum einen stellt sich die Frage, inwieweit<br />
die auf den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GeR) abgestimmten<br />
Lehrwerke und internationalen Prüfungsformate die Curriculumentwicklung in den<br />
unterschiedlichen Lernkontexten im schulischen Bereich beeinflusst haben und wie eine<br />
Balance zwischen Standardisierung und zielgruppenspezifischer Unterrichtsgestaltung in<br />
den vielfältigen DaF-Lernkontexten in Lateinamerika erreicht werden kann.<br />
Eine weitere Herausforderung stellt die Umsetzung aktueller didaktischer<br />
Ansätze in lateinamerikanischen DaF-Lernkontexten dar, z.B. die Schaffung einer<br />
binnendifferenzierten Lernumgebung durch veränderte Sozial- und Vermittlungsformen<br />
oder die Einbeziehung neuer Medien in den DaF-Unterricht (eventuell sogar im<br />
Rahmen eines Blended-Learning-Modells). In diesem Zusammenhang geht es auch um<br />
die veränderte Rolle des Lehrers und um die Frage der Förderung von Lernerautonomie.<br />
Nicht nur die Unterrichtspraxis, auch die didaktische Forschung soll in dieser<br />
Sektion im Mittelpunkt stehen. Inwieweit konnte sich Fremdsprachendidaktik unter<br />
Berücksichtigung eigener Lehr- und Lerntraditionen bisher als eigenständiges<br />
Forschungsgebiet in Lateinamerika etablieren? In welchen Bereichen lassen sich<br />
didaktische Forschungsdesiderata im lateinamerikanischen Kontext identifizieren?<br />
Es sind vor allem Beiträge in einer der folgenden Kategorien willkommen:<br />
1. Vorstellung innovativer Praxisbeispiele (“best-practice”-Beispiele) aus spezifischen<br />
DaF-Lernkontexten im schulischen Bereich in Lateinamerika.<br />
2. Vorstellung von Curricula, Unterrichtsmaterialien und Aufgabenformaten, die für<br />
spezifische DaF-Lernkontexte im schulischen Bereich in Lateinamerika entwickelt<br />
wurden.<br />
3. (Empirische) Forschungsvorhaben aus dem didaktisch-methodischen Bereich.<br />
4. Theoretische Reflexionen, die Perspektiven der didaktischen Forschung in<br />
Lateinamerika aufzeigen.
Montag, 05.03.2012<br />
Uhrzeit Ort<br />
8:30-10:00 Einschreibung Paraninfo<br />
10:00-11:30 Eröffnungsveranstaltung:<br />
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Generalrektor Juárez 975<br />
der Universität Guadalajara / Rector general de la (Ecke Enrique Díaz<br />
Universidad de Guadalajara. Mtro. Pablo Arredondo<br />
Ramírez, Rektor des Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrums CUCSH / Rector del Centro Universitario<br />
de Ciencias Sociales y Humanidades. Dr. Lilia Oliver<br />
Sánchez, Leiterin der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät / Directora de la División de Estudios Históricos<br />
y Humanos. Dr. Edmund Duckwitz, Botschafter<br />
der Bundesrepublik Deutschland / Embajador de la<br />
República Federal de Alemania.<br />
Dr. Alfred Längle, Botschafter der Republik Österreich /<br />
Embajador de Austria. Dr. Gisela Schneider, Deutscher<br />
Akademischer Austauschdienst / Servicio Alemán<br />
de Intercambio Académico (DAAD). Dr. Olivia C.<br />
Díaz Pérez, Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes / Presidenta de la Asociación<br />
Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
de León)<br />
11:30-12.00 Empfang des Generalrektors der Universität Guadalajara<br />
12:00-12:45 Plenarvortrag Paulo Astor Soethe:<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer<br />
international vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
12:45-13:30 Plenarvortrag Ottmar Ette: Die Literaturen der Welt aus<br />
transarealer Perspektive<br />
13:45-14:30 Abfahrt zum Tagungsort (CUCSH)<br />
14:30-16:00 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Vor dem<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
16:00-16:30 Einführung Raum 67 H**<br />
16:30-17.00 Isabel Heller Ein Versuch standardisierter<br />
Leistungsmessung in Deutsch als Fremdsprache an einem<br />
universitären Sprachenzentrum: Das Beispiel des CELIN<br />
der UFPR<br />
Raum 67 H<br />
135
17:00-17:30 Dieter Jaeschke Balanced Teaching:<br />
DaF-Unterricht zwischen Offenheit und Geschlossenheit<br />
17:30-18:00 Pause<br />
18:00-19:30 Kulturveranstaltung (Goethe-Institut): Kabaret und<br />
Musik mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll<br />
19:30 Empfang der Deutschen Botschaft<br />
Eröffnung Karikaturenausstellung Goethe-Institut<br />
136<br />
Dienstag, 06.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Hermann Funk:<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?. Modelle zum<br />
Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz und ihre<br />
praktischen Konsequenzen<br />
Semiplenarvortrag Friedhelm Schmidt-Welle:<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und<br />
Alzheimer<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Peter Bickelmann Interkultureller Deutschunterricht an<br />
Deutschen Schulen im spanischsprachigen Südamerika<br />
10:45-11:15 Diana Rode Die Arbeit mit Literatur im Deutsch als<br />
Fremdspracheunterricht am Beispiel von „Eva Wien“, einer<br />
Hueber Lese Novela<br />
11:15-11:45 Heloisa Liberto, Monica Savedra DaF-Unterricht und<br />
die Entwicklung der Interkulturellen Kompetenz im<br />
schulischen Kontext<br />
11:45-12:15 Pause<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Erwin Tschirner:<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Semiplenarvortrag Claudia Dornbusch:<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche Wissenschaft?<br />
Sektion 7 v Sección 7<br />
Raum 67 H<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
Vor dem<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
und Bibliothek<br />
Manuel Rodríguez<br />
Lapuente<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium Carlos<br />
Ramírez Ladewig<br />
Raum 67 H<br />
Raum 67 H<br />
Raum 67 H<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium Carlos<br />
Ramírez Ladewig
Sektion 7 v Sección 7<br />
13:00-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der<br />
Jurafakultät (siehe<br />
Campusplan)<br />
14:30-15:00 Franziska Bard Cordero Förderung der Interkulturellen<br />
Kompetenz per Internet: eine Analyse verschiedener<br />
Austauschprojekte<br />
Raum 67 H<br />
15:00-15:30 Mathias Sannemann Skype-Konferenz der DS<br />
Guadalajara und der Maria-Montessori Schule Jena<br />
Raum 67 H<br />
15:30-16:00 Raum 67 H<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Martin Dettmer Die Aktionsforschung –<br />
Methodologische Gesichtspunkte zur effektiven<br />
Unterrichtsforschung<br />
17:00-17:30 Jacqueline Tiburcio Barwis Proyecto Aula: una<br />
experiencia en la enseñanza del alemán como lengua<br />
extranjera.<br />
17:30-18:00 Maria Nilse Schneider Frühzeitige Praktika<br />
zur Förderung der Reflexionsfähigkeit und der<br />
Lernerautonomie in der DaF-Lehrerausbildung<br />
18:15-19:45 Kulturveranstaltung (Foro Cultural de Austria, BMUKK):<br />
Lesung von Tarek Eltayeb<br />
Donnerstag, 08.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Christian Fandrych: Zum Stil<br />
deutscher wissenschaftlicher Vorträge (auch) aus<br />
kontrastiver Sicht.<br />
Semiplenarvortrag Karen Pupp Spinassé:<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht in<br />
einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Raum 67 H<br />
Raum 67 H<br />
Raum 67 H<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium Carlos<br />
Ramírez Ladewig<br />
10:15-10:45<br />
Sektionsarbeit<br />
Ulrike Pleß Translation im DaF-Unterricht Raum 67 H<br />
10:45-11:15 Valeria Wilke Verstehensprozesse beim Leseverstehen in<br />
verwandten Sprachen<br />
Raum 67 H<br />
137
11:15-11:45 Claus Witte Film im DaF Unterricht – Möglichkeiten und<br />
Grenzen<br />
11:45-12:00 Pause<br />
138<br />
Sektion 7 v Sección 7<br />
Raum 67 H<br />
12:00-12:30<br />
Sektionsarbeit<br />
Charlotte Lerchner Deutsch macht sexy! Vorstellung<br />
eines produktiv-kreativen Filmprojekts<br />
Raum 67 H<br />
12:30-13:00<br />
13:00-13:30<br />
Auswertung Raum 67 H<br />
13:30-14:30<br />
14:30-15:00<br />
15:00-15:30<br />
15:30-16:00<br />
Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der<br />
Jurafakultät (siehe<br />
Campusplan)<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00<br />
17:00-17:30<br />
17:30-18:00<br />
18:00-19:00 Abfahrt zum Paraninfo<br />
19:00 Kulturveranstaltung der Universität Guadalajara:<br />
Lehrstuhl „Cortázar“ (Cátedra Cortázar): Plenarvortrag<br />
Juan Villoro: *Te doy mi palabra. Un itinerario en la<br />
traducción.<br />
Freitag, 09.03.2012<br />
9:00-11:00 9:00-9:25 Reinhard Andress “... heiße ich daher<br />
die Emigration gut”: der Fall des Egon<br />
Schwarz<br />
9:25- 09:50 Egon Schwarz:<br />
Lesung auf Deutsch***<br />
10:00 – 11:00 Elisabeth Siefer: Einführung in die<br />
Übersetzung<br />
Egon Schwarz: Lesung auf Spanisch<br />
- Diskussion<br />
Paraninfo<br />
Juárez 975<br />
(Ecke Enrique Díaz<br />
de León)<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig
Sektion 7 v Sección 7<br />
9:00-11:00 Documental de Juliana Fischbein:<br />
des aparecer Exil und Erinnerung im Rahmen des<br />
Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er Jahre in<br />
Südamerika***<br />
Workshop Karen Schramm: Mündliches Erzählen im<br />
Fremdsprachenunterricht<br />
Workshop Dieter Jaeschke: Freundschaft, Ostalgie und<br />
weite Welt: Der Spielfilm „Friendship!“ (D 2010) im DaF-<br />
Unterricht<br />
Workshop Carmen Schier: Zur Arbeit mit Hörbüchern.<br />
Ein „Grenzgänger“ wird (neu) entdeckt<br />
9:00-10:00 Verlagspräsentation Martina Bartucz, Cornelsen Verlag:<br />
Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Verlagspräsentation Anne Robert, Hueber Verlage:<br />
Menschen<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: DaF<br />
kompakt – das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: „Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur Sprache<br />
11:00-11:30 Pause<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
11:30-12:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven der Germanistik in Auditorium<br />
Lateinamerika<br />
Silvano Barba<br />
Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: Beste<br />
Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
64 H<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven<br />
Tafelbildern am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz Neu“<br />
und „Logisch!“<br />
65 H<br />
Verlagspräsentation Christina Kuhn, Cornelsen Verlag:<br />
Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was ändert sich,<br />
was bleibt?<br />
66 H<br />
12:30-13:30 Abschlussplenum <strong>ALEG</strong> Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
13:30-15:00 Mittagessen Hof der<br />
Jurafakultät (siehe<br />
Campusplan)<br />
15:00-17:00 <strong>ALEG</strong>-Mitgliederversammlung Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
61 H<br />
62 H<br />
63 H<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H<br />
64 H<br />
139
140<br />
Sektion 7 v Sección 7<br />
17:15-19:15 AMPAL- Mitgliederversammlung Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
20:00 Abendessen & Abschlussfeier El Callejón de<br />
los Rumberos.<br />
Chapultepec Ecke<br />
Lerdo de Tejada<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
** Die Tagungsräume befinden sich im 3. Stock des Gebäude H vom CUCSH.<br />
*** Teil der Sektion 2 und des Kulturprogramms; nähere Informationen im Kulturprogramm<br />
Beiträge in alphabetischer Reihenfolge<br />
Förderung der Interkulturellen Kompetenz per Internet: eine Analyse<br />
verschiedener Austauschprojekte<br />
Bard Cordero, Franziska<br />
Universidad Veracruzana, Mexiko<br />
Immer wieder hören wir, dass die Globalisierung so wie das Internet uns den Andern<br />
physisch immer näher bringen. Dieses Nähersein bedeutet jedoch nicht automatisch<br />
ein Näherkommen und Sichverstehen. Deshalb wird die „Interkulturelle Kompetenz als<br />
grundlegende Komponente der Persönlichkeitsbildung für die Gesellschaft von morgen<br />
eingeschätzt.” Obwohl ein Bewusstsein über die Notwendigkeit des Förderns dieser<br />
Kompetenzen herrscht, fehlt im Unterrichtsalltag noch sehr oft die konkrete Umsetzung.<br />
Dies besonders in einsprachigen Gruppen und auf den Anfängerstufen, zwei Faktoren,<br />
die im lateinamerikanischen Raum sehr oft anzutreffen sind. Bei diesem Vortrag wird<br />
zuerst kurz darauf eingegangen, welche Fähigkeiten und Verhaltensweisen überhaupt<br />
gefördert werden sollen, um allmählich interkulturelle Kompetenzen zu erlangen. Danach<br />
werden mehrere Austauschprojekte mit dem Internet vorgestellt und verglichen, was<br />
hauptsächlich als Anregung und Reflexion für die Entwicklung eigener Projekte dienen soll.<br />
Interkultureller Deutschunterricht an Deutschen Schulen im<br />
spanischsprachigen Südamerika<br />
Dr. Bickelmann, Peter<br />
Colegio Alemán / Deutsche Schule Barranquilla, Kolumbien<br />
Aus der Sicht der Hirnforschung ist der Lernerfolg entscheidend vom Vorwissen der<br />
LernerInnen abhängig: Wissen wird, gesteuert durch das Unbewusste, im Gehirn der<br />
LernerInnen aufgebaut. Durch das limbische System überprüft das Gehirn Situationen<br />
auf Bekanntes hin. Bei positivem Ergebnis wird über die neuromodulatorischen Systeme<br />
Neues mit in der Großhirnrinde enthaltenem Wissen verknüpft, so dass neues Wissen
Sektion 7 v Sección 7<br />
entstehen kann. Über den Arbeitsspeicher werden neue Informationen, die das Gehirn<br />
erreichen, mit im Langzeitgedächtnis gespeicherten Wissens-Schemata abgeglichen.<br />
Der Mensch interpretiert seine Erfahrungen hinsichtlich dessen, was er bereits weiß; er<br />
kann Neues nur in Bezug auf bekannte Muster verstehen.<br />
Da der Mensch nach der Hirnforschung Neues nur in Bezug auf bekannte Muster<br />
verstehen kann, erscheint zur Steigerung des Lernerfolgs ein von vornherein interkulturell<br />
konzipierter Deutschunterricht an Deutschen Schulen im spanischsprachigen<br />
Südamerika sinnvoll. Die LernerInnen reflektieren im ersten Schritt das Bekannte. In<br />
den nächsten Schritten distanzieren die LernerInnen sich von ihrer Kultur und nehmen<br />
das Neue, Deutsch, wahr. Mit diesem Vorgehen findet ein Befund der Hirnforschung<br />
Anwendung, dass nämlich LernerInnen im Unterricht einen erheblichen Lernzugewinn<br />
erreichen können, wenn sie vergleichen.<br />
Im interkulturellen Deutschunterricht an Deutschen Schulen im spanischsprachigen<br />
Südamerika reflektieren die SchülerInnen im ersten Schritt, was ihnen bekannt oder<br />
näher ist. Sie arbeiten auf Spanisch und auf Englisch zu Simón Bolívar, dem Führer der<br />
südamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die spanische Kolonialmacht, und<br />
zu dessen Begleiterin Manuela Sáenz, die als erste Feministin des Kontinents bezeichnet<br />
wird, und beschäftigen sich mit Textsorten des spanischsprachigen Südamerika.<br />
Die Aktionsforschung – Methodologische Gesichtspunkte zur effektiven<br />
Unterrichtsforschung<br />
Dettmer, Martin<br />
Universidad Autónoma de Chiapas, Mexiko<br />
“Aktionsforschung ist keine neue Erfindung, sondern ein anderes Wort für<br />
systematisch reflektierte Praxis …” (Posch 2009: 1). Fast jeder Fremdsprachenlehrer betreibt<br />
Aktionsforschung in seiner Unterrichtspraxis, häufig allerdings ohne sich dessen bewusst zu<br />
sein. Sehr oft suchen wir Antworten auf so komplexe Fragestellungen, wie der Motivation<br />
zum Fremdsprache lernen, oder warum unsere Lerner einfache Strukturen nicht erfassen<br />
können, oder warum sie sich nicht für bestimmte landeskundliche Themen interessieren etc.<br />
Die Aktionsforschung kann bei der Beantwortung dieser ganz konkreten<br />
Problemstellungen eine grosse Hilfe sein, sie ist eine aus der Praxis heraus entwickelte<br />
Forschungsmethode, die für die einzelnen Lehrer ein wirksames Hilfsmittel ist um konkrete<br />
Unterrichtssituation zu erforschen, zu analysieren und deren Resultate sofort wieder in die<br />
Unterrichtspraxis einfliessen können. Je komplexer, offener, risikoreicher eine Praxis ist,<br />
desto wichtiger wird es, sich ihrer kontinuierlich zu vergewissern und das Handeln und die<br />
eigenen Wertvorstellungen aufeinander abzustimmen (vergl. Posch 2009: 1).<br />
Grundlage für diesen Beitrag ist das Forschungsprojekt meines Promotionsvorhabens<br />
im Rahmen des Doktorantenprogramms über Regionalstudien an der Universidad<br />
Autónoma de Chiapas mit dem Titel: Die Englischlehre an öffentlichen Sekundarschulen<br />
141
142<br />
Sektion 7 v Sección 7<br />
in den Regionen Zentrum und Hochland von Chiapas. Im Laufe dieser Arbeit, habe<br />
ich festgestellt, dass viele der gewonnenen Rückschlüsse ebenso auf und für den<br />
Deutschunterricht anzuwenden wären und diese Studie durchaus alle Fremdsprachen<br />
einschliesst und zu Reflektionsprozessen anregt.<br />
Ein Versuch standardisierter Leistungsmessung in Deutsch als Fremdsprache an<br />
einem universitären Sprachenzentrum: Das Beispiel des CELIN der UFPR<br />
Dr. Heller, Isabel<br />
Universidade Federal do Paraná, Brasilien<br />
Objektivität, Reliabilität und Validität von Tests sind die must-haves zuverlässigen<br />
Testens. Dies gilt auch für Sprachtests (Bolton 1996, Hughes 2002). Ausserdem wird<br />
im Zuge der Globalisierung der Stellenwert und die Einstufbarkeit von deutschen<br />
Sprachkenntnissen durch Tests im Ausland ein immer wichtigerer Aspekt der<br />
Sprachausbildung Deutsch als Fremdsprache (DaF).<br />
In Brasilien sind die den Universitäten angegliederten Sprachenzentren, oft die Orte<br />
an denen die Fremdsprachenausbildung neben der tertiären Fachausbildung stattfindet<br />
und sollten deshalb auch auf die geforderten Standards der Sprachfertigkeiten, wie<br />
z.B. standardisierte Sprachtests des Goethe Instituts und Gemeinsamer Europäischer<br />
Referenzrahmen (GER), vorbereiten.<br />
Das gilt auch für den Kurs Deutsch-als-Fremdsprache des CELIN der UFPR, der sich<br />
jedoch (noch) nicht an einem einheitlichen Curriculum von Sprachthemen- und fertigkeiten<br />
in DaF orientiert. Ausserdem werden die DaF-Kurse von ausgewählten Studenten der Área<br />
de Alemão (UFPR) unterrichtet, die oft noch weiterer Ausbildung bedürfen.<br />
Aus diesem Grund bedarf es eines Systems einheitlichen Sprachtestens, welches sich<br />
an Sprachfertigkeitstandards orientiert und ein definiertes Curriculum zur Grundlage<br />
hat. Während schon im 1. Semester 2011 von der Área de Alemão Lehrmaterial analysiert<br />
und darauf basierend ein Test des A1- Niveaus (GER) entwickelt wurde, entspricht dieser<br />
nicht den so schon genannten Gütekriterien moderner Testforschung.<br />
Dieser Beitrag soll aufzeigen, wie die existierenden Lücken im Testmaterial<br />
zu schliessen sind und welche notwendigen Schritte in Materialentwicklung und<br />
Testorganisation getan werden müssen, um die DaF-Lerner des CELINs standardisiert<br />
und verlässlich testen zu können.<br />
Balanced Teaching: DaF-Unterricht zwischen Offenheit und Geschlossenheit<br />
Jaeschke, Dieter<br />
Central de la Enseñanza Alemana en el Extranjero/ Zentralstelle für das<br />
Auslandsschulwesen, Mexiko<br />
Die fremdsprachliche Fachdidaktik befindet sich seit nunmehr mindestens einem<br />
halben Jahrhundert auf der Suche nach der besten Unterrichtsmethode. Eine Suche, die
Sektion 7 v Sección 7<br />
sich als weitgehend vergeblich herausgestellt hat. Während Frontalunterricht heute zur<br />
pädagogischen Mottenkiste zählt und auf der anderen Seite offene Lernarrangements<br />
den besten Erfolg zu versprechen scheinen, haben die Sprachlehrforscher Herbert<br />
Gudjons und Engelbert Thaler den „Frontalunterricht“ als effektive Vermittlungsform<br />
„neu“ entdeckt, sofern diese Sozialform nicht als exklusives Allheilmittel betrachtet wird.<br />
Der Beitrag befasst sich mit sinnvollen Einsatzmöglichkeiten „frontalunterrichtlicher“<br />
Elemente im DaF-Unterricht: zur Übertragung der Begeisterung der Lehrerinnen und<br />
Lehrer auf ihre Schüler, zur authentischen Darstellung eigenen Humors, zur Demonstration<br />
exemplarischen Lernens und zur optimierten Strukturierung neu erworbenen Wissens.<br />
Deutsch macht sexy! Vorstellung eines produktiv-kreativen Filmprojekts.<br />
Lerchner, Charlotte<br />
Goethe-Institut, Mexiko<br />
Film ist ein beliebtes Medium im Deutsch als Fremdsprachen-Unterricht. Zum<br />
einen weil die Verbindung von bewegten Bildern mit Sprache das Verstehen erleichtert.<br />
Zum anderen wird es häufig zur Präsentation landeskundlicher Inhalte herangezogen.<br />
Obwohl die positiven Effekte des produktiven Umgangs mit dem Medium Film in<br />
anderen didaktischen Kontexten schon genutzt werden, beschränkt sich der DaF-<br />
Unterricht meist auf die Rezeption.<br />
Ausgehend von der Idee des kreativ-produktiven Umgangs mit Film, erarbeitete die<br />
Vortragende mit den Studenten eines Konversationskurses den fiktiven Kurzfilm „Deutsch<br />
macht sexy!“, der als Werbung für den Deutschunterricht an der eigenen Universität<br />
konzipiert ist. In ihrem Vortrag stellt sie vor, wie dieses Filmprojekt entwickelt wurde.<br />
DaF-Unterricht und die Entwicklung der Interkulturellen Kompetenz im<br />
schulischen Kontext<br />
Liberto, Heloisa<br />
Universidade Federal Fluminense, Brasilien<br />
Die heutige Welt der sozialen und kulturellen Beziehungen erfordert neue Richtlinien<br />
im Bereich des Fremdsprachenlehrens. Die Bedeutung der interkulturellen Aspekte in der<br />
Lehre einer Fremdsprache wuchs in den letzten Jahren und wurde zum Hauptthema in<br />
Studien, die sich auf die Lehre als eine soziale Praxis beziehen und den aktuellen Kontext<br />
berücksichtigen, in dem der Lernprozess stattfindet. Zu der multikulturellen Perspektive<br />
kommen die Aussichten der interkulturellen Erziehung. Fremdsprachenunterricht<br />
wird also wie ein privilegierter Platz gesehen, um Themenbereiche des Sprach- und<br />
Kulturerwerbs zu entfalten. Überlegungen zum interkulturellen Ansatz, zu seiner<br />
Konzipierung und seinen Herausforderungen sowie seinen Einflüssen im Prozess des<br />
DaF-Lernens im brasilianischen Raum werden hier angestellt. Die Arbeit soll einen<br />
Beitrag zum Bereich der Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht leisten. Das heißt,<br />
143
144<br />
Sektion 7 v Sección 7<br />
sie berücksichtigt das DaF-Lehren im schulischen Bereich unter den Gesichtspunkten<br />
der Interkulturellen Kompetenz und deren Entwicklung. Diese Studie basiert auf einer<br />
soziokulturellen Perspektive der Sprache und konzentriert sich auf die Beziehung<br />
zwischen Sprache, Identität und soziale Struktur. Sie zielt darauf ab, zur wirksamen<br />
Integration kultureller und sprachlicher Faktoren in der Schule beizutragen, die<br />
Entwicklung und die Anpassung der Lehrmethoden zu überwachen, die von diesem<br />
Prinzip abweichen. Dieser Beitrag bietet schließlich einen kurzen Überblick über die<br />
Lehre der deutschen Sprache in Brasilien und folgt den Konzepten und Dimensionen<br />
der Zweisprachigkeit, bzw. der Lehre von Deutsch als Fremdsprache / Zweitsprache. Er<br />
befasst sich mit dem Aspekt des interkulturellen Lernens in zwei bilingualen Schulen in<br />
Rio de Janeiro, wo Deutsch als „Sprache und Kultur 2“ definiert ist.<br />
Übersetzen im DaF-Unterricht<br />
Pleß, Ulrike<br />
Universidad de Guadalajara, Mexiko<br />
DaF-Unterricht ist kein Translationsunterricht, das steht außer Frage. Ist jedoch<br />
DaF-Unterricht ohne Translation und Translation ohne Fremdsprachenkenntnisse<br />
möglich? Letztendlich ist beides eng miteinander verbunden: Translation ist nur durch<br />
das Beherrschen der Fremdsprache möglich und im Fremdsprachenunterricht werden<br />
Übersetzungen sehr häufig angewendet.<br />
In diesem Vortrag soll das Thema des Übersetzens im Fremdsprachenunterricht<br />
untersucht werden. Ich möchte darauf eingehen, welche Arten des Übersetzens im<br />
Fremdsprachenunterricht verwendet werden. Während meines gesamten Vortrags<br />
halte ich eine enge Verbindung zwischen DaF-Unterricht und Übersetzung aufrecht<br />
und werde meine übersetzungwissenschaftlichen Vermutungen anhand von<br />
praktischen Beispielen aus meinem eigenen Deutschunterricht verdeutlichen. Dabei<br />
greife ich auf meine Erfahrungen als Deutschlehrerin an der Universidad de Guadalajara<br />
in Mexiko zurück. Diese Erfahrungen beschränken sich selbstverständlich auf ein<br />
spanischsprachiges (und somit einsprachiges) Lernpublikum. Anhand der Beispiele<br />
möchte ich diskutieren, bis zu welchem Grad Übersetzen im Fremdrspachenunterricht<br />
sinnvoll ist, unter Berücksichtigung verschiedener Niveaustufen der Lernenden, und<br />
wann besser davon abzusehen ist.<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht in einem bilingualen<br />
Kontext Brasiliens<br />
Prof. Dr. Pupp Spinassé, Karen<br />
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasilien<br />
Deutsch ist eine der meistgelernten Sprachen in Brasilien, sei es in der Schule, in<br />
Sprachkursen oder an der Universität. Insgesamt schätzt man, dass ca. 70.500 Brasilianer
Sektion 7 v Sección 7<br />
die deutsche Sprache lernen – und die gröβte Mehrheit (etwa 52.000 davon) lernt das<br />
Deutsche im schulischen Bereich.<br />
Eine sehr groβe Anzahl von DaF-Schulen befindet sich in der Südregion Brasiliens,<br />
wo eine starke deutschsprachige Einwanderung stattfand. In den Bundesländern<br />
im Süden gibt es noch Ortschaften, in denen neben dem Portugiesischen auch ein<br />
deutscher Dialekt weiterhin gesprochen wird. Viele Schüler in diesen Kontexten<br />
bringen also zu ihrem Deutschunterricht gewisse sprachliche Vorkenntnisse mit, die<br />
zum Erlernen des Hochdeutschen beitragen könnten. Dennoch wird diese Vorkenntnis<br />
oft nicht berücksichtigt und somit im Unterricht nicht einbezogen – was vielleicht von<br />
Vorteil wäre.<br />
Mit diesem Kontext als Forschungsobjekt möchte ich in diesem Beitrag mögliche<br />
sprachpolitische sowie didaktisch-methodische Vorgänge präsentieren, die eine<br />
Transformation im DaF-Unterricht in den dargestellten Regionen schaffen könnte. Das<br />
Ziel ist es, methodische Ansätze für diesen spezifischen Kontext zu besprechen, welche<br />
die Wahrnehmung der deutschstämmigen Mundart zugunsten des Lernerfolges im<br />
Deutschunterricht einsetzen.<br />
Die Arbeit mit Literatur im Deutsch als Fremdspracheunterricht am Beispiel von<br />
„Eva Wien“, einer Hueber Lese Novela<br />
Rode, Diana Annika<br />
Technische Universität Berlin, Deutschland<br />
Für meinen Beitrag habe ich das Thema Arbeit mit Literatur im Deutsch als<br />
Fremdspracheunterricht am Beispiel von „Eva Wien“, einer Hueber Lese Novela gewählt.<br />
Lesen im Fremdspracheunterricht hat viele Funktionen. Es hat einen emotionalen<br />
und ästhetischen Wert und fördert die kommunikative Kompetenz der Studenten. So<br />
verbessert Lesen die verbalen und schriftlichen Fähigkeiten. Neben diesen sprachlichen-<br />
hat Lesen auch interkulturelle Funktionen.<br />
Literarische Texte werden im DaF-Unterricht oft eingesetzt und der Umgang mit<br />
Ihnen wird viel diskutiert. Einleitend möchte ich mich mit der Frage beschäftigen<br />
welche Vor- und Nachteile es bei der Verwendung von Literatur im DaF-Unterricht<br />
gibt, wie und mit welchen Lesestilen und -strategien mit ihr gearbeitet und wie sie als<br />
Unterrichtsergänzung eingesetzt werden kann.<br />
Anschließend möchte ich diese Aspekte an einem ganz konkreten Beispiel erläutern,<br />
nämlich anhand meiner Erfahrung im Deutschunterricht unter Einbeziehung der Hueber<br />
Lese Novela „Eva Wien“. Ich habe mich nach Absprache mit den Studenten des A1.2<br />
Niveaus für die Arbeit mit dieser Lese Novela in einem Konversationskurs entschieden.<br />
Die im theoretischen Teil angesprochenen Punkte werden also in diesem praktischen<br />
Teil wieder aufgegriffen, dargestellt und die während der Arbeit entstandenen Vorzüge<br />
und Schwierigkeiten erläutert.<br />
145
146<br />
Sektion 7 v Sección 7<br />
Skype-Konferenz der DS Guadalajara und der Maria-Montessori Schule Jena<br />
Sannemann, Mathias<br />
Deutsche Schule Guadalajara, Mexiko<br />
In Zusammenarbeit mit OIKOS und der Ganztagsschule „Maria Montessori“ Jena<br />
realisiert die DS GDL seit November 2011 ein Videokonferenzprojekt mit SuS der Klasse<br />
acht. Zu den Zielen dieses Projekts gehören:<br />
l Ausbildung von Planungskompetenzen der SuS durch Einbeziehung in Planung<br />
und Umsetzung des Projektes<br />
l Verbesserung des bewussten Lernens durch Evaluationen im Anschluss an die<br />
Videokonferenzen<br />
l Schulung von Medienkompetenz durch Einsatz neuer Medien (PC, Internet, Skype)<br />
l Interkulturelles Lernen durch für Jugendliche relevante Themenauswahl<br />
(Weihnachts- & Sylvestertraditionen in Deutschland und Mexiko, Taschengeld)<br />
l langfristiger Aufbau eines Schüleraustauschs zwischen GDL und Jena<br />
l Training von Toleranz und Empathie (sensibler Umgang mit Fehlern, Metasprache<br />
bei Missverständnissen und Unklarheiten, Diplomatie)<br />
l Stärkung der Präsentationskompetenzen durch Vorstellen von Kurzreferaten<br />
während der Videokonferenzen<br />
l Umwälzung von Wortschatz und Grammatik in authentischen mündlichen<br />
Kommunikationsanlässen<br />
l Förderung der sprachlichen Kompetenzen Hören & Sprechen (kurzfristig DaF,<br />
langfristig Spanisch als Fremdsprache (SaF)) durch hohen Sprechanteil der SuS<br />
vor, während und nach den Videokonferenzen (Lehrer = Begleiter, Moderator im<br />
Hintergrund)<br />
l Steigerung der Motivation Deutsch zu lernen, Wecken von Interesse an Deutschland,<br />
seiner Kultur, Sprache und Traditionen<br />
Frühzeitige Praktika zur Förderung der Reflexionsfähigkeit und der<br />
Lernerautonomie in der DaF-Lehrerausbildung<br />
Dr. Schneider, Maria Nilse<br />
Universidade Federal de Pelotas – UFPel, Brasilien<br />
Entsprechend dem Motto des Kongresses “Transformationen: Lateinamerikanische<br />
Germanistik im Wandel” werden im vorliegenden Beitrag Fragestellungen hinsichtlich<br />
der aktuellen Herausforderungen nach adäquaten Curricula und der mangelnden<br />
Praktikumsmöglichkeiten in der DaF-Lehrerausbildung in vielen Gemeinden Brasiliens<br />
nachgegangen. In den letzten Jahrzehnten steigt die Forderung nach Curricula, die den<br />
Bedürfnissen der spezifischen DaF-Lern- und Lehrkontexten entgegenkommen. Hier<br />
soll eine innovative Praxis in der DaF-Lehrerausbildung eines spezifischen Lehr- und<br />
Lernkontextes vorgestellt und diskutiert werden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass
Sektion 7 v Sección 7<br />
das Sprachenlehren und -lernen stark durch gesellschaftlich-politische, soziokulturelle<br />
und regionalspezifische Faktoren geprägt ist. Die spezifischen Gegebenheiten<br />
unterschiedlicher Regionen sind bei der Entwicklung der Curricula und der<br />
Fremdsprachenlehrerausbildung zu betrachten. In dieser Hinsicht ist „das Curriculum<br />
als ein ‚Ergebnis’, das sich auf interdependente Ebenen (gesellschaftlich-politische,<br />
institutionelle und fachliche)“ entsprechend der regionalen Bedürfnisse verändert<br />
(Neuner 2003:16) bzw. verändern sollte. Im Kontext der Ausbildungsforschung wird<br />
anhand der ‚Erforschung Subjektiver Theorien’ (Groeben et al. 1988) die Subjektive<br />
Sicht der DaF-Praktikanten und deren Lernenden in Bezug auf deren Erfahrungen als<br />
frühzeitige Praktikanten untersucht. Der Erkenntniswert dieser Theorien liegt daran,<br />
dass sie von einem Menschen ausgehen, ,,der über seine Umwelt nachdenkt, sie zu<br />
erklären versucht, bestrebt ist, dieses Erklärungs- und Wissenssystem funktionstüchtig<br />
[...] zu halten und dabei immer wieder den Bezug zu sich und seine Erfahrungen<br />
herstellt.“ (Kallenbach 1999:13) Zur Datenerhebung wurden Fragebogen benutzt<br />
und Besprechungen von Unterrichtsstunden der Praktikanten an einer Universität<br />
in Südbrasilien. Zusammenfassend kann man behaupten, dass frühzeitige Praktika<br />
zur Entwicklung der Reflexionsfähigkeit und der Lernerautonomie beitragen und in<br />
bestimmten Kontexten empfehlenswert sind.<br />
Proyecto Aula: una experiencia en la enseñanza del alemán como lengua<br />
extranjera.<br />
Tiburcio Barwis, Jacqueline Evelia und Soto Sánchez, Irais<br />
Universidad Veracruzana, Mexiko<br />
En el nivel de educación superior en nuestro país (México), podría afirmarse que<br />
el profesor de lenguas generalmente es un profesional formado para la docencia. Esto<br />
le proporciona el conocimiento y el desarrollo de las capacidades para tomar un papel<br />
activo en todos los momentos del proceso educativo, incluyendo la selección, adaptación<br />
y creación de sus propios recursos didácticos en el aula (Chávez y San Juan, 2004).<br />
Este trabajo de investigación se aborda desde una perspectiva didáctica que utiliza<br />
el aprendizaje basado en proyectos; ya que esta estrategia de enseñanza se enfoca<br />
en que los estudiantes toman una mayor responsabilidad en su aprendizaje y en su<br />
aplicación. Por tanto, se incluyen en el aula proyectos reales que pudieran llevar a cabo<br />
en la vida diaria.<br />
Así, inmersos en la disciplina de las lenguas extranjeras, presentamos aquí, la<br />
intervención didáctica implementada en la Experiencia Educativa Alemán Básico II de<br />
los Centros de Idiomas-Veracruz y Orizaba de la Universidad Veracruzana como parte<br />
de la nueva propuesta institucional: el proyecto aula. Dicha intervención se enfocó en<br />
observar el impacto que pudiese tener la aplicación de esta estrategia de enseñanza en<br />
el aprendizaje de los estudiantes.<br />
147
148<br />
Sektion 7 v Sección 7<br />
Dentro de los hallazgos, se observó que la estrategia tuvo una aceptación positiva<br />
por parte de los estudiantes; pero también se encontraron algunas debilidades, las<br />
cuales se analizaron para proponer las mejoras pertinentes en el diseño instruccional,<br />
cuya aplicación tendrá lugar en el semestre de invierno 2011-2012 en ambos Centros<br />
de Idiomas (Veracruz y Orizaba).<br />
In der Hochschulausbildung in unserem Land, Mexiko, könnte man behaupten,<br />
dass der Lehrer für das Unterrichten ausgebildet wird. Dieses vermittelt ihm sowohl<br />
die Kenntnis als auch die Entwicklung derjenigen Fähigkeiten, die ihn eine aktive<br />
Rolle in jedem Moment des Lernprozesses einnehmen lassen, sogar die Auswahl, die<br />
Anpassung und den Entwurf der eigenen Lehrmittel im Unterricht mit einbezogen<br />
(Chávez y San Juan, 2004).<br />
Die vorliegende Forschungsarbeit geht von einer didaktischen Sicht aus, die sich<br />
auf Projektunterricht stützt. Diese Lehrstrategie richtet sich an die Studenten, damit<br />
sie mehr Verantwortung für ihre eigenen Lernprozesse und Anwendung des Erlernten<br />
übernehmen. Deshalb werden im Unterricht auch reale Projekte durchgeführt, die so<br />
im täglichen Leben durchgeführt werden könnten.<br />
Aus dem Fremdsprachenbereich stellen wir hier die didaktische Intervention vor,<br />
die in der Grundstufe II der Sprachzentren Veracruz und Orizaba der Universität von<br />
Veracruz verwendet wird. Sie ist Teil eines Vorschlags der Institution: el proyecto Aula.<br />
Die genannte Intervention bezog sich auf die Beobachtung des Einflusses in der<br />
Anwendung dieser Unterrichtsstrategie beim Lernverhalten der Studenten.<br />
Im Rahmen der Auswertung wurde beobachtet, dass die Strategie von den Studenten<br />
positiv akzeptiert wurde. Aber es wurden auch Schwächen gefunden, die wiederum<br />
analysiert und ausgewertet wurden, um sie in die Verbesserung der Aufgabenstellung<br />
einfließen zu lassen. Die verbesserte Aufgabenstellung wird im Wintersemester 2011-<br />
2012 in beiden Sprachzentren (Orizaba und Veracruz) wieder angewendet.<br />
Verstehensprozesse beim Leseverstehen in verwandten Sprachen<br />
Wilke, Valeria<br />
Universidad Nacional de Córdoba, Argentinien<br />
An der Sprachenfakultät der Universität Córdoba, Argentinien, wird zur Zeit<br />
ein Forschungsvorhaben durchgeführt, das zum Ziel hat, Lernmaterialien für die<br />
Vermittlung des Leseverstehens in den germanischen Sprachen Englisch, Deutsch<br />
und Niederländisch für spanischsprechende Lernende zu erstellen. In Rahmen des<br />
theoretischen Hintergrunds unseres Projekts haben wir uns mit verschiedenen<br />
Fragestellungen beschäftigt, darunter auch mit den Verstehensprozessen, die beim<br />
Lesen in Mutter- und Fremdsprache stattfinden. Diese Prozesse werden in der Kognitiven<br />
Psychologie in auf- und absteigende Verstehensprozesse klassifiziert, die ersten sind<br />
daten- und die letzten wissensgeleitet. Textverstehen ist als ein Wechselspiel zwischen
Sektion 7 v Sección 7<br />
diesen zwei Arten von Prozessen zu begreifen, denn es gelingt nicht nur, wenn der Leser<br />
die sprachlichen Daten dekodiert, sondern er muss auch den unmittelbaren Kontext<br />
der sprachlichen Daten berücksichtigen und sein Weltwissen anwenden. Absteigende<br />
Prozesse laufen beim geübten Leser automatisiert ab und können reflektiert werden.<br />
Unser Ziel ist, unseren Lernern die Fertigkeit Lesen in verwandten Sprachen in der<br />
uns knappen, zur Verfügung stehenden Zeit möglichst effektiv zu vermitteln. Zwei<br />
dieser Sprachen (Deutsch und Niederländisch) sind unseren Lernern unbekannt und<br />
deshalb stellt das Training und die Bewusstmachung dieser absteigenden Prozesse<br />
einen besonders wichtigen Aspekt dar. Wir gehen also in unserem Ansatz davon aus,<br />
dass das Weltwissen eine besonders wichtige Rolle beim Leseverstehen spielt, was an<br />
den Ergebnissen in Pilotkursen für erwachsene Lerner deutlich wurde. Aber könnten<br />
die entwickelten Materialien auch für die Vermittlung von Interkomprehension bei<br />
Jugendlichen in der Schule verwendet werden? In diesem Beitrag möchte ich mich<br />
zuerst mit absteigenden Prozessen beim Leseverstehen beschäftigen und dann<br />
der Frage nachgehen, ob die entwickelten Materialien auch für die Vermittlung von<br />
Interkomprension bei Jugendlichen in den letzten Jahren der Sekundarschule mit<br />
Vorkenntnissen in Englisch und ohne Deutsch- und Niederländischkenntnisse geeignet<br />
sind. Zuletzt möchte ich Themen vorschlagen, die sich im Unterricht mit Jugendlichen<br />
interessant und motivierend auswirken könnten.<br />
Film im DaF Unterricht – Möglichkeiten und Grenzen<br />
Witte, Claus<br />
IDEAL, Instituto de Enseñanaza para el aprendizaje de Lenguas S.C.,<br />
Guadalajara, Mexiko<br />
Seit den ersten öffentlichen Filmvorführungen der Brüder Lumière Ende des<br />
19. Jahrhunderts hat sich der Film sicherlich zu DEM Kulturprodukt der modernen<br />
Gesellschaft entwickelt. Musste sich der Film anfangs noch gegen die seinerzeit<br />
etablierten Kunstformen wie Literatur und Theater durchsetzen, hat er ihnen inzwischen<br />
sicher den Rang abgelaufen. Als weltumspannendes Medium ist der Film inzwischen auch<br />
Teil des Unterrichts im Allgemeinen und des DaF-Unterrichts im Besonderen geworden.<br />
Ohne genau zu wissen, wie verschiedene Lehrkräfte den Film einsetzen, liegt doch<br />
die Vermutung nahe, dass sich die Verwendung von Film im Deutschunterricht auf das<br />
Zeigen von Filmen in deutscher Sprache und vielleicht noch anschließender Diskussion<br />
über den Inhalt des Films beschränkt. Eventuell gilt dann der je spezielle Film noch als<br />
ein „authentischer“ Ausschnitt aus der Realität in den deutschsprachigen Ländern, ihre<br />
Kultur und die Lebensweise der Menschen.<br />
In diesem Beitrag soll nun der Blick auf Film ein wenig erweitert werden.<br />
Anhand einiger Beispiele aus bereits vorhandenen und selbstentwickelten<br />
Materialien soll ein Einblick in eine Filmdidaktik für den DaF-Unterricht gegeben werden.<br />
149
150<br />
Sektion 7 v Sección 7<br />
Film als ein Medium, welches Ton und Bild verbindet, bietet aufgrund genau dieser<br />
Eigenschaft ganz spezifische Möglickhkeiten kreaktiver Arbeit mit und an sprachlichem<br />
Material, ein Potenzial, welches den Unterricht sicherlich bereichern kann. Doch soll<br />
auch gezeigt werden, welche Grenzen dem Einsatz von Filmen im Unterricht gesetzt<br />
sind. Denn Filme als Ausschnitt der Realität zu sehen und sie somit als einen Beitrag zum<br />
landeskundlichen Unterricht einzusetzen geht zu kurz und am eigentlichen Gehalt des<br />
Kunstmittels Film vorbei.
Sektion 7 v Sección 7<br />
Sektion 8<br />
Angewandte Linguistik<br />
Sektionsleitung:<br />
Prof. Peter Ecke, Ph.D.<br />
University of Arizona, USA<br />
Dr. Selma Meireles<br />
Universidade de Sao Paulo, Brasil<br />
Prof. Dr. Erwin Tschirner<br />
Universität Leipzig, Deutschland<br />
Konzept der Sektion<br />
Welche angewandt-linguistischen Fragestellungen sind besonders relevant für die<br />
Germanistik und für Deutsch als Fremdsprache in den lateinamerikanischen Ländern?<br />
Welche Fragestellungen der Korpuslinguistik, Grammatikographie, Lexikographie, und<br />
aus der linguistisch orientierten Sprachlehr- und -lernforschung vermögen, eine genuin<br />
lateinamerikanische Perspektive auf die germanistische Linguistik zu entwickeln?<br />
Wie viel und welche Art von Linguistik ist im Studium und in der Lehrerausbildung<br />
notwendig? Wie steht es um die Grammatik in Lehrwerken und anderen Lehrmaterialien.<br />
Wie könnte man sich eine zielgruppenorientierte Grammatik vorstellen? Diesen und<br />
ähnlichen Fragen möchte sich diese Linguistiksektion widmen. Willkommen sind<br />
theoretische und empirische Beiträge, die neue, aber auch bewährte Wege aufzeigen,<br />
die lateinamerikanische angewandte Linguistik auf die Herausforderungen einer<br />
Germanistik im Wandel einzustellen.<br />
151
152<br />
Montag, 05.03.2012<br />
Uhrzeit Ort<br />
Sektion 8 v Sección 8<br />
8:30-10:00 Einschreibung Paraninfo<br />
10:00-11:30 Eröffnungsveranstaltung:<br />
Juárez 975<br />
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Generalrektor (Ecke Enrique Díaz<br />
der Universität Guadalajara / Rector general de la<br />
Universidad de Guadalajara. Mtro. Pablo Arredondo<br />
Ramírez, Rektor des Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrums CUCSH / Rector del Centro Universitario<br />
de Ciencias Sociales y Humanidades. Dr. Lilia Oliver<br />
Sánchez, Leiterin der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät / Directora de la División de Estudios<br />
Históricos y Humanos. Dr. Edmund Duckwitz,<br />
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland /<br />
Embajador de la República Federal de Alemania.<br />
Dr. Alfred Längle, Botschafter der Republik Österreich<br />
/ Embajador de Austria. Dr. Gisela Schneider,<br />
Deutscher Akademischer Austauschdienst / Servicio<br />
Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Dr. Olivia<br />
C. Díaz Pérez, Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes / Presidenta de la Asociación<br />
Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
de León)<br />
11:30-12.00 Empfang des Generalrektors der Universität<br />
Guadalajara<br />
12:00-12:45 Plenarvortrag Paulo Astor Soethe:<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer<br />
international vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
12:45-13:30 Plenarvortrag Ottmar Ette: Die Literaturen der Welt aus<br />
transarealer Perspektive<br />
13:45-14:30 Abfahrt zum Tagungsort (CUCSH)<br />
14:30-16:00 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Vor dem<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
16:00-16:30 Einführung Raum 68 H**<br />
16:30-17.00 Lars Schirrmeister Regelgeleitete Genusvermittlung bei<br />
LernerInnen des Deutschen als Fremdsprache in Mexiko –<br />
eine empirische Studie<br />
Raum 68 H
Sektion 8 v Sección 8<br />
17:00-17:30 Peter Ecke Automatisierung der Wortproduktion und<br />
interkulturelles Lernen im kurzfristigen Auslandsstudium<br />
US amerikanischer DaF-Studenten in Deutschland<br />
17:30-18:00 Pause<br />
18:00-19:30 Kulturveranstaltung (Goethe-Institut): Kabaret und<br />
Musik mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll<br />
19:30 Empfang der Deutschen Botschaft<br />
Eröffnung Karikaturenausstellung Goethe-Institut<br />
Dienstag, 06.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Hermann Funk:<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?. Modelle zum<br />
Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz und ihre praktischen<br />
Konsequenzen<br />
Semiplenarvortrag Friedhelm Schmidt-Welle:<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und<br />
Alzheimer<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Raum 68 H<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
Vor dem Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
und Bibliothek<br />
Manuel Rodríguez<br />
Lapuente<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
10:15-10:45<br />
Sektionsarbeit<br />
Peter Colliander Der Gebrauch der Flexionsformen Raum 68 H<br />
10:45-11:15 José da Silva Simões Grammatikalisierungsprozesse<br />
komplexer Sätze: eine kontrastive Analyse Portugiesisch/<br />
Deutsch<br />
Raum 68 H<br />
11:45-12:15 Pause<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Erwin Tschirner:<br />
Auditorium<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Silvano Barba<br />
Semiplenarvortrag Claudia Dornbusch:<br />
Auditorium<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche Wissenschaft? Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
13:00-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der Jurafakultät<br />
(siehe<br />
Campusplan)<br />
153
14:30-15:00 Eva Maria Ferreira Glenk Funktionsverbgefüge im Deutschen<br />
und im brasilianischen Portugiesisch aus der Sicht<br />
der Konstruktionsgrammatik<br />
15:00-15:30 Marc Felfe Transitive Resultativkonstruktionen - konstruktionsgrammatisch<br />
15:30-16:00 Jutta H. Wester de Michelini Die „Arbeit des Philosophen“.<br />
Vergleichende Diskursanalyse von Buchbesprechungen der<br />
Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren „polylog“<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Neyda García Díaz Linguistisch-pragmatische Rezeption<br />
von Texten in deutscher Sprache<br />
17:00-17:30 Selma M. Meireles Syntaktische Negation und Pragmatik:<br />
eine Untersuchung in Bezug auf Prosodie und Informationsstruktur<br />
17:30-18:00 Brigitte Merzig Prosodie und Interkomprehension Germanischer<br />
Sprachen<br />
18:15-19:45 Kulturveranstaltung (Foro Cultural de Austria, BMUKK):<br />
Lesung von Tarek Eltayeb<br />
154<br />
Donnerstag, 08.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Christian Fandrych: Zum Stil<br />
deutscher wissenschaftlicher Vorträge (auch) aus<br />
kontrastiver Sicht.<br />
Semiplenarvortrag Karen Pupp Spinassé:<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht in<br />
einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45<br />
10:45-11:15<br />
11:15-11:45<br />
11:45-12:00 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
12:00-12:30<br />
12:30-13:00<br />
Sektion 8 v Sección 8<br />
Raum 68 H<br />
Raum 68 H<br />
Raum 68 H<br />
Raum 68 H<br />
Raum 68 H<br />
Raum 68 H<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium Carlos<br />
Ramírez Ladewig
Sektion 8 v Sección 8<br />
13:00-13:30<br />
13:30-14:30<br />
14:30-15:00<br />
15:00-15:30<br />
15:30-16:00<br />
Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der<br />
Jurafakultät (siehe<br />
Campusplan)<br />
16:00-16:30<br />
16:30-17:00<br />
17:00-17:30<br />
17:30-18:00<br />
Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
18:00-19:00 Abfahrt zum Paraninfo<br />
19:00 Kulturveranstaltung der Universität Guadalajara:<br />
Paraninfo<br />
Lehrstuhl „Cortázar“ (Cátedra Cortázar): Plenarvortrag Juárez 975<br />
Juan Villoro: *Te doy mi palabra. Un itinerario en la (Ecke Enrique<br />
traducción.<br />
Díaz de León)<br />
Freitag, 09.03.2012<br />
9:00-11:00 9:00-9:25 Reinhard Andress “... heiße ich daher die Auditorium<br />
Emigration gut”: der Fall des Egon Schwarz Carlos Ramírez<br />
9:25- 09:50 Egon Schwarz:<br />
Lesung auf Deutsch***<br />
Ladewig<br />
10:00- 11:00 Elisabeth Siefer: Einführung in die<br />
Übersetzung<br />
Egon Schwarz: Lesung auf Spanisch<br />
-Diskussion<br />
9:00-11:00 Documental de Juliana Fischbein:<br />
Auditorium<br />
des aparecer Exil und Erinnerung im Rahmen des Nationalsozialismus<br />
und der Diktaturen der ‘70er Jahre in<br />
Südamerika***<br />
Silvano Barba<br />
9:00-11:00 Workshop Karen Schramm: Mündliches Erzählen im<br />
Fremdsprachenunterricht<br />
61 H<br />
Workshop Dieter Jaeschke: Freundschaft, Ostalgie und weite<br />
Welt: Der Spielfilm „Friendship!“ (D 2010) im DaF-Unterricht<br />
62 H<br />
Workshop Carmen Schier: Zur Arbeit mit Hörbüchern. Ein<br />
„Grenzgänger“ wird (neu) entdeckt<br />
63 H<br />
155
9:00-10:00 Verlagspräsentation Martina Bartucz, Cornelsen Verlag:<br />
Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Verlagspräsentation Anne Robert, Hueber Verlage:<br />
Menschen<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: DaF kompakt<br />
– das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: „Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur Sprache<br />
11:00-11:30 Pause<br />
156<br />
Sektion 8 v Sección 8<br />
11:30-12:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven der Germanistik in Auditorium<br />
Lateinamerika<br />
Silvano Barba<br />
Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: Beste<br />
Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
64 H<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven Tafelbildern<br />
am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz Neu“ und<br />
„Logisch!“<br />
65 H<br />
Verlagspräsentation Christina Kuhn, Cornelsen Verlag:<br />
Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was ändert sich,<br />
was bleibt?<br />
66 H<br />
12:30-13:30 Abschlussplenum <strong>ALEG</strong> Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
13:30-15:00 Mittagessen Hof der<br />
Jurafakultät<br />
(siehe Campusplan)<br />
15:00-17:00 <strong>ALEG</strong>-Mitgliederversammlung Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
AMPAL- Mitgliederversammlung Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
20:00 Abendessen & Abschlussfeier El Callejón de<br />
los Rumberos.<br />
Chapultepec<br />
Ecke Lerdo de<br />
Tejada<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H<br />
64 H<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
** Die Tagungsräume befinden sich im 3. Stock des Gebäude H vom CUCSH.<br />
*** Teil der Sektion 2 und des Kulturprogramms; nähere Informationen im Kulturprogramm
Sektion 8 v Sección 8<br />
Beiträge in alphabetischer Reihenfolge<br />
Der Gebrauch der Flexionsformen<br />
Prof. Dr. Colliander, Peter<br />
Wirtschaftsuniversität Kopenhagen (CBS), Dänemark<br />
Das Flexionssystem der deutschen Sprache stellt den Lerner vor zwei Probleme: 1.<br />
das Erlernen der Flexionsparadigmen selbst, 2. das Erlernen des Gebrauchs der einzelnen<br />
Flexionsformen. Beim Erlernen der Paradigmen helfen gewisse Systematisierungen der<br />
zu flektierenden Lexeme sicher lich, wobei ich dem Nutzen von Systematisierungen<br />
gegenüber wie der traditionellen Klassifizi e rung der stark konjugierten Verben nach<br />
diachron begründeten Ablautreihen aller dings eher skep tisch bin. Im Beitrag werde<br />
ich mich hauptsächlich mit dem Gebrauch der Flexionsformen be schäf ti gen, wobei<br />
ich eine linguistisch fundierte Didaktisierung des Bereichs anstrebe. Die Mor phosyntax<br />
war immer ein Kernstück bei der Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache, und<br />
sie ist – vielleicht eben deswegen? – von zum Teil hartnäckigen Traditionen geprägt,<br />
von denen ich einige konstruktiv-kritisch unter die Lupe nehmen möchte. Ein Teil dieser<br />
Traditionen hält einer näheren linguistischen Prüfung einfach nicht stand; als Beispiel<br />
sei die in den allermeisten Lehrwerken und Grammatiken zu findende Aussage, das<br />
Finitum und das Subjekt würden in Person und Numerus kongruieren, angeführt. Allein<br />
aus dem Grund, dass die deutschen Substantive, die ja typische Sub jekt ausdrücke sind,<br />
nur in Numerus, aber nicht in Person flektieren, ist die Annahme der Kon gru enz relation<br />
inkonsistent.<br />
Grammatikalisierungsprozesse komplexer Sätze:<br />
eine kontrastive Analyse Portugiesisch/Deutsch<br />
Dr. Da Silva Simões, José<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien<br />
Studien über die Grammatikalisierung von Diskursmarkern im Deutschen<br />
(GÜNTHNER 1999, 2000, 2001, 2005 e 2005) und über den Kontrast zwischen diesen<br />
Elementen im brasilianischen Portugiesischen und im Deutschen (SIMÕES 2008, 2009a<br />
e 2009b) zeigen, dass man feststellen kann, dass diese Phänomene in den Domänen<br />
der Syntax, der Semantik und des Diskurses unterschiedliche Aufgaben leisten.<br />
Dazu kann man noch anhand einiger Evidenzen ähnliche Grammatikalisierung- und<br />
Pragmatikalisierungssprozesse in beiden Sprachen beschreiben. Diese Arbeit versucht<br />
eine theoretische Diskussion über den Begriff Pragmatikalisierung darzustellen und<br />
nimmt als Untersuchungsobjekte die Diskursmarker weil, obwohl, wobei aus dem<br />
Deutschen und porque, apesar de que, se bem que aus dem Portugiesischen als<br />
Grundlagen für die Diskussion über Gramatikalisierungsprozesse komplexer Sätze in<br />
beiden Sprachen. Der Vortrag ist folgendermassen gegliedert: (1) Diskussion über die<br />
157
158<br />
Sektion 8 v Sección 8<br />
Definition von Diskursmarkern; (2) Überblick der aktuellen Forschung über Diskursmarker<br />
im Hinblick auf die Theorie der Grammatikalisierung; (3) Diskussion über das Konzept der<br />
Pragmatikalisierung; und letztendlich (4) Analyse einiger Okkurenzen von Diskursmarkern<br />
in beiden Sprachen. Ziel dieses Vortrages ist es, Grammatikalisierungsprozesse<br />
nicht nur der Diskursmarker (Deutsch-Portugiesisch), sondern auch den Prozess der<br />
Degrammatikalisierung von Konjunktionalpartikeln zu verdeutlichen, um weitere<br />
Prozesse der Grammatikalisierung wie die Syntaktisierung, die Semantisierung und die<br />
Diskursivierung/Pragmatikalisierung der hipotatischen Konstruktionen im Deutschen<br />
und im brasilianischen Portugiesischen beschreiben zu können.<br />
Linguistisch-pragmatische Rezeption von Texten in deutscher Sprache<br />
Dr. Díaz García, Neyda<br />
Universität Havanna, Kuba<br />
Der vorliegende Beitrag hat das Ziel, einen methodologischen Ansatz (Textanalyse)<br />
vorzuschlagen, der kubanischen Germanistikstudierenden ein tieferes Verstehen<br />
deutschsprachiger Texte ermöglichen soll. Darüber hinaus soll die konzipierte<br />
Textanalyse das Interpretieren von Texten – im Rahmen bestimmter Textsorten – auf ein<br />
höheres Niveau bringen, was zur späteren Übersetzung ähnlicher Texte beitragen kann.<br />
Automatisierung der Wortproduktion und interkulturelles Lernen im<br />
kurzfristigen Auslandsstudium US amerikanischer DaF-Studenten in<br />
Deutschland<br />
Prof. Ecke, Peter Ph.D.<br />
University of Arizona, USA<br />
Wie viel können Lernende von Deutsch als Fremdsprache in einem kurzfristigen<br />
Auslandsstudienaufenthalt in sprachlicher und kultureller Hinsicht lernen? Früheren<br />
Untersuchungen zufolge zeigen sich Lernfortschritte in Auslandsstudienaufenthalten<br />
am ehesten in den Bereichen des Wortschatzerwerbs, der Entwicklung des<br />
Hörverstehens und des Lernens über die Zielkultur. In diesem Beitrag untersuchen<br />
wir Lernfortschritte, die amerikanische DaF-Studenten der Universitätsstufe im Laufe<br />
eines einmonatigen Studienaufenthalts in Deutschland erzielten. Von Interesse<br />
waren zwei spezifische Bereiche der Kompetenzentwicklung: (1) die Aktivierung<br />
und Automatisierung des produktiven Wortschatzes und (2) die Entwicklung<br />
interkultureller Kompetenz. An der Teiluntersuchung zur Wortproduktion nahmen 27<br />
Studenten teil. In einer Voruntersuchung am Anfang des Auslandsstudienaufenthalts<br />
und einer Nachuntersuchung am Ende des Studienprogramms erhielten die<br />
Untersuchungsteilnehmer verschiedene Aufgaben zur Wortproduktion, die sie unter<br />
Zeitdruck bewältigen mussten. In einer Testphase mussten die Teilnehmer innerhalb<br />
jeweils einer Minute so viele Wörter wie möglich mit bestimmten Anfangsbuchstaben
Sektion 8 v Sección 8<br />
produzieren. In einer weiteren Testphase mussten sie wiederum innerhalb jeweils einer<br />
Minute Wörter produzieren, die zu bestimmten semantischen Kategorien gehörten. An<br />
der Untersuchung zu Aspekten des interkulturellen Lernens nahmen 55 Studenten teil.<br />
Sie erhielten in einer Vor- und einer Nachuntersuchung am Anfang und am Ende des<br />
Studienprogramms Fragebögen, in denen sie ihren Lernzuwachs, ihre Einstellungen<br />
gegenüber der eigenen Kultur und „gegenüber den Deutschen“ sowie ihre Disposition<br />
zum interkulturellen Lernen einschätzten sollten. Die Ergebnisse der Vor- und<br />
Nachuntersuchungen wurden verglichen, um Rückschlüsse über Lernzuwachs und<br />
Persönlichkeitsentwicklung ziehen zu können. Vorläufige Analysen legen nahe, dass<br />
sich der kurzfristige Studienaufenthalt signifikant sowohl auf die Automatisierung der<br />
Wortproduktion wie auch auf das interkulturelle Lernen ausgewirkt hat.<br />
Transitive Resultativkonstruktionen - konstruktionsgrammatisch<br />
Felfe, Marc<br />
Universidad Nacional de Córdoba/DAAD, Argentinien<br />
Resultativkonstruktionen gehören nicht nur aus kontrastiver Sicht mit zu den<br />
spannendsten Phänomenen der deutschen Grammatik. Auch die Grammatiktheorien<br />
beißen sich die Zähne an ihnen aus - u. a. mit dem Resultat, dass sie in DaF-Lehrwerken<br />
unter den Tisch fallen und in der Produktion von DaF-Lernern kaum vorkommen.<br />
Die Konstruktionsgrammatik bietet ein verlockendes Analyseformat. Grob gesagt<br />
wird die Argumentstruktur vom Verb abstrahiert: [Nominativ Akkusativ Adjektiv]<br />
und steht mit der Bedeutung [Jemand tut etwas, was dazu führt, dass etwas so wird]<br />
zum produktiven Gebrauch zur Verfügung. Während Goldberg & Jackendoff (2004)<br />
für ein Netz verwandter abstrakter Konstruktionen argumentieren, plädiert Boas<br />
(2003, 2011) für verbspezifische Minikonstruktionen als Instanzen jener abstrakten<br />
Schablonen. Die zentralen Fragen lassen sich zugespitzt folgendermaßen formulieren:<br />
Wie viel Valenztheorie braucht die Konstruktionsgrammatik - oder umgekehrt? Wie viel<br />
„Konstruktion“ braucht die Rezeption aus Perspektive des DaF-Lerners und wie viel<br />
Verbspezifik die Produktion? Oder: Wie groß ist die Angst vor Übergeneralisierungen?<br />
In Bezug auf transitive Resultativkonstruktionen werde ich vorschlagen, zwei<br />
weitere Ebenen anzusetzen: einerseits Mesokonstruktionen mit konkreten Verben bzw.<br />
Verbgruppen und/oder APs als lexikalische Bestandteile und andererseits schematische<br />
Konstruktionen, welche jedoch über spezifische Implikaturen wie die Folgebeziehung<br />
zwischen dem Gebrauch eines Instrumentes und dessen Abnutzung spezifiziert werden.<br />
Boas, Hans C. (2011): „Zum Abstraktionsgrad von Resultativkonstruktionen.“<br />
In: Engelberg, Stefan/ Holler, Anke/ Proost, Kristel (eds.) (2011): Sprachliches Wissen<br />
zwischen Lexikon und Grammatik. Berlin, Boston: de Gruyter, S. 37-70.<br />
Boas, Hans C. (2003): A constructional approach to resultatives. Stanford: CSLI<br />
Publications.<br />
159
160<br />
Sektion 8 v Sección 8<br />
Goldberg, Adele E./ Jackendoff, Ray (2004): „The English Resultative as a Family of<br />
Constructions.“ In: Language 80.3, S. 532-568.<br />
Welke, Klaus (2009): „Konstruktionsvererbung, Valenzvererbung und die Reichweite<br />
von Konstruktionen.“ In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik (ZGL) 37, S. 514-543.<br />
Funktionsverbgefüge im Deutschen und im<br />
brasilianischen Portugiesisch aus der Sicht der<br />
Konstruktionsgrammatik<br />
Dr. Glenk, Eva Maria Ferreira<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien<br />
Traditionelle Grammatiken machen einen klaren Unterschied zwischen Lexik<br />
und Grammatik. Die Konstruktionsgrammatik jedoch geht davon aus, dass es sich<br />
bei Lexik und Grammatik um Konstruktionen handelt, die in einem Kontinuum vom<br />
Einfachen zum Komplexen und vom Konkreten zum Abstrakten alle sprachlichen<br />
Phänomene erfassen. Lexik und Grammatik werden hier verstanden als Inventar<br />
sprachlicher Zeichen, das heißt, konventionalisierter Paare von Form und Bedeutung.<br />
Die Goldbergsche Analyse von Argumentstrukturen (Goldberg 1995) hat gezeigt, dass<br />
diese Konstruktionen eine Eigenbedeutung aufweisen, die sie in die Instantiation des<br />
sprachlichen Ausdrucks gemeinsam mit der Bedeutung des Verbs einbringen. Nicht<br />
jedes Verb kann jedoch mit jeder beliebigen Argumentstruktur kombiniert werden.<br />
Das semantische Verhältnis zwischen der Bedeutung einer Argumentstruktur<br />
und der Bedeutung eines Verbs wird durch die R-Relationen beschrieben, bei<br />
denen es sich, wie Stefanowitsch (2008:247) zeigen konnte, nicht so sehr um<br />
kategorische Beschränkungen, sondern eher um statistische Präferenzen handelt,<br />
die in unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich gewichtet sein können. Ziel dieser<br />
Arbeit ist es, Funktionsverbgefüge im Deutschen und im brasilianischen Portugiesisch<br />
auf ihre R-Relationen hin zu untersuchen.<br />
Syntaktische Negation und Pragmatik: eine Untersuchung in Bezug auf<br />
Prosodie und Informationsstruktur<br />
Dr. Meireles, Selma M.<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien<br />
Wie man der einschlägigen Literatur entnehmen kann, bietet sich die syntaktische<br />
Negation im Deutschen als komplexer Untersuchungsgegenstand an. Ihre konkrete<br />
Realisierung in Gesprächssituationen beweist sich als Schnittstelle zwischen Satz und<br />
Text, Syntax und Pragmatik, und bringt damit außer syntaktischen und semantischen<br />
Erwägungen auch andere Faktoren ins Spiel. Eine kleine Untersuchung anhand<br />
authentischer Gespräche und in Anlehnung an die Arbeiten von Büring (1997, 2005) und<br />
Blühdorn (2010) zeigte, dass das Zusammenspiel von Prosodie und Informationsstruktur
Sektion 8 v Sección 8<br />
in Äußerungen mit syntaktischer Negation pragmatische Effekte hervorbringt, die zu<br />
bestimmten prosodischen Mustern assoziiert werden können. In diesem Vortrag wird<br />
über die Hauptergebnisse dieser Studie berichtet.<br />
Bibliografische Hinweise:<br />
Büring, Daniel. Intonation und Informationsstruktur. In: Blühdorn, H.; Breindl, E. &<br />
Waßner, U.H. (Hrg.) Text-Verstehen. Grammatik und darüber hinaus. Berlin/New York:<br />
de Gruyter. 2006. 144-163.<br />
Blühdorn, Hardarik. Negation im Deutschen: Syntax, Prosodie, Semantik. Tübingen:<br />
Narr 2010.<br />
Prosodie Und Interkomprehension<br />
Germanischer Sprachen<br />
Merzig, Brigitte<br />
Universidad Nacional de Córdoba, Argentinien<br />
Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Forschungsprojekts “Intercomprensión en<br />
lenguas germánicas, diseño curricular y de materiales para la enseñanza simultánea de<br />
lenguas germánicas a hispanohablantes”, welches seit 2008 an der Sprachenfakultät der<br />
Universidad Nacional de Córdoba läuft.<br />
Über die Phonethik wurde versucht, Dekodifizierungshilfen für die Sprachentrilogie<br />
Englisch, Deutsch und Niederländisch aufzuzeigen, unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Ausgangssprache Spanisch. Phonetisch-phonologische Ähnlichkeiten und<br />
Unterschiede wurden analysiert (López Barrios et al. 2009) und die phonetischen<br />
Realisierungen wurden mit deren graphemischen Repräsentationen in Beziehung<br />
gestellt (Brigitte Merzig, 2010). Innerhalb der Beziehung zwischen Interkomprehension<br />
und Phonetik beschäftigt sich diese Arbeit mit der Prosodie. Die Suprasegmentalik ist<br />
Träger einer breitgefächerten Informationspalette, welche über die des geschriebenen<br />
Textes hinausgeht (Stock 1999, Löffler 1994). García Jurado /Arenas (2005:153) zeigen<br />
auf, dass der Hörer eine intuitive Fähigkeit besitzt, Grenzen innerhalb eines Redeflusses<br />
auszumachen, welche ihm Information zur semantischen und syntaktischen Struktur<br />
der Botschaft geben. Dadurch kann er bestimmen, wo eine Einheit endet und die<br />
nächste beginnt. Sowohl Pausen als auch Endphasenmelodie sind Merkmale, die, wie<br />
wir sehen werden, das Spanische mit den hier berücksichtigten germanischen Sprachen<br />
gemeinsam haben. Sie können so als Dekodifikationswerkzeug ohne besonderes<br />
vorausgehendes Training angewendet werden.<br />
Das innerhalb des Projekts entwickelte Lernmaterial beinhaltet die Audiodateien<br />
der schriftlichen Texte. Es soll an Beispielen aus diesem Material aufgezeigt werden,<br />
wie die Wahrnehmung der hier behandelten prosodischen Merkmale zu einer besseren<br />
Identifikation der Sinneinheiten beitragen kann, was bei der Dekodifikation der Texte<br />
hilfreich sein könnte.<br />
161
162<br />
Sektion 8 v Sección 8<br />
Regelgeleitete Genusvermittlung bei LernerInnen des Deutschen als<br />
Fremdsprache in Mexiko – eine empirische Studie<br />
Schirrmeister, Lars<br />
Hochschule Magdeburg-Stendal, Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland<br />
Für Lernende des Deutschen als Fremdsprache stellt der Erwerb des deutschen<br />
Genus häufig einen Teilbereich dar, der mit erheblichen Lernschwierigkeiten<br />
verbunden ist. Seit den 1980er Jahren wird anhand deskriptiven Untersuchungen<br />
darauf hingewiesen, dass die Genuszuweisung im Deutschen keineswegs völlig<br />
arbiträr ist, sondern auf Grundlage nachweisbarer Prinzipien erfolgt, woraufhin für<br />
den DaF-Bereich Mitte der 1990er Jahre grundlegende Tendenzregeln hinsichtlich der<br />
Vermittlung des Genus zusammengestellt wurden. Trotzdem haben diese Erkenntnisse<br />
bislang keinen nennenswerten Einzug in entsprechende DaF-Lehrmaterialien gehalten.<br />
Aus aktuelleren Untersuchungen geht hervor, dass LernerInnen auch ohne explizite<br />
Regelinstruktion regelhaftes Wissen zur Genuszuweisung aus dem Input extrahieren,<br />
welches teilweise starke Übereinstimmungen mit den vorgeschlagenen Genusregeln<br />
aufweist. In mehreren Studien wird dafür plädiert, die Genusvermittlung im DaF-<br />
Unterricht mit expliziter Instruktion durch Regeln zu unterstützen. Bislang sind jedoch<br />
Studien zum Effekt der Vermittlung von Genusregeln deutlich unterrepräsentiert. Von<br />
April bis Juni 2011 wurde am CELE der UNAM eine empirische Pilotstudie durchgeführt,<br />
in der versucht wurde, mögliche Erfolge einer regelgesteuerten Genusvermittlung<br />
nachzuweisen. Das Projekt bestand (1) aus der schrittweisen, expliziten Vermittlung<br />
der Genusregeln in 2 Testgruppen im Verlauf des Semesters. Daraufhin wurde (2) am<br />
Ende des Semesters eine Querschnittsstudie in Form eines kombinierten Kunst- und<br />
Realwörtertests durchgeführt, wobei untersucht werden sollte, ob den Lernenden die<br />
vermittelten Regeln als deklaratives Wissen zur Verfügung stehen und ob Lernerfolge<br />
von 2 Test- gegenüber 2 Kontrollgruppen messbar sind. Erste Ergebnisse legen nahe,<br />
dass die Vermittlung von Genusregeln zu messbaren Lernerfolgen führte.<br />
Die „Arbeit des Philosophen“. Vergleichende Diskursanalyse von<br />
Buchbesprechungen der Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren<br />
„polylog“<br />
Wester de Michelini, Jutta H.<br />
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentinien<br />
Der Beitrag stellt ein Forschungsprojekt vor, das sich noch in seinem Anfangsstadium<br />
befindet und zusammen mit Philosophiestudenten der Nationalen Universität von Río<br />
Cuarto durchgeführt wird, die deutsche Lesekurse als Wahlfach belegt haben. Das<br />
Projekt geht der Frage nach, ob in philosophischen Texten, deren Ursprungssprachen<br />
Deutsch, Spanisch und Englisch sind und deren Autoren aus vielen verschiedenen<br />
Ländern der Welt stammen, Besonderheiten festgestellt werden können, die
Sektion 8 v Sección 8<br />
Rückschlüsse auf kulturelle Unterschiede erlauben. Die Studie möchte einerseits einen<br />
Beitrag leisten zu einer kritischen Diskursanalyse philosophischer Diskurse, denen<br />
vonseiten der Textwissenschaftler bisher nur geringe Aufmerksamkeit gewidmet<br />
wurde, und bezieht dabei den Aspekt der Interkulturalität in die Diskursanalyse mit<br />
ein. Das Forschungsprojekt hat außerdem das didaktische Ziel, die interkulturelle<br />
kommunikative Kompetenz der Studenten zu verbessern.<br />
Der Korpus beschränkt sich auf die Buchbesprechungen, die „polylog. Zeitschrift<br />
für interkulturelles Philosophieren” zwischen den Jahren 2000 und 2006 online<br />
veröffentlicht hat. Als mögliche Diskursmarkierer, die Schlüsse auf kulturelle<br />
Unterschiede zwischen den philosophischen Diskursen erlauben sollen, werden vor<br />
allem die Verben klassifiziert und miteinander verglichen, die unmittelbar der „Arbeit<br />
des Philosophen“ und den Leistungen ihrer Theorien Ausdruck geben. Von dieser<br />
zunächst diskursanalytischen Perspektive aus sollen die Studenten semantische<br />
Wortfelder erschließen, Kenntnisse gewinnen bezüglich der akademischen Textsorte<br />
„Rezension“, sich spezifische Lesestrategien aneignen und insgesamt ihre interkulturelle<br />
kommunikative Kompetenz erweitern.<br />
163
Sektion 9<br />
Die deutsche Sprache aus lateinamerikanischer Sicht<br />
164<br />
Sektionsleitung:<br />
Prof. Dr. Christian Fandrych<br />
Universität Leipzig, Deutschland<br />
Dr. Adriana R. Galván<br />
Universid de Guadalajara, México<br />
Konzept der Sektion<br />
Willkommen sind alle Beiträge, die sich mit der deutschen Grammatik, Semantik,<br />
Pragmatik, Textlinguistik und mit deutschen Diskurstraditionen in vergleichender<br />
Perspektive auseinandersetzen, sowie Beiträge, die linguistische Modelle und Ansätze<br />
darstellen, die sich besonders für einen Sprachvergleich / für die Beschreibung des<br />
Deutschen aus lateinamerikanischer Sicht eignen. Insbesondere willkommen sind<br />
Beiträge, deren Ergebnisse wichtig für die höheren Sprachniveaus von B2 bis C2 sind,<br />
zum Beispiel für das Deutsche als Wissenschaftssprache für Studierende, die ein (Teil-)<br />
Studium in Deutschland absolvieren wollen, oder für Fachkräfte im Beruf, die mündlich<br />
und/oder schriftlich höchsten Ansprüchen genügen müssen.
Sektion 9 v Sección 9<br />
Montag, 05.03.2012<br />
Uhrzeit Ort<br />
8:30-10:00 Einschreibung Paraninfo<br />
10:00-11:30 Eröffnungsveranstaltung:<br />
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Generalrektor Juárez 975<br />
der Universität Guadalajara / Rector general de la<br />
(Ecke Enrique<br />
Universidad de Guadalajara. Mtro. Pablo Arredondo<br />
Ramírez, Rektor des Geisteswissenschaftlichen Zentrums<br />
CUCSH / Rector del Centro Universitario de Ciencias<br />
Sociales y Humanidades. Dr. Lilia Oliver Sánchez,<br />
Leiterin der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät / Directora de la División de Estudios Históricos<br />
y Humanos. Dr. Edmund Duckwitz, Botschafter<br />
der Bundesrepublik Deutschland / Embajador de la<br />
República Federal de Alemania.<br />
Dr. Alfred Längle, Botschafter der Republik Österreich /<br />
Embajador de Austria. Dr. Gisela Schneider, Deutscher<br />
Akademischer Austauschdienst / Servicio Alemán<br />
de Intercambio Académico (DAAD). Dr. Olivia C.<br />
Díaz Pérez, Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes / Presidenta de la Asociación<br />
Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
Díaz de León)<br />
11:30-12.00 Empfang des Generalrektors der Universität Guadalajara<br />
12:00-12:45 Plenarvortrag Paulo Astor Soethe:<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer<br />
international vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
12:45-13:30 Plenarvortrag Ottmar Ette: Die Literaturen der Welt aus<br />
transarealer Perspektive<br />
13:45-14:30 Abfahrt zum Tagungsort (CUCSH)<br />
14:30-16:00 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Vor dem<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
16:00-16:30 Ulrike Agathe Schröder Metaphorische Szenarien im CAAI Ergeschoss<br />
brasilianischen und deutschen Diskurs über ̦Gesellschaft, Gebäude H<br />
16:30-17.00 Pamela Esmeralda Padilla Martínez Eine kontrastive<br />
Beschreibung der Verortung des Fokus im Spanischen und<br />
Deutschen<br />
CAAI<br />
165
17:00-17:30 Anne Biedermann ¿Frases terremoteadas? Syntaktische<br />
Strukturen und ihre Funktionen in Heinrich von Kleists „Das<br />
Erdbeben in Chili“<br />
17:30-18:00 Pause<br />
18:00-19:30 Kulturveranstaltung (Goethe-Institut): Kabaret und Musik<br />
mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll<br />
19:30 Empfang der Deutschen Botschaft<br />
Eröffnung Karikaturenausstellung Goethe-Institut<br />
166<br />
Dienstag, 06.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Hermann Funk:<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?. Modelle zum<br />
Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz und ihre<br />
praktischen Konsequenzen<br />
Semiplenarvortrag Friedhelm Schmidt-Welle:<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und<br />
Alzheimer<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Brigitte Handwerker Warum ‚der Krug zerbricht‘ und ‚die<br />
Tür sich öffnet‘. – Konstruktionen mit alternierenden Verben<br />
und die Konzeptualisierung eines Ereignisses<br />
10:45-11:15 Rainer Bäuerle Das deutsche Perfekt und seine<br />
Verwandten<br />
11:15-11:45 Tinka Reichmann Hochschulterminologie deutschportugiesisch<br />
11:45-12:15 Pause<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Erwin Tschirner:<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Sektion 9 v Sección 9<br />
CAAI<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
Vor dem<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
und Bibliothek<br />
Manuel<br />
Rodríguez<br />
Lapuente<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
CAAI<br />
CAAI<br />
CAAI<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba
Sektion 9 v Sección 9<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Claudia Dornbusch:<br />
Auditorium<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche Wissenschaft? Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
13:00-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der<br />
Jurafakultät<br />
(siehe<br />
Campusplan)<br />
14:30-15:00 Lissette Mächler Erwerb des wissenschaftlichen<br />
Schreibens in der Fremdsprache Deutsch – Die Ausdrücke<br />
der „Alltäglichen Wissenschaftssprache“<br />
CAAI<br />
15:00-15:30 Christian Koch Unser Stil ist der bessere – Über<br />
Wahrnehmung und Vermittlung des deutschen<br />
Wissenschaftsstils in Lateinamerika<br />
CAAI<br />
15:30-16:00 Hans-Joachim Althaus Warum C1 keine Lösung ist! –<br />
Sprachniveaus und sprachliche Anforderungen im Studium<br />
an Hochschulen in Deutschland<br />
CAAI<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00<br />
17:00-17:30<br />
17:30-18:00<br />
18:15-19:45 Kulturveranstaltung (Foro Cultural de Austria, BMUKK):<br />
Lesung von Tarek Eltayeb<br />
Donnerstag, 08.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Christian Fandrych: Zum Stil<br />
deutscher wissenschaftlicher Vorträge (auch) aus<br />
kontrastiver Sicht.<br />
Semiplenarvortrag Karen Pupp Spinassé:<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht in<br />
einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45<br />
10:45-11:15<br />
11:15-11:45<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
167
168<br />
Sektion 9 v Sección 9<br />
11:45-12:00<br />
12:00-12:30<br />
12:30-13:00<br />
13:00-13:30<br />
Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
13:30-14:30<br />
14:30-15:00<br />
15:00-15:30<br />
15:30-16:00<br />
Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der<br />
Jurafakultät<br />
(siehe<br />
Campusplan)<br />
16:00-16:30<br />
16:30-17:00<br />
17:00-17:30<br />
17:30-18:00<br />
Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
18:00-19:00 Abfahrt zum Paraninfo<br />
19:00 Kulturveranstaltung der Universität Guadalajara:<br />
Paraninfo<br />
Lehrstuhl „Cortázar“ (Cátedra Cortázar): Plenarvortrag Juárez 975<br />
Juan Villoro: *Te doy mi palabra. Un itinerario en la (Ecke Enrique<br />
traducción.<br />
Díaz de León)<br />
Freitag, 09.03.2012<br />
9:00-11:00 9:00-9:25 Reinhard Andress “... heiße ich daher<br />
die Emigration gut”: der Fall des Egon<br />
Schwarz<br />
9:25- 09:50 Egon Schwarz:<br />
Lesung auf Deutsch***<br />
10:00 – 11:00 Elisabeth Siefer: Einführung in die<br />
Übersetzung<br />
Egon Schwarz: Lesung auf Spanisch<br />
-Diskussion<br />
9:00-11:00 Documental de Juliana Fischbein:<br />
des aparecer Exil und Erinnerung im Rahmen des<br />
Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er Jahre in<br />
Südamerika***<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba
Sektion 9 v Sección 9<br />
9:00-11:00 Workshop Karen Schramm: Mündliches Erzählen im<br />
Fremdsprachenunterricht<br />
Workshop Dieter Jaeschke: Freundschaft, Ostalgie und<br />
weite Welt: Der Spielfilm „Friendship!“ (D 2010) im DaF-<br />
Unterricht<br />
Workshop Carmen Schier: Zur Arbeit mit Hörbüchern. Ein<br />
„Grenzgänger“ wird (neu) entdeckt<br />
9:00-10:00 Verlagspräsentation Martina Bartucz, Cornelsen Verlag:<br />
Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Verlagspräsentation Anne Robert, Hueber Verlage:<br />
Menschen<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: DaF<br />
kompakt – das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: „Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur Sprache<br />
11:00-11:30 Pause<br />
11:30-12:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven der Germanistik in Auditorium<br />
Lateinamerika<br />
Silvano Barba<br />
Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: Beste<br />
Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
64 H<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven<br />
Tafelbildern am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz Neu“<br />
und „Logisch!“<br />
65 H<br />
Verlagspräsentation Christina Kuhn, Cornelsen Verlag:<br />
Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was ändert sich,<br />
was bleibt?<br />
66 H<br />
12:30-13:30 Abschlussplenum <strong>ALEG</strong> Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
13:30-15:00 Mittagessen Hof der<br />
Jurafakultät<br />
(siehe<br />
Campusplan)<br />
15:00-17:00 <strong>ALEG</strong>-Mitgliederversammlung Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
17:15-19:15 AMPAL- Mitgliederversammlung Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
61 H<br />
62 H<br />
63 H<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H<br />
64 H<br />
169
170<br />
Sektion 9 v Sección 9<br />
20:00 Abendessen & Abschlussfeier El Callejón de<br />
los Rumberos.<br />
Chapultepec<br />
Ecke Lerdo de<br />
Tejada<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
** Die Tagungsräume befinden sich im 3. Stock des Gebäude H vom CUCSH.<br />
*** Teil der Sektion 2 und des Kulturprogramms; nähere Informationen im Kulturprogramm<br />
Beiträge in alphabetischer Reihenfolge<br />
Warum C1 keine Lösung ist! – Sprachniveaus und sprachliche Anforderungen im<br />
Studium an Hochschulen in Deutschland.<br />
Dr. Althaus, Hans-Joachim<br />
TestDaF-Institut Bochum, Deutschland<br />
Mit der Verbreitung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen<br />
(GER) hat sich die Vorstellung durchgesetzt, das GER-Niveau C1 müsse erreicht sein, um<br />
zum Studium zugelassen zu werden. Eine Festlegung dieser Art gibt es weder in den<br />
gültigen Zulassungsordnungen, noch lassen sich empirische Befunde nennen, die eine<br />
solche Niveaufestlegung begründen. Prüfungen zum Nachweis der Deutschkenntnisse<br />
für die Hochschulzulassung bewegen sich national wie international irgendwo zwischen<br />
B1/B2 und C1/C2. Die Unklarheit, welche Sprachzulassungsprüfung und welche<br />
Aufnahmeentscheidung von Hochschulen auf welcher Kompetenzstufe getroffen<br />
wurde, korrespondiert mit der Unklarheit „wie viel Deutsch“ für ein Studium überhaupt<br />
erforderlich ist. Auch hier mangelt es durchaus an wissenschaftlichen Nachweisen. Zu<br />
fragen ist, welche Sprachniveaus bei Studienbeginn in welchen Fächern und für welche<br />
Zwecke erforderlich sind. Anhand der Zulassungspraxis deutscher Hochschulen, einer<br />
Analyse der gängigen Sprachprüfungen und Untersuchungen des TestDaF-Instituts<br />
zu aktuellen sprachlichen Anforderungen für ein Studium werden Vorschläge für<br />
Sprachniveaus und Sprachprüfungen gemacht.<br />
Das deutsche Perfekt und seine Verwandten<br />
Prof. Bäuerle, Rainer<br />
Universität Stuttgart, Deutschland<br />
Das Plusquamperfekt scheint sprachübergreifend recht homogen zu funktionieren,<br />
während sich beim Perfekt große Unterschiede zeigen: das Spanische ähnelt hier<br />
dem Englischen, das Deutsche teilt die Möglichkeit der Verwendung eines Adverbs<br />
wie ‚gestern’ mit dem Französischen, die zukunftsbezogene Verwendung mit dem<br />
Schwedischen. Die beliebte Gleichung Perfekttempora = Tempus (Präsens, Präteritum)
Sektion 9 v Sección 9<br />
+ ‚Aspekt’ (Perfekt) kann also nicht generell aufgehen, sondern nur in der Sprache, die<br />
dem Perfekt kaum Restriktionen auferlegt, also dem Deutschen.<br />
Für die im Deutschen beliebte kompositionelle Analyse werden nun aber<br />
gemeinhin Entitäten angenommen wie der Nachzustand (Klein 2000, Musan 2002)<br />
oder das Perfektintervall (Rothstein 2008). Beide haben aber keinerlei unabhängigen<br />
semantischen Gehalt und damit auch keine erklärende Kraft.<br />
Ich werde eine dem Plusquamperfekt analoge Vorzeitigkeitssemantik für das Perfekt<br />
vorstellen, nach der das Deutsche letztlich zwei Vergangenheitstempora hat (Präteritum,<br />
Perfekt), wovon eines (z.B. Präteritum im Süddeutschen) als verzichtbar angesehen<br />
werden kann. Die im Hochdeutschen grammatikalisierten Bedeutungsunterschiede<br />
werden dann sekundär aus einer unterschiedlichen Ereignisperspektivierung abgeleitet.<br />
Ein Ausblick gilt dann den eher nicht-kompositionellen Formen des Perfekt in<br />
anderen Sprachen.<br />
Klein, Wolfgang (2000), „An Analysis of the German Perfekt“, Language 76(2), 358 - 382.<br />
Musan, Renate (2002), The German Perfect, Dordrecht: Kluwer.<br />
Rothstein, Björn (2008), The Perfect Time Span [= Linguistik aktuell 125], Amsterdam:<br />
John Benjamins.<br />
¿Frases terremoteadas? Syntaktische Strukturen und ihre Funktionen in<br />
Heinrich von Kleists „Das Erdbeben in Chili“<br />
Biedermann, Anne<br />
DAAD/Universidad de Concepción, Chile<br />
Heinrich von Kleist wird immer wieder – und besonders im Kleistjahr 2011 – als genialer<br />
Erzähler gefeiert. Im Vordergrund stehen dabei überwiegend literaturwissenschaftliche<br />
Kategorien wie Figuren- und Konfliktkonstellation. In Bezug auf Kleists Sprache<br />
auftretende Aussagen wie „Schachtelsätze“ und „lange Sätze“ gründen sich nicht<br />
auf syntaktische Analysen, sondern auf einen subjektiv empfundenen Eindruck.<br />
Zum Anlass des 200. Todestages Kleists bringen auch viele lateinamerikanische Bühnen<br />
Dramen und dramatisierte Erzählungen auf die Bühne. Die Kleistsche Originalsprache<br />
kommt dabei in den Übersetzungen und Vereinfachungen kaum zur Geltung. Selbst<br />
für sehr fortgeschrittene Deutschlerner aus dem spanischsprachigen Raum stellt das<br />
Verständnis der Kleistschen Sprache eine besonders anspruchsvolle Herausforderung<br />
dar, was einerseits in der historischen Distanz, andrerseits in der vielschichtigen<br />
Komplexität des Satzbaus begründet liegt.<br />
An der Erzählung „Das Erdbeben in Chili“ wird beispielhaft eine syntaktische Analyse<br />
durchgeführt, um zu einer linguistisch präziseren Erfassung der Erzählsprache Kleists<br />
zu gelangen. Dafür werden ausgewählte syntaktische Phänomene des einfachen und<br />
komplexen Satzes im Sinne des Strukturalismus beschrieben und ihre Textfunktionen<br />
dargestellt, die zu einem umfassenderen Textverständnis beitragen können. Die<br />
171
172<br />
Sektion 9 v Sección 9<br />
Konzentration liegt dabei auf denjenigen Phänomenen, die dem spanischsprachigen<br />
Leser in der Rezeption besondere Schwierigkeiten bereiten und in der Übersetzung von<br />
Yolanda Mateos von der originalen Satzstruktur abweichen.<br />
Warum der Krug zerbricht und die Tür sich öffnet. — Konstruktionen mit<br />
alternierenden Verben und die Konzeptualisierung eines Ereignisses<br />
Prof. Dr. Handwerker, Brigitte<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland<br />
In den romanischen Sprachen, im Englischen und im Deutschen finden sich auf<br />
den ersten Blick sehr ähnliche Verhältnisse beim Ausdruck von Sachverhalten, in denen<br />
eine verursachende Größe entweder explizit genannt (Adam hat den Krug zerbrochen)<br />
oder aber implizit mitverstanden (Der Krug wurde zerbrochen) oder aber unterdrückt<br />
wird (Der Krug zerbrach/Die Tür öffnete sich). Gerade der Eindruck der strukturellen<br />
Ähnlichkeit führt leicht, - so lehrt es die Erfahrung zum Beispiel beim Erwerb des<br />
englischen Perfekts durch deutsche Muttersprachler -, zu falschen Hypothesen über die<br />
Verwendung des Ausdrucks in der Zielsprache und über die Konzeptualisierung des<br />
ausgedrückten Sachverhalts.<br />
Der Vortrag arbeitet sprachvergleichend die syntaktischen und semantischen<br />
Eigenschaften von Konstruktionen heraus, bei denen ein Verb zwischen einer transitiven<br />
(kausativen) und einer intransitiven bzw. reflexiven (antikausativen) Verwendung<br />
alterniert. Mithilfe sprachlicher Tests wird untersucht, welche Charakteristika der<br />
Konzeptualisierung eines Ereignisses (mit oder ohne Verursacher, mit oder ohne<br />
Spezifizierung der Handlung etc.), mit welcher Realisierung (passivisch, intransitivunakkusativisch,<br />
reflexiv) einhergehen. Darauf aufbauend wird die Frage diskutiert,<br />
wo die entscheidenden Faktoren festzumachen sind: in der lexikalischen Präsentation<br />
des jeweiligen Verbs, in der Konstruktion oder aber im Situationskontext, der eine Art<br />
abstrakten Verursacher als konzeptuelle Größe bereit halten kann.<br />
Die Resultate der Untersuchungen lassen sich direkt anwenden für die Optimierung<br />
einer Sprachvermittlung, die Syntax, semantische und konzeptuelle Struktur zusammen<br />
im Blick hat. Ein besonders offensichtlicher Bereich ist dabei der wissenschafts-/<br />
techniksprachliche, in dem sich die Frage nach der Angemessenheit einer Explizierung<br />
bzw. eines Mitverstehens von agentiven und kausalen Größen ständig stellt.<br />
Unser Stil ist der bessere – Über Wahrnehmung und Vermittlung des deutschen<br />
Wissenschaftsstils in Lateinamerika<br />
Koch, Christian<br />
Pontificia Universidad Católica, Ecuador<br />
Deutsche Wissenschaftssprache ist klar, direkt und inhaltsbezogen. Lateinamerikanische<br />
Wissenschaftssprache ist schwammig, essayistisch verschlungen und mehr
Sektion 9 v Sección 9<br />
auf die Form als auf den Inhalt konzentriert. So zumindest könnte man aus einer deutschen<br />
Perspektiven urteilen. Der deutsche Stil ist für die Qualität der wissenschaftlichen<br />
Darstellung adäquat, brauchbar und sinnvoll, der lateinamerikanische hinderlich und<br />
ungeeignet. So (oder etwas weniger radikal) mag es mancher in der deutschen Hochschullandschaft<br />
ausgebildete Dozent empfinden, wenn er nach Lateinamerika kommt<br />
und die Arbeit hiesiger Studenten beurteilen soll.<br />
Dabei darf man nicht den Candideschen Fehlschluss begehen und meinen, dass der<br />
eigene Stil der beste aller möglichen Stile sei. Es treffen hier Diskurstraditionen mit ihren<br />
historisch gewachsenen Eigenheiten aufeinander: auf der einen Seite die radikal Logoskodierte<br />
Wissenschaftssprache, die bezeichnend für den deutschen Sprachraum ist, auf<br />
der anderen Seite der eklektisch-blumige, geradezu barocke lateinamerikanische Stil.*<br />
Vor der Frage, wie wir den deutschen Wissenschaftsstil lateinamerikanischen Deutsch-<br />
Studenten vermitteln können, muss die Frage gestellt werden, inwieweit dies wirklich<br />
erstrebenswert ist. Darüber kann im konkreten Fall ganz unterschiedlich geurteilt<br />
werden. Bereiten wir Studenten auf das Studium in deutschsprachigen Ländern vor,<br />
sieht die Situation möglicherweise völlig anders aus, als wenn wir unsere (deutschen)<br />
Vorstellungen von sprachlicher Präzision aus dem Grund einfordern, dass wir damit<br />
eine Qualitätssteigerung verbinden und dabei die interkulturellen Unterschiede von<br />
Wissenschaftlichkeit übersehen.<br />
In meinem Beitrag möchte die Problematik anhand einiger zum Teil konfliktiver<br />
Beispiele aus meiner ecuadorianischen Unterrichtspraxis erläutern und zur Diskussion<br />
stellen.<br />
*Vgl. Dill, Hans-Otto (2009): Rhetorik und Stilistik in Lateinamerika. In: Fix, Ulla/<br />
Gardt, Andreas/Knape, Joachim (eds.): Rhetorik und Stilistik. Vol. 2. Berlin/New York: de<br />
Gruyter, 2053-2067. [Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 31.2]<br />
Erwerb des wissenschaftlichen Schreibens in der Fremdsprache Deutsch – Die<br />
Ausdrücke der „Alltäglichen Wissenschaftssprache“<br />
Mächler, Lissette<br />
Universidad de Antioquia, Argentinien<br />
In der neueren Schreib-, Schreibentwicklungs- und Wissenschaftsforschung hat man<br />
sich mit dem wissenschaftlichen Schreiben im universitären Bereich auseinandergesetzt.<br />
Unter anderem wurde dabei festgestellt, dass die Studenten Zeit brauchen, um<br />
sich das wissenschaftliche Schreiben anzueignen: Keiner wird als Wissenschaftler<br />
geboren; das wissenschaftliche Schreiben ist eine sprachliche Kompetenz, die sich<br />
stufenartig erwerben lässt. Die Untersuchungen zum wissenschaftlichen Schreiben in<br />
der Fremdsprache Deutsch betonen, dass L2-Schreiber beim Verfassen akademischer<br />
Texte vor großen Schwierigkeiten stehen: Die Komponente Fremdsprache falle der<br />
Ontogenese wissenschaftlichen Schreibens zur Last; vor allem die Ausdrücke der<br />
173
174<br />
Sektion 9 v Sección 9<br />
„Alltäglichen Wissenschaftssprache“ bereiten Fremdsprachlern große Schwierigkeiten.<br />
Das vorzustellende Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit dem Erwerb des<br />
wissenschaftlichen Schreibens in der Fremdsprache Deutsch. Akademische Texte,<br />
die von kolumbianischen Studenten auf Deutsch und auf Spanisch verfasst wurden,<br />
werden aus textlinguistischer Perspektive analysiert. Das Korpus umfasst eine Reihe<br />
von Texten derselben Autoren auf unterschiedlichen Erwerbsstufen, wobei fünf<br />
Fallbeispiele untersucht werden. Ziel der empirischen Untersuchung ist festzustellen,<br />
wie das wissenschaftliche Schreiben in der L1 – Spanisch – und in der L2 – Deutsch<br />
– erworben wird. Dabei soll rekonstruiert werden, ob die Erwerbsprozesse in den<br />
beiden Sprachen Parallele aufweisen, sowie ob beide Sprachen „interagieren“ und ggf.<br />
wie sie interagieren. Bei der kontrastiven Analyse werden verschiedene Aspekte des<br />
wissenschaftlichen Schreibens berücksichtigt, wobei die Ausdrücke der „Alltäglichen<br />
Wissenschaftssprache“ den Schwerpunkt der Analyse bilden. Im vorliegenden Beitrag<br />
wird der Frage nachgegangen, ob sich der Erwerbsprozess wissenschaftlichen<br />
Schreibens in der Fremdsprache Deutsch anhand der Ausdrücke der „Alltäglichen<br />
Wissenschaftssprache“ erkennen bzw. rekonstruieren lässt.<br />
“Eine kontrastive Beschreibung der Verortung des Fokus im Spanischen und<br />
Deutschen”<br />
Padilla Martínez, Pamela Esmeralda<br />
Universidad de Guadalajara, Mexiko<br />
Das Ziel dieses Beitrags ist es, das Verhalten der Kategorie Fokus unter besonderer<br />
Berücksichtigung seiner Verortung aus einer komparativen Perspektive heraus mittels<br />
je eines mündlichen Korpus für das Spanische und das Deutsche zu beschreiben.<br />
Der Begriff Fokus wird in sehr unterschiedlicher Weise definiert, verortet und<br />
in Beziehung zu den übrigen Satzteilen beschrieben. Seine nicht eindeutige<br />
Definition bringt Probleme bei seiner Abgrenzung und Kontroversen über seine<br />
Charakterisierung, die Methode zu seiner Auffindung und über seine Verortung<br />
innerhalb des Satzes mit sich, was sich auf die Klarheit, mit der er untersucht werden<br />
kann, auswirkt. Neben den Schwierigkeiten bei seiner Bestimmung lohnt es sich, den<br />
Fokus als sprachliches Phänomen in Hinsicht auf seine Bedeutung und Beziehung<br />
zur Sprache zu untersuchen. Es handelt sich um eine Kategorie, die ins weite Gebiet<br />
der Pragmatik fällt und deren Hauptfunktion die Hilfe bei der Disambiguierung der<br />
Information in der Kommunikation ist. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur<br />
bestehenden Diskussion zu diesem Thema zu leisten.<br />
Grundlage dieses Vorhabens ist ein mündliches Korpus, das die theoretischen<br />
Darstellungen und die Ergebnisse bezüglich des Verhaltens und der Verortung<br />
des Fokus bekräftigen soll, wobei sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten<br />
hervorgehoben werden sollen. Es werden Versprachlichungsstrategien in Bezug auf
Sektion 9 v Sección 9<br />
die kommunikative Nähe und Distanz unter Einbindung in den jeweiligen Kontext<br />
dargestellt.<br />
Das Ergebnis ist ein Beitrag zu den Formen, in denen der Fokus im Vergleich<br />
zweier Sprachen mit unterschiedlichem Verhalten bei der Fokusmarkierung auftritt<br />
und verortet ist. Dabei steht der für das Spanische charakteristischen Inflexibilität die<br />
Flexibilität des Deutschen gegenüber.<br />
Hochschulterminologie deutsch-portugiesisch<br />
Dr. Reichmann, Tinka<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien<br />
Brasilianische Studierende der USP, die sich auf ein Austauschsemester in<br />
Deutschland vorbereiten, werden von dem Auslandsamt der Fakultät aufgefordert, die<br />
Auflistung ihrer Studienleistungen (das sogenannte „resumo escolar“) ins Deutsche zu<br />
übersetzen. Aufgrund der fehlenden Kenntnisse über das deutsche Hochschulsystem<br />
(teilweise auch über das eigene) sowie über diese Textsorte und die Terminologie sind die<br />
Studierenden – trotz guter Deutschkenntnisse – mit diesem Auftrag völlig überfordert.<br />
Diese Problematik wurde zum Anlass genommen, in einer Einführungsveranstaltung<br />
in das Fachübersetzen diese Textsorte und insbesondere die Basisterminologie des<br />
Hochschulbereichs kontrastiv zu besprechen. Außer einer großen Menge von falschen<br />
Freunden (z.B. dissertação/Dissertation, habilitação/Habilitation, seminário/Seminar)<br />
wurden Besonderheiten, die keine Entsprechung im jeweils anderen System haben,<br />
herausgearbeitet (z.B. iniciação científica). In diesem Vortrag sollen die wichtigsten<br />
Ergebnisse dargestellt werden und somit ein Beitrag zur Aktualisierung des schon lange<br />
überholten DAAD-Lexikons zur Hochschulterminologie geleistet werden.<br />
Metaphorische Szenarien im brasilianischen und deutschen Diskurs über<br />
‚Gesellschaft‘<br />
Dr. Schröder, Ulrike Agathe<br />
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasilien<br />
Auf der Grundlage eines Korpus’, das sich aus vier Diskursgenres zusammensetzt<br />
– mündliche und schriftliche Interviews, Zeitungsartikel und Sachbücher –<br />
fragen wir danach, mit welchen Metaphern in Brasilien und Deutschland über<br />
die eigene Gesellschaft diskutiert wird. Im Fokus stehen so genannte ‚mixed<br />
metaphors‘ (Lakoff & Johnson 1980), die schon lange vor dem Auftauchen der<br />
Konzeptuellen Metapherntheorie von Paul (1880/1995) als ‚Kontamination‘ und<br />
von Mauthner (1912/1982) als ‚Wippchen‘ bezeichnet wurden. Im Rahmen neuerer<br />
Forschungsergebnisse der Kognitiven Linguistik können wir gerade solche vermischten<br />
metaphorischen Ausdrücke als ‚integration networks’ oder ‚blending scenarios‘<br />
(Fauconnier & Turner 2002, 2008; Brandt & Brandt 2005) auf ihre Komplexität hin genauer<br />
175
176<br />
Sektion 9 v Sección 9<br />
betrachten. Die Untersuchungsergebnisse illustrieren, dass im Hinblick auf vermischte<br />
Bildschemata und Metaphern bemerkenswerte Unterschiede zwischen den beiden<br />
Korpora zutage treten. Während es im deutschen Korpus parallel zur Wahrnehmung der<br />
deutschen Gesellschaft als im Wandel begriffen dynamischere Bildschemata gibt, lässt<br />
sich im brasilianischen Korpus im Vergleich dazu eine stärkere Tendenz zu statischen<br />
Bildern verzeichnen, was sich besonders in dem hohen Gebrauch von Personifikationen<br />
manifestiert. Anhand von vier ausgewählten Beispielen wird in Mikroperspektive<br />
veranschaulicht, welche pragmatischen Funktionen die metaphorischen Szenarien im<br />
jeweiligen kulturellen Kontext übernehmen: Während sie im brasilianischen Korpus<br />
eine eher argumentative und explikative Funktion haben, spiegeln sie im deutschen<br />
Korpus häufig intertextuelle Bezüge und ironische Einstellungen wider.
Sektion 9 v Sección 9<br />
Sektion 10<br />
Subjektivität und Objektivität: Gibt es Wahrheit in der Übersetzung?<br />
Sektionsleitung:<br />
Dr. Werner Heidermann<br />
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasilien<br />
Dr. Mary Snell-Hornby<br />
Universität Wien, Österreich<br />
Dr. Susana Kampff Lages<br />
Universidade Federal Fluminense, Brasilien<br />
Konzept der Sektion<br />
Ausgehend von dieser Fragestellung wird die Sektion eine Plattform darstellen, auf<br />
der ein breites Spektrum von translationswissenschaftlichen Details diskutiert werden<br />
kann. Beiträge zu allen Dimensionen translatorischer Reflexion und translatorischen<br />
Handelns sind willkommen. Es kann im einzelnen also um Fragen der Ausbildung und<br />
der beruflichen Praxis von Übersetzern (und auch Dolmetschern) wie auch um Überlegungen<br />
translationstheoretischer Art gehen. Es interessiert, was sich gegenwärtig an<br />
den Schnittstellen von Germanistik und Translationswissenschaften in Lateinamerika<br />
vollzieht. Besonders begrüßt werden Beiträge, die darüberhinaus das allgemeine Kongressthema<br />
berücksichtigen möchten und Aspekte aufzeigen wollen, die den Wandel<br />
innerhalb der lateinamerikanischen Germanistik mitkonturieren. So kann u. a. der Frage<br />
nachgegangen werden, welche Rückwirkungen der Übersetzungsboom, von dem hier<br />
und da die Rede ist, auf die Germanistik in Lateinamerika hat. Was wird eigentlich aktuell<br />
übersetzt? Lässt die übersetzerische Produktion in Lateinamerika konzeptionelle<br />
Linien erkennen, etwa auch in Form von Projekten – oder wird rein individualistisch und<br />
spontaneistisch übersetzt? Als wie handfest sind die Transformationen der letzten Jahre<br />
und Jahrzehnte zu bewerten? Gibt es systematische Evaluierungen oder eher nur feuilletonistischen<br />
Subjektivismus? Wo liegen theoretische Eigenständigkeiten der lateinamerikanischen<br />
Szene? Die Sektionsleitung ermuntert ausdrücklich KollegInnen aus<br />
den kleineren lateinamerikanischen Ländern zur Teilnahme am Gedankenaustausch<br />
über diese und andere translationswissenschaftliche Themen.<br />
177
178<br />
Montag, 05.03.2012<br />
Sektion 10 v Sección 10<br />
Uhrzeit Ort<br />
8:30-10:00 Einschreibung Paraninfo<br />
10:00-11:30 Eröffnungsveranstaltung:<br />
Juárez 975<br />
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Generalrektor (Ecke Enrique<br />
der Universität Guadalajara / Rector general de la<br />
Universidad de Guadalajara. Mtro. Pablo Arredondo<br />
Ramírez, Rektor des Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrums CUCSH / Rector del Centro Universitario<br />
de Ciencias Sociales y Humanidades. Dr. Lilia Oliver<br />
Sánchez, Leiterin der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät / Directora de la División de Estudios Históricos<br />
y Humanos. Dr. Edmund Duckwitz, Botschafter<br />
der Bundesrepublik Deutschland / Embajador de la<br />
República Federal de Alemania.<br />
Dr. Alfred Längle, Botschafter der Republik Österreich /<br />
Embajador de Austria. Dr. Gisela Schneider, Deutscher<br />
Akademischer Austauschdienst / Servicio Alemán<br />
de Intercambio Académico (DAAD). Dr. Olivia C.<br />
Díaz Pérez, Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes / Presidenta de la Asociación<br />
Latinoamericana de Estudios Germanísticos (<strong>ALEG</strong>)<br />
Díaz de León)<br />
11:30-12.00 Empfang des Generalrektors der Universität Guadalajara<br />
12:00-12:45 Plenarvortrag Paulo Astor Soethe:<br />
Forschungsperspektiven und Anschlussfähigkeit einer<br />
international vernetzten Germanistik in Lateinamerika<br />
12:45-13:30 Plenarvortrag Ottmar Ette: Die Literaturen der Welt aus<br />
transarealer Perspektive<br />
13:45-14:30 Abfahrt zum Tagungsort (CUCSH)<br />
14:30-16:00 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Vor dem<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
16:00-16:30 Raum 69 H**<br />
16:30-17.00 Raum 69 H<br />
17:00-17:30 Raum 69 H<br />
17:30-18:00 Pause
Sektion 10 v Sección 10<br />
18:00-19:30 Kulturveranstaltung (Goethe-Institut): Kabaret und<br />
Musik mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll<br />
19:30 Empfang der Deutschen Botschaft<br />
Eröffnung Karikaturenausstellung Goethe-Institut<br />
Dienstag, 06.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Hermann Funk:<br />
Wie viel Wissen braucht Sprachkönnen?. Modelle zum<br />
Verhältnis von Regelwissen und Kompetenz und ihre<br />
praktischen Konsequenzen<br />
Semiplenarvortrag Friedhelm Schmidt-Welle:<br />
Detektive gegen das Vergessen. Kriminalliteratur und<br />
Alzheimer<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Gunter Pressler Duineser Elegien — Original und<br />
Übersetzung als transkulturelle Identifikation der Moderne<br />
bei Paulo Plínio Abreu (1950er Jahre, Belém) und Augusto<br />
de Campos (1990er Jahre, São Paulo).<br />
10:45-11:15 María Pacheco Der Gesang des Coyoten. Mexikanische<br />
Geschichten von Chrristoph Janacs. Die Übersetzung eines<br />
interkulturellen Textes<br />
11:15-11:45 Magdalena Nowinska Sensible Texte und translatorisches<br />
Handeln: Die Judenbuche und ihre Übersetzer<br />
11:45-12:15 Pause<br />
12:15-13:00 Semiplenarvortrag Erwin Tschirner:<br />
Grammatisches Wissen und Grammatikprogression:<br />
textlinguistische Grundlagen<br />
Semiplenarvortrag Claudia Dornbusch:<br />
Literaturwissenschaft in DaF, die fröhliche Wissenschaft?<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
Vor dem<br />
Auditorium<br />
Salvador Allende<br />
und Bibliothek<br />
Manuel<br />
Rodríguez<br />
Lapuente<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Raum 69 H<br />
Raum 69 H<br />
Raum 69 H<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
179
180<br />
Sektion 10 v Sección 10<br />
13:00-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der<br />
Jurafakultät<br />
(siehe<br />
Campusplan)<br />
14:30-15:00 Christian Bahr *Subjetividad y objetividad en el uso y la<br />
traducción de los topónimos: los casos de México y Galicia<br />
Raum 69 H<br />
15:00-15:30 Siegfried Boehm Übersetzungsdidaktik im Rahmen eines<br />
„Diplomado de Traducción“<br />
Raum 69 H<br />
15:30-16:00 Lucía Orquídea Pino Madroñal Lehrbücher für die Lehre<br />
der Translatologie?<br />
Raum 69 H<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00 Werner Heidermann Zum ‚Kulturschatten‘ von Wörtern<br />
am Beispiel von Uwe Tellkamps ‚Der Turm<br />
Raum 69 H<br />
17:00-17:30 Raum 69 H<br />
17:30-18:00 Raum 69 H<br />
18:15-19:45 Kulturveranstaltung (Foro Cultural de Austria, BMUKK): Auditorium<br />
Lesung von Tarek Eltayeb<br />
Salvador Allende<br />
Donnerstag, 08.03.2012<br />
9:00 – 9:45 Semiplenarvortrag Christian Fandrych: Zum Stil<br />
deutscher wissenschaftlicher Vorträge (auch) aus<br />
kontrastiver Sicht.<br />
Semiplenarvortrag Karen Pupp Spinassé:<br />
Methodische Reflexionen für den Deutschunterricht in<br />
einem bilingualen Kontext Brasiliens<br />
9:45-10:15 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
10:15-10:45 Olga García Können Übersetzungen alt werden oder wie<br />
modern darf ein Klassiker sein?<br />
10:45-11:15 Heike Gruhn, Jean Hennquin Mercier “Man solle<br />
einen Autor so übersetzen wie er selbst würde deutsch<br />
geschrieben haben.” Von einem Irrglauben bezüglich der<br />
Übersetzung<br />
11:15-11:45 Morton Münster An den Grenzen der Übersetzbarkeit von<br />
modernen Prosatexten<br />
11:45-12:00 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Raum 69 H<br />
Raum 69 H<br />
Raum 69 H
Sektion 10 v Sección 10<br />
12:00-12:30 Anette Kind Das Selbstverständnis des Übersetzers<br />
im Wandel: die Übersetzungen von O Mandarin und A<br />
Relíquia von Eça de Queirós<br />
Raum 69 H<br />
12:30-13:00 Klaus Schulte Muchachas, Chicas, Niñas. Probleme beim<br />
Übersetzen von Anna Seghers‘ Ausflug der toten Mädchen<br />
ins Spanische.<br />
Raum 69 H<br />
13:00-13:30 Irsula Peña Jesús Literarische Übersetzung in die<br />
Fremdsprache<br />
Muttersprachler der Ausgangssprache vs. Muttersprachler<br />
der Zielsprache in der literarischen Übersetzung<br />
Raum 69 H<br />
13:30-14:30 Mittagessen<br />
Sektionsarbeit<br />
Hof der<br />
Jurafakultät<br />
(siehe<br />
Campusplan)<br />
14:30-15:00 Susanne Garbe LÍNEAS ROTAS. Die Übersetzung<br />
des Gedichts La muerte me da als Versuch einer<br />
transformativen Sprachergänzung<br />
Raum 69 H<br />
15:00-15:30 Ulrike Sperr Dolmetschen im Fremdsprachenunterricht-<br />
Rechtfertigung und Anwendungsbeispiele<br />
Raum 69 H<br />
15:30-16:00 Tito Romao Ist alles eine Reaktion auf Dada? Raum 69 H<br />
16:00-16:30 Pause<br />
Sektionsarbeit<br />
16:30-17:00<br />
17:00-17:30<br />
17:30-18:00<br />
18:00-19:00 Abfahrt zum Paraninfo<br />
19:00 Kulturveranstaltung der Universität Guadalajara:<br />
Lehrstuhl „Cortázar“ (Cátedra Cortázar): Plenarvortrag<br />
Juan Villoro: *Te doy mi palabra. Un itinerario en la<br />
traducción.<br />
Freitag, 09.03.2012<br />
9:00-11:00 9:00-9:25 Reinhard Andress “... heiße ich daher<br />
die Emigration gut”: der Fall des Egon<br />
Schwarz<br />
Paraninfo<br />
Juárez 975<br />
(Ecke Enrique<br />
Díaz de León)<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
181
9:00-11:00 9:25- 09:50 Egon Schwarz:<br />
Lesung auf Deutsch***<br />
10:00 – 11:00 Elisabeth Siefer: Einführung in die<br />
Übersetzung<br />
Egon Schwarz: Lesung auf Spanisch<br />
-Diskussion<br />
9:00-10:00<br />
Documental de Juliana Fischbein:<br />
des aparecer Exil und Erinnerung im Rahmen des<br />
Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er Jahre in<br />
Südamerika***<br />
Workshop Karen Schramm: Mündliches Erzählen im<br />
Fremdsprachenunterricht<br />
Workshop Dieter Jaeschke: Freundschaft, Ostalgie und<br />
weite Welt: Der Spielfilm „Friendship!“ (D 2010) im DaF-<br />
Unterricht<br />
Workshop Carmen Schier: Zur Arbeit mit Hörbüchern.<br />
Ein „Grenzgänger“ wird (neu) entdeckt<br />
Verlagspräsentation Martina Bartucz, Cornelsen Verlag:<br />
Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Verlagspräsentation Anne Robert, Hueber Verlage:<br />
Menschen<br />
10:00-11:00 Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: DaF<br />
kompakt – das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: „Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur Sprache<br />
11:00-11:30 Pause<br />
11:30-12:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven der Germanistik in<br />
Lateinamerika<br />
Verlagspräsentation Rainer Koch, Klett Verlag: Beste<br />
Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
Verlagspräsentation Foelke Feenders, Langenscheidt<br />
Verlag: Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven<br />
Tafelbildern am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz Neu“<br />
und „Logisch!“<br />
Verlagspräsentation Christina Kuhn, Cornelsen Verlag:<br />
Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was ändert sich,<br />
was bleibt?<br />
182<br />
Sektion 10 v Sección 10<br />
Auditorium<br />
Carlos Ramírez<br />
Ladewig<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
61 H<br />
62 H<br />
63 H<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H<br />
64 H<br />
Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
64 H<br />
65 H<br />
66 H
Sektion 10 v Sección 10<br />
12:30-13:30 Abschlussplenum <strong>ALEG</strong> Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
13:30-15:00 Mittagessen Hof der<br />
Jurafakultät<br />
(siehe<br />
Campusplan)<br />
15:00-17:00 <strong>ALEG</strong>-Mitgliederversammlung Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
17:15-19:15 AMPAL- Mitgliederversammlung Auditorium<br />
Silvano Barba<br />
20:00 Abendessen & Abschlussfeier El Callejón de<br />
los Rumberos.<br />
Chapultepec<br />
Ecke Lerdo de<br />
Tejada<br />
* Vorträge mit diesem Vermerk werden auf Spanisch gehalten.<br />
** Die Tagungsräume befinden sich im 3. Stock des Gebäude H vom CUCSH.<br />
*** Teil der Sektion 2 und des Kulturprogramms; nähere Informationen im Kulturprogramm<br />
Beiträge in alphabetischer Reihenfolge<br />
*“Subjektivität und Objektivität in Gebrauch und Übersetzung von Ortsnamen<br />
am Beispiel Mexikos und Galiciens”/<br />
“Subjetividad y objetividad en el uso y la traducción de los topónimos:<br />
los casos de México y Galicia”<br />
Bahr, Christian<br />
Universität Leipzig, Deutschland<br />
In zwei- oder mehrsprachigen Gebieten kann der Gebrauch von Ortsnamen in<br />
der einen oder anderen Namensform eine subjektive Entscheidung sein, die eine<br />
ideologische Positionierung des Sprechers mit sich führt. Das Ziel dieses Beitrags ist<br />
es, die Sprachkonfliktsituationen im Bereich der Toponymie in Mexiko, wo zahlreiche<br />
Ortsnamen im Laufe der Kolonisations- und Dekolonisationsprozesse geändert wurden,<br />
und in Galicien, wo sich der Sprachkonflikt zwischen dem Galicischen und dem<br />
Spanischen auch in den Kastilianisierungen und Regalicisierungen der Ortsnamen widerspiegelt,<br />
zu vergleichen. Für beide Fälle sollen kurz die Standardisierungsprozesse<br />
im Bereich der Ortsnamen sowie die (ideologischen etc.) Implikationen ihres nichtnormativen<br />
Gebrauchs dargestellt werden. In einem zweiten Schritt soll die Übersetzung<br />
dieser Ortsnamen ins Deutsche untersucht werden, um herauszufinden, ob sich<br />
183
184<br />
Sektion 10 v Sección 10<br />
allgemeine Tendenzen feststellen lassen, die mit diesen Konflikten in Zusammenhang<br />
stehen. So soll beispielsweise analysiert werden, von welcher der Namensformen die<br />
ins Deutsche übernommenen Ortsnamen ausgehen. In diesem Sinne möchte der<br />
vorliegende Beitrag bestimmen, in welchem Maße davon gesprochen werden kann,<br />
dass die eher „subjektiven Faktoren“, die den Gebrauch mehrsprachiger Ortsnamen in<br />
ihrer endonymischen Umgebung bestimmen, bei der Übersetzung ins Deutsche an<br />
Bedeutung verlieren und stattdessen eher „objektive“ Faktoren wie die Namensart,<br />
die Ausgangssprache oder die Geschichte, Größe und Bedeutung des Namenträgers<br />
entscheidend sind.<br />
En las regiones bilingües o plurilingües el uso de los topónimos en una u otra de sus<br />
formas lingüísticas puede suponer una decisión subjetiva que implique un posicionamiento<br />
ideológico por parte del hablante. El objetivo de esta comunicación es comparar<br />
estas situaciones de conflicto lingüístico en el ámbito de la toponimia en México, donde<br />
numerosos topónimos han ido cambiando durante los procesos de colonización y descolonización,<br />
y en Galicia, donde el conflicto lingüístico entre el gallego y el castellano se<br />
manifiesta también en las castellanizaciones y regalleguizaciones de los topónimos. Para<br />
ambos casos se describirán brevemente los procesos de estandarización de la toponimia<br />
y las implicaciones (ideológicas etc.) de los usos no normativos. En un segundo paso se<br />
analizará la traducción de estos topónimos al alemán para comprobar la existencia de<br />
tendencias generales relacionadas con estos conflictos, por ejemplo, se pretende verificar<br />
a partir de cuál de las formas lingüísticas se importan al alemán. En este sentido la presente<br />
comunicación se propone determinar en qué medida podríamos decir que los factores<br />
más bien “subjetivos” que determinan el uso de los topónimos plurilingües en su entorno<br />
endonímico pierden su importancia a la hora de la traducción al alemán, y en qué medida<br />
son decisivos factores más “objetivos” como el tipo de topónimo, las lenguas de partida o<br />
la historia, el tamaño y la importancia del lugar geográfico.<br />
Übersetzungsdidaktik im Rahmen eines „Diplomado de Traducción“<br />
Boehm, Siegfried<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Acatlán, Mexiko<br />
Durch die ständig zunehmende Globalisierung, die sich in den letzten Jahren in allen<br />
Lebensbereichen durchgesetzt hat, ist auch der Bedarf an qualifizierten Übersetzern<br />
konstant gestiegen. Während die Fremdsprachenforschung derzeitig große Fortschritte<br />
erreicht und deren Vermittlung sich somit erheblich verbessert hat, befindet sich der<br />
Übersetzungsunterricht wenigstens hierzulande im Allgemeinen noch im Anfangsstadium.<br />
Viele Übersetzer haben sich somit autodidaktisch weiter gebildet und nur wenige<br />
können eine theoretisch- und praxisbezogene Ausbildung auf diesem Gebiet vorweisen.<br />
Im Gegensatz zur Fremdsprachenvermittlung gibt es auch kaum ausgebildete<br />
Lehrkräfte, die in der Lage sind Übersetzungsunterricht zu erteilen.
Sektion 10 v Sección 10<br />
Aufgrund dieser mangelnden Voraussetzungen sind wir an der Autonomen Nationalen<br />
Universität von Mexiko, FES Acatlán im Moment dabei einen Einführungskurs<br />
zum Übersetzer anzubieten. In sieben Modulen mit insgesamt 200 Stunden soll den<br />
Kursteilnehmern, die ausreichende Kenntnisse der Ausgangs- und Zielsprache vorweisen<br />
müssen, theoretisches und praktisches Wissen vermittelt werden mit dem Ziel verschiedene<br />
Textsorten profesionell zu übersetzen.<br />
Im folgenden Beitrag geht es um die Didaktik des Übersetzens, d.h. um die Vermittlung<br />
theoretischer und praktischer Aspekte, um die Rolle der Linguistik bei der Übersetzung,<br />
um Aufgaben und Ziele eines theoretisch orientierten Übersetzungsunterrichts<br />
sowie um didaktische Hinweise für rezeptive und produktive Phasen des Übersetzens.<br />
Letztendlich werden Überlegungen zur Bewertung der Übersetzungen angestellt. Sicherlich<br />
reicht der vorgestellte Kurs noch nicht aus, um professioneller Übersetzer zu<br />
werden, aber er ist dennoch ein erster Schritt, um eine translatorische Kompetenz zu<br />
erlangen, die sich wahrscheinlich erst in der späteren Berufspraxis festigen kann.<br />
LÍNEAS ROJAS – die Übersetzung des Gedichts<br />
La muerte me da als Versuch einer transformativen Sprachergänzung<br />
Garbe, Susanne<br />
Universidad de Concepción, Chile<br />
In diesem Vortrag möchte ich meine translatorischen Auseinandersetzungen mit<br />
der experimentellen Literatur der mexikanischen Schriftstellerin Cristina Rivera Garza<br />
vorstellen.<br />
Besonders interessant ist ihr Werk La muerte me da, da dieses sowohl in Form eines<br />
Prosagedichts als auch in Form eines Thrillerromans vorliegt. Angesichts der Dichte der<br />
oftmals intertextuell referierenden Sprachspiele habe ich mich in meinen translatorischen<br />
Bemühungen zunächst auf das Prosagedicht konzentriert. Vor allem angesichts<br />
der Frage, ob man überhaupt von einem ,Original‘ sprechen kann, wenn dies von Anfang<br />
an in zwei Versionen existiert, bietet sich hier Benjamins innovatives Konzept der<br />
,Sprachergänzung‘ durch die ,fremde Art des Meinens‘ als theoretischer Hintergrund<br />
für eine Übersetzung an. Denn anders als traditionelle Ansätze, zielt diese Methode<br />
nicht mehr darauf ab, ein vermeintliches ,Original‘ zu verdeutschen. Vielmehr geht es<br />
darum, mit der als ,Umdichtung‘ verstandenen Übersetzungsbewegung, die sogenannte<br />
,reine Sprache‘ als „Ausdruck des innersten Verhältnisses der Sprachen zueinander“<br />
aufzuspüren. Die ,reine Sprache‘ ist die Sprache Gottes, die „nichts mehr meint“, sondern<br />
als „schöpferisches Wort das in allen Sprachen Gemeinte ist“, eine Sprache, der es<br />
nicht primär um die Vermittlung eines Inhalts zu tun ist, sondern in der das Wort selbst<br />
zum Thema wird – en arché en o lògos. In diesem Sinne richten sich meine Bemühungen<br />
darauf, die deutsche Sprache zu verspanischen und sie so – durch diese Ver-fremdung<br />
bereichert – der ,reinen Sprache‘ ein Stück näher zu bringen.<br />
185
186<br />
Sektion 10 v Sección 10<br />
Können Übersetzungen alt werden oder wie modern<br />
darf ein Klassiker sein? Zum Phänomen Neuübersetzung<br />
Prof. Dr. García, Olga<br />
Universidad de Extremadura, Spanien<br />
Dieser Vortrag befasst sich mit der Mehrdeutigkeit des Begriffs „retranslation“. Dazu<br />
seien zunächst die theoretischen Annäherungen an das Konzept der Neuübersetzung<br />
der Franzosen Berman und Gambier sowie die englischsprachigen Ausführungen von<br />
Pym, Venuti und Chesterman herangezogen. Es werden einige für den Übersetzer und<br />
auch Leser literarischer Werke interessante Aspekte diskutiert werden. Darüber hinaus<br />
gilt es, andere Aspekte, die direkten Bezug zum Begriff der Neuübersetzung haben,<br />
etwa das „Veraltern von Übersetzungen“ oder die „kanonische Übersetzung“, sowie<br />
einschlägige Gründe, die ein Neuübersetzen erfordern, zu untersuchen. Dies alles soll<br />
anhand von Beispielen aus der deutschen Literatur und den entsprechenden Übersetzungen<br />
ins Spanische verdeutlicht werden.<br />
Zum ‚Kulturschatten‘ von Wörtern am Beispiel von Uwe Tellkamps ‚Der Turm<br />
Werner Heidermann<br />
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasilien<br />
Die Komplexität von landeskundlichen Gegebenheiten führt zu immensen Schwierigkeiten<br />
bei der Übersetzung. Dies wird anhand von Uwe Tellkamps ‚Wenderoman‘ Der<br />
Turm veranschaulicht, der bislang nichts ins Portugiesische übersetzt worden ist und<br />
dessen Gegenüberstellung von Kleinbürgertum und (Bildungs-)Bürgertum eine gute<br />
Gelegenheit bietet, den Begriff von „einem schwer fassbaren Schatten unter den Worten,<br />
einem Kulturschatten“ (Peter Weiss) zu reflektieren.<br />
“Man solle einen Autor so übersetzen wie er selbst<br />
würde deutsch geschrieben haben.” Von einem<br />
Irrglauben bezüglich der Übersetzung<br />
Hennequín Mercier, Jean und Gruhn, Dorit Heike<br />
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexiko<br />
Obwohl Friedrich Schleiermacher in seiner Abhandlung “Ueber die verschiedenen<br />
Methoden des Uebersezens” die im Titel zitierte Aussage schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts<br />
als absurd entlarvte, ist bis heute der Irrglaube weit verbreitet, dass Übersetzen<br />
bedeute, einen Text so zu verfassen, wie der Autor es selbst getan hätte, wenn er<br />
der Zielsprache mächtig gewesen wäre. Worin besteht das Absurde dieser Vorstellung?<br />
Warum erfreut sie sich immer noch so groβer Beliebtheit, nicht nur unter Laien, sondern<br />
selbst unter professionellen Übersetzern? Und welches Konzept kann ihr entgegengestellt,<br />
d.h. wie kann dem komplexen Phänomen des Übersetzens besser Rechnung getragen<br />
werden?
Sektion 10 v Sección 10<br />
Diese Fragen werden uns in dem Vortrag beschäftigen. Den Versuch, einige Elemente<br />
zu ihrer Beantwortung beizutragen, sollen Beispiele aus mehreren Sprachen und Bereichen<br />
illustrativ unterstützen. Auch die Folgen der theoretischen Betrachtungen für<br />
die Übersetzungslehre sollen mitbedacht werden.<br />
Das Selbstverständnis des Übersetzers im Wandel:<br />
die Übersetzungen von O Mandarin und A Relíquia von Eça de Queirós<br />
Kind, Anette<br />
Universidade do Porto, Brasilien<br />
Der bedeutendste portugiesische Romancier des 19. Jahrhunderts, Eça de Queirós,<br />
gehört im Deutschland des 20. Jahrhunderts zu den meistrezipierten portugiesischen<br />
Autoren. Verschiedene Rezeptionsphasen zeichnen sich durch eine quantitativ und<br />
qualitativ unterschiedliche Gewichtung der publizierten Werke in deutscher Sprache aus.<br />
Den Übersetzer stellt die Übertragung der Werke Eças insofern vor eine besondere<br />
Herausforderung, als dieser entscheidende stilistische Neuerungen in die lusophone Literatur<br />
eingeführt hat, wie Variationen sprachlicher Register, gezielten Einsatz erlebter<br />
Rede, Wortschöpfungen und Neologismen, ganz besonders aber die seinen Stil auszeichnenden<br />
Adjektivierungsprozesse, die sich u.a. in Stellung, Häufung, Synästhesie<br />
und Hypallage manifestieren.<br />
In vorliegendem Beitrag sollen einige Ergebnisse des Forschungsprojekts im Rahmen<br />
meiner Promotion aufgezeigt werden. Exemplarisch werden die Übersetzungen<br />
von zwei Prosatexten Eças untersucht: Der Mandarin und Die Reliquie, denen von Anbeginn<br />
der Eça-Rezeption in Deutschland ein besonderes Interesse der Leserschaft<br />
galt, was sich nicht zuletzt auf das beiden Texten gemeinsame phantastisch-exotische<br />
Element zurückführen lässt. Anhand der verschiedenen zwischen 1918 und 1984 in<br />
Deutschland publizierten Übersetzungen lässt sich ein Wandel der Übersetzungsstrategien<br />
beim Translationsprozess aufzeigen. Es wird nicht nur dargestellt, inwieweit den<br />
Übersetzern der Drahtseilakt gelungen ist, den Eça eigenen Stil in deutscher Sprache<br />
wiederzugeben bzw. die Prozesse spielerischer Wortschöpfungen in der Zielsprache<br />
umzusetzen, sondern es soll auch anhand exemplarischer Analysen von Ausgangs- und<br />
Zieltexten veranschaulicht werden, was die Übersetzungen verschiedener Epochen<br />
auszeichnet und inwiefern sich Prioritäten im Translationsprozess verschoben haben.<br />
An den Grenzen der Übersetzbarkeit von modernen Prosatexten<br />
Münster, Morton<br />
Universidad de Extremadura, Spanien<br />
Der stark ausgeprägte Sprachskeptizismus in Deutschland, Frankreich, Spanien und<br />
England seit dem 19. Jahrhundert, der sich etwa in der poésie pure, Hofmannsthals Ein<br />
Brief oder Mauthners Schriften zur Sprache widerspiegelt, führt zu einem poetologi-<br />
187
188<br />
Sektion 10 v Sección 10<br />
schen Umdenken. Um trotz des defizitären Wesens der Sprache mitzuteilen, was sich<br />
ihnen doch eigentlich entzieht, suchen Schriftsteller wie Joyce, Beckett, Hildesheimer,<br />
Simone oder Benet nach neuen Formen in der Literatur, etwa dem nouveau roman.<br />
Ihre innovativen Werke gelten jedoch als weitgehend unübersetzbar. Dabei verlagert<br />
die Poetisierung der Sprache, die zur Erhöhung der Form gegenüber dem Inhalt führt,<br />
die Schwierigkeiten einer Übersetzung. Die Semantik tritt in den Hintergrund, ohne jedoch<br />
belanglos zu werden. Mediale Überlagerungen in der Gestalt von Bild und Musik<br />
müssen berücksichtigt werden. Denn wie übersetzt man am besten aus Finnegans Wake<br />
„What clashes here of wills gen wonts, oystrygods gaggin fishy-gods ! Brékkek Kékkek“?<br />
Allein an diesem Werk haben sich zahlreiche Übersetzer versucht. Ein anderer Fall sind<br />
die Sprachspiele in Hildesheimers Prosa, die sich mindestens in Tynset und Masante in<br />
einen musikalischen Aufbau integrieren. Wie soll man diese Sprachspiele in eine andere<br />
Sprache übertragen, semantische Nuancen und Klangbild berücksichtigen, damit das<br />
Werk seinen musikalischen Charakter nicht verliert? Die hohe Komplexität dieser Art<br />
Literatur erfordert viel Kreativität und Fingerspitzengefühl des Übersetzers, der eine Balance<br />
zwischen Übersetzung und Nachdichtung finden muss. Bei diesem Vortrag sollen<br />
die Schwierigkeiten und Grenzen bei der Übersetzung (bzw. Nachdichtung) von modernen<br />
Prosawerken diskutiert werden.<br />
Sensible Texte und translatorisches Handeln:<br />
Die Judenbuche und ihre Übersetzer<br />
Nowinska, Magdalena<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien<br />
Der Vortrag zielt darauf ab, einen Aspekt des translatorischen Handelns zu diskutieren,<br />
nämlich das Verhältnis von Übersetzern zu den von ihnen übersetzten Texten, und<br />
geht dabei der Frage nach, ob und wie sich dieses Verhältnis in den übersetzten Texten<br />
bemerkbar macht. Ausgehend vom Modell der echoic translation von Theo Hermans<br />
(2007) stellt der Vortrag das Verhältnis der Übersetzer der Erzählung Die Judenbuche<br />
(1842) von Annette von Droste-Hülshoff zu diesem Text dar. Insbesondere geht es im<br />
Vortrag darum, das Verhältnis der Übersetzer zu einem sensiblen Aspekt der Erzählung<br />
zu diskutieren, nämlich dem von ihr thematisiertem spannungsgeladenen Verhältnis<br />
zwischen der jüdischen und nicht-jüdischen Bevölkerung im Deutschland des 18. Jahrhunderts.<br />
Der Vortrag präsentiert damit Ergebnisse einer von mir gerade eingereichten<br />
Dissertation, die der Frage nachgeht, ob Übersetzer beim Übersetzen eines „sensiblen<br />
Texts“ (Simms 1997) die von der translatorischen Ethik geforderte Objektivität gegenüber<br />
dem zu übersetzenden Text bewahren (sollen).
Sektion 10 v Sección 10<br />
Der Gesang des Coyoten. Mexikanische Geschichten von Christoph Janacs. Die<br />
Übersetzung eines interkulturellen Textes<br />
Pacheco Vázquez, María Josefina<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko<br />
Der österreichische Schriftsteller Christoph Janacs (Linz, 1955) ist mehrmals nach<br />
Mexiko gereist und hat ein grosses Interesse für die mexikanische Kultur gezeigt, besonders<br />
für die Werke von Juan Rulfo. Er veröffentlichte schon verschiedene Titel mit<br />
dem Thema Mexikos: Templo Mayor (Gedichte, 1998), Aztekensommer (Roman, 2001,<br />
Stefan Zweig-Preis der Stadt Salzburg), und die Erzählungen die ich zurzeit übersetze:<br />
Der Gesang des Coyoten. Mexikanische Geschichten, Haymon, 2001. Das Verständnis<br />
der mexikanischen Kultur und Mentalität ist bei diesen Texten wirklich erstaunlich; bei<br />
der Erzählung „Diegos Totenkopf“ wird, z.B., die grausame Wirklichkeit mit den Mythen<br />
des mexikanischen Fest des Totentages gemischt. Bei einer anderen Erzählung gibt es<br />
auch eine weitere Perspektive, da es in einem Dialog mit den Werken von G. G. Márquez<br />
vorgestellt wird. Aber die Mehrheit der Texte hat Mexiko als Zentrum und Motiv. Einige<br />
Kritiker finden, dass die Benutzung von mexikanischen Wörtern bei den Werken von<br />
Janacs exzessiv ist, aber ich verstehe es auch als Provokation: Wir, lateinamerikanische<br />
Leser, haben immer Texte mit europäischen Wörtern (auf Französisch, Englisch, usw.)<br />
ohne Klage gelesen.<br />
Ich habe schon die Hälfte der Erzählungen mit dem Gutachten von Janacs übersetzt,<br />
und ich hoffe, dass ich bald schon das Ganze habe, um eine mexikanische Version<br />
des Buches veröffentlichen zu können. Beim <strong>ALEG</strong> würde ich gerne über diesen<br />
Prozess sprechen.<br />
Literarische Übersetzung in die Fremdsprache<br />
Muttersprachler der Ausgangssprache vs. Muttersprachler<br />
der Zielsprache in der literarischen Übersetzung<br />
Dr. Irsula Peña, Jesús<br />
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Kuba<br />
Die Übersetzung in die Fremdsprache ist eine Aufgabe von auserwählten Sprachmittlern,<br />
von denen man behauptet, sie hätten die genügende Erfahrung und eine<br />
hohe fremdsprachliche Kompetenz. Da es sich um relative bzw. subjektive Bewertungen<br />
handelt, wollen wir uns hier mit dieser Problematik auseinandersetzen. Es ist eine<br />
Arbeit, die sich auf praktischen Beispielen in der Übersetzung von literarischen Texten<br />
von Spanisch ins Deutsche stützt. Wir versuchen folgenden Fragen nachzugehen: In<br />
wie weit unterscheiden sich diese Übersetzungen aus dem Spanischen von Übersetzungen<br />
des gleichen Textes, die aber von einem Muttersprachler stammen? Welche<br />
Vorteile und Nachteile haben die Muttersprachler der Ausgangssprache gegenüber<br />
der Muttersprachler der Zielsprache? Wie werden die in Ausgangstext enthaltenen<br />
189
190<br />
Sektion 10 v Sección 10<br />
Wahrheiten von beiden Muttersprachlern in die Zielsprache übertragen? Wie gehen<br />
beide mit dem interkulturellen Aspekt um? Die meisten Werke bzw. Anthologien der<br />
lateinamerikanischen Literatur sind von Deutschsprachigen ins Deutsche übersetzt<br />
worden. Wäre nicht die Bildung von Übersetzerduos von Spanisch- bzw. Portugiesischsprechenden<br />
für die Bewältigung der Literaturen unserer Sprachregionen denkbar,<br />
sogar empfehlenswert?<br />
Lehrbücher für die Lehre der Translatologie? /<br />
¿Libros de texto para la enseñanza de la traductología?<br />
Dr. Pino Madroñal, Lucía Orquídea<br />
Universität Havanna, Kuba<br />
Die Ausbildung im Bereich Translatologie unterscheidet sich von einem Ausbildungsort<br />
zum anderen, von Land zu Land, von Erdteil zu Erdteil. Das ist die Konsequenz<br />
von verschiedenen Marktpräferenzen, den Eigenheiten der Studierenden, der Tradition<br />
bei der Ausbildung der entsprechenden Ausbildungsstätte u. ä.<br />
Die Lehrpläne der verschiedenen Ausbildungsstätten für Übersetzer und Dolmetscher<br />
stimmen aber in bestimmen Fächern überein. Sie behandeln unter anderem<br />
Fragen zur Geschichte der Translatologie, das Übersetzen und Dolmetschen von verschiedenen<br />
Textsorten mehrerer Textklassen und Fachbereiche, Theorie und Praxis der<br />
Translation, kontrastive Studien in ausgewählten Sprachen, Terminologie, EDV-gestützte<br />
Werkzeuge etc.<br />
In den bibliographischen Angaben jener Lehrpläne erscheinen aber sehr wenige<br />
Materialien, die als Lehrbücher betrachtet werden können. In dem Sprachenpaar<br />
Deutsch – Spanisch werden meist die Bücher von Amparo Hurtado Albir „Traducción<br />
y Traductología“ sowie „Enseñar a Traducir“ und von Christiane Nord „Lernziel: Professionelles<br />
Übersetzen Spanisch – Deutsch“ oder auch das „Handbuch Translation“ von<br />
einem Autorenkollektiv genannt.<br />
Die Liste könnte um drei oder vier neuere Titel erweitert werden. Verfügen wir aber<br />
in unseren jeweiligen Ausbildungsstätten über Lehrbücher für die Ausbildung in Translatologie,<br />
die den oben genannten Bedürfnissen entsprechen? Wenn ja, wie werden<br />
jene linguistische, textuelle, soziale und interkulturelle Fragen behandelt? Welche und<br />
wie viel Theorie sollen sie enthalten? Auf diese und ähnliche Fragen werde ich in meinem<br />
Beitrag eingehen.<br />
La enseñanza de la traductología difiere de un centro formador a otro, de un país a<br />
otro, y por supuesto de un continente a otro. Esto responde a cuestiones tales como preferencias<br />
del mercado, características del alumnado, tradición en la formación entre otras.<br />
Los currículos de las diferentes instituciones formadoras coinciden sin embargo en<br />
toda una serie de materias, se incluye en cierta medida aspectos de la historia de la<br />
translatología, traducción e interpretación de diferentes tipos de textos de diversos gé-
Sektion 10 v Sección 10<br />
neros y materias, teoría y práctica de la traslación, estudios comparativos entre pares de<br />
lenguas, terminología, herramientas informáticas para la traducción, etc.<br />
No obstante, en la bibliografía de estos programas aparecen muy contados materiales<br />
que podrían asumirse como un tipo de libros de texto para la enseñanza de nuestra<br />
ciencia. En el par de lenguas español-alemán se consignan por ejemplo Traducción y<br />
Traductología de Amparo Hurtado Albir, Enseñar a Traducir de la misma autora, Lernziel:<br />
Professionelles Übersetzen Spanisch-Deutsch de Christiane Nord, también de esta autora,<br />
Handbuch Translation de un colectivo de autores. La lista podría ampliarse a tres o cuatro<br />
libros más o menos recientes, pero ¿contamos con libros de texto para la enseñanza<br />
de la traductología en nuestros centros de estudio que respondan a las necesidades de<br />
formación arriba mencionadas? De ser así ¿cómo se insertan estos elementos lingüísticos,<br />
textuales, sociales e interculturales? ¿Hasta dónde y qué teoría deben abarcar?<br />
Sobre estas y otras interrogantes reflexionaremos en nuestra contribución.<br />
Duineser Elegien — Original und Übersetzung als transkulturelle Identifikation<br />
der Moderne bei Paulo Plínio Abreu (1950er Jahre, Belém) und Augusto de<br />
Campos (1990er Jahre, São Paulo).<br />
Dr. Pressler, Gunter Karl<br />
Universidade Federal do Pará, Brasilien<br />
Bekanntlich gibt es keine geschichtlich-kulturelle Äquivalenz zwischen zwei Ländern<br />
verschiedener Sprachen, auf verschiedenen Kontinenten und unter Berücksichtigung<br />
kolonialistischer Verhältnisse. Unserer Beitrag fragt nicht nur ob mit der Rezeption<br />
der Poesie von Rainer Maria Rilke (1875-1926) ein bestimmtes Deutschlandbild mitgeteilt<br />
wurde oder entstand, sondern auch, inwieweit ein solches bei Lyrikübersetzung<br />
ein Rolle spielt. Die Studie zielt auf zwei translationswissenschaftliche Schwerpunkte:<br />
als Verständigungswissenschaft weckt sie hermeneutische Interessen (Subjekt-Objekt-<br />
Verhältnis), die ohnehin bei literarischen Übersetzungen elementar wichtig sind, zweitens<br />
geht es auch um “hierarchisch strukturierte Ortungen” (H.Kalverkämpers, 2009) im<br />
interkulturellen Rezeptionsvorgang, die im kreativen Prozess des Schreibens in einer<br />
bestimmten sozialpolitischen Umwelt zu berücksichtigen sind. Beide Übersetzer sind<br />
Poeten aus verschiedenen Regionen Brasiliens (Amazonien und São Paulo) und in verschiedenen<br />
Geschichtsepochen. Gemeinsam haben sie die Aktualisierung/Problematisierung<br />
der Moderne: obwohl oder gerade angesichts eines ökonomischen (nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg) und politischen Niedergangs (Militärdiktatur), neue Generationen<br />
von Intellektuellen und Künstlern entdecken das Werk Rilkes als poetische Referenz. Die<br />
Duineser Elegien gehören zu den “schwierigsten Texte der deutschen Literatur [...] neue<br />
Wortkombinationen, die die deutsche Sprache erlaubt, aber im Grunde nicht übersetzt<br />
werden können”. Rilke gehöre in eine Epoche des Übergangs (transição), in der “der<br />
Dichter nicht mehr poetisch im traditionellen Sinne zu denken wuβte [...] und an die<br />
191
192<br />
Sektion 10 v Sección 10<br />
linguístische Grenze des Sagbaren stieβ“(Abreu, 2008). Dieser Herausforderung stellte<br />
sich der konkretistische Dichter Augusto de Campos: “I like Rilke”. Die poetische Sprache<br />
erreicht die Grenze der visuellen Wahrnehm- und Übersetzbarkeit. “Nur manchmal<br />
schiebt der Vorhang der Pupille/Sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein” (Rilke, 1907).<br />
Ist alles eine Reaktion auf Dada?<br />
Romão, Tito Lívio Cruz<br />
DLE/Universidade Federal do Ceará - PGET/Universidade Federal<br />
de Santa Catarina, Brasilien<br />
Im Jahre 2006 ließ der Schweizer Schriftsteller Peter K. Wehrli, der jahrelang als Kulturjournalist<br />
beim Schweizer Fernsehen tätig war und etwa durch seine Werke Katalog<br />
von Allem und El Catálogo Latinoamericano bekannt wurde, den Text Alles ist eine Reaktion<br />
auf Dada ins Portugiesische übersetzen. Der Text, der in Zürich abgefasst wurde,<br />
sollte von einem Übersetzer im nordostbrasilianischen Fortaleza ins Portugiesische<br />
übertragen werden und im mosambikanischen Maputo erscheinen. Der Übersetzer<br />
fertigte zuerst eine brasilianische Fassung des Ausgangstextes an, die in der Folge in<br />
eine „neutrale“ europäisch-portugiesische Version umzuschreiben wäre. Es gäbe nämlich<br />
brasilianische Wörter, die ersetzt sowie Rechtschreibdetails, die adaptiert werden<br />
sollten. Dies führte zu einem regen E-Mail-Austausch zwischen dem Autor und dem<br />
Übersetzer, der aufschlussreich und für beide Handelnde bereichernd war. Aus der Korrespondenz<br />
konnten u.a. folgende Erkenntnisse abgeleitet werden: a) der Originaltext<br />
bereitete dem Übersetzer Schwierigkeiten eher im Bereich der Kulturspezifik (und nicht<br />
etwa der Semantik bzw. Lexik); b) im Vergleich zwischen Ausgangstext und Zieltext<br />
konnte auf der semantischen Ebene festgestellt werden, wie manche Begriffe im zielsprachlichen<br />
Text an Bedeutung verloren bzw. gewonnen haben; c) durch den Ideenaustausch<br />
mit dem Autor konnte der Übersetzer durch konkrete Beispiele begreifen,<br />
wie sich dieser Übersetzungs- bzw. Kommunikationsprozess von der eher „normalen“<br />
Übersetzungsprozedur unterscheidet, bei der der Übersetzer keinen Kontakt zu dem<br />
Autor des Ausgangstextes hat. Mit diesem Kurzvortrag wird somit Einblick in Teile des<br />
o.g. E-Mail-Austauschs gewährt, so dass ausgehend von anschaulichen Beispielen eruiert<br />
wird, wie hilfreich und entscheidend der Dialog zwischen Übersetzer und Autor zu<br />
einem „störungsfreieren“ Übersetzungsablauf bzw. –ergebnis sein kann.<br />
Muchachas, Chicas, Niñas. Probleme beim Übersetzen von Anna Seghers‘<br />
Ausflug der toten Mädchen ins Spanische.<br />
Schulte, Klaus<br />
Universität Roskilde, Dänemark<br />
Der Beitrag entsteht unter maßgeblicher Mitarbeit von Dr. Peter Jehle, Berlin, Mitherausgeber<br />
der Zeitschrift Das Argument und des Historisch Kritischen Wörterbuchs des Marxismus.
Sektion 10 v Sección 10<br />
Analysen des spezifischen Textverfahrens in Anna Seghers Exilerzählung Der Ausflug<br />
der toten Mädchen haben gezeigt, dass die Erfahrung eines Kulturzusammenstoßes,<br />
ausgelöst durch den erzwungenen Aufenthalt der Autorin im mexikanischen Exil,<br />
in diesem Text nicht nur thematisch ist, sondern eher noch in der literarischen Methode<br />
der Darstellung selber ihren genuinen ästhetischen Niederschlag findet. Wie genau<br />
die jeweiligen Leser sich gerade auf die hieraus resultierende konkrete Sprachgestalt<br />
einlassen, die die unabweisbare Rezeptionsvorgabe jeder Lektüre ist, entscheidet deshalb<br />
über die Angemessenheit dieser oder jener aus der Vielzahl von Lesarten dieser<br />
1944 (zuerst auf Spanisch!) erschienenen Erzählung, die zu einem der meist rezipierten<br />
Werken der deutschsprachigen Exilliteratur werden sollte. Für den besonderen Rezeptionstyp<br />
‚Übersetzung‘ ergeben sich hierbei jeweils zielsprachenspezifische Herausforderungen<br />
für Versuche, die kommunikationsstrategische Funktion derjenigen auch in<br />
der deutschen Ausgangssprache ungewöhnlichen sprachlichen Operationen der Zeit-,<br />
Orts- und Persondeixis angemessen zu berücksichtigen, denen die Erzählung das besondere<br />
Wirkungspotential verdankt, das ihre rezeptionsgeschichtlich erwiesene ‚Haltbarkeit‘<br />
erklären mag.<br />
In Fortsetzung einschlägiger Untersuchungen zu Übersetzungen der Erzählung<br />
ins Dänische (Schulte 2004) und ins Französische (Roussel/Schulte 2007) wird der beabsichtigte<br />
Beitrag ausgewählte Passagen aus vier verschiedenen Übersetzungen ins<br />
Spanische miteinander vergleichen; dabei wird verdeutlicht, wie die jeweiligen Übersetzer<br />
auf die Schwierigkeiten reagieren, die sich u.a. aus den Unterschieden zwischen<br />
den Tempussystemen des Deutschen und des Spanischen ergeben. Der vergleichende<br />
Blick durch das Prisma der Übersetzungen auf den Originaltext trägt gleichzeitig zur<br />
genaueren Erkenntnis des in ihm realisierten Textverfahrens und damit der potentiellen<br />
Wirkungsweise seiner wichtigsten rezeptionsleitenden Elemente bei.<br />
Dolmetschen im Fremdsprachenunterricht- Rechtfertigung<br />
und Anwendungsbeispiele<br />
Sperr, Ulrike<br />
Universidad de las Américas Puebla, Mexiko<br />
In diesem Vortrag wird zunächst ein kurzer Überblick über die Verwendung des<br />
Übersetzens und Dolmetschens im Fremdsprachenunterricht (FSU) unter Berücksichtigung<br />
der verschiedenen methodischen Ansätze gegeben. Zu Zeiten der Grammatik-<br />
Übersetzungsmethode erreichte sie ihren Höhepunkt, wenig später schon wurde sie<br />
z.B. durch die audiovisuelle und die Direkte Methode völlig aus dem FSU verdrängt. In<br />
Methoden wie der Suggestopädie und der Zweisprachigen Methode tauchte sie erneut<br />
auf, doch erst seit kurzem wird wieder ernsthaft über ihren Nutzen im FSU diskutiert,<br />
was darin gipfelte, dass einige Experten ihr sogar den Stellenwert einer fünften Fertigkeit<br />
(neben den vier Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen) zusprechen.<br />
193
194<br />
Sektion 10 v Sección 10<br />
Auch der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR) befürwortet<br />
die Sprachmittlung (d.h., das Übersetzen und Dolmetschen) als eine wichtige Teilkompetenz<br />
der Sprachenlerner. Durch den enormen Einfluss des GeR auf den lateinamerikanischen<br />
FSU i.A. ergibt sich die Frage, in wieweit auch der DaF-Unterricht in Mexiko<br />
hinsichtlich dieser Tendenz transformiert werden könnte bzw. schon wird. Konkret<br />
heiβt das, dass schon im Anfängerunterricht spezifische Übungen integriert werden<br />
können, die die Grundlagen für eine sprachmittelnde Kompetenz bilden können ohne<br />
jegliche negative Auswirkungen auf die linguistische produktiven sowie rezeptiven<br />
Fertigkeiten in der Fremdsprache zu haben. Es werden die Vor- und Nachteile, Chancen<br />
und Gefahren und neue Tendenzen des Übersetzens und Dolmetschens im FSU<br />
diskutiert, konkrete Anwendungsbeispiele erwähnt und über persönliche Erfahrungen<br />
mit dem Übersetzungs- und Dolmetschunterricht für fortgeschrittene Englisch- und<br />
Spanischlerner berichtet.
Kulturprogramm v Programa cultural<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanisten Verbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Rainald Grebe und Jens-Karsten<br />
Stoll: Grüße aus der Heimat. Neue<br />
deutsche Volkslieder<br />
Goethe-Institut Mexiko<br />
Mo 05.03.2012<br />
18:00 Uhr<br />
Auditorium Salvador Allende.<br />
Rainald Grebe singt seine Lieder über<br />
Bundesländer, Regionen, Städte. Fahrtenlieder,<br />
Liebeslieder, Lieder über Arbeit<br />
© Jim Rakete © privat<br />
und Soziales, eine Deutschlandreise in Songs. Der Pianist Jens Karsten Stoll begleitet ihn<br />
oder singt alte Volkslieder und Schlager, die oft bei Rainald Grebe mitschwingen.<br />
Karikaturenausstellung: Die Macht<br />
der Zeichnung - MeisterSchüler der<br />
Komischen Kunst<br />
Eine Ausstellung des Goethe-Instituts<br />
Mexiko und der Caricatura Kassel<br />
05.03.-09.03.1012<br />
Bibliothek „Dr. Manuel Rodríguez<br />
Lapuente“<br />
Mo-Fr 8:00 – 20:00 Uhr<br />
Sa 9:00 – 19:00 Uhr<br />
Komische Kunst ist scharfe Satire,<br />
tiefgründiger Humor und Nonsens in<br />
©privat<br />
Form von Karikaturen oder Malerei auf<br />
Papier gebannt. Sie überspitzt, verzerrt und widerspricht. Die Komische Kunst kritisiert,<br />
hinterfragt und amüsiert sich über aktuelle Themen, Personen oder Ereignisse.<br />
In oft nur wenigen Strichen, die flüchtig hingekritzelt erscheinen, entfaltet sie eine<br />
ungemeine Macht: Sie kann aufwecken und erschrecken, vernichten und verändern.<br />
Die Komische Kunst geht weit über die bloße Unterhaltung hinaus.<br />
Die CARICATURA ist mit einer Galerie in Kassel, dem Museum für Komische Kunst<br />
in Frankfurt am Main und einer Agentur die führende Institution für Komische Kunst<br />
in Deutschland. Sie verfügt über eine Sammlung von mehr als 12000 Zeichnungen<br />
195
196<br />
Kulturprogramm v Programa cultural<br />
und hat sich an der Seite der weltberühmten documenta in Kassel etabliert. Seit<br />
2007 bildet sie in Sommerakademien Nachwuchs aus. Die Ausstellung portraitiert<br />
das Gestern, Heute und Morgen der deutschen Karikatur: die bisherigen zwölf Dozenten<br />
der Sommerakademien – allesamt Star-Zeichner der Komischen Kunst - sowie<br />
die zwölf erfolgreichsten Talente, die aus den Workshops hervorgegangen sind.<br />
In über ca. 100 Zeichnungen zeigen die<br />
„MeisterSchüler ̏ Komik in Deutschland in all ihren Facetten und entführen die<br />
Besucher auf einen verschlungenen Pfad von Stilen und Generationen. Die Meister<br />
werden repräsentiert von den Malern der Komischen Kunst (Kahl, Hurzlmeier, Haderer<br />
und Glück), den Cartoonisten (z.B. Greser & Lenz, Stephan Rürup) sowie den Vertretern<br />
der caricature brute (Rattelschneck, Hauck & Bauer). Bei den Schülern finden<br />
sich neben aktuellen Stars der Szene wie Sowa Newcomer (Kittihawk, Holtschulte)<br />
und Cartoonisten, die direkt vorm Durchbruch stehen (Lilli Bravo, Finkenstein oder<br />
Riegel), alles Namen, von denen in den kommenden Jahren viel zu sehen sein wird.<br />
Lesung: Tarek Eltayeb<br />
Foro Cultural de Austria, BMUKK<br />
Di 06.03.2012<br />
18:00 Uhr<br />
Auditorium Salvador Allende<br />
Das österreichsiche Kulturforum in Mexiko, in Zusammenarbeit<br />
mit dem österreichischen Bundesministerium für Unterricht,<br />
Kunst und Kultur, präsentiert eine Lesung des Schriftstellers Tarek<br />
Eltayeb, ein Vertreter der österreichischen Migrantenliteratur,<br />
welcher in El Kairo geboren ist und seit 1984 in Wien lebt.<br />
Plenarvortrag Juan Villoro:<br />
* “Te doy mi palabra” Un itinerario en la traducción<br />
Cátedra Cortázar (Lehrstuhl Cortázar)<br />
Do 08.03.2012<br />
19:00 Uhr<br />
Paraninfo Enrique Díaz de León.<br />
Wenn man auf Deutsch etwas nicht versteht,<br />
sagt man “Das kommt mir Spanisch vor”.<br />
In diesem Vortrag werde ich meine ersten<br />
Buchübersetzungen analysieren und Revue<br />
passieren lassen:<br />
“Aphorismen” von Lichtenberg bestand genaugenommen<br />
aus Aufzeichnungen, die der<br />
©privat<br />
©privat
Kulturprogramm v Programa cultural<br />
Physiker des 18. Jh. auf seinem Schreibtisch hinterließ und eigentlich nicht für die Öffentlichkeit<br />
gedacht hatte. Man könnte fast sagen, es handelte sich um geheime Niederschriften.<br />
Meine Übersetzung war die erste ausführliche Version dieser Aufzeichnungen<br />
in spanischer Sprache.<br />
Der Autor von “Memoiren eines Antisemiten”, Gregor von Rezzori, wurde als Proust<br />
der Nachkriegszeit heimatlos in Bukowina (heutiges Rumänien und früher Teil von<br />
Österreich-Ungarn) geboren und suchte nach verlorenen Zeiten und Imperien. Anhand<br />
seiner Schriften erlebt man eine Sprache, Nation und Identität von neuem.<br />
“Lieutenant Gustl” von Arthur Schnitzler stellt noch vor Joyce aber nach Dujardin<br />
den ersten deutschen inneren Monolog dar. Es geht um einen feigen Offizier, eine Geschichte,<br />
die es dem Autor wert war, aus der Armee ausgeschlossen zu werden. Wie bei<br />
Rezzori ist auch hier das Thema des Antisemitismus vertreten. Die Leitfrage ist hier: Wie<br />
übersetzt man eine Fremdsprache so, dass sie natürlich, spontan, nicht literarisch, aber<br />
als Teil des Denkens klingt? Man muss dabei die verschiedenen Arten des Spanischen<br />
berücksichtigen. In früheren Übersetzungen wurde Schnitzler einbürgernd übersetzt,<br />
sodass seine Schriften sehr einheimisch klangen. Gibt es aber überhaupt ein ganzheitlich<br />
„natürliches“ Spanisch?<br />
Das Trauerspiel “Egmont” von Goethe habe ich für die Compañía Nacional de Teatro<br />
(nationale Theaterkompanie in Mexiko-Stadt) übersetzt und etwas angepasst, indem<br />
ich den Kommentaren Schillers zu diesem Werk folgte. Das Werk des Phoenix von Weimar<br />
scheiterte bereits zu dessen Lebzeiten. Er versuchte es mit Musik von Beethoven<br />
zu retten, scheiterte jedoch erneut. Lediglich die Version von Goethes Freund, Schiller,<br />
konnte sich durchsetzen. Das Werk erzählt von der Unabhängigkeit von Spanien, eine<br />
Situation mit der wir uns identifizieren können.<br />
In diesem Vortrag beschreibe ich meinen persönlichen Ansatz zum Übersetzen. Ich<br />
möchte die Lehren, die ich aus der Übersetzung gezogen habe vermitteln; als ständiges<br />
Leitbild gelten dabei meine eigenen Übersetzungen.<br />
Hinweis: Dieser Plenarvortrag wird auf Spanisch vorgetragen!<br />
Lesung Egon Schwarz:<br />
Unfreiwillige Wanderjahre<br />
Fr 09.03.2012<br />
09:00-11:00 Uhr<br />
Auditorium Carlos Ramírez Ladewig<br />
Egon Schwarz wird sowohl aus dem<br />
deutschen Original seiner Autobiographie,<br />
Unfreiwillige Wanderjahre, als auch<br />
aus der spanischen Übersetzung, Vagabundeo<br />
forzado, vorlesen. Die Autobio- © Irène Lindgren<br />
197
198<br />
Kulturprogramm v Programa cultural<br />
graphie enthält eine Auseinandersetzung mit jenen geschichtlich bedingten Themen,<br />
die man für die Exilsituation erwarten würde: Verstoßenwerden aus der Geburtsstadt<br />
Wien, Verlust der österreichischen und europäischen Heimat, Entwurzelung in der südamerikanischen<br />
Fremde und in einem langsamen Anpassungsprozess die Erfahrung<br />
und Erkundung der Fremdheit. So schwierig die Erlebnisse auch waren, was die Autobiographie<br />
jedoch hervorhebt, ist Schwarz’ Philosophie der Emigration, die trotz allem<br />
aus einer Bejahung der Exilerfahrung besteht.<br />
Dokumentarfilm Juliana Fischbein<br />
Universidad de Buenos Aires, Instituto Goethe, Buenos Aires, Argentinien<br />
Fr 09.03.2012<br />
09:00-11:00 Uhr<br />
Auditorium Silvano Barba<br />
d e s a p a r e c e r<br />
Exilio y Memoria en el marco del Nacionalsocialismo y las dictaduras de los años ’70 en<br />
el Cono Sur*<br />
d e s a p a r e c e r<br />
Exil und Erinnerung im Rahmen des Nationalsozialismus und der Diktaturen der ‘70er<br />
Jahre in Südamerika*<br />
Esta documentación en formato audiovisual presenta experiencias colectivas e individuales<br />
surgidas a partir del establecimiento tanto del Nacionalsocialismo, como de<br />
las dictaduras de los años ’70 en el Cono Sur.<br />
Como explicita el subtítulo de la presentación, el trabajo se centra en el fenómeno<br />
del exilio sufrido por ciudadanos de uno u otro contexto histórico, y en algunos casos<br />
de ambos.<br />
A la desaparición forzada de carácter temporal que implica el exilio, se suma esa<br />
otra desaparición forzada que es la eliminación definitiva de personas puesta en práctica<br />
por el terrorismo de Estado.<br />
También en este punto se detiene la mirada: un modo de reconstruir la identidad<br />
de estos “desaparecidos” y hacerlos aparecer en la memoria colectiva de sus conciudadanos,<br />
es la colocación de marcaciones urbanas como monumentos, parques, placas<br />
recordatorias y “baldosas por la memoria”.<br />
Tanto los testimonios de quienes retornaron del exilio, como la presencia de este<br />
tipo de huellas, provocan la participación de aquellos que no se vieron tan directamente<br />
afectados por los estragos del totalitarismo.<br />
Se trata, en ambos casos, de visibilizar lo que alguna vez se intentó ocultar.
Kulturprogramm v Programa cultural<br />
Die vorliegende audiovisuelle Dokumentation präsentiert kollektive und individuelle<br />
Erfahrungen im Zusammenhang mit der Errichtung sowohl des nationalsozialistischen<br />
Regimes als auch der Diktaturen der ‘70er Jahre in Südamerika.<br />
Die Arbeit handelt vom Exil der Menschen in einem der beiden historischen Kontexte<br />
oder, in manchen Fällen, in beiden.<br />
Zu diesem vorläufigen Verschwinden von Bürgern kommt unter totalitären Systemen<br />
die endgültige Vernichtung von Menschen hinzu.<br />
Auch damit beschäftigt sich dieser Beitrag: Eine Art, die Identität der „Verschwundenen“<br />
zu rekonstruieren, um sie im kollektiven Gedächtnis ihrer Mitbürger präsent zu<br />
halten, ist das Verlegen von Gedenktafeln, Stolpersteinen, die Errichtung von Erinnerungsorten<br />
wie Denkmälern und Parks.<br />
Sowohl die Aussagen der Menschen, die aus dem Exil zurückkehrten, als auch diese<br />
Art topografischer Spuren führen zur Anteilnahme von denjenigen, die nicht so direkt<br />
von den Katastrophen des Totalitarismus betroffen waren.<br />
Es geht in beiden Fällen darum, ans Licht zu bringen, was die Machthaber einst verschweigen<br />
wollten.<br />
Hinweis: der Dokumentarfilm ist auf Spanisch mit deutschen Untertiteln<br />
199
Workshops v Talleres<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
200<br />
AMPAL-Workshops<br />
- Die Workshops werden am Freitag, den 9.3.2012, vormittag stattfinden -<br />
Freundschaft, Ostalgie und weite Welt: Der Spielfilm „Friendship!“<br />
(D 2010) im DaF-Unterricht<br />
Dieter Jaeschke<br />
ZfA - Deutsche Auslandsschularbeit International<br />
November 1989: Die Mauer ist gefallen, Deutschland im Freudentaumel, ganz<br />
Berlin eine einzige Party. Veit Jagoda will die neu gewonnene Freiheit sogleich<br />
nutzen, um sich einen Traum zu erfüllen: Das Begrüßungsgeld in harter D-Mark soll<br />
ihn zum westlichsten Punkt der Welt bringen, nach San Francisco. Sein bester Freund<br />
Tom wittert das große Abenteuer und möchte unbedingt mitkommen ins Land der<br />
unbegrenzten Möglichkeiten. Was Veit aber eigentlich im Sinn hat, ist die Suche nach<br />
seinem Vater. Der war in die Staaten geflohen, als der Sohn noch ganz klein war. Ein<br />
Bündel Geburtstagspostkarten aus San Francisco sind der einzige Hinweis auf seinen<br />
Aufenthaltsort. Veit möchte also unbedingt an seinem Geburtstag – in drei Wochen –<br />
am Pazifik sein. Leider reicht das Geld nur bis über den Atlantik und nach New York.<br />
Ohne Dollar, ohne Kontakte und mit ihrem einzigen Englisch-Wortschatz („Friendship! ̏)<br />
versuchen die beiden, ihr Ziel doch noch zu erreichen.<br />
Losgelöst von der Filmkritik, die Markus Gollers Film sehr unterschiedlich bewertet<br />
hat, sollen in dem Workshop zeitgemäße didaktische Anregungen zur Behandlung<br />
von Spielfilmen im Fremdsprachenunterricht vermittelt werden. Schüleraktivierende<br />
Strategien sind dabei genauso von Bedeutung wie die im interkulturellen Kontext<br />
spannende Annährung an den Begriff der „Freundschaft ̏. Ebenso bietet der Film Anlass,<br />
deutsch-deutsche Geschichte, die DDR und das Phänomen der „Ostalgie ̏ im DaF-<br />
Unterricht anzusprechen.<br />
Zur Arbeit mit Hörbüchern. Ein „Grenzgänger ̏ wird (neu) entdeckt<br />
Dr. Carmen Schier<br />
Herder-Institut, Universität Leipzig<br />
Globalisierung und wachsender technischer Fortschritt bleiben nicht ohne Einfluss<br />
auf die Vermittlung von Sprache und Kultur. Ein Medium, das literarische Hörbuch,<br />
erfährt in diesem Zusammenhang eine Art Renaissance beim Publikum. Sein Erfolg<br />
verstärkt zunehmend auch die wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Hörtexte im
Workshops v Workshops<br />
Fremdsprachenunterricht haben bereits eine relativ lange Tradition. Die Arbeit mit<br />
literarischen Hörbüchern dagegen, wo aus dem Hin-Hören ein Zuhören wird und neben<br />
der Komponente der Sinnkonstitution auch der ästhetische Genuss hinzu kommt, zieht<br />
erst seit einiger Zeit auch didaktisches Interesse auf sich und wird als literarisches,<br />
mediales und sprechkünstlerisches Phänomen in der Fremdsprachendidaktik gerade<br />
erst entdeckt.<br />
In diesem Workshop sollen zunächst gemeinsam Lernziele erarbeitet werden,<br />
die durch die Arbeit mit literarischen Hörbüchern erreicht werden können. Anhand<br />
konkreter Beispiele wird gezeigt, wie literarische Hörbücher mit dem Ziel der Förderung<br />
von Wahrnehmungskompetenzen und Teilkompetenzen wie Sprechen und Schreiben<br />
bearbeitet werden können. Darüber hinaus wird ein weltweit kostenlos zugängliches<br />
Projekt des Herder-Institutes mit dem Buchfunkverlag vorgestellt, das Lehrer<br />
motivieren und unterstützen soll, mit diesem Medium zu arbeiten. Schließlich erfolgt in<br />
Gruppen eine erste Überlegung zur Didaktisierung konkreter Hörbuchausschnitte für<br />
verschiedene Lerner auf unterschiedlichen Niveaustufen.<br />
Mündliches Erzählen im Fremdsprachenunterricht<br />
Prof. Dr. Karen Schramm<br />
Herder-Institut, Universität Leipzig<br />
Im Mittelpunkt des Workshops steht die Frage, wie sich das mündliche Erzählen von<br />
Erlebnis- und Phantasiegeschichten im Anfängerunterricht (auf A1- und A2-Niveau)<br />
für Erwachsene gezielt für den Spracherwerb nutzen lässt. Thematisiert (und praktisch<br />
erprobt) werden dabei sowohl das sprachförderliche Erzählen auf Seiten des oder der<br />
Kursleitenden (z.B. unter Verwendung von Elementen des Total Physical Response<br />
Storytelling) als auch didaktische Arrangements, in denen Kursteilnehmende mit<br />
begrenzten sprachlichen Mitteln erfolgreich in der Fremdsprache Deutsch erzählen.<br />
201
Verlagspräsentationen v Editoriales<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanisten Verbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
202<br />
- die Verlagspräsentationen finden am Freitag statt -<br />
Deutschlernen in der Post-Kreidezeit<br />
Martina Bartucz<br />
Cornelsen Verlag, Fachberaterin für Deutsch als Fremdsprache<br />
Der digitale Trend hat den Bildungsbereich voll erfasst. Mit seinem breiten Angebot<br />
an digitalen Lehrwerkskomponenten hat studio d Maßstäbe gesetzt und die neue<br />
DaF-Lehrwerksgeneration entscheidend geprägt. Video, digitaler Unterrichtsplaner<br />
oder Whiteboardmaterial gehören mittlerweile zum Standardangebot moderner DaF-<br />
Lehrwerke. Schlagwörter wie Lernerautonomie, Lernerzentriertheit, Interaktivität treten<br />
im Zusammenhang mit Beschreibungsmerkmalen der digitalen Komponenten immer<br />
wieder auf. Neue Medien können, aber müssen nicht zwangsläufig zu einer neuen<br />
Qualität des Lernen und Lehrens führen. Welchen Zugewinn für den Unterricht und<br />
den Lernerfolg die digitalen Komponenten von studio d ermöglichen, soll in dieser<br />
Veranstaltung gezeigt und diskutiert werden.<br />
Qualitätsstandards für die Mittelstufe - was ändert sich, was bleibt?<br />
Christina Kuhn<br />
Cornelsen Verlag<br />
Mit studio d die Mittelstufe B2 wird ein erfolgreiches Grundstufenlehrwerk<br />
fortgesetzt. Die Diskussion der bereits bekannten Prinzipien für das B2-Niveau war<br />
dazu ebenso notwendig wie ihre Erweiterung und Anpassung an die neue Zielgruppe<br />
und die Berücksichtigung der neueren Forschungen zum Spracherwerb und zur<br />
Sprachvermittlung. Im Mittelpunkt des Beitrags stehen deshalb zum einen die Fragen des<br />
Transfers von Qualitätsstandards aus der Grund- in die Mittelstufe und ihre notwendige<br />
zielgruppenadäquate Erweiterung. Zum anderen werden neuere Forschungsergebnisse<br />
z.B. im Bereich des Wortschatzes und im Umgang mit sprachlichen Routinen vorgestellt<br />
und ihre lehrwerksbezogene Umsetzung an Beispielen aus studio d die Mittelstufe B2<br />
gezeigt und zur Diskussion gestellt.
Verlagspräsentationen v Editoriales<br />
Menschen<br />
Anne Robert<br />
Hueber Verlag<br />
Neugierig auf Menschen?!<br />
Sprache dient dazu, Menschen kennenzulernen und Menschen hilft<br />
dabei, die deutsche Sprache kennenzulernen. Beim Lehrwerk Menschen<br />
(A1 bis B1) stehen Geschichten über Personen und deren Lebenswelten im<br />
Mittelpunkt. Verknüpft mit neuesten Erkenntnissen der Lernpsychologie schafft<br />
das Lehrwerk so die Basis für einen motivierenden Unterricht: Der Lernstoff<br />
wird übersichtlich, interessant und über verschiedene Kanäle vermittelt.<br />
Zahlreiche begleitende Materialien für Lernende, wie z. B. eine DVD-ROM mit Übungen<br />
für das Selbststudium vertiefen und erweitern den Stoff. Ein reichhaltiges Angebot<br />
an Lehrer-Materialien wie z.B. eine landeskundlich interessante DVD für den Einsatz<br />
im Unterricht, ein übersichtliches Lehrerhandbuch und Materialien für das Interaktive<br />
Whiteboard erleichtern die Gestaltung eines spannenden, vielfältigen Unterrichts.“<br />
DaF kompakt – das neue Lehrwerk für schnelle Lerner!<br />
Rainer Koch, Klett Verlag<br />
Fachberater für DaF<br />
Kompakt aufbereitet und auf die wesentlichen Inhalte der Niveaustufen fokussiert,<br />
führt DaF kompakt schnell zum Niveau B1. Das Lehrwerk richtet sich an Erwachsene,<br />
die bereits eine andere Fremdsprache gelernt haben und Deutsch insbesondere für das<br />
Studium oder den Beruf benötigen.<br />
Bereiten Sie Ihre Lernenden mit DaF kompakt auf reale Alltagssituationen und<br />
Kommunikation vor: Jede der 30 Lektionen enthält eine abgeschlossene Geschichte mit<br />
vielen Identifikationsmöglichkeiten. Systematisches Schreib- und Aussprachetraining<br />
begleitet die Lernenden von Anfang an.<br />
In diesem Workshop untersuchen wir, wie mittels der Lektionsgeschichten sowohl<br />
relevante Textsorten, Grammatik und Wortschatz als auch thematische, landeskundliche<br />
und interkulturelle Inhalte vermittelt werden. Lernen Sie DaF kompakt kennen und<br />
überzeugen Sie sich von seinen Vorteilen!<br />
Beste Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
Rainer Koch, Klett Verlag<br />
Fachberater für DaF<br />
Mit dem neuen Anfänger-Lehrwerk von Klett unterrichten Sie Deutsch echt, lebendig<br />
und mit viel Spaß. Authentische Charaktere, eine natürliche Sprache und unterhaltsame<br />
Hörspielsequenzen motivieren und machen Lust auf die deutsche Sprache und Kultur.<br />
203
204<br />
Verlagspräsentationen v Editoriales<br />
Sie rüsten die Lernenden in jeder Lektion zudem für die Handlungsbereiche privat,<br />
öffentlich und beruflich.<br />
Für erwachsene Lerner ohne Vorkenntnisse konzipiert, führt Aussichten in drei<br />
Bänden zur Niveaustufe B1 und ermöglicht durch abwechslungsreiche Übungen<br />
und vielfältige Komponenten, kreative Phonetikaufgaben sowie durch ein intensives<br />
Strategietraining die individuelle Förderung der Lernenden.<br />
Eine DVD mit Porträts realer Personen, umfangreiche Zusatzmaterialien und<br />
Moodle-Kursinhalte runden die Lektionen ab. Lernen Sie unser aktuelles DaF-Lehrwerk<br />
kennen und entdecken Sie neue Aussichten für Ihren Unterricht!<br />
„Deutsch sehen“: Die lebendige Brücke zur Sprache<br />
Foelke Feenders<br />
Langenscheidt Verlag<br />
Motivierende Filmszenen auf DVD am Beispiel des neuen Grundstufenlehrwerks<br />
„Netzwerk“ schaffen authentische Sprechanlässe. Die Lerner werden auf kulturelle<br />
Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufmerksam, entwickeln interkulturelle<br />
Fähigkeiten und werden emotional angesprochen. Daneben festigen sie ihr Hör- und<br />
Sehverständnis und trainieren ihre Sprechfertigkeit.<br />
Nicht nur die DVD, auch der Bezug auf die neue mediale Lernwelt der Lerner<br />
(z.B. Austausch auf „Facebook“) und der Lehrer (z.B. zusätzliches Material auf der<br />
Lernplattform „Moodle) stehen für ein modernes integratives Lehrwerk.<br />
Zum Unterrichtseinsatz von interaktiven Tafelbildern<br />
am Beispiel der Lehrwerke „Berliner Platz Neu“ und „Logisch!“<br />
Foelke Feenders<br />
Langenscheidt Verlag<br />
Interaktive Tafelbilder bieten zahlreiche Sprechanlässe und motivieren spielerisch<br />
zum Vertiefen grundlegender Strukturen.<br />
Wie kommunikativer Unterricht mit Hilfe dieses neuen Mediums möglich ist, (auch<br />
wenn ein Interactive Whiteboard nicht vorhanden sein sollte), wird in der Veranstaltung<br />
anhand von Beispielen und praktischen Tipps gezeigt.
Kooperationspartner v Instituciones organizadoras<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanisten Verbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
<strong>ALEG</strong><br />
Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Associação Latino-Americana de Estudos Germanísticos<br />
Lateinamerikanischer Germanistenverband<br />
Das Ziel des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes (<strong>ALEG</strong>) besteht in der<br />
Förderung der akademischen Forschung und Lehre im Bereich der deutschen Sprache<br />
und deutschsprachigen Literatur und Kultur in Lateinamerika, in Zusammenarbeit mit<br />
Germanisten und Germanistenverbänden aus allen anderen Kontinenten. Zu den Aufgaben<br />
gehört vor allem die regelmäßige Veranstaltung von Kongressen, im Abstand<br />
von drei bis vier Jahren.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter: http://aleg-online.org<br />
Der Lateinamerikanische Germanistenverband (<strong>ALEG</strong>) wurde am 27. April 1965<br />
in Mendoza (Argentinien) gegründet. Bisher wurden vom <strong>ALEG</strong> folgende Kongresse<br />
durchgeführt:<br />
I. Jornadas Nacionales de Literatura Germánica. Mendoza, Argentinien, 1955.<br />
II. Jornadas Universitarias de Literatura en Lengua Alemana. Mendoza, Argentinien,<br />
1965.<br />
III. Jornadas Universitarias de Literatura Alemana. Córdoba, Argentinien, 1969.<br />
IV. Lateinamerikanischer Germanistenkongress. São Paulo, Brasilien, 1973.<br />
V. Jornadas Universitarias de Literatura Alemana. Córdoba, Argentinien, 1979.<br />
VI. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos. Buenos<br />
Aires, Argentinien, 1985.<br />
VII. Congreso Latinoamericano de Germanística. Mendoza, Argentinien, 1991.<br />
VIII. Congreso Latinoamericano de Estudios Germanísticos. Mexiko Stadt, 24.-28.Oktober<br />
1994<br />
IX. Congreso Latinoamericano de Estudios Germanísticos. Concepción, Chile, 1998.<br />
X. Congreso Latinoamericano de Estudios Germanísticos. Caracas, Venezuela, 2000.<br />
XI. Congreso Latinoamericano de Estudios Germanísticos. São Paulo – Paraty –Petrópolis,<br />
Brasilien, 27.09- 03.10.2003.<br />
XII. Congreso Latinoamericano de Estudios Germanísticos. La Havanna, Kuba, 2006<br />
XIII. Congreso Latinoamericano de Estudios Germanísticos. Córdoba, Argentinien,<br />
2009.<br />
205
206<br />
Kooperationspartner v Instituciones organizadoras<br />
Universität Guadalajara (Universidad de Guadalajara)<br />
Die Universität Guadalajara wurde 1792 als vierte Universität in Mexiko im Zuge der<br />
spanischen Kolonisation gegründet. Heute besteht die Universität aus sechs Fakultäten,<br />
(Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Rechtswissenschaften, Ingenieurwissenschaften,<br />
Medizin und Wirtschaftswissenschaft), die in sechs verschiedenen Bezirken<br />
der Fünf-Millionenstadt Guadalajara liegen; die meisten befinden sich jedoch in Zentrumsnähe.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.udg.mx/<br />
Geisteswissenschaftliches Zentrum CUCSH (Centro Universitario de Ciencias<br />
Sociales y Humanidades)<br />
Das Geisteswissenschaftliche Zentrum der Universität Guadalajara wurde 1994<br />
im Rahmen der 1989 begonnenen Strukturreform, welche zum Aufbau des Universitätsnetzwerkes<br />
Jalisco führte, gegründet. Das ihm zugeordnete Institut für Neuere<br />
Sprachen steht im engen Austausch mit einer Reihe von deutschsprachigen Universitäten,<br />
wie u.a. Köln, Tübingen, Freiburg, Bielefeld, Leipzig, Hamburg, Bayreuth, Berlin<br />
und Passau.<br />
Die Universität Guadalajara und vor allem dieses Universitätszentrum spielen in der<br />
Sprachförderung des Deutschen und im akademischen Austausch mit den deutschsprachigen<br />
Ländern eine bedeutsame Rolle innerhalb der Region und innerhalb Mexikos.<br />
So gibt es allein 41 Abkommen mit Universitäten aus deutschsprachigen Ländern,<br />
außerdem drei Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften (ISAP) mit den<br />
Universitäten Köln, Bielefeld und Hamburg, sowie eine Germanistische Institutspartnerschaft<br />
(GIP) und ein Doppelabschlussprogramm mit dem Herder-Institut der Universität<br />
Leipzig, alle <strong>Programm</strong>e vom DAAD gefördert.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.cucsh1.udg.mx/<br />
Lehrstuhl „Julio Cortázar“ der Universität Guadalajara (Cátedra „Julio Cortázar“)<br />
Ende Dezember des Jahres 1993 einigten sich die Schriftsteller Carlos Fuentes und<br />
Gabriel García Márquez darauf, ihre Stipendiengelder, die sie von der mexikanischen<br />
Regierung für ihre Tätigkeiten als emeritierte Künstler erhalten, zu nutzen, um den lateinamerikanischen<br />
Lehrstuhl „Julio Cortázar“ zu gründen. Diesen Lehrstuhl errichteten sie zu<br />
Ehren Julio Cortázars, eines der wichtigsten Schriftsteller Lateinamerikas des 20. Jahrhunderts.<br />
Am 12. Oktober 1994 wurde der Lehrstuhl „Julio Cortázar“ im Paraninfo Enrique Díaz<br />
de León der Universität Guadalajara eingeweiht. An dieser Feier nahmen Carlos Fuentes,<br />
Gabriel García Márquez und die verwitwete Ehefrau Cortázars, Aurora Bernárdez, teil.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.jcortazar.udg.mx/<br />
206
Kooperationspartner v Instituciones organizadoras<br />
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)<br />
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist die weltweit größte Förderorganisation<br />
für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern.<br />
Er wird als Verein öffentlichen Rechts von den deutschen Hochschulen und<br />
Studierendenschaften getragen und ist weltweit in 231 Universitäten und Institutionen<br />
vertreten. Mit mehr als 500 Repräsentanten ist der DAAD in 100 Ländern aktiv.<br />
In Mexiko gibt es eine Aussenstelle des DAAD sowie vier Lektoren in Mexiko City,<br />
Monterrey und Guadalajara.<br />
Der DAAD Mexiko verschickt einen Newsletter mit Nachrichten, die sich an alle mexikanischen<br />
Studenten, Dozenten, Wissenschaftler und anderen Personen richtet, die<br />
an Studium und Forschung in Deutschland interessiert sind.<br />
Monatlich wird darin über internationale Masterstudiengänge der deutschen Hochschulen<br />
informiert, sowie über Forschungsprojekte, Förder- und Stipendienprogramme<br />
für Mexikaner und akademische Veranstaltungen in ganz Mexiko.<br />
Der Newsletter kann bestellt werden über:<br />
www.daadmx.org<br />
Zudem hat der DAAD eine eigene Seite auf Facebook.<br />
Embajada de la República Federal de Alemania en México<br />
Die deutsche Botschaft in Mexiko gibt Informationen zum Rechts- und Konsularwesen,<br />
zur Kultur- und Wirtschaftszusammenarbeit sowie zu den deutschen Institutionen in<br />
Mexiko. Seit Oktober 2010 ist Dr. Edmund Duckwitz neuer deutscher Botschafter in Mexiko.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.mexiko.diplo.de<br />
Goethe- Institut<br />
Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik<br />
Deutschland. Wir fördern die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und pflegen<br />
die internationale kulturelle Zusammenarbeit. Wir vermitteln ein umfassendes Deutschlandbild<br />
durch Information über das kulturelle, gesellschaftliche und politische Leben.<br />
Das Goethe-Institut Mexiko-Stadt organisiert und unterstützt ein breites Spektrum<br />
kultureller Veranstaltungen zur Förderung des interkulturellen Austausches. Die Projekte<br />
entstehen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Institutionen des Gastlandes<br />
und werden häufig von deutschen Firmen gefördert. Unsere Kurse in „Deutsch als<br />
Fremdsprache“ bieten wir auf sechs differenzierten Stufen an. Spezifisch qualifizierte<br />
Lehrkräfte sichern mit modernen Materialien und Methoden den Lernerfolg, der sich<br />
durch international anerkannte Prüfungen bestätigen lässt. Die Bibliothek des Instituts<br />
vermittelt Informationen zu aktuellen Aspekten des kulturellen, gesellschaftlichen und<br />
politischen Lebens in Deutschland. Wir kooperieren außerdem mit anderen Bibliotheken<br />
und Fach-Institutionen in Mexiko, Zentralamerika und der Karibik.<br />
207
208<br />
Kooperationspartner v Instituciones organizadoras<br />
Die Arbeit des Goethe-Instituts Mexiko beschränkt sich nicht nur auf Mexiko, sondern<br />
es besteht eine enge Zusammenarbeit innerhalb eines kulturellen Netzwerkes aus<br />
Deutschen Botschaften, Kulturgesellschaften sowie Sprach- und Prüfungszentren in<br />
Costa Rica, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika,<br />
Kuba, Panama sowie in Trinidad und Tobago. Im Rahmen der Initiative „Schulen<br />
– Partner der Zukunft“ betreut das Goethe-Institut außerdem zwölf Partnerschulen. Die<br />
Zusammenarbeit mit den Ländern in Mittelamerika und der Karibik führt uns täglich<br />
vor Augen, dass ein reges Kulturleben die Entwicklung eines Landes entscheidend beeinflusst:<br />
Künstler und Kulturschaffende sind Seismografen und zugleich Mitgestalter<br />
gesellschaftlicher Veränderungen. Das Goethe-Institut fördert deshalb schwerpunktmäßig<br />
junge Spitzenmusiker und Filmtalente und organisiert Tourneen.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.goethe.de/mx<br />
Österreichisches Kulturforum Mexiko (Foro Cultural de Austria)<br />
Das Österreichische Kulturforum in Mexiko ist weltweit eines von 29 Kulturforen<br />
und das einzige in Lateinamerika. Es gehört zur Österreichischen Botschaft Mexikos und<br />
widmet sich Aktivitäten im Bereich von Kultur und Wissenschaft, wobei das Hauptaugenmerk<br />
auf zeitgenössischen künstlerischen Ausdrucksformen liegt. Ziel dieser Aktivitäten<br />
ist es, die Präsenz Österreichs in Mexiko als modernes, kreatives, offenes und<br />
kosmopolitisches Land zu stärken.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.austriadossier.com/esp/<br />
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur in Österreich (BMUKK)<br />
Der Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur<br />
umfasst das gesamte primäre und sekundäre staatliche Bildungswesen von der Pflichtschule<br />
bis zum Abschluss der Sekundarstufe 2 (Matura) sowie die Pädagogischen Hochschulen.<br />
Auch die Erwachsenenbildung und alle Angelegenheiten des lebenslangen<br />
Lernens gehören dazu. Im Bereich Kunst und Kultur ist das BMUKK für die Förderung<br />
aller Sparten des Kunstschaffens durch den Bund für sowie für die Pflege und Erhaltung<br />
des kulturellen Erbes (Bibliotheken, Bundesmuseen, Denkmalschutz, Kulturförderung)<br />
und die Bundestheater verantwortlich.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bmukk.gv.at/<br />
Mexikanischer Deutschlehrerverband AMPAL<br />
(Asociación Mexicana de Profesores de Alemán)<br />
AMPAL wurde im Jahr 1992 gegründet. Zu den wichtigsten Zielen unserer Organisation<br />
gehören die Förderung der Unterrichts- und Forschungstätigkeiten im Bereich<br />
Deutsch als Fremdsprache, die Unterstützung des Faches Deutsch als Fremdsprache<br />
und anderer Bereiche der deutschen Sprache und Kultur, die Förderung der Kommuni-
Kooperationspartner v Instituciones organizadoras<br />
kation und des Erfahrungsaustausches im Bereich Deutsch als Fremdsprache, die Förderung<br />
der Kontakte zu ähnlichen Institutionen im In- und Ausland sowie die Förderung<br />
von Veröffentlichungen im Fach Deutsch als Fremdsprache.<br />
AMPAL organisiert jedes Jahr eine größere Veranstaltung, das AMPAL-Treffen (Encuentro<br />
AMPAL) und die DACH-Tage (Jornadas DACH). Diese letztere sind wichtige<br />
Fortbildungsveranstaltungen. AMPAL veröffentlicht regelmäßig folgende Publikationen:<br />
die Verbandszeitschrift Info-ampal, die Memorias der AMPAL-Treffen und den digitalen<br />
Rundbrief “AMPAL... am Ball”. Außerdem arbeitet AMPAL an der Zeitschrift der<br />
lateinamerikanischen Deutschlehrerverbände “DaF-Brücke” aktiv mit. Der Mexikanische<br />
Deutschlehrerverband AMPAL fördert auch den Kontakt zum Internationalen Deutschlehrerverband<br />
(IDV) und anderer Sprachverbände im In- und Ausland.<br />
Im Internet ist AMPAL nicht nur durch seine moderne Webseite www.ampal.org<br />
(Menüs: Forum und Kontakt), sondern auch durch die wichtigsten sozialen Netzwerken<br />
zu erreichen: im Facebook unter “AMPAL Mexico Mexikanischer Deutschlehrerverband”,<br />
beim Twitter unter @AMPAL_Mex_DLV, bei LinkedIn unter “AMPAL Mexico”.<br />
Alexander von Humboldt Stiftung<br />
Jährlich ermöglicht die Alexander von Humboldt-Stiftung über 2.000 Forschern aus<br />
aller Welt einen wissenschaftlichen Aufenthalt in Deutschland. Die Stiftung pflegt ein<br />
Netzwerk von weltweit mehr als 25.000 Humboldtianern aller Fachgebiete in über 130<br />
Ländern, unter ihnen 48 Nobelpreisträger.<br />
Die Alexander von Humboldt-Stiftung für Naturforschung und Reisen war 1860<br />
ein Jahr nach dem Tod Alexander von Humboldts in Berlin gegründet worden. Sie<br />
unterstützte bis zum Verlust des Stiftungskapitals in der Inflationszeit 1923 vor allem<br />
Forschungsreisen deutscher Wissenschaftler in andere Länder. 1925 gründete das<br />
Deutsche Reich eine neue Alexander von Humboldt-Stiftung. Ihr Zweck war, vor allem<br />
ausländische Studenten und später auch Wissenschaftler und Doktoranden während<br />
ihres Aufenthalts in Deutschland zu unterstützen. 1945 stellte diese Stiftung ihre Tätigkeit<br />
ein. Auch auf Anregung ehemaliger Humboldt-Gastwissenschaftler wurde die heutige<br />
Alexander von Humboldt-Stiftung am 10. Dezember 1953 von der Bundesrepublik<br />
Deutschland errichtet. Ihr Sitz war und ist in Bonn-Bad Godesberg.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.humboldt-foundation.de/<br />
209
Masterstudiengang Deutsch als Fremdsprache:<br />
Estudios interculturales de lengua, literatura y cultura alemanas<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Der binationale Master-Studiengang Estudios interculturales de lengua, literatura<br />
y cultura alemanas ist ein gemeinsames Angebot des Herder-Instituts der Universität<br />
Leipzig (UL) und der Deutschabteilung am Departamento de Lenguas Modernas der Universidad<br />
de Guadalajara (UdeG), Mexiko. Er ist als forschungsorientierter und berufsqualifizierender<br />
4semestriger Präsenzstudiengang mit Fokussierung auf den mexikanischdeutschen<br />
Sprach- und Kulturraum konzipiert.<br />
Der Studiengang richtet sich an besonders motivierte und qualifizierte Graduierte<br />
der Fächer Deutsch als Fremdsprache und Germanistik sowie verwandter Studiengänge,<br />
die ein ausgeprägtes Interesse für die spanischsprachigen Länder mitbringen.<br />
Deutschkenntnisse müssen auf dem Niveau B2 nachgewiesen werden, Spanischkenntnisse<br />
auf dem Niveau B1 (Leseverstehen B2).<br />
Das 1. und 4. Semester verbringen die Studierenden an der Heimatuniversität<br />
(UdeG oder UL), das 2. und 3. Semester an der Partneruniversität. An beiden Standorten<br />
können die Studierenden Veranstaltungen aus den inhaltlichen Kernbereichen des Studiengangs<br />
wählen und dabei je nach Interesse ganz individuelle Schwerpunkte setzen:<br />
Linguistik, Didaktik, Literatur- und Übersetzungswissenschaft, Kulturwissenschaft.<br />
Die aktuelle Ausschreibung von Seiten der UdeG für den Master-Studiengang<br />
ist vom 27.2. bis 28.5.2012 geöffnet und auf der Homepage des CUCSH zu finden:<br />
http://www.cucsh1.udg.mx/programas_academicos<br />
210<br />
Informationen zum <strong>Programm</strong> außerdem auch unter:<br />
http://www.uni-leipzig.de/herder/<br />
Kontakt Universität Guadalajara:<br />
Dra. Olivia Concepción Díaz Pérez, E-Mail: odiaz@cencar.udg.mx<br />
Dr. Florian Gräfe, E-Mail: masterdafudg@yahoo.com.mx<br />
Kontakt Universität Leipzig:<br />
Prof. Dr. Erwin Tschirner<br />
Herder-Institut Universität Leipzig<br />
Beethovenstr. 15 D-04107 Leipzig<br />
E-Mail: tschirner@uni-leipzig.de
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
XIV. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes<br />
XIV. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos<br />
Alcalde Mato, Nuria<br />
Hochschulstudium mit Diplomabschluss im Fach Germanistik an der Universität<br />
Valladolid. Seit 1996 wohnhaft in Saarbrücken, wo sie in verschiedenen<br />
Einrichtungen, wie Gymnasien, universitären Sprachenzentren oder öffentlichen<br />
und privaten Sprachschulen, als Spanischlehrerin unterrichtet hat. Seit 2003 arbeitet<br />
sie in einer Festanstellung als Spanischlektorin an der Universität des Saarlandes<br />
in Saarbrücken. Ihre Vorlesungen umfassen Sprachkurse, Übersetzungsübungen,<br />
Linguistik und spanische Landeskunde. Seit 2008 ist Frau Alcalde Mato<br />
freie Mitarbeiterin beim deutschen Verlag C.C. Buchner und Mitverfasserin<br />
spanischer Lehrbücher für den Spanischunterricht an deutschen Gymnasien. Ihre<br />
Forschungsaktivitäten konzentrieren sich auf eine Unterrichtsanalyse der deutschen<br />
und spanischen Sprache als Fremdsprachen, genauer gesagt, auf die Verwendung<br />
der Lexik in Lehrbüchern sowie die Methodik des Sprachunterrichts. Diese Themen<br />
sind zentraler Bestandteil ihrer Doktorarbeit und waren Gegenstand von Vorträgen<br />
auf nationalen und internationalen Kongressen sowie Veröffentlichungen in<br />
Fachzeitschriften.<br />
E-Mail: n.alcalde@mx.uni-saarland.de<br />
Althaus, Hans-Joachim Dr.<br />
Studium der Empirischen Kulturwissenschaft und Neueren Deutschen Literatur.<br />
Nach Studium, journalistischer Tätigkeit und verschiedenen Forschungsprojekten<br />
in den Kulturwissenschaften, der Germanistik/DaF und der Soziologie an der<br />
Universität Tübingen Arbeit im Ausland als Sprachlehrer im Goethe-Institut<br />
Warschau, DAAD-Lektor an der Uniwersytet Wrocławski (Breslau, Polen). Seit<br />
Ende 2000 Leiter des TestDaF-Instituts und Geschäftsführer der Gesellschaft für<br />
Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V. Ehrenamtliche<br />
Tätigkeit in Kommissionen und Beiräten des DAAD und der Zentralstelle für das<br />
Ausländische Schulwesen. Publikationen siehe www.testdaf.de.<br />
E-Mail: saskia.six@testdaf.de<br />
Andress, Reinhard Dr.<br />
Reinhard Andress wurde als Sohn deutscher Emigranten in Milwaukee, Wisconsin,<br />
USA geboren. Nach einem Doktorstudium der Germanistik an der University of<br />
Illinois bekleidete er Stellen an Middlebury College, Colby College, Alfred University<br />
und Saint Louis University, wo er zum Professor of German befördert wurde, das<br />
Department of Modern and Classical Languages leitete und nun als Associate<br />
Dean for Graduate Affairs fungiert. Er unterrichtet deutsche Sprache, Literatur und<br />
211
212<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Kultur und forscht zur DDR-Literatur, zur deutschen Exilliteratur und Alexander<br />
von Humboldt. Zu seinen Veröffentlichungen gehören: Protokolliteratur in der<br />
DDR: der dokumentierte Alltag (2000), „Der Inselgarten“ - das Exil deutschsprachiger<br />
Schriftsteller auf Mallorca, 1931-1936 (2001) und als Herausgeber (unter Mitarbeit<br />
von Evelyn Meyers und Greg Divers) Weltanschauliche Orientierungsversuche im<br />
Exil / New Orientations of World View in Exile (2010). Ebenfalls hat er den Exilroman<br />
von Marte Brill, Der Schmelztiegel (2002), und zusammen mit Egon Schwarz Benno<br />
Weiser Varons Exilroman Yo era europeo als Ich war Europäer (2008) übersetzt.<br />
E-Mail: andressp@slu.edu<br />
Antonic, Thomas<br />
Thomas Antonic, Mag. Dr. phil., geb. 1980 in Bruck an der Mur (Österreich), Studium<br />
der Germanistik und Philosophie an den Universitäten Wien und Graz, lebt als<br />
Kulturwissenschaftler und Kunstschaffender in Wien, arbeitet zur Zeit am Institut<br />
für Germanistik der Universität Wien an einem umfangreichen Forschungsprojekt<br />
zu Werk, Nachlass und Wirkung Wolfgang Bauers, das 2008 von Wendelin Schmidt-<br />
Dengler initiiert wurde. Forschungsaufenthalte in Berlin und Berkeley, mehrere<br />
Publikationen, zuletzt: „‚Darm-Realismus‘ und Ich-Verlust zwischen Fiktion und<br />
Wirklichkeit. Überlegungen zu Wolfgang Bauers letztem Theaterstück Foyer.“ In:<br />
Modern Austrian Literature 44 (2011), No. 3–4; und Herausgeber von Wolfgang<br />
Bauer: Der Geist von San Francisco. Verstreut publizierte und nachgelassene Texte. Mit<br />
einem einleitenden Essay von Elfriede Jelinek. Klagenfurt/Graz/Wien: Ritter 2011.<br />
E-Mail: thomas.antonic@univie.ac.at<br />
Arnold, Sonja<br />
Von 2002-2007 Studium der Germanistik, Anglistik, Romanistik (Spanisch) in<br />
Stuttgart, Freiburg, Granada. Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes<br />
von 2005-2007. Von 2008-2011 Promotion an der Albert-Ludwigs-Universität<br />
Freiburg und Stipendiatin im Promotionskolleg Geschichte und Erzählen (Abgabe<br />
der Dissertation im April 2011, Promotionsprüfung im Januar 2012). Titel der<br />
Dissertation: Erzählte Erinnerung. Das autobiographische Gedächtnis im Prosawerk<br />
Max Frischs (Betreuer: Prof. Dr. Günter Schnitzler, Prof. Dr. Rolf Kailuweit). Seit August<br />
2011 DAAD-Lektorin an der UFRGS in Porto Alegre (Brasilien).<br />
E-Mail: daad_porto_alegre@daad.org.br<br />
Auf der Maur Tomé, Simone<br />
1999: Lizentiat Universität Zürich (Lehramt Anglistik/Germanistik). Seit 2000:<br />
Lektorin für Deutsch an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität<br />
Porto. Arbeitsschwerpunkte: Methodik und Didaktik Deutsch als Fremdsprache,<br />
Lehrerausbildung. 2007: Mestrado em Estudos Alemães (Universität Porto). Seit 2009:<br />
Doktorandin in Fremdsprachen-Didaktik (Universität Porto).<br />
E-Mail: stome@letras.up.pt
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Augustin, Günther<br />
Geboren 1942 in Stuttgart. Studium in Anglistik und Geschichte an der Universität<br />
Hamburg. Auslandsstudium an der Hull University in England. Abschlüsse des<br />
Lehramtsstudiums in Wissenschaftlicher Politik, Geschichte und Anglistik an der<br />
Universität Tübingen. Studienrat am Gymnasium. 1976-1979 DAAD-Lektor an der<br />
Sheffield University in England. Übersiedlung nach Brasilien. Deutschlehrer in<br />
einer multinationalen Firma mit interkulturellem Training brasilianischer leitender<br />
Angestellten. Seit 1996 Professor für deutsche Sprache, Literatur und Kultur sowie<br />
Vergleichender Literaturwissenschaft. Postdoktorat an der University of California<br />
in Berkeley. Forschungsschwerpunkte: Sprach- und Kulturvergleich; Interkulturelle<br />
Literatur.<br />
E-Mail: gha@ufmg.br; gaugustin@hotmail.com<br />
Bahr, Christian<br />
Geboren 1982 in Jena. - 2003-2009: Studium Diplom-Übersetzen (Spanisch,<br />
Französisch) an der Universität Leipzig, mit Auslandssemestern in Havanna und<br />
Genf. - seit 2010: wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Iberoromanische<br />
Sprach- und Übersetzungswissenschaft des Instituts für Angewandte Linguistik<br />
und Translatologie der Universität Leipzig.<br />
E-Mail: chbahr@gmx.de<br />
Bard Cordero, Franziska<br />
Seit 2005 Deutschlehrerin an der Universidad Veracruzana, Campus Xalapa. 2006<br />
– 2010: Mitglied im Ampal-Vorstand. 2006 – 2010: Licenciatura en la Enseñanza de<br />
Lenguas Extranjeras (LICEL). Seit 2007: ÖSD-Prüferin.<br />
E-Mail: fbard@uv.mx<br />
Bäuerle, Rainer Prof.<br />
Geboren 1949 in Stuttgart. Promotion zur Tempussemantik 1978 in Konstanz.<br />
1979/80 Postdoc Wellington/NZ, Habilitation 1988 in Konstanz. Tätigkeit in Konstanz<br />
(1974 – 1985, Sprachwissenschaft), Tübingen (1985 – 1988, Computerlinguistik) und<br />
Stuttgart (seit 1988, Computerlinguistik). Hauptarbeitsgebiete: Semantik, Pragmatik.<br />
E-Mail: rainer@ims.uni-stuttgart.de<br />
Bernstein, Nils Dr. des.<br />
geb. 1979. 2001 bis 2006 Studium Germanistik, Theaterwissenschaft, Komparatistik<br />
und Deutsch als Fremdsprache an der Universität Mainz. 2011 Promotion an der<br />
Universität Wuppertal (Stipendium der Landesgraduiertenförderung und des<br />
Literaturarchivs Marbach). 2006/07 DAAD-Sprachassistent an der Universidad de<br />
Chile in Santiago. 2008 bis 2009 Lehrbeauftragter an den Universitäten Wuppertal<br />
und Hannover. seit August 2011 DAAD-Lektor am CELE der UNAM, Mexiko-Stadt<br />
(Sprachkurse, Lehrerausbildung, Linguistik- und Literaturwissenschaftsseminare).<br />
E-Mail: bernstein@daadmx.org<br />
213
214<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Bickelmann, Peter Dr.<br />
Studium der Hispanistik; Lehrer für Deutsch und Englisch in Deutschland,<br />
Großbritannien, Thailand, Albanien und Kolumbien; promoviert in Deutsch<br />
als Fremdsprache; Interessenschwerpunkte: interkultureller Zweit- und<br />
Fremdsprachenunterricht, Grammatik, Textsorten.<br />
E-Mail: pbickelmann@yahoo.com<br />
Biedermann, Anne<br />
Anne Biedermann ist Lehrerin für Deutsch/DaF, Französisch und Spanisch. Seit August<br />
2010 ist sie DAAD-Lektorin an der Universidad de Concepción im Süden Chiles.<br />
E-Mail: abiedermann@udec.cl<br />
Boehm, Siegfried<br />
Der Referent ist seit 26 Jahren an der Deutschabteilung des Sprachenzentrums der<br />
FES Acatlán, UNAM tätig. Im Jahre 1992 hat er eine Übersetzerausbildung am El<br />
Colegio de México beendet, wo er später auch Übersetzungsunterricht erteilt hat.<br />
Außer dem DaF-Unterricht hat er Fremdsprachendidaktik in Letras Modernas an der<br />
Fakultät Filosofía y Letras gelehrt und derzeit ist er Tutor für zwei „Online-Fächer“<br />
der Licenciatura de Enseñanza de Lenguas (LICEL) an der FES Acatlán. Er ist Autor<br />
von zwei Lesekursen, einem Handbuch des Studienfachs „Bräuche und Kultur der<br />
deutschsprachigen Länder“ (LICEL), dem Buch La didáctica teatral como medio para<br />
lograr una sensibilidad intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras sowie<br />
von zahlreichen Artikeln und Aufsätzen im Bereich der Fremdsprachenforschung<br />
und Übersetzung. Zur Zeit arbeitet er am Projekt „Diplomado de traducción“ am<br />
Sprachenzentrum der FES Acatlán, UNAM mit.<br />
E-Mail: sboehm30@yahoo.com.mx<br />
Bonilla, Joshua<br />
Joshua Clemente Bonilla graduierte 2001 an der Princeton University und ist seit<br />
2003 Doktorand an der University of Chicago. Der zentrale Schwerpunkt seiner<br />
Dissertation, “Transubstantiating the Stage: Calderón and the Invention of German<br />
Romantic Drama,” ist die deutsche ‘Entdeckung’ der spanischen Literatur des<br />
goldenen Zeitalters. Behandelt werden die verschiedenen Neuerfindungen der<br />
barocken Dramatik auf der deutschen Bühne und in der literarischen Theorie unter<br />
anderem in den Werken von Ludwig Tieck, den Gebrüdern Schlegel, Clemens<br />
Brentano und Goethe. Bonillas Lektüre dieses so genannten ‘Calderonismus’<br />
untersucht sowohl das romantische Interesse an Calderóns comedias als auch die<br />
oft übersehenen und missverstandenen Einflüsse von Cervantes, Lope de Vega<br />
und Calderóns Fronleichnahmspielen. Nicht zuletzt behandelt sein Projekt den<br />
Calderonismus als Übergang von der Frühromantik in deren spätere nationalistische<br />
und katholische Iterationen. Seine weiteren Forschungsinteressen sind Theatralität<br />
im europäischen Barock, die Möglichkeit einer spanischen Romantik, deutscher Film
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
der Nachkriegszeit sowie Phantasie und Erinnerung im literarischen Realismus.<br />
E-Mail: bonilla@uchicago.edu<br />
Brumm, Maria<br />
Studium der Romanistik und Geschichte an den Universitäten von München,<br />
Madrid und Mexiko (UNAM).Master in Angewandter Sprachwissenschaft.<br />
Langjährige Erfahrung im Fremdsprachen-unterricht (DaF, Fle) am Centro de<br />
Enseñanza de Lenguas Extranjeras, UNAM und seit 1989 am Sprachenzentrum<br />
der Universität von Michoacan. Lehrerausbildung, Fremdsprachenlehrer und<br />
Lehrer von Indianersprachen. (Maria Brumm ; Formación de profesores de lenguas<br />
indígenas, INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, México, DF., 2010)<br />
Zahlreiche Übersetzungen, u.a. das dt-tarahumarische Wörterbuch von P.M. Steffel<br />
(Manuskript,1791 und Buchversion von 1809) und die Schriften von Gerhart Muench.<br />
E-Mail: brumm@umich.mx, mariabrumm49@gmail.com<br />
Bujaldón de Esteves, Lila Prof. Dr.<br />
Lila Bujaldón de Esteves ist Professorin für Germanistik und Komparatistik an<br />
der Universidad Nacional de Cuyo in Mendoza, Argentinien. Gleichzeitig ist sie<br />
Forscherin des CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)<br />
Argentiniens und Herausgeberin des Boletín de Literatura Comparada. Ihre<br />
Schwerpunkte sind Exilliteratur, Geschichte der Germanistik, deutsch-argentinische<br />
Kulturbeziehungen, Reiseliteratur und komparatistische Imagologie.<br />
E-Mail: lilabujaldon@gmail.com<br />
Campos de Albuquerque Mello, Suzana<br />
Sprachwissenschaft (Germanistik- an der USP 2004); Magisterarbeit (Germanistik an<br />
der USP 2009); Dozentin (deutsche Sprache) bei der FATEC-SP (Es ist eine staadtliche<br />
Fakultät) in den Kursen: Tourismus und Sekretatiat seit 2009.<br />
E-Mail: janaina.ft.su@gmail.com<br />
Castillo Rodríguez, Girla<br />
Girla Castillo Rodríguez ist am 25. November 1987 in Mexiko City geboren. Sie hat<br />
an der Fakultät für Philosophie und Sprachen der UNAM Deutsche Literatur studiert<br />
und schreibt zur Zeit ihre Abschlussarbeit über die Umdeutung des Mythos<br />
der Medea im Werk von Christa Wolf. Sie hat auch den Artikel “Medea: ¿bruja asesina<br />
o fármacos? Deconstrucción del mito en Christa Wolf” im Anuario de Letras der<br />
gennanten Fakultät veröffentlicht. Sie arbeitet am Colegio Alemán Alexander von<br />
Humboldt als Bibliothekarin, Deutschlehrerin, Übersetzerin und Dolmetscherin.<br />
E-Mail: yirlacr@hotmail.com<br />
Colliander, Peter Prof. Dr.<br />
Jetzige Position: Professor für moderne deutsche Sprache an der<br />
Wirtschaftsuniversität Kopenhagen (= Copenhagen Business School); außerdem<br />
habe ich eine Sondergastprofessur am Institut für Deutsch als Fremdsprache,<br />
215
216<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Universität München, inne. 2008-2010: Lehrstuhlvertretung am Institut für Deutsch<br />
als Fremdsprache, Universität München. 2006-2010: Inhaber des Lehrstuhls für<br />
deutsche Sprache und Kultur an der Universität Jyväskylä/Finnland. Studium<br />
der germanischen Philologie in Kopenhagen; Promotion in Kopenhagen<br />
zum Thema Korrelate im Deutschen. Mehrere Aufenthalte an der Universität<br />
München als Alexander-von-Humboldt-Stipendiat. Verfasser und Mitverfasser<br />
mehrerer kontrastiver Lehrwerke im Bereich der deutschen Grammatik und<br />
Phonetik/Phonologie und der linguistischen Pragmatik. Verfasser vieler Aufsätze<br />
zu theoretischen linguistischen Themen, zur Vermittlung des deutschen als<br />
Fremdsprache, zur Übersetzungswissenschaft und zur Fremdsprachenpolitik. Ca.<br />
150 Vorträge auf wissenschaftlichen Kongressen<br />
E-Mail: pc.ikk@cbs.dk<br />
Costa Pereira, Rogeria<br />
Sprach- und Literaturwissenschaftstudium (Portugiesisch, Französisch und<br />
Deutsch) und Magisterstudiengang Theoretische und Angewandte Linguistik<br />
an der Universidade Federal do Ceará-UFC. Doktorandin an der Universität Bonn.<br />
Schwerpunkt der Arbeit: Erwerb des Deutschen durch Portugiesischsprechende<br />
der brasilianischen Varietät. Seit 1993 Dozentin an der Casa de Cultura Alemã-UFC.<br />
Verschiedene Veröffentlichungen und Vorträgen zu folgenden Themen: Musik im<br />
DaF-Unterricht, Ausspracheerwerb des Deutschen durch Portugiesischsprechende,<br />
Neue Medien im DaF-Unterricht.<br />
E-Mail: pc.ikk@cbs.dk<br />
Da Silva Simões, José Dr.<br />
Dozent für Deutsch als Fremdsprache. Seit 2003 Forschungsprojekte im Bereich der<br />
Diakronie des brasilianischen Portugiesischen (Projeto Para a História do Português<br />
Brasileiro). Seit 2008 in der DaF-Lehrerausbildung der USP tätig.<br />
E-Mail: jssimoes@uol.com.br<br />
Dávalos, Patricia Miranda<br />
Die Autorin hat ihre Magisterarbeit („Ficção e autobiografia: Uma análise<br />
comparativa das narrativas de Thomas Bernhard ̏) 2010 an der Universidade de<br />
São Paulo geschrieben. Zur Zeit arbeitet sie als DAF-Lehrerin und beschäftigt sie<br />
sich weiter mit den Beziehungen zwischen fiktionalen und faktualen Gattungen,<br />
sowie mit der Darstellung persönlicher Erfahrungen und politischen Ereignissen<br />
in der Literatur. Sie hat Anfang dieses Jahres ihre Doktorarbeit begonnen, deren<br />
Schwerpunkt das Werk Christa Wolfs ist.<br />
E-Mail: athena_glaucopis@yahoo.com.br<br />
Dettmer, Martin<br />
Studium der Soziologie in Hannover. Seit 1987 Deutschlehrer an der<br />
Deutschabteilung der Escuela de Lenguas-Tuxtla der Universidad Autónoma
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
de Chiapas (UNACH). Seit 1992 Leiter der Deutschabteilung. Seit 2007 Leiter der<br />
akademischen Gruppe “Berufliche Entwicklung und Evaluation in Fremdsprachen”.<br />
2005-2008 Präsident der Asociación Mexicana de Profesores de Alemán (AMPAL).<br />
z.Zt. Promotion in Regionalstudien an der UNACH<br />
E-Mail: mdettmer2006@yahoo.com.mx, mdettmer@unach.mx<br />
Díaz García, Neyda Dr.<br />
Hochschuldozentin an der Abteilung Deutsch der Fremdsprachenfakultät<br />
der Universität Havanna. Unterrichtsfächer: Textlinguistik und Lexikologie.<br />
Diplomgermanistin (Universität Leipzig). Doktorarbeit in Phraseologie (Universität<br />
Leipzig). Erfahrung: 40 Jahre<br />
E-Mail: neyda@flex.uh.cu<br />
Díaz Pérez, Olivia C. Dr.<br />
Geboren 1970 in Escuinapa, Sinaloa, Mexiko. Promotion im Bereich Neure Deutsche<br />
Literatur an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seit 1991 an der Universität<br />
Guadalajara tätig und seit 2005 Profesor Titular am Institut für Neuere Sprachen der<br />
Universität Guadalajara. Seit 2008 Dozentin im binationalen Masterstudiengang<br />
Deutsch als Fremdsprache: Estudios interculturales de lengua, literatura y cultura<br />
alemanas an der Universität Guadalajara, in Zusammenarbeit mit dem Herder-<br />
Institut der Universität Leipzig. Olivia Díaz hat verschiedene Artikel über deutsche<br />
und mexikanische Literatur und über Deutsch als Fremdsprach (DaF) veröffentlicht.<br />
Außerdem hat sie an verschiedenen nationalen und internationalen Kongressen<br />
teilgenommen. Sie war unter anderem an der Universität Köln und an der Universität<br />
Hamburg als Gastdozentin tätig. Zurzeit ist sie Präsidentin des Lateinamerikanischen<br />
Germanistenverbandes (<strong>ALEG</strong>).<br />
E-Mail: odiaz@cencar.udg.mx<br />
Donà, Chiara<br />
Seit 2009 DAAD-Lektorin an der Facultad de Estudios Superiores Acatlán (UNAM),<br />
México.<br />
Studium: Deutsch als Fremdsprache und Romanische Philologie an der LMU<br />
München (Magister Artium) und „Las Américas-The Americas-Les Amériques“<br />
(Interdisziplinäres Studium über die Amerikas) an der Heinrich-Heine-Universität<br />
Düsseldorf (Master of Arts).<br />
E-Mail: dona@daadmx.org<br />
Dornbusch, Claudia Dr.<br />
Geboren in Niterói, Rio de Janeiro – Brasilien. Studium der Germanistik an der<br />
Universidade Federal Fluminense. Referendariat für Germanisten – DaF-Ausbildung:<br />
Goethe-Institut São Paulo und Kassel (bei H. Funk, Neuner). Seit 1987 Dozentin an<br />
der Universidade de São Paulo. Pós-graduação-Seminare zu Film und Literatur, u.a.<br />
zusammen mit Rolf Renner und Dagmar von Hoff. Dolmetscherin und Übersetzerin.<br />
217
218<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Mestrado zur Rezeption der Werke von Thomas Mann in Brasilien.. DAAD-<br />
Forschungsaufenthalte u.a. München, Berlin. UNIBRAL-Koordinatorin zusammen<br />
mit Erwin Tschirner beim Studentenaustauschprogramm zwischen der USP und<br />
dem Herder-Institut/Leipzig. Promotion: Kanon der deutschsprachigen Literatur an<br />
brasilianischen Universitäten, veröffentlicht als: DORNBUSCH, C. A literatura alemã<br />
nos trópicos – uma aclimatação do cânone nas universidades brasileiras. S. Paulo:<br />
Annablume, 2005. 166 S. Habilitation: As representações da ausência na literatura e<br />
no cinema alemães pós-reunificaçã.<br />
E-Mail: claudia.dornbusch@gmail.com<br />
Durzak, Manfred Prof. Dr.<br />
Manfred Durzak, Dr. phil. et habil., o. Prof. für Neuere deutsche<br />
Literaturwissenschaft an der Universität Paderborn em., vorher als Full<br />
Professor of German an amerikanischen und kanadischen Universitäten<br />
tätig. Gastprofessuren u.a. in der Türkei, in Indien, Australien und den USA.<br />
Zahlreiche Buchveröffentlichungen zur Literatur des 20. Jahrhunderts,<br />
zur Literatur des 18. Jahrhunderts, zur Exilliteratur, zur Vergleichenden<br />
Literaturwissenschaft, zur Medienliteratur, seit den 90er Jahren<br />
verstärktes Forschungsinteresse an interkultureller Literaturwissenschaft.<br />
Jüngste Veröffentlichungen: Die andere Deutsche Literatur. Istanbuler Vorträge<br />
(zusammen mit Nilüfer Kuruyazici), Würzburg 2004; Interkulturelle Begegnungen<br />
(zusammen mit Nilüfer Kuruyazici). Würzburg 2004; Kleist und Hebbel. Zwei<br />
Einzelgänger der deutschen Literatur, Würzburg 2004; Bilder Indiens in der deutschen<br />
Literatur, Frankfurt/Main 2010.<br />
E-Mail: mdur1@t-online.de<br />
Ecke, Peter Prof. Ph.D.<br />
Peter Ecke (Ph.D.) ist Associate Professor und Direktor des Sprachprogramms<br />
für Deutsch als Fremdsprache an der University of Arizona in Tucson, Arizona<br />
(USA). Er leitet das Arizona-Sommerstudienprogramm in Leipzig und lehrt im<br />
interdisziplinären Doktorandenprogramm für „Zweitsprachenerwerb und Lehre“<br />
und im bi-nationalen Promotionsstudiengang für „Transkulturelle German Studies/<br />
Deutsch als Fremdsprache“ (der University of Arizona und der Universität Leipzig).<br />
Seine Interessen umfassen psycholinguistische und didaktische Aspekte des<br />
Zweitsprachenerwerbs und des DaF-Unterrichts.<br />
E-Mail: eckep@email.arizona.edu<br />
Delmann, Esther<br />
Esther Edelmann ist derzeit PhD-Studentin an der University of Minnesota.<br />
Während ihrer Studien Romanistik und Germanistik an der Rijksuniversiteit<br />
Groningen in den Niederlanden entwickelte sie ein starkes Interesse für den<br />
interkulturellen Austausch zwischen deutsch- und spanischsprachiger Literatur.
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Es folgten Studienaufenthalte in Spanien, und später in Chile und Argentinien, wo<br />
sie als Mitarbeiterin der Filmabteilung des Goethe-Instituts an der Vorbereitung<br />
der Eröffnung des ersten chilenischen Filmmuseums beteiligt war und Deutsch<br />
als Fremdsprache in Buenos Aires, ebenfalls am Goethe Institut unterrichtete.<br />
Während des Studiums Vergleichende Literaturwissenschaften an der Universität<br />
Leiden arbeitete sie als selbstständige Deutschlehrerin. Es folgte eine Reise nach<br />
Argentinien, Chile, Peru, Uruguay und Brasilien. Seit August 2011 ist sie PhD-<br />
Studentin am Department of German, Scandinavian and Dutch. Ihr Hauptinteresse<br />
gilt den Themenbereichen: Faschismus, Gewalt, Gesetz und Literatur und den<br />
positiven Auswirkungen der Kunst auf den gesellschaftlichen Diskurs bezüglich<br />
postdiktatorialer Vergangenheitsbewältigung im spanischsprachigen und<br />
deutschsprachigen Raum.<br />
E-Mail: edelm026@umn.edu; esther-edelmann@hotmail.com<br />
Eggensperger, Klaus Dr.<br />
Geboren in Deutschland, dort auch M.A. in Literaturwissenschaft und sprachwissenschaftliche<br />
Promotion. DAAD-Lektor in Brasilien, Dozent am Goethe-Institut, dann<br />
Dozent im brasilianischen Hochschuldienst. Arbeitsgebiete: Literatur und Kultur der<br />
Goethezeit, Cultural Studies, Postkolonialismus, Anna Seghers/Jorge Amado.<br />
E-Mail: klausegge@gmail.com<br />
Eltayeb, Tarek Dr.<br />
Geboren 1959 als Sohn sudanesischer Eltern in Kairo, lebt Tarek Eltayeb seit 1984<br />
in Wien. Er studierte Betriebswirtschaft an der Universität Ain Shams in Kairo<br />
und an der Wirtschaftsuniversität Wien. In seiner Dissertation am Institut für<br />
Wirtschaftsphilosophie befasste er sich mit dem Thema ‚Der Transfer von Ethik<br />
durch Technologie im Kampf zwischen Identität und Profit’. Seit 1999 arbeitet<br />
Tarek Eltayeb als Fachhochschulprofessor am International Management Center/<br />
University of Applied Sciences in Krems und seit 2007 als Lehrbeauftragter an der<br />
Karl-Franzens-Universität Graz sowie seit 2011 an der Universität Wien.<br />
Ab 1985 widmet sich Tarek Eltayeb auch schriftstellerischer Tätigkeit. Er erhielt<br />
mehrere Projektstipendien für Literatur, nahm am International Writing Program der<br />
University of Iowa 2008 teil und hatte 2009 und 2010 einen Lehrauftrag für Creative<br />
Writing Workshop (BTL) für junge arabische AutorInnen an der Universität von<br />
Iowa City 2009 und 2010 inne. Darüber hinaus nahm Tarek Eltayeb an zahlreichen<br />
internationalen Literaturfestivals (Struga, Poitiers, Dublin, Dornbirn, Wien, Linz,<br />
Valencia/Venezuela, Triest, Sarajevo, Maastricht, Novi Sad, Bratislava, Lemberg,<br />
Zagreb, Smederov, Ljubljana, Bukarest, San Francisco, Sharjah, Kairo, Alexandria,<br />
Valletta) teil und hielt zahlreiche Lesungen im In- und Ausland. Er erhielt mehrere<br />
Stipendien und Prämien, unter ihnen das Elias-Canetti-Stipendium der Stadt Wien<br />
im Jahre 2005.<br />
219
220<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Neben acht Publikationen in arabischer Sprache liegen vier Bücher in Deutsch<br />
vor: die beiden Lyrikbände „Ein mit Tauben und Gurren gefüllter Koffer“ und „Aus<br />
dem Teppich meiner Schatten“, der Roman „Städte ohne Dattelpalmen“, sowie der<br />
Roman „Das Palmenhaus“.<br />
Ette, Ottmar Prof. Dr.<br />
1956 im Schwarzwald geboren. Promotion 1990 an der Albert-Ludwigs-Universität<br />
Freiburg i.Br., Habilitation 1995 an der Katholischen Universität Eichstätt. Seit<br />
Oktober 1995 Lehrstuhl für Romanische Literaturwissenschaft an der Universität<br />
Potsdam mit Venia für Romanische sowie für Allgemeine und Vergleichende<br />
Literaturwissenschaft. 2004 / 2005 Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. 2010<br />
Fellow am Freiburg Institute for Advanced Studies. 2010 Berufung zum ordentlichen<br />
mitglied der Academia Europaea in der Sektion »Literary and Theatrical Studies«, seit<br />
2011 Mitglied der Leitungsgruppe dieser Sektion. Gastdozenturen in verschiedenen<br />
Ländern der Amerikas. Mitherausgeber der Zeitschriften Iberoamericana, HiN -<br />
Humboldt im Netz sowie Istmo. Mitinitiator der DFG Graduiertenkollegs Lebensformen<br />
und Lebenswissen (Potsdam - Frankfurt/O.), Zwischen Räumen / Entre Espacios (Berlin<br />
- Potsdam - Mexico) und Sichtbarmachung (Potsdam).<br />
E-Mail: ette@rz.uni-potsdam.de<br />
Fandrych, Christian Prof. Dr.<br />
Christian Fandrych ist Professor für Linguistik im Fach Deutsch als Fremdsprache am<br />
Herder-Institut der Universität Leipzig. Weitere wichtige berufliche Stationen waren<br />
die Universität München (Institut für Deutsch als Fremdsprache, 1991-1993), UNAM/<br />
Mexiko (DAAD-Lektor 1994-1996), King‘s College London (Lecturer / Senior Lecturer<br />
in German Linguistics, 1996-2006). Arbeitsschwerpunkte sind u.a. Wortbildung,<br />
Lexikologie, Textlinguistik, Kontrastive Linguistik, Wissenschaftssprache und<br />
Sprachdidaktik.<br />
E-Mail: fandrych@rz.uni-leipzig.de<br />
Feick, Diana<br />
Diana Feick ist Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich Didaktik/<br />
Methodik Deutsch als Fremdsprache sowie Praktikums- und<br />
Erasmuskoordinatorin am Herder-Institut der Universität Leipzig und<br />
promoviert derzeit zu Gruppenautonomiepotenzialen am Beispiel eines<br />
Handyvideoprojekts im mexikanischen Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht.<br />
Arbeitsschwerpunkte: Autonomes Lernen, Lernen mit neuen Medien, Mobiles<br />
Lernen, Alphabetisierung in Deutsch-als-Fremd- und Zweitsprache<br />
E-Mail: dfeick@rz.uni-leipzig.de<br />
Felfe, Marc<br />
Marc Felfe ist DAAD-Lektor und Dozent für germanistische Linguistik und<br />
Sprachgeschichte an der Sprachenfakultät der Universidad Nacional de Córdoba.
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Im November 2011 verteidigt er seine Dissertation „Partikelverben mit an -<br />
konstruktionsgrammatisch“ an der Humboldt-Universität zu Berlin.<br />
E-Mail: felfe@daad.org.ar<br />
Finch, Vivian<br />
Vivian Finch ist Doktorandin und studiert deutsche Literatur an der Vanderbilt<br />
University in Nashville, Tennessee. Sie hat 2009 ihr Masters von Vanderbilt<br />
bekommen und ist jetzt im dritten Jahr ihres Studiums als Doktorandin. Sie schreibt<br />
ihre These über die Literatur der deutschen Immigranten im 19. Jahrhundert in<br />
Südbrasilien.<br />
E-Mail: vivian.m.finch@vanderbilt.edu<br />
Fischbein, Juliana<br />
Juliana Fischbein ist in Argentinien geboren. Sie studierte DaF und Film- u.<br />
Theaterwissenschaften. Sie ist am Goethe-Institut und an der Universidad de<br />
Buenos Aires (UBA) tätig.<br />
E-Mail: alexiaju@gmail.com<br />
Funk, Hermann Dr.<br />
Dr. Hermann Funk, seit 2000 Lehrstuhl für Didaktik und Methodik des Deutschen<br />
als Fremd- und Zweitsprache am Institut für Auslandsgermanistik DaF/DaZ<br />
der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Dekan der Philosophischen Fakultät,<br />
Vorsitzender des deutschen IDV-Verbandes Fachgruppe DaF 1994 – 2006,<br />
Präsident des Gesamtverbandes Modernen Fremdsprachen 2009 – 2011. Leiter<br />
der Arbeitsstelle Lehrwerkforschung und Materialentwicklung (ALM) der FSU<br />
Jena. Wissenschaftlicher Koordinator der ERFA-Wirtschaft-Sprache. Arbeits-<br />
und Forschungsschwerpunkte: Fremdsprachliche Übungen und Aufgaben,<br />
Lehrmedienentwicklung, Deutsch in beruflichen Kontexten.<br />
E-Mail: hermann.funk@uni-jena.de<br />
Frank, Svenja<br />
Nach dem Abitur 2002 Studium der Europäischen Kultur an der Katholischen<br />
Universität Eichstätt und Abschluss mit Bachelor of Arts; seit SoSe 2003 im<br />
Doppelstudium außerdem Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Englische<br />
Philologie am University College London und an der Universität Freiburg, wo sie<br />
im Juli 2009 mit einer Arbeit über Felicitas Hoppe einen Magister Artium erwarb.<br />
Während des Studiums redaktionelle und journalistische Tätigkeiten für die<br />
Badische Zeitung, das Literaturbüro und das Kulturamt Freiburg, Lehrtätigkeit am<br />
Englischen und am Deutschen Seminar Freiburg und an der Universität in Riga.<br />
Seither erste Veröffentlichungen, Vorträge, Konferenzorganisation und Promotion<br />
zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, seit Oktober 2010 DAAD-Lektorin an<br />
der University of Oxford.<br />
E-Mail: svenja.frank@mod-langs.ox.ac.uk<br />
221
222<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Galle, Helmut P. E.<br />
Helmut Galle ist seit 2001 Professor für Deutsche Literatur an der Universidade de<br />
São Paulo. Studium der Älteren und Neueren Deutschen Literatur an der Freien<br />
Universität Berlin und 1989 Promotion mit einer Dissertation zum Thema Deutsche<br />
Psalmendichtung vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Im August 2011 Habilitation (Livredocência)<br />
an der Universidade de São Paulo mit einer Arbeit über Possibilidade(s) da<br />
autobiografia. 1989 – 2000 als DAAD-Lektor in Portugal, Brasilien und Argentinien.<br />
Zahlreiche Veröffentlichungen zur Autobiographie, zum kollektiven Gedächtnis,<br />
zur Darstellung von Gewalt und zu verschiedenen deutschsprachigen Autoren.<br />
Zur Zeit Arbeit an einem Projekt zum Verhältnis von Fakt und Fiktion in Werken der<br />
deutschen Gegenwartsliteratur.<br />
E-Mail: helmut_galle@hotmail.com<br />
Garbe, Susanne<br />
2011 Dozentin für Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Concepción. 2011<br />
Aufnahme einer Dissertation in romanistischer Medien- und Kulturwissenschaften.<br />
2009-2011 Mitarbeit im Team der Internationalen Friedensschule Köln:<br />
wissenschaftliche Supervision des bilingualen Sprachkonzepts. 2006-2011 Mitarbeit<br />
im Gleichstellungsamt der Universität Düsseldorf: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.<br />
2004--2011 Diplomstudiengang Literaturübersetzen (Anglistik, Romanistik,<br />
Germanistik), Abschluss: Ø 1,2. 2010 Deutschlehrerin für Deutsch als Fremdsprache<br />
und Übersetzerin in der bilingualen Privatschule Insituto Gutenberg Mar del Plata,<br />
Argentinien. 2010 mehrmonatiger Studienaufenthalt in Spanien (Forschungsprojekt<br />
Walter Benjamins Theorie der ,reinen Sprache’ und Sprachtraining). 2009-2010<br />
mehrmonatiger Studienaufenthalt in Peru (Forschungsprojekt Walter Benjamins<br />
Theorie der ,reinen Sprache’ und Sprachtraining). 2009 Wissenschaftliche Assistenz<br />
bei einer Doktorarbeit der Universität Köln, Thema: Bilingualität deutscher Kinder<br />
im Ausland. 2008 Übersetzung des Fotobildbands Teheran von Reza Nadji. 2007-<br />
2008 Mentee im <strong>Programm</strong> Net.Work21 – Leben und Arbeiten in der transkulturellen<br />
Gesellschaft (Team- und Individualcoaching). 2006/2008 Praktika im Europäischen<br />
Übersetzungsinstitut. 2007 Scheunemann-Stipendium und mehrmonatiges<br />
Praktikum in einer Übersetzungsagentur auf Ibiza<br />
E-Mail: susanne.garbe@googlemail.com<br />
García, Olga Prof. Dr.<br />
Studium der Germanistik und Übersetzungswissenschaft an der Universität<br />
Complutense Madrid. Übersetzerin bei Institutionen und Verlage; Lehrtätigkeiten<br />
an Universitäten in Spanien, Costa Rica und Slowenien. Derzeit Prof. für Deutsche<br />
Kulturgeschichte und Literatur an der Universität Extremadura. Leiterin des Instituts<br />
für Moderne Sprachen und Komparatistik. Essayistin und Übersetzerin literarischer<br />
Werke aus dem Deutschen.<br />
E-Mail: olgarcia@unex.es
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
García Díaz, Teresa Dr.<br />
Doctorado en literatura mexicana en la UNAM. Estancia Posdoctoral en investigación,<br />
en el Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne, de la Universidad de<br />
Bologna de octubre de 1998 a mayo de 2000. Estancia Posdoctoral, en el Centro de<br />
Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, agosto 2009-agosto 2011.<br />
Impartición de la Cátedra de las Américas, Universidad de Rennes 2, 18 de marzo- 4<br />
de abril 2011, Rennes, Francia. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores,<br />
Nivel I.<br />
E-Mail: teresagarciadiaz@yahoo.com<br />
Garciadiego, Rubén<br />
Studium der Deutschen Literaturgeschichte und Angewandten Linguistik an<br />
der Universität Mexikos (UNAM). Mehrjährige Unterrichtserfahrung im Bereich<br />
Deutsch als Fremdsprache an verschiedenen mexikanischen Institutionen der<br />
Erwachsenenbildung (IPN, Colmex, ITAM, UNAM). Mitarbeiter an Forschungen der<br />
Interkulturalität am Sprachzentrum der UNAM.<br />
E-Mail: israel@unam.mx, rubengarciadiego@correo1.com<br />
García-Wistädt, Ingrid Prof. Dr.<br />
Promotion 2005 über die Figur des Musikers bei Ludwig Tieck. Seit 2005<br />
Dozentin an der Universität Valencia und dort seit 2011 Professorin für deutsche<br />
Literaturwissenschaft. Publikationen über Musik und Literatur in der Romantik, zum<br />
Frühwerk Ludwig Tiecks, Reiseliteratur u.a. Derzeitige Forschungsschwerpuntkte:<br />
Deustch-spanische interkulturelle Beziehungen sowie Bilder und Stereotype in der<br />
Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts.<br />
E-Mail: ingrid.garcia@uv.es<br />
Garnica de Bertona, Claudia<br />
Claudia Garnica de Bertona ist seit 1991 an der Philosophischen Fakultät der<br />
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentinien als Dozentin für Deutsche<br />
und Österreichische Literatur tätig. Sie hat im Bereich der deutschen Literatur<br />
der Nachkriegszeit, der Frauenliteratur und der Literatur der Emigranten und<br />
Exilanten in Argentinien geforscht und veröffentlicht. Seit 1987 ist sie Mitglied<br />
des Argentinischen Forschungsprogramms für Vergleichende Literatur (PAILICO),<br />
des Argentinischen Germanistenverbands (AAG) (Vizepraesidentin 2006-2008), des<br />
Lateinamerikanischen Verbands der Germanisten (<strong>ALEG</strong>) und des Internationalen<br />
Verbands der Germanisten (IVG). Sie arbeitet zurzeit an ihrer Promotion zum Thema<br />
„Auslandsdeutsche Literatur in Argentinien“.<br />
E-Mail: claudiagbertona@gmail.com<br />
Giovanni, Gustavo<br />
Wissenschaftlicher Assistent (Profesor Adjunto), Lehrstuhl für deutsche Literatur<br />
an der Philosophischen Fakultät der Universidad Nacional de Córdoba<br />
223
224<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
(Argentinien). Forschungsschwerpunkte: Der Fauststoff in der deutschen und<br />
argentinischen Literatur, deutsche Autoren des XX. Jahrhunderts, Literatur der<br />
DDR. Weiteres Forschungsgebiet: Vergleichende Literaturwissenschaft. Neueste<br />
Veröffentlichungen: Inaccesibilidad y silencio. La figura de Martin Heidegger en<br />
dos obras literarias contemporáneas (2009), Fausto en el teatro de Rolf Hochhuth<br />
(2009), Metafísica, escepticismo y conocimiento. Fausto en la narrativa argentina<br />
contemporánea (2010).<br />
E-Mail: giovanni@ffyh.unc.edu.ar, giovannini_77@hotmail.com<br />
Glenk, Eva Maria Ferreira Dr.<br />
Eva Maria Ferreira Glenk ist als Dozentin für deutsche Sprache und Sprachwissenschaft<br />
in Graduierung und Postgraduierung am Institut für deutsche Sprache, Literatur<br />
und Übersetzung an der Universität São Paulo, Brasilien tätig und arbeitet zur Zeit<br />
an einem bilingualen Wörterbuch fester verbaler Konstruktionen.<br />
E-Mail: spoelten@usp.br<br />
Góngora, Arlety Dr.<br />
Die Referentin ist Diplomgermanistin/ PhD. (Linguistik)/ Master fuer angewandte<br />
Linguistik und Translatologie/ Master fuer Universitaetsmanagement. Sie hat ueber<br />
10 Jahre lang als Dozentin Ubersetzen/ Dolmetschen und DaF an der Fakultaet<br />
fuer Fremdsprachen gelehrt, sowie fachbezogenes Deutsch an der Fakultaet<br />
fuer Tourismus der Universitaet Havanna. Vom 2005 bis 2008 leitete sie die<br />
Deutschabteilung der Universitaet Havanna. Seit 2010 leitet sie das Zentrum fuer<br />
Fachubersetzen und Terminologie des Ministeriums fuer Wissenschaft, Technologie<br />
und Umwelt Kubas.<br />
E-Mail: arletygongora@gmail.com; arlety.gongora@idict.cu<br />
Grebe, Rainald<br />
Rainald Grebe (geb. 1971) betätigt sich seit 1989 als Autor, Dramaturg, Schauspieler,<br />
Regisseur, Comedian und Liedersänger. Er stammt aus Köln und machte sich Anfang<br />
der neunziger Jahre in die neuen Bundesländer auf, um seine künstlerische Karriere<br />
zu verfolgen. Nach einem Diplom im Fach „Puppenspiel“ und einem längeren<br />
Aufenthalt am Jenaer Theaterhaus, stand er mit verschiedenen Soloprogrammen,<br />
aber auch mit der „Kapelle der Versöhnung“, die später zum „Orchester“ anwuchs,<br />
auf der Bühne. Als Solist präsentiert sich Grebe, der „Ururenkel des Dadaismus“, in<br />
2012 mit seinem aktuellen <strong>Programm</strong> „Das Rainald Grebe Konzert“ auf den Bühnen<br />
Deutschlands.<br />
Gruhn, Dorit Heike<br />
Dorit Heike Gruhn hat in Deutschland eine Ausbildung zur staatlich<br />
geprüften Übersetzerin absolviert und anschlieβend deutsche Literatur und<br />
Erziehungswissenschaften studiert. Gegenwärtig lehrt sie an der Sprachenfakultät<br />
der Benemérita Universidad Autónoma de Puebla und arbeitet auβerdem als “perito
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
traductor”. Sie ist Koautorin eines deutschsprachigen Reiseführers über Mexiko, hat<br />
diverse Veröffentlichungen im akademischen Bereich und fungiert als Sekretärin<br />
des Mexikanischen Deutschlehrerverbands.<br />
E-Mail: heike50@hotmail.com<br />
Guldin, Rainer Prof. Dr.<br />
Rainer Guldin ist Dozent für deutsche Sprache und Kultur an den Fakultäten für<br />
Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften der Università della Svizzera<br />
Italiana in Lugano (Schweiz). Er promovierte an der Universität Zürich zum Werk<br />
Hubert Fichtes und ist Editor-in-Chief der on-line Zeitschrift Flusser Studies (http://<br />
www.flusserstudies.net/). Neuere Publikationen: Die Sprache des Himmels. Eine<br />
Geschichte der Wolken, Berlin 2006; „Wolkenformationen […] aus dem Dunst der<br />
Möglichkeiten. Zur nubigenen Einbildungskraft, Köln 2009; Pensar entre linguas. A<br />
teoria da tradução de Vilém Flusser, Annablume, São Paulo 2010; Spiegelgeschichten.<br />
Zu Hubert Fichtes und Hans Henny Jahnns Thomas Chatterton, Aachen 2010, Vilém<br />
Flusser. An Introduction, Minneapolis 2011 (zus. mit A. Finger und G. Bernardo).<br />
E-Mail: rainer.guldin@usi.ch<br />
Gutiérrez Koester, Isabel Prof. Dr.<br />
Studium der Germanistik und Anglistik in Valencia. Promotion 2000 über weibliche<br />
Wassermythen in der deutschen Literatur. Seit 2003 Professorin für Neuere Deutsche<br />
Literatur am Departamento de Filología Inglesa y Alemana der Universitat de València.<br />
Derzeitiger Forschungsschwerpunkt: Deutsch-spanische interkulturelle Beziehungen<br />
und Reiseliteratur im 20. und 21. Jahrhundert. Finanzierte Forschungsprojekte: 2005-<br />
2007: Viajeros alemanes en Valencia en el siglo XVIII y principios del XIX; 2007-2010:<br />
Viajeros alemanes en España. Documentación y selección de textos<br />
2011-2013: Imágenes y estereotipos españoles en libros de viaje alemanes:<br />
evolución histórica entre realidad y ficción interculturales. Letzte Publikationen in<br />
diesem Bereich: Bis an den Rand Europas. Spanien in deutschen Reiseberichten vom<br />
Mittelalter bis zur Gegenwart (Mithrsg., Vervuert 2010); Estereotipos interculturales<br />
germanoespañoles (Mithrsg., PUV 2011).<br />
E-Mail: isabel.gutierrez@uv.es<br />
Gutjahr, Ortrud Prof. Dr.<br />
Ortrud Gutjahr hat die Eckprofessur für Neuere Deutsche Literatur und Interkulturelle<br />
Literaturwissenschaft an der Universität Hamburg inne. Sie leitet die Arbeitsstelle<br />
Interkulturelle Literatur-und Medienwissenschaft und leitet u.a. das internationale<br />
Projekt Interkultureller Topos Hafenstadt. Sie ist Erasmus-Beauftragte der Fakultät für<br />
Geisteswissenschaften, hat die von der ZEIT-Stiftung geförderte und ihr organisierte<br />
Hamburger Gastprofessur für Interkulturelle Poetik ins Leben gerufen und ist u.a.<br />
Herausgeberin der Publikationsreihe Interkulturelle Moderne.<br />
E-Mail: gutjahr@uni-hamburg.de<br />
225
226<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Hachmann, Gundela Dr.<br />
Gundela Hachmann ist derzeit Assistenzprofessorin für Deutsche Sprache, Literatur<br />
und Film an der Louisiana State University in Baton Rouge. Sie hat 2008 an der Harvard<br />
University in Cambridge bei Professor Judith Ryan promoviert. Ihre Dissertation mit<br />
dem Titel Blick in die Zeit. Optische Medien in deutschen Romanen der Postmoderne<br />
widmet sich der Schnittstelle zwischen Text und technisch produzierten Bildern in<br />
Romanen von W. G. Sebald, Rainald Goetz, Helmut Krausser und Thomas Lehr. Sie<br />
hat bisher Aufsätze zur Darstellung des Krieges in den Gedichten von Raoul Schrott,<br />
zur Intermedialität bei E. T. A. Hoffmann sowie zur Wissenspoetik bei Thomas Lehr<br />
veröffentlicht.<br />
E-Mail: ghachmann@lsu.edu<br />
Handwerker, Brigitte Prof. Dr.<br />
Geboren am 29.02.1952, Studium in Berlin und Paris, wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
an der Universität Wuppertal und an der TU Berlin, von 1984 bis 1993 Professorin<br />
für Angewandte Sprachwissenschaft an der Universität Hildesheim, 1993<br />
Gastprofessorin an der Université Denis Diderot (Paris VII), seit 1993 Professorin<br />
am Institut für deutsche Sprache und Linguistik der Humboldt-Universität<br />
zu Berlin, 2010 Kurzzeitprofessur an der Universidad Nacional Autónoma de<br />
México. Lehrgebiete: Germanistische Linguistik / Deutsch als Fremdsprache;<br />
Forschungsgebiete: Grammatik des Deutschen als Fremdsprache, insbesondere<br />
die Lexikon-Syntax-Schnittstelle aus der Sprachlernperspektive, Sprachvergleich,<br />
Inputverarbeitung beim Fremdsprachenlernen, Chunks und Konstruktionen im<br />
Deutschen als Fremdsprache, Multimedia-Chunks für DaF.<br />
E-Mail: brigitte.handwerker@cms.hu-berlin.de<br />
Haro-Luviano, Adriana<br />
Studium der deutschen Sprache und Literatur an der Universidad Nacional<br />
Autónoma de México (UNAM). Dozentin an der Facultad de Filosofía y Letras der<br />
UNAM.<br />
E-Mail: posvorta@yahoo.de<br />
Heidermann, Werner Dr.<br />
Werner Heidermann hat in Münster studiert und promoviert, von 1989-1992 als<br />
DAAD-Lektor an der University of Jordan in Amman gearbeitet. Vorher für zwei Jahre<br />
Tätigkeit als mitreisender Circuslehrer deutschlandweit und im Bereich dezentraler<br />
Kulturarbeit in Leverkusen; nachher DaF an der Universität Köln und Arbeit in der<br />
Berufsvorbereitung benachteiligter Jugendlicher in Solingen. Seit 1995 professor<br />
associado an der Universidade Federal de Santa Catarina in Florianópolis/Brasilien.<br />
Herausgabe der Clássicos da teoria da tradução vol. I alemão-português 2001 (2.<br />
Auflage 2010) und von Humboldt - Linguagem, Literatura, Bildung 2006. Daneben<br />
Autor von bei Hueber erschienenen DaF-Lehrwerken.
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Heller, Isabel Dr.<br />
Studium und Arbeitserfahrung: Deutschland, Vereinigtes Königreich, Neuseeland.<br />
Master of Arts in Foreign Language Teaching and Learning and Applied Linguistics,<br />
University of Auckland, Neuseeland; Dissertation im Bereich e-learning:<br />
Erforschung des web-basierten Grammatikprogramm Chemnitz InternetGrammar:<br />
Herausforderungen und Möglichkeiten, Technische Universität Chemnitz.<br />
Interessengebiete: Fremdsprachenlehr- und erwerbstheorien und deren<br />
Erforschung, Autonomes Lernen, Standardisierte Sprachtesterstellung und –<br />
erforschung, DaF-Lehrerfortbildung im Ausland Aktuelle Arbeit: Lektorin des DAAD,<br />
Área de Alemão, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Lehre in der Gradução<br />
(Sprachlehre), Pós-Graduação (Angewandte Linguistik), Lehrerfortbildung für DaF-<br />
Lehrer im Staat Paraná.<br />
E-Mail: isabel.heller@phil.tu-chemnitz.de<br />
Hennequín Mercier, Jean<br />
Studium der Germanistik an der Universität Besançon, Frankreich, ist Dozent und<br />
Forscher an der Sprachenfakultät der Benemérita Universidad Autónoma de Puebla<br />
und professioneller Übersetzer. Er ist Autor des übersetzungstheoretischen Werks<br />
En busca de la piedra traductorial, des Werks La sociolingüística: ¿qué es? ¿para qué<br />
sirve? sowie Redaktionsleiter der Zeitschrift Lenguas en contexto (BUAP). Auβerdem<br />
hat er diverse Artikel über Übersetzungstheorie in verschiedenen akademischen<br />
Zeitschriften verfasst.<br />
E-Mail: jehenneq@yahoo.fr<br />
Hermann, Iris Prof. Dr.<br />
Professur für Neuere dt. Literaturwissenschaft an der Universität Bamberg.<br />
Habilitation und Promotion in Bielefeld.<br />
E-Mail: iris.hermann@uni-bamberg.de<br />
Hernández, Isabel Prof. Dr.<br />
Isabel Hernández (geb. 1965) ist Professorin für Deutsche Literaturwissenschaft<br />
an der Universidad Complutense de Madrid. Dort promovierte sie 1994 über<br />
den Heimatbegriff in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Werkes<br />
des Schweizer Schriftstellers Gerold Späth. Lehr- und Forschungsaufenthalte an<br />
verschiedenen Universitäten in Europa und Amerika. Ihre Forschungsgebiete<br />
sind Deutschsprachige Literatur der Schweiz, Realismus, Gegenwartsliteratur,<br />
Prosagattungen und Komparatistik. Dazu zahlreiche Veröffentlichungen in<br />
Zeitschriften und Sammelbänden. Übersetzungen und kommentierte Ausgaben zu<br />
Goethe, Schiller, Kleist, Hoffmann, Heine, Gotthelf, Keller, Meyer, Kafka, Bichsel, Frisch<br />
u.a. Sie ist Herausgeberin der Zeitschriften Revista de Filología Alemana und Estudios de<br />
Traducción und Mitherausgeberin des Ibero-amerikanischen Jahrbuch für Germanistik.<br />
E-Mail: isabelhg@filol.ucm.es<br />
227
228<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Herzig, Katharina<br />
Studium in Deutsch, Musik und Erziehungswissenschaft an der Universität<br />
Dortmund/ Deutschland; Referendariat am Studienseminar Siegen; 1. und 2.<br />
Staatsexamen für Lehramt, Sekundarstufe II und I; 2002/03 DAAD-Stipendiatin<br />
an der Universidad de Guadalajara/ Mexiko (Sprachassistenz); 2003-2006<br />
Deutschlehrerin am Goethe-Institut in Guadalajara und Tätigkeiten in der DaF-<br />
Lehreraus- und –fortbildung in Mexiko; 2006-2010 DAAD-Ortskraftlektorin<br />
an der Universidad de Guadalajara; seit 2008 Dozentin im binationalen<br />
Masterstudiengang Deutsch als Fremdsprache: Estudios interculturales de lengua,<br />
literatura y cultura alemanas (Didaktikmodul) und DaF-Lehrerin an der Universidad<br />
de Guadalajara; zur Zeit Promotionsprojekt in Didaktik am Herder-Institut/<br />
Universität Leipzig<br />
E-Mail: katharina.herzig@gmail.com<br />
Hess-Lüttich, Ernest Prof. Dr.<br />
1970-72 Lektor f. Deutsch als Fremdsprache Univ. of London; 1972-74 Tutor f.<br />
Anglistik Univ. Bonn; 1974-75 Wiss. Ass. f. Anglistik TU Braunschweig; 1975-80<br />
Wiss. Ass. f. Germanistik FU Berlin; 1980-85 Wiss. Ass. u. Privatdozent f. Germanistik<br />
Univ. Bonn; 1985-90 Prof. f. Germanistik u. Linguistik FU Berlin; 1990-92 Full Prof. of<br />
German, Assoc. Prof. of Comparative Literature, Fellow at the Research Center for<br />
Semiotic Studies Indiana University Bloomington; 1992- Ordinarius f. Germanistik<br />
(Dt. Sprache u. Literatur) Univ. Bern, Schweiz, sowie (2007- ) Hon. Prof. Extraordinary<br />
Univ. of Stellenbosch nr. Cape Town, Südafrika.<br />
E-Mail: ernest.hess-luettich@germ.unibe.ch<br />
Hirschfeld, Diana<br />
Abgeschlossenes Studium von Deutsch als Fremdsprache (LICEL), zurzeit im<br />
Masterstudiengang für angewandte Linguistik (MLA) an der Nationalen Universität<br />
Mexiko (UNAM). Seit 13 Jahren als Deutschlehrerin im Sprachzentrum (CELE)<br />
der UNAM tätig, vorwiegend im Niveau für fortgeschrittene Lerner. Besonderes<br />
Interesse an verschiedenen Beurteilungsmethoden, vor allem aber an formativer<br />
Evaluation, und auch an Portfolioarbeit. Außerdem Erfahrung im Unterricht mit der<br />
Unterstützung von elektronischen Medien (blended learning).<br />
E-Mail: diana.hirschfeld@gmail.com<br />
Hüttinger, Christine Dr.<br />
Christine Hüttinger, kommt aus Salzburg, lebt in Mexiko Stadt. Studium der<br />
Germanistik und der Geschichte. Arbeitet an der Geisteswissenschaftlichen<br />
Abteilung der „Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco“.<br />
Veröffentlichungen literarischer Übersetzungen österreichischer Literatur und von<br />
Arbeiten zur Literaturkritik.<br />
E-Mail: chuettinger@gmx.at
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Ito Sugiyama, Gloria Josephine Hiroko<br />
1982-1984 DaF-Lehrer am Sprachzentrum der Nationalen Unabhängigen Universität<br />
Mexikos (UNAM- Acatlán). 1983-1985 DaF-Lehrer am Sprachzentrum des National-<br />
Politeknisches Instituts (CENLEX-IPN) (Sprachzentrum). DaF-Lehrer 1990-1993. 1991<br />
Dozentin für Deutsche Literatur an der Fakultät Philologie-Philosophie der UNAM.<br />
(Romantik). Ab 2001 DaF, Erziehungsforschung und Literatur an der Autonome<br />
Metropolitansiche Universität (Metropolitanischen Autonomen Universität-<br />
Azcapotzalco)<br />
E-Mail: gloria_ito@yahoo.com<br />
Jaeschke, Dieter<br />
Dieter Jaeschke ist seit August 2009 Fachberater der „Zentralstelle für das<br />
Auslandsschulwesen“ (ZfA) und koordiniert das Deutsche Sprachdiplom<br />
(DSD) in Mexiko, Costa Rica und Texas/USA. Geboren 1969 in Hattingen (Ruhr);<br />
Studium 1990 - 1996 in Karlsruhe, Bochum und Florenz (Betriebswirtschaft,<br />
Geschichte und Italienisch); 1998 - 2009: Lehrer an der Gesamtschule Dortmund-<br />
Brünninghausen; 2004 - 2009: Fachberater für Italienisch in NRW und Fachleiter<br />
am Studienseminar Dortmund; journalistische Arbeit für die Westdeutsche<br />
Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung; Mitglied der Bundesjury beim<br />
Bundeswettbewerb Fremdsprachen<br />
E-Mail: DJ@dieter-jaeschke.de<br />
Janisch, Valentina<br />
Valentina Janisch ist seit August 2011 als OeAD-Lektorin an der Universidad de<br />
Guadalajara (Mexiko) tätig. Nach dem Studium an der Universität Wien absoliverte<br />
sie DaF-Prakika am Deutschinstitut des King’s College, London (Großbritannien) und<br />
der Université d’Oran (Algerien). Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen<br />
Migration, Migration und Literatur, Migration und Arbeitsmarkt, Fremdheit sowie<br />
Fremdsprachendidaktik.<br />
E-Mail: valentina.janisch@gmail.com<br />
Janz, Rolf-Peter Prof. Dr.<br />
Rolf-Peter Janz, geb. 1940, Studium der Germanistik, Komparatistik und Philosophie<br />
in Kiel, Leeds (UK) und Berlin, lehrte Neuere deutsche Literatur am Institut für<br />
Deutsche und Niederländische Philologie der Freien Universität Berlin (bis 2008).<br />
Arbeitsschwerpunkte: Literatur und Ästhetik der Romantik und Klassik, der Wiener<br />
Moderne und der Weimarer Republik; Text-Bild-Beziehungen; Reformulierungen<br />
von Mythen in der Literatur der Moderne; Das Erhabene und das Lächerliche.<br />
Neuere Buchpublikationen: R.-P. Janz, F. Störmer (Hg.): Schwindelerfahrungen. Zur<br />
kulturhistorischen Diagnose eines vieldeutigen Phänomens, Amsterdam, New York<br />
2004; H. R. Brittnacher, R.-P. Janz (Hg.): Labyrinth und Spiel. Umdeutungen eines<br />
Mythos, Göttingen 2007; Aufsätze zur Literatur und Kultur des 18. bis 20. Jahrhunderts.<br />
229
230<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Gastprofessuren u.a. in Sydney, Lawrence (Kansas), Fes (Marokko), Philadelphia<br />
(UPenn), Peking (Peking University 2006 und 2010); Fellow am IFK Wien (1994) und<br />
am Freiburg Institute for Advanced Studies (Oktober 2009 - Juli 2010).<br />
E-Mail: rp.janz@fu-berlin.de<br />
Jennerjahn, Sigurd<br />
geboren 1969 in Berlin; Studium der Neueren Geschichte, Anglistik und Ethnologie<br />
in Berlin und Cork; 1998 Abschluss Magister Artium an der Technischen Universität<br />
Berlin; 2000/2001 DAAD-Sprachassistent an der Universidade Federal do Ceará<br />
in Fortaleza; Arbeit an Dissertation im Fach Kulturanthropologie an der Europa-<br />
Universität Viadrina, Frankfurt (Oder); seit 2008 DAAD-Lektor an der Universidade<br />
Federal do Pará in Belém<br />
E-Mail: daad_belem@daad.org.br<br />
Kadipinar, Enis<br />
Enis Kadipinar hat zuerst Germanistik und Erziehungswissenschaften auf B.A und<br />
anschließend Neuere deutsche Literaturwissenschaften, Medienwissenschaften<br />
und kulturwissenschaftliche Anthropologie an der Universität Paderborn auf M.A<br />
studiert. Er arbeitet seit 1997 als Deutschlehrer. Angefangen als Deutschdozent<br />
an der Universität Paderborn führte er die Lehrtätigkeit später an diversen<br />
Universitäten und Institutionen im Ausland fort. Seit 2007 geht er seiner Tätigkeit<br />
als Deutschlehrer an Tecnológico de Monterrey in Mexiko nach.<br />
E-Mail: enisk@itesm.mx<br />
Kind, Anette<br />
1989 Licenciatura em Estudos Portugueses e Alemães an der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät der Universität Porto. 1991 Post-Graduierung in Übersetzung Deutsch-<br />
Portugiesisch an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Porto.<br />
1997 Mestre em Estudos Alemães durch die Faculdade de Ciências Sociais e<br />
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Seit 1990 Lektorin für Deutsch an der<br />
Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Porto. Arbeitsschwerpunkte: DaF,<br />
Übersetzung, Didaktik. Seit 2009: Doktorandin in Übersetzung (Universität Porto)<br />
E-Mail: akind@letras.up.pt<br />
Kinder, Anna<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Literaturarchiv Marbach,<br />
Wissenschaftliche Koordination des Suhrkamp-Forschungsprojekts; Studium der<br />
Germanistik und Politischen Wissenschaft in München und Heidelberg; Promotion<br />
an der Universität Heidelberg (2011).<br />
E-Mail: anna.kinder@dla-marbach.de<br />
Knoll, Hans Dr.<br />
Dr. phil., (Geschichte, Germanistik), ehemaliger Lektor des DAAD, Prof. Titular<br />
der Fächer Deutsche Literatur und Kultur der deutschsprachigen Völker an
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
der Sprachenfakultät der Nationaluniversität Córdoba, Argentinien. Zur Zeit<br />
Forschungen zur Geschichte der deutschen Minderheit in Argentinien.<br />
E-Mail: ahknoll@yahoo.de<br />
Koch, Christian<br />
2005-2011 Studium der romanischen Philologie an der Christian-Albrechts-<br />
Universität zu Kiel. 2008 Volontär als Englisch- und Musiklehrer in einer Grundschule<br />
in Ecuador. 2008-2009 PAD-Fremdsprachenassistent in Saint-Omer, Frankreich.<br />
Februar 2011 1. Staatsexamen für das Lehramt am Gymnasium in den Fächern<br />
Französisch, Spanisch, Italienisch (mit Auszeichnung). SoSe 2011 Lehrbeauftragter<br />
für romanische Linguistik an der Uni Kiel (Proseminar: La retórica intermedial de<br />
la canción protesta hispanoamericana). Seit WS 2011 DAAD-Sprachassistent an<br />
der Pontificia Universidad Católica del Ecuador mit momentanem Schwerpunkt im<br />
spanisch-deutschen und deutsch-spanischen Übersetzen und Dolmetschen.<br />
E-Mail: chrkoch@hotmail.com<br />
Kraft, Tobias<br />
2000-2007 Studium der Romanistik, Germanistik, Medienwissenschaft und<br />
Geschichte an der Universität Potsdam und an der Universität Bonn. Magisterarbeit<br />
zum Thema Literatur in Zeiten transnationaler Lebensläufe. Identitätsentwürfe<br />
und Großstadtbewegungen bei Terézia Mora und Fabio Morábito (Potsdam:<br />
Publikationsserver 2007). Seit 2008 Promotion zu Alexander von Humboldt.<br />
Studien- und Promotionsstipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes.<br />
Seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für französisch- und<br />
spanischsprachige Literaturen (Prof. Dr. Ottmar Ette) am Institut für Romanistik<br />
der Universität Potsdam. Mehrwöchige Forschungsaufenthalte 2008 in La Habana<br />
(DAAD-Kurzzeitstipendium), 2009 in Washington D.C und 2011 in Mexiko-Stadt. Seit<br />
2001 kontinuierliche Projektarbeit zu Alexander von Humboldt: als Mitglied des<br />
Editorial Board von HiN – Internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien (www.hinonline.de),<br />
als Redaktionsleiter des Informationsportals avhumboldt.de – Alexander<br />
von Humboldt Informationen online (www.avhumboldt.de), als wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter bei HiE – the Humboldt in English Project der Vanderbilt University<br />
(Nashville, TN), sowie als Begründer von Humboldt Digital, der ersten online<br />
verfügbaren Digitalisate-Bibliographie zu den selbständig erschienenen Schriften<br />
Alexander von Humboldts (http://www.avhumboldt.de/?page_id=469).<br />
E-Mail: kraft@uni-potsdam.de<br />
Kuhn, Christina Dr.<br />
Akademische Rätin, Studium der Germanistik, Geschichte und DaF/DaZ an der<br />
Universität Kassel, Promotion an der FSU Jena, Kursleiterin von DaF-/DaZ- und<br />
DSH-Kursen, Lehrwerksautorin, zahlreiche Lehrerfortbildungen im In- und Ausland,<br />
Koordinatorin des Masterstudiengangs Auslandsgermanistik/DaF/DaZ an der FSU<br />
231
232<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Jena, Schwerpunkte in Forschung und Lehre: berufsorientierter DaF-Unterricht<br />
/ Lernen und Lehren mit digitalen Medien / Fertigkeiten / Lehrwerkanalyse und<br />
Lehrmaterialerstellung/ Curriculumentwicklung / Mehrsprachigkeitsdidaktik<br />
E-Mail: krako82@hotmail.com; krakovicdiana@gmail.com<br />
Kuhn, Julia Prof. Dr.<br />
Geboren in Innsbruck (A), Studium der Romanistik, Germanistik sowie Übersetzerausbildung<br />
Französisch, Spanisch und Italienisch an den Universitäten Innsbruck (A),<br />
Valladolid (Sp.), Grenoble (F) und Cambridge (UK). 1995-2002 Mitarbeit am Schweizer<br />
Nationalfondprojekt St. Galler Namenbuch, u.a. Universität Zürich (CH), am Projekt<br />
Onoma an der Université de Neuchâtel (CH), sowie am Dicziunari Rumantsch Grischun,<br />
Chur (CH). SS 2001 Vortragstätigkeit an der Universität L’Aquila (I). SS 2006 am<br />
Glendon College York University Toronto, Kanada. 2001-3 Forschungsaufenthalte an<br />
der Cambridge University (UK). seit 2005 Mitglied des Board of Directors des International<br />
Council of Onomastic Sciences, Sitz Uppsala Schweden. Seit 2009 Vorsitzende<br />
der ICOS Terminology Group. 1998 Vertragsassistentin an der Universität Innsbruck,<br />
Institut für Romanistik, 2003 als Universitätsdozentin und dann als ao. Univ. Prof. an<br />
der WU Wien, Institut für Romanische Sprachen, tätig. Seit 2008 Universitätsprofessorin<br />
am Institut für Romanistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena (D).<br />
E-Mail: christina.kuhn@uni-jena.de<br />
Lerchner, Charlotte<br />
Charlotte Lerchner studierte Deutsch als Fremdsprache, Kommunikations- und<br />
Medienwissenschaft und Ethnologie in Leipzig. Nach ihrem Abschluss kam<br />
sie als DAAD-Sprachassistentin an die FES Acatlán (UNAM) in Mexiko-Stadt,<br />
wo sie Studenten verschiedener Fachrichtungen in Deutsch als Fremdsprache<br />
unterrichtete. Seit Juni 2011 arbeitet sie in der Bildungskooperation Deutsch am<br />
Goethe-Institut Mexiko.<br />
E-Mail: charlotte.lerchner@mexiko.goethe.org<br />
Liberto, Heloisa<br />
Heloisa Liberto hat einen BA-Abschluss in Sprachen (Portugiesisch-Deutsch)<br />
von der Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) und einen MA-Abschluss<br />
im interdisziplinären <strong>Programm</strong> für Angewandte Sprachwissenschaft von der<br />
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Derzeit macht sie ein PhD- Studium<br />
im Bereich der sprachwissenschaftlichen Studien an der Universidade Federal<br />
Fluminense (UFF) und ist seit über 10 Jahren als DaF-Lehrerin an einer DaF-Schule in<br />
Rio de Janeiro tätig.<br />
E-Mail: heloisaliberto@gmail.com<br />
López Barrios, Mario Prof. Dr.<br />
Studium der Anglistik und Germanistik an der Sprachenhochschule der<br />
Nationaluniversität Córdoba, Argentinien. Promotion an der Universität Kassel
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
mit einer Dissertation über die curriculare Grundlegung der Fertigkeit Schreiben<br />
im Fremdsprachenunterricht unter der Leitung von Prof. Dr. Gerd Neuner<br />
(1998). Professor für DaF- und Englischdidaktik an der Facultad de Lenguas,<br />
Universidad Nacional de Córdoba. Autor mehrerer Publikationen und Leitung von<br />
Forschungsprojekten zu folgenden Themen: Fremdsprachenerwerbsforschung,<br />
Lehrmaterialentwicklung- und Forschung, Mehrsprachigkeitsdidaktik, Geschichte<br />
des Fremdsprachenunterrichts, Lexik.<br />
E-Mail: lopez@fl.unc.edu.ar; mariolopezbarrios@hotmail.com<br />
Lorenz, Patrycja<br />
Patrycja Lorenz, geb. 16.12.1978, in Wolsztyn, Polen. Nach meiner Schulausbildung<br />
studierte ich in Posen an der Adam-Mickiewicz-Universität Polonistik und schloss<br />
das Studium im Jahre 2003 mit dem Magistertitel ab. Während der Studienzeit<br />
verbrachte ich zwei Jahre an der Johannes Guttenberg-Universität in Mainz, wo ich<br />
Seminare in Theaterwissenschaft und Publizistik belegte. Von März 2005 bis August<br />
2006 absolvierte ich das Zusatzstudium „Deutsch als Fremdsprache“ am Herder-<br />
Institut der Universität Leipzig. Seit September 2006 arbeite ich als Dozentin am<br />
Instituto de Idiomas an der Universidad del Norte in Barranquilla und koordiniere<br />
dort die Deutschkurse der Niveaustufe A1.<br />
E-Mail: lorenzp@uninorte.edu.co<br />
Lützeler, Paul Michael Prof. Dr.<br />
Paul Michael Lützeler, Rosa May Distinguished University Professor in the Humanities,<br />
Washington University in St. Louis. Gründete 1985 das Max Kade Center for<br />
Contemporary German Literature, das er bis heute leitet. 1985 begründete er auch<br />
das European Studies Program, das er zwei Jahrzehnte lang bis 2004 leitete. Er<br />
ist der Herausgeber der Werke Hermann Brochs und hat auch die Biographie des<br />
Autors geschrieben, die ins Englische, Spanische und Japanische übersetzt wurde.<br />
Ansonsten mehrere Bücher zum Europa-Diskurs der Schriftsteller, zur Klassik und<br />
Romantik wie zur Gegenwartsliteratur. Er ist Gründer und Herausgeber des Jahrbuchs<br />
“Gegenwartsliteratur”. Vor zwei Jahren erschien sein Buch “Bürgerkrieg global.<br />
Menschenrechtsethos und deutschsprachiger Gegenwartsroman” und in diesem Jahr<br />
seine Studie “Hermann Broch und die Moderne” (beide bei Wilhelm Fink in München).<br />
E-Mail: jahrbuch@wustl.edu<br />
Mächler, Lissette<br />
Lissette Mächler, in Barranquilla/ Kolumbien geboren und aufgewachsen, absolvierte<br />
ihr Magisterstudium der germanistischen Linguistik an der Universität Hamburg. Nach<br />
ihrer Rückkehr in Kolumbien arbeitete sie knapp zwei Jahre als Dozentin für Linguistik<br />
und Didaktik am Studiengang „Licenciatura en Filología e Idiomas. Alemán“ an der<br />
Universidad Nacional de Colombia in Bogotá sowie als DaF-Lehrerin am Goethe-<br />
Institut Bogotá. 2009 schloss sie die Schreibberaterausbildung an der PH Freiburg ab.<br />
233
234<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Seit Frühjahr 2009 promoviert sie über den „Erwerb des wissenschaftlichen Schreibens<br />
in der Fremdsprache Deutsch“ an der PH Freiburg. Seit August 2009 arbeitet sie als<br />
Linguistik-Dozentin am Studiengang „Maestría en Lingüística Intercultural: Alemán<br />
como Lengua Extranjera“ an der Universidad de Antioquia in Medellín, Kolumbien.<br />
E-Mail: lissette.maechler@gmail.com<br />
MacKeldey, Anja<br />
Anja María MacKeldey verbringt ihren ersten Lebensabschnitt (1967-1987) als Tochter<br />
zugewanderter „Preußen“an der Grenze zwischen Oberbayern und Schwaben mit<br />
der „Vertiefung in Liebe zum Landleben, humanistische Bildung und Punk.“ Das<br />
Magisterstudium in „Vergleichender Literatur, romanistischer Literaturwissenschaft/<br />
Spanisch und angewandter Sprachwissenschaft/ Romanistik“ (1988-1994) in<br />
Augsburg, das empirische Studium der „deutsch, englisch und spanischsprachigen<br />
Anarkopunkbewegungen“ und ein DaF-Zusatzstudium (1994/5) verlegen ihren<br />
Lebensmittelpunkt ab 1996 nach Medellín/Kolumbien. Dort ist sie von 1996-<br />
1998 als DaF-Lehrkraft an der Universidad Nacional und der Universidad EAFIT,<br />
dem Humboldt-Institut und seit 1997 an der Deutschen Schule Medellín tätig.<br />
Nach verschiedenen Fortbildungen im Erziehungswissenschaftlichen und DaF-<br />
Bereich entwickelt sie seit 08/2004 an der Universidad de Antioquia/Medellín<br />
ihre Promotion in Erziehungswissenschaften ergänzend zu ihrer ausschließlichen<br />
Lehrtätigkeit an der DS Medellín als DaF-Lehrkraft, ToK/IB (Theory of Knowledge)-<br />
Koordinatorin (2009), DaF-Koordinatorin (2011) und Deutsch/IB-Lehrkraft (ab 2012)<br />
in der Oberstufe.<br />
E-Mail: tapiro@gmx.net<br />
Mager Hois, Elisabeth Albine<br />
Elisabeth Albine Mager Hois hat im Jahre 1971 in Regensburg das Studium<br />
der Pädagogik und 2004 in Mexiko-Stadt an der ENAH das Studium der<br />
Sozialanthropologie absolviert. 2001 hat sie an der FES Acatlán, UNAM, das<br />
Magisterstudium, Mexiko-USA, abgeschlossen und 2008 an der Philosophisch-<br />
Literarischen Fakultät derselben Universität zum Doktor in Anthropologie<br />
promoviert. Seit 1980 ist sie Deutschlehrerin an der FES-Acatlán und nationale<br />
Forscherin (SNI). 2009 hat sie vom CISAN den Preis für die beste Doktorarbeit und<br />
2010 vom CIESAS und der Universität von Veracruz die Ehrenbezeichnung des<br />
Lehrstuhls Gonzalo Aguirre Beltrán erhalten. Es wurden vier Bücher veröffentlicht:<br />
Lucha y resistencia de la tribu kikapú (FES-Acatlán, UNAM), und 2008 die 2. aktualisierte<br />
Ausgabe; im Jahre 2006 die Monographie Kikapú (CDI) und 2010 das Buch Casinos<br />
y poder (CISAN, IIA und FES-Acatlán, UNAM). Außerdem verfügt sie über mehr als<br />
30 veröffentlichte Artikel über ethnische Identität, Gruppenkohäsion, Lexiko und<br />
literarische Analysen, unter anderem.<br />
E-Mail: emagerh@yahoo.com.mx
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Maldonado Alemán, Manuel Prof. Dr.<br />
Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte an der Universität zu Köln.<br />
Ab 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Sevilla (Spanien). 1994<br />
Promotion. Seit 1996 Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität<br />
Sevilla. Forschungsaufenthalte in Siegen, Leipzig, Frankfurt a. M., Stanford,<br />
Bamberg, Berlin und Auckland. Forschungsprojekte zur deutschen Literatur nach<br />
der Vereinigung und zum Themenfeld Gedächtnis und Literatur. Buchpublikationen<br />
und zahlreiche Aufsätze zur deutschen Literatur des 19.-21. Jahrhunderts<br />
sowie zu literatursystematischen Fragestellungen. Forschungsschwerpunkte:<br />
Expressionismus und Dadaismus, deutschsprachige Gegenwartsliteratur,<br />
literarische Erinnerungsdiskurse, Literaturgeschichte und Pragmatik der Literatur.<br />
E-Mail: mmaldonado@us.es<br />
Massa, Adriana<br />
Dr. für moderne Literatur, ordentliche Prof. für deutsche Literatur (Fakultät für<br />
Philosophie und Geisteswissenschaften, UNC), Ordentl. Prof. unf Inhaberin des<br />
Lehrstuhls für Diskursanalyse und -theorie, (Deutschabteilung der Sprachenfakultät<br />
der UNC). Vorsitzende des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes (<strong>ALEG</strong>) 2006-<br />
2009. Gegenwertig Vorsitzende des argentinischen Germanitikverbandes (AAG).<br />
E-Mail: adrianamassa@hotmail.com<br />
Maul, Cornelia Anna<br />
Cornelia Anna Maul, geb. 1982 in Burglengenfeld (bei Regensburg). 2002-2008<br />
Studium der Neueren deutschen Literatur, Spanischen Philologie und Neueren<br />
Geschichte an der Universität Regensburg, der Universitat de Barcelona und der<br />
Freien Universität Berlin; Zusatzausbildung in Deutsch als Fremdsprachenphilologie.<br />
2009 DAAD-Sprachassistentin am Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas<br />
“Juan Ramón Fernández” in Buenos Aires. Seit 2010 Lehrbeauftragte für Deutsch<br />
als Fremdsprache und Promotionsstudentin an der Humboldt-Universität zu Berlin.<br />
Dissertationsprojekt mit dem Arbeitstitel „Die Poetiken der Transdifferenz im<br />
europäischen Gegenwartsroman“, betreut von Prof. Dr. Dieter Ingenschay, finanziert<br />
durch das Elsa-Neumann-Stipendium des Landes Berlin.<br />
E-Mail: corneliamaul@hotmail.com<br />
Meireles, Selma M. Dr.<br />
Studium der Anglistik, Germanistik und Romanistik (Portugiesisch) an der Universität<br />
São Paulo, Brasilien. Referendariat für Absolventen der Germanistik in Brasilien<br />
am Goethe Institut São Paulo. M. A. Studiengang der germanistischen Linguistik<br />
– Universität São Paulo. Dissertationsschrift: A negação sintaticamente explícita<br />
em diálogos falados do português e do alemão [Syntaktisch explizite Negation<br />
in gesprochenen Dialogen im Deutschen und brasilianischen Portugiesisch].<br />
Promotionsstudium der germanistischen Linguistik an der Universität São Paulo.<br />
235
236<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Doktorarbeit: A Dissensão e as Estratégias de Trabalho da Face em diálogos do alemão<br />
(veröffentlicht 2002 als Dissension and Face-Work Strategies in German Dialogues<br />
– Linguistische Arbeiten 457 – Niemeyer). Seit 1987 Dozentin für Deutsch als<br />
Fremdsprache und germanistische Linguistik an der Universität São Paulo, Brasilien.<br />
E-Mail: mazzari@usp.br<br />
Merzig, Brigitte<br />
Brigitte Merzig ist seit vielen Jahren für den Bereich Phonetik und Phonologie der<br />
Studiengänge DaF-Lehramt, Überesetzung Deutsch-Spanisch und Germanistik der<br />
Facultad de Lenguas der Universidad Nacional de Córdoba zuständig. Ausserdem<br />
ist sie an dieser Institution Dozentin für Technische und wissenschaftliche<br />
Übersetzung. Ihre Forschungsinteressen sind Didaktik der Phonetik-Phonologie und<br />
der Übersetzung, kontrakstive Phonetik Deutsch-Spanisch und Phraseologismen<br />
in der Übersetzung. Innerhalb dieser Schwerpunkte entwickelt sie spezifisches<br />
Studienmaterial, zum Teil auch multimedial. Sie hat ihre Arbeiten auf Kongressen<br />
innerhalb Argentiniens und Lateinamerikas vorgestellt und veröffentlichte auf<br />
Deutsch und Spanisch in Sammelbänden und argentinischen und internationalen<br />
Fachzeitschriften.<br />
E-Mail: brigitte_merzig@yahoo.de<br />
Michael, Joachim Dr.<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg. Unterrichtet<br />
iberoamerikanische Literatur, Kultur und Medien am Institut für Romanistik. 2008<br />
und 2009 bis 2010 Gastdozenturen an der Universidad de Guadalajara, Mexiko.<br />
Dissertation in Freiburg i.Br. über lateinamerikanische Telenovelas (Telenovelas<br />
in Lateinamerika: intermediale Gattungspassagen und kulturelle Zäsur, 2010).<br />
Mitherausgegebene Sammelbände: Machado de Assis e a escravidão, São Paulo,<br />
2010; Massenmedien und Alterität, Frankfurt, 2004; Imágenes en vuelo, textos en fuga.<br />
Identidad y alteridad en el contexto de género y medio de comunicación, Frankfurt,<br />
2004; Passagens de gêneros na cultura brasileira, Frankfurt, 2003; O Brasil no contexto<br />
latino-americano, Tübingen, 2001. Eine Reihe von Beiträgen zur Medientheorie, zu<br />
lateinamerikanischen Medienkulturen und zur Kolonialliteratur sowie zur Literatur<br />
des 19. und 20. Jahrhunderts. Aktuelles Forschungsthema: Gewalt und Apokalypse.<br />
Zu diesem Thema liegen ebenfalls Einzelveröffentlichungen vor.<br />
E-Mail: Joachim.Michael@uni-hamburg.de<br />
Morales, Alberto<br />
Der Referent hat Germanistik an der Universität Havanna studiert. Seit 1995 arbeitet<br />
er als Deutschlehrer für Berufsbezogenes Deutsch im Tourismus. Er hat die Reihe<br />
„Deutsch im Tourismus“ (Lehrmaterialien für kubanische Tourismusstudenten)<br />
konzipiert. 2006 hat er seine Magisterarbeit über die Fertigkeit Schreiben bei<br />
Reklamationsbriefen in Reiseagenturen geschrieben. Ab 2011 schreibt er seine
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Dissertation über interkulturelle Kommunikation kubanischer Reiseleiter. Im Februar<br />
2011 wurde er zum Vorsitzenden des Deutschlehrervereins von Kuba gewählt.<br />
E-Mail: juanalf@infomed.sld.cu<br />
Müller, Gesine<br />
Gesine Müller leitet seit 2008 die Emmy Noether-Nachwuchsgruppe (DFG)<br />
“Transkoloniale Karibik” am Institut für Romanistik der Univ. Potsdam. In ihren<br />
Publikationen hat sie sich schwerpunktmäßig mit Literaturen und Kulturen<br />
Lateinamerikas und der Karibik beschäftigt. Hier sind vor allem ihre beiden<br />
Qualifikationsschriften “Die Boom-Autoren heute. García Márquez, Fuentes, Vargas<br />
Llosa, Donoso und ihr Abschied von den großen identitätsstiftenden Entwürfen”<br />
(Diss., Frankfurt: Vervuert 2004), sowie “Die koloniale Karibik zwischen Bi-Polarität<br />
und Multirelationalität. Transferprozesse in frankophonen und hispanophonen<br />
Literaturen.” (Habil, im Druck bei De Gruyter, Reihe mimesis. Romanische Literauren der<br />
Welt (Hg. O. Ette)). Zudem ist sie Mitherausgeberin mehrerer Sammelbände. Seit Juni<br />
2011 ist sie Kooperationspartnerin des Suhrkamp-Forschungskollegs am Deutschen<br />
Literaturarchiv Marbach (Bereich: Suhrkamps internationale Beziehungen).<br />
E-Mail: gesine.mueller@uni-potsdam.de<br />
Müller Uhlenbrock, Klaus Dr.<br />
Philosophie, Religionswissenschaften und Geschichte an der Freien Universität<br />
Berlin. Promotion an der UNAM. Professor an der Deutsch-Abteilung und am<br />
Postgraduiertenstudiengang der Rechtswissenschaft der UNAM, FES Acatlán.<br />
E-Mail: klausm50@hotmail.com<br />
Münster, Morton<br />
Morton Münster, Erststudium der Romanischen Philologie und Linguistik des Deutschen<br />
an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen von 2002 bis 2007 mit dem Abschluss<br />
Magister Artium. Zusatzstudium der Philosophie ebenfalls in Tübingen. Seit 2005<br />
Freier Übersetzer und seit 2007 Lektor für Deutsche Philologie an der Universidad de<br />
Extremadura. Promotionsvorhaben im Cotutelleverfahren zwischen den Universitäten<br />
Tübingen und Extremadura seit 2008 mit dem Arbeitstitel „Das Unsagbare sagen. Ein<br />
phänomenologischer Vergleich von Wolfgang Hildesheimers Masante und Tynset, Juan<br />
Benets Herrumbrosas lanzas und Mia Coutos Estórias abensonhadas“.<br />
E-Mail: muenster@unex.es<br />
Muranyi, Heike<br />
Heike Muranyi studierte Lusitanistik, Anglistik und Komparatistik an den Universitäten<br />
Leipzig und Wien und promovierte sich 2011 an der Universität Potsdam (Titel der<br />
Arbeit: „Brasilien als insularer Raum. Literarische Bewegungsfiguren im 19. und 20.<br />
Jahrhundert ̏; Publikation in Vorbereitung). Seit 2010 ist sie als Lektorin des DAAD<br />
an der Universidade Federal de Minas Gerais in Belo Horizonte tätig.<br />
E-Mail: heike.muranyi@gmail.com<br />
237
238<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Neumann, Gerson Roberto Dr.<br />
Dr. Gerson Roberto Neumann ist seit 2011 an der Universidade Federal do Rio<br />
Grande do Sul – UFRGS – tätig, wo er sich besonders mit der deutschen Literatur<br />
des 19. Jahrhunderts und der Literatur in deutscher Sprache in Brasilien beschäftigt.<br />
Er studierte Sprachwissenschaften Portugiesisch/Deutsch an der UNISINOS, in São<br />
Leopoldo, Brasilien. Von 1996 bis 2001 war er in Rio de Janeiro als Deutschlehrer<br />
tätig. Master an der UFRJ im Bereich Literaturwissenschaften – Vergleichende<br />
Literatur. Promotion in Germanistik an der FU-Berlin. Von 2006 bis 2008 Dozent an<br />
der UFRGS und 2008 an der PUCRS, in Porto Alegre. Von 2009 bis 2010 hatte er eine<br />
Stelle an der UFPel, in Pelotas.<br />
E-Mail: gerson.neumann@gmail.com<br />
Nickel, Ingeborg<br />
Studium der Hispanistik, Germanistik und Mediävistik. Wissenschaftliche<br />
Angestellte am Institut für Romanistik und am Sprachenzentrum der Universität<br />
Erlangen-Nürnberg. Langjährige stellvertretende Vorsitzende des Deutschen<br />
Spanischlehrerverbandes (DSV). Aktuell: Kurse zur Kulturwissenschaft und<br />
Landeskunde in Spanien und Lateinamerika. Publikationen zur spanischen und<br />
lateinamerikanischen Literatur, Kunst und Kultur.<br />
E-Mail: IngeborgNickel@gmx.de<br />
Nowinska, Magdalena<br />
Studium der Geschichte, Slawistik und Anglistik an der Universität Regensburg und<br />
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland. Studienaufenthalt an<br />
der Universität Leicester, England. M.A. in Osteuropäischer Geschichte. Promotion<br />
im Bereich der Übersetzungswissenschaft an der Universität São Paulo, Brasilien.<br />
E-Mail: mnowinska@gmx.net<br />
Ortega González, Edgar<br />
Ich wurde am 14. April 1989 in Zacapu, Michoacan geboren. Von Kindheit an<br />
waren Sprachen mein Hauptinteresse und waren eine Motivation zum Lernen, da<br />
ich immer an öffentlichen Schulen lernte. Im Jahr 2007 trat ich das Studium der<br />
Germanistik in der Philosophischen Fakultät der UNAM an. In den Jahren 2008 und<br />
2009 erhielt ich ein Stipendium des Goethe-Instituts Mexiko, um mein Deutsch in<br />
Göttingen und Innsbruck zu verbessern. Ich bin zur Zeit Assistent an der Universität<br />
und beteilige mich an dem Wettbewerb SECREA für junge Künstler, von der<br />
Regierung des Bundesstaates Michoacán.<br />
E-Mail: edogyn@yahoo.se<br />
Padilla Martínez, Pamela Esmeralda<br />
Geboren 1983 in Guadalajara, Mexiko. 2001-2009: Studium in Philosophie an der<br />
Universidad de Guadalajara, Mexiko. 2006-2007: 2 Auslandssemester an der Julius-<br />
Maximilians-Universität Würzburg. 2009-2012: Master-Studium in Angewandter
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Linguistik an der Universidad de Guadalajara, Mexiko. 2011: Forschungsaufenthalt<br />
an der Universität Leipzig.<br />
E-Mail: pamespm@gmail.com<br />
Paulino, Sibele<br />
Von 2008 bis 2011 war ich Mitarbeiterin des vom Prof. Dr. Paulo Soethe<br />
koordenierten Zentrum für deutsch-brasilianische Zusammenarbeit (ZdbZ/<br />
UFPR). Zusammen mit ihm veröffentlichte ich 2009 einen Artikel, in dem<br />
der Dialog zwischen brasilianischer und deutscher Literatur und Kultur den<br />
Zentralpunkt ausmacht. 2009 nahm ich an der Organisation des vom ZdbZ<br />
veranstalteten 4. Deutsch-Brasilianischen Symposiums teil. Unterstützt durch<br />
den DAAD verbrachte ich 2010 drei Monate in Berlin, in denen ich u.a. folgende<br />
Aktivitäten durchgeführt habe: Gespräch mit Prof. Dr. Ottmar Ette, meinem<br />
Betreuer bei der Gelegenheit; Forschung am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI);<br />
und Vorstellung eines Beitrags auf einem Kolloquium in diesem Institut. 2011<br />
schloss ich als Stipendiat meinen Magister an der Universidade Federal do Paraná<br />
ab. Seit 2010 pflege ich engen Kontakt mit dem Geographischen Institut an der<br />
UFPR, wo ich Seminare auf postgradualem Niveau besuche und die Promotion in<br />
kultureller Geographie anstrebe.<br />
E-Mail: sibelepaulino@yahoo.com.br<br />
Peña, Irsula Jesús<br />
1969-1973 Deutschlehrerstudium (Mittelstufe) Fremdspracheninstitut „Maxim<br />
Gorki“, Havanna. 1973 – Sommerkurs für Germanistikstudenten, Universität<br />
Rostock. Kurs für Deutschunterricht mit der Methode „Guten Tag Berlin“, Humboldt-<br />
Universität. 1973 – 1975 Deutschlehrer im Institut für Dolmetscher und Übersetzer<br />
„Paul Lafargue“, Havanna. 1975 -1979 Studium der Germanistik an der Universität<br />
Leipzig. 1979 -1983 Dozent an der Pädagogischen Hochschule für Fremdsprachen<br />
„Paul Lafargue“, Havanna. 1982- 6 Monatiger Weiterbildungskurs für Deutschlehrer<br />
an der Universität Potsdam. IWS Brandenburg. 1983 – 1994 Übersetzer und<br />
Simultandolmetscher im ESTI. Fremdsprachendienst des Ministerrates der<br />
Republik Kubas. 1998 – 1992 Promotion im Bereich der Komparativen Linguistik<br />
Deutsch – Spanisch. Dr. Phil mit dem Thema Substantiv – Verbkollokationen,<br />
Universität Leipzig. 1994 – 1999 Direktor für Internationale Beziehungen der UNEAC<br />
(Schriftsteller- und Künstlerverband Kubas. Ab 2000 freischaffender literarischer<br />
Übersetzer, Fachübersetzer und Dolmetscher und Reiseleiter<br />
E-Mail: irsula@cubarte.cult.cu<br />
Pereira, Valéria Sabrina<br />
Valéria Pereira studierte deutsche und brasilianische Literatur an der Universität São<br />
Paulo. Nach Stipendienaufenthalten in Deutschland verfasste sie ihre Mestrado-<br />
Arbeit über die weiblichen Figuren im Nibeliungenlied und der Völsungasaga.<br />
239
240<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Im Jahr 2011 promovierte sie über Kempowskis Echolot – Barbarossa ’41. Zurzeit<br />
arbeitet sie als Dozentin für Deutsch an der Fakultät São Francisco der Univesität<br />
São Paulo und an einem Projekt zur politischen Dystopien des 20. Jahrhunderts.<br />
E-Mail: valeria_sabrina@yahoo.com.br<br />
Perez, Juliana Prof. Dr.<br />
FAPESP- und DAAD-Stipendiatin, hat an der Universidade de São Paulo (USP) und<br />
an der RWTH Aachen promoviert. Von 2006 bis Anfang 2009 war sie Professorin<br />
für deutsche Sprache und Literatur an der Universidade Federal do Rio de Janeiro<br />
(UFRJ). 2009 trat sie eine Stelle als Professorin für deutschsprachige Literatur an der<br />
USP an. Forschungsschwerpunkte: Deutschsprachige Lyrik des 20. Jahrhunderts,<br />
Forschung der brasilianischen und deutschsprachigen Literatur in literarischen<br />
Archiven.<br />
E-Mail: perez.usp@gmail.com<br />
Peuschel, Kristina Dr.<br />
Studiert an den Universitäten Leipzig und Sevilla. Magistra Artium 2002 in den<br />
Fächern Deutsch als Fremdsprache, Hispanistik und Ost- und Südosteuropäische<br />
Geschichte. Von 2006 bis 2011 Mitarbeiterin des Herder-Instituts, Universität<br />
Leipzig. Promoviert mit Dr. phil. an der Universität Leipzig, Philologische Fakultät,<br />
Herder-Institut (DaF, DaF), im Jahr 2011 mit einer empirischen Untersuchung zur<br />
Sprachlichen Tätigkeit in Radio- und Podcastprojekten. Derzeit DAAD-Lektorin an der<br />
Universidade de São Paulo, Brasilien. Berufs- und Unterrichtserfahrung sowohl in der<br />
Sprachlehre als auch in der Aus- und Fortbildung von Studierenden und Lehrenden<br />
zu Themen wie Lernberatung, Projektdidaktik und Podcasts, Alphabetisierung in<br />
der Zweitsprache Deutsch, Fremdsprachenerwerb, Curriculumentwicklung<br />
E-Mail: daad_usp@daad.org.br<br />
Pfleger, Sabine Dr.<br />
Dr. Sabine Pfleger ist Professorin für Linguistik an der Universidad Nacional<br />
Autíonoma de México. Sie arbeitet und forscht im Posgrado de Lingüística sowie am<br />
Fremdsprachenzentrum der UNAM. Seit 2010 ist sie Mitglied im Sistema Nacional<br />
de Investigadores. Ihre Forschungsinteressen reichen von kognitiver Semantik<br />
über Studien zur Narrativität bis hin zu interkulturellen Fragestellungen. Sabine<br />
Pfleger erhielt 2010 den Sonderpreis beim Premio Nacional del INAH für die beste<br />
Dissertation im Bereich Linguistik und die Medalle Alfonso Caso der UNAM für<br />
herausragende akademische Leistungen.<br />
E-Mail: feliza@prodigy.net.mx<br />
Pino Madroñal, Lucía Orquídea Dr.<br />
Otros títulos: Germanista Diplomada. Formación en Traducción e Interpretación.<br />
Categoría docente: Prof. Titular. Labor que desempeña: Profesora de traducción.<br />
Líneas de investigación que desarrolla y las tres investigaciones más importantes
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
realizadas en los últimos cinco años: Recursos lingüísticos para la expresión<br />
del mandato en un texto directivo. La lingüística del texto y su aplicación en la<br />
enseñanza de la traducción a filólogos. Acerca de la Audiodescripción Cognición<br />
y traducción. Asignaturas que habitualmente imparte: Pre-grado: Traducción I y II,<br />
Gramática Alemana I y II, Traducción Asistida por computador.Postgrado: Tópicos de<br />
Traductología. Últimas publicaciones: Actas del XIII Congreso de la <strong>ALEG</strong>. Córdoba,<br />
Argentina (2009) Cruzando fronteras sensoriales: La audiodescripción. Traducción<br />
de tres artículos de Albrecht Neubert, que aparecerán en el 2011 en la serie “Studien<br />
zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation“, Peter<br />
Lang Verlag: La Escuela Traductológica de Leipzig: sus inicios, su credo y su florecer<br />
(1965-1985). Otros: Presidenta del Congreso de la <strong>ALEG</strong>, La Habana, 2006<br />
E-Mail: lopino@flex.uh.cu<br />
Pleß, Ulrike<br />
1983 in Berlin geboren; 2003-2007 Studium des Bachelor of Arts „Mehrsprachige<br />
Kommunikation“ an der Fachhochschule Köln mit Auslandsjahr an der Universidad<br />
Europea de Madrid in Spanien. Im Anschluss Praktika, beim Goethe-Institut in<br />
Brüssel und in Madrid. 2007-2009 Studium des Master of Arts im „Fachübersetzen“<br />
ebenfalls an der Fachhochschule Köln mit Studienaufenthalt an der Universidad<br />
Nacional de Córdoba in Argentinien; Praktikum im Übersetzungsbüro „intextus“ in<br />
Córdoba, Argentinien. Abschluss August 2009 in Köln. Anschließend 6-monatiges<br />
Praktikum beim Übersetzungsbüro „transcript“ in Köln. Sommer 2010 einjährige<br />
DAAD-Sprachassistenz an der Universidad de Guadalajara, Mexiko. Seit Sommer<br />
2011 Vertrag als Profesor Huésped an ebendieser Einrichtung.<br />
E-Mail: ulrikeist@hotmail.de<br />
Pressler, Gunter Karl Dr.<br />
Geb. 1951 in Delmenhorst (Niedersachsen). Nach Berufsausbildung und Zweitem<br />
Bildungsweg (Westfalen Kolleg/Paderborn) Studium der Neueren Deutschen<br />
Literaturgeschichte, Theaterwissenschaft und Philosophie in München und<br />
Neapel (Magister; Veröffentlichung 1998). Wissenschaftsjournalismus und<br />
Kongressorganisation (“Geist und Natur”, 1988 in Hannover; Theaterfestival<br />
1980/82/84/87 in München und Stuttgart). Promotion an der Universität von São<br />
Paulo (USP) über die Rezeption Walter Benjamins in Brasilien (Veröffentlichung<br />
2006). Sprachlehrer am Goethe-Institut und am brasilianischen Auβenministerium<br />
in Brasilia. Seit 1996 Hochschuldozent für Literaturtheorie an der Universität<br />
in Belém (UFPA) in der Graduation und in zwei Magisterstudiengängen.<br />
Forschungsgebiete: Handlungs- und Erzählteorie, Hermeneutik, Moderne,<br />
Rezeptions- und Übersetzungstheorie. Letzte Buch und Zeitschriftpublikationen:<br />
“De Marajó para o Mundo: a Cidade dos Sonhos”. Revista de História (Rio de Janeiro,<br />
2011), “Amazoniens gröβter Romanautor Dalcídio Jurandir und die Welt des Marajó-<br />
241
242<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Archipels” In: Amazonien. Weltregion und Welttheater. Berlin und São Paulo (2010),<br />
“Benjamin in der Perspektive der Konkreten Poesie (Brasilien)” (Pisa/Roma, 2009).<br />
E-Mail: gupre@ufpa.br<br />
Pupp Spinassé, Karen Prof. Dr.<br />
Prof. Dr. Karen Pupp Spinassé ist seit 2006 Professorin für Deutsch als Fremdsprache an der<br />
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) in Porto Alegre, Brasilien. Vor ihrem<br />
Ruf an diese Universität studierte sie deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften an<br />
der Universidade Federal do Rio de Janeiro (1997-2000) und promovierte in Deutsch als<br />
Fremdsprache an der Technischen Universität Berlin (2001-2005).<br />
An der UFRGS ist Prof. Pupp Spinassé besonders in den Bereichen Sprachwissenschaft<br />
und Didaktik tätig, und ist die Koordinatorin für die deutsche Sprache in den<br />
Sprachkursen der Universität. Ihre Forschungsschwerpunkte sind hauptsächlich<br />
die Fremdsprachendidaktik, die Spracherwerbsforschung und der Bilingualismus.<br />
E-Mail: spinasse@ufrgs.br<br />
Rall, Dieter Prof. Dr.<br />
Studium der Romanistik und Germanistik in Tübingen, Berlin, Innsbruck,<br />
Toulouse und Pau. Dr. phil. 1968 mit einer Dissertation über die Rezeption<br />
spanischer Literatur in Frankreich. 1969-1973 DAAD-Lektor in Mexiko. Von 1975<br />
bis 2007 Ordentlicher Professor für Deutsch als Fremdsprache, Germanistik<br />
und Literaturbeziehungen zwischen Europa und Lateinamerika an der<br />
Universidad Nacional Autónoma de México. Zahlreiche Buchpublikationen<br />
und Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden, die v.a. in Deutschland und<br />
Lateinamerika erschienen sind. Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte<br />
u.a an den Universitäten von München, Istanbul, Montreal, Potsdam, Salzburg,<br />
sowie Einladungen an Universitäten in Argentinien, Brasilien, Chile, Costa<br />
Rica, Kolumbien, Perú, Venezuela. 1991-1994 Präsident der <strong>ALEG</strong>. Im Jahr<br />
2000 Auszeichnung mit dem Universitätspreis der UNAM für Lehre in den<br />
Geisteswissenschaften. Seit 2003 Mitglied der Mexikanischen Akademie der<br />
Wissenschaften. 2009 Bundesverdienstkreuz für die Förderung der deutschen<br />
Sprache und der Germanistik in Mexiko und Lateinamerika.<br />
E-Mail: dieterrall@hotmail.com<br />
Redondo, Tercio<br />
Tercio Redondo, geboren 1957 in São Paulo, promovierte mit einer Arbeit über<br />
Woyzeck von Georg Büchner. Seit 2010 ist er Professor für Deutsche Literatur an der<br />
Universidade de São Paulo. Auch als Übersetzer tätig hat er unter anderen Werke<br />
von Büchner, Rilke, Jünger und Brecht ins Portugiesische übersetzt. Im Moment<br />
beschäftigt er sich mit den erzählerischen Texten Robert Walsers im Vergleich zu<br />
einigen brasilianischen Romanen des 20. Jahrhunderts.<br />
E-Mail: tercioredondo@terra.com.br
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Reichmann, Tinka Dr.<br />
Tinka Reichmann hat an der Universität Heidelberg und an der Universität des<br />
Saarlandes Diplom-Übersetzen (Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch,<br />
Sachfach: Recht) studiert. Die Promotion erfolgte 2005 an der Universität des<br />
Saarlandes. Sie ist als Übersetzerin und Dolmetscherin für Portugiesisch und als<br />
Übersetzerin für Englisch, Französisch und Spanisch am Landgericht Saarbrücken<br />
vereidigt. Seit 2008 ist sie Professorin für Übersetzungswissenschaft an der<br />
Universidade de São Paulo, Vertreterin der Gesellschaft für deutsche Sprache in São<br />
Paulo und seit 2009 DAAD-Ortslektorin.<br />
E-Mail: reichmann@usp.br<br />
Reinert, Bastian<br />
Bastian Reinert hat Neuere deutsche Literatur, Amerikanistik und Geschichte an<br />
der Freien Universität Berlin, am University College London und an der Washington<br />
University in St. Louis studiert, wo er 2006 für eine Arbeit über Paul Celan (betreut<br />
von Paul-Michael Lützeler) seinen M.A. erhalten hat. Er promoviert am Department<br />
of Germanic Studies der University of Chicago mit einer Arbeit zum toten Erzähler<br />
in der Literatur nach 1945.<br />
Veröffentlichungen u.a.: Metaleptische Dialoge. Wirklichkeit als Reflexionsprozess<br />
in Annette von Droste-Hülshoffs Versepos Des Arztes Vermächtniß, in: Redigierte<br />
Tradition. Literaturhistorische Positionierungen Annette von Droste-Hülshoffs,<br />
hrsg. von Claudia Liebrand, Irmtraud Hnilica und Thomas Wortmann, Paderborn:<br />
Ferdinand Schoeningh 2010, S. 75-89. Im Frühjahr 2012 erscheint „Wir taten ein<br />
Schweigen darüber“. Intertextualität als Zeugenschaft in Paul Celans Engführung,<br />
Würzburg: Königshausen & Neumann. In Vorbereitung sind zudem ein Aufsatz<br />
zu Rainer Werner Fassbinders Querelle sowie die Herausgabe der Gesammelten<br />
Schriften von Margareta Klopstock.<br />
E-Mail: bastian.reinert@web.de<br />
Renner, Rolf G. Prof. Dr.<br />
Geboren 1945. Studium der Germanistik, Geschichte und Wissenschaftlichen Politik<br />
in Wien und Freiburg i. Br. Promotion 1976. Habilitation 1983. Seit 1989 Professor<br />
für Neuere deutsche Literaturgeschichte und Vorsitzender des Frankreich-Zentrums<br />
an der Universität Freiburg i.Br., Lehrtätigkeit in München, Göttingen, Bochum;<br />
mehrere Gastprofessuren in den USA, Australien, Neuseeland, Argentinien, Brasilien<br />
und Mexiko.<br />
E-Mail: rolf.renner@googlemail.com<br />
Ríos Kuri, Sandra<br />
Meistergrad in angewandte Linguistik 2008-2010, UNAM (gerade an den Korrekturen<br />
der Schlussarbeit). Germanistik-Titel (2004), UNAM. Teilnahmebestätigung<br />
am Deutschsprachkurs, (2005) Goethe Institut Göttingen. Teilnahme am<br />
243
244<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Sonderprogramm für Lateinamerikanische Graduierte der Fachrichtung<br />
Germanistik. Albert Ludwig Universität, (2005) Freiburg am Breisgau. Mexikanisch-<br />
Deutscher Kultur-und Sprachvergleich, (2002) Europa Universität Viadrina,<br />
Frankfurt, Oder. <strong>Programm</strong> für Übersetzerausbildung, Deutsch-Spanisch, (2002)<br />
COLMEX. Deutschlehrerin: CELE, UNAM seit 2004.<br />
E-Mail: sandra.rios@cele.unam.mx<br />
Robin, Guillaume Dr.<br />
Dr. in Germanistik (Thema: „Der antifaschistische Widerstandskampf der deutschen<br />
Arbeitersportler 1919-1945“). Wissenschaftlicher Mitarbeiter im GEPECS-<br />
Forschungslabor. Als Forscher befasse ich mich mit der Frage der kollektiven<br />
Identität unter dem besonderen Blickwinkel der deutschen Sportgeschichte und<br />
der Bild-Medien (Photographie, Film & Zeitgenössische Kunst). Die Geschichte<br />
des deutschen Sports im 20. Jahrhundert, besonders die des Arbeitersports<br />
von 1893 bis 1945. Gekreuzte Perspektiven: Sport & Photographie ; Sport & Film;<br />
Sport & zeitgenössische Kunst. Eine detaillierte Biographie und eine Liste meiner<br />
Publikationen (Bücher, Artikel, Rezensionen usw.) finden Sie auf der Homepage<br />
meines Forschungslabors. Ich lehre Wirtschaftsdeutsch an der Fachhochschule<br />
Paris Descartes für Studierende aus verschiedenen Fachbereichen: Information-<br />
und Kommunikationswissenschaften; Betriebswirtschaftslehre; Buchwesen. Ich<br />
bin zuständig für die internationalen Beziehungen mit Partneruniversitäten,<br />
insbesondere mit den deutschsprachigen Ländern.<br />
E-Mail: guillaumerobin.paris@gmail.com guillaume.robin@parisdescartes.fr<br />
Rode, Diana Annika<br />
Geb. 20.01.1986 in Lüneburg. 10.2006 – 07.2009 Studium der<br />
Geschichtswissenschaften (Hauptfach) und der Hispanistik (Nebenfach) an der<br />
Universität Bremen; 2-Fach Bachelor für den schulischen Bereich, Gymnasium,<br />
Bachelor of Arts (Note 1,83). Seit 10.2011 Studium an der Technischen Universität<br />
Berlin. Studiengang „Kommunikation und Sprache- Schwerpunkt Deutsch als<br />
Fremdsprache“. Angestrebter Abschluss: Master of Arts (M.A.). 02.2010 – 02.2011<br />
Lehrbeauftragte der Deutschabteilung der Universidad de Guadalajara, Mexiko.<br />
02.2011 – 08.2011 Tätigkeit als „Profesora de Huésped“ (Gastdozentin) an der<br />
Universidad de Guadalajara, Mexiko<br />
E-Mail: diana_rode@web.de<br />
Rodríguez Moreno, Susy<br />
Studium der Germanistik (Letras Alemanas) an der Philosophischen Fakultät der<br />
Universidad Nacional Autónoma de México. 2000 Stipendiatin des DAAD an der<br />
Universität Freiburg, im Rahmen des Studienprogramms für lateinamerikanische<br />
Graduierte der Fachrichtung Germanistik. Von 2002 bis 2005 Dozentin an der<br />
Deutschen Abteilung der FFyL der UNAM. Seit 2006 Inhaberin eines Lehrstuhls an der
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Abteilung für Expresión Oral y Escrita an der Universidad Autónoma de la Ciudad de<br />
México. Forschungsschwerpunkte: Griechische Mythen im Werk deutschsprachiger<br />
Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts; die Rezeption deutschsprachiger<br />
SchriftstellerInnen in der mexikanischen Literatur. Mitarbeit an einer Untersuchung<br />
über den Einfluss Rainer Maria Rilkes auf das Werk von Juan Rulfo (2006).<br />
E-Mail: susykamepe@hotmail.com<br />
Rohland de Langbehn, Regula Dr.<br />
Regula Rohland de Langbehn, Buenos Aires: Dr. phil., promovierte bei Erich Köhler an<br />
der Universität Heidelberg. Spezialistin für spanische Literatur des Spätmittelalters,<br />
hat zahlreiche Artikel und einige Texteditionen auf diesem Gebiet herausgegeben.<br />
In Buenos Aires vor allem als Germanistin tätig (1987-2007 Professorin für Deutsche<br />
Literatur und Europäische Literatur des Mittelarlers an der UBA). Mitherausgeberin,<br />
verantwortlich für den deutschen Teil, von Inter litteras (11 Bände) und dem Anuario<br />
Argentino de Germanística (bisher 6 Bände). Übersetzte mit ihren Mitarbeitern<br />
zahlreiche Texte zur historischen Literaturtheorie und einige Komödien von Nestroy<br />
und Grabbe, sowie dessen Don Juan und Faust. Arbeitete in den letzten Jahren an<br />
einem Buch über weibliche Pikareske von Pietro Aretino bis Daniel Defoe und an<br />
einem Katalog der deutschsprachigen Publikationen, die in Argentinien ediert<br />
wurden, und organisiert zur Zeit Kolloquien zum Thema der deutschsprachigen<br />
Immigration nach Argentinien.<br />
E-Mail: rrohland@gmail.com<br />
Romão, Tito Lívio Cruz<br />
Dozent an der Universidade Federal do Ceará (Deutsche Sprache und Kultur sowie<br />
Übersetzungswissenschaft); vereidigter Übersetzer und Dolmetscher; verschiedene<br />
übersetzte Artikel und Bücher (z.B.: Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, von<br />
Ottfried Höffe, Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles, von Hans-Georg<br />
Gadamer, und Legalität und Legitimität, von Carl Schmitt)<br />
E-Mail: cruzromao@terra.com.br<br />
Rotemberg, Silvina<br />
Silvina Rotemberg hat den Studiengang Letras der Universidad de Buenos<br />
Aires abgeschlossen, unterrichtet DaF und Allgemeines Übersetzen und ist als<br />
Übersetzerin tätig. Als Licenciada en Letras beschäftigt sie sich mit dem Thema<br />
Wendeliteratur. Sie hat Vorträge zu diesem Thema auf Kongressen des AAG und<br />
auf dem <strong>ALEG</strong>-Kongress 2009 gehalten. Ihr Beitrag “Una mirada literaria sobre la<br />
reunificación alemana” wurde in dem Sammelband Mapas de la transición. La<br />
política después del terror en Alemania, Chile, España, Guatemala, Sudáfrica y Uruguay<br />
(Buenos Aires, Ladosur, 2010) veröffentlicht. Eine Rezension des Bandes erschien in<br />
der Kulturbeilage “ADN” der Zeitung La Nación (19.06.2010).<br />
E-Mail: silvinarotemberg@yahoo.com.ar<br />
245
246<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Saban, Karen Dr. des.<br />
Karen Saban hat Romanistik an der Universität Buenos Aires und Germanistik<br />
an der Universität Freiburg (DAAD-Stipendium) studiert. Als wissenschaftliche<br />
Assistentin am Lehrstuhl für Neudeutsche Literatur der Facultad de Filosofía y Letras<br />
(UBA) schrieb sie über die dramaturgische Theorie Peter Weiss’ und den Einfluss<br />
der marxistischen Literaturtheorie (Brecht, Lukács, Bloch) auf seine Ästhetik des<br />
Widerstands. Seit 2004 arbeitet sie als Lektorin für Spanisch am Romanischen Seminar<br />
der Universität Heidelberg, wo sie neben der Sprachpraxis Spanisch, Proseminare<br />
zur Literatur- und Kulturwissenschaft sowie Literaturübersetzungskurse hält. Ihre<br />
aktuellen Forschungsschwerpunkte sind der Kulturkontakt in der iberischen<br />
Halbinsel und das sephardische Erbe in Deutschland und die deutsch-argentinische<br />
Erinnerungsliteratur. Ihre absolvierte Dissertation über das kulturelle Gedächtnis<br />
und neue argentienische Fiktionen über die letzte Militärdiktatur wird demnächst<br />
im FCE veröffentlicht. Darüber hinaus arbeitet sie freiberuflich als Übersetzerin<br />
(hat u.a. Lúkacs, Goethe, Assmann übersetzt) und ist Co-Verlegerin der online<br />
Literaturzeitschrift HeLix, Beiträge zur romanischen Literaturwissenschaft sowie Co-<br />
Herausgeberin der gleichnamigen Reihe im Winter Verlag.<br />
E-Mail: Karen.Saban@rose.uni-heidelberg.de<br />
Sadowski, Sabrina<br />
WS 2006 – SS 2009 Bachelor of Arts in Language and Communication (Spanisch<br />
und Englisch) an der Universität Siegen / Deutschland; WS 2009 – SS 2011 Master<br />
of Arts in Deutsch als Fremdsprache: Estudios interculturales de lengua, literatura y<br />
cultura alemanas an der Universität Leipzig und der Universität Guadalajara; Titel<br />
der Masterarbeit: DaF für Studierende der Geisteswissenschaften an der Universidad<br />
de Guadalajara, Mexiko. Überlegungen zur Erstellung spezifischen Lernmaterials für die<br />
Fertigkeiten Lesen und Schreiben unter Einbeziehung von studio d als Vorbereitung auf<br />
einen Studienaufenthalt in Deutschland; seit August 2011 DAAD-Sprachassistentin<br />
an der Universidad de Guadalajara / Mexiko.<br />
E-Mail: Sabrina.Sadowski@gmx.de<br />
Saint Sauveur-Henn, Anne Prof. Dr.<br />
Jahrgang 1952, Studium und Abschluss der Germanistik an der Ecole Normale<br />
Supérieure und an der Sorbonne, der Politologie am Institut d’Etudes Politiques<br />
in Paris, 1982 Promotion, 1993 Habilitation an der Sorbonne Nouvelle. Seit 1996<br />
Professorin an der Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Forschungsschwerpunkt: deutsche<br />
Auswanderung nach Argentinien, Exil in Frankreich und Lateinamerika, Identitäten<br />
und Integration. Veröffentlichungen zu Auswanderung und Exil u.a.: Un siècle<br />
d‘émigration allemande vers l‘Argentine 1853-1945, (Böhlau) ; Zweimal verjagt. Die<br />
deutschsprachige Emigration und der Fluchtweg Frankreich-Lateinamerika, 1933-1945<br />
(Metropol); Fluchtziel Paris. Die deutschsprachige Emigration 1933-1940 (Metropol).
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Österreichische Satire. Exil, Remigration, Assimilation (Peter Lang) ; Migrations-,<br />
Emigrations- und Remigrationskulturen (Peter Lang) ; Migrations, intégrations et<br />
identités plurielles. Le cas de l’Allemagne au vingtième siècle (Presses de la Sorbonne<br />
Nouvelle).<br />
E-Mail: Anne.saintsauveur@gmail.com<br />
Sánchez Loyola, Sergio Dr.<br />
Dr. in Germanistik mit einem Magister in Vergleichender Literaturwissenschaft. Ist<br />
Akademiker an der Universität Mexikos (UNAM) wo er seit drei Jahre einen Lehrstuhl<br />
an der germanistischen Abteilung der Facultad de Filosofía y Letras hat. DAAD-<br />
Stipendiat in Berlin, Augsburg und Marbach.<br />
E-Mail: sersaloy@yahoo.com<br />
Sannemann, Mathias<br />
Geboren am 18. Juli 1976 in Bremen. 1996-2005: Lehramtsstudium der Anglistik/<br />
Amerikanistik und Hispanistik an der Universität zu Köln. 2000-2001: akademischer<br />
Auslandsaufenthalt an der Universidad de Costa Rica in San José / Costa Rica. 2002-<br />
2003: Fremdsprachenassistenz DaF an der Drumchapel High School in Glasgow<br />
/ Schottland. 2004-2006: Zertifikatsstudium Deutsch als Fremdsprache (DaF) an<br />
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 2006-2009: Referendariat.<br />
2. Staatsarbeit zum Thema: „eTwinning – ein virtueller Schüleraustausch des<br />
Gymnasiums Leichlingen mit einer Schule in Levice / Slovakei“. 9. Klasse. Zielsprache:<br />
Englisch. PPP, Word-Dokumente, DVD. 2009: Lehrer für Spanisch am Freiherr-vom-<br />
Stein-Gymnasium Leverkusen. Seit 2009: Lehrer für Englisch und DaF an der DS<br />
Guadalajara. Seit 2010: Fachvorsitzender Englisch & Schüleraustauschkoordinator<br />
E-Mail: mathiassannemann@hotmail.com<br />
Saxe, Facundo<br />
Professor für Literaturwissenschaft (Universidad Nacional de La Plata/National<br />
Universität La Plata), JTP/Teaching Asisstant Deutsche Literatur (FaHCE-UNLP),<br />
Fellow PHD CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).<br />
Spezialitäten: Allgemeine und Vergleichende Literaturawissenschaft, Queer Studies.<br />
E-Mail: facusaxe@yahoo.com.ar<br />
Schier, Carmen Dr.<br />
Lehramtsstudium Germanistik/Slawistik und später des Deutschen als<br />
Fremdsprache. 1990 Promotion in der Didaktik und Methodik des Deutschen an der<br />
Akademie der Pädagogischen Wissenschaften in Berlin, später wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin am Institut für Lern- und Lehrforschung in Berlin. DAAD-Lektorin<br />
an der Schewtschenko-Universität Kiew (Ukraine) und Dozentin an der<br />
Universidade de Coimbra (Portugal); DAAD-Lektorin an der Universidade Federal<br />
do Paraná (UFPR) in Brasilien. Seit 2006 am Herder-Institut der Universität Leipzig,<br />
Lehrveranstaltungen im Bereich Kulturstudien/Literatur und Didaktik und Methodik<br />
247
248<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
DaF/DaZ. Zahlreiche Lehrerfortbildungen im In- und Ausland. Fachpublikationen zu<br />
kulturwissenschaftlichen Fragestellungen, zur interdisziplinären Arbeit im Sprach-<br />
und Landeskundeunterricht, zum ganzheitlichen Lernen und zur Behandlung von<br />
Gegenwartsliteratur im DaF-Unterricht<br />
E-Mail: schier@uni-leipzig.de<br />
Schirrmeister, Lars<br />
Geboren 1980 in Magdeburg. 2001 – 2008 Studium der Fachkommunikation<br />
an der Hochschule Magdeburg-Stendal. 10/2003 – 01/2004 Mitarbeit an einem<br />
wasserwirtschaftlichen Sanierungsprojekt an der Universidad de Camagüey, Kuba<br />
als Übersetzer. 02/2004 – 06/2004 Unterrichtspraktikum an der Facultad de Lenguas<br />
Extranjeras (FLEX) der Universidad de La Habana, Kuba. Seit 2008 freischaffender<br />
Übersetzer. Seit 2008 Studierender im Masterstudiengang Deutsch als Fremdsprache<br />
der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 10/2009 Lehrbeauftragter für DaF an der<br />
Hochschule Magdeburg-Stendal. 02/2010 – 06/2010 Auslandssemester am Centro<br />
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) der Universidad Nacional Autónoma de<br />
México (UNAM). 03/2011 – 06/2011 Durchführung der oben genannten Pilotstudie<br />
am CELE der UNAM als Grundlage für eine Masterarbeit<br />
E-Mail: schirrml@cms.hu-berlin.de, lars_schirrmeister@hotmail.com<br />
Schmidt-Welle, Friedhelm Dr.<br />
Dr. phil. Friedhelm Schmidt-Welle ist seit 2000 am Ibero-Amerikanischen<br />
Institut Preußischer Kulturbesitz in Berlin als Verantwortlicher für den Bereich<br />
Literaturwissenschaft und Kulturstudien tätig. Er lehrte zuvor lateinamerikanische,<br />
vergleichende und deutsche Literatur an der Freien Universität Berlin, der<br />
Mexikanischen Nationaluniversität (UNAM), der Universidad Autónoma de Nuevo<br />
León (Monterrey) und der Universidad de Guadalajara. Von 2008 bis 2010 hatte er<br />
den Wilhelm und Alexander von Humboldt-Sonderlehrstuhl des DAAD am El Colegio<br />
de México und der UNAM inne. Im Sommer 2010 lehrte er als William P. and Dewilda<br />
N. Harris German/Dartmouth Dinstinguished Visiting Professor am Dartmouth<br />
College in Hanover, USA. Seit 2009 ist er Mitglied des Herausgebergremiums der<br />
Reihe „Nexos y Diferencias ̏ im Verlag Iberoamericana/Vervuert.<br />
E-Mail: Schmidt-Welle@iai.spk-berlin.de<br />
Schmiedgen, Katja<br />
2006-2009 Studium Translation (Spanisch, Englisch) an der Universität Leipzig;<br />
Abschluss Bachelor of Arts. 2009-2011 Studium ‚Deutsch als Fremdsprache: Estudios<br />
interculturales de lengua, literatura y cultura alemanas‘ an der Universität Leipzig<br />
sowie an der Universidad de Guadalajara, Mexiko; Abschluss Master of Arts. 2011-<br />
DAAD-Sprachassistenz an der Universidad Autónoma de Nuevo León in Monterrey,<br />
Mexiko.<br />
E-Mail: KatjaSchmiedgen@aol.com
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Schneeberger, Paul Christoph<br />
Mein Name ist Paul Schneeberger, ich komme aus Österreich und habe in Wien<br />
Germanistik und Spanisch und Deutsch als Fremdsprache studiert. Neben meiner<br />
Unterrichtsarbeit an verschiedenen Institutionen in Österreich, Spanien und Mexiko,<br />
habe ich Buchausstellungen organisiert, bei einer österreichischen Tageszeitung<br />
gearbeitet und war auch immer wieder als Übersetzer in den Bereichen Kunst und<br />
Kultur tätig. Seit einem Jahr bin ich als Lektor des ÖAD an der UNAM und vor allem<br />
am CELE tätig, wo ich mich mit den Bereichen deutschsprachige Gegenwartsliteratur<br />
und Didaktik beschäftige. In meiner Unterrichtstätigkeit im DaF-Bereich beschäftige<br />
ich mich seit längerer Zeit mit Literatur und Film.<br />
E-Mail: paulschneeberger@gmx.at<br />
Schneider, Maria Nilse Dr.<br />
Maria Nilse Schneider ist seit 2009 Deutschlehrerin und Koordenatorin der<br />
Deutschabteilung (seit 2010) an der Universidade Federal de Pelotas. Ihr<br />
Forschungsgebiet ist Angewandte Linguistik im fremdsprachlichen und<br />
muttersprachlichen Bereich (Deutsch und Portugiesisch). 2007 hat sie das<br />
Dokterstudium in Angewandte Linguistik - Portugiesisch an der Universidade<br />
Federal do Rio Grande do Sul beendet. 1994 hat sie das Magisterstudium in<br />
Germanistik und Romanistik an der Albert-Ludwigs-Universität-Freiburg -<br />
Deutschland abgeschlossen. 1988 hat sie den Bachelor in Übersetzung Deutsch/<br />
Englisch/Portugiesisch und die Lizenziatur in Deutsch / Portugiesisch (1990) an der<br />
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul abgeschlossen.<br />
E-Mail: nilse_schneider@yahoo.com.br<br />
Schramm, Karen Prof. Dr.<br />
Karen Schramm, Professorin für Deutsch als Fremdsprache mit Schwerpunkt Didaktik/<br />
Methodik am Herder-Institut der Universität Leipzig. Forschungsschwerpunkte:<br />
Unterrichtsdiskursanalyse, videobasierte Unterrichtsforschung; fremdsprachliche<br />
Lese- und Schreibkompetenzen, zweitsprachliche Alphabetisierung;<br />
handlungsorientiertes Sprachenlernen.<br />
E-Mail: karen.schramm@uni-leipzig.de<br />
Schröder, Ulrike Agathe Dr.<br />
Dr. Ulrike Agathe Schröder hat seit 2006 an der Universität von Minas Gerais<br />
(UFMG), Brasilien, einen Lehrstuhl als Professorin für Germanistik inne und<br />
arbeitet im Rahmen der Postgraduierung innerhalb der Linguistik. Sie studierte<br />
Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Psychologie an der Universität<br />
Essen, Deutschland, wo sie 2003 ihren Doktortitel erhielt. Von 2003-2006 war sie an<br />
der UFMG als DAAD-Lektorin tätig. Ihr Forschungsschwerpunkt umfasst die Bereiche<br />
der konzeptuellen Metapherntheorie, kognitiven und anthropologischen Linguistik,<br />
interkulturellen Pragmatik, DaF und Kommunikationstheorie. Bisher veröffentlichte<br />
249
250<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
sie zwei Bücher, 30 wissenschaftliche Artikel und sieben Buchkapitel in deutscher,<br />
englischer und portugiesischer Sprache. Zurzeit arbeitet Frau Schröder an zwei<br />
Forschungsprojekten: 1) der Skizzierung kommunikativer und extrakommunikativer<br />
Perspektiven im Rahmen kognitiver Metapherntheorien vom 17. Jahrhundert bis<br />
zur Gegenwart (Habilitationsprojekt an der Universität Duisburg-Essen) und 2) der<br />
Untersuchung von Höflichkeitsstrategien, Multimodalität und Metareflexivität in<br />
Kommunikationsprozessen zwischen Deutschen und Brasilianern.<br />
E-Mail: schroederulrike@gmx.com<br />
Schuck, Silke<br />
Magister-Studium der Germanistik, Kunstgeschichte, Romanistik (Französische<br />
Literatur) und Komparatistik an den Universitäten Frankfurt, Lausanne (Erasmus)<br />
und Hamburg; 2003–2004 Wiss. Assistentin am Bucerius Kunst Forum Hamburg;<br />
2004–2007 Promotionsstipendium im DFG-Graduiertenkolleg „Zeiterfahrung und<br />
ästhetische Wahrnehmung“, Goethe-Universität; seit 04/2009 Wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Edgar Pankow, Institut für Allgemeine<br />
und Vergleichende Literaturwissenschaft, Goethe-Universität (Vertretung PD<br />
Dr. Anja Lemke). Derzeit Abschluss der interdisziplinären Dissertation: Flirrende<br />
Konvergenz. Dimensionen des Bildes in der Poetik und Ästhetik Heinrich von Kleists<br />
(Arbeitstitel), betreut von Prof. Dr. Edgar Pankow und Prof. Dr. Horst Bredekamp.<br />
Veröffentlichungen u.a.: „Alles Vortreffliche führt etwas Befremdendes mit sich...“<br />
Heinrich von Kleists Wendung der Fremdheit. In: Etrangeté des formes, formes<br />
de l’étrangeté, hg. von Jean-Pierre Chassagne, Siant-Etienne 2011 [i. V.]; „Wann<br />
ist ein Kunstwerk?“ Das Mögliche des Unmöglichen, mit Adorno und Bacon. In:<br />
Kunstkommunikation: „Wie ist Kunst möglich?“ Beiträge zu einer systemischen<br />
Medien- und Kunstwissenschaft, hg. von Christian Filk u.a., Berlin 2009, S. 187–210.<br />
E-Mail: Schuck@em.uni-frankfurt.de<br />
Schulte, Klaus<br />
Klaus Schulte, geb. 1946, studierte 1966 – 1971 Germanistik, Philosophie, Allgemeine<br />
und Vergleichende Literaturwissenschaften an der Freien Universität (West)Berlin,<br />
anschließend dort Teilzeitassistent und Projektforscher. 1975 associate professor für<br />
Deutsch und Interkulturelle Studien/Cultural Encounters (seit 2000), Universität Roskilde,<br />
Dänemark. Lehr- und Forschungsgebiete: Literaturwissenschaft; deutsche Literatur- und<br />
Kulturgeschichte im internationalen Kontext, speziell Geschichte der deutschsprachigen<br />
Exilliteratur; deutsche Landeskunde und Geschichte der deutsch-dänischen<br />
Kulturbeziehungen; Kulturtheorie und Kulturgeschichte Europas; Globalisierung,<br />
Ethnizität und Nation; (Neo)Rassismus und Antisemitismus; Theorie, Kritik und Praxis<br />
literarischer Übersetzung. (zu Letzterem vgl. u.a.: Schulte, Klaus, Hrsg.: (2004): Anna Seghers:<br />
Et Rejsemøde og andre fortællinger. Roskilde: Batzer & Co. (dänischspr. Nachwort, S.149-<br />
175); Roussel, Hélène. & Klaus Schulte (2007): Exil, Textverfahren und Übersetzungsstrategie.
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
‚Der Ausflug der toten Mädchen’ von Anna Seghers im Prisma verschiedener Übertragungen,<br />
vornehmlich ins Französische. In: Krohn, Claus-Dieter et. al. (Hrsg.), Mitarbeit Michaela<br />
Enderle-Ristori: Übersetzung als transkultureller Prozess. Exilforschung. Ein internationales<br />
Jahrbuch (25), (S. 90 – 111) München: edition text + kritik)<br />
E-Mail: klaus@ruc.dk<br />
Schulze, Frank<br />
1999 M.A. in Germanistik, Jornalistik, Soziologie an Universität Leipzig. 2001<br />
Abschluss Aufbaustudium Deutsch als Fremdsprache, Herder-Institut, Universität<br />
Leipzig. 2001-2007 DAAD-Lektor an Universidad del País Vasco (Spanien).<br />
2009-heute DAAD-Lektor in Buenos Aires am I.E.S. en Lenguas Vivas “J.R.Fernández”.<br />
E-Mail: frank.schulze.web@gmail.com<br />
Schwarz, Egon<br />
Egon Schwarz, geboren 1922 in Wien, flüchtete über Prag und Paris nach Südamerika.<br />
Von 1939-1949 schuftete er als Wanderarbeiter in Bolivien, Chile und Ecuador.<br />
Anschließend studierte er Jura in Cuenca, machte seinen Magister in Ohio, und<br />
seinen Doktor im Staat Washington. Er hatte Professuren an der Harvard University<br />
und der Washington University inne, sowie Gastprofessuren an verschiedenen<br />
Universitäten in Amerika, Europa und Neuseeland.<br />
E-Mail: eschwarz@artsci.wustl.edu<br />
Setton, Román Dr.<br />
Professor und Forscher in der Universidad Buenos Aires und Universidad del Cine.<br />
Er war DAAD-Stipendiat und promovierte in der Universität zu Köln. Er war auch als<br />
Übersetzer tätig und hat unter anderem Werke von Brecht, Heine, Lukács, Nietzsche<br />
und Börne ins Spanische übersetzt. Er hat verschiedene Forschungsprojekte zum<br />
deutschen Dokumentarfilm und über Theorien des Kriminalromans. Er verzeichnet<br />
Buchpublikationen und zahlreiche Aufsätze zur deutschen und argentinischen<br />
Literatur des 19.-20. Jahrhunderts. Forschungsschwerpunkte: Vergleichende<br />
Literatur, Kriminalroman, Gattungstheorien, Dokumentarfilm.<br />
E-Mail: rsetton@hotmail.com<br />
Seydel, Ute Dr.<br />
Doctora en Filologías Romances por la Universidad de Potsdam, Alemania.<br />
Profesora de Tiempo Completo Asociada C en la Facultad de Filosofía y Letras,<br />
Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte cátedra en el<br />
Posgrado en Letras y el Colegio de Letras Modernas. Es miembro del Sistema<br />
Nacional de Investigadores.<br />
En 2007, publicó el libro Narrar historia(s): La ficcionalización de temas históricos<br />
por las escritoras mexicanas Elena Garro, Rosa Beltrán y Carmen Boullosa. Frankfurt<br />
am Main/Madrid: Iberoamericana-Vervuert. Es coautora de diversos libros<br />
sobre literatura mexicana y latinoamericana del siglo XX, entre otros, Escrituras<br />
251
252<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
en contraste. Femenino/masculino en la literatura mexicana del siglo XX (2004),<br />
Femenino/masculino en las literaturas de América (2005), Género, cultura y sociedad<br />
(2006), Diccionario de Estudios culturales (2009), Passagen: Hybridity, Transmedialité,<br />
Transculturalidad (2010) y Cristina Rivera Garza: Ningún crítico cuenta esto (2010).<br />
Asimismo tiene diversas publicaciones en revistas académicas. Sus líneas de<br />
investigación son: estudios de género y estudios poscoloniales, literatura de<br />
mujeres latinoamericanas, ficción histórica y cultura de la memoria.<br />
E-Mail: useydel@gmail.com<br />
Soethe, Paulo Astor Prof. Dr.<br />
Dozent für dt. Sprache und Literatur, Universidade Federal do Paraná, Rua General<br />
Carneiro, 460, 80060-050 Curitiba-PR, Brasilien. Jahrgang 1968; Studium der Germanistik<br />
u. Romanistik (Portugiesisch) an der Bundesuniversität Paraná, 1999 Promotion<br />
an der Universität São Paulo über die ethische Aussagekraft der Raumdarstellung<br />
in Thomas Manns Der Zauberberg und João Guimarães Rosas Grande Sertão), Forschungsaufenthalt<br />
in Tübingen 1998/99 (Daad/Capes-Stipendium); Forschungsstipendiat<br />
der Alexander von Humboldt-Stiftung an der Universität Tübingen 2005/06.<br />
Kurzzeitdozentur an der Universität Passau, Bundesuniversität Santa Catarina (Brasilien),<br />
Landesuniversität Londrina (Brasilien), Universität Zagreb und Universität Leipzig.<br />
E-Mail: paulosoethe@me.com<br />
Soto Sánchez, Irais<br />
Seit 2007 ist sie Deutschlehrerin am Sprachzentrum-Orizaba der Universidad<br />
de Veracruz. Sie studierte von 1994-1995 Pädagogik und Romanistik an der<br />
Würzburger Julius-Maximilians-Universität. Von 1995-1997 machte sie eine Lehre<br />
als Fremdsprachenkorrespondentin Spanisch-Italienisch an der Würzburger<br />
Dolmetscherschule. Sie unterrichtete bei der ASCO, Coburg und bei Sachs. In<br />
Würzburg war sie eine der Gründerinnen der Spanischsprechende Gesellschaft<br />
„Despertar ̏, deren Ziel es ist, die Kultur der veschiedenen lateinoamerikanischen<br />
Ländern zu bewahren und sich gleichzeitig auch in der deutschen Kultur zu<br />
integrieren. Von 2002-2007 absolvierte sie das Studium für Grafikdesign an<br />
der BUAP, wo sie die Auszeichnung Ad-Honorem erhielt. Von 2007-2009 war<br />
sie Deutschlehrerin im Kulturhaus von Orizaba. Sie hat an verschiedenen<br />
Lehrerweiterbildungen an der UV und dem GI teilgenommen. Seit 2009 ist sie ÖSD-<br />
Prüferin und seit 2010 Ampal Beisitzerin.<br />
E-Mail: irais-ss@hotmail.com<br />
Sperr, Ulrike<br />
1999 Beendung der Studiengänge Diplom-Übersetzer und Diplom-Dolmetscher<br />
an der Universität Leipzig mit Anglistik als Hauptfach, Hispanistik und Journalistik<br />
als Nebenfächer, sowie eines Spezial-Zertifikats als Simultan-Dolmetscherin<br />
für Englisch und Spanisch. 1999-2000 Hospitations- und Unterrichtspraktikum
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
für Deutsch als Fremdsprache am Departamento de Lenguas Modernas der<br />
Universidad de Guadalajara, gefördert vom DAAD, Lehrkraft am Goethe-Institut<br />
in Guadalajara, Arbeit als Übersetzerin und Dolmetscherin für Deutsch und<br />
Spanisch. 2000 Beendung des Aufbaustudiums Deutsch als Fremdsprache am<br />
Herder-Institut der Universität Leipzig. Teilnahme als Referentin und Assistentin<br />
an Kolloquien und Kongressen über Übersetzen, Linguistik, Fremdsprachenlehren<br />
und autonomes Lernen. Seit 2000 Vollzeitdozentin, 2001-2008 Koordinatorin<br />
der Deutschabteilung der Universidad de las Américas- Puebla, 2008-2010<br />
Koordinatorin des Sprachlernzentrums der Universidad de las Américas- Puebla,<br />
seit 2010 Koordinatorin für Drittsprachen, Universidad de las Américas Puebla.<br />
Seit Mai 2009 Beisitzerin im Vorstand des Mexikanischen Deutschlehrerverbands<br />
AMPAL. Organisation einiger Linguisten- und DaF-Kongresse.<br />
E-Mail: ulrike.sperr@udlap.mx<br />
Stephan, Inge<br />
Lehrstuhlinhaberin „Geschlechterproblematik im literarischen Prozess“ am<br />
Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin bis Oktober<br />
2009. Zahlreiche Gastprofessuren, u.a. in Tateshina (Japan), Nairobi (Kenia) und<br />
Seattle (USA). Zahlreiche Veröffentlichungen zur deutschen Literatur vom 18. bis<br />
20. Jahrhundert, zu Frauenforschung, feministischer Literaturwissenschaft und<br />
Geschlechterstudien. Zuletzt erschienen: Gender Studien. Eine Einführung (2000, 2.<br />
Aufl. 2006, zus. mit C. v. Braun); Männlichkeit als Maskerade. Kulturelle Inszenierungen<br />
vom Mittelalter bis zur Gegenwart (2003, zus. mit C. Benthien); Inszenierte Weiblichkeit.<br />
Codierung der Geschlechter in der Literatur des 18. Jahrhunderts (2004); Meisterwerke.<br />
Deutschsprachige Autorinnen im 20. Jahrhundert (2005, zus. mit C. Benthien),<br />
Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien (2005, 2. Aufl. 2009, zus. mit C.<br />
v. Braun), Medea. Multimediale Karriere einer mythologischen Figur (2006), NachBilder<br />
des Holocaust (2007, zus. mit A. Tacke), NachBilder der RAF (2008, zus. mit A. Tacke), ),<br />
NachBilder der Wende (2008, zus. mit A. Tacke), Carmen. Ein Mythos in Literatur, Film<br />
und Kunst (2010, zus. mit K. Möller und A. Tacke).<br />
E-Mail: ingestephan44@yahoo.de<br />
Stoll, Jens-Karsten<br />
Jens-Karsten Stoll wurde in Berlin geboren. Von 1982 bis 1987 absolvierte er ein<br />
Studium der Korrepetition und Komposition an der Hochschule für Musik „Hanns<br />
Eisler“ in Berlin, an der er seit 1989 einen Lehrauftrag ausübt. Als musikalischer Leiter<br />
ist er für zahlreiche Produktionen an vielen deutschen Bühnen tätig. Darüber hinaus<br />
begleitet er regelmäßig Sänger und Schauspieler am Piano. In den letzten Jahren<br />
arbeitete er kontinuierlich mit Rainald Grebe, Ulf Otto und Nino Sandow zusammen.<br />
„Seine Braut war das Meer und sie umschlang ihn“, ein Soloprogramm mit Nina Petri,<br />
hatte im September 2011 an den Hamburger Kammerspielen Premiere.<br />
253
254<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Theele, Ivo<br />
Geboren 1980 in Bremen, Deutschland. Magisterstudium der Neueren<br />
deutschen Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft und Sportwissenschaft.<br />
Auslandsaufenthalt 2005 in Buenos Aires, Argentinien. Seit 2007 Mitarbeiter am<br />
Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaften der Universität<br />
Paderborn, Deutschland. Dissertationsprojekt zum Thema „Poetische Inszenierung<br />
von Weiblichkeit im Frühwerk Rainer Maria Rilkes“ (voraussichtlicher Abschluss<br />
2012). Lehraufträge an der Universität Paderborn (seit 2009) und der Hochschule<br />
für Musik Detmold (2010-11). Verschiedene Aufsatz-Publikationen sowie Vorträge,<br />
zuletzt auf der Jahrestagung der Internationalen Rilke-Gesellschaft in Harvard/<br />
Boston, USA. Seit 2011 mit dem Künstlerkollektiv „Kommando Elektrolyrik“ als<br />
Kulturbotschafter für das Goethe Institut und das Auswärtige Amt unterwegs, u.a.<br />
Auftritte und Workshops in Norwegen, Dänemark und Polen.<br />
E-Mail: Ivotheele@gmx.de<br />
Thiemann, Susanne<br />
Dr. Susanne Thiemann absolvierte zunächst eine Buchhändlerlehre und studierte<br />
dann Romanistik und Germanistik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in<br />
Frankfurt am Main. Von 1996-2008 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für<br />
Romanistik in Potsdam, Promotion über die spanische Humanistin Luisa Sigea (16.<br />
Jahrhundert). Seit 2008 ist sie DAAD-Lektorin an der Facultad de Filosofía y Letras<br />
der Universidad Nacional de Tucumán, Argentinien, wo sie Deutsche Sprache und<br />
Literatur unterrichtet und postgraduierte Seminare im Bereich vergleichender<br />
Literatur- und Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt gender studies hält.<br />
E-Mail:thiemann@daad.org.ar<br />
Tiburcio Barwis, Jacqueline Evelia<br />
Hochschulausbildung in Tourismusmanagement, Deutschlehrerin im Sprachzentrum<br />
Veracruz der Universidad Veracruzana. Seit 2009 ÖSD-Prüferin. An der Universität des<br />
Saarlandes absolvierte sie eine Weiterbildung in Philologie und Phonetik. 2008 war sie<br />
an dieser Uni auch Tutorin für spanische Konversation. Sie gab Spanischunterricht an<br />
der VHS Ormesheim, Mandelbachtal. Derzeit absolviert sie einen Master für Didaktik in<br />
Sozialwissenschaften an der Universidad Veracruzana. Sie ist Stipendiatin von CONACYT<br />
und PROMEP. Die Forschung, ein neues Gebiet für Jacqueline, hat ihr Interesse an<br />
diesem Projekt über die deutsche Sprache an der Universidad Veracruzana erweckt.<br />
E-Mail: irais-ss@hotmail.com<br />
Tschirner, Erwin Prof. Dr.<br />
Erwin Tschirner (Ph.D. University of California, Berkeley) ist Gerhard-Helbig-Professor<br />
für Deutsch als Fremdsprache am Herder-Institut der Universität Leipzig, Associated<br />
Professor of German Studies an der University of Arizona (Tucson, USA) sowie profesor<br />
honorífico adscrito a la Universidad de Guadalajara (Mexiko). Schwerpunkte seiner
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit sind Morphologie und Syntax des Deutschen,<br />
der Erwerb mündlicher Kompetenzen, Wortschatzerwerb, Korpuslinguistik sowie<br />
Testforschung und -entwicklung. Er hat als Professor und Gastprofessor an Universitäten<br />
in den USA, in Kuba, Argentinien und Deutschland gelehrt und zahlreiche Vorträge und<br />
Workshops auf internationalen Tagungen und an Universitäten in vielen Ländern der<br />
Welt gehalten. Er ist Ko-Autor von Kontakte: A Communicative Approach (McGraw-<br />
Hill 2012 7 ) und von A Frequency Dictionary of German: Core Vocabulary for Learners<br />
(Routledge 2006) sowie Herausgeber der Reihe Lex:tra Grund- und Aufbauwortschatz<br />
für Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Chinesisch<br />
(Cornelsen). Er hat zahlreiche Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden zum<br />
Fremdsprachenerwerb, zum Lernen und Lehren von Fremdsprachen sowie zur<br />
Beurteilung fremdsprachlicher Kompetenzen veröffentlicht.<br />
E-Mail: tschirner@uni-leipzig.de<br />
Varela Alvarez, Jacinto Arturo<br />
Er hat Deustche Literatur an der Philosophieschen Fakultät der UNAM, Mexiko und<br />
an der Universität Erfurt, Deutschland studiert. Er hat eine Lehrerausbild am Goethe-<br />
Institut Mexiko absolviert. Im September 2009 hat er am Weiterbildungskurs<br />
“Angewante Sprachwissenschaft für Fremsprachenlehrer“ am CELE der UNAm<br />
teilgenohmen. Er sit ÖSD-Prüfer und im Moment ist er Deutschlehrer an der<br />
Philosophieschen Fakukultät und am Fremsprachenzentrum der UNAM tätig.<br />
E-Mail: javacinto@hotmail.com<br />
Vedda, Miguel Prof. Dr.<br />
Miguel Vedda ist Lehrstuhlinhaber für Deutsche Literatur in der Universität Buenos<br />
Aires und Forscher des Conicet. Er ist Direktor der „Maestría en Literaturas en Lenguas<br />
Extranjeras y en Literaturas Comparadas“ (UBA) und des Forschungsprojekts<br />
„Gemeinschaft und Gerechtigkeit in der deutschen Kriminalliteratur (1825-1875)“<br />
(UBA/Conicet). Er war DAAD-Stipendiat. Er ist sowohl Mit- als auch alleiniger<br />
Herausgeber bzw. Autor zahlreicher Sammelbände.<br />
E-Mail: miguelvedda@yahoo.com.ar<br />
Villoro, Juan<br />
Juan Villoro wurde 1956 in Mexiko Stadt geboren. Er war Kulturattaché der<br />
Mexikanischen Botschaft in der ehemaligen DDR und Mitarbeiter bei Zeitschriften<br />
und verschiedenen Zeitungen. Er wurde in seinen facettenreichen Funktionen<br />
als Schrifsteller, Essayist, Kinderbuchautor sowie Übersetzer wichtiger Werke der<br />
deutschen und englischen Sprache ausgezeichnet. Er ist Professor für Literatur an<br />
der Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sowie Gastprofessor an den<br />
Universitäten Princenton, Yale, Boston und Pompeu Fabra de Barcelona. Er arbeitet<br />
regelmäßig mit den Zeitungen La Jornada, Reforma, El País und El Periódico sowie mit<br />
Zeitschriften wie Letras Libres, Proceso, Nexos und la italiana Internazionale zusammen.<br />
255
256<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Wamba Gaviña, Graciela Prof. Dr.<br />
Hat an der Nationalen Universität La Plata (UNLP) studiert, und ihre Doktortitel an<br />
der gleichen Universität erhalten. 1982, Alumni DAAD, Forschungsaufenthalte in<br />
Deutschland, an vielen internationalen und nationalen Tagungen und Kongressen<br />
teilgenommen. Ordinaria Lehrstuhl fur Deutsche Literatur und Dt. Sprache an<br />
der Nationalen Universität La Plata, Professorin fur Postgraduierte Studien in<br />
Komparatistik an der UNLP. Mitglied von AAG (Argentinischer Germanistenverband)<br />
seit 1989 und zweimal Präsidentin, von <strong>ALEG</strong> (seit 1979), Mitglied des IVG,<br />
Internationalen Vereinigung für Germanische Sprach- und Literaturwissenschaft<br />
seit 1985, von AALC, (Argentinischer Komparatistikverband) und von AILC .Hat<br />
zahlreiche Schriften an nationalen und internationalen Zeitschriften von ihrem Fach<br />
veröffentlicht und leitet Forschungsprojekte, betreut Promotionen. Schwerpunkte:<br />
neueste dt. Literaturwiss. (besonders Roman), Migrantenliteratur, Intermedialitaet,<br />
Literaturwissenschaften und Philosophie.<br />
E-Mail: gracielawamba@gmail.com, gracielawamba@hotmail.com<br />
Wegmann, Sarah Anke<br />
Sarah Anke Wegmann, geboren 1980. Studium der Spanischen Philologie,<br />
Hispanoamerikanistik und Neueren Deutschen Literaturwissenschaft an der<br />
Universität des Saarlandes und der Universidad de Sevilla. 2011 Magistra Artium<br />
(M. A.). Von 2006 bis 2010 studentische Mitarbeiterin, seit 2011 Projektmitarbeiterin<br />
im Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass / Arbeitsstelle für Gustav-Regler-Forschung,<br />
freie Lektorin im Conte-Verlag, Saarbrücken und Lehraufträge an der Universität des<br />
Saarlandes.<br />
E-Mail: literaturarchiv@sulb.uni-saarland.de<br />
Wester de Michelini, Jutta H.<br />
Jutta H. Wester de Michelini, geb 1954 in Ransbach, Westerwald. Studium der<br />
Germanistik, Philosophie und Erziehungswissenschaften in Frankfurt a.M. und Münster<br />
Westf.. Master in Angewandter Ethik (2000, Río Cuarto, Argentinien). Seit 1981 Tätigkeit<br />
an der Nationalen Universität von Río Cuarto, Argentinien, zur Zeit als „Profesora<br />
Asociada“. Lehrtätigkeit vor allem im Bereich deutscher Lesekurse für Studenten der<br />
Humanwissenschaftlichen Fakultät. Forschungsarbeiten über Verständnisstrategien<br />
von Fachtexten, besonders in digitalen Lernumgebungen; sowie über ethische<br />
Probleme der Erziehung, die Entwicklung des Moralbewusstseins und Interkulturalität.<br />
E-Mail: juttawester@arnet.com.ar<br />
Wichard, Norbert Dr.<br />
Studium der Deutschen Philologie, Philosophie, Psychologie an der Universität<br />
zu Köln, Stipendiat des Cusanuswerks, Magister Artium 2005, Abschluss der<br />
Promotionsprüfungen 2010 (Universität zu Köln); seit 2005 wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am Institut für deutsche Sprache und Literatur I der Universität zu
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Köln; Fachkooperationen mit den Germanisten der Karls-Universität Prag und<br />
der Universität Zagreb. Forschungsinteressen: Wohnen und Literatur, deutschkroatische<br />
Literaturbeziehungen, Erinnern und Erzählen in der Gegenwartsliteratur,<br />
Komödie im 18. Jahrhundert. Publikationen: N. W.: Erzähltes Wohnen. Literarische<br />
Fortschreibungen eines Diskurskomplexes im Bürgerlichen Zeitalter. Bielefeld:<br />
transcript (erscheint voraussichtlich Ende 2011); – Daniel Fulda, Antje Roeben und<br />
N. W. (Hrsg.): „Kann man denn auch nicht lachend sehr ernsthaft sein?“ Sprachen<br />
und Spiele des Lachens in der Literatur. Berlin, New York: de Gruyter 2010. – Aufsätze<br />
zu Fontane, Bettina von Arnim, Christoph Meckel und Hans-Ulrich Treichel.<br />
E-Mail: N.Wichard@uni-koeln.de<br />
Wilke, Valeria<br />
Valeria Wilke ist Dozentin für Didaktik und Methodik und Sprachpraxis an der<br />
Sprachenfakultät der Universität Córdoba, Argentinien. Sie ist auch zuständig für<br />
die Betreuung des Unterrichtspraktikums angehender Deutschlehrender. Sie hat<br />
in Córdoba an der Sprachenfakultät die Abschlüsse Deutschlehrerin (1993) und<br />
Deutschübersetzerin (1994) erworben und in Kassel (2003) den Masterstudiengang<br />
Deutsch als Fremdsprache abgeschlossen. Zur Zeit ist sie am Forschungsvorhaben<br />
Interkomprehension in germanischen Sprachen (Englisch, Deutsch und<br />
Niederländisch) tätig, das seit 2008 an der Sprachenfakultät durchgeführt wird.<br />
Sie war mehrmals in Deutschland als Stipendiatin verschiedener Institutionen wie<br />
DAAD und Goethe-Institut. Seit 2009 ist sie auch DAAD-Ortslektorin. Seit 2008<br />
vertritt sie die Professoren im Sprachenfakultätsrat.<br />
E-Mail: valewilke@yahoo.com.ar<br />
Witte, Claus<br />
Claus Witte, Jahrgang 1973. Nach dem Zivildienst im Centro Social de Cardonal<br />
in Cardonal/Hidalgo in Mexiko hat er ab 1994 verschiedene Studiengänge an der<br />
Ruhr-Universität Bochum angefangen. Beendet hat er schließlich 2003 romanische<br />
Philologie mit Schwerpunkt Spanisch und den Nebenfächern Komparatistik und<br />
Sprachlehrforschung. Anschließend noch Abschluss im Zusatzstudiengang Deutsch<br />
als Fremdsprache, auch an der Ruhr-Universität Bochum. Während der Studienzeit<br />
Redakteur der Zeitung des Bochumer AstA „bsz“ und Mitglied des Arbeitskreises rote<br />
ruhr uni. Von 2004-2005 DAAD Sprachassistent an der Universidad de Guadalajara<br />
(UdG). Danach Arbeit als Deutschlehrer an der UdG, ITESO, als Privatlehrer und<br />
am Goethe-Institut Guadalajara. 2008 Mitinitiator der Sprachschule IDEAL in<br />
Guadalajara und seit dieser Zeit Verwaltungsleiter der Schule.<br />
E-Mail: claus.witte@yahoo.com.mx<br />
Wucherpfennig, Norma<br />
1999-2004 Magisterstudium mit den Hauptfächern Deutsch als Fremdsprache<br />
und Erwachsenen pädagogik an der Universität Leipzig. 2001-2006 verschiedene<br />
257
258<br />
Biographische Angaben der Teilnehmer v Información biográfica de los participantes<br />
Brasilienaufenthalte mit Tätigkeiten im DaF-Bereich. Seit 2007 festangestellte<br />
Dozentin für Deutsch als Fremdsprache am Sprachlehrzentrum der Unicamp/Brasilien;<br />
Unterricht für Hörer aller Fakultäten. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: DaF-<br />
Methodik/Didaktik, derzeit v.a. Materialentwicklung; akademische Fachsprache;<br />
Einsatz von Lernplattformen; Leistungsmessung im Bereich Wortschatz.<br />
E-Mail: nowupf@unicamp.br<br />
Zaharia, Mihaela Dr.<br />
Mihaela Zaharia unterrichtet an der Universität Bukarest hauptsächlich<br />
deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts und Landeskunde.<br />
E-Mail: mzahariaro@gmail.com<br />
Zehl Romero, Christiane Dr.<br />
Christiane Zehl Romero stammt aus Wien, Österreich, wo sie Anglistik, Germanistik<br />
und Romanistik studierte und promovierte. Weitere Studien an der Sorbonne<br />
in Paris, Frankreich, und an der Yale Universität, New Haven, USA (Vergleichende<br />
Literaturwissenschaft) folgten. Sie schrieb u. a. Monographien über Simone de<br />
Beauvoir und Anna Seghers, eine zweibändige Biographie zu Leben und Werk<br />
von Anna Seghers (2000 und 2003) und zahlreiche Artikel zu deutscher Literatur,<br />
vergleichender Literatur und zu deutschem Film von Goethe bis zur Gegenwart.<br />
Gemeinsam mit Almut Giesecke gab sie im Rahmen der Werkausgabe die Briefe von<br />
Anna Seghers heraus: Briefe 1924-1952 (2008) und Briefe 1953-1983 2010) heraus. Sie<br />
ist Tübingen Professor of German und Goldthwaite Professor of Rhetoric an der Tufts<br />
University in Medford, Massachusetts, USA, und Director of the German Program<br />
im Department of German, Russian, and Asian Languages and Literatures. Sie war<br />
auch Leiter dieser Sektion und des interdisziplinären <strong>Programm</strong>s in Internationalen<br />
Beziehungen.<br />
E-Mail: Christiane.Romero@tufts.edu
Menschen_Anzeige 4c_A5_Layout 1 17.01.12 11:27 Seite 3<br />
Für Lernende in der<br />
Grundstufe ab 16 Jahren<br />
Für die Niveaustufen<br />
A1 bis B1<br />
Wahlweise erhältlich als<br />
Ausgabe in drei oder sechs<br />
Bänden<br />
Kursbuch mit eingelegter<br />
Lerner-DVD-ROM<br />
Separates Arbeitsbuch mit<br />
eingelegter Audio-CD<br />
Breites Angebot an Zusatzmaterialien<br />
für Kursleiter/<br />
innen und Lernende wie<br />
z.B. Lehrer-DVD mit Filmen<br />
zum Hör-Sehverstehen<br />
MENSCHEN<br />
bewegen.<br />
Das neue Grundstufenlehrwerk<br />
für Deutsch als Fremdsprache ist da!<br />
Probelektionen und<br />
Filmsequenzen unter<br />
www.hueber.de/menschen<br />
Hueber
ür Fogra39] Cyan Magenta Yellow BlacK<br />
akt A1 – B1<br />
io-CDs<br />
nden zu B1<br />
nde, die Deutsch für das Studium<br />
B. an Universitäten oder Goethe-Instituten<br />
ne Lektionsgeschichten<br />
tionen und -kommunikation vor<br />
eutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein)<br />
n<br />
n des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens um<br />
ffektives Lehren und Lernen<br />
ikprogramm<br />
tsch vor<br />
ltests zu Start Deutsch 1 und 2 sowie zum Zertifikat Deutsch<br />
bungsbuch erhältlich!<br />
ISBN 978-3-12-676180-2<br />
Z34143_DaF_kompakt_aussichten_<strong>ALEG</strong>.indd 09.02.2012 14:47:32 Seite: 1 [Farbbalken für Fogra39] Cyan Magenta Yellow BlacK<br />
Z34143<br />
DaF kompakt A1 – B1 Kursbuch mit 3 Audio-CDs<br />
Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene<br />
Beste Aussichten für Sie!<br />
DaF kompakt A1 – B1<br />
DO01676221_AS_B1_AB_U1U4U2U3.indd 24.01.2012 16:57:58 Seite: 1-3 [Farbbalken für Fogra39] Cyan Magenta Yellow BlacK<br />
DO01676231_Einfachschreiben_Cover.indd 18.02.2011 08:10:45 08:10:45 Seite: Seite: 1 1 [Farbbalken für für Fogra39] Fogra39] Cyan Magenta Yellow BlacK<br />
DO01676230_Einfachsprechen_Cover.indd DO01676230_Einfachsprechen_Cover.indd 22.06.2011 22.06.2011 10:27:10 10:27:10 10:27:10 Seite: Seite: Seite: 1 1 1 [Farbbalken [Farbbalken für für für Fogra39] Fogra39] Fogra39] BlacK Cyan Magenta Yellow<br />
Rückenstärke: 11 mm<br />
Beste Aussichten für Sie!<br />
Lehrwerk für die Niveaustufen A1 bis B1 des Gemeinsamen europäischen<br />
Referenzrahmens unter Berücksichtigung des Rahmencurriculums<br />
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge<br />
Aussichten<br />
Kursbuch mit 3 • vermittelt Deutsch echt und Audio-CDs<br />
lebendig<br />
• macht fit für die Lebensbereiche privat, beruflich, öffentlich<br />
• fördert Lernende individuell<br />
• trainiert Strategien<br />
• macht Spaß durch humorvolle Hörspiele und integrierte DVD<br />
• bereitet auf die Prüfungen Start Deutsch 1 und 2,<br />
Deutsch-Test für Zuwanderer und Zertifikat Deutsch vor<br />
Erscheint in 3 bzw. 6 Bänden.<br />
DO01676220_AS_B1_KB_U1U4U2U3.indd DO01676220_AS_B1_KB_U1U4U2U3.indd DO01676220_AS_B1_KB_U1U4U2U3.indd 24.01.2012 24.01.2012 24.01.2012 16:47:01 16:47:01 16:47:01 Seite: Seite: Seite: Seite: 1-3 1-3 1-3 1-3 [Farbbalken [Farbbalken [Farbbalken [Farbbalken für für für für Fogra39] Fogra39] Fogra39] Fogra39] Magenta BlacK Cyan Yellow<br />
Rückenstärke: 11 mm<br />
Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene<br />
Beste Aussichten für Sie!<br />
Lehrwerk für die Niveaustufen A1 bis B1 des Gemeinsamen europäischen<br />
Referenzrahmens unter Berücksichtigung des Rahmencurriculums<br />
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge<br />
Aussichten<br />
• vermittelt Deutsch echt und lebendig<br />
• macht fit für die Lebensbereiche privat, beruflich, öffentlich<br />
• fördert Lernende individuell<br />
• trainiert Strategien<br />
• macht Spaß durch humorvolle Hörspiele und integrierte DVD<br />
• bereitet auf die Prüfungen Start Deutsch 1 und 2,<br />
Deutsch-Test für Zuwanderer und Zertifikat Deutsch vor<br />
Erscheint in 3 bzw. 6 Bänden.<br />
Aussichten B 1<br />
Aussichten B1<br />
Arbeitsbuch B 1<br />
mit 2 Audio-CDs<br />
und DVD<br />
978-3-12-676221-2<br />
Kursbuch mit 2 Audio-CDs<br />
www.klett.de/aussichten<br />
Kursbuch B 1<br />
mit 2 Audio-CDs<br />
978-3-12-676220-5<br />
www.klett.de/aussichten<br />
Kursbuch mit 2 Audio-CDs Aussichten B 1<br />
Neues bei Klett!<br />
DO01676220_AS_B1_KB_U1U4U2U3.indd DO01676220_AS_B1_KB_U1U4U2U3.indd 25.01.2012 25.01.2012 10:34:11 Seite: Seite: 1-3 [Farbbalken für für für Fogra39] Fogra39] Cyan Magenta Yellow BlacK<br />
Lehrwerk für die Niveaustufen A1 bis B1 des Gemeinsamen europäischen<br />
Referenzrahmens unter Berücksichtigung des Rahmencurriculums<br />
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge<br />
Aussichten<br />
• vermittelt Deutsch echt und lebendig<br />
• macht fit für die Lebensbereiche privat, beruflich, öffentlich<br />
• fördert Lernende individuell<br />
• trainiert Strategien<br />
• macht Spaß durch humorvolle Hörspiele und integrierte DVD<br />
• bereitet auf die Prüfungen Start Deutsch 1 und 2,<br />
Deutsch-Test für Zuwanderer und Zertifikat Deutsch vor<br />
Arbeitsbuch mit Audio-CD und DVD Aussichten B 1<br />
Erscheint in 3 bzw. 6 Bänden.<br />
Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene<br />
Einfach schreiben!<br />
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache A2 – B1<br />
Vom Wort zum Satz zum Text. Für Ihren Deutschkurs und für Selbstlerner.<br />
Das Übungsbuch<br />
Das Übungsbuch<br />
• trainiert den schriftlichen Ausdruck auf den Niveaustufen A2 – B1<br />
• trainiert die Sprechkompetenz auf den Niveaustufen A2 – B1<br />
• fördert schrittweise die Schreibkompetenz<br />
• unterstützt den mündlichen Ausdruck durch Redemittelkarten,<br />
Einfach schreiben!<br />
• ermöglicht ein intensives Training der Textsorten Brief und E-Mail<br />
Texte zum Hören und Mitsprechen auf Audio-CD sowie Transkriptionen<br />
Einfach sprechen!<br />
• bereitet auf den Teil „Schreiben“ in den Prüfungen Start Deutsch 2,<br />
• bereitet auf den Teil Sprechen in den Prüfungen Deutsch A2/<br />
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache<br />
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache<br />
Deutsch-Test für Zuwanderer und Zertifi kat Deutsch vor<br />
Start Deutsch 2, Deutsch-Test für Zuwanderer, Deutsch B1/Zertifi kat Deutsch vor<br />
A2 – B1<br />
A2 – B1<br />
• orientiert sich am Rahmencurriculum für Integrationskurse<br />
• orientiert sich am Rahmencurriculum für Integrationskurse<br />
und am Europäischen Referenzrahmen<br />
und am Europäischen Referenzrahmen<br />
• kann ergänzend zu jedem Grundstufenlehrwerk eingesetzt werden<br />
• kann ergänzend zu jedem Grundstufenlehrwerk eingesetzt werden<br />
• Lösungen als kostenloser Download unter www.klett.de/einfachschreiben<br />
Lösungen als kostenloser Download unter www.klett.de/einfachsprechen<br />
Auch erhältlich:<br />
DO01676231_Einfachschreiben_Cover.indd DO01676231_Einfachschreiben_Cover.indd DO01676231_Einfachschreiben_Cover.indd 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 08:10:45 08:10:45 08:10:45 Seite: Seite: Seite: 1 1 1 [Farbbalken [Farbbalken [Farbbalken für für für Fogra39] Fogra39] Fogra39] BlacK Magenta Yellow Cyan<br />
Einfach schreiben!<br />
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache A2 – B1<br />
Vom Wort zum Satz zum Text. Für Ihren Deutschkurs und für Selbstlerner.<br />
Das Übungsbuch<br />
• trainiert den schriftlichen Ausdruck auf den Niveaustufen A2 – B1<br />
• fördert schrittweise die Schreibkompetenz<br />
Einfach schreiben!<br />
• ermöglicht ein intensives Training der Textsorten Brief und E-Mail<br />
• bereitet auf den Teil „Schreiben“ in den Prüfungen Start Deutsch 2,<br />
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache<br />
Deutsch-Test für Zuwanderer und Zertifi kat Deutsch vor<br />
A2 – B1<br />
• orientiert sich am Rahmencurriculum für Integrationskurse<br />
und am Europäischen Referenzrahmen<br />
• kann ergänzend zu jedem Grundstufenlehrwerk eingesetzt werden<br />
• Lösungen als kostenloser Download unter www.klett.de/einfachschreiben<br />
Einfach schreiben! A2 – B1<br />
Übungsbuch<br />
ISBN 978-3-12-676231-1<br />
Übungsbuch<br />
ISBN 978-3-12-676231-1<br />
ISBN 978-3-12-676230-4<br />
Übungsbuch<br />
978-3-12-676231-1<br />
Übungsbuch mit Audio-CD<br />
www.klett.de/einfachsprechen<br />
Einfach schreiben! Einfach sprechen!<br />
Deutsch als Zweit- und Deutsch als Zweit- und<br />
Fremdsprache A2–B1 Fremdsprache A2–B1<br />
Übungsbuch<br />
Übungsbuch + Audio-CD<br />
978-3-12-676231-1 978-3-12-676230-4<br />
Aussichten B 1<br />
Arbeitsbuch mit<br />
Audio-CD und DVD<br />
Arbeitsbuch B 1 mit<br />
Audio-CD und DVD<br />
978-3-12-676221-2<br />
Einfach sprechen!<br />
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache A2 – B1<br />
Vom Wort zum Satz zum Gespräch. Für Ihren Deutschkurs und für Selbstlerner.<br />
www.klett.de/aussichten<br />
• Anfängerlehrwerk für erwachsene<br />
Lernende, die Deutsch für das Studium<br />
oder den Beruf benötigen<br />
• führt in ca. 450 Unterrichtseinheiten<br />
zu B1<br />
• enthält ein intensives Phonetikprogramm<br />
• Zusatzmaterialien wie Lösungen,<br />
eine Moodle-Komponente und weiterführende<br />
Links stehen kostenlos im<br />
Internet bereit<br />
• weitere Informationen unter<br />
www.klett.de/dafkompakt<br />
Ihre Bezugsquellen in Mexiko:<br />
www.hemybooks.com<br />
Rückenstärke: 11 mm<br />
Kursbuch mit 2 Audio-CDs Aussichten B 1<br />
Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene<br />
Aussichten B 1<br />
Kursbuch mit 2 Audio-CDs<br />
DaF kompakt Aussichten<br />
NEU<br />
• für erwachsene Lernende ohne<br />
Vorkenntnisse, für die Niveaus A1 – B1<br />
• vermittelt Deutsch echt und lebendig<br />
• macht fit für den privaten, beruflichen<br />
und öffentlichen Lebensbereich<br />
• mit vielfältigen Medien, z.B. einer<br />
integrierten DVD<br />
• Zusatzmaterialien sowie das Lehrerhandbuch<br />
stehen kostenlos im Internet<br />
zum Download bereit<br />
• weitere Informationen unter<br />
www.klett.de/aussichten