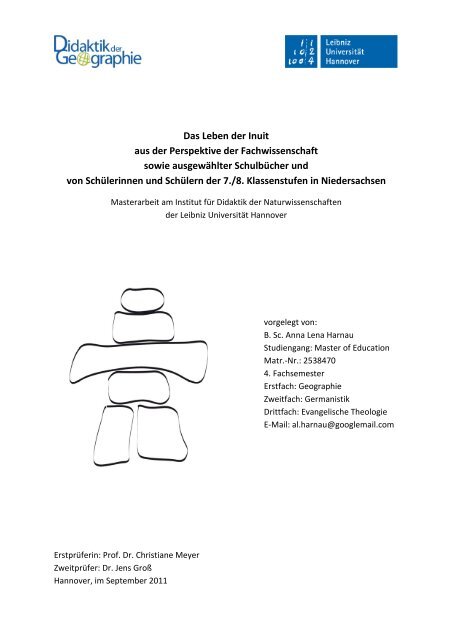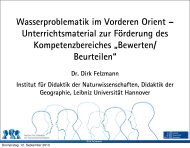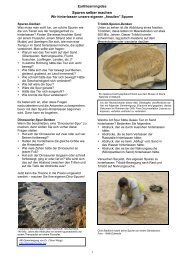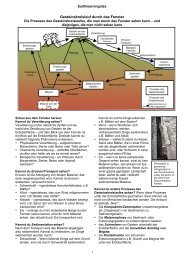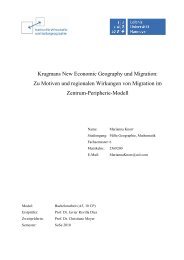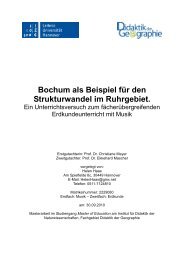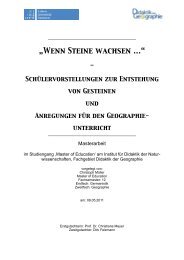Ich weiß, dass ich nichts weiß - Didaktik der Geographie - Leibniz ...
Ich weiß, dass ich nichts weiß - Didaktik der Geographie - Leibniz ...
Ich weiß, dass ich nichts weiß - Didaktik der Geographie - Leibniz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Leben <strong>der</strong> Inuit<br />
aus <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft<br />
sowie ausgewählter Schulbücher und<br />
von Schülerinnen und Schülern <strong>der</strong> 7./8. Klassenstufen in Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
Masterarbeit am Institut für <strong>Didaktik</strong> <strong>der</strong> Naturwissenschaften<br />
<strong>der</strong> <strong>Leibniz</strong> Universität Hannover<br />
Erstprüferin: Prof. Dr. Christiane Meyer<br />
Zweitprüfer: Dr. Jens Groß<br />
Hannover, im September 2011<br />
vorgelegt von:<br />
B. Sc. Anna Lena Harnau<br />
Studiengang: Master of Education<br />
Matr.-Nr.: 2538470<br />
4. Fachsemester<br />
Erstfach: <strong>Geographie</strong><br />
Zweitfach: Germanistik<br />
Drittfach: Evangelische Theologie<br />
E-Mail: al.harnau@googlemail.com
Eidesstattl<strong>ich</strong>e Vers<strong>ich</strong>erung<br />
Hiermit vers<strong>ich</strong>ere <strong>ich</strong>, Anna Lena Harnau, geboren am 12. Juni 1987 in Celle, an Eides statt,<br />
<strong>dass</strong> <strong>ich</strong> die vorliegende Arbeit zu dem Thema „Das Leben <strong>der</strong> Inuit aus <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong><br />
Fachwissenschaft sowie ausgewählter Schulbücher und von Schülerinnen und Schülern <strong>der</strong><br />
7./8. Klassenstufen in Nie<strong>der</strong>sachsen“ vollständig selbstständig verfasst und keine an<strong>der</strong>en<br />
als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen <strong>der</strong> Arbeit, die an<strong>der</strong>en Werken im<br />
Wortlaut o<strong>der</strong> dem Sinn nach entnommen sind, habe <strong>ich</strong> unter Angabe <strong>der</strong> Quellen kenntl<strong>ich</strong><br />
gemacht.<br />
Hannover, den 1. September 2011
Inhaltsverze<strong>ich</strong>nis<br />
Inhaltsverze<strong>ich</strong>nis I<br />
Abbildungsverze<strong>ich</strong>nis II<br />
Tabellenverze<strong>ich</strong>nis III<br />
Abkürzungsverze<strong>ich</strong>nis III<br />
Vorwort<br />
V<br />
1 Einleitung<br />
2 Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer<br />
S<strong>ich</strong>t<br />
2.1 Die Ordnung <strong>der</strong> Dinge und die Ordnung <strong>der</strong> Blicke aus konstruktivistischer<br />
S<strong>ich</strong>t<br />
2.2 Die Ordnung <strong>der</strong> Dinge und die Ordnung <strong>der</strong> Blicke bei <strong>der</strong> Selbst- und<br />
Fremdwahrnehmung<br />
3 Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 17<br />
3.1 Naturräuml<strong>ich</strong>e Gegebenheiten <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis 17<br />
3.2 Die Inuit als autochthone Bevölkerung <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis: Herkunft,<br />
Siedlungsraum und traditionelle Lebensweisen<br />
23<br />
3.3 Streben nach Selbstbestimmung: <strong>der</strong> Autonomieprozess 29<br />
3.4 Grundlegende wirtschaftsstrukturelle Gegebenheiten 52<br />
3.5 Inuit-Identität in <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne: die Rolle von Selbstbestimmung und indigenen<br />
Werten<br />
61<br />
4 Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 70<br />
4.1 Fragestellung und methodisches Vorgehen <strong>der</strong> Schulbuchanalyse 70<br />
4.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Schulbuchanalyse 74<br />
4.2.1 Beschreibende Zusammenfassung des Untersuchungsmaterials 74<br />
4.2.2 Kategorienbasierte Analyse des Untersuchungsmaterials 79<br />
4.2.3 Fazit <strong>der</strong> Schulbuchanalyse<br />
85<br />
5 Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 90<br />
5.1 Fragestellung und Hypothesen <strong>der</strong> Schülerbefragung 90<br />
5.2 Methodisches Vorgehen 91<br />
5.3 Auswertung <strong>der</strong> Schülerbefragung 95<br />
5.4 Fazit <strong>der</strong> Schülerbefragung<br />
109<br />
6 Gegenüberstellende Zusammenfassung <strong>der</strong> Perspektiven und Fazit<br />
Literaturverze<strong>ich</strong>nis 115<br />
Internetquellenverze<strong>ich</strong>nis 120<br />
Verze<strong>ich</strong>nis <strong>der</strong> Schulbücher 123<br />
Anhang<br />
I<br />
1<br />
4<br />
4<br />
10<br />
111
Abbildungsverze<strong>ich</strong>nis<br />
Titelbild: Inuksuk 1<br />
Abb. 1 Aufbau <strong>der</strong> Arbeit 2<br />
Abb. 2 Wahrnehmung und subjektive Wirkl<strong>ich</strong>keit: individuelle Konstruktionsvoraussetzungen<br />
7<br />
Abb. 3 Vier Raumkonzepte im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t 11<br />
Abb. 4 Inhalts- und Beziehungsebene im Eisbergmodell 14<br />
Abb. 5 Beitrag <strong>der</strong> Thematisierung frem<strong>der</strong> Lebensweisen im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t<br />
zur Herausbildung interkultureller Kompetenz<br />
16<br />
Abb. 6 Karte des Nordpolargebietes (Arktis) 17<br />
Abb. 7 Jahreszeitenklimate <strong>der</strong> polaren und subpolaren Zonen Nordamerikas nach<br />
TROLL/PAFFEN (1963)<br />
18<br />
Abb. 8 Klimadiagramme <strong>der</strong> Städte Barrow/Nordalaska und Nuuk/Westgrönland 20<br />
Abb. 9 Überblick: naturräuml<strong>ich</strong>e Gegebenheiten <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis 22<br />
Abb. 10 Siedlungsraum <strong>der</strong> Inuit in <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis 23<br />
Abb. 11 Besiedlung <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis durch die Inuit 24<br />
Abb. 12 Inuk bei <strong>der</strong> Robbenjagd am Eisloch 26<br />
Abb. 13 Traditionelle Häuser <strong>der</strong> Inuit 28<br />
Abb. 14 Flagge und Wappen Grönlands 32<br />
Abb. 15 Grönlandkarte 34<br />
Abb. 16 Entwicklungsschritte <strong>der</strong> grönländischen Autonomie 35<br />
Abb. 17 Flagge und Wappen Nunavuts 39<br />
Abb. 18 Karte des Territoriums Nunavut 39<br />
Abb. 19 Entwicklungsschritte <strong>der</strong> Autonomie Nunavuts 42<br />
Abb. 20 Regionale ANCSA-Körperschaften in Alaska 44<br />
Abb. 21 Inuit-Land und staatl<strong>ich</strong>es Land in <strong>der</strong> Inuvialuit-Region<br />
Abb. 22 Inuit-Land und Inuit-Siedlungsgebiet in Nunatsiavut nach dem Land Claims<br />
45<br />
Agreement<br />
48<br />
Abb. 23 Karte Nunaviks<br />
Abb. 24 Zeitl<strong>ich</strong>e Abfolge <strong>der</strong> Autonomieabkommen mit den Inuit Alaskas, des Ma-<br />
49<br />
ckenzie-Deltas, Nunaviks und Labradors<br />
51<br />
Abb. 25 Erdölför<strong>der</strong>gebiete und Verkehrsinfrastruktur in Alaska 57<br />
Abb. 26 Rohstofferschließung und Verkehrsinfrastruktur in <strong>der</strong> kanadischen Arktis 57<br />
Abb. 27 Anzahl <strong>der</strong> ausländischen Touristen in Grönland 2001 bis 2005<br />
Abb. 28 Vertikale Integration <strong>der</strong> Labrador Inuit Development Corporation im Ver-<br />
58<br />
hältnis zur Nunatsiavut-Regierung<br />
60<br />
Abb. 29 Filmplakat <strong>der</strong> Igloolik Isuma-Produktion ‚Atanarjuat (the fast runner)‘ 61<br />
Abb. 30 Die 38 Dimensionen von Inuit Qaujimajatuqangit 63<br />
1 Quelle: http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/image21/Inukshuk1.jpg<br />
II
Abb. 31 Die acht Prinzipien von Inuit Piqujangit 64<br />
Abb. 32 Inuit Holistic Lifelong Learning Model<br />
Abb. 33 Der Einfluss des Schulbuches auf die Lehrkraft, den Unterr<strong>ich</strong>t und die Schü-<br />
65<br />
lerinnen und Schüler<br />
72<br />
Abb. 34 Diercke Erdkunde (Westermann): ‚Die Inuit – Überleben bei -30°C‘ 75<br />
Abb. 35 Diercke Erdkunde (Westermann): Frontcover 75<br />
Abb. 36 Unsere Erde (Cornelsen): ‚Die Inuit – Leben in <strong>der</strong> Kälte‘ 76<br />
Abb. 37 Seydlitz <strong>Geographie</strong> (Schroedel): ‚Inuit – zwischen Iglu und Internet‘ 77<br />
Abb. 38 Terra <strong>Geographie</strong> (Klett): ‚Nunavut heißt: „Unser Land“‘<br />
Abb. 39 Häufigkeit <strong>der</strong> Nennungen <strong>der</strong> Beze<strong>ich</strong>nungsvorschläge für die Bewohner <strong>der</strong><br />
78<br />
kalten Zone<br />
Abb. 40 Spontane Assoziationen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler zum Leben in <strong>der</strong> kal-<br />
96<br />
ten Zone<br />
Abb. 41 Interessen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler hins<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> des Lebens in <strong>der</strong> kalten<br />
98<br />
Zone<br />
Abb. 42 Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe 1 über das Leben<br />
100<br />
gle<strong>ich</strong>altriger Jugendl<strong>ich</strong>er in Grönland<br />
Abb. 43 Häufigkeit <strong>der</strong> Nennungen <strong>der</strong> einzelnen Bil<strong>der</strong> in Frage 5 des Fragebogens<br />
102<br />
(St<strong>ich</strong>probe 1)<br />
Abb. 44 Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe 2 über das Leben<br />
104<br />
gle<strong>ich</strong>altriger Jugendl<strong>ich</strong>er in Grönland<br />
Abb. 45 Häufigkeit <strong>der</strong> Nennungen <strong>der</strong> einzelnen Bil<strong>der</strong> aus Frage 5 des Fragebogens<br />
105<br />
(St<strong>ich</strong>probe 2)<br />
109<br />
Tabellenverze<strong>ich</strong>nis<br />
Tab. 1 Vier Raumkonzepte im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t am Beispiel des Themas „Leben<br />
mit <strong>der</strong> Kälte: Anpassung an die kalte Zone“<br />
12<br />
Tab. 2 Arbeitslosenquoten in den Siedlungsgebieten <strong>der</strong> Inuit 52<br />
Abkürzungsverze<strong>ich</strong>nis<br />
ANCSA Alaska Native Claims Settlement Act<br />
DEW-Line Distant Early Warning Line<br />
EG Europäische Gemeinschaft<br />
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft<br />
IBC Inuit Broadcasting Corporation<br />
ICC Inuit Circumpolar Conference; ab 2006: Inuit Circumpolar Council<br />
ITC Inuit Tapirisat of Canada<br />
III
ITK Inuit Tapiriit Kanatami<br />
IQ Inuit Quajimajatuqangit<br />
JBNQA James Bay and Northern Québec Agreement<br />
KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat<br />
LIDC Labrador Inuit Development Corporation<br />
NTI Nunavut Tunngavik Incorporated<br />
SMART Sustainable Model for Arctic Regional Tourism<br />
TFN Tunngavik Fe<strong>der</strong>ation of Nunavut<br />
UNO United Nations Organization<br />
IV
Vorwort V<br />
Vorwort<br />
Ein herzl<strong>ich</strong>er Dank gilt in erster Linie Prof. Dr. Christiane Meyer, die mir während <strong>der</strong> ge-<br />
samten Bearbeitungsphase dieser Arbeit mit Rat und Tat zur Seite stand, und immer ein of-<br />
fenes Ohr für meine Anliegen hatte, sowie Dr. Jens Groß für die Übernahme <strong>der</strong> Zweitkor-<br />
rektur. Beson<strong>der</strong>s bedanken möchte <strong>ich</strong> m<strong>ich</strong> zudem bei Achim Seifert von <strong>der</strong> Schillerschule<br />
Hannover für die freundl<strong>ich</strong>e und engagierte Organisation <strong>der</strong> Schülerbefragung, sowie bei<br />
den beiden Fachlehrerinnen <strong>der</strong> befragten Klassen, Elisabeth Reiß und Eva Szagun, für die<br />
Bereitstellung ihrer Unterr<strong>ich</strong>tszeit und natürl<strong>ich</strong> bei den Schülerinnen und Schülern, die an<br />
<strong>der</strong> Befragung teilgenommen haben. Ein herzl<strong>ich</strong>es Dankeschön gilt außerdem den beiden<br />
Korrekturleserinnen Maire Stubbe und Sandra Windolph für ihre Mühe und Hilfsbereitschaft<br />
sowie ihre formalen Anmerkungen. Letztl<strong>ich</strong> möchte <strong>ich</strong> auch meiner Familie danken für die<br />
Unterstützung, die sie mir während des gesamten Studiums hat zukommen lassen.
Einleitung 1<br />
1 Einleitung<br />
„<strong>Ich</strong> <strong>weiß</strong>, <strong>dass</strong> <strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>ts <strong>weiß</strong>“<br />
In Eis und Schnee nördl<strong>ich</strong> irgendwo, da lebt ein netter kleiner Eskimo,<br />
das Fell im Mantel, ja das wärmt ihn so,<br />
er zittert gar n<strong>ich</strong>t, weht <strong>der</strong> Wind auch noch so roh.<br />
Des Morgens purzelt er zum Bett hinaus,<br />
mit Hund und Schlitten fährt er aus dem Haus,<br />
er jagt übers Eis und er ist so froh,<br />
<strong>der</strong> nette kleine, pelzbedeckte Eskimo.<br />
(SOKRATES; zit. nach FRIPERTINGER 2011:59)<br />
Die Alltagsvorstellungen vieler Menschen über die Inuit und ihr Leben in <strong>der</strong> Arktis sind<br />
von ähnl<strong>ich</strong>en Bil<strong>der</strong>n geprägt wie <strong>der</strong> voranstehend aufgeführte Text des Kin<strong>der</strong>liedes Der<br />
nette kleine Eskimo. <strong>Ich</strong> selbst habe dieses Lied einst in <strong>der</strong> Grundschule gelernt. Als <strong>ich</strong> eini-<br />
ge Jahre später Peter Høegs Roman Fräulein Smillas Gespür für Schnee las, kam es mir wie-<br />
<strong>der</strong> in den Sinn. Dabei fiel mir auf, <strong>dass</strong> die dortige Beschreibung <strong>der</strong> Inuit n<strong>ich</strong>t zu dem pass-<br />
te, was <strong>ich</strong> in <strong>der</strong> Schule gelernt hatte. Ein spontaner Blick in ein aktuelles Schulbuch –<br />
Diercke Erdkunde 7/8 für Gymnasien in Nie<strong>der</strong>sachsen (2009) – offenbarte schließl<strong>ich</strong> eine<br />
dritte Darstellungsweise, die s<strong>ich</strong> wie<strong>der</strong>um von den an<strong>der</strong>en beiden unterschied. Vor die-<br />
sem Hintergrund entstand die Idee, im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit verschiedene, im<br />
schulischen Kontext relevante Perspektiven zum Leben <strong>der</strong> Inuit zu erheben.<br />
Es werden somit in dieser Arbeit drei verschiedene Perspektiven auf das Leben <strong>der</strong> Inuit<br />
vorgestellt: die nach Objektivität strebende fachwissenschaftl<strong>ich</strong>e S<strong>ich</strong>t, die didaktisch redu-<br />
zierten und transformierten Darstellungen in den Schulbüchern und die subjektiven Vorstel-<br />
lungen von Schülerinnen und Schüler je einer 7. und einer 8. Klasse. Während diese Perspek-<br />
tiven auf den ersten Blick nebeneinan<strong>der</strong> stehen, sind sie im schulischen Kontext hinterei-<br />
nan<strong>der</strong> geschaltet. Fachwissenschaftl<strong>ich</strong>e Erkenntnisse werden in den Schulbüchern didak-<br />
tisch aufbereitet. Diese Darstellungen dienen wie<strong>der</strong>um den Schülerinnen und Schülern im<br />
Unterr<strong>ich</strong>t häufig als inhaltl<strong>ich</strong>e Grundlage zur Erarbeitung des Themas. Es entsteht somit<br />
eine Informationskette, die durch verschiedene weitere Faktoren wie die Lehrkraft o<strong>der</strong> das
Einleitung 2<br />
Vorwissen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler ergänzt wird. Jede <strong>der</strong> drei Perspektiven verfügt<br />
somit über einen eigenen Blickwinkel, <strong>der</strong> s<strong>ich</strong> jeweils von dem <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en unterscheidet.<br />
Vor diesem Hintergrund wird den Fragen nachgegangen, wie Fachwissenschaft, Schulbü-<br />
cher und Schülerinnen und Schüler das Leben <strong>der</strong> Inuit darstellen, und wie s<strong>ich</strong> diese Per-<br />
spektiven zueinan<strong>der</strong> verhalten. In theoretischer Hins<strong>ich</strong>t wird dabei auf die konstruktivisti-<br />
sche <strong>Didaktik</strong> und Pädagogik nach KERSTEN REICH zurückgegriffen. Diese geht davon aus, <strong>dass</strong><br />
die Wahrnehmung ein subjektiver, individueller und aktiver Konstruktionsprozess ist und<br />
insofern niemals eine originalgetreue Abbildung <strong>der</strong> Realität sein kann; es können ledigl<strong>ich</strong><br />
unterschiedl<strong>ich</strong>e Grade hins<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Annäherung hieran und <strong>der</strong> Reflexion des Wahrneh-<br />
mungsprozesses unterschieden werden. Unter Bezugnahme auf SOKRATES gilt es daher, s<strong>ich</strong><br />
stets sein eigenes Unwissen ins Bewusstsein zu rufen.<br />
Der Aufbau <strong>der</strong> Arbeit ist in drei Teile geglie<strong>der</strong>t. Nach einer Erläuterung theoretischer<br />
Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t folgt die Dar-<br />
legung <strong>der</strong> Perspektiven <strong>der</strong> Fachwissenschaft, <strong>der</strong> Schulbücher und <strong>der</strong> Schülerinnen und<br />
Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit. Diese Perspektiven werden zunächst jeweils für s<strong>ich</strong> erörtert<br />
und anschließend in <strong>der</strong> Schlussbetrachtung zusammenfassend gegenübergestellt. Dem folgt<br />
ein abschließendes Fazit mit didaktischem Ausblick.<br />
Theoretischer Teil<br />
• Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus<br />
konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t (Kapitel 2)<br />
• Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit (Kapitel 3)<br />
Empirischer Teil<br />
• Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit (Kapitel 4)<br />
• Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit<br />
(Kapitel 5)<br />
Schlussbetrachtung<br />
• Gegenüberstellende Zusammenfassung <strong>der</strong> Perspektiven und Fazit<br />
(Kapitel 6)<br />
Abbildung 1: Aufbau <strong>der</strong> Arbeit
Einleitung 3<br />
Es sei an dieser Stelle angemerkt, <strong>dass</strong> im Rahmen dieser Arbeit ledigl<strong>ich</strong> ein Einblick in<br />
die jeweiligen S<strong>ich</strong>tweisen mögl<strong>ich</strong> ist. We<strong>der</strong> die fachwissenschaftl<strong>ich</strong>e Perspektive noch die<br />
diejenigen <strong>der</strong> Schulbücher o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler können umfassend darge-<br />
stellt werden. Stattdessen wird angestrebt, jeweils zentrale Aspekte herauszuarbeiten und<br />
aufzuzeigen. In Hinblick auf die Fachwissenschaft wird daher vertieft auf die naturräumli-<br />
chen Voraussetzungen, die traditionelle Lebensform <strong>der</strong> Inuit, auf den Autonomieprozess<br />
<strong>der</strong> letzten Jahrzehnte, grundlegende wirtschaftsstrukturelle Gegebenheiten sowie die Inuit-<br />
Identität in <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne eingegangen. Diese fünf Fel<strong>der</strong> decken s<strong>ich</strong> mit gegenwärtigen For-<br />
schungsschwerpunkten. Für die Darstellung wird vorhandene fachwissenschaftl<strong>ich</strong>e Literatur<br />
herangezogen. Allerdings stellte s<strong>ich</strong> hier die Verfügbarkeit dieser Literatur als begrenzen<strong>der</strong><br />
Faktor heraus. Die wissenschaftl<strong>ich</strong>e Forschung in Bezug auf die Inuit konzentriert s<strong>ich</strong> sehr<br />
stark auf Universitäten in Kanada und im Norden <strong>der</strong> USA. Deren Publikationen sind jedoch<br />
in deutschen Bibliotheken oftmals n<strong>ich</strong>t vorhanden. Des Weiteren wird die Aussagekraft <strong>der</strong><br />
erhobenen Schülervorstellungen durch die Größe <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>proben begrenzt. Es wurden ins-<br />
gesamt 52 Schülerinnen und Schüler befragt. Eine größere Untersuchung war im Rahmen<br />
dieser Arbeit n<strong>ich</strong>t zu bewältigen. Um einen Eindruck von den Auswirkungen des Unterr<strong>ich</strong>ts<br />
auf die Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler zu erhalten, wurde allerdings darauf<br />
geachtet, <strong>dass</strong> die eine Hälfte <strong>der</strong> befragten Schülerinnen und Schüler das Thema bereits aus<br />
dem Unterr<strong>ich</strong>t kannte, die an<strong>der</strong>e n<strong>ich</strong>t. Die Analyse <strong>der</strong> Schulbücher erfolgte anhand prä-<br />
gen<strong>der</strong> Schwerpunkte in den Darstellungen. Jede <strong>der</strong> drei Perspektiven kann somit noch<br />
deutl<strong>ich</strong> detaillierter erfasst werden, einige grundsätzl<strong>ich</strong>e Aussagen und Erkenntnisse sind<br />
jedoch auch in diesen Rahmen mögl<strong>ich</strong>.
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 4<br />
2 Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer<br />
S<strong>ich</strong>t<br />
2.1 Die Ordnung <strong>der</strong> Dinge und die Ordnung <strong>der</strong> Blicke aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t<br />
„Es gibt n<strong>ich</strong>t die Wirkl<strong>ich</strong>keit unabhängig von den unterschiedl<strong>ich</strong>en Wahrnehmungen<br />
von Beobachtern“ (REICH 2010:21) o<strong>der</strong> mit an<strong>der</strong>en Worten: Je<strong>der</strong> ist seiner Wahrnehmung<br />
Schmied. Dies ist eine <strong>der</strong> Kernaussagen des Konstruktivismus. Wahrnehmung erfolgt aus<br />
dieser Perspektive auf <strong>der</strong> Grundlage individuell beeinflusster Konstruktionsprinzipien und<br />
ist insofern zwangsläufig subjektiv geprägt. Der Beobachter ist demnach kein passiver Be-<br />
trachter, son<strong>der</strong>n ein aktiver Konstruktivist. Nachfolgend werden zunächst einige Theorien<br />
vorgestellt, denen für die Herausbildung <strong>der</strong> konstruktivistischen Denkschule wegweisende<br />
Bedeutung zukommt. Daran anschließend werden die zentralen Grundannahmen des Kon-<br />
struktivismus unter Bezugnahme auf die Theorie <strong>der</strong> konstruktivistischen <strong>Didaktik</strong> nach REICH<br />
vorgestellt sowie die elementaren Konstruktionsmuster erläutert, denen die Wahrnehmung<br />
aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t folgt.<br />
Die Psychologie beschreibt den komplexen Mechanismus <strong>der</strong> menschl<strong>ich</strong>en Wahrneh-<br />
mung in den kognitiven Lerntheorien. Kognitionen sind nach EDELMANN (2000:114) definiert<br />
als „jene Vorgänge, durch die ein Organismus Kenntnis von seiner Umwelt erlangt. Im<br />
menschl<strong>ich</strong>en Bere<strong>ich</strong> sind dies beson<strong>der</strong>s: Wahrnehmung, Vorstellung, Denken, Urteilen,<br />
Sprache“. Die kognitiven Lerntheorien gehen heute davon aus, <strong>dass</strong> Lernen im Rahmen einer<br />
aktiven Auseinan<strong>der</strong>setzung und Interaktion mit den Gegenständen, Personen und Ereignis-<br />
sen des eigenen Umfeldes erfolgt. Die Reize <strong>der</strong> Umwelt und ihre Informationen werden<br />
dabei ihrer Art entsprechend verbal o<strong>der</strong> non-verbal encodiert und gespe<strong>ich</strong>ert. Die auf die-<br />
se Weise konstruierte innere Darstellung <strong>der</strong> äußeren Gegebenheiten wird kognitive Reprä-<br />
sentation genannt. Sie fungiert als vermittelndes Bindeglied zwischen den äußeren Reizen<br />
und dem menschl<strong>ich</strong>en Verhalten als darauffolgende Reaktion. Dadurch stellt sie ein Schema<br />
bereit, auf dessen Grundlage und in dessen Abhängigkeit Schlussfolgerungen gezogen sowie<br />
neue Informationen integriert werden können (vgl. PETERMANN/PETERMANN/WINKEL 2006:145ff).<br />
Die konstruktivistische <strong>Didaktik</strong> greift diese Erkenntnisse <strong>der</strong> Psychologie als ihre Grund-<br />
lage auf. Des Weiteren fungieren die Theorien von JOHN DEWEY, JEAN PIAGET und LEV S. WYGOTSKI<br />
als w<strong>ich</strong>tige Impulsgeber (vgl. REICH 2008:71ff).
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 5<br />
DEWEY stellt das Handeln in den Fokus des Lernens. Lernen beze<strong>ich</strong>net demnach einen in-<br />
teraktiven Prozess, eine auf <strong>der</strong> Basis von Erfahrungen stattfindende Wechselwirkung zwi-<br />
schen erfahrenen und selbsterzeugten Handlungen. Im Verlauf dieses Prozesses generiert<br />
<strong>der</strong> Lerner durch explorative und experimentierende Auseinan<strong>der</strong>setzung mit seiner Umwelt<br />
neues Wissen, welches jedoch kein bloßes Abbild <strong>der</strong> äußeren Gegebenheiten darstellt. Es<br />
handelt s<strong>ich</strong> vielmehr um ein subjektives Konstrukt <strong>der</strong> Wirkl<strong>ich</strong>keit, dessen Urheber <strong>der</strong><br />
Lerner selbst ist. Im Zuge <strong>der</strong> Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt entstehen Anrei-<br />
ze, die mittels regelmäßiger Erfahrungen Verhaltenseigenschaften herausbilden. Diese fun-<br />
gieren wie<strong>der</strong>um als Kontext, in den neuerworbenes Wissen eingeordnet und auf dessen<br />
Basis es interpretiert und genutzt wird (vgl. REICH 2008:71).<br />
PIAGETs Ansatz <strong>der</strong> konstruktiven Psychologie setzt die subjektive Konstruiertheit des Ler-<br />
nens voraus und fragt nach den Entwicklungsstufen des einzelnen Lerners, auf denen dieser<br />
seine eigenen konstruktiven Lernfähigkeiten in zunehmendem Maße verbessert. Dieser Pro-<br />
zess vollzieht s<strong>ich</strong> in Interaktion mit <strong>der</strong> Umwelt und mittels zweier Modi, <strong>der</strong> Assimilation<br />
und <strong>der</strong> Akkomodation. Unter Assimilation versteht PIAGET die Einordnung neuer Informatio-<br />
nen in bereits vorhandene kognitive Schemata des Lerners sowie die Interpretation und die<br />
Strukturierung dieser Informationen durch den Lerner auf <strong>der</strong> Grundlage dieser Schemata.<br />
Es handelt s<strong>ich</strong> somit um einen Akt <strong>der</strong> Anpassung des Neuen an Bekanntes. Akkomodation<br />
hingegen beschreibt den umgekehrten Prozess. Hierbei ist es das Individuum, welches s<strong>ich</strong><br />
situationsbedingt an die Gegebenheiten seiner Umwelt anpasst. Die Differenzierung dieser<br />
beiden Vorgänge durch PIAGET hat seither für nahezu alle Lerntheorien grundlegende Bedeu-<br />
tung erlangt (vgl. REICH 2008:72).<br />
Im Gegensatz zu dem subjektorientierten Ansatz PIAGETs hebt WYGOTSKI das Zusammenwir-<br />
ken von Kognition und Sozialisation hervor. Er begreift die Wirkl<strong>ich</strong>keit als ein Konstrukt <strong>der</strong><br />
gesellschaftl<strong>ich</strong>en Interaktion und Kognitionen folgl<strong>ich</strong> als soziokulturell bedingt. Des Weite-<br />
ren betont er, <strong>dass</strong> s<strong>ich</strong> gemeinsames, zwischenmenschl<strong>ich</strong>es Handeln för<strong>der</strong>l<strong>ich</strong> auf das<br />
Lernen auswirkt. Von beson<strong>der</strong>er Bedeutung ist dabei die Zone <strong>der</strong> nächsten Entwicklung.<br />
Sie beschreibt das Potenzial des Lerners, also den Unterschied zwischen seinen momentanen<br />
Fähigkeiten und den nächsthöheren Kompetenzen, welche er durch Nutzung seiner psychi-<br />
schen Werkzeuge und gegebenenfalls unter Anleitung zu erre<strong>ich</strong>en im Stande ist. WYGOTSKI<br />
charakterisiert den Lerner als aktiv; er gestaltet seinen Lernprozess selbst und je selbstbe-
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 6<br />
stimmter er dabei vorgehen kann, desto größer werden seine Lernerfolge sein (vgl. REICH<br />
2008:72f).<br />
Die Theorien von DEWEY, PIAGET und WYGOTSKI unterscheiden s<strong>ich</strong> in mancherlei Hins<strong>ich</strong>t;<br />
gemein ist ihnen jedoch ihre Problemstellung. Sie fragen danach,<br />
„wie das Verhältnis einer sinnl<strong>ich</strong> gewissen und erfahrbaren Welt unserer Wahrnehmungen mit unseren<br />
kognitiven o<strong>der</strong> emotionalen Beschreibungen, Interpretationen, Deutungen und Deutungsmustern über die<br />
Erfahrungen zusammengedacht und zusammengebracht werden kann“ (REICH 2008:73).<br />
Im Gegensatz zu zahlre<strong>ich</strong>en an<strong>der</strong>en Ansätzen stellen sie die Interaktion des Subjekts mit<br />
seiner Umwelt sowie die Bedeutung jener Handlungen für das Lernen heraus und verneinen<br />
somit die Prämisse eines dualistischen Weltbildes, das von einer direkten Abbildung des Äu-<br />
ßeren im Inneren ausgeht. Dieses Misstrauen gegenüber einer „unmittelbaren Verbindung<br />
von Welt (›da draußen‹) und Abbild (›in uns‹)“ (REICH 2008:74) bildet zugle<strong>ich</strong> eine <strong>der</strong> zent-<br />
ralen Grundannahmen <strong>der</strong> konstruktivistischen <strong>Didaktik</strong> (vgl. REICH 2008:73f). Fernerhin legt<br />
<strong>der</strong> Konstruktivismus nachfolgende Annahmen zu Grunde:<br />
(1) Die konstruktivistische <strong>Didaktik</strong> nimmt eine erkenntniskritische Grundhaltung ein. In<br />
Anlehnung an eine These DEWEYs, nach <strong>der</strong> <strong>der</strong> Mensch in all seinem Tun, durch sein<br />
Wissen, sein Testen und sein Handeln tiefgreifend in ebenjenes eingreift, was er<br />
dann als die „Natur <strong>der</strong> Dinge“ (REICH 2008:75) ansieht, scheint es n<strong>ich</strong>t mögl<strong>ich</strong>, ei-<br />
ne wahrhaft objektive Beobachterposition einzunehmen (vgl. REICH 2008:74f).<br />
(2) Der Beobachter als Konstruktivist ist n<strong>ich</strong>t in <strong>der</strong> Lage, s<strong>ich</strong> gänzl<strong>ich</strong> von persönli-<br />
chen Determinanten wie Interesse, Betroffenheit, Ethnozentrismus, Geschlechts-<br />
spezifität und persönl<strong>ich</strong>em Habitus zu befreien (vgl. REICH 2008:76).<br />
(3) Konstruktionen durch den Beobachter erfolgen immer vor dem Hintergrund <strong>der</strong> so-<br />
ziokulturellen Rahmenbedingungen und sozialer Interaktion (vgl. REICH 2008:74f).<br />
Drei wesentl<strong>ich</strong>e Determinanten hierfür sind persönl<strong>ich</strong>e Erfahrungen, individuelles<br />
Befinden und die soziale Wahrnehmung; diese werden in Abbildung 2 (Seite 7) nä-<br />
her beschrieben (vgl. REICH 2010:21).<br />
(4) Ein allgegenwärtiger und unumgängl<strong>ich</strong>er Konstruktionsmechanismus ist die Spra-<br />
che. Ihr arbiträrer Charakter bewirkt, <strong>dass</strong> <strong>der</strong> Mensch selbst bereits im Akt des
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 7<br />
Sprechens zum Konstrukteur von Wahrheiten wird 2 (vgl. REICH 2008:76).<br />
(5) Aus den vorangehend angeführten Annahmen folgert <strong>der</strong> Konstruktivismus seine<br />
zentrale Kernaussage: „Es gibt keine Wirkl<strong>ich</strong>keit, die n<strong>ich</strong>t konstruiert ist“ (REICH<br />
2008:115). Vor diesem Hintergrund versteht es die konstruktivistische <strong>Didaktik</strong> als<br />
eines ihrer Hauptanliegen, dem Lerner die „Multiperspektivität von Wirkl<strong>ich</strong>keits-<br />
auffassungen“ (REICH 2008:76) offenzulegen.<br />
Persönl<strong>ich</strong>e Erfahrungen<br />
• Grundlegende<br />
emotionale Erlebnisse<br />
• Verhaltensmuster aus<br />
dem Elternhaus<br />
• Eigene Biographie als<br />
Konstrukt<br />
• Lernerfolge<br />
• Spezifische Lebenswelt<br />
• Kulturelle<br />
Beson<strong>der</strong>heiten<br />
Individuelles Befinden<br />
• Wünsche<br />
• Sehnsüchte<br />
• Erwartungen<br />
• Motivationen<br />
• Körperl<strong>ich</strong>er Zustand<br />
• Krankheiten<br />
• Körperl<strong>ich</strong>e Symptome<br />
Abbildung 2: Wahrnehmung und subjektive Wirkl<strong>ich</strong>keit: individuelle Konstruktionsvoraussetzungen<br />
(eigene Darstellung nach REICH 2010:21)<br />
Gibt es tatsächl<strong>ich</strong> keine Wirkl<strong>ich</strong>keit die n<strong>ich</strong>t konstruiert ist? Das Zustandekommen die-<br />
ser radikalen Prämisse wird im Folgenden anhand <strong>der</strong> vom Konstruktivismus angenomme-<br />
nen elementaren Konstruktionsmuster nachvollzogen.<br />
Soziale Wahrnehmung<br />
• Konventionen <strong>der</strong><br />
Lebenswelt<br />
• Übernahme von<br />
Rollenkonzepten<br />
• Übernahme von<br />
sozialen Erwartungen<br />
• Suche nach eigenen<br />
Idealen<br />
• Positive und negative<br />
Vorbil<strong>der</strong><br />
• Feindbil<strong>der</strong> und<br />
Sündenböcke<br />
Gewiss gibt es Dinge, die äußerst unstrittig erscheinen. Der Wahrheitsgehalt sogenannter<br />
harter Fakten wie <strong>der</strong> Temperatur, des Einmaleins, <strong>der</strong> Syntax o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Uhrzeit wird von<br />
2 „Ist die Sprache <strong>der</strong> adäquate Ausdruck aller Realitäten?“ Diese Frage stellt Friedr<strong>ich</strong> NIETZSCHE (1873) vor dem<br />
Hintergrund des Wissens um den Charakter sprachl<strong>ich</strong>er Ausdrücke als mehrfach reduzierte und transformierte<br />
Konstruktionen dessen, was sie wie<strong>der</strong>zugeben vorgeben. „Ein Nervenreiz, zuerst übertragen in ein Bild! Erste<br />
Metapher. Das Bild wird nachgeformt in einem Laut! Zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges Überspringen<br />
<strong>der</strong> Sphäre, mitten hinein in eine ganz andre und neue“ (NIETZSCHE 1873). KORZYBSKI benennt in diesem Zusammenhang<br />
die folgenden drei Prinzipien, die <strong>der</strong> Sprache im Konkreten sowie je<strong>der</strong> Form von Konstrukt im<br />
Allgemeinen zu Grunde liegen:<br />
(1) Prinzip <strong>der</strong> N<strong>ich</strong>tidentität – Konstruktionen können keine unmittelbaren Abbildungen <strong>der</strong> äußeren Wirkl<strong>ich</strong>keit<br />
sein,<br />
(2) Prinzip <strong>der</strong> N<strong>ich</strong>t-Vollständigkeit – Konstruktionen geben die äußere Wirkl<strong>ich</strong>keit n<strong>ich</strong>t in Gänze wie<strong>der</strong>,<br />
(3) Prinzip <strong>der</strong> Selbst-Reflexivität – Konstruktionen entstehen in Abhängigkeit vom Beobachter; er selbst ist<br />
immer Teil seiner Konstruktion (vgl. REICH 2010:28).
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 8<br />
kaum jemandem ernsthaft angezweifelt werden. So leugnet auch <strong>der</strong> Konstruktivismus diese<br />
Form von Wirkl<strong>ich</strong>keit n<strong>ich</strong>t; er weist jedoch darauf hin, <strong>dass</strong> es s<strong>ich</strong> auch bei den hier zu<br />
Grunde liegenden Mustern um menschl<strong>ich</strong>e Konstruktionen handelt – die Thermometerska-<br />
la, die Mathematik, die Grammatik, die Zeiteinteilung –, die dem Zweck dienen, das Leben zu<br />
ordnen, es einfacher und übers<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>er zu gestalten (vgl. REICH 2008:79). Es wird dennoch<br />
hypothetisch die Mögl<strong>ich</strong>keit einer objektiven Wirkl<strong>ich</strong>keit angenommen. REICH (2008:76f)<br />
definiert diese als „ein Ereignis, das wir immer dann wahrnehmen, wenn wir noch kein Kon-<br />
strukt, noch kein Verständnis, keine Erklärung über das gebildet haben, was uns […] er-<br />
scheint“. Jedoch wird im Moment <strong>der</strong> Wahrnehmung durch ebenjene ein Konstrukt geschaf-<br />
fen, so<strong>dass</strong> wie<strong>der</strong>um <strong>der</strong> konstruktivistische Grundsatz greift „Es gibt keine Realität, die wir<br />
n<strong>ich</strong>t konstruieren. […] Realität [ist] eine symbolische Ordnung o<strong>der</strong> eine imaginäre Vorstel-<br />
lung, die wir uns über o<strong>der</strong> für eine von uns erwartete und erfahrene Welt machen“ (REICH<br />
2008:115). Beide Varianten, Symbole und Imaginationen, stellen eine Form von Konstrukt<br />
dar, ein Abbild, welches n<strong>ich</strong>t mit <strong>der</strong> äußeren Wirkl<strong>ich</strong>keit identisch ist. Ein Symbol ist et-<br />
was, das für etwas an<strong>der</strong>es steht. Der Mensch als symbolfähiges Wesen ist in <strong>der</strong> Lage, seine<br />
ganze Welt in Symbolen darzustellen, ebenso, wie diese Welt s<strong>ich</strong> ihm symbolvermittelt dar-<br />
stellt. In ihrer Bedeutung kaum zu überschätzende Symbolsysteme sind beispielsweise die<br />
Sprache und die Körpersprache (vgl. REICH 2008:104ff). Bei Imaginationen handelt es s<strong>ich</strong> um<br />
jene Bil<strong>der</strong>, Eindrücke, Vorstellungen, Emotionen, Wünsche und Antriebe die s<strong>ich</strong> hinter den<br />
Symbolen verbergen, von diesen aber nie gänzl<strong>ich</strong> erfasst werden (vgl. REICH 2008:108ff). Im<br />
Rahmen des eingangs angeführten NIETZSCHE-Zitates (vgl. Fußnote 2) nähme die Ebene <strong>der</strong><br />
Imaginationen somit die Rolle <strong>der</strong> ersten Metapher ein, die Symbolebene die <strong>der</strong> zweiten<br />
Metapher.<br />
Vor diesem Hintergrund kann <strong>der</strong> Mensch gar n<strong>ich</strong>t an<strong>der</strong>s als zu konstruieren. Diese<br />
Konstruktion erfolgt jedoch n<strong>ich</strong>t willkürl<strong>ich</strong>, son<strong>der</strong>n sie folgt bestimmten Prinzipien. MICHEL<br />
FOUCAULT (vgl. 1974/2003:22f) argumentiert in diesem Zusammenhang, <strong>dass</strong> es bei <strong>der</strong> „Ein-<br />
r<strong>ich</strong>tung einer Ordnung unter den Dingen […] keine Ähnl<strong>ich</strong>keit [und] keine Trennung [gibt],<br />
die n<strong>ich</strong>t aus […] <strong>der</strong> Anwendung eines im Voraus bestehenden Kriteriums resultiert“<br />
(FOUCAULT 1974/2003:22). Dieses Kriterium benennt er als die Codes einer Kultur.<br />
„Die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch,<br />
ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen, fixieren gle<strong>ich</strong> zu Anfang für jeden
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 9<br />
Menschen die empirischen Ordnungen mit denen er zu tun haben und in denen er s<strong>ich</strong> wie<strong>der</strong>finden wird“<br />
(FOUCAULT 1974/2003:22).<br />
Das Wirken dieses Ordnungskriteriums führe jedoch we<strong>der</strong> dazu, <strong>dass</strong> die entstehende<br />
Ordnung die einzig mögl<strong>ich</strong>e, noch dazu, <strong>dass</strong> sie die bestmögl<strong>ich</strong>e Ordnung sei. Vielmehr<br />
verhalte s<strong>ich</strong> eine jede Ordnung zeitl<strong>ich</strong> und räuml<strong>ich</strong> relativ zu allen an<strong>der</strong>en Ordnungen<br />
(vgl. FOUCAULT 1974/2003:22f). Diese Aussagen FOUCAULTs decken s<strong>ich</strong> mit den Annahmen <strong>der</strong><br />
konstruktivistischen <strong>Didaktik</strong>. Konstruktionen sind demnach kulturabhängig. Dies bedeutet<br />
für den Konstruktionsprozess selbst, <strong>dass</strong> jede menschl<strong>ich</strong>e Konstruktionsleistung immer<br />
auch einer kontextbezogenen Rekonstruktion in Form eines Rückbezuges auf das kulturelle<br />
Raster bedarf. Nur auf diese Weise wird die notwendige Passung erzeugt, ohne die ein Kon-<br />
strukt n<strong>ich</strong>t anschlussfähig wäre. Gle<strong>ich</strong>es gilt für die externe Betrachtung eines Konstruktes:<br />
Losgelöst von <strong>der</strong> jeweiligen Kultur kann es n<strong>ich</strong>t betrachtet werden, ohne in elementarem<br />
Maße an Sinn und Verständl<strong>ich</strong>keit zu verlieren (vgl. REICH 2008:79ff).<br />
Eine Kultur bildet jedoch n<strong>ich</strong>t einfach einen statischen Rahmen für die Interaktion <strong>der</strong> ihr<br />
zugehörigen Individuen. Sie ist ihrerseits einer stetigen Verän<strong>der</strong>ung, Erweiterung und An-<br />
passung durch die Gesellschaft unterworfen. Eine kulturell kohärente Gesellschaft beze<strong>ich</strong>-<br />
net REICH (2008:80) als Verständigungsgemeinschaft. Innerhalb einer solchen Verständi-<br />
gungsgemeinschaft sind es bestimmte, repräsentativ exponierte Mehrheiten und Mehr-<br />
heitsvertreter, die Vorverständigungen darüber treffen, was ist <strong>der</strong> Gemeinschaft als Wahr-<br />
heit gelten kann. Auf diese Weise wird ein Rahmen geschaffen, in welchem s<strong>ich</strong> das Indivi-<br />
duum positionieren kann. Ebenso wie die vorangegangene Vorverständigung erfolgt jedoch<br />
auch diese Positionierung stets im Kontext <strong>der</strong> sozialen Interaktion sowie vor dem impliziten<br />
Bezugshorizont bereits vorhandener Verständigungen und latenter Grundvoraussetzungen.<br />
Hierzu zählen beispielsweise die jeweilige Sprache, vorhandene Institutionen, geltende Re-<br />
geln, ethische und moralische Denkweisen, gängige Routinen und Praktiken. Das Wirken<br />
dieser Faktoren kann mitunter so unumgängl<strong>ich</strong> und selbstverständl<strong>ich</strong> sein, <strong>dass</strong> es gar<br />
n<strong>ich</strong>t erst wahrgenommen wird. Ein Individuum ist daher niemals in <strong>der</strong> Lage, in völliger Un-<br />
abhängigkeit von seiner Verständigungsgemeinschaft zu denken o<strong>der</strong> zu handeln. Doch<br />
wenngle<strong>ich</strong> diese Annahmen den individuellen Wahrnehmungshorizont stark zu begrenzen<br />
scheinen, so ist eine Befreiung aus diesem Muster aufgrund seiner elementaren Orientie-<br />
rungsfunktion ebenso wenig wünschenswert wie mögl<strong>ich</strong> (vgl. REICH 2008:80f).
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 10<br />
Es ist jedoch sehr wohl mögl<strong>ich</strong>, s<strong>ich</strong> die Abhängigkeit <strong>der</strong> eigenen Wahrnehmung be-<br />
wusst zu machen, ihr Zustandekommen zu reflektieren und daran anknüpfend ihre Relativi-<br />
tät zu an<strong>der</strong>en Wahrnehmungen und Verständigungsgemeinschaften zu akzeptieren. Denn,<br />
so verschiedenartig o<strong>der</strong> gar wi<strong>der</strong>sprüchl<strong>ich</strong> Wahrheiten in unterschiedl<strong>ich</strong>en Verständi-<br />
gungsgemeinschaften auch aussehen mögen 3 , sie sind doch alle gle<strong>ich</strong>ermaßen das Resultat<br />
eines Appells an die Vernunft. Und dieser Umstand relativiert wie<strong>der</strong>um den Wahrheitsbe-<br />
griff. REICH (2008:80) definiert Wahrheiten daher als „Zuschreibungsformen eines adäquaten<br />
Handelns und Beobachtens im Sinne von Verständigungen und gemeinschaftl<strong>ich</strong> ausgebilde-<br />
ten Normierungen, Beobachtungen und Kontrollen hierüber“. Eine Wahrheit kann im Kon-<br />
struktivismus somit nie absolute Geltung besitzen (vgl. REICH 2008:79ff). „Die Moral des Den-<br />
kens“, wie ADORNO (1951/2003:83) feststellt, besteht deshalb darin,<br />
„we<strong>der</strong> stur noch souverän, we<strong>der</strong> blind noch leer, we<strong>der</strong> atomistisch noch konsequent zu verfahren. Die<br />
Doppelschlächtigkeit <strong>der</strong> Methode […], gle<strong>ich</strong>zeitig die Phänomene als solche sprechen zu lassen – das „rei-<br />
ne Zusehen“ – und doch in jedem Augenblick ihre Beziehung auf das Bewusstsein als Subjekt, die Reflexion<br />
präsent zu halten, drückt diese Moral am genauesten […] aus.“ (ADORNO 1951/2003:83).<br />
2.2 Die Ordnung <strong>der</strong> Dinge und die Ordnung <strong>der</strong> Blicke bei <strong>der</strong> Selbst- und<br />
Fremdwahrnehmung<br />
VAN DER VAART (2001:162) stellt fest: „School Geography is the only subject that introduces<br />
young people to the world as a whole“. Ein wesentl<strong>ich</strong>es Element dessen ist die reflektierte<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung mit fremden Län<strong>der</strong>n und den dort lebenden Menschen. Doch die vo-<br />
rangehend erläuterten Konstruktionsprinzipien <strong>der</strong> Wahrnehmung sind natürl<strong>ich</strong> auch für<br />
die Selbst- und Fremdwahrnehmung bei <strong>der</strong> Thematisierung frem<strong>der</strong> Lebensweisen im Geo-<br />
3 REICH (2008:81) führt in diesem Zusammenhang das Beispiel des vorwiegend in den USA geführten Streits<br />
zwischen Anhängern des Kreationismus einerseits und den Verfechtern <strong>der</strong> Evolutionstheorie an<strong>der</strong>erseits an.<br />
Die Kernthese des Kreationismus lautet, die Entstehung <strong>der</strong> Erde habe s<strong>ich</strong> auf exakt jene Weise zugetragen,<br />
wie es in <strong>der</strong> Bibel (Gen 1-10) beschrieben steht. Demzufolge sei die Erde n<strong>ich</strong>t mehr als 10.000 Jahre alt und<br />
mitsamt allen Lebens innerhalb von sechs Tagen erschaffen worden. Dem s<strong>ich</strong> daraus ergebenden, unauflösl<strong>ich</strong>en<br />
Wi<strong>der</strong>spruch zu den Erkenntnissen <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Naturwissenschaften wird durch eigene Theorien begegnet,<br />
die den Naturwissenschaften jeden Wahrheitsgehalt absprechen. Demnach seien beispielsweise alle<br />
auf <strong>der</strong> Erde vorhandenen Fossilien und Sedimente auf die Sintflut zurückzuführen (vgl. HEMMINGER 2009:17f).<br />
Aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t handelt es s<strong>ich</strong> hierbei um zwei Ans<strong>ich</strong>ten, die einan<strong>der</strong> zwar vollkommen wi<strong>der</strong>sprechen,<br />
von denen jedoch jede für ihre jeweilige Verständigungsgemeinschaft als wahr gilt. Eine konstruktivistische<br />
<strong>Didaktik</strong> würde dem Lerner daher beide Ans<strong>ich</strong>ten darlegen und die jeweiligen Konstruktionsprinzipien<br />
herausarbeiten (vgl. REICH 2008:82).
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 11<br />
graphieunterr<strong>ich</strong>t von zentraler Bedeutung. Denn gerade bei Fremdem und Unbekanntem<br />
wird das, was wir sehen, häufig durch unsere Erwartungshaltung bestimmt (vgl. REICH<br />
2010:22). Die folgenden Ausführungen werden die Annahmen <strong>der</strong> konstruktivistischen Di-<br />
daktik an dem konkreten Fall <strong>der</strong> Thematisierung frem<strong>der</strong> Lebensweisen im <strong>Geographie</strong>un-<br />
terr<strong>ich</strong>t spezifizieren und dabei aufzeigen, inwiefern Selbstwahrnehmung, Schülervorstellun-<br />
gen und letztl<strong>ich</strong> auch die Lehrer-Schüler-Interaktion den subjektiven Blick auf fremde Kultu-<br />
ren beeinflussen. Hieran anknüpfend wird dargelegt, auf welche Weise eine reflektierte Aus-<br />
einan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong> eigenen Selbst- und Fremdwahrnehmung einen Beitrag zum Inter-<br />
kulturellen Lernen leistet.<br />
Die Grundlage einer jeden geographischen Betrachtung ist <strong>der</strong> Raum, bzw. das Abbild ei-<br />
nes Raumes. RHODE-JÜCHTERN (2009:141) for<strong>der</strong>t anges<strong>ich</strong>ts seiner konstruktivistischen Prä-<br />
misse, jedes Abbild sei eine Konstruktion, <strong>der</strong> <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t müsse „jedes Abbild von<br />
Wirkl<strong>ich</strong>keit auf seine Entstehung, Erscheinung und Wirkung hinterfragen“. Diese For<strong>der</strong>ung<br />
exemplifiziert er anhand <strong>der</strong> im Curriculum 2000+ (vgl. DGfG 2002:8) dargestellten vier<br />
Raumkonzepte, welche den jeweils gle<strong>ich</strong>en Raum aus gänzl<strong>ich</strong> verschiedenen Blickwinkeln<br />
zeigen (s. Abb. 3).<br />
"... als „Container“ aufgefasst, in denen bestimmte<br />
Sachverhalte <strong>der</strong> physisch-materiellen Welt<br />
enthalten sind. In diesem Sinne werden „Räume“ als<br />
Wirkungsgefüge natürl<strong>ich</strong>er und anthropogener<br />
Faktoren verstanden, als das Ergebnis von<br />
Prozessen, die die Landschaft gestaltet haben, o<strong>der</strong><br />
als Prozessfeld menschl<strong>ich</strong>er Tätigkeiten."<br />
"... als „Kategorie <strong>der</strong> Sinneswahrnehmung“<br />
und damit als „Anschauungsformen“ gesehen, mit<br />
<strong>der</strong>en Hilfe Individuen und Institutionen ihre<br />
Wahrnehmungen einordnen und so Welt in ihren<br />
Handlungen „räuml<strong>ich</strong>“ differenzieren."<br />
Im<br />
<strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t<br />
werden Räume ...<br />
Abbildung 3: Vier Raumkonzepte im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t<br />
(eigene Darstellung nach RHODE-JÜCHTERN 2009:137 und DGfG 2002:8)<br />
"... als „Systeme von Lagebeziehungen“<br />
materieller Objekte betrachtet, wobei <strong>der</strong> Akzent<br />
<strong>der</strong> Fragestellung beson<strong>der</strong>s auf <strong>der</strong> Bedeutung von<br />
Standorten, Lage-Relationen und Distanzen für die<br />
Schaffung gesellschaftl<strong>ich</strong>er Wirkl<strong>ich</strong>keit liegt."<br />
"... in <strong>der</strong> „Perspektive ihrer sozialen,<br />
technischen und gesellschaftl<strong>ich</strong>en<br />
Konstruiertheit“ aufgefasst, indem danach gefragt<br />
wird, wer unter welchen Bedingungen und aus<br />
welchen Interessen wie über bestimmte Räume<br />
kommuniziert und sie durch alltägl<strong>ich</strong>es Handeln<br />
fortlaufend produziert und reproduziert."
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 12<br />
Die beiden Definitionen des Raumes als Container und als System von Lagebeziehungen<br />
fasst RHODE-JÜCHTERN (vgl. 2002:141) unter dem Oberbegriff Abbild zusammen, die des Rau-<br />
mes als Kategorie <strong>der</strong> Sinneswahrnehmung und als Konstruktion unter dem Begriff Konstruk-<br />
tion. HOFFMANN (vgl. 2009:108) greift diese Unterteilung auf, benennt sie jedoch n<strong>ich</strong>t als Ab-<br />
bild und Konstruktion, son<strong>der</strong>n als Ordnung <strong>der</strong> Dinge und Ordnung <strong>der</strong> Blicke. Erstgenannte<br />
Ordnung bezieht s<strong>ich</strong> auf den Charakter <strong>der</strong> zugehörigen Raumkonzepte als Abbild dessen,<br />
was wir als harte Fakten wahrnehmen. Die Raumkonzepte <strong>der</strong> Ordnung <strong>der</strong> Blicke hingegen<br />
stellen ebenjene Muster <strong>der</strong> subjektiven Wahrnehmung dar, welche <strong>der</strong> Konstruktivismus<br />
beson<strong>der</strong>s hervorhebt. Tab. 1 zeigt die jeweiligen Zugriffe <strong>der</strong> einzelnen Raumkonzepte am<br />
Beispiel des Themas „Leben mit <strong>der</strong> Kälte: Anpassung an die kalte Zone“.<br />
Ordnung<br />
<strong>der</strong><br />
Dinge<br />
Ordnung<br />
<strong>der</strong><br />
Blicke<br />
Raumdefinition Beispiel<br />
Raum als Container Wie bewirken bestimmte Geofaktoren die<br />
naturräuml<strong>ich</strong>en Gegebenheiten in <strong>der</strong> kalten<br />
Zone?<br />
Raum als System von<br />
Lagebeziehungen<br />
Raum als Kategorie<br />
<strong>der</strong><br />
mungSinneswahrneh-<br />
Wie ist die Raumstruktur im Bere<strong>ich</strong> <strong>der</strong> kalten<br />
Zone beschaffen? Welche regionalen, Zusammenhänge<br />
bedingen bestimmte Anpassungsformen<br />
an die klimatischen Gegebenheiten?<br />
Wie werden die Formen <strong>der</strong> Anpassung an die<br />
kalte Zone wahrgenommen und bewertet?<br />
Raum als Konstruktion Wie wird diese Anpassung von wem, wo und<br />
mit welchen Auswirkungen auf ihn, an<strong>der</strong>e<br />
und die Natur vorgenommen? Wie werden<br />
diese Anpassungsformen reproduziert?<br />
Tabelle 1: Vier Raumkonzepte im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t am Beispiel des Themas „Leben in <strong>der</strong> Kälte: Anpassung<br />
an die kalte Zone“<br />
(eigene Darstellung in Anlehnung an HOFFMANN 2009:110)<br />
Vorab (vgl. Kap. 2.1) war festgehalten worden, „Realität [sei] eine symbolische Ordnung<br />
o<strong>der</strong> eine imaginäre Vorstellung, die wir uns über o<strong>der</strong> für eine von uns erwartete und er-<br />
fahrene Welt machen“ (REICH 2008:115). Das Beispiel in Tabelle 1 zeigt, <strong>dass</strong> insbeson<strong>der</strong>e im<br />
Hinblick auf den Raum als Kategorie <strong>der</strong> Sinneswahrnehmung solche subjektiven Konstrukti-<br />
onsprinzipien durchschlagen. Dies führt in Bezug auf die Fremdwahrnehmung dazu, <strong>dass</strong><br />
zunächst „das Bild vom Fremden immer ein Eigenbild“ (ROHWER 1996:5) ist. Daher bedarf
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 13<br />
eine Auseinan<strong>der</strong>setzung mit dem Fremden eines Bewusstseins für das Eigene und das<br />
Selbst, das in erster Linie über Projektionen, Stereotype, Vorurteile sowie einen persönl<strong>ich</strong>en<br />
Ethnozentrismus in die Wahrnehmung des Fremden einfließt. (vgl. ROHWER 1996:5).<br />
Die Projektion ist ein Mechanismus, bei dem eigene Ideale, Wünsche und auch Ängste auf<br />
an<strong>der</strong>e übertragen werden. Fremden werden meist einhergehend mit einer entsprechenden<br />
Stilisierung Eigenschaften zugeschrieben, für die es keine tragfähige empirische Grundlage<br />
gibt; sie werden entwe<strong>der</strong> positiv verklärt, kritisch abgewertet o<strong>der</strong> gar kollektiv verurteilt<br />
(vgl. ROHWER 1996:5).<br />
Stereotype und Vorurteile sind beide reduzierte und vereinfachte Vorstellungen, die s<strong>ich</strong><br />
jedoch hins<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> ihrer affektiven Konnotation unterscheiden. So beze<strong>ich</strong>nen Stereotype<br />
„schemenhafte sowie stark selektierte […] kognitive Klischees“ (REINFRIED 2006:58), die dem<br />
Zweck dienen, die vielsch<strong>ich</strong>tige und schwer fassbare Wirkl<strong>ich</strong>keit mittels Kategorisierungen<br />
und Generalisierungen zu vereinfachen und überschaubar zu machen. Unter einem Vorurteil<br />
hingegen ist „eine affektiv abwertende Vorstellung […] gegenüber einem Individuum o<strong>der</strong><br />
einer Gruppe“ (REINFRIED 2006:58) zu verstehen, <strong>der</strong> anstelle persönl<strong>ich</strong>er Erfahrungen haupt-<br />
sächl<strong>ich</strong> gesellschaftl<strong>ich</strong> konstruierte Verallgemeinerungen zugrunde liegen. Als Beispiel für<br />
ein Stereotyp bzw. ein Vorurteil können folgende Aussagen angeführt werden: „Die Inuit<br />
leben in Iglus und gehen jeden Tag auf Robbenjagd“ (Stereotyp) bzw. „Alle Inuit sind barbari-<br />
sche Rohfleischesser“ (Vorurteil). Während Stereotypen also vornehml<strong>ich</strong> eine kognitive<br />
Strukturierungsfunktion innewohnt, sind Vorurteile in hohem Maße wertbeladen (vgl. REIN-<br />
FRIED 2006:58).<br />
Der Mensch neigt von Kindheit an dazu, soziale, moralische und religiöse Ans<strong>ich</strong>ten und<br />
Formen, die s<strong>ich</strong> stark von den eigenen unterscheiden, abzulehnen sowie Fremde und Frem-<br />
des an eigenen Einstellungen und Wertmaßstäben zu messen. Häufig wird dabei die Welt-<br />
wahrnehmung „von einem Punkt, <strong>der</strong> ‚<strong>ich</strong>‘ o<strong>der</strong> ‚wir‘ heißt, ausgehend gesteuert, ist auf die<br />
eigene Person o<strong>der</strong> die eigene Gruppe zentriert“ (ROHWER 1996:5). Ein solcherart gefärbter<br />
Blick wird als ethnozentrisch beze<strong>ich</strong>net und führt meist zu Missverständnissen und zur Ab-<br />
wertung des an<strong>der</strong>en in <strong>der</strong> subjektiven Wahrnehmung. Der Ethnozentrismus gilt daher als<br />
Son<strong>der</strong>fall des Vorurteils (vgl. ROHWER 1996:5).
n<br />
hle<br />
ne<br />
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 14<br />
Die vorangehend angeführten Konstruk-<br />
tionsmechanismen bedingen die Vorstel-<br />
lungen jedes einzelnen über das Fremde.<br />
Diese Vorstellungen stellen eine Form von<br />
Alltagswissen dar und sind insofern „in die<br />
(soziale) Praxis, Common-Sense-Annahmen,<br />
Handlungsnormen und Weltanschauungen<br />
bzw. Ideologien eingebettet“ (REINFRIED<br />
2008:9). Fernerhin kommen sie im (Geogra-<br />
phie)-Unterr<strong>ich</strong>t im Zuge <strong>der</strong> Interaktion<br />
Beziehungsebene<br />
Inhalte<br />
Vorstellungen<br />
Stimmungen<br />
Gefühle<br />
Inhaltsebene<br />
Abbildung 4: Inhalts- und Beziehungsebene im<br />
Eisbergmodell<br />
(eigene Darstellung in Anlehnung an REICH 2010:34)<br />
und Kommunikation mit Mitschülern und <strong>der</strong> Lehrkraft o<strong>der</strong> auch mit Lehrmedien wie dem<br />
Schulbuch zum Tragen, „weil man das Neue nur durch die Brille des bereits Bekannten ‚se-<br />
hen‘ kann“ (DUIT 2008:3). Wenn beispielsweise im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t die Lebensweise<br />
einer fremden Kultur behandelt wird, dann sendet die Lehrkraft Informationen hierüber auf<br />
<strong>der</strong> Inhaltsebene mittels Symbolen und vor dem Hintergrund ihrer eigenen Vorstellungen<br />
und affektiven Konnotationen. Die Lerner empfangen diese Informationen und integrieren<br />
sie in ihre persönl<strong>ich</strong>en Vorstellungen unter Berücks<strong>ich</strong>tigung ihrer eigenen affektiven<br />
Konnotationen, ohne diejenigen <strong>der</strong> Lehrkraft zu kennen. Die Information wird somit durch<br />
den Empfänger in einen Kontext eingebaut, <strong>der</strong> s<strong>ich</strong> von dem des Sen<strong>der</strong>s unterscheidet.<br />
„Der Sen<strong>der</strong> hat eine Abs<strong>ich</strong>t, <strong>der</strong> Empfänger hat eine Deutung. Beide können zusammenfal-<br />
len, müssen es aber n<strong>ich</strong>t“ (REICH 2010:33f). Eine darauffolgende Rückmeldung <strong>der</strong> Lerner an<br />
die Lehrkraft erfolgt nach demselben Muster (vgl. DUIT 2008:3). REICH (vgl. 2010:33) unter-<br />
scheidet daher für jede Form von Kommunikation eine Inhalts- und eine Beziehungsebene<br />
als die zwei Seiten einer Nachr<strong>ich</strong>t. Die Inhaltsebene umfasst die sachl<strong>ich</strong>en Informationen,<br />
<strong>der</strong>en Vermittlung vom Sen<strong>der</strong> intendiert ist. Zur Beziehungsebene gehören hingegen Vor-<br />
stellungen, Erwartungen, Gefühle, Stimmungen und das Verhalten, das diese unterschwellig<br />
bedingen. Beide Ebenen stehen in interdependenter Wechselwirkung, wobei <strong>der</strong> Einfluss <strong>der</strong><br />
Beziehungsebene auf die Inhaltsebene deutl<strong>ich</strong> größer ist als umgekehrt. Das im Kern auf<br />
SIGMUND FREUD zurückgehende Eisbergmodell (vgl. Abb. 4) stellt diese Relation dar. Demnach<br />
bilden die Inhalte ledigl<strong>ich</strong> die Spitze des Eisberges, dessen überwiegen<strong>der</strong> Großteil in Form<br />
<strong>der</strong> Beziehungen in <strong>der</strong> Tiefe <strong>der</strong> inneren Unterwasserwelt lauert (vgl. REICH 2010:33f).
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 15<br />
Der <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t strebt mit <strong>der</strong> Thematisierung frem<strong>der</strong> Lebensweisen danach,<br />
bei den Schülerinnen und Schülern Einstellungen zu entwickeln, auf <strong>der</strong>en Grundlage ihnen<br />
eine reziproke Denkweise mögl<strong>ich</strong> ist, welche „Unterschiede zwischen verschiedenen Be-<br />
trachtungspositionen aufdeckt und zu erklären versucht [und somit] […] die eigene S<strong>ich</strong>twei-<br />
se relativiert und Empathiefähigkeit […] för<strong>der</strong>t“ (SCHRÜFER 2003:9). Hierdurch leistet das Fach<br />
einen elementaren Beitrag zum Interkulturellen Lernen (vgl. Abb. 5), welches s<strong>ich</strong> als „die<br />
pädagogische Antwort auf Fremdenfeindl<strong>ich</strong>keit, Rassismus, Intoleranz und Gruppenegois-<br />
mus“ (REINFRIED 2006:58) versteht und danach „strebt, das spezifische Orientierungssystem<br />
<strong>der</strong> Wahrnehmung, des Denkens, Wertens und Handelns von Menschen an<strong>der</strong>er Kulturen zu<br />
verstehen, es in das eigenkulturelle Orientierungssystem zu integrieren und es im Umgang<br />
mit ihnen anzuwenden“ (ROHWER 1996:5). Sein Anliegen ist das Herausbilden einer interkul-<br />
turellen Kompetenz im Sinne <strong>der</strong> folgenden, von NIEKE (2000:204) formulierten Ziele des In-<br />
terkulturelles Lernens:<br />
(1) „Erkennen des eigenen unvermeidl<strong>ich</strong>en Ethnozentrismus“<br />
(2) „Umgehen mit <strong>der</strong> Befremdung“<br />
(3) „Grundlegen von Toleranz“.<br />
Zum Erre<strong>ich</strong>en dieser Ziele werden gegenwärtig zwei verschiedene Ansätze verfolgt: Es<br />
können einerseits die vorhandenen Gemeinsamkeiten hervorgehoben werden; an<strong>der</strong>erseits<br />
ist auch das Bewusstmachen bestehen<strong>der</strong> Unterschiede ein vielfach beschrittener Weg. Die<br />
Methoden sind in beiden Fällen mannigfaltig (vgl. SCHRÜFER 2003:11). Gerade Ethnozentris-<br />
mus und Vorurteile sind jedoch tradierte, sehr fest verankerte Wahrnehmungsmuster und<br />
als solche äußerst schwer abzuän<strong>der</strong>n (vgl. REINFRIED 2006:58). THOMAS (2004:6) kommt gar zu<br />
dem Schluss, Vorurteile seien „unausrottbare Bestandteile des menschl<strong>ich</strong>en Zusammenle-<br />
bens“, weshalb BUDKE (2008:22) for<strong>der</strong>t, das „Ziel des <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>ts sollte […] weni-<br />
ger die Bekämpfung und Ber<strong>ich</strong>tigung von Stereotypen 4 , als vielmehr die Offenlegung <strong>der</strong><br />
Konstruktionsprinzipien dieser Fiktion und eine Sensibilisierung <strong>der</strong> SchülerInnen für ihre<br />
gesellschaftl<strong>ich</strong>en Bedeutungen sein“. Die Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage ver-<br />
setzt werden, die ihrer eigenen Wahrnehmung anhaftenden Stereotype, Ethnozentrismen<br />
und Vorurteile als solche zu identifizieren und zu reflektieren. Ein wesentl<strong>ich</strong>es Element des-<br />
4 Der Begriff „Stereotyp“ wird bei von BUDKE (2008) entsprechend <strong>der</strong> vorab angeführten Definition eines Vorur-<br />
teils verwendet.
Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung frem<strong>der</strong> Kulturen aus konstruktivistischer S<strong>ich</strong>t 16<br />
sen ist die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Denk- und Lebensweisen des an<strong>der</strong>en zu er-<br />
kennen, sie als bedenkenswert anzuerkennen und auf diese Weise den eigenen Blick auf den<br />
an<strong>der</strong>en zu hinterfragen, verhilft zu einem respektvollen und toleranten Umgang mit Frem-<br />
dem und Unbekanntem (vgl. SCHRÜFER 2003:16). Eine zentrale Rolle spielt hierbei <strong>der</strong> Ansatz<br />
Verstehen durch Werteorientierung. Er strebt danach, den Schülerinnen und Schülern ihre<br />
Gebundenheit an ihre eigenen ethnozentrischen Wertevorstellungen ins Bewusstsein zu<br />
rufen, um diejenigen an<strong>der</strong>er Menschen zwar als abwe<strong>ich</strong>ende, aber ebenso vernünftige<br />
Alternativen zu respektieren (vgl. SCHRÜFER 2003:21f). „Mit den Augen <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en schauen<br />
zu lernen, relativiert auch die eigenen S<strong>ich</strong>tweisen. Die Schüler können durch die Auseinan-<br />
<strong>der</strong>setzung mit dem Fremden lernen, an<strong>der</strong>e Einstellungen und Werte als gle<strong>ich</strong>wertig anzu-<br />
erkennen“ (FÜHRING 1993:4).<br />
Individuelle<br />
Voraussetzungen<br />
Ethnozentrischer<br />
Blick<br />
Vorurteile<br />
Stereotype<br />
Eigene Wertevorstellungen<br />
Lernprozess Lernziel<br />
„Lebensweisen“<br />
im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t <br />
Perspektivenwechsel <br />
Werteorientierung <br />
Interkulturelle<br />
Kompetenz<br />
Abbildung 5: Beitrag <strong>der</strong> Thematisierung frem<strong>der</strong> Lebensweisen im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t zur Herausbildung<br />
interkultureller Kompetenz<br />
(eigene Darstellung)
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 17<br />
3 Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit<br />
3.1 Naturräuml<strong>ich</strong>e Gegebenheiten im Siedlungsgebiet <strong>der</strong> Inuit<br />
Das Siedlungsgebiet <strong>der</strong> Inuit umfasst die Alëuten, die alaskische West- und Nordküste,<br />
den Nordrand Kanadas und <strong>der</strong> Halbinsel Labrador sowie den kanadisch-arktischen Archipel<br />
und die Nordwest-, West- und Ostküste Grönlands. Entsprechend <strong>der</strong> in <strong>der</strong> <strong>Geographie</strong> ver-<br />
bindl<strong>ich</strong>en Definition, nach <strong>der</strong> die Südgrenze <strong>der</strong> Arktis durch die 10°C-Juli-Isotherme mar-<br />
kiert wird, ist <strong>der</strong> gesamte Siedlungsraum <strong>der</strong> Inuit als arktisch anzusehen. Ein Siedlungs-<br />
schwerpunkt ist dabei in <strong>der</strong> arktischen Tundra auszumachen (vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH<br />
2002:11f). Abbildung 6 gibt einen ersten Überblick über die naturräuml<strong>ich</strong>en Gegebenheiten<br />
des Nordpolargebietes.<br />
Abbildung 6: Karte des Nordpolargebietes (Arktis)<br />
(DIERCKE WELTATLAS 2008:220)
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 18<br />
Abbildung 7: Jahreszeitenklimate <strong>der</strong> polaren und subpolaren<br />
Zonen Nordamerikas nach TROLL/PAFFEN (1963)<br />
(DIERCKE WELTATLAS 2008:228.1 (Ausschnitt))<br />
Gemäß <strong>der</strong> Klassifizierung <strong>der</strong> Jahreszeitenkli-<br />
mate nach TROLL/PAFFEN (vgl. Abb. 7) ist <strong>der</strong> arkti-<br />
sche Raum Nordamerikas deckungsgle<strong>ich</strong> mit <strong>der</strong><br />
polaren und subpolaren Klimazone, die ebenfalls durch die 10°C-Juli-Isotherme nach Süden<br />
hin begrenzt wird. Sie ist unterglie<strong>der</strong>t in die Klimate I1 bis I4, die wie<strong>der</strong>um mit <strong>der</strong> durch<br />
THANNHEISER/WÜTHRICH (vgl. 2002:10) vorgenommenen naturräuml<strong>ich</strong>en Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Arktis<br />
kongruieren. Dem Klimatyp I1 (hochpolares Eisklima bzw. Eiswüste) ist demnach <strong>der</strong> Glet-<br />
scherbere<strong>ich</strong> zuzuordnen, <strong>der</strong> das grönländische Inlandeis umfasst. Der Begriff ‚hochpolar‘ ist<br />
auf zweierlei Weise zu verstehen: Einerseits bildet das Inlandeis eine Hochebene, die Höhen<br />
bis 3700 m erre<strong>ich</strong>t. An<strong>der</strong>erseits ist das Klima „extrem streng“ (THANNHEISER/WÜTHRICH<br />
2002:36), d.h. die Mitteltemperaturen liegen in wärmsten Monat des Jahres zwischen -10°C<br />
und -20°C und im kältesten Monat zwischen -40°C und -50°C. Mitunter werden sogar Ext-<br />
remwerte bis -70°C erre<strong>ich</strong>t. In Zentralgrönland befindet s<strong>ich</strong> ganzjährig ein arktischer Kälte-<br />
pol. Das polare Klima des Typs I2 prägt die polare Frostschuttzone, zu <strong>der</strong> die nördl<strong>ich</strong>en In-<br />
seln des kanadischen Archipels gehören (Ellesmere-, Devon- und Banks-Insel, Parry-Inseln<br />
sowie <strong>der</strong> Norden <strong>der</strong> Baffin- und <strong>der</strong> Victoria-Insel). Die Mitteltemperatur übersteigt dort<br />
im wärmsten Monat des Jahres n<strong>ich</strong>t 6°C, im kältesten liegt sie zwischen -30°C und -40°C. Im<br />
Bere<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Tundra des südl<strong>ich</strong>en kanadischen Archipels, <strong>der</strong> Barren Grounds sowie <strong>der</strong> Nor-<br />
drän<strong>der</strong> Alaskas und Labradors herrscht <strong>der</strong> Klimatyp I3 (subarktische Tundrenklimate) vor.<br />
Im wärmsten Monat liegt die Mitteltemperatur in dieser Zone zwischen 6°C und 10°C, im<br />
kältesten Monat überschreitet sie n<strong>ich</strong>t die 8°C-Marke. Das subpolar-hochozeanische Klima<br />
(Klimatyp I4) ist räuml<strong>ich</strong> auf die westalaskische Inselkette <strong>der</strong> Alëuten beschränkt. Neben<br />
den übrigen arktischen Klimaten ist es verhältnismäßig mild. Kennze<strong>ich</strong>nend ist eine geringe
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 19<br />
Jahrestemperaturamplitude, wobei die Temperaturen im wärmsten Monat im Mittel zwi-<br />
schen 5°C und 12°C liegen, im kältesten zwischen -8°C und 2°C (vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH<br />
2002:36ff).<br />
Ein charakteristisches Element des Polarklimas ist die geringe Strahlungsintensität. Ur-<br />
sächl<strong>ich</strong> hierfür ist <strong>der</strong> flache Einstrahlwinkel, <strong>der</strong> am Polarkreis maximal 47° erre<strong>ich</strong>t, sowie<br />
<strong>der</strong> lange Weg, <strong>der</strong> „in <strong>der</strong> l<strong>ich</strong>tstreuenden und -absorbierenden Atmosphäre“ (THANNHEI-<br />
SER/WÜTHRICH 2002:37) zurückgelegt werden muss. Hinzu kommt, <strong>dass</strong> die Strahlungsintensi-<br />
tät im Jahresverlauf starken Schwankungen unterworfen ist, welche jedoch auch innerhalb<br />
<strong>der</strong> polaren Zone entsprechend <strong>der</strong> Breitenlage variieren. So geht die Sonne am Pol im<br />
Sommerhalbjahr (21. März – 23. September) n<strong>ich</strong>t unter (Polartag), wodurch <strong>der</strong> niedrige<br />
Stand <strong>der</strong> Sonne in Bezug auf die Einstrahlungsenergie in Teilen kompensiert wird. Im Win-<br />
terhalbjahr (23. September – 21. März) steht die Sonne jedoch für die Dauer von sechs Mo-<br />
naten unter dem Horizont (Polarnacht). Mit zunehmen<strong>der</strong> Entfernung zum Pol än<strong>der</strong>t s<strong>ich</strong><br />
das Beleuchtungsregime; Polartag und Polarnacht werden kürzer, bis sie schließl<strong>ich</strong> am Po-<br />
larkreis auf die Sonnenwenden (21. Juni und 21. Dezember) beschränkt sind. Die geringe<br />
Strahlungsintensität ist <strong>der</strong> Hauptgrund für die niedrigen Temperaturen in <strong>der</strong> Polarzone<br />
(vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:36f). Als zweiter bedingen<strong>der</strong> Faktor ist jedoch auch die Al-<br />
bedo relevant. Sie erre<strong>ich</strong>t nach <strong>der</strong> Darstellung von BAUMGARTNER ET AL. (vgl. HÄCKEL 2005:194)<br />
nirgendwo auf <strong>der</strong> Erde so hohe Werte wie in <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis. Dort wird für<br />
den Bere<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Gletscherzone ein Albedowert von 80 % angegeben; in <strong>der</strong> Frostschuttzone<br />
liegt dieser zwischen 70 und 80 %, in <strong>der</strong> Tundra noch zwischen 60 und 70 % (Mitteleuropa:<br />
40-50%). Bedingt werden diese hohen Werte durch die Schnee- und Eisbedeckung, die in <strong>der</strong><br />
Gletscherzone ganzjährig, in <strong>der</strong> Frostschuttzone und <strong>der</strong> Tundra über weite Teile des Jahres<br />
vorherrscht (vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:37f).<br />
Die polare Klimazone ist grundsätzl<strong>ich</strong> verhältnismäßig nie<strong>der</strong>schlagsarm, wobei mit<br />
>100mm die geringsten Jahresnie<strong>der</strong>schläge in <strong>der</strong> Gletscherzone zu verze<strong>ich</strong>nen sind. An<br />
den Küsten des Pazifiks und des Nordpolarmeeres liegen sie aufgrund größerer<br />
Erwärmungen im Sommer etwas höher. In Barrow, an <strong>der</strong> Nordküste Alaskas gelegen (vgl.<br />
Abb. 8), werden beispielsweise bei einer Mitteltemperatur von -12,5°C im Jahresmittel 113<br />
mm Nie<strong>der</strong>schlag gemessen. Die größten Nie<strong>der</strong>schlagsmengen weisen mit 25mm bzw.<br />
23mm die Monate Juli und August auf, während die Nie<strong>der</strong>schläge im übrigen Jahr auf
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 20<br />
Abbildung 8: Klimadiagramme <strong>der</strong> Städte Barrow/Nordalaska und Nuuk/Westgrönland<br />
(a) www.klimadiagramme.de/Namerika/barrow.html; b) www.klimadiagramme.de/Europa/nuuk.html)<br />
gle<strong>ich</strong>mäßig niedrigem Niveau um 5mm pendeln (vgl. Abb. 8). Auf <strong>der</strong> Ostseite des<br />
Kontinents fallen die Nie<strong>der</strong>schläge hingegen deutl<strong>ich</strong> umfangre<strong>ich</strong>er aus. Dies ist zum einen<br />
auf den Einfluss des atlantischen Ozeans zurückzuführen, zum an<strong>der</strong>en begünstigt aber auch<br />
das Relief die Nie<strong>der</strong>schlagsbildung (vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:43f). Das Land bzw. das<br />
Inlandeis steigen schon in Küstennähe steil an. Die größten Erhebungen befinden s<strong>ich</strong> in<br />
Zentralgrönland (3231m) und an <strong>der</strong> ostgrönländischen Küste (3700m). Auch an den<br />
Ostküsten Labradors und <strong>der</strong> Baffin-Insel befinden s<strong>ich</strong> Höhenzüge, die Höhen bis 1676m<br />
(Labrador) bzw. 2591m (Baffin-Insel) erre<strong>ich</strong>en. Sie sind gegenüber den ansonsten flachen<br />
Landschaften des kanadischen Schildes deutl<strong>ich</strong> herausgehoben (vgl. DIERCKE WELTATLAS<br />
2008:190.1). In Nuuk, an <strong>der</strong> Südwestküste Grönlands, werden im Jahresmittel 723mm<br />
Nie<strong>der</strong>schlag gemessen, bei einer Mitteltemperatur von -1,4°C. Es gibt ein ausgeprägtes<br />
Nie<strong>der</strong>schlagsmaximum in den Monaten Juli, August und September (85-87mm gegenüber<br />
45-50mm zwischen Dezember und Mai) sowie eine weitere Spitze im November (71mm; vgl.<br />
Abb. 8). Ursächl<strong>ich</strong> für letztere ist vor allem die stärkere Zyklonenaktivität im Spätherbst (vgl.<br />
THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:43f).<br />
Fernerhin beeinflussen Meeresströmungen die klimatischen Gegebenheiten <strong>der</strong> Arktis.<br />
„Warme und kalte Meeresströmungen modifizieren das Klima und rufen Asymmetrien her-<br />
vor“ (THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:45). Im arktischen Raum Nordamerikas ist hier in erster Li-<br />
nie <strong>der</strong> Ostgrönland-Labradorstrom bedeutsam, eine meridional ausger<strong>ich</strong>tete, kalte Ober-
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 21<br />
flächenströmung. Er bildet gemeinsam mit seinem ‚Gegenspieler‘, dem warmen Golfstrom,<br />
einen „großen zyklonalen Wirbel“ (THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:46) im Nordatlantik. Als Folge<br />
dieser Strömungsverhältnisse schlagen die Isothermen im nordwestatlantischen Raum weit<br />
nach Südwesten aus (vgl. 10°C-Juli-Isotherme in Abb. 6), im Nordostatlantik hingegen nach<br />
Nordosten. So kann beispielsweise die an <strong>der</strong> Nordspitze Norwegens gelegene Stadt Ham-<br />
merfest ganzjährig von Schiffen angelaufen werden; das ostgrönländische Fjordsystem<br />
Scoresbysund ist hingegen nur zwei Monate im Jahr befahrbar, und auch dann nur durch<br />
Eisbrecher (vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:45f).<br />
Ebenso wie die geringe Strahlungsintensität und die Meeresströmungen bedingt das<br />
Meereis die niedrigen Temperaturen im arktischen Nordamerika. Neben <strong>der</strong> bereits ange-<br />
führten hohen Albedo bewirkt es eine deutl<strong>ich</strong>e Vermin<strong>der</strong>ung des Wärmeaustausches zwi-<br />
schen Meer und Atmosphäre. Zudem ist das Abschmelzen des Eises ein sehr energieintensi-<br />
ver Prozess. Der Begriff Meereis umfasst das feste, zusammengeschobene Packeis, verfestig-<br />
tes Küsteneis sowie lockeres Treibeis. Dauerhaft von Eis bedeckt ist ledigl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> innerhalb<br />
<strong>der</strong> Packeisgrenze befindl<strong>ich</strong>e Teil des Nordpolarmeeres, die sogenannte innere Polarregion.<br />
Das Gebiet zwischen <strong>der</strong> Packeisgrenze und <strong>der</strong> äußeren Treibeisgrenze wird als äußere Po-<br />
larregion beze<strong>ich</strong>net, zu <strong>der</strong> auch das Siedlungsgebiet <strong>der</strong> Inuit gehört. Das Eis dieser Region<br />
umfasst zum einen Salzwassereis, das durch das Gefrieren des Meerwassers entstanden ist,<br />
und zum an<strong>der</strong>en Süßwassereis terrestrischen Ursprungs, das vor allem in Küstennähe und<br />
in Form von Schelfeis o<strong>der</strong> Eisbergen vorkommt. Während das Salzwassereis eine mittlere<br />
Mächtigkeit von einem halben Meter aufweist, ist das Süßwassereis in <strong>der</strong> Regel dicker. Be-<br />
dingt durch die größere Jahrestemperaturamplitude auf dem Festland erfolgt die Vereisung<br />
mit zunehmen<strong>der</strong> Nähe zur Küste umso schneller und mächtiger. Die größte Ausdehnung<br />
des Meereises ist im späten Winter und im Frühjahr zu verze<strong>ich</strong>nen. Im Sommer dagegen<br />
sind weite Teile <strong>der</strong> äußeren Polarregion für mehrere Monate eisfrei (vgl. THANNHEI-<br />
SER/WÜTHRICH 2002:70ff).<br />
Das Siedlungsgebiet <strong>der</strong> Inuit in <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis liegt vollständig nördl<strong>ich</strong><br />
<strong>der</strong> Baumgrenze und im Verbreitungsgebiet des Permafrostbodens. Die dortige Vegetation<br />
verän<strong>der</strong>t s<strong>ich</strong> in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Breitenlage und <strong>der</strong> Entfernung zur Küste. Grundsätz-<br />
l<strong>ich</strong> lassen s<strong>ich</strong> für den in dieser Arbeit relevanten Raum, zwei große Vegetationszonen un-<br />
terscheiden: die Vegetationszone <strong>der</strong> nördl<strong>ich</strong>en Arktis und die <strong>der</strong> mittleren Arktis. Erstge-
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 22<br />
nannte befindet s<strong>ich</strong> im Bere<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Frostschuttzone und weist im Mittel eine Pflanzenbede-<br />
ckung von 5% bis 25% auf. Vor allem Moose und Flechten bilden hier die Pflanzendecke. Zu-<br />
dem kommen niedrig wachsende Pflanzen wie Gräser, Polsterpflanzen und Zwergsträucher<br />
vor. Weite Gebiete dieser Zone sind jedoch gänzl<strong>ich</strong> vegetationslos. Die Vegetationszone <strong>der</strong><br />
mittleren Arktis nimmt die Bere<strong>ich</strong>e <strong>der</strong> südl<strong>ich</strong>en Frostschuttzone und <strong>der</strong> arktischen Tun-<br />
dra ein. Hier werden Pflanzenbedeckungsgrade zwischen 25% und 50% erre<strong>ich</strong>t. Unter aus-<br />
geprägtem maritimem Einfluss können örtl<strong>ich</strong> sogar bis zu 75% des Bodens durch Pflanzen<br />
bedeckt sein, was dann hauptsächl<strong>ich</strong> auf die vermehrte Ausbreitung <strong>der</strong> Moose zurückzu-<br />
führen ist. Ähnl<strong>ich</strong> wie in <strong>der</strong> Vegetationszone <strong>der</strong> nördl<strong>ich</strong>en Arktis sind auch hier Flechten<br />
und Moose die dominante Form <strong>der</strong> Vegetation. Daneben treten aber auch zunehmend<br />
Kräuter und vor allem Zwergsträucher auf. Kennze<strong>ich</strong>nend ist überdies die Silberwurzheide<br />
(vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:102f).<br />
Abschließend lässt s<strong>ich</strong><br />
festhaltend, <strong>dass</strong> die na-<br />
turräuml<strong>ich</strong>en Merkmale<br />
des Siedlungsraumes <strong>der</strong><br />
Inuit durch polares Klima<br />
mit ganzjährig niedrigen<br />
Temperaturen, geringen<br />
Nie<strong>der</strong>schlägen und gro-<br />
ßen Unterschieden im<br />
Beleuchtungsregime zwi-<br />
schen Sommer und Win-<br />
ter geprägt werden. Kli-<br />
mazone und kalte Mee-<br />
resströmungen bedingen<br />
zusammen eine mehrmo-<br />
natige Meervereisung. Das<br />
Nie<strong>der</strong>schlag<br />
Niedriges<br />
Nie<strong>der</strong>schlagsniveau<br />
mit<br />
Nie<strong>der</strong>schlagsmaximum<br />
im<br />
Sommer<br />
Vegetation<br />
Arktische und<br />
subarktische<br />
Tundrenvegetation<br />
(Flechten, Moose,<br />
Zwergsträucher)<br />
Polare und<br />
subpolare<br />
Klimazone, hohe<br />
Albedo,<br />
mehrmonatige<br />
Meervereisung<br />
Naturräuml<strong>ich</strong>e<br />
Gegebenheiten <strong>der</strong><br />
nordamerikanischen<br />
Arktis<br />
Geschlossene bzw.<br />
in Südgrönland<br />
inselartige<br />
Verbreitung des<br />
Permafrostbodens<br />
Ebener<br />
kanadischer Schild<br />
mit Erhebungen im<br />
Norden Alaskas, in<br />
Ostkanadas und<br />
auf Grönland<br />
Abbildung 9: Überblick: naturräuml<strong>ich</strong>e Gegebenheiten <strong>der</strong> nordamerikanischen<br />
Arktis<br />
(eigene Darstellung)<br />
Relief wird geprägt durch den weitgehend ebenen kanadischen Schild sowie das bis zu 3.700<br />
m mächtige grönländische Inlandeis. Auf den Permafrostböden herrscht eine baumlose,<br />
nach Süden hin d<strong>ich</strong>ter werdende Tundrenvegetation vor.<br />
Klima<br />
Relief<br />
Boden
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 23<br />
3.2 Die Inuit als autochthone Bevölkerung <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis: Herkunft,<br />
Siedlungsraum und traditionelle Lebensweisen<br />
Die Inuit bilden eine <strong>der</strong> größten Ethnien innerhalb <strong>der</strong><br />
Gruppe <strong>der</strong> indigenen Völker <strong>der</strong> Arktis, zu denen ferner-<br />
hin die auf <strong>der</strong> Kola-Halbinsel lebenden Saami und Komi,<br />
die Nenzen im Ural sowie die in Nordsibirien ansässigen<br />
Enzen, Nganasanen, Evenken, Dolganen, Evenen,<br />
Jakuten, Jukagiren und Tschuktschen gezählt werden. Ihr<br />
Siedlungsraum (vgl. Abb. 10) erstreckt s<strong>ich</strong> vornehml<strong>ich</strong><br />
auf die nordamerikanische Arktis – auf Alaska, Nordkana-<br />
da und Grönland (vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:173).<br />
Der Name Inuit 5 (Singular: Inuk, Dual: Inuuk) bedeutet<br />
‚Menschen‘ und wird allgemeinhin für die Gesamtheit <strong>der</strong><br />
in diesen Gebieten lebenden, Inuktitut-sprechenden Be-<br />
Abbildung 10: Siedlungsraum <strong>der</strong><br />
Inuit in <strong>der</strong> nordamerikanischen<br />
Arktis<br />
(verän<strong>der</strong>t nach:<br />
http://www.makivik.org/wpcontent/uploads/2010/1<br />
1/circumpolar_region.gif)<br />
völkerung verwandt. Dennoch bilden die Inuit keine homogene Bevölkerungsgruppe, was<br />
anges<strong>ich</strong>ts <strong>der</strong> Ausdehnung ihres Siedlungsraumes auch schwerl<strong>ich</strong> zu erwarten wäre. Inner-<br />
halb <strong>der</strong> gegenwärtig etwa 150.000 Menschen umfassenden Gruppe <strong>der</strong> Inuit existieren drei<br />
Großgruppen – die grönländischen, die kanadischen und die alaskischen Inuit – welche in<br />
s<strong>ich</strong> weiterhin unterteilt sind. In Grönland werden die Kalaallit in Westgrönland, die Inughuit<br />
in Nordwestgrönland und die Iit in Ostgrönland unterschieden, in Kanada die Inuit in Nuna-<br />
vut und auf <strong>der</strong> Halbinsel Labrador und die Inuvialuit am Mackenzie-Delta sowie in Alaska<br />
die Iñupiaq, die Yup’ik und die Alutiiq (vgl. NUTTALL 2005f:990f).<br />
Wie die übrigen indigenen Völker <strong>der</strong> Arktis stammen die Inuit ursprüngl<strong>ich</strong> aus Asien.<br />
Aufgrund archäologischer Funde sowie sprachl<strong>ich</strong>er und kultureller Merkmale werden ihre<br />
Wurzeln gegenwärtig nahe des Baikalsees in Sibirien bzw. mögl<strong>ich</strong>erweise in Zentralasien<br />
angenommen. Die Wan<strong>der</strong>ung nach Nordosten bis an die asiatische Küste des Beringmeeres<br />
und schließl<strong>ich</strong> die Überquerung <strong>der</strong> Beringstraße in R<strong>ich</strong>tung Alaska um 3000 v. Chr. wird<br />
als Reaktion auf Wan<strong>der</strong>ungsbewegungen <strong>der</strong> Wildtiere vermutet, welche infolge klimati-<br />
5 Nachdem die durch die Europäer von den Algonkin-Indianern übernommene Beze<strong>ich</strong>nung Eskimo (dt. ‚Rohfleischesser‘)<br />
zunehmend auf Vorbehalte stieß, sprach s<strong>ich</strong> die Inuit Circumpolar Conference (ICC) 1977 dafür<br />
aus, <strong>dass</strong> anstelle dieses Begriffes künftig die Beze<strong>ich</strong>nung Inuit zu verwenden sei. Sie wurde von den im nordostkanadischen<br />
Nunavut beheimateten Inuit übernommen, die diesen Namen bereits zuvor als Selbstbeze<strong>ich</strong>nung<br />
verwandten (vgl. NUTTALL 2005f:991).
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 24<br />
scher Verän<strong>der</strong>ungen aufkamen. Ziel war demnach das Erschließen neuer Jagdgründe. Zu-<br />
nächst beschränkte s<strong>ich</strong> die Besiedlung Nordamerikas durch die Inuit auf Alaska. Dort ent-<br />
stand um 2500 vor Christus die arktische Kleingerätetradition und es entwickelten s<strong>ich</strong> klei-<br />
nere Regionalkulturen. Zu den ältesten archäologischen Fundorten aus dieser Zeit gehört das<br />
am Point Hope in Nordwestalaska gelegene Ipiutak, eine mehr als 600 Häuser umfassende<br />
Siedlung <strong>der</strong> Norton-Kultur. Diese Kultur siedelte entlang des Beringmeeres und war auf die<br />
Jagd großer Meeressäuger spezialisiert. Um 1800 vor Christus entstand die Alte Beringmeer-<br />
Kultur, die durch eine hierarchische Gesellschaftsstruktur gekennze<strong>ich</strong>net war. Die Angehö-<br />
rigen dieser Kultur lebten in ständigen Siedlungen an <strong>der</strong> Küste <strong>der</strong> Beringstraße in Alaska<br />
und jagten sowohl Meeres- als auch Landsäugetiere. Als Fortbewegungsmittel nutzten sie im<br />
Winter Hundeschlitten und im Sommer Qajaq (Kajak; ein wendiges, mit Fellen bespanntes,<br />
geschlossenes Boot) und Umiak (ein hauptsächl<strong>ich</strong> von Frauen genutztes, mit Fellen be-<br />
spanntes, offenes Boot). Eine weitere frühe Inuitkultur war die ebenfalls nordalaskische<br />
Birnirk-Kultur. Diese Menschen lebten vor allem von <strong>der</strong> Karibujagd und vom Fischfang, ehe<br />
ein drastischer Rückgang <strong>der</strong> Karibupopulation eine Spezialisierung auf die Meeressäuger-<br />
jagd bewirkte. Insbeson<strong>der</strong>e die Kapitäne <strong>der</strong> Walfangboote und ebenso ihre Frauen genos-<br />
sen anges<strong>ich</strong>ts ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten beim Walfang ein hohes Ansehen inner-<br />
halb <strong>der</strong> Gesellschaft. Es wird angenommen, <strong>dass</strong> die Birnirk-Kultur die Norton-Kultur in Ipiu-<br />
tak nach einer Phase <strong>der</strong> Koexistenz letztl<strong>ich</strong> verdrängte. Zudem gilt sie als Vorläufer <strong>der</strong><br />
heutigen Iñupiaq in Alaska. Um 1000 nach Christus setzte eine erste expansive Besiedlungs-<br />
Abbildung 11: Besiedlung <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis durch die Inuit<br />
(http://www.mr-kartographie.de/uploads/pics/IHW5-Inuit.jpg)
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 25<br />
phase in den bis dahin unbevölkerten Teilen <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis ein (vgl. Abb.<br />
11). Damals besiedelten die Inuit den Nordrand Amerikas und drangen bis nach Québec und<br />
Labrador vor (vgl. NUTTALL 2005f:991f). Eine zweite expansive Phase leitete um 1200 die Thu-<br />
le-Kultur ein, <strong>der</strong>en Angehörige als ausnehmend gute Jäger auf dem Meer galten. Nachdem<br />
die Thule-Inuit zunächst die in Ostkanada ansässige Dorset-Kultur verdrängt hatten, besie-<br />
delten sie erst Nord- und Westgrönland, dann Ostgrönland (vgl. NUTTALL 2005f:991f). Ab etwa<br />
1700 zerfiel die Thule-Kultur jedoch in kleine, regionale Teilkulturen (vgl. THANNHEI-<br />
SER/WÜTHRICH 2002:176).<br />
Schon aufgrund <strong>der</strong> Weite des Siedlungsraumes mit einer Ost-West-Ausdehnung von<br />
mehreren Tausend Kilometern sind die traditionellen Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit vielfältig; über-<br />
greifende Eigenschaften, auf <strong>der</strong>en Grundlage ein allgemeines Bild traditioneller Inuit-Kultur<br />
geze<strong>ich</strong>net werden kann, sind dennoch vorhanden. Die folgenden Ausführungen bieten ei-<br />
nen querschnittartigen Überblick über jene traditionelle Lebensweise <strong>der</strong> Inuit; dies erfolgt<br />
jedoch dem Rahmen dieser Arbeit entsprechend in aller Kürze.<br />
Zunächst einmal stellen die Inuit eine „superbly adapted culture in what Europeans only<br />
saw a frozen wasteland“ (NUTTALL 2005f:992) dar. Ihre traditionelle Lebensgrundlage bildete<br />
die Fischerei sowie die in Gemeinschaften durchgeführte Jagd auf Karibus, Moschusochsen<br />
und Meeressäuger wie Robben, Wale und Walrosse. Die Jagd- und Fischereiaktivitäten <strong>der</strong><br />
Inuit hatten einen geregelten saisonalen Ablauf, <strong>der</strong> s<strong>ich</strong> zum einen aus den jährl<strong>ich</strong>en Wan-<br />
<strong>der</strong>ungsbewegungen <strong>der</strong> Tiere und zum an<strong>der</strong>en aus den Jagdtechniken <strong>der</strong> Inuit ergab. Als<br />
Beispiel sei hier <strong>der</strong> traditionelle Jahresablauf <strong>der</strong> im Westen <strong>der</strong> heutigen kanadischen Pro-<br />
vinz Nunavut ansässigen Netsilik-Inuit angeführt. Ihr Jagdjahr begann Mitte April mit <strong>der</strong><br />
Jagd auf Karibus, die zu dieser Zeit von Süden her in das Siedlungsgebiet <strong>der</strong> Netsilik zogen.<br />
In Abhängigkeit von <strong>der</strong> Größe <strong>der</strong> Herde, <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Jäger, den topographischen Gege-<br />
benheiten und den Schnee- und Eisverhältnissen wurde die Karibujagd entwe<strong>der</strong> vom Land<br />
aus mit Pfeil und Bogen o<strong>der</strong> aus dem Qajaq heraus mit <strong>der</strong> Harpune durchgeführt. Auch<br />
durch Schnee verdeckte Fallgruben kamen mitunter zum Einsatz. Wenn ab Anfang Juli das<br />
Meereis langsam schmolz, erlangten die Jagd auf Wasservögel und die Forellenfischerei Be-<br />
deutung für die Inuit. Die Forellen schwimmen im Juli und August in Schwärmen flussab-<br />
wärts R<strong>ich</strong>tung Meer. Um sie auf diesem Weg abzufangen, err<strong>ich</strong>teten die Netsilik von einem<br />
Ufer zum nächsten steinerne Fischwehre durch die Flüsse. Eine weitere Fischfangtechnik <strong>der</strong>
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 26<br />
Netsilik bestand in <strong>der</strong> Nutzung <strong>der</strong> Fischharpune. Sie wurde<br />
vor allem an felsigen Ufern von Seen und Flussmündungen<br />
angewandt. Hierbei stellte s<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Inuk in erhöhter Position<br />
auf einen Uferfelsen und ließ die Harpune ins Wasser hinun-<br />
ter schnellen. Mithilfe einer Leine konnte sie anschließend<br />
wie<strong>der</strong> hochgezogen werden. Im Winter war die Robben-<br />
jagd die vorherrschende Art <strong>der</strong> Nahrungsbeschaffung. Sie<br />
erfolgte hauptsächl<strong>ich</strong> an Eislöchern (vgl. Abb. 12), die die<br />
Tiere etwa alle zwanzig Minuten aufsuchen, um zu Atmen.<br />
Eine Robbe nutzt in <strong>der</strong> Regel mehrere Eislöcher, weshalb<br />
s<strong>ich</strong> die Gruppe <strong>der</strong> Jäger auf verschiedene, in relativer Nä-<br />
he zueinan<strong>der</strong> liegende Eislöcher verteilte. Die Jäger lauer-<br />
ten den Tieren dort mit einer Harpune auf und stießen<br />
schnell zu, sobald eine Robbe an das Loch kam (vgl. BALIKCI<br />
1970:23ff). Als Fortbewegungs- und Transportmittel während <strong>der</strong> Jagd wurden im Winter<br />
<strong>der</strong> Hundeschlitten sowie im Sommer Qajaq und Umiak genutzt, doch auch zu Fuß wurden<br />
oft weite Wege zurückgelegt (vgl. NUTTALL 2005f:992). THANNHEISER/WÜTHRICH (2002:176) stel-<br />
len bezügl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Jagdmethoden <strong>der</strong> Inuit fest: „Ein Inuk war als Jäger kaum ein reiner Spezi-<br />
alist, <strong>der</strong> in eine extrem enge ökologische Nische gedrängt war, son<strong>der</strong>n er überlebte viel-<br />
mehr durch die vielseitige Nutzung sämtl<strong>ich</strong>er vorhandener Nischen“. Hierzu gehört auch die<br />
vollständige Nutzung aller Teile eines erlegten Tieres. Während das Fleisch <strong>der</strong> Tiere generell<br />
als Nahrung für Mensch und Hund diente, wurden beispielweise bei einer Robbe zudem das<br />
Fell für den Bootsbau verwendet, die Sehnen als Angelschnüre genutzt und das Fett zur<br />
L<strong>ich</strong>t- und Wärmegewinnung verbrannt (vgl. NUTTALL 2005f:992).<br />
Abbildung 12: Inuk bei <strong>der</strong> Robbenjagd<br />
am Eisloch<br />
(BALIKCI 1970:76)<br />
Die Inuit lebten größtenteils in kleinen Gruppen als Nomaden. Diese setzten s<strong>ich</strong> aus<br />
mehreren Familien zusammen und hatten Stammescharakter (vgl. NUTTALL 2005f:992). Zu<br />
den grundlegenden Prinzipien des Zusammenlebens gehörten dabei drei Formen von Part-<br />
nerschaft: die Jagdgemeinschaft, das Teilen <strong>der</strong> vorhandenen Lebensmittel und <strong>der</strong> Frauen-<br />
tausch. Die Inuit jagten in festen Gruppen von dreizehn Männern. Die zwölf Jagdpartner<br />
suchten die Mütter für ihre Söhne aus, und zwar unmittelbar nach <strong>der</strong>en Geburt o<strong>der</strong> in <strong>der</strong><br />
frühen Kindheit. Die Beute wurde nach bestimmten Prinzipien unter den Jägern aufgeteilt.
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 27<br />
Eine Robbe beispielsweise wurde traditionell in vierzehn Teile zerlegt. Dies übernahm grund-<br />
sätzl<strong>ich</strong> die Frau des Jägers, <strong>der</strong> das jeweilige Tier erlegt hatte. Diesem Jäger stand <strong>der</strong> vier-<br />
zehnte Teil zu, welcher die Vor<strong>der</strong>flossen, den Rückenspeck, den Halsspeck und die Innerei-<br />
en umfasste. Die übrigen Teile wurden durch die Frau des Jägers nach einem festen Schema<br />
an die Frauen <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Jäger verteilt (vgl. BALKCI 1970:134f). Ein Teil des Fleisches eines<br />
jeden erlegten Tieres wurde eingelagert. Im Falle von Nahrungsmittelknappheiten wurde es<br />
dann unter allen aufgeteilt. Das Teilen gehörte zu den sozialen Grundprinzipien <strong>der</strong> Inuitge-<br />
sellschaften (vgl. BACK/GERMAIN/MORRISON 1996:87). „Das heißt n<strong>ich</strong>t, daß die Inuit eine Art<br />
‚Ur-Kommunismus‘ praktizierten, aber Großzügigkeit war ein absolutes soziales Muß“<br />
(BACK/GERMAIN/MORRISON 1996:87). Dem Frauentausch letztl<strong>ich</strong> als drittem Grundprinzip des<br />
Zusammenlebens <strong>der</strong> Inuit kam eine w<strong>ich</strong>tige Funktion für den Zusammenhalt <strong>der</strong> Gemein-<br />
schaft zu. Er erfolgte immer im gegenseitigen Einvernehmen <strong>der</strong> jeweiligen Ehemänner und<br />
galt insofern n<strong>ich</strong>t als Ehebruch. Der Zweck eines Frauentausches war oft praktischer Natur.<br />
Kam beispielweise ein Frem<strong>der</strong> ins Dorf, war er bestrebt mögl<strong>ich</strong>st bald mit einem <strong>der</strong> Dorf-<br />
bewohner die Frau zu tauschen. Auf diese Weise gewann er einen Fürsprecher und fand An-<br />
schluss an die Gemeinschaft. War die Frau eines Jägers schwanger und n<strong>ich</strong>t reisefähig, bot<br />
s<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Frauentausch ebenfalls als praktikable Lösung an. Ihr Mann ließ sie für die Zeit, die<br />
er auf Jagd ging, in <strong>der</strong> Obhut eines Freundes und lieh s<strong>ich</strong> im Gegenzug dessen Frau aus (vgl.<br />
BACK/GERMAIN/MORRISON 1996:54f).<br />
Des Weiteren prägten die animistischen religiösen Vorstellungen den Alltag <strong>der</strong> Inuit. Die-<br />
se besagen, <strong>der</strong> Luft sowie jedem Wesen und allen Dingen auf <strong>der</strong> Erde wohne ein bestimm-<br />
ter Geist inne, <strong>der</strong> das Schicksal <strong>der</strong> Menschen beeinflussen könne. Der jeweilige Schamane<br />
genoss daher hohes Ansehen innerhalb <strong>der</strong> einzelnen Gemeinschaften. Er galt als Vermittler<br />
zwischen Menschen und Geistern; ihm wurde die Fähigkeit zugesprochen, auf die Geister<br />
Einfluss zu nehmen. Zudem wurden religiöse Verbote und Rituale genau eingehalten, um die<br />
Geister <strong>der</strong> Tiere keinesfalls zu verletzen (vgl. NUTTALL 2005f:992). Als Beispiel sei hier <strong>der</strong><br />
Umgang mit einer erlegten Robbe genannt: Es war streng verboten, eine Robbe auf schmut-<br />
zigen Boden zu legen, denn es hieß, dies würde ihre Seele beleidigen. Daher musste zu-<br />
nächst frischer, sauberer Schnee in das Haus gebracht werden, worauf die Robbe gelegt<br />
werden konnte. Weiterhin existierte die Vorstellung, auch eine tote Robbe sei durstig. Es<br />
wurde deshalb Wasser für sie bereitgestellt. Durch diese Gesten sollte die Robbe dabei un-
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 28<br />
terstützt werden, im Körper einer an<strong>der</strong>en Robbe wie<strong>der</strong>geboren zu werden. Gle<strong>ich</strong>zeitig<br />
erhoffte man s<strong>ich</strong>, <strong>dass</strong> das Tier s<strong>ich</strong> dann erkenntl<strong>ich</strong> zeigen würde, indem es s<strong>ich</strong> erneut<br />
von demselben Jäger erlegen ließ (vgl. BALIKCI 1970:218f).<br />
Während die Inuit den Sommer über<br />
durchs Land zogen und in Zelten aus Tier-<br />
häuten lebten, wurden für den Winter se-<br />
mipermanente Siedlungen err<strong>ich</strong>tet. In Europa ist dies-<br />
bezügl<strong>ich</strong> die Vorstellung sehr verbreitet, <strong>dass</strong> die Inuit<br />
traditionell in Iglus lebten, wobei unter einem solchen<br />
Iglu ein Haus aus Schnee und Eisblöcken verstanden<br />
wird. Tatsächl<strong>ich</strong> bedeutet <strong>der</strong> Begriff ‚Iglu‘ übersetzt<br />
ganz allgemein ‚Haus‘ und besagtes Schneehaus war<br />
eher ein Son<strong>der</strong>fall unter den architektonischen Leistun-<br />
gen <strong>der</strong> Inuit. Es war vor allem in Ostkanada verbreitet<br />
und diente dort als provisorische Unterkunft auf langen<br />
Winterreisen. „Wie vieles in <strong>der</strong> Inuit-Kultur war es ein<br />
Notbehelf: äußerst zweckmäßig […] und doch aus fast<br />
n<strong>ich</strong>ts gemacht“ (BACK/GERMAIN/MORRISON 1996:34). Es<br />
wurde kuppelförmig und mit einem langen Eingangs-<br />
tunnel gebaut. Dieser Tunnel wurde im rechten Winkel zur Hauptwindr<strong>ich</strong>tung und niedriger<br />
als <strong>der</strong> Rest des Hauses err<strong>ich</strong>tet; er führte somit von schräg unten in den Hauptraum. Da<br />
kalte Luft absinkt und warme aufsteigt, wurde <strong>der</strong> Hauptraum auf diese Weise zu einer<br />
Wärmefalle. Für L<strong>ich</strong>t im Inneren des Schneehauses sorgte ein Fenster aus einem Süßwas-<br />
sereisblock. Im Regelfall jedoch wurden die Winterhäuser aus dauerhaften Materialen wie<br />
Stein, Treibholz und Erde gebaut. Hierbei werden zwei Typen unterschieden: das in <strong>der</strong><br />
nordamerikanischen Ostarktis verbreitete Steinhaus und das westarktische Holzhaus (vgl.<br />
Abb. 13). Das Steinhaus wurde halbunterirdisch aus einer Doppelsch<strong>ich</strong>t von Steinen err<strong>ich</strong>-<br />
tet, <strong>der</strong>en Zwischenraum mit Torf und Erde ausgefüllt wurde. Das Holzhaus war ein großes<br />
Mehrfamilienhaus mit einem zentralen Wohnraum und radial daran angebauten, erhöhten<br />
Schlafalkoven. Wie das Schneehaus verfügten auch das Holz- und das Steinhaus über den<br />
langen, niedrigen Eingangstunnel (vgl. BACK/GERMAIN/MORRISON 1996:34f).<br />
a) Holzhaus<br />
c) Schneehaus<br />
b) Steinhaus<br />
Abbildung 13: Traditionelle Häuser <strong>der</strong><br />
Inuit<br />
(BACK/GERMAIN/MORRISON 1996: a) 35; b)<br />
34; c) 36)
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 29<br />
Zum Ende des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts hin und vor allem im Laufe des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts vollzog<br />
s<strong>ich</strong> in den Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit ein grundlegen<strong>der</strong> soziokultureller Wandel, <strong>der</strong><br />
weitgehend alle Lebensbere<strong>ich</strong>e betraf. Auslöser hierfür waren neben einem verstärkten<br />
Kontakt mit den Qallunaat (n<strong>ich</strong>t-Inuit) Nordamerikas vor allem staatl<strong>ich</strong>e Programme in<br />
Kanada und Grönland, die die Umsiedlung <strong>der</strong> Inuit in dauerhafte, feste Siedlungen<br />
veranlassten (vgl. NUTTALL 2005f:992ff). Der Zusammenbruch des Pelzhandels in den 1940er<br />
Jahre brachte zahlre<strong>ich</strong>e Inuit in die Abhängigkeit <strong>der</strong> staatl<strong>ich</strong>en Wohlfahrtssysteme und<br />
gle<strong>ich</strong>zeitig verstärkte Kanada seine Bemühungen, durch Missionierung, staatl<strong>ich</strong>en<br />
Schulunterr<strong>ich</strong>t und eine rechtl<strong>ich</strong>e Begrenzung <strong>der</strong> Selbstversorgungsaktivitäten die<br />
indigenen Traditionen zu unterwan<strong>der</strong>n (vgl. HUHNDORF 2009:84). In Kapitel 3.5 erfolgt eine<br />
ausführl<strong>ich</strong>e Darstellung dieser <strong>der</strong> Auswirkungen dieser Entwicklungen.<br />
3.3 Streben nach Selbstbestimmung: <strong>der</strong> Autonomieprozess<br />
Mit Ende des Zweiten Weltkrieges und insbeson<strong>der</strong>e seit den 1960er Jahren setzte auf<br />
Seiten <strong>der</strong> Inuit ein s<strong>ich</strong> allmähl<strong>ich</strong> verstärkendes Streben nach Selbstbestimmung und spä-<br />
ter auch nach Selbstverwaltung ein. „Colonization, oppression, dispossession, disease, and<br />
assimilation of indigenous peoples by settlers and nation states“ benennt KAALHAUGE NIELSEN<br />
(2005b:1876) als ausschlaggebende Gründe für die vielfältigen Autonomiebewegungen, wel-<br />
che mittlerweile einige Erfolge vorzuweisen haben. Zwar ist bisher in keinem <strong>der</strong> Inuit-<br />
Territorien ein unabhängiger Nationalstaat gegründet worden, was KAALHAUGE NIELSEN (vgl.<br />
2005b:1877) in <strong>der</strong> engen Verknüpfung von Eigenständigkeit und Nachhaltigkeit begründet<br />
sieht: Dem Erre<strong>ich</strong>en vollständiger Unabhängigkeit müssten demnach weitre<strong>ich</strong>ende Fort-<br />
schritte in wirtschaftl<strong>ich</strong>er und sozialer Hins<strong>ich</strong>t vorausgehen. Allerdings existiert heute ein<br />
breites Spektrum von Selbstverwaltungsformen, die jeweils unterschiedl<strong>ich</strong>e Grade an Auto-<br />
nomie aufweisen.<br />
Hjemmestyre und Selvstyre in Grönland<br />
Unter den einzelnen Inuit-Territorien in <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis ist Grönland heute<br />
dasjenige, welches über die weitre<strong>ich</strong>endste Autonomie verfügt. Als autonome Provinz
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 30<br />
innerhalb des Königre<strong>ich</strong>es Dänemark verwaltet es s<strong>ich</strong> zu großen Teilen selbstständig 6 .<br />
Das zuvor von Norwegen kontrollierte Grönland geriet bereits ab 1380 über die dänisch-<br />
norwegische Personalunion unter dänischen Einfluss (vgl. VEITER 1990:10), <strong>der</strong> s<strong>ich</strong> dort in<br />
den folgenden Jahrhun<strong>der</strong>ten vornehml<strong>ich</strong> durch Handel und Missionsdienste bemerkbar<br />
machte (vgl. IRLBACHER FOX 2005:1881). Dänemark glie<strong>der</strong>te Grönland damals ebenso wie<br />
Island und die Färöer als Kolonie in sein Re<strong>ich</strong> ein. Im Jahr 1747 wurde Grönland schließl<strong>ich</strong><br />
offiziell zum dänischen Protektorat erklärt. Damit ging das alleinige Handelsrecht von <strong>der</strong><br />
norwegischen Bergen-Kompagnie auf die Köngl<strong>ich</strong>e Dänische Handelsgesellschaft über,<br />
bevor 1766 mit <strong>der</strong> Kongelik Grønlandske Handel eine eigene Monopolhandelsgesellschaft<br />
für den Grönlandhandel geschaffen wurde (vgl. VEITER 1990:10). Im Jahr 1782 weitete<br />
Dänemark das Handelsmonopol dahingehend aus, <strong>dass</strong> Grönland vollständig vom übrigen<br />
europäischen Markt abgekoppelt wurde. Auf diese Weise sollte zum einen <strong>der</strong> alleinige<br />
dänische Zugriff auf grönländische Rohstoffe ges<strong>ich</strong>ert und zum an<strong>der</strong>en <strong>der</strong> Schutz <strong>der</strong><br />
grönländischen Inuit vor mögl<strong>ich</strong>er wirtschaftl<strong>ich</strong>er Ausbeutung gewährleistet werden (vgl.<br />
THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:190). Auch nach <strong>der</strong> Auflösung <strong>der</strong> dänisch-norwegischen<br />
Personalunion im Kieler Frieden 1814 verblieb das Hoheitsrecht über Grönland beim<br />
Königre<strong>ich</strong> Dänemark (vgl. VEITER 1990:10).<br />
Zu einer ersten wesentl<strong>ich</strong>en Verän<strong>der</strong>ung dieser Verhältnisse führte die dänische<br />
Verfassungsreform von 1953, bei <strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Kronkolonie Grönland eine dänische Provinz<br />
mit lokaler Selbstverwaltung wurde und die grönländischen Inuit Anerkennung als dänische<br />
Staatsbürger erlangten (vgl. IRLBACHER FOX 2005:1881). Daneben wurde Grönland nun durch<br />
zwei in allgemeinen Wahlen gewählte Abgeordnete im Folketinget, dem dänischen<br />
Parlament, vertreten. VEITER (1990:11) merkt hierzu allerdings an, <strong>dass</strong> die Wahlen in<br />
Grönland auf geringes Interesse stießen und die Wahlbeteiligung entsprechend niedrig<br />
ausfiel. Zurückzuführen sei dies in erster Linie auf das Fehlen politischer Parteien und<br />
organisierter Wahlwerbung sowie auf die beträchtl<strong>ich</strong>en Distanzen zwischen den einzelnen<br />
6 Der dänische Begriff Hjemmestyre als Beze<strong>ich</strong>nung für die grönländische Autonomie von 1978 bedeutet wörtl<strong>ich</strong><br />
übersetzt etwa heimische Regierung (entsprechend <strong>der</strong> englischen Übersetzung Home Rule), wird aber in<br />
<strong>der</strong> deutschsprachigen Literatur zumeist mit Selbstverwaltung o<strong>der</strong> Selbstregierung übersetzt. Mit <strong>der</strong> Reform<br />
<strong>der</strong> grönländischen Autonomie im Jahr 2009 wurde allerdings, um den qualitativen Unterschied zur vorherigen<br />
Regelung hervorzuheben, auch die offizielle Beze<strong>ich</strong>nung von Hjemmestyre in Selvstyre geän<strong>der</strong>t, wobei Selvstyre<br />
nun wörtl<strong>ich</strong> übersetzt tatsächl<strong>ich</strong> Selbstregierung bedeutet. Der begriffl<strong>ich</strong>e Unterschied wäre somit im<br />
Deutschen n<strong>ich</strong>t erkennbar. Um einer Verwechselung <strong>der</strong> beiden Etappen <strong>der</strong> grönländischen Autonomie vorzubeugen,<br />
werden daher im Folgenden die dänischen Begriffe Hjemmestyre bzw. Selvstyre verwandt.
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 31<br />
Orten. In <strong>der</strong> Hoffnung, die Wahlbeteiligung durch einen stärkeren regionalen Bezug zu<br />
erhöhen, wurde Grönland 1974 in zwei Wahlkreise aufgeteilt, Südgrönland einerseits sowie<br />
Nord- und Ostgrönland an<strong>der</strong>erseits, die fortan je einen Abgeordneten stellten. Überdies<br />
wurde mit besagter Verfassungsän<strong>der</strong>ung von 1953 ein Provinzialrat in Grönland<br />
einger<strong>ich</strong>tet, <strong>der</strong> jedoch ledigl<strong>ich</strong> exekutive, aber keine legislative Gewalt inne hatte. Ein<br />
Gouverneur, <strong>der</strong> gemäß den rechtl<strong>ich</strong>en Bestimmungen Däne sein musste, wurde als<br />
Vertreter <strong>der</strong> dänischen Krone nach Grönland entsandt. Der Gouverneur saß bis 1967 dem<br />
Provinzialrat vor und kontrollierte somit die grönländische Verwaltungsordnung.<br />
Anschließend wurde <strong>der</strong> Vorsitzende des Provinzialrates aus dessen Reihen gewählt, <strong>der</strong><br />
Gouverneur behielt jedoch das Recht, s<strong>ich</strong> in die Ratsdebatten einzuschalten (vgl. VEITER<br />
1990:11f).<br />
VEITER (1990:13) führt aus: „wie die Dinge bis zum 1. Mai 1979 7 lagen [,] [kann] man n<strong>ich</strong>t<br />
von mehr als reinen Ansätzen zu einer Autonomie sprechen“. Jedoch kamen bereits seit den<br />
1960er Jahren erste, wenn auch schleppende Initiativen des Wi<strong>der</strong>standes gegen die<br />
dänische Herrschaft und Bevormundung auf. Dies drückt s<strong>ich</strong> unter an<strong>der</strong>em in <strong>der</strong> 1963<br />
erfolgten Gründung <strong>der</strong> Inuit-Partei als erster politischer Partei Grönlands aus.<br />
Ausschlaggeben<strong>der</strong> Anlass hierfür war das sogenannte ‚Geburtsortkriterium‘ (dän.<br />
Fødestedskriteriet), das in einem Gesetz über die Besoldung grönländischer Beamter<br />
festgeschrieben wurde. Es besagt, <strong>dass</strong> in Grönland geborene Staatsbeamte im Vergle<strong>ich</strong> zu<br />
solchen, die außerhalb Grönlands geboren wurden, ledigl<strong>ich</strong> 85% des Lohnes bekommen<br />
sollten. Die Inuit-Partei setzte s<strong>ich</strong> in diesem Zusammenhang für die Gle<strong>ich</strong>berechtigung <strong>der</strong><br />
Grönlän<strong>der</strong> innerhalb des dänischen Staates ein. Ab 1967 wurde überdies die For<strong>der</strong>ung<br />
nach vollständiger Unabhängigkeit Grönlands Teil ihres Parteiprogrammes. 1969 erfolgte<br />
durch den grönländischen Folketing-Abgeordneten Knud Hertling die Gründung einer<br />
zweiten Partei in Grönland, <strong>der</strong> Sukaq-Partei. Sie vertrat gegenüber <strong>der</strong> Inuit-Partei eine<br />
gemäßigtere Position und plädierte für eine grönländische Selbstverwaltung. Beide Parteien<br />
konnten s<strong>ich</strong> jedoch zu dieser Zeit noch n<strong>ich</strong>t in <strong>der</strong> breiten Masse <strong>der</strong> grönländischen<br />
Bevölkerung durchsetzen (vgl. FÆGTEBORG 2005b:1003). Breiteren Rückhalt erhielten die<br />
For<strong>der</strong>ungen nach mehr Autonomie durch die s<strong>ich</strong> verstärkenden, län<strong>der</strong>übergreifenden<br />
Bestrebungen zum Schutz <strong>der</strong> Rechte und <strong>der</strong> Kultur <strong>der</strong> Inuit. So fand im November 1973<br />
7 Am 1. Mai 1979 trat die grönländische Hjemmestyre in Kraft.
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 32<br />
mit <strong>der</strong> Arctic Peoples‘ Conference die erste von den indigenen Völkern <strong>der</strong> Arktis bezügl<strong>ich</strong><br />
ihrer Belange und Interessen organisierte Konferenz statt. Auch verschiedene Vertreter <strong>der</strong><br />
grönländischen Inuit nahmen hieran teil. Aus <strong>der</strong> Arctic Peoples‘ Conference ging unter<br />
an<strong>der</strong>em die 1977 gegründete Inuit Circumpolar Conference (ICC) hervor, die s<strong>ich</strong> seither als<br />
zentrale, multilaterale Organisation <strong>der</strong> Inuit für <strong>der</strong>en Rechte und den Fortbestand ihrer<br />
Kultur einsetzt. Diese Tendenzen för<strong>der</strong>ten die Herausbildung eines kollektiven Bewusstseins<br />
unter den Inuit und stärkten somit das Streben nach Autonomie (vgl. WEEN 2005a:141f).<br />
Fernerhin rief <strong>der</strong> Beitritt Dänemarks zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1973<br />
in Grönland Protest hervor. Im Vorfeld hierzu hatte 1972 ein Referendum über den Beitritt<br />
stattgefunden, in dem s<strong>ich</strong> die Grönlän<strong>der</strong> mit 70,3% <strong>der</strong> Stimmen dagegen aussprachen.<br />
Ungeachtet dessen wurde Grönland im darauffolgenden Jahr als Teil Dänemarks EWG-<br />
Mitglied. Als Reaktion hierauf wurde schließl<strong>ich</strong> eine Kommission gegründet, die eine<br />
grönländische Hjemmestyre vorbereiten sollte (vgl. FÆGTEBORG 2005a:786). In <strong>der</strong> Folgezeit<br />
gründeten s<strong>ich</strong> auch jene Parteien, die bis heute das politische Geschehen in Grönland<br />
bestimmen, die liberale Atassut, die sozialdemokratische Siumut und die sozialistische Inuit<br />
Ataqagiit (vgl. FÆGTEBORG 1998:38f).<br />
Das Gesetz Nr. 577(1978) über die Hjemmestyre Grönlands<br />
wurde am 29. November 1978 vom Folketing verabschiedet<br />
und trat am 1. Mai 1979 in Kraft (vgl. FÆGTEBORG 2005a:786),<br />
nachdem es im Januar 1979 von den Grönlän<strong>der</strong>n mit einer<br />
Zustimmung von 70% <strong>der</strong> Stimmen per Referendum bestätigt<br />
worden war (vgl. VEITER 1990:13). Die einleitenden Paragraphen<br />
dieses Gesetzes bestimmen die Grundzüge <strong>der</strong> grönländischen<br />
Hjemmestyre wie folgt:<br />
„§ 1. Grønland udgør et særligt folkesamfund inden for det danske rige. Det grønlandske hjemmestyre va-<br />
retager inden for rigsenhedens rammer grønlandske anliggen<strong>der</strong> efter reglerne i denne lov.<br />
Stk. 2. Det grønlandske hjemmestyre består af en i Grønland valgt repræsentation, <strong>der</strong> benævnes landstin-<br />
get, og en forvaltning, <strong>der</strong> ledes af et landsstyre.<br />
Abbildung 14: Flagge und<br />
Wappen Grönlands<br />
(http://www.mapsofworld.com<br />
/flags/greenland-flag.html;<br />
http://dk.nanoq.gl/)<br />
§ 2. Landstingets medlemmer vælges for 4 år ved almindelige, direkte og hemmelige valg. […]
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 33<br />
§ 3. Landstinget vælger landsstyrets formand og de øvrige medlemmer af landsstyret. Landsstyrets formand<br />
fordeler forretningerne mellem landsstyrets medlemmer“ 8 (DANMARKS STATSMINISTERIET 1978:1).<br />
Die grönländische Hjemmestyre (grönl. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqar-<br />
tussat) umfasst somit ein für vier Jahre gewähltes Parlament, den Landsting, sowie eine von<br />
<strong>der</strong> Landesregierung (Landsstyre) geführte Administration, <strong>der</strong> <strong>der</strong> Premierminister (Lands-<br />
styreformand) vorsteht. Ein Re<strong>ich</strong>sombudsmann vertritt den dänischen Staat in Grönland.<br />
Des Weiteren wurde Grönland im Zuge <strong>der</strong> Selbstverwaltung administrativ in achtzehn<br />
Kommunen unterglie<strong>der</strong>t, die die Zuständigkeit für das Sozialwesen, die örtl<strong>ich</strong>e Verwaltung<br />
sowie für Bildungseinr<strong>ich</strong>tungen und die Bere<strong>ich</strong>e Kultur und Sport innehaben. Zwecks <strong>der</strong><br />
Vertretung <strong>der</strong> Anliegen <strong>der</strong> Kommunen gegenüber <strong>der</strong> Landesregierung, haben s<strong>ich</strong> diese<br />
wie<strong>der</strong>um in dem Gemeindebund KANUKOKA zusammengeschlossen (vgl. FÆGTEBORG<br />
2005a:786f). Die Befugnisse <strong>der</strong> Hjemmestyre gemäß dem Gesetz von 1978 umfassen fol-<br />
gende innere Angelegenheiten Grönlands: die grönländische Verwaltungsordnung; die Ver-<br />
waltungsordnung <strong>der</strong> Kommunen; Steuern und Abgaben; die evangelisch-lutherische Volks-<br />
kirche und hiervon abwe<strong>ich</strong>ende Glaubensgemeinschaften; die Fischerei innerhalb <strong>der</strong> eige-<br />
nen Hoheitsgewässer, Jagd, Landwirtschaft und Rentierzucht; Denkmalschutz; Landespla-<br />
nung; übrige wirtschaftl<strong>ich</strong>e Angelegenheiten, darunter die staatl<strong>ich</strong> kontrollierte Fischerei<br />
und <strong>der</strong>en Produkte, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung und Wirtschaftsentwicklung; Sozialwesen; Maß-<br />
nahmen bezügl<strong>ich</strong> des Arbeitsmarktes; Bildung, Berufsausbildung und Kultur; Gesetzgebung<br />
bezügl<strong>ich</strong> des Wettbewerbs und des Handels, einschließl<strong>ich</strong> des Gaststätten- und Hotelge-<br />
werbes, Bestimmungen für alkoholhaltige Getränke und Ladenschlussregelungen; Gesund-<br />
heitswesen; Mietgesetzgebung, Mietzuschüsse und Verwaltung <strong>der</strong> Wohngebäude; Güter-<br />
versorgung; interner Personen- und Gütertransport sowie den Umweltschutz (vgl. DANMARKS<br />
STATSMINISTERIET 1978:4f). Wenngle<strong>ich</strong> die Zuständigkeit für die Außen- und S<strong>ich</strong>erheitspolitik<br />
inklusive Polizei und Justiz beim dänischen Staat verbleibt, wird <strong>der</strong> grönländischen Regie-<br />
rung die Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Organisationen gewährt. So<br />
8 „§ 1. Grönland macht eine beson<strong>der</strong>e Volksgruppe innerhalb des dänischen Re<strong>ich</strong>es aus. Die grönländische<br />
Hjemmestyre nimmt im Rahmen <strong>der</strong> Re<strong>ich</strong>seinheit grönländische Anliegen nach den Regelungen dieses Gesetzes<br />
wahr. Abs. 2. Die grönländische Hjemmestyre besteht aus einer in Grönland gewählten Vertretung, genannt<br />
Landstinget, und einer Verwaltung, die von einer Landesregierung geführt wird. § 2. Die Mitglie<strong>der</strong> des Landstinges<br />
werden für vier Jahre durch allgemeine, direkte und geheime Wahl gewählt. […] § 3. Der Landsting<br />
wählt den Vorsitzenden <strong>der</strong> Landesregierung und die übrigen Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Landesregierung. Der Vorsitzende<br />
<strong>der</strong> Landesregierung verteilt die Geschäftsbere<strong>ich</strong>e unter den Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Landesregierung“ (eigene Übersetzung).
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 34<br />
steht sie in engem Kontakt mit <strong>der</strong> ICC und seit 1984 ist Grönland durch zwei gewählte Ab-<br />
geordnete im Nordischen Rat, dem parlamentarischen Organ für die offizielle Zusammenar-<br />
beit <strong>der</strong> nordischen Län<strong>der</strong>, vertreten. Zudem verließ es nach erneuter Volksabstimmung<br />
1985 die EG, mit <strong>der</strong> es seither im Rahmen eines Abkommens für überseeische Län<strong>der</strong> und<br />
Territorien kooperiert. Dieses Abkommen ermögl<strong>ich</strong>t einerseits den EG-Staaten weiterhin<br />
die Nutzung <strong>der</strong> grönländischen Fischgründe und an<strong>der</strong>erseits Grönland mit seinen Fische-<br />
rei-Produkten freien Zugang zum europäischen Markt (vgl. FÆGTEBORG 2005a:786f).<br />
VEITER (vgl. 1990:26) nimmt eine Beur-<br />
teilung dieser Gesetzgebung von 1978 vor<br />
und stellt dabei insbeson<strong>der</strong>e den in § 1<br />
festgeschriebenen Schutz <strong>der</strong> Grönlän<strong>der</strong><br />
als Volksgruppe im Vergle<strong>ich</strong> zu an<strong>der</strong>en<br />
Autonomiegesetzgebungen als positiv her-<br />
aus. Unterstützt wird diese Regelung durch<br />
§ 9, <strong>der</strong> festlegt, <strong>dass</strong> „det grønlandske<br />
sprog er hovedsproget“ 9 (DANMARKS STATS-<br />
MINISTERIET (Hrsg.) 1978:2). Dänisch sei zwar<br />
ebenfalls zu lehren, beide Sprachen fungie-<br />
ren aber gle<strong>ich</strong>berechtigt als Amtsspra-<br />
chen. Die Einschätzung Isi FOIGHELs, <strong>der</strong>zu-<br />
folge an <strong>der</strong> grönländischen Autonomie<br />
„keinerlei Mangel erkennbar wäre“ (VEITER<br />
Abbildung 15: Grönlandkarte<br />
(http://www.esm.rochester.edu/organ/Greenland/Image<br />
s/Map-Large.jpg)<br />
1990:27), will VEITER jedoch n<strong>ich</strong>t teilen. Er stellt zwar fest, insgesamt könne s<strong>ich</strong> „die grön-<br />
ländische Autonomie im internationalen Vergle<strong>ich</strong> sehr wohl sehen lassen“ (VEITER 1990:28),<br />
merkt jedoch in Anlehnung an die dänischen Verfassungsrechtler MAX SØRENSEN und FREDERIK<br />
HARHOFF kritisch an, <strong>dass</strong> „die Grönlän<strong>der</strong> wie die Färinger als ‚Völker‘ (peoples) im Sinne <strong>der</strong><br />
UNO-Charta anzusehen sind und daher das Recht auf volle Selbstbestimmung hätten, das<br />
ihnen aber von Dänemark unverän<strong>der</strong>t vorenthalten wurde“ (VEITER 1990:27f). Auch von<br />
grönländischer Seite wurden vermehrt For<strong>der</strong>ungen nach externem Selbstbestimmungsrecht<br />
(vgl. VEITER 1990:27) o<strong>der</strong> zumindest weitre<strong>ich</strong>en<strong>der</strong>en Befugnissen in <strong>der</strong> Außen- und Si-<br />
9 „Die grönländische Sprache ist die Hauptsprache“ (eigene Übersetzung).
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 35<br />
cherheitspolitik laut. Dänemark nahm s<strong>ich</strong> letztl<strong>ich</strong> dieser Kritik an und rief eine Kommission<br />
ins Leben, die Mögl<strong>ich</strong>keiten ausloten sollte, wie Grönland diese zusätzl<strong>ich</strong>e Autonomie ge-<br />
währt werden könne, allerdings ohne, <strong>dass</strong> es vollständig unabhängig von Dänemark würde.<br />
Die Arbeit <strong>der</strong> Kommission endete 2003 und führte letztl<strong>ich</strong> zu dem Gesetz Nr. 473(2009)<br />
über die Selvstyre Grönlands vom 12. Juni 2009 (vgl. FÆGTEBORG 2005a:786f).<br />
Die neue Qualität <strong>der</strong> grönländischen Autonomie, die dieses Gesetz bewirkt, kommt be-<br />
reits in <strong>der</strong> Präambel zum Ausdruck. Dort heißt es: „I erkendelse af, at det grønlandske folk<br />
er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om<br />
at fremme ligeværdighed og gensidig respekt i partnerskabet mellem Danmark og Grøn-<br />
land“ 10 (DANMARKS STATSMINISTERIET 2009:1). Grönland bleibt zwar Teil des dänischen Re<strong>ich</strong>es,<br />
wird aber von nun an als völkerrechtl<strong>ich</strong> zur Selbstbestimmung berechtigter Partner auf Au-<br />
genhöhe wahrgenommen und respektiert. Daneben besteht eine bedeutende Neuerung in<br />
<strong>der</strong> vollständigen Übertragung <strong>der</strong> Legislative und <strong>der</strong> Jurisdiktion an das Parlament und die<br />
Ger<strong>ich</strong>te <strong>der</strong> grönländische Selvstyre, die damit in geteilter Form über alle drei Gewalten<br />
verfügt (§ 1). Die Zahl <strong>der</strong> Kommunen wurde durch Zusammenlegungen von achtzehn auf<br />
vier reduziert. Zudem wurde die grönländische Sprache zur alleinigen Amtssprache Grön-<br />
lands erklärt (§ 20). Fernerhin kann die grönländische Regierung fortan in eigenen Belangen<br />
außenpolitisch agieren (§§ 11-16). Auch die Verfügungsgewalt über die Rohstoffe und die<br />
damit erzielten wirtschaftl<strong>ich</strong>en Gewinne liegt auf Seiten Grönlands (§ 7). Selbst die Mög-<br />
l<strong>ich</strong>keit einer vollständigen Unabhängigkeit Grönlands wurde mit § 21 eingeräumt; über die-<br />
se habe das grönländische Volk zu entscheiden (vgl. DANMARKS STATSMINISTERIET 2009:1ff).<br />
1953<br />
Grönland<br />
wird<br />
dänische<br />
Provinz<br />
1978/<br />
1979<br />
Grönlands<br />
Hjemmestyre<br />
2009<br />
Abbildung 16: Entwicklungsschritte <strong>der</strong> grönländischen Autonomie (eigene Darstellung)<br />
Grönlands<br />
Selvstyre<br />
10 „In Anerkennung dessen, <strong>dass</strong> das grönländische Volk ein Volk in Bezug auf das Völkerrecht mit dem Recht<br />
auf Selbstbestimmung ist, gründet das Gesetz auf dem Wunsch, die Gle<strong>ich</strong>wertigkeit und den gegenseitigen<br />
Respekt in <strong>der</strong> Partnerschaft zwischen Dänemark und Grönland zu för<strong>der</strong>n“ (eigene Übersetzung).
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 36<br />
Nunavut: ‚Unser Land‘<br />
Das heutige kanadische Territorium Nunavut erstreckt s<strong>ich</strong> über die nördl<strong>ich</strong>e und östli-<br />
che kanadische Arktis. Teile dieses Gebietes gerieten erstmals 1576 unter fremde Herrschaft,<br />
als MARTIN FROBISHER auf <strong>der</strong> Baffin Insel anlandete und diese für England beschlagnahmte.<br />
Vor allem im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t eroberte Großbritannien im Zuge <strong>der</strong> Suche nach einer Nord-<br />
West-Passage durch die arktische See zahlre<strong>ich</strong>e weitere Gebiete des arktischen Archipels,<br />
nachdem es zuvor schon in Konkurrenz zu Frankre<strong>ich</strong> starken Einfluss auf weite Teile des<br />
heutigen kanadischen Staatsgebietes gewonnen hatte. Im Jahr 1867 wurde Kanada schließ-<br />
l<strong>ich</strong> britisches Dominion und erwarb als solches drei Jahre später Rupert’s Land, das Kern-<br />
land des heutigen Nunavut, von Großbritannien. Die Souveränität über den übrigen arkti-<br />
schen Archipel wurde 1880 von Großbritannien an Kanada übertragen. Von nun an stand das<br />
Gebiet Nunavuts vollständig unter kanadischer Oberhoheit, die in erster Linie durch die Ro-<br />
yal Canadian Mounted Police vertreten wurde. Sie führte ab 1903 regelmäßige Besuche <strong>der</strong><br />
Inuit-Siedlungen und <strong>der</strong> amerikanischen Walfang-Nie<strong>der</strong>lassungen durch, wenngle<strong>ich</strong> den<br />
Inuit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges von Seiten des kanadischen Staates in politischer<br />
Hins<strong>ich</strong>t kaum Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde. Während des Krieges err<strong>ich</strong>tete<br />
die US-Armee militärische Stützpunkte in <strong>der</strong> kanadischen Arktis, was mittelbar dazu führte,<br />
<strong>dass</strong> die amerikanische und kanadische Presse vermehrt auf die Inuit und ihre damals deso-<br />
late Lebenssituation aufmerksam wurde. Der Nie<strong>der</strong>gang des Pelzhandels in den 1930er und<br />
1940er Jahren hatte zum wirtschaftl<strong>ich</strong>en Zusammenbruch vieler Inuit-Siedlungen geführt.<br />
Die kanadische Regierung reagierte in den 1950er Jahren auf das Bekanntwerden dieser<br />
Problematik mit einem Umsiedlungs- und Integrationsprogramm. Im Zuge dessen wurden<br />
die nordkanadischen Inuit in feste Siedlungen umgesiedelt, die s<strong>ich</strong> zumeist in räuml<strong>ich</strong>er<br />
Nähe zu alten Handelsnie<strong>der</strong>lassungen <strong>der</strong> Hudson’s Bay Company befanden. Dort wurden<br />
sie dann über soziale Wohlfahrtsprogramme mit Nahrungsmitteln, Geld und Bildung ver-<br />
sorgt. Es wurden Häuser und Krankenstationen gebaut und Schulen err<strong>ich</strong>tet, in denen die<br />
Kin<strong>der</strong> Englisch lernten (vgl. LÉGARÉ 2005:1526f). LÉGARÉ (2005:1527) stellt bezügl<strong>ich</strong> dieser<br />
Maßnahmen fest: „With the goal of improving Inuit health and education, the government<br />
integrated the Inuit into Canadian mainstream society“.<br />
Resultierend aus dem beschriebenen Integrationsprogramm entwickelte s<strong>ich</strong> in den<br />
1960er Jahren unter den Inuit Nordkanadas eine kleine politische Elite, die zwar einerseits
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 37<br />
eine den kanadischen Maßstäben entsprechende Erziehung und Bildung erfahren hatte, an-<br />
<strong>der</strong>erseits aber auch noch in den alten Inuit-Traditionen verwurzelt war. Anges<strong>ich</strong>ts <strong>der</strong> ne-<br />
gativen Begleiterscheinungen des Regierungsprogrammes – Trennung vom ursprüngl<strong>ich</strong>en<br />
Siedlungsland, Entfremdung von Traditionen sowie Abhängigkeit von staatl<strong>ich</strong>en Sozialleis-<br />
tungen – fanden s<strong>ich</strong> in den frühen 1970er Jahren einige Mitglie<strong>der</strong> dieser Gruppe zusam-<br />
men, mit dem Ziel, die Verantwortung für das Leben <strong>der</strong> Inuit und dessen Gestaltung wie<strong>der</strong><br />
zurück in die Hände <strong>der</strong> Inuit zu legen (vgl. LÉGARÉ 2005:1527). Im Jahr 1971 wurde in diesem<br />
Zusammenhang die gemeinnützige Organisation Inuit Tapirisat of Canada (ITC) 11 gegründet.<br />
Sie fungiert seither als die gemeinsame Stimme <strong>der</strong> kanadischen Inuit und setzt s<strong>ich</strong> für den<br />
Erhalt <strong>der</strong> Inuit-Kultur in Kanada ein (vgl. MUELLER/NICKELS 2005:1004f). Im Jahr 1976 rief die<br />
ITC das Projekt Nunavut ins Leben, das <strong>der</strong> Intention folgte, den Inuit <strong>der</strong> östl<strong>ich</strong>en kanadi-<br />
schen Arktis eine weitgehende Selbstverwaltung ihres Siedlungsraumes zu ermögl<strong>ich</strong>en. Be-<br />
son<strong>der</strong>s das Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen sowie die Verwaltung des Landes und<br />
<strong>der</strong> dortigen Rohstoffe standen hierbei im Fokus. Zur Verwirkl<strong>ich</strong>ung dieses Vorhabens sah<br />
das Nunavut-Projekt vor, die Nord-West-Territorien zu teilen und in <strong>der</strong> mehrheitl<strong>ich</strong> von<br />
Inuit bevölkerten östl<strong>ich</strong>en Hälfte ein neues Territorium mit Namen Nunavut (dt. Unser<br />
Land) zu gründen. Rechtl<strong>ich</strong> berief s<strong>ich</strong> die ITC dabei auf eine königl<strong>ich</strong>e Proklamation Groß-<br />
britanniens aus dem Jahr 1763, die den Ureinwohnern Kanadas das Besitzrecht für das von<br />
ihnen besiedelte und genutzte Land zuerkennt und unter den Schutz <strong>der</strong> Krone stellt. Im Jahr<br />
1973 entschied <strong>der</strong> Oberste Ger<strong>ich</strong>tshof Kanadas in <strong>der</strong> sogenannten Cal<strong>der</strong> decision, <strong>dass</strong><br />
die Proklamation nach wie vor Gültigkeit besitze, da die kanadische Regierung mit Inkrafttre-<br />
ten <strong>der</strong> Unabhängigkeit Kanadas die Verantwortung für die Wahrung <strong>der</strong> Rechte <strong>der</strong> Urein-<br />
wohner übernommen habe. Alle indigenen Völker Kanadas verfügen somit über traditionelle<br />
Besitztitel für ihr Land. Ausgenommen davon sind ledigl<strong>ich</strong> jene Landgebiete, die die Urein-<br />
wohner in <strong>der</strong> Zwischenzeit vertragl<strong>ich</strong> an Kanada abgetreten hatten (vgl. LÉGARÉ 2005:1527).<br />
Die Inuit in Nordostkanada hatten bis dato keinen solchen Vertrag geschlossen, was zum<br />
einen darauf zurückzuführen ist, <strong>dass</strong> ihr Siedlungsgebiet aufgrund des fehlenden landwirt-<br />
schaftl<strong>ich</strong>en Potentials in <strong>der</strong> Vergangenheit keine größere Zahl neuer Siedler angezogen<br />
hatte, wodurch das Interesse <strong>der</strong> kanadischen Regierung an dem Land gering war (vgl.<br />
KULCHYSKI 2005:1529). Als in den 1950er Jahren damit begonnen wurde, im Siedlungsgebiet<br />
11 2001 umbenannt in Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 38<br />
<strong>der</strong> Inuit Nickel und an<strong>der</strong>e metallische Rohstoffe zu för<strong>der</strong>n, ignorierte die Regierung die<br />
Besitzansprüche <strong>der</strong> Inuit einfach, anstatt die landrechtl<strong>ich</strong>en Fragen vertragl<strong>ich</strong> zu klären<br />
(vgl. KULCHYSKI 2005:1529). Somit konnte die ITC nun auf dem Landrecht gemäß <strong>der</strong> Prokla-<br />
mation von 1763 beharren und trat mit <strong>der</strong> Regierung in Verhandlungen über die Gründung<br />
des Territoriums Nunavut (vgl. LÉGARÉ 2005:1527).<br />
Die Verhandlungen verliefen zunächst schleppend; während <strong>der</strong> ersten zwei Jahre<br />
wurden kaum Fortschritte erzielt. Schwierigkeiten bereitete vor allem, <strong>dass</strong> die kanadische<br />
Regierung <strong>der</strong> ITC-For<strong>der</strong>ung nach einem eigenen Territorium zunächst verhalten<br />
gegenüberstand. Die Territorialregierung <strong>der</strong> Nord-West-Territorien lehnte über traditionelle<br />
Rechte begründete Landfor<strong>der</strong>ungen grundsätzl<strong>ich</strong> ab; bei den Wahlen von 1979 wurde sie<br />
jedoch zugunsten einer diesbezügl<strong>ich</strong> offeneren Regierung abgewählt. So markiert das Jahr<br />
1980 für die Verhandlungen schließl<strong>ich</strong> den Beginn einer deutl<strong>ich</strong> konstruktiveren Phase. Um<br />
ihre Verhandlungsposition zu stärken, gründeten die Inuit Nunavuts 1982 eine eigene<br />
Organisation, die Tunngavik Fe<strong>der</strong>ation of Nunavut (TFN), die fortan an die Stelle <strong>der</strong> im<br />
Dienste aller kanandischen Inuit stehenden ITC als Verhandlungsvertreter <strong>der</strong> Nunavut-Inuit<br />
trat (vgl. KULCHYSKI 2005:1529f). Die ITC insistierte <strong>der</strong>weil darauf, das Selbstbestimmungrecht<br />
<strong>der</strong> Inuit in <strong>der</strong> kanadischen Verfassung zu verankern und positionierte s<strong>ich</strong> wie folgt:<br />
„Inuit have certain collective rights un<strong>der</strong> international law because colonization has violated the right of<br />
Inuit to govern themselves and their lands. Colonization is recognized by the international community as a<br />
serious violation of the right of peoples to self-determination. Inuit are entitled to assert this right of self-<br />
determination within Canada and to have it recognizes in the constitution“ (INUIT TAPIRISAT OF CANADA zit. in<br />
HUHNDORF 2009:85).<br />
Das 1982 beschlossene kanadische Verfassungsgesetz (Canada Act / Constitution Act)<br />
erkannte daraufhin neben an<strong>der</strong>en Völkern auch die Inuit ausdrückl<strong>ich</strong> als indigenes Volk mit<br />
entsprechenden Rechten an. Um R<strong>ich</strong>tlinien für die praktische Umsetzung dieser<br />
Anerkennung auszuarbeiten, berief die Regierung eine Son<strong>der</strong>kommission ein, die 1986<br />
ihren Abschlussber<strong>ich</strong>t, den sogenannten Coolican Report mit dem Titel Living Treaties:<br />
Lasting Agreements, vorstellte. Darin wurde die Empfehlung ausgesprochen, die<br />
traditionellen Besitzrechte dauerhaft abzus<strong>ich</strong>ern. Parallel dazu fanden innerhalb <strong>der</strong> Nord-<br />
West-Territorien Verhandlungen über <strong>der</strong>en Teilung zugunsten eines neu zu schaffenden<br />
Territoriums statt, die 1987 in einen Abkommensentwurf mündeten. Diese Entwicklungen
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 39<br />
bildeten zusammen die Grundlage für das 1989 von <strong>der</strong> kanadischen Regierung, <strong>der</strong><br />
Regierung <strong>der</strong> Nord-West-Territorien und <strong>der</strong> TFN unterze<strong>ich</strong>nete Grundsatzabkommen<br />
über die Gründung Nunavuts als eigenständiges Territorium. Die Inuit befürworteten dieses<br />
Abkommen 1992 in einer Abstimmung mit großer Mehrheit (vgl. KULCHYSKI 2005:1529f),<br />
woraufhin das kanadische Parlament im Juni 1993 das Nunavut Final Agreement beschloss.<br />
Entsprechend den dort getroffenen Vereinbarungen, wurden in den folgenden sechs Jahren<br />
alle Modalitäten für die Gründung des neuen Territoriums geklärt, bevor schließl<strong>ich</strong> am 1.<br />
April 1999 das Territorium Nunavut offiziell proklamiert wurde (vgl. LÉGARÉ 2005:1528).<br />
Das Territorium Nunavut umfasst die vormals zu<br />
den Nord-West-Territorien gehörige östl<strong>ich</strong>e<br />
kanadische Arktis, das heißt den arktischen Archipel<br />
Abbildung 18: Karte des Territoriums Nunavut<br />
(http://atlas.gc.ca/site/english/maps/referenc<br />
2005:1522f).<br />
östl<strong>ich</strong> von<br />
110° W und<br />
die Barren<br />
Grounds. Im<br />
Abbildung 17: Flagge und Wappen<br />
Nunavuts<br />
(http://www.assembly.nu.ca/aboutlegislative-assembly/flag-nunavut;http://www.assembly.nu.ca/aboutlegislative-assembly/coat-arms-nunavut)<br />
Osten wird es durch die Baffin Bay und die<br />
Davisstraße begrenzt, im Süden durch die Hudson<br />
Bay (vgl. Abb. 18). Nunavut ist somit<br />
weitestgehend deckungsgle<strong>ich</strong> mit dem<br />
traditionellen Landbesitz <strong>der</strong> Inuit in diesem Teil<br />
Kanadas. Mit einer Fläche von 2.121.103 km² –<br />
dies entspr<strong>ich</strong>t etwa <strong>der</strong> Fläche Grönlands (vgl.<br />
NUTTALL 2005d:778) – bildet es nunmehr die<br />
flächenmäßig größte politische Einheit innerhalb<br />
des kanadischen Staatsgebietes (vgl. LÉGARÉ<br />
Das politische System Nunavuts entspr<strong>ich</strong>t im Allgemeinen dem <strong>der</strong> übrigen kanadischen<br />
Territorien. Die hochrangigste Position in <strong>der</strong> Territorialregierung hat <strong>der</strong> Hohe Kommissar<br />
inne. Er wird als Vertreter <strong>der</strong> Königin für jeweils fünf Jahre vom kanadischen<br />
Bundeskabinett nach Nunavut entsandt und nimmt dort vorwiegend repräsentative<br />
Aufgaben wahr. Die gesetzgebende Gewalt liegt beim Parlament, <strong>der</strong> im Fünf-Jahres-
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 40<br />
Rhythmus gewählten, neunzehn Mitglie<strong>der</strong> umfassenden Legislative Assembly (Inuktitut:<br />
Maligaliurvia). Sie wählt den Premierminister, <strong>der</strong> wie<strong>der</strong>um sechs Parlamentsmitglie<strong>der</strong> als<br />
Minister ins Kabinett (Executice Council) beruft. Die Jurisdiktion wird durch verschiedene<br />
Ger<strong>ich</strong>te ausgeübt. Nunavut ist in die drei Verwaltungsbezirke Kivalliq, Kitikmeot und<br />
Qikiqtaaluk unterglie<strong>der</strong>t (vgl. Anhang 2) und es gibt Bestrebungen, die gegenwärtig noch<br />
größtenteils auf die Hautstadt Iqaluit konzentrierten Verwaltungseinr<strong>ich</strong>tungen des<br />
Territoriums künftig stärker zu dezentralisieren und auf die Regionalzentren Iglulik (Igloolik),<br />
Kangiqliniq (Rankin Inlet) und Iqaluktuuttiaq (Cambridge Bay) zu verteilen. Dies soll primär<br />
eine größere Nähe zu den Bürgern ermögl<strong>ich</strong>en und auch jenseits <strong>der</strong> Hauptstadt<br />
Arbeitsplätze im öffentl<strong>ich</strong>en Dienst schaffen. Eine umfassende Dezentralisierung scheiterte<br />
bisher jedoch mangels entsprechend ausgebildeter Arbeitskräfte in den abgelegeneren<br />
Teilen Nunavuts (vgl. LÉGARÉ 2005:1528).<br />
Der kanadische Staat unterscheidet in administrativer Hins<strong>ich</strong>t unterhalb <strong>der</strong><br />
Bundesebene zwei Formen <strong>der</strong> Verwaltung: Provinzen und Territorien (vgl. BERIÉ/KOBERT<br />
2006:277). Nunavut hat seit dem 1. April 1999 rechtl<strong>ich</strong> den Statut eines Territoriums inne<br />
und ist damit dem Yukon-Territorium und den Nord-West-Territorien gle<strong>ich</strong>gestellt. Ähnl<strong>ich</strong><br />
wie die Provinzen hat es somit weitre<strong>ich</strong>ende Befugnisse im Bildungs-, Gesundheits- und<br />
Sozialsystem sowie in <strong>der</strong> Verwaltung und im Umweltschutz. An<strong>der</strong>s als diese ist es jedoch<br />
n<strong>ich</strong>t offiziell im Besitz des Landes und <strong>der</strong> dort befindl<strong>ich</strong>en Rohstoffe und kann daher mit<br />
<strong>der</strong> Rohstoffför<strong>der</strong>ung auch keine wirtschaftl<strong>ich</strong>en Gewinne erzielen. Einfluss hierauf hat die<br />
Territorialregierung ledigl<strong>ich</strong> durch Formen des Ko-Managements (vgl. LÉGARÉ 2005:1528).<br />
Finanziell und steuerl<strong>ich</strong> sind die Territorien von <strong>der</strong> kanadischen Regierung abhängig und<br />
somit gegenüber den Provinzen benachteiligt (vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:194).<br />
Insbeson<strong>der</strong>e die Frage des Landbesitzes war daher bei den Verhandlungen zum Nunavut<br />
Final Agreement strittig. Die letztl<strong>ich</strong> ausgehandelte Lösung entspr<strong>ich</strong>t <strong>der</strong> übl<strong>ich</strong>en<br />
Vorgehensweise <strong>der</strong> kanadischen Landrechtepolitik. Sie sieht so aus, <strong>dass</strong> für die Inuit in<br />
ihrem Siedlungsgebiet ein eigener Verwaltungsbezirk (in diesem ein Territorium)<br />
einger<strong>ich</strong>tet und unter verfassungsrechtl<strong>ich</strong>en Schutz gestellt wird und die Inuit im Gegenzug<br />
dazu ihre traditionellen Landrechte an den Staat abtreten. In Artikel 3.1.1 des Nunavut Final<br />
Agreement heißt es: Die Inuit „cede, release, surren<strong>der</strong> and convey all rights, titles and<br />
interest if any in and to all lands and waters within Canada to her majesty in right of Canada
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 41<br />
forever“ (zit. nach KULCHYSKI 2005:1530ff). Die Inuit haben nunmehr ledigl<strong>ich</strong> über jene<br />
350.000 km² Land, die s<strong>ich</strong> offiziell in ihrem Grundbesitz befinden, direkte<br />
Verfügungsgewalt. Dies entspr<strong>ich</strong>t etwa 18% <strong>der</strong> Territoriumsfläche. Durch die Gründung<br />
des Territoriums haben sie jedoch die Mögl<strong>ich</strong>keit, auf öffentl<strong>ich</strong>-demokratische Weise auch<br />
die übrigen 82% des Landes zu gestalten (vgl. KULCHYSKI 2005:1530f).<br />
Da die Bevölkerung Nunavuts zu 85% aus Inuit besteht, kann de facto von einer<br />
Selbstregierung <strong>der</strong> Inuit gesprochen werden. So waren beispielsweise nach den ersten<br />
Wahlen von 1999 fünfzehn <strong>der</strong> neunzehn Parlamentsabgeordneten Inuit. Dennoch ist<br />
Nunavut eine staatl<strong>ich</strong>e Verwaltungseinheit und steht als solche im Dienste aller<br />
Nunavummiut (vgl. LÉGARÉ 2005:1528). Als geson<strong>der</strong>te Interessenvertretung <strong>der</strong> Inuit in<br />
Nunavut wurde daher die Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) gegründet, die offizielle<br />
Nachfolgeorganisation <strong>der</strong> 1993 mit Verabschiedung des Nunavut Final Agreement<br />
aufgelösten Tunngavik Fe<strong>der</strong>ation of Nunavut. Um die Beachtung <strong>der</strong> Anliegen <strong>der</strong> Inuit aus<br />
dem gesamten Territorium zu gewährleisten, sind jeweils zwei Vertreter <strong>der</strong> drei<br />
Verwaltungsbezirke Nunavuts, Kitikmeot, Kivalliq und Qikiqtaaluk, in <strong>der</strong> NTI vertreten. Die<br />
NTI verwaltet die in Inuit-Besitz befindl<strong>ich</strong>en 350.000 km² Land und erstellt<br />
Landnutzungspläne hierfür. Daneben überwacht sie die Einhaltung im Nunavut Final<br />
Agreement erfolgter, spezifischer Zugeständnisse an die Inuit. Hierzu zählen etwa die<br />
Erlaubnis zum Fang eines Grönlandwals im Jahr, die bevorzugte Behandlung von<br />
Unternehmen in Inuit-Besitz sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen im öffentl<strong>ich</strong>en Dienst<br />
für mindestend 50% <strong>der</strong> Inuit-Bevölkerung (vgl. MCCANN 2005b:1532f).<br />
Die NTI sorgte fernerhin dafür, <strong>dass</strong> die politische Gestaltung Nunavuts auf <strong>der</strong> Grundlage<br />
des Wertesystems <strong>der</strong> Inuit und im Bewusstsein ihrer Traditionen erfolgte. Inuit<br />
Qaujimajatuqangit (IQ) diente hierfür als R<strong>ich</strong>tlinie (vgl. LÉGARÉ 2005:1528). IQ ist eine Form<br />
des indigenen Wissens <strong>der</strong> Inuit;<br />
„[it] indicates the values and practices that allowed Inuit to survive in the eastern Arctic. At the same time,<br />
IQ is also the way in wh<strong>ich</strong> Inuit live their lives, the way in wh<strong>ich</strong> they approach daily decisions at home, at<br />
work and in the family. IQ is thus how an Inuk conducts his or her life“ (HENDERSON 2005:1004).<br />
Von übergeordneter Bedeutung sind hierbei gemeinschaftl<strong>ich</strong>e Zusammenarbeit,<br />
Konsensbereitschaft sowie Achtung vor älteren Menschen. Alle Ministerien und Behörden
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 42<br />
Nunavuts sind angehalten, IQ in ihr politisches Handeln einzubinden. Dazu wurden teilweise<br />
IQ-Arbeitsgruppen einger<strong>ich</strong>tet; in einigen Behörden gibt es einen IQ-Koordinator (vgl.<br />
HENDERSON 2005:1004). Darüber hinaus kommt IQ in bestimmten Eigenheiten Nunavuts zum<br />
Ausdruck. So gibt es infolge des hohen Ansehens von Konsens und Zusammenarbeit in<br />
Nunavut keine Parteien. Alle Abgeordneten im Parlament sind unabhängig und parteilos (vgl.<br />
LÉGARÉ 2005:1528). Daneben ist auch im Bathurst Mandate ein Bekenntnis zu IQ zu sehen.<br />
Dabei handelt es s<strong>ich</strong> um einen auf zwanzig Jahre angelegten Plan zur Bewältigung <strong>der</strong><br />
massiven sozioökonomischen Probleme Nunavuts. Das Bathurst Mandate nimmt explizit<br />
Bezug auf IQ und stellt dessen Bedeutung für die Selbstachtung <strong>der</strong> Inuit heraus (vgl.<br />
HENDERSON 2005:1004 & LÉGARÉ 2005:1528).<br />
1976<br />
Start des<br />
Projekts<br />
'Nunavut'<br />
1982<br />
Abbildung 19: Entwicklungsschritte <strong>der</strong> Autonomie Nunavuts<br />
(eigene Darstellung)<br />
Die Inuit in Alaska, im Mackenzie-Delta und auf <strong>der</strong> Halbinsel Labrador<br />
Grönland und Nunavut sind die bevölkerungsstärksten Siedlungsgebiete <strong>der</strong> Inuit und zu-<br />
dem diejenigen, die über die weitre<strong>ich</strong>endste Autonomie verfügen. Doch auch in an<strong>der</strong>en<br />
Räumen <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis leben Inuit und auch dort wurden in <strong>der</strong> Vergangen-<br />
heit regionale Autonomieabkommen ausgehandelt.<br />
Das erste dieser Abkommen war <strong>der</strong> 1971 verabschiedete Alaska Native Claims Settle-<br />
ment Act (ANCSA). Er war zugle<strong>ich</strong> die letzte staatl<strong>ich</strong>e Abmachung in Bezug auf Landbesitz-<br />
ansprüche von Ureinwohnern in den Vereinigten Staaten, aber auch <strong>der</strong> erste als mo<strong>der</strong>n zu<br />
beze<strong>ich</strong>nende Vertrag dieser Art in Nordamerika und hatte insofern Vorbildfunktion für die<br />
später in Kanada geschlossenen Abkommen. Der ANCSA ist kein Abkommen, das exklusiv mit<br />
den Inuit geschlossen wurde, son<strong>der</strong>n er bezieht s<strong>ich</strong> auf alle indigenen Völker Alaskas (vgl.<br />
COLT/PRETES 2005:34). Neben den Inuit ist dies hauptsächl<strong>ich</strong> die in mehrere regionale Grup-<br />
pen unterglie<strong>der</strong>te Großgruppe <strong>der</strong> Dene-Indianer, die mit den Navajo und den Apachen<br />
verwandt sind (vgl. PRETES 2005:24f).<br />
Canada<br />
Act<br />
1993<br />
Nunavut<br />
Final<br />
Agreement<br />
1999<br />
Gründung<br />
Nunavuts
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 43<br />
Für US-amerikanische Verhältnisse erfolgte die endgültige Regelung <strong>der</strong> Landrechte <strong>der</strong><br />
Ureinwohner Alaskas spät. Dies liegt vornehml<strong>ich</strong> in <strong>der</strong> Kolonialgesch<strong>ich</strong>te Alaskas begrün-<br />
det. Erst im Jahr 1958 erhielt es durch den Alaska Statehood Act den Status als US-<br />
amerikanischer Bundesstaat. In diesem Gesetz wurden auch die durch dauerhafte Nutzung<br />
und Besiedlung legitimierten Landrechte <strong>der</strong> indigenen Bevölkerung grundsätzl<strong>ich</strong> bestätigt.<br />
Dennoch stand die amerikanische Regierung einem umfassenden Abkommen über die Land-<br />
rechte zunächst ablehnend gegenüber. Dass es mit dem ANCSA letztl<strong>ich</strong> doch dazu kam, liegt<br />
in folgenden drei Entwicklungen <strong>der</strong> 1960er Jahre begründet:<br />
(1) Unter den Ureinwohnern Alaskas bildete s<strong>ich</strong> eine gut ausgebildete und unterei-<br />
nan<strong>der</strong> eng vernetzte Führungssch<strong>ich</strong>t heraus, die 1962 die erste von Ureinwohnern<br />
verantwortete und herausgegebene Zeitung Alaskas, die Tundra Times, ins Leben<br />
rief. Für die Indianer und Inuit war sie damals neben den lokalen Radiosen<strong>der</strong>n <strong>der</strong><br />
einzige Zugang zu Massenmedien und erre<strong>ich</strong>te in <strong>der</strong> Folgezeit große Bedeutung<br />
als Stimme <strong>der</strong> Ureinwohner.<br />
(2) 1966 ordnete <strong>der</strong> US-Innenminister Stuart UDALL einen sofortigen Stopp <strong>der</strong> Veräu-<br />
ßerung besitzrechtl<strong>ich</strong> umstrittenen Landes in Alaska an. Er war zuvor zu dem<br />
Schluss gekommen, <strong>dass</strong> <strong>der</strong> Organic Act, mit dem Alaska 1884 US-amerikanisches<br />
Territorium geworden war, die Rechte <strong>der</strong> Ureinwohner verletze. Dieser Beschluss<br />
setzte den Kongress unter Druck, im Streit um die Landrechte in Alaska zu einer offi-<br />
ziellen Lösung zu kommen.<br />
(3) Den endgültigen Ausschlag zur Aushandlung des ANCSA gab die Entdeckung eines<br />
Erdölfeldes mit Ölreserven von mehr als zehn Milliarden Barrel in Prudhoe Bay an<br />
<strong>der</strong> Nordküste Alaskas. Denn, obgle<strong>ich</strong> das Ölfeld selbst s<strong>ich</strong> auf zweifelsfrei staats-<br />
eigenem Land befindet, muss das dort geför<strong>der</strong>te Öl über eine Entfernung von<br />
1.100 km durch besitzrechtl<strong>ich</strong> umstrittenes Land zum nächstgelegenen eisfreien<br />
Hafen nach Valdez an die Südküste Alaskas transportiert werden. Das Interesse an<br />
einer Lösung des Problems stieg somit auf allen Seiten. Daneben verschmolzen die<br />
Landfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> alaskischen Ureinwohner durch den Ölfund mit <strong>der</strong> Problema-<br />
tik <strong>der</strong> ökonomischen Unterentwicklung dieses Teiles <strong>der</strong> Bevölkerung. Mit <strong>der</strong><br />
Rückgabe des gefor<strong>der</strong>ten Landes erhoffte s<strong>ich</strong> die Regierung einerseits eine Teil-<br />
habe <strong>der</strong> Ureinwohner an dem zu erwartenden neuen Re<strong>ich</strong>tum Alaskas und zum
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 44<br />
an<strong>der</strong>en eine schnellere Erschließung des Ölfeldes, da dies dann auch im Interesse<br />
<strong>der</strong> Ureinwohner wäre (vgl. COLT/PRETES 2005:34ff). COLT/PRETES (2005:35f) merken<br />
hierzu an:<br />
„In the socially tumultous climate of the late 1960s, the Alaska Native land claims issue presented<br />
Congress and the nation with a chance to make more enlightened, or al least more compassiona-<br />
te, Indian policy than had been imposed on the tribes of the lower 48 states“.<br />
Abbildung 20: Regionale ANCSA-Körperschaften in<br />
Alaska<br />
(http://www.cr.nps.gov/history/online_books/norris1<br />
/images/map4-1.jpg)<br />
Der ANCSA wurde am 17. Dezember 1971<br />
verabschiedet und überführte 44 Millionen<br />
Morgen Land (etwa 12% <strong>der</strong> Fläche Alaskas)<br />
sowie US$ 962,5 Millionen als Barzahlung an<br />
zwölf neu gegründete regionale Körperschaf-<br />
ten <strong>der</strong> Ureinwohner. Fünf dieser Körper-<br />
schaften befinden s<strong>ich</strong> in den Händen <strong>der</strong><br />
Inuit: Arctic Slope, Bering Strait, Calista, Bris-<br />
tol Bay und Nana (vgl. Abb. 20). Auf lokaler<br />
Ebene wurden etwa 200 weitere Körper-<br />
schaften gegründet. Die Summe <strong>der</strong> Trans-<br />
fergel<strong>der</strong> wurde zu jeweils 45% an die regionalen und lokalen Körperschaften ausgezahlt; die<br />
übrigen 10% wurden unter den einzelnen in Alaska nie<strong>der</strong>gelassenen Ureinwohnern zu glei-<br />
chen Teilen aufgeteilt (vgl. COLT/PRETES 2005:34ff). Diese Regelung war für je<strong>der</strong>mann an-<br />
nehmbar und stieß daher bei allen beteiligten Interessengruppen auf Zustimmung:<br />
„Assimilationists saw in corporations business dealings and mo<strong>der</strong>n capitalism. Tribalists saw more real au-<br />
tonomy and, in any event, an improvement over the reservation system. New Native political lea<strong>der</strong>s saw<br />
the opportunity for economic and political self-determination, not to mention the promise of management<br />
positions for themselves“ (COLT/PRETES 2005:36).<br />
Der ANCSA enthält keinerlei konkrete Vorgaben für die Selbstverwaltung <strong>der</strong> Ureinwoh-<br />
ner innerhalb <strong>der</strong> körperschaftl<strong>ich</strong>en Strukturen. Angestrebt wurde vor allem ökonomische<br />
Selbstständigkeit <strong>der</strong> Ureinwohner als Bestandteil und Wegbereiter erweiterter Selbstbe-<br />
stimmung (vgl. IRLBACHER FOX 2005:1878f).
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 45<br />
Neue Impulse für die Regelung <strong>der</strong> Landbesitzverhältnisse in Kanada bewirkte die ab 1973<br />
von Seiten <strong>der</strong> Regierung verfolgte Comprehensive Land Claims Policy. Vor dem Hintergrund<br />
<strong>der</strong> Cal<strong>der</strong> Decision verfolgte sie das Ziel, mit allen indigenen Völkern Kanadas endgültige<br />
Landbesitzabkommen auszuhandeln. Das grundsätzl<strong>ich</strong>e Prinzip dieser Politik basierte auf<br />
einem Tausch: „A claimant group would receive defined rights, financial compensation, and<br />
other benefits in exchange for relinquishing its title rights“ (LÉGARÉ 2005:1527). Im Zuge <strong>der</strong><br />
Comprehensive Land Claims Policy wurden<br />
auch mit den Inuit <strong>der</strong> Inuvialuit-Region,<br />
Nunatsiavuts und Nunaviks Landrechte-<br />
Abkommen geschlossen (vgl. LÉGARÉ<br />
2005:1527).<br />
Als erstes trat 1984 ein Abkommen mit<br />
den Inuvialuit, den etwa 2.500 Inuit <strong>der</strong><br />
Mackenzie-Delta-Region in den Nord-<br />
West-Territorien, in Kraft. Es war das erste<br />
Landrechteabkommen, <strong>dass</strong> die Inuit im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Comprehensive Land Claims<br />
Policy mit dem kanadischen Staat schlos-<br />
sen. Wie zuvor schon in Alaska, waren es<br />
Abbildung 21: Inuit-Land und staatl<strong>ich</strong>es Land in <strong>der</strong><br />
Inuvialuit-Region<br />
(http://www.aincinac.gc.ca/al/ldc/ccl/fagr/inu/iifa96/images/mp1e.jpg)<br />
auch in <strong>der</strong> Inuvialuit-Region letztl<strong>ich</strong> Rohstofffunde, die den Ausschlag für die Aufnahme<br />
ernsthafter Verhandlungen über die Landrechte gaben. Die Inuvialuit-Region umfasst mit<br />
einer Gesamtfläche von 344.000 km² das Mackenzie-Delta, die östl<strong>ich</strong>e Hälfte <strong>der</strong> Beaufort-<br />
seeküste, die Porcupine River-Senke, die Banks Insel, die westl<strong>ich</strong>e Hälfte <strong>der</strong> Victoria Insel<br />
sowie einen Teil <strong>der</strong> Parry Inseln. Die Rolle als Verhandlungsvertreter <strong>der</strong> Inuvialuit nahm<br />
das Commitee for Original Peoples‘ Entitlement (COPE) war. Es war Anfang <strong>der</strong> 1970er Jahre<br />
gegründet worden, als es im Mackenzie-Delta zu Konflikten zwischen den Inuit und den Erd-<br />
ölgesellschaften kam. Die Erdölexploration einerseits und die Jagd <strong>der</strong> Inuit an<strong>der</strong>erseits be-<br />
hin<strong>der</strong>ten s<strong>ich</strong> gegenseitig. Das COPE for<strong>der</strong>te daraufhin im Namen <strong>der</strong> Inuvialuit zum einen<br />
Mitsprache bei künftigen Bohrunternehmungen und zum an<strong>der</strong>en Teilhabe an den daraus<br />
resultierenden Gewinnen für die Inuit. In einer regionalen Autonomieregelung sahen die<br />
Inuvialuit in diesem Zusammenhang eine Chance, von den Rohstofffunden zu profitieren und
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 46<br />
so ihre sozioökonomischen Probleme zu vermin<strong>der</strong>n. Bisher hatten die Inuvialuit ihre Land-<br />
rechte noch n<strong>ich</strong>t vertragl<strong>ich</strong> an Kanada abgetreten und so stellten sie 1977 offiziell die Inu-<br />
vialuit Nunangat beze<strong>ich</strong>nete For<strong>der</strong>ung nach Selbstverwaltung innerhalb ihres Siedlungsge-<br />
bietes. Der kanadischen Regierung war in dieser Frage an einem schnellen Verhandlungser-<br />
folg gelegen, denn bis zu einer Einigung opponierten die Inuvialuit gegen eine Erschließung<br />
<strong>der</strong> Rohstoffe in ihrem Siedlungsgebiet. Schon ein Jahr später wurde daher ein Agreement in<br />
Principle unterze<strong>ich</strong>net, das vorsah, eine eigene regionale Regierung <strong>der</strong> Inuvialuit einzur<strong>ich</strong>-<br />
ten. Das aus diesem Abkommen resultierende Inuvialuit Final Agreement wurde schließl<strong>ich</strong><br />
am 5. Juni 1984 unterze<strong>ich</strong>net, <strong>der</strong> damit verbundene Western Arctic Claims Settlement Act<br />
noch im selben Jahr vom kanadischen Parlament verabschiedet. Unterze<strong>ich</strong>ner waren die<br />
COPE-Verhandlungsführerin NELLIE COURNOYEA, <strong>der</strong> damalige kanadische Premierminister PIER-<br />
RE TRUDEAU sowie <strong>der</strong> Minister für Indian Affairs and Northern Development, JOHN C. MUNRO<br />
(vgl. MCCANN 2005a:1012).<br />
Über das Abkommen erhielten die Inuit das volle Besitzrecht für 11.000 km² Land ringsum<br />
ihre Siedlungen (vgl. Abb. 21) inklusive <strong>der</strong> dort befindl<strong>ich</strong>en n<strong>ich</strong>t-erneuerbaren Rohstoffe<br />
sowie das Recht zur Entscheidungsteilhabe über weitere 78.000 km² Land im Rahmen von<br />
Ko-Management-Gremien, an denen neben den Inuit auch die kanadische Regierung und die<br />
Regierung <strong>der</strong> Nord West Territorien beteiligt ist. Daneben erhielten sie in <strong>der</strong> Zeit zwischen<br />
1984 und 1997 Transferzahlungen in Höhe von insgesamt Can$ 90 Millionen. Die neu ge-<br />
gründete Inuvialuit Development Corporation erhielt zudem eine Einmalzahlung von Can$ 10<br />
Millionen als Startkapital. Die Aufgabe <strong>der</strong> Corporation besteht darin, durch gezielte langfris-<br />
tige Investitionen Arbeitsplätze für die Inuit zu schaffen und sie in die lokale Wirtschaft aktiv<br />
einzubinden. Unterstützt wird sie dabei durch lokale Körperschaften, die in je<strong>der</strong> Siedlung<br />
ins Leben gerufen wurden und s<strong>ich</strong> speziell um Unternehmen, die Landesplanung und Belan-<br />
ge im Zusammenhang mit dem Erdöl kümmern. Sie haben mittlerweile Abkommen ausge-<br />
handelt, die den Inuit über Abfindungszahlungen und Arbeitsplatzgarantien Teilhabe an <strong>der</strong><br />
Ölwirtschaft gewähren. Von staatl<strong>ich</strong>er Seite wurde im Inuvialuit Final Agreement zuge-<br />
stimmt, im öffentl<strong>ich</strong>en Dienst <strong>der</strong> Region künftig bevorzugt Inuvialuit einzustellen. Vor al-<br />
lem in Nationalparks und im Rahmen des Rückbaus <strong>der</strong> Radarstationen <strong>der</strong> seit dem Ende<br />
des Kalten Krieges n<strong>ich</strong>t mehr genutzten Distant Early Warning Line wurden dadurch Ar-<br />
beitsplätze für Inuit geschaffen. Um den Lebensstandard <strong>der</strong> Inuvialuit im Allgemeinen und
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 47<br />
ihre Bildung, Gesundheit und Wohnsituation im Beson<strong>der</strong>en zu verbessern, wurde außer-<br />
dem <strong>der</strong> Social Development Fund einger<strong>ich</strong>tet und mit Can$ 7,5 Millionen ausgestattet. Des<br />
Weiteren wurde ein Ausbildungsför<strong>der</strong>ungsprogramm für Jugendl<strong>ich</strong>e geschaffen und das<br />
Inuvialuit Cultural Centre einger<strong>ich</strong>tet, das das Einfließen indigenen Wissens <strong>der</strong> Inuvialuit<br />
und von Inuvialuntun, dem regionalen Inuktitut-Dialekt, in den Schulunterr<strong>ich</strong>t unterstützt<br />
(vgl. MCCANN 2005a:1012f).<br />
Auf <strong>der</strong> Halbinsel Labrador leben Inuit sowohl in Nunavik, das den Norden <strong>der</strong> Provinz<br />
Québec einnimmt, als auch in Nunatsiavut, dem nördl<strong>ich</strong>en Teil <strong>der</strong> Provinz Neufundland<br />
und Labrador. Mit letzteren wurde am 29. August 2003 das Labrador Inuit Land Claims Ag-<br />
reement unterze<strong>ich</strong>net (vgl. HAYSOM 2005:1146). Die Labrador-Inuit, die s<strong>ich</strong> selbst Sikumiut –<br />
Menschen des Meereises – nennen (vgl. RICHLING 2005:1144), for<strong>der</strong>n bereits seit 1977 von<br />
<strong>der</strong> kanadischen Regierung offiziell die Rechte für 80.000 km² Land auf <strong>der</strong> Halbinsel Labra-<br />
dor sowie weitere 27.000 km² <strong>der</strong> angrenzenden Seegebiete innerhalb <strong>der</strong> kanadischen Ho-<br />
heitsgewässer. Im Jahr 1978 erklärte s<strong>ich</strong> die Regierung zu Verhandlungen hierüber bereit<br />
und zwei Jahre später stimmte dem auch die Regierung <strong>der</strong> Provinz Neufundland und Labra-<br />
dor zu. Bis zum tatsächl<strong>ich</strong>en Beginn <strong>der</strong> Verhandlungen zwischen den drei Parteien (Staat,<br />
Provinz und Inuit) dauerte es jedoch noch weitere zehn Jahre, bis November 1990. Im Mai<br />
1999 wurde schließl<strong>ich</strong> das erste Ergebnis <strong>der</strong> Verhandlungen vorgelegt, das Labrador Inuit<br />
Land Claims Agreement in Principle. Bevor es jedoch unterze<strong>ich</strong>net wurde, folgten zunächst<br />
noch Verhandlungen über die Grenzen des Landes, für das die Inuit die Landrechte erhalten<br />
sollten. Es wurde letztl<strong>ich</strong> eine Einigung erzielt, nach <strong>der</strong> 45.000 km² Land sowie die bean-<br />
spruchten 28.000 km² Seegebiet unter Inuit-Verwaltung gestellt werden sollten. 10.000 km²<br />
Land und 6.000 km² Seegebiet sollten dabei direkt in Inuit-Besitz überführt werden (vgl. Abb.<br />
22). Nach dem Beschluss dieser Regelung wurde das Abkommen am 25. Juni 2001 von <strong>der</strong><br />
Regierung Kanadas, <strong>der</strong> Provinzregierung Neufundland und Labradors sowie <strong>der</strong> Labrador<br />
Inuit Association unterze<strong>ich</strong>net. Als Agreement in Principle hatte es jedoch zunächst noch<br />
keine rechtl<strong>ich</strong>e Verbindl<strong>ich</strong>keit. Diese erre<strong>ich</strong>te es erst, als es 2003 durch den Labrador Inuit<br />
Land Claims Agreement Act unter verfassungsrechtl<strong>ich</strong>en Schutz gestellt wurde (vgl. HAYSOM<br />
2005:1146f).<br />
Das Abkommen veranlasste die Einr<strong>ich</strong>tung einer regionalen Regierung in Nunatsiavut,<br />
den Inuit-Siedlungsgebieten Labradors. Diese besteht aus <strong>der</strong> Nunatsiavut-Regierung für die
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 48<br />
gesamte Region sowie fünf kommunalen Regierungen für die Gemeinden Nunainguk,<br />
Aqvituq, Marruuvik, Qipuqqaq und Kikiak. Die Nunatsiavut-Regierung verfügt innerhalb des<br />
Inuit-Siedlungsgebietes über die gesetzgebende Gewalt im Gesundheits-, Bildungs- und Sozi-<br />
alwesen sowie im kulturellen Bere<strong>ich</strong>. Auch die Rechtsprechung über innere Angelegenhei-<br />
ten und Rechte <strong>der</strong> Inuit obliegt ihr. Alle Einwohner des Zuständigkeitsgebietes haben die<br />
Mögl<strong>ich</strong>keit an <strong>der</strong> Regierung zu partizipieren, unabhängig davon, ob sie Inuit sind o<strong>der</strong><br />
n<strong>ich</strong>t. Der Beschluss des Labrador Inuit Land Claims Agreement beinhaltete überdies die Zah-<br />
lung von insgesamt US$ 255 Millionen an die Inuit. US$ 115 Millionen hiervon gingen an die<br />
Nunatsiavut-Regierung zur praktischen Um-<br />
setzung des Abkommens. Die übrigen US$<br />
140 Millionen wurden in eine wohltätige<br />
Stiftung zu Gunsten <strong>der</strong> Inuit überführt. Fer-<br />
nerhin regelt das Abkommen die Teilhabe<br />
<strong>der</strong> Inuit an den Gewinnen aus <strong>der</strong> Roh-<br />
stoffför<strong>der</strong>ung. Zum einen ist festgeschrie-<br />
ben, <strong>dass</strong> den Inuit 25% <strong>der</strong> Staatseinnah-<br />
men aus <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung mineralischer Roh-<br />
stoffe innerhalb des von ihnen verwalteten<br />
Gebietes zusteht. Darüber hinaus erhalten<br />
sie 50% <strong>der</strong> ersten US$ 2 Millionen, die <strong>der</strong><br />
Staat durch die För<strong>der</strong>ung mineralischer<br />
Rohstoffe in Siedlungsgebieten <strong>der</strong> Inuit<br />
innerhalb <strong>der</strong> Provinz Neufundland und La-<br />
brador, aber außerhalb Nunatsiavuts erwirt-<br />
schaftet. Anschließend stehen ihnen 5% die-<br />
ser Einnahmen zu. Letztl<strong>ich</strong> werden die Inuit<br />
Abbildung 22: Inuit-Land und Inuit-Siedlungsgebiet<br />
in Nunatsiavut nach dem Land Claims Agreement<br />
(http://www.laa.gov.nl.ca/laa/labrador_living/map<br />
.jpg)<br />
zu 5% an den Staatseinnahmen aus den Nickel- Kupfer- und Kobaltminen an <strong>der</strong> Voisey‘s Bay<br />
beteiligt. Abgesehen davon sieht das Abkommen vor, <strong>dass</strong> die Inuit Entschädigungszahlun-<br />
gen erhalten für eine eventuelle Verringerung <strong>der</strong> Qualität, <strong>der</strong> Fließgeschwindigkeit o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Menge des Wassers <strong>der</strong> Flüsse in Nunatsiavut. Daneben sind die Inuit befugt, zu Zwe-<br />
cken <strong>der</strong> Selbstversorgung Wildtiere und Vögel zu jagen, zu fischen und die Pflanzenbestän-<br />
de zu nutzen. Zum Schutz und zur Kontrolle <strong>der</strong> Wild- und Fischbestände wurde eine Ko-
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 49<br />
Management-Behörde einger<strong>ich</strong>tet, an <strong>der</strong> Vertreter <strong>der</strong> Nunatsiavut-Regierung, <strong>der</strong> Pro-<br />
vinzregierung und <strong>der</strong> Bundesregierung beteiligt sind (vgl. HAYSOM 2005:1146f).<br />
Abbildung 23: Karte Nunaviks<br />
(http://www.makivik.org/media-centre/nunavik-maps/)<br />
Das jüngste mit den Inuit geschlos-<br />
sene Abkommen regelt die Landrechte<br />
in Nunavik, das mit einer Fläche von<br />
660.000 km² den Norden <strong>der</strong> Provinz<br />
Québec jenseits 55° N einnimmt (vgl.<br />
Abb. 23). Die Grundlage hierfür bildete<br />
<strong>der</strong> 1999 ausgehandelte Nunavik Poli-<br />
tical Accord, <strong>der</strong> eine Kommission ins<br />
Leben rief, die in den Folgejahren<br />
R<strong>ich</strong>tlinien für die Einsetzung einer<br />
autonomen Selbstverwaltung in Nunavik ausarbeitete. Dem war von Seiten <strong>der</strong> Inuit ein<br />
jahrzehntelanges Ringen um mehr Selbstbestimmung vorausgegangen. Infolgedessen unter-<br />
suchte bereits 1970 die NEVILLE-ROBITAILLE-Kommission Mögl<strong>ich</strong>keiten, Teile <strong>der</strong> Verwaltung<br />
Nunaviks auf die Inuit zu übertragen (vgl. JACOBS 2005b:1522). Im Jahr 1975 wurde mit dem<br />
James Bay and Northern Québec Agreement (JBNQA) ein erster Schritt in diese R<strong>ich</strong>tung ge-<br />
tan. Das Abkommen, das mit den Inuit in Nunavik und den an <strong>der</strong> James Bay ansässigen Cree<br />
und Naskapi geschlossen wurde, führte für die Inuit zu <strong>der</strong> Einr<strong>ich</strong>tung <strong>der</strong> Kativik-<br />
Regionalregierung in Nunavik (vgl. JACOBS 2005a:1519). Für die Bere<strong>ich</strong>e Bildungs- und Sozi-<br />
alwesen sowie Umweltschutz wurden das Kativik School Board, <strong>der</strong> Kativik Health and Social<br />
Services Council und das Kativik Environmental Advisory Commitee als Beratungsgremien<br />
einger<strong>ich</strong>tet (vgl. KATIVIK REGIONAL GOVERNMENT (Hrsg.) o.J.). Das JBNQA ermögl<strong>ich</strong>te den Inuit<br />
somit eine stärkere Partizipation an <strong>der</strong> Gestaltung Nunaviks, jedoch keine wirkl<strong>ich</strong>e Selbst-<br />
verwaltung. In <strong>der</strong> Parliamentary Commission on Aboriginal People im Jahr 1983 brachten<br />
die Inuit Nunaviks ihre For<strong>der</strong>ung nach Einheit und größerer Autonomie noch einmal nach-<br />
drückl<strong>ich</strong> zum Ausdruck. René LÉSVESQUE, <strong>der</strong> Premierminister <strong>der</strong> Provinz Québec, stimmte<br />
daraufhin Verhandlungen zu, die eine Regelung herbeiführen sollten, nach <strong>der</strong> den Inuit eine<br />
begrenzte Autonomie eingeräumt werden sollte. Voraussetzung hierfür war, <strong>dass</strong> die ver-<br />
schiedenen Inuit-Gruppen <strong>der</strong> Region eine gemeinsame Position vertraten. Daher wurde<br />
1990 das Nunavik Institutional Commitee gegründet, das anschließend in Verhandlungen mit
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 50<br />
<strong>der</strong> Provinzregierung Québecs trat. Ab 1997 waren diese Verhandlungen explizit auf das Ziel<br />
ausger<strong>ich</strong>tet, in Nunavik eine autonome Regierung einzur<strong>ich</strong>ten. Sie führten schließl<strong>ich</strong> zu<br />
<strong>der</strong> Unterze<strong>ich</strong>nung des Political Accord between the Nunavik party, the Government of<br />
Québec and the fe<strong>der</strong>al government for the examination of a form of government in Nunavik<br />
through the establishment of a Nunavik Commission, kurz Nunavik Political Accord, am 5.<br />
November 1999. Die Kommission legte den beteiligten Parteien im März 2001 ihren Ber<strong>ich</strong>t<br />
mit dem Titel Amiqqaaluta – Let Us Share: Mapping the Road Towards a Government for<br />
Nunavik vor (vgl. JACOBS 2005b:1522). Im Anschluss hieran wurde zunächst im Oktober 2002<br />
ein Agreement in Principle unterze<strong>ich</strong>net, das nach <strong>der</strong> Bestätigung durch alle beteiligten<br />
Verhandlungsparteien am 1. Dezember 2006 als Nunavik Inuit Land Claims Agreement end-<br />
gültig beschlossen wurde (vgl. DEPARTMENT OF ABORIGINAL AFFAIRS AND NORTHERN DEVELOPMENT CA-<br />
NADA 2008).<br />
Das Agreement sieht vor, <strong>dass</strong> die neu geschaffene Regierung Nunaviks alle dortigen Ein-<br />
wohner vertreten soll. Neben den Inuit, die bei weitem die Bevölkerungsmehrheit darstel-<br />
len, sind dies auch die Indianerstämme <strong>der</strong> Cree, Innu und Naskapi. Zur Verständigung <strong>der</strong><br />
einzelnen Bevölkerungsgruppen und gemeinsamen Vertretung ihrer Anliegen wurde ein Fo-<br />
rum of Aboriginal Peoples of Northern Québec einger<strong>ich</strong>tet. Es setzt s<strong>ich</strong> zusammen aus Re-<br />
präsentanten <strong>der</strong> Inuit, Cree, Naskapi und Innu sowie jeweils einem Abgeordneten des ka-<br />
nadischen Parlamentes und <strong>der</strong> Nationalversammlung Nunaviks. Nunavik erhielt überdies<br />
einen eigenen Ger<strong>ich</strong>tshof und bekam fernerhin Zugang zu Steuereinnahmen und Einfluss<br />
auf die Finanzpolitik. Bei <strong>der</strong> Neuordnung Nunaviks wurde zwar darauf geachtet, im Einklang<br />
mit den rechtl<strong>ich</strong>en und ökonomischen Gegebenheiten Québecs und Kanadas zu bleiben;<br />
innovative Elemente, welche kulturelle Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Inuit wi<strong>der</strong>spiegeln, waren den-<br />
noch ausdrückl<strong>ich</strong> erwünscht. Dem wurde nachgekommen, indem unter an<strong>der</strong>em ein Ältes-<br />
tenrat einger<strong>ich</strong>tet wurde. Dieser soll künftig über den Fortbestand <strong>der</strong> Kultur, <strong>der</strong> Sprache<br />
und <strong>der</strong> Werte <strong>der</strong> Inuit wachen. Daneben wurde Inuktitut zur gle<strong>ich</strong>berechtigten Sprache<br />
neben Englisch und Französisch erklärt. Öffentl<strong>ich</strong>e Dokumente müssen demnach in allen<br />
drei Sprachen publiziert werden (vgl. JACOBS 2005b:1521f).
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 51<br />
Alaska Native<br />
Claims<br />
Settlement Act<br />
James Bay and<br />
Northern Québec<br />
Agreement<br />
Inuvialuit<br />
Final<br />
Agreement<br />
Abbildung 24: Zeitl<strong>ich</strong>e Abfolge <strong>der</strong> Autonomieabkommen mit den Inuit Alaskas, des Mackenzie-Deltas,<br />
Nunaviks und Labradors<br />
(Eigene Darstellung)<br />
KAALHAUGE NIELSEN (2005b:1876) definiert Selbstbestimmung als „a social actor‘s capacity<br />
vis-à-vis its cultural value-system to control its political environment in such a way that it is<br />
able to determine its own being in a sovereign fashion“, ergänzt dazu aber: „In the real<br />
world, political self-determination is a matter of degree“ (KAALHAUGE NIELSEN 2005b:1876).<br />
Dies trifft auch auf die Inuit zu. Über die vorangehend dargestellten Abkommen haben alle<br />
Inuit im Laufe <strong>der</strong> letzten 35 Jahre eine mehr o<strong>der</strong> weniger weitre<strong>ich</strong>ende Autonomie er-<br />
langt. Sie re<strong>ich</strong>t von <strong>der</strong> umfassenden Selbstverwaltung Grönlands bis zu den sehr viel stär-<br />
ker begrenzten kleinen Autonomieabkommen Nunatsiavuts und <strong>der</strong> Inuvialuit-Region. Ob<br />
eine weitergehende Autonomie im Interesse <strong>der</strong> Inuit überhaupt mögl<strong>ich</strong> wäre, ist fragl<strong>ich</strong><br />
und von <strong>der</strong> jeweiligen Region abhängig. Wirtschaftl<strong>ich</strong> sind alle autonomen Regionen <strong>der</strong><br />
Inuit bis heute in hohem Maße von Kanada, den USA beziehungsweise Dänemark abhängig.<br />
Dies soll jedoch n<strong>ich</strong>t über den elementaren Wert <strong>der</strong> Autonomieabkommen hinwegtäu-<br />
schen. Für die Wahrung <strong>der</strong> Identität <strong>der</strong> Inuit, für den Schutz von Kultur, Sprache und indi-<br />
genem Wissen sind sie von zentraler Bedeutung. In allen Regionen wurde <strong>der</strong> jeweilige Inuk-<br />
titut-Dialekt zur gle<strong>ich</strong>berechtigten Amtssprache neben Englisch, Französisch beziehungs-<br />
weise Dänisch. Daneben legen die Abkommen das Bildungswesen und die innere Verwaltung<br />
sowie die Entscheidung über <strong>der</strong>en Gestaltung in die Hände <strong>der</strong> Inuit. Auf diese Weise wird<br />
ermögl<strong>ich</strong>t, <strong>dass</strong> die regionale Politik auf den Werten <strong>der</strong> Inuit gründet und Inuit Qaujima-<br />
jatuqangit darin Ausdruck findet. Zudem eröffnet die Autonomie, wenn auch in variieren-<br />
dem Umfang, die Mögl<strong>ich</strong>keit, eine stärker angepasste Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. Die<br />
in Alaska geschaffenen regionalen Körperschaften und die kanadischen Development Corpo-<br />
rations sind in dieser Hins<strong>ich</strong>t ein sinnvoller Ansatz.<br />
Labrador Inuit<br />
Land Claims<br />
Agreement<br />
Nunavik Inuit Land<br />
Claims Agreement<br />
1971 1975 1984 2003 2006
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 52<br />
3.4 Grundlegende wirtschaftsstrukturelle Gegebenheiten<br />
Die ökonomischen Gegebenheiten <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis sind durch einige<br />
grundlegende Determinanten geprägt. Zu allererst ist hier die Lage des Raumes fernab <strong>der</strong><br />
Metropolitanräume südl<strong>ich</strong>erer Teile des nordamerikanischen Kontinents als benachteili-<br />
gen<strong>der</strong> Faktor zu nennen. Die Ausdehnung des Raumes über eine Fläche von mehreren Mil-<br />
lionen Quadratkilometern in Kombination mit <strong>der</strong> ausnehmend dünnen Besiedlung – in <strong>der</strong><br />
gesamten nordamerikanischen Arktis leben n<strong>ich</strong>t mehr als 150.000 Inuit – sowie den natur-<br />
räuml<strong>ich</strong>-klimatischen Voraussetzungen bedingen zudem eine mangelhaft ausgebaute Infra-<br />
struktur. Ein Straßensystem, das die einzelnen Siedlungen <strong>der</strong> Inuit miteinan<strong>der</strong> vernetzt,<br />
fehlt ebenso wie eine entsprechende Anbindung an die südl<strong>ich</strong>en Landesteile Kanadas. Als<br />
einzige Stadt <strong>der</strong> Inuit ist das im Mackenzie-Delta gelegene Inuvik über eine Straße erre<strong>ich</strong>-<br />
bar. Der Gütertransport muss daher größtenteils per Luftfracht beziehungsweise im Sommer<br />
auch durch Schiffe erfolgen, wodurch wie<strong>der</strong>um die Transportkosten in die Höhe getrieben<br />
werden. Die Inuit sind jedoch bezügl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Versorgung mit Nahrungsmitteln und weiteren<br />
Konsumgütern zu großen Teilen auf Einfuhren angewiesen, da eine Produktion vor Ort für<br />
die meisten Güter aufgrund des sehr kleinen Marktes unrentabel ist. Dies führt wie<strong>der</strong>um zu<br />
hohen Lebenshaltungskosten. Gle<strong>ich</strong>zeitig verfügen die Inuit (vor allem in Kanada und Alas-<br />
ka) größtenteils über eine geringe Kaufkraft. Geringe Ersparnisse und hohe Arbeitslosigkeit<br />
sind hierfür die Hauptgründe (vgl. FUGMANN 2009:73).<br />
2001 2006 2011<br />
Grönland 9,4% ¹ 8,6% ¹ 9,6% ¹<br />
Kanada 6% ² 5,2% ² 7,4% ³<br />
Nunavut 20,8% ² 19,2% ² 16,6% ⁴<br />
Nunavik 14,7% ² 18,8% ² k. A.<br />
Nunatsiavut 33,9% ² 34,8% ² k. A.<br />
Inuvialuit-Region 17,9% ² 24,5% ² k. A.<br />
Alaska 6,1% ⁵ 6,9% ⁵ 7,5% ⁵<br />
Nome k. A. k. A. 14,5% ⁶<br />
North Slope k. A. k. A. 5,5% ⁶<br />
North West Arctic k. A. k. A. 16,5% ⁶<br />
Wade Hampton k. A. k. A. 23,5% ⁶<br />
Tabelle 2: Arbeitslosenquoten in den Siedlungsgebieten <strong>der</strong> Inuit<br />
(eigene Darstellung; Daten: ¹GRØNLANDS STATISTIK 2001/2006/2011a; ²NUNIVAAT – NUNAVIK STATISTICS PROGRAM 2008; ³STATISTICS<br />
CANADA 2011; ⁴NUNAVUT BUREAU OF STATISTICS o.J.; ⁵UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR – BUREAU OF LABOR STATISTICS o.J.; ⁶STATE OF<br />
ALASKA – DEPARTMENT OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT 2011:2)
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 53<br />
Bevor im Folgenden einzelne wirtschaftl<strong>ich</strong>e Schwerpunkte <strong>der</strong> Inuit exemplarisch darge-<br />
stellt werden, kann als Grundtendenz festgehalten werden, <strong>dass</strong> die Inuit in Grönland wirt-<br />
schaftl<strong>ich</strong> deutl<strong>ich</strong> besser dastehen als in Kanada und weiten Teilen Alaskas. So liegt bei-<br />
spielsweise die Arbeitslosenquote (vgl. Tab. 2) in Grönland konstant unter 10%. Zurückzufüh-<br />
ren ist dies primär auf eine gezielte und angepasste Wirtschafts- und Entwicklungspolitik im<br />
Rahmen <strong>der</strong> mittlerweile dreißigjährigen Autonomie sowie vor allem in Westgrönland auf<br />
eine vielseitiger ausger<strong>ich</strong>tete Wirtschaft (vgl. NUTTALL 2005d:782f). Insbeson<strong>der</strong>e in Kanada,<br />
aber auch in Teilen Alaskas hingegen liegen die Arbeitslosenquoten <strong>der</strong> Inuit um ein Vielfa-<br />
ches über dem jeweiligen Landesdurchschnitt. Ursächl<strong>ich</strong> hierfür ist neben dem Fehlen grö-<br />
ßerer Arbeitgeber im Kontext allgemeiner Strukturschwäche auch das niedrige Bildungsni-<br />
veau weiter Teile <strong>der</strong> Inuitbevölkerung. Beispielsweise haben in Kanada 51% <strong>der</strong> Inuit keinen<br />
Schulabschluss. Nur 36% <strong>der</strong> kanadischen Inuit können eine Berufsausbildung vorweisen,<br />
darunter 4% einen Hochschulabschluss (vgl. STATISTICS CANADA 2008:14ff). In Alaska ist die Si-<br />
tuation weitgehend ähnl<strong>ich</strong>. Eine Ausnahme bildet ledigl<strong>ich</strong> das North Slope Borough, wo die<br />
Inuit an dem Wohlstand, den <strong>der</strong> wirtschaftl<strong>ich</strong>e Aufschwung durch die Erdölfunde in Prud-<br />
hoe Bay nach s<strong>ich</strong> zog, partizipieren und zudem einen bedeutenden Teil ihrer Gewinne in das<br />
Bildungs- und Sozialsystem investierten (vgl. IRLBACHER FOX 2005:1879).<br />
Die w<strong>ich</strong>tigsten wirtschaftl<strong>ich</strong>en Standbeine <strong>der</strong> Inuit sind heute Fischerei, Jagd, Bergbau<br />
und Erdöl- bzw. Erdgasför<strong>der</strong>ung, Tourismus und <strong>der</strong> öffentl<strong>ich</strong>e Dienst. Jedoch weisen die<br />
einzelnen Regionen innerhalb dieses Spektrums unterschiedl<strong>ich</strong>e Schwerpunkte auf. In<br />
Nunavut etwa beschäftigt die öffentl<strong>ich</strong>e Hand mehr als 50% aller Arbeitnehmer unter den<br />
Inuit. In <strong>der</strong> Privatwirtschaft ist die Erdölindustrie <strong>der</strong> w<strong>ich</strong>tigste Arbeitgeber. Eine zuneh-<br />
mende Bedeutung verze<strong>ich</strong>net daneben gegenwärtig <strong>der</strong> Tourismus (vgl. LÉGARÉ 2005:1525).<br />
Seit dem Nie<strong>der</strong>gang des Pelzhandels fungiert die öffentl<strong>ich</strong>e Verwaltung auch in <strong>der</strong> Inu-<br />
vialuit-Region als bedeutendster Arbeitgeber. Für die Zukunft bietet die Erdgasindustrie Po-<br />
tential für die Schaffung einer größeren Zahl von Arbeitsplätzen (vgl. STERN 2005:1015). An-<br />
<strong>der</strong>s sieht die Situation in Grönland und Nunatsiavut aus (vgl. RICHLING 2005:1155). Dort sind<br />
vor allem die Fischerei und die Jagd von wirtschaftl<strong>ich</strong>er Bedeutung. In Grönland spielt über-<br />
dies die Schafhaltung regional eine Rolle und in jüngerer Zeit entwickelt s<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Tourismus<br />
zu einem wesentl<strong>ich</strong>en Wirtschaftsfaktor (vgl. NUTTALL 2005d:782f). In Alaska stützt s<strong>ich</strong> die<br />
Wirtschaft <strong>der</strong> Inuit primär auf die Fischerei sowie im North Slope Borough ebenso auf die
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 54<br />
Erdölindustrie (vgl. PRETES 2005:25). In Nunavik letztl<strong>ich</strong> spielen traditionelle Wirtschaftsfor-<br />
men heute kaum noch eine Rolle. Behörden sowie das Bildungs- und Gesundheitswesen sind<br />
die bedeutendsten Arbeitgeber. Daneben stellen <strong>der</strong> Bergbau und das Bauwesen eine große<br />
Zahl von Arbeitsplätzen (vgl. JACOBS 2005a:1520).<br />
Die traditionelle Wirtschaftsordnung <strong>der</strong> Inuit basierte zu großen Teilen auf Subsistenz-<br />
wirtschaft. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat jedoch ein tiefgreifen<strong>der</strong> Wandel stattge-<br />
funden, <strong>der</strong> eine vermehrte Hinwendung zur Lohnwirtschaft mit s<strong>ich</strong> brachte. Diese konnte<br />
die Subsistenzwirtschaft allerdings n<strong>ich</strong>t gänzl<strong>ich</strong> verdrängen. Vielmehr hat s<strong>ich</strong> unter <strong>der</strong><br />
indigenen Bevölkerung eine gemischte Wirtschaft etabliert, das heißt, Substistenz- und<br />
Lohnwirtschaft werden ergänzend betrieben. Dabei geht <strong>der</strong> Trend gegenwärtig dahin, <strong>dass</strong><br />
ursprüngl<strong>ich</strong> subsistenzwirtschaftl<strong>ich</strong>e Unternehmungen den Status als Nebenerwerbsquelle<br />
einnehmen und vor allem bei jüngeren und mittleren Altersklassen aufs Wochenende ver-<br />
legt werden. Zudem ze<strong>ich</strong>net s<strong>ich</strong> im traditionellen Fleischverteilungsnetz ein Wandel ab:<br />
„Der für den Verkauf bestimmte Fleischanteil nimmt zu, während s<strong>ich</strong> <strong>der</strong> vom System er-<br />
fasste Personenkreis pro Jäger reduziert“ (THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:197). Zurückzuführen<br />
ist dies unter an<strong>der</strong>em auf steigende Kosten für die Jagd und Fischerei, die aus den mo<strong>der</strong>-<br />
nen Ausrüstungen – Gewehre, Motorschlitten und motorisierte Frachtkanus – resultieren<br />
(vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:197).<br />
Ein traditionelles wirtschaftl<strong>ich</strong>es Standbein <strong>der</strong> Inuit bildeten die Jagd auf Robben, Wale,<br />
Eisbären, Karibus und Moschusochsen sowie <strong>der</strong> Handel mit Fleisch und Fellen. Dem Arten-<br />
schutz dienende Fang- und Jagdquoten sowie internationale Handelsbeschränkungen führ-<br />
ten jedoch zu einem tiefgreifenden Wandel in diesem Sektor. So kam <strong>der</strong> Ringelrobbenjagd<br />
traditionell eine große Bedeutung für die Selbstversorgung <strong>der</strong> Inuit zu; die Felle waren da-<br />
neben eines ihrer w<strong>ich</strong>tigsten Handelsgüter. Mitte <strong>der</strong> 1960er Jahre führte jedoch die auf<br />
grausame Weise vorgenommene Tötung einer großen Zahl von Jungtieren an <strong>der</strong> kanadi-<br />
schen Südostküste durch <strong>weiß</strong>e Jäger (Inuit waren hieran n<strong>ich</strong>t beteiligt) zunächst zu einem<br />
Kaufboykott und ab 1983 schließl<strong>ich</strong> zu einem Importverbot für Ringelrobbenfelle in Europa.<br />
In achtzehn von zwanzig Inuit-Siedlungen in <strong>der</strong> Inuvialuit-Region bewirkte dies einen 60-<br />
prozentigen Rückgang <strong>der</strong> Jahreseinnahmen. Um die Versorgung <strong>der</strong> Bevölkerung mit Fleisch<br />
abzus<strong>ich</strong>ern und die Jagd rentabel zu gestalten, subventionieren sowohl die kanadische als<br />
auch die grönländische Regierung die Preise für Ringelrobbenfelle bis heute. Der Erfolg ist
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 55<br />
jedoch wechselhaft. Die Jagd auf Wale und Eisbären wird heutzutage durch Jagdquoten be-<br />
stimmt. Lizenzen für die Eisbärenjagd werden in <strong>der</strong> gesamten nordamerikanischen Arktis<br />
ausschließl<strong>ich</strong> an Inuit vergeben; in Grönland und Alaska darf sie nur zu Subsistenzzwecken<br />
erfolgen. Daher ist in Grönland zudem die Nutzung einer mo<strong>der</strong>nen Jagdausrüstung unter-<br />
sagt. Eisbärenfelle aus Kanada dürfen jedoch exportiert werden und sind insofern wirtschaft-<br />
l<strong>ich</strong> bedeutsam. Hauptabnehmer <strong>der</strong> Felle ist Japan. Insgesamt werden in Kanada pro Jahr<br />
600 Eisbären erlegt, in Alaska 100 und in Grönland 75. Der Walfang <strong>der</strong> Inuit zielt hauptsäch-<br />
l<strong>ich</strong> auf den Grönlandwal und konzentriert s<strong>ich</strong> sehr stark auf Alaska. Seit 1977 ist er durch<br />
die Internationale Walfangkommission reglementiert. Gegenwärtig dürfen die alaskischen<br />
Inuit jährl<strong>ich</strong> 280 Grönlandwale erlegen, wobei jedes einzelne Tier etwa 8.000 kg Fleisch,<br />
Muktuk (die Außenhaut des Wals, die als Delikatesse gilt) und essbare Innereien liefert (vgl.<br />
THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:197ff).<br />
Neben <strong>der</strong> Jagd ist für die Inuit teilweise auch die Tierhaltung von Bedeutung. So hat s<strong>ich</strong><br />
in Grönland die Schafhaltung wirtschaftl<strong>ich</strong> etabliert. Die 60, in <strong>der</strong> Regel in Familienbesitz<br />
befindl<strong>ich</strong>en Betriebe sind hauptsächl<strong>ich</strong> in den südgrönländischen Orten Nanortalik, Nar-<br />
saq, Qaqortoq und Paamiut angesiedelt. Sie beschäftigen etwa 350 Menschen; weitere 63<br />
sind im zentralen Schlachthof in Narsaq angestellt. In den letzten Jahren wurde in <strong>der</strong> grön-<br />
ländischen Schafhaltung von extensiver zu intensiver Wirtschaft übergegangen. Das bedeu-<br />
tet, <strong>dass</strong> die Schafe nur noch im Sommer auf den Bergweiden bleiben, während sie im Win-<br />
ter in Ställen gehalten und dort mit Heu versorgt werden. Der Staat subventionierte den Bau<br />
<strong>der</strong> Ställe und Scheunen. Insgesamt wurden in Grönland im Jahr 2000 zwischen 26.000 und<br />
28.000 Lämmer geschlachtet (vgl. NUTTALL 2005d:782 & THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:205). Von<br />
abnehmen<strong>der</strong> Bedeutung ist die Haltung halbdomestizierter Rentiere durch die Inuit. Mitt-<br />
lerweile existieren noch vierzehn Herden, von denen s<strong>ich</strong> elf in Alaska befinden, eine im Ma-<br />
ckenzie-Delta sowie zwei in Westgrönland. Die Herden umfassen zusammen 35.000 Tiere.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> geringen Nachfrage nach Rentierfleisch sowie wachsendem Wi<strong>der</strong>stand gegen<br />
den Schutz <strong>der</strong> Rentierweideflächen von Seiten <strong>der</strong> lokalen Bevölkerung ist ein deutl<strong>ich</strong>er<br />
Rückgang <strong>der</strong> Rentierhaltung zu erwarten (vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:204).<br />
Die Küstenfischerei ist ein w<strong>ich</strong>tiger Wirtschaftszweig <strong>der</strong> Inuit. Zu unterscheiden sind<br />
hier die in <strong>der</strong> gesamten nordamerikanischen Arktis betriebene Fischerei für den Eigenbe-<br />
darf einerseits und die regional auf Westalaska, Nunatsiavut und Westgrönland begrenzte
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 56<br />
kommerzielle Fischerei an<strong>der</strong>erseits. Letztere stellt in den betreffenden Regionen mittler-<br />
weile die Haupteinnahmequelle <strong>der</strong> Inuit dar; „an <strong>der</strong> Küste W-Alaskas gilt die kommerzielle<br />
Fischerei auf Lachs und Hering als einziger Bargeldlieferant innerhalb <strong>der</strong> indigenen ‚ge-<br />
mischten Wirtschaft‘“ (THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:208). Das Zentrum <strong>der</strong> westalaskischen<br />
Fischerei ist die Bristol Bay. Innerhalb <strong>der</strong> alaskischen Gewässer weist sie sowohl die um-<br />
fangre<strong>ich</strong>sten Fischbestände als auch die größte Anzahl an Fischern auf. Etwa 90% <strong>der</strong> in<br />
Alaska gefangen Lachse stammen aus <strong>der</strong> Bristol Bay. Die Fischer sind überwiegend Inuit,<br />
daneben aber auch saisonal Ansässige aus an<strong>der</strong>en Landesteilen. Die nördl<strong>ich</strong> angrenzenden<br />
Küstengewässer bis Point Hope werden ausschließl<strong>ich</strong> von Inuit befischt. Die kommerzielle<br />
Lachsfischerei durch die Inuit begann bereits in den 1960er Jahren; die Heringsfischerei ent-<br />
wickelte s<strong>ich</strong> erst ab 1977 im Schutz <strong>der</strong> neu geschaffenen 200-Meilen-Zone, nachdem s<strong>ich</strong><br />
die zuvor durch russische und japanische Flotten stark überfischten Bestände erholt hatten.<br />
In Westgrönland konzentriert s<strong>ich</strong> die Fischerei seit Ende <strong>der</strong> 1970er Jahre auf den küsten-<br />
nahen Fang <strong>der</strong> Rosa Tiefseegarnele. Sie ist mittlerweile das bedeutendste Exportgut Grön-<br />
lands. Eine Ertragssteigerung über das gegenwärtige Maß hinaus scheint allerdings n<strong>ich</strong>t<br />
mögl<strong>ich</strong>, denn zum einen kann das Fanggebiet n<strong>ich</strong>t mehr ausgeweitet werden und zum an-<br />
<strong>der</strong>en kommt auch eine Intensivierung <strong>der</strong> Fischerei wegen Überfischung n<strong>ich</strong>t in Frage. Fi-<br />
schereibiologen raten hingegen eine Vermin<strong>der</strong>ung des Fangvolumens um 20% an. Überfi-<br />
schung ist auch vor den Küsten Labradors ein schwerwiegendes Problem. Die dortigen<br />
Dorschbestände sind bereits in den 1980er Jahren massiv eingebrochen und erholen s<strong>ich</strong><br />
seither nur langsam. Auch die Heilbuttbestände sind überfischt, für die Lachsforellen-<br />
Fischerei gelten Einschränkungen und <strong>der</strong> Lachsfang ist <strong>der</strong>weil gänzl<strong>ich</strong> verboten. Vor die-<br />
sem Hintergrund konzentrieren s<strong>ich</strong> die Inuit Nunatsiavuts auf den Fang <strong>der</strong> Rosa Tiefsee-<br />
garnele, den sie zumeist in Kooperation mit südkanadischen Hochseefischereiunternehmen<br />
durchführen. Die Labrador Inuit Development Corporation ist hierfür im Besitz von fünf Kon-<br />
zessionen. Da die Küsten Nordlabradors nur für eine kurze Zeit des Jahres eisfrei sind, ist die<br />
Küstenfischerei nur eingeschränkt mögl<strong>ich</strong>. Die ganzjährig durchführbare Hochseefischerei<br />
bietet den Inuit somit eine Mögl<strong>ich</strong>keit zur Generierung eines stabilen Einkommens, wobei<br />
die Fischer ihre Löhne größtenteils in die gemischte Wirtschaft einbringen (vgl. THANNHEI-<br />
SER/WÜTHRICH 2002:207ff).
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 57<br />
Die einzelnen Landrechteabkommen<br />
beinhalten jeweils Vereinbarungen über<br />
verschiedene Formen des Ressourcen-<br />
Ko-Managements. Die Inuit haben seit-<br />
her die Mögl<strong>ich</strong>keit an <strong>der</strong> Politikformu-<br />
lierung bezügl<strong>ich</strong> des Verfahrens mit<br />
n<strong>ich</strong>t erneuerbaren Rohstoffen und auch<br />
an <strong>der</strong>en Umsetzung mitzuwirken. Dane-<br />
ben partizipieren sie in regional unter-<br />
schiedl<strong>ich</strong>em Maße an den wirtschaftli-<br />
chen Erträgen aus <strong>der</strong> Rohstoffför<strong>der</strong>ung<br />
(vgl. DÖRRENBÄCHER 2006:52). Am ausge-<br />
prägtesten ist dies bei <strong>der</strong> Erdölförde-<br />
rung im alaskischen North Slope Borough<br />
<strong>der</strong> Fall. Die Inuit erhalten dort die voll-<br />
ständigen Grundbesitzabgaben <strong>der</strong> Erd-<br />
ölgesellschaften. Gegenwärtig sind in <strong>der</strong><br />
Region neun Bohrlöcher in Prudhoe Bay<br />
(vgl. Abb. 25), Kuparuk und Alpine in Be-<br />
trieb. Das För<strong>der</strong>volumen ist jedoch rück-<br />
läufig und somit auch das Einkommen<br />
<strong>der</strong> Inuit. Daher ist geplant, weitere Erd-<br />
Abbildung 25: Erdölför<strong>der</strong>gebiete und Verkehrsinfrastruktur<br />
in Alaska<br />
(THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:217)<br />
Abbildung 26: Rohstofferschließung und Verkehrsinfrastruktur<br />
in <strong>der</strong> kanadischen Arktis<br />
(THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:219)<br />
ölfel<strong>der</strong> im Arctic National Wildlife Refuge zu erschließen. Sowohl Alaska als auch Kanada<br />
verfügen fernerhin innerhalb <strong>der</strong> Siedlungsgebiete <strong>der</strong> Inuit über umfangre<strong>ich</strong>e Erdgasvor-<br />
kommen (vgl. Abb. 26). Aufgrund des lange Zeit niedrigen Preisniveaus wurden sie jedoch<br />
bisher kaum erschlossen. Mittlerweile gibt es allerdings Pläne für den Bau einer Arctic Gas<br />
Pipeline, die von Prudhoe Bay nach Inuvik und von dort durch das Mackenzie-Tal nach Calga-<br />
ry führen soll. Dies würde eine deutl<strong>ich</strong>e Intensivierung <strong>der</strong> Nutzung <strong>der</strong> Gasvorkommen in<br />
<strong>der</strong> Beaufortsee nach s<strong>ich</strong> ziehen. Metallische Rohstoffe werden vor allem in Nunatsiavut<br />
abgebaut. Dort finden s<strong>ich</strong> große Vorkommen an Nickel, Kupfer und Kobalt. An den Einnah-<br />
men aus dem Bergbau sind die Inuit wie bereits unter 3.3 (Seite 47) beschrieben beteiligt. In<br />
Grönland findet bereits seit den 1980er Jahren kein rentabler Bergbau mehr statt. Die ehe-
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 58<br />
mals großen Kryolithvorkommen sind erschöpft und auch die Blei-Zink-Grube in Maarmorilik<br />
wurde 1990 geschlossen. Explorationen in jüngerer Zeit haben zwar zu vielversprechenden<br />
Funden von Erdöl und Erdgas, Blei-Zink- und Gol<strong>der</strong>zlagerstätten sowie Diamantenvorkom-<br />
men geführt, in naher Zukunft ist jedoch keine Erschließung geplant (vgl. THANNHEI-<br />
SER/WÜTHRICH 2002:216ff).<br />
Einen gegenwärtig stark wachsenden<br />
Wirtschaftszweig stellt <strong>der</strong> Tourismus dar.<br />
Im Zuge des Aufkommens des Massentou-<br />
rismus in <strong>der</strong> zweiten Hälfte des 20. Jahr-<br />
hun<strong>der</strong>ts wurde auch die nordamerikani-<br />
sche Arktis als Reiseziel attraktiv. Es ist vor<br />
allem die Suche nach Ursprüngl<strong>ich</strong>keit<br />
und unberührter Natur, die Reisende in<br />
die Arktis zieht, und an die arktische Tou-<br />
rismusorganisationen appellieren. So<br />
40000<br />
35000<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
Abbildung 28: Anzahl <strong>der</strong> ausländischen Touristen in<br />
Grönland 2001 bis 2005<br />
(eigene Darstellung nach: GRØNLANDS STATISTIK 2010)<br />
wirbt <strong>der</strong> Greenland Tourism and Business Council mit dem Slogan „Greenland – be a pio-<br />
neer“ (GREENLAND.COM o.J.) und Nunavut for<strong>der</strong>t auf: „discover Canada’s best kept secret…<br />
explore Nunavut“ (EXPLORE NUNAVUT o.J.). Die Zahl <strong>der</strong> Touristen nimmt von Jahr zu Jahr zu.<br />
Während in Grönland beispielsweise die Zahl <strong>der</strong> ausländischen Touristen Anfang <strong>der</strong> 1990er<br />
Jahre noch bei 3.000 pro Jahr lag, wurden 2005 bereits 34.000 ausländische Reisende ver-<br />
ze<strong>ich</strong>net. Die Aktivitäten <strong>der</strong> Arktis-Touristen umfassen „specialized adventure tourism,<br />
guided walking, wildlife, ornithological tours, sport fishing and sport hunting, cruise ships,<br />
dog mushing, cross-country skiing, and visits to Santa Claus“ (NUTTALL 2005g:2038). Da <strong>der</strong><br />
Tourismus s<strong>ich</strong> bisher stark auf die Sommermonate konzentriert, wird insbeson<strong>der</strong>e durch<br />
Wintersportevents wie das Yukon Quest-Hundeschlittenrennen o<strong>der</strong> die Eis-Golf-<br />
Meisterschaften in Uummannaq versucht, die Touristenzahlen in den Wintermonaten zu<br />
steigern. Ein relativ junger Trend ist daneben <strong>der</strong> arktische Kultur-Tourismus. Das Bereisen<br />
abgelegener Inuit-Dörfer und <strong>der</strong> direkte Kontakt mit <strong>der</strong> indigenen Bevölkerung werden<br />
vermehrt nachgefragt. „The remoteness of Arctic villages (many of wh<strong>ich</strong> are only accessible<br />
by air) and traditional Native culture is attractive for tourists in search of authenticity“ (NUT-<br />
TALL 2005g:2039). In Alaska werden solche Reisen in Kooperation mit den im ANCSA geschaf-
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 59<br />
fenen lokalen Körperschaften <strong>der</strong> Inuit angeboten. In ökonomischer Perspektive bietet <strong>der</strong><br />
Tourismus den Inuit eine Mögl<strong>ich</strong>keit zu größerer Eigenständigkeit. Die touristische Erschlie-<br />
ßung <strong>der</strong> nordamerikanischen Arktis führt zu einem Ausbau <strong>der</strong> Infrastruktur und schafft<br />
Arbeitsplätze im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Souvenirhandel und im Personentrans-<br />
portgewerbe. Lokal führt dies zu einer Diversifizierung <strong>der</strong> Wirtschaftsstruktur, vor allem in<br />
stark durch Subsistenzwirtschaft geprägten Inuit-Siedlungen. Um die künftige Entwicklung<br />
des arktischen Tourismus nachhaltig zu gestalten, hat die Sustainable Development Working<br />
Group des Arctic Council das Programm SMART (Sustainable Model for Arctic Regional Tou-<br />
rism) ins Leben gerufen. Ziel von SMART ist es, im Tourismussektor die Gründung kleiner und<br />
mittelgroßer Unternehmen zu för<strong>der</strong>n, wobei Wert darauf gelegt wird, <strong>dass</strong> die Unterneh-<br />
men ökonomisch effektiv und gle<strong>ich</strong>zeitig ökologisch und kulturell angepasst agieren (vgl.<br />
NUTTALL 2005g:2037ff).<br />
Letztl<strong>ich</strong> stellt auch das Militär zumindest regional einen gewissen Wirtschaftsfaktor dar,<br />
wenngle<strong>ich</strong> seine Bedeutung seit Ende des Kalten Krieges deutl<strong>ich</strong> abgenommen hat. In den<br />
1950er Jahren wurde eine Reihe von Militärbasen und Radarstationen in <strong>der</strong> nordamerikani-<br />
schen Arktis err<strong>ich</strong>tet, da die Querung über das Nordpolarmeer für Interkontinentalraketen<br />
die kürzeste Strecke zur Sowjetunion darstellte. Die sogenannte Distant Early Warning Line<br />
(DEW-Line) erstreckte s<strong>ich</strong> die gesamte arktische Küste entlang durch Alaska, Kanada und<br />
Grönland. In den 1990er Jahren wurden die Standorte <strong>der</strong> DEW-Line geschlossen; geblieben<br />
ist ledigl<strong>ich</strong> die US-Luftwaffenbasis in Thule, die bis heute neben Clear/Alaska 12 und Fylingda-<br />
les/Großbritannien eines von drei Zentren des Ballistic Missile Early Warning System ist. Ge-<br />
genwärtig sind in Thule 800 Mitarbeiter stationiert, die aus den USA, Kanada, Dänemark und<br />
Grönland stammen (vgl. THANNHEISER/WÜTHRICH 2002:237f).<br />
Eines <strong>der</strong> wesentl<strong>ich</strong>en Ziele <strong>der</strong> Autonomiebewegung <strong>der</strong> Inuit neben dem Schutz <strong>der</strong><br />
Kultur und Identität war es, eine Grundlage für die wirtschaftl<strong>ich</strong>e Eigenständigkeit <strong>der</strong> Inuit<br />
zu schaffen. Eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den Development<br />
Corporations zu, die seit den 1970er Jahren im Zuge <strong>der</strong> Verhandlungen über die Landrechte<br />
<strong>der</strong> Inuit in Kanada gegründet wurden. Ihr Startkapital bezogen sie teilweise über die Land-<br />
rechte-Abkommen aus staatl<strong>ich</strong>en Transferleistungen und teilweise direkt von den regiona-<br />
12 Die Clear Air Force Station befindet s<strong>ich</strong> in einem Teil Alaskas, <strong>der</strong> n<strong>ich</strong>t zum Siedlungsgebiet <strong>der</strong> Inuit gehört.<br />
Daher wird diese Militärbasis im Folgenden n<strong>ich</strong>t näher thematisiert.
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 60<br />
len Inuit-Organisationen. Sieben dieser Corporations existieren in Kanada, jeweils eine zent-<br />
rale in Nunavut, Nunavik, Nunatsiavut und <strong>der</strong> Inuvialuit-Region, sowie drei weitere, regio-<br />
nale in den drei Distrikten Nunavuts. Ihre Aufgabe besteht darin, durch Investitionen in wirt-<br />
schaftl<strong>ich</strong>e Projekte und Unternehmen nachhaltiges Wachstum zu för<strong>der</strong>n und Arbeitsplätze<br />
für die Inuit zu schaffen (vgl. FUGMANN 2009:69f).<br />
Als Beispiel einer solchen Development Corporation soll hier die Labrador Inuit Develop-<br />
ment Corporation vorgestellt werden. Sie ist in Nunatsiavut, dem Inuit-Siedlungsgebiet in <strong>der</strong><br />
kanadischen Provinz Neufundland und Labrador tätig. Unter allen Inuit-Regionen weist<br />
Nunatsiavut mit 34,8% im Jahr 2006 die höchste Arbeitslosenquote auf (vgl. FUGMANN<br />
2009:75).<br />
Die Labrador Inuit Development Corporation (LIDC) wurde 1982 als wirtschaftl<strong>ich</strong>er Arm<br />
<strong>der</strong> Labrador Inuit Association gegründet. Von dieser sowie von privaten Investoren erhielt<br />
sie auch ihr Startkapital. Ursprüngl<strong>ich</strong> waren an <strong>der</strong> LIDC drei Anteilseigner beteiligt. Mitt-<br />
lerweile wurden diese Anteile jedoch aus finanziellen Gründen in eine Treuhandgesellschaft,<br />
die Labrador Inuit Capital Strategy Trust, überführt, die <strong>der</strong> Nunatsiavut-Regierung unter-<br />
steht. Die LIDC zahlt dafür Verwaltungsbeiträge an die Gesell-<br />
schaft, die ihr diese für Investitionen in neue Projekte wie<strong>der</strong><br />
zur Verfügung stellt (vgl. Abb. 28). Die Treuhandgesellschaft<br />
fungiert außerdem als Bürge für Kredite. Gegenwärtig<br />
befinden s<strong>ich</strong> unter den von <strong>der</strong> LIDC geför<strong>der</strong>ten Toch-<br />
tergesellschaften unter an<strong>der</strong>em die Torngait U-<br />
jaganniavingit Corporation, die zwei Steinbrüche<br />
bewirtschaftet, den Stein maßgefertigt be- und<br />
verarbeitet und unter an<strong>der</strong>em nach Italien und<br />
in die USA exportiert, sowie das Sägewerk Post<br />
Mill Lumber und die Garnelen-Fischerei PiKalujak<br />
Fisheries (vgl. FUGMANN 2009:75ff).<br />
Nunatsiavut-Regierung<br />
Labrador Inuit Capital<br />
Strategy Trust<br />
Labrador Inuit<br />
Development Corporation<br />
Tochtergesellschaften<br />
und Joint Ventures<br />
Abbildung 28: Vertikale Integration <strong>der</strong> Labrador<br />
Inuit Development Corporation im Verhältnis<br />
zur Nunatsiavut-Regierung<br />
(Eigene Darstellung in Anlehnung an FUGMANN<br />
2009:75)
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 61<br />
3.5 Inuit-Identität in <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne: die Rolle von Selbstbestimmung und indigenen<br />
Werten<br />
Den Vorstellungen und Bil<strong>der</strong>n vom Leben <strong>der</strong> Inuit und ihrem Lebensraum in <strong>der</strong> Arktis,<br />
die s<strong>ich</strong> in <strong>der</strong> Vergangenheit in <strong>der</strong> Welt verbreitet haben, ist größtenteils eines gemein:<br />
Ihre Urheber sind n<strong>ich</strong>t die Inuit selbst. Es waren zumeist Entdecker, Kolonialherren, Han-<br />
dels- und Forschungsreisende aller Art sowie Dokumentarfilmer und -journalisten, die mit<br />
ihren Beschreibungen ein auf verschiedene Weise vereinfachtes und verzerrtes Bild ze<strong>ich</strong>ne-<br />
ten. Dies hat zur Folge, <strong>dass</strong> „Native people live within a world of imaginary that isn’t their<br />
own“ (ALIA 2005:941). FIENUP-RIORDAN (1995:ix) stellt dazu heraus, die am weitesten verbreite-<br />
ten Vorstellungen in Bezug auf die Inuit besagten, <strong>dass</strong><br />
„all Eskimos live in igloos, fight polar bears, and are peaceful, smiling nature children of the Arctic […]. The<br />
other side of that – with no middle ground – is the portrayal of native, primitive savages, trying to survive in<br />
a barren environment and at the mercy of white exploiters and civilization“.<br />
Dieses Blatt beginnt s<strong>ich</strong> mittlerweile zu wenden. Ab den 1960er<br />
Jahren ist ein Wie<strong>der</strong>aufblühen <strong>der</strong> Inuit-Kultur zu beobachten, das<br />
einhergeht mit einem Streben nach Rückgewinnung <strong>der</strong> Selbstbe-<br />
stimmung. Ausdruck findet dies in dem politischen Autonomiepro-<br />
zess <strong>der</strong> letzten Jahrzehnte, <strong>der</strong> Gründung multilateraler Organisati-<br />
onen wie <strong>der</strong> Inuit Circumpolar Conference, aber auch in verschie-<br />
denen Initiativen zur Repräsentation und Selbstdarstellung <strong>der</strong> Inuit.<br />
Sie beginnen s<strong>ich</strong> von dem ‚Stereotyp des frierenden Eskimos im<br />
Iglu‘ zu lösen (vgl. ALIA 2005:940ff). „Images of indigeneous peoples<br />
are no longer constructed primarily from the outside, looking in;<br />
they are taking control of their own image-making“ (ALIA 2005:940).<br />
Indigene Filmproduktionen spielen in diesem Zusammenhang ei-<br />
Abbildung 29: Filmplakat<br />
<strong>der</strong> Igloolik Isuma-<br />
Produktion ‚Atanarjuat<br />
(the fast runner)‘<br />
(http://www.cinecovershd.fr/gallerie/files/<br />
1/atanarjuat_la_legende<br />
_de_l_homme_rapide_4_<br />
original.jpg)<br />
ne bedeutende Rolle. So stellt etwa IGLOOLIK ISUMA PRODUCTIONS mit dem Satz „From the inside<br />
and through Inuit eyes“ (IGLOOLIK ISUMA PRODUCTIONS 2001) das vollkommen Neue des Filmes<br />
Atanarjuat (the fast runner) 13 aus dem Jahr 2001 heraus. Atanarjuat war <strong>der</strong> erste von Inuit<br />
13 Atanarjuat, die Filme The Journals of Knud Rasmussen und Before Tomorrow sowie die 13-teilige TV-Serie<br />
Nunavut können in voller Länge und mit englischen Untertiteln unter http://www.isuma.tv/lo/en/isumaproductions<br />
online angesehen werden.
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 62<br />
produzierte und auf Inuktitut gedrehte Film, <strong>der</strong> ein internationales Publikum erre<strong>ich</strong>te. In<br />
Kanada war er sogar <strong>der</strong> erfolgre<strong>ich</strong>ste Film des Jahres und bei den Filmfestspielen in Cannes<br />
wurde er als bester Spielfilm mit <strong>der</strong> Caméra d’Or ausgeze<strong>ich</strong>net. ZACHARIAS KUNUK, <strong>der</strong> Regis-<br />
seur des Filmes, zählte zugle<strong>ich</strong> 1990 neben PAUL APAK ANGILIRQ, PAUL QUALITALIK und NORMAN<br />
COHN zu den Begrün<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Produktionsfirma Igloolik Isuma, <strong>der</strong> ersten unabhängigen Film-<br />
gesellschaft <strong>der</strong> Inuit. Die Gründung dieses Unternehmens bedeutete für die Inuit einen gro-<br />
ßen Schritt in R<strong>ich</strong>tung Selbstbestimmung, denn in <strong>der</strong> Vergangenheit waren gerade Medien<br />
wie das Fernsehen zu einer Bedrohung für ihre Kultur geworden. Neben Maßnahmen wie<br />
<strong>der</strong> Missionierung und <strong>der</strong> Einr<strong>ich</strong>tung staatl<strong>ich</strong>er Schulen in <strong>der</strong> Arktis war auch die Einfüh-<br />
rung des Fernsehens Teil <strong>der</strong> Assimilierungspolitik <strong>der</strong> kanadischen Regierung. Der ehemali-<br />
ge ITC-Präsident JOHN AMOGOALIK beschreibt dieses Vorgehen als Invasion einer fremden Kul-<br />
tur in die Wohnzimmer <strong>der</strong> Inuit. Das staatl<strong>ich</strong>e TV-Programm verdrängte dabei nach und<br />
nach die Tradition <strong>der</strong> mündl<strong>ich</strong>en Weitergabe alter Gesch<strong>ich</strong>ten von Generation zu Genera-<br />
tion (vgl. HUHNDORF 2009:71ff). „Four thousand years of oral history silenced by fifty years of<br />
priests, schools and cable TV? This death of history is happening in my lifetime“ schil<strong>der</strong>t<br />
KUNUK (zit. in HUHNDORF 2009:73) die Situation und folgert daraus: „We had to make media<br />
work for us, to preserve the culture“ (KUNUK zit. in HUHNDORF 2009:73).<br />
Stärkung von Kultur, Sprache und Identität <strong>der</strong> Inuit war die Intention hinter <strong>der</strong> Grün-<br />
dung von Igloolik Isuma. Alle Produktionen sind auf Inuktitut gedreht; Schauspieler, Regis-<br />
seure und Drehbuchautoren sind ausnahmslos Inuit. Die Spielfilme und Dokumentationen<br />
stellen die traditionellen Lebensweisen dar, lassen dabei Kritik an <strong>der</strong> Kolonisierung deutl<strong>ich</strong><br />
werden und Ältere <strong>der</strong> Inuit zu Themen wie Erziehung, Bildung, Missionierung und Autono-<br />
miefor<strong>der</strong>ungen zu Wort kommen. Dabei erfolgt die Fokussierung auf die Tradition n<strong>ich</strong>t als<br />
bloßer Rückblick auf Vergangenes, son<strong>der</strong>n betont <strong>der</strong>en Fortdauern bis in die Gegenwart.<br />
Atanarjuat beispielsweise ist eine alte Legende, die davon handelt, <strong>dass</strong> ein böser Schamane<br />
einen Fluch ausspr<strong>ich</strong>t und die einzelnen Charaktere <strong>der</strong> Gesch<strong>ich</strong>te s<strong>ich</strong> infolge dessen von<br />
Traditionen und alten Werten wie <strong>der</strong> Achtung vor Älteren o<strong>der</strong> dem Teilen <strong>der</strong> Vorräte in<br />
schlechten Zeiten abwenden. Diese Abkehr führt die Gemeinschaft letztl<strong>ich</strong> ins Ver<strong>der</strong>ben,<br />
wodurch Atanarjuat die Bedeutung und den Wert <strong>der</strong> Traditionen bis in die Gegenwart her-<br />
ausstellt (vgl. HUHNDORF 2009:86ff).
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 63<br />
Daneben ist die Bedeutung von Film- und Fernsehproduktionen – neben Igloolik Isuma ist<br />
in diesem Zusammenhang auch die öffentl<strong>ich</strong>-rechtl<strong>ich</strong>e Inuit Broadcasting Corporation (IBC)<br />
zu nennen – für die Herausbildung einer gemeinsamen Identität und eines Gemeinschaftsge-<br />
fühls unter den Inuit, wie es zuvor n<strong>ich</strong>t existiert hatte, zu nennen. Die Inuit leben in kleinen,<br />
oftmals nur über Flugrouten miteinan<strong>der</strong> verbundenen Siedlungen und Städten über eine<br />
Fläche von mehreren Millionen Quadratkilometern verteilt. Die Fernsehsendungen von IBC<br />
und Igloolik Isuma präsentieren jedoch den Inuit im gesamten<br />
Siedlungsraum gemeinsame Werte, eine gemeinsame Kultur<br />
und Tradition und bieten zugle<strong>ich</strong> eine Plattform für aktuelle<br />
Themen und Interessen <strong>der</strong> Inuit wie etwa die Autonomiebes-<br />
trebungen und die Landrechtefor<strong>der</strong>ungen. Die Inuit legen<br />
ihren eigenen Blick in je<strong>der</strong> für sie relevanten S<strong>ich</strong>t auf s<strong>ich</strong><br />
selbst dar. Während die Traditionen <strong>der</strong> Inuit von Seiten <strong>der</strong><br />
Qallunaat oftmals dazu genutzt wurden, die Inuit als primitiv<br />
und auf die Hilfe und Kontrolle <strong>der</strong> Qallunaat angewiesen dar-<br />
zustellen, berufen s<strong>ich</strong> die Inuit in ihren eigenen Darstellungen<br />
auf ihre Traditionen, um damit ihre kulturelle Gebundenheit<br />
an ihr Land und ihre Identität aufzuzeigen. Selbstdarstellung<br />
geht somit Hand in Hand mit Selbstbestimmung (vgl. HUHNDORF<br />
2009:74ff). Zacharias KUNUK (zit. in HUHNDORF 2009:74f) führt<br />
dazu aus:<br />
„For 175 years, since the Parry expedition of 1822-23, Igloolik Inuit ha-<br />
ve been observed, examined, measured, and studied by other cultures.<br />
To our knowledge, this practice of ‚anthropolgy/ethnography‘ has been<br />
entirely a one-way street. Qallunaat [Europeans] study Inuit, but Inuit<br />
do not study qallunaat. This uneven exchange influences all levels of re-<br />
lation between the two cultures: political, economic, social, and so<br />
forth with qallunaat values and assumptions defining both cultures“.<br />
Die Definition ihrer Kultur über die eigenen Werte – die 38<br />
Dimensionen von Inuit<br />
Qaujimajatuqangit (vgl. Abb.<br />
30) – ist jedoch von zentraler<br />
Inuit Qaujimajatuqangit<br />
Abbildung 30: Die 38 Dimensionen von<br />
Inuit Qaujimajatuqangit<br />
(eigene Darstellung auf <strong>der</strong> Grundlage<br />
von CANADIAN COUNCIL ON LEARNING 2007b:20)<br />
•Belastbarkeit<br />
•Brauchtum<br />
•Zusammenarbeit<br />
•Teilen<br />
•Liebe<br />
•Überleben<br />
•Bewahrung<br />
•Teamwork<br />
•Einfallsre<strong>ich</strong>tum<br />
•Geduld<br />
•Fortschritt<br />
•Beherrschung<br />
•Familie<br />
•zuhören<br />
•Bedeutsamkeit<br />
•Anpassungsfähigkeit<br />
•Beobachtung<br />
•Stärke<br />
•Freiwilligkeit<br />
•Weits<strong>ich</strong>t<br />
•Konsens<br />
•Ausdauer<br />
•Großzügigkeit<br />
•Kraft<br />
•Respekt<br />
•Einigkeit<br />
•Bescheidenheit<br />
•s<strong>ich</strong> entschuldigen<br />
•Akzeptanz<br />
•Einzigartigkeit<br />
•Vernetzung<br />
•Vertrauen<br />
•Hilfe<br />
•Verantwortung<br />
•Beharrl<strong>ich</strong>keit<br />
•Ehrl<strong>ich</strong>keit<br />
•Gle<strong>ich</strong>heit<br />
•Improvisationsvermögen
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 64<br />
Bedeutung für die Identität <strong>der</strong> Inuit in <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne (INUIT TAPIRIIT KANATAMI 2011:71). IQ um-<br />
fasst alle Bere<strong>ich</strong>e <strong>der</strong> traditionellen Inuitkultur und gründet auf drei verschiedenen Arten<br />
von Regeln: Inuit Maligait beschreibt Konventionen, denen gefolgt werden soll, Inuit Tiri-<br />
gusuusiit sind Tabus und Dinge, die vermieden werden sollen, Inuit Piqujangit sind die Dinge,<br />
die ein Inuk tun soll (vgl. CANADIAN COUNCIL ON LEARNING 2007b:20). Letztere sind in acht Prinzi-<br />
pien unterglie<strong>der</strong>t (vgl. Abb. 31). IQ bildet seit jeher die Grundlage des gesellschaftl<strong>ich</strong>en<br />
Zusammenlebens und fungiert über eine Rückbindung an die Tradition als Kontinuität stif-<br />
ten<strong>der</strong> Faktor in <strong>der</strong> Gegenwart und für die Zukunft. Vor diesem Hintergrund ist die Bewah-<br />
rung und die Weitergabe von IQ ein zentrales Anliegen <strong>der</strong> Inuit. So wie diese Prinzipien<br />
ihnen früher ein Überleben in <strong>der</strong> Arktis ermögl<strong>ich</strong>ten, bilden sie heute die Grundlage und<br />
den Orientierungsrahmen <strong>der</strong> Politik und <strong>der</strong> Gesellschaft und sollen vor allem in den Schu-<br />
len an nachfolgende Generationen weitervermittelt werden. INUIT TAPIRIIT KANATAMI hat dem-<br />
entsprechend in <strong>der</strong> National Strategy on Inuit Education die Vermittlung des „Inuit World-<br />
view“ (INUIT TAPIRIIT KANATAMI 2011:71) als eines <strong>der</strong> Hauptziele ausgewiesen. Ziel ist es, junge<br />
Menschen zu Inummarik heranwachsen zu lassen, zu „able human being[s], who can act with<br />
wisdom and use ancestral knowledge skills and attitudes to be successful in today’s world“<br />
(INUIT TAPIRIIT KANATAMI 2011:72).<br />
Respekt für an<strong>der</strong>e, Pflege von Beziehungen<br />
und s<strong>ich</strong> um an<strong>der</strong>e kümmern<br />
Tiere, Land und Umwelt achten<br />
und Sorge dafür tragen<br />
Einfallsre<strong>ich</strong>tum<br />
und Innovation<br />
Zusammenarbeit bei gemeinsamen<br />
Anliegen<br />
Qanuqtuurniq<br />
Avatittinnik<br />
Kamastiarniq<br />
Ikajuqtigiinniq<br />
Inuukatigiitsianiq<br />
Inuit<br />
Piqujangit<br />
Pilimmaksarniq<br />
Tunnganarniq<br />
Aajiiqatigiinniq<br />
Abbildung 31: Die acht Prinzipien von Inuit Piqujangit<br />
(Eigene Darstellung auf <strong>der</strong> Grundlage von GOVERNMENT OF NUNAVUT 2010:1)<br />
Pijitsirniq<br />
Pflege des guten Geistes<br />
durch Offenheit und Gastfreundschaft<br />
Der Familie und Gemeinschaft<br />
dienen<br />
und für sie sorgen<br />
Entscheidungsfindung durch<br />
Diskussion und Konsens<br />
Ausbilden von Fertigkeiten durch Beobachten,<br />
Ausprobieren, Anstrengung und Unterstützung<br />
durch an<strong>der</strong>e
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 65<br />
Inuit Qaujimajatuqangit bildet den Rahmen und die R<strong>ich</strong>tschnur für den Prozess des<br />
ganzheitl<strong>ich</strong>en, lebenslangen Lernens, <strong>der</strong> elementarer Bestandteil <strong>der</strong> Ausbildung und Be-<br />
wahrung <strong>der</strong> Inuit-Identität ist. Das CANADIAN COUNCIL ON LEARNING hat den lebenslangen Lern-<br />
weg <strong>der</strong> Inuit mit seinen maßgebl<strong>ich</strong>en Einflussfaktoren und Determinanten im Inuit Holistic<br />
Lifelong Learning Model dargestellt (vgl. Abb. 32). Es stellt das bei den Inuit beliebte De-<br />
ckenwurfspiel dar und setzt s<strong>ich</strong> aus vier Komponenten zusammen: den Dimensionen des<br />
Gemeinwohls, IQ, den einzelnen Lebens- und Lernbere<strong>ich</strong>en und dem Lebensweg (vgl. CANA-<br />
DIAN COUNCIL ON LEARNING 2007:20).<br />
Abbildung 32: Inuit Holistic Lifelong Learning Model 14<br />
(CANADIAN COUNCIL ON LEARNING 2007a)<br />
14 Eine interaktive Version des Models ist unter http://cli.ccl-cca.ca/Inuit/index.php?q=model abrufbar.
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 66<br />
Das Model zeigt, <strong>dass</strong> s<strong>ich</strong> das Gemeinwohl <strong>der</strong> Inuit aus vier Faktoren zusammensetzt,<br />
dem Wohl <strong>der</strong> Umwelt sowie dem physischen, dem sozialen und dem wirtschaftl<strong>ich</strong>en Wohl<br />
<strong>der</strong> Gemeinschaft. Sie bilden zusammen die Determinanten, die die Inuitgesellschaft in <strong>der</strong><br />
Waage halten. Getragen werden die Gesellschaft und das gesamte Lebensumfeld <strong>der</strong> Inuit<br />
(im Modell die Decke) von den 38 Prinzipien des Inuit Qaujimajatuqangit, das im Modell<br />
durch 38 Inuit repräsentiert wird, die die Decke halten. Die blasser dargestellten Menschen<br />
stehen für die Vorfahren und verweisen auf die spirituelle Kontinuität, die durch die Weiter-<br />
gabe ihrer Namen von einer Generation zur nächsten begründet wird. Im Verständnis <strong>der</strong><br />
Inuit ist mit jedem Namen eine bestimmte Seele verbunden, die alle Träger des gle<strong>ich</strong>en<br />
Namens zu einer geistigen Gemeinschaft verbindet. Ein solcher Seelen-Name (Atiq) bewahrt<br />
die individuelle Identität eines jeden Inuk über den Tod hinaus und lässt somit seine Seele in<br />
seinem Namen weiterleben (vgl. CANADIAN COUNCIL ON LEARNING 2007:20f).<br />
Die runde Decke und die am Außenrand angebrachte Trageschnur versinnbildl<strong>ich</strong>en die<br />
Interdependenz und Vernetzung aller Elemente des Lebens <strong>der</strong> Inuit. Sie sind auf <strong>der</strong> Decke<br />
einzeln dargestellt und in drei Teilbere<strong>ich</strong>e unterglie<strong>der</strong>t. Der erste dieser Teilbere<strong>ich</strong>e ist<br />
Sila, das Äußere, dem ein eigener Geist (Inua), innewohnt. Sila umfasst sowohl das spezifi-<br />
sche Land, mit dem die Inuit traditionell eng verbunden sind, als auch die Umwelt im Allge-<br />
meinen und die dort lebenden Tiere (vgl. INUIT TAPIRIIT KANATAMI 2011:71).<br />
Als zweiter Bere<strong>ich</strong> fungieren die Menschen. Hier sind als beson<strong>der</strong>e Teilbere<strong>ich</strong>e die Fa-<br />
milie, die Ältesten und die Gemeinschaft aufgeführt. Die Gesellschaft <strong>der</strong> Inuit ist durch eine<br />
starke Familienbindung geprägt. Innerfamiliärer Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe zäh-<br />
len zu den Grundwerten <strong>der</strong> Inuit. Entsprechend ist die Loyalität zur Familie allen an<strong>der</strong>en<br />
Verpfl<strong>ich</strong>tungen übergeordnet. Die Ältesten stellen eine beson<strong>der</strong>s angesehene Gruppe un-<br />
ter den Inuit dar. Sie gelten als weise und verfügen über ein großes Wissen über die Vergan-<br />
genheit. Daher kommt ihnen innerhalb <strong>der</strong> Gesellschaft große Bedeutung als Ratgeber und<br />
Gesch<strong>ich</strong>tenerzähler zu. Sie werden mit Respekt behandelt; Kin<strong>der</strong> beispielsweise begrüßen<br />
immer zu erst die Ältesten und danach alle an<strong>der</strong>en (vgl. PAUKTUUTIT 2006:26). Der bis heute<br />
hohe Stellenwert <strong>der</strong> Gemeinschaft resultiert aus <strong>der</strong> Zeit des Nomadenlebens im Stammes-<br />
verbund. Obgle<strong>ich</strong> diese Lebensform unter den Inuit heutzutage <strong>der</strong> Vergangenheit ange-<br />
hört, sind die engen Bande innerhalb <strong>der</strong> Gemeinschaften geblieben. Verantwortungsgefühl
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 67<br />
gegenüber den Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe gelten als Tugenden<br />
(vgl. PAUKTUUTIT 2006:30).<br />
Der dritte Bere<strong>ich</strong> letztl<strong>ich</strong> ist die Kultur. Hier ist vor allem die Sprache von zentraler Be-<br />
deutung für die Identität. Ein Beispiel aus dem Jahr 1970 verdeutl<strong>ich</strong>t dies: Nachdem MOGENS<br />
BOSERUP, ein zu jener Zeit führen<strong>der</strong> Vertreter <strong>der</strong> dänischen Integrationspolitik, in seiner<br />
Rede anlässl<strong>ich</strong> einer Tagung in <strong>der</strong> Knud-Rasmussen-Schule in Sisimiut die Einschätzung<br />
vertreten hatte, die grönländische Sprache habe keine Zukunft, demonstrierten grönländi-<br />
sche Tagungsteilnehmer bei seiner Abreise mit einem Kajakgerüst, dem die Außenhaut fehl-<br />
te. Es war mit <strong>der</strong> Aufschrift versehen: „Here you can see how Greenland looks without its<br />
language“ (zit. nach FÆGTEBORG 2005c:100). Der Sprache Inuktitut wird von den Inuit ein ho-<br />
her Wert beigemessen. Einerseits ist sie für sie das einfachste und adäquateste Mittel zum<br />
Ausdruck <strong>der</strong> eigenen Gedanken und Gefühle, an<strong>der</strong>erseits fungiert sie als Symbol <strong>der</strong> eige-<br />
nen Identität. Vor allem in Kanada besteht in dieser Hins<strong>ich</strong>t jedoch das Problem, <strong>dass</strong> viele<br />
Inuit in <strong>der</strong> Schule ausschließl<strong>ich</strong> auf Englisch unterr<strong>ich</strong>tet wurden und auch außerhalb <strong>der</strong><br />
Schule, hauptsächl<strong>ich</strong> durch die Massenmedien, häufig mit <strong>der</strong> englischen Sprache konfron-<br />
tiert wurden. Inuktitut wurde daher in weiten Teilen <strong>der</strong> Inuit-Regionen Kanadas zurückge-<br />
drängt. Die meisten Inuit beherrschen die Sprache zwar immer noch, aber sie hat s<strong>ich</strong> ge-<br />
genüber früher verän<strong>der</strong>t und häufig kommt es zu Verständnisproblemen zwischen jüngeren<br />
und älteren Inuit (vgl. PAUKTUUTIT 2006:27). Aus diesem Grund ist die durch die einzelnen Au-<br />
tonomieabkommen erre<strong>ich</strong>te offizielle Gle<strong>ich</strong>berechtigung von Inuktitut neben Englisch,<br />
Französisch bzw. Dänisch und die Einführung von Inuktitut als Unterr<strong>ich</strong>tssprache von hoher<br />
Bedeutung (vgl. INUIT TAPIRIIT KANATAMI 2011:71).<br />
Neben <strong>der</strong> Sprache sind die Traditionen <strong>der</strong> zweite große Bestandteil <strong>der</strong> Kultur <strong>der</strong> Inuit.<br />
Zu den Traditionen gehört Inuit Qaujimajatuqangit ebenso wie die mündl<strong>ich</strong>e Weitergabe<br />
alter Gesch<strong>ich</strong>ten und Mythen, Riten und alte Lebensformen. Das Erbe <strong>der</strong> mehrere Jahrtau-<br />
sende alten Inuit-Kultur zu bewahren, ist für viele Inuit von großer Bedeutung. N<strong>ich</strong>t grund-<br />
los hat ZACHARIAS KUNUK das Motto „recreate the past“ (KUNUK zit. in HUHNDORF 2009:73) zum<br />
Programm von Igloolik Isuma gemacht. Sein Ziel ist es, den Inuit ihre Kultur und Tradition<br />
wie<strong>der</strong> näher zu bringen, denn auf diese Weise erhielten sie trotz <strong>der</strong> tiefgreifenden Verän-<br />
<strong>der</strong>ungen ihrer Lebensweisen in den letzten Jahrzehnten Orientierung und Kontinuität (vgl.<br />
HUHNDORF 2009:87f).
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 68<br />
Im Zentrum des Models befindet s<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Lebensweg <strong>der</strong> Inuit. Er verläuft zyklisch und im<br />
Spannungsfeld von einerseits indigenem und westl<strong>ich</strong>em Wissen und Lebensstil und ande-<br />
rerseits formellem und informellem Umfeld. In je<strong>der</strong> Lebensphase – als Kind, als Jugendli-<br />
cher, als junger Erwachsener, als Erwachsener und als Älterer - kommt <strong>der</strong> Inuk mit jedem<br />
Teilbere<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Lebenswelt <strong>der</strong> Inuit in Berührung und Interaktion. Und jede dieser Interakti-<br />
onen bewirkt einen Lernzuwachs und eine Modifizierung o<strong>der</strong> Reformierung <strong>der</strong> Identität.<br />
Menschen, Kultur und Umwelt ebenso wie Fertigkeiten und Wissen werden zunehmend be-<br />
wusster und vertrauter, wodurch er in die Lage versetzt wird zum Gemeinwohl mit seinen<br />
einzelnen Teildeterminanten beizutragen (vgl. CANADIAN COUNCIL ON LEARNING 2007:21).<br />
In jüngerer Zeit hat die Inuitgesellschaft in hohem Maße mit Problemen wie Alkoholismus<br />
und hohen Selbstmordraten zu kämpfen. Die Selbstmordraten insbeson<strong>der</strong>e männl<strong>ich</strong>er<br />
Inuit zwischen 15 und 29 Jahren gehören zu den höchsten <strong>der</strong> Welt. Vor allem in <strong>der</strong> zweiten<br />
Hälfte des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts ist ein starker Anstieg <strong>der</strong> Selbstmordzahlen zu verze<strong>ich</strong>nen ge-<br />
wesen. MCNICOLL/TESTER (2004:2626) geben etwa für Grönland für den Zeitraum von 1960 bis<br />
1986 eine Steigerung <strong>der</strong> Selbstmordrate von 0,094‰ auf 1,141‰ an. In Nunavut stieg die<br />
Zahl <strong>der</strong> Selbstmorde zwischen 1985 und 1996 von 0,487‰ auf 0,855‰; in Nunatsiavut lag<br />
sie bereits 1983 bei 2,950‰. Alkoholmissbrauch stellt ein n<strong>ich</strong>t min<strong>der</strong> signifikantes Problem<br />
dar. Beispielsweise hat eine Studie des NUNAVIK REGIONAL BOARD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES<br />
(2004:5) ergeben, <strong>dass</strong> 25,7% <strong>der</strong> Inuit in Nunavik Gefahr laufen, <strong>dass</strong> ihr Alkoholkonsum<br />
tiefgreifende Auswirkungen auf ihr tägl<strong>ich</strong>es Leben zur Folge hat, wobei hiervon primär Inuit<br />
<strong>der</strong> mittleren Altersgruppe betroffen sind. MCNICOLL/TESTER (vgl. 2004:2625) führen diese<br />
Entwicklungen auf eine Identitätskrise <strong>der</strong> Inuit infolge <strong>der</strong> Assimilierungspolitik zurück. Die-<br />
se Krise betraf zunächst die Eltern <strong>der</strong> heutigen jungen Erwachsenen. Während <strong>der</strong>en Eltern<br />
wie<strong>der</strong>um im Rahmen <strong>der</strong> traditionellen Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit aufgewachsen waren, erleb-<br />
te diese Generation ihre Kindheit und Jugend zwischen <strong>der</strong> westl<strong>ich</strong>en Kultur einerseits und<br />
<strong>der</strong> <strong>der</strong> Inuit an<strong>der</strong>erseits. In <strong>der</strong> Schule, im Gesundheitswesen und durch staatl<strong>ich</strong>e Sozial-<br />
arbeiter wurden sie mit dem häufig vorurteilsbeladenen und rassistischen Blick <strong>der</strong> Qalluna-<br />
at auf die Inuit konfrontiert. Die traditionelle Lebensform <strong>der</strong> Inuit – die ihrer eigenen Eltern<br />
– wurde ihnen als primitiv, rückwärtsger<strong>ich</strong>tet, unmoralisch und verantwortungslos darge-<br />
stellt, was weitre<strong>ich</strong>ende Folgen hatte:
Die Perspektive <strong>der</strong> Fachwissenschaft auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 69<br />
„Manifest in the physical, sexual and emotional abuse of Inuit, these attitudes contributed to anger, low<br />
self-esteem, poor and destructive parenting practices, failed relationships, alcoholism and other forms of<br />
self-destructive behaviour. […] These experiences […] have, in many cases, created consi<strong>der</strong>able shame, an-<br />
ger and raticence in a generation of Inuit parents who do not know how, or do not feel comfortable in<br />
communicating this developmental experience to their children“ (MCNICOLL/TESTER 2004:2633f).<br />
MCNICOLL/TESTER (vgl. 2004:2634) argumentieren, die massiven Probleme <strong>der</strong> Elterngene-<br />
ration hätten gegenüber <strong>der</strong> jungen Generation zu einem Verstummen über die alten Tradi-<br />
tionen ebenso wie über die eigenen Erfahrungen mit <strong>der</strong> Kolonisierung geführt und in <strong>der</strong><br />
Folge unter <strong>der</strong> jungen Generation eine Form von Orientierungslosigkeit hervorgerufen.<br />
Während s<strong>ich</strong> die Eltern oftmals in den Alkohol geflüchtet hätten, äußere s<strong>ich</strong> die Problema-<br />
tik bei den Jungen in <strong>der</strong> großen Zahl von Selbstmorden. Jemanden zu haben, mit dem man<br />
reden kann, enge Bindungen zur Familie und zu den traditionellen Werten benennen viele<br />
Inuit als ihre Auffassung von Glück und Wohlbefinden. Inuit Qaujimajatuqangit ist jedoch<br />
heutzutage vielen Inuit <strong>der</strong> jüngeren Generation n<strong>ich</strong>t mehr präsent. JACK ANAWAK, <strong>der</strong> Kul-<br />
turminister von Nunavut, führt dazu aus: „Many people now feel these values and beliefs<br />
that kept us in harmony with one another are not being communicated regularly, clearly and<br />
loud enough to be heard by youth“ (zit. in MCNICOLL/TESTER 2004:2635). Die Rückbindung <strong>der</strong><br />
Inuit an ihre traditionellen Werte sowie das Wie<strong>der</strong>erlangen von Autonomie und Selbstbe-<br />
stimmung seien aber gerade die notwendigste Maßnahme zur Verbesserung <strong>der</strong> Situation<br />
(vgl. MCNICOLL/TESTER 2004:233ff).
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 70<br />
4 Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit<br />
4.1 Fragestellung <strong>der</strong> Schulbuchanalyse und methodisches Vorgehen<br />
Das Schulbuch ist das „traditionelle Bildungsmedium“ (STEIN 2003:235), das im Schulunter-<br />
r<strong>ich</strong>t häufig sehr präsent ist. In diesem Zusammenhang ist es vor allem insofern bedeutsam,<br />
„als es einen für die Sozialisation junger Menschen entscheidenden Ausschnitt <strong>der</strong> Wirkl<strong>ich</strong>-<br />
keit nachhaltig beeinflusst“ (THÖNEBÖHN 1995:328). Dabei erfüllt es ein vielfältiges Spektrum<br />
von Funktionen, die BAMBERGER ET AL. (1998:7ff) in ihrer Gesamtheit als Bildungsfunktion be-<br />
ze<strong>ich</strong>nen und unter den drei Teilkategorien Lehrfunktionen, außerschulische Funktionen und<br />
allgemein didaktische Funktionen subsummieren. Erstgenannte liegen im Motivieren und<br />
Informieren <strong>der</strong> Schüler, <strong>der</strong> Bereitstellung von Mögl<strong>ich</strong>keiten zum Üben und Anwenden des<br />
Gelernten sowie letztl<strong>ich</strong> in <strong>der</strong> Lernkontrolle. Die außerschulischen Funktionen haben zum<br />
einen eine kulturelle Dimension, indem sie gesellschaftl<strong>ich</strong> akzeptierte Welts<strong>ich</strong>ten wie<strong>der</strong>-<br />
geben, und zum an<strong>der</strong>en eine politische Dimension, indem Darstellungen politischer Kräfte<br />
unter Umständen bestimmte Färbungen tragen. Zu den allgemein didaktischen Funktionen<br />
gehören zunächst eine lehrplangerechte, systematische Strukturierung <strong>der</strong> Lerninhalte sowie<br />
eine Darbietung dieser Inhalte die einerseits fachwissenschaftl<strong>ich</strong> abges<strong>ich</strong>ert und vollstän-<br />
dig und an<strong>der</strong>erseits durch didaktische Transformation schülergerecht ist. Im Sinne letzterer<br />
müssen die Inhalte gegenüber <strong>der</strong> Realität didaktisch reduziert werden. Die auf diese Weise<br />
zu Stande kommende Repräsentation soll wie<strong>der</strong>um dreierlei bewirken: die Befähigung <strong>der</strong><br />
Schülerinnen und Schüler zu selbstgesteuerter Arbeit mit dem Schulbuch, die Vernetzung<br />
geographischer Fachinhalte mit denen an<strong>der</strong>er Fächer durch entsprechende Hinweise im<br />
Buch sowie letztl<strong>ich</strong> die Beeinflussung <strong>der</strong> Werthaltungen und Einstellungen <strong>der</strong> Schülerin-<br />
nen und Schüler zu <strong>der</strong> jeweiligen Thematik (vgl. BAMBERGER ET AL. 1998:7ff). Nach STEIN<br />
(2003:236) ist das Schulbuch somit zusammenfassend Paedagogicum, Informatorium und<br />
Politicum.<br />
Der Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und dem Schulbuch kommt auf zweier-<br />
lei Weise zustande (vgl. Abb. 33). Einerseits ist hier die eigenständige und selbstgesteuerte<br />
Nutzung des Schulbuches durch die Schülerinnen und Schüler zu nennen. In diesem Falle<br />
besteht eine direkte Beziehung zwischen Schüler und Schulbuch. An<strong>der</strong>erseits ist das Unter-<br />
r<strong>ich</strong>tsgeschehen die typische Situation <strong>der</strong> Schulbuchnutzung für die Schülerinnen und Schü-<br />
ler. Die Wahrnehmung und Verarbeitung <strong>der</strong> Schulbuchinhalte verläuft dabei sehr subjektiv,
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 71<br />
wie bereits in Kapitel 2 dargestellt wurde. Im Hinblick auf die Darstellung frem<strong>der</strong> Kulturen<br />
und Lebensweisen – in diesem Falle die <strong>der</strong> Inuit – bleibt jedoch generell festzuhalten, <strong>dass</strong><br />
„meinungsbestärkende Informationen und Inhalte in <strong>der</strong> Wahrnehmung des Lesenden eher<br />
berücks<strong>ich</strong>tigt [werden], als jene, die eine veruns<strong>ich</strong>ernde Wirkung gegenüber Vorurteilen“<br />
(MÖNTER/SCHIFFER-NASSERIE 2006:201) haben. Vor diesem Hintergrund „muss davon ausgegan-<br />
gen werde, <strong>dass</strong> die mögl<strong>ich</strong>erweise in den Einzelmaterialien enthaltenen stereotypisieren-<br />
den o<strong>der</strong> abwertenden Aussagen und Darstellungen in ihrer Wirkung auf Schüler beson<strong>der</strong>s<br />
ins Gew<strong>ich</strong>t fallen“ (MÖNTER/SCHIFFER-NASSERIE 2006:201). In <strong>der</strong> nachfolgenden Schulbuchana-<br />
lyse stehen daher n<strong>ich</strong>t nur die Schulbuchseiten in ihrer Gesamtheit im Fokus, son<strong>der</strong>n auch<br />
ihre jeweiligen Teilelemente.<br />
Diese einzelnen Darstellungselemente des Verbundmediums Schulbuch sind Texte, Abbil-<br />
dungen und Aufgabenstellungen, die jedoch untereinan<strong>der</strong> durch inhaltl<strong>ich</strong>e Bezüge ver-<br />
netzt sind. In Hinblick auf die Analyse <strong>der</strong> Schulbücher ist zu berücks<strong>ich</strong>tigen, <strong>dass</strong> die Texte<br />
zwar auf den einzelnen Doppelseiten zumeist den meisten Platz einnehmen und zentral po-<br />
sitioniert sind, gerade Bil<strong>der</strong> und Aufgabenstellungen in ihrem Stellenwert für die Wahr-<br />
nehmung des Themas durch die Schülerinnen und Schüler aber ebenfalls n<strong>ich</strong>t unterschätzt<br />
werden dürfen. So merkt WRIGHT (2001:165f) hins<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Schulbuchabbildungen an, <strong>dass</strong><br />
„the student starts visual rather than verbal. […] The contrast between the pupils‘ enthusi-<br />
asm for visual resources and their boredom with the text is very marked. The visual items<br />
create interest and motivation“. Bezügl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Arbeitsaufgaben stellen MÖNTER/SCHIFFER-<br />
NASSERIE (2006:200) heraus, <strong>dass</strong> diese dem Erschließen <strong>der</strong> Doppelseite dienten und „die bei<br />
ihrer Bearbeitung eingenommene Perspektive die Vorstellungen und Einstellungen <strong>der</strong> Ler-<br />
nenden zum Unterr<strong>ich</strong>tsgegenstand nachhaltig beeinflusst“.<br />
Die Form des Schulbucheinsatzes im Unterr<strong>ich</strong>t bestimmt die Lehrkraft. Sie tritt im Unter-<br />
r<strong>ich</strong>tsgeschehen als intermittierende Variable zwischen Schulbuch und Schüler. Von Bedeu-<br />
tung ist in diesem Zusammenhang zunächst die Konzeption des Erdkundebuches. MÖN-<br />
TER/SCHIFFER-NASSERIE (2006:200) führen hierzu aus, <strong>dass</strong> die Bücher aufgrund ihrer Gestaltung<br />
als Material- und Mediensammlungen, die eine große methodische Vielfalt bereitstellten, im<br />
Fach Erdkunde mehr als in an<strong>der</strong>en Fächern auch als R<strong>ich</strong>tlinie <strong>der</strong> Unterr<strong>ich</strong>tsplanung und -<br />
gestaltung genutzt würden. Für die Lehrkraft fugierten sie dabei einerseits als Materialfun-<br />
dus und an<strong>der</strong>erseits als Informationsmedium über den Fortschritt und den diskursiven
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 72<br />
Wandel in <strong>der</strong> Fachwissenschaft. Den tatsächl<strong>ich</strong>en Stellenwert des Schulbuches im Unter-<br />
r<strong>ich</strong>t und somit auch die Schüler-Schulbuch-Interaktion bedingt letztl<strong>ich</strong> die Haltung <strong>der</strong><br />
Lehrkraft gegenüber dem Buch. In Anlehnung an THÖNEBÖHN beschreiben MÖNTER/SCHIFFER-<br />
NASSERIE (2006:200f) hierzu drei verschiedene Vorgehensweisen von Lehrern (vgl. Abb. 33):<br />
So gebe es zum einen jenen Lehrertyp, <strong>der</strong> das Schulbuch als Leitmedium einsetze und nahe-<br />
zu seinen ganzen Unterr<strong>ich</strong>t darauf aufbaue. Die weitaus häufigste Variante sei jedoch die<br />
souveräne Schulbuchverwendung, bei <strong>der</strong> <strong>der</strong> Lehrer s<strong>ich</strong> zwar vom Schulbuch leiten ließe,<br />
aber dennoch das Angebot des Buches gezielt filtere und nutze. Ein dritter Lehrertyp ver-<br />
wende das Schulbuch hingegen nur als didaktischen Steinbruch, <strong>der</strong> vereinzelt die eigene<br />
Materialsammlung ergänze (vgl. MÖNTER/SCHIFFER-NASSERIE 2006:197ff).<br />
Leitmedium<br />
Schulbuch<br />
Fachwissenschaft<br />
und Fachdidaktik<br />
Schulbuch Lehrkraft<br />
souveräne Schulbuchverwendung<br />
Schülerinnen<br />
und<br />
Schüler<br />
Stellenwert des<br />
Schulbuches bei <strong>der</strong><br />
Unterr<strong>ich</strong>tsvorbereitung<br />
Schulbuch:<br />
didaktischer<br />
Steinbruch<br />
Stellenwert des<br />
Schulbuches im Unterr<strong>ich</strong>t<br />
Abbildung 33: Der Einfluss des Schulbuches auf die Lehrkraft, den Unterr<strong>ich</strong>t und die Schülerinnen und Schüler<br />
(eigene Darstellung)<br />
In welcher Quantität und Qualität die Arbeit <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler mit dem<br />
Schulbuch erfolgt, hängt somit maßgebl<strong>ich</strong> von <strong>der</strong> Lehrkraft ab. Tendenziell ist <strong>der</strong> Einfluss<br />
des Schulbuches auf den Unterr<strong>ich</strong>t jedoch eher als groß anzusehen. STEIN (2001:840) be-<br />
ze<strong>ich</strong>net es sogar als „Großmacht <strong>der</strong> Schule“ und STÖBER (2001b:17) führt aus: „<strong>Geographie</strong>-<br />
schulbücher sind vielle<strong>ich</strong>t das w<strong>ich</strong>tigste <strong>der</strong> schulischen Medien, die ‚das Fremde‘ in den
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 73<br />
Unterr<strong>ich</strong>t holen“. Umso bedeutsamer ist eine adäquate Darstellung des Themas in den<br />
Schulbüchern. Vor dem Hintergrund <strong>der</strong> vorangegangenen Ausführungen erfolgt die Schul-<br />
buchanalyse daher auf <strong>der</strong> Grundlage folgen<strong>der</strong> drei Leitfragen:<br />
(1) Ist die inhaltl<strong>ich</strong>e Darstellung des Themas fachwissenschaftl<strong>ich</strong> korrekt?<br />
(2) Erfolgt durch die didaktische Reduktion eine Verzerrung o<strong>der</strong> unangemessene Ver-<br />
kürzung <strong>der</strong> fachwissenschaftl<strong>ich</strong>en Erkenntnisse?<br />
(3) Trägt die Darstellungsweise des Themas in den Schulbüchern zu einer vorurteilsbe-<br />
hafteten Wahrnehmung <strong>der</strong> Inuit durch die Schülerinnen und Schüler bei?<br />
Den Untersuchungskorpus bilden die jeweiligen Schulbuchseiten zum Thema Lebenswei-<br />
sen <strong>der</strong> Inuit <strong>der</strong> in Nie<strong>der</strong>sachsen zugelassenen Schulbücher für den monolingualen Erd-<br />
kundeunterr<strong>ich</strong>t <strong>der</strong> Klassenstufen 7/8. Dies sind die Doppelseiten ‚Inuit – zwischen Iglu und<br />
Internet‘ im Buch Seydlitz <strong>Geographie</strong> des Schroedel-Verlages (S. 104/105), ‚Die Inuit – Leben<br />
in <strong>der</strong> Kälte‘ im Cornelsen-Buch Unsere Erde (S. 80/81), ‚Nunavut heißt: „Unser Land“‘ im<br />
Klett-Buch Terra Erdkunde (S. 14/15) sowie ‚Die Inuit – Überleben bei -30°C‘ im Buch Diercke<br />
Erdkunde des Westermann-Verlages (S. 66/67). Verwendet werden jeweils die gegenwärtig<br />
aktuellen Auflagen aus dem Jahr 2009; ledigl<strong>ich</strong> im Falle des Terra-Buches wird auf die ältere<br />
Auflage von 2006 zurückgegriffen, da das Thema Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit in die neueste Aus-<br />
gabe n<strong>ich</strong>t aufgenommen wurde.<br />
Zur Beantwortung <strong>der</strong> Leitfragen wurde für die vier relevanten Schulbuch-Doppelseiten<br />
eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt, denn <strong>der</strong> Gehalt <strong>der</strong> Darstellungen kann auf<br />
diese Weise ganzheitl<strong>ich</strong> erfasst werden (vgl. MEIER KRUKER/RAUH 2005:80). Die qualitative<br />
Inhaltsanalyse versteht „den Zuordnungsprozess von Kategorien und Textstellen als Inter-<br />
pretationsakt […], [möchte] aber durch inhaltsanalytische Regeln kontrollieren“ (MAYRING<br />
2008:10). Die Analyse erfolgte anhand folgen<strong>der</strong> Arbeitsschritte:<br />
(1) Zusammenfassung: Die einzelnen Schulbuchdoppelseiten wurden zunächst be-<br />
schreibend zusammengefasst und als Überblick über die Inhalte dargestellt.<br />
(2) Strukturierung: Es wurden aus <strong>der</strong> Gesamtheit des Untersuchungsmaterials zentrale<br />
inhaltl<strong>ich</strong>e Aspekte herausgesucht, die die Darstellung des Themas Lebensweisen<br />
<strong>der</strong> Inuit bestimmen. Aus diesen Aspekten wurden Analysekategorien gebildet, die
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 74<br />
im Zuge mehrfacher kategoriengeleiteter Durchs<strong>ich</strong>t des Materials überarbeitet<br />
wurden.<br />
(3) Kategoriale Analyse: Anhand <strong>der</strong> Kategorien wurde das Material analysiert. Im Zuge<br />
dessen wurden Strukturen innerhalb <strong>der</strong> Gesamtdarstellung ebenso wie <strong>der</strong> Einzel-<br />
darstellungen in den jeweiligen Büchern herausgearbeitet.<br />
(4) Auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Analyse werden letztl<strong>ich</strong> in einem Fazit die Leitfragen beant-<br />
wortet.<br />
4.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Schulbuchanalyse<br />
4.2.1 Beschreibende Zusammenfassung des Untersuchungsmaterials<br />
Dem Thema Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit wird in allen vier untersuchten Schulbüchern jeweils<br />
eine Doppelseite gewidmet. Es wurde dabei in den einzelnen Lehrwerken in den Kontext<br />
verschiedener übergeordneten Kapitels eingeordnet. So trägt das Oberkapitel im thematisch<br />
geglie<strong>der</strong>ten Diercke-Buch den Titel Anpassung an naturräuml<strong>ich</strong>e Bedingungen und behan-<br />
delt spezifische Lebens- und Anpassungsformen in allen Klimazonen <strong>der</strong> Erde. Die Inuit re-<br />
präsentieren hierbei die Anpassung in <strong>der</strong> kalten Zone. Zum Thema kalte Zone befindet s<strong>ich</strong><br />
in diesem Kapitel noch eine zweite Doppelseite zum Konfliktfeld Ökonomie-Ökologie bei <strong>der</strong><br />
Erschließung <strong>der</strong> fossilen Rohstoffe in Alaska. Die übrigen drei Bücher sind hingegen (zumin-<br />
dest in Teilen) regional geglie<strong>der</strong>t und enthalten jeweils ein eigenes Kapitel zum Thema kalte<br />
Zone. Im Seydlitz-Buch etwa trägt es den Titel Polarräume und zeigt einen Schwerpunkt im<br />
Bere<strong>ich</strong> <strong>der</strong> naturräuml<strong>ich</strong>en Gegebenheiten während Terra unter <strong>der</strong> Überschrift Leben in<br />
<strong>der</strong> Kalten Zone eher die Lebensbedingungen und -formen in den Vor<strong>der</strong>grund stellt. Unsere<br />
Erde letztl<strong>ich</strong> legt im Kapitel Zusammenhänge in <strong>der</strong> Polarzone erklären den Fokus auf Nut-<br />
zungspotenziale und -gefahren in den Polarräumen.<br />
Diercke Erdkunde<br />
Die Karte M1 in <strong>der</strong> linken oberen Ecke von Seite 66 trägt den Titel Völker <strong>der</strong> Arktis und<br />
zeigt die Siedlungsräume ausgewählter arktischer Völker, wie <strong>der</strong> Inuit in Nordamerika, <strong>der</strong><br />
Tschuktschen, Jakuten und Nenzen in Asien und <strong>der</strong> Samen in Europa. Als Grenze <strong>der</strong> Arktis<br />
ist die 10°C-Juli-Isotherme eingeze<strong>ich</strong>net. Die übrigen Teile <strong>der</strong> Doppelseite greifen die Inuit
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 75<br />
als eines dieser arktischen Völker heraus und zeigen an ihrem Beispiel exemplarisch Formen<br />
<strong>der</strong> Anpassung in <strong>der</strong> kalten Zone auf.<br />
Abbildung 34: Diercke Erdkunde (Westermann): ‚Die Inuit – Überleben<br />
bei -30°C‘<br />
(Diercke Erdkunde 7/8 Gymnasium Nie<strong>der</strong>sachsen 2009:66/67)<br />
Der Text stellt unter <strong>der</strong> Überschrift Die Inuit – Überleben<br />
bei -30°C im Einleitungssatz zunächst die extremen Klimabe-<br />
dingungen und die Notwendigkeit einer überlebenss<strong>ich</strong>ern-<br />
den Anpassung heraus. Anschließend erzählen drei Inuitkin-<br />
<strong>der</strong>, Torun, Pikalu und Smilla, von ihrem Leben in Grönland.<br />
Torun und Pikalu repräsentieren dabei die traditionelle Le-<br />
bensweise, Smilla die mo<strong>der</strong>ne. Es wird ber<strong>ich</strong>tet, die Familie<br />
von Torun und Pikalu lebe als Selbstversorger in einem Out-<br />
post Camp nahe Upernavik in Westgrönland. Es folgt ein Hin-<br />
weis, <strong>dass</strong> die Inuit in Grönland heute zunehmend in Städten<br />
Abbildung 35: Diercke Erdkunde<br />
(Westermann): Frontcover<br />
(Diercke Erdkunde 7/8 Gymnasium<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen 2009)<br />
lebten, woraufhin Smilla von dem Leben ihrer Familie in <strong>der</strong> westgrönländischen Stadt Ilulis-<br />
sat erzählt. Ein Bild dieser Stadt befindet s<strong>ich</strong> auf dem Frontcover des Buches.
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 76<br />
Unsere Erde<br />
Abbildung 36: Unsere Erde (Cornelsen): ‚Die Inuit – Leben in <strong>der</strong> Kälte‘<br />
(Unsere Erde 7/8 Gymnasium Nie<strong>der</strong>sachsen 2009:80/81)<br />
Unsere Erde bereitet das Thema Inuit als Geo-Aktiv-Einheit auf. Im Zentrum <strong>der</strong> Darstel-<br />
lung steht <strong>der</strong> E-Mail-Wechsel <strong>der</strong> beiden Mädchen Laura aus Deutschland und Alukie aus<br />
Iqaluit in Nunavut. Laura sendet ihrer Brieffreundin einen Text, <strong>der</strong> wie<strong>der</strong>gibt, was sie an<br />
Informationen über das Leben <strong>der</strong> Inuit gefunden hat, und bittet Alukie, zu überprüfen, ob<br />
diese Schil<strong>der</strong>ungen noch aktuell sind. Lauras Text beschreibt die traditionelle Lebensweise<br />
<strong>der</strong> Inuit. Alukie beantwortet Lauras E-Mail mit dem Hinweis, <strong>dass</strong> die beschriebene Le-<br />
bensweise heutzutage n<strong>ich</strong>t mehr zutreffe. Verschiedene Vorschläge for<strong>der</strong>n die Schülerin-<br />
nen und Schüler dazu auf, s<strong>ich</strong> eigenständig über die Inuit zu informieren und ihre Ergebnis-<br />
se verschiedenartig aufzuarbeiten und zu präsentieren.<br />
Seydlitz <strong>Geographie</strong><br />
Unter <strong>der</strong> Überschrift Inuit – zwischen Iglu und Internet stellt auch das Seydlitz-Buch die<br />
traditionelle und mo<strong>der</strong>ne Lebensweise <strong>der</strong> Inuit gegenüber. Seite 104 widmet s<strong>ich</strong> dabei
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 77<br />
<strong>der</strong> traditionellen Form, Seite 105 <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen. Eine Karte (105.3) zeigt zudem die Lage<br />
des Lebensraumes des Inuit innerhalb <strong>der</strong> Vegetationszonen <strong>der</strong> Arktis. Im Zentrum <strong>der</strong> Dar-<br />
stellung steht <strong>der</strong> Text. Eingeleitet wird er mit einer Erklärung, weshalb die Inuit heute n<strong>ich</strong>t<br />
mehr Eskimos genannt werden. Anschließend folgt eine Erzählung des älteren Inuk Loasie,<br />
<strong>der</strong> vom Leben <strong>der</strong> Inuit vor 50 Jahren ber<strong>ich</strong>tet. Er führt aus, die Inuit seien damals Selbst-<br />
versorger gewesen und die Jagd habe in Bezug auf die Lebensmittelversorgung und die jah-<br />
reszeitl<strong>ich</strong>en Wan<strong>der</strong>ungen ihr Leben bestimmt. Auf Seite 105 ber<strong>ich</strong>tet dann die Schülerin<br />
Nyla aus Tuktoyaktuk im Mackenzie-Delta von <strong>der</strong> heutigen Lebenssituation <strong>der</strong> Inuit und<br />
geht dabei auf den Hausbau, das Arbeitsleben sowie Probleme mo<strong>der</strong>ner Inuit ein.<br />
Abbildung 37: Seydlitz <strong>Geographie</strong> (Schroedel): ‚Inuit – zwischen Iglu und Internet‘<br />
(Seydlitz <strong>Geographie</strong> 7/8 Gymnsium Nie<strong>der</strong>sachsen 2009:104/105)<br />
Terra Erdkunde<br />
Das Terra-Buch verfolgt einen an<strong>der</strong>en Zugang zum Thema als die übrigen Bücher. Im Fo-<br />
kus stehen hier die Erschließung <strong>der</strong> re<strong>ich</strong>en Rohstoffe Nordkanadas und die damit einher-<br />
gehenden Konflikte <strong>der</strong> Inuit einschließl<strong>ich</strong> des Autonomieprozesses. Entsprechend beginnt<br />
<strong>der</strong> Haupttext auf Seite 15 unter <strong>der</strong> Überschrift Kanadas Re<strong>ich</strong>tum und seine Konflikte mit
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 78<br />
einer Situationsbeschreibung: Nordkanada sei zum einen re<strong>ich</strong> an Bodenschätzen, die für<br />
den Weltmarkt geför<strong>der</strong>t würden. Zum an<strong>der</strong>en sei es aber auch Lebensraum <strong>der</strong> aus Asien<br />
eingewan<strong>der</strong>ten Inuit und Indianer, die s<strong>ich</strong> gegen die Ausbeutung <strong>der</strong> Natur wehrten und<br />
Selbstbestimmung for<strong>der</strong>ten. Die Ausweitung des Bergbaus und die Abholzung von Nadel-<br />
wäl<strong>der</strong>n führten zu daher Nutzungskonflikten zwischen Inuit und Indianern auf <strong>der</strong> einen<br />
und <strong>der</strong> kanadischen Regierung auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite. Der zweite Teil des Textes trägt die<br />
Überschrift Das Leben <strong>der</strong> Inuit heute und thematisiert verschiedene Lebensbere<strong>ich</strong>e <strong>der</strong><br />
Inuit, die s<strong>ich</strong> gegenüber früher geän<strong>der</strong>t hätten. Anschließend wird ausgeführt, diese Ver-<br />
än<strong>der</strong>ungen stellten eine Gefahr für die Inuit-Kultur dar, <strong>der</strong> man entgegenzuwirken versu-<br />
che. Ergänzt wird <strong>der</strong> Text durch verschiedene bildl<strong>ich</strong>e Darstellungen sowie einen Zeitungs-<br />
artikel, <strong>der</strong> den Titel Eine erstaunl<strong>ich</strong>e Karriere trägt und anlässl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Gründung des Terri-<br />
toriums Nunavut den Werdegang des ersten Premierministers von Nunavut schil<strong>der</strong>t.<br />
Abbildung 38: Terra Erdkunde (Klett): ‚Nunavut heißt: „Unser Land“‘<br />
(Terra Erdkunde 7/8 Gymnasium Nie<strong>der</strong>sachsen 2006:14/15)
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 79<br />
4.2.2 Kategorienbasierte Analyse des Untersuchungsmaterials<br />
Auf <strong>der</strong> Grundlage des beschriebenen Untersuchungsmaterials wurden vier Kategorien<br />
gebildet – traditionelle Lebensweise, Kultur und gesellschaftl<strong>ich</strong>e Werte <strong>der</strong> Inuit; mo<strong>der</strong>ne<br />
Wohnverhältnisse; wirtschaftl<strong>ich</strong>e Verhältnisse; Selbstbestimmung –, anhand <strong>der</strong>er nachste-<br />
hend die bestimmenden Aspekte <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit in den Schulbü-<br />
chern erörtert werden.<br />
Traditionelle Lebensweise, Kultur und gesellschaftl<strong>ich</strong>e Werte <strong>der</strong> Inuit<br />
Die traditionelle Lebensweise <strong>der</strong> Inuit wird in drei <strong>der</strong> vier Schulbücher auf mindestens<br />
<strong>der</strong> Hälfte <strong>der</strong> Doppelseite ausführl<strong>ich</strong> thematisiert. Dabei sind die Perspektiven, die in den<br />
einzelnen Büchern gegenüber diesem Aspekt eingenommen werden, sehr verschieden.<br />
In Seydlitz etwa erzählt ein Großvater von <strong>der</strong> Zeit vor 50 Jahren. Dieser Zugang ist ge-<br />
schickt gewählt, da er s<strong>ich</strong> in <strong>der</strong> Beschreibung <strong>der</strong> traditionellen Lebensform eines ihrer<br />
typischen Elemente, näml<strong>ich</strong> die Weitergabe von Wissen und Informationen von einer Gene-<br />
ration an die nächste durch Erzählungen, zu Nutze macht. Mit <strong>der</strong> Fokussierung <strong>der</strong> Aspekte<br />
Selbstversorgung durch die Jagd und Leben im Iglu werden dabei spezifische Anpassungs-<br />
formen <strong>der</strong> Inuit an ihre naturräuml<strong>ich</strong>e Umgebung dargestellt. Allerdings ist hierzu anzu-<br />
merken, <strong>dass</strong> die doppelte bildl<strong>ich</strong>e Darstellung des Iglus bei den Schülerinnen und Schülern<br />
wahrscheinl<strong>ich</strong> den Eindruck hervorrufen o<strong>der</strong> verstärken wird, <strong>dass</strong> Inuit immer im Iglu ge-<br />
lebt hätten. Dies trifft jedoch zum einen n<strong>ich</strong>t zu und zum an<strong>der</strong>en wird auch im Text be-<br />
schrieben, Iglus seien nur im Winter gebaut worden. Anstelle von Bild 104.1 hätte somit<br />
auch ein Bild eines Zeltes, wie es im Text als typische Sommerunterkunft genannt wird, ab-<br />
gedruckt werden können. Am Ende des Textes wird darauf hingewiesen, <strong>dass</strong> viele „davon<br />
überzeugt [sind], <strong>dass</strong> das Ende des traditionellen Nomadenlebens den meisten Inuit eher<br />
geschadet als genutzt hat“ (Seydlitz 2009:105). Dadurch wird zwar einerseits die Mo<strong>der</strong>ne<br />
relativiert und somit das traditionelle Nomadenleben in <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>der</strong> Schülerinnen<br />
und Schüler aufgewertet. Zugle<strong>ich</strong> wird ihnen aber auch bereits eine beurteilende Meinung<br />
zu <strong>der</strong> Entwicklung vorgegeben. Im Sinne einer unvoreingenommeneren Reflexion <strong>der</strong> Vor-<br />
und Nachteile traditioneller und mo<strong>der</strong>ner Lebensweisen hätte alternativ, beispielsweise in<br />
Anknüpfung an Aufgabe 1, eine Stellungnahme <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler zu dieser Ein-<br />
schätzung gefor<strong>der</strong>t werden können.
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 80<br />
Unsere Erde stellt die traditionelle Lebensform im Rahmen von Recherche-Ergebnissen<br />
einer Schülerin vor, die von ihrer Internetpartnerin, einem Inuit-Mädchen, als längst n<strong>ich</strong>t<br />
mehr zutreffend zurückgewiesen werden: „so wie du das Leben bei uns beschreibst, ist es<br />
schon lange n<strong>ich</strong>t mehr“ (Unsere Erde 2009:81). Allerdings gibt sie fernerhin an, <strong>dass</strong> ihr Va-<br />
ter „ganz tolle Skulpturen“ (Unsere Erde 2009:81) herstelle, die er verkaufe, und ihr Onkel<br />
für Touristen „Fahrten mit dem Hundeschlitten“ (Unsere Erde 2009:81) organisiere, wodurch<br />
zum Ausdruck gebracht wird, <strong>dass</strong> zumindest kulturelle Elemente <strong>der</strong> traditionellen Lebens-<br />
form in gewissem Rahmen fortgeführt werden. Wie schon bei Seydlitz steht die Selbstver-<br />
sorgung im Zentrum <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> traditionellen Lebensweise. Hiervon ausgehend<br />
werden Jagd- und Fischereimethoden sowie die Verwertung <strong>der</strong> Tiere beschrieben. Über die<br />
bei Seydlitz beschriebenen Inhalte hinausgehend werden zudem zwei <strong>der</strong> gesellschaftl<strong>ich</strong>en<br />
Prinzipien <strong>der</strong> Inuit angesprochen. Als notwendige Voraussetzung zum Überleben in <strong>der</strong> Ark-<br />
tis werden zum einen <strong>der</strong> Zusammenhalt und zum an<strong>der</strong>en das Teilen <strong>der</strong> Lebensmittel her-<br />
ausgestellt. Kultur und Anpassung werden somit in dieser Darstellung zu ineinan<strong>der</strong>greifen-<br />
den Elementen.<br />
Demgegenüber lässt Diercke einen Jungen, <strong>der</strong> in heutiger Zeit mit seiner Familie auf tra-<br />
ditionelle Weise in einem Outpost Camp in Grönland lebt, erzählen und kontrastiert diese<br />
Darstellung mit <strong>der</strong> <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>n lebenden Familie von Smilla. Die Beschreibung des traditio-<br />
nellen Lebens fokussiert s<strong>ich</strong> im Text auf die Jagd und Verarbeitung <strong>der</strong> Tiere zur Selbstver-<br />
sorgung. Mehrere Abbildungen sollen dies illustrieren, werfen allerdings (ungewollt) Wi<strong>der</strong>-<br />
sprüche zum Text auf. So wird im Text eingehend beschrieben, wie die Inuit aus den Fellen<br />
bereits erlegter Tiere ihre Kleidung und Schuhe fertigten. M3 zeigt jedoch „Inuit mit erlegter<br />
Robbe“ (Diercke 2009:66), die mo<strong>der</strong>n gekleidet sind. In M2 ist ein Iglu als „‘Haus‘ zur Jagd-<br />
zeit“ (Diercke 2009:66) abgebildet. Dieses Bild befindet s<strong>ich</strong> zwar unmittelbar neben dem<br />
Text, nimmt aber offenbar Bezug auf M5, wo das Iglu als winterl<strong>ich</strong>e Wohnstätte auf Wande-<br />
rungen angeführt wird. Die inhaltl<strong>ich</strong>e Einordnung von M5 bleibt dabei unklar. Es trägt den<br />
Titel „Jahresablauf im Leben eines Inuit“ (Diercke 2009:67) und schil<strong>der</strong>t naturräuml<strong>ich</strong>e<br />
Gegebenheiten und Lebensverhältnisse <strong>der</strong> Menschen im Verlauf eines Jahres. Die Graphik<br />
ist auf Seite 67, die s<strong>ich</strong> im Übrigen mit den mo<strong>der</strong>nen Lebensformen beschäftigt, abge-<br />
druckt und suggeriert durch den Titel gegenwärtige Gültigkeit. Die enthaltenen Beschreibun-<br />
gen beziehen s<strong>ich</strong> jedoch ausschließl<strong>ich</strong> auf traditionelle Lebensformen. Ob dies nun die Le-
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 81<br />
bensweise im Outpost Camp zeigen soll o<strong>der</strong> gar die eines mo<strong>der</strong>n lebenden Inuk, wenn er<br />
zur Jagd geht, wird n<strong>ich</strong>t erklärt. Auch in <strong>der</strong> dazugehörigen Aufgabenstellung ist ledigl<strong>ich</strong><br />
vom „Jahresablauf eines Inuit während <strong>der</strong> Jagd“ die Rede. Positiv ist an dieser Graphik je-<br />
doch die Darstellung <strong>der</strong> L<strong>ich</strong>t- und Eisverhältnisse hervorzuheben, die den Schülerinnen und<br />
Schülern auf anschaul<strong>ich</strong>e Weise einen Eindruck von dem jahreszeitl<strong>ich</strong>en Wechsel dieser<br />
beiden naturräuml<strong>ich</strong>en Faktoren vermittelt.<br />
Nahezu ohne eine Darstellung <strong>der</strong> traditionellen Lebensweisen kommt Terra aus. Dies ist<br />
mit dem inhaltl<strong>ich</strong>en Schwerpunkt <strong>der</strong> Doppelseite zu erklären, <strong>der</strong> n<strong>ich</strong>t auf <strong>der</strong> Anpassung<br />
an die kalte Zone, son<strong>der</strong>n auf <strong>der</strong> Nutzung <strong>der</strong> Bodenschätze liegt. Ausgehend von einem<br />
Nutzungskonflikt zwischen Wirtschaft und indigener Bevölkerung <strong>der</strong> Region werden ver-<br />
schiedenartige Auswirkungen auf Kultur und Tradition <strong>der</strong> Inuit geschil<strong>der</strong>t und anschließend<br />
beispielhaft Maßnahmen genannt, die zur Bewahrung <strong>der</strong> Kultur beitragen sollen. Die Kultur<br />
wird dabei unabhängig von <strong>der</strong> traditionellen Lebensform <strong>der</strong> Inuit betrachtet und in <strong>der</strong><br />
Funktion eines identitätsstiftenden Elementes als bedeuten<strong>der</strong> Kontrapunkt zur „kulturellen<br />
Entfremdung“ (Terra 2006:14) dargestellt.<br />
Insgesamt ist zu beobachten, <strong>dass</strong> die einzelnen Schulbücher von unterschiedl<strong>ich</strong>en Prä-<br />
missen hins<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> des Stellenwertes <strong>der</strong> traditionellen Lebensformen in heutiger Zeit aus-<br />
gehen. Sie re<strong>ich</strong>en von ‚diese Lebensformen sind vergangen und nur noch museal für Touris-<br />
ten vorhanden (Unsere Erde)‘, über ‚die traditionelle Lebensweise ist heute n<strong>ich</strong>t mehr üb-<br />
l<strong>ich</strong>, aber die Kultur ist geblieben in Form von Sprache (Terra und Seydlitz), Jagdbegeisterung<br />
(Seydlitz), kulturellem Wissen (Terra) und Kunst (Unsere Erde)‘ bis hin zu ‚ein kleiner Teil Inu-<br />
it führt sie parallel zur Mehrheit <strong>der</strong> Gesellschaft, die die Traditionen aufgegeben hat, fort‘<br />
(Diercke).<br />
Daneben ist festzuhalten, <strong>dass</strong> auch die Auffassungen über den Charakter <strong>der</strong> traditionel-<br />
len Lebensweisen in den verschiedenen Büchern variieren. Diercke, Seydlitz und Unsere Erde<br />
neigen dazu, alle Elemente <strong>der</strong> traditionellen Lebensweise als Ausdruck einer Anpassung an<br />
den Lebensraum zu sehen. So steht im Zentrum <strong>der</strong> Darstellung bei Diercke die Praxis <strong>der</strong><br />
Selbstversorgung, die auf den beiden Prinzipien basiere, „<strong>dass</strong> wir nur so viele Tiere erlegen<br />
wie wir benötigen [und] jedes erlegte Tier mögl<strong>ich</strong>st sinnvoll […] verwerten“, denn „unter<br />
den harten klimatischen Bedingungen <strong>der</strong> Arktis überleben nur Menschen […], die s<strong>ich</strong> den
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 82<br />
extremen Bedingungen angepasst haben“ (Diercke 2009:66). Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite betrach-<br />
tet Terra die Anpassungsformen und Traditionen <strong>der</strong> Inuit genau an<strong>der</strong>sherum als Ausdruck<br />
einer Kultur. Diese sei durch die Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lebensweise bedroht, verloren zu gehen,<br />
weshalb es Bestrebungen gebe, „die Inuit-Kultur zu bewahren, z.B. indem die Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong><br />
Schule Inuktitut, die Sprache <strong>der</strong> Inuit, lernen und am Pfl<strong>ich</strong>tfach ‚Inuit-Kultur‘ teilnehmen“.<br />
Diese unterschiedl<strong>ich</strong>en Blickwinkel sind n<strong>ich</strong>t unerhebl<strong>ich</strong>, da s<strong>ich</strong> auf Anpassung basieren-<br />
de Lebensformen im Zuge einer Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Rahmenbedingungen ebenfalls än<strong>der</strong>n,<br />
Kultur aber ein identitätsstiftendes Element einer Gesellschaft ist, das auch bei einem Wan-<br />
del <strong>der</strong> Lebensformen zumindest in Teilen weitergetragen wird.<br />
Mo<strong>der</strong>ne Wohnverhältnisse<br />
Zu den mo<strong>der</strong>nen Wohnverhältnissen finden s<strong>ich</strong> in den Schulbüchern drei Darstellungen<br />
zu drei verschiedenen Regionen. In Unsere Erde heißt es hierzu, die Familie von Alukie woh-<br />
ne „in einem kleinen Haus gar n<strong>ich</strong>t weit von unserer Schule. […] Heute unterscheiden s<strong>ich</strong><br />
unsere Siedlungen kaum von denen in an<strong>der</strong>en Teilen Kanadas mit Supermärkten, Schulen,<br />
festen Häusern mit Heizung und Fernsehern“ (Unsere Erde, S. 81). Diese Beschreibung be-<br />
zieht s<strong>ich</strong> konkret auf Iqaluit, die Hauptstadt Nunavuts, beansprucht durch die Formulierung<br />
„unsere Siedlungen“ aber ebenso Allgemeingültigkeit für die übrigen Siedlungen <strong>der</strong> Inuit.<br />
Der Hinweis auf die Ähnl<strong>ich</strong>keit zu an<strong>der</strong>en kanadischen Siedlungen mit Supermärkten, Schu-<br />
len und festen Häusern als ausschlaggebende Merkmale suggeriert implizit auch eine Ähn-<br />
l<strong>ich</strong>keit zu den Schülerinnen und Schülern bekannten europäischen Siedlungen. Im Zentrum<br />
dieser Darstellung steht somit eine Betonung <strong>der</strong> Ähnl<strong>ich</strong>keiten zur Lebenswelt <strong>der</strong> Schüle-<br />
rinnen und Schüler und vermittelt ihnen den Eindruck, ‚die Inuit wohnen genau wie wir‘.<br />
Die gle<strong>ich</strong>e R<strong>ich</strong>tung schlägt auch die Darstellung des Diercke-Buches ein. Als räuml<strong>ich</strong>es<br />
Beispiel ist hier die westgrönländische Stadt Ilulissat genannt (die allerdings im Text fälschli-<br />
cherweise Illusiat genannt wird). Dort lebe die Familie von Smilla in „einem ruhigen Holzhaus<br />
am Ortsrand“ (Diercke, S. 67), in dem es „fließend kaltes und warmes Wasser, einen Elektro-<br />
herd, Zentralheizung, Mikrowelle, Telefon und Kabelfernsehen“ (Diercke, S. 67) gebe. Zuvor<br />
habe die Familie „in einem großen Mehrfamilienhaus in <strong>der</strong> Nähe zum Hafen gewohnt“<br />
(Diercke, S. 67). Es werden also zwei in Ilulissat übl<strong>ich</strong>e Wohnformen angesprochen, wobei<br />
<strong>der</strong> Umzug an den Ortsrand implizit einen Suburbanisierungsprozess andeutet. Relativiert
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 83<br />
wird diese Darstellung durch den Hinweis, <strong>dass</strong> es „n<strong>ich</strong>t allen Inuit, die inzwischen in die<br />
Städte Grönlands gezogen sind, […] so gut wie Smillas Familie“ gehe. Das Titelbild des Buches<br />
zeigt zudem eine Einfamilienhaussiedlung am Rande von Ilulissat. Zu sehen ist darauf eine<br />
Vielzahl d<strong>ich</strong>t nebeneinan<strong>der</strong> stehen<strong>der</strong>, bunter Holzhäuser in einer verschneiten Küsten-<br />
landschaft. Das Bild vermittelt insgesamt einen idyllischen, beschaul<strong>ich</strong>en Eindruck und steht<br />
somit in scharfem Gegensatz zu Abbildung 105.2 im Seydlitz-Buch.<br />
Auch dieses Bild zeigt eine „mo<strong>der</strong>ne Inuitsiedlung“ (Seydlitz, S. 105). Im Vor<strong>der</strong>grund des<br />
Bildes ist ein großes Zelt zu sehen, im Mittelgrund mehrere <strong>der</strong> Matchbox-Häuser, die auch<br />
im Text erwähnt werden. Dort werden sie als „Fertighäuser aus Holz o<strong>der</strong> Wellblech“<br />
(Seydlitz, S. 105) beschrieben, die „in unserer vom Frost versiegelten Welt auf den soge-<br />
nannten Dauerfrostboden aufgepfropft [werden], so<strong>dass</strong> wir wie auf Stelzen wohnen“<br />
(Seydlitz, S. 105). Des Weiteren wird erklärt, <strong>dass</strong> die Montage dieser Häuser nur im Sommer<br />
mögl<strong>ich</strong> sei. Der Hintergrund des Bildes zeigt große, mindestens achtgeschossige Wohn-<br />
blocks. An <strong>der</strong> Seydlitz-Darstellung ist positiv hervorzuheben, <strong>dass</strong> sie mit den Matchboxhäu-<br />
sern eine spezifisch an die naturräuml<strong>ich</strong>en Gegebenheiten angepasste Bauform vorgestellt<br />
und <strong>der</strong> thematische Rahmen <strong>der</strong> Anpassung somit auch für die Mo<strong>der</strong>ne verfolgt wird.<br />
Dennoch ist das Bild 105.2, insbeson<strong>der</strong>e in Kombination mit <strong>der</strong> Bildunterschrift „mo<strong>der</strong>ne<br />
Inuitsiedlung“, als problematisch anzusehen. Denn einerseits beansprucht die Betitelung<br />
Inuitsiedlung ohne nähere räuml<strong>ich</strong>e Einordnung Allgemeingültigkeit und Repräsentativität<br />
für die Gesamtheit <strong>der</strong> Inuitsiedlungen und an<strong>der</strong>erseits vermittelt das Attribut mo<strong>der</strong>n den<br />
Eindruck, das Bild zeige den aktuell höchsten Wohnstandard <strong>der</strong> Inuit. Gle<strong>ich</strong>zeitig vermittelt<br />
das Bild einen sehr ärml<strong>ich</strong>en und tristen Eindruck. Dieser wird unnötigerweise dadurch ver-<br />
stärkt, <strong>dass</strong> die Froschperspektive einerseits am Boden herumliegenden Müll und an<strong>der</strong>er-<br />
seits die dunkle Bewölkung am Himmel stark betont. Dass ein Bild einer mo<strong>der</strong>nen Inuitsied-<br />
lung zudem ein Zelt <strong>der</strong>art raumgreifend in den Vor<strong>der</strong>grund stellt, erscheint ebenfalls un-<br />
glückl<strong>ich</strong>. Ein an<strong>der</strong>s gewählter Bildausschnitt, <strong>der</strong> die Matchbox-Häuser (in Normalperspek-<br />
tive) stärker hervorhebt, wäre an dieser Stelle objektiver. Statt als Beispiel für eine mo<strong>der</strong>ne<br />
Inuitsiedlung wäre dieses Bild vielmehr für eine Thematisierung des in manchen Regionen<br />
drängenden Wohnraummangels und <strong>der</strong> teilweise stark veralteten Bausubstanz geeignet<br />
(vgl. INUIT TAPIRIIT KANATAMI:2004). Aufgrund <strong>der</strong> Signifikanz dieses Problems, wäre eine Be-<br />
handlung im Schulbuch im Rahmen einer Doppelseite zu den Inuit sogar gerechtfertigt.
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 84<br />
Durch die hier vorgenommene Bild-Bildunterschrift-Kombination werden bei den Schülerin-<br />
nen und Schülern jedoch – insbeson<strong>der</strong>e auch im Vergle<strong>ich</strong> zu dem idyllischen „Iglu bei<br />
Nacht“-Bild (104.1) auf Seite 104 – sehr negative Vorstellungen geprägt.<br />
Selbstbestimmung<br />
Der Aspekt <strong>der</strong> Selbstbestimmung ist in den Schulbüchern wenig vertreten. Bei Seydlitz<br />
kommt er in einem Nebensatz, allerdings mit falschem Raumbezug, zum Ausdruck. Dort<br />
heißt es aus <strong>der</strong> Perspektive von Nyla: „In <strong>der</strong> Schule ist sie [die Sprache Inuktitut] seit eini-<br />
gen Jahren Unterr<strong>ich</strong>tsfach, denn seit 1999 ist Nunavut, ‚unser Land‘ als selbstständiges Ter-<br />
ritorium anerkannt“ (Seydlitz 2009:105). Tuktoyaktuk, <strong>der</strong> Ort, <strong>der</strong> als Nylas Wohnort ange-<br />
geben wird, befindet s<strong>ich</strong> jedoch n<strong>ich</strong>t in Nunavut.<br />
Ausführl<strong>ich</strong>er geht Terra auf dieses Thema ein. Anhand eines Quellentextes, einem kana-<br />
dischen Zeitungsartikel, wird die Gründung Nunavuts dargelegt und <strong>dass</strong> die Inuit dadurch<br />
„weitgehende Selbstverwaltung und Nutzungsrechte im Nunavut-Gebiet“ (Terra 2006:14)<br />
erhalten. Aufgabe 5 stellt einen Bezug zwischen Selbstbestimmung und dem Fortbestand <strong>der</strong><br />
Inuit-Kultur her. Der Aspekt <strong>der</strong> Selbstbestimmung ist in <strong>der</strong> Terra-Darstellung zentral, denn<br />
er verdeutl<strong>ich</strong>t zum einen die verän<strong>der</strong>te Position <strong>der</strong> Inuit innerhalb des beschriebenen<br />
Nutzungskonfliktes und zum an<strong>der</strong>en zeigt er die Inuit auch in <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne als Volk mit ei-<br />
gener Identität.<br />
Wirtschaftl<strong>ich</strong>e Verhältnisse<br />
Die wirtschaftl<strong>ich</strong>en Verhältnisse in den Inuit-Regionen kommen in allen vier Büchern in<br />
wechseln<strong>der</strong> Ausführl<strong>ich</strong>keit zur Sprache.<br />
Terra nutzt hierfür einen problematisierenden Zugang, <strong>der</strong> auf den Landnutzungskonflikt<br />
zwischen den Inuit und <strong>der</strong> kanadischen Regierung eingeht. Die Interessen bei<strong>der</strong> Parteien<br />
werden aufgeführt und die Schülerinnen und Schüler aufgefor<strong>der</strong>t dies zu erläutern.<br />
In den übrigen Büchern wird dieser Aspekt zumeist eher am Rande thematisiert, etwa<br />
über die Berufe <strong>der</strong> Eltern <strong>der</strong> ber<strong>ich</strong>tenden Kin<strong>der</strong>, die zumeist typische Wirtschaftszweige<br />
vertreten. Beispielsweise arbeitet Alukies Mutter (Unsere Erde) bei <strong>der</strong> Stadtverwaltung von<br />
Iqaluit und spiegelt somit exemplarisch die Bedeutung <strong>der</strong> Behörden als Arbeitgeber in Nu-<br />
anvut wi<strong>der</strong>. Smillas Vater (Diercke) vertritt auf die gle<strong>ich</strong>e Weise als Kapitän eines Fischkut-
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 85<br />
ters die Fischerei, Alukies Onkel (Unsere Erde) den Tourismus. Zugle<strong>ich</strong> vermittelt die Angabe<br />
von Berufen, die auch den Schülerinnen und Schülern bekannt sind, einen Eindruck von ei-<br />
nerseits Mo<strong>der</strong>nität und an<strong>der</strong>erseits Ähnl<strong>ich</strong>keit zur eigenen Lebenswelt.<br />
Diercke und Seydlitz gehen daneben auch auf Probleme ein, indem beispielsweise darge-<br />
legt wird, <strong>dass</strong> es vielen Inuit an einer guten Schulbildung o<strong>der</strong> Berufsausbildung fehle<br />
(Diercke) und Nyla (Seydlitz) ausführt, <strong>dass</strong> die Inuit im Arbeitsleben oftmals auf die Fremd-<br />
sprache Englisch angewiesen seien und die Arbeitslosigkeit anspr<strong>ich</strong>t. Deren Folgen werden<br />
in Verbindung gebracht mit Kriminalität und dem Hinweis, die örtl<strong>ich</strong>en Gefängniszellen sei-<br />
en fast immer ausgebucht. Auch bei Terra werden als Folgen von Arbeitslosigkeit Alkoholis-<br />
mus, Selbstmorde und Kriminalität aufgeführt. Die Betrachtungsweise in beiden Büchern<br />
unterscheidet s<strong>ich</strong> dennoch erhebl<strong>ich</strong> durch die Kontextualisierung <strong>der</strong> Darstellungen. Wäh-<br />
rend <strong>der</strong> Beschreibung bei Seydlitz <strong>der</strong> Hinweis folgt, viele Inuit seien <strong>der</strong> Ans<strong>ich</strong>t, das Ende<br />
des traditionellen Nomadenlebens sei eher schädl<strong>ich</strong> gewesen, präsentiert Terra diese Prob-<br />
leme anhand <strong>der</strong> Vorbildfigur Paul Okalik, <strong>der</strong> s<strong>ich</strong> davon befreit habe und lässt die Schüle-<br />
rinnen und Schüler zudem in Aufgabe 3 erläutern, weshalb Okalik als Vorbild betrachtet<br />
werde. Bezogen auf die Wahrnehmung <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler werden somit einmal<br />
eher Perspektivlosigkeit und beim an<strong>der</strong>en Mal eher Chancen und Aufbruch suggeriert. Bei<br />
Unsere Erde hingegen fehlt eine diesbezügl<strong>ich</strong> problematisierende Perspektive vollkommen.<br />
4.2.3 Fazit <strong>der</strong> Schulbuchanalyse<br />
Vorangehend wurden einige zentrale Tendenzen <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das<br />
Leben <strong>der</strong> Inuit aufgezeigt. Vor diesem Hintergrund werden nachstehend die eingangs for-<br />
mulierten Leitfragen beantwortet und ein abschließendes Fazit gezogen.<br />
Leitfrage 1: Ist die inhaltl<strong>ich</strong>e Darstellung fachwissenschaftl<strong>ich</strong> korrekt?<br />
In den einzelnen Schulbüchern finden s<strong>ich</strong> durchaus einige fachl<strong>ich</strong>e Fehler o<strong>der</strong> Verfäl-<br />
schungen durch Ungenauigkeiten. Sehr auffällig ist dabei, <strong>dass</strong> dies überwiegend durch Ver-<br />
allgemeinerungen und Nachlässigkeiten bei den Raumbezügen verursacht wird, und das,<br />
obwohl für Erdkunde <strong>der</strong> Raum die entscheidende fachl<strong>ich</strong>e Dimension ist. Insbeson<strong>der</strong>e im<br />
Diercke-Buch geht in dieser Hins<strong>ich</strong>t einiges durcheinan<strong>der</strong>. So wird zunächst <strong>der</strong> Ortsname
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 86<br />
Ilulissat im Text auf Seite 67 fälschl<strong>ich</strong>erweise als Ilusiat wie<strong>der</strong>gegeben. Darüber hinaus ist<br />
anzumerken, <strong>dass</strong> s<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Buchtext explizit auf Grönland als Beispielraum bezieht, und, <strong>dass</strong><br />
somit aus Schülerperspektive auch davon ausgegangen werden kann, <strong>dass</strong> für die Abbildun-<br />
gen <strong>der</strong> gle<strong>ich</strong>e Raumbezug gilt, sofern dies n<strong>ich</strong>t an<strong>der</strong>s angegeben ist. Tatsächl<strong>ich</strong> ist dies<br />
jedoch n<strong>ich</strong>t <strong>der</strong> Fall. So zeigt M6 zwei Inuuk auf einem Skidoo vor einem Kaufhaus <strong>der</strong> Hud-<br />
son’s Bay Company, woraus ers<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> wird, <strong>dass</strong> dieses Bild in Kanada aufgenommen wur-<br />
de. Mit dem Bildtitel „Mo<strong>der</strong>ne Versorgung“, <strong>der</strong> im kontextuellen Zusammenhang steht mit<br />
<strong>der</strong> Beschreibung „Die Menschen hier [in Ilulissat/Grönland] benutzen als Verkehrsmittel im<br />
Winter Motorschlitten“ (Diercke 2009:67), wird jedoch <strong>der</strong> Eindruck erweckt, das Bild zeige<br />
eine Szene in Grönland. Der fachl<strong>ich</strong>en Angemessenheit wegen, müsste an dieser Stelle im<br />
Bildtitel angemerkt werden, <strong>dass</strong> hier ein Beispiel für die mo<strong>der</strong>ne Versorgung in Kanada<br />
abgebildet ist. Ähnl<strong>ich</strong> wie mit M6 verhält es s<strong>ich</strong> auch mit <strong>der</strong> Graphik M5. Das grundsätzli-<br />
che Problem <strong>der</strong> Zuordnung dieser Graphik zu <strong>der</strong> traditionellen o<strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Lebenswei-<br />
se ist bereits angesprochen worden. Doch auch inhaltl<strong>ich</strong> sind hier Stolpersteine zu finden.<br />
So beziehen s<strong>ich</strong> die angegebenen Durchschnittstemperaturen auf die Stadt Inuvik, aller-<br />
dings ohne, <strong>dass</strong> auf die Lage <strong>der</strong> Stadt in Nordwestkanada hingewiesen wird. Da davon aus-<br />
gegangen werden muss, <strong>dass</strong> die Schülerinnen und Schüler n<strong>ich</strong>t zwangsläufig wissen, wo<br />
s<strong>ich</strong> Inuvik befindet, ist ohne eine diesbezügl<strong>ich</strong>e Angabe die Wahrscheinl<strong>ich</strong>keit groß, <strong>dass</strong><br />
sie fälschl<strong>ich</strong>erweise in Grönland verortet wird. Da s<strong>ich</strong> die Mitteltemperaturen jedoch<br />
standortabhängig unterscheiden, wäre gerade bei einem solchen Indikator eine eindeutige<br />
räuml<strong>ich</strong>e Angabe w<strong>ich</strong>tig. Irreführend ist zudem im Seydlitz-Buch die Begründung „denn seit<br />
1999 ist Nunavut, ‚unser Land‘, als selbstständiges Territorium anerkannt“ (Seydlitz<br />
2009:105) für den Schulunterr<strong>ich</strong>t in <strong>der</strong> Sprache Inuktitut. Denn auch dieses Buch weist mit<br />
<strong>der</strong> Ortsangabe Tuktoyaktuk im Mackenzie-Delta einen klaren Raumbezug auf, <strong>der</strong> durch<br />
den genannten Beisatz verletzt wird. We<strong>der</strong> Tuktoyaktuk noch das Mackenzie-Delta befin-<br />
den s<strong>ich</strong> in Nunavut, weshalb die Gründung dieses Territoriums für die Unterr<strong>ich</strong>tssprache in<br />
Tuktoyaktuk irrelevant ist. Letztl<strong>ich</strong> muss noch auf die verallgemeinernde Darstellung des<br />
Iglus als typisches Haus im Winter bzw. auf <strong>der</strong> Jagd hingewiesen werden, wie sie bei Seydlitz<br />
und bei Diercke erfolgt. Wie bereits in Kapitel 3.2 angeführt, wurde das Iglu ledigl<strong>ich</strong> von<br />
einigen Inuitgruppen <strong>der</strong> östl<strong>ich</strong>en kanadischen Arktis während <strong>der</strong> Jagd im Winter gebaut<br />
(vgl. BACK/GERMAIN/MORRISON 1996:36). Seydlitz und Diercke beziehen s<strong>ich</strong> in ihren Darstellun-<br />
gen aber auf die westl<strong>ich</strong>e kanadische Arktis bzw. auf Westgrönland und somit auf Regionen,
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 87<br />
in denen das Iglu n<strong>ich</strong>t übl<strong>ich</strong> war. Zudem müsste eine räuml<strong>ich</strong>e Einordnung zu den Anga-<br />
ben erfolgen, um <strong>der</strong> Generalisierung solcher Informationen vorzubeugen.<br />
Leitfrage 2: Erfolgt durch die didaktische Reduktion eine Verzerrung o<strong>der</strong> unangemessene<br />
Verkürzung <strong>der</strong> fachwissenschaftl<strong>ich</strong>en Erkenntnisse?<br />
Eine starke inhaltl<strong>ich</strong>e Verkürzung ist an einer Stelle bei Terra zu bemerken. Dort heißt es<br />
zum Leben <strong>der</strong> Inuit heute: „Sie […] wohnen und ernähren s<strong>ich</strong> an<strong>der</strong>s als ihre Vorfahren“<br />
(Terra 2006:15) und, <strong>dass</strong> diese „Verän<strong>der</strong>ungen […] überall in den Inuit-Siedlungen s<strong>ich</strong>t-<br />
bar“ (Terra 2006:15) sind. Eine nähere Konkretisierung, wie s<strong>ich</strong> die Schülerinnen und Schü-<br />
ler diese Verän<strong>der</strong>ungen vorzustellen haben, erfolgt dabei n<strong>ich</strong>t. Auch Aufgabe 4, „Beschrei-<br />
be die Lebensweise <strong>der</strong> Inuit früher und heute“ ist auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> im Buch vorhande-<br />
nen Informationen nur schwerl<strong>ich</strong> lösbar.<br />
Bei Diercke gestalten s<strong>ich</strong> bereits angesprochene Verallgemeinerungen o<strong>der</strong> Ungenauig-<br />
keiten als problematisch, da sie durch Generalisierungen stereotype Wahrnehmungen för-<br />
<strong>der</strong>n.<br />
Darüber hinaus ist anzumerken, <strong>dass</strong> eine Darstellung, die den Anspruch hat, die gegen-<br />
wärtige Situation einer ganzen Volksgruppe aufzuzeigen – für Diercke, Seydlitz und Unsere<br />
Erde ist dieser Anspruch anzunehmen, da die Doppelseiten jeweils den Titel Inuit o<strong>der</strong> die<br />
Inuit tragen –, <strong>der</strong>en Probleme und Stärken gle<strong>ich</strong>ermaßen benennen sollte. Teilweise er-<br />
folgt in dieser Hins<strong>ich</strong>t jedoch eine sehr einseitige Darstellung. Bei Cornelsen etwa werden an<br />
keiner Stelle Probleme <strong>der</strong> Inuit, wie Arbeitslosigkeit o<strong>der</strong> kulturelle Entfremdung angespro-<br />
chen. Allerdings muss hierzu einschränkend angemerkt werden, <strong>dass</strong> dies mit <strong>der</strong> Aufberei-<br />
tung des Themas als Geo-Aktiv-Einheit zusammenhängen kann. Die Schulbuchseiten dienen<br />
hier als Hinführung zu einem Thema, das die Schülerinnen und Schüler größtenteils eigen-<br />
ständig und unter Verwendung weiterer externer Materialien erarbeiten sollen. Demgegen-<br />
über verfährt Seydlitz in dieser Hins<strong>ich</strong>t genau an<strong>der</strong>sherum und stellt den gegenwärtigen<br />
Problemen kaum positive Aspekte gegenüber o<strong>der</strong> relativiert neutrale Darstellungen durch<br />
beigefügte Bil<strong>der</strong>. Auffällig ist dabei <strong>der</strong> Kontrast zwischen den Darstellungen <strong>der</strong> traditionel-<br />
len und <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Lebensform. Während die traditionelle Lebensweise durchweg positiv<br />
dargelegt wird und auch die Bil<strong>der</strong> den Eindruck von angepasster Idylle unterstre<strong>ich</strong>en, ist
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 88<br />
<strong>der</strong> Blick auf die mo<strong>der</strong>ne Lebensweise vor allem durch die Bil<strong>der</strong> 105.2 (Mo<strong>der</strong>ne Inuitsied-<br />
lung) und 105.4 (Müllkippe „Wildnis“) stark negativ konnotiert.<br />
Leitfrage 3: Trägt die Darstellungsweise des Themas in den Schulbüchern zu einer vorur-<br />
teilsbehafteten Wahrnehmung <strong>der</strong> Inuit durch die Schülerinnen und Schüler bei?<br />
Insbeson<strong>der</strong>e Bild 105.4 im Seydlitz-Buch ist in dieser Hins<strong>ich</strong>t anzusprechen. Es zeigt eine<br />
große Menge Müll und Schrott am Ufer eines Sees o<strong>der</strong> Flusses und trägt den Untertitel<br />
„Müllkippe Wildnis“. Da an keiner an<strong>der</strong>en Stelle <strong>der</strong> Doppelseite erklärend Bezug hierauf<br />
genommen wird, ist aus Schülerperspektive zunächst davon auszugehen, <strong>dass</strong> die Inuit Ver-<br />
ursacher dieser Form von Umweltverschmutzung sind. Der einzige Schluss <strong>der</strong> folgl<strong>ich</strong> aus<br />
diesem Bild gezogen würde, wäre somit, <strong>dass</strong> die Inuit in früherer Zeit zwar angepasst an<br />
ihre Umwelt gelebt hätten, dies aber in <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne verloren gegangen sei und sie im Zuge<br />
<strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung dazu übergegangen seien, auch ihre Umwelt zu zerstören. Um dieses<br />
Bild gedankl<strong>ich</strong> einordnen zu können, wäre entwe<strong>der</strong> im Text o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Bildunterschrift ein<br />
Hinweis notwendig, was es mit <strong>der</strong> Müllkippe Wildnis auf s<strong>ich</strong> hat, und wer dafür verant-<br />
wortl<strong>ich</strong> ist.<br />
Zusammenfassend ist festzuhalten, <strong>dass</strong> die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben<br />
<strong>der</strong> Inuit zunächst inhaltl<strong>ich</strong> durch die curricularen Vorgaben auf den Aspekt <strong>der</strong> Anpassung<br />
an den Lebensraum gelenkt wird. Hierbei werden mo<strong>der</strong>ne und traditionelle Lebensweisen<br />
gegenüber gestellt. Mit Ausnahme von Terra zielen die Aufgabenstellungen in diesem Zu-<br />
sammenhang mehrheitl<strong>ich</strong> auf die traditionelle Lebensform. Inhaltl<strong>ich</strong>e Schwerpunkte bilden<br />
die Lebensumstände <strong>der</strong> Menschen – wie sie wohnen, wovon sie s<strong>ich</strong> ernähren, wie sie s<strong>ich</strong><br />
kleiden, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen und mit welchen Problemen sie konfron-<br />
tiert sind. Bei Terra kommt zudem die Thematik des Nutzungskonfliktes zwischen zwei Inte-<br />
ressengruppen zum tragen. Um einen Bezug zur Lebenswelt <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler<br />
herzustellen, lassen die Bücher in drei von vier Fällen jugendl<strong>ich</strong>e Inuit von ihrem Leben be-<br />
r<strong>ich</strong>ten. Dem Anspruch nach streben sie hiermit danach, die Lebensform in einer an<strong>der</strong>en<br />
Klimazone fachl<strong>ich</strong> korrekt und vorurteilsfrei darzulegen und einen Beitrag zur Herausbil-<br />
dung interkultureller Kompetenz zu leisten. Dies gelingt ihnen jedoch in unterschiedl<strong>ich</strong>em<br />
Maße. Seydlitz tendiert zur Einseitigkeit und Diercke verwirrt und verfälscht durch Verallge-<br />
meinerungen. Die Terra-Seiten sind hierbei aufgrund eines an<strong>der</strong>s gelegten und deutl<strong>ich</strong>
Die Perspektive <strong>der</strong> Schulbücher auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 89<br />
enger gefassten inhaltl<strong>ich</strong>en Schwerpunktes weniger problematisch. Ursächl<strong>ich</strong> für Mängel<br />
in den Darstellungen sind zumeist fachl<strong>ich</strong>e Ungenauigkeiten und starke Verallgemeinerun-<br />
gen, die mitunter Vorurteile för<strong>der</strong>n und Stereotype verstärken. In dieser Hins<strong>ich</strong>t wären<br />
eine transparente Darlegung <strong>der</strong> Vielfalt und genaue räuml<strong>ich</strong>e Bezüge w<strong>ich</strong>tig für eine Ver-<br />
besserung.
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 90<br />
5 Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit<br />
5.1 Fragestellung und Hypothesen <strong>der</strong> Schülerbefragung<br />
Nachdem vorangehend bereits mit <strong>der</strong> Fachwissenschaft und den Schulbüchern zwei Per-<br />
spektiven auf das Leben <strong>der</strong> Inuit dargelegt wurden, wird nachfolgend ein dritter Blickwinkel<br />
zu dieser Thematik erhoben. Die Wahrnehmung <strong>der</strong> Inuit durch die Schülerinnen und Schü-<br />
ler und ihre Vorstellungen über <strong>der</strong>en Leben repräsentieren dabei nun in Hinblick auf die<br />
anfangs eingeführte Differenzierung zwischen einer Ordnung <strong>der</strong> Dinge und einer Ordnung<br />
<strong>der</strong> Blicke letztgenannte, wohingegen die Fachwissenschaft und zumindest dem Anspruch<br />
nach auch die Schulbücher eher danach streben, eine Ordnung <strong>der</strong> Dinge wie<strong>der</strong>zugeben.<br />
Interessant ist in dieser Hins<strong>ich</strong>t vor allem zweierlei: zum einen, wie s<strong>ich</strong> die Schülerinnen<br />
und Schüler das Leben <strong>der</strong> Inuit grundsätzl<strong>ich</strong> vorstellen, und zum an<strong>der</strong>en, wie s<strong>ich</strong> die Be-<br />
handlung des Themas im Unterr<strong>ich</strong>t auf die Vorstellungen auswirkt. Dabei ist mit <strong>der</strong> Darstel-<br />
lung von HEMMER/HEMMER (vgl. REINFRIED 2006:53) davon auszugehen, <strong>dass</strong> die Schülerinnen<br />
und Schüler <strong>der</strong> Thematik zwar grundsätzl<strong>ich</strong> ein hohes Interesse entgegenbringen, gle<strong>ich</strong>-<br />
zeitig aber aufgrund <strong>der</strong> geringen Präsenz <strong>der</strong> Inuit im alltägl<strong>ich</strong>en medialen Umfeld über<br />
wenig Vorwissen verfügen, sofern das Thema noch n<strong>ich</strong>t Gegenstand des Unterr<strong>ich</strong>tes war.<br />
Allerdings sind ihnen mit hoher Wahrscheinl<strong>ich</strong>keit gängige Stereotype wie das vom ‚frie-<br />
renden, Robben jagenden Eskimo im Iglu‘ vertraut (vgl. FIENUP-RIORDAN 1995:ix).<br />
Vor diesem Hintergrund liegen <strong>der</strong> Erhebung <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schü-<br />
ler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit folgende Hypothesen zugrunde:<br />
Hypothese 1:<br />
(a) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit noch n<strong>ich</strong>t Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes wa-<br />
ren, dann verwenden die Schülerinnen und Schüler zur Benennung <strong>der</strong> Inuit teilwei-<br />
se noch den früher gebräuchl<strong>ich</strong>en Namen Eskimo.<br />
(b) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit bereits Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes waren,<br />
dann ist den Schülerinnen und Schülern die Beze<strong>ich</strong>nung Inuit bekannt und wird<br />
auch von ihnen verwandt.<br />
Hypothese 2:<br />
(a) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit noch n<strong>ich</strong>t Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes wa-<br />
ren, dann sind Spontanassoziationen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler über das Leben in
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 91<br />
<strong>der</strong> kalten Zone von gängigen Stereotypen hierzu geprägt.<br />
(b) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit bereits Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes waren,<br />
dann kommen bei Spontanassoziationen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler zum Leben in<br />
<strong>der</strong> kalten Zone im Unterr<strong>ich</strong>t thematisierte Inhalte wie etwa <strong>der</strong> Wandel <strong>der</strong> Le-<br />
bensweisen zum Ausdruck.<br />
Hypothese 3:<br />
Unabhängig davon, ob die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit bereits Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>-<br />
tes waren o<strong>der</strong> n<strong>ich</strong>t, besteht auf Seiten <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler Interesse am Leben<br />
<strong>der</strong> Menschen und an Eingriffen in den Naturhaushalt (vgl. REINFRIED 2006:54f unter Bezug-<br />
nahme auf HEMMER/HEMMER).<br />
Hypothese 4:<br />
(a) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit noch n<strong>ich</strong>t Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes wa-<br />
ren, dann dominieren (ggf. stereotype) Aspekte <strong>der</strong> traditionellen Lebensweisen <strong>der</strong><br />
Inuit (z. B. Leben im Iglu, Nomadismus, Robbenjagd, Hundeschlitten, …) einseitig die<br />
Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler und sie assoziieren das Leben <strong>der</strong> Inuit<br />
n<strong>ich</strong>t o<strong>der</strong> nur sehr eingeschränkt mit technischen (Strom, fließend Wasser, Tele-<br />
fon, Internet, Fernsehen, Heizung, …) und infrastrukturellen (Supermärkte, ÖPNV,<br />
Krankenhäuser, …) Errungenschaften sowie Freizeitaktivitäten (Sportvereine, Kon-<br />
zerte, IT- und Mediennutzung, …).<br />
(b) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit bereits Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes waren,<br />
dann verfügen die Schülerinnen und Schüler über ein überblicksartiges Wissen zum<br />
Leben <strong>der</strong> Inuit, wobei sie traditionelle und mo<strong>der</strong>ne Lebensweisen differenzieren,<br />
und mit dem heutigen Leben <strong>der</strong> Inuit vor allem Aspekte <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Lebenswei-<br />
sen wie etwa feste Häuser, Schulen, Supermärkte, Freizeitaktivitäten, Motorschlit-<br />
ten o<strong>der</strong> auch Arbeitslosigkeit und Kriminalität assoziieren.<br />
5.2 Methodisches Vorgehen<br />
Ziel <strong>der</strong> Erhebung war es, auch in dem vergle<strong>ich</strong>sweise kleinen Rahmen dieser Arbeit<br />
Schülerinnen und Schüler mit unterschiedl<strong>ich</strong>en Eingangsvoraussetzungen hins<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> des<br />
Vorwissens, <strong>der</strong> Leistungsstärke und des fachl<strong>ich</strong>en Interesses in ausre<strong>ich</strong>end großer Zahl zu
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 92<br />
befragen, um einen ersten Eindruck ihrer Vorstellungen und S<strong>ich</strong>tweisen zu gewinnen. Aus<br />
diesem Grund wurde eine standardisierte, schriftl<strong>ich</strong>e Befragung mittels eines Fragebogens<br />
durchgeführt. Alternativ hierzu hätten s<strong>ich</strong> auch Einzelinterviews mit mehreren Schülerinnen<br />
und Schülern angeboten. Diese Variante hätte mit hoher Wahrscheinl<strong>ich</strong>keit zu differenzier-<br />
teren Ergebnissen geführt, wäre aber nur mit einer sehr kleinen St<strong>ich</strong>probe mögl<strong>ich</strong> gewe-<br />
sen. Zu Gunsten eines aussagekräftigeren Eindruckes <strong>der</strong> grundlegenden Vorstellungen einer<br />
größeren Zahl von Schülerinnen und Schüler wurde somit <strong>der</strong> Form <strong>der</strong> Fragebogenbefra-<br />
gung <strong>der</strong> Vorzug gegeben. Hierzu wurde ein Fragebogen erstellt, <strong>der</strong> von den Schülerinnen<br />
und Schülern schriftl<strong>ich</strong> zu beantworten war.<br />
Den Fragebogen (vgl. Anhang 4) leitet ein kurzer Text ein, <strong>der</strong> den Schülerinnen und Schü-<br />
lern darlegt, worum es in <strong>der</strong> Befragung geht und was von ihnen erwartet wird. Daran an-<br />
schließend werden einige allgemeine, statistische Angaben erfragt, die Geschlecht, Alter,<br />
Klasse und das Interesse an den Themen im Erdkundeunterr<strong>ich</strong>t betreffen. Für die Einstu-<br />
fung des Interesses wurden Ankreuzfel<strong>der</strong> in sechsfacher Abstufung von sehr interessant bis<br />
uninteressant vorgegeben. Zusätzl<strong>ich</strong> wird zu dieser Frage eine kurze Begründung <strong>der</strong> Ant-<br />
wort erbeten. Dies soll bei <strong>der</strong> Auswertung <strong>der</strong> Antworten Rückschlüsse auf die grundsätzli-<br />
che Haltung des Schülers/<strong>der</strong> Schülerin zum Fach und seinen Inhalten ermögl<strong>ich</strong>en. Um ge-<br />
genüber den Schülerinnen und Schülern die Ernsthaftigkeit <strong>der</strong> Befragung zu unterstre<strong>ich</strong>en,<br />
wurde die Kopfzeile auf <strong>der</strong> ersten Seite des Fragebogens mit den Logos <strong>der</strong> <strong>Leibniz</strong> Universi-<br />
tät und <strong>der</strong> Abteilung für <strong>Didaktik</strong> <strong>der</strong> <strong>Geographie</strong> versehen.<br />
Der Fragebogen umfasst insgesamt acht Fragen, die nach dem Schema vom Allgemeinen<br />
zum Konkreten angeordnet sind. Die Fragen bieten teilweise offene, teilweise geschlossene<br />
Antwortmögl<strong>ich</strong>keiten, je nach dem, ob allgemeine Angaben o<strong>der</strong> individuelle Interessen<br />
und Vorstellung erfragt werden. Mitunter wird eine geson<strong>der</strong>te Begründung <strong>der</strong> Antwort<br />
gefor<strong>der</strong>t. Dadurch soll zum einen vermieden werden, <strong>dass</strong> die Schülerinnen und Schüler mit<br />
schlecht o<strong>der</strong> n<strong>ich</strong>t zu deutenden Ein-Wort-Sätzen antworten und zum an<strong>der</strong>en soll es be-<br />
wirken, <strong>dass</strong> die Schülerinnen ihre Antworten überdenken. Zudem wurde darauf geachtet,<br />
<strong>dass</strong> jene Fragen, die die zeitintensivste Bearbeitung erfor<strong>der</strong>n, in <strong>der</strong> Mitte des Fragebo-<br />
gens stehen. Dies soll verhin<strong>der</strong>n, <strong>dass</strong> die Schülerinnen und Schüler zu Beginn <strong>der</strong> Bearbei-<br />
tung des Fragebogens abgeschreckt werden (vgl. MEIER KRUKER/RAUH 2005:96). Die Formulie-<br />
rung <strong>der</strong> Fragestellungen erfolgte in enger inhaltl<strong>ich</strong>er Anlehnung an die Hypothesen <strong>der</strong>
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 93<br />
Untersuchung. So fragt Frage 1 nach <strong>der</strong> Beze<strong>ich</strong>nung für die Bewohner <strong>der</strong> kalten Zone. Für<br />
die Antwort stehen hier die Begriffe Indianer, Eskimos, Inuit und Tuareg als Ankreuzmögl<strong>ich</strong>-<br />
keiten zur Auswahl. In Frage 2 ist die Nennung dreier spontaner St<strong>ich</strong>worte zum Leben in <strong>der</strong><br />
kalten Zone gefor<strong>der</strong>t. Die soll einen Hinweis auf allgemeine Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen<br />
und Schüler über das Leben in <strong>der</strong> kalten Zone geben, bevor sie s<strong>ich</strong> im Fortlauf des Frage-<br />
bogens näher mit dieser Thematik beschäftigen. Auf die Verwendung des Begriffes Inuit bei<br />
dieser und auch bei den weiteren Fragestellungen wurde bewusst verz<strong>ich</strong>tet, um die Beant-<br />
wortung von Frage 1 n<strong>ich</strong>t zu beeinflussen. Stattdessen wird von Bewohnern <strong>der</strong> kalten Zone<br />
bzw. dem Leben in <strong>der</strong> kalten Zone gesprochen. Damit den Schülerinnen und Schülern klar<br />
ist, welcher Raum mit <strong>der</strong> kalten Zone gemeint ist, wurde neben <strong>der</strong> Frage eine Karte plat-<br />
ziert, die den Siedlungsraum <strong>der</strong> Inuit zeigt. Frage 3 erfragt spezifische Interessen <strong>der</strong> Schü-<br />
lerinnen und Schüler in Bezug auf das Leben in <strong>der</strong> kalten Zone sowie eine entsprechende<br />
Begründung <strong>der</strong> Antwort. Dies soll die allgemeine Haltung des Schülers/<strong>der</strong> Schülerin zum<br />
Thema zeigen. Außerdem ist zu erwarten, <strong>dass</strong> diejenigen Aspekte, die für die Schülerinnen<br />
und Schüler von beson<strong>der</strong>em Interesse sind, auch ihre Vorstellungen prägen. Die umfang-<br />
re<strong>ich</strong>sten inhaltl<strong>ich</strong>en Erträge bezügl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Schülervorstellungen werden von Frage 4 erwar-<br />
tet. Hier sollen s<strong>ich</strong> die Schülerinnen und Schüler vorstellen, sie stünden über Skype in Kon-<br />
takt mit einem gle<strong>ich</strong>altrigen Jugendl<strong>ich</strong>en aus Grönland, und aufschreiben, wie dieser Ju-<br />
gendl<strong>ich</strong>e ihnen sein alltägl<strong>ich</strong>es Leben in Bezug auf Familie, Freunde, Schule, Freizeit und<br />
Wohnung beschreiben würde. Mit Grönland wurde hier exemplarisch eines <strong>der</strong> Hauptsied-<br />
lungsgebiete <strong>der</strong> Inuit als Raum gewählt, weil davon ausgegangen wird, <strong>dass</strong> die Schülerin-<br />
nen und Schüler hierzu konkretere Vorstellungen haben als zu abstrakten Raumbeze<strong>ich</strong>nun-<br />
gen wie kalte Zone o<strong>der</strong> nordamerikanische Arktis. In Frage 5 sollen die Schülerinnen und<br />
Schüler Bil<strong>der</strong> ankreuzen, die ihren Vorstellungen über das Leben in Grönland entsprechen.<br />
Die Frage wurde so formuliert, <strong>dass</strong> die Schülerinnen und Schüler aufgefor<strong>der</strong>t sind, ihre<br />
eigenen, individuellen Vorstellungen und Assoziationen wie<strong>der</strong>zugeben und n<strong>ich</strong>t ihre Ver-<br />
mutungen darüber, welche Bil<strong>der</strong> fachl<strong>ich</strong> r<strong>ich</strong>tig sein könnten. Zur Auswahl stehen acht Bil-<br />
<strong>der</strong>, die verschiedene Aspekte traditioneller und mo<strong>der</strong>ner Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit zeigen.<br />
Sie haben folgende Inhalte:<br />
(a) Blick über einen Teil <strong>der</strong> westgrönländischen Stadt Uummannaq<br />
(b) Traditionell gekleideter Inuk beim Bau eines Iglus
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 94<br />
(c) Zwei Kin<strong>der</strong> beim Fußballspielen auf einem Sportplatz in Nuuk<br />
(d) Traditionell gekleideter Inuk bei <strong>der</strong> Robbenjagd mit einer Harpune am Eisloch<br />
(e) Jugendl<strong>ich</strong>e Inuit mit Laptops<br />
(f) Konzert einer grönländischen Band in <strong>der</strong> Stadthalle von Nuuk aus <strong>der</strong> Publikums-<br />
perspektive<br />
(g) Inuit in einem grönländischen Supermarkt<br />
(h) Inuk in einem traditionell gebauten Kajak<br />
Frage 6 dient weniger <strong>der</strong> Überprüfung <strong>der</strong> Hypothesen als <strong>der</strong> Abschätzung <strong>der</strong> Potentia-<br />
le eines Märchens als didaktischem Zugang zu <strong>der</strong> Thematik. Die Schülerinnen und Schüler<br />
werden gefragt, ob sie ein Märchen kennen, das aus <strong>der</strong> kalten Zone stammt, und ob sie ein<br />
solches Märchen interessieren würde. Auch zu dieser Frage wird eine Begründung <strong>der</strong> Ant-<br />
wort gefor<strong>der</strong>t. Die Fragen 7 und 8 sollen letztl<strong>ich</strong> helfen, die Antworten <strong>der</strong> Schülerinnen<br />
und Schüler zu vorherigen Fragen einzuordnen. So sollen die Schülerinnen und Schüler in<br />
Frage 7 angeben, woher ihr Wissen über das Leben in <strong>der</strong> kalten Zone stammt. Als An-<br />
kreuzmögl<strong>ich</strong>keiten wurden Fernsehen (Nachr<strong>ich</strong>ten, Dokumentationen, …); Zeitung, Zeit-<br />
schriften; Familie, Freunde; Schule; Internet und Bücher angegeben. Daneben wurde eine<br />
Zeile für sonstige Nennungen einger<strong>ich</strong>tet. In Frage 8 sind die Schülerinnen und Schüler auf-<br />
gefor<strong>der</strong>t, ihre Vorstellungen in Bezug auf die fachl<strong>ich</strong>e R<strong>ich</strong>tigkeit einzuschätzen. Hierfür<br />
wurden sechs Ankreuzfel<strong>der</strong> von sehr s<strong>ich</strong>er bis uns<strong>ich</strong>er erstellt. Auch hier soll die Antwort<br />
kurz begründet werden.<br />
Das Leben <strong>der</strong> Inuit findet in <strong>der</strong> Regel im Rahmen <strong>der</strong> Thematisierung angepasster Le-<br />
bensformen in verschiedenen Klimazonen <strong>der</strong> Erde Eingang in den Erdkundeunterr<strong>ich</strong>t an<br />
nie<strong>der</strong>sächsischen Gymnasien. Da das Kerncurriculum (vgl. NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM<br />
2008:12) diesen Themenkomplex für die Klassenstufen 7 und 8 vorsieht, wurden Schülerin-<br />
nen und Schüler ebendieser Klassenstufen befragt. Daneben musste bei <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong><br />
befragten Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong>en Vorwissen berücks<strong>ich</strong>tigt werden, da die vorab<br />
formulierten Hypothesen in dieser Hins<strong>ich</strong>t differenzieren, ob die Schülerinnen und Schüler<br />
mit dem Thema bereits vertraut sind o<strong>der</strong> n<strong>ich</strong>t. Es wurden daher zwei verschiedene Klassen<br />
als Versuchsgruppen ausgewählt, wobei die eine das Thema bereits im Unterr<strong>ich</strong>t durchge-<br />
nommen hatte, die an<strong>der</strong>e hingegen n<strong>ich</strong>t.
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 95<br />
Die erste Befragung (St<strong>ich</strong>probe 1) fand am Dienstag, den 21. Juni 2011 zwischen 8⁰⁰ Uhr<br />
und 8³⁰ Uhr an <strong>der</strong> Schillerschule in Hannover statt. Dabei wurden die Vorstellungen von 28<br />
Schülerinnen und Schülern einer achten Klasse erhoben, denen das Thema Lebensweisen <strong>der</strong><br />
Inuit bisher n<strong>ich</strong>t aus dem Schulunterr<strong>ich</strong>t bekannt war. Die zweite Befragung (St<strong>ich</strong>probe 2)<br />
erfolgte zwei Tage später, am Donnerstag, den 23. Juni 2011 zwischen 9⁵⁰ Uhr und 10²⁰ Uhr<br />
ebenfalls an <strong>der</strong> Schillerschule in Hannover. Im Gegensatz zur ersten handelte es s<strong>ich</strong> in die-<br />
sem Fall um 24 Schülerinnen und Schüler einer siebten Klasse, die das Thema Lebensweisen<br />
<strong>der</strong> Inuit bereits im Verlauf desselben Schuljahres im Unterr<strong>ich</strong>t durchgenommen hatten.<br />
Während <strong>der</strong> Durchführung wurde darauf geachtet, den Schülerinnen und Schülern bei-<br />
<strong>der</strong> St<strong>ich</strong>proben mögl<strong>ich</strong>st gle<strong>ich</strong>e Bedingungen zu schaffen. Die Befragungen fanden jeweils<br />
im Unterr<strong>ich</strong>tsraum <strong>der</strong> Klasse unter meiner Aufs<strong>ich</strong>t statt. Bei <strong>der</strong> ersten Befragung war<br />
zudem auch die Fachlehrerin anwesend. Vor dem Austeilen <strong>der</strong> Fragebögen wurden den<br />
Schülerinnen und Schülern Ziel und Anliegen <strong>der</strong> Befragung dargelegt und sie wurden darauf<br />
hingewiesen, <strong>dass</strong> die Fragebögen in Einzelarbeit auszufüllen seien, um Verfälschungen zu<br />
vermeiden. In Absprache mit den Fachlehrern wurde den Schülerinnen und Schülern für die<br />
Bearbeitung <strong>der</strong> Fragebögen keine zeitl<strong>ich</strong>e Begrenzung vorgegeben. Die einzelnen Schüle-<br />
rinnen und Schüler haben ihre fertig ausgefüllten Fragebögen abgegeben und s<strong>ich</strong> anschlie-<br />
ßend still an ihren Plätzen aufgehalten, bis alle an<strong>der</strong>en auch fertig waren. Beide Befragun-<br />
gen dauerten letztl<strong>ich</strong> jeweils eine halbe Stunde.<br />
Die Auswertung <strong>der</strong> Fragebögen erfolgt nachstehend auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> eingangs<br />
formulierten Hypothesen. Anhand <strong>der</strong>en Überprüfung werden grundsätzl<strong>ich</strong>e Tendenzen <strong>der</strong><br />
Schülervorstellungen und -einstellungen zum Leben <strong>der</strong> Inuit herausgearbeitet und in einem<br />
Fazit abschließend betrachtet.<br />
5.3 Auswertung <strong>der</strong> Schülerbefragung<br />
Hypothese 1:<br />
a) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit noch n<strong>ich</strong>t Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes waren,<br />
dann verwenden die Schülerinnen und Schüler zur Benennung <strong>der</strong> Inuit teilweise noch den<br />
früher gebräuchl<strong>ich</strong>en Namen ‚Eskimo‘.
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 96<br />
b) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit bereits Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes waren,<br />
dann ist den Schülerinnen und Schülern die Beze<strong>ich</strong>nung Inuit bekannt und wird auch von<br />
ihnen verwandt.<br />
Unter den vier vorgegeben Antwortmög-<br />
l<strong>ich</strong>keiten für Frage 1 wurden fast ausschließ-<br />
l<strong>ich</strong> die Namen Eskimos und Inuit ausge-<br />
wählt; Indianer wurden n<strong>ich</strong>t genannt, Tua-<br />
reg nur ein einziges Mal in St<strong>ich</strong>probe 1. Die<br />
Auswertung <strong>der</strong> Fragebögen zeigt, <strong>dass</strong> Inuit<br />
zwar die mit Abstand häufigste Nennung ist,<br />
ein signifikanter Anteil <strong>der</strong> Nennungen in<br />
St<strong>ich</strong>probe 1 aber auch auf die Beze<strong>ich</strong>nung<br />
Eskimo entfällt. Hier gaben dies mehr als ein<br />
Drittel <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler als Be-<br />
nennung <strong>der</strong> Bewohner <strong>der</strong> kalten Zone an,<br />
wobei in drei Fällen sowohl Inuit als auch<br />
Eskimo angekreuzt wurde. Bei diesen drei Schülerinnen und Schülern liegt die Vermutung<br />
nahe, <strong>dass</strong> sie zwar wissen, <strong>dass</strong> Inuit heutzutage die übl<strong>ich</strong>e Beze<strong>ich</strong>nung ist, sie aber den-<br />
noch alle Beze<strong>ich</strong>nungen angekreuzt haben, die ihnen hins<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Bewohner <strong>der</strong> kalten<br />
Zone bekannt waren. Es bleiben somit sechs von 28 Schülerinnen und Schülern, denen Eski-<br />
mo als einzige Beze<strong>ich</strong>nung geläufig ist. In St<strong>ich</strong>probe 2 wurde Eskimo ledigl<strong>ich</strong> von zwei <strong>der</strong><br />
24 Schülerinnen und Schüler genannt im Gegensatz zu 22 Nennungen von Inuit. Relativ ge-<br />
sehen wird die Beze<strong>ich</strong>nung Eskimo somit in St<strong>ich</strong>probe 2 wie zu erwarten deutl<strong>ich</strong> seltener<br />
für die r<strong>ich</strong>tige gehalten als in St<strong>ich</strong>probe 1.<br />
Hypothese 2:<br />
a) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit noch n<strong>ich</strong>t Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes waren,<br />
dann sind Spontanassoziationen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler über das Leben in <strong>der</strong> kalten<br />
Zone von gängigen Stereotypen hierzu geprägt.<br />
Abbildung 39: Häufigkeit <strong>der</strong> Nennungen <strong>der</strong> Beze<strong>ich</strong>nungsvorschläge<br />
für die Bewohner <strong>der</strong> kalten<br />
Zone (Mehrfachnennungen mögl<strong>ich</strong>)<br />
(eigene Darstellung)<br />
b) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit bereits Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes waren,<br />
dann kommen bei Spontanassoziationen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler zum Leben in <strong>der</strong> kal-<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Indianer Eskimos Inuit Tuareg<br />
St<strong>ich</strong>probe 1 (n=32) St<strong>ich</strong>probe 2 (n= 24)
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 97<br />
ten Zone im Unterr<strong>ich</strong>t thematisierte Inhalte wie etwa <strong>der</strong> Wandel <strong>der</strong> Lebensweisen zum<br />
Ausdruck.<br />
Zunächst fällt bei einer allgemeinen Betrachtung <strong>der</strong> Antworten bei<strong>der</strong> St<strong>ich</strong>proben auf,<br />
<strong>dass</strong> die Schülerinnen und Schüler mit dem Leben in <strong>der</strong> kalten Zone in Hinblick auf die Häu-<br />
figkeiten <strong>der</strong> Nennungen n<strong>ich</strong>t primär das Leben <strong>der</strong> Inuit o<strong>der</strong> von Menschen im Allgemei-<br />
nen verbinden (vgl. Abb. 40). Die häufigsten Assoziationen entfallen für beide Befragungen<br />
einerseits auf einzelne, für die Polarzonen typische Tierarten. Der Eisbär wurde in diesem<br />
Zusammenhang sehr häufig genannt, aber auch Pinguine und Wale fanden mehrfach Erwäh-<br />
nung. An<strong>der</strong>erseits stehen naturräuml<strong>ich</strong>e Voraussetzungen im Vor<strong>der</strong>grund. Das St<strong>ich</strong>wort<br />
Kälte bzw. kalt fiel bei <strong>der</strong> zweiten Befragung am häufigsten, bei <strong>der</strong> ersten am zweithäufigs-<br />
ten. Mögl<strong>ich</strong>erweise ist dies jedoch in Teilen auf die Fragestellung zurückzuführen, in <strong>der</strong><br />
nach <strong>der</strong> kalten Zone gefragt wurde. Dass dieser zunächst das Attribut kalt zugeordnet wird,<br />
liegt nahe. Vor allem in St<strong>ich</strong>probe 1 gehörten daneben auch St<strong>ich</strong>worte wie Eis, Eisberge<br />
und Schnee zu den häufigsten Nennungen.<br />
Die Inuit (teilweise auch als Eskimos beze<strong>ich</strong>net) lagen von <strong>der</strong> Quantität <strong>der</strong> Nennungen<br />
her ebenso wie die damit in Verbindung stehenden Begriffe Iglu und Jagd bei beiden St<strong>ich</strong>-<br />
proben im Mittelfeld, wobei Inuit in St<strong>ich</strong>probe 2 relativ gesehen häufiger genannt wurde.<br />
In Hypothese 2a wurde davon ausgegangen, <strong>dass</strong> die Assoziationen <strong>der</strong> Schülerinnen und<br />
Schüler <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe 1 von Stereotypen geprägt seien. Als verbreitete Stereotype zum Le-<br />
ben <strong>der</strong> Inuit beze<strong>ich</strong>net FIENUP-RIORDAN (vgl. 1995:ix) einerseits den friedl<strong>ich</strong>en, freundl<strong>ich</strong><br />
lächelnden Inuk, <strong>der</strong> Eisbären jagt und im Iglu lebt, und an<strong>der</strong>erseits den primitiven Wilden,<br />
<strong>der</strong> versucht, in einer unwirtl<strong>ich</strong>en Umgebung zu überleben, und von <strong>der</strong> Gunst <strong>der</strong> westli-<br />
chen Zivilisation abhängig ist. ALIA (vgl. 2005:942) ergänzt zudem das Bild vom frierenden<br />
Inuk im Iglu. Einzelne Aspekte dieser S<strong>ich</strong>tweisen kommen bei den spontanen Assoziationen<br />
<strong>der</strong> Schülerinnen und Schülern durchaus zum Tragen. Insbeson<strong>der</strong>e die erste von FIENUP-<br />
RIORDAN beschriebene Vorstellung zeigt s<strong>ich</strong> hierbei. So ze<strong>ich</strong>nen alle direkt o<strong>der</strong> indirekt auf<br />
die Inuit bezogenen Aussagen <strong>der</strong> ersten St<strong>ich</strong>probe zusammengenommen folgendes Bild:<br />
Die Inuit leben ohne Kontakt zur Außenwelt in sehr kleinen Gruppen, wobei s<strong>ich</strong> diese<br />
durch Zusammenhalt und einen geregelten Lebensablauf ausze<strong>ich</strong>nen. Sie wohnen im Iglu<br />
und versorgen s<strong>ich</strong> durch die Jagd und den Fischfang mit Lebensmitteln, leiden dabei aller-
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 98<br />
dings unter Lebensmittelmangel. Die Fortbewegung bewerkstelligen sie mit Hundeschlitten<br />
und zum Schutz vor <strong>der</strong> Kälte tragen sie mehrere Kleidungssch<strong>ich</strong>ten aus Fellen und Pelzen. In<br />
ihrer Freizeit spielen sie Eishockey.<br />
Große Einigkeit besteht unter den Schülerinnen und Schülern in Bezug auf das Iglu, wel-<br />
ches elf von ihnen nannten. Jagd, Lebensmittelmangel und viel Kleidung aus Fellen/Pelzen<br />
wurden je drei Mal angeführt, während alle übrigen Elemente <strong>der</strong> vorangegangenen Be-<br />
schreibung immer nur von einem Schüler o<strong>der</strong> einer Schülerin geäußert wurden (vgl.<br />
Abb.40).<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
kein Kontakt zur Außenwelt<br />
an<strong>der</strong>es Klima, arktisch<br />
Anpassung<br />
wenige Einwohner<br />
Eis, Eisberge<br />
Eishockey<br />
Fertighäuser<br />
Fisch<br />
Forschungsstationen<br />
geregelter Lebensablauf<br />
Grönland & Kanada<br />
Hundeschlitten, Huskies<br />
Iglu<br />
Inuit/Eskimo<br />
Jagd<br />
Kälte<br />
Lebensmittelmangel<br />
Nord- und Südpol<br />
Ölpipeline<br />
Pelz, Felljacken, viel Kleidung<br />
Polartag, Polarnacht<br />
Schnee<br />
Selbstversorger (früher)<br />
Skidoo<br />
Tiere<br />
lang Wege (Transport, Schule)<br />
Überlebenskampf<br />
Umweltgefährdung<br />
Vegetation gering<br />
Zusammenhalt<br />
St<strong>ich</strong>probe 1 (n=86) St<strong>ich</strong>probe 2 (n=70)<br />
Abbildung 40: Spontane Assoziationen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler zum Leben in <strong>der</strong> kalten Zone<br />
(eigene Darstellung)<br />
Die Assoziationen <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe 2 unterscheiden s<strong>ich</strong> hiervon in mancherlei Hins<strong>ich</strong>t.<br />
Hypothese 2b geht davon aus, <strong>dass</strong> s<strong>ich</strong> im Unterr<strong>ich</strong>t behandelte Inhalte in den Antworten<br />
<strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler nie<strong>der</strong>schlagen. Der Unterr<strong>ich</strong>t in dieser Klasse fand unter
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 99<br />
Verwendung des Seydlitz-Buches (Ausgabe 2007) statt. Die darin enthaltenen Seiten zum<br />
Leben <strong>der</strong> Inuit sind identisch mit denen des Seydlitz-Buches von 2009, die in Kapitel 4 vor-<br />
gestellt wurden.<br />
Tatsächl<strong>ich</strong> zeigen die Angaben <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler eine Mischung aus Vorstel-<br />
lungen, die einerseits (häufig) denen von St<strong>ich</strong>probe 1 sehr ähnl<strong>ich</strong> sind, und an<strong>der</strong>erseits<br />
(bei einem Teil <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler) auf den Darlegungen des Schulbuches zum<br />
Leben <strong>der</strong> Inuit bzw. zu den Polarzonen im Allgemeinen beruhen. So sind zwar Iglu und Jagd<br />
sowie Hundeschlitten die meistgenannten unter jenen Begriffen, die s<strong>ich</strong> auf das Leben <strong>der</strong><br />
Inuit beziehen lassen. In breiterer Streuung werden daneben aber auch Aspekte wie Skidoo<br />
und Fertighäuser o<strong>der</strong> Anpassung und Selbstversorgung in früherer Zeit genannt. Eine Schü-<br />
lerin nennt Grönland und Kanada als konkrete Räume. Ein gegenüber St<strong>ich</strong>probe 1 vertiefte-<br />
res Wissen über die Polarzonen im Allgemeinen deutet s<strong>ich</strong> durch die Nennung von Begriffen<br />
wie Forschungsstationen, Ölpipeline, Nordpol und Südpol sowie Polartag und Polarnacht an.<br />
Hypothese 3:<br />
Unabhängig davon, ob die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit bereits Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>-<br />
tes waren o<strong>der</strong> n<strong>ich</strong>t, besteht auf Seiten <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler Interesse am Leben <strong>der</strong><br />
Menschen und an Eingriffen in den Naturhaushalt (vgl. REINFRIED 2006:52ff unter Bezugnahme<br />
auf HEMMER/HEMMER).<br />
HEMMER/HEMMER stellen zunächst heraus, das Interesse <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler an<br />
den Polarregionen sei allgemein als hoch einzustufen. Thematisch lässt s<strong>ich</strong> hierzu spezifizie-<br />
ren, <strong>dass</strong> Naturvölker, zu denen die Inuit gezählt werden könnten, und Eingriffe des Men-<br />
schen in den Naturhaushalt, die in Bezug auf die Inuit etwa hins<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Rohstoffexplora-<br />
tion o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> Lebensweisen erfolgen, zu den zehn beliebtesten Themen<br />
<strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler im Erdkundeunterr<strong>ich</strong>t zählen (vgl. REINFRIED 2006:53f). Vor<br />
diesem Hintergrund ist davon auszugehen, <strong>dass</strong> s<strong>ich</strong> diese Vorlieben auch in den Interessen<br />
<strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler bezügl<strong>ich</strong> des Lebens in <strong>der</strong> kalten Zone ausdrücken.<br />
Die Auswertung <strong>der</strong> Fragebögen (vgl. Abb. 41) bestätigt dies weitgehend. Deutl<strong>ich</strong>e Inte-<br />
ressenschwerpunkte <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler bei<strong>der</strong> St<strong>ich</strong>proben bilden einerseits das<br />
Leben und Überleben <strong>der</strong> Tiere und an<strong>der</strong>erseits das Leben <strong>der</strong> Inuit sowie ihre Überlebens-<br />
strategien. Der überwiegende Großteil <strong>der</strong> weiteren Nennungen bezieht s<strong>ich</strong> ebenfalls auf
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 100<br />
einzelne Aspekte des Lebens und Überlebens <strong>der</strong> Menschen. Die Schülerinnen und Schüler<br />
bei<strong>der</strong> St<strong>ich</strong>proben sind daran interessiert, wie <strong>der</strong> Alltag <strong>der</strong> Inuit und ihre Kultur aussehen,<br />
wie sie wohnen und was sie tun, wenn sie eingeschneit sind, wovon sie s<strong>ich</strong> ernähren, wie<br />
sie s<strong>ich</strong> kleiden und fortbewegen. Auffällig ist in dieser Hins<strong>ich</strong>t allerdings die große Diskre-<br />
panz bezügl<strong>ich</strong> des Interesses an <strong>der</strong> Ernährung <strong>der</strong> Inuit. Während in St<strong>ich</strong>probe 1 elf von 28<br />
Schülerinnen und Schülern danach fragen, was die Inuit essen und wo bzw. wie sie Lebens-<br />
mittel bekommen, ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln in St<strong>ich</strong>probe 2 nur für einen<br />
Schüler interessant. Sehr wahrscheinl<strong>ich</strong> haben die Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe<br />
2 hierauf bereits Antworten im Unterr<strong>ich</strong>t bekommen. Das Schulbuch etwa führt zu dieser<br />
Frage aus, <strong>dass</strong> die Inuit früher durch Jagd und Fischfang Selbstversorger waren, sie heutzu-<br />
tage jedoch ihre Lebensmittel im Supermarkt kaufen und nur noch zum Freizeitvergnügen<br />
jagen (vgl. Seydlitz 2007:104).<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
St<strong>ich</strong>probe 1 (n=45) St<strong>ich</strong>probe 2 (n=33)<br />
Abbildung 41: Interessen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler hins<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> des Lebens in <strong>der</strong> kalten Zone<br />
(eigene Darstellung)<br />
Des Weiteren kommen in den Interessen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auch implizit eini-<br />
ge ihrer eigenen Vorstellungen zum Ausdruck. So ist es auffällig, <strong>dass</strong> oftmals n<strong>ich</strong>t nur das<br />
Leben <strong>der</strong> Menschen, son<strong>der</strong>n <strong>der</strong>en Überleben auch in <strong>der</strong> Gegenwart für sie von Interesse<br />
ist. In dieser Hins<strong>ich</strong>t wird beispielsweise ergänzend ausgeführt, es sei interessant, wie die
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 101<br />
Menschen es schafften, n<strong>ich</strong>t „einzufrieren und, <strong>dass</strong> man in einem Iglu wohnen kann“ (Fra-<br />
gebogen 1/10) und „wie sie das Leben hinbekommen ohne viele Hilfsmittel wie Strom und<br />
Wasserleitung“ (Fragebogen 1/19). Diese Äußerungen stehen exemplarisch für verschiedene<br />
weitere und deuten an, <strong>dass</strong> insbeson<strong>der</strong>e den Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler<br />
<strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe 1 zufolge mo<strong>der</strong>ne technische Errungenschaften bei den Inuit noch n<strong>ich</strong>t an-<br />
gekommen sind. Sie werden hier, wie bereits zu Hypothese 2 ausgeführt, als abgelegen und<br />
von <strong>der</strong> Außenwelt abgeschnitten wahrgenommen.<br />
Eingriffe des Menschen in den Naturraum o<strong>der</strong> zumindest <strong>der</strong>en Auswirkungen werden<br />
dagegen von einigen Schülerinnen <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe 2 angesprochen. So ist eine Schülerin da-<br />
ran interessiert, zu erfahren, welche Folgen <strong>der</strong> Tourismus hat, und eine weitere möchte<br />
etwas über die Auswirkungen des Klimawandels erfahren. Eine dritte fragt letztl<strong>ich</strong>: „Warum<br />
schmilzt das Eis? Warum wird n<strong>ich</strong>ts getan?“ (Fragebogen 2/10).<br />
Hypothese 4:<br />
a) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit noch n<strong>ich</strong>t Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes waren,<br />
dann dominieren (ggf. stereotype) Aspekte <strong>der</strong> traditionellen Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit (z. B.<br />
Leben im Iglu, Nomadismus, Robbenjagd, Hundeschlitten, …) einseitig die Vorstellungen <strong>der</strong><br />
Schülerinnen und Schüler und sie assoziieren das Leben <strong>der</strong> Inuit n<strong>ich</strong>t o<strong>der</strong> nur sehr einge-<br />
schränkt mit technischen (Strom, fließend Wasser, Telefon, Internet, Fernsehen, Heizung, …)<br />
und infrastrukturellen (Supermärkte, ÖPNV, Krankenhäuser, …) Errungenschaften sowie Frei-<br />
zeitaktivitäten (Sportvereine, Konzerte, IT- und Mediennutzung, …).<br />
Abbildung 42 (Seite 101) vermittelt zunächst einen Überblick darüber, wie s<strong>ich</strong> die Schüle-<br />
rinnen und Schüler <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe 1 das Leben eines gle<strong>ich</strong>altrigen Jugendl<strong>ich</strong>en aus Grön-<br />
land vorstellen. Die Darstellung ist unterglie<strong>der</strong>t in die Schwerpunkte <strong>der</strong> Betrachtungen <strong>der</strong><br />
Schülerinnen und Schüler.<br />
Es zeigt s<strong>ich</strong> sehr deutl<strong>ich</strong>, <strong>dass</strong> die Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler überwie-<br />
gend einseitig von verbreiteten Stereotypen und <strong>der</strong> Prämisse, <strong>dass</strong> die Inuit sehr abgelegen<br />
und vormo<strong>der</strong>n als Selbstversorger leben, geprägt sind. Daneben sind die Vorstellungen <strong>der</strong><br />
meisten Schülerinnen und Schüler durch Schnee, Eis und extreme Kälte gekennze<strong>ich</strong>net. Bei-<br />
spielsweise schreibt ein Schüler: „Man schläft in Iglus und muss dicke Klamotten tragen. Wir<br />
müssen uns Fische angeln, damit wir überleben. Es ist sehr kalt. Man bekommt schnell eine
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 102<br />
Lungenentzündung, weil es so kalt ist. Die Winter sind meist kälter als -40°C und die Sommer<br />
werden 0°C“ (Fragebogen 1/11). Einige wenige Schülerinnen und Schüler stellen s<strong>ich</strong> das<br />
Leben <strong>der</strong> Inuit hingegen auch ähnl<strong>ich</strong> vor wie ihr eigenes. Ein Beispiel hierfür ist Fragebogen<br />
1/6. Diese Schülerin schreibt: „<strong>Ich</strong> glaube, die leben in normalen Häusern und Dörfern. <strong>Ich</strong><br />
denke auch, <strong>dass</strong> die zur Schule gehen wie wir auch. In <strong>der</strong> Freizeit gehen die vielle<strong>ich</strong>t fi-<br />
schen o<strong>der</strong> machen Sachen wie wir auch“.<br />
• Viele Freunde<br />
• Freunde wohnen sehr weit<br />
weg<br />
• Zusammen spielen<br />
• „Ne digge Party“<br />
Wohnen<br />
Freunde<br />
• R<strong>ich</strong>tige/normale Häuser<br />
und Dörfer/Städte<br />
• Kleine Hütten<br />
• Containerhäuser und Iglu auf<br />
<strong>der</strong> Jagd<br />
• Iglu<br />
• Alle schlafen in einem Raum<br />
und unter Pelz<br />
• Wasser muss zum Duschen<br />
aufgetaut werden<br />
Freizeit<br />
• Man kann n<strong>ich</strong>t viel machen<br />
• Spielen mit Freunden<br />
• Schneeballschlachten, Eisburgen bauen,<br />
Schlittenrennen, Eishockey<br />
• Fischen<br />
• Jagen, sammeln, Eisbären fangen<br />
• Holz hacken, um das Haus zu wärmen<br />
Schule<br />
• Hausaufgeben<br />
• Lange Schulwege, die bei starkem Schneefall<br />
n<strong>ich</strong>t bewältigt werden können<br />
• Schulweg mit dem Schlitten o<strong>der</strong> zu Fuß<br />
• Kältefrei<br />
• In <strong>der</strong> Schule sitzen alle in Jacken<br />
• Unterr<strong>ich</strong>t beim Dorfältesten<br />
• Es gibt keine Schule<br />
Das Leben eines<br />
Jugendl<strong>ich</strong>en in<br />
Grönland<br />
Familie<br />
• Viele Geschwister<br />
• Viel zu Hause mithelfen<br />
• Mit dem Vater auf Jagd o<strong>der</strong><br />
zum Fischen gehen<br />
• Mit <strong>der</strong> Mutter einkaufen<br />
gehen<br />
Sonstiges<br />
• Polarl<strong>ich</strong>ter<br />
• Sehr kalt<br />
• Pelze als Kleidung<br />
• Kein Internet<br />
• An<strong>der</strong>e Berufe und wenige elektrische<br />
Geräte<br />
• Es gibt einen Laden, in dem man sehr<br />
viel einkaufen kann<br />
• Ernährung durch Jagd und Fischfang<br />
Abbildung 42: Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe 1 zum Leben eines Jugendl<strong>ich</strong>en in<br />
Grönland<br />
(eigene Darstellung)<br />
Die größten Unterschiede zwischen den Vorstellungen <strong>der</strong> einzelnen Schülerinnen und<br />
Schüler bestehen hins<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Beschreibung <strong>der</strong> Wohnsituation. Einerseits findet s<strong>ich</strong> die<br />
Vorstellung vom Wohnen im Iglu. Von den insgesamt dreizehn Schülerinnen und Schülern,<br />
die bezügl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Wohnsituation Angaben gemacht haben, benennen vier das Iglu als übl<strong>ich</strong>e
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 103<br />
Unterkunft; ein weiterer Schüler führt aus: „Er wohnt in Containerhäusern und nur bei <strong>der</strong><br />
Jagd in Iglus“ (Fragebogen 1/9). Erläuterungen, die die Wohnformen <strong>der</strong> Inuit betreffen, wei-<br />
sen überwiegend in eine R<strong>ich</strong>tung. So führen zwei Schüler aus, die Inuit würden abends ins<br />
Bett gehen, wobei jedoch das Wort Bett in Anführungsze<strong>ich</strong>en gesetzt wird. Dies lässt darauf<br />
schließen, <strong>dass</strong> das hier gemeinte Bett n<strong>ich</strong>t dem übl<strong>ich</strong>en Verständnis dieses Schlafmöbels<br />
entspr<strong>ich</strong>t. Oftmals wird zudem implizit davon ausgegangen, es gebe keinen Strom, keine<br />
Heizung und kein fließend Wasser. Eine Schülerin schreibt hierzu etwa: „Es ist sehr kalt, des-<br />
halb schlafen wir alle zusammen und unter Pelz“ (Fragebogen 1/2). Ein an<strong>der</strong>es Mal wird<br />
ausgeführt, ein jugendl<strong>ich</strong>er Inuk verbringe seine Freizeit damit, „das Haus zu wärmen, in-<br />
dem er z.B. Holz hackt“ (Fragebogen 1/14) und morgens müsse man nach dem Aufstehen<br />
„Wasser auftauen, um zu duschen o<strong>der</strong> etwas zu trinken“ (Fragebogen 1/10). Seinen Alltag<br />
bestreite man dabei „ohne viele elektrische Geräte“ (Fragebogen 1/17). Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Seite werden aber auch vereinzelt Vorstellungen geäußert, nach denen die Inuit in „r<strong>ich</strong>ti-<br />
gen“, „normalen“ Häusern und „fast wie in Deutschland“ (Fragebogen 1/21) o<strong>der</strong> in kleinen<br />
Hütten lebten.<br />
Die Familien stellen s<strong>ich</strong> die Schülerinnen und Schüler zumeist als Großfamilien vor, in<br />
denen die Kin<strong>der</strong> mit vielen Geschwistern aufwachsen. Die Eltern werden dabei häufig im<br />
Sinne einer traditionellen Rollenverteilung dargestellt. Während die Mutter das Wasser auf-<br />
wärmt, kocht und in einer Schil<strong>der</strong>ung einkauft, geht <strong>der</strong> Vater jagen und fischen. Die Kin<strong>der</strong><br />
müssten zu Hause viel helfen, wobei die Jungen wie <strong>der</strong> Vater auf Jagd gehen und fischen.<br />
Die Freizeitaktivitäten jugendl<strong>ich</strong>er Inuit drehen s<strong>ich</strong> in den Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerin-<br />
nen und Schüler einerseits um alle in Zusammenhang mit Schnee und Eis denkbaren Tätig-<br />
keiten. Ein Schüler führt beispielsweise aus, „seine Hobbies sind Schneeballschlachten,<br />
Schneeengel machen, Eisburgen bauen, Eishockey, Schlittenrennen, fischen, Schneemänner<br />
bauen und den Weihnachtsmann suchen“ (Fragebogen 1/3). Ähnl<strong>ich</strong>e Beschreibungen fin-<br />
den s<strong>ich</strong> in mehreren an<strong>der</strong>en Fragebögen. An<strong>der</strong>erseits spielen aber auch Versorgungsas-<br />
pekte in einige Beschreibungen hinein. So werden mitunter das Jagen, Fischen, Sammeln<br />
und Eisbärenfangen als Freizeitaktivitäten angegeben. Zwei Schüler schätzen das Leben da-<br />
gegen eher als langweilig ein und führen aus: „In <strong>der</strong> Freizeit kann man n<strong>ich</strong>t viel machen“<br />
(Fragebogen 1/8). Ledigl<strong>ich</strong> ein Schüler denkt, <strong>dass</strong> die jugendl<strong>ich</strong>en Inuit „ihre Freizeit gle<strong>ich</strong><br />
[…] verbringen“ (Fragebogen 1/21) wie er selbst. Letztl<strong>ich</strong> wird das Spielen mit Freunden
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 104<br />
mehrfach als typische Freizeitbeschäftigung genannt, wobei allerdings auch angegeben wird,<br />
„<strong>dass</strong> seine Freunde sehr weit weg wohnen“ (Fragebogen 1/14).<br />
Der Aspekt <strong>der</strong> großen Entfernungen kommt zusammen mit Kälte und Schnee auch bei<br />
den Vorstellungen zum Schulalltag zum tragen. Beschreibungen wie die in Fragebogen 1/13<br />
– „Er hat einen sehr langen Schulweg und wenn es schneit, kann er gar n<strong>ich</strong>t zur Schule ge-<br />
hen“ – werden mehrfach geäußert. Ebenso verbreitet ist die Vorstellung, die Kin<strong>der</strong> würden<br />
mit dem Schlitten zur Schule fahren. Daneben werden die Vermutungen geäußert, <strong>dass</strong> man<br />
„kältefrei bekommen […] kann“ (Fragebogen 1/8) und, <strong>dass</strong> in <strong>der</strong> Schule „alle in Jacken […]<br />
sitzen“ (Fragebogen 1/7). An<strong>der</strong>e Vorstellungen distanzieren s<strong>ich</strong> von einer institutionalisier-<br />
ten Schule in einem eigenen Gebäude, wie es die befragten Schülerinnen und Schüler selbst<br />
kennen. So schreibt ein Schüler, ein jugendl<strong>ich</strong>er Inuk würde ihm mitteilen, er „gehe n<strong>ich</strong>t<br />
zur Schule, weil es keine gibt“ (Frage-<br />
bogen 1/18), während eine Schülerin<br />
demgegenüber davon ausgeht, <strong>dass</strong> die<br />
Kin<strong>der</strong> eines Dorfes „zum Dorfältesten<br />
[gehen], um etwas zu lernen“ (Frage-<br />
bogen 1/2).<br />
All diese Vorstellungen spiegeln s<strong>ich</strong><br />
auch in den Nennungen <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong> in<br />
Aufgabe 5 des Fragebogens wi<strong>der</strong> (vgl.<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Abbildung 43: Häufigkeit <strong>der</strong> Nennungen <strong>der</strong> einzelnen<br />
Bil<strong>der</strong> in Frage 5 des Fragebogens (St<strong>ich</strong>probe 1)<br />
(eigene Darstellung)<br />
Abb. 43). In dieser Aufgabe waren die Schülerinnen und Schüler aufgefor<strong>der</strong>t, unter den ab-<br />
gebildeten Fotos jene anzukreuzen, die ihren Vorstellungen über das Leben in Grönland ent-<br />
sprechen. Drei <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong> (b, d und h) stellen Aspekte <strong>der</strong> traditionellen Lebensweisen <strong>der</strong><br />
Inuit dar, die zugle<strong>ich</strong> in gängigen Stereotypen präsent sind. Sie wurden jeweils von 19 bzw.<br />
20 <strong>der</strong> insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler und somit beson<strong>der</strong>s häufig angekreuzt.<br />
Quantitativ übertroffen wurden diese Bil<strong>der</strong> nur von Bild a, das sogar 24 Kreuze erhielt. Es<br />
entspr<strong>ich</strong>t offenbar den in Aufgabe 4 wie<strong>der</strong>holt geäußerten Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen<br />
und Schüler von einem Leben <strong>der</strong> Inuit in Dörfern. Zu sehen sind darauf einige eng beieinan-<br />
<strong>der</strong> stehende Holzhäuser am Fuße eines Berges. Jene Bil<strong>der</strong> hingegen, die Szenen des mo-<br />
<strong>der</strong>nen Lebens <strong>der</strong> Inuit zeigen (c, f und g) wurden nur von wenigen Schülerinnen und Schü-<br />
lern angekreuzt; f sogar überhaupt n<strong>ich</strong>t. Dies bestätigt insgesamt die in <strong>der</strong> Hypothese for-
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 105<br />
mulierte Tendenz, <strong>dass</strong> die Schülerinnen und Schüler eher über stereotype Vorstellungen<br />
zum Leben <strong>der</strong> Inuit verfügen. Einen Ausreißer stellt im Kontext <strong>der</strong> übrigen Nennungen <strong>der</strong><br />
hohe Wert für Bild e dar. Es ist allerdings wahrscheinl<strong>ich</strong>, <strong>dass</strong> es s<strong>ich</strong> hierbei um einen Halo-<br />
Effekt handelt. Denn in <strong>der</strong> vorangehenden Frage sollten die Schülerinnen und Schüler bei<br />
ihren Ausführungen von einem Skype-Kontakt mit einem gle<strong>ich</strong>altrigen Grönlän<strong>der</strong> ausge-<br />
hen. Diese Vorgabe setzt natürl<strong>ich</strong> voraus, <strong>dass</strong> es in Grönland Computer und Internetan-<br />
schlüsse gibt, was das Ankreuzverhalten in Frage 5 wohl beeinflusst hat.<br />
b) Wenn die Lebensweisen <strong>der</strong> Inuit bereits Gegenstand des Schulunterr<strong>ich</strong>tes waren, dann<br />
verfügen die Schülerinnen und Schüler über ein überblicksartiges Wissen zum Leben <strong>der</strong> Inuit,<br />
wobei sie traditionelle und mo<strong>der</strong>ne Lebensweisen differenzieren, und mit dem heutigen Le-<br />
ben <strong>der</strong> Inuit vor allem Aspekte <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Lebensweisen wie etwa feste Häuser, Schulen,<br />
Supermärkte, Freizeitaktivitäten, Motorschlitten o<strong>der</strong> auch Arbeitslosigkeit und Kriminalität<br />
assoziieren.<br />
• Oft Besuch von Freunden zu<br />
Hause<br />
• Wenige Freunde, wegen<br />
kleiner Siedlungen<br />
Wohnen<br />
Freunde<br />
• Normale Häuser<br />
• Mo<strong>der</strong>ne Wohnblocks<br />
• Fertighäuser<br />
• Schlechte Wohnhäuser, oft<br />
Container<br />
• Häuser aus Blech und Holz<br />
• Sehr kleine und volle Hütte,<br />
wenig Platz<br />
• An die Kälte angepasste Häuser<br />
Freizeit<br />
• Kino<br />
• „Genau das, was wir auch tun“<br />
• Jagen, Fischen<br />
• Kajak fahren<br />
• Ski/Snowboard, Rodeln<br />
Schule<br />
• Kleine Dorfschule<br />
• Die Schule ist in schlechtem Zustand<br />
• Es gibt nur eine Schule und die ist sehr weit weg<br />
• Lange Schulwege, die oft wegen Schnee n<strong>ich</strong>t zu<br />
bewältigen sind<br />
• Schulweg mit dem Skidoo o<strong>der</strong> zu Fuß<br />
• Kältefrei<br />
Das Leben eines<br />
Jugendl<strong>ich</strong>en in<br />
Grönland<br />
• Viele Geschwister / große Familien<br />
• Viel zu Hause mithelfen<br />
• Mit dem Vater auf Jagd gehen<br />
• Die Eltern arbeiten vormittags<br />
Sonstiges<br />
• Eigentl<strong>ich</strong> Selbstversorger, aber die w<strong>ich</strong>tigsten<br />
Dinge werden gekauft<br />
• Lebensmittelvorräte und -importe<br />
• Großer Zusammenhalt<br />
• Keine Autos<br />
• Warme Kleidung<br />
• Schlecht bezahlte Arbeit<br />
• Berufe: Jäger und Fischer<br />
Familie<br />
Abbildung 44: Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe 2 zum Leben eines Jugendl<strong>ich</strong>en in<br />
Grönland (eigene Darstellung)
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 106<br />
Abbildung 44 (Seite 104) zeigt zunächst überblicksartig die Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerin-<br />
nen und Schüler zum Leben gle<strong>ich</strong>altriger Jugendl<strong>ich</strong>er in Grönland.<br />
Grundsätzl<strong>ich</strong> ist in Hinblick auf die Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler in St<strong>ich</strong>-<br />
probe 2 zu sagen, <strong>dass</strong> einige Inhalte des in dieser Klasse eingeführten Schulbuches deutl<strong>ich</strong><br />
zum Ausdruck kommen. Dies ist insbeson<strong>der</strong>e in Bezug auf die Wohnverhältnisse und die<br />
Lebensmittelversorgung <strong>der</strong> Fall. Ebenso werden Unterschiede zu den Vorstellungen von<br />
St<strong>ich</strong>probe 1 in diesem Zusammenhang beson<strong>der</strong>s deutl<strong>ich</strong>. Gle<strong>ich</strong>zeitig weisen aber auch<br />
die Vorstellungen dieser St<strong>ich</strong>probe mithin stereotype Züge auf.<br />
In Bezug auf die Wohnverhältnisse <strong>der</strong> Inuit macht s<strong>ich</strong> die Behandlung des Themas im<br />
Unterr<strong>ich</strong>t schon anhand dessen bemerkbar, <strong>dass</strong> keiner <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler das<br />
Iglu ernsthaft als Wohnung <strong>der</strong> Inuit benennt. An dieser Stelle offenbart s<strong>ich</strong> allerdings eine<br />
Diskrepanz zwischen dem Wissen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler einerseits und ihren grund-<br />
sätzl<strong>ich</strong>en Assoziationen an<strong>der</strong>erseits. Denn unter Frage 2 hatten noch sechs <strong>der</strong> 24 Schüle-<br />
rinnen und Schüler das Iglu jeweils als eines von drei Dingen genannt, die ihnen spontan zum<br />
Leben in <strong>der</strong> kalten Zone einfielen. Eine Schülerin legt hierzu ihren Gedankengang explizit<br />
offen: „Viele sagen, <strong>dass</strong> Inuit in Iglus wohnen. <strong>Ich</strong> glaube das aber n<strong>ich</strong>t. Sie wohnen, glaube<br />
<strong>ich</strong>, eher in Häusern. Okay, doch. Aber auch n<strong>ich</strong>t. Für m<strong>ich</strong> müssen echte Inuit in Iglus woh-<br />
nen und so. Obwohl <strong>ich</strong> <strong>weiß</strong>, <strong>dass</strong> es n<strong>ich</strong>t so stimmt“ (Fragebogen 2/3). Die Vorstellungen<br />
sind dieser Schil<strong>der</strong>ung zufolge somit in Teilen auch Wunschvorstellungen, die parallel neben<br />
dem schulischen Wissen beibehalten werden. Demgegenüber sind die Aussagen, die Inuit<br />
wohnten in „Fertighäusern“ (Fragebogen 2/14) bzw. in „Häusern aus Blech und Holz“ (Fra-<br />
gebogen 2/6) sowie die Beschreibung „Es sind dort schlechte Wohnhäuser, denn es sind<br />
auch oft nur Container“ (Fragebogen 2/11) inhaltl<strong>ich</strong> auf das Schulbuch zurückzuführen. Dort<br />
sind die containerartigen Fertighäuser aus Holz und Wellblech im Text beschrieben und auf<br />
einem Bild abgebildet. Die übrigen Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler zeigen inhalt-<br />
l<strong>ich</strong> eine relativ breite Streuung in zwei R<strong>ich</strong>tungen. Es gibt sowohl die Vorstellung von mo-<br />
<strong>der</strong>nen Wohnverhältnissen als die eines sehr beengten Wohnens in kleinen Hütten. So führt<br />
eine Schülerin einerseits aus, die Inuit wohnten „in einem ganz normalen Haus“ (Fragebogen<br />
2/1) und eine weitere schreibt, sie wohnten „in mo<strong>der</strong>nen Wohnblocks“ (Fragebogen 2/7).<br />
Zwei an<strong>der</strong>e Schüler erklären hingegen, „<strong>dass</strong> er auf engstem Raum mit <strong>der</strong> Familie wohnt“<br />
(Fragebogen 2/9) und „viel draußen [spielt], weil die Hütte sehr klein und voll ist“ (Fragebo-
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 107<br />
gen 2/5). Zwei weitere Schüler stellen zudem die Notwendigkeit einer an die Kälte angepass-<br />
ten Bauform heraus.<br />
Bezügl<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Darstellung des Familienlebens unterscheiden s<strong>ich</strong> die Vorstellungen <strong>der</strong><br />
Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> St<strong>ich</strong>probe 2 nur wenig von denen <strong>der</strong> ersten St<strong>ich</strong>probe. Auch<br />
hier ist die Vorstellung von <strong>der</strong> Großfamilie dominant und <strong>der</strong> Vater wird mitunter als Jäger<br />
beschrieben. Allerdings wird auch in zwei von acht Beschreibungen ausgeführt, <strong>dass</strong> die El-<br />
tern mindestens halbtags arbeiten, „so wie bei uns auch“ (Fragebogen 2/11). In dieser Hin-<br />
s<strong>ich</strong>t ist also eine Verän<strong>der</strong>ung gegenüber St<strong>ich</strong>probe 1 zu bemerken. Die Vorstellungen über<br />
die Berufe zeigen dabei in die traditionelle R<strong>ich</strong>tung. Eine Schülerin schreibt etwa, typische<br />
Arbeiten seien „oft auch in <strong>der</strong> Natur als Fischer o<strong>der</strong> als Jäger. Ihre Jobs werden auch n<strong>ich</strong>t<br />
so gut bezahlt“ (Fragebogen 2/11).<br />
Unterdessen bekommen die Jugendl<strong>ich</strong>en zu Hause Besuch von ihren Freunden, die sie<br />
von <strong>der</strong> Schule her kennen. Weil die Siedlungen klein seien, hätten sie nur wenige, dafür<br />
aber gute Freunde. Die Vorstellungen über die Freizeitaktivitäten sind dabei im Vergle<strong>ich</strong> zu<br />
St<strong>ich</strong>probe 1 stärker von mo<strong>der</strong>nen Mögl<strong>ich</strong>keiten geprägt. Zwei Schülerinnen führen bei-<br />
spielsweise aus, in <strong>der</strong> Freizeit gingen junge Grönlän<strong>der</strong> manchmal mit ihren Freunden ins<br />
Kino o<strong>der</strong> machten „genau das, was wir auch tun“ (Fragebogen 2/10). Ansonsten prägen<br />
jedoch ebenso wie in St<strong>ich</strong>probe 1 insbeson<strong>der</strong>e zwei Arten von Freizeitgestaltung die Vor-<br />
stellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler: Zum einen werden auch hier auf den Schnee bezo-<br />
gene Aktivitäten wie Ski fahren, snowboarden o<strong>der</strong> rodeln mehrfach genannt. Zum an<strong>der</strong>en<br />
steht das Jagen im Vor<strong>der</strong>grund. Allerdings sind hier zwei Linien erkennbar. Das Jagen wird<br />
von einigen Schülern als notwendiger Beitrag zur Lebensmittelversorgung betrachtet (vgl.<br />
Fragebogen 2/5, 2/9, 2/12 und 2/16), von an<strong>der</strong>en wie im Schulbuch (vgl. Seydlitz 2007:104)<br />
beschrieben als Freizeitvergnügen (vgl. Fragebogen 2/8 und 2/17).<br />
Die Vorstellungen über die Schulen sind in dieser St<strong>ich</strong>probe eher homogen. Sechzehn <strong>der</strong><br />
24 Schülerinnen und Schüler geben ausdrückl<strong>ich</strong> an, <strong>dass</strong> die Jugendl<strong>ich</strong>en in Grönland in die<br />
Schule gehen. In ihren Vorstellungen handelt es s<strong>ich</strong> dabei zumeist um eine kleine Schule<br />
mitten im Dorf. Dort werde „z.B. Englisch“ (Fragebogen 2/5) gelernt. Dabei unterscheiden<br />
s<strong>ich</strong> die Schulen in den Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler jedoch in Bezug auf die<br />
Anzahl und die Ausstattung von den hiesigen. So führt eine Schülerin aus: „Es würde wahr-
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 108<br />
scheinl<strong>ich</strong> nur eine Schule dort […] geben und n<strong>ich</strong>t wie hier mehrere“ (Fragebogen 2/15)<br />
und ein an<strong>der</strong>er Schüler ergänzt: „Die Schule ist in schlechtem Zustand“ (Fragebogen 2/12).<br />
Wie schon in St<strong>ich</strong>probe 1 spielt daneben auch <strong>der</strong> Schulweg in Zusammenhang mit den Fak-<br />
toren Schnee und Eis eine Rolle in den Vorstellungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler, aller-<br />
dings auf unterschiedl<strong>ich</strong>e Weise. Einmal heißt es „<strong>Ich</strong> fahre mit dem Skidoo dorthin“ (Fra-<br />
gebogen 2/4), ein an<strong>der</strong>es Mal hingegen „<strong>dass</strong> er oft wegen Schnee n<strong>ich</strong>t zur Schule kommt“<br />
(Fragebogen 2/9). Autos gibt es einem Schüler zufolge n<strong>ich</strong>t (vgl. Fragebogen 2/8).<br />
Einiger Unterschiede bei <strong>der</strong> Beschreibung des Lebens eines Jugendl<strong>ich</strong>en in Grönland<br />
zum Trotz fallen die Ergebnisse von Frage 5 in beiden St<strong>ich</strong>proben relativ ähnl<strong>ich</strong> aus. Ein<br />
signifikanter Unterschied besteht ledigl<strong>ich</strong> in Bezug auf Bild g, den Supermarkt. Dies ist ver-<br />
mutl<strong>ich</strong>, ebenso wie zuvor schon die Interessensdiskrepanz zwischen den St<strong>ich</strong>proben in<br />
Hinblick auf die Ernährung <strong>der</strong> Inuit, durch entsprechende Unterr<strong>ich</strong>tsinhalte begründet. Im<br />
Schulbuch etwa wird ausgeführt die Lebensmittel würden heutzutage im Supermarkt ge-<br />
kauft. Ansonsten ist wie<strong>der</strong>um Bild a<br />
das am häufigsten angekreuzte, was<br />
mit den Äußerungen <strong>der</strong> Schülerin-<br />
nen und Schüler über das Leben <strong>der</strong><br />
Inuit in Dörfern o<strong>der</strong> kleinen Sied-<br />
lungen konform geht. Dass auch in<br />
St<strong>ich</strong>probe 2 wie<strong>der</strong> die Bil<strong>der</strong> b, d<br />
und h häufig genannt werden, f hin-<br />
gegen gar n<strong>ich</strong>t, mag schließl<strong>ich</strong> mit<br />
dem eingangs bereits angesproche-<br />
nen Phänomen <strong>der</strong> Persistenz ste-<br />
reotypenhafter Vorstellungen wi<strong>der</strong><br />
besseres Wissen zusammenhängen.<br />
Denn das Ankreuzverhalten deckt s<strong>ich</strong> in dieser Hins<strong>ich</strong>t nur begrenzt mit den Ausführungen<br />
<strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler über ihre Vorstellungen in Frage 4.<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Abbildung 45: Häufigkeit <strong>der</strong> Nennungen <strong>der</strong> einzelnen Bil<strong>der</strong><br />
in Frage 5 des Fragebogens (St<strong>ich</strong>probe 2)<br />
(eigene Darstellung)
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 109<br />
5.4 Fazit <strong>der</strong> Schülerbefragung<br />
In den vorangegangenen Ausführungen hat s<strong>ich</strong> gezeigt, <strong>dass</strong> die Schülerinnen und Schü-<br />
ler ohne eine unterr<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>e Thematisierung <strong>der</strong> Inuit in ihren Vorstellungen vorwiegend auf<br />
verbreitete Stereotype zurückgreifen. Insbeson<strong>der</strong>e die Faktoren Kälte, Eis und das Meistern<br />
lebensfeindl<strong>ich</strong>er Bedingungen sowie typische Tierarten <strong>der</strong> polaren Zone prägen dabei die<br />
Vorstellungen vom Leben <strong>der</strong> Inuit. Mo<strong>der</strong>nität o<strong>der</strong> das Vorhandensein technischer Geräte<br />
werden in <strong>der</strong> Regel n<strong>ich</strong>t assoziiert. Die Inuit werden im Vergle<strong>ich</strong> zum eigenen Leben als<br />
ganz an<strong>der</strong>s wahrgenommen und diese An<strong>der</strong>sartigkeit weckt Interesse und Neugier. Eine<br />
Schülerin schreibt hierzu beispielsweise: „<strong>Ich</strong> denke, <strong>dass</strong> es dort an<strong>der</strong>s ist, und deshalb will<br />
<strong>ich</strong> das wissen“ (Fragebogen 1/16). Fast alle diesbezügl<strong>ich</strong>en Äußerungen <strong>der</strong> Schülerinnen<br />
und Schüler gehen in diese R<strong>ich</strong>tung.<br />
Nachdem eine Thematisierung <strong>der</strong> Inuit im Unterr<strong>ich</strong>t stattgefunden hat, sind vor allem<br />
drei Dinge zu beobachten:<br />
(1) Spontane Assoziationen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler bedienen s<strong>ich</strong> weiterhin<br />
überwiegend <strong>der</strong> ursprüngl<strong>ich</strong>en Vorstellungen unter Verwendung gängiger Stereo-<br />
type. Nur vereinzelt werden Aspekte <strong>der</strong> unterr<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>en Inhalte eingebracht.<br />
(2) Im Rahmen einer konkreten Fragestellung greift die Mehrzahl <strong>der</strong> Schülerinnen und<br />
Schüler das im Unterr<strong>ich</strong>t erworbene Wissen auf und baut es in die Darstellung ein.<br />
Allerdings bleiben die ursprüngl<strong>ich</strong>en Vorstellungen meist in (in unterschiedl<strong>ich</strong>er<br />
Ausprägung) erhalten und werden mit dem neuen Wissen zusammengefügt. Auffäl-<br />
lig ist, <strong>dass</strong> die Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> zweiten St<strong>ich</strong>probe im Gegensatz zu<br />
denen <strong>der</strong> ersten St<strong>ich</strong>probe vermehrt abwertende Haltungen zum Ausdruck brin-<br />
gen mit Vorstellungen wie „Es sind dort schlechte Wohnhäuser“ (Fragebogen 2/11)<br />
o<strong>der</strong> „Die Schule ist in schlechtem Zustand“ (Fragebogen 2/12).<br />
(3) Zumindest eine Schülerin erklärt, <strong>dass</strong> sie eigentl<strong>ich</strong> gar n<strong>ich</strong>t gewillt ist, ihre Vor-<br />
stellungen dem unterr<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>en Wissen anzupassen, weil dies n<strong>ich</strong>t ihrem Ideal von<br />
den Inuit entspr<strong>ich</strong>t. Eine solche Haltung wäre, wenn s<strong>ich</strong> bei einer umfangre<strong>ich</strong>e-<br />
ren Untersuchung zeigen würde, <strong>dass</strong> sie häufiger auftritt, zweifelsfrei eine Heraus-<br />
for<strong>der</strong>ung für den Unterr<strong>ich</strong>t.<br />
Insgesamt lässt s<strong>ich</strong> auf <strong>der</strong> Grundlage dieser kleinen St<strong>ich</strong>probe sagen, <strong>dass</strong> die Perspek-
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit 110<br />
tive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler auf das Leben <strong>der</strong> Inuit durch eine Thematisierung im Un-<br />
terr<strong>ich</strong>t durchaus geprägt und beeinflusst wird, ursprüngl<strong>ich</strong>e Vorstellungen jedoch ebenfalls<br />
eine hohe Persistenz aufweisen. Es erfolgt eine Kombination bei<strong>der</strong> Aspekte, die zu individu-<br />
ellen Konstruktionen führt. Subjektive Konstruktionsprinzipien wie Projektionen, Stereotype,<br />
Vorurteile und Ethnozentrismus sind dabei in beiden Fällen zu finden. Allerdings vermuten<br />
die Schülerinnen und Schüler größtenteils, <strong>dass</strong> ihre Vorstellungen n<strong>ich</strong>t <strong>der</strong> Realität ent-<br />
sprechen. So geben die meisten von ihnen auf die Frage, wie s<strong>ich</strong>er sie sind, <strong>dass</strong> ihre Vor-<br />
stellungen zutreffen, an, <strong>dass</strong> sie n<strong>ich</strong>t s<strong>ich</strong>er seien, da sie bisher noch n<strong>ich</strong>t viel über die<br />
kalte Zone erfahren hätten.
Gegenüberstellende Zusammenfassung <strong>der</strong> Perspektiven und Fazit 111<br />
6 Gegenüberstellende Zusammenfassung <strong>der</strong> Perspektiven und Fazit<br />
Fachwissenschaft, Schulbücher sowie Schülerinnen und Schüler repräsentieren drei un-<br />
terschiedl<strong>ich</strong>e Perspektiven auf das Leben <strong>der</strong> Inuit. Die Unterschiede liegen unter an<strong>der</strong>em<br />
in den Bere<strong>ich</strong>en des Vorwissens, in <strong>der</strong> Fokussierung des Blicks, in <strong>der</strong> Tiefe <strong>der</strong> Betrachtung<br />
und im Objektivitätsgrad.<br />
Die Fachwissenschaft strebt danach, die Ordnung <strong>der</strong> Dinge darzulegen. Dazu nimmt sie<br />
einen mögl<strong>ich</strong>st objektiven Blickwinkel ein und erforscht tiefgehend und unter Bezugnahme<br />
auf bestimmte Theorien reale Phänomene. Das Gesamtbild des Forschungsstandes setzt s<strong>ich</strong><br />
dabei aus zahlre<strong>ich</strong>en eng fokussierten Einzelarbeiten zusammen.<br />
Das wesentl<strong>ich</strong>e Merkmal <strong>der</strong> Schulbücher gegenüber <strong>der</strong> Fachwissenschaft ist die didak-<br />
tische Reduktion und Transformation <strong>der</strong> Inhalte. Ein bestimmtes Thema wird unter Berück-<br />
s<strong>ich</strong>tigung didaktischer Abwägungen zunächst stark eingegrenzt und dann schülergerecht<br />
aufbereitet. Dies erfolgt in <strong>der</strong> Regel in Anlehnung an die curricularen Vorgaben. Das Thema<br />
das Leben <strong>der</strong> Inuit wird in diesem Rahmen zumeist im Kontext <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en menschli-<br />
chen Anpassung an den Naturraum behandelt. Als Informations- und Bildungsmedium hat<br />
das Schulbuch einerseits den Anspruch die Ordnung <strong>der</strong> Dinge zu repräsentieren. Aufgrund<br />
<strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ung, komplexe Zusammenhänge und eine große Informationsfülle auf engem<br />
Raum unterzubringen einerseits und impliziter subjektiver Theorien <strong>der</strong> Autoren an<strong>der</strong>er-<br />
seits spiegelt es in <strong>der</strong> Realität jedoch eher eine Ordnung <strong>der</strong> Blicke wi<strong>der</strong>. Dies wird bereits<br />
bei einem Vergle<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Unsere Erde- und <strong>der</strong> Seydlitz-Doppelseiten zum Thema Inuit in Hin-<br />
blick auf die impliziten Haltungen zum Gegenstand deutl<strong>ich</strong>.<br />
Die Perspektive <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler ist letztl<strong>ich</strong> eindeutig <strong>der</strong> Ordnung <strong>der</strong> Bli-<br />
cke zuzuordnen. Die in Kapitel 2.2 erläuterten subjektiven Konstruktionsprinzipien – Projek-<br />
tion, Stereotype, Vorurteile und Ethnozentrismus – treten hier deutl<strong>ich</strong> hervor. Jedoch un-<br />
terscheiden s<strong>ich</strong> die Vorstellungen sehr stark in Abhängigkeit von Wissen und Interesse. Je<br />
größer das Interesse an einem Thema ist, desto stärker ist auch die persönl<strong>ich</strong>e Motivation,<br />
s<strong>ich</strong> ernsthaft damit zu befassen. Auch die Nachhaltigkeit <strong>der</strong> Lernerfolge korreliert positiv<br />
hiermit (vgl. REINFRIED 2006:52). Das Interesse <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die<br />
kalte Zone zeigt deutl<strong>ich</strong>e Schwerpunkte in den Bere<strong>ich</strong>en das Leben <strong>der</strong> Tiere, das Leben<br />
(und Überleben) <strong>der</strong> Menschen und das Eis. Diese Aspekte dominieren auch ihre Vorstellun-
Gegenüberstellende Zusammenfassung <strong>der</strong> Perspektiven und Fazit 112<br />
gen. Diese unterscheiden s<strong>ich</strong> allerdings in Abhängigkeit von einer vorherigen unterr<strong>ich</strong>tli-<br />
chen Behandlung des Themas. Schülerinnen und Schüler, die bereits im Unterr<strong>ich</strong>t mit dem<br />
Leben <strong>der</strong> Inuit konfrontiert wurden, integrieren unterr<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>e Aspekte in ihre subjektiven<br />
Vorstellungen, wobei ursprüngl<strong>ich</strong>e Konstruktionen oftmals n<strong>ich</strong>t gänzl<strong>ich</strong> aufgegeben wer-<br />
den. Ohne eine unterr<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>e Thematisierung kommen hingegen verstärkt allgemeine Ste-<br />
reotype in den Vorstellungen zum Ausdruck.<br />
Im schulischen Kontext stehen diese drei einzelnen Perspektiven in linearer Abfolge hin-<br />
tereinan<strong>der</strong>. Die Fachwissenschaft liefert die Inhalte, die die Schulbücher didaktisch aufbe-<br />
reiten. Die Schulbücher fungieren wie<strong>der</strong>um als w<strong>ich</strong>tiges Bezugsmedium für die Schülerin-<br />
nen und Schüler bei <strong>der</strong> Erschließung des Themas. An den Schnittstellen <strong>der</strong> einzelnen Per-<br />
spektiven finden jedoch unter dem Einfluss affektiver Determinanten und intermittieren<strong>der</strong><br />
Faktoren wie <strong>der</strong> Lehrkraft (mit Einschränkungen ähnl<strong>ich</strong> dem Stille-Post-Effekt) inhaltl<strong>ich</strong>e<br />
Verschiebungen statt, so<strong>dass</strong> die Vorstellung eines Schülers nach dem Unterr<strong>ich</strong>t mitunter<br />
n<strong>ich</strong>t mit den fachwissenschaftl<strong>ich</strong>en Erkenntnissen konform geht.<br />
Die Darstellungsweise des Themas das Leben <strong>der</strong> Inuit im Schulbuch als vermittelndem<br />
Medium zwischen Fachwissenschaft und Schülerschaft begünstigt in den meisten Fällen die-<br />
se inhaltl<strong>ich</strong>en Verschiebungen. Der Umfang des Themas spielt hierbei eine wesentl<strong>ich</strong>e Rol-<br />
le. Drei von vier untersuchten Schulbüchern versuchen, auf einer Doppelseite die traditionel-<br />
le und die mo<strong>der</strong>ne Lebensform <strong>der</strong> Inuit einschließl<strong>ich</strong> des Wandels und <strong>der</strong> Probleme ab-<br />
zubilden. Dass eine solche Informationsfülle auf so engem Raum zwangsläufig nur sehr stark<br />
vereinfachend und verallgemeinernd wie<strong>der</strong>gegeben werden kann, liegt auf <strong>der</strong> Hand. Dabei<br />
ist allerdings auffällig, „<strong>dass</strong> die dargestellten ‚Kulturen‘ in <strong>der</strong> Regel völlig leere Begriffe<br />
bleiben“ (STÖBER 2001:25). Die Inuit werden als (ehemals) beson<strong>der</strong>s angepasste Überlebens-<br />
künstler in <strong>der</strong> Kälte dargestellt, jedoch weitgehend ohne Bezug zu damit in Zusammenhang<br />
stehenden kulturellen Prinzipien und Werten. STÖBER (2001:22) führt hierzu aus, <strong>dass</strong><br />
„menschl<strong>ich</strong>e Gruppen und Gesellschaften, die gelegentl<strong>ich</strong> als ‚Kulturen‘ beze<strong>ich</strong>net und als<br />
Einheiten mit bestimmten Charakteristika vorgestellt werden, in den Schulbüchern erschei-<br />
nen, ohne <strong>dass</strong> ‚Kultur‘ hierbei eine größere Rolle zufallen muss“. Dabei ist anzumerken, <strong>dass</strong><br />
gerade diese ausgeblendeten Aspekte eine hohe Eignung aufweisen für eine werteorientier-<br />
te Unterr<strong>ich</strong>tsgestaltung im Sinne <strong>der</strong> Herausbildung interkultureller Kompetenz. Im Fall <strong>der</strong>
Gegenüberstellende Zusammenfassung <strong>der</strong> Perspektiven und Fazit 113<br />
Inuit beispielsweise böten s<strong>ich</strong> mindestens zwei werteorientierte Zugänge für den Erdkun-<br />
deunterr<strong>ich</strong>t an.<br />
Zum einen könnten die Prinzipien von Inuit Qaujimajatuqangit im Unterr<strong>ich</strong>t thematisiert<br />
werden. Davon ausgehend ließe s<strong>ich</strong> gemäß den curricularen Vorgaben gut an traditionelle<br />
Anpassungsformen <strong>der</strong> Inuit an die naturräuml<strong>ich</strong>en Gegebenheiten anknüpfen. Zugle<strong>ich</strong><br />
ermögl<strong>ich</strong>t IQ auch einen Zugang zu <strong>der</strong> gegenwärtigen Lebenssituation <strong>der</strong> Inuit. Hier könn-<br />
ten beispielsweise das Streben <strong>der</strong> Inuit nach Rückgewinnung ihrer Selbstbestimmung und<br />
nach Bewahrung und Weitergabe ihrer Kultur thematisiert werden. Ebenso können aktuelle<br />
Probleme <strong>der</strong> Inuit mit einem Einstieg über IQ gut erschlossen werden.<br />
Zum an<strong>der</strong>en wurden zahlre<strong>ich</strong>e Märchen und Sagen <strong>der</strong> Inuit durch die Sammlung des<br />
grönländisch-dänischen Polarforschers KNUD RASMUSSEN für ein breites Publikum zugängl<strong>ich</strong><br />
gemacht. Ein Märchen bietet auf erzählerische Weise einen guten Einblick in die Vorstel-<br />
lungswelt seiner Verständigungsgemeinschaft und kann den Schülerinnen und Schülern ei-<br />
nen Eindruck von den Eigenheiten einer Kultur, aber auch von mögl<strong>ich</strong>en Gemeinsamkeiten<br />
verschaffen. Vor diesem Hintergrund wurde bei <strong>der</strong> Schülerbefragung nach dem Interesse an<br />
einer unterr<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>en Behandlung eines Märchens aus <strong>der</strong> kalten Zone gefragt. Die Einstel-<br />
lung <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler scheint die Mögl<strong>ich</strong>keiten eines Märchens im Unterr<strong>ich</strong>t<br />
allerdings einzuschränken. Während die 8. Klasse diesbezügl<strong>ich</strong> indifferent ist – es gibt eben-<br />
so viele Interessensbekundungen wie Ablehnungen –, tendiert die 7. Klasse recht deutl<strong>ich</strong> zu<br />
einer ablehnenden Haltung gegenüber einem Märchen. Mehrere Schüler geben an, für Mär-<br />
chen mittlerweile zu alt zu sein. Als alternative und für die Schülerinnen und Schüler viel-<br />
le<strong>ich</strong>t attraktivere Variante, könnte auch eine <strong>der</strong> Igloolik-Isuma-Dokumentation im Unter-<br />
r<strong>ich</strong>t gezeigt und besprochen werden. Gemäß dem Motto „from the inside and through Inuit<br />
eyes“ (IGLOOLIK ISUMA PRODUCTIONS 2001) böte s<strong>ich</strong> die Mögl<strong>ich</strong>keit zu einem Perspektiven-<br />
wechsel und einer auf diese Weise vertieften Auseinan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong> Thematik.<br />
Perspektivenwechsel und Werteorientierung fungieren als zwei zentrale Elemente bei <strong>der</strong><br />
Thematisierung frem<strong>der</strong> Lebensweisen und Kulturen im Erdkundeunterr<strong>ich</strong>t. Sie ermögl<strong>ich</strong>en<br />
eine reflektierte Auseinan<strong>der</strong>setzung mit dem Fremden und ebnen somit den Weg zu inter-<br />
kultureller Kompetenz. „Jedes Abbild von Wirkl<strong>ich</strong>keit auf seine Entstehung, Erscheinung<br />
und Wirkung [zu] hinterfragen“ sollte daher verstärkt zum Bestandteil des Unterr<strong>ich</strong>tes wer-
Gegenüberstellende Zusammenfassung <strong>der</strong> Perspektiven und Fazit 114<br />
den. Es gilt, s<strong>ich</strong> stets vor Augen zu führen: „<strong>Ich</strong> <strong>weiß</strong>, <strong>dass</strong> <strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>ts <strong>weiß</strong>“ (SOKRATES zit. nach<br />
FRIPERTINGER 2011:59).
Literaturverze<strong>ich</strong>nis 115<br />
Literaturverze<strong>ich</strong>nis<br />
ADORNO, T. W. 1951/2003: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben (=<br />
Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Bd. 1704). Frankfurt am Main: Suhrkamp.<br />
ALIA, V. 2005: Art. Images of indigenous peoples. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the<br />
Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 940-944.<br />
BACK, F.; GERMAIN, G.-H.; MORRISON, D. 1996: Eskimo: Gesch<strong>ich</strong>te, Kultur und Leben in <strong>der</strong> Arktis.<br />
München: Fre<strong>der</strong>king & Thaler.<br />
BALIKCI, A. 1989: The Netsilik Eskimo. Prospect Heights: Waveland Press.<br />
BAMBERGER, R.; BOYER, L.; SRETENOVIC, K.; STRIETZEL, H. 1998: Zur Gestaltung und Verwendung von<br />
Schulbüchern. Mit beson<strong>der</strong>er Berücks<strong>ich</strong>tigung <strong>der</strong> elektronischen Medien und <strong>der</strong> neuen<br />
Lernkultur. Wien: ÖBD.<br />
BERIÉ, E.; KOBERT, H. (Hrsg.) 2006: Der Fischer-Weltalmanach 2007. Frankfurt am Main: Fi-<br />
scher.<br />
BUDKE, A. (Hrsg.) 2008a: Interkulturelles Lernen im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t (= Potsdamer Geographische<br />
Forschungen, Bd. 27). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam.<br />
BUDKE, A. 2008b: Zwischen Kulturerdteilen und Kulturkonstruktionen – Historische und neue<br />
Konzepte des Interkulturellen Lernens im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t. In: BUDKE, A. (Hrsg.): Interkulturelles<br />
Lernen im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t (= Potsdamer Geographische Forschungen,<br />
Bd. 27). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam. S. 9-29.<br />
COLT, S.G.; PRETES, M. 2005: Art. Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA). In: NUTTALL, M.<br />
(Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic. Volume 1 A-F. New York/London: Routledge. S. 34-38.<br />
DIERCKE WELTATLAS – ALBRECHT, M.; GEHRING, W.; KIRCHHOF, J.; MICHAEL, T.; RICHTER, B.; SCHLIMM, R.;<br />
SENG, P. Braunschweig: Westermann 2008.<br />
DORAIS, L.-J. 1995: Language, culture and identity: some Inuit examples. In: The Canadian<br />
Journal of Native Studies, 14 (15). S. 293-306.<br />
DÖRRENBÄCHER, H. P. 2006: Natur und Ressource in Kanada – Mehr Umweltgerechtigkeit und<br />
selbstbestimmte Entwicklung indigener Völker. In: GLASER R.; KREMB, K. (Hrsg.): Nord- und<br />
Südamerika (= Planet Erde). Darmstadt: Wissenschaftl<strong>ich</strong>e Buchgesellschaft. S. 50-62.<br />
DUIT, R. 2008: Zur Rolle von Schülervorstellungen im Unterr<strong>ich</strong>t. In: <strong>Geographie</strong> heute, 28<br />
(265). S. 2-6.<br />
EDELMANN, W. 2000: Lernpsychologie. (6. Auflage). Weinheim: Beltz.
Literaturverze<strong>ich</strong>nis 116<br />
FÆGTEBORG, M. 1998: Grønland i dag: en introduktion 1998-99. Kopenhagen: Arctic Informati-<br />
on.<br />
FÆGTEBORG, M. 2005a: Art. Greenland Home Rule Act. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of<br />
the Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 786-787.<br />
FÆGTEBORG, M. 2005b: Art. Inuit Party. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic. Volume<br />
2 G-N. New York/London: Routledge. S. 1003.<br />
FIENUP-RIORDAN, A. 1995: Freeze frame: Alaska Eskimos in the movies. Seattle: University of<br />
Washington Press.<br />
FOUCAULT, M. 1974/2003: Die Ordnung <strong>der</strong> Dinge: Eine Archäologie <strong>der</strong> Humanwissenschaften<br />
(= Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Bd. 96). Frankfurt am Main: Suhrkamp.<br />
FRIPERTINGER, B. 2011: Interview mit Unzeitgenossen: „<strong>Ich</strong> <strong>weiß</strong>, <strong>dass</strong> <strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>ts <strong>weiß</strong>!“ (Sokrates).<br />
In: Abenteuer Philosophie, 31 (124). S. 58-59.<br />
FUGMANN, G. 2009: Development corporations in the Canadian north. Examples for economic<br />
grassroots initiatives among the Inuit. In: Erdkunde, 63 (1). S. 69-79.<br />
FÜHRING, G. 1993: Begegnung mit dem Fremden. Materialien für die entwicklungspolitische<br />
Bildungsarbeit. Berlin: Deutscher Entwicklungsdienst/DED.<br />
GLASER R.; KREMB, K. (Hrsg.) 2006: Nord- und Südamerika (= Planet Erde). Darmstadt: Wissenschaftl<strong>ich</strong>e<br />
Buchgesellschaft.<br />
HÄCKEL, H. 2005: Meteorologie (= UTB 1338). (5. Auflage). Stuttgart: Ulmer.<br />
HAUBRICH, H. (Hrsg.) 2006: <strong>Geographie</strong> unterr<strong>ich</strong>ten lernen. Die neue <strong>Didaktik</strong> <strong>der</strong> <strong>Geographie</strong><br />
konkret. (2. Auflage). München/Düsseldorf/Stuttgart: Oldenbourg.<br />
HAYSOM, V. 2005: Art. Labrador Inuit Land Claims Agreement in Principle. In: NUTTALL, M.<br />
(Hrsg.) 2005b: Encyclopedia of the Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S.<br />
1146-1148.<br />
HEMMINGER, H. 2009: Und Gott schuf Darwins Welt. Der Streit um Kreationismus, Evolution<br />
und Intelligentes Design. Gießen: Brunnen.<br />
HENDERSON, A. 2005: Art. Inuit Qaujimajatuqangit. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the<br />
Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 1003-1004.<br />
HOFFMANN, K. W. 2009: Mit den Nationalen Bildungsstandards <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t planen<br />
und auswerten. In: <strong>Geographie</strong> und ihre <strong>Didaktik</strong>, 37 (3), S. 105-119.<br />
HUHNDORF, S. M. 2009: Mapping the Americas: the transnational politics of contemporary<br />
native culture. Ithaca: Cornell University Press.
Literaturverze<strong>ich</strong>nis 117<br />
IRLBACHER FOX, S. 2005: Art. Self-government. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic.<br />
Volume 3 O-Z. New York/London: Routledge. S. 1878-1883.<br />
JACOBS, P. 2005a: Art. Nunavik. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic. Volume 2 G-<br />
N. New York/London: Routledge. S. 1518-1521.<br />
JACOBS, P. 2005b: Art. Nunavik Political Accord. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the<br />
Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 1521-1522.<br />
KAALHAUGE NIELSEN, J. 2005a: Art. Inuit Ataqatigiit. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the<br />
Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 998.<br />
KAALHAUGE NIELSEN, J. 2005b: Art. Self-determination. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of<br />
the Arctic. Volume 3 O-Z. New York/London: Routledge. S. 1876-1878.<br />
KULCHYSKI, P. 2005: Art. Nunavut Final Agreement. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the<br />
Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 1529-1532.<br />
LÉGARÉ, A. 2005: Art. Nunavut. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic. Volume 2 G-<br />
N. New York/London: Routledge. S. 1522-1529.<br />
MATTHES, E.; HEINZE, C. (Hrsg.) 2003: Didaktische Innovationen im Schulbuch (= Beiträge zur<br />
historischen und systematischen Schulbuchforschung). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.<br />
MCCANN, D. 2005a: Art. Inuvialuit Final Agreement. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of<br />
the Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 1012-1013.<br />
MCCANN, D. 2005b: Art. Nunavut Tunngavik Inc. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the<br />
Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 1532-1533.<br />
MCNICOLL, P.; TESTER, F. J. 2004: Isumagijaksaq: mindful of the state: social constructions of<br />
Inuit suicide. In: Social Science and Medicine, 38 (58). S. 2625-2636.<br />
MAYRING, P.; GLÄSER-ZIKUDA, M. (Hrsg.) 2008: Die Praxis <strong>der</strong> qualitativen Inhaltsanalyse. (2. Auflage).<br />
Weinheim/Basel: Beltz.<br />
MAYRING, P. 2008: Neuere Entwicklungen in <strong>der</strong> qualitativen Forschung und <strong>der</strong> Qualitativen<br />
Inhaltsanalyse. In: MAYRING, P.; GLÄSER-ZIKUDA, M. (Hrsg.): Die Praxis <strong>der</strong> qualitativen Inhaltsanalyse.<br />
(2. Auflage). Weinheim/Basel: Beltz. S. 7-19.<br />
MEIER KRUKER, V.; RAUH, J: 2005: Arbeitsmethoden <strong>der</strong> Humangeographie (= Geowissen kompakt).<br />
Darmstadt: Wissenschaftl<strong>ich</strong>e Buchgesellschaft.<br />
MÖNTER, L. O.; SCHIFFER-NASSERIE, A. 2006: Antirassismus als Herausfor<strong>der</strong>ung für die Schule.<br />
Von <strong>der</strong> Theoriebildung zur praktischen Umsetzung im geographischen Schulbuch (= Europäische<br />
Hochschulschriften Reihe XI, Bd. 955). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Literaturverze<strong>ich</strong>nis 118<br />
MUELLER, D.; NICKELS, S. 2005: Art. Inuit Tapiriit Kanatami. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia<br />
of the Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 1004-1005.<br />
NIEKE, W. 2000: Interkulturelle Erziehung und Bildung. Wertorientierungen im Alltag (= Schule<br />
und Gesellschaft, Bd. 4). (2. Aufl.). Opladen: Leske & Budr<strong>ich</strong>.<br />
NUTTALL, M. (Hrsg.) 2005a: Encyclopedia of the Arctic. Volume 1 A-F. New York/London: Rout-<br />
ledge.<br />
NUTTALL, M. (Hrsg.) 2005b: Encyclopedia of the Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Rou-<br />
tledge.<br />
NUTTALL, M. (Hrsg.) 2005c: Encyclopedia of the Arctic. Volume 3 O-Z. New York/London: Rout-<br />
ledge.<br />
NUTTALL, M. 2005d: Art. Greenland. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic. Volume<br />
2 G-N. New York/London: Routledge. S. 778-785.<br />
NUTTALL, M. 2005e: Art. Greenland Inuit. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic.<br />
Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 790-795.<br />
NUTTALL, M. 2005f: Art. Inuit. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic. Volume 2 G-N.<br />
New York/London: Routledge. S. 990-997.<br />
NUTTALL, M. 2005g: Art. Tourism. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic. Volume 3<br />
O-Z. New York/London: Routledge. S. 2037-2040.<br />
PETERMANN, F.; PETERMANN, U.; WINKEL, S. 2006: Lernpsychologie (= UTB Basics). Pa<strong>der</strong>born:<br />
Schöningh.<br />
PRETES, M. 2005: Art. Alaska. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic. Volume 1 A-F.<br />
New York/London: Routledge. S. 21-27.<br />
REICH, K. 2008: Konstruktivistische <strong>Didaktik</strong>. Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool (=<br />
Pädagogik und Konstruktivismus). (4. Auflage). Weinheim/Basel: Beltz.<br />
REICH, K. 2010: Systemisch-konstruktivistische Pädagogik. Einführung in die Grundlagen einer<br />
interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik (= Pädagogik und Konstruktivismus). (6.<br />
Auflage). Weinheim/Basel: Beltz.<br />
REINFRIED, S. 2006: Interessen, Vorwissen, Fähigkeiten und Einstellungen von Schülerinnen<br />
und Schülern berücks<strong>ich</strong>tigen. In: HAUBRICH, H. (Hrsg.): <strong>Geographie</strong> unterr<strong>ich</strong>ten lernen.<br />
Die neue <strong>Didaktik</strong> <strong>der</strong> <strong>Geographie</strong> konkret. (2. Auflage). München/Düsseldorf/Stuttgart:<br />
Oldenbourg. S. 49-78.<br />
REINFRIED, S. 2008: Schülervorstellungen und Lernen von <strong>Geographie</strong>. In: <strong>Geographie</strong> heute,<br />
28 (265). S. 8-13.
Literaturverze<strong>ich</strong>nis 119<br />
RHODE-JÜCHTERN, T. 2009: Eckpunkte einer mo<strong>der</strong>nen <strong>Geographie</strong>didaktik. Hintergrundbegriffe<br />
und Denkfiguren. Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer.<br />
RICHLING, B. 2005: Art. Labrador Inuit. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the Arctic. Volume<br />
2 G-N. New York/London: Routledge. S. 1144-1145.<br />
ROHWER, G. 1996: Interkulturelles Lernen im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t. In: <strong>Geographie</strong> heute, 16<br />
(141). S. 4-9.<br />
STEIN, G. 2003: Vom medienkritischen Umgang mit Schulbüchern: mehr als nur „eine didaktische<br />
Innovation“. In: MATTHES, E.; HEINZE, C. (Hrsg.): Didaktische Innovationen im Schulbuch<br />
(= Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung). Bad Heilbrunn:<br />
Klinkhardt. S. 233-254.<br />
STERN, P. 2005: Art. Inuvialuit Settlement Region. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the<br />
Arctic. Volume 2 G-N. New York/London: Routledge. S. 1013-1015.<br />
STÖBER, G. (Hrsg.) 2001a: „Fremde Kulturen“ im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t. Analysen – Konzeptionen<br />
– Erfahrungen (= Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Bd. 106). Hannover:<br />
Hahn.<br />
STÖBER, G. 2001b: „Fremde Kulturen“ zwischen Buchdeckeln – ein Überblick. In: STÖBER, G.<br />
(Hrsg.): „Fremde Kulturen“ im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t. Analysen – Konzeptionen – Erfahrungen<br />
(= Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Bd. 106). Hannover: Hahn. S.<br />
17-41.<br />
THANNHEISER, D.; WÜTHRICH, C. 2002: Die Polargebiete (= Das Geographische Seminar). Braun-<br />
schweig: Westermann.<br />
THOMAS, A. 2006: Die Bedeutung von Vorurteil und Stereotyp im interkulturellen Handeln. In:<br />
Interculture Journal, 1(2), S. 3-20.<br />
THÖNEBÖHN, F. 1995: Rezeption und Verwendung des geographischen Schulbuches in <strong>der</strong> Sekundarstufe<br />
I. Interviewstudie zum Umgang von Lehrern mit dem geographischen Schulbuch<br />
bei curricularen Entscheidungen, bei <strong>der</strong> Unterr<strong>ich</strong>tsplanung und im Unterr<strong>ich</strong>t. Essen:<br />
Ruhr-Universität Bochum.<br />
VAN DER VAART, R. 2001: „Other cultures“ in school geography: what does academic geography<br />
have to offer? In: STÖBER, G. (Hrsg.): „Fremde Kulturen“ im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t. Analysen<br />
– Konzeptionen – Erfahrungen (= Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Bd.<br />
106). Hannover: Hahn. S. 156-163.<br />
VEITER, T. 1990: Die Autonomie Grönlands. Das autonome Nordland (= Ethnos, Bd. 36). Wien:<br />
Braumüller.
Literaturverze<strong>ich</strong>nis 120<br />
WEEN, G. 2005a: Art. Arctic Peoples‘ Conference. In: NUTTALL, M. (Hrsg.): Encyclopedia of the<br />
Arctic. Volume 1 A-F. New York/London: Routledge. S. 141-142.<br />
WRIGHT, D. R. 2001: Analysing textbook pictures: How can this contribute to pupils‘ un<strong>der</strong>standing<br />
of other cultures? In: STÖBER, G. (Hrsg.): „Fremde Kulturen“ im <strong>Geographie</strong>unterr<strong>ich</strong>t.<br />
Analysen – Konzeptionen – Erfahrungen (= Studien zur internationalen Schulbuchforschung,<br />
Bd. 106). Hannover: Hahn. S. 165-168.<br />
Internetquellenverze<strong>ich</strong>nis<br />
CANADIAN COUNCIL ON LEARNING (Hrsg.) 2007a: Inuit Holistic Life Long Learning Model.<br />
http://cli.ccl-cca.ca/Inuit/index.php?q=home<br />
Erstellt: 2007; Abruf: 1. August 2011<br />
CANADIAN COUNCIL ON LEARNING (Hrsg.) 2007b: Redefining how success is measured in First Nations,<br />
Inuit and Métis learning. Report on learning in Canada 2007.<br />
http://www.cepn-fnec.com/conf-micro/documents/2-<br />
%20Viviane%20Ayougman%20mardi%209%20h%2015/Redefining_How_Success_Is_Measured_EN.pdf<br />
Erstellt: November 2007; Abruf: 1. August 2011<br />
DANMARKS STATSMINISTERIET (Hrsg.) 1978: Lov om Grønlands Hjemmestyre.<br />
http://www.renteberegning.gl/dokumenter/19781129-Lov-om-groenlands-hjemmestyre.pdf<br />
Erstellt: 29.11.1978; Abruf: 25. Juli 2011<br />
DANMARKS STATSMINISTERIET (Hrsg.) 2009: Lov om Grønlands Selvstyre.<br />
http://www.stm.dk/multimedia/selvstyreloven.pdf<br />
Erstellt: 13.06.2009; Abruf: 25. Juli 2011<br />
DEPARTMENT OF ABORIGINAL AFFAIRS AND NORTHERN DEVELOPMENT CANADA (Hrsg.) 2008: Backgroun<strong>der</strong><br />
- The Nunavik Inuit Land Claims Agreement.<br />
http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/mr/nr/j-a2007/2-2855-bk-eng.asp<br />
Erstellt: 28. Oktober 2008; Abruf: 01. August 2011<br />
DGfG (= Deutsche Gesellschaft für <strong>Geographie</strong>; Hrsg.) 2002: Grundsätze und Empfehlungen<br />
für die Lehrplanarbeit im Schulfach <strong>Geographie</strong>.<br />
www.unijena.de/unijenamedia/Downloads/faculties/chgeo/inst_geogr/<strong>Didaktik</strong>/Lehrmaterialien/<strong>Didaktik</strong>%2BII%2B_<br />
%2BGEO%2B251/curriculum2000.doc<br />
Erstellt: Dezember 2002; Abruf: 30. April 2011<br />
EXPLORE NUNAVUT o. J.: Offizielle Tourismus-Internetseite Nunavuts.<br />
http://www.explorenunavut.com/index.php<br />
Erstellt: o. J.; Abruf: 31. Juli 2011
Literaturverze<strong>ich</strong>nis 121<br />
GOVERNMENT OF NUNAVUT (Hrsg.) 2010: Inuit Qaujimajatuqangit – Inuit societal values. Guiding<br />
principles.<br />
http://www.gov.nu.ca/files/IQ_Principles_2010.pdf<br />
Erstellt: 2010; Abruf: 01. August 2011<br />
GREENLAND.COM o. J.: Offizielle Tourismus-Internetseite Grönlands.<br />
http://www.greenland.com/en/<br />
Erstellt: o.J.; Abruf: 31. Juli 2011<br />
GRØNLANDS STATISTIK (Hrsg.) 2001: Arbejdsmarkedsforhold – Ledigheden i 2001.<br />
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&version=200101&link=AF&subthemecode=p3&colcode=p<br />
Erstellt: 28. April 2002; Abruf: 31. Juli 2011<br />
GRØNLANDS STATISTIK (Hrsg.) 2006: Arbejdsmarkedsforhold – Ledigheden i byerne i 2006.<br />
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&version=200601&link=AF&subthemecode=p4&colcode=p<br />
Erstellt: 04. April 2007; Abruf: 31. Juli 2011<br />
GRØNLANDS STATISTIK (Hrsg.) 2010: 2010 Statistisk Årbog – Turisme.<br />
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&version=2010&link=TR&subthemecode=o2&colcode=o<br />
Erstellt: 2010; Abruf: 31. Juli 2011<br />
GRØNLANDS STATISTIK (Hrsg.) 2011: Arbejdsmarkedsforhold – Ledigheden i byerne i 1. kvartal<br />
2011.<br />
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&version=201101&link=AF&subthemecode=p2&colcod=p<br />
Erstellt: 28. Juni 2011; Abruf: 31. Juli 2011<br />
INUIT TAPIRIIT KANATAMI (Hrsg.) 2004: Backgroun<strong>der</strong> on Inuit and housing. For discussion at Hosing<br />
Sectoral Meeting, November 24 and 25 th in Ottawa.<br />
http://www.aboriginalroundtable.ca/sect/hsng/bckpr/ITK_BgPaper_e.pdf<br />
Erstellt: 1. November 2004; Abruf: 13. August 2011<br />
INUIT TAPIRIIT KANATAMI (Hrsg.) 2011: First Canadians, Canadians First – National strategy on<br />
Inuit education 2011.<br />
http://www.itk.ca/sites/default/files/National-Strategy-on-Inuit-Education-2011_0.pdf<br />
Erstellt: Juni 2011; Abruf: 1. August 2011<br />
IGLOOLIK ISUMA PRODUCTIONS (Hrsg.) 2001: Learning Materials ‚Atanarjuat the fast runner‘.<br />
http://www.isuma.tv/node/6115/<br />
Erstellt: 2001; Abruf: 3. August 2011<br />
KATIVIK REGIONAL GOVERNMENT o. J.: Administration régionale Kativik – Renseignements<br />
généraux.<br />
http://www.krg.ca/fr/renseignements-generaux-krg<br />
Erstellt: o.J.; Abruf: 01. August 2011<br />
NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM (Hrsg.) 2008: Kerncurriculum für das Gymnasium, Schuljahrgänge<br />
5-10 – Erdkunde.
Literaturverze<strong>ich</strong>nis 122<br />
http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_gym_erdk_08_nib2.pdf<br />
Erstellt: 2008; Abruf: 01. August 2011<br />
NIETZSCHE, F. 1873: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. 1. Teil.<br />
http://gutenberg.spiegel.de/buch/3243/1<br />
Erstellt: o. J.; Abruf: 21. April 2011<br />
NUNAVIK REGIONAL BOARD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES & INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU<br />
QUÉBEC (Hrsg.) 2007: Qanuippitta? How are we? Alcohol, drug use and gambling among<br />
the Inuit of Nunavik: epidemological profile.<br />
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/657_esi_alcool_drogues_gambling.pdf<br />
Erstellt: 2007; Abruf: 1. August 2011<br />
NUNAVUT BUREAU OF STATISTICS (Hrsg.) o. J.: Nunavut Quick Facts.<br />
http://www.eia.gov.nu.ca/stats/<br />
Erstellt: o. J.; Abruf: 31. Juli 2011<br />
NUNAVUT DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES (Hrsg.) 2005: Inuit Employment Plan.<br />
http://www.gov.nu.ca/hr/site/iepinfo.htm<br />
Erstellt: 2005; Abruf: 22. Juli 2011<br />
NUNAVUT TUNNGAVIK INCORPORATED (Hrsg.) 1993: Agreement Between the Inuit in the Nunavut<br />
Settlement Area and Her Majesty the Queen in Right of Canada (= Nunavut Final Agreement).<br />
http://www.tunngavik.com/documents/publications/1993-00-00-Nunavut-Land-Claims-Agreement-<br />
English.pdf<br />
Erstellt: 23. Mai 1993; Abruf: 20. Juli 2011<br />
NUNIVAAT – NUNAVIK STATISTICS PROGRAM (Hrsg.) 2008: Unemployment rates for Inuit and non-<br />
Aboriginal people aged 25 to 54 years, by sex, Canada and Inuit regions, 2001 and 2006.<br />
http://www.nunivaat.org/TableViewer.aspx?S=2&ID=12689<br />
Erstellt: November 2008; Abruf: 31. Juli 2011<br />
PAUKTUUTIT (Hrsg.) 2006: The Inuit way: a guide to Inuit culture.<br />
http://www.pauktuutit.ca/pdf/publications/pauktuutit/InuitWay_e.pdf<br />
Erstellt: 2006; Abruf: 1. August 2011<br />
SCHRÜFER, G. 2003: Verständnis für fremde Kulturen.<br />
http://opus.ub.uni-bayreuth.de/volltexte/2004/76/pdf/Diss.pdf<br />
Erstellt: Januar 2003; Abruf: 02. Mai 2011<br />
STATE OF ALASKA – DEPARTMENT OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT (Hrsg.) 2011: Press release.<br />
Unemployment rate at 7.5 percent in June.<br />
http://labor.alaska.gov/news/2011/news11-40.pdf<br />
Erstellt: 22. Juli 2011; Abruf: 31. Juli 2011
Literaturverze<strong>ich</strong>nis 123<br />
STATISTICS CANADA - SOCIAL AND ABORIGINAL STATISTICS DIVISION (Hrsg.) 2008: Tables Report. 2006<br />
Inuit Census Tables. Ottawa: Department of Industry Canada.<br />
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-636-x/89-636-x2008001-eng.pdf<br />
Erstellt: November 2008; Abruf: 31. Juli 2011<br />
STATISTICS CANADA (Hrsg.) 2011: Labour force characteristics, seasonally adjusted, by province<br />
(monthly).<br />
http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/lfss01a-eng.htm<br />
Erstellt: 08. Juli 2011; Abruf: 31. Juli 2011<br />
UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR – BUREAU OF LABOR STATISTICS (Hrsg.) o. J.: Local Area Unemployment<br />
Statistics.<br />
http://data.bls.gov/timeseries/LASST02000003<br />
Erstellt: o. J.; Abruf: 31. Juli 2011<br />
Verze<strong>ich</strong>nis <strong>der</strong> Schulbücher<br />
Diercke Erdkunde 7/8 Gymnasium Nie<strong>der</strong>sachsen. – DÖPKE, G.; ELLMANN, R.; FREYTAG, M.; HÄUS-<br />
LER, M.; KEHLER, U.; KERKHOF, H.; KOCH, R.; MITTELSTÄDT, F.-G.; POMMERENING, R.; RÖßNER, T.; STON-<br />
JEK, D. Braunschweig: Westermann 2009.<br />
Seydlitz <strong>Geographie</strong> 7/8 Gymnasium Nie<strong>der</strong>sachsen. – BÖTTCHER-SPECKELS, K.; MINGENBACH, H.-<br />
M.; MÜLLER, H. Braunschweig: Schroedel 2007.<br />
Seydlitz <strong>Geographie</strong> 7/8 Gymnasium Nie<strong>der</strong>sachsen. – AMTSFELD, P.; BAUER, J.; ENGLERT, W.;<br />
GEHRKE, A.; GERLACH, A.; HALLERMANN, S.; HEBEL, A.; HERZIG, R.; HOENIG, C.; KIRSCH, H.; MAGER, F.-<br />
P.; NICKLAUS, W.; OCHSENWADEL, B.; REINHARDT, K. H.; SCHMIDT, K.; SCHMIDT, M.; SCHÖPFLIN, F.;<br />
WETZEL, J.; WERB, I. Braunschweig: Schroedel 2009.<br />
Terra Erdkunde 7/8 Gymnasium Nie<strong>der</strong>sachsen. – HABERLAG, B.; HEID, C.; HEIL, J.; PLAMANN, R.;<br />
ROTERMANN, G.; WAGENER, D. Leipzig: Klett 2006.<br />
Unsere Erde 7/8 Gymnasium Nie<strong>der</strong>sachsen. – FLATH, M.; JUNG, L.; MAROSKE, R.; MATHESIUS-<br />
WENDT, U.; MCCLELLAND, S.; MEYER, C.; RUDYK, E. Berlin: Cornelsen 2009.
Anhang 1: Siedlungen <strong>der</strong> Inuit in Grönland (Karte)<br />
Siedlungen <strong>der</strong> Inuit in Grönland<br />
(Quelle: http://www.esm.rochester.edu/organ/Greenland/Images/Map-Large.jpg)
Anhang 2: Siedlungsgebiete <strong>der</strong> Inuit in Kanada (Karte)<br />
Siedlungsgebiete <strong>der</strong> Inuit in Kanada<br />
(Quelle: http://www.makivik.org/media-centre/nunavik-maps/)
Anhang 3: Siedlungsgebiete <strong>der</strong> Inuit in Alaska (Karte)<br />
Siedlungsgebiete <strong>der</strong> Inuit in Alaska<br />
(Eigene Darstellung mit: http://www.nationalatlas.gov/mapmaker/mapmaker/printableMap)<br />
North Slope<br />
Northwest<br />
Arctic<br />
Nome<br />
Wade Hampton<br />
Bethel<br />
Dillingham
Anhang 4: Fragebogen<br />
Liebe Schülerin, lieber Schüler,<br />
mit diesem Fragebogen möchte <strong>ich</strong> gerne erfahren, was du über das Leben in <strong>der</strong> kalten Zone <strong>weiß</strong>t<br />
bzw. welche Vorstellungen du darüber hast. Bitte beantworte die folgenden Fragen ganz spontan.<br />
Es kommt n<strong>ich</strong>t darauf an, ob deine Antworten alle r<strong>ich</strong>tig sind. Der Fragebogen ist anonym und<br />
deine Antworten werden n<strong>ich</strong>t bewertet, son<strong>der</strong>n sind für m<strong>ich</strong> eine w<strong>ich</strong>tige Rückmeldung. Mir<br />
geht es vor allem darum, zu erfahren, worauf künftig im Erdkundeunterr<strong>ich</strong>t eingegangen werden<br />
sollte und wie <strong>der</strong> Erdkundeunterr<strong>ich</strong>t womögl<strong>ich</strong> verbessert werden könnte.<br />
Bitte denke daran, <strong>dass</strong> nur ehrl<strong>ich</strong>e Antworten weiterhelfen können!<br />
Vielen Dank für deine Mitarbeit,<br />
Anna Lena Harnau<br />
Zunächst brauche <strong>ich</strong> ein paar persönl<strong>ich</strong>e Angaben zu deiner Person und deiner Einstellung<br />
zu Erdkunde:<br />
□ weibl<strong>ich</strong> □ männl<strong>ich</strong><br />
Alter: Klasse:<br />
Die Themen im Erdkundeunterr<strong>ich</strong>t finde <strong>ich</strong><br />
sehr interessant □ □ □ □ □ □ uninteressant<br />
Begründe bitte deine Antwort:<br />
1. Wie heißen die Bewohner <strong>der</strong> kalten Zone? Kreuze an.<br />
□ Indianer □ Eskimos □ Inuit □ Tuareg<br />
2. Nenne drei St<strong>ich</strong>worte, die dir spontan zum „Leben in <strong>der</strong><br />
kalten Zone“ einfallen.<br />
1
Anhang 4: Fragebogen<br />
3. Was interessiert d<strong>ich</strong> beson<strong>der</strong>s in Bezug auf das Leben in <strong>der</strong> kalten Zone?<br />
Begründe bitte deine Antwort.<br />
4. Stell dir vor, du würdest d<strong>ich</strong> über Skype mit einem/einer gle<strong>ich</strong>altrigen Jugendl<strong>ich</strong>en aus<br />
Grönland unterhalten. Du fragst ihn/sie, wie sein/ihr alltägl<strong>ich</strong>es Leben abläuft (Familie,<br />
Freunde, Schule, Freizeit, wie wohnt er/sie). Was glaubst du, würde er/sie dir antworten?<br />
2
Anhang 4: Fragebogen<br />
5. Welche Bil<strong>der</strong> entsprechen deinen Vorstellungen über das Leben in Grönland? Kreuze an.<br />
a) b c)<br />
d e) f)<br />
g)<br />
6. Kennst du ein Märchen, das aus <strong>der</strong> kalten Zone stammt? Würde d<strong>ich</strong> ein solches Märchen<br />
interessieren?<br />
Begründe bitte deine Antwort.<br />
h<br />
3
Anhang 4: Fragebogen<br />
7. Woher nimmst du dein Wissen über das Leben in <strong>der</strong> kalten Zone?<br />
□ Fernsehen (Nachr<strong>ich</strong>ten, Dokumentationen, …) □ Schule<br />
□ Zeitung, Zeitschriften □ Internet<br />
□ Familie, Freunde □ Bücher<br />
□ An<strong>der</strong>e:<br />
8. Wie s<strong>ich</strong>er bist du dir, <strong>dass</strong> deine Vorstellungen über das Leben in <strong>der</strong> kalten Zone zutreffen?<br />
sehr s<strong>ich</strong>er □ □ □ □ □ □ uns<strong>ich</strong>er<br />
Begründe bitte deine Antwort.<br />
Geschafft!!!<br />
4<br />
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
Anhang 5: Tabellarische Ergebnisauflistung <strong>der</strong> Fragebogenerhebung<br />
Fragebogen<br />
Angaben zur Person<br />
Geschlecht Alter Klasse Interesse am<br />
Erdkundeunterr<strong>ich</strong>t<br />
(1 = w.; 2 = m.) (1 = sehr<br />
interessant; …; 6<br />
= uninteressant)<br />
Begründung des<br />
Interesses<br />
1/1 1 13 8 2 Die Themen,<br />
die wir<br />
bearbeiten<br />
interessieren<br />
m<strong>ich</strong> meistens<br />
und so erfahre<br />
<strong>ich</strong> mehr über<br />
die Erde.<br />
1/2 1 13 8 1 <strong>Ich</strong> finde es<br />
sehr<br />
interessant, da<br />
m<strong>ich</strong><br />
interessiert,<br />
was auf <strong>der</strong><br />
Erde vor s<strong>ich</strong><br />
geht.<br />
1/3 2 14 8 3 Man lernt viel<br />
über die ganze<br />
Welt, aber<br />
Spezialgebiete<br />
sind manchmal<br />
langweilig.<br />
1/4 2 14 8 2 Man lernt von<br />
<strong>der</strong> Welt. Man<br />
lernt etwas<br />
über das Klima.<br />
1/5 2 14 8 2 Manche<br />
Themen sind<br />
interessant und<br />
wenige auch<br />
n<strong>ich</strong>t.<br />
1/6 1 14 8 3 Manche<br />
Themen wie<br />
Karten und<br />
Län<strong>der</strong><br />
auswendiglerne<br />
n machen<br />
keinen Spaß.<br />
Dafür aber<br />
Kulturen und<br />
r<strong>ich</strong>tige<br />
Themen.<br />
1/7 1 13 8 2 <strong>Ich</strong> finde<br />
Erdkunde<br />
relativ<br />
interessant,<br />
weil die<br />
Themen im<br />
reellen Leben<br />
passieren.<br />
Wie heißen die<br />
Bewohner <strong>der</strong><br />
kalten Zone?<br />
(1 = Indianer; 2<br />
= Eskimos; 3 =<br />
Inuit; 4 =<br />
Tuareg)<br />
Drei spontane<br />
St<strong>ich</strong>worte<br />
zum "Leben in<br />
<strong>der</strong> kalten<br />
Zone"<br />
3 Eis; Iglu; Inuit Überleben in<br />
<strong>der</strong> kalten<br />
Zone; Tiere;<br />
Klima<br />
2; 3 Eis; arktisch;<br />
Pelz<br />
Den<br />
Vorstellungen<br />
entsprechende<br />
Bil<strong>der</strong> über das<br />
Leben in Grönland<br />
Interesse Begründung Familie Freunde Schule Freizeit Wohnverhältnisse Sonstiges (1 = a; 2 = b; 3 = c; Märchen aus Interesse an<br />
4 = d; 5 = e; 6 = f; 7 <strong>der</strong> kalten Zone einem Märchen<br />
= g; 8 = h) bekannt?<br />
(1 = ja; 2 = nein;<br />
3 = vielle<strong>ich</strong>t)<br />
<strong>Ich</strong> finde diese<br />
Themen<br />
interessant und<br />
möchte mehr<br />
darüber<br />
erfahren.<br />
Wie die Inuit es Es interessiert<br />
schaffen, s<strong>ich</strong> m<strong>ich</strong>!<br />
warm zu<br />
halten. Was<br />
essen sie?<br />
3 Iglus; Was passiert, Weil <strong>ich</strong> das<br />
Felljacken, wenn man n<strong>ich</strong>t <strong>weiß</strong>.<br />
Hundeschlitten eingeschneit ist<br />
und n<strong>ich</strong>t mehr<br />
wegkommt;<br />
wovon man<br />
s<strong>ich</strong> ernährt.<br />
3 Eisbären;<br />
Eishockey;<br />
Pinguine<br />
3 kalt; Eis;<br />
Eisbären<br />
2 Iglus; Eisbären;<br />
Fisch<br />
2 Eskimos; Kälte;<br />
Iglus; Eis<br />
Beson<strong>der</strong>es Interesse in Bezug<br />
auf das Leben in <strong>der</strong> kalten<br />
Zone<br />
Wie sie<br />
wohnen, was<br />
sie essen, was<br />
ihr Alltag ist,<br />
was sie<br />
anziehen.<br />
Weil es m<strong>ich</strong><br />
interessiert.<br />
Wie überleben Weil es m<strong>ich</strong><br />
dort die interessiert.<br />
Menschen?<br />
Was gibt es<br />
dort zu essen?<br />
Laufen da frei<br />
Eisbären und<br />
Pinguine rum?<br />
M<strong>ich</strong><br />
interessiert,<br />
wie die<br />
Bewohner dort<br />
überleben<br />
können.<br />
Weil die kalte<br />
Zone eine sehr<br />
anspruchsvolle<br />
Zone ist.<br />
Mein Vater holt das<br />
Essen und meine<br />
Mutter wärmt schon<br />
mal etwas Wasser<br />
auf. Dann stehen<br />
meine Schwester und<br />
<strong>ich</strong> auf. Alle<br />
zusammen essen wir<br />
etwas.<br />
Wie würde ein gle<strong>ich</strong>altriger grönländischer Jugendl<strong>ich</strong>er sein alltägl<strong>ich</strong>es Leben beschreiben?<br />
Er fährt jeden<br />
Morgen mit einem<br />
Schlitten in die<br />
Schule.<br />
… er mit seinen … <strong>dass</strong> es in <strong>der</strong><br />
"Freunden" ne digge Schule langweilig<br />
Party gemacht hat … war, …<br />
Anschließend gehen Wir spielen noch<br />
wir mit den etwas und gehen<br />
Nachbarkin<strong>der</strong>n zum dann ins Bett.<br />
Dorfältesten, um<br />
etwas zu lernen.<br />
Anschließend ist es<br />
schon spät und<br />
dunkel, wenn wir<br />
Im Sommer gehen sie Sie wohnen in<br />
auf Jagd genau wie r<strong>ich</strong>tigen Häusern.<br />
im Winter, aber sie<br />
sammeln manchmal<br />
auch.<br />
wie<strong>der</strong>kommen.<br />
Er hat einen sehr Seine Hobbies sind<br />
langen Schulweg und Schneeballschlachten<br />
wenn es stark , Schneeengel<br />
schneit, kann er gar machen, Eisburgen<br />
n<strong>ich</strong>t zur Schule bauen, Eishockey,<br />
gehen.<br />
Schlittenrennen,<br />
Fischen,<br />
Schneemänner bauen<br />
und den<br />
Weihnachtsmann<br />
suchen.<br />
… und danach noch<br />
ne Runde Eishockey<br />
gespielt hat … Am<br />
nächsten Tag hat er<br />
einen Schneemann<br />
gebaut und einen<br />
Schneeengel<br />
gemacht, <strong>der</strong> bei<br />
einer<br />
Schneeballschlacht<br />
ums Leben<br />
Es gibt einen Laden,<br />
in dem sie viel<br />
einkaufen können;<br />
alles, was sie<br />
brauchen. Es gibt<br />
auch sehr viele<br />
an<strong>der</strong>e Menschen in<br />
ihrem Dorf.<br />
Es ist sehr kalt, Sobald die<br />
deshalb schlafen wir Polarl<strong>ich</strong>ter<br />
alle zusammen und verloschen sind,<br />
unter Pelz. stehen wir auf, da<br />
das beste Frühstück<br />
um diese Zeit<br />
herumläuft.<br />
… und am Abend in<br />
seinem "Bett" im Iglu<br />
eingeschlafen ist.<br />
Gibt es dort<br />
überhaupt überall<br />
Internet? Er würde<br />
erzählen, <strong>dass</strong> er s<strong>ich</strong><br />
hauptsächl<strong>ich</strong> von<br />
Fisch und<br />
Eisbärenfleisch<br />
ernährt.<br />
Er würde erzählen,<br />
wenn er Internet<br />
hätte, …<br />
gekommen ist.<br />
<strong>Ich</strong> stehe auf. Papa Nach dem Mittag Zur Schule gehen. Schneemänner Abends gehe <strong>ich</strong> ins Nachts kann man den<br />
hat Fisch geholt. Wir spiele <strong>ich</strong> mit meinen<br />
bauen.<br />
Iglu in mein "Bett". Sternenhimmel<br />
essen alle am Tisch vielen Freunden.<br />
beobachten und<br />
Fisch und Fleisch (mit<br />
manchmal auch die<br />
Mama, Papa und<br />
meinen fünf<br />
Geschwistern).<br />
Danach gehe <strong>ich</strong> mit<br />
meinem Bru<strong>der</strong> auf<br />
Jagd. Außerdem<br />
helfen wir, das Essen<br />
zu kochen.<br />
Polarl<strong>ich</strong>ter.<br />
<strong>Ich</strong> denke auch, <strong>dass</strong> In <strong>der</strong> Freizeit gehen <strong>Ich</strong> glaube, die leben<br />
die zur Schule gehen, die vielle<strong>ich</strong>t fischen in normalen Häusern<br />
wie wir auch. o<strong>der</strong> machen Sachen, und Dörfern.<br />
wie wir auch.<br />
In <strong>der</strong> Schule sitzen<br />
alle in Jacken.<br />
In <strong>der</strong> Freizeit gehe<br />
<strong>ich</strong> Schlitten fahren.<br />
Meine Familie und Das Leben hier ist<br />
<strong>ich</strong> wohnen in einem sehr kalt.<br />
Iglu und meine<br />
Freunde auch.<br />
1; 3; 5; 7 <strong>Ich</strong> kenne,<br />
glaube <strong>ich</strong>,<br />
keins.<br />
Herkunft des Wissens über<br />
die kalte Zone<br />
Begründung S<strong>ich</strong>erheit Begründung<br />
2 M<strong>ich</strong> würde es<br />
interessieren,<br />
weil Märchen<br />
tolle<br />
Gesch<strong>ich</strong>ten<br />
sind und sie<br />
dann noch aus<br />
einer so<br />
schönen<br />
Umgebung<br />
stammen.<br />
1; 2; 3; 5; 7; 8; 9 2 Nein, da<br />
Märchen nur<br />
erfunden sind.<br />
<strong>Ich</strong> möchte<br />
aber die<br />
Wahrheit<br />
wissen.<br />
1; 2; 3; 4; 5 <strong>Ich</strong> kenne kein<br />
Märchen.<br />
2; 4; 5; 8 Der<br />
Weihnachtsmann,<br />
<strong>der</strong> hat<br />
m<strong>ich</strong> früher<br />
sehr<br />
interessiert.<br />
1; 2; 4; 5; 8 <strong>Ich</strong> kenne kein<br />
Märchen. <strong>Ich</strong><br />
kenne aber<br />
einen Film.<br />
Habe aber den<br />
Namen<br />
vergessen. Es<br />
geht um so 506<br />
Schlittenhunde.<br />
1; 4; 5; 7; 8 Wo <strong>der</strong><br />
Weihnachtsmann<br />
wohnt<br />
(Anm.: Das ist<br />
ein Kin<strong>der</strong>buch<br />
von Mauri<br />
Kunnas und<br />
spielt in<br />
Finnland ).<br />
1; 2; 4; 5 Nein, kenne <strong>ich</strong><br />
n<strong>ich</strong>t.<br />
Bekanntheit eines Märchens aus <strong>der</strong> kalten<br />
Zone und Interesse an einem Solchen<br />
1 <strong>Ich</strong> habe gar<br />
keine<br />
Vorstellung,<br />
was es dort für<br />
Märchen gibt.<br />
Weil das lustig<br />
war.<br />
1 Weil es<br />
vielle<strong>ich</strong>t<br />
spannend ist.<br />
1 Als Kind mochte<br />
<strong>ich</strong> das.<br />
2 Weil m<strong>ich</strong> die<br />
reelle Welt<br />
interessiert und<br />
n<strong>ich</strong>t die<br />
Märchenwelt.<br />
(1 = Fernsehen; 2 =<br />
Zeitung/Zeitschriften; 3 =<br />
Familie/Freunde; 4 =<br />
Schule; 5 = Internet; 6 =<br />
(1 = sehr s<strong>ich</strong>er; …;<br />
6 = uns<strong>ich</strong>er)<br />
Bücher; 7 = An<strong>der</strong>e)<br />
1; 2; 4; 6 3 <strong>Ich</strong> glaube, meine<br />
Angaben letztens<br />
irgendwo gelesen<br />
zu haben.<br />
1; 3; 4; 5; 7 (Umgebung) 5 Da <strong>ich</strong> noch n<strong>ich</strong>t<br />
so viel <strong>weiß</strong>.<br />
1; 2; 6; 7 (iPod) 5 <strong>Ich</strong> habe noch nie<br />
etwas Genaues<br />
darüber gehört.<br />
1; 5; 7 (PSN, MSN, xBox<br />
Live, iPod, iPad, iMac)<br />
S<strong>ich</strong>erheit bzgl. des Zutreffens <strong>der</strong><br />
Vorstellungen über die kalte Zone<br />
6 <strong>Ich</strong> habe keine<br />
Ahnung über das<br />
Leben in <strong>der</strong> kalten<br />
Zone.<br />
1; 2; 3; 4; 7 (iPod) 5 <strong>Ich</strong> glaube, sie<br />
machen ganz<br />
an<strong>der</strong>e Dinge.<br />
1; 2; 3; 4; 5; 7 3 <strong>Ich</strong> <strong>weiß</strong> n<strong>ich</strong>t so<br />
viel über die kalte<br />
Zone, aber bei ein<br />
paar Dingen bin<br />
<strong>ich</strong> mir s<strong>ich</strong>er.<br />
1; 4 3 Weil wir dieses<br />
Thema noch n<strong>ich</strong>t<br />
hatten.
Anhang 5: Tabellarische Ergebnisauflistung <strong>der</strong> Fragebogenerhebung<br />
1/8 2 14 8 3 Öfters<br />
langweilige<br />
Gestaltung<br />
1/9 2 14 8 1 Weil <strong>ich</strong><br />
darüber n<strong>ich</strong>ts<br />
<strong>weiß</strong> und <strong>ich</strong> es<br />
wissen möchte.<br />
1/10 2 14 8 2 Weil es<br />
spannend ist<br />
und man sieht<br />
die Welt mit<br />
an<strong>der</strong>en Augen.<br />
1/11 2 13 8 2 Manche<br />
Themen sind<br />
langweilig.<br />
1/12 2 14 8 3 Es gibt<br />
schlimmere<br />
Fächer, aber<br />
auch bessere.<br />
1/13 2 13 8 2 Einige Themen<br />
sind manchmal<br />
schnell<br />
langweilig.<br />
1/14 2 14 8 4 Interessiert<br />
m<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t<br />
wirkl<strong>ich</strong>, weil<br />
<strong>ich</strong> z.B.<br />
gesch<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>e<br />
Themen<br />
interessanter<br />
finde.<br />
1/15 2 14 8 2 Es ist schon<br />
sehr<br />
interessant,<br />
aber manchmal<br />
werden die<br />
Themen<br />
komisch<br />
rübergebracht.<br />
1/16 1 14 8 3 Weil <strong>ich</strong><br />
manches schon<br />
<strong>weiß</strong> und m<strong>ich</strong><br />
manches n<strong>ich</strong>t<br />
interessiert<br />
(n<strong>ich</strong>t so<br />
detailliert<br />
zumindest).<br />
2 Es ist kalt. Man<br />
fängt dort viele<br />
Fische. Es gibt<br />
auch Eisbären.<br />
N<strong>ich</strong>ts. In <strong>der</strong> Schule kann<br />
man "kältefrei"<br />
bekommen. Zur<br />
Schule muss man<br />
In <strong>der</strong> Freizeit kann<br />
man n<strong>ich</strong>t viel<br />
machen.<br />
3 Schnee; jagen; Wie kriegt man <strong>Ich</strong> habe keine Er muss viel zu Hause Wenn er s<strong>ich</strong> mit<br />
weit laufen.<br />
Er geht in die Schule. Er wohnt in<br />
frieren das Essen? Was Ahnung davon mithelfen.<br />
Freunden trifft, dann<br />
Containerhäusern<br />
essen die so? und mit den<br />
spielen sie PC (Eis<br />
und nur bei <strong>der</strong> Jagd<br />
Wie bewegen Motorschlitten<br />
essen sie<br />
in Iglus.<br />
die s<strong>ich</strong> fort? fährt man<br />
bestimmt n<strong>ich</strong>t<br />
sehr weit.<br />
wahrscheinl<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t).<br />
3 Fisch; Iglu; Dass man dort Es ist dort sehr Nachmittags geht er Danach spielt er mit … und geht zur<br />
Er würde aufstehen, Dann zieht er s<strong>ich</strong><br />
Eisbären leben kann, kalt.<br />
mit seinem Vater seinen Freunden … Schule.<br />
Wasser auftauen, um seine Pelze an … …<br />
ohne<br />
fischen.<br />
zu duschen o<strong>der</strong> und isst zu Abend<br />
einzufrieren<br />
und, <strong>dass</strong> man<br />
in einem Iglu<br />
wohnen kann.<br />
etwas zu trinken. und geht ins Bett.<br />
3 Kälte; Eis;<br />
Pinguine<br />
3 Fischen;<br />
Pinguine; Iglu<br />
3 Kälte; Eis;<br />
Schnee<br />
Wie die Tiere Weil das<br />
dort überleben. interessant ist.<br />
Das Eis Interessantes<br />
Thema<br />
Tiere in <strong>der</strong><br />
Kälte<br />
3 Iglu; kalt; Eis Die soziale<br />
Ordnung und<br />
die Kultur.<br />
2; 3 kalt; Eis;<br />
Schnee<br />
3 Iglu; kalt;<br />
an<strong>der</strong>es Klima<br />
als hier<br />
Weil m<strong>ich</strong> … und vielle<strong>ich</strong>t gehe<br />
interessiert, wie <strong>ich</strong> noch mit meiner<br />
die Tiere bei so Mutter einkaufen.<br />
einer Kälte<br />
überleben<br />
können.<br />
Weil <strong>ich</strong> m<strong>ich</strong><br />
interessiere, ob<br />
die Kultur<br />
etwas mit dem<br />
Überleben in<br />
<strong>der</strong> kalten Zone<br />
zu tun hat.<br />
So halt die Tiere sind<br />
Lebensformen, immer<br />
Bäume und, ob interessant und<br />
meine zu meiner<br />
Behauptung Behauptung:<br />
stimmt, <strong>dass</strong> Sinn und Zweck<br />
Pflanzen die des Lebens ist<br />
fortschrittl<strong>ich</strong>st<br />
e Lebensform<br />
sind.<br />
Ernährung; Wo<br />
wohnen sie<br />
bzw. wie<br />
wohnen sie?<br />
die<br />
Fortpflanzung.<br />
Das tun<br />
Pflanzen.<br />
<strong>Ich</strong> denke, <strong>dass</strong><br />
es dort an<strong>der</strong>s<br />
ist als hier,<br />
deswegen will<br />
<strong>ich</strong> das wissen.<br />
Dass seine Freunde<br />
sehr weit weg<br />
wohnen.<br />
Sie müssen früh<br />
aufstehen und einen<br />
langen Weg zur<br />
Schule haben.<br />
In die Schule. Dann<br />
gehe <strong>ich</strong> nach Hause,<br />
mache meine<br />
Hausaufgaben …<br />
Dass seine Schule<br />
sehr weit weg ist.<br />
Dass er in seiner<br />
Freizeit seinen Eltern<br />
hilft, das Haus zu<br />
wärmen, indem er<br />
z.B. Holz hackt.<br />
… Mit dem Schlitten … Schneeballschlacht<br />
zur Schule, Erdkunde usw. Schlitten nach<br />
üba Wüste reden, … Hause ziehen, essen,<br />
trinken und dann<br />
gamen. Cool ne :)<br />
Nee, eigentl<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t.<br />
Es ist sehr kalt. 1; 5; 7; 8 Nein. 2 M<strong>ich</strong><br />
interessieren<br />
keine Märchen.<br />
Man schläft in Iglus … … und muss dicke<br />
Klamotten tragen.<br />
Wir müssen uns<br />
Fische angeln, damit<br />
wir überleben. Es ist<br />
sehr kalt. Man<br />
bekommt schnell<br />
eine Lungenentzündung,<br />
weil es<br />
so kalt ist. Die Winter<br />
sind meist kälter als -<br />
40°C und die Sommer<br />
werden 0°C.<br />
<strong>Ich</strong> denke, <strong>dass</strong> er/sie<br />
erzählt, <strong>dass</strong> ihr<br />
Alltag schwer ist. Es<br />
ist sehr kalt und es<br />
gibt n<strong>ich</strong>t viele Shops.<br />
Sie müssen ihre<br />
Nahrung selbst<br />
fangen und leben von<br />
<strong>der</strong> Natur.<br />
Vielle<strong>ich</strong>t würde<br />
er/sie antworten: <strong>Ich</strong><br />
stehe morgens auf,<br />
frühstücke und ziehe<br />
m<strong>ich</strong> ganz warm an,<br />
um raus zu gehen. ...<br />
Dann gehe <strong>ich</strong><br />
schlafen.<br />
Hey du, wie geht’s? -<br />
Guddi, Digga. Mir<br />
geht’s gut. - Was<br />
machste so imma? …<br />
<strong>Ich</strong> denke, er/sie<br />
würde sagen, <strong>dass</strong><br />
dort alles ist wie hier.<br />
1; 2; 4; 8 Nein, <strong>ich</strong> kenne<br />
keine.<br />
1; 2; 4; 5; 8 <strong>Ich</strong> kenne einen<br />
Film, <strong>der</strong> dort in<br />
<strong>der</strong> Gegend<br />
stattfand, wo<br />
ein Junge<br />
ermordet wird<br />
und sie erkennt<br />
anhand von<br />
Spuren im<br />
Schnee, <strong>dass</strong> er<br />
gejagt wurde<br />
(Anm.: Fräulein<br />
Smillas<br />
Gespühr für<br />
Schnee ).<br />
1; 2; 5 <strong>Ich</strong> kenne kein<br />
Märchen.<br />
1; 4 5 <strong>Ich</strong> <strong>weiß</strong> wenig<br />
darüber.<br />
2 1; 2; 4 3 Man kennt wenig<br />
Filme und in <strong>der</strong><br />
Schule haben wir<br />
es noch n<strong>ich</strong>t<br />
durchgenommen.<br />
Weil <strong>ich</strong> keins<br />
kenne.<br />
1; 3; 4; 5; 6 3 Da <strong>ich</strong> vieles aus<br />
zuverlässigen<br />
Quellen <strong>weiß</strong>.<br />
1; 2; 6 2 <strong>Ich</strong> bin mir s<strong>ich</strong>er,<br />
aber auch mal<br />
n<strong>ich</strong>t so s<strong>ich</strong>er.<br />
2; 4; 5; 8 Narnia. 1; 4 3 N<strong>ich</strong>t s<strong>ich</strong>er.<br />
1; 5 Nein, <strong>ich</strong> kenne<br />
kein Märchen.<br />
1; 2; 4; 8 Nein, <strong>ich</strong> kenne<br />
kein Märchen.<br />
1; 2; 4; 8 <strong>Ich</strong> kenne ein<br />
Märchen von<br />
einer <strong>weiß</strong>en<br />
Robbe, die<br />
einen neuen<br />
Geburtsplatz<br />
für die Herde<br />
sucht.<br />
1; 3; 5; 8 Nein, kenne <strong>ich</strong><br />
n<strong>ich</strong>t.<br />
2 Es ist ja in <strong>der</strong><br />
heutigen Zeit<br />
dort fast<br />
genauso wie<br />
hier. Also ist es<br />
n<strong>ich</strong>t wirkl<strong>ich</strong><br />
etwas<br />
Beson<strong>der</strong>es.<br />
3 Weil Märchen<br />
eventuell die<br />
Lebenslage<br />
beschreiben<br />
und die<br />
Befürchtungen,<br />
Ängste und<br />
Wünsche<br />
ausdrücken<br />
können.<br />
Naja, <strong>ich</strong> kenne<br />
halt das<br />
Märchen und<br />
<strong>ich</strong> mag es.<br />
1 Weil es<br />
vielle<strong>ich</strong>t ganz<br />
an<strong>der</strong>s ist<br />
(Form und<br />
Inhalt).<br />
1; 2 4<br />
1; 2; 4; 6 2 Weil <strong>ich</strong> einen Teil<br />
<strong>weiß</strong> bzw. gehört<br />
habe.<br />
4; 6; 7 (Ice Age I, II, III) 1 Naja, <strong>ich</strong> bin voll<br />
<strong>der</strong> Pro in Sachen<br />
kalte Zone und<br />
Jaguar und Löwe<br />
und so weiter.<br />
4 6 <strong>Ich</strong> kann m<strong>ich</strong><br />
n<strong>ich</strong>t mehr<br />
erinnern, was wir<br />
in <strong>der</strong> Schule<br />
gelernt haben.
Anhang 5: Tabellarische Ergebnisauflistung <strong>der</strong> Fragebogenerhebung<br />
1/17 2 14 8 5 N<strong>ich</strong>t alle<br />
Themen<br />
interessieren<br />
m<strong>ich</strong> (z.B.<br />
Gletscher,<br />
Gebirgsketten<br />
etc.).<br />
1/18 2 13 8 2 Weil m<strong>ich</strong> die<br />
Welt<br />
interessiert, wie<br />
es dort aussieht<br />
und so weiter.<br />
1/19 2 14 8 4 <strong>Ich</strong> finde die<br />
Themen relativ<br />
spannend, doch<br />
man könnte es<br />
ein bisschen<br />
spannen<strong>der</strong><br />
unterr<strong>ich</strong>ten.<br />
Außerdem mag<br />
<strong>ich</strong> Naturwissenschaften.<br />
1/20 1 14 8 3 <strong>Ich</strong> finde es<br />
langweilig,<br />
irgendwelche<br />
Städte im Atlas<br />
zu suchen o<strong>der</strong><br />
Sonstiges.<br />
1/21 2 14 8 3 Es gibt<br />
Schlimmeres als<br />
Erdkunde, da es<br />
manchmal sehr<br />
interessant ist.<br />
1/22 2 14 8 4 Manche<br />
Themen sind<br />
n<strong>ich</strong>t<br />
interessant,<br />
an<strong>der</strong>e jedoch<br />
umso mehr.<br />
1/23 2 14 8 3 Die meisten<br />
Themen sind<br />
langweilig und<br />
uninteressant.<br />
1/24 2 15 8 3 <strong>Ich</strong> finde<br />
Wissenschaften<br />
(zieml<strong>ich</strong>)<br />
interessant.<br />
1/25 1 13 8 2 <strong>Ich</strong> finde<br />
Erdkunde<br />
zieml<strong>ich</strong><br />
interessant,<br />
weil <strong>ich</strong> einige<br />
Themen sehr<br />
spannend finde,<br />
wie den Orient<br />
und Naturkatastrophen.<br />
3; 4 Kalt; schwere Überleben in Wenn <strong>ich</strong> mal in<br />
Nahrungsbesch <strong>der</strong> kalten Zone <strong>der</strong> kalten Zone<br />
affung; Eis<br />
bin, kann <strong>ich</strong><br />
überleben.<br />
3 Wale; Eisbären; Dass es dort<br />
Inuit<br />
Menschen gibt,<br />
die diese Kälte<br />
aushalten.<br />
Weil <strong>ich</strong> wissen <strong>Ich</strong> habe vier<br />
möchte, wie die Geschwister …<br />
Menschen es<br />
dort aushalten.<br />
3 Iglu; Beutejagd; Vielle<strong>ich</strong>t wie Weil <strong>ich</strong> es<br />
Zusammenhalt sie das Leben außergewöhnlic<br />
hinbekommen h finde, wie sie<br />
ohne viele das<br />
Hilfsmittel wie hinbekommen.<br />
Strom,<br />
Wasserleitung.<br />
2 Ein geregelter<br />
Lebensablauf;<br />
Pinguine;<br />
Eskimos<br />
3 Iglus; Pinguine;<br />
Eisbären<br />
3 kalt;<br />
Eis/Schnee;<br />
wenige<br />
Einwohner<br />
Der Alltag und<br />
die Lebensbedingungen<br />
<strong>der</strong> Menschen.<br />
Das harte<br />
Leben<br />
Weil <strong>ich</strong> gerne<br />
wüsste, ob die<br />
Vorurteile<br />
stimmen.<br />
Weil es ganz<br />
an<strong>der</strong>s ist, als<br />
wir leben.<br />
Was die Weil <strong>ich</strong> es<br />
Menschen n<strong>ich</strong>t kenne.<br />
essen und wie<br />
sie genau<br />
leben.<br />
3 kalt/kühl; Wie die <strong>Ich</strong> interessiere<br />
abgelegen; Eis Menschen dort m<strong>ich</strong> für an<strong>der</strong>e<br />
leben (Lebens- Kulturen,<br />
bedingungen) Län<strong>der</strong> usw.<br />
und ihre<br />
Lebensformen.<br />
3 Kalt; Nahrung<br />
begrenzt; viel<br />
Kleidung<br />
2 Schnee; Iglus;<br />
Eisbären<br />
Vielle<strong>ich</strong>t<br />
Krankheiten<br />
und Nahrung<br />
Die Lebens- <strong>Ich</strong> finde dieses<br />
gewohnheiten Thema<br />
<strong>der</strong> Menschen, interessant, da<br />
die dort leben. die Menschen<br />
dort total<br />
an<strong>der</strong>s leben<br />
und <strong>ich</strong> gerne<br />
wissen möchte,<br />
wie.<br />
… und eine Familie,<br />
genauso wie wir.<br />
5. Freunde treffen 1. Zur Schule<br />
3. Hausaufgaben<br />
Außerdem, <strong>dass</strong> sie<br />
auch Freunde haben<br />
…<br />
… und gehe n<strong>ich</strong>t zur In meiner Freizeit<br />
Schule, weil es keine gehe <strong>ich</strong> mit meinem<br />
gibt.<br />
Vater Eisbären<br />
fangen.<br />
Wir haben n<strong>ich</strong>t so<br />
viel Schule …<br />
Wir müssen jeden<br />
Tag zur Schule 20<br />
Minuten zu Fuß durch<br />
hohen Schnee<br />
wan<strong>der</strong>n. Das ist echt<br />
anstrengend.<br />
Keine Ahnung. <strong>Ich</strong><br />
denke, ähnl<strong>ich</strong> wie<br />
bei uns, allerdings mit<br />
an<strong>der</strong>en Berufen und<br />
ohne viele elektrische<br />
Geräte.<br />
Hallo, <strong>ich</strong> wohne in<br />
Grönland.<br />
6. zurück in die Hütte 2. zurück<br />
4. Helfen beim Jagen<br />
7. schlafen<br />
<strong>Ich</strong> glaube, <strong>dass</strong> sie in<br />
ganz normalen<br />
Häusern leben, weil<br />
es dort<br />
wahrscheinl<strong>ich</strong> ganz<br />
normale Städte gibt.<br />
… und verbringen ihre <strong>Ich</strong> denke, die<br />
Freizeit gle<strong>ich</strong>. wohnen fast wie in<br />
Deutschland …<br />
… und haben zwar<br />
viel Freizeit, doch<br />
können da n<strong>ich</strong>t so<br />
viel machen.<br />
Wir wohnen in einer<br />
kleinen Hütte.<br />
Wahrscheinl<strong>ich</strong><br />
würde er sagen, <strong>dass</strong><br />
es etwas kälter ist als<br />
bei uns.<br />
Das Leben ist n<strong>ich</strong>t<br />
einfach. … Nach <strong>der</strong><br />
Schule müssen wir<br />
noch Essen besorgen<br />
und eisfischen.<br />
Aus Interesse Er würde s<strong>ich</strong><br />
beschweren, <strong>dass</strong> es<br />
bei ihnen so kalt ist.<br />
<strong>Ich</strong> hätte keine<br />
Ahnung, was er sonst<br />
noch antworten<br />
würde, weil <strong>ich</strong> mir<br />
das n<strong>ich</strong>t so r<strong>ich</strong>tig<br />
vorstellen könnte.<br />
Sie würde antworten,<br />
<strong>dass</strong> sie auch bei sehr<br />
kalten Temperaturen<br />
zur Schule muss, da<br />
dies dort normal ist.<br />
2; 4; 5; 8 Nein. 2 Märchen aus<br />
<strong>der</strong> kalten Zone<br />
würden m<strong>ich</strong><br />
n<strong>ich</strong>t mehr o<strong>der</strong><br />
weniger<br />
interessieren<br />
als welche von<br />
woan<strong>der</strong>s. <strong>Ich</strong><br />
mag keine<br />
Märchen.<br />
1; 3; 4; 7 Nein, <strong>ich</strong> kenne<br />
keine.<br />
1 Weil <strong>ich</strong> wissen<br />
möchte, wie die<br />
Menschen dort<br />
leben und was<br />
sie dort<br />
machen.<br />
2; 4; 5 3 Weil <strong>ich</strong> keine<br />
Lust hätte ein<br />
langweiliges<br />
Märchen zu<br />
hören.<br />
An<strong>der</strong>erseits<br />
hätte <strong>ich</strong><br />
vielle<strong>ich</strong>t die<br />
Neugier, um<br />
was von den<br />
Menschen in<br />
<strong>der</strong> kalten Zone<br />
zu hören. (<strong>Ich</strong><br />
mag Märchen<br />
eigentl<strong>ich</strong><br />
n<strong>ich</strong>t!!!)<br />
1; 2; 4; 6 4 Soweit <strong>ich</strong> <strong>weiß</strong>,<br />
hatten wir das<br />
Thema noch n<strong>ich</strong>t<br />
in <strong>der</strong> Schule.<br />
1; 4 3 Weil <strong>ich</strong> schon<br />
mehrere<br />
Dokumentationen<br />
über die kalte Zone<br />
gesehen habe.<br />
1; 4; 6 3 <strong>Ich</strong> habe früher<br />
noch Dokufilme<br />
von vielen Sachen<br />
gesehen.<br />
1; 2; 5; 7; 8 Nein. 3 Weil <strong>der</strong><br />
1; 3; 6 4 Weil <strong>ich</strong> noch nie<br />
Verge<strong>ich</strong><br />
dort war und <strong>ich</strong><br />
zwischen<br />
m<strong>ich</strong> auch n<strong>ich</strong>t<br />
unseren<br />
genau damit<br />
Märchen und<br />
denen aus <strong>der</strong><br />
kalten Zone<br />
ganz spannend<br />
beschäftigt habe.<br />
wäre.<br />
1; 2; 4; 8 2 <strong>Ich</strong> interessiere<br />
1; 4 5 <strong>Ich</strong> interessiere<br />
m<strong>ich</strong> mehr für<br />
m<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t für<br />
an<strong>der</strong>e Sachen.<br />
Grönland und<br />
glaube, <strong>dass</strong> das<br />
Leben teilweise<br />
fast genauso ist<br />
wie in<br />
Deutschland.<br />
1; 2; 4; 5 Tabaluga 1 7 (eigenes Wissen) 3 <strong>Ich</strong> kenne m<strong>ich</strong> ein<br />
bisschen damit<br />
aus, doch die<br />
Fragen waren<br />
n<strong>ich</strong>t so schwer.<br />
1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 <strong>Ich</strong> kenne kein<br />
Märchen, das<br />
dort spielt.<br />
3 Kommt darauf<br />
an, worum es<br />
geht, aber<br />
allgemein<br />
interessieren<br />
Märchen m<strong>ich</strong><br />
n<strong>ich</strong>t.<br />
1; 5; 8 Nein. 2 M<strong>ich</strong><br />
interessieren<br />
allgemein keine<br />
Märchen.<br />
1; 2; 4 <strong>Ich</strong> kenne kein<br />
Märchen.<br />
1 M<strong>ich</strong> würde<br />
eines<br />
interessieren,<br />
da man dort<br />
den Alltag zu<br />
sehen<br />
bekommt.<br />
1; 2; 3; 4; 5; 6 5 Weil <strong>ich</strong> mir<br />
uns<strong>ich</strong>er bin.<br />
1 3 <strong>Ich</strong> <strong>weiß</strong> n<strong>ich</strong>t<br />
wirkl<strong>ich</strong> viel<br />
darüber.<br />
1; 4; 6 3 <strong>Ich</strong> beschäftige<br />
m<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t wirkl<strong>ich</strong><br />
mit diesem<br />
Thema, deswegen<br />
bin <strong>ich</strong> mir n<strong>ich</strong>t so<br />
s<strong>ich</strong>er.
Anhang 5: Tabellarische Ergebnisauflistung <strong>der</strong> Fragebogenerhebung<br />
1/26 2 14 8 3 Es ist ein<br />
interessantes<br />
Thema mit<br />
vielen guten<br />
Themen. Viele<br />
davon sind<br />
auch für m<strong>ich</strong><br />
interessant.<br />
1/27 1 14 8 3 Themen wie<br />
Er<strong>der</strong>wärmung<br />
und<br />
Naturschäden<br />
interessieren<br />
m<strong>ich</strong> ein wenig<br />
und z.B. "Wo<br />
liegt was" n<strong>ich</strong>t<br />
so sehr. Dieses<br />
Thema kommt<br />
sehr oft vor.<br />
3 Wale; Eisbären; Wie leben dort <strong>Ich</strong> finde es das<br />
Inuit mögl<strong>ich</strong> ist Interessanteste<br />
(überleben).<br />
Leben dort<br />
generell.<br />
.<br />
2 kalt;<br />
Lebensmittelmangel<br />
(kein<br />
Obst/Früchte);<br />
Fisch<br />
1/28 2 14 8 3 2; 3 Schnee; jagen;<br />
Eis; kalt<br />
2/1 1 12 7 2 <strong>Ich</strong> interessiere<br />
m<strong>ich</strong> sehr für<br />
Erdkunde, aber<br />
manchmal<br />
machen wir<br />
auch doofe<br />
Sachen.<br />
2/2 1 13 7 3 Manchmal ist<br />
es r<strong>ich</strong>tig cool<br />
und<br />
interessant,<br />
manchmal aber<br />
auch tierisch<br />
langweilig.<br />
2/3 1 12 7 3 <strong>Ich</strong> <strong>weiß</strong> n<strong>ich</strong>t.<br />
Manchmal<br />
interessiert es<br />
m<strong>ich</strong> einfach<br />
n<strong>ich</strong>t, wieviel<br />
Grad es<br />
irgendwo auf<br />
<strong>der</strong> Erde ist.<br />
Aber manches<br />
finde <strong>ich</strong> auch<br />
interessant.<br />
2/4 1 12 7 3 Manche<br />
Themen<br />
interessieren<br />
m<strong>ich</strong>, so wie die<br />
Ozeane. Aber<br />
an<strong>der</strong>e<br />
wie<strong>der</strong>um<br />
n<strong>ich</strong>t.<br />
2/5 1 13 7 3 M<strong>ich</strong><br />
interessiert, wie<br />
an<strong>der</strong>e<br />
Menschen<br />
leben. Aber<br />
Karten /<br />
Diagramme<br />
sind n<strong>ich</strong>t so<br />
interessant.<br />
2/6 1 13 7 3 Viele Themen<br />
sind sehr<br />
interessant,<br />
denn die<br />
meisten sind<br />
aktuell o<strong>der</strong><br />
betreffen die<br />
Zukunft.<br />
Woher<br />
bekommen sie<br />
ihre<br />
Lebensmittel?<br />
Was essen die<br />
so? Wie<br />
bewegen sie<br />
s<strong>ich</strong> fort?<br />
3 Umwelt ist Polartag und<br />
gefährdet;<br />
keine Pflanzen;<br />
Eis<br />
Polarnacht<br />
3 Inuit; Tiere;<br />
Klima<br />
3 Huskies; Iglus;<br />
Eisberge<br />
3 Robben; Iglus;<br />
Kanada;<br />
Grönland<br />
3 Iglu; kein<br />
Kontakt zur<br />
Außenwelt;<br />
Robben<br />
3 Minustemperaturen;<br />
Jagd;<br />
Zusammenhalt<br />
In <strong>der</strong> kalten<br />
Zone wachsen<br />
ja keine<br />
Apfelbäume<br />
und dann<br />
müssen solche<br />
dorthin<br />
transportiert<br />
werden.<br />
Wie die Tiere Wie die<br />
dort leben; die<br />
Lebensweise<br />
<strong>der</strong> Inuit und<br />
das Klima.<br />
Keine Ahnung. M<strong>ich</strong><br />
Am meisten<br />
wahrscheinl<strong>ich</strong><br />
eher die Tiere<br />
und die<br />
Eisberge.<br />
Weniger die<br />
Menschen, die<br />
dort leben.<br />
Polartag und <strong>Ich</strong> habe einen<br />
Polarnacht<br />
interessieren<br />
m<strong>ich</strong>, da <strong>ich</strong><br />
m<strong>ich</strong> gerne mit<br />
<strong>der</strong> Erde und<br />
dem All<br />
beschäftige.<br />
Lebewesen das<br />
in <strong>der</strong> Kälte<br />
aushalten und<br />
welche Dinge<br />
sie dafür<br />
benutzen, finde<br />
<strong>ich</strong> interessant.<br />
interessiert es<br />
einfach n<strong>ich</strong>t,<br />
was die Leute<br />
dort essen o<strong>der</strong><br />
so etwas.<br />
Wie die Inuit es Wie schaffen<br />
schaffen, dort sie es, dort zu<br />
zu überleben. überleben. Das<br />
interessiert<br />
m<strong>ich</strong>.<br />
Wie die<br />
Menschen dort<br />
leben und wie<br />
sie früher da<br />
gelebt haben.<br />
Was hat <strong>der</strong><br />
Tourismus für<br />
Folgen?<br />
<strong>Ich</strong> finde es<br />
interessant, das<br />
Leben <strong>der</strong><br />
Menschen dort<br />
mit unserem zu<br />
vergle<strong>ich</strong>en.<br />
M<strong>ich</strong><br />
interessiert,<br />
was die<br />
Menschen<br />
machen<br />
können, um die<br />
Erde zu<br />
schützen.<br />
kleinen Bru<strong>der</strong>. Mit<br />
diesem muss <strong>ich</strong><br />
manchmal einkaufen<br />
gehen o<strong>der</strong> das Haus<br />
putzen. Mein Vater<br />
und meine Mutter<br />
arbeiten vormittags.<br />
Später darf <strong>ich</strong><br />
manchmal auch<br />
meinen Vater mit auf<br />
die Jagd begleiten.<br />
<strong>Ich</strong> lebe nur noch mit<br />
meinem Vater und<br />
meiner Schwester.<br />
Meine Mutter ist<br />
gestorben.<br />
In meiner Freizeit<br />
treffe <strong>ich</strong> meine<br />
Freunde und wir<br />
gehen z.B. in Kino.<br />
<strong>Ich</strong> gehe jeden Tag<br />
zur Schule<br />
Dann gehe <strong>ich</strong> zu<br />
einer kleinen Schule<br />
mitten im Dorf.<br />
Sie haben von dort Sie gehen in eine<br />
aus [von <strong>der</strong> Schule] Schule.<br />
auch Freunde.<br />
Meine Freunde<br />
besuchen m<strong>ich</strong> oft zu<br />
Hause. Sie mögen<br />
meine<br />
Schlittenhunde.<br />
In <strong>der</strong> Schule läuft es<br />
gut. Fahre mit dem<br />
Skidoo dorthin.<br />
viele Geschwister lernt z.B. Englisch in<br />
<strong>der</strong> Schule<br />
<strong>Ich</strong> denke, er/sie hat<br />
eine relativ große<br />
Familie (5 bis 6<br />
Personen).<br />
Wenige, aber dafür<br />
gute Freunde.<br />
Unterr<strong>ich</strong>t in einer<br />
kleinen Schule.<br />
In meiner Freizeit<br />
treffe <strong>ich</strong> meine<br />
Freunde und wir<br />
gehen z.B. in Kino.<br />
geht in <strong>der</strong> Freizeit<br />
mit ihrem Vater<br />
Robben jagen und<br />
lernt Sachen im<br />
Haushalt von ihrer<br />
Mutter<br />
<strong>Ich</strong> wohne in einem<br />
ganz normalen Haus.<br />
<strong>Ich</strong> stehe morgens<br />
auf und mache m<strong>ich</strong><br />
fertig. … Wenn <strong>ich</strong><br />
nach Hause komme,<br />
gibt es Essen. … Wir<br />
sind eigentl<strong>ich</strong><br />
Selbstversorger, doch<br />
kaufen wir die<br />
w<strong>ich</strong>tigsten Sachen<br />
im Supermarkt.<br />
Viele sagen, <strong>dass</strong> Mehr fällt mir n<strong>ich</strong>t<br />
Inuit in Iglus wohnen. ein.<br />
<strong>Ich</strong> glaube das aber<br />
n<strong>ich</strong>t. Sie wohnen,<br />
glaube <strong>ich</strong>, eher in<br />
Häusern. … Okay,<br />
doch. Aber auch<br />
n<strong>ich</strong>t. Für m<strong>ich</strong><br />
müssen echte Inuit in<br />
Iglus wohnen und so.<br />
Obwohl <strong>ich</strong> <strong>weiß</strong>,<br />
<strong>dass</strong> es n<strong>ich</strong>t so<br />
stimmt.<br />
spielt viel draußen,<br />
weil die Hütte sehr<br />
klein und voll ist<br />
Wohnen in Häusern<br />
aus Blech und Holz.<br />
sehr großer<br />
Zusammenhalt in den<br />
Dörfern<br />
Den genauen Ablauf<br />
des Tages kann <strong>ich</strong><br />
mir n<strong>ich</strong>t so gut<br />
vorstellen. Aufstehen -<br />
Frühstück - Schule -<br />
nach Hause - im<br />
Haushalt helfen.<br />
2; 4; 5; 7 Nein, <strong>ich</strong> kenne<br />
kein Märchen.<br />
1; 2; 4; 8 Nein, <strong>ich</strong> kenne<br />
keins.<br />
1; 4; 8 Nein, <strong>ich</strong> kenne<br />
kein Märchen<br />
aus <strong>der</strong> kalten<br />
Zone.<br />
1; 5; 7 <strong>Ich</strong> kenne kein<br />
Märchen aus<br />
dieser Zone.<br />
2 <strong>Ich</strong> glaube<br />
n<strong>ich</strong>t, <strong>dass</strong> man<br />
in <strong>der</strong> kalten<br />
Zone eine<br />
Märchenumgebung<br />
findet, wie wir<br />
sie kennen.<br />
1 Man könnte<br />
dann auch<br />
an<strong>der</strong>e<br />
Märchen lesen.<br />
2; 4; 7 Nein. 2 <strong>Ich</strong> finde<br />
insgesamt<br />
Märchen n<strong>ich</strong>t<br />
so prickelnd.<br />
Früher mochte<br />
<strong>ich</strong> Märchen,<br />
jetzt sind sie für<br />
m<strong>ich</strong> einfach<br />
nur langweilig.<br />
2; 4; 8 <strong>Ich</strong> kenne keins. 3 Es kommt auf<br />
das Märchen<br />
an, aber eher<br />
n<strong>ich</strong>t. <strong>Ich</strong> finde<br />
Märchen<br />
allgemein<br />
langweilig.<br />
1; 2; 4; 8 Nein, kenne <strong>ich</strong><br />
n<strong>ich</strong>t.<br />
1; 3; 6; 7 (früher<br />
Kin<strong>der</strong>bücher; Ice Age)<br />
1 1; 2; 3; 4; 5 3<br />
3 Naja. <strong>Ich</strong> glaube<br />
n<strong>ich</strong>t, <strong>dass</strong> ein<br />
Märchen über<br />
die kalte Zone<br />
spannend ist.<br />
4; 5; 8 Nein. 1 Es würde m<strong>ich</strong><br />
interessieren,<br />
ob solche<br />
Märchen auch<br />
immer gut<br />
ausgehen wie<br />
die deutschen.<br />
M<strong>ich</strong><br />
interessiert, ob<br />
es da auch z.B.<br />
gute Feen und<br />
böse<br />
Stiefmütter gibt<br />
und was für<br />
Unterschiede es<br />
gibt.<br />
1; 2; 4; 5; 7 Schneekönigin? 1 <strong>Ich</strong> mag<br />
Märchen.<br />
2 Da die<br />
Fragestellung<br />
zunächst auf<br />
meiner eigenen<br />
Vorstellung<br />
basierte.<br />
5; 6 4 <strong>Ich</strong> habe mein<br />
Wissen nur aus<br />
Medien und da<br />
<strong>weiß</strong> man n<strong>ich</strong>t, ob<br />
das auch r<strong>ich</strong>tig<br />
ist.<br />
1; 2; 4 3 In <strong>der</strong> Schule<br />
haben wir n<strong>ich</strong>t so<br />
viel zu diesem<br />
Thema gemacht.<br />
4; 5; 6 2 <strong>Ich</strong> habe viel im<br />
Unterr<strong>ich</strong>t gelernt<br />
über die kalte<br />
Zone.<br />
4 6 Das sind voll die<br />
Vorurteile, <strong>dass</strong><br />
Inuit in Iglus<br />
wohnen und so.<br />
Das stimmt aber,<br />
glaube <strong>ich</strong>, n<strong>ich</strong>t.<br />
<strong>Ich</strong> stelle es mir<br />
trotzdem so vor.<br />
1; 3; 4; 6 3 <strong>Ich</strong> <strong>weiß</strong> noch<br />
n<strong>ich</strong>t alles über die<br />
kalte Zone, aber<br />
die Sachen, die <strong>ich</strong><br />
schon <strong>weiß</strong>, sind,<br />
glaube <strong>ich</strong>, r<strong>ich</strong>tig.<br />
1; 2; 4 2 M<strong>ich</strong> interessiert,<br />
wie die Menschen<br />
woan<strong>der</strong>s leben<br />
und deshalb passe<br />
<strong>ich</strong> bei solchen<br />
Themen gut auf<br />
und merke mir<br />
Dinge.<br />
4; 6 3 <strong>Ich</strong> denke, über<br />
viele Dinge <strong>weiß</strong><br />
<strong>ich</strong> Bescheid, aber<br />
n<strong>ich</strong>t über alle.
Anhang 5: Tabellarische Ergebnisauflistung <strong>der</strong> Fragebogenerhebung<br />
2/7 1 13 7 1 Es sind aktuelle<br />
Themen und sie<br />
beschäftigen<br />
s<strong>ich</strong> mit Dingen<br />
auf unserer<br />
Erde.<br />
2/8 2 13 7 2 Es gibt viele<br />
Themen, die<br />
mir gefallen,<br />
aber auch<br />
uninteressante.<br />
3 lange<br />
Schulwege;<br />
Forschungsstationen;<br />
Transportwege<br />
3 kalt; früher<br />
Selbstversorger<br />
; Skidoo<br />
(Schlitten)<br />
Die Umstände, Es ist<br />
mit denen die<br />
Menschen dort<br />
leben müssen.<br />
Überlebensweise;<br />
Versorgung;<br />
Jagd<br />
interessant,<br />
<strong>dass</strong> man dort<br />
n<strong>ich</strong>t so viel<br />
Luxus braucht<br />
wie hier in<br />
Europa.<br />
Überlebenskünstler;<br />
ob<br />
Supermarkt<br />
o<strong>der</strong><br />
Selbstversorger;<br />
Jagd mit<br />
Wenig Freunde, da<br />
kleine Siedlungen<br />
keine Ahnung jagen, Ski fahren,<br />
snowboarden<br />
Leben in mo<strong>der</strong>nen<br />
Wohnblocks<br />
Sprachunterschiede<br />
… müssen mit<br />
Essensvorräten leben<br />
und sind auf<br />
Transporte aus dem<br />
Ausland angewiesen<br />
… nur mit dicker<br />
Jacke aus dem Haus<br />
(extreme Kälte)<br />
kleine Siedlungen müssen s<strong>ich</strong> dick<br />
anziehen, wegen <strong>der</strong><br />
Kälte … keine Autos<br />
(Umweltbelastung)<br />
2/9 2 13 7 3 Da wir uns oft 3 kalt; wenig Der Alltag <strong>der</strong><br />
Gewehr o.ä.<br />
Weil man sonst<br />
Dass er oft wegen Er geht öfter mit Dass er auf engstem<br />
wie<strong>der</strong>holt<br />
besiedelt; Nord- Menschen dort beim<br />
Schnee n<strong>ich</strong>t zur seinem Vater jagen Raum mit <strong>der</strong> Familie<br />
haben.<br />
und Südpol<br />
St<strong>ich</strong>punkt<br />
Schule kommt. und hat deshalb auch wohnt.<br />
"kalte Zone" oft<br />
fast nur etwas<br />
über die Tiere<br />
erfährt.<br />
weniger Freizeit.<br />
2/10 1 13 7 2 Manchmal ist 3 Polartag; Welche Tiere <strong>Ich</strong> interessiere große Familie eine kleine Schlitten / Bob Haus für beson<strong>der</strong>s<br />
es spannend<br />
Polarnacht; leben dort? Wie m<strong>ich</strong> für Tiere<br />
Dorfschule fahren, fischen, Kajak an das Klima<br />
und man lernt<br />
Inuit leben sie? und Pflanzen<br />
fahren, Kino, genau angepasste Kälte<br />
Neues, mal ist<br />
Warum und (ein wenig)<br />
das, was wir auch tun<br />
es langweilig.<br />
schmilzt das für<br />
Eis? Warum<br />
wird n<strong>ich</strong>ts<br />
getan?<br />
Naturschutz.<br />
2/11 2 13 7 3 3 Iglu;<br />
Der Alltag Die Eltern würden<br />
Er würde auch in die<br />
Es sind dort schlechte Sie arbeiten oft auch<br />
Forschungs-<br />
dort arbeiten, so wie<br />
Schule gehen.<br />
Wohnhäuser, denn es in <strong>der</strong> Natur als<br />
station; jagen<br />
bei uns auch.<br />
sind auch oft nur Fischer o<strong>der</strong> als Jäger.<br />
Container. Ihre Jobs werden<br />
auch n<strong>ich</strong>t so gut<br />
bezahlt.<br />
2/12 2 13 7 3 Der Lehrer(in) 2 kalt; Eisbären; Wie die Tiere es <strong>Ich</strong> mag Tiere<br />
Er muss lange zur Er geht auf Jagd. Dass er früh<br />
macht den<br />
Eis<br />
schaffen, unter gerne.<br />
Schule laufen. Die<br />
aufstehen muss. Es<br />
Unterr<strong>ich</strong>t n<strong>ich</strong>t<br />
diesen<br />
Schule ist in<br />
gibt wenig Essen. Er<br />
so interessant.<br />
Bedingungen zu<br />
schlechtem Zustand.<br />
muss lange nach<br />
leben.<br />
Hause gehen.<br />
2/13 1 13 7 2 <strong>Ich</strong> finde es<br />
3 Robben; Wie die Weil <strong>ich</strong> es<br />
Das Haus ist etwas <strong>Ich</strong> glaube, er/sie<br />
w<strong>ich</strong>tig zu<br />
Polartag; Menschen dort interessant<br />
an<strong>der</strong>s, denn es muss würde antworten,<br />
wissen, wo<br />
Polarnacht leben und wie finde, wie man<br />
ja so sein, <strong>dass</strong> es die <strong>dass</strong> es gar keinen so<br />
welches Land<br />
sie früher dort lebt, wenn<br />
Kälte übersteht. großen Unterschied<br />
liegt und zu<br />
gelebt haben. es den ganzen<br />
zwischen unseren<br />
wissen, wie<br />
Und wie sie die Tag dunkel ist.<br />
Län<strong>der</strong>n gibt. Bei<br />
man dort lebt.<br />
Polarnacht<br />
ihm/ihr ist es nur<br />
überstehen.<br />
kälter.<br />
2/14 2 13 7 2 <strong>Ich</strong> finde,<br />
Erdkunde ist ein<br />
interessantes<br />
Fach, weil man<br />
viel über die<br />
Erde lernt.<br />
2/15 1 12 7 2 Es ist mir<br />
w<strong>ich</strong>tig und <strong>ich</strong><br />
finde es<br />
interessant,<br />
etwas über die<br />
Welt, das Klima<br />
und die Leute<br />
zu erfahren.<br />
2/16 2 13 7 3 <strong>Ich</strong> möchte<br />
wissen, was da<br />
so vor s<strong>ich</strong><br />
geht, aber so<br />
brennend<br />
interessiert<br />
m<strong>ich</strong> das n<strong>ich</strong>t.<br />
2/17 1 12 7 2 Über manche<br />
Sachen wusste<br />
<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t viel,<br />
daher ist es<br />
interessant.<br />
3 Jagen<br />
(Ernährung);<br />
Iglus/Fertighäuser/Häuser<br />
aus Fell; kalt<br />
3 kalt; Schnee;<br />
Polarnacht;<br />
Polartag<br />
3 Jagen; Wölfe;<br />
Eis<br />
Das frühere<br />
Jagen (Selbstversorger)<br />
und<br />
Jagen: Es ist<br />
interessant, zu<br />
wissen, wie die<br />
die Überlebens- Inuit Jagd auf<br />
kunst ihre Beute<br />
gemacht haben<br />
und sie dann<br />
gefangen<br />
haben.<br />
Wie es dort <strong>Ich</strong> finde es<br />
überhaupt interessant und<br />
mögl<strong>ich</strong> ist zu w<strong>ich</strong>tig, etwas<br />
überleben und darüber zu<br />
wie die lernen.<br />
Menschen mit<br />
<strong>der</strong> Kälte<br />
umgehen sowie<br />
<strong>der</strong> Einfluss des<br />
Klimawandels.<br />
Wie die Inuit da Es ist<br />
leben. interessant.<br />
Dann essen wir<br />
gemeinsam.<br />
3 wenig Die Fauna und Da <strong>ich</strong> m<strong>ich</strong> für Er wohnt mit seiner<br />
Vegetation; die Inuit Tiere Familie …<br />
kalt; Anpassung<br />
interessiere und<br />
an den<br />
es interessant<br />
Lebensraum<br />
ist, wie die<br />
Menschen dort<br />
leben.<br />
Er trifft s<strong>ich</strong> gerne mit Er geht zur Schule. Er rodelt gerne. Er wohnt in einem<br />
Freunden.<br />
Fertighaus.<br />
… und seinen<br />
Freunden …<br />
Es würde<br />
wahrscheinl<strong>ich</strong> nur<br />
eine Schule dort und<br />
weit entfernt geben<br />
und n<strong>ich</strong>t wie hier<br />
mehrere.<br />
Dann gehe <strong>ich</strong> in die<br />
Schule.<br />
<strong>Ich</strong> stehe morgens<br />
auf und gehe auf<br />
Jagd.<br />
<strong>Ich</strong> glaube, es würde<br />
m<strong>ich</strong> erstaunen, wie<br />
man damit umgehen<br />
würde, in <strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Kälte zu leben, im<br />
Gegensatz zu<br />
unserem Leben.<br />
Hat kein Internet. Es<br />
ist sehr kalt. … Wenn<br />
<strong>ich</strong> von <strong>der</strong> Schule<br />
nach Hause komme,<br />
essen wir. Dann gehe<br />
<strong>ich</strong> schlafen.<br />
1; 5; 7 Die<br />
Schneekönigin<br />
2 Da es dort ja<br />
nur Eis gibt und<br />
keine Tiere,<br />
Fel<strong>der</strong>, Wiesen<br />
1; 4; 5 2 Über den<br />
Unterr<strong>ich</strong>t sind<br />
Vorstellungen<br />
entstanden.<br />
1; 5; 7; 8 Nö. 2 1; 4 2 Manches r<strong>ich</strong>tig<br />
s<strong>ich</strong>er, aber bei<br />
an<strong>der</strong>em ein wenig<br />
uns<strong>ich</strong>er.<br />
2; 3; 4; 5; 7 1; 4 3 <strong>Ich</strong> <strong>weiß</strong> n<strong>ich</strong>t<br />
genau, wie sie<br />
heute leben, weil<br />
man oft nur etwas<br />
von früher erfährt<br />
(im Fernsehen).<br />
1; 5; 7; 8 Kein Märchen. 3 Wenn es<br />
spannend und<br />
lustig ist.<br />
1; 4; 6 4 Weil wir noch<br />
n<strong>ich</strong>t so viel zu<br />
dem Thema<br />
gemacht haben.<br />
1; 2; 3; 5; 7 1; 2; 4; 5 3<br />
1; 2; 4; 7 Nein. 3 <strong>Ich</strong> mag<br />
Märchen n<strong>ich</strong>t<br />
so.<br />
1; 3; 7 <strong>Ich</strong> kenne kein<br />
Märchen.<br />
1; 5; 7; 8 <strong>Ich</strong> kenne keine<br />
Märchen, die<br />
von <strong>der</strong> kalten<br />
Zone handeln.<br />
1; 5 Schneekönigin.<br />
Kenne <strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t<br />
und will <strong>ich</strong><br />
auch n<strong>ich</strong>t<br />
kennen (uninteressant).<br />
1 Es wäre schon<br />
interessant,<br />
weil man<br />
meistens nur<br />
Märchen hört,<br />
wo eine Frau<br />
(ein Mädchen)<br />
ein Kleid anhat<br />
und das dort zu<br />
kalt wäre und<br />
n<strong>ich</strong>t so<br />
1; 2; 3; 4 2 Manches <strong>weiß</strong> <strong>ich</strong>,<br />
manches n<strong>ich</strong>t.<br />
1; 2; 3; 4 3 <strong>Ich</strong> glaube, das<br />
was <strong>ich</strong> bei Nr. 4<br />
geschrieben habe,<br />
stimmt n<strong>ich</strong>t ganz.<br />
sommerl<strong>ich</strong>.<br />
3 1; 4 2 Weil wir es so im<br />
Unterr<strong>ich</strong>t gelernt<br />
haben.<br />
2 Es ist eher was<br />
für Kleinere, da<br />
wir jetzt n<strong>ich</strong>t<br />
mehr diese<br />
Fantasie haben.<br />
2; 4; 5; 7 Nein. 2 <strong>Ich</strong> mag keine<br />
Märchen.<br />
… mit einer Schule. In seiner Freizeit geht … in einem Dorf … 1; 2; 4; 8 Nein, kenne <strong>ich</strong><br />
er jagen.<br />
n<strong>ich</strong>t.<br />
2 Da <strong>ich</strong> Märchen<br />
n<strong>ich</strong>t mag.<br />
1; 4; 5 3 Keine Ahnung.<br />
4; 5; 6; 7 (Minecraft) 5 <strong>Ich</strong> <strong>weiß</strong> n<strong>ich</strong>t<br />
beson<strong>der</strong>s viel<br />
darüber.<br />
1; 4 3 Da es zwar im<br />
Fernsehen Dokus<br />
gibt, man da aber<br />
n<strong>ich</strong>t s<strong>ich</strong>er ist, ob<br />
das stimmt.
Anhang 5: Tabellarische Ergebnisauflistung <strong>der</strong> Fragebogenerhebung<br />
2/18 2 12 7 3 3 kalt; polar;<br />
Eskimos<br />
2/19 2 13 7 3 <strong>Ich</strong> interessiere<br />
m<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t<br />
beson<strong>der</strong>s für<br />
Erdkunde.<br />
2/20 2 13 7 4 <strong>Ich</strong> interessiere<br />
m<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t so<br />
dafür, weil <strong>ich</strong><br />
die<br />
Themenauswah<br />
l n<strong>ich</strong>t mag.<br />
2/21 1 13 7 3 Es kommt<br />
immer auf den<br />
Lehrer und das<br />
Thema an.<br />
2/22 2 13 7 3 <strong>Ich</strong> finde<br />
manche<br />
Themen eben<br />
interessant und<br />
manche n<strong>ich</strong>t.<br />
2/23 2 13 7 2 M<strong>ich</strong><br />
interessiert, wie<br />
es in an<strong>der</strong>en<br />
Län<strong>der</strong>n ist.<br />
2/24 1 12 7 3 Weil <strong>ich</strong> es eh<br />
später nie<br />
brauchen<br />
werde und es<br />
kümmert m<strong>ich</strong><br />
einen Dreck,<br />
was Schelfeis<br />
ist.<br />
Was für Tiere<br />
dort leben.<br />
Da leben ja<br />
n<strong>ich</strong>t so viele.<br />
Manchmal<br />
bekommen wir<br />
kältefrei.<br />
Hi, wenig Leute hier<br />
und <strong>der</strong> Winter ist<br />
lang. Oft liegt Schnee.<br />
3 kalt; Jagd; Inuit N<strong>ich</strong>ts. Er würde sagen, <strong>dass</strong><br />
alles ungefähr so ist<br />
wie bei uns.<br />
3 Schnee; Eis;<br />
Überlebenskampf<br />
3 Inuit; Karibu; Öl-Der<br />
tägl<strong>ich</strong>e<br />
Pipeline Überlebenskampf<br />
2 kalt; Eisbär;<br />
kälter<br />
<strong>Ich</strong> möchte<br />
n<strong>ich</strong>t dort<br />
wohnen.<br />
Wie die Tiere Es interessiert<br />
dort überleben. m<strong>ich</strong> eben, wie<br />
sie bei so einer<br />
Kälte dort<br />
überleben und<br />
Essen finden.<br />
3 Hundeschlitten; Die Tiere Das Leben <strong>der</strong><br />
Robben; Felle<br />
Menschen ist<br />
überall sehr<br />
ähnl<strong>ich</strong>.<br />
mit Freunden oft im<br />
Haus<br />
früh aufstehen, dann<br />
zur Schule<br />
1; 4; 5; 8 Kenne keins. 1; 2; 3; 4; 5 3 <strong>Ich</strong> war noch nie<br />
dort.<br />
sehr kalt 2; 4 <strong>Ich</strong> kenne kein<br />
Märchen.<br />
Dass es langweilig<br />
und kalt ist. Er hat<br />
einen Eisbären als<br />
Haustier (er heißt<br />
Sushi). Den hat er<br />
darauf spezialisiert,<br />
meine Familie zu<br />
fressen. So great!<br />
Cool, da will <strong>ich</strong> auch<br />
hin.<br />
Es ist kalt, aber auch<br />
lustig.<br />
3 kalt; Iglu; Inuit N<strong>ich</strong>ts!!! Hä?! langweilig kalt, Schnee, mo<strong>der</strong>n<br />
geworden. Fragen Sie<br />
die Person dann<br />
selbst…<br />
1; 2; 5 <strong>Ich</strong> kenne keins. 2 <strong>Ich</strong> lese n<strong>ich</strong>t<br />
gern.<br />
1; 3; 5; 7; 8 Die<br />
Schneekönigin,<br />
Väterchen<br />
Frost, Yeti, Alm-<br />
Öhi<br />
3 Kommt auf das<br />
Märchen an.<br />
1; 2; 4 <strong>Ich</strong> kenne keins. 2 <strong>Ich</strong> mag<br />
Märchen n<strong>ich</strong>t<br />
so.<br />
4 4 <strong>Ich</strong> habe n<strong>ich</strong>t gut<br />
aufgepasst im<br />
Unterr<strong>ich</strong>t.<br />
4 4 <strong>Ich</strong> habe im<br />
Unterr<strong>ich</strong>t n<strong>ich</strong>t so<br />
gut aufgepasst.<br />
1; 4; 6 1 Intuition<br />
1; 2; 4 3 <strong>Ich</strong> denke, <strong>ich</strong> bin<br />
mir s<strong>ich</strong>er, weil <strong>ich</strong><br />
glaube, <strong>dass</strong> das<br />
Fernsehen keinen<br />
Blödsinn erzählt.<br />
Hab kein Internet. 1; 5; 7; 8 Nein. 2 1; 2; 3; 4; 7 (Minecraft) 3 Wieso?<br />
1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 Woher soll <strong>ich</strong><br />
das wissen?<br />
Schneekönigin,<br />
Väterchen Frost<br />
(Russland) etc.<br />
1; 4; 6 2 Wieso sollte<br />
<strong>ich</strong>???!!!